Die Bedeutung der Biologischen Landwirtschaft für den Naturschutz im Grünland
|
|
|
- Gretel Hofmeister
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Bedeutung der Biologischen Landwirtschaft für den Naturschutz im Grünland Detlef Mahn und Anton Fischer 1. Problematik und Ziel Die heutige intensive Nutzung der Landschaft durch den Menschen hat den Rückgang zahlreicher Tier- und Pflanzenarten zur Folge, da deren L e bensräume vernichtet werden. So weist die Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen der B R D (K O R N E C K & SU KO PP 1988) etwa ein Drittel aller heimischen Gefäßpflanzenarten als gefährdet, vom Aussterben bedroht oder ausgestorben aus; die Roten Listen der verschiedenen Tiergruppen (B L A B et.al 1984) nennen meist sogar höhere Anteile. Noch stärker als die einzelnen Tier- und Pflanzenarten sind deren Lebensgemeinschaften bedroht: so stehen in Schleswig-Holstein 46 % der Pflanzenarten, aber 76 % der Pflanzengesellschaften auf der Roten Liste (D IE R SSE N 1988), in Niedersachsen sind es 41 % der Arten und 79 % der Gesellschaften (H A E U P L E R et al. 1983, P R E I SIN G 1986). In den Nachbarländern der Bundesrepublik herrscht eine ähnliche Situation (KNAPP et al. 1985, M O R A V EC 1986, PIO TRO W SKA 1986). Als Hauptverursacher des Artenschwundes ist die moderne Landwirtschaft anzusehen, nachdem die Landbewirtschaftung bis ins 19. Jahrhundert hinein zu einer Bereicherung von Flora, Vegetation und Fauna beigetragen hatte. In einer Analyse der G e fährdungsursachen der Gefäßpflanzen der B R D kommen K O R N E C K & SU KO PP (1988) zu dem Ergebnis, daß die Landwirtschaft am Rückgang von 72 % der aktuell gefährdeten Rote-Liste-Arten beteiligt ist. Innerhalb der Landwirtschaft kommt der Grünlandwirtschaft eine besondere Bedeutung zu (beteiligt am Rückgang von 46 % der aktuell gefährdeten RL-A rten), gefolgt von Acker- und G artenbau (35 % ), Sonderkulturen (14 % ), Dorfsanierung (4 % ) und Flurbereinigung (3 % ). Andere Verursacher tragen in geringerem Maße zur Artengefährdung bei, so der Tourismus zu 23 %, Gewerbe, Siedlung und Industrie zu 22 %, Verkehr und Transport zu 10 %. Ähnliche Ergebnisse erbrachten frühere Studien von SU KO PP et al. (1978), W E B E R (1979), SUKO PP (1981) und D IE R SSE N (1983,1984). Begründet ist die herausragende Bedeutung der Landwirtschaft für den Rückgang von Arten und Lebensräumen in ihrem im Vergleich zu Industrie, Siedlung und Verkehr erheblich größeren Flächenbedarf sowie in der Intensität der Nutzung. Vor diesem Hintergrund scheint die biologische Landwirtschaft auf den ersten Blick geradezu prädestiniert zu sein, einen wesentlichen Beitrag zum Naturschutz zu leisten, strebt sie doch bewußt eine Minimierung chemisch-technischer Eingriffe in den Naturhaushalt und eine naturschonende Wirtschaftsweise an. Im Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen über Umweltprobleme der Landwirtschaft (SR U 1985) wird ihr unter diesem Gesichtspunkt eplizit ein Vorbildcharakter zuerkannt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Relevanz der biologischen Landwirtschaft für den Naturschutz am Beispiel der Grünlandvegetation zu untersuchen und zu bewerten. Verglichen werden Grünlandflächen von Bio-Betrieben mit unmittelbar benachbarten Parzellen unter konventioneller Bewirtschaftung. Alle Untersuchungsflächen liegen in Mittelhessen; die Ergebnisse dürften aber in den Grundzügen überregionale Gültigkeit besitzen. 2. Gefährdung und Schutz der Grünlandvegetation 2.1 Aktuelle Gefährdung und Schutzmaßnahmen Grünland ist in der Bundesrepublik Deutschland seit einigen Jahrzehnten in ständigem Rückgang begriffen. Allein von 1970 bis 1986 schrumpfte die Grünlandfläche der B R D um 17.5 %, und der Anteil des Grünlandes an der landwirtschaftlichen Nutzfläche ging von 41.2 auf 37.8 % zurück (SR U 1985, STA T. B U N D E SA M T 1987). Mehr und mehr wird Dauergrünland durch Feldfutterbau ersetzt und der Anbau von Mais, Klee-Gras-Gemengen und Weidelgras ausgeweitet. Die Entwicklung des verbleibenden Grünlandes ist durch zwei gegenläufige Trends gekennzeichnet: Zum einen werden landwirtschaftlich unrentable Bestände aus der Nutzung entlassen, zum anderen werden die produktiven Flächen einer immer intensiveren Behandlung unterzogen. Der erstgenannte Prozeß betrifft vor allem seltene und damit besonders schutzbedürftige Pflanzengesellschaften bzw. Ökosysteme wie Streuwiesen, Seggenrieder, Borstgrasrasen und Halbtrockenrasen, die - soweit sie nicht in Acker- oder Siedlungsland umgewandelt wurden - vielerorts der Sukzession überlassen oder sogar aufgeforstet werden. M E ISE L (1979b) schätzt, daß die Bestände derartiger Pflanzengesellschaften seit Anfang der fünfziger Jahre um % zurückgegangen sind. Begonnen hat dieser Rückgang jedoch bereits im 19. Jahrhundert (M E ISE L 1984). Der zweite Vorgang, die fortschreitende Grünlandintensivierung, betrifft das gesamte normale Wirtschaftsgrünland. Folgende Veränderungen kennzeichnen diesen Wandel: - Umstellung von Wiesen- zu Weide- und Mähweidewirtschaft. Die Fläche der Wiesen nahm von 1970 bis 1986 um 25.7 % ab, die der Weiden und Mähweiden um 4.8 % ; der relative Anteil der letzteren am Grünland hat also zugenommen (SR U 1985, STA T. B U N D E SA M T 1987). D a die Mähweide der Wiese aus landwirtschaftlichökonimischer Sicht deutlich überlegen ist (KÖ- N EKA M P 1965, R IE D E R 1983, D IE T L 1986), hat sie in viele ehemals typische Wiesenlandschaften Einzug gehalten. - Erhöhung der Nutzungsfrequenz und -intensität. Wurde die klassische Fettwiese zweimal pro Jahr gemäht, so ist bei starker Düngung eine 4-6-malige Mahd möglich. Die Erhöhung der Nutzungsfrequenz ist mit einer Vorverlegung der 261
2 Tabelle 1 Grünlandarten mit Bestandesrückgang, die nicht auf der Roten Liste der BRD stehen (nach Angaben von M EI- SEL , ,1979b, 1983,1984, M EISEL & H Ü B SC H M A N N 1976, H U N D T 1983) = in den hier untersuchten Beständen vorhanden GRASER Agrostis canina Agrostis stolonifera Agrostis tenuis Anthoantum odoratum Avenochloa pubescens Brachypodium pinnatum Briza media Bromus racemosus X Cynosurus cristatus X X Danthonia decumbens X Deschampsia cespitosa X X Festuca ovina X Glyceria fluitans Molinia caerulea X Nardus stricta Poa palustris X KRAUTER Achillea ptarmica Betónica officinalis Calluna vulgaris Caltha palustris Cardamine pratensis Centaurea jacea Cirsium palustre Comarum palustre Daucus carota Dianthus deltoides Galium album Galium harcynicum Galium uliginosum Galium verum Hieracium pilosella Hydrocotyle vulgaris Hypochoeris radicata Knautia arvensis Leontodón autumnalis Leontodón hispidus LEGUMINOSEN Leucanthemum ircutianum Linum catharticum Lychnis flos-cuculi Lythrum salicaria Pimpinella saífraga Plantago lanceolata Polygala vulgaris Potentilla erecta Prunella vulgaris Ranunculus bulbosus Rhinanthus minor Rhinanthus serotinus Sanguisorba officinalis Saifraga granulata Senecio jacobaea Stellaria gramínea Succisa pratensis Tragopogón pratensis Valeriana dioica Veronica chamaedrys Lathyrus pratensis Lotus corniculatus Lotus uliginosus Medicago lupulina Trifolium campestre Trifolium dubium Trifolium pratense Trifolium repens Vicia cracca SONSTIGE Care canescens Care leporina Care nigra Care panicea Juncus effusus Juncus filiformis Luzula campestris Luzula multiflora Scirpus silvaticus 2 6 2
3 Tabelle 2 Zunehmende Grünlandarten (weitere Hinweise s. Tab. 1) GRASER Agropyron repens Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Bromus hordeaceus Dactylis glomerata Festuca pratensis Lolium perenne Phleum pratensis Poa annua Poa pratensis Poa trivialis Trisetum flavescens KRAUTER Bellis perennis Capsella bursa-pastoris Cirsium arvense Cirsium vulgare Plantago major Ranunculus repens Rume crispus Rume obtusifolius Stellaria media Taraacum officinale Urtica dioica ersten M ahd und dem W ech sel von H eu zu Silagew irtschaft g ek o p p elt. A u f der W eid e führt die E ntw icklung von der Standw eide über die U m triebs- zur P o rtionsw eid e m it hoh er B esatzd ich te und täglicher W eideflächenzuteilung. - Steigerung der D ü n gung. D ie durchschnittliche Stickstoffdüngung landw irtschaftlicher N u tzflächen betrug 1950/51 2 5,6 kg N h a 'V 1, 1982/83 w aren es 120,7 kg. D er E insatz von K ali, P h osphat und K alk hat sich im selb en Z eitraum u n g e fähr verd op p elt (S R U 1985). - Z u n ah m e des V ieh b esa tzes. D er V ieh b esatz stieg zw ischen 1970/71 und 1982/83 von 0,9 2 auf 1,12 G V E / ha L N ; ein e Z u n ahm e um 22 %. - M elioration. Sehr v iele der eh em als feu ch ten bis nassen G rünlandflächen w urden im Z u ge der kulturtechnischen M eliorationen drainiert. V ie le U n tersu ch u n gen aus versch ied en en R eg io n en D eutschlands zeigen, daß d ie m oderne Landw irtschaft ein en B estandesrückgang zahlreicher G rünlandarten verursacht (K N A P P 1968, 1969, M E I- SE L , M E IS E L & H Ü B S C H M A N N 1976, H U N D T 1983, R U T H S A T Z 1985). D en n o ch steh en nur w en ig e A rten des W irtschaftsgrünlandes im engeren Sinne (A rrhenatheretalia) auf der R o ten L iste, da sie trotz der rückläufigen B estan d s entw icklung im m er n och relativ w eit verbreitet sind; die derzeit als gefährdet ein gestu ften G rünlandarten sind zum ü b erw iegen d en T eil von jeh er se lte n e, an sehr eten siv e N u tzu n gen geb u n d en e S tan d ortsp ezialisten, deren G efährdung b ereits im 19. Jahrhundert ein setzte. (M E IS E L 1984, K U N Z M A N N et al. 1985). In T ab. 1 sind d iejen igen G rünlandarten zusam m en gefaß t, die nach Literaturangaben im R ü ck gang b egriffen sind, aber nicht au f der R o ten L iste der B R D steh en, in T ab. 2 d ie A rten m it zu n eh m en d er B esta n d esten d en z. D ie U ntersu ch u n gen v on K N A P P (1986) und R U T H S A T Z (1985) b lieb en unberücksichtigt, da ihnen zum indest teilw eise für die h eu tige landw irtschaftliche In ten sivierungsphase untypische E n tw ick lu n gen zugrunde liegen. D ie A rten versch ieb u n gen im G rünland äußern sich natürlich auch in ein er V eränderung der P flanzengesellsch aften. G en erell sind d ie m ageren, z.t. auch d ie trock en en und feu ch ten A u sb ild u n gen von G latth aferw iesen, G old h aferw iesen und W eid elgrasw eiden gefährdet, w ährend typische A u sb ild u n gen, also solch e o h n e w eitere D ifferen tialarten, häufiger anzutreffen sind (M E IS E L 1979 b, D IE R S S E N 1986, F O E R S T E R 1986). Im h essischen M ittelgebirgsland g elten m it A u sn a h m e der A g r o p y r o n r e p e n s -F e s tu c a a ru n d in a c e a -G e se W - schaft alle G rünlandgesellschaften als durch F lächenrückgang oder floristische V erarm ung gefährdet; selb st beim L olio-c yn osu retu m sind fast alle B estä n d e an A rten verarm t oder degradiert (B E R G M E IE R & N O W A K 1988). D ie V erdrängung zahlreicher G rünlandarten durch einige w en i g e, häufig aus anderen Ö k osystem en einw andernde A rten kann zu ein er v ölligen U m strukturierung von P flanzen gem ein schaften führen, deren Z uordnung zu den klassischen G rünlandgesellschaften kaum m ehr m öglich ist (T Ü X E N 1977, A R K E N A U & W U C H E R P F E N N IG 1985, F IL G E R 1986, ST E IN 1986). D IE R S S E N (1986) w eist aber ergänzend darauf hin, daß ein e B eu rteilu n g der G efährdung auf dem syntaonom isch en N iv ea u der A sso zia tio n oft nicht sinnvoll ist. So repräsentiert das L olio-c yn osu retum typicum den am w eitesten verbreiteten G rünlandtyp S ch lesw ig-h olstein s, w ährend das L olio- C ynosuretum lo teto su m, ein e S ubassoziation feuchter Standorte, regional bereits selten gew orden isl. D er geschilderten E ntw icklung kann die Sicherung k leiner, m usealer N aturflecken inm itten einer anson sten in ten siv gen u tzten K ulturlandschaft, w ie sie im traditionellen N aturschutz im V ordergrund des In teresses stand, auf D au er nicht en tgegen w irk en. D ah er erw eitert sich der T ätigkeitsbereich des N a turschutzes h eu te auf die landw irtschaftlichen Produktion sfläch en und den b esied elten B ereich. In der ersten H ä lfte der achtziger Jahre w urden in fast allen B u n d esländern E tensivierungsprogram m e für A ck er- und G rünlandflächen ins L eb en gerufen. D ie G rundstruktur aller Program m e besteh t in einer freiw illigen V erpflichtung des L andw irtes, b e stim m te B ew irtschaftsauflagen ein zu h alten, für die er ein en fin anziellen A u sg leich erhält. Ü b ersich ten hierzu liegen von der N A T U R L A N D S T IF T U N G H E S S E N (1987) und V O G E L (1988) vor; ein e zusam m enfassende B ew ertung der G rünlandpro- 263
4 gramme wurde von BÜTTENDORF & MÜLLER (1988) veröffentlicht. 2.2 Biologischer Landbau und Naturschutz Als biologisch wirtschaftend werden solche landwirtschaftlichen Betriebe angesehen, die sich nach den Rahmenrichtlinien für die Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten aus ökologischen Anbau in der Bunderepublik Deutschland richten (STIFTUNG ÖKOLOGISCHER LAND BAU 1986) und sich zu deren Einhaltung vertraglich verpflichtet haben. Derzeit zählen dazu die Mitglieder von sechs Erzeugerverbänden, deren größte der Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise und die Fördergemeinschaft organisch-biologischer Land- und Gartenbau sind. Wenngleich die Anfänge der biologischen Landwirtschaft in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts zurückreichen, erlebt sie einen besonderen Aufschwung erst seit den siebziger Jahren. Während 1975 in der BRD 340 Höfe mit ca ha landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN) biologischen Landbau betrieben, waren es Ende 1988 bereits 2330 Betriebe mit ca ha; dies entspricht ca. 0,35 % der LN der BRD (ANONYM 1989). Die jährliche Zunahme beträgt etwa 15 % (BECHMANN 1987). In Hessen werden derzeit ca ha von 81 Betrieben biologisch bewirtschaftet (LÖSCH & MEIM BERG 1986). Am markantesten unterscheidet sich die biologische von der konventionellen Landwirtschaft durch den Verzicht auf synthetische Stickstoffdünger, leichtlösliche Mineraldünger und synthetische Pestizide. Da der Aufwand für Dünge- und Futtermittel, mithin die Nährstoffzufuhr zum Betrieb, geringer ist als bei konventioneller Bewirtschaftung (PRIEBE 1987), kann auch eine geringere Nährstoffversorgung von Boden und Pflanze angenommen werden. Es ist zu erwarten, daß sich dieser Unterschied in einer entsprechenden Differenzierung der Grünlandvegetation widerspiegelt. - Zur genaueren Information über die Charakteristika sowie über die Ziele und Methoden des biologischen Landbaues muß auf die einschlägige Literatur (z. B. KICKUTH 1987) verwiesen werden. Vergleichende Untersuchungen der Vegetation biologisch und konventionell bewirtschafteter Grünflächen sind bereits von mehreren Autoren vorgenommen worden. MEISEL beschrieb bei Vergleichen in Norddeutschland (MEISEL 1978) und Bayern (MEISEL 1979 a) eine um ca. ein Drittel höhere Artenzahl sowie einen um % erhöhten Kräuteranteil als Charakteristika der biologischen Wirtschaftsweise. BRAUNEW ELL et. al. (1985) und RAUE (1985) fanden auf biologisch bewirtschaftetem Grünland bei Rotenburg an der Fulda bzw. im Taunus ebenfalls einen höheren Kräuteranteil, jedoch eine etwa gleiche Artenzahl wie auf den konventionell bewirtschafteten Vergleichsflächen vor. Allerdings beruhen ihre Ergebnisse auf der Analyse von nur zwei (BRAUNE WELL et al. 1985) bzw. einer (RAUE 1985) biologisch bewirtschafteten Parzelle. STEIN (1986) stellte in der W etterau hingegen fest, daß das Grünland eines biologisch-dynamischen Betriebes doppelt so viele Arten und einen doppelt so hohen Kräuteranteil aufwies wie die Vergleichsbestände, die einer sehr starken Düngung und intensiven Nutzung unterlagen. Leguminosen waren in den Untersuchungen von MEISEL (1979), RA U E (1985) und STEIN (1986) auf biologisch bewirtschaftetem Grünland stärker vertreten, in der von BRAUN EWELL et al. (1985) dagegen nicht. 3. Objekte und Methoden 3.1 Untersuchungsflächen Auf fünf biologisch-dynamisch wirtschaftenden Betrieben in Mittelhessen wurden im Jahre 1987 je 1 bis 4 Grünlandparzellen untersucht und mit einer gleichen Anzahl unmittelbar benachbarter, konventionell bewirtschafteter Grünlandbestände verglichen. Insgesamt wurden 24 Parzellen erfaßt. Die biologisch-dynamisch arbeitenden Höfe betrieben diese Wirtschaftsweise mindestens seit Zwei der untersuchten Biobetriebe (L = Lichtenroth und M = Melchiorsgrund) liegen im Vogelsberg, einer (B = Bingenheim) auf einem Basaltrücken an der Grenze vom Vogelsberg zur W etterau, einer (F = Friedelhausen) im Lahntal zwischen Marburg und Gießen und einer (S = Stedebach) im Gladenbacher Bergland, einem östlichen Ausläufer des Rheinischen Schiefergebirges. Die Untersuchungsorte liegen zwischen 160 und 475 m Meereshöhe; die klimatische Spannweite reicht von einem milden Klima mit einer durchschnittlichen mittleren Jahrestemperatur von 8-9 C und Jahresniederschlägen von 600 mm in Bingenheim bis zur Stufe kühl bis ziemlich rauh mit 7 C und 1000 mm Niederschlag in Lichtenroth (ELLEN BERG & ELLENBERG 1974, DEUTSCHER W ETTERDIENST 1950). Bei den Böden handelt es sich in Friedelhausen um einen aus alluvialen Flußsedimenten entstandenen Auenboden, in Stedebach um Braunerden und Pseudogleye über saurem, lößüberdeckten Tonschiefer und bei den übrigen Untersuchungsflächen um Ranker, Braunerden und Pseudogleye auf mehr oder weniger lößbedecktem Basalt. Die Bewirtschaftung der untersuchten Grünlandbestände kann hier nur zusammenfassend dargestellt werden. Auf den biologisch wirtschaftenden Betrieben erfolgt die Düngung durchwegs mit Stallmist; keiner der Betriebe arbeitet mit Gülle. Am meisten verbreitet ist eine Düngung in zweijährigem Abstand; das Spektrum reicht aber von sehr unregelmäßiger bis zu jährlicher Düngergabe. Die Wiesen werden zumeist zweimal gemäht, auf einigen Flächen erfolgt zusätzlich eine Nachweide im Herbst. Ein Betrieb strebt eine konsequente Mähweidenutzung an. Die Mehrzahl der konventionell bewirtschafteten Flächen wird mit einer PK-Grunddüngung versorgt. Stickstoff wird als Stallmist, Jauche, Gülle oder Kalkammonsalpeter zugeführt. Die Spannweite der mineralischen N-Gaben reicht von 0 bis 150 kg ha'1 a'1, liegt aber meist zwischen 40 und 100 kg ha'1 a'1. Die Wiesen werden 2-4 mal im Jahr geschnitten, eine Mähweidenutzung erfolgt auf drei von insgesamt zwölf Parzellen. Alle untersuchten Betriebe liegen in Gebieten, die nach heutigen Maßstäben als landwirtschaftlich etensiv bis mäßig intensiv bewirtschaftet gelten müssen; in keinem Fall wurde auf den konventionellen Untersuchungsflächen mehr als 150 kg N ha'1 a'1 Mineraldünger ausgebracht, während die heutigen Düngungsempfehlungen für Intensivgrünland bei kg N ha'1a'1liegen (RIEDER 1983). Diese Auswahl ist insofern repräsentativ, als sich die Mehrzahl der biologisch wirtschaftenden Betriebe außerhalb der agrarischen Intensivgebiete befindet
5 Besonderes Gewicht wurde auf eine gute Vergleichbarkeit der biologisch und konventionell bewirtschafteten Grünlandflächen gelegt. Deshalb wurden nur solche Parzellen zum Vergleich herangezogen, die unmittelbar aneinander grenzten, d.h. höchstens durch einen Zaun, einen Weg, eine Hecke o.ä. getrennt waren und die hinsichtlich ihrer naturbürtigen Standortfaktoren wie des Reliefs, der Neigung und Eposition, der Höhe am Hang und ggf. der Entfernung zu einem Fließgewässer annähernd gleiche Verhältnisse aufweisen. Wiesen und Weiden, auf denen eine erkennbare Nach-oder Neueinsaat stattgefunden hatte, wurden von der Untersuchung ausgeschlossen. Ferner wurde angestrebt, nur Flächen mit gleicher Nutzungsart, d.h. Wiesen mit Wiesen und Weiden mit Weiden zu vergleichen. Da aber einige Parzellen sowohl gemäht als auch beweidet werden und die Anteile beider Nutzungsarten nie genau gleich sind, kann in dieser Hinsicht die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein. Im folgenden wird mit dem Begriff Untersuchungsfläche oder Parzelle immer ein als Einheit bewirtschaftetes Grünlandstück bezeichnet, mit dem Wort Aufnahmefläche dagegen die Fläche einer pflanzensoziologischen Aufnahme. 3.2 Pflanzensoziologische Aufnahmen Zur Erhebung der Vegetation wurde die auf BRAUN-BLANQUET (1964) zurückgehende pflanzensoziologische Methode angewandt. Auf jeder Untersuchungsfläche wurden in Abhängigkeit von ihrer Größe und der Verschiedenartigkeit ihres Pflanzenbestandes 2 bis 5 pflanzensoziologische Aufnahmen durchgeführt; die Anzahl der Aufnahmen war auf den zu vergleichenden Parzellen stets dieselbe. Insgesamt konnten 78 Bestandsaufnahmen ausgewertet werden. Die Größe der Aufnahmefläche betrug durchgehend 25 m2 (5 m 5 m). Die Artmächtigkeit wurde in Anlehnung an die von REICHELT & WILMANNS (1973) vorgeschlagene Skala geschätzt. Jede Aufnahmefläche wurde im Lauf der Vegetationsperiode zweimal aufgesucht; der erste Aufnahmetermin fiel in der Regel vor die erste Mahd bzw. Beweidung, der zweite in den Sommer. Sofern sich die Mächtigkeitswerte aus den beiden Aufnahmeterminen unterschieden, gelangte der höhere W ert zur Auswertung. Bei der Vegetationsaufnahme gefundene Moose wurden von der Analyse ausgenommen. Die Nomenklatur der Gefäßpflanzen richtet sich nach EHRENDÖRFER (1973). Die synsystematische Gliederung folgt weitgehend OBERDÖRFER (1983). 3.3 Auswertung Artenzahl Für jeden pflanzensoziologisch erfaßten Bestand wurde die Artenzahl ermittelt. Da alle Aufnahmeflächen von gleicher Größe (25 m2) waren, sind die Artenzahlen pro Aufnahmefläche untereinander vergleichbar. Die Artenzahlen pro Parzelle können dagegen auf verschieden große Flächen bezogen sein (je nach Anzahl der Aufnahmeflächen auf 225 bis 525 m2), so daß ein Vergleich dieser Daten zwar innerhalb eines Paares von Untersuchungsflächen, nicht aber zwischen verschiedenen Paaren möglich ist Zeigerwerte Eine einfache ökologische Charkterisierung von Pflanzenbeständen ist anhand der von ELLEN BERG (1979) veröffentlichten Zeigerwerte möglich. Da besonders die Stickstoffzahl geeignet ist, Unterschiede in der Bewirtschaftungsintensität wiederzugeben, wurde hier nur sie berücksichtigt. Üblicherweise wird aus den Zeigerwerten aller bewerteten Arten einer oder mehrerer Vegetationsaufnahmen eine mittlere Zeigerzahl als arithmetisches Mittel gebildet. Dieses Verfahren ist mathematisch unbefriedigend, da Zeigerwerte als ordinale Daten nicht arithmetisch verrechnet werden dürfen. Es erfährt jedoch dadurch eine gewisse empirische Bestätigung, daß die erhaltenen mittleren Zeigerwerte ökologisch sinnvolle Aussagen erlauben und mit Ergebnissen nach anderen Methoden, z. B. der pflanzensoziologischen, mehr oder weniger genau übereinstimmen (ELLENBERG 1979, BÖCKER et. al. 1983). - Die mittlere Zeigerzahl wurde hier ohne Berücksichtigung der Artmächtigkeit errechnet. Daneben stehen zur Analyse der Zeigerwerte aber auch mathematisch einwandfreie Auswertungswege zur Verfügung. Eine anschauliche Darstellungsweise ist etwa die Angabe von Zeigerwertspektren, also von der Häufigkeitsverteilung der Arten auf Klassen von Zeigerwerten. Um die Aussage dieser Spektren zur Charakterisierung eines Bestandes in einer einzelnen Zahl zu verdichten, schlägt MÖL LER (1987) am Beispiel der Reaktionszahlen vor, die Anzahl der Arten mit hohen Zeigerwerten (R6-R9) ins Verhältnis zur Gesamtzahl der verrechneten Arten zu setzen; den so erhaltenen Quotienten nennt er Reaktionszahlen-Inde) (Ir). Die Grenzziehung zwischen den Klassen 5 und 6 ist dabei prinzipiell willkürlich. Analog zu diesem Verfahren wurde hier ein Stickstoffzahlen-Inde (In) für jede Untersuchungsfläche berechnet, wobei die Grenze ebenfalls zwischen die Klassen 5 und 6 gelegt wurde Anteile von Gräsern, Kräutern und Leguminosen Für die Gruppen der Gräser, der Leguminosen, der übrigen Kräuter und der sonstigen Phanerogamen wurde die mittlere Artenzahl und der Mengenanteil pro Aufnahme berechnet. Zum Vergleich der Mengenanteile wurde die Summe der Deckungsgrade (= Mittelwerte der Artmächtigkeitsklassen; FISCHER 1982) der einzelnen Arten einer Gruppe ins Verhältnis zur Summe der Deckungsgrade aller Arten der jeweiligen Vegetationsaufnahme gesetzt und der Quotient als Gruppendeckungsgrad bezeichnet. Dieser Wert ist dem Ertragsanteil nicht gleichzusetzen (VOIGTLÄNDER/VOSS 1979) Statistische Auswertung In der vorliegenden Untersuchung wurden Parameter der biologischen und der konventionellen Untersuchungsflächen miteinander verglichen. Dabei wurden alle auf die Aufnahmefläche bezogenen Parameter als unverbundene, alle auf Untersuchungsflächen bezogene als verbundene Stichproben behandelt. Besonderes Gewicht wurde auf die korrekte Behandlung ordinaler Daten wie der Zeigerwerte gelegt, auf die die in der Auswertung von Meßergebnissen üblichen Tests nicht angewandt werden dürfen. 265
6 Tabelle 3 Vegetation der Pflanzenbestände unter biologischer und unter konventioneller Bewirtschaftung im Vergleich. Par- Biologisch Konventionell zelle bewirtschaftet bewirtschaftet B1 B2 FI LI L2 L3 HI M2 H3 H4 Subass. v. Ranunculus bulb. FB+, M+ typ. Subass. Subass. v. Lychnis fl.-cuc. Poo-Trisetetum Subass. v. Festuca rubra1 M+ Geranio-Trisetetum Mol+, Nard+, M+ Geranio-Trisetetum Subass. v. Polygonum bist.1 Poo-Trisetetum Typ. Subass.1 Subass. v. Ranunculus bulb. M+ Poo-Trisetetum typ. Subass.1 Lolio-Cynosuretum Ugr > typ. Subass. typ. Subass. Subass. v. Lychnis fl.-cuc. Poo-Trisetetum typ. Subass.1 Poo-Trisetetum Geranio-Trisetetum Subass. v. Polygonum bist.1 Poo-Trisetetum Subass. v. Festuca rubra1 M+ Subass. v. Ranunculus bulb. typ. Subass. Lolio-Cynosuretum Ogr > 51 Molinio-Arrhenatheretea- Gesellschaft Mol+ 52 Lolio-Cynosuretum Ugr > typ. Subass. Ogr > FB+ = mit Festuco-Brometea-Arten Mol+ = mit Molinietalia-Arten Nard+ = mit Nardetalia-Arten M+ = mit Magerkeitszeigern Ugr > = Untergräser stärker als auf Vergleichsfläche Ogr > = Obergräser stärker als auf Vergleichsfläche (1) Subassoziationen von Geranio-Trisetetum und Poo-Trisetetum im Sinne von SPEIDEL (1963) 266
7 Tabelle 4 Pflanzensoziologische Aufnahmen der Untersuchungsfläche L 2 1-4: biologisch bewirtschaftete Parzelle; 5-8 konventionell bewirtschaftete Parzelle; näheres s. Tet. laufende Nr Hoehe uebar NN in m Eposition SE SE SE SE SE SE SE SE Neigung in Grad Gesamtdeckung Artenzahl A/V GERANI0-TRISETETUM Polygonum bistorta a Phyteuma nigrum +. 2m 2m.... Phyteuma spicatum Anemone nemorosa + MOLINIETALIA-ARTEN Lychnis flos-cuculi Achillea ptarmica +. Nyosotis palustris + 1. Dactylorhiza majalis +.. Betónica officinalis.. + Galium uliginosum 1 WEITERE FEUCHTEZEIGER Sanguisorba officinalis 1 2m Viola palustris Ranunculus ficaria + NARDETALIA-ARTEN Nardus stricta. 2m 2m 2m.... Hypericum maculatum Potentilla erecta 1 HAGERKEITSZEIGER Lotus corniculatus Leucanthemum ircutianum Luzula campestris 2m 2m 2m. Avenochloa pubescens. 2m 2m 1 Pimpinella saifraga Saifraga granulata Briza media ARRHENATHERETALIA Taraacum officinale agg b 2b 2m 1 Beilis perennis m 2m 1 + Trisetum flavescens 2m 1 2m 2m. 2m 2m. Veronica chamaedrys 2m 1 2m 2m Cyonosurus cristatus m 1 1 Alchemilla vulgaris agg Achillea millefolium m 1 Anthriscus silvestris Veronica serpy11 ifolia Oactylis glomerata... 2m 2m. Bromus hordeaceus 1.. 2m.. Trifolium dubium Knautia arvensis 1 1 K MOLINIO-ARRHENATHERETEA Trifolium repens m m Poa pratensis agg. 2m b 2b Rume acetosa 2m 2m 1 2m 2a 2a 2m 2m Holcus lanatus 2m 2m 2m 2m 1 2m 2m 2m Ranunculus acris 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2a 2a Trifolium pratense 2a 2a Cerastium holosteoides 1 1 2m 2m 2m 2m 2m 2m Cardamine pratensis Poa trivialis 2m m 2m 2b 2a Plantago lanceolata 2m 2a 2m 1 1 2m 1. Alopecurus pratensis m 2m 2m 3 Centaurea jacea Festuca pratensis 2b 2m.. 2m 2a 2m 2b Vicia cracca 2m 1 1 SONSTIGE Festuca rubra agg m 2b 2m Anthoantum odoratum 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m Agrostis tenuis 2m.. 2m. 2m 2a 2a Brachythecium rutabulum 2m m 2m 2m Dechampsia cespitosa 2m 2m m Stellaria graminea Leontodón autumnal is Ajuga reptans Ranunculus repens.. 1 Ausserdem je einmal in 1: Poa annua agg. (1), Cirsium arvansa (+); in 3i Heracleum sphondylium (+ ), Lathyrus pratensis ( ), Ranunculus bulbosus ( * ), Campanula spec. (+ ) in 5: Veronica arvansis (2m), Plantago major (+) Aufnahmeort: TK 5521 R H
8 Der Vergleich von unverbundenen Stichproben ordinaler Daten erfolgte mit dem U-Test nach Mann und Whitney, der von verbundenen mit dem Wilcoon-Test. Metrische, d.h. aus einer Absolutskala stammende Datenreihe wurden mit dem t-test bzw. dem verkürzten t-test geprüft, soweit sie normalverteilt waren; zur Prüfung auf Normalverteilung wurde der chi-quadrat-test herangezogen. Verhältniszahlen wurden zuvor nach SACHS (1984) transformiert. Metrische Datenreihen, die nicht normalverteilt waren oder bei denen eine Prüfung auf Normalverteilung wegen zu geringen Stichprobenumfanges nicht möglich war, wurden wie ordinale Daten behandelt und dem entsprechenden nichtparametrischen Test unterworfen. Zur Ermittlung von Korrelationen wurde der Spearman sche Rangkorrelationskoeffizient rs berechnet. Das jeweils angewandte Testverfahren wird im Ergebnisteil nicht etra angegeben. Die Signifikanzniveaus werden folgendermaßen symbolisiert: * <0,05 ** <0,01 *** <0,001 n.s. nicht signifikant (-) statistischer Test nicht möglich 4 Ergebnisse 4.1 Gesellschaftszugehörigkeit Da hier nicht alle Originalaufnahmen wiedergegeben werden können, ist in Tab. 3 ein vereinfachter Vegetationsvergleich dargestellt; zusätzlich sind in Tab. 4 eemplarisch die pflanzensoziologischen Aufnahmen eines Untersuchungsflächenpaares dokumentiert. Bei insgesamt 12 Vergleichspaaren erweist sich in einem Fall (M l) die biologische Untersuchungsfläche als diejenige höherer Bewirtschaftungsintensität, in drei Fällen (B2, F l, L3) zeigt die Vegetation nur sehr geringe Unterschiede an. Bei den übrigen acht Paaren läßt die Vegetation auf ein geringeres Intensitätsniveau der biologischen Grünlandbewirtschaftung schließen, wobei in einem Fall (S2) dieser Unterschied durch verschiedene Anteile von Mähund Weidenutzung überlagert wird. In vier der genannten acht Fälle (B l, L I, L2, M2) sind die Pflanzenbestände der biologischen Parzelle deutlich als durch Magerkeitzeiger differenzierte Ausbildungen der jeweiligen Gesellschaft gekennzeichnet. Bei zwei weiteren biologisch bewirtschafteten Untersuchungsflächen (M4, S2) sind zwar keine ausgesprochenen Magerkeitszeiger vorhanden, jedoch weist der höhere Mengenanteil von Untergräsern wie Festuca rubra und Agrostis tenuis bei gleichzeitig geringerem Auftreten der nitrophilen Obergräser Dactylis glomerata und Agropyron repens auf ein niedrigeres Niveau der Nährstoffversorgung hin. Bei drei Vergleichspaaren zeigen die Pflanzenbestände der biologisch bewirtschafteten Flächen deutliche Beziehungen zu Gesellschaften des Etensivgrünlandes, nämlich zu den Molinientalia (L2, Sl) bzw. zu den Festuco-Brometea (B l), während derartige Übergänge auf den jeweiligen konventionell bewirtschafteten Vergleichsflächen nicht zu erkennen sind. In zwei Fällen (L2, M3) muß der Pflanzenbestand der konventionellen Parzellen einer Gesellschaft zugeordnet werden, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in tieferen Höhenlagen hat, obwohl orographische Höhe und Eposition identisch sind. Auch dies kann auf unterschiedlich starke Bewirtschaftung zurückgeführt werden, wie Grünlandkartierungen von SPEIDEL (1963) aus dem Vogelsberg zeigen: In ein und derselben Höhe bilden sich bei steigender Intensität der Bewirtschafting Pflanzengesellschaften der nächsttieferen Stufe aus. Das beispielhaft in Tab. 4 wiedergegebene U ntersuchungsflächenpaar (L2) zeigt einige dieser U nterschiede in sehr deutlicher Weise: während der biologisch bewirtschaftete Pflanzenbestand sich als eine durch Molinietalia-Arten, Nardetalia-Arten sowie weitere Magerkeits- und Feuchtigkeitszeiger differenzierte Ausbildung des Geranio-Trisetetum erweist, fehlen unter konventioneller Bewirtschaft die Carakterarten dieser Gesellschaft weitgehend (lediglich die Aufnahme Nr. 8 weist ein deutliches Vorkommen von Polygonum bistorta auf). Die eben genannten Differentialarten sind auf der konventionell bewirtschafteten Fläche fast gar nicht vertreten; ihr Pflanzenbestand ist daher als typische Ausbildung des Poo-Trisetetum anzusprechen. 4.2 Quantitative Auswertungen Artenzahl Die Artenzahl pro Aufnahmefläche liegt auf dem biologisch bewirtschafteten Grünland im Durchschnitt um 4 bis 5 Arten oder 18 % höher (Tab. 5). Der Unterschied ist hochsignifikant. Zieht man die Artenzahl pro Parzelle in Betracht, so ist die Differenz mit 26 % zugunsten der biologisch bewirtschafteten Flächen noch größer; das niedrigere Signifikanzniveau (Tab. 5) ist durch eine geringere Stichprobengröße von 12 Untersuchungsflächen gegenüber 39 Aufnahmeflächen je Wirtschaftsweise zu erklären. Die Gesamtzahl der in dieser Untersuchung angetroffenen Gefäßpflanzenarten ist auf dem biologischen Grünland mit 126 gar um 34 % höher als auf dem konventionellen mit 94 Arten. Die Differenz der Artenzahl wird also mit zunehmender Bezugsfläche größer. Diese Zunahme kann darauf zurückgeführt werden, daß unter der intensiveren konventionellen Bewirtschaftung nicht nur einige Arten zurückgedrängt werden - wodurch die flächenbezogene A r tenzahl sinkt -, sondern darüberhinaus auch das kleinflächige Mosaik der naturbürtigen Standortfaktoren nivelliert wird, so daß sich die Pflanzenbestände ursprünglich verschiedenartiger Teilflächen derselben Parzelle einander angleichen. Tabelle 5 Unterschiede von biologisch und konventionell bewirtschafteten Parzellen in der Artenzahl biol. konv. biol. Pz. Signifi Parzelle Parzelle relativ1 kanz- Niveau AZ/AF 30,9 26,1 + 18% * * * AZ/Pz. 45,9 36,2 + 26% * * Ges.-AZ % (-) AZ = Artenzahl AF = Aufnahmefläche Pz = Parzelle (1) relativer Wert der biologisch bewirtschafteten Parzelle (konventionelle Parzelle = 100 %) 268
9 Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) Zeigerwerte In Abb. 1 ist die prozentuale Häufigkeitsverteilung der Arten auf die E L L E N B E R G schen StickstoffZeigerwerte wiedergegeben. In der Gesamtheit al ler Aufnahmen zeigt sich klar, daß Arten der K las sen 1 bis 4, welche also überwiegend an nährstoff armen Standorten anzutreffen sind, auf den biolo gisch bewirtschafteten Flächen häufiger Vorkom men, solche der Klassen 5 bis 9 dagegen auf den konventionellen. D as Spektrum der N-Zahlen ist also auf dem biologisch bewirtschafteten Grünland in Richtung der Magerkeitzeiger verschoben. Abbildung 2 Korrelation von mittlerer N-Zahl und N-Inde Anteilevon Gräsern, Kräutern und Le guminosen Spektrum der Stickstoff-Zeigerwerte von biologisch bzw. konventionell bewirtschafteten Grünlandflächen Die mittlere N-Zahl der biologisch bewirtschafteten Pflanzenbestände beträgt 5,1, die der Vergleichs flächen 5,5. Auch der N-Inde zeigt mit 0,41 ge genüber 0,50 eine deutliche Differenz. In beiden Fällen ist der Unterschied signifikant. Interessant ist ein Vergleich der hier ermittelten mittleren N-Zahlen mit Literaturangaben von B Ö C K E R et. al. (1983). Die Autoren berechneten aus den Vegetationstabellen der ersten A uflage der Süddeutschen Pflanzengesellschaften (O B E R D Ö R F E R 1957) die mittleren Zeigerwerte der dort aufgeführten Assoziationen. D a die Auflage 1957 erschien, repräsentieren die ermittelten Werte den Zustand, der vor der letzten landwirtschaftlichen M odernisierungsphase geherrscht hat. Folgende mittlere N-Zahlen werden angegeben: Arrhenatheretum medioeuropaeum ( = ) 4,2 Poo-Trisetetum 4,4 Lolio-Cynosuretum 5,0 D iese Werte liegen um mindestens eine halbe Ein heit niedriger als der hier ermittelte Durchschnitt biologisch bewirtschafteter, denselben Pflanzenge sellschaften zugehöriger Grünlandbestände: ein In diz dafür, daß auch unter dieser Wirtschaftsweise eine gewisse Verdrängung von solchen Pflanzenar ten stattgefunden hat, die aus Konkurrenzgründen an Nährstoffarmut gebunden sind. Methodisch interessant ist der Vergleich der übli cherweise berechneten mittleren N-Zahl mit dem N-Inde. Beide Param eter korrelieren hochsignifi kant (rs = 0,86, A bb. 2), unterscheiden sich also nicht wesentlich in ihrer A ussage. Darüberhinaus vermag der N-Inde ebensogut zu differenzieren wie die N-Zahl. Nach den hier vorliegenden E rgeb nissen ist deshalb kein Grund ersichtlich, die m a thematisch zweifelhafte Berechnung mittlerer NZahlen beizubehalten. Vergleicht man die N-Indices mit den Artenzahlen, so deutet sich eine negative Korrelation an: bei ho her Artenzahl tendiert der N-Inde zu niedrigen Werten und umgekehrt. D er Zusammenhang ist aber statistisch nicht gesichert. In A bb. 3 sind die durchschnittlichen Artenzahlen der aus landwirtschaftlicher Sicht relevanten A r tengruppen dargestellt;. Während bei den Gräsern kein Unterschied zwischen den verglichenen B e ständen eistiert, sind die Kräuter (ohne Legum i nosen) mit etwa drei, die Leguminosen mit etwa ei ner A rt pro Aufnahm efläche stärker auf den biolo gisch bewirtschafteten Flächen vertreten; auch die Gruppe der Sonstigen (vor allem C are, Ju n cu s, L u z u la ) tritt dort in höherer Zahl auf. D ie U nter schiede bei Kräutern und Leguminosen sind stati stisch signifikant. Die in Kapitel festgestellte Reduktion der Artenzahl auf dem konventionell bewirtschafteten Grünland geht also in erster Linie zu Lasten der Kräuter, Leguminosen und Sonsti gen, während die Gruppe der G räser im ganzen nicht betroffen ist. ** Gräser Kräuter ohne Legum. Leguminosen Sonstige Abbildung 3 Artenzahl von Gräsern, Kräutern (ohne Legumino sen), Leguminosen und sonstigen Phanerogamen pro Aufnahmefläche Besonders auffällig ist der höhere Legum inosenan teil auf dem biologischen Grünland. Relativ zu der auf konventionellen Vergleichsflächen gefundenen Anzahl ist die Artenzahl dieser Gruppe um 57 % erhöht. Gruppiert man die Aufnahmen nach der Anzahl der in ihnen auftretenden Leguminosen-Arten (A bb. 4), so ergibt sich ein nach der Wirt schaftsweise deutlich verschiedenes Bild: am häu figsten sind unter konventioneller Bewirtschaftung Aufnahm en mit zwei, unter biologischer mit drei Arten anzutreffen. Aufnahmen mit 5 oder 6 Leguminosen-Arten konnten nur auf dem biologisch bewirtschafteten Grünland gewonnen werden, Aufnahm en ohne Leguminosen stammen dagegen ausschließlich von konventionell bewirtschafteten Flächen. D ie Gruppendeckungsgrade der landwirtschaftli chen Artengruppen sind in A bb. 5 dargestellt. Während die G räser nach ihrer Artmächtigkeit auf 269
10 Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) Lathyrus p ra te n s is b io l. M konv. T rifo liu m dubium L eu c an th em u m irc. Luzula cam p e s tris R anunculus repens P la n ta g o m e d ia T rifo liu m p rate n se L otus c o m ic u la tu s Leg u m in o sen a rten pro AF P im p in e lla s a ífra g a Abbildung 4 Häufigkeitsverteilung der pflanzensoziologischen Auf nahmen in Abhängigkeit von der Anzahl der pro Auf nahmefläche vertretenen Leguminosenarten den konventionellen Parzellen stärker vertreten sind, ist dies bei Legum inosen und Sonstigen auf den biologisch bewirtschafteten Untersuchungsflä chen der Fall. D ie Differenz bei den Kräutern läßt sich dagegen nicht mit ausreichender Wahrschein lichkeit als nicht zufällig absichern. D as sowohl nach Artenzahl als auch nach Menge um mehr als 50 % stärkere Vorkomm en der Legu minosen ist wohl das m arkanteste Charakteristikum der V egetation des biologisch bewirtschafteten Grünlandes. D ie Ursache des höheren Legum ino senbesatzes dürfte in der geringeren Stickstoffzu fuhr zu den Flächen der Biobetriebe liegen; durch N-Düngung verlieren die Fabaceen ihren Konkur renzvorteil der N 2-Fiierung durch Rhizobien. Die Förderung der Legum inosen ist ein ausdrückliches Ziel des biologischen Landbaus, da die N 2-Bindung der Wurzelknöllchen (neben der Fiierung durch freilebende Mikroorganismen und der vom Land wirt nicht beeinflußbaren Deposition von Stickoi den) die einzige quantitativ bedeutsam e Stickstoff quelle ist, die dem Betrieb zur Verfügung steht. b io l. 0.7 X R anunculus bulbosus V e ro n ic a s e rp y llif. Lychnis flo s cu cu li T rifo liu m repens H o lcu s lanatus B e ilis perennis Leo n to d ó n au tu m n a lis S te lla ria g ra m ín e a V ic ia sepïum S te tig k e it Abbildung 6 Arten mit deutlich höherer Stetigkeit auf biologisch bewirtschaftetem Grünland (Abszisse: Anzahl der Aufnahmen mit der jeweiligen Art) konv. 0.1 X 15 S te tig k e it (a b s. A n za h l d e r A u fn a h m e n ) Abbildung 7: Arten mit deutlich höherer Stetigkeit auf konventionell bewirtschaftetem Grünland (Abszisse: Anzahl der Aufnahmen mit der jeweiligen Art) Abbildung 5 Mittlerer Gruppendeckungsgrad von Gräsern, Kräu tern (ohne Leguminosen), Leguminosen und sonstigen Phaneragamen Stetigkeit der Pflanzenarten In A bb. 6 sind die Stetigkeiten aller Pflanzenarten aufgeführt, die auf dem biologisch bewirtschafteten Grünland mit deutlich größerer Regelmäßigkeit als auf den Vergleichsflächen auftreten. A ls U nter schiedsschwelle wurde eine Stetigkeitsdifferenz von mindestens 5 Aufnahmen ( = 13 % ) festgesetzt. Die aufgelisteten Arten repräsentieren vier ökolo gische Artengruppen: Legum inosen, M agerkeits zeiger, niedrigwüchsige und damit lichtliebende Kräuter sowie Feuchtigkeitszeiger. Ü ber die Bedeutung der Legum inosen und der M a gerkeitszeiger wurde bereits berichtet. D as ver- 270 stärkte Vorkommen niedrigwüchsiger Kräuter hängt vermutlich mit der geringeren Bedeutung der G räser, insbesondere der O bergräser zusammen, woraus für die Kräuter der Unterschicht günstigere Lichtverhältnisse resultieren. Überraschend ist die höhere Stetigkeit von R an u n cu lu s rep en s, da er als eine Pflanze gilt, die durch starke Düngung und Übernutzung gefördert wird (D IE T L 1982). M ögli cherweise kommen auch dieser niedrigwüchsigen und feuchtigkeitsliebenden A rt der höhere Licht genuß und ein ausgeglichenerer W asserhaushalt auf den biologisch bewirtschafteten Parzellen zugute. D ie höhere Stetigkeit von Lych n is flos-cuculi kann als Folge einer geringeren düngungsbedingten biologischen Entw ässerung (K L A P P 1971, M E I S E L 1984) erklärt werden. B ei der Interpretation der Stetigkeitsdifferenzen muß einschränkend berücksichtigt werden, daß bei einer Anzahl von 39 Aufnahm en je Wirtschaftswei se Zufälle nicht ganz ausgeschlossen werden kön nen. A bb. 7 gibt diejenigen Arten an, die auf dem kon ventionellen Grünland mit deutlich höherer Stetig keit angetroffen wurden. H eracleu m sphondylium ist als G üllepflanze be kannt. E s verm ag sich vor allem dann auszubreiten,
11 w en n stark m it m ineralischem S tick stoff od er F lüssigm ist gedüngt w ird, d ie N u tzu n gsfreq u en z aber hinter der Stärke der D ü n gu n g zurückbleibt; es ist also ein A n zeig er für Ü b erd ü n gung (K L A P P 1971, D IE T L 1980, 1982). Für P im p in e lla m a jo r gilt ähnlich es, w o b ei die A rt jed o ch vor allem durch m äßige D ü n gu ng gefördert und b ei sehr h oh en Stickstoffgaben w ieder zurückgedrängt wird (D IE T L 1982). D a c ty lis g lo m e r a ta und A r r h e n a th e r u m e la tiu s w erd en als düngerdankbare O bergräser durch die stärkere k o n v en tio n elle D ü n g u n g begünstigt. N e b en der direkten D üngerw irkung dürfte für b eid e A rten, in sb eson d ere aber für d en G latthafer auch die indirek te W irkung der B od en austrock n u n g ein e R olle spielen. D ie h ö h ere S tetigkeit v o n C o n v o lv u lu s a rv e n s is w ar nicht u nbedingt zu erw arten. D ie A rt ist k ein e typische G rünlandpflanze, sondern hat ihren V erbreitungsschw erpunkt in Ä ck ern, G ärten und an R u d e- ralstellen. E L L E N B E R G (1979) stuft sie als indifferen t in bezu g auf d ie Stickstoffversorgung ein. D ie H auptverbreitung der A ck erw in d e läßt darauf sch ließ en, daß sie im G rünland an lückige N arben g eb u n d en ist; da d ie N arb en d ich te im allgem ein en m it zu n eh m en d er D ü n g u n g abnim m t (S C H E C H T N E R 1979), k ö n n te hierin ein e E rklärung des S tetigkeitsunterschiedes geseh en w erden. Für ein e naturschutzfachliche B ew ertu n g ist die F rage v on b eson d erem In teresse, ob A rten m it allgem ein er R ü ck gangsten d en z unter b iologisch er B ew irtschaftung häufiger auftreten. A ls G rundlage ein er d iesbezüglichen B eu rteilu n g soll die nach L i teraturangaben zusam m en gestellte L iste der zurückg eh en d en G rünlandarten (T ab. 1) d ien en. V o n den in d ieser L iste aufgeführten 74 A rten sind au f den hier u ntersuchten F lächen insgesam t 44 vertreten. V o n d iesen 44 A rten erreichen 39 ( = 89 % ) ein e h ö h ere S tetigk eit auf d em b io lo g isch, 2 ( = 4 % ) auf dem k on v en tio n ell bew irtsch afteten G rünland; b ei 3 A rten ( = 7 % ) ist die S tetigk eit gleich. D ie S tetigkeitsdifferenz der G esam tgruppe der 44 A rten erw eist sich als hochsignifikant. - D adurch ist ein deutig b eleg t, daß selten er w erdende G rünlandarten unter biologischer B ew irtschaftung bessere L e b en sm öglich k eiten finden als unter k o n v en tio n eller! V o n den in der R o ten L iste H essen s (K A H L H E B E R et. al. 1979) und der B R D (K O R N E C K & S U K O P P 1988) aufgeführten A rten k om m en auf unseren U n tersu ch u n gsfläch en nur 2 vor: D a c ty - lo r rh iz a m a ja lis fin d et sich in ein er A u fn a h m e der b iologisch bew irtsch afteten P arzelle L 2, T ro lliu s e u r o p a e u s einm al auf der k o n v en tio n ell bew irtschafteten P arzelle M l. In bezu g auf d ie G rünlandarten m it zuneh m en d er B esta n d esten d en z (T ab. 2) ergibt sich kein d eu tlicher U n tersch ied hinsichtlich der W irtschaftsw eisen: von 23 in der L iste en th a lten en A rten, die alle in den hier untersuchten B estä n d en V orkom m en, sind 10 A rten auf d em b iologisch und 13 auf dem k o n v en tio n ell b ew irtsch afteten G rünland häufiger anzutreffen. E in statistisch abzusichernder T rend ist daraus nicht abzuleiten. 5. Zur Relevanz der Biologischen Landwirtschaft für den Naturschutz E s k o n n te in dieser U n tersu ch u n g n a ch gew iesen w erden, daß sich b iologisch bew irtschaftete G rünlandbestände in folgen d er W eise von d enen unter ortsüblicher k on ven tion eller B ew irtschaftung abheben: durch ein e h ö h ere A rten zah l, durch einen h öh eren A n teil an K räutern und in sb eson d ere L e g u m in osen so w ie durch ein e größere H äufigkeit v on A rten, d ie an relativ nährstoffarm e Standorte gebunden sind. E in V ergleich m it den vor allem von M E IS E L ( ) aufgezeigten V eränderungen der G rünla n d vegetation in jüngerer Z eit zeig t, daß d iese C harakteristika des b iologisch bew irtsch afteten G rünlandes den allgem ein zu b eo b a ch ten d en A r ten verschiebungen genau en tgegen steh en : die S tetigkeit von solch en A rten, die b ei der h eu te üblichen L andbew irtschaftung zurückgehen, ist auf b io logisch b ew irtsch aftetem G rünland deutlich höher (K ap ). D e r b iologisch e L andbau ist som it in der L age, der A rtenverarm ung im A grarraum en t g egen zu w irk en und zur E rhaltung der V egeta tio n des W irtschaftsgrünlahdes beizutragen. D ie b iologisch e Landbew irtschaftung kann außerdem d ie A u fg a b e der landw irtschaftlichen N utzung w en ig produktiver F lächen b egren zen. D en n m it ein em niedrigen E rtragsniveau, das ein en k on ven tio n ellen L andw irt zur A u fg a b e zw ingen w ürde, kann ein b iologisch er B etrieb aufgrund h öherer P reise n och G ew in n e erzielen. V ergleich t m an aus der Sicht des N aturschutzes d ie b iologisch e Landw irtschaft m it den in K ap. 2.1 erw ähnten N aturschutzprogram m en, so fallen zu nächst ein ig e V o rteile d ieser Program m e ins A uge: 1. In ih n en sind klare B ew irtschaftungsbedigungen festg elegt, an d ie zu halten sich der L andw irt g e gen ü b er der N aturschutzbehörde verpflichtet; die b io lo g isch e B ew irtschaftung kann d agegen im K on fliktfall von S eiten des N aturschutzes nicht ein g e fordert w erden. 2. D ie B ed in g u n g en ein iger P rogram m e g eh en über die in der biologisch en Landw irtschaft übliche Intensitätsbeschränkung hinaus, w enn etw a - w ie im h essisch en Ö kow iesen p rogram m - der vollstän d ige V erzich t au f N -D ü n g u n g gefordert wird. 3. D ie N aturschutzprogram m e erfassen breits ein e sehr viel größere F läche als der B io-l an d b au, ob w ohl sie erst vor w en igen Jahren ins L eb en gerufen w urden. A n d ererseits hat der b io lo g isch e L andbau w esen tliche V orteile 1. D ie U m stellu n g ein es B etriebes auf b iologisch e W irtschaftsw eise verspricht ein e langfristige R e duktion der B ew irtschaftungsintensität; V erträge im R ah m en von N aturschutzprogram m en sind dagegen kurzfristig kündbar, stellen also ein e S ich e rung auf Z eit und nach M aßgabe der betriebsw irtschaftlichen K alkulation des L andw irtes dar. 2. D er b iologisch en L andw irtschaft ist es gelu n gen, d ie E isten z der B etrieb e durch d ie eig en e P roduktion und au f der G rundlage v o n am M arkt erzielten P reisen zu sichern; sie k ö n n te, w ie P R IE B E (1987) sagt, fast ein agrarpolitisches T raum ziel sein und w ird daher v on m anchen A u to ren als V orb ild für ein e fläch en d eck en d e U m stellu n g der gesam ten L andw irtschaft an g eseh en (z. B. B E C H M A N N 1987). N aturschutzprogram m e bringen es dagegen m it sich, daß der L andw irt ö ffen tlich geforderte D ien stleitu n gen gegen E n tgelt verrichtet, d ie häufig nicht m ehr der P roduktion v o n N ahrungsm itteln d ien en. S ie erfordern also ein en W andel des landw irtschaftlichen B eru fes, für den zw ar gu te G ründe angeführt w erden k önnen (H A M P IC K E 1986), dem aber von vielen S eiten W iderstand en tgegen gesetzt wird. 271
Vegetationsaufnahmen Brandschänkeried
 Vegetationsaufnahmen Brandschänkeried 3. Juni / 1. Juli 2014 Terminologie gemäss Synonymie-Index der Schweizer Flora und der Angrenzenden Gebiete (SISF), 2005 Legende Fett, mit dom. beschriftet Blaue Schrift,
Vegetationsaufnahmen Brandschänkeried 3. Juni / 1. Juli 2014 Terminologie gemäss Synonymie-Index der Schweizer Flora und der Angrenzenden Gebiete (SISF), 2005 Legende Fett, mit dom. beschriftet Blaue Schrift,
 Deutsche Rentenversicherung Deutsche Sozialversicherung und Europarecht im H inb lick auf und ausländische d ie A l terssicherung W anderarb eitnehm er/ innen m o b il er W issenscha f tl er Aktuelle Entwicklungen
Deutsche Rentenversicherung Deutsche Sozialversicherung und Europarecht im H inb lick auf und ausländische d ie A l terssicherung W anderarb eitnehm er/ innen m o b il er W issenscha f tl er Aktuelle Entwicklungen
 Preisliste w a r e A u f t r a g 8. V e r t r b 8. P C K a s s e 8. _ D a t a n o r m 8. _ F I B U 8. O P O S 8. _ K a s s a b u c h 8. L o h n 8. L e t u n g 8. _ w a r e D n s t l e t u n g e n S c h
Preisliste w a r e A u f t r a g 8. V e r t r b 8. P C K a s s e 8. _ D a t a n o r m 8. _ F I B U 8. O P O S 8. _ K a s s a b u c h 8. L o h n 8. L e t u n g 8. _ w a r e D n s t l e t u n g e n S c h
Die Glatthaferwiese von Hof Sackern
 Die Glatthaferwiese von Hof Sackern Hans-Christoph Vahle Inhalt Seite Hof Sackern: Zukünftiger Modellhof der regionalen Artenvielfalt... 2 Lichtvegetation... 3 Ein Acker wird zur Wiese... 3 Das erste Jahr:
Die Glatthaferwiese von Hof Sackern Hans-Christoph Vahle Inhalt Seite Hof Sackern: Zukünftiger Modellhof der regionalen Artenvielfalt... 2 Lichtvegetation... 3 Ein Acker wird zur Wiese... 3 Das erste Jahr:
Ökologische Schnellansprache von Bewirtschaftungseinheiten als methodische Grundlage für die Honorierung ökologischer Effekte im Grünland
 Ökologische Schnellansprache von Bewirtschaftungseinheiten als methodische Grundlage für die Honorierung ökologischer Effekte im Grünland Henning Kaiser, Heinz-Walter Kallen Methodische Grundlage für eine
Ökologische Schnellansprache von Bewirtschaftungseinheiten als methodische Grundlage für die Honorierung ökologischer Effekte im Grünland Henning Kaiser, Heinz-Walter Kallen Methodische Grundlage für eine
Artenvielfalt auf der Pferdeweide
 Artenvielfalt auf der Pferdeweide Grünland erkennen Zeigerpflanzen deuten 1. Auflage Dr. Renate Ulrike Vanselow 3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 3 1 Vorwort 4 2 Vegetationstypen der Weiden und Wiesen
Artenvielfalt auf der Pferdeweide Grünland erkennen Zeigerpflanzen deuten 1. Auflage Dr. Renate Ulrike Vanselow 3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 3 1 Vorwort 4 2 Vegetationstypen der Weiden und Wiesen
Düngung. Agroscope, INH Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften
 Düngung 1. Allgemeines 2. Nährstoffentzug Düngebedürfnis / Normen 3. Wirkung der Düngung auf die Pflanzen der Naturwiesen 4. Hofdünger 5. Düngung der Wiesen und Weiden Allgemeines Begriffe: Extensives
Düngung 1. Allgemeines 2. Nährstoffentzug Düngebedürfnis / Normen 3. Wirkung der Düngung auf die Pflanzen der Naturwiesen 4. Hofdünger 5. Düngung der Wiesen und Weiden Allgemeines Begriffe: Extensives
Sitzungsberichte. der. philosophisch-philologischen und historischen Classe. der» k. b. Akademie der Wissenschaften. zu IVEünchen Heft I.
 Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der» k. b. Akademie der Wissenschaften zu IVEünchen. 1881. Heft I. M ü n c h e n. Akademische Buchdruckerei von F. Straub 1881.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der» k. b. Akademie der Wissenschaften zu IVEünchen. 1881. Heft I. M ü n c h e n. Akademische Buchdruckerei von F. Straub 1881.
WildpflanzenMischungen
 TerraGrün WildpflanzenMischungen 2015 Regio-Saatgut für die Landschaftsgestaltung 2 Firmensitz TerraGrün GbR Telefon 0 71 50/95 92 65 Hofgut Mauer 1a Telefax 0 71 50/95 92 67 70825 Korntal-Münchingen E-mail
TerraGrün WildpflanzenMischungen 2015 Regio-Saatgut für die Landschaftsgestaltung 2 Firmensitz TerraGrün GbR Telefon 0 71 50/95 92 65 Hofgut Mauer 1a Telefax 0 71 50/95 92 67 70825 Korntal-Münchingen E-mail
I n h a l t 1 J o b R o t a t i o a l s u e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e S t r a t e g i e E s t u s P r o b l u V w u s t V g l h d R
 J o b R o t a t i o n A b s c h l u s s d o k u m e nt a t i o n d e s P r o j e k t s ( 1 9 9 8 2 002 ) H e r a u s g e b e r : A R B EI T & L EB EN g G m b H W a l p o d e ns t r. 1 0 5 5 1 1 6 M a i
J o b R o t a t i o n A b s c h l u s s d o k u m e nt a t i o n d e s P r o j e k t s ( 1 9 9 8 2 002 ) H e r a u s g e b e r : A R B EI T & L EB EN g G m b H W a l p o d e ns t r. 1 0 5 5 1 1 6 M a i
Dachbegrünung - Parkhaus Neue Messe Stuttgart: Trockenmagerrasen auf Oberbodensubstrat als ökologische Ausgleichsfläche
 Manuskript DRG-Rasenthema 09-2008 Dachbegrünung - Parkhaus Neue Messe Stuttgart: Trockenmagerrasen auf Oberbodensubstrat als ökologische Ausgleichsfläche Autor: Wolfgang Henle, RFH Hohenheim Die Region
Manuskript DRG-Rasenthema 09-2008 Dachbegrünung - Parkhaus Neue Messe Stuttgart: Trockenmagerrasen auf Oberbodensubstrat als ökologische Ausgleichsfläche Autor: Wolfgang Henle, RFH Hohenheim Die Region
Ökologische Standortbestimmung: Methodik zur Einschätzung des Ist- Zustandes im Rahmen des Kulturlandplans
 Ökologische Standortbestimmung: Methodik zur Einschätzung des Ist- Zustandes im Rahmen des Kulturlandplans Hintergrund Um sinnvolle und angemessene Naturschutzmaßnahmen für zukünftige Entwicklungen und
Ökologische Standortbestimmung: Methodik zur Einschätzung des Ist- Zustandes im Rahmen des Kulturlandplans Hintergrund Um sinnvolle und angemessene Naturschutzmaßnahmen für zukünftige Entwicklungen und
DER BAUINGENIEUR. 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper.
 DER BAUINGENIEUR 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper. D e r D e u t s c h e E is e n b a u - V e r b a n d h
DER BAUINGENIEUR 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper. D e r D e u t s c h e E is e n b a u - V e r b a n d h
Cultandüngung im Dauergrünland
 Cultandüngung im Dauergrünland Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpaß 5, 47533 Kleve
Cultandüngung im Dauergrünland Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Landwirtschaftszentrum Haus Riswick - Fachbereich Grünland und Futterbau - Elsenpaß 5, 47533 Kleve
Wildpflanzenansaaten in der Praxis
 Wildpflanzenansaaten in der Praxis oder die Blumenwiese: - ökologisch - preiswert - bunt und pflegeleicht Geht das? Warum Wildpflanzen? Merkmal Wildformen Kulturformen Homogenität gering hoch Variabilität
Wildpflanzenansaaten in der Praxis oder die Blumenwiese: - ökologisch - preiswert - bunt und pflegeleicht Geht das? Warum Wildpflanzen? Merkmal Wildformen Kulturformen Homogenität gering hoch Variabilität
Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald
 Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Sachstandsbericht 2004 PR O F. D R. M A N FR ED JÜ RG EN M A TS CH K E G R EI FS W A LD 20 04 Im pr es su m ISBN 3-86006-209-3
Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Sachstandsbericht 2004 PR O F. D R. M A N FR ED JÜ RG EN M A TS CH K E G R EI FS W A LD 20 04 Im pr es su m ISBN 3-86006-209-3
MEX-Editor Möglichkeiten für das Outsourcing von Leistungen beim Einsatz der Software
 MEX-Editor Möglichkeiten für das Outsourcing von Leistungen beim Einsatz der Software 1 ArchivInForm Dienstleister für Archive G rü n d u n g 1 9 9 9 E in tra g u n g in s H a n d e ls re g is te r a ls
MEX-Editor Möglichkeiten für das Outsourcing von Leistungen beim Einsatz der Software 1 ArchivInForm Dienstleister für Archive G rü n d u n g 1 9 9 9 E in tra g u n g in s H a n d e ls re g is te r a ls
Kooperationsprojekt Charakteristische Arten von Lebensraumtypen nach FFH-RL
 Kooperationsprojekt Charakteristische Arten von Lebensraumtypen nach FFH-RL Im Rahmen einer Kooperation mit dem Land Schleswig-Holstein sollen in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig bestimmte charakteristische
Kooperationsprojekt Charakteristische Arten von Lebensraumtypen nach FFH-RL Im Rahmen einer Kooperation mit dem Land Schleswig-Holstein sollen in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig bestimmte charakteristische
G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1
 G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. S e ite 1 - G iro k o n to - S p a re n - K re d it - K fw -S tu d ie n k re d it - S ta a tlic h e F ö rd e ru n g - V e rs ic h e ru n g e n S e ite 2 G iro k
G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. S e ite 1 - G iro k o n to - S p a re n - K re d it - K fw -S tu d ie n k re d it - S ta a tlic h e F ö rd e ru n g - V e rs ic h e ru n g e n S e ite 2 G iro k
Der zweiundzwanzigste Psalm ¹ ¹. Ich heu le, a ber mei ne Hül fe ist fern Recit. Recit. Ï. Tutti
 mein gott arum hast.myr 1/12 Mercoledì 27 Giugno 2012, 23:49:46 Soran 1 Alt 1 Tenor 1 Bass 1 Soran 2 Alt 2 Tenor 2 Bass 2 Der zeiundzanzigste Psalm O. 78 Nr. 3 1809-1847 Andante Ich heu le, a ber mei ne
mein gott arum hast.myr 1/12 Mercoledì 27 Giugno 2012, 23:49:46 Soran 1 Alt 1 Tenor 1 Bass 1 Soran 2 Alt 2 Tenor 2 Bass 2 Der zeiundzanzigste Psalm O. 78 Nr. 3 1809-1847 Andante Ich heu le, a ber mei ne
 1 F r e q u e n t l y A s k e d Q u e s t i o n s Was ist der Global Partner Event Calendar (GPEC)? D e r g l o b a l e V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r f ü r P a r t n e r i s t e i n w i c
1 F r e q u e n t l y A s k e d Q u e s t i o n s Was ist der Global Partner Event Calendar (GPEC)? D e r g l o b a l e V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r f ü r P a r t n e r i s t e i n w i c
Weisungen nach Artikel 59 und Anhang 4 der Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV)
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung Januar 2014 Weisungen nach Artikel 59
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung Januar 2014 Weisungen nach Artikel 59
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
ACHTUNDZWANZIG LACHGESCHICHTEN
 Ursula Wölfel ACHTUNDZWANZIG LACHGESCHICHTEN Mit Bildern von Bettina Wölfel Thienemann Die Ge schichte vom Kind, das im mer lachen musste Ein mal war ein Kind so lus tig, dass es im mer la chen musste.
Ursula Wölfel ACHTUNDZWANZIG LACHGESCHICHTEN Mit Bildern von Bettina Wölfel Thienemann Die Ge schichte vom Kind, das im mer lachen musste Ein mal war ein Kind so lus tig, dass es im mer la chen musste.
 Potentialanalyse EU-F ö r d er u ng - ein Werkstattbericht - Grundlinien des Instruments - P l a n u n g s s t a n d D e z e m b e r 2 0 0 7 - D r. J e n s -P e t e r G a u l, K o W i KoWi Koordinierungsstelle
Potentialanalyse EU-F ö r d er u ng - ein Werkstattbericht - Grundlinien des Instruments - P l a n u n g s s t a n d D e z e m b e r 2 0 0 7 - D r. J e n s -P e t e r G a u l, K o W i KoWi Koordinierungsstelle
Gräser und Kräuter. Sammeln und Bestimmen
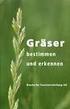 - Gräser und Kräuter Sammeln und Bestimmen (Teil 1: Grundlagen) für Auszubildende in den Ausbildungsberufen Landwirt / Landwirtin Pferdewirt / Pferdewirtin Tierwirt / Tierwirtin Auszubildende/r Name Vorname
- Gräser und Kräuter Sammeln und Bestimmen (Teil 1: Grundlagen) für Auszubildende in den Ausbildungsberufen Landwirt / Landwirtin Pferdewirt / Pferdewirtin Tierwirt / Tierwirtin Auszubildende/r Name Vorname
J. Gedan. KLAVIER SPIELEN Heft Ib. Kinderlieder im Fünftonraum. Edition Pian e forte
 Gedan KLAVIER SPIELEN Heft Ib Kinderlieder im Fünftonraum Edition Pian e forte 2 Am Abend Nun ol- len ir sin -gen das A - bend - lied und be - ten, daß Gott uns be - hüt Hopp, hopp 2 c c Hopp, hopp, 2
Gedan KLAVIER SPIELEN Heft Ib Kinderlieder im Fünftonraum Edition Pian e forte 2 Am Abend Nun ol- len ir sin -gen das A - bend - lied und be - ten, daß Gott uns be - hüt Hopp, hopp 2 c c Hopp, hopp, 2
ÜBER DEN FARBENWECHSEL DES POECILIMON ORNATUS SCHMIDT IN DER POSTEMBRYONALEN ENTWICKLUNG
 ÜBER DEN FARBENWECHSEL DES POECILIMON ORNATUS SCHMIDT IN DER POSTEMBRYONALEN ENTWICKLUNG (Orthoptera - Tettigoniidae) Von Sonja MIKSIC - Zemaljski muzej, Sarajevo Unter den Orthoptera -Arten, welche in
ÜBER DEN FARBENWECHSEL DES POECILIMON ORNATUS SCHMIDT IN DER POSTEMBRYONALEN ENTWICKLUNG (Orthoptera - Tettigoniidae) Von Sonja MIKSIC - Zemaljski muzej, Sarajevo Unter den Orthoptera -Arten, welche in
Gärqualität von Grassilage über die Düngung beeinflussen?
 Gärqualität von Grassilage über die Düngung beeinflussen? Am Niederrhein gewinnt Ammoniumsulfat-Lösung (ASL) als Stickstoffdünger nicht nur für Getreide, sondern vermehrt auch für Grünlandflächen zunehmend
Gärqualität von Grassilage über die Düngung beeinflussen? Am Niederrhein gewinnt Ammoniumsulfat-Lösung (ASL) als Stickstoffdünger nicht nur für Getreide, sondern vermehrt auch für Grünlandflächen zunehmend
 E i n b a u-b a c k o f e n O I M 2 2 3 0 1 B i t t e z u e r s t d i e s e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g l e s e n! S e h r g e e h r t e K u n d i n, s e h r g e e h r t e r K u n d e, v i e
E i n b a u-b a c k o f e n O I M 2 2 3 0 1 B i t t e z u e r s t d i e s e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g l e s e n! S e h r g e e h r t e K u n d i n, s e h r g e e h r t e r K u n d e, v i e
Hamburger Naturdach Pflanzenliste für die extensive Dachbegrünung mit regionalen Arten 1
 Hamburger Naturdach Pflanzenliste für die extensive Dachbegrünung mit regionalen Arten Durchwurzelbare Aufbaudicke: 8-15 cm Stand: 1.4.2016 Das extensive Hamburger Naturdach" bietet viel Raum für eine
Hamburger Naturdach Pflanzenliste für die extensive Dachbegrünung mit regionalen Arten Durchwurzelbare Aufbaudicke: 8-15 cm Stand: 1.4.2016 Das extensive Hamburger Naturdach" bietet viel Raum für eine
Ich war noch niemals in New York
 S A M iano 5 Ich ar noch niemals in Ne York Text: Michael Kunze 8 q = ca 122 (1x tacet) c c c c Du (1x tacet) (mit edal) nach als dem er A A - end es - sen sag - drau -ßen au der Stra - n geh n trug, 4
S A M iano 5 Ich ar noch niemals in Ne York Text: Michael Kunze 8 q = ca 122 (1x tacet) c c c c Du (1x tacet) (mit edal) nach als dem er A A - end es - sen sag - drau -ßen au der Stra - n geh n trug, 4
Bestimmungsschlüssel für landwirtschaftlich genutzte Grünlandgesellschaften in Tirol und Südtirol
 Gredleriana ol. 10 / 2010 pp. 11-62 Bestimmungsschlüssel für landwirtschaftlich genutzte Grünlandgesellschaften in Tirol und Südtirol Erich Tasser, Christian Lüth, Georg Niedrist & Ulrike Tappeiner Abstract
Gredleriana ol. 10 / 2010 pp. 11-62 Bestimmungsschlüssel für landwirtschaftlich genutzte Grünlandgesellschaften in Tirol und Südtirol Erich Tasser, Christian Lüth, Georg Niedrist & Ulrike Tappeiner Abstract
Statistik Testverfahren. Heinz Holling Günther Gediga. Bachelorstudium Psychologie. hogrefe.de
 rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
KONZEPT SAMENMISCHUNGEN AN STRASSENBÖSCHUNGEN
 KONZEPT SAMENMISCHUNEN AN STRASSENBÖSCHUNEN Chur, 20. Januar 2013 Tiefbauamt raubünden Samenmischungen für Strassenböschungen 20.01.2013 Tiefbauamt raubünden Samenmischungen für Strassenböschungen Seite
KONZEPT SAMENMISCHUNEN AN STRASSENBÖSCHUNEN Chur, 20. Januar 2013 Tiefbauamt raubünden Samenmischungen für Strassenböschungen 20.01.2013 Tiefbauamt raubünden Samenmischungen für Strassenböschungen Seite
Bekleidung. Accessoires. Vintage Linie. Bekleidung. Accessoires
 Bekleidung Der fröhliche und unverwechselbare Charakter des Fiat 500 und Fiat 500 spiegelt sich in einer breiten Palette von Produkten und Zubehör wider, um Ihnen eine wertvolle und unterhaltende Sammlung
Bekleidung Der fröhliche und unverwechselbare Charakter des Fiat 500 und Fiat 500 spiegelt sich in einer breiten Palette von Produkten und Zubehör wider, um Ihnen eine wertvolle und unterhaltende Sammlung
Biotopkartierung und -bewertung
 DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz ggmbh Penzliner Straße 56 17235 Neustrelitz Biotopkartierung und -bewertung zum Vorhaben Anbau einer IMC-Station und eines Therapie-Bereiches einschließlich Loser Ausstattung
DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz ggmbh Penzliner Straße 56 17235 Neustrelitz Biotopkartierung und -bewertung zum Vorhaben Anbau einer IMC-Station und eines Therapie-Bereiches einschließlich Loser Ausstattung
Futterbau 22.10.14: Bestandeslenkung I
 Futterbau 22.10.14: Bestandeslenkung I Prof. Nina Buchmann, Institut für Agrarwissenschaften Der optimale Bestand (AGFF 2010) 1 Futterbau DS5 Grundlagen der Bestandeslenkung I Ziele und Werkzeuge Über-,
Futterbau 22.10.14: Bestandeslenkung I Prof. Nina Buchmann, Institut für Agrarwissenschaften Der optimale Bestand (AGFF 2010) 1 Futterbau DS5 Grundlagen der Bestandeslenkung I Ziele und Werkzeuge Über-,
Statistische Tests zu ausgewählten Problemen
 Einführung in die statistische Testtheorie Statistische Tests zu ausgewählten Problemen Teil 4: Nichtparametrische Tests Statistische Testtheorie IV Einführung Beschränkung auf nichtparametrische Testverfahren
Einführung in die statistische Testtheorie Statistische Tests zu ausgewählten Problemen Teil 4: Nichtparametrische Tests Statistische Testtheorie IV Einführung Beschränkung auf nichtparametrische Testverfahren
Die Allelopathie und ihr Nutzen in der biologischen Landwirtschaft
 Die Allelopathie und ihr Nutzen in der biologischen Landwirtschaft Nicolas Delabays Christian Bohren Station fédérale de recherches agronomiques Agroscope RAC Changins Ein Referat in 4 Teilen: Definition
Die Allelopathie und ihr Nutzen in der biologischen Landwirtschaft Nicolas Delabays Christian Bohren Station fédérale de recherches agronomiques Agroscope RAC Changins Ein Referat in 4 Teilen: Definition
Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014 N-Düngung von Winterweizen bei Trockenheit (Versuch 536) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014 N-Düngung von Winterweizen bei Trockenheit (Versuch 536) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen ( D a s W T O - D i e n s t l e i s t u n g s a b k o m m e n G A T S ) Teil I Geltungsbereich und Begriffsbestimmung A rtik el I Geltungsbereich
Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen ( D a s W T O - D i e n s t l e i s t u n g s a b k o m m e n G A T S ) Teil I Geltungsbereich und Begriffsbestimmung A rtik el I Geltungsbereich
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
BESTIMMUNGSSCHLÜSSEL WICHTIGER WIESENGRÄSER JUNGE SCHOSSENDE GRÄSER. Blätter mit Doppelrille (selten schmal und weich)
 BESTIMMUNGSSCHLÜSSEL WICHTIGER WIESENGRÄSER 1 Blätter borstenförmig, hart (selten fadenförmig, weich) Alte Blattscheiden braun, meist zerfasernd, dann Nerven freigelegt 2 Blätter mit Doppelrille (selten
BESTIMMUNGSSCHLÜSSEL WICHTIGER WIESENGRÄSER 1 Blätter borstenförmig, hart (selten fadenförmig, weich) Alte Blattscheiden braun, meist zerfasernd, dann Nerven freigelegt 2 Blätter mit Doppelrille (selten
S o ziale und p sy c h o lo g isc h e U rsa c h e n von U n fällen und ih re w irts c h a ftlic h e n A u sw irk u n g en S.
 S o ziale und p sy c h o lo g isc h e U rsa c h e n von U n fällen und ih re w irts c h a ftlic h e n A u sw irk u n g en S. HANDSCHUH Ich m ö ch te m ic h v o r a lle m d a ra u f b e s c h rä n k e n,
S o ziale und p sy c h o lo g isc h e U rsa c h e n von U n fällen und ih re w irts c h a ftlic h e n A u sw irk u n g en S. HANDSCHUH Ich m ö ch te m ic h v o r a lle m d a ra u f b e s c h rä n k e n,
GEO-Tag der Artenvielfalt 4.6.2011 Auswertung der Erfassung der Höheren Pflanzenarten
 Frank Zimmermann, Rainer Ziebarth & Armin Herrmann GEO-Tag der Artenvielfalt 4.6.2011 Auswertung der Erfassung der Höheren Pflanzenarten Insgesamt konnten an diesem Tag 382 höhere Pflanzenarten im Naturschutzgebiet
Frank Zimmermann, Rainer Ziebarth & Armin Herrmann GEO-Tag der Artenvielfalt 4.6.2011 Auswertung der Erfassung der Höheren Pflanzenarten Insgesamt konnten an diesem Tag 382 höhere Pflanzenarten im Naturschutzgebiet
3.3.1 Referenzwerte für Fruchtwasser-Schätzvolumina ( SSW)
 50 3.3 Das Fruchtwasser-Schätzvolumen in der 21.-24.SSW und seine Bedeutung für das fetale Schätzgewicht in der 21.-24.SSW und für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.3.1 Referenzwerte für
50 3.3 Das Fruchtwasser-Schätzvolumen in der 21.-24.SSW und seine Bedeutung für das fetale Schätzgewicht in der 21.-24.SSW und für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.3.1 Referenzwerte für
Tabelle 28: ph-werte des Harns aller Tiere über den gesamten Zeitraum.
 4.3. Ergebnisse der Harnuntersuchung 4.3.1. ph- des Harns Der ph- des Harns aller 132 untersuchten Tiere betrug zu Beginn der Untersuchung im Mittel 8,47 und verringerte sich mit Beginn der Vorbereitungsfütterung
4.3. Ergebnisse der Harnuntersuchung 4.3.1. ph- des Harns Der ph- des Harns aller 132 untersuchten Tiere betrug zu Beginn der Untersuchung im Mittel 8,47 und verringerte sich mit Beginn der Vorbereitungsfütterung
4.Wie gut haben Sie im letzten Jahr(1997) Ihre Ziele bezüglich der Neukundengewinnung erreicht? 1 = gar nicht erreicht 7 = voll erreicht
 2.2.4.1. Antwortprofil Anhand einer siebenstufigen Ratingskala 1 konnten die Unternehmen den Zielerreichungsgrad bezüglich der einzelnen vorgegebenen Ziele ankreuzen. Abbildung 33 zeigt das Antwortprofil
2.2.4.1. Antwortprofil Anhand einer siebenstufigen Ratingskala 1 konnten die Unternehmen den Zielerreichungsgrad bezüglich der einzelnen vorgegebenen Ziele ankreuzen. Abbildung 33 zeigt das Antwortprofil
146 Glück aul Nr. f» P f. 6000 ßetriebstunden im Jahr F ig. 1. Kosten des e/ek/r StromsJ * tps/st in Zent, -a/en. Kostenjur 10kg Dampf in
 B e z u g p r e i s v ie rte ljä h rlic h : bei A b h o lu n g in d e r D r u c k e re i 5 «.#; bei B e z u g d u rc h die P o s t und d en B u c h h a n d e l 6 J(, unter S tre ifb a n d fü r Deutschland,
B e z u g p r e i s v ie rte ljä h rlic h : bei A b h o lu n g in d e r D r u c k e re i 5 «.#; bei B e z u g d u rc h die P o s t und d en B u c h h a n d e l 6 J(, unter S tre ifb a n d fü r Deutschland,
Tab. 4.1: Altersverteilung der Gesamtstichprobe BASG SASG BAS SAS UDS SCH AVP Mittelwert Median Standardabweichung 44,36 43,00 11,84
 Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Indikatorpflanzen im Schulgelände
 Indikatorpflanzen im Schulgelände 1.1 Inhaltsangabe Deckblatt 1.1 Inhaltsverzeichnis 1.2 Kurzfassung 1.3 Einleitung 2. Vorstellung unseres Schulgeländes 3. Einführung in unsere Untersuchungsmethode 4.
Indikatorpflanzen im Schulgelände 1.1 Inhaltsangabe Deckblatt 1.1 Inhaltsverzeichnis 1.2 Kurzfassung 1.3 Einleitung 2. Vorstellung unseres Schulgeländes 3. Einführung in unsere Untersuchungsmethode 4.
Vegetationstabellen bearbeiten, das Programm "VEG"
 Vegetationstabellen bearbeiten, das Programm "VEG" Objekttyp: Chapter Zeitschrift: Berichte des Geobotanischen nstitutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel Band (Jahr): 6 (994) PDF erstellt am:
Vegetationstabellen bearbeiten, das Programm "VEG" Objekttyp: Chapter Zeitschrift: Berichte des Geobotanischen nstitutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel Band (Jahr): 6 (994) PDF erstellt am:
Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei)
 Dietmar Brandes (2007): Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei) 1/5 Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei) Some notes to the spontaneous flora of
Dietmar Brandes (2007): Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei) 1/5 Notizen zur spontanen Flora der Altstadt von Bratislava (Slowakei) Some notes to the spontaneous flora of
0 3 0 4 J 0 3 0 4 J 0 3 0 4 0 4. 0 4 J. j 0 4. 0 7. 0 3 j 0 4 0 4. 0 4. 0 4 0 3 J 0 3 J
 1 318 Architektur in deutschland Text und MuSIK: Bodo WARtke rechtwinklig resolut (q = ca 136 ) /B b /A m/a b 7 12 8 К 1 7 1 7 1 7 12 8 12 8 К b B b 2 B n 5 1 7 0 7 Ich find a, К К Deutsch - land ent-wi-ckelt
1 318 Architektur in deutschland Text und MuSIK: Bodo WARtke rechtwinklig resolut (q = ca 136 ) /B b /A m/a b 7 12 8 К 1 7 1 7 1 7 12 8 12 8 К b B b 2 B n 5 1 7 0 7 Ich find a, К К Deutsch - land ent-wi-ckelt
Wildblumen- Samenmischungen. Inhalt. 1. Tipps für die Neuanlage aus Wildsamen-Mischungen. 2. Wildblumen-Samenmischungen im Shop.
 Wildblumen- Samenmischungen Inhalt 1. Tipps für die Neuanlage aus Wildsamen-Mischungen 2. Wildblumen-Samenmischungen im Shop Blumenrasen Blumenwiese Bunter Saum Fettwiese Feldblumen Schattsaum Schmetterlings-
Wildblumen- Samenmischungen Inhalt 1. Tipps für die Neuanlage aus Wildsamen-Mischungen 2. Wildblumen-Samenmischungen im Shop Blumenrasen Blumenwiese Bunter Saum Fettwiese Feldblumen Schattsaum Schmetterlings-
Autochthones Pflanz- und Saatgut zur Erhaltung der Biodiversität?
 Autochthones Pflanz- und Saatgut zur Erhaltung der Biodiversität? Seminar der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 2. April 2009, Karlsruhe, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg
Autochthones Pflanz- und Saatgut zur Erhaltung der Biodiversität? Seminar der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 2. April 2009, Karlsruhe, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg
Bodenschutz in der Baubegleitung
 Bodenschutz in der Baubegleitung Foto: Richard Zweig RP Stuttgart 1 Bodenschutz in der Baubegleitung Andreas Lehmann Universität Hohenheim, LANGE GbR - BWK-Bezirksgruppe - 11.Juli 2013 - Technologiepark
Bodenschutz in der Baubegleitung Foto: Richard Zweig RP Stuttgart 1 Bodenschutz in der Baubegleitung Andreas Lehmann Universität Hohenheim, LANGE GbR - BWK-Bezirksgruppe - 11.Juli 2013 - Technologiepark
Stickstoffdüngeempfehlungen für das Saarland 2016
 Stickstoffdüngeempfehlungen für das Saarland 2016 Wie in jedem Jahr hat die Landwirtschaftskammer auf den 73 repräsentativen Ackerflächen des saarländischen Nitratkatasters Bodenproben gezogen, die von
Stickstoffdüngeempfehlungen für das Saarland 2016 Wie in jedem Jahr hat die Landwirtschaftskammer auf den 73 repräsentativen Ackerflächen des saarländischen Nitratkatasters Bodenproben gezogen, die von
Artenvielfalt: eine natürliche Versicherung gegen Extrem-Ereignisse?
 Artenvielfalt: eine natürliche Versicherung gegen Extrem-Ereignisse? Nina Buchmann Institut für Pflanzenwissenschaften nina.buchmann@ipw.agrl.ethz.ch Biodiversität, eine Versicherung? Biodiversität & Ökosystemfunktionen/leistungen
Artenvielfalt: eine natürliche Versicherung gegen Extrem-Ereignisse? Nina Buchmann Institut für Pflanzenwissenschaften nina.buchmann@ipw.agrl.ethz.ch Biodiversität, eine Versicherung? Biodiversität & Ökosystemfunktionen/leistungen
Floristische Untersuchung der Wiesen in den Wasserwerken Flehe und Am Staad mit Pflegehinweisen
 Floristische Untersuchung der Wiesen in den Wasserwerken Flehe und Am Staad mit Pflegehinweisen November 2010 Auftraggeber Ersteller Projektleitung Stadtwerke Düsseldorf Biologische Station Haus Bürgel
Floristische Untersuchung der Wiesen in den Wasserwerken Flehe und Am Staad mit Pflegehinweisen November 2010 Auftraggeber Ersteller Projektleitung Stadtwerke Düsseldorf Biologische Station Haus Bürgel
Statistische Tests für unbekannte Parameter
 Konfidenzintervall Intervall, das den unbekannten Parameter der Verteilung mit vorgegebener Sicherheit überdeckt ('Genauigkeitsaussage' bzw. Zuverlässigkeit einer Punktschätzung) Statistischer Test Ja-Nein-Entscheidung
Konfidenzintervall Intervall, das den unbekannten Parameter der Verteilung mit vorgegebener Sicherheit überdeckt ('Genauigkeitsaussage' bzw. Zuverlässigkeit einer Punktschätzung) Statistischer Test Ja-Nein-Entscheidung
Konfidenzintervalle Grundlegendes Prinzip Erwartungswert Bekannte Varianz Unbekannte Varianz Anteilswert Differenzen von Erwartungswert Anteilswert
 Konfidenzintervalle Grundlegendes Prinzip Erwartungswert Bekannte Varianz Unbekannte Varianz Anteilswert Differenzen von Erwartungswert Anteilswert Beispiel für Konfidenzintervall Im Prinzip haben wir
Konfidenzintervalle Grundlegendes Prinzip Erwartungswert Bekannte Varianz Unbekannte Varianz Anteilswert Differenzen von Erwartungswert Anteilswert Beispiel für Konfidenzintervall Im Prinzip haben wir
Pflanzen auf den Ruderalflächen im Kirchfeld
 Pflanzen auf den Ruderalflächen im Kirchfeld Natur- und Umweltschutzstelle Horw Pflanzenliste 2012 INHALTSVERZEICHNIS Ruderalflächen Definition.. 4 Lavendel...2 Hopfenklee...2 Gewöhnlicher Natterkopf...2
Pflanzen auf den Ruderalflächen im Kirchfeld Natur- und Umweltschutzstelle Horw Pflanzenliste 2012 INHALTSVERZEICHNIS Ruderalflächen Definition.. 4 Lavendel...2 Hopfenklee...2 Gewöhnlicher Natterkopf...2
2.Tag (Sa., ) a) Düne bei Klein-Schmöhlen (MTB 2833)
 Wendland-Exkursion der Arbeitsgemeinschaft für Botanik im Kreis Steinburg 6.7 8.7.12 Fundliste (unvollständig) 1.Tag (Fr., 6.7.12) Hitzacker (Friedhof, Weinberg, Weg an der Jeetze) - Führung: Frau Kelm
Wendland-Exkursion der Arbeitsgemeinschaft für Botanik im Kreis Steinburg 6.7 8.7.12 Fundliste (unvollständig) 1.Tag (Fr., 6.7.12) Hitzacker (Friedhof, Weinberg, Weg an der Jeetze) - Führung: Frau Kelm
Chi-Quadrat Verfahren
 Chi-Quadrat Verfahren Chi-Quadrat Verfahren werden bei nominalskalierten Daten verwendet. Die einzige Information, die wir bei Nominalskalenniveau zur Verfügung haben, sind Häufigkeiten. Die Quintessenz
Chi-Quadrat Verfahren Chi-Quadrat Verfahren werden bei nominalskalierten Daten verwendet. Die einzige Information, die wir bei Nominalskalenniveau zur Verfügung haben, sind Häufigkeiten. Die Quintessenz
Die Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands ist eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener syntaxonomischer Arbeitsgruppen (A-H) innerhalb des
 I Die Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands ist eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener syntaxonomischer Arbeitsgruppen (A-H) innerhalb des Arbeitskreises für Syntaxonomie der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft.
I Die Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands ist eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener syntaxonomischer Arbeitsgruppen (A-H) innerhalb des Arbeitskreises für Syntaxonomie der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft.
Vegetationsentwicklung der Uferbereiche an der Körne nach den Renaturierungsmaßnahmen
 Vegetationsentwicklung der Uferbereiche an der Körne nach den Renaturierungsmaßnahmen Assessing changes of the riparian vegetation after renaturation measures at the river Körne Bachelorarbeit von Martina
Vegetationsentwicklung der Uferbereiche an der Körne nach den Renaturierungsmaßnahmen Assessing changes of the riparian vegetation after renaturation measures at the river Körne Bachelorarbeit von Martina
Halbtrockenrasen in Arzl mehrfach gefährdet?
 Halbtrockenrasen in Arzl mehrfach gefährdet? Betreuung durch Univ.-Prof. Dr. Brigitta Erschbamer und Mag. Dr. Roland Mayer Verfasst von A. Danler, M. Epstein, P. Heidenwolf, M. Karadar, S. M. Laiminger,
Halbtrockenrasen in Arzl mehrfach gefährdet? Betreuung durch Univ.-Prof. Dr. Brigitta Erschbamer und Mag. Dr. Roland Mayer Verfasst von A. Danler, M. Epstein, P. Heidenwolf, M. Karadar, S. M. Laiminger,
1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll
 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e
1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. Einfluss der Aufzuchtintensität auf die Lebensleistung und Nutzungsdauer von Milchkühen
 Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Einfluss der Aufzuchtintensität auf die Lebensleistung und Nutzungsdauer von Milchkühen Themenblatt-Nr.: 43.31.520/2008 Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Einfluss der Aufzuchtintensität auf die Lebensleistung und Nutzungsdauer von Milchkühen Themenblatt-Nr.: 43.31.520/2008 Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
1 3N a rbenhernien Patientena bh 0 1 ng ig e Fa ktoren
 1 3N a rbenhernien Patientena bh 0 1 ng ig e Fa ktoren A o. U n iv. P ro f. D r. C h ris to p h P ro fa n te r U n iv e rs it 0 1 ts k lin ik fø¹ r V is c e ra l-, T ra n s p la n ta tio n s - u n d T
1 3N a rbenhernien Patientena bh 0 1 ng ig e Fa ktoren A o. U n iv. P ro f. D r. C h ris to p h P ro fa n te r U n iv e rs it 0 1 ts k lin ik fø¹ r V is c e ra l-, T ra n s p la n ta tio n s - u n d T
Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell)
 Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell) Name des Ausarbeitenden: Oliver Litz Matrikelnummer: xxxxxxx Name des Ausarbeitenden: Andreas Engel Matrikelnummer: xxxxxxx Fachbereich: GIS Studiengang: Praktische
Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell) Name des Ausarbeitenden: Oliver Litz Matrikelnummer: xxxxxxx Name des Ausarbeitenden: Andreas Engel Matrikelnummer: xxxxxxx Fachbereich: GIS Studiengang: Praktische
Hypothesen: Fehler 1. und 2. Art, Power eines statistischen Tests
 ue biostatistik: hypothesen, fehler 1. und. art, power 1/8 h. lettner / physik Hypothesen: Fehler 1. und. Art, Power eines statistischen Tests Die äußerst wichtige Tabelle über die Zusammenhänge zwischen
ue biostatistik: hypothesen, fehler 1. und. art, power 1/8 h. lettner / physik Hypothesen: Fehler 1. und. Art, Power eines statistischen Tests Die äußerst wichtige Tabelle über die Zusammenhänge zwischen
Borstgrasrasen in Schleswig-Holstein
 Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (Kiel. Not. Pflanzenkd.) 36 (2): 42 74, Kiel 2009 Borstgrasrasen in Schleswig-Holstein Katrin Romahn Kurzfassung In den Jahren 2007 und 2008 wurden in Schleswig-Holstein
Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (Kiel. Not. Pflanzenkd.) 36 (2): 42 74, Kiel 2009 Borstgrasrasen in Schleswig-Holstein Katrin Romahn Kurzfassung In den Jahren 2007 und 2008 wurden in Schleswig-Holstein
Prüfung eines Datenbestandes
 Prüfung eines Datenbestandes auf Abweichungen einzelner Zahlen vom erwarteten mathematisch-statistischen Verhalten, die nicht mit einem Zufall erklärbar sind (Prüfung auf Manipulationen des Datenbestandes)
Prüfung eines Datenbestandes auf Abweichungen einzelner Zahlen vom erwarteten mathematisch-statistischen Verhalten, die nicht mit einem Zufall erklärbar sind (Prüfung auf Manipulationen des Datenbestandes)
Floristische Mitteilungen vom Ostufer der Müritz (Müritz-Nationalpark)
 27 Floristische Mitteilungen vom Ostufer der Müritz (Müritz-Nationalpark) Anselm Krumbiegel Zusammenfassung: Krumbiegel, A. 2008: Floristische Mitteilungen vom Ostufer der Müritz (Müritz-Nationalpark).
27 Floristische Mitteilungen vom Ostufer der Müritz (Müritz-Nationalpark) Anselm Krumbiegel Zusammenfassung: Krumbiegel, A. 2008: Floristische Mitteilungen vom Ostufer der Müritz (Müritz-Nationalpark).
Anlage zu Ziff. 2.3 der Liste der Detailregelungen zur Auslegung der Bewertungsregeln Blatt 1
 Anlage zu Ziff. 2.3 der Liste der Detailregelungen zur Auslegung der Bewertungsregeln Blatt 1 Wirtschaftswiesen bei Eingriffs-/Ausgleichsbewertungen und Planungen im Ökokonto Beurteilung und Bewertung
Anlage zu Ziff. 2.3 der Liste der Detailregelungen zur Auslegung der Bewertungsregeln Blatt 1 Wirtschaftswiesen bei Eingriffs-/Ausgleichsbewertungen und Planungen im Ökokonto Beurteilung und Bewertung
Unkrautbekämpfung. Ratgeber. im Rasen. Breitblättrige Unkräuter und Klee. Bekämpfungsmöglichkeiten Als erstes eine mechanische Methode anwenden:
 Ratgeber Unkrautbekämpfung im Rasen Breitblättrige Unkräuter und Klee Bekämpfungsmöglichkeiten Als erstes eine mechanische Methode anwenden: Von Hand ausreissen (bei kleinen Flächen oder sehr tiefem Befall)
Ratgeber Unkrautbekämpfung im Rasen Breitblättrige Unkräuter und Klee Bekämpfungsmöglichkeiten Als erstes eine mechanische Methode anwenden: Von Hand ausreissen (bei kleinen Flächen oder sehr tiefem Befall)
Re ch n e n m it Term e n. I n h a l t. Ve re i n fac h e n vo n Te r m e n Ve r m i s c h t e Au fg a b e n... 8
 Re ch n e n m it Term e n I n h a l t B e re c h n e n vo n Z a h l e n te r m e n........................................................ We rt e vo n Te r m e n b e re c h n e n........................................................
Re ch n e n m it Term e n I n h a l t B e re c h n e n vo n Z a h l e n te r m e n........................................................ We rt e vo n Te r m e n b e re c h n e n........................................................
Treibhausgas-Bilanzierung der Landnutzungen und der empfohlenen Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen
 Anhang II ierung der Landnutzungen und der empfohlenen Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen (A) Berechnungsgrundlagen Für die Berechnung der CO 2 -Äquivalente in der Bilanz im Kap. 6.3, in der Maßnahmen-
Anhang II ierung der Landnutzungen und der empfohlenen Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen (A) Berechnungsgrundlagen Für die Berechnung der CO 2 -Äquivalente in der Bilanz im Kap. 6.3, in der Maßnahmen-
Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland
 Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland Dr. Frank Hertwig und Dr. Reinhard Priebe Brandenburg Referat 43, Ackerbau und Grünland 14641 Paulinenaue 3.11.29 Anwendungsumfang der Maßnahmen
Futterqualität und Ertrag von extensiv bewirtschaftetem Grünland Dr. Frank Hertwig und Dr. Reinhard Priebe Brandenburg Referat 43, Ackerbau und Grünland 14641 Paulinenaue 3.11.29 Anwendungsumfang der Maßnahmen
8. Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus 2014
 8. Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus 214 Die ökonomische Bewertung des Sojabohnenanbaus orientiert sich an der Systematik des Deckungsbeitrages. Im Hinblick auf die Verrechnung der verwendeten Kennwerte
8. Wirtschaftlichkeit des Sojabohnenanbaus 214 Die ökonomische Bewertung des Sojabohnenanbaus orientiert sich an der Systematik des Deckungsbeitrages. Im Hinblick auf die Verrechnung der verwendeten Kennwerte
Thema: Stellung von Arzt und Koordinator STELLUNG DES ARTZES IN DER ERNÄHRUNGSMEDIZINISCHEN PRAXIS. P ra x is
 Thema: Stellung von Arzt und Koordinator STELLUNG DES ARTZES IN DER ERNÄHRUNGSMEDIZINISCHEN PRAXIS 1. K o n z e p t d e r S c h w e rp u n k tp ra x is 2. O rg a n is a tio n s s tru k tu re n in d e r
Thema: Stellung von Arzt und Koordinator STELLUNG DES ARTZES IN DER ERNÄHRUNGSMEDIZINISCHEN PRAXIS 1. K o n z e p t d e r S c h w e rp u n k tp ra x is 2. O rg a n is a tio n s s tru k tu re n in d e r
ANHANG 1 Vegetation der Gräben häufig auftretende Arten sind unterstrichen, geschützte und gefährdete Arten mit Fettdruck hervorgehoben
 ANHANG 1 Vegetation der Gräben häufig auftretende Arten sind unterstrichen, geschützte und gefährdete Arten mit Fettdruck hervorgehoben Graben 1a Auf der Westseite Gärten angrenzend (Ufer stark verbaut),
ANHANG 1 Vegetation der Gräben häufig auftretende Arten sind unterstrichen, geschützte und gefährdete Arten mit Fettdruck hervorgehoben Graben 1a Auf der Westseite Gärten angrenzend (Ufer stark verbaut),
Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Schleswig-Holstein
 Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Dipl. Ing. agr. Sönke Beckmann Sönke Beckmann 1 Ziele des europäischen Naturschutzes Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Erhaltung der natürlichen
Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Dipl. Ing. agr. Sönke Beckmann Sönke Beckmann 1 Ziele des europäischen Naturschutzes Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Erhaltung der natürlichen
Es ist Sternsingerzeit
 Es ist Sternsinzeit G C G C H G Glo Wie Wie Wie - ri - a! Es ist C: Lied Nr. 1 Text & Musik: aniela icker Rechte über Kindermissionswerk weit! G zeit! C G G G7 Glo-ri - a, Glo-ri - a, Glo - ri - a! Öff-t
Es ist Sternsinzeit G C G C H G Glo Wie Wie Wie - ri - a! Es ist C: Lied Nr. 1 Text & Musik: aniela icker Rechte über Kindermissionswerk weit! G zeit! C G G G7 Glo-ri - a, Glo-ri - a, Glo - ri - a! Öff-t
Arbeits marktmonitoring Gels enkirchen Zentrale Ergebnisse
 G.I.B. - Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbh Arbeits marktmonitoring Gels enkirchen Zentrale Ergebnisse A n d re a s M e rte n s (G.I.B.) vgl. Abb. 1 im Anhang Arbeits marktmonitoring
G.I.B. - Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbh Arbeits marktmonitoring Gels enkirchen Zentrale Ergebnisse A n d re a s M e rte n s (G.I.B.) vgl. Abb. 1 im Anhang Arbeits marktmonitoring
Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft
 DLG-Grünlandtagung, 21.Juni 2007 Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft Dr. habil. Günter Breitbarth Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft
DLG-Grünlandtagung, 21.Juni 2007 Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft Dr. habil. Günter Breitbarth Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft
3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung
 Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Beteiligung der Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung. und Unternehmensgröße
 Beteiligung der Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung und Unternehmensgröße Befunde auf der Grundlage von CVTS3 Friederike Behringer, Gudrun Schönfeld Bonn, Februar 2011 1 Vorbemerkung Im Folgenden
Beteiligung der Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung und Unternehmensgröße Befunde auf der Grundlage von CVTS3 Friederike Behringer, Gudrun Schönfeld Bonn, Februar 2011 1 Vorbemerkung Im Folgenden
Flächenentwicklung in Nordrhein-Westfalen Berichtsjahr 2013
 Flächenentwicklung in Nordrhein-Westfalen Berichtsjahr 2013 Stand: 26. Juni 2014 Quelle: IT.NRW (Datenbereitstellung am 06.06.2014) Aktualisierte Statistik: 33111-Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Flächenentwicklung in Nordrhein-Westfalen Berichtsjahr 2013 Stand: 26. Juni 2014 Quelle: IT.NRW (Datenbereitstellung am 06.06.2014) Aktualisierte Statistik: 33111-Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Sechs Module aus der Praxis
 Modu l 1 : V o r b e r e i tung für d a s Re i te n L e r n s i tuatio n : De r e r ste Ko n ta k t K i n d u n d P fe r d d a r f : 1 2 0 m i n. D i e K i n d e r so l l e n d a s P f e r d, s e i n e
Modu l 1 : V o r b e r e i tung für d a s Re i te n L e r n s i tuatio n : De r e r ste Ko n ta k t K i n d u n d P fe r d d a r f : 1 2 0 m i n. D i e K i n d e r so l l e n d a s P f e r d, s e i n e
Der Europäische Betriebsrat
 Der Europäische Betriebsrat Inaugural-D issertation zur E rlangung des akadem ischen G rades eines D oktors der R echte durch die R echtsw issenschaftliche Fakultät d er W estfälischen W ilhelm s-u niversität
Der Europäische Betriebsrat Inaugural-D issertation zur E rlangung des akadem ischen G rades eines D oktors der R echte durch die R echtsw issenschaftliche Fakultät d er W estfälischen W ilhelm s-u niversität
Statistik II: Signifikanztests /1
 Medien Institut : Signifikanztests /1 Dr. Andreas Vlašić Medien Institut (0621) 52 67 44 vlasic@medien-institut.de Gliederung 1. Noch einmal: Grundlagen des Signifikanztests 2. Der chi 2 -Test 3. Der t-test
Medien Institut : Signifikanztests /1 Dr. Andreas Vlašić Medien Institut (0621) 52 67 44 vlasic@medien-institut.de Gliederung 1. Noch einmal: Grundlagen des Signifikanztests 2. Der chi 2 -Test 3. Der t-test
zu 6 Abs. 1, 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 61 Abs. 1 und 4, 62 Abs. 6, 63 Abs. 3, 64 Abs. 1 sowie 79 Abs. 1 und 2 Voraussetzungen für die Freigabe
 BGBl. II - Ausgegeben am 22. Mai 2006 - Nr. 191 1 von 148 Anlage 1 zu 6 Abs. 1, 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 61 Abs. 1 und 4, 62 Abs. 6, 63 Abs. 3, 64 Abs. 1 sowie 79 Abs. 1 und 2 A. Allgemeines Voraussetzungen
BGBl. II - Ausgegeben am 22. Mai 2006 - Nr. 191 1 von 148 Anlage 1 zu 6 Abs. 1, 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 61 Abs. 1 und 4, 62 Abs. 6, 63 Abs. 3, 64 Abs. 1 sowie 79 Abs. 1 und 2 A. Allgemeines Voraussetzungen
F Gm7 C Am und neu be gin nen ganz neu, da berühren sich Himmel und. C Am7 Dm7 Gm7
 1 a rühren sich Himmel rde Musik hristoph Lehmann m7 7 1. Wo Menschen sich ver ges sen, We ge ver las sen 2. Wo Menschen sich ver schenken, den ken 3. Wo Menschen sich ver bün den, den Hass ü r win den
1 a rühren sich Himmel rde Musik hristoph Lehmann m7 7 1. Wo Menschen sich ver ges sen, We ge ver las sen 2. Wo Menschen sich ver schenken, den ken 3. Wo Menschen sich ver bün den, den Hass ü r win den
