Phänomene des Hydraulischen Grundbruches an einer Baugrubenwand
|
|
|
- Emil Schmidt
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Phänomene des Hydraulischen Grundbruches an einer Baugrubenwand Dipl.-Ing. Robert-Balthasar Wudtke, Prof. Dr.-Ing. Karl Josef Witt, Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau 1 Einführung Die Analyse des Phänomens Hydraulischer Grundbruch kann auf eine lange Geschichte verweisen. Erste Ansätze zur Betrachtung der Gefährdung von Deichen und Wehren wurden durch BLIGH (1910) veröffentlicht. Die grundlegende Idee der Beschreibung des Grenzzustandes als quasi Kriechvorgang wurde durch LANE (1935) weiterentwickelt. Unabhängig hiervon entwickelte TERZAGHI (1925) einen Ansatz zur Analyse des Grenzzustandes an umströmten Baugrubenwänden in nichtbindigem Baugrund. Seine Betrachtung eines Kontrollvolumens steht im Gegensatz zum durch DAVIDENKOFF (1964) entwickelten Ansatz, welcher sich auf den größten im Einflussbereich vorhandenen hydraulischen Gradienten i bezieht. Bei dem von KNAUPE (1968) aufgestellten empirischen Nachweiskonzept wurde ausgehend vom Strömungsnetz neben der Mächtigkeit der wasserführenden Schicht, repräsentativ für den möglichen Zustrom, die Breite der Baugrube und deren Einbindung in der wasserführenden Schicht in den Berechnungen berücksichtigt. Sämtliche genannten Ansätze beziehen sich auf einen Grenzzustand im nichtbindigen Baugrund. Die bisher veröffentlichte Literatur zeigt, dass speziell die Verwendung des Begriffes Hydraulischer Grundbruch mitunter verschiedenen Vorgängen zugewiesen ist. Nach den aktuell gültigen Betrachtungen tritt der Grenzzustand eines Hydraulischen Grundbruches ein, wenn lokal die infolge einer Potenzialdifferenz vorhandene Strömungskraft als Einwirkung den durch das Bodeneigengewicht aktivierbaren Widerstand übersteigt. Im nichtbindigen Boden ist dann, sofern eine Partikelbewegung kinematisch möglich ist, die Lagesicherheit eines Partikels nicht mehr gegeben. Das Versagen tritt in Form eines plötzlichen Aufbruches der Baugrubensohle ein. Es ist selbstverständlich, dass die Bestimmung der Strömungskraft an einem für die Bausituation gültigen Strömungsnetz erfolgt. Neben dem Einfluss der durch unterschiedliche Bodenarten bestimmten Anteile des Scherwiderstandes sind bei der Analyse des Grenzzustandes die vorhandene geologische Stratigraphie sowie die Art und Abmessung der Konstruktion von entscheidender Bedeutung. Bei der Analyse des Einflusses einer hydraulischen Belastung an einer Baugrubenwand muss in jedem Fall sicher gestellt sein, dass der betrachtete Grenzzustand der für die Bausituation relevante ist. Überschneidungen zu anderen Versagensarten, wie Auftrieb und Erosionsgrundbruch, sind möglich. Ein Auftriebsversagen kann an einem Baugrubenverbau durch Gewichtslosigkeit einer zusammenhängenden, die Baugrubensohle bildenden Bodenschicht stattfinden und berücksichtigt als Grenzzustand nicht die Zerstörung des Bodenkontinuums. Diese Versagensart kann in geschichtetem Baugrund dominant sein. Ein Erosionsgrundbruch beginnt mit dem Abtransport des ersten Partikels an der Baugrubensohle. Durch einen kontinuierlich fortgesetzten Partikeltransport entgegen der Strömungsrichtung erreicht der sich bildende Strömungskanal schließlich die Wasserseite. Ein plötzlicher Druckausgleich führt letztlich zu einer konzentrierten Durchspülung und Aufweitung des Strömungskanals. Bei allen genannten Versagensarten ist der Verlust der Korn-zu-Korn-Spannung das entscheidende Kriterium zur Definition des Grenzzustandes. Die Versagensarten unterscheiden sich durch den Ort der Initiation und die Kinematik des Bruches. Scherwiderstände oder Deformationsenergie werden bei den Grenzzustandsbetrachtungen nicht berücksichtigt. Daher sind vor allem bei bindigen Böden nicht näher quantifizierbare Sicherheitsreserven vorhanden. Hydraulische Transportvorgänge wie innere Erosion und innere Suffosion können ebenfalls zur Schädigung der Kornstruktur führen. Durch die verursachte Veränderung der Wegsamkeiten im Baugrund wird lokal ein Anstieg des hydraulischen Gradienten möglich und somit die Sicherheit gegen Hydraulischen Grundbruch beeinflusst. Im Fokus der folgenden Ausführungen steht unter Beachtung der genannten Randbedingungen die Frage nach den unterschiedlichen Arten des Versagens eines Hydraulischen Grundbruches im nichtbindigen und bindigen Baugrund. Seite 1
2 2 Phänomene in nichtbindigem Baugrund In Übereinstimmung mit den derzeit gültigen Normen definieren die EAB (2006) und die EAU 2004 (2005) den Grenzzustand eines Hydraulischen Grundbruches für den Fall, dass der Boden am Fuß einer Baugrubenwand infolge einer aufwärts gerichteten Strömungskraft gewichtlos wird und die Summe aus Bodeneigengewicht und zusätzlich aktivierbaren Rückhaltekräften nicht ausreicht die einwirkende Strömungskraft zu kompensieren. Im entsprechend der DIN 1054 gültigen Grenzzustand 1A ist für nichtbindigen Baugrund der folgende Kräfteansatz gültig. S' γ G' γ (1) k H k G.stb Hierbei sind S k der in einem Kontrollvolumen aktivierbare charakteristische Wert der Strömungskraft und G k der charakteristische Wert des unter Auftrieb stehenden Bodenkörpers. Die Teilsicherheitsbeiwerte γ H und γ G.stb stellen die einwirkungsbezogene Wichtung entsprechend DIN 1054 sicher. Außerdem besteht die Möglichkeit einen vereinfachten Nachweis zu führen, bei dem sichergestellt wird, dass kein Bereich des durchströmten Bodens gewichtslos wird (σ > 0). ( i ) γ γ γ' γ (2) w H G.stb Durch die Parameter γ w und γ sind das Raumgewicht von Wasser und des unter Auftrieb stehenden Baugrundes definiert. Diese beiden Ansätze zum Nachweis des Grenzzustandes gehen auf Untersuchungen von TERZGAHI (1925) und DAVIDENKOFF (1964) zurück. Als Ergebnis von Versuchen an nichtbindigem Boden stellte TERZAGHI (1925) fest, dass der Grenzzustand an einer umströmten Baugrubenwand dem Kräftegleichgewicht zwischen einwirkender Strömungskraft und haltendem Gewicht eines Bodenprismas entspricht. Die Breite des Bodenprismas wird mit der halben Einbindetiefe der Wand angenommen. Die Gegenüberstellung bezieht sich auf einen vom Wandfuß ausgehenden horizontalen Schnitt (siehe Bild 1). Der Parameter h a repräsentiert den Mittelwert der Druckhöhe der über die Breite des Kontrollvolumens vertikal aufwärts gerichteten Strömung. Bild 1: Berechnung der Sicherheit gegen Hydraulischen Grundbruch in nichtbindigem Boden (nach TERZAGHI & PECK (1961)) Für homogenen, isotropen, nichtbindigen Baugrund stellt die genannte Einflussbreite eine gute Abschätzung der Sicherheit dar. Im Fall von komplexeren Randbedingungen sind Variationen des relevanten Bodenkörpers wahrscheinlich. Hierzu zählt eine Veränderung der Strömung hervorgerufen durch räumliche Effekte als Auswirkung geometrischer Variationen der angeströmten Baugrube (siehe EAB (2006)). Bei Wechsellagerung unterschiedlich durchlässiger Bodenschichten an der Baugrubenwand werden zu- Seite 2
3 sätzlich die Verteilung und die Größe der Strömungskraft beeinflusst. Empirische Lösungen zur Erfassung der Problematik werden von KNAUPE (1968) für unterschiedliche Varianten unterströmter Baugrubenverbaukonstruktionen und für diverse Kombinationen von Bodenschichtungen vorgestellt. Da diese Lösungen ausschließlich standardisierte Situationen betreffen, ist im Fall einer komplexen Bausituation der von DAVIDENKOFF (1964) vorgeschlagene Ansatz zur Verhinderung der Gewichtslosigkeit des angeströmten Bodens am praktikabelsten. Die Berechnung des maximalen hydraulischen Gradienten i kann durch Verwendung numerischer Lösungsansätze ausgeführt werden. Weitere Reserven können in Anlehnung an TERZAGHI (1925) durch eine Variation der Bruchkörperbreite mit dem Ziel der Identifikation des ungünstigsten Zustandes definiert werden. Außerdem ist die Anwendung verschiedener Oberflächenformen zur Beschreibung des Kontrollvolumens denkbar. Ist im nichtbindigen Baugrund die Sicherheit gegen Hydraulischen Grundbruch nicht ausreichend, sind unterschiedliche vom aktuellen Bauzustand der Konstruktion abhängige Maßnahmen möglich. Hierzu zählen die Vergrößerung der Einbindetiefe der Wand, das Vorsehen einer undurchlässigen Schicht im Untergrund, ein Auflastfilter auf der Baugrubensohle oder auch der Einsatz von Entlastungsbrunnen. 3 Phänomene in bindigem Baugrund Die oben beschriebenen Gleichgewichtsbetrachtungen ohne Berücksichtigung von Scherkräften oder Deformationsenergie der Bruchkinematik entsprechen einer plötzlichen Fluidisierung des Bodens. Tatsächlich trifft dies für kohäsionslose Böden, insbesondere für enggestufte Feinsande zu, für die in den Regelwerken auch die höchsten Sicherheitsanforderungen gelten. Die Fluidisierung eines Bodens setzt aber zur Aufhebung der inneren Scherkräfte eine Volumendehnung und einen Strukturverlust voraus. Mit zunehmender Kohäsion wird daher mit einer Gleichgewichtsbetrachtung die Kohäsionssicherheit unterschätzt, da selbst eine geringe Kohäsion der Verflüssigung des Bodens entgegenwirkt. Ein erster Ansatz zur Erfassung dieser Problematik wird in DAVIDENKOFF (1970) vorgestellt (siehe Bild 2). Analog zum Ansatz des Kontrollvolumens von TERZAGHI (1925) berücksichtigt er an einem Bruchkörper die angreifenden Strömungskräfte S k und vergleicht diese mit den aktivierbaren Widerständen, bestehend aus dem Eigengewicht des Bodenkörpers G k, der in den vertikalen Scherfugen angesetzten Kohäsionskraft C und der in der horizontalen Abrissebene vorhandenen Zugkraft Z. Die Höhe des Bruchkörpers ist durch die Einbindung der Baugrubenwand definiert. Die Breite des Bruchkörpers wird durch eine schrittweise von der Baugrubenwand ausgehende Verbreiterung mit dem Ziel der Ermittlung der kleinsten Sicherheit berechnet. Bild 2: Hydraulischer Grundbruch im bindigen Baugrund (nach DAVIDENKOFF (1970)) Der Ansatz setzt voraus, dass ein Starrkörperversagen der maßgebende Grenzzustand ist und auch hier Reibungskräfte aufgrund von Ruhedruck und Auflagerreaktion der Wand unberücksichtigt bleiben. Die in den vertikalen und horizontalen Trennflächen angesetzten Widerstände gehen auf die Versagensarten Seite 3
4 Scherbruch und Rissentstehung zurück und sind daher nicht zum gleichen Zeitpunkt am Bruchkörper aktivierbar. Zur Unterscheidung der Grenzzustände ist der Spannungszustand an der Baugrubenwand, repräsentiert durch den Grad des Aushubfortschrittes und die zeitgleiche Absenkung des baugrubenseitigen Wasserstandes maßgebend. Um das hydraulisch verursachte Aufbrechen bindiger Böden zu visualisieren, haben wir Versuche durchgeführt. Als Ergebnis konnte klar gezeigt werden, dass das Versagen durch eine Abfolge von Riss- und Scherversagen komplettiert durch einen Strukturverlust des bindigen Bodens beschrieben werden kann. Der Grenzzustand ist jedoch nicht zwangsläufig durch die Entstehung eines Risses definiert. Entsprechend den Ausführung der EAB (2006) kann einer solchen Abfolge auch durch einen bei einer angenommen Rissentstehung geführten Auftriebsnachweis Rechnung getragen werden. Eine Abtrennung der oben liegenden bindigen Bodenschicht ist hierfür zwingend. Die uneinheitliche Darstellung des Versagens sowie die Verschmierung und Kopplung verschiedener Versagensarten zeigt, dass eine grundlegende Analyse des Grenzzustandes sinnvoll ist. Relevante Versagensarten sind die Erosion, das Starrkörperversagen als Scherbruch und das Versagen durch die Initiation eines Risses. In WITT & WUDTKE (2007) wurde gezeigt, dass ein Erosionsversagen in bindigem Baugrund auszuschließen ist. Bereits bei geringen Kohäsionen sind die für eine Zerlegung einer bindigen Bodenstruktur notwendigen hydraulischen Gradienten derart hoch, dass ein reines Strukturversagen, wie es bei nichtbindigen Böden in Form einer Verflüssigung auftritt, nicht dominant ist. Ein als Scherbruch eintretendes Starrkörperversagen ist maßgebend. Das vom Boden, der Auflagerspannung und von den Isotropiebedingungen abhängende Bruchvolumen hat wesentlichen Einfluss auf die Sicherheit. Das Versagen ist nicht nur vom Anteil der Kohäsion an der Gesamtscherfestigkeit des Baugrundes, sondern auch von der Bruchkörperform sowie der Breite und Tiefe des Bruchkörpers bestimmt. Zusätzlich wird die Betrachtung einer 3-dimensionalen Bruchkörperform interessant, da ein hydraulisches Versagen an einer Baugrubenwand grundsätzlich lokal und nie auf der gesamten Wandlänge stattfindet. Weitere Fragestellungen ergeben sich aus dem Einfluss des Widerlagers auf den Grenzzustand und umgekehrt dem hydraulischen Einfluss auf das Widerlager der Baugrubenwand und dessen Tragfähigkeit. 4 Spannungs- und Verformungsanalyse Während im nichtbindigen Baugrund ein Verlust der Korn-zu-Korn-Spannung (σ = 0) in Verbindung mit Dilatation einen Strukturverlust des Bodens zur Folge hat, wird mit dem Eintrag einer Zugspannung im bindigen Baugrund die Ausnutzung der Zugfestigkeit des Materials eingeleitet. Unter der Voraussetzung einer richtungsabhängigen Aufteilung der Spannungen im Baugrund kann mit einem Aufreißen des Bodens gerechnet werden, wenn die kleinste effektive Hauptspannung σ 3 gleich der effektiven Zugfestigkeit des Bodens σ t ist. σ ' = σ ' (3) 3 t Bei Berücksichtigung der lokal wirksamen totalen Spannung, incl. Porenwasserdruck u 0 und Porenwasserüberdruck Δu, ist der Grenzzustand wie folgt darstellbar: σ ' t = σ 3 + u0 + Δ u (4) Ein Porenwasserüberdruck Δu kann hierbei auf eine Veränderung des Strömungszustandes, z. B. bei einer baugrubenseitigen Absenkung des Wasserspiegels und auf eine Veränderung des Gesamtspannungszustandes, verursacht durch einen Baugrubenaushub, zurückgeführt werden. Für einfache ebene Fälle sind die Einflussgrößen analog zum in SKEMPTON (1954) gezeigten Ansatz berechenbar. Da ein nichtbindiger Boden über keine Zugfestigkeit verfügt, tritt das Versagen definitionsgemäß bei einer lokalen Gewichtslosigkeit ein. Das Gewicht und die Lagerungsdichte des Bodens haben entscheidenden Einfluss auf die Verflüssigung. Variabilitäten der Parameter werden in den Regelwerken durch unterschiedliche Sicherheitsfaktoren für günstige und ungünstige Böden berücksichtigt (WITT & WUDTKE (2007)). Wie oben erläutert ist eine Verflüssigung im bindigen Boden bereits bei sehr geringen Bindungskräften zwischen den Partikeln und Aggregaten sowie bei realistischen Gradienten nicht mehr möglich. Der hyd- Seite 4
5 raulisch verursachte Aufbruch der Baugrubensohle kann in Form eines Scherbruches oder nach einer Rissentstehung stattfinden. Der vorhandene Spannungszustand bestimmt die Dominanz der jeweiligen Versagensart. Bei den gegebenen Randbedingungen findet ein Scherbruch statt, wenn die Differenz zwischen den lokalen effektiven Hauptspannungen σ 1 und σ 3 die undrainierte Kohäsion c u, als Maß für die Scherfestigkeit, doppelt übersteigt. Wird zuvor der laut Gleichung (3) definierte Grenzzustand bei Ausnutzung der Zugfestigkeit erreicht, ist ein Riss dominant. Das Versagen wird in jedem Fall am Fuß der Baugrubenwand beginnen. Bei Annahme eines Risses als Versagensart sind in Bild 3 zwei verschiedene Anwendungen von umströmten Wänden gezeigt, um den Einfluss des Spannungszustandes auf die Ausrichtung des Risses zu verdeutlichen. Bild 3: Prinzipskizze zur Rissinitiation eines Fangdammes (a) und einer Baugrube (b) (nach WITT & WUDTKE (2007)) Im Fall eines Fangdammes ist der Riss etwa vertikal nach unten gerichtet zu erwarten. An der Baugrubenwand wird die Ausrichtung aufgrund der am Wandfuß gedrehten Hauptspannungen schräg oder sogar nahezu horizontal verlaufen. Mit der lokalen Rissentstehung liegt nicht zwangsläufig ein Versagenszustand vor, da durch eine Rissfortpflanzung und Rissaufweitung und die einhergehende Deformation von Risswurzel und Rissoberfläche erheblich Energie dissipiert wird (VALKO & ECONOMIDES (1995)). Kernziel einer aktuellen Forschungsarbeit an der Bauhaus-Universität Weimar ist die Quantifizierung der Grenzzustandsbedingung bei angenommener Rissaufweitung und gleichzeitig die spannungsabhängige Abgrenzung zum Grenzzustand des Scherbruches. Als Ergebnis von im Rahmen des Forschungsprojektes ausgeführten Versuchen konnte gezeigt werden, dass die Porenaufweitung vor dem Durchbruch zu einer strukturierten Schichtzerlegung führt. Der finale Durchbruch zur Baugrubenseite findet nach einer fortgesetzten Öffnung weiterer Risse statt. Gleichzeitig verlagert sich die Strömung und die am Anfang des Vorganges entstandenen Risse schließen sich. Der Vorgang wird von anfänglich gleichmäßig verteilten und letztlich lokal stark zunehmenden Hebungen der Baugrubensohle begleitet. Die Struktur des Bodens wird komplett zerstört. Das Phänomen des hydraulischen Grundbruches wird im bindigen Boden durch die Rissentstehung initiiert und setzt sich bei sukzessiver Rissfortpflanzung und Schieferung des Baugrundes quasi als Auftriebsphänomen fort, wobei jedoch eine undefinierte Potenzialverteilung vorliegt. 5 Empfehlungen zur Nachweismethode Nach den oben gezeigten Zusammenhängen kann festgestellt werden, dass ein hydraulischer Grundbruch an Baugrubenwänden in bindigen Böden in erster Näherung durch ein Starrkörperversagen in Form eines Scherbruches und durch ein Versagen nach der Bildung eines Risses beschrieben werden kann. Ein Versagen infolge eines durch Strömung verursachten Partikeltransportes, wie dies beim nichtbindigen Boden auftritt, ist für bindigen Baugrund als Grenzzustand nicht relevant. Die Frage nach dem maßgebenden Grenzzustand muss in Abhängigkeit des vorhandenen Spannungszustandes und der Ei- Seite 5
6 genschaften des Baugrundes beantwortet werden. Im undrainierten Zustand wird mit Zunahme der Scherfestigkeit und steigendem hydraulischen Potenzial die Entstehung eines Risses vor einem Scherversagen wahrscheinlicher. Im Umkehrschluss ist für schwach bindigen Baugrund ein Starrkörperversagen eher dominant. Eine detaillierte Untersuchung der Starrkörperproblematik wird durch die folgenden Randbedingungen beeinflusst: Bruchkörperform, Verlauf der Scherfuge Bruchkörperbreite, Verhältnis zur Einbindetiefe der Wand t berücksichtigte Widerstände, undrainierte Kohäsion c u als Scherwiderstand in Richtung der Scherfuge und Zugfestigkeit σ t orthogonal zur Scherfuge Bild 4: Starrkörperversagen im bindigen Boden WUDTKE & WITT (2006) In WUDTKE & WITT (2006) wurden für undrainierte Bodenverhältnisse verschiedene statische Lösungsansätze bei Annahme vertikaler, schräger und parabelförmiger Scherfugen vorgestellt. Ergebnis der Analyse des Bruchphänomens an einer Baugrubenwand ist die Empfehlung eines Bruchkörpers, welcher durch eine parabelförmige Scherfuge begrenzt wird und am Wandfuß beginnt (siehe Bild 4). Die bindigen Bodeneigenschaften werden durch eine in der Scherfuge angenommene undrainierte Kohäsion, repräsentativ für die Scherfestigkeit des Materials, realisiert. Auflagerreaktionen werden vernachlässigt. Der Grenzzustand kann als Gegenüberstellung von Einwirkungen und Widerständen wie folgt formuliert werden: Δh t u γ ' u γh + A γg.stb γw γw t c (5) Der am Wandfuß wirksame hydraulische Gradient wird durch die lokale Potenzialdifferenz Δh u und die Einbindetiefe der Wand t berechnet. Die Breite des Bruchkörpers (m t) wird durch den Faktor A berücksichtigt und durch die Einbindetiefe der Wand, die Kohäsion des Baugrundes und die an der Baugrubenwand mobilisierte Adhäsion beeinflusst. Auf Grundlage einer numerischen Studie kann für A in erster Näherung eine Größenordnung von 4,5 bis 6 angenommen werden. Da der Aktivierungsgrad der undrainierten Kohäsion c u spannungsabhängig ist, kann alternativ auf der sicheren Seite liegend die effektive Kohäsion c in Gleichung (5) berücksichtigt werden. Stärker als beim nichtbindigen kündigt sich im bindigen Baugrund der hydraulische Grundbruch durch eine Volumendehnung in Verbindung mit einer Hebung der Baugrubensohle an, sodass hier durch Porenwasserdruck- und Verschiebungsmessungen geeignete Methoden existieren, mit denen sich eine Annäherung an eine kritische Situation erkennen lässt. 6 Zusammenfassung Im nichtbindigen Baugrund ist der Hydraulische Grundbruch an einer Baugrubenwand durch eine Verflüssigung des Bodens infolge Porenwasserüberdrucks gekennzeichnet. Mit den bekannten Gleichgewichtsbetrachtungen werden Scherdeformationen wie auch strukturstützende Effekte aus Auflagerreakti- Seite 6
7 onen der Baugrubenwand nicht erfasst. Da es sich initial um lokale Effekte handelt, welche sich aufgrund der ungünstigen Verlagerung der Potenzialverhältnisse rasch zu einer progressiv verlaufenden Erosion entwickeln können, ist dieser Ansatz für kohäsionslose Böden gerechtfertigt. Bei kohäsivem Baugrund findet eine vergleichbare Verflüssigung des Bodens, eine hydraulisch bedingte Zerlegung der Partikel oder Aggregate, selbst bei geringer Kohäsion erst bei sehr hohem, in der Baupraxis unrealistischen Gradienten statt. Der Bruchzustand wird im bindigen Boden durch ein Aufreißen eingeleitet und setzt sich in Abhängigkeit der Randbedingungen durch eine schichtweise Zerlegung oder durch Scherdeformation eines quasi Starrkörpers fort. Mit den üblichen Gleichgewichtsbetrachtungen wird in solchen Böden die Sicherheit gegen Hydraulischen Grundbruch weit unterschätzt. Auf der Widerstandsseite können der Spannungszustand im Auflagerbereich der Wand und die Kohäsion bzw. die Zugfestigkeit des Bodens angesetzt werden. 7 Dank Der vorgestellte Ansatz zur Abschätzung der Sicherheit gegen einen Hydraulischen Grundbruch an einer Baugrubenwand im bindigen Baugrund ist ein Zwischenergebnis des Forschungsprojektes Hydraulischer Grundbruch in bindigem Boden, das durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) gefördert wird. Wir möchten uns an dieser Stelle für die Unterstützung und kooperative Zusammenarbeit bedanken. Literatur BLIGH, W. G. (1910): Dams, barrages and weirs on porous foundations. In: Engineering News, Vol. 64, S DAVIDENKOFF, R. (1964): Deiche und Erddämme, Sickerströmung - Standsicherheit. Werner-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1964 DAVIDENKOFF, R. (1970): Unterläufigkeit von Stauwerken. Werner-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1970 EAB - EMPFEHLUNGEN DES ARBEITSKREISES BAUGRUBEN (2006): 4. Auflage, Ernst & Sohn, Berlin 2006 EAU EMPFEHLUNGEN DES ARBEITSAUSSCHUSSES UFEREINFASSUNGEN HÄFEN UND WASSERSTRAßEN (2005): 10. Auflage, Ernst & Sohn, Berlin, 2005 KNAUPE W. (1968): Hydraulischer Grundbruch an Baugrubenumschließungen. In: Deutsche Bauenzyklopädie, Schriftenreihen der Bauforschung, Reihe Ingenieur- und Tiefbau, Heft 15 LANE, E. W. (1935): Security from under-seepage-masonry dams on earth foundations. In: Transactions of the American Society of Civil Engineers, Vol. 100, S SKEMPTON, A. W. (1954): The Pore-Pressure Coefficients A and B. In: Géotechnique, Vol. 4, S TERZAGHI, K. (1925): Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage. Verlag F. Deutike, Leipzig und Wien, 1925 TERZAGHI, K., PECK, R. B. (1961): Die Bodenmechanik in der Baupraxis. Springer-Verlag, Berlin - Göttingen Heidelberg, 1961 VALKO, P., ECONOMIDES, M. J. (1995): Hydraulic Fracture Mechanics. John Wiley & Sons, 1995 WITT, K. J., WUDTKE, R.-B. (2007): Versagensmechanismen des Hydraulischen Grundbruchs an einer Baugrubenwand. In: 22. Christian Veder Kolloquium, Graz, 2007 WUDTKE, R.-B., WITT, K. J. (2006): A Static Analysis of Hydraulic Heave in Cohesive Soil. In: 3 rd International Conference on Scour and Erosion, Amsterdam, 2006 Seite 7
Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration
 8. Juni 2006-1- Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration Für die folgende Präsentation wurden mehrere Folien aus einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing. Carsten Hauser übernommen, den er im
8. Juni 2006-1- Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration Für die folgende Präsentation wurden mehrere Folien aus einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing. Carsten Hauser übernommen, den er im
Gelenkträger unter vertikalen und schrägen Einzellasten und einer vertikalen Streckenlast
 www.statik-lernen.de Beispiele Gelenkträger Seite 1 Auf den folgenden Seiten wird das Knotenschnittverfahren zur Berechnung statisch bestimmter Systeme am Beispiel eines Einfeldträgers veranschaulicht.
www.statik-lernen.de Beispiele Gelenkträger Seite 1 Auf den folgenden Seiten wird das Knotenschnittverfahren zur Berechnung statisch bestimmter Systeme am Beispiel eines Einfeldträgers veranschaulicht.
Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser
 Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser Questions due to Water-Soil-Interaction in unsaturated soils below water table H.-J. Köhler Bundesanstalt für Wasserbau
Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser Questions due to Water-Soil-Interaction in unsaturated soils below water table H.-J. Köhler Bundesanstalt für Wasserbau
Statische Berechnung
 P fahlgründung Signalausleger Bauvorhaben: Objekt: Bahnhof Bitterfeld Signalausleger Diese Berechnung umfaßt 10 Seiten und gilt nur in Verbindung mit der statischen Berechnung Signalausleger, Bundesbahn-Zentralamt
P fahlgründung Signalausleger Bauvorhaben: Objekt: Bahnhof Bitterfeld Signalausleger Diese Berechnung umfaßt 10 Seiten und gilt nur in Verbindung mit der statischen Berechnung Signalausleger, Bundesbahn-Zentralamt
STUDIENANLEITUNG UNIVERSITÄRES TECHNISCHES FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN
 Bearbeitungsstand: April 2011 Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium STUDIENANLEITUNG UNIVERSITÄRES TECHNISCHES FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN - DIPLOM-PRÜFUNG / GRUNDFACHSTUDIUM - 1. Modul
Bearbeitungsstand: April 2011 Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium STUDIENANLEITUNG UNIVERSITÄRES TECHNISCHES FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN - DIPLOM-PRÜFUNG / GRUNDFACHSTUDIUM - 1. Modul
3. Grundwasser in Baugruben 3.1 Wasserhaltung
 3.1 Wasserhaltung. 3. Grundwasser in Baugruben 3.1 Wasserhaltung Im Hinblick auf die unterschiedlichsten Erscheinungsformen des Wassers sind im Zusammenhang mit Baugruben im Wasser folgende Fälle zu unterscheiden:
3.1 Wasserhaltung. 3. Grundwasser in Baugruben 3.1 Wasserhaltung Im Hinblick auf die unterschiedlichsten Erscheinungsformen des Wassers sind im Zusammenhang mit Baugruben im Wasser folgende Fälle zu unterscheiden:
Scherfestigkeit von Böden
 Scherfestigkeit von Böden W. Wu 1 1 Scherfestigkeit von Böden Physikalische Ursachen: - Innere Reibung makroskopisches Auf- bzw. Abgleiten Umlagerungen der Bodenkörner bzw. Strukturänderungen Abrieb und
Scherfestigkeit von Böden W. Wu 1 1 Scherfestigkeit von Böden Physikalische Ursachen: - Innere Reibung makroskopisches Auf- bzw. Abgleiten Umlagerungen der Bodenkörner bzw. Strukturänderungen Abrieb und
Grundbau und Bodenmechanik Übung Erddruck K.1
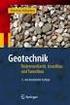 Übung Erddruck K.1 Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau K Erddruck K.1 Allgemeines Im Zusammenhang mit Setzungsberechnungen wurden bereits die im Boden wirksamen Vertikalspannungen
Übung Erddruck K.1 Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau K Erddruck K.1 Allgemeines Im Zusammenhang mit Setzungsberechnungen wurden bereits die im Boden wirksamen Vertikalspannungen
Entwicklung und Stand der Grundbau-Normen aus europäischer und deutscher Sicht. Dr.-Ing. B. Schuppener
 Entwicklung und Stand der Grundbau-Normen aus europäischer und deutscher Sicht Dr.-Ing. B. Schuppener Die weitere Entwicklung der s und -Normen Einleitung für die Geotechnik Grundsätze der Harmonisierung
Entwicklung und Stand der Grundbau-Normen aus europäischer und deutscher Sicht Dr.-Ing. B. Schuppener Die weitere Entwicklung der s und -Normen Einleitung für die Geotechnik Grundsätze der Harmonisierung
ASPEKTE UND MÖGLICHKEITEN ZUR STANDSICHERHEITSBEWERTUNG VON FLUSSDEICHEN
 Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik ASPEKTE UND MÖGLICHKEITEN ZUR STANDSICHERHEITSBEWERTUNG VON FLUSSDEICHEN Konferenz für ein verbessertes Hochwasserrisikomanagement
Fakultät Bauingenieurwesen Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik ASPEKTE UND MÖGLICHKEITEN ZUR STANDSICHERHEITSBEWERTUNG VON FLUSSDEICHEN Konferenz für ein verbessertes Hochwasserrisikomanagement
Beuth Hochschule für Technik Berlin
 Seite 1 sind ebene flächenförmige Konstruktionen, die in ihrer Ebene belastet werden und deren Bauhöhe im Verhältnis zur Stützweite groß ist. Es können ein- und mehrfeldrige Systeme ausgeführt werden;
Seite 1 sind ebene flächenförmige Konstruktionen, die in ihrer Ebene belastet werden und deren Bauhöhe im Verhältnis zur Stützweite groß ist. Es können ein- und mehrfeldrige Systeme ausgeführt werden;
Technischer Bericht 041 / 2006
 Technischer Bericht 041 / 2006 Datum: 08.08.2006 Autor: Dr. Peter Langer Fachbereich: Anwendungsforschung DIN 1055-100 Einwirkungen auf Tragwerke Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept
Technischer Bericht 041 / 2006 Datum: 08.08.2006 Autor: Dr. Peter Langer Fachbereich: Anwendungsforschung DIN 1055-100 Einwirkungen auf Tragwerke Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept
Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems
 THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
Lv/Vo L:\ZG\L\Übung\Skript_EC7\L Erddruck\L-Erddruck.docx
 Übung Erddruck 1 Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau L Erddruck Inhaltsverzeichnis L.1 Allgemeines 1 L.1.1 Flächenbruch Linienbruch 3 L. Erdruhedruck 4 L.3 Aktiver Erddruck
Übung Erddruck 1 Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau L Erddruck Inhaltsverzeichnis L.1 Allgemeines 1 L.1.1 Flächenbruch Linienbruch 3 L. Erdruhedruck 4 L.3 Aktiver Erddruck
Neues Beiblatt 2 zu DIN 4108
 an: V E R T E I L E R Technischer Bericht cc: Xella Baustoffe GmbH Technologie und Marketing Datum: 18.11.2003 Zeichen: BH von: Horst Bestel Technischer Bericht 6/2003 Neues Beiblatt 2 zu DIN 4108 Zusammenfassung:
an: V E R T E I L E R Technischer Bericht cc: Xella Baustoffe GmbH Technologie und Marketing Datum: 18.11.2003 Zeichen: BH von: Horst Bestel Technischer Bericht 6/2003 Neues Beiblatt 2 zu DIN 4108 Zusammenfassung:
1. EINLEITUNG 2. WIRKUNGSWEISE DER VERNAGELUNG. Klaus Dietz, Stump Spezialtiefbau GmbH, Langenfeld
 EINSATZMÖGLICHKEITEN VON NÄGELN ZUR BÖSCHUNGSSICHERUNG UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES KORROSIONSSCHUTZES Klaus Dietz, Stump Spezialtiefbau GmbH, Langenfeld 1. EINLEITUNG Die Sicherung von Fels-
EINSATZMÖGLICHKEITEN VON NÄGELN ZUR BÖSCHUNGSSICHERUNG UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES KORROSIONSSCHUTZES Klaus Dietz, Stump Spezialtiefbau GmbH, Langenfeld 1. EINLEITUNG Die Sicherung von Fels-
Dreigelenkrahmen unter vertikalen und horizontalen Einzellasten sowie horizontaler Streckenlast
 www.statik-lernen.de Beispiele Dreigelenkrahmen Seite 1 Auf den folgenden Seiten wird das Knotenschnittverfahren zur Berechnung statisch bestimmter Systeme am Beispiel eines Dreigelenkrahmens veranschaulicht.
www.statik-lernen.de Beispiele Dreigelenkrahmen Seite 1 Auf den folgenden Seiten wird das Knotenschnittverfahren zur Berechnung statisch bestimmter Systeme am Beispiel eines Dreigelenkrahmens veranschaulicht.
Berücksichtigung von Wärmebrücken im Energieeinsparnachweis
 Flankendämmung Dieser Newsletter soll auf die Thematik der Flankendämmung in Kellergeschossen und Tiefgaragen zu beheizten Bereichen hinweisen. Hierfür wird erst einmal grundsätzlich die Wärmebrücke an
Flankendämmung Dieser Newsletter soll auf die Thematik der Flankendämmung in Kellergeschossen und Tiefgaragen zu beheizten Bereichen hinweisen. Hierfür wird erst einmal grundsätzlich die Wärmebrücke an
GEOTECHNISCHE AUFGABEN BEI DER PLANUNG VON BINNENHÄFEN BEISPIELE UND LÖSUNGSANSÄTZE
 GEOTECHNISCHE AUFGABEN BEI DER PLANUNG VON BINNENHÄFEN BEISPIELE UND LÖSUNGSANSÄTZE DR.-ING. HENDRIK GAITZSCH, DIPL.-ING. KAY THOMAS PASCHOLD G.U.B. Ingenieur AG Glacisstraße 2, 01099 Dresden T: +493516587780,
GEOTECHNISCHE AUFGABEN BEI DER PLANUNG VON BINNENHÄFEN BEISPIELE UND LÖSUNGSANSÄTZE DR.-ING. HENDRIK GAITZSCH, DIPL.-ING. KAY THOMAS PASCHOLD G.U.B. Ingenieur AG Glacisstraße 2, 01099 Dresden T: +493516587780,
Hausarbeit Grundlagen des Grundbaus (Version 6.8 Teil 2)
 Hausarbeit Grundbau Teil 2 Seite 1 Lehrstuhl für Grundbau, Boden- und Felsmechani Vorname:.............................. Name:.............................. Matr.-Nr.:.............................. E-mail:..............................
Hausarbeit Grundbau Teil 2 Seite 1 Lehrstuhl für Grundbau, Boden- und Felsmechani Vorname:.............................. Name:.............................. Matr.-Nr.:.............................. E-mail:..............................
Stahlbau Grundlagen. Verbindungen im Stahlbau. Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka
 Stahlbau Grundlagen Verbindungen im Stahlbau Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Leitbauwerk Halle: Verbindung in einer Rahmenecke Verbindungen im Stahlbau Nieten (heute nicht mehr) Schrauben Bild: Georg Slickers
Stahlbau Grundlagen Verbindungen im Stahlbau Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Leitbauwerk Halle: Verbindung in einer Rahmenecke Verbindungen im Stahlbau Nieten (heute nicht mehr) Schrauben Bild: Georg Slickers
Statistische Tests. Kapitel Grundbegriffe. Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe
 Kapitel 4 Statistische Tests 4.1 Grundbegriffe Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe X 1,..., X n. Wir wollen nun die Beobachtung der X 1,...,
Kapitel 4 Statistische Tests 4.1 Grundbegriffe Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe X 1,..., X n. Wir wollen nun die Beobachtung der X 1,...,
Grundbau und Bodenmechanik Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit 1. G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit. Inhaltsverzeichnis
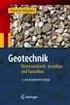 Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Inhaltsverzeichnis G. Allgemeiner Spannungszustand
Übung Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau G Mohr scher Spannungskreis und Scherfestigkeit Inhaltsverzeichnis G. Allgemeiner Spannungszustand
Grundwasserhydraulik Und -erschließung
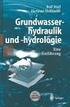 Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Die elektrische Drucksondierung (CPTu)
 FACHVERANSTALTUNG BAUGRUND-BAUWERK-INTERAKTION: OPTIMIERUNG DER FUNDATION UND BEMESSUNG NACH DEM STAND DER TECHNIK Die elektrische Drucksondierung (CPTu) zur Minimierung von Projektkosten und risiken Hendrik
FACHVERANSTALTUNG BAUGRUND-BAUWERK-INTERAKTION: OPTIMIERUNG DER FUNDATION UND BEMESSUNG NACH DEM STAND DER TECHNIK Die elektrische Drucksondierung (CPTu) zur Minimierung von Projektkosten und risiken Hendrik
Zugstab
 Bisher wurde beim Zugstab die Beanspruchung in einer Schnittebene senkrecht zur Stabachse untersucht. Schnittebenen sind gedankliche Konstrukte, die auch schräg zur Stabachse liegen können. Zur Beurteilung
Bisher wurde beim Zugstab die Beanspruchung in einer Schnittebene senkrecht zur Stabachse untersucht. Schnittebenen sind gedankliche Konstrukte, die auch schräg zur Stabachse liegen können. Zur Beurteilung
Klaus Palme Tel. +49 (0) Fax Nr. +49 (0)
 Datum 06.12.2011 Bericht Auftraggeber 2011/016-B-5 / Kurzbericht Palme Solar GmbH Klaus Palme Tel. +49 (0) 73 24-98 96-433 Fax Nr. +49 (0) 73 24-98 96-435 info@palme-solar.de Bestellungsnummer 7 Auftragnehmer
Datum 06.12.2011 Bericht Auftraggeber 2011/016-B-5 / Kurzbericht Palme Solar GmbH Klaus Palme Tel. +49 (0) 73 24-98 96-433 Fax Nr. +49 (0) 73 24-98 96-435 info@palme-solar.de Bestellungsnummer 7 Auftragnehmer
Tech-News Nr. 2013/04 (Stand )
 Tech-News Nr. 2013/04 (Stand 10.07.2013) Massivbau Dr.-Ing. Hermann Ulrich Hottmann Prüfingenieur für Bautechnik VPI Taubentalstr. 46/1 73525 Schwäbisch Gmünd DIN EN 1992-1-1 (EC2) Massivbau Betonstahl
Tech-News Nr. 2013/04 (Stand 10.07.2013) Massivbau Dr.-Ing. Hermann Ulrich Hottmann Prüfingenieur für Bautechnik VPI Taubentalstr. 46/1 73525 Schwäbisch Gmünd DIN EN 1992-1-1 (EC2) Massivbau Betonstahl
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM FAKULTÄT FÜR BAUINGENIEURWESEN STATIK UND DYNAMIK. Diplomprüfung Frühjahr Prüfungsfach. Statik. Klausur am
 Diplomprüfung Frühjahr 00 Prüfungsfach Statik Klausur am 0.0.00 Name: Vorname: Matr.-Nr.: (bitte deutlich schreiben!) (9-stellig!) Aufgabe 5 6 7 8 9 Summe mögliche Punkte 7 5 5 6 0 8 0 6 0 erreichte Punkte
Diplomprüfung Frühjahr 00 Prüfungsfach Statik Klausur am 0.0.00 Name: Vorname: Matr.-Nr.: (bitte deutlich schreiben!) (9-stellig!) Aufgabe 5 6 7 8 9 Summe mögliche Punkte 7 5 5 6 0 8 0 6 0 erreichte Punkte
Inhalt 1 Einführung 2 Wirkung der Kräfte 3 Bestimmung von Schwerpunkten
 Inhalt (Abschnitte, die mit * gekennzeichnet sind, enthalten Übungsaufgaben) 1 Einführung... 1 1.1 Begriffe und Aufgaben der Statik... 2 1.1.1 Allgemeine Begriffe 1.1.2 Begriffe für Einwirkungen... 4 1.1.3
Inhalt (Abschnitte, die mit * gekennzeichnet sind, enthalten Übungsaufgaben) 1 Einführung... 1 1.1 Begriffe und Aufgaben der Statik... 2 1.1.1 Allgemeine Begriffe 1.1.2 Begriffe für Einwirkungen... 4 1.1.3
Seminar Neue Normen in der Geotechnik
 BAUFORUM MINDEN Vorträge und Arbeitsseminare Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen Professor Dr.-Ing. H.-G. Gülzow www.fh-bielefeld.de/fb6/grundbau Seminar Neue Normen
BAUFORUM MINDEN Vorträge und Arbeitsseminare Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen Professor Dr.-Ing. H.-G. Gülzow www.fh-bielefeld.de/fb6/grundbau Seminar Neue Normen
Einleitung von Sole in die Innenjade (Systemtest im bestehenden 3D-HN-Modell der BAW)
 BAW Hamburg Bundesanstalt für Wasserbau Ilmenau - Karlsruhe - Hamburg - Ilmenau Dipl.-Ing. Holger Rahlf Karlsruhe http://www.baw.de http://www.baw.de BAW-DH / Januar 21 Folie-Nr. 1 BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU
BAW Hamburg Bundesanstalt für Wasserbau Ilmenau - Karlsruhe - Hamburg - Ilmenau Dipl.-Ing. Holger Rahlf Karlsruhe http://www.baw.de http://www.baw.de BAW-DH / Januar 21 Folie-Nr. 1 BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU
Bodenuntersuchungen im Feld 31
 Bodenuntersuchungen im Feld 31 4.3.1 Rammsondierungen. Bei Rammsondierungen werden gemäß [L 30] Sonden mit Rammbären in den Boden gerammt. Gemessen wird die Anzahl der Schläge N 10, die für eine Eindringtiefe
Bodenuntersuchungen im Feld 31 4.3.1 Rammsondierungen. Bei Rammsondierungen werden gemäß [L 30] Sonden mit Rammbären in den Boden gerammt. Gemessen wird die Anzahl der Schläge N 10, die für eine Eindringtiefe
Experimentelle Hydromechanik Wehrüberfall und Ausfluss am Planschütz
 UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Wasserwesen Dr.-Ing. H. Kulisch Universitätsprofessor Dr.-Ing. Andreas Malcherek Hydromechanik und Wasserbau
UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Wasserwesen Dr.-Ing. H. Kulisch Universitätsprofessor Dr.-Ing. Andreas Malcherek Hydromechanik und Wasserbau
In der Technik treten Fachwerke als Brückenträger, Masten, Gerüste, Kräne, Dachbindern usw. auf.
 6. Ebene Fachwerke In der Technik treten Fachwerke als Brückenträger, Masten, Gerüste, Kräne, Dachbindern usw. auf. 6.1 Definition Ein ideales Fachwerk besteht aus geraden, starren Stäben, die miteinander
6. Ebene Fachwerke In der Technik treten Fachwerke als Brückenträger, Masten, Gerüste, Kräne, Dachbindern usw. auf. 6.1 Definition Ein ideales Fachwerk besteht aus geraden, starren Stäben, die miteinander
Ein Beispiel für die Anwendung des Risikographen
 Ein Beispiel für die Anwendung des Risikographen Birgit Milius 1 Der Risikograph Von jedem System geht ein Risiko aus. Das Risiko darf nicht unzulässig groß sein; es muss tolerierbar sein. Der Risikograph
Ein Beispiel für die Anwendung des Risikographen Birgit Milius 1 Der Risikograph Von jedem System geht ein Risiko aus. Das Risiko darf nicht unzulässig groß sein; es muss tolerierbar sein. Der Risikograph
Warme Kante für Fenster und Fassade
 Seite 1 von 7 Dipl.-Phys. ift Rosenheim Einfache Berücksichtigung im wärmetechnischen Nachweis 1 Einleitung Entsprechend der Produktnorm für Fenster EN 14351-1 [1] (Fassaden EN 13830 [2]) erfolgt die Berechnung
Seite 1 von 7 Dipl.-Phys. ift Rosenheim Einfache Berücksichtigung im wärmetechnischen Nachweis 1 Einleitung Entsprechend der Produktnorm für Fenster EN 14351-1 [1] (Fassaden EN 13830 [2]) erfolgt die Berechnung
Kräftepaar und Drehmoment
 Kräftepaar und Drehmoment Vorlesung und Übungen 1. Semester BA Architektur KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Kräftepaar
Kräftepaar und Drehmoment Vorlesung und Übungen 1. Semester BA Architektur KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft www.kit.edu Kräftepaar
FE-Berechnung von Baugruben mit den Nachweisverfahren des EC7
 FE-Berechnung von Baugruben mit den Nachweisverfahren des EC7 Helmut F. Schweiger 1 Einleitung Mit Inkrafttreten des Eurocode 7 wird das Teilsicherheitskonzept in die europäische Normung eingeführt. Die
FE-Berechnung von Baugruben mit den Nachweisverfahren des EC7 Helmut F. Schweiger 1 Einleitung Mit Inkrafttreten des Eurocode 7 wird das Teilsicherheitskonzept in die europäische Normung eingeführt. Die
Hypothesen: Fehler 1. und 2. Art, Power eines statistischen Tests
 ue biostatistik: hypothesen, fehler 1. und. art, power 1/8 h. lettner / physik Hypothesen: Fehler 1. und. Art, Power eines statistischen Tests Die äußerst wichtige Tabelle über die Zusammenhänge zwischen
ue biostatistik: hypothesen, fehler 1. und. art, power 1/8 h. lettner / physik Hypothesen: Fehler 1. und. Art, Power eines statistischen Tests Die äußerst wichtige Tabelle über die Zusammenhänge zwischen
Bei Rettungsmaßnahmen im Rahmen
 Erdanker: Experimentelle Untersuchungen zum Trag- und Verformungsverhalten Teil 1 Einleitung Bei Rettungsmaßnahmen im Rahmen von Hilfeleistungseinsätzen können mit Hilfe von temporären Erdankern Festpunkte
Erdanker: Experimentelle Untersuchungen zum Trag- und Verformungsverhalten Teil 1 Einleitung Bei Rettungsmaßnahmen im Rahmen von Hilfeleistungseinsätzen können mit Hilfe von temporären Erdankern Festpunkte
Programm STÜTZBAUWERKE
 Programm STÜTZBAUWERKE Das Programm STÜTZBAUWERKE dient zur Berechnung der notwendigen Sicherheitsnachweise für eine Stützmauer. Bei der Berechnung der Sicherheitsnachweise können folgende Einflussfaktoren
Programm STÜTZBAUWERKE Das Programm STÜTZBAUWERKE dient zur Berechnung der notwendigen Sicherheitsnachweise für eine Stützmauer. Bei der Berechnung der Sicherheitsnachweise können folgende Einflussfaktoren
Anhang 4. Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen
 Anhang 4 Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen H. Bertelsmann AG Epidemiologie und Medizinische Statistik Universität Bielefeld Dezember
Anhang 4 Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen H. Bertelsmann AG Epidemiologie und Medizinische Statistik Universität Bielefeld Dezember
Statistische Verfahren zur Maschinen- und Prozessqualifikation
 Statistische Verfahren zur Maschinen- und Prozessqualifikation Bearbeitet von Edgar Dietrich, Alfred Schulze 5., aktualisierte Auflage 2005. Buch. XVIII, 630 S. Hardcover ISBN 978 3 446 22894 8 Format
Statistische Verfahren zur Maschinen- und Prozessqualifikation Bearbeitet von Edgar Dietrich, Alfred Schulze 5., aktualisierte Auflage 2005. Buch. XVIII, 630 S. Hardcover ISBN 978 3 446 22894 8 Format
3.6 Eigenwerte und Eigenvektoren
 3.6 Eigenwerte und Eigenvektoren 3.6. Einleitung Eine quadratische n n Matrix A definiert eine Abbildung eines n dimensionalen Vektors auf einen n dimensionalen Vektor. c A x c A x Von besonderem Interesse
3.6 Eigenwerte und Eigenvektoren 3.6. Einleitung Eine quadratische n n Matrix A definiert eine Abbildung eines n dimensionalen Vektors auf einen n dimensionalen Vektor. c A x c A x Von besonderem Interesse
Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung
 Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe zu Wirkungsmessung und deren Definitionen. Zudem wird der Begriff Wirkungsmessung zu Qualitätsmanagement
Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe zu Wirkungsmessung und deren Definitionen. Zudem wird der Begriff Wirkungsmessung zu Qualitätsmanagement
VOB/C Homogenbereiche ersetzen Boden- und Felsklassen
 VOB/C Homogenbereiche ersetzen Boden- und Felsklassen Vortrag im Rahmen der 10. Öffentlichkeitsveranstaltung des Netzwerks Baukompetenz München BKM 17. März 2016 Hochschule München Referent Prof. Dipl.-Ing.
VOB/C Homogenbereiche ersetzen Boden- und Felsklassen Vortrag im Rahmen der 10. Öffentlichkeitsveranstaltung des Netzwerks Baukompetenz München BKM 17. März 2016 Hochschule München Referent Prof. Dipl.-Ing.
Zusammenfassung. Vergleichsrechnungen DIN 1054 zu EC7-1. Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen der RWTH Aachen Mies-van-der-Rohe-Straße Aachen
 Zeichen: Zie/Tf Datum: 30.09.10 Zusammenfassung Aktenzeichen: ZP 52-5- 11.74-1350/09 Forschungsthema: Forschende Stelle: Vergleichsrechnungen DIN 1054 zu EC7-1 Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen der
Zeichen: Zie/Tf Datum: 30.09.10 Zusammenfassung Aktenzeichen: ZP 52-5- 11.74-1350/09 Forschungsthema: Forschende Stelle: Vergleichsrechnungen DIN 1054 zu EC7-1 Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen der
B A C H E L O R A R B E I T
 University of Applied Sciences Cologne B A C H E L O R A R B E I T TRAGWERKSPLANUNG EINES BAUWERKS IM ERDBEBENGEBIET Verfasser: Studienrichtung: Bauingenieurwesen WS 2010/2011 Inhaltsverzeichnis Begriffe...7
University of Applied Sciences Cologne B A C H E L O R A R B E I T TRAGWERKSPLANUNG EINES BAUWERKS IM ERDBEBENGEBIET Verfasser: Studienrichtung: Bauingenieurwesen WS 2010/2011 Inhaltsverzeichnis Begriffe...7
Verankerungen ÖNORM EN ÖNORM B Verankerungen von. Bauwerkswänden, Bauwerkssohlen, Böschungen, Zuggliedern, etc.
 Die Einführung des EC 7, Teil 1 ÖNORM EN 1997-1 ÖNORM B 1997-1-1 VERANKERUNGEN K. Breit, L. Martak, M. Suppan 2009-06-04 von Bauwerkswänden, Bauwerkssohlen, Böschungen, Zuggliedern, etc. 2 1 Um das gängige
Die Einführung des EC 7, Teil 1 ÖNORM EN 1997-1 ÖNORM B 1997-1-1 VERANKERUNGEN K. Breit, L. Martak, M. Suppan 2009-06-04 von Bauwerkswänden, Bauwerkssohlen, Böschungen, Zuggliedern, etc. 2 1 Um das gängige
Spundwände aus Kunststoffen Innovative Lösungen für den Tiefbau und für den Wasserbau
 Spundwände aus Kunststoffen Innovative Lösungen für den Tiefbau und für den Wasserbau Martin Busse Kunststoffspundwände "DuoLock" werden aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Kunststoff im Extrusionsverfahren
Spundwände aus Kunststoffen Innovative Lösungen für den Tiefbau und für den Wasserbau Martin Busse Kunststoffspundwände "DuoLock" werden aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Kunststoff im Extrusionsverfahren
Global- und Teilsicherheitskonzept bei der Ankerbemessung
 Global- und Teilsicherheitskonzept bei der Ankerbemessung Bundesanstalt für Wasserbau Dienststelle Hamburg Dr.-Ing. Martin Pohl BAW - DH / 2006-11 K1 Folie-Nr. 1 Gliederung Normen Vergleich der Bemessungsansätze
Global- und Teilsicherheitskonzept bei der Ankerbemessung Bundesanstalt für Wasserbau Dienststelle Hamburg Dr.-Ing. Martin Pohl BAW - DH / 2006-11 K1 Folie-Nr. 1 Gliederung Normen Vergleich der Bemessungsansätze
...~l(it Scientific. Ingenieurwissenschaftliche Untersuchungen an der Hauptkuppel und den Hauptpfeilern der Hagia Sophia in Istanbul
 Ingenieurwissenschaftliche Untersuchungen an der Hauptkuppel und den Hauptpfeilern der Hagia Sophia in Istanbul von Christoph Duppel...~l(IT Scientific ~ Publishing Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Ingenieurwissenschaftliche Untersuchungen an der Hauptkuppel und den Hauptpfeilern der Hagia Sophia in Istanbul von Christoph Duppel...~l(IT Scientific ~ Publishing Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Bemessung von Ziegelmauerwerk im Brandfall nach DIN EN /NA und nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
 AMz-Bericht 5/2014 Bemessung von Ziegelmauerwerk im Brandfall nach DI E 1996-1-2/A und nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 1. Einleitung In diesem Bericht werden die neu denierten Ausnutzungsfaktoren
AMz-Bericht 5/2014 Bemessung von Ziegelmauerwerk im Brandfall nach DI E 1996-1-2/A und nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 1. Einleitung In diesem Bericht werden die neu denierten Ausnutzungsfaktoren
2 Berechnung von Flächengründungen nach EC 7-1, Abschnitt 6
 19 2 Berechnung von Flächengründungen nach EC 7-1, Abschnitt 6 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley, Dipl.-Ing. Robert Höppner 2.1 Grundlagen zur Bemessung von Flächengründungen 2.1.1 Neue und alte Normung
19 2 Berechnung von Flächengründungen nach EC 7-1, Abschnitt 6 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley, Dipl.-Ing. Robert Höppner 2.1 Grundlagen zur Bemessung von Flächengründungen 2.1.1 Neue und alte Normung
Statik- und Festigkeitslehre I
 05.04.2012 Statik- und Festigkeitslehre I Prüfungsklausur 2 WS 2011/12 Hinweise: Dauer der Klausur: Anzahl erreichbarer Punkte: 120 Minuten 60 Punkte Beschriften Sie bitte alle Seiten mit und Matrikelnummer.
05.04.2012 Statik- und Festigkeitslehre I Prüfungsklausur 2 WS 2011/12 Hinweise: Dauer der Klausur: Anzahl erreichbarer Punkte: 120 Minuten 60 Punkte Beschriften Sie bitte alle Seiten mit und Matrikelnummer.
Physik G8-Abitur 2011 Aufgabenteil Ph 11 LÖSUNG
 3 G8_Physik_2011_Ph11_Loe Seite 1 von 7 Ph 11-1 Physik G8-Abitur 2011 Aufgabenteil Ph 11 LÖSUNG 1) a) b) - - + + + c) In einem Homogenen elektrischen Feld nimmt das Potential in etwa linear. D.h. Es sinkt
3 G8_Physik_2011_Ph11_Loe Seite 1 von 7 Ph 11-1 Physik G8-Abitur 2011 Aufgabenteil Ph 11 LÖSUNG 1) a) b) - - + + + c) In einem Homogenen elektrischen Feld nimmt das Potential in etwa linear. D.h. Es sinkt
Statikbuch Charakteristische Werte Pitzl HVP Verbinder
 kompetent und leistungsstark Statikbuch Charakteristische Werte Pitzl HVP Verbinder einfach schnel l sichtbar oder ver deckt 1. Allgemeines Pitzl HVP Verbinder sind zweiteilige Verbinder für verdeckte
kompetent und leistungsstark Statikbuch Charakteristische Werte Pitzl HVP Verbinder einfach schnel l sichtbar oder ver deckt 1. Allgemeines Pitzl HVP Verbinder sind zweiteilige Verbinder für verdeckte
ERLÄUTERUNGEN ZUM KRAFTGRÖßENVERFAHREN An einem einfachen Beispiel soll hier das Prinzip des Kraftgrößenverfahrens erläutert werden.
 FACHBEREICH 0 BAUINGENIEURWESEN Arbeitsblätter ERLÄUTERUNGEN ZUM An einem einfachen Beispiel soll hier das Prinzip des Kraftgrößenverfahrens erläutert werden.. SYSTEM UND BELASTUNG q= 20 kn / m C 2 B 4
FACHBEREICH 0 BAUINGENIEURWESEN Arbeitsblätter ERLÄUTERUNGEN ZUM An einem einfachen Beispiel soll hier das Prinzip des Kraftgrößenverfahrens erläutert werden.. SYSTEM UND BELASTUNG q= 20 kn / m C 2 B 4
Beuth Hochschule für Technik Berlin
 Seite 1 nehmen die Lasten des Bauwerks auf und leiten sie in den Baugrund weiter. Die Bemessung und Konstruktion der wird sowohl von den Gebäudelasten als auch von den Eigenschaften des Baugrunds bestimmt.
Seite 1 nehmen die Lasten des Bauwerks auf und leiten sie in den Baugrund weiter. Die Bemessung und Konstruktion der wird sowohl von den Gebäudelasten als auch von den Eigenschaften des Baugrunds bestimmt.
Verteilte Filtergeschwindigkeitsmessung in Staudämmen
 354 Verteilte Filtergeschwindigkeitsmessung in Staudämmen Distributed Flow Velocity Measurement in Embankment Dams Sebastian Perzlmaier, Markus Aufleger Abstract In the scope of a DFG-funded (Deutsche
354 Verteilte Filtergeschwindigkeitsmessung in Staudämmen Distributed Flow Velocity Measurement in Embankment Dams Sebastian Perzlmaier, Markus Aufleger Abstract In the scope of a DFG-funded (Deutsche
Risikosimulationsrechnungen in der geotechnischen und baubetrieblichen Praxis
 Risikosimulationsrechnungen in der geotechnischen und baubetrieblichen Praxis Problemstellung Die größte Unsicherheit im Bereich der Geotechnik besteht in dem unzureichenden Wissen über die räumlich streuenden
Risikosimulationsrechnungen in der geotechnischen und baubetrieblichen Praxis Problemstellung Die größte Unsicherheit im Bereich der Geotechnik besteht in dem unzureichenden Wissen über die räumlich streuenden
Standsicherheit der Schwellen von Sicherheitstoren
 Standsicherheit der Schwellen von Sicherheitstoren Dipl.-Ing. Charlotte Laursen Bundesanstalt für Wasserbau, Abteilung Geotechnik 1 Einführung Im Oktober 2005 kam es im Bereich der Baustelle der neuen
Standsicherheit der Schwellen von Sicherheitstoren Dipl.-Ing. Charlotte Laursen Bundesanstalt für Wasserbau, Abteilung Geotechnik 1 Einführung Im Oktober 2005 kam es im Bereich der Baustelle der neuen
Kapitel VIII - Tests zum Niveau α
 Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel VIII - Tests zum Niveau α Induktive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller Hartwig Senska Carlo Siebenschuh Testsituationen
Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel VIII - Tests zum Niveau α Induktive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller Hartwig Senska Carlo Siebenschuh Testsituationen
Bauen im Bestand - Baugruben für den Neubau der Schleusen Münster
 Bauen im Bestand - Baugruben für den Neubau der Schleusen Münster Dr.-Ing. Markus Herten Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe, Abteilung Geotechnik 1 Einleitung Die Südstrecke des Dortmund-Ems-Kanals
Bauen im Bestand - Baugruben für den Neubau der Schleusen Münster Dr.-Ing. Markus Herten Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe, Abteilung Geotechnik 1 Einleitung Die Südstrecke des Dortmund-Ems-Kanals
2 Elektrischer Stromkreis
 2 Elektrischer Stromkreis 2.1 Aufbau des technischen Stromkreises Nach der Durcharbeitung dieses Kapitels haben Sie die Kompetenz... Stromkreise in äußere und innere Abschnitte einzuteilen und die Bedeutung
2 Elektrischer Stromkreis 2.1 Aufbau des technischen Stromkreises Nach der Durcharbeitung dieses Kapitels haben Sie die Kompetenz... Stromkreise in äußere und innere Abschnitte einzuteilen und die Bedeutung
Bemessung von Pfählen mit numerischen Verfahren
 Bemessung von Pfählen mit numerischen Verfahren BAW - DH / 2009-09 K1 Folie-Nr. 1 Bundesanstalt für Wasserbau Dienststelle Hamburg, Referat Geotechnik Nord Dipl.-Ing. Christian Puscher Gliederung - Warum
Bemessung von Pfählen mit numerischen Verfahren BAW - DH / 2009-09 K1 Folie-Nr. 1 Bundesanstalt für Wasserbau Dienststelle Hamburg, Referat Geotechnik Nord Dipl.-Ing. Christian Puscher Gliederung - Warum
Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung
 Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung Christoph Rosinski, Franz Josef Zapp GEFGA mbh, Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung von Geothermen
Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung Christoph Rosinski, Franz Josef Zapp GEFGA mbh, Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung von Geothermen
BÖSCHUNGEN UND BAUGRUBEN
 BÖSCHUNGEN UND BAUGRUBEN 20. Symposium Standsicherheit von Felsböschungen beim Lastfall schnelle Absenkung Dr.-Ing. René Sommer, Projektleiter, WBI Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende Ingenieure für Grundbau
BÖSCHUNGEN UND BAUGRUBEN 20. Symposium Standsicherheit von Felsböschungen beim Lastfall schnelle Absenkung Dr.-Ing. René Sommer, Projektleiter, WBI Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende Ingenieure für Grundbau
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
Überlegungen zur Leistung und zum Wirkungsgrad von Solarkochern
 Überlegungen zur Leistung und zum Wirkungsgrad von Solarkochern (Dr. Hartmut Ehmler) Einführung Die folgenden Überlegungen gelten ganz allgemein für Solarkocher, unabhängig ob es sich um einen Parabolkocher,
Überlegungen zur Leistung und zum Wirkungsgrad von Solarkochern (Dr. Hartmut Ehmler) Einführung Die folgenden Überlegungen gelten ganz allgemein für Solarkocher, unabhängig ob es sich um einen Parabolkocher,
EF Q1 Q2 Seite 1
 Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Stahlbau Grundlagen. Einführung. Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka
 Stahlbau Grundlagen Einführung Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Stahl hat Tradition und Zukunft Die Hohenzollernbrücke und das Dach des Kölner Doms sind beides Stahlkonstruktionen, die auch nach über 100 Jahren
Stahlbau Grundlagen Einführung Prof. Dr.-Ing. Uwe E. Dorka Stahl hat Tradition und Zukunft Die Hohenzollernbrücke und das Dach des Kölner Doms sind beides Stahlkonstruktionen, die auch nach über 100 Jahren
Berechnung des LOG-RANK-Tests bei Überlebenskurven
 Statistik 1 Berechnung des LOG-RANK-Tests bei Überlebenskurven Hans-Dieter Spies inventiv Health Germany GmbH Brandenburger Weg 3 60437 Frankfurt hd.spies@t-online.de Zusammenfassung Mit Hilfe von Überlebenskurven
Statistik 1 Berechnung des LOG-RANK-Tests bei Überlebenskurven Hans-Dieter Spies inventiv Health Germany GmbH Brandenburger Weg 3 60437 Frankfurt hd.spies@t-online.de Zusammenfassung Mit Hilfe von Überlebenskurven
ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen:
 Sehr geehrter Herr Reuter, ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen: Wie soll man den SGS beurteilen, was ist er in Ihren Augen?
Sehr geehrter Herr Reuter, ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und wir können unser kleines Interview starten, hier nun meine Fragen: Wie soll man den SGS beurteilen, was ist er in Ihren Augen?
Draufsicht - Aufprall auf Poller 1:50
 Draufsicht - Aufprall auf Poller Draufsicht - Aufprall auf Poller mit Schutzplanke VdTÜV-Merkblatt 965 Teil 2, Stand: 18.03.2011 Bild 1 - Poller, Zapfsäule vor dem Behälter Draufsicht Draufsicht VdTÜV-Merkblatt
Draufsicht - Aufprall auf Poller Draufsicht - Aufprall auf Poller mit Schutzplanke VdTÜV-Merkblatt 965 Teil 2, Stand: 18.03.2011 Bild 1 - Poller, Zapfsäule vor dem Behälter Draufsicht Draufsicht VdTÜV-Merkblatt
DISC. Verdeckter Scheibenverbinder Dreidimensionales Lochblech aus Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung DISC - 01 VERPACKUNG
 DISC Verdeckter Scheibenverbinder Dreidimensionales Lochblech aus Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung VERPACKUNG Montageschrauben und TX-Einsatz im Lieferumfang enthalten ANWENDUNGSBEREICHE Scherverbindungen
DISC Verdeckter Scheibenverbinder Dreidimensionales Lochblech aus Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung VERPACKUNG Montageschrauben und TX-Einsatz im Lieferumfang enthalten ANWENDUNGSBEREICHE Scherverbindungen
Syspro Allgemeines. Anpassung Syspro Handbuch an DIN EN mit NA(D) H+P Ingenieure GmbH & Co. KG Kackertstr.
 Syspro Allgemeines H+P Ingenieure GmbH & Co. KG Kackertstr. 10 52072 Aachen Tel. 02 41.44 50 30 Fax 02 41.44 50 329 www.huping.de Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger Dr.-Ing. Naceur Kerkeni Dr.-Ing. Wolfgang Roeser
Syspro Allgemeines H+P Ingenieure GmbH & Co. KG Kackertstr. 10 52072 Aachen Tel. 02 41.44 50 30 Fax 02 41.44 50 329 www.huping.de Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger Dr.-Ing. Naceur Kerkeni Dr.-Ing. Wolfgang Roeser
Mathematische und statistische Methoden II
 Statistik & Methodenlehre e e Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, Wallstr. 3 (Raum 06-206) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung und nach der Vorlesung. Mathematische und statistische Methoden II Dr. Malte
Statistik & Methodenlehre e e Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, Wallstr. 3 (Raum 06-206) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung und nach der Vorlesung. Mathematische und statistische Methoden II Dr. Malte
Bevölkerungsvorausschätzung für die Stadt Iserlohn für den Zeitraum 2007 bis 2022 Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse
 Bevölkerungsvorausschätzung für die Stadt Iserlohn für den Zeitraum 2007 bis 2022 Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse Vom 30.06.05 (Stichtag der vorhergehenden Prognose) bis zum 30.06.07 hat die
Bevölkerungsvorausschätzung für die Stadt Iserlohn für den Zeitraum 2007 bis 2022 Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse Vom 30.06.05 (Stichtag der vorhergehenden Prognose) bis zum 30.06.07 hat die
Vorkurs: Mathematik für Informatiker
 Vorkurs: Mathematik für Informatiker Teil 3 Wintersemester 2016/17 Steven Köhler mathe@stevenkoehler.de mathe.stevenkoehler.de 2 c 2016 Steven Köhler Wintersemester 2016/17 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Teil
Vorkurs: Mathematik für Informatiker Teil 3 Wintersemester 2016/17 Steven Köhler mathe@stevenkoehler.de mathe.stevenkoehler.de 2 c 2016 Steven Köhler Wintersemester 2016/17 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Teil
2.4 Frischbetondruck. 2.4 Frischbetondruck 33
 .4 dem Nachweis der Biegefestigkeit und der Berechnung der Durchbiegungen, die für den Nachweis der Ebenheitstoleranzen erforderlich sind. Darüber hinaus ist es für Lasteinleitungspunkte oft notwendig,
.4 dem Nachweis der Biegefestigkeit und der Berechnung der Durchbiegungen, die für den Nachweis der Ebenheitstoleranzen erforderlich sind. Darüber hinaus ist es für Lasteinleitungspunkte oft notwendig,
Aufgabe 1: Bemessung einer Stahlbeton-π-Platte (15 Punkte)
 Massivbau 1 Dauer: 120 Minuten Seite 1 Aufgabe 1: Bemessung einer Stahlbeton-π-Platte (15 Punkte) Für die unten dargestellte Stahlbeton-π-Platte ist eine Bemessung für Biegung und Querkraft für den Lastfall
Massivbau 1 Dauer: 120 Minuten Seite 1 Aufgabe 1: Bemessung einer Stahlbeton-π-Platte (15 Punkte) Für die unten dargestellte Stahlbeton-π-Platte ist eine Bemessung für Biegung und Querkraft für den Lastfall
Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität
![Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität Übung 5 : G = Wärmeflussdichte [Watt/m 2 ] c = spezifische Wärmekapazität k = Wärmeleitfähigkeit = *p*c = Wärmediffusität](/thumbs/26/9283097.jpg) Übung 5 : Theorie : In einem Boden finden immer Temperaturausgleichsprozesse statt. Der Wärmestrom läßt sich in eine vertikale und horizontale Komponente einteilen. Wir betrachten hier den Wärmestrom in
Übung 5 : Theorie : In einem Boden finden immer Temperaturausgleichsprozesse statt. Der Wärmestrom läßt sich in eine vertikale und horizontale Komponente einteilen. Wir betrachten hier den Wärmestrom in
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Rechenverfahren. DGfM. Schallschutz. SA2 Rechenverfahren Seite 1/7. Kennzeichnung und Bewertung der Luftschalldämmung
 Rechenverfahren Kennzeichnung und Bewertung der Luftschalldämmung von Bauteilen Zur allgemeinen Kennzeichnung der frequenzabhängigen Luftschalldämmung von Bauteilen mit einem Zahlenwert wird das bewertete
Rechenverfahren Kennzeichnung und Bewertung der Luftschalldämmung von Bauteilen Zur allgemeinen Kennzeichnung der frequenzabhängigen Luftschalldämmung von Bauteilen mit einem Zahlenwert wird das bewertete
Bachelorprüfung SS 2011 Massivbau I Freitag, den Uhr
 Hochschule München 1 Name:.. Fak. 02: Bauingenieurwesen Studiengruppe.. Bachelorprüfung SS 2011 Massivbau I Freitag, den 15.07.2011 12.15 14.15 Uhr Gesamt erreichbar ca. 95 Punkte (davon ca. 32 Punkte
Hochschule München 1 Name:.. Fak. 02: Bauingenieurwesen Studiengruppe.. Bachelorprüfung SS 2011 Massivbau I Freitag, den 15.07.2011 12.15 14.15 Uhr Gesamt erreichbar ca. 95 Punkte (davon ca. 32 Punkte
Grundlagen und Bedeutung von Baugrundgutachten
 Grundlagen und Bedeutung von Baugrundgutachten Dipl.-Ing. F. Eißfeldt, Referat Geotechnik Nord www.baw.de Gliederung: Motivation Normen Geotechnische Kategorien nach DIN 4020 Auftragskategorien der WSV
Grundlagen und Bedeutung von Baugrundgutachten Dipl.-Ing. F. Eißfeldt, Referat Geotechnik Nord www.baw.de Gliederung: Motivation Normen Geotechnische Kategorien nach DIN 4020 Auftragskategorien der WSV
Experiment Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die Sch experimentieren, was eine Eierschale alles aushält und üben mit den svorschlägen rund um das Ei. Ziel Die Sch verstehen den Aufbau der Eierschale und können
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die Sch experimentieren, was eine Eierschale alles aushält und üben mit den svorschlägen rund um das Ei. Ziel Die Sch verstehen den Aufbau der Eierschale und können
Bemessungshilfen für Architekten und Ingenieure
 Bemessungshilfen für Architekten und Ingenieure Vorbemessung von Decken und Unterzügen 1.Auflage Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Vorwort... 3 Haftungsausschluss... 3 Kontakt... 3 Literaturverzeichnis...
Bemessungshilfen für Architekten und Ingenieure Vorbemessung von Decken und Unterzügen 1.Auflage Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Vorwort... 3 Haftungsausschluss... 3 Kontakt... 3 Literaturverzeichnis...
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A
 Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A Warum die Diskussion über den JMF? EN 1434 legt für die zulässigen Messabweichungen fest: Seite 2 Grundsätzliche Überlegungen Messfehler / Messabweichung ist wichtig für
Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A Warum die Diskussion über den JMF? EN 1434 legt für die zulässigen Messabweichungen fest: Seite 2 Grundsätzliche Überlegungen Messfehler / Messabweichung ist wichtig für
A Teilsicherheitskonzept nach EC 7-1
 Studienunterlagen Geotechnik Seite A-1 A Teilsicherheitskonzept nach EC 7-1 1 Einführung Mit der Einführung des Eurocode 7 (EC 7-1) Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1 Allgemeine
Studienunterlagen Geotechnik Seite A-1 A Teilsicherheitskonzept nach EC 7-1 1 Einführung Mit der Einführung des Eurocode 7 (EC 7-1) Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1 Allgemeine
Konfidenzintervalle Grundlegendes Prinzip Erwartungswert Bekannte Varianz Unbekannte Varianz Anteilswert Differenzen von Erwartungswert Anteilswert
 Konfidenzintervalle Grundlegendes Prinzip Erwartungswert Bekannte Varianz Unbekannte Varianz Anteilswert Differenzen von Erwartungswert Anteilswert Beispiel für Konfidenzintervall Im Prinzip haben wir
Konfidenzintervalle Grundlegendes Prinzip Erwartungswert Bekannte Varianz Unbekannte Varianz Anteilswert Differenzen von Erwartungswert Anteilswert Beispiel für Konfidenzintervall Im Prinzip haben wir
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen
 Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Schlusswort Einen wissenschaftlichen Text kann man schließen: mit einem Fazit (nach jedem größeren Kapitel des Hauptteils oder nur nach dem ganzen Hauptteil); mit Schlussfolgerungen; mit einem Fazit und
Glasschaumgranulat Dämmmaterial unter lastabtragenden Bauteilen
 Titel der Arbeitsgruppe, wird vom PHI eingefügt. ARBEITSGRUPPE XX Glasschaumgranulat Dämmmaterial unter lastabtragenden Bauteilen Universität Innsbruck / Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften
Titel der Arbeitsgruppe, wird vom PHI eingefügt. ARBEITSGRUPPE XX Glasschaumgranulat Dämmmaterial unter lastabtragenden Bauteilen Universität Innsbruck / Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften
Statische Berechnung
 Ing.-Büro Klimpel Stapel - Gitterbox - Paletten Seite: 1 Statische Berechnung Tragwerk: Stapel - Gitterbox - Paletten Rack 0,85 m * 1,24 m Herstellung: Scafom International BV Aufstellung: Ing.-Büro Klimpel
Ing.-Büro Klimpel Stapel - Gitterbox - Paletten Seite: 1 Statische Berechnung Tragwerk: Stapel - Gitterbox - Paletten Rack 0,85 m * 1,24 m Herstellung: Scafom International BV Aufstellung: Ing.-Büro Klimpel
Bachelorarbeit. Das Ersatzstabverfahren nach Eurocode 3. Vereinfachungsmöglichkeiten
 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Bauingenieurwesen Fachgebiet Stahlbau Prof. Dr.-Ing. Othmar Springer Sommersemester 2014 Das Ersatzstabverfahren nach Eurocode 3 Regensburg, 30.Juni
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Bauingenieurwesen Fachgebiet Stahlbau Prof. Dr.-Ing. Othmar Springer Sommersemester 2014 Das Ersatzstabverfahren nach Eurocode 3 Regensburg, 30.Juni
