Schadschnecken Biologie, Arten und Bekämpfung
|
|
|
- Heiko Bäcker
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Schadschnecken Biologie, Arten und Bekämpfung
2 Medien rund um Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung Click Click! einfach einkaufen aid-medienshop.de unabhängig praxisorientiert wissenschaftlich fundiert
3 INHALT 1. EINLEITUNG SYSTEMATIK Gehäuseschnecken Nacktschnecken SCHNECKEN IM ÖKOSYSTEM BIOLOGIE Fortbewegung Nahrungsaufnahme Fortpflanzung Lebenszyklus Unterscheidungsmerkmale SCHÄDIGENDE ARTEN Herkunft der Schadschnecken Schadschnecken in Haus- und Kleingärten Arion-Arten Agriolimacidae-Arten Limacidae-Arten Boettgerillidae-Art Milacidae-Arten Gehäuseschnecken-Arten Schadschnecken im Gewächshaus Limacidae-Art Agriolimacidae-Arten Gehäuseschnecken-Arten Schadschnecken im Acker- und Gemüsebau NATÜRLICHE FEINDE Igel Vögel Gliederfüßer (Arthropoden) Laufkäfer (Carabidae) Leuchtkäfer (Lampyridae) Schneckenräu ber (Drilidae) Aaskäfer (Silphidae) Hornfliegen (Sciomycidae) BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN Schneckenbekämpfung in Haus- und Kleingärten Vorbeugende Maßnahmen Ansiedlung und Förderung natürlicher Feinde Resistente Pflanzenarten Mechanische Barrieren Gezieltes Gießen Eigelege entfernen Der richtige Platz für den Komposthaufen Maßnahmen zur direkten Bekämpfung Biologische und bio mechanische Maßnahmen Einsatz natürlicher Feinde Anlocken und Absammeln der Schnecken Einsatz von mollusken pathogenen Nematoden Chemische Nacktschneckenbekämpfung Metaldehyd Methiocarb Eisen-III-Phosphat Kombinationen verschiedener Bekämpfungsmethoden Alternative Mittel zur Bekämpfung Schneckenbekämpfung im Acker- und Gemüsebau Vorbeugende Maßnah men im Gemüsebau Vorbeugende Maßnah men im Ackerbau Chemische Bekämpfung im Ackerund Gemüse bau Glossar...56 aid-medien
4 11. EINLEITUNG In Deutschlands Gärten haben Schnecken wegen der Schäden, die sie an Kulturpflanzen anrichten, einen schlechten Ruf. Es lohnt sich jedoch, genauer hinzuschauen und mehr von den Überlebensstrategien dieser interessanten Tiergruppe zu erfahren nicht zuletzt, um sie besser aus dem Garten fernhalten zu können. Schnecken besiedeln Haus- und Kleingärten ebenso wie weitläufige, maschinell bewirtschaftete Agrarflächen und richten in vielen Beständen beträchtliche Schäden an. Durch ihre bodennahe, verborgene Lebensweise können sie bereits unterirdisch wachsende Sämlinge zerstören. Wenn sie den Spross oder die Vegetationspunkte befressen, sterben junge Pflanzen oft ganz ab. Beim Zerstören der Blattfläche mindern sie den Ertrag durch den Fraßschaden, aber auch Deformation, Fäulnis, Verunreinigung mit Schleim und Kotresten können Folgen des Schneckenbefalls sein und die Ernte entwerten. Von Schnecken befallene Erdbeeren können nicht mehr vermarktet werden. Die meisten heimischen Arten sind an bestimmte Lebensräume gebunden und leben in Wäldern, Sümpfen oder an Trockenhängen. Besonders interessant sind jedoch die Arten, die ohne weiteres in vom Menschen stark beeinflussten Lebensräumen zurechtkommen. Welche Eigenschaften in Körperbau und Verhalten zeichnen sie aus? Wie konnten sie im Laufe der Evolution Wurzelgemüse ist bei unterirdisch lebenden Nacktschneckenarten wie Arion distinctus beliebt. 4
5 1 EINLEITUNG Kohlrabi nach Schneckenfraß Schleim und Kotreste neben der Fraßstelle sind Spuren, die auf Schnecken schliessen lassen. entstehen? Und warum sind eigentlich gerade Nacktschnecken in den gemäßigten Breiten Europas so zahlreich? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen der folgende Text zum Thema Schadschnecken Biologie, Arten und Bekämpfung. Hier finden Sie auch Informationen darüber, wie Schnecken den Winter verbringen und ob sie ein Liebesleben haben. Der Fokus liegt zunächst auf den Arten und der Biologie der Schadschnecken, um Ansatzpunkte für die Bekämpfung zu verdeutlichen. Im Anschluss werden erprobte und praxisgerechte Maßnahmen zur Schneckenreduktion vorgestellt, die bedarfsgerecht angewandt werden können. Werden die Vegetationspunkte befressen, können die Pflanzen kaum noch wachsen. Jüngere Pflanzen sterben meist ab. Auch im Zierpflanzenbau können Schnecken zu Verlusten durch Fraß und Schleimreste führen. 5
6 2 2. SYSTEMATIK Schnecken gehören zusammen mit Tintenfischen und Muscheln zu den Weichtieren (Mollusca). Mit ihrem Artenreichtum stellen Weichtiere nach den Gliedertieren den zweitgrößten Stamm im Tierreich dar. Die meisten Weichtiere kommen im Meer vor. Die einzigen heute an Land lebenden Vertreter sind die Schnecken (Gastropoda). Die Landbesiedlung erfolgte hauptsächlich durch Schnecken, bei denen durch eine Manteleinfaltung eine primitive Lunge gebildet wurde. Die landbewohnenden Lungenschnecken erkennt man an den zwei Paaren einstülpbarer Tentakel am Kopf, von denen das obere Paar an der Spitze mit Augen ausgestattet ist. Atemöffnung Mündung der Sohlendrüse Mundlappen Obere Tentakel mit Auge Untere Tentakel Landlungenschnecken besitzen zwei Paar Tentakel. Während sich Meeresschnecken in vielen Fällen räuberisch ernähren, leben die meisten Lungenschnecken von Pflanzenresten, die sich bereits im Zerfall befinden. Landbewohnende Schnecken besitzen jedoch noch grundlegende gemeinsame Merkmale mit ihren im Meer lebenden Vorfahren: Der weiche Körper besteht aus einem Kopf mit Tentakeln und Augen, einem abgeflachten, muskulären Fuß und einem Eingeweide sack, der zumindest teilweise vom so genannten Mantel bedeckt ist. Ein weiteres Merkmal der Schnecken ist ihr äußerer asymmetrischer Körperbau. Bei den Lungenschnecken münden Geschlechtswege und Darm auf der rechten Körperseite unterhalb der Atemöffnung. Nur Kopf und Fuß sind bilateral symmetrisch gebaut. 2.1 Gehäuseschnecken Bei den Gehäuseschnecken ist der Eingeweidesack meist verdreht und typischerweise von einer kalkigen Schale dem Gehäuse bedeckt. Es kann den Körper ganz oder teilweise aufnehmen. Es ist zwar ein lebloses Gebilde, wird aber von der Schnecke selbst hergestellt. Das Gehäuse hat zwei wichtige Funktionen: Es schützt die Schnecke vor Austrocknung und vor Fraßfeinden. Die Schale wächst vom Mantelrand aus, wo eine Reihe von Drüsen sitzt. Die Schale nimmt außerdem durch Abscheidungen der Epithelzellen des Mantels an Dicke zu. Die einzige feste Verbindung zwischen Weichkörper und Schale besteht an der Gehäusespitze über den Spindelmuskel, ansonsten liegt die Schale dem Weichkörper frei auf. Der Spindelmuskel durchzieht von der Gehäusespitze ausgehend strahlenförmig den gesamten Körper und teilt sich am Ende in mehrere Stränge, nämlich in den Tentakel-, Schlund- und Fußretraktor. Er dient zum Zurückziehen des Tieres in die Schale. Zum Ausstülpen presst die Gehäuseschnecke mit Muskelkraft Hämolymphe in den Fuß. Hier befindet sich Schwellgewebe, das allein durch die Kapillarität große Mengen Hämolymphe aufnimmt und den Fuß nach 6
7 2 SYSTEMATIK außen quellen lässt, sobald beim Tier bestimmte Muskelsysteme erschlaffen. Trotz der starken Abhängigkeit von Feuchtigkeit schaffen es manche Gehäuseschnecken, auch extrem trockene Biotope zu besiedeln. Ein gemeinsames Kennzeichen dieser Arten sind helle Gehäuse zur Refle xion der Wärmestrahlung mit großer Wandstärke. Dazu kommt die Fähigkeit, der unmittelbar am Boden herrschenden größten Hitze zu entgehen. Hierfür heften sie sich entweder in einiger Höhe an Pflanzenstängel und bilden einen dünnen Schutzdeckel aus, oder sie graben sich in den Boden ein. 2.2 Nacktschnecken Nacktschnecken sind dem Klima scheinbar schutzlos ausgeliefert. Sie besitzen jedoch Verhaltensprogramme, die eine versteckte Lebensweise steuern. Aus diesem Grund benötigen sie kein Gehäuse. Bei Trockenheit suchen sie feuchte Verstecke auf oder ziehen sich in kleinste Bodenspalten zurück, in die sie mit einem Gehäuse nicht eindringen könnten. Unter den in Mitteleuropa herrschenden feuchteren Witterungsbedingungen treten daher Nacktschnecken als Schädlinge in Erscheinung, während in den trockeneren Ländern Südeuropas eher Gehäuseschnecken Schäden verursachen. Gehäuseschnecken im Trockenschlaf : Die Schnecken heften sich in einiger Höhe zum Beispiel an Pflanzenstängel. Nacktschnecken suchen bei Trockenheit feuchte Verstecke auf oder ziehen sich in Hohlräume im Boden zurück. Zum Schutz vor Austrocknung zieht sich die Weinbergschnecke Helix pomatia in ihr Gehäuse zurück und ver schließt die Mündung mit einer Membran aus getrocknetem Schleim. Nacktschnecken bestehen zu 80 bis 90 Prozent ihres Lebendgewichts aus Wasser und besitzen keinen wasserdichten Schutzbehälter wie die Gehäuseschnecken. Es kommt daher gerade bei ihnen zu einem kontinuierlichen Wasserverlust, sobald die relative Luftfeuchtigkeit bei 20 Celsius unter 99,5 Prozent fällt. Um das ständig drohende Austrocknen der empfindlichen Haut zu verhindern, wird aus den Schleimdrüsen kontinuierlich ein Schleimfilm mit hohem Wassergehalt abgeschieden und über Furchen auf 7
8 der gesamten Körperoberfläche verteilt. Die Schleimzellen sitzen so dicht, dass das Wasser nicht direkt auf der Haut, sondern über der als Puffer wirkenden Schleimschicht verdunstet. Beim Schleim handelt es sich um ein organisches Hydrogel, das beim Austreten aus den Drüsen quillt, und zwar unter Aufnahme von Wasser aus der Umgebung. Das Hydrogel kann das Zweieinhalbfache seines Gewichts an Wasser aufnehmen. Durch ein System aus Furchen wird der Schleim auf dem Körper verteilt und die Körperoberfläche feucht gehalten. Nacktschnecken stammen von gehäusetragenden Vorfahren ab. Da landbewohnende Nacktschneckenarten sehr häufig sind, stellt sich die Frage, wie es im Laufe der Evolution zur Rückentwicklung des Gehäuses kommen konnte. Seinen Vorteil als Schutzraum verliert das Gehäuse offenbar in feuchten, warmen Lebensräumen. Man trifft in feuchten Lebensräumen häufig Arten an, bei denen das Gehäuse in Rückbildung begriffen und bereits ganz oder teilweise vom Mantel überwachsen ist. Im Kampf ums Überleben haben hier vermutlich die Nachteile des Gehäuses überwogen: Die Schnecke musste mehr Ener gie für den Aufbau und die Erhaltung des Gehäuses aufbringen und sein Gewicht stellte einen unnötigen Ballast dar. Heute gibt es Nacktschnecken unterschiedlichster Verwandtschaftsgruppen, bei denen oft nur noch kleine Kalkkörnchen als Gehäuserest unter dem Mantel vorhanden sind. Nacktschnecken haben zwangsläufig eine andere innere Anatomie als Gehäuseschnecken. Eine Gehäuseschnecke verlässt ihre Schale nur mit dem Fuß. Ein großer Teil des Körpers, der die Organe des Eingeweidesacks umfasst, bleibt ständig geschützt im Inneren des Gehäuses. Bei Nacktschnecken sind die ursprünglich im Gehäuse verborgenen Organe in den Kopf- und Fußraum verlagert. An der entsprechenden Stelle, an der sonst das Gehäuse wäre (hinter dem Kopf), ist der Körper von einem Rest des ehemaligen Mantels bedeckt, dem so genannten Mantelschild. Anhand des Mantelschilds können die einheimischen Nacktschnecken grob bestimmten Familien zugeordnet werden. Als Merkmal eignet sich die Anordnung der Atemöffnung, die entweder vor der Mitte oder hinter der Mitte des Mantelschilds liegt. Schale Fuß mit Kriechsohle Schale unter der Haut: Schalenrest Mantelrand Mantelschild Die Entstehung des Mantelschilds bei Nacktschnecken 8
9 3 3. SCHNECKEN IM ÖKOSYSTEM Gartenbesitzer kennen Schnecken in erster Linie als Pflanzenschädlinge. Die meisten der bei uns in Deutschland lebenden, oft sehr kleinen Arten ernähren sich jedoch von Moder. Ohne gezielt nach ihnen zu suchen, bekommt man die Kleinschnecken allerdings nicht zu Gesicht, denn sie führen in der Laubstreu ein verborgenes Leben. Größere waldbewohnende Arten, wie beispielsweise der 6 cm lange Pilzschnegel (Malacolimax tenellus), sind mobiler und verlassen die Streuschicht gelegentlich zur Nahrungssuche. Wie viele Arten an einem Standort leben, hängt von bestimmten Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit und Kalkversorgung des Bodens ab. Im Allgemeinen leben in Deutschlands Laubwäldern auf einem Quadratmeter bis zu 50 Individuen von durchschnittlich 10 Arten. Im Extremfall können auf einem Quadratmeter eines kalkreichen Waldbodens bis zu 30 Arten mit insgesamt mehr als 2000 lebenden Individuen vorkommen. Standorte auf kalkarmem Untergrund werden von Schnecken dagegen weitgehend gemieden. Der Pilzschnegel Malacolimax tenellus Die Weinbergschnecke Helix pomatia ist wie die Gefleckte Weinbergschnecke gesetzlich geschützt. Die heimischen Schnecken spielen eine wichtige Rolle als Zersetzer von Pflanzenresten; in Wäldern nehmen sie beispielsweise etwa 1 Prozent der in jedem Jahr anfallenden Laubstreu auf. Sie sind in ein komplexes Gefüge von Nahrungsbeziehungen im Ökosystem eingebunden und dienen hier als Beute. Durch ihre Anwesenheit fördern sie eine ganze Reihe anderer Organismen. Die winzige Felsen-Pyramidenschnecke Pyramidula pusilla kommt hauptsächlich in Gebieten mit Kalkstein vor. 9
10 In intakten Ökosystemen stellt sich ein Räuber-Beute-Gleichgewicht ein. Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen besteht dieses Gleichgewicht ebenfalls, es ist jedoch stark zugunsten der Schadschnecken verschoben und erscheint somit für den Menschen als Ungleichgewicht. Eine Feinddichte, mit der die Schneckendichte wirksam kontrolliert wird, kann hier allerdings nur schwer erreicht werden, da die Schneckenfeinde hier meist keine günstigen Lebensbedingungen vorfinden. Je strukturreicher ein Lebensraum dagegen ist, desto größer ist die Anzahl der dort lebenden schneckenfressenden Gegenspieler. Einige Schneckenarten in Deutschland sind in ihrem Bestand gefährdet und werden daher auf Roten Listen der einzelnen Bundesländer als vom Aussterben bedroht eingestuft. Diese Einstufung dient als Entscheidungshilfe bei bevorstehender Biotopzerstörung, zum Beispiel durch Baumaßnahmen. Unter Naturschutz und damit Individuenschutz steht keine der kleineren einheimischen Landschneckenarten. Die einzigen Landschneckenarten, die nach der Bundesartenschutzverordnung gesetzlichen Schutz genießen, sind die Weinbergschnecken Helix pomatia und Cornu aspersum. Der Grund: Helix pomatia hat eine wirtschaftliche Bedeutung als Nahrungsmittel. Die Gefleckte Weinbergschnecke Cornu aspersum gehört nicht zur einheimischen Fauna und kommt bei uns nur sporadisch vor. Zu einem bestimmten, nach der jeweiligen Landesartenschutzverordnung variierenden Zeitpunkt darf Helix pomatia landkreisweise gesammelt werden. Mithilfe dieser Einschränkung will der Gesetzgeber verhindern, dass die Weinbergschnecke durch jährliches Sammeln ausgelöscht wird und nicht mehr als Nahrungsmittel zur Verfügung steht. Die Vernichtung einer Weinbergschneckenpopulation durch das jährliche Sammeln ist auf Grund der mehrjährigen Lebenserwartung dieser Art durchaus möglich. Da die jeweils größten also die einzigen fortpflanzungsfähigen Tiere abgesammelt werden, bleibt der Nachwuchs aus. Bei einer einjährigen Art würde nur das Absammeln aller Tiere die Population dezimieren. Sowohl die Weinbergschnecke Helix pomatia als auch die Schnirkel- oder Bänderschnecken Cepaea hortensis und C. nemoralis werden in den Roten Listen in der niedrigsten Kategorie unter nicht bedroht geführt. Die Gefleckte Weinbergschnecke Cornu aspersum gehört nicht zur einheimischen Fauna und kommt in Deutschland nur sporadisch in Gärten oder Parkanlagen vor. Sie ist nicht schädlich. 10
11 4 4. BIOLOGIE Obwohl Schnecken ein relativ einfach gebautes Nervensystem besitzen, reicht die Organisation der Nervenknoten aus, um komplexe Verhaltensmuster zu steuern. Dazu zählen zum Beispiel die Fortbewegung, Angriffs- und Fluchtreaktionen sowie die Paarung. Die Nahrungsaufnahme gehört nicht zu den komplexen Verhaltensmustern, da sie nach einer Prüfung der Nahrung mit stereotypen Bewegungen erfolgt. Die Fortbewegung ist wesentlich komplexer, da sich die Schnecke ständig in einer veränderlichen Umwelt orientieren muss. Bei der Fortbewegung verliert die Schnecke durch die Schleimproduktion viel mehr Wasser als zum Beispiel durch Verdunstung. Selbst bei gesättigter Luft können die Wasserverluste so hoch sein, dass eine kriechende Schnecke nach 40 Minuten Bewegung rund 17 Prozent weniger wiegt. Die Verluste müssen durch Trinken wieder ausgeglichen werden. Bereits Wasserverluste von mehr als 40 Prozent des anfänglichen Körpergewichts führen meist zum Tod. 4.1 Fortbewegung Schnecken bewegen sich mithilfe ihrer abgeplatteten Kriechsohle fort. Durch Kontraktionen der Fußmuskeln, die in wellenartigen Bewegungen von hinten nach vorne laufen, schiebt sich das Tier nach vorne. Die Kriechsohle hat dabei nie direkten Kontakt mit dem Untergrund, da die Schnecke ein Schleimband produziert, auf dem sie wie auf einer selbst gebauten Straße dahingleitet. Der Schleim wird aus einem Drüsenkanal ausgeschieden, der unterhalb des Kopfes mündet und aus vielen Einzeldrüsen besteht. Er ermöglicht, dass die Schnecke auf dem Untergrund haftet und dass die Muskelkräfte des Sohlengewebes auf den Untergrund übertragen werden. Darüber hinaus gleicht er Unebenheiten des Bodens aus. Der Schleim ist für die Fortbewegung unbedingt notwendig: Wird die Sohlendrüse entfernt, bewegt sich die Schnecke wie eine Spannerraupe, jedoch völlig unkoordiniert. Auf trockenen Wegen ist der Wasservorrat einer Nacktschnecke schnell verbraucht. Bei der Schneckenabwehr macht man sich diesen Umstand durch Schutzstreifen aus trockenem Sägemehl oder Ähnlichem zu Nutze. Das Material saugt Wasser auf und bietet wenig Haftmöglichkeit für den Schneckenschleim. Derselbe Effekt scheint dafür verantwortlich zu sein, dass man auf Sandböden nur wenige Nacktschnecken antrifft. Landschnecken haben sich spezielle Verhaltensweisen angeeignet, um Wasserverluste zu kompensieren. Neben dem Trinken sind sie in der Lage, Wasser durch die Fußsohle 11
12 Die Genetzte Ackerschnecke Deroceras reticulatum nimmt in taubenetztem Gras Wasser auf. aufzunehmen. Dazu suchen sie eine feuchte Stelle auf, an der sie über mehrere Stunden verbleiben und ihren Fuß ausbreiten. Das Wasser wird dabei entlang der Zellzwischenräume der Fußepithelzellen ins Körperinnere transportiert. Die Schleimproduktion bedeutet für eine Schnecke auch, dass sie bei der Fortbewegung enorm viel Energie verbraucht. Das Kriechen der Landschnecken ist die energetisch aufwändigste Form der Fortbewegung im ganzen Tierreich. Landlungenschnecken sind jedoch in der Lage, ihre Nahrung mithilfe einer für Pflanzenfresser ungewöhnlich hohen Effizienz zu verwerten. Selbst Zellulose wird von den Allesfressern verdaut. Durch einen Darm, der doppelt so lang ist wie ihr Körper, und eine vielseitige Ausstattung mit Enzymen gelingt es einer Schnecke, rund 70 Prozent der Energie aus der aufgenommenen Nahrung zu verwerten. Diese Energie wird einerseits bei Stoffwechselvorgängen veratmet, andererseits für die Schleimproduktion benötigt. Schnecken können vermutlich nicht gut sehen, aber einfache Gegenstände wahrnehmen und in verschiedene Richtungen schauen. Bei den Augen, die jeweils am Ende der großen Tentakel sitzen, handelt es sich um einfach gebaute Blasenaugen, die mit einer Linse ausgestattet sind. Im Gegensatz zu den Wirbeltieren ist die Retina im Laufe der Evolution durch ein Einstülpen der Haut entstanden, die Linse durch Abscheidungen der angrenzenden Zellschichten. Die Linse bietet keine Möglichkeit zur veränderlichen Scharfeinstellung. Da das Auge und die Rezeptorplatten eher klein sind, ist auch die optische Leistung gering und die Erfassung von Informationen beschränkt. Alle heimischen schädlichen Schneckenarten scheinen Nachttiere zu sein. Besonders bei Trockenheit kommen die Tiere nur nachts, wenn die Pflanzen taufeucht sind, aus ihren Verstecken. Bei Regenwetter ist die Periodik weniger ausgeprägt und die Quartiere werden auch tagsüber zum Fressen verlassen. 4.2 Nahrungsaufnahme Als Generalisten steht Schnecken ein breites Nahrungsangebot zur Verfügung. Sie bevorzugen jedoch deutlich bestimmte Nahrungsquellen. Sie müssen sowohl den Nährwert einer Nahrungsquelle als auch ihre mögliche Giftigkeit abschätzen. Auch schädigende Arten bevorzugen vermodernde Pflanzenreste neben Algen, Pilzen, Flechten und Aas. Diese besitzen meist eine fraßstimulierende Wirkung, sodass Landlungenschnecken sie in den seltensten Fällen verschmähen. In menschlich geprägten Lebensräumen, wie Gärten oder landwirtschaftlich genutz ten 12
13 4 BIOLOGIE Auch inmitten grüner Pflanzen fressen Schnecken selektiv. Nacktschnecken lieben Pflanzen mit weichen Blättern, zum Beispiel Salat. Flächen, werden vermodernde Pflan zenreste jedoch kaum geduldet. Lebende Pflanzen bilden daher allein auf Grund ihrer Häufigkeit einen großen Anteil an der Nahrung. Schnecken fressen nicht kontinuierlich, sondern nehmen jede Nacht einzelne Mahlzeiten zu sich, die jeweils höchstens eine Stunde dauern. Zwischen den Mahlzeiten erkundet die Schnecke ihre nähere Umgebung. Die Entscheidung, an welcher Pflanze sie frisst, hängt von deren Gehalt giftiger Pflanzeninhaltsstoffe sowie ihrer Gewebsstruktur ab. Viele Pflanzen enthalten eine Fülle spezifischer Substanzen, welche auf Pflanzenfresser abschreckend wirken. Unter diesen so genannten sekundären Pflanzenstoffen befinden sich viele giftige und solche, die den Verdauungsstoffwechsel stören und die Nährstoffgewinnung aus der Nahrung beeinträchtigen. Kulturpflanzen sind folglich für Schnecken besonders attraktiv. Sie besitzen oft einen niedrigen, durch Züchtung reduzierten Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen und einen hohen Anteil an jungem, saftigem Gewebe. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die verschiedenen Kohlsorten, Salat und Bohnen zu den am stärksten von Schnecken bedrohten Kulturen gehören. Die Schnecke prüft zudem die Oberfläche und den Wassergehalt der Nahrung. Zusätzlich nimmt sie mit ihren oberen Tentakeln den Geruch besonders stark duftender Nah - rung auf eine Distanz von bis zu 40 cm wahr. In Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei Pilzen im Wald oder Bierfallen in Gärten, kann die Lockwirkung über mehrere Meter funktionieren. Die attraktiv wirkenden, leicht flüchtigen Komponenten werden in der bodennahen Luftschicht verbreitet und führen offenbar je nach Kon stanz der Windrichtung zu einer gerichteten Wanderungsbewegung. Wird eine Schnecke vom Geruch angelockt, kriecht sie heran, berührt zunächst die Oberfläche der Nahrungsquelle mit den oberen und unteren Tentakeln und erkundet sie dann geschmacklich: Sie presst ihre Mundlappen, die wie ein drittes Tentakelpaar seitlich der Mundöffnung hervortreten, auf die Nahrung. Erst wenn die dort konzentrierten Geschmacksrezeptoren eine schmackhafte Nahrung melden, werden 13
14 mit dem Radula- und Kieferapparat Stücke abgebissen und im Mundraum erneut geschmacklich geprüft. Fällt die Prüfung negativ aus, wandert die Schnecke weiter. Schnecken sind erstaunlich lernfähig und können sich die Eigenschaften einer ungeeigneten Nahrungsquelle wahrscheinlich wochenlang merken. Daher sind sie bei der Nahrungssuche sehr effektiv. Die Idee, so genannte Ablenkpflanzen für Schnecken einzusetzen, besteht darin, den Schnecken Pflanzen anzubieten, die sie bevorzugt fressen und die sie von der Hauptkultur ablenken sollen. Diese Aufgabe erfüllen bereits im Feld vorhandene Unkräuter im gewissen Maße, allerdings sind diese oft weniger schmackhaft und konkurrieren mit den Kulturpflanzen um Wasser, Licht und Nährstoffe. Aufgrund von Versuchsergebnissen weiß man, dass bestimmte Unkräuter Rapspflanzen bei niedriger Schneckendichte durchaus vor starkem Fraß schützen können. Bei hoher Schneckendichte dagegen sinken die Überlebenschancen der Rapspflanzen trotz der Unkräuter. Ablenkpflanzen können gezielt eingesetzt werden, wenn sich die Kulturpflanzen in den empfindlichen frühen Wachstumsstadien befinden. Besonders in anfälligen Kulturen sollte man allerdings darauf achten, dass Ablenkpflanzen und Unkräuter keine Versteckmöglichkeiten in Pflanzennähe bieten. Je weiter die Tagesverstecke weg sind, desto unwahrscheinlicher wird die massenhafte Einwanderung. Wie viel eine Schnecke frisst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt Berichte, wonach in 24 Stunden 10 bis 40 Prozent des Körpergewichts an Salat gefressen wurden. Zur Nahrungsaufnahme sind Landlungenschnecken mit einer knorpelartigen, beweglichen Zunge und einem festsitzenden Kiefer ausgestattet. Der Kiefer besteht aus einer festen sklerotisierten Platte mit Querleisten. Je nach Beschaffenheit der Nahrung können zwei unterschiedliche Fraßtechniken zum Einsatz kommen. Die Zunge kann nach oben bewegt werden, Nahrungsstücke gegen den Kiefer drücken und anschließend abtrennen. Dieser Vorgang ist beim Fressen von Blättern von Bedeutung. Damit können beachtlich große Stücke abgebissen und ohne weitere Zerkleinerung in den Vorderdarm befördert werden. Kriechsohle Nahrungsstücke Zungenknorpel Mundöffnung Sohlendrüsenkanal Der Radula-Apparat einer Landschnecke Radula Verdauungstrakt Kiefer Nahrung Daneben können Schnecken auch dünne, filmartige Nahrungsschichten sehr effizient abweiden. Über die Zunge ist eine feine Membran gespannt, die so genannte Radula, auf der mehrere tausend nach hinten gerichtete Chitinzähnchen in Reihen angeordnet sind. Während sich die Zunge in Richtung des Kiefers schiebt, wird die bewegliche Radula in einer komplizierten Bewegung wie bei einem 14
15 4 BIOLOGIE Schaufelrad über die Nahrungsschicht geführt. Damit kratzen Schnecken dünne, nährstoffreiche Oberflächenbeläge wie Algen oder Flechten ab und erschließen sich so eine zusätzliche Nahrungsquelle. Beim Abweiden schwenken sie den Kopf mit dem Fressapparat langsam hin und her, so dass oft auffällige, schlangenlinienförmige Fraßspuren entstehen. Der Radulaapparat bewegt sich mithilfe einer komplizierten Muskulatur. Die Nahrung wird mit einer Zungenbewegung in den vorderen Teil des Magens geschaufelt. In einem großen, lang gestreckten Blindsack beginnen Verdauung und Resorption der zerkleinerten Nahrung. In das Ende des Blindsacks münden die Ausführgänge der Mitteldarmdrüse, die aus zwei Hauptlappen besteht. Die Mitteldarmdrüse ist traubenförmig zusammengesetzt und füllt einen Großteil des Eingeweidesacks aus. Sie gibt Verdauungssekrete ab und resorbiert die im Magensaft gelösten Nährstoffe. Dies geschieht, indem der flüssige Mageninhalt wiederholt vom Magen in die Drüsengänge und Alveolen der Drüse einströmt und in den Magen zurückkehrt. Zusätzlich dient die Der Verdauungstrakt einer Nacktschnecke Mitteldarmdrüse auch zur Speicherung von Nährstoffen. Die nicht verdaulichen Reste werden schließlich in die Abzweigung zum Mitteldarm gepresst. An den Mitteldarmdrüsenlappen vorbei verläuft der Mitteldarm in einer Schlinge, bis er als Enddarm neben das Atemloch führt, wo er als After mündet. In Mittel- und Enddarm werden die unverdaulichen Nahrungsreste zu Kotballen geformt. 4.3 Fortpflanzung Afteröffnung Atemöffnung Mundöffnung Schnecken sind Zwitter. Eine Besonderheit im Tierreich ist das Vorhandensein von nur einer einzigen Gonade, die sowohl Sper mien als auch Eizellen produziert. Bei Landlungenschnecken differenziert sich der Ausführgang dieser so genannten Haben Schnecken Blut? Das Blut der Schnecken enthält einen Sauerstoff bindenden Blutfarbstoff, das Hämocyanin, wodurch es bläulich erscheint. Die Bindung des Sauerstoffs übernehmen jeweils zwei Kupfer atome pro Molekül- Untereinheit. Bei Landschnecken wird die blaue Farbe oft durch andere Pigmente überdeckt. Das Blut erhält den Sauerstoff in der lungenartigen Atemhöhle. Durch dünne Wände hindurch nimmt das in den Lungengefäßen strömende Blut den Sauerstoff aus der Atemhöhle auf und gibt Kohlendioxid ab. Aus dem Herzen wird das Blut über die wenigen vorhandenen Gefäße in die Hauptorgane gepumpt. Da es kein Kapillarsystem gibt, zirkuliert das Blut frei in den Körperzwischenräumen. Das Blut erfüllt bei Schnecken noch eine weitere Funktion: Es dient als Hydroskelett. Durch Muskelkontraktionen kann der Blutdruck gezielt erhöht werden und beispielsweise zum Ausstülpen der Fühler oder Geschlechtsorgane eingesetzt werden. 15
16 Zwitterdrü se in zwei Teile, sodass jedes Individuum mit einem kompletten Satz männlicher und weiblicher Genitalorgane ausgerüstet ist. Die Samenzellen reifen vor den Eizellen und bei der Kopulation wird das Sperma zunächst von den Partnern wechselseitig übertragen und dann gespeichert. Erst zu einem späte ren Zeitpunkt, wenn die Eizellen herangereift sind, wird dieses Partnersperma zur Befruchtung verwendet. Nur wenige Arten, wie die Rote Wegschnecke, sind in Ausnahmefällen zur Selbstbefruchtung fähig. Landlungenschnecken besitzen, soweit bisher bekannt, ein hochkomplexes Paarungsverhalten. Wie der Vorgang abläuft, ist weitgehend artspezifisch. Während oder vor der eigentlichen Paarung kommen bei vielen Arten so genannte Kopulationshilfsorgane zum Einsatz. Diese Organe sind Anhänge des Genitaltrakts und bestehen im einfachsten Fall aus einem kegelförmigen Gebilde, mit dem der Rücken des Partners berührt wird. In manchen Fällen, wie bei einigen Schnirkelschnecken (Familie Helicidae), ist dies ein schleimumhüllter Kalkstachel, der aus einer Tasche herausgepresst wird und sich durch die Haut des Partners ins Körperinnere schneidet. Mit dem anhaftenden Schleim werden hormonähnliche Substanzen übertragen. Bei den meisten Nacktschnecken sondert ein fortpflanzungsreifes Tier aus einer Drüse am Hinterleib Schleim ab, der von einem paarungsbereiten Artgenossen abgenagt wird, während er dieses verfolgt. Vor der Vereinigung streichen sich beide Partner der Genetzten Ackerschnecke Deroceras reticulatum mit einem Kopulationshilfsorgan über den Rücken. Das Verfolgen des Partners vor der Paarung Später bilden die Tiere einen Kreis, indem sich die Genitalöffnungen zueinander orientieren. Nach der Ausstülpung der beteiligten Organe kann das Sperma wechselseitig ausgetauscht werden. Über die Bedeutung dieser Hilfsorgane und Substanzen ist noch wenig bekannt. Man weiß, dass eine Schnecke in einer Saison das Sperma vieler verschiedener Partner empfängt, die tatsächliche Befruchtung ihrer Eier jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Möglich scheint daher, dass jede Schnecke bei einer Paarung auf hormonellem Wege die Geschlechtsorgane ihres 16
17 4 BIOLOGIE Partners gezielt manipulieren möchte, um ihr Sperma bevorzugt zur Befruchtung gelangen zu lassen. Jedes Tier legt innerhalb mehrerer Wochen Eier in Häufchen ab, Gesamtzahl und Gelege größen variieren je nach Art. Zur Eiablage suchen die Schnecken Hohlräume im Boden oder unter Steinen und Brettern auf, wobei sie Orte mit einem relativ hohen, aber nicht mit höchstem Wassergehalt des Bodens bevorzugen. Offenbar soll dies helfen, die Schneckeneier einerseits vor Austrocknung und andererseits vor dem bei zu hoher Feuchtigkeit leicht auftretenden Verpilzen zu bewahren. Die Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus bei der Eiablage Die Eier sind je nach Schneckenart rund oder oval, geleeartig durchsichtig oder mit einer harten, kalkigen Schale umgeben. Im Inneren des Eis durchlaufen Landlungenschnecken zwar noch Stadien mit larvalen Organen. Sie weichen im Entwicklungsgang jedoch von ihren wasserbewohnenden Vorfahren ab, welche ein frei lebendes, planktonisches Larvenstadium besitzen. Kurz vor dem Schlupf werden die larvalen Organe zurückgebildet und die jungen Schnecken gleichen bereits vollständig den erwachsenen. Nur die Geschlechtsorgane sind noch nicht ausgebildet. Eigelege der Genetzten Ackerschnecke Deroceras reticulatum Eigelege der Gartenwegschnecke Arion distinctus 17
18 4.4 Lebenszyklus Nacktschnecken haben eine begrenzte Lebensdauer. Hinsichtlich ihrer Lebenszyklen kann man zwei Typen unterscheiden: Manche Arten, wie die Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus, sind mit ihrem Lebenszyklus eng an die Jahreszeit gebunden. Bei ihnen lässt sich gut vorhersagen, wann beispielsweise Schlupf, Überwinterung oder Paarung stattfinden. Bei vielen anderen Arten, wie der Genetzten Ackerschnecke Deroceras reticulatum, entwickeln sich die einzelnen Populationen zeitlich leicht verschoben und man findet zu jeder Jahreszeit alle Stadien. Um im Winter nicht zu erfrieren, haben Schnecken zwei unterschiedliche Strategien entwickelt: Im einfachsten Fall wandern sie rechtzeitig an eine geschützte Stelle, um zu niedrige Temperaturen zu vermeiden. Weinbergschnecken suchen zum Beispiel spezielle Überwinterungsquartiere auf, graben sich dort ein und verschließen ihr Gehäuse mit einem Kalkdeckel, der erst im Frühjahr wieder abgesprengt wird. Die zweite Strategie zielt darauf ab, Frost durch Anpassungen im Weichkörper zu überl eben. Lebensgefährlich wird es für die Schnecken, sobald im Innern der Zellen Eiskristalle entstehen. Deshalb verhindern sie durch Wasserreduktion und Anreicherung osmotisch aktiver Substanzen, dass die Flüssigkeit im Zellinneren gefriert. Manche Nacktschneckenarten können auf diese Weise in den oberen Bodenschichten des Ackers überwintern und sind dann an milden Wintertagen aktiv. Weinbergschnecken graben sich im Herbst in den Boden ein und verschließen die Gehäusemündung mit einem Kalkdeckel, dem sogenannten Epiphragma. Noch einen Schritt weiter gehen manche Arten, die ein Gefrieren der extrazellulären Körperflüssigkeit überleben können. Bei dieser so genannten teilweisen Gefriertoleranz kann das Tier unbeschadet weiterleben, obwohl 40 bis 60 Prozent des Körperwassers gefroren sind. Gehäuseschnecken können je nach Jahreszeit Temperaturen von 15 bis 20 Celsius überleben. Auch Nacktschnecken können im teilweise gefrorenen Zustand überleben. Bei der Spanischen Wegschnecke sind es insbesondere die kleinen Jungtiere, die Temperaturen von 2 C unter Umständen tagelang überstehen. Kälter wird es in der oberen Bodenschicht, wo die Tiere überwintern, selbst in strengen Wintern nur selten. 18
19 4 BIOLOGIE 4.5 Unterscheidungsmerkmale Um Schadschnecken wirksam zu kontrollieren, muss man sie exakt bestimmen können. Bei Gehäuseschnecken ist dies über das Gehäuse möglich. Es kann beispielsweise auf seiner Unterseite eine Vertiefung aufweisen. Dieser so genannte Nabel ist bei manchen Arten halb von der lippenartigen Erweiterung der Gehäusemündung bedeckt, was auch als bedeckt durchbohrt bezeichnet wird. Der Nabel kann auch offen sein wie bei Fruticicola fruticum oder ganz bedeckt wie zum Beispiel bei Cornu aspersum. Nacktschnecken besitzen kaum verlässliche äußerliche Unterscheidungsmerkmale und sind zudem oft sehr variabel gefärbt. Der Farbton spezieller Hautzellen verändert sich während des Wachstums in Abhängigkeit von Temperatur und Nahrung. Linke Seite: Die Gartenbänderschnecke Cepaea hortensis besitzt keinen Nabel, ist gebändert oder einfarbig gefärbt. Mitte: Die Genabelte Strauchschnecke Fruticicola fruticum hat einen offenen Nabel und ein grünlich-gelb gefärbtes Gehäuse. Rechte Seite: Das Gehäuse der Weinbergschnecke Helix pomatia ist bedeckt durchbohrt. Bei einer Reihe von Arten ergibt sich die Farbe letztlich aus einem Gemisch mit ei nem zweiten Farbton, der von Schleim produzierenden Drüsenzellen erzeugt wird. Nacktschneckenarten, die sich äußerlich nicht bestimmen lassen, werden anhand des Genitaltrakts identifiziert. Hierzu muss die Schnecke getötet und präpariert werden. Nach äußeren Merkmalen schwierig zu bestimmen sind beispielsweise Wegschnecken (Arion-Arten) oder manche Ackerschnecken (Deroceras-Arten). Der Nabel der Gefleckten Weinbergschnecke Cornu aspersum ist ganz bedeckt. 19
20 Mantelschild Atemloch Arion Kiel Milacidae Kiel Agriolimacidae, Limacidae Die roten Arion-Arten sind äußerlich nicht leicht zu unterscheiden. Nacktschneckengruppen werden anhand äußerer Merkmale wie dem Mantelschild und der Form des Rückens unterschieden. Wenn man eine unbekannte Nacktschnecke vor sich hat, sollte man das Augenmerk zunächst auf ihren Mantelschild und die Form des Rückens richten: Bei Vertretern der Gattung Arion ist das Atemloch auf der rechten Seite vor der Mitte des Mantelschilds gelegen und der Rücken des Tieres nicht gekielt. Bei allen anderen Arten ist das Atemloch auf der rechten Seite hinter der Mitte des Mantelschilds gelegen und der Rücken mehr oder weniger deutlich gekielt. Bei Milacidae (z. B. Tandonia, Milax) und Boettgerilla reicht der Rückenkiel bis zum Mantelschild. Bei Agriolimacidae und Limacidae ist der Rückenkiel auf das Hinterende beschränkt und reicht nicht bis zum Mantelschild. Bei manchen gekielten Nackschnecken, hier Limax cinereo niger, tritt der Kiel durch eine hellere Färbung deutlich hervor. 20
21 5 5. SCHÄDIGENDE ARTEN 5.1 Herkunft der Schadschnecken Viele der bei uns lebenden Nacktschnecken arten sind Neozoen oder besitzen eine unge klärte Herkunftsgeschichte, wie die Spani sche Wegschnecke Arion lusitanicus. Manche Arten sind offenbar jahrelang übersehen worden, wie der Wurmschnegel Boettgerilla pallens. Man vermutet, dass Nacktschnecken an Pflanzen, anhaftender Erde oder in Erntegut leicht über Ländergrenzen hinweg verschleppt werden. Dies wird durch den verstärkten internationalen Handel seit den 1960er Jahren begünstigt, zum Beispiel durch Pflanzenimporte und den individuellen Reiseverkehr. Darüber hinaus haben die Mechanisierung der Landwirtschaft und großräumige Klimaveränderungen bei uns zu veränderten Umweltbedingungen geführt, die bestimmten gebietsfremden Arten zusagen. Nur wenigen der verschleppten Arten gelingt es jedoch, sich in ihrer neuen Heimat zu etablieren oder gar zum Schädling zu werden. Viele Arten können bei uns nur in Gewächshäusern überleben. Es gibt jedoch Beispiele dafür, dass sich auch wärmeliebende Arten wie die Mittelmeer-Ackerschnecke Deroceras invadens ausbreiten können, wenn sie aus dem Gewächshaus ins Freie gelangen. 5.2 Schadschnecken in Hausund Kleingärten Arion-Arten Die wichtigste Art im Haus- und Kleingarten ist die Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus. Aussehen: Sie ist 70 bis 120 mm lang, besitzt einen schlanken Körper, beinahe farblosen Schleim und ist wässrig schmutzig-braun bis orange gefärbt. Die erwachsene Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus ist wässrig schmutzig-braun bis orange gefärbt und kann leicht mit der Roten Wegschnecke Arion rufus verwechselt werden. Daher können ausgewachsene Tiere leicht mit der Roten Wegschnecke Arion rufus oder der Schwarzen Wegschnecke Arion ater verwechselt werden. Auf Kulturland ist jedoch meistens nur die Spanische Wegschnecke anzutreffen. Eine Unterscheidung ist in Zweifelsfällen nur durch Genitalpräparation möglich. Diese Art wurde lange Zeit für eine ähnliche Art gehalten, die echte 21
22 Arten in Haus- und Kleingärten Hauptschädlinge Ähnliche, nicht schädliche Arten Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus Rote Wegschnecke Schwarze Wegschnecke Braune Wegschnecke Gartenwegschnecken Genetzte Ackerschnecke Gelegentliche Schädlinge Arion distinctus/a. hortensis (Artkomplex) Deroceras reticulatum Waldwegschnecke Gelbstreifige Wegschnecke Einfarbige Ackerschnecke Hammerschnegel Heller Schnegel Wasserschnegel Arion rufus Arion ater Arion fuscus Arion silvaticus Arion fasciatus Deroceras agreste Deroceras sturanyi Deroceras rodnae / juranum Deroceras laeve Mittelmeer-Ackerschnecke Deroceras invadens siehe Deroceras reticulatum Bierschnegel Boden-Kielschnegel Dunkle Kielnacktschnecke Limacus flavus Tandonia budapestensis Milax gagates Weinbergschnecke Helix pomatia Junge Weinbergschnecken, gleichgroß wie Genabelte Strauchschnecke Gefleckte Weinberg - schnecke Bänderschnecken Cepaea hortensis Cepaea nemoralis Genabelte Strauchschnecke Fruticicola fruticum Cornu aspersum Fruticicola fruticum Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus, die bis heute nur in Zentralportugal vorkommt. Neuere Untersuchungen zeigten, dass es sich bei diesem Schädling nicht um die selbe Art handelt. Die zugewanderte Art hat ihr Ursprungsgebiet wahrscheinlich nicht auf der iberischen Halbinsel, sondern in Südwestfrankreich, wo weitere ähnliche Arten leben, die aber nicht als schädlich in Erscheinung treten. Manche Autoren benutzen den Namen Arion vulgaris für den Neubürger, dies ist jedoch umstritten. Solange weitere in Frage kommende Arten und die Ausdehnung ihrer Verbreitungsgebiete Seitenbinden und eine variable Färbung kennzeichnen die juvenilen Tiere der Spanischen Wegschnecke Arion lusitanicus. 22
23 5 SCHÄDIGENDE ARTEN nicht genauer erforscht sind, wird die Schadschnecke bis auf weiteres den Namen Spanische Wegschnecke (Arion lusitanicus) behalten. Juvenile Tiere besitzen Seitenbinden und sind sehr variabel gefärbt. Lebensweise: Die Spanische Wegschne cke Arion lusitanicus hat sich in den 1960er bis 1980er Jahren in Europa von Frank reich bis Skandinavien explosions ar tig verbreitet, ihre Herkunft ist jedoch un geklärt. Sie kommt vor allem in vom Men schen beeinflussten Lebensräumen, in Gärten, Ödland und an Wegrändern vor und wird in landwirtschaftlichen Kulturen zum Schädling. Lebenszyklus: Sie wird in der Regel ein Jahr alt und überwintert in unseren Breiten im juvenilen Stadium. Die Eier findet man von September bis Februar, dabei maximal 220 Eier pro Gelege. Die Jungtiere treten von September bis Juni auf, die ausgewachsenen Tiere von Juni bis November. Die Jungtiere sind im Frühjahr zunächst gleichmäßig verteilt, halten sich meist in der obersten Bodenschicht auf, später nächtliche Wanderungen bis zu 10 Meter pro Nacht aus Verstecken in die Kulturen und zurück, daher sind Kleingärten besonders gefährdet. Ähnliche Arten: Die Rote Wegschnecke Arion rufus wird mit 70 bis 150 mm Länge größer. Ihr Lebensraum beschränkt sich in der Regel auf Wälder, sie ist auch weniger mobil und wird daher nicht schädlich. Ihre Färbung reicht von einem leuchtenden orange über ziegelrote Formen bis hin zu beinahe schwarz gefärbten Exemplaren, wie man sie zum Beispiel in kalten Tälern der Schwäbischen Alb antrifft. Jungtiere sind einfarbig weiß gefärbt. Die adulte Rote Wegschnecke Arion rufus wird 70 bis 150 mm lang. Die Färbung ist variabel von leuchtend orange über ziegelrot bis hin zu beinahe schwarz. Jungtiere der Roten Wegschnecke Arion rufus sind einfarbig weiß gefärbt. Ein dunkel gefärbtes Exemplar der Roten Wegschnecke Arion rufus. Fast schwarze Tiere kommen zum Beispiel in kalten Tälern der Schwäbischen Alb vor. 23
24 Die Schwarze Wegschnecke Arion ater erreicht 70 bis 150 mm Länge. Diese Art ist in Schleswig-Holstein und weiter nördlich häufig, in Süddeutschland kommt sie nicht vor, sie ist nicht schädlich. Sie ist in der Regel schwarz bis grau gefärbt und besitzt einen roten Fußsaum. sich äußerlich ähnlich sehen und nur durch eine Präparation zu unterscheiden sind. In Deutschland leben zwei dieser Arten: Die Echte Gartenwegschnecke Arion hortensis und die Gemeine Gartenwegschnecke Arion distinctus: Aussehen: Die Tiere werden 25 bis 35 mm lang. Die Fußsohle ist gelblich-orange, der Rücken schwarzgrau oder dunkelgraubraun. Sie können Seitenbinden aufweisen, der Körperschleim ist orange. Arion ater ist grau bis schwarz gefärbt. Eine weitere ähnliche Art ist die Braune Wegschnecke Arion fuscus: Sie wird bis 70 mm lang, ist in Deutschland nur in Wäldern häufiger anzutreffen und kein Schädling. Sie ist gelbbraun mit dunkelbraunen Seitenbinden und auch ohne Genitalpräparation von den vorgenannten Arten zu unterscheiden, da ihr Schleim deutlich orange ist. Die Echte Gartenwegschnecke Arion hortensis lebt unterirdisch oder nahe der Bodenoberfläche und schädigt vor allem Wurzelgemüse. Ihre Fußsohle ist gelblich-orange. Die Braune Wegschnecke Arion fuscus ist kein Schädling und in Deutschland nur in Wäldern häufiger anzutreffen. Kleinere, dunkle Arioniden gehören zur Gruppe des Arion hortensis. Dabei handelt es sich um einen Komplex aus drei weltweit verschleppten europäischen Arten, die Lebensweise: Beide Arten besiedeln Gärten, Ackerland und Ruderalflächen. Arion distinctus ist am weitesten verbreitet und wahrscheinlich auf Ackerland häufiger anzutreffen. Die Tiere leben unterirdisch oder nahe der Bodenoberfläche. Ihre Populationsdichte ist daher schwer einschätzbar. Sie schädigen hauptsächlich Wurzelgemüse, aber auch grüne Pflanzenteile. Lebenszyklus: Ein großer Anteil schlüpft im Mai und Juni aus überwinternden Eiern, die Tiere sind im Oktober erwachsen und im Winter aktiv. 24
25 5 SCHÄDIGENDE ARTEN Ähnliche, kleine Arten: Gelbstreifige Wegschnecke Arion fasciatus: Sie wird bis 55 mm lang, hat unter der Körperlängsbinde ein gelbliches Band; ihr Schleim ist leicht gelblich. Man trifft sie auf Kulturgelände an, sie wird jedoch nie schädlich. Wald-Wegschnecke Arion silvaticus: Bei dieser schwarz-weiß-gefärbten Art sind die Seitenbinden nach unten stärker abgegrenzt als nach oben. Der Rücken ist dunkler als die Körperseiten. Sie lebt sowohl in Wäldern als auch auf Kulturgelände und ist kein Schädling. Die Waldwegschnecke Arion silvaticus (links) und die Gelbstreifige Wegschnecke Arion fasciatus (rechts) Agriolimacidae-Arten Hier sind fünf größere Arten von Bedeutung, die anatomisch unterschieden werden können. Alle haben einen cremefarbenen Körper mit dunkler Netzzeichnung, die mehr oder weniger stark ausgebildet ist: Genetzte Ackerschnecke Deroceras reticulatum: Aussehen: 35 bis 50 mm, Farbe gelblichweiß oder bräunlich mit netzartiger Zeichnung, Sohle weiß. Körperschleim weiß. Die Genetzte Ackerschnecke Deroceras reticulatum ist die mit Abstand bedeutendste Schadschnecke. Sie ernährt sich von grünen Pflanzen, kann aber bereits Keimlinge schädigen. Lebensweise: Die Tiere leben hauptsächlich unterirdisch. Die Genetzte Ackerschnecke wurde weltweit verschleppt und ist international die mit Abstand bedeutendste Schadschnecke im Ackerbau. Sie ernährt sich hauptsächlich von grünen Pflanzen und weicht somit von den Fraß präferenzen anderer Schneckenarten ab. Die Tiere kriechen bei feuchter Witterung gerne die Pflanzen empor und schädigen durch Blattfraß. Lebenszyklus: Das Lebensalter beträgt etwa ein Jahr. Eier findet man zu allen Jahreszeiten, sie werden der unterirdischen Lebensweise entsprechend in gepflügtem Boden in bis zu 10 cm Tiefe abgelegt. Im Herbst und im späten Frühjahr treten die erwachsenen Tiere am häufigsten auf. Einfarbige Ackerschnecke Deroceras agreste: Größe und Aussehen sind ähnlich wie bei Deroceras reticulatum, sie ist aber stets einfarbig und nie gesprenkelt. Diese seltene Schneckenart lebt in Biotopen wie Sümpfen und Mooren. Eine Unterscheidung ist nur über Genitalpräparation möglich. 25
26 Heller Schnegel Deroceras rodnae/juranum (Artkomplex): Bis 40 mm lang. Der Körper ist meist cremigweiß, der Schleim hellweiß. Lebt hauptsächlich in Wäldern. Eine Unterscheidung ist nur über Genitalpräparation möglich. Die Mittelmeer-Ackerschnecke Deroceras invadens ist mittlerweile häufig im Freiland anzutreffen, tritt aber nur gelegentlich als Schädling auf. Der Helle Schnegel Deroceras rodnae lebt hauptsächlich in Wäldern. Hammerschnegel Deroceras sturanyi: Mittelgroße Art, Tiere werden bis 40 mm lang. Unterschied zu Deroceras reticulatum: Der Körperschleim ist farblos. Die Tiere sind einfarbig ocker oder cremefarben bräunlich, kaum gefleckt. Sie kommen meist auf Kulturgelände vor, sind aber selten. Unterscheidung nur über Genital präparation. Mittelmeer-Ackerschnecke Deroceras invadens (bis 2011 als D. panormitanum bezeichnet): Etwas kleinere Art, bis 35 mm lang. Unterschied zu Deroceras reticulatum: Der Körperschleim ist farblos. Heller oder dunkler braun bis schwarz, selten gefleckt. Tritt hierzulande erst seit kurzem im Freiland auf, aber jetzt sehr häufig, weltweit verschleppte Art. Gelegentlicher Schädling. Unterscheidung nur über Genitalpräparation. Ähnliche Arten: Wasserschnegel Deroceras laeve: Kleine Tiere, bis 25 mm lang. Einfarbig dunkelbraun, Körperschleim farblos, leben an sehr nassen Orten und sind selten schädlich. Ebenfalls weltweit verschleppt Limacidae-Arten Bierschnegel Limacus flavus: Der Körperschleim ist gelb, Mantel und Rücken tragen gelbe Flecken auf dunk lem Grund. Fühler stahlblau. Bis 100 mm lang, in Gärten und Kellern, aber selten schädlich. Weitere Arten: Tigerschnegel Limax maximus: 100 bis 150 mm lang, anzutreffen in Wäldern, Gärten und anderem Kulturland. Der Körperschleim ist farblos, der Mantel dunkel marmoriert auf hellem Grund. Die Fußsohle ist einfarbig hell. In der Regel kein Pflanzenschädling, sondern eher nützlich, da er bei Gelegenheit andere Nacktschnecken angreift und deren Eigelege frisst. 26
27 5 SCHÄDIGENDE ARTEN In der Regel kein Pflanzenschädling: der Tigerschnegel Limax maximus Schwarzer Schnegel Limax cinereoniger: Die größte einheimische Nacktschnecke wird über zwei Jahre alt. Sie wird bis 180 mm lang, Mantelschild weder punktiert noch marmoriert, grauer oder schwärzlicher Körper, Sohle mit hellem Mittelfeld und schwarzen Seitenfeldern. Nur in Wäldern, kein Schädling. Es gibt viele verwandte Arten in Südeuropa und den Alpen, die bislang kaum erforscht sind. Baumschnegel Lehmannia marginata: 70 bis 80 mm lang. Die Sohle ist gräulich-weiß, mit zwei Seitenbinden auf dem Mantelschild, ansonsten ist die Färbung variabel. Kommt nur in Wäldern vor und ist kein Schädling. Kann mit dem in Gewächshäusern lebenden Gewächshausschnegel Lehmannia valentiana verwechselt werden. Pilzschnegel Malacolimax tenellus: 25 bis 45 mm lang. Der Körperschleim ist gelb, die Tiere gelblich bis ockerfarben, die Fühler schwärzlich bis dunkelbraun. Kommt in Wäldern vor, kein Schädling Boettgerillidae-Art Wurmschnegel Boettgerilla pallens: Das ausgestreckte Tier ist wurmförmig, 20 bis 45 mm lang und dünn, die Oberseite ist bleigrau, die Fühler sind schwarz, der Schleim farblos. Die räuberischen Tiere leben unterirdisch in Wäldern und Gärten. Der Mund kann rüsselartig vorgestülpt werden und in die Beute eindringen. Ernährt sich vor allem von Schneckeneiern. Mit einer Körperlänge bis 18 cm ist der Schwarze Schnegel Limax cinereoniger die größte einheimische Nacktschnecke. Er kommt nur in Wäldern vor und ist kein Schädling. Der Wurmschnegel Boettgerilla pallens lebt räuberisch und ernährt sich vor allem von Schneckeneiern. 27
28 5.2.5 Milacidae-Arten Boden-Kielschnegel Tandonia budapestensis: 50 bis 60 mm lang. Die Tiere sind netzförmig schwarz gesprenkelt, der Kiel gelblich bis orange gefärbt. Auch in einfarbig hellen, gelblichen Formen auftretend. Sie leben unterirdisch auf Kulturland und in Gärten. Kommt die Art lokal in Massen vor, kann sie schädlich werden. Dunkle Kielnacktschnecke Milax gagates: 50 bis 60 mm lang, meist einheitlich schwarz gefärbter Rücken ohne Binden, seltener grau gefärbt. Eine träge, nicht so bewegliche Art, die bisher in Deutschland nur im Rheintal vorkommt, wo sie in Gärten und auf Der Boden-Kielschnegel Tandonia budapestensis wird nur schädlich, wenn er lokal in Massen vorkommt. landwirtschaftlichen Flächen gelegentlich schädlich wird Gehäuseschnecken-Arten Die drei gelegentlich schädlichen Helix- und Cepaea-Arten sind wärmeliebend, aber zugleich schattenbedürftig. Es handelt sich um bewegliche Arten, die im Schutz von Büschen und einzelnen Bäumen leben können. Von dort aus gelangen sie gelegentlich in benachbarte Nutzflächen. Weinbergschnecke Helix pomatia Aussehen: Sie ist die größte einheimische Gehäuseschnecke, ihre Schale wird bis 50 mm hoch und ist bedeckt durchbohrt. Die Oberfläche der Schale ist unregelmäßig rippenstreifig (die Zuwachsstreifen treten als Rippen hervor). Bild siehe S. 9. Lebensweise: Sie lebt in Wäldern und Gebüschen oder an offenen Stellen in der Kulturlandschaft. Besonders junge Tiere treten gelegentlich als Schädlinge in Erscheinung, adulte Tiere sind zu schwer, um an dünnen Pflanzen empor zu klettern. Die ursprüngliche Heimat der Weinbergschnecke liegt nicht in unseren Breiten, sondern wahrscheinlich in Südeuropa. Die roman snail, wie sie auf Englisch heißt, wurde von den Römern mitgebracht und im Mittelalter durch Mönche bis nach Skandinavien weiter verbreitet. Die eher träge Dunkle Kielnacktschnecke Milax gagates schädigt bisher nur gelegentlich in Gärten und auf landwirtschaftlichen Flächen im Rheintal. Lebenszyklus: Die Tiere können mehrere Jahre alt werden, im Freiland erreichen sie ein Alter von sechs bis acht Jahren. 28
29 5 SCHÄDIGENDE ARTEN Ähnliche Arten: Genabelte Strauchschnecke Fruticicola fruticum: Das Gehäuse ist 18 bis 25 mm breit, der Nabel offen, die Schale kugelig-konisch. Lebt in Gärten und Gebüschen und ist selten schädlich. Die Weißmündige Bänderschnecke Cepaea hortensis wird auch Gartenbänderschnecke genannt. Bänderschnecken können vor allem im Zierpflanzenbau in warmen Lagen Schäden anrichten. Nach circa zweieinhalb Jahren sind sie geschlechtsreif. Die Paarung erfolgt im Frühjahr, ein bis zwei Monate später im Sommer dann die Eiablage. Pro Jahr gibt es eine Fortpflanzungsperiode. Weißmündige Bänderschnecke Cepaea hortensis: Diese Art hat keinen Nabel und wird bis 20 mm breit. Der Mundsaum ist in der Regel hellgrau, die Lippe weiß. Sie kommt in Wäldern, Gebüschen und Gärten vor. Besonders im Zierpflanzenbau können die Bänder- oder Schnirkelschnecken in warmen Lagen empfindliche Schäden anrichten. Gefleckte Weinbergschnecke Cornu aspersum: Das Gehäuse ist kugelig und 25 bis 40 mm hoch. Der Nabel ist bedeckt, das Gehäuse gefleckt gefärbt. In Deutschland kommt diese nicht einheimische und nicht schädliche Schnecke lokal nur sehr begrenzt in Gärten oder Parkanlagen vor. Das Gehäuse der Gefleckten Weinbergschnecke Cornu aspersum ist kugelig, gefleckt und 25 bis 40 mm hoch. Schwarzmündige Bänderschnecke Cepaea nemoralis: Ohne Nabel, bis 25 mm breit. Der Mundsaum ist in der Regel dunkelbraun bis schwarz, die Lippe braunrot. Lebt in Wäldern, Gebüschen und Gärten. 29
30 Ebenfalls häufig in Gärten anzutreffende Gehäuseschnecke: Große Glanzschnecke Oxychilus draparnaudi: Das Gehäuse ist scheibenförmig, 11 bis 16 mm breit, oben gelblichbraun, unten weißlich gefärbt. Der Körper der Schnecke ist dunkel kobaltblau. Die Art ist ein Kulturfolger und kommt aus dem Mittelmeergebiet. Sie gehört zu den nützlichen Schneckenarten, da sie räuberisch lebt. 5.3 Schadschnecken im Gewächshaus Im Gewächshaus treten gelegentlich der Gewächshausschnegel Lehmannia valentiana und die Mittelmeer-Ackerschnecke Deroceras invadens auf Limacidae-Art Gewächshausschnegel Lehmannia valentiana: 50 bis 70 mm lang, gelblich-grau mit farblosem Schleim. Wurde von der Iberischen Halbinsel eingeschleppt, sieht dem einheimischen, in Wäldern lebenden Lehmannia marginata ähnlich. Kommt in Gewächshäusern vor und tritt dort gelegentlich als Schädling auf. Selten im Freiland anzutreffen (nur bei Karlsruhe). Die Große Glanzschnecke Oxychilus draparnaudi lebt räuberisch und gehört damit zu den nützlichen Schnecken arten. Der gelblich-graue Gewächshausschnegel Lehmannia valentiana wurde von der Iberischen Halbinsel eingeschleppt und tritt gelegentlich in Gewächshäusern als Schädling auf. 30
31 5 SCHÄDIGENDE ARTEN Agriolimacidae-Arten Mittelmeer-Ackerschnecke Deroceras invadens: Kleinere Art, bis 35 mm lang, Unterschied zu Deroceras reticulatum, der auch in Gewächshäusern lebt: Der Körperschleim ist farblos. Heller oder dunkler braun bis schwarz, selten gefleckt. Erst seit kurzem auch im Freiland und dort jetzt sehr häufig anzutreffen. Gelegentlicher Schädling. Unterscheidung von ähnlichen Deroceras-Arten nur über Genitalpräparation möglich (siehe auch Kapitel 5.2.2) Gehäuseschnecken-Arten Folgende Arten sind in Gewächshäusern anzutreffen: Große Glanzschnecke Oxychilus draparnaudi: Das Gehäuse ist scheibenförmig, 11 bis 16 mm breit, oben gelblichbraun, unten weißlich gefärbt. Der Körper der Schnecke ist dunkel kobaltblau. Sie ist ein Kulturfolger aus dem Mittelmeergebiet und gehört wegen der räuberischen Ernährungsweise zu den nützlichen Schneckenarten. Kulturfolger im Freiland und Gewächshaus (siehe auch Kapitel 5.2.6). Keller-Glanzschnecke Oxychilus cellarius: Das Gehäuse ist 10 bis 12 mm groß und grünlich-hornfarben. Die Jugendstadien sind nicht von O. drapar naudi zu unterscheiden. Sie ist nicht schädlich. Kulturfolger im Freiland und Gewächshaus. Gefleckte Schüsselschnecke Discus rotundatus: 5,5 bis 7 mm breit, scharf gerippt, gekielt und Schalenoberfläche gefleckt. Kommt in Gewächshäusern und im Freiland vor. Nicht schädlich. Hawaiia minuscula: Winzig klein, aus Nordamerika. In Gewächshäusern sind sie unter Abdeckfolie von Bewässerungstischen anzutreffen. Nicht schädlich. Glänzende Dolchschnecke Zonitoi des nitidus: 6 bis 7 mm Gehäusebreite. Eine einheimische Art mit gestreifter, flachkonischer Schale. Ist auf nassen Wiesen und an feuchten Stellen in Gewächshäusern anzutreffen. Nicht schädlich, eventuell räuberische Lebensweise. Gewächshaus-Dolchschnecke Zoni toi des arboreus: 4 bis 5 mm Gehäuse breite. Wurde aus Nordamerika eingeschleppt. Bei uns kann diese Art nur in Gewächshäusern überleben, man findet sie häufig an Blumentöpfen. Nicht schädlich. 5.4 Schadschnecken im Acker- und Gemüsebau Die meisten Schneckenarten spielen im Erwerbsanbau auf Grund der großflächigen maschinellen Bodenbearbeitung eine relativ geringe Rolle. Die Schadschnecken Arion distinctus, Arion hortensis und Deroceras reticulatum kommen jedoch auch mit diesen Bedingungen gut zurecht. Sie leben unterirdisch in 5 bis 10 cm Bodentiefe, 31
32 Arten im Ackerbau und Gemüsebau Hauptschädlinge Gartenwegschnecken Genetzte Ackerschnecke Arion distinctus/ Arion hortensis (Artkomplex) Deroceras reticulatum Ähnliche, nicht schädliche Arten Waldwegschnecke Gelbstreifige Wegschnecke Einfarbige Ackerschnecke Hammerschnegel Heller Schnegel Wasserschnegel Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus Rote Wegschnecke Schwarze Wegschnecke Braune Wegschnecke Gelegentliche Schädlinge Mittelmeer-Ackerschnecke Boden-Kielschnegel Dunkle Kielnacktschnecke Deroceras invadens Tandonia budapestensis Milax gagates Einfarbige Ackerschnecke Hammerschnegel Heller Schnegel Wasserschnegel Weinbergschnecke Helix pomatia Genabelte Strauch schnecke, (gleich groß wie junge Weinbergschnecken) Gefleckte Weinbergschnecke Bänderschnecken Cepaea hortensis Cepaea nemoralis Genabelte Strauchschnecke Arion silvaticus Arion fasciatus Deroceras agreste Deroceras sturanyi Deroceras rodnae / juranum Deroceras laeve Arion rufus Arion ater Arion fuscus Deroceras agreste Deroceras sturanyi Deroceras rodnae / juranum Deroceras laeve Fruticicola fruticum Cornu aspersum Fruticicola fruticum ziehen sich aber in größere Tiefen zurück, wenn die obersten Bodenschichten austrocknen. Arion lusitanicus wandert meist von Wegrändern, Gräben und Feldrainen in die Kulturen ein. Die Schäden durch diese Art konzentrieren sich auf Randbereiche der Schläge, bei sehr grobscholligem Boden und entsprechend feuchter Witterung können sich auch Befallsnester im Bestand bilden. Die hier wichtigen Schnecken wie Arion lusitanicus Arion distinctus Arion hortensis Deroceras reticulatum Deroceras invadens Helix pomatia Cepaea hortensis Cepaea nemoralis wurden schon weiter oben vorgestellt. 32
33 6 6. NATÜRLICHE FEINDE Trotz aller Erkenntnisse über schneckenfressende Wirbeltiere steckt die Erforschung der wichtigsten Gegenspieler von Schnecken noch in den Anfängen. 6.1 Igel Bei natürlichen Gegenspielern von Schnecken denken viele Menschen zunächst an Igel, die wohl bekanntesten Schneckenfeinde. Igel fressen gerne bis zu 15 cm große Nacktschnecken, allerdings bevorzugen sie den wenig schädlichen Tigerschnegel Limax maximus und fressen größere Wegschnecken (Arion-Arten) dagegen nur ungern. Trotz der abschreckenden Schleimabsonderung werden auch der Boden-Kielschnegel (Tandonia budapestensis) und die Echte Gartenwegschnecke (Arion hortensis) gefressen. Bei der Nahrungssuche können Igel kleinere Steine umdrehen, um die darunter befindliche Beute aufzustöbern. Tote oder Igel fressen gerne große Nacktschnecken und verschmähen auch die Spanische Wegschnecke nicht. sterbende Tiere werden verschmäht. Igel knacken auch die Schale von Bänderschnecken (Cepaea), aber nicht von Gehäuseschnecken mit größerem Durchmesser als 18 mm, wie Weinbergschnecken (Helix pomatia und Cornu aspersum). Die meistbevorzugte Schnecke ist offensichtlich die karnivore Große Glanzschnecke Oxychilus draparnaudi. 6.2 Vögel Viele Vögel zählen ebenfalls zu den Schneckenfeinden. Von Drosseln weiß man, dass sie Schneckenhäuser an Steinen zerschmettern, um an den Weichkörper zu gelangen. Auch Nacktschnecken mit zähem Schleim werden von Amseln und Staren gefressen und dazu zunächst auf dem Boden hin- und hergestreift, bevor sie geschluckt werden. 6.3 Gliederfüßer (Arthropoden) Der größte Feinddruck auf eine Schneckenpopulation geht sicherlich von Arthropoden aus. Bis heute weiß man beispielsweise fast nichts über die Bedeutung der räuberischen Laufkäferlarven als Schneckenfeinde. Der Grund hierfür ist vermutlich, dass sie im Verborgenen leben und ihre Artbestimmung nicht einfach ist. Da viele Laufkäfer als Larven überwintern und auch bei tieferen Temperaturen aktiv sind, ist anzunehmen, dass sie große Mengen an Schneckeneiern und jungen Schnecken vertilgen. 33
34 Die Larven großer Laufkäferarten wie die der Gattung Carabus sind Schneckenfresser. Um herauszufinden, welche Tiere zum Nahrungsspektrum eines bestimmten Räubers gehören, werden meist Mageninhalt- oder Kotreste analysiert. Wirbellose Räuber sind oft so klein, dass man dafür ein Mikroskop braucht. Schneckenreste im Magen oder Kot sind jedoch häufig allein durch eine Sichtkontrolle schlecht nachzuweisen: Viele Gliedertiere, darunter auch manche Käfer, nehmen keine Stücke aus dem Beutetier auf, sondern verflüssigen zunächst die Nahrung außerhalb des Körpers, indem sie Verdauungssäfte abgeben. Anschließend nehmen sie diesen Brei auf. Aus diesem Grund werden neuerdings genetische Analysen durchgeführt. Hier genügen geringste Nahrungsreste, etwa im Kropf eines kleinen Laufkäfers, um einen Fraßnachweis zu erbringen. Manche Laufkäfer töten allerdings während der Nahrungssuche mehr Schnecken, als sie dann tatsächlich fressen. Daher geben Mageninhaltsanalysen bei manchen Arten nur geringe Anhaltspunkte über den Einfluss auf eine Schneckenpopulation. Zeitaufwändig, aber aussagekräftig ist es, den Räuber gefangen zu halten und Fraßpräferenztests durchzuführen. Dabei werden dem Räuber bestimmte Beutetiere einzeln oder in Kombination angeboten und dessen Reaktion in Abhängigkeit vom Hungerzustand registriert. Allerdings ist von den wenigsten Tieren, zu deren Nahrungsspektrum Schnecken zählen, bisher bekannt, wie oft sie im Freiland tatsächlich Schnecken fressen oder zu welcher Jahreszeit sie eine andere Beute bevorzugen. Da jede einzelne Schnecke in der Lage ist, nach der Paarung etliche Eier zu legen, ist die Anzahl der Nachkommen ungeheuer groß. Doch gerade Eier und frisch geschlüpf te Schnecken sind einer Vielzahl von Feinden ausgeliefert und werden von räuberischen Gliedertieren (Arthropoden), die den Boden auf der Suche nach Nahrung durchstöbern, verzehrt. Larven der Kurzflügelkäfer (Familie Staphylinidae) fressen gerne Schneckeneier und die Larven kleiner, parasitisch lebender Fliegen (Familie Phoridae) höhlen Schneckeneier aus. Auch von den Schneckenarten Oxychilus draparnaudi, Boettgerilla pallens und Limax maximus weiß man, dass sie Schneckeneier fressen. Die Große Glanzschnecke Oxychilus draparnaudi frisst Eier der Spanischen Wegschnecke Arion lusitanicus. 34
35 6 NATÜRLICHE FEINDE Frisch geschlüpfte Nacktschnecken besitzen eine dünne Haut und noch keine zähe Schleimschicht, dadurch sind sie eine besonders leichte Beute auch für kleinere, unspezialisierte Käfer. Es gibt auch Arthropoden, die nur von Schnecken leben. Dazu gehören spezialisierte Weberknechtarten, die Larven einiger Fliegenarten und manche Käferarten mit ihren Larven. Frisch geschlüpfte Nacktschnecken wie hier von Arion rufus sind Feinden schutzlos ausgeliefert. Neben vielen Laufkäfern (Carabidae) mit ihren Larven sind hier Aaskäfer (Silphidae), Kurzflügelkäfer (Staphylinidae) und Larven von Weichkäfern (Cantharidae) zu nennen. Viele Weberknechtarten, darunter der auffällige Schneckenkanker (Ischyropsalis hellwigi), ernähren sich nur von Schnecken Laufkäfer (Carabidae) Auch eine Reihe von Laufkäferarten besitzt eine Vorliebe für Schnecken. In unseren Breiten leben zwei Arten Schaufelläufer, Käfer der Gattung Cychrus, die mit lang gezogenem Kopf und schmaler Vorderbrust ausgestattet sind, um in die Zu den Feinden frisch geschlüpfter Nacktschnecken zählen unter anderem die Larven von Weichkäfern (Cantharidae). Der Kopf des Schaufelläufers Cychrus caraboides ist pinzettenartig schmal. Damit kann er in die Öffnung des Schneckenhauses eindringen und den Weichkörper angreifen. 35
36 Öffnung des Schneckenhauses einzudringen und den darin verborgenen Weichkörper anzugreifen. Während des Todeskampfes sondert die Schnecke eine Menge Schleim ab, was die Funktion der mächtigen Oberkiefer jedoch nicht beeinträchtigt. Diese sind ohnehin nicht als Kauwerkzeuge geeignet. Mit ihnen beißen sich die Käfer blitzartig in ihrem Opfer fest, quetschen das Gewebe aus oder trennen Stücke ab. Anschließend verdauen die Käfer das Gewebe außerhalb des Körpers vor und nehmen es in flüssiger Form auf. Auch die Larven der Schaufelläufer machen vor allem Jagd auf Schnecken. mit ihren Mundwerkzeugen in der Lage, die zähe Haut der Nacktschnecken zu durchtrennen, um an die weichen inneren Organe zu gelangen. Weit verbreitet und daher wichtige Nacktschneckenfresser: Adulte und Larven des Laufkäfers Carabus cancellatus Leuchtkäfer (Lampyridae) Mit ihren mächtigen Oberkiefern beißen sich die Laufkäfer blitzartig in ihrem Opfer fest, quetschen das Gewebe aus oder trennen Stücke ab. Von den drei heimischen Leuchtkäferarten (Lampyris noctiluca, Lamprohiza splendidula und Phosphaenus hemipterus), auch Glühwürmchen genannt, fallen besonders die Larven und die Weibchen mit ihrer lang gestreckten Gestalt und einem stark segmentierten Körper auf. Viele auf Feldern lebende große und mittelgroße Laufkäferarten sind Generalisten und ernähren sich von jungen Nacktschnecken, solange sie deren Schleimschicht überwinden können. In Untersuchungen auf Kulturland werden besonders häufig die Arten Carabus violaceus, Pterostichus melanarius und Abax parallelepipedus als wichtige Nacktschneckenfresser erwähnt. Diese Laufkäferarten sind als Adulte und Larven Die Larven des Leuchtkäfers Lampyris noctiluca sind auf den Fraß von Schnecken spezialisiert und besitzen Mundwerkzeuge, die Injektionskanülen ähneln. 36
37 6 NATÜRLICHE FEINDE Leuchtkäferweibchen ähneln den Larven, nehmen jedoch wie die männlichen Käfer keine Nahrung mehr auf. Die Larven aller drei bei uns lebenden Leuchtkäferarten fressen Nackt- und Gehäuseschnecken. Wenn sich eine Larve auf Beutefang begibt, folgt sie den Schleimspuren, um ihr Opfer zu finden. Sobald sie eine Schnecke gefunden hat, wendet sie sich mithilfe ihres Geruchssinns deren Vorderende zu und injiziert mit ihren spritzenähnlichen Oberkiefern eine Substanz mit lähmender Wirkung. Anschließend beginnt sie mit dem bis zu zwei Tage dauernden Fressvorgang. Jede Larve wird drei Jahre alt und kann demnach viele Schnecken töten, bevor sie sich in einen Käfer verwandelt Schneckenräuber (Drilidae) Die Männchen der Schneckenräuber besitzen auffällige, kammförmige Fühler. Die männlichen Käfer nehmen keine Nahrung mehr zu sich. Die weiblichen Käfer und die Larven jagen Schnecken und töten sie durch Giftbisse in die Tentakel. Anschließend zerren sie die Schnecken in ein Versteck und verzehren sie dort. Die Drilidenlarven wechseln während ihrer Entwicklung die Gestalt. Nach einem sehr beweglichen schneckenfressenden Stadium zieht sich die Larve in ein leeres Schneckenhaus zurück und häutet sich dort im Winter zu einer unbeweglichen Ruheform. Im Frühjahr verwandelt sie sich erneut in eine bewegliche Larve. Erst nach einem weiteren Gestaltwechsel erfolgt ebenfalls in einem Schneckenhaus die Verpuppung zum erwachsenen Käfer Aaskäfer (Silphidae) Auch unter den Aaskäfern findet man ausgesprochene Schneckenfresser. Die Aaskäferarten Phosphuga atrata oder Ablattaria laevigata besitzen sogar in Anpassung an ihre Beutezüge einen lang gezogenen Kopf in erstaunlicher Ähnlichkeit zu den Cychrus-Arten. Die gefächerten Antennen des männlichen Schneckenräubers Drilus flavescens. Auch der Aaskäfer Ablattaria laevigata hat in Anpassung an seine Lebensweise als gefräßiger Schneckenjäger einen schmalen Kopf. 37
38 Viele Vertreter der Hornfliegen leben an feuchten Orten. Ihre Larven sind an ein Leben im Wasser angepasst, wo sie sich von Wasserschnecken ernähren. Eine Larve des Aaskäfers Es gibt aber auch landbewohnende Hornfliegenlarven. Adulte Hornfliegen halten sich meist an den Plätzen auf, wo sich auch die Larven entwickeln. Man findet die Fliegen auf der Vegetation oft mit dem Kopf nach unten sitzend. Meist leben die Arten, die sich von Schnecken ernähren, in Wäldern mit viel Bodenbewuchs oder an feuchten Orten, wie nassen Wiesen oder Ufervegetation. Sie verirren sich selten in Gebäude. Die meisten Arten durchlaufen während der warmen Jahreszeiten mehrere Lebenszy klen. Dann überlappen sich die Generatio nen und man findet Eigelege, Larven und Puppen nebeneinander. Sie überwintern als Puppen, nur wenige überwintern als ausgewachsene Tiere. Unter den Aaskäfern gibt es spezialisierte Schneckenfresser, die auch gerne schädliche Nacktschnecken wie Deroceras reticulatum verzehren Hornfliegen (Sciomycidae) Manche Fliegenarten sind im Larvenstadium auf Schneckengewebe als Nahrungsquelle spezialisiert. Die meisten im Innern von Schnecken lebenden Fliegenlarven sind jedoch Aasfresser und besiedeln tote oder sterbende Tiere. Nur wenige Arten ernähren sich parasitisch oder töten ihren Wirt gezielt. Die landbewohnenden Arten sind unterschiedlich stark spezialisiert. Manche Hornfliegenarten können sich ausschließlich von Nacktschnecken ernähren. Die meisten leben als Parasitoide, das heißt, die Larven entwickeln sich im Körper des Wirtes und ernähren sich von dessen Gewebe, bis dieser stirbt. Die Larven mancher Arten sind räuberisch und überwältigen Schnecken, die um ein Vielfaches größer sind als sie selbst und töten diese. Drei Gruppen von Hornfliegen lassen sich anhand ihrer Ernährung unterscheiden: 38
39 6 NATÜRLICHE FEINDE Die erste Gruppe ist relativ unspezialisiert und parasitiert unterschiedliche Schnecken. Die Larve frisst an den Sekreten der Schnecke, bis diese stirbt. Meist geschieht dies noch während des zweiten Larvenstadiums. Nach Verzehr der Reste sucht die Larve weitere Opfer, die sie schnell tötet. Jede Larve kann drei oder vier Schnecken töten. Eine zweite Gruppe parasitiert nur bestimmte Schneckenarten, -gattungen oder -fa milien. Diese Hornfliegenarten bleiben im ersten Larvenstadium im Schneckenhaus und vermeiden den Fraß an lebenswichti gen Organen, damit die Schnecke am Leben bleibt, bis die Larve groß genug ist. Spätere Larvenstadien laufen frei umher, töten eine Schnecke, sobald sie hungrig sind, und ernähren sich vom Weichkörper, den sie nicht auf einmal fressen, sondern auch noch über einen längeren Zeitraum verwerten können. Auch die Arten, die nur Nacktschnecken fressen, beginnen ihr Larvenleben als spezialisierte Parasitoide, die bestimmte Schneckengattungen parasitieren. Die frisch geschlüpfte Larve liegt mit dem Hinterende nahe ihrer Eihülle auf dem Boden und führt mit dem Vorderende Suchbewegungen aus. Sobald sie eine Nacktschnecke der entsprechenden Gattung berührt, klettert sie schnell auf deren Körper und bohrt sich hinein. Darin bleibt sie über zwei Larvenstadien verborgen. Sobald die Schnecke gestorben ist was 20 Tage dauern kann verlässt die Larve die Schnecke und geht auf die Suche nach einem neuen Wirt. In dieser Phase ist Adulte Hornfliegen (hier: Coremacera marginata) sitzen oft mit dem Kopf nach unten auf der Vegetation, nah an den Plätzen, an denen sich auch ihre Larven entwickeln. sie jedoch nicht mehr auf eine bestimmte Schneckengattung angewiesen. Im letzten Larvenstadium lähmt die Larve ihr Opfer, indem sie ihm Neurotoxine spritzt. Jede Larve kann auf diese Weise zwei bis zehn Nacktschnecken töten. Bei der dritten und am höchsten spezialisierten Gruppe leben die parasitischen Larven solitär und jede Larve frisst jeweils nur eine Schnecke. Die Fliege legt ihre Eier direkt auf dem Schneckenhaus ab. Die Larve dringt ins Wirtsgewebe ein und verlässt es erst als adulte Fliege wieder. Wenn weitere Larven versuchen, in besetzte Schneckenhäuser einzudringen, werden sie von der bereits anwesenden getötet. Die Larve frisst eine Woche lang und durchläuft zwei Larvenstadien, bevor sie die Schnecke tötet. Die Überreste der Schnecke verzehrt sie ebenfalls und verpuppt sich anschließend im Schneckenhaus. 39
40 7 7. BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Landschnecken und besonders die Biologie, Schadwirkung und natürlichen Gegenspieler der Nacktschnecken vorgestellt. Im folgenden Teil geht es um die vorbeugende Abwehr eines Schneckenbefalls und um die mechanische, biologische und chemische Bekämpfung. In Nord- und Mitteleuropa gibt es mehr als 400 Landschneckenarten, darunter 54 Nacktschneckenarten. Von diesen werden nur wenige Arten an Kulturpflanzen schädlich. In der Regel sind dies die Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus, die Gartenwegschnecken Arion distinctus und Arion hortensis sowie Ackerschnecken wie die Gefleckte Ackerschnecke Deroceras reticulatum. Auch zwei Cepaea-Arten (Hainschnirkelschnecke oder Schwarzmündige Bänderschnecke (Cepaea nemoralis) und Gartenschnirkelschnecke oder Weißmündige Bänderschnecke (Cepaea hortensis) werden zu den schädlichen Schnecken gezählt Vorbeugende Maßnahmen Ansiedlung und Förderung natürlicher Feinde Eine sinnvolle Maßnahme gegen Schneckenbefall ist die Förderung der natürlichen Schneckenfeinde. Dazu gehören: Kleinstlebewesen wie Nematoden, Einzeller und Bakterien sowie Wirbeltiere wie Igel, Spitzmäuse, Maulwürfe, Salamander, Blindschleichen, Kröten, Frösche, Enten und Hühnervögel (Indische Laufente, Pekingente, Hühner und andere), Drosseln, Amseln, Elstern, Stare, Würger. 7.1 Schneckenbekämpfung in Haus- und Kleingärten Im Haus- und Kleingarten gibt es viele Möglichkeiten, einem Schneckenbefall sinnvoll vorzubeugen oder die Schnecken mit biologischen und chemischen Mitteln gezielt zu bekämpfen. Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die Abwehr- und Bekämpfungsmöglichkeiten. Bei den Wirbeltieren zählen unter anderem Grasfrösche zu den natürlichen Schneckenfeinden. Insekten wie Lampyriden (Leuchtkäfer), Silphiden (Aaskäfer), Driliden (Schneckenräuber), Carabiden (Laufkäfer) und Sciomyziden (Hornfliegen). Diese Tiere lassen sich fördern durch: Kleinbiotope wie Teiche, Tümpel, Feuchtbiotope, Hecken, Gehölzstreifen, sowie 40
41 7 BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN Insekten wie Laufkäfer und deren Larven sind die wichtigsten natürlichen Feinde von Schnecken. Die äußeren Blätter von Kopfkohl werden oft von Schnecken durchlöchert. Versteckmöglichkeiten für Kleinsäuger und Reptilien wie Reisighaufen, Erdhöhlen unter einzelnen Steinen, Steinpyramiden, Schichtmauern ohne Mörtel, Feldsteinhaufen oder Komposthaufen. Igel kann man gezielt durch das Auslegen von Hundefutter oder Eiern in den Garten locken. Brot und Milch vertragen sie dagegen nicht. In einer mit Stroh oder Heu ausgelegten trockenen Igelburg kann sich ein Igel dauerhaft ansiedeln, bei günstigen Futterbedingungen auch über mehrere Generationen. Die Wirkung der natürlichen Schneckenfeinde ist nicht nur im Haus- und Kleingarten, sondern auch in natürlichen und naturnahen Bereichen beachtlich (siehe Kapitel 6 Natürliche Feinde ) Resistente Pflanzenarten Generell können Nacktschnecken an fast allen krautigen Pflanzen fressen. Sie haben aber eindeutige Vorlieben für weichblättrige Pflanzen. Besonders gerne fressen sie an Kohl-, Kürbis- und einigen Zwiebelgewächsen, grünen Salaten, Erdbeeren, Dahlien, Funkien und Rittersporn. Nacktschnecken wie hier juvenile Tiere der Spanischen Wegschnecke Arion lusitanicus sind nachtaktiv und fressen unter anderem gerne die Blätter von Zwiebelgewächsen. Welkende Blätter mögen sie besonders gerne. Dagegen meiden sie Pflanzen mit einem hohen Anteil an Geschmacksstoffen wie Kerbel oder Koriander sowie ätherischen Ölen wie Eberraute, Kapuzinerkresse, Lavendel, Oregano, Rosmarin, Salbei, Thymian, Toma ten, Ysop. Mit diesen Pflanzen können Schnecken von Gärten oder Beeten abgehalten werden, man sollte diese Kräuter deshalb als Randbepflanzung nutzen. Auf die Spanische Wegschnecke scheinen einige dieser Inhaltstoffe allerdings keinen Einfluss zu haben. Sie frisst an Lavendel und Rosmarin. 41
42 Auch Pflanzen mit starker Behaarung wie Borretsch, Beinwell, Königskerze und Tomate oder mit abwehrenden Inhaltstoffen wie Efeu, Farne, Fleißiges Lieschen, Geranien, Gräser, Löwenmaul, Moose, Rhododendron und Vergissmeinnicht werden von vielen Schneckenarten nicht gefressen. Es lohnt sich auch im Haus- und Kleingarten weniger anfällige Sorten anzubauen. Zum Beispiel werden Kartoffelsorten wie Estima, Kestrel, oder Romano, Löwenmäulchen- sowie Funkiensorten und bestimmte Blütenmischungen als wenig anfällig angeboten. Schneckenzaun aus Kunststoff auf einem Beet mit Kohl Mechanische Barrieren Schnecken bewegen sich auf einer Schleimschicht vorwärts. Auf sehr rauen Untergründen ist es erheblich schwieriger eine durchgängige Schleimschicht zu bilden, daher meiden Schnecken diese Flächen. Dazu gehören zum Beispiel Flächen mit Asche, Holzasche, Branntkalk, zerbröselten Eierschalen, Splitt, grobem Sand, Kies, Rindenschrot, Holzschnitzel und Sägespäne, gepflasterte Flächen und Wege oder Begrenzungssteine. Die Materialien können flächig zwischen die Pflanzen oder als Dämme um Beete oder Gartenteile herum ausgebracht werden. Bei Trockenheit wirken solche Barrieren recht gut, bei Regen und Feuchtigkeit können Schnecken sie jedoch häufig leicht überwinden. Die Materialien müssen daher nach längeren Regenperioden erneut ausgebracht werden. Beim Mulchen mit Holzprodukten und Branntkalk muss jedoch bedacht werden, dass diese den ph-wert des Bodens Schneckenzäune aus Metall wie hier um ein Beet mit gemischter Bepflanzung sind dauerhaft wirksam. Elektrischer Schneckenzaun verändern können. Mit Asche und Schlacke können außerdem Schwermetalle in den Boden gelangen. Ein Streumittel mit dem Namen Schnecken-Zaun Neem-Dünger soll die Einwanderung der Schnecken verringern und die Ernährung der Pflanzen verbessern. Dadurch soll die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gestärkt und der Schneckenfraß reduziert werden. Das Produkt besteht aus entölten Samen des indischen Neembaumes. 42
43 7 BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN Dauerhaft wirksam sind Schneckenzäune aus Metall oder Kunststoff. Bei ihnen ist der obere Rand des Zauns nach außen gebogen. Den Schnecken gelingt es so nicht, den Rand zu übersteigen. Kupferdraht oder -blech oder unter Spannung stehende blanke Kup fer drähte sowie flache Litzen halten Schnecken ebenfalls ab. Bei diesen mechanischen Barrieren besteht allerdings die Gefahr, dass die Tiere überhängende Pflanzen als Brücken benutzen und über diese in die Beete gelangen. Außerhalb des Schneckenzauns sollten die Pflanzen deshalb kurz gehalten werden. Da Nacktschnecken trockene Böden meiden, beugt morgendliches, punktuelles Gießen der einzelnen Pflanzen einem Eindringen der Schnecken vor. Auch mit Netzen oder Vliesen, wie sie bei Möhren, Salat oder Kohl zur Abwehr von Schadschmetterlingen, -fliegen oder Thripsen eingesetzt werden, lassen sich Schnecken aus den Beeten fern halten. Hierzu müssen die Netze und Vliese am Beetrand tief in den Boden eingegraben werden. Voraussetzung ist aber, dass innerhalb der Beete keine Schnecken vorhanden sind oder sie wirkungsvoll bekämpft werden. Eigelege der Spanischen Wegschnecke Arion lusitanicus kann man im Herbst durch Ausgraben dezimieren Gezieltes Gießen Nacktschnecken meiden trockene Böden. Ein flächiges Gießen auch zwischen den Pflanzen in den Beeten erleichtert den Schnecken das Kriechen. Sie sind dann häufig auch tagsüber unterwegs. Ein gezieltes Gießen nur der einzelnen Pflanzen behindert die Ausbreitung der Schnecken stark und hilft auch gegen Unkrautbewuchs zwischen den Pflanzen Eigelege entfernen Besonders im Herbst und Frühjahr stößt man beim Umgraben im Boden mitunter auf die Eigelege von Schnecken, auf frühe Jugendstadien oder auf adulte Schnecken. Diese sollte man absammeln und mit dem Hausmüll entsorgen. Umgraben kann die Ausbreitung von Nacktschnecken dagegen auch fördern, da beim Umgraben Ritzen und Lücken zwischen den einzelnen Bodenstücken entstehen. Diese Hohlräume bieten den Schnecken Verstecke und leichten Zugang zu den 43
44 Wurzeln. In einem feinkrümeligen Boden finden Schnecken weniger Unterschlupf und können daher auch weniger Pflanzen schädigen. Kleinere Schneckenarten, wie die Acker- und Gartenwegschnecke, halten sich häufig tief im Boden auf. Daher ist es schwierig, ihre Eigelege im Herbst und Winter auszugraben. Den Befall durch die großen Arion- und Tandonia-Arten kann man auf diese Weise aber verringern Der richtige Platz für den Komposthaufen Schnecken können sich in Komposthaufen mit frischen Gemüseabfällen und Ähnlichem vermehren und auf benachbarte Kulturpflanzen abwandern. Der Kompostbehälter sollte deshalb möglichst weit von empfindlichen Kulturen entfernt aufgestellt werden. Die Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus findet auf Komposthaufen ein reichhaltiges Nahrungsangebot Maßnahmen zur direkten Bekämpfung Bei starkem Befallsdruck reichen die beschriebenen vorbeugenden Maßnahmen häufig nicht aus, um Schäden durch Nacktschnecken zu verhindern. Auch sind viele Gärten zu klein, um Biotope und Verstecke für Schneckenfeinde anzulegen. Dann sollten direkte Bekämpfungsverfahren gegen Nacktschnecken eingesetzt werden Biologische und biomechanische Maßnahmen Einsatz natürlicher Feinde Vogelarten wie die Indische Laufente (Anas platyrhynchos), die Mandarinente (Aix galericulata) oder das Haushuhn (Gallus gallus domesticus) können Schneckenpopulationen mindern. Ihr Einsatz ist aber nicht unproblematisch: Sie fressen wie die Schnecken auch an den Kulturpflanzen (wenn man sie lässt). Sie müssen vor Beutegreifern wie Füchsen oder Greifvögeln geschützt werden und benötigen besonders in der Nacht eine dafür geeignete Unterkunft. Enten brauchen einen ständigen Zugang zu Wasser, weil sie sonst an den Schnecken ersticken können. Ihre Haltung und ihr Einsatz sind somit aufwändig. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass Gemüse mit Kot verunreinigt wird und auf diesem Weg gefährliche Salmonellosen übertragen werden können. Vor der Saat und nach der Ernte können Laufenten und Hühner sinnvoll auf Beeten und Schlägen eingesetzt werden. Auch sollten sie rund um abgegrenzte Beete und Gewächshäuser nach Schnecken jagen 44
45 7 BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN können. Hier halten sie zusätzlich Gras und Wildkräuter kurz. Die Vögel sollten aus Tierschutzgründen aber weder geleast noch verliehen werden. In Zeiten der Vogelgrippe sind ihrem Einsatz zudem enge Grenzen gesetzt. Andere natürliche Gegenspieler der Nacktschnecken und ihre Förderung sind bereits im Kapitel 6 Natürliche Feinde behandelt worden. Die hier erwähnten Vögel gehören nicht zu den spontan auftretenden Gegenspielern. Sie müssen gezielt vom Menschen eingesetzt werden Anlocken und Absammeln der Schnecken Das Anlocken und Absammeln der Nacktschnecken ist aufwändig und nur auf kleinen Flächen möglich, aber eine der sichers ten Bekämpfungsmethoden, wenn sie mit weiteren Methoden kombiniert wird. Die Schnecken sollten in den Abend- beziehungs weise frühen Morgenstunden und besonders an Regentagen im Garten abgesammelt werden. Entsorgen kann man sie am besten in einem naturnahen Gelände, zum Beispiel in Wald, Wiese, Fluss- oder Bach böschung, über den Kompost oder über den Hausmüll. Tote Schnecken sind nährstoffreich und werden von Artgenossen bevorzugt gefressen. Artgenossen an, da die toten Schnecken nährstoffreich sind und bevorzugt gefressen werden. Daher ist es ratsam, die toten Schnecken über den Hausmüll (Biomüll) zu entsorgen. Bietet man den Schnecken selbstausgelegte Verstecke an, kann man sie leichter aufsammeln. Als künstliche Verstecke können alte Bretter, Hohlziegel, alte Säcke, schwarze Folien, ausgehöhlte Pampelmusenhälften oder große Blätter, zum Beispiel von Rhabarber, dienen. Sie sollten flach auf den Boden ausgelegt werden. Werden die Schnecken in einem naturnahen Gelände entsorgt, besteht die Gefahr, dass sie wieder zuwandern. Bei der Entsorgung über den Kompost müssen die Tiere vorher getötet werden. Sie mit kochendem Wasser abzutöten erhöht zwar den Aufwand, ist jedoch eine schnelle und effiziente Methode neben dem Zerschneiden mit Messer oder Schere. Entsorgt man die getöteten Schnecken über den Kompost, lockt dies jedoch Alte Bretter können als künstliche Verstecke ausgelegt werden. Unter ihnen kann man die Schnecken leicht aufsammeln. 45
46 Bei Säcken, Folien und Blättern kann eine Befestigung am Boden notwendig sein. In diesen Verstecken kann man die Schnecken tagsüber finden und einsammeln. Hühner-, Hunde- oder Katzenfutter sowie Sauerteig in den Verstecken lockt sie besonders effektiv an. Die Verstecke müssen regelmäßig kontrolliert werden Einsatz von molluskenpathogenen Nematoden Seit einigen Jahren wird zur Nacktschneckenbekämpfung auch der molluskenpathogene Nematode Phasmarhabditis hermaphrodita angeboten. Die Nematoden sind mit bloßem Auge kaum erkennbar, da sie nur rund 1 mm groß werden. In Versuchen wirkten sie gut gegen die Genetzte Ackerschnecke (Deroceras reticulatum), in höherer Dosierung verhinderten sie bei der Gartenwegschnecke (Arion distinctus, Arion hortensis) die Nahrungsaufnahme. Die Gehäuseschnecken Helix pomatia (Weinbergschnecke) und wohl auch Cornu aspersum (Gefleckte Weinbergschnecke) infiziert der Nematode nicht. Eine Wirkung gegen die Spanische Wegschnecke (Arion lusitanicus) war in Versuchen der ehemaligen Landesanstalt für Pflanzenschutz, Stuttgart, nicht gegeben. In anderen Arbeiten wird jedoch über eine Wirkung gegen junge Stadien dieser Art mit einem Wirkungsgrad von rund 50 Prozent berichtet. Phasmarhabditis hermaphrodita ist unter natürlichen Verhältnissen mit verschiedenen Bakterien wie Pseudomonas fluores cens, Providencia rettgeri und anderen vergesellschaftet. Die Nematoden dringen durch eine Körperöffnung (Exkretionsöffnung) Nematoden der Gattung Phasmarhabditis hermaphrodita auf einer Zählplatte. Von den Bakterien des Nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita infizierte Genetzte Ackerschnecken. am hinteren Ende des Mantelschilds in die Nacktschnecke ein. Hier geben sie die Bakterien ab, die sich in der Schnecke vermehren und dem Nematoden als Nahrungsgrundlage dienen. Die Bakterien wiederum infizieren die Schnecke, führen zum Abbau des inneren Schalenrestes und schließlich zu einer Sepsis. Der Mantelschild der Schnecke schwillt dann an und das Tier verendet. Die sterbenden Schnecken ziehen sich meist in das Erdreich zurück, sodass abgetötete Tiere selten zu finden sind. Der Nematode entwickelt und vermehrt sich in den Resten der Schnecke. Eine Nematodenanwendung wirkt etwa sechs Wochen lang. Daher ist es sinnvoll, Saaten und Jungpflanzen mit Nematoden zu schützen. 46
47 7 BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN Anwendung des molluskenpathogenen Nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita Die Nematoden sollten einige Tage vor der Pflanzung oder der Saat ausgebracht werden, am besten vor einem Regenschauer, bei trübem Wetter oder abends. UV-Strahlen also auch Sonnenlicht können die Nematoden abtöten. Wird der Boden vor der Anwendung befeuchtet, sind die Nematoden beweglicher. Sie sollten unter ständigem Aufrühren mit viel Wasser in den Boden eingeschwemmt werden. Falls die Ausbringung mit einer Pflanzenschutzspritze erfolgt, darf nur mit großen Düsen (> 1 mm) und ohne Filter gearbeitet werden. Gegen Ackerschnecken sollten pro Quadratmeter Phasmarhabditis hermaphrodita und gegen die Gartenwegschnecken Arion distinctus und Arion hortensis Nematoden pro Quadratmeter (3 5 x 10 9 /ha) ausgebracht werden. Die Nematoden sind im Kühlschrank nur wenige Tage haltbar. Sie können ab einer Bodentemperatur von 5 C eingesetzt werden. Die Gebrauchsanleitung auf der Packung ist stets zu beachten. Vor dem Einkauf und dem Einsatz der Nematoden ist es aber sinnvoll zu prüfen, welche Schneckenart die häufigste im Garten ist. Herrscht die Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus vor, so sind zusätzlich weitere Bekämpfungsmethoden zu wählen. Die Ausbringung der schneckenpathogenen Nematoden mithilfe einer Gießkanne erfolgt am besten einige Tage vor der Pflanzung oder der Saat Chemische Nacktschneckenbekämpfung Zur chemischen Schneckenbekämpfung sind Präparate mit den Wirkstoffen Metaldehyd und Eisen-III-Phosphat im Haus- und Kleingarten zugelassen. Ihre Wirkung auf die Schnecken und die Umwelt ist recht unterschiedlich. Beide Wirkstoffe besitzen momentan sowohl im Haus- und Kleingarten als auch im Ackerbau eine Zulassung; Stand: Juni Aktuelle Hinweise zur Zulassungssituation sind in der Pflanzenschutzmittel-Datenbank im Internet zu finden. Wichtig ist, dass man vor einer Anwendung die Gebrauchsanleitung auf der Packung liest und beachtet. Das schützt vor Enttäuschung und zusätzlichen Kosten Metaldehyd Metaldehyd wird schon seit über 70 Jahren zur Schneckenbekämpfung genutzt. Es wird mit Kleie oder Mehl gemischt als Fraßgiftköder eingesetzt. Die Schnecken schleimen nach der Aufnahme von Metaldehyd stark und trocknen aus. Der Wirkstoff kann in größerer Menge auch Wirbeltiere wie Igel, Ratten, Hunde oder Meerschweinchen töten. Der LD 50 -Wert liegt bei 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Vergiftungen treten äußerst selten auf, da metaldehydhaltige Mittel von Wirbeltieren in der Regel gemieden werden. Bei ordnungsgemäßer Anwendung ist der Wirkstoff weder bienengefährlich noch fischtoxisch. Metaldehydhaltige Schneckenkörner werden einzeln zwischen die Pflanzen gestreut. Metaldehyd findet sich als Wirkstoff in sehr vielen 47
48 Produkten von verschiedenen Herstellern und in unterschiedlichen Aufmachungen, zum Beispiel als Granulat oder Linsen. Die Regenbeständigkeit vieler Mittel wurde in den letzten Jahren deutlich verbessert Methiocarb Zum 19. September 2014 ist die Zulassung für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Methiocarb zur Anwendung gegen Schnecken widerrufen worden. Das betrifft die Mittel Mesurol Schneckenkorn und Bayer Garten Schneckenkorn Mesurol. Die Mittel dürfen ab dem 19. September 2014 weder verkauft noch angewendet werden! Restmengen sind über den Sondermüll zu entsorgen. Methiocarb ist ein Fraßgift, das über eine Störung des Nervensystems wirkt. Die Wirkung tritt sehr schnell ein und hält lange an. Es ist jedoch schon in niedriger Dosierung toxisch für Wirbeltiere. Der LD 50 -Wert für Ratte, Maus, Hund und Meerschweinchen liegt zwischen 20 und 58 Milligramm und bei Vögeln je nach Art zwischen 5 und 190 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der Wirkstoff tötet auch viele Insekten wie Fliegen, Käfer, Schmetterlinge und Wanzen, zudem ist er bienengefährlich und fischtoxisch. Die Schnecken sterben auf der Erd oberfläche ab. in NEU 1165 Garten vorhanden ist, um nur einige zu nennen. Diese Mittel bestehen jeweils aus einem Lockstoff und dem in geringen Mengen auch in Pflanzen enthaltenen Eisen-III-Phosphat. Als Abbauprodukte bilden sich unschädliche organische Reste sowie die Pflanzennährstoffe Eisen und Phosphat. Das Mittel wird zwischen die Pflanzen gestreut und muss regelmäßig nachgestreut und befeuchtet werden. Schneckenkorn-Pellets werden zwischen die Pflanzen gestreut, sie müssen bei Eisen-III-phosphathaltigem Schneckenkorn regelmäßig nachgestreut und befeuchtet werden. Wenn die Schnecken das Schneckenkorn gefressen haben, ziehen sie sich in ihre Verstecke zurück und sterben dort. Es wirkt nicht nur gegen Nacktschnecken, sondern auch gegen die beiden häufigsten Cepaea-Arten Eisen-III-Phosphat Eisen-III-Phosphat ist ein Wirkstoff, der seit Herbst 1998 in Deutschland zur Schneckenbekämpfung in Fraßgiftködern zugelassen in Mitteln wie Bayer Garten Schneckenkorn Biomol, COMPO Bio Schneckenkorn, Derrex, Ferramol Schneckenkorn sowie Schneckenkorn Ferramol auf Holzmulch, mit einer Aufwandmenge von 350 Körnern pro Quadratmeter 48
49 7 BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN Bei Versuchen zeigte der umweltfreundliche Wirkstoff Eisen-III-Phosphat eine genauso gute Wirkung wie metaldehydhaltige Präparate, wenn alle genannten Voraussetzungen (siehe Kasten Übersicht zur Anwendung von Eisen-III-phosphathaltigen Pflanzenschutzmitteln ) erfüllt wurden Kombinationen verschiedener Bekämpfungsmethoden Da die vorgestellten Maßnahmen gegen Schnecken auf unterschiedliche Weise wirken und dementsprechend Vor- und Nachteile aufweisen, ist es sinnvoll, verschiedene Methoden zu kombinieren. So müssen Methoden, die Schnecken im Garten und in den Beeten vor Ort bekämpfen, mit Methoden kombiniert werden, die das Zuwandern weiterer Schnecken in den Garten bzw. die Beete verhindern. Zum Beispiel unterbinden Schneckenzäune ebenso wie in den Boden tief eingelassene Netze/Vliese die Zuwanderung von Schnecken in eine Fläche. Innerhalb der so geschützten Fläche leben aber in der Regel auch schon Nacktschnecken. Diese sollten mit direkten Methoden reduziert werden. Die toten Schnecken sollten regelmäßig aus der Falle entfernt und das Bier erneuert werden. Übersicht zur Anwendung von Eisen-III-phosphathaltigen Pflanzenschutzmitteln Die Anwendung erfolgt am besten in den Abendstunden, zum Beispiel nach dem Säen oder Pflanzen. Das Mittel kann dann gut Feuchtigkeit aufnehmen eine wichtige Voraussetzung dafür, dass es optimal und bei den nachtaktiven Schnecken umgehend wirkt. Auf leichten Böden kann dies problematisch sein. Die schnelle Wirksamkeit ist wichtig, da Schnecken vor allem Jungpflanzen innerhalb einer Nacht vernichten können. Bei der Anwendung von Eisen-III-phosphathaltigem Schneckenkorn sollten auch die Randbereiche mitbehandelt werden. Das Mittel muss unbedingt breitwürfig verteilt werden, am besten auch die Randbereiche mitbehandeln. Die Körner sollten nicht auf die Pflanzen geworfen werden. Ein Ausbringen in Häufchen oder ringförmig um einzelne Pflanzen bringt nur wenig Erfolg. Ist das Schneckenkorn in den folgenden Tagen teilweise oder ganz weggefressen, muss sofort nachgestreut werden. Das Nachstreuen ist regelmäßig zu wiederholen. Trockener Boden sollte kurz bewässert werden. Feuchtes Granulat hat eine bessere Lockwirkung. Eine grobkrümelige Bodenoberfläche ist vor dem Schneckenkorn-Einsatz zu glätten. 49
50 Schneckenzaun und Bierfalle: Bierfallen sind nur innerhalb kleinerer, abgegrenzter Areale sinnvoll. Die Kombination beider Verfahren wirkt gegen zuwandernde und im Beet befindliche Schnecken wie Acker- und Wegschnecken. Nützliche Schneckenarten gehen nicht in die Falle, wohl aber Laufkäfer und Spinnen. Das Bier sollte regelmäßig erneuert und die toten Schnecken aus der Falle entfernt werden. In diesen Kleingarten können leicht Schnecken aus der angrenzenden Wiese zuwandern. Vlies oder Netz und Bierfalle: Diese Kombination wirkt gegen zuwandernde und im Beet befindliche Schnecken wie Acker- und Wegschnecken. Bier regelmäßig erneuern, Vliese und Netze tief eingraben. Schneckenzaun und Schneckenkorn: Das Schneckenkorn nur innerhalb abgegrenzter Areale oder um empfindliche Bestände herum ausbringen. Schneckenzaun und Absammeln: Anlocken in Verstecke unter Steinen und Ähnlichem oder durch Köder wie Brot- (Sauer-)teig, Hunde- oder Katzenfutter innerhalb des Schneckenzauns; eventuell zusätzlich Nematoden einsetzen. Dies ist eine recht aufwändige und teure, aber effektive Kombination der verschiedenen Methoden. Einsatz eines Aluminiumblechs zur Schneckenabwehr in Richtung einer Wiese Laufenten und Zaun, Netze oder Vliese und Nematoden: Die Laufenten werden außerhalb der umfriedeten Beete gehalten. Die Nematoden werden innerhalb der Begrenzungen eingesetzt. Die genannte Kombination unterbindet die Zuwanderung der Schnecken und tötet schon vorhandene durch die Nematoden ab. Die gemeinsame Anwendung der Verfahren wird aber nur bei sehr starkem Befallsdruck notwendig sein. 50
51 7 BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN Schneckenzaun an benachbarten Flächen: Nacktschnecken wandern in Gärten häufig aus Streuobstwiesen, Äckern, Rasenflächen und Ruderalflächen ein. Versuche haben gezeigt, dass ein Schneckenzaun an der Grenze zu diesen Flächen die Zuwanderung der Schnecken drastisch verringern kann. Auch aus Rasenflächen im Garten wandern stets Schnecken in die Gemüse- und Zierpflanzenbeete ein, daher ist es sinnvoll, auch Rasenflächen von anderen Gartenteilen mit einem Schneckenzaun abzugrenzen. Steinplatten vor dem Schneckenzaun verhindern, dass Pflanzen direkt vor dem Zaun wachsen und den Schnecken als Brücke dienen. Das Gleiche gilt für stark verdünnten Sud aus Chilischoten. Nach dem seit 2012 gültigen neuen Pflanzenschutzgesetz und der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 müssen Substanzen zur Selbstherstellung von Pflanzenschutzmitteln (sogenannte Basissubstanzen) in einer Liste der EU eingetragen sein. Bisher sind hier jedoch nur zwei Mittel aufgenommen, die zudem nicht die Schneckenbekämpfung betreffen. Daher gibt es derzeit keine legale Möglichkeit, Mittel zur Schneckenbekämpfung selbst herzustellen, auch nicht aus bisher traditionell angewendeten oder den oben genannten Mitteln. Ihre Anwendung stellt somit einen Verstoß gegen das Pflanzenschutzgesetz dar. (Stand Juni 2014) Alternative Mittel zur Bekämpfung In der Vergangenheit wurde versucht, Salate mit kalten Auszügen oder speziellen Jauchen zum Beispiel aus Begonien, Farnkraut, Fichten- und Tannenzapfen, Johannisbeeren oder Moosen vor Schneckenfraß zu schützen. Knoblauch-Granulate sollten ebenfalls die Fraßaktivität der Schnecken vermindern. Viele dieser Mittel wirkten kaum oder nur bis sie vom nächsten Regen abgewaschen wurden. Von verschiedenen Seiten wird Koffein als Mittel gegen Schnecken empfohlen. In einer Konzentration von 1 bis 2 Prozent tötet es Nacktschnecken schnell und zuverlässig ab. Dabei werden jedoch auch behandelte Pflanzen und Nützlinge geschädigt. Schon bei einer Konzentration von nur 0,1 Prozent, die Schnecken nur abschreckte, verursachte Kaffee Verbrennungen an Blättern, zum Beispiel bei Salat. Von dieser Anwendung ist somit nicht nur wegen der Kosten für den Kaffee abzuraten. 7.2 Schneckenbekämpfung im Acker- und Gemüsebau Im Acker- und Gemüsebau schädigen vor allem die Genetzte Ackerschnecke Deroceras reticulatum und die Gartenwegschnecken Arion distinctus und Arion hortensis. Andere Nacktschnecken-Arten wie Arion lusitanicus halten sich eher im Randbereich auf Böschungen oder Wegrändern auf. Im Landbau ist die Bekämpfung von Schnecken wesentlich schwieriger als im Haus- und Kleingarten. Trotzdem sollten sich die Maßnahmen nicht nur auf die Anwendung von Schneckenkorn beschränken. Wichtige Strategien, die durchaus ihren Beitrag zu einer kostengünstigen umweltgerechten Bekämpfung von Nacktschnecken leisten können, bleiben sonst unberücksichtigt. Eine vorbeugende Bekämpfungsmaßnahme ist zum Beispiel die Bodenbearbeitung mit nachfolgender Bodenverfestigung. 51
52 Das Verfestigen verhindert die Entstehung von Hohlräumen, in denen die Schnecken Hitze- und extreme Kälteperioden überdauern könnten. Sinnvoll ist es auch, Erntereste gleichmäßig zu verteilen und einzuarbeiten. Diese Maßnahmen sind auf großen Flächen jedoch sehr arbeitsaufwändig. Auch im Ackerbau werden Vorlieben der Nacktschnecken für bestimmte Pflanzen deutlich. Sie fressen gerne Jungpflanzen von Raps, Getreide, Zuckerrüben und Sonnenblumen. Besonders gefährdet sind Saatgut und Keimlinge in der Auflaufphase: Beim Raps sind dies in erster Linie die Entwicklungsstadien 09 bis 20, bei Getreide die Entwicklungsstadien 02 bis 05. Der Mais ist erst ab dem 4-Blattstadium nicht mehr gefährdet. In Gemüsekulturen bevorzugen die Schnecken Wirsing, Rot- und Weißkohl, Blumenkohl, Salat, Spinat und Zuckermais. Hier kann ein Schneckenfraß in fast allen Altersstufen der Pflanze zu finanziellen Verlusten in Form von Pflanzenausfällen oder Kosten für das Putzen des Gemüses führen Vorbeugende Maßnahmen im Gemüsebau Fruchtfolge Kulturen mit hohem Bodendeckungsgrad wie Kohl, Salat, Zuckermais und Spinat fördern insbesondere in feuchten Jahren die Vermehrung der Nacktschnecken. Nach milden Wintern kann sich das in der Folgekultur sehr negativ bemerkbar machen. Empfindliche Kulturen sollten daher nicht auf Schlägen mit vorhergehendem dichtem Bewuchs angebaut werden. Eine leichte Verunkrautung kann als Ablenkfutter dienen und Nützlinge fördern. Verunkrautung Eine leichte Verunkrautung kann als Ablenkfutter dienen und direkt oder indirekt Nützlinge wie schneckenfressende Laufkäfer und Wirbeltiere fördern. Ein hoher Unkrautbewuchs führt jedoch dazu, dass sich die Schnecken gut vermehren können. Außerdem konkurriert das Unkraut mit den Nutzpflanzen um Nährstoffe und Wasser. Saattiefe und Saattermin In Versuchen konnten Fraßschäden an Gemüse um 10 bis über 20 Prozent vermindert werden, wenn die Samen 4 bis 5 cm tief gesät wurden. Ein früher Saattermin hatte dagegen keine Vorteile. Randstreifen Nutzpflanzen sollten mindestens ein bis drei Meter Abstand zu Hecken, extensiven Wiesen, schattigen Stellen oder Brachen aufweisen. Der Randstreifen muss stets kurz gehalten werden. Barrieren in Form von Kiesund Sandstreifen, Kräutern (siehe Kapitel ), Pflastersteinen oder Schneckenzäunen können eine Zuwanderung der Schnecken verringern. Bei einem Schneckenzaun 52
53 7 BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN Vorbeugende Maßnahmen im Ackerbau Ein Streifen mit Ablenkpflanzen neben der Kultur und ein unbestellter Schutzsstreifen als Abstand zur benachbarten Wiese vermindern das Einwandern von Schnecken. Ein genügend großer Abstand zum Nachbarbeet hilft, die Wanderung der Schnecken zu begrenzen. sollte jedoch auf die unerwünschte Brückenbildung durch überhängende Pflanzen geachtet werden. Vorbereitung des Saat- oder Pflanzbeetes Das Saat- oder Pflanzbeet sollte möglichst feinkrümelig sein, um Schnecken keine Unterschlupfmöglichkeiten zu bieten. Saattiefe und Saattermin Versuchsergebnissen zufolge konnte eine tiefe Saatfurche von 4 bis maximal 5 cm bei Weizen einen frühen Schadfraß um 10 bis über 20 Prozent verringern. Ein früher Saattermin hatte dagegen keine Vorteile. Bodenbearbeitung Der Bodenbearbeitung kommt bei der vorbeugenden Schneckenbekämpfung eine Schlüsselstellung zu. Generell gilt: Je weniger der Boden zum Beispiel durch Pflügen oder Grubbern bewegt wird, desto besser vermehren sich die Nacktschnecken. Im Umkehrschluss kann das Pflügen vor einer Bepflanzung mit empfindlichen Kulturen die Population der Genetzten Ackerschnecke nachhaltig reduzieren. Wichtig ist, dass die beim Pflügen entstandenen Bodenschollen durch Eggen umgehend eingeebnet werden. Die Nacktschnecken könnten sich sonst in den geschaffenen Hohlräumen in tiefere Bodenschichten zurückziehen, wo sie mit dem nachfolgenden Walzen nicht mehr erreicht und reduziert werden können. Einoder zweimaliges Walzen des Bodens nach der Saat verbessert den Bodenschluss und damit die Wasserversorgung der Keimlinge, da es die im Boden befindlichen Hohlräume schließt. Außerdem werden dadurch die Schnecken in ihrer Fortbewegung im Boden behindert und zum Teil abgetötet. Die Bestandsdichte von Winterraps konnte durch Walzen um 31 bis 64 Prozent je nach vorheriger Bodenbearbeitung gegenüber der Kontrolle erhöht werden. Gleiche Effekte ließen sich auch im Gemüsebau ermitteln. 53
54 Die richtige Bodenbearbeitung kann helfen, einem Schne ckenbefall vorzubeugen. Beim Pflügen entstandene Bodenschollen sollten durch Eggen umgehend eingeebnet werden. Schonung der natürlichen Gegenspieler Ohne natürliche Gegenspieler ist eine integrierte Schneckenbekämpfung nicht möglich. Auch im Landbau können Nützlinge wie Laufkäfer, Kurzflügelkäfer, Igel, Spitzmäuse, Vögel sowie Nematoden, Einzeller und Bakterien die Schneckenpopulationen deutlich reduzieren. Vorbeugende Maßnahmen gegen einen Befall schonen die natürlichen Gegenspieler. Ist eine chemische Bekämpfung erforderlich, sollten nützlingsschonende Molluskizide ausgewählt werden Chemische Bekämpfung im Acker- und Gemüse - bau Ernterückstände sollten nicht in den Boden eingearbeitet, sondern entfernt werden. Verschlämmung und Krustenbildung vermeiden Gepflügte Flächen können nach dem ersten Regen verkrusten. Diese Kruste, die durch Tonmineralien und Feinschluff erzeugt wird, verzögert das Auflaufen der Pflanzen, sodass sie dem Schneckenangriff über eine längere Zeit ausgesetzt sind. Wird die Krustenbildung verhindert, schützt dies die Pflanzen vor Schneckenfraß. Umgang mit Pflanzenresten Englischen Untersuchungen zufolge konnte der Schneckenbefall langfristig verringert werden, wenn Pflanzenreste abtransportiert wurden, statt sie zu häckseln und einzuarbeiten. Im integrierten Pflanzenbau sollten Schaderreger nur bekämpft werden, wenn ihre Anzahl so hoch ist, dass wirtschaftliche Einbußen drohen (Schadschwelle). Exakte Daten zur tatsächlichen Schneckendichte auf einem Acker oder Beet sind jedoch kaum zu erhalten. Mit Lockfallen lässt sich nur die Aktivität der Schnecken erfassen. Diese ist jedoch von mehreren Faktoren abhängig, wie dem Schneckenbesatz im Bestand, der Temperatur, der Boden- und Luftfeuchtigkeit oder dem Sättigungsgrad der Tiere. Zudem sind Schnecken niemals gleichmäßig in einem Bestand verteilt. Auch gibt es zurzeit nur Hinweise und keine handfesten Daten zu Schadschwellen für Nacktschnecken in den verschiedenen Beständen. Viele Landwirte umgehen das Dilemma, indem sie bei empfindlichen Kulturen vorbeugend Schneckenkorn anwenden. Wichtig ist dabei, dass die Anwendung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, es wirkt in auflaufenden Kulturen besser als während der Saat. 54
55 7 BEKÄMPFUNG VON SCHADSCHNECKEN Allerdings ist die Ausbringung während der Saat weniger arbeitsaufwändig. Die zwei im Acker- und Gemüsebau zugelassenen molluskiziden Wirkstoffe wurden bereits im Kapitel Chemische Schneckenbekämpfung vorgestellt. Vor einer Anwendung ist unbedingt die Zulassungssituation zu beachten (Pflanzenschutzmitteldatenbank Hier können Angaben zu den zugelassenen Anwendungen, zur Aufwandmenge und weitere Daten abgefragt werden. Bevor eine chemische Bekämpfung erfolgt, sollte man generell alle nicht chemischen Maßnahmen angewendet haben. So sehen es die Richtlinien des integrierten Pflanzenbaus vor. Ist eine Anwendung von Schneckenkorn nicht zu umgehen, sollte man das Mittel unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten auswählen. Entscheidungskriterien können zum Beispiel sein: die Menge beziehungsweise die Anzahl Schneckenkorn pro m², die Regenfestigkeit (einige Produzenten werben mit der speziellen Regenfestigkeit ihres Schneckenkorns), die Stabilität des Einzelkorns bei der Ausbringung und im Feld, der Preis, die Anwenderfreundlichkeit (Schneckenkorn von annähernd gleicher Korngröße und in Linsenform ist gleichmäßiger auszubringen als unterschiedlich geformtes), die schnelle Anfangswirkung oder eigene Erfahrungen mit den Mitteln in Bezug auf die Wirksamkeit. Gleichmäßig verteilte Schneckenkorn-Pellets erhöhen die Wirkung. Da die Mittel Schnecken weniger stark an locken als manche Pflanzen, können schon Pflanzen gefressen werden, bevor die Schnecke auf Schneckenkorn trifft. Viele gleichmäßig verteilte Körner erhöhen daher die Wirkung. Ein Mittel, das nur in geringen Kornzahlen pro m² gestreut werden darf, ist weniger geeignet. Die Regenfestigkeit und Stabilität des Einzelkorns sind weitere Kriterien für die Qualität des Schneckenkorns. Wenn ein Mittel zu schnell zerfällt, wirkt es nicht und belastet den Boden. Auch die einheitliche Größe der Körner kann ein Auswahlkriterium sein. Stark stäubende Mittel sind in der Praxis weniger beliebt, bei großflächiger Anwendung spielt auch der Preis eine Rolle. 55
56 8. GLOSSAR adult Alveolen Arthropoden Artkomplex bilateral Biotop Blindsack Epithel Enzyme extrazellulär Fußretraktor Gastropoda Generalisten Gonade Hämocyanin Hämolymphe Hybridisierung Hydrogel Hydroskelett juvenil erwachsen oder geschlechtsreif napf-, mulden- oder bläschenartige Gebilde Gliederfüßer (Insekten, Spinnentiere und Krebse) zwei oder mehr nahe verwandte Arten, die ein ähnliches Aussehen besitzen und deren Verwandtschaftsverhältnisse nicht gut erforscht sind zweiseitig der von einer Gemeinschaft besiedelte Lebensraum, der anhand von bestimmten biotischen Merkmalen (z. B. Populationsdichte, Feinde) und abiotischen Merkmalen (z. B. Klimaeinflüsse, chemisch-physikalische Eigenschaften des Bodens sowie geografische Bedingungen) charakterisiert wird Organ am hinteren Ende des Magens einer Schnecke, in dem sich der Nahrungsbrei staut und in dem hauptsächlich die Verdauung durch die Sekrete der Mitteldarmdrüse stattfindet eine zusammenhängende Zellenlage, welche die Köperoberfläche oder einen inneren Hohlraum bekleidet Eiweiße, die von lebenden Zellen gebildet werden und bestimmte Stoffwechselreaktionen des Organismus ermöglichen außerhalb einer Zelle Muskel, der den Fuß der Gehäuseschnecke in das Gehäuse zieht Schnecken; artenreichste Tierklasse aus dem Stamm Mollusca Tierarten, die ein breites Nahrungs- bzw. Wirtsspektrum nutzen Keim- oder Geschlechtsdrüse (von gr. häm=blut, cyanos = himmelblau) sauerstoffbindender Bestandteil des Blutes der Gliederfüßer und vieler Weichtiere Körperflüssigkeit der Gliederfüßer und vieler Weichtiere, die unter anderem dem Transport von Nährstoffen, dem Temperaturausgleich, dem Sauerstofftransport und dem Verschluss von Wunden dient Kreuzung von genetisch ungleichen Eltern (verschiedene Rassen oder Arten) Wasser enthaltende, aber wasserunlösliche chemische Verbindung, deren Moleküle zu einem dreidimensionalen Netz verknüpft sind hier: Der Flüssigkeitsdruck im Innern versteift das Tier bzw. einzelne Organe; bestimmte Muskeln arbeiten gegen den Flüssigkeitsdruck jugendlich 56
57 8 GLOSSAR Karnivoren Kapillarität Kontraktion Kulturfolger larval LD 50 -Wert Litze Mantel Mollusca molluskenpathogen Molluskizid Neozoen Neurotoxine Osmose Parasitoid Photoperiode planktonisch Puffer Radula Reflexion Retina Resorption Fleischfresser durch Oberflächenspannung bedingtes Einströmen von Flüssigkeiten bei Kontakt mit engen Röhren, Spalten oder anderen Hohlräumen Zusammenziehen, zum Beispiel von Muskeln Tiere oder Pflanzen, die vom Menschen beeinflusste Lebensräume besiedeln die Larve oder das Larvenstadium betreffend Maß für die akute Giftigkeit einer Substanz (üblicherweise in mg/kg Körpergewicht), im Tierversuch entspricht der Wert der Menge, die bei einmaliger Gabe den Tod von 50 % der Versuchstiere zur Folge hat ein aus dünnen Einzeldrähten bestehender und daher leicht zu biegender elektrischer Leiter den Rücken einer Schnecke bedeckendes Organsystem, bildet eine Einheit mit dem Eingeweidesack; der Mantelrand scheidet die Schale ab Weichtiere Krankheiten bei Weichtieren verursachend chemische Mittel, die Weichtiere, insbesondere Schnecken, töten (Einzahl: Neozoon) Tierarten, die nach 1492 (Entdeckung Amerikas) in andere Gebiete eingeschleppt wurden oder eingewandert sind und sich dort etabliert haben Nervengifte Hindurchtreten (durch Diffusion) von Flüssigkeitsmolekülen durch eine halbdurchlässige Membran, mit der Tendenz, Konzentrationsunterschiede gelöster Teilchen auf beiden Seiten auszugleichen Tier (in der Regel ein Insekt), das in seiner Entwicklung parasitisch lebt und seinen Wirt dabei tötet Verhältnis zwischen Licht und Dunkelphase (Tag/Nacht), hängt von der Jahreszeit und dem geografischen Breitengrad ab wie Plankton im Wasser schwebend (Plankton = Bezeichnung für frei im Wasser schwebende Organismen) Stoffgemisch, meist aus einer schwachen Säure und dem basisch wirkenden Salz der Säure, dessen ph-wert sich bei Zugabe einer Säure oder Base weniger stark ändert auch Raspelzunge: Das Mundwerkzeug der Weichtiere: Ein bezahntes chitinöses Band, das meistens mit dem Radulaknorpel eine zungenartige Struktur bildet. Rückstrahlung, Widerspiegelung Netzhaut Aufnahme 57
58 Rezeptor Ruderalflächen Seitenbinden Sepsis sklerotisiert solitär Spindelmuskel Tentakel Zellulose für spezifische Reize empfindliche Empfangseinrichtung eines Organs; meist Sinneszellen, die chemische oder physikalische Reize an das Nervensystem weitergeben unter dem Einfluss des Menschen entstandene Biotope (lat. rudus = Schutt, Ruine, Bauabfall); vor allem auf Brachen sowie an stickstoffreichen Wegrändern und Kompostplätzen zu finden; Standorte meist nährstoffreich Färbung auf den Längsseiten des Körpers eine außer Kontrolle geratene Infektion, umgangssprachlich auch Blutvergiftung verhärtet (Sklerose = Verhärtung von Organen oder Gewebe) allein Rückziehmuskel bei Gehäuseschnecken, der den Körper der Schnecke mit dem Gehäuse verbindet Fühler Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden, bestehend aus langkettigen Makromolekülen (Polysaccharid) 58
59 aid-medien Kompost im Garten Organische Abfälle fallen in jedem Garten und Haushalt an. Mit geringem Aufwand lässt sich daraus ein hervorragendes Dünge- und Bodenverbesserungsmittel herstellen: Kompost. Das Heft vermittelt alles, was man über das Multitalent wissen muss. Heft, DIN A5 (14,8 x 21 cm), 28 Seiten Bestell-Nr Heil- und Gewürzpflanzen aus dem eigenen Garten Von Anis bis Zitronenmelisse: Mit übersichtlichen Steckbriefen stellt das Heft 76 Heil- und Gewürzpflanzen vor. Daneben lernen Gartenfreunde verschiedene Varianten von Kräutergärten kennen und erfahren, was bei Anlage, Pflege und Ernte zu beachten ist. Heft, DIN A5 (14,8 x 21 cm), 60 Seiten Bestell-Nr Schnittblumen frisch halten in Produktion, Handel und zu Hause Deutschland ist ein Blumenland! Aber gerade Schnittblumen sind ein empfindliches Produkt, dessen Qualität von vielen Faktoren abhängt. Das Heft zeigt, wie man Haltbarkeit und Qualität der Pflanzen gezielt verbessern kann. Heft, 14 x 21 cm, 72 Seiten Bestell-Nr Weitere aid-medien und Leseproben finden Sie unter: 59
60 aid-medien Nützlinge im Garten Viele wissen, dass Marienkäfer Gegenspieler von Blattläusen sind. Weniger bekannt ist die Bedeutung anderer Tiere für das Ökosystem Garten. Das Nachschlagewerk hilft, die wichtigsten Nützlinge zu erkennen und gibt Hinweise zu ihrer Schonung und Förderung. Broschüre, DIN A5 (14,8 x 21 cm), 164 Seiten Bestell-Nr Von Apfel bis Zucchini Das Jahr im Garten Praktische Tipps rund um die Arbeit im Nutzgarten stecken in diesem Heft. Damit sind die beliebten und fachlich fundierten Tipps für Hobbygärtner der aid-seite nun kompakt und übersichtlich in Heftform verfügbar. Heft, DIN A5 (14,8 x 21 cm), 96 Seiten Bestell-Nr Rasen anlegen und pflegen Ob Zierrasen, Familientummelplatz oder Blumenwiese: Das Heft hilft Gartenbesitzern dabei, ihren Wunschrasen zu gestalten und lange daran Freude zu haben. Es enthält ausführliche Anleitungen und praktische Tipps rund um Anlage, Pflege und Sanierung. Heft, DIN A5 (14,8 x 21 cm), 68 Seiten, 1 Poster Bestell-Nr Weitere aid-medien und Leseproben finden Sie unter:
61 Nützlinge im Garten Die App hilft, die wichtigsten Nützlinge zu erkennen und gibt Hinweise zu ihrer Schonung und Förderung. Gartenfreunde erfahren, gegen welche Schädlinge ein Nützling wirksam ist, wie er lebt, woran er zu erkennen ist und wie er sich besonders wohlfühlt. App für Smartphone Schnittblumen frisch halten Schnittblumen sind ein empfindliches Produkt, dessen Qualität von vielen Faktoren abhängt. Das frisch-bunte Poster zeigt, wie man Haltbarkeit und Qualität der Blumen gezielt verbessern kann. Poster, DIN A1 auf A4 gefalzt, 2 Seiten Bestell-Nr Weitere aid-medien und Leseproben finden Sie unter: 61
62 In den Garten fertig los! Kinder- und Jugendarbeit im Verein Gärten bieten viel Raum für Naturerlebnisse und Abenteuer. Grund genug, um jungen Menschen Lust aufs Gärtnern zu machen! Das Handbuch stellt Ideen und Möglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen des Freizeitgartenbaus vor. Es informiert ausführlich über organisatorische Fragen und pädagogische Grundlagen. Praktische Beispiele zeigen den Ablauf von Aktionen und Gruppenstunden für jede Saison. Das Handbuch macht Lust auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und begleitet die Verantwortlichen auf ihrem Weg. Inhaltlich ist es auf die Belange von Vereinen abgestimmt. Daneben kann es Kindergärten und Schulen als Impuls dienen und Vereine als Lern-Partner näher bringen. Ein Kapitel zeigt, wie die Kooperation aussehen kann. Ringordner DIN A4 148 Seiten Bestell-Nr.: 3977 Einzelne Kapitel zum Download: Bestellnummern 672 bis 677
63 Umweltfreundlich Impressum 1509/2014 Herausgegeben vom aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. Heilsbachstraße Bonn Matthias Gschwendner/Fotolia.com produziert! Text Diplom-Agrarbiologe Dr. Christoph Allgaier (Kapitel 1 6) und Diplom-Biologe Dr. Reinhard Albert (Kapitel 7) Redaktion Anne Staeves, aid Bilder Allgaier: Titel (Arion lusitanicus), S. 4 41, 43 45, 48 oben, 49 rechts, 50 oben, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg: S. 42, 46, 47, 48 unten, 49 links, 50 unten Grafik van Son Grafik/Layout, Alfter Druck Druckerei Lokay e. K. Königsberger Str Reinheim Dieses Heft wurde in einem klimaneutralen Druckprozess mit Farben aus nachwachsenden Rohstoffen bei einer EMAS-zertifizierten Druckerei hergestellt. Das Papier besteht zu 100 Prozent aus Recyclingpapier. Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise sowie Weitergabe mit Zusätzen, Aufdrucken oder Aufklebern nur mit Genehmigung des aid gestattet. 2. Auflage ISBN einfach einkaufen aid-medienshop.de
64 Foto: Emmanuelle Guillou Fotolia.com aid infodienst Wissen in Bestform Ihr Informationsanbieter rund um Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung. Wir bereiten Fakten verständlich auf und bieten für jeden den passenden Service. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung. Foto: Subbotina Anna Fotolia.com unabhängig praxisorientiert wissenschaftlich fundiert Foto: Tatyana Gladskih - Fotolia.com Bestell-Nr.: 1509, Preis: 2,50
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Erfolgreiche Schneckenkontrolle und deren Bekämpfung
 Erfolgreiche Schneckenkontrolle und deren Bekämpfung August 2013, Nordgermersleben Heinrich Wilhelm, DE SANGOSSE GmbH Entwicklungszyklus Entwicklungszyklus der Nacktschnecken 25.07.2013 Heinrich WIlhelm
Erfolgreiche Schneckenkontrolle und deren Bekämpfung August 2013, Nordgermersleben Heinrich Wilhelm, DE SANGOSSE GmbH Entwicklungszyklus Entwicklungszyklus der Nacktschnecken 25.07.2013 Heinrich WIlhelm
AUF DER SCHLEIMSPUR. Kleine Schneckenkunde
 AUF DER SCHLEIMSPUR Kleine Schneckenkunde DE SANGOSSE GmbH Neue Börsenstraße 6 60487 Frankfurt/Main Tel.: 069/17 53 77 09-0 Fax: 069/17 53 77 09-9 www.desangosse.de info@desangosse.de www.desangosse.de
AUF DER SCHLEIMSPUR Kleine Schneckenkunde DE SANGOSSE GmbH Neue Börsenstraße 6 60487 Frankfurt/Main Tel.: 069/17 53 77 09-0 Fax: 069/17 53 77 09-9 www.desangosse.de info@desangosse.de www.desangosse.de
Vorschau. Filmen: Unser Wohnort, unser Schulhaus. Arbeitsblatt 1.1. Haltet hier eure Ideen zum Filmeinstieg fest:
 Arbeitsblatt 1.1 Filmen: Unser Wohnort, unser Schulhaus Haltet hier eure Ideen zum Filmeinstieg fest: Was sollen eure Filmaufnahmen genau zeigen? Wie sind die Rollen aufgeteilt? Was sagt ihr während den
Arbeitsblatt 1.1 Filmen: Unser Wohnort, unser Schulhaus Haltet hier eure Ideen zum Filmeinstieg fest: Was sollen eure Filmaufnahmen genau zeigen? Wie sind die Rollen aufgeteilt? Was sagt ihr während den
DOWNLOAD. Lineare Texte verstehen: Das Schneckenterrarium. Ulrike Neumann-Riedel. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Lineare Texte verstehen: Das Schneckenterrarium Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich differenziert Ein
DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Lineare Texte verstehen: Das Schneckenterrarium Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich differenziert Ein
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Stationenlernen: Schnecken - Alltagsnaher Sachunterricht
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Schnecken - Alltagsnaher Sachunterricht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Stationenlernen:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen: Schnecken - Alltagsnaher Sachunterricht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Stationenlernen:
Wie lange würde. Wie viele Fühler. hat eine
 Mit dem Schleim. Kriechen? die Schnecke beim Womit schützt sich Säugetiere? Sind Schnecken Drei. Schneckenhaus? Schichten hat ein Radula. Ungefähr neun Tage. Vier = 2 Paar. In feuchten, schattigen Gegenden.
Mit dem Schleim. Kriechen? die Schnecke beim Womit schützt sich Säugetiere? Sind Schnecken Drei. Schneckenhaus? Schichten hat ein Radula. Ungefähr neun Tage. Vier = 2 Paar. In feuchten, schattigen Gegenden.
Wie viele Fühler hat eine Weinbergschnecke? Legen Schnecken Eier? Sie hat vier Fühler. Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.
 Wie viele Fühler hat eine Weinbergschnecke Sie hat vier Fühler. Legen Schnecken Eier Ja, fast alle Schneckenarten legen Eier. Wie wird die Zunge der Schnecke genannt Die Zunge der Schnecke heißt Radula.
Wie viele Fühler hat eine Weinbergschnecke Sie hat vier Fühler. Legen Schnecken Eier Ja, fast alle Schneckenarten legen Eier. Wie wird die Zunge der Schnecke genannt Die Zunge der Schnecke heißt Radula.
Kapitel Weichtiere
 1 Kapitel 01.03 Weichtiere Eine Weinbergschnecke 2 Inhalt Kapitel 01.03 Weichtiere... 1 Inhalt... 2 Weichtiere (Mollusken)... 3 Der Stammbaum der Weichtiere...3 Der Körperbau der Weichtiere am Beispiel
1 Kapitel 01.03 Weichtiere Eine Weinbergschnecke 2 Inhalt Kapitel 01.03 Weichtiere... 1 Inhalt... 2 Weichtiere (Mollusken)... 3 Der Stammbaum der Weichtiere...3 Der Körperbau der Weichtiere am Beispiel
Die Stabheuschrecke. Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, Sprache: Deutsch. Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2
 Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, 2007 Sprache: Deutsch Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2 Schlagwörter: Phasmiden, Stabheuschrecke, Insekt, Phytomimese, Parthenogenese, Holometabolie,
Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, 2007 Sprache: Deutsch Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2 Schlagwörter: Phasmiden, Stabheuschrecke, Insekt, Phytomimese, Parthenogenese, Holometabolie,
Was tun gegen die Schneckenplage? Schnecke ist nicht gleich Schnecke
 Was tun gegen die Schneckenplage? Schnecke ist nicht gleich Schnecke LANDWIRTSCHAFTLICHES TECHNOLOGIEZENTRUM AUGUSTENBERG Schäden an Gemüse und Zierpflanzen im Haus- und Kleingarten verursachen hauptsächlich
Was tun gegen die Schneckenplage? Schnecke ist nicht gleich Schnecke LANDWIRTSCHAFTLICHES TECHNOLOGIEZENTRUM AUGUSTENBERG Schäden an Gemüse und Zierpflanzen im Haus- und Kleingarten verursachen hauptsächlich
Gartenfreude. ohne Schnecken
 Gartenfreude ohne Schnecken Praktische Tipps zur wirksamen und sicheren Schneckenbekämpfung Wissenswertes über Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Metaldehyd Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres als
Gartenfreude ohne Schnecken Praktische Tipps zur wirksamen und sicheren Schneckenbekämpfung Wissenswertes über Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Metaldehyd Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres als
Tier-Steckbriefe. Tier-Steckbriefe. Lernziele: Material: Köcher iege. Arbeitsblatt 1 - Welches Tier lebt wo? Methode: Info:
 Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
Gartenfreude. ohne Schnecken
 Gartenfreude ohne Schnecken Praktische Tipps zur wirksamen und sicheren Schneckenbekämpfung Wissenswertes über Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Metaldehyd Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres als
Gartenfreude ohne Schnecken Praktische Tipps zur wirksamen und sicheren Schneckenbekämpfung Wissenswertes über Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Metaldehyd Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres als
Kurze Übersicht über die Biologie und Ökologie der Flusskrebse
 Kurze Übersicht über die Biologie und Ökologie der Flusskrebse Lebensraum und Aktivität: Flusskrebse besiedeln in der Schweiz verschiedene Lebensräume wie Bäche, Flüsse, Seen und Weiher. Die einheimischen
Kurze Übersicht über die Biologie und Ökologie der Flusskrebse Lebensraum und Aktivität: Flusskrebse besiedeln in der Schweiz verschiedene Lebensräume wie Bäche, Flüsse, Seen und Weiher. Die einheimischen
Der Regenwurm. Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar.
 Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar. - Auf der gesamten Welt gibt es ca. 320 verschiedene Regenwurmarten. 39 Arten leben in Europa.
Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar. - Auf der gesamten Welt gibt es ca. 320 verschiedene Regenwurmarten. 39 Arten leben in Europa.
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum S 2. Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe
 Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Pflanzenschutzamt Berlin
 Pflanzenschutzamt Berlin Stadtgrün, Dienstleistungsgartenbau, Haus- und Kleingarten Schadschnecken und ihre Bekämpfung Schadpotential Schnecken gehören in allen grünen Bereichen zu den wichtigsten Schädlingen.
Pflanzenschutzamt Berlin Stadtgrün, Dienstleistungsgartenbau, Haus- und Kleingarten Schadschnecken und ihre Bekämpfung Schadpotential Schnecken gehören in allen grünen Bereichen zu den wichtigsten Schädlingen.
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Flussnapfschnecke Hakenkäfer. Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs. große Köcherfliegenlarve. larve. Schlammschnecke. Kriebelmücke (Larve) Kugelmuschel
 Zeigertiere in Fließgewässern Mit diesen Zeigertieren kannst du die Wasserqualität von Fließgewässern bestimmen. (Dargestellt sind häufig Larven der genannten Tiere.) Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs Flussnapfschnecke
Zeigertiere in Fließgewässern Mit diesen Zeigertieren kannst du die Wasserqualität von Fließgewässern bestimmen. (Dargestellt sind häufig Larven der genannten Tiere.) Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs Flussnapfschnecke
Das Pflanzenschutzamt Berlin informiert
 Das Pflanzenschutzamt Berlin informiert Juni 2016 Schadschnecken und ihre Bekämpfung Schadpotential Schnecken gehören in allen grünen Bereichen zu den wichtigsten Schädlingen. In Berlin werden vorwiegend
Das Pflanzenschutzamt Berlin informiert Juni 2016 Schadschnecken und ihre Bekämpfung Schadpotential Schnecken gehören in allen grünen Bereichen zu den wichtigsten Schädlingen. In Berlin werden vorwiegend
Das große Schneckentreffen
 Das große Schneckentreffen Begleitheft mit Sachinformationen, Arbeitsvorschlägen und Kopiervorlagen Finken Verlag Inhaltsverzeichnis Zur Idee und zum Konzept der tablo-bücher..........................................................
Das große Schneckentreffen Begleitheft mit Sachinformationen, Arbeitsvorschlägen und Kopiervorlagen Finken Verlag Inhaltsverzeichnis Zur Idee und zum Konzept der tablo-bücher..........................................................
Legekreis. "Heimische Insekten"
 Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Presse Information 4. Insekt des Jahres 2016 Deutschland Österreich Schweiz
 Presse Information 4. Dez. 2015 Insekt des Jahres 2016 Deutschland Österreich Schweiz Der Dunkelbraune Kugelspringer Berlin (4. Dezember 2015) Der Dunkelbraune Kugelspringer ist das Insekt des Jahres 2016.
Presse Information 4. Dez. 2015 Insekt des Jahres 2016 Deutschland Österreich Schweiz Der Dunkelbraune Kugelspringer Berlin (4. Dezember 2015) Der Dunkelbraune Kugelspringer ist das Insekt des Jahres 2016.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Ist der Elefant ein kleines Tier?...
 Fragen stellen 1 Meist kann man aus einem einfachen Satz durch das Umstellen der Wörter eine Frage bilden Der Elefant ist ein kleines Tier. Ist der Elefant ein kleines Tier? Der Satz beginnt immer mit
Fragen stellen 1 Meist kann man aus einem einfachen Satz durch das Umstellen der Wörter eine Frage bilden Der Elefant ist ein kleines Tier. Ist der Elefant ein kleines Tier? Der Satz beginnt immer mit
Die Sch erfahren anhand von Wissensposten, was ein Reh ausmacht, wie es lebt und welches die Eigenheiten sind.
 Arbeitsbeschrieb Arbeitsauftrag: Die Sch erfahren anhand von Wissensposten, was ein Reh ausmacht, wie es lebt und welches die Eigenheiten sind. Ziel: Die Sch erkennen die Lebensweise eines einheimischen
Arbeitsbeschrieb Arbeitsauftrag: Die Sch erfahren anhand von Wissensposten, was ein Reh ausmacht, wie es lebt und welches die Eigenheiten sind. Ziel: Die Sch erkennen die Lebensweise eines einheimischen
Gestatten, mein Name ist: Hochmoor-Bläulinge!
 Bläulinge: Infoblatt 1 Gestatten, mein Name ist: Hochmoor-Bläulinge! Die Hochmoor-Bläulinge sind etwas ganz Besonderes. Sie leben nur im Hochmoor. Warum eigentlich? Wofür brauchen Hochmoor-Bläulinge diese
Bläulinge: Infoblatt 1 Gestatten, mein Name ist: Hochmoor-Bläulinge! Die Hochmoor-Bläulinge sind etwas ganz Besonderes. Sie leben nur im Hochmoor. Warum eigentlich? Wofür brauchen Hochmoor-Bläulinge diese
Ostseegarnele (Palaemon adspersus)
 Ostseegarnele (Palaemon adspersus) Verbreitung: europäische Küstengebiete, Küsten des Schwarzen Meeres, im Mittelmeer vor Nordafrika als auch in den kühleren Regionen der Nord- und Ostsee Größe: bis zu
Ostseegarnele (Palaemon adspersus) Verbreitung: europäische Küstengebiete, Küsten des Schwarzen Meeres, im Mittelmeer vor Nordafrika als auch in den kühleren Regionen der Nord- und Ostsee Größe: bis zu
Stadt Luzern. öko-forum. Stichwort. Marienkäfer. öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz Luzern.
 Stadt Luzern öko-forum Stichwort Marienkäfer Stadt Luzern öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 6004 Luzern Telefon: 041 412 32 32 Telefax: 041 412 32 34 info@oeko-forum.ch www.ublu.ch Inhalt
Stadt Luzern öko-forum Stichwort Marienkäfer Stadt Luzern öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 6004 Luzern Telefon: 041 412 32 32 Telefax: 041 412 32 34 info@oeko-forum.ch www.ublu.ch Inhalt
Form und Funktion der Tiere. Mechanismen der Sensorik und Motorik
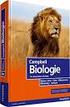 Form und Funktion der Tiere Mechanismen der Sensorik und Motorik Bewegung und Lokomotion 49.25 Die energetischen Kosten der Fortbewegung. Diese Grafik vergleicht die Energie pro Kilogramm Körpermasse pro
Form und Funktion der Tiere Mechanismen der Sensorik und Motorik Bewegung und Lokomotion 49.25 Die energetischen Kosten der Fortbewegung. Diese Grafik vergleicht die Energie pro Kilogramm Körpermasse pro
Biologie. I. Grundlegende Begriffe im Überblick:
 I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
Das Wichtigste auf einen Blick... 66
 Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
 Elefanten Elefanten erkennt man sofort an ihren langen Rüsseln, mit denen sie Gegenstände greifen und festhalten können, den gebogenen Stoßzähnen und den riesigen Ohren. Da Elefanten nicht schwitzen können,
Elefanten Elefanten erkennt man sofort an ihren langen Rüsseln, mit denen sie Gegenstände greifen und festhalten können, den gebogenen Stoßzähnen und den riesigen Ohren. Da Elefanten nicht schwitzen können,
Granulatköder gegen Nackt- und Gehäuseschnecken in Wein-, Obst-, Acker-, Gemüse- und Zierpflanzenbau, sowie Grünland. Gefahrensymbol: Abgabe: frei
 236 Metarex Inov Metarex Inov Granulatköder gegen Nackt- und Gehäuseschnecken in Wein-, Obst-, Acker-, Gemüse- und Zierpflanzenbau, sowie Grünland. Granulatköder Pfl-Reg.Nr.: 3216 Wirkstoff und Wirkstoffgehalt:
236 Metarex Inov Metarex Inov Granulatköder gegen Nackt- und Gehäuseschnecken in Wein-, Obst-, Acker-, Gemüse- und Zierpflanzenbau, sowie Grünland. Granulatköder Pfl-Reg.Nr.: 3216 Wirkstoff und Wirkstoffgehalt:
3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch!
 1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
Zelldifferenzierung Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A)
 Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A) Abb. 1: Querschnitt durch ein Laubblatt (Rasterelektronenmikroskop) Betrachtet man den Querschnitt eines Laubblattes unter dem Mikroskop (Abb. 1), so sieht
Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A) Abb. 1: Querschnitt durch ein Laubblatt (Rasterelektronenmikroskop) Betrachtet man den Querschnitt eines Laubblattes unter dem Mikroskop (Abb. 1), so sieht
Pfeilgiftfrösche. Wie sehen Pfeilgiftfrösche aus und sind sie wirklich giftig?
 Wie sehen aus und sind sie wirklich giftig? sind kleine Frösche und haben sehr auffällige, knallbunte Farben. Einige Frösche sind schwarz und haben gelbe, rote oder blaue Flecken, manche sind orange oder
Wie sehen aus und sind sie wirklich giftig? sind kleine Frösche und haben sehr auffällige, knallbunte Farben. Einige Frösche sind schwarz und haben gelbe, rote oder blaue Flecken, manche sind orange oder
[Text eingeben] Steinobst.
![[Text eingeben] Steinobst. [Text eingeben] Steinobst.](/thumbs/64/50697423.jpg) Steinobst Als Steinobst bezeichnet man jene Früchte, die einen verholzten Kern besitzen. In diesem harten Kern befindet sich der tatsächliche Samen; außen ist er von dem essbaren Fruchtfleisch umgeben.
Steinobst Als Steinobst bezeichnet man jene Früchte, die einen verholzten Kern besitzen. In diesem harten Kern befindet sich der tatsächliche Samen; außen ist er von dem essbaren Fruchtfleisch umgeben.
Unterrichtsmaterialien zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC)
 Unterrichtsmaterialien zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC) Thema: Der Schweinswal Autor: Leonie Märtens Klassenstufe: Primarstufe Qualitätssicherung: Prof. Carsten Hobohm Art des Materials: Arbeitsbögen,
Unterrichtsmaterialien zum Thema Erhaltung der Biodiversität (TMBC) Thema: Der Schweinswal Autor: Leonie Märtens Klassenstufe: Primarstufe Qualitätssicherung: Prof. Carsten Hobohm Art des Materials: Arbeitsbögen,
Schnecken. Unterrichtsmaterial für die 1./2. Klasse
 Schnecken Unterrichtsmaterial für die 1./2. Klasse Weichtiere Schnecken gehören zum Stamm der Weichtiere. Das bedeutet sie haben keine Knochen. Zu den Weichtieren gehören auch Muscheln und Tintenfische.
Schnecken Unterrichtsmaterial für die 1./2. Klasse Weichtiere Schnecken gehören zum Stamm der Weichtiere. Das bedeutet sie haben keine Knochen. Zu den Weichtieren gehören auch Muscheln und Tintenfische.
Kurzinfo. Sachunterricht. Der Igel. Leseverstehen. Klasse 3. Einzel- und Partnerarbeit. Lehrer kopiert: o Material 1 auf Folie o Material 2 und 3
 Kurzinfo Fach Thema Förderbereich Altersstufe Sozialform Sachunterricht Der Igel Leseverstehen Klasse 3 Einzel- und Partnerarbeit Medien Material/ Vorbereitung Lehrer kopiert: o Material 1 auf Folie o
Kurzinfo Fach Thema Förderbereich Altersstufe Sozialform Sachunterricht Der Igel Leseverstehen Klasse 3 Einzel- und Partnerarbeit Medien Material/ Vorbereitung Lehrer kopiert: o Material 1 auf Folie o
Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse
 Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse Biologie Lehre der Lebewesen Kennzeichen der Lebewesen Aufbau aus Zellen Bewegung aus eigener Kraft Fortpflanzung Aufbau aus Zellen Zellkern Chef der Zelle Zellmembran
Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse Biologie Lehre der Lebewesen Kennzeichen der Lebewesen Aufbau aus Zellen Bewegung aus eigener Kraft Fortpflanzung Aufbau aus Zellen Zellkern Chef der Zelle Zellmembran
Das ist die Geschichte vom Eichelbohrer
 Das ist die Geschichte vom Eichelbohrer Wegbegleiter Von E.Ullrich 2013 Sehen lernen,- Man sieht nur was man kennt Der Eichelbohrer Der Eichelbohrer, Curculio glandium, gehört zur artenreichen Familie
Das ist die Geschichte vom Eichelbohrer Wegbegleiter Von E.Ullrich 2013 Sehen lernen,- Man sieht nur was man kennt Der Eichelbohrer Der Eichelbohrer, Curculio glandium, gehört zur artenreichen Familie
Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten
 Inhaltsverzeichnis Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten 1 Reise in die Welt des Winzigen... 8 Zelle Grundbaustein der Lebewesen... 10 Hilfsmittel zum Betrachten winzig kleiner Dinge... 12 Das
Inhaltsverzeichnis Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten 1 Reise in die Welt des Winzigen... 8 Zelle Grundbaustein der Lebewesen... 10 Hilfsmittel zum Betrachten winzig kleiner Dinge... 12 Das
ab 8 Jahre Tiere des Waldes
 Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 8 Jahre Tiere des Waldes Die Räume im Museum sind nummeriert, damit man sich besser zurechtfinden kann. Rechts von der großen Säulenhalle steht der Elefant. Hier fangen
Schloss Am Löwentor Rosenstein ab 8 Jahre Tiere des Waldes Die Räume im Museum sind nummeriert, damit man sich besser zurechtfinden kann. Rechts von der großen Säulenhalle steht der Elefant. Hier fangen
Sind Faultiere wirklich faul?
 Sind Faultiere wirklich faul? Faultiere sind Säugetiere. Sie bringen ihre Jungen lebend zur Welt. In ihrem Aussehen sind sie mit den Ameisenbären und Gürteltieren verwandt. Es gibt Zweifinger- und Dreifinger-Faultiere.
Sind Faultiere wirklich faul? Faultiere sind Säugetiere. Sie bringen ihre Jungen lebend zur Welt. In ihrem Aussehen sind sie mit den Ameisenbären und Gürteltieren verwandt. Es gibt Zweifinger- und Dreifinger-Faultiere.
der Lage, einem Temperaturgradienten zu folgen. Es meidet kühle, harte Oberflächen und sucht nach dem wärmsten, weichsten Platz nach seiner Mutter.
 der Lage, einem Temperaturgradienten zu folgen. Es meidet kühle, harte Oberflächen und sucht nach dem wärmsten, weichsten Platz nach seiner Mutter. Während Katzen mit Nase und Lippen die Temperatur der
der Lage, einem Temperaturgradienten zu folgen. Es meidet kühle, harte Oberflächen und sucht nach dem wärmsten, weichsten Platz nach seiner Mutter. Während Katzen mit Nase und Lippen die Temperatur der
Die Stockwerke der Wiese
 Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Schlammschnecken. bis 6 cm in Teichen mit schwacher Strömung Güteklasse II
 Schlammschnecken bis 6 cm in Teichen mit schwacher Strömung Güteklasse II Die Schlammschnecken gehören wie die Tellerschnecken zu den Wasserlungenschnecken mit einer echten Lunge. Die Spitzschlammschnecke
Schlammschnecken bis 6 cm in Teichen mit schwacher Strömung Güteklasse II Die Schlammschnecken gehören wie die Tellerschnecken zu den Wasserlungenschnecken mit einer echten Lunge. Die Spitzschlammschnecke
Entwicklung der Tiere
 Entwicklung der Tiere Entwicklung beginnt, wie immer, mit einer ersten Zelle. Diese Zelle ist die befruchtete, diploide Zygote, deren Kern durch Verschmelzung der Kerne einer männlichen und einer weiblichen
Entwicklung der Tiere Entwicklung beginnt, wie immer, mit einer ersten Zelle. Diese Zelle ist die befruchtete, diploide Zygote, deren Kern durch Verschmelzung der Kerne einer männlichen und einer weiblichen
Weichtiere. Nur zwei der sieben Weichtierklassen haben Formen entwickelt, die
 234 235 Nur zwei der sieben Weichtierklassen haben Formen entwickelt, die außerhalb der Meere vorkommen die Schnecken und die Muscheln. Für die Schnecken charakteristisch ist der aus Kopf-, Kriechfuß und
234 235 Nur zwei der sieben Weichtierklassen haben Formen entwickelt, die außerhalb der Meere vorkommen die Schnecken und die Muscheln. Für die Schnecken charakteristisch ist der aus Kopf-, Kriechfuß und
DOWNLOAD. Vertretungsstunde Biologie 9. 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren. Corinna Grün/Cathrin Spellner
 DOWNLOAD Corinna Grün/Cathrin Spellner Vertretungsstunde Biologie 9 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren auszug aus dem Originaltitel: Die Pflanzen Lebensgrundlage aller Organismen
DOWNLOAD Corinna Grün/Cathrin Spellner Vertretungsstunde Biologie 9 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren auszug aus dem Originaltitel: Die Pflanzen Lebensgrundlage aller Organismen
Legekreis Heimische Vögel
 Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Der Boden - Reich an Organismen
 Der Boden - Reich an Organismen Im Boden sind neben mineralischen Teilchen, Luft und Wasser auch organische Bestandteile vorhanden. Den Großteil davon machen tierische und pflanzliche Zersetzungsprodukte
Der Boden - Reich an Organismen Im Boden sind neben mineralischen Teilchen, Luft und Wasser auch organische Bestandteile vorhanden. Den Großteil davon machen tierische und pflanzliche Zersetzungsprodukte
Ostsee zu verbessern. Der Seehund dient hier als Beispiel und kann durch andere Ostsee-Arten ersetzt werden.
 Ostsee-Quiz Seehund Ziel: Dieses Quiz eignet sich sehr gut dazu, den Wortschatz, das Wissen und die Fähigkeiten der Schüler zur Ostsee zu verbessern. Der Seehund dient hier als Beispiel und kann durch
Ostsee-Quiz Seehund Ziel: Dieses Quiz eignet sich sehr gut dazu, den Wortschatz, das Wissen und die Fähigkeiten der Schüler zur Ostsee zu verbessern. Der Seehund dient hier als Beispiel und kann durch
Evolutionsfaktoren. = Gesamtheit der Gene aller Individuen einer Population bleibt nach dem HARDY-WEINBERG-Gesetz unter folgenden Bedingungen
 Evolutionsfaktoren 1 Genpool = Gesamtheit der Gene aller Individuen einer bleibt nach dem HARDY-WEINBERG-Gesetz unter folgenden Bedingungen gleich: keine Mutationen alle Individuen sind für Umweltfaktoren
Evolutionsfaktoren 1 Genpool = Gesamtheit der Gene aller Individuen einer bleibt nach dem HARDY-WEINBERG-Gesetz unter folgenden Bedingungen gleich: keine Mutationen alle Individuen sind für Umweltfaktoren
DOWNLOAD. Die Verdauung Basiswissen Körper und Gesundheit. Jens Eggert. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Jens Eggert Die Verdauung Basiswissen Körper und Gesundheit auszug aus dem Originaltitel: Der Weg der Nahrung durch unseren Körper Mund Speicheldrüse Leber Dünndarm Darmausgang Speiseröhre Magen
DOWNLOAD Jens Eggert Die Verdauung Basiswissen Körper und Gesundheit auszug aus dem Originaltitel: Der Weg der Nahrung durch unseren Körper Mund Speicheldrüse Leber Dünndarm Darmausgang Speiseröhre Magen
Meer und Küste in Leichter Sprache
 Meer und Küste in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern sehr viel an der Natur. Zum Beispiel: Wir fällen Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen
Meer und Küste in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern sehr viel an der Natur. Zum Beispiel: Wir fällen Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen
DOWNLOAD. Lineare Texte verstehen: Die Verdauung. Ulrike Neumann-Riedel. Downloadauszug aus dem Originaltitel: Sachtexte verstehen kein Problem!
 DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Lineare Texte verstehen: Die Verdauung Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich differenziert Was geschieht
DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Lineare Texte verstehen: Die Verdauung Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich differenziert Was geschieht
So sehen die Schüler aus der Mittelstufe die Bartagame. Wir wollen uns bei ihnen für Die Bartagame bedanken. Zurzeit bauen wir das Terrarium.
 Die Klasse schreibt: So sehen die Schüler aus der Mittelstufe die Bartagame Hallo Terra Mater, Wir, die Schüler der wfs wollten euch gerne berichten was wir für die Bartagamen alles machen. Für diese schönen
Die Klasse schreibt: So sehen die Schüler aus der Mittelstufe die Bartagame Hallo Terra Mater, Wir, die Schüler der wfs wollten euch gerne berichten was wir für die Bartagamen alles machen. Für diese schönen
Kultur- und Lebensräume
 Kultur- und Lebensräume 14 Kultur- und Lebensräume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Einstieg: Lebensräume
Kultur- und Lebensräume 14 Kultur- und Lebensräume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Einstieg: Lebensräume
Markl Biologie 1 ( ) für Gymnasien in Baden-Württemberg Stoffverteilungsplan Klassen 5/6 Autor: Sven Gemballa
 Markl Biologie 1 (978-3-12-150020-8) für Gymnasien in Baden-Württemberg Stoffverteilungsplan Klassen 5/6 Autor: Sven Gemballa Bildungsstandard Verortung in Markl Biologie 1 (Klasse 5/6) Phänomene aus der
Markl Biologie 1 (978-3-12-150020-8) für Gymnasien in Baden-Württemberg Stoffverteilungsplan Klassen 5/6 Autor: Sven Gemballa Bildungsstandard Verortung in Markl Biologie 1 (Klasse 5/6) Phänomene aus der
Quaterna Garten. Für die Erde und lange Zeit
 EFFIZIENZ,3+60,3 üppige und schöne Pflanzen, guter Geschmack trägt mit bei zu einer guten Qualität und einer schönen Umgebung Quaterna Garten ist das ganze Jahr über wirksam. Die optimalsten Bedingungen
EFFIZIENZ,3+60,3 üppige und schöne Pflanzen, guter Geschmack trägt mit bei zu einer guten Qualität und einer schönen Umgebung Quaterna Garten ist das ganze Jahr über wirksam. Die optimalsten Bedingungen
Zellalterung ist steuerbar. Ein gut geölter Motor lebt länger.
 Zellalterung ist steuerbar Ein gut geölter Motor lebt länger. Dasselbe trifft auch auf den menschlichen Organismus zu. Wenn Organ- und Blutgefäß Zellen regelmäßig mit den notwendigen Vitalstoffen versorgt
Zellalterung ist steuerbar Ein gut geölter Motor lebt länger. Dasselbe trifft auch auf den menschlichen Organismus zu. Wenn Organ- und Blutgefäß Zellen regelmäßig mit den notwendigen Vitalstoffen versorgt
Das Blut fließt nicht wie beim geschlossenen Blutkreislauf in Gefäßen (Adern) zu den Organen, sondern umspült diese frei.
 Grundwissen Biologie 8. Klasse 6 Eucyte Zelle: kleinste lebensfähige Einheit der Lebewesen abgeschlossene spezialisierte Reaktionsräume Procyte Vakuole Zellwand pflanzliche Zelle Zellkern tierische Zelle
Grundwissen Biologie 8. Klasse 6 Eucyte Zelle: kleinste lebensfähige Einheit der Lebewesen abgeschlossene spezialisierte Reaktionsräume Procyte Vakuole Zellwand pflanzliche Zelle Zellkern tierische Zelle
So schmeckt Frische! Von der Ernte bis in Ihre Tiefkühltruhe dreht sich bei uns alles um Frische und Qualität.
 So schmeckt Frische! Von der Ernte bis in Ihre Tiefkühltruhe dreht sich bei uns alles um Frische und Qualität. Frisch schmeckt es einfach am besten Deshalb naschen wir so gerne Kirschen direkt vom Baum,
So schmeckt Frische! Von der Ernte bis in Ihre Tiefkühltruhe dreht sich bei uns alles um Frische und Qualität. Frisch schmeckt es einfach am besten Deshalb naschen wir so gerne Kirschen direkt vom Baum,
Der Maikäfer. Familie
 Der Maikäfer Ingrid Lorenz Familie Die Maikäfer gehören zur Familie der Blatthornkäfer. Der deutsche Name bezieht sich auf die Gestalt der Fühler, deren letzten Glieder blattförmig verbreiterte Lamellen
Der Maikäfer Ingrid Lorenz Familie Die Maikäfer gehören zur Familie der Blatthornkäfer. Der deutsche Name bezieht sich auf die Gestalt der Fühler, deren letzten Glieder blattförmig verbreiterte Lamellen
Sicher experimentieren
 Sicher experimentieren A1 Das Experimentieren im Labor kann gefährlich sein. Deswegen muss man sich an Regeln im Labor halten. Lies dir die 6 wichtigsten Regeln im Labor durch. 1. Kein Essen und Trinken
Sicher experimentieren A1 Das Experimentieren im Labor kann gefährlich sein. Deswegen muss man sich an Regeln im Labor halten. Lies dir die 6 wichtigsten Regeln im Labor durch. 1. Kein Essen und Trinken
 Das Huhn Hühner stammen ursprünglich aus Indien und China und wurden von Händlern nach Europa gebracht. Der Hahn ist größer und kräftiger als die Hühner und hat ein prächtiges buntes Gefieder. Die Hühner
Das Huhn Hühner stammen ursprünglich aus Indien und China und wurden von Händlern nach Europa gebracht. Der Hahn ist größer und kräftiger als die Hühner und hat ein prächtiges buntes Gefieder. Die Hühner
Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora. Fotodokumentation einiger Zielarten
 Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora Fotodokumentation einiger Zielarten Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen
Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora Fotodokumentation einiger Zielarten Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen
Waldeidechse. Zootoca vivipara (JACQUIN, 1787)
 6 Eidechsen von MARTIN SCHLÜPMANN Im Grunde sind die wenigen Eidechsenarten gut zu unterscheiden. Anfänger haben aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung. Die wichtigsten Merkmale
6 Eidechsen von MARTIN SCHLÜPMANN Im Grunde sind die wenigen Eidechsenarten gut zu unterscheiden. Anfänger haben aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung. Die wichtigsten Merkmale
Kennzeichen des Lebens. Zelle. Stoffebene und Teilchenebene. Teilchenmodell. Allen Lebewesen sind folgende Merkmale gemeinsam:
 Allen Lebewesen sind folgende Merkmale gemeinsam: Kennzeichen des Lebens Zelle Grundbaustein der Lebewesen. Ist aus verschiedenen Zellorganellen, die spezielle Aufgaben besitzen, aufgebaut. Pflanzenzelle
Allen Lebewesen sind folgende Merkmale gemeinsam: Kennzeichen des Lebens Zelle Grundbaustein der Lebewesen. Ist aus verschiedenen Zellorganellen, die spezielle Aufgaben besitzen, aufgebaut. Pflanzenzelle
Hintergrund zur Ökologie von C. elegans
 GRUPPE: NAME: DATUM: Matrikelnr. Genereller Hinweis: Bitte den Text sorgsam lesen, da er Hinweise zur Lösung der Aufgaben enthält! Hintergrund zur Ökologie von C. elegans Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans
GRUPPE: NAME: DATUM: Matrikelnr. Genereller Hinweis: Bitte den Text sorgsam lesen, da er Hinweise zur Lösung der Aufgaben enthält! Hintergrund zur Ökologie von C. elegans Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans
Rhagoletis completa, ein neuer Schädling auf Walnuss
 Walnussfruchtfliege Thomas Schwizer Rhagoletis completa, ein neuer Schädling auf Walnuss Die Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) stammt aus dem Südwesten der USA und ist dort unter dem Namen "Walnut
Walnussfruchtfliege Thomas Schwizer Rhagoletis completa, ein neuer Schädling auf Walnuss Die Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) stammt aus dem Südwesten der USA und ist dort unter dem Namen "Walnut
GRUNDWISSEN BIOLOGIE DER 6. JAHRGANGSSTUFE
 Auszug aus dem Lehrplan: Sie verstehen wichtige Beziehungen zwischen Körperbau und Lebensweise bei Wirbeltieren. Sie können die Verwandtschaft der Wirbeltiere anhand ausgewählter e nachvollziehen. Sie
Auszug aus dem Lehrplan: Sie verstehen wichtige Beziehungen zwischen Körperbau und Lebensweise bei Wirbeltieren. Sie können die Verwandtschaft der Wirbeltiere anhand ausgewählter e nachvollziehen. Sie
Experte: Dieser Schüler kann Dir gut helfen!
 Ich habe für die Schüler ein Arbeitsheft/Regenwurm-Heft erstellt, damit nicht zu viele Arbeitsblätter in der Klasse herumfliegen und die Lernangebote übersichtlich bleiben,was mir auch die Kontrolle erleichtert.
Ich habe für die Schüler ein Arbeitsheft/Regenwurm-Heft erstellt, damit nicht zu viele Arbeitsblätter in der Klasse herumfliegen und die Lernangebote übersichtlich bleiben,was mir auch die Kontrolle erleichtert.
MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN
 MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN REGENPFEIFERARTIGE - CHARADRIIFORMES Text und Fotos von Katharina Kreissig Bei dem Besuch einer Pinguinkolonie kann man einige interessante Vogelarten beobachten, deren Lebensweise
MÖVEN, SKUAS UND SEESCHWALBEN REGENPFEIFERARTIGE - CHARADRIIFORMES Text und Fotos von Katharina Kreissig Bei dem Besuch einer Pinguinkolonie kann man einige interessante Vogelarten beobachten, deren Lebensweise
Tier- und Pflanzenwelt der Sandachse
 Tier- und Pflanzenwelt der Sandachse Von schnellen Geparden und Wo die Umwelt das Überleben schwer macht, brauchen Pflanzen und Tiere besondere Anpassungen. Über Jahrtausende hinweg haben sich im Lauf
Tier- und Pflanzenwelt der Sandachse Von schnellen Geparden und Wo die Umwelt das Überleben schwer macht, brauchen Pflanzen und Tiere besondere Anpassungen. Über Jahrtausende hinweg haben sich im Lauf
Vertikutieren richtig gemacht
 Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
1. Erkennen von Schädlingsbefall an Rosen. Ungezieferbefall
 1. Erkennen von Schädlingsbefall an Rosen Ungezieferbefall Blattläuse Blattläuse saugen den Pflanzensaft auf und scheiden Honigtau aus. So kann schwarzer Schimmel entstehen, ein Virus übertragen werden
1. Erkennen von Schädlingsbefall an Rosen Ungezieferbefall Blattläuse Blattläuse saugen den Pflanzensaft auf und scheiden Honigtau aus. So kann schwarzer Schimmel entstehen, ein Virus übertragen werden
Ablaufplan eines Elternabends Kennenlernen von PSE-Methodentraining
 Ablaufplan eines Elternabends Kennenlernen von PSE-Methodentraining Um unsere Eltern über das Projekt zu informieren, wurden alle Eltern der Klassen, die an dem Projekt teilnehmen, eingeladen. Da unsere
Ablaufplan eines Elternabends Kennenlernen von PSE-Methodentraining Um unsere Eltern über das Projekt zu informieren, wurden alle Eltern der Klassen, die an dem Projekt teilnehmen, eingeladen. Da unsere
Wir sind die _ aus den ICE AGE Filmen Zwei in Originalgröße nachgebaute Exemplare siehst du im 1. Ausstellungsraum.
 wurde es immer kälter, bis zu 10 Grad kälter. Das war der Beginn der EISZEIT, in der viel Schnee fiel und große Gletscher entstanden. Es gab 5 Kaltzeiten, in denen sich die Gletscher über halb Deutschland
wurde es immer kälter, bis zu 10 Grad kälter. Das war der Beginn der EISZEIT, in der viel Schnee fiel und große Gletscher entstanden. Es gab 5 Kaltzeiten, in denen sich die Gletscher über halb Deutschland
Kleiner Beutenkäfer. Gekommen um zu bleiben?
 Kleiner Beutenkäfer Gekommen um zu bleiben? 1 Kleiner Beutenkäfer Aufbau 1. Aktuelle Situation 2. Aussehen 3. Lebenszyklus 4. Schäden 5. Bekämpfung 6. Verhalten der Imkerinnen und Imker 2 Verbreitungsgebiete
Kleiner Beutenkäfer Gekommen um zu bleiben? 1 Kleiner Beutenkäfer Aufbau 1. Aktuelle Situation 2. Aussehen 3. Lebenszyklus 4. Schäden 5. Bekämpfung 6. Verhalten der Imkerinnen und Imker 2 Verbreitungsgebiete
Meeresschildkröten. Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz. WWF Schweiz. Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0) Zürich
 WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Meeresschildkröten Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Jürgen Freund / WWF-Canon Steckbrief
WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Tel.: +41 (0)44 297 21 21 Postfach pandaclub@wwf.ch 8010 Zürich www.pandaclub.ch Meeresschildkröten Ein Vortragsdossier des WWF Schweiz Jürgen Freund / WWF-Canon Steckbrief
M 5 Ein Leben in den Baumwipfeln Anpassungen im Körperbau des Eichhörnchens. Voransicht
 S 4 M 5 Ein Leben in den Baumwipfeln Anpassungen im Körperbau des Eichhörnchens Für das Eichhörnchen sind bestimmte Merkmale im Körperbau typisch. Durch sie ist es an seinen Lebensraum angepasst. Befasse
S 4 M 5 Ein Leben in den Baumwipfeln Anpassungen im Körperbau des Eichhörnchens Für das Eichhörnchen sind bestimmte Merkmale im Körperbau typisch. Durch sie ist es an seinen Lebensraum angepasst. Befasse
Körperbau und Sinnesorgane
 Biberinfo: Körperbau und Sinnesorgane Der Biber ist das größte Nagetier Europas und kann bis zu 36 kg schwer und 1.30m lang werden. Der Schwanz des Bibers, die Biberkelle ist netzartig mit Schuppen bedeckt
Biberinfo: Körperbau und Sinnesorgane Der Biber ist das größte Nagetier Europas und kann bis zu 36 kg schwer und 1.30m lang werden. Der Schwanz des Bibers, die Biberkelle ist netzartig mit Schuppen bedeckt
Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 4 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 4 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Schlaf gut, kleiner Igel
 Förderhorizont 1 und 2 1 Lies dir den Text genau durch Im Winter Der Igel schläft im Winter Der Igel sucht im Herbst einen Platz für den Winterschlaf Im Winter ist es sehr kalt Der Igel braucht Schutz
Förderhorizont 1 und 2 1 Lies dir den Text genau durch Im Winter Der Igel schläft im Winter Der Igel sucht im Herbst einen Platz für den Winterschlaf Im Winter ist es sehr kalt Der Igel braucht Schutz
Arbeitsblatt Rundgang Tropengarten Klasse 7/8
 1 Arbeitsblatt Rundgang Tropengarten Klasse 7/8 Datum: Herzlich willkommen in der Biosphäre Potsdam! Schön, dass du da bist! Auf dem Weg durch die Biosphäre kannst du verschiedene Aufgaben lösen: 1.) Zu
1 Arbeitsblatt Rundgang Tropengarten Klasse 7/8 Datum: Herzlich willkommen in der Biosphäre Potsdam! Schön, dass du da bist! Auf dem Weg durch die Biosphäre kannst du verschiedene Aufgaben lösen: 1.) Zu
Die Bedeutung von Wasser für das Lernen und unsere Gesundheit Lernmaterial, erstellt von Dagmar Krawczik, GRÜNE LIGA Berlin e.v.
 Die Bedeutung von Wasser für das Lernen und unsere Gesundheit Lernmaterial, erstellt von Dagmar Krawczik, GRÜNE LIGA Berlin e.v. Wie kommt das Wasser in den Körper? 1. Durch den Mund, die Speiseröhre und
Die Bedeutung von Wasser für das Lernen und unsere Gesundheit Lernmaterial, erstellt von Dagmar Krawczik, GRÜNE LIGA Berlin e.v. Wie kommt das Wasser in den Körper? 1. Durch den Mund, die Speiseröhre und
Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie Seiten
 Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Material. 3 Akteure im Simulationsspiel
 Akteure im Simulationsspiel Blattläuse vermehren sich schnell und brauchen dazu nicht einmal einen Geschlechtspartner. Bei den meisten Arten wechselt sich eine geschlechtliche Generation (mit Männchen
Akteure im Simulationsspiel Blattläuse vermehren sich schnell und brauchen dazu nicht einmal einen Geschlechtspartner. Bei den meisten Arten wechselt sich eine geschlechtliche Generation (mit Männchen
Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen
 / 0 1 * 2 3 ' (. *. ' ' / ( 0. Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen Der Teichfrosch kommt im Spreewald häufig vor. Er sitzt gern am Rand bewachsener Gewässer und sonnt sich. Dabei ist er stets auf der
/ 0 1 * 2 3 ' (. *. ' ' / ( 0. Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen Der Teichfrosch kommt im Spreewald häufig vor. Er sitzt gern am Rand bewachsener Gewässer und sonnt sich. Dabei ist er stets auf der
Dies sind lebendige Organismen, welche andere Lebewesen als Beute fangen um sich selbst oder ihre Nachkommen zu ernähren.
 Der biologische Schutz im Garten Wir werden als Definition, die Formulierung zurückbehalten, welche die internationale Organisation für den biologischen Schutz gegeben hat: Verwendung durch den Menschen
Der biologische Schutz im Garten Wir werden als Definition, die Formulierung zurückbehalten, welche die internationale Organisation für den biologischen Schutz gegeben hat: Verwendung durch den Menschen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Tiere im Frühling Bestellnummer:
Tagfalter in Bingen. Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 3 Besonderheiten... 4 Beobachten / Nachweis... 4 Zucht / Umweltbildung...
Tagfalter in Bingen Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 3 Besonderheiten... 4 Beobachten / Nachweis... 4 Zucht / Umweltbildung...
