Schrenk, Christhard / Weckbach, Hubert / Schlösser, Susanne: Von Helibrunna nach Heilbronn. Eine Stadtgeschichte 1998 Stadtarchiv Heilbronn
|
|
|
- Emil Böhmer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Online-Publikationen des Stadtarchivs Heilbronn 28 Schrenk, Christhard / Weckbach, Hubert / Schlösser, Susanne: Von Helibrunna nach Heilbronn. Eine Stadtgeschichte 1998 Stadtarchiv Heilbronn Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn 36 urn:nbn:de:101: Die Online-Publikationen des Stadtarchivs Heilbronn sind unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 3.0 DE lizenziert. Stadtarchiv Heilbronn Eichgasse Heilbronn Tel
2 CHRISTHARD SCHRENK HUBERT WECKBACH SUSANNE SCHLÖSSER VON HELIBRUNNA NACH Eine Stadtgeschichte
3 VON HELIBRUNNA NACH HEILBRONN
4 Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn Im Auftrag der Stadt Heilbronn herausgegeben von Christhard Schrenk Band 36 Stadtarchiv Heilbronn
5 VON HELIBRUNNA NACH HEILBRONN Eine Stadtgeschichte Von Christhard Schrenk Hubert Weckbach Susanne Schlösser Mit einem Beitrag von Siegfried Schilling THEISS
6 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Von Helibrunna nach Heilbronn : eine Stadtgeschichte / Christhard Schrenk ; Hubert Weckbach ; Susanne Schlösser. [Im Auftr. der Stadt Heilbronn hrsg. von Christhard Schrenk. Mit einem Beitr. von Siegfried Schilling]. - Stuttgart : Theiss, 1998 (Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn ; Bd. 36) ISBN X Umschlaggestaltung: Atelier Jürgen Reichert, Stuttgart unter Verwendung einer Chromlithographie (Heilbronn von Südwesten), nach Satz und Produktion: Verlagsbüro Wais & Partner, Stuttgart Layout: Hans-Jürgen Trinkner, Stuttgart Lithographie: D/D/S Digital Data Service Lenhard, Stuttgart Druck und Bindung: Wilhelm Röck, Weinsberg Konrad Theiss Verlag GmbH, Stuttgart 1998 Alle Rechte vorbehalten ISBN X
7 Inhalt 7 Geleitwort 8 Vorwort Hubert Weckbach 9 AUS DEM DUNKEL INS LICHT DER GESCHICHTE Die»Villa Helibrunna" und ihre Michaelsbasilika Christhard Schrenk 16 VOM DORF ZUR STADT Der Aufstieg beginnt Christhard Schrenk 29 VON DER STADT ZUR REICHSSTADT Heilbronn im 14. Jahrhundert Hubert Weckbach 36 BEDROHUNG VON ALLEN SEITEN Die Stadt in den Fehden und Kriegen des 14. bis 16. Jahrhunderts Hubert Weckbach 43 RELIGI Ö SE ERREGTHEIT UND KIRCHLICHE MISSSTÄNDE Heilbronn auf dem Weg zur Reformation Hubert Weckbach 49 ERSCH Ü TTERUNG DER ORDNUNG Der Bauernkrieg 1525 Hubert Weckbach 65 BANGEN UND TRIUMPH Heilbronn wird und bleibt evangelisch Hubert Weckbach 73 DER KRIEGSFURIE AUSGELIEFERT Heilbronns Geschicke bis zum Ende des 17. Jahrhunderts Susanne Schlösser 90 ÄUSSEREN WIDRIGKEITEN ZUM TROTZ Die Reichsstadt Heilbronn behauptet sich als Handelsplatz Susanne Schlösser 97 ZWISCHEN AUFKLÄRUNG UND ABERGLAUBEN Gesellschaft und Geselligkeit im Heilbronn des 18. Jahrhunderts Hubert Weckbach 104 DAS ENDE DER SELBSTÄNDIGKEIT Heilbronn wird württembergisch
8 Christhard Schrenk 113 HEILBRONN Ein führender Wirtschaftsstandort Württembergs im 19. Jahrhundert Susanne Schlösser 120»EDLE MENSCHEN UND NÜTZLICHE BÜRGER«Schulwesen, Lehrer und berühmt gewordene Schüler Christhard Schrenk 127 VEREINE, FESTE, ZIRKEL Die moderne bürgerliche Gesellschaft formiert sich Christhard Schrenk 132 KATZENMUSIKEN, VOLKSVERSAMMLUNGEN, MEUTEREI Die 1848er Revolution Christhard Schrenk 139 TECHNOLOGIEREGION HEILBRONN Glanzlichter aus dem 19. Jahrhundert Susanne Schlösser 149»DAS FORTSCHRITTLICHE HEILBRONN." Politik und Kultur am Beginn des 20. Jahrhunderts Susanne Schlösser 156»ZUR EHRE DES JUDENTUMS UND DES DEUTSCHEN VATERLANDES. " Blütezeit und Zerstörung der Jüdischen Gemeinde Heilbronn Susanne Schlösser 163»MIT GEWALT AUF NATIONALSOZIALISTISCHEN KURS. " Machtergreifung und Drittes Reich Susanne Schlösser 169»HEILBRONN IST VOLLKOMMEN ZERSTÖRT UND SCHEINT OHNE LEBEN ZU SEIN«Der Zweite Weltkrieg Susanne Schlösser 176»DAS WUNDER VON HEILBRONN«Nachkriegszeit und Wiederaufbau Siegfried Schilling 183 DIE Ü BERSCHAUBARE GROSSSTADT Heilbronn seit 1967 Susanne Schlösser 193»NICHT WEIT VON DER STADT LIEGT DAS FREUNDLICHE DORF«Die Heilbronner Stadtteile vor ihrer Eingemeindung 201 Literaturhinweise 204 Register
9 Geleitwort Eine zusammenhängende Heilbronner Stadtgeschichte in einem Band - das hat es seit der 1828 erschienenen»geschichte der Stadt Heilbronn«von Karl Jäger nicht mehr gegeben. Zwar bot die 1901/03 in der Oberamtsbeschreibung veröffentlichte Abhandlung von Friedrich Dürr nochmals eine überblickartige Zusammenfassung des damaligen Standes der Heilbronner Stadtgeschichtsforschung, und auch die eindrucksvollen und ausführlich kommentierten Bilder des 1971/73 publizierten Buches»Heilbronn. Geschichte und Leben einer Stadt«lassen rasche Einblicke in die wichtigsten Bereiche des städtischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart zu. In den letzten Jahrzehnten sind aber vorwiegend Einzelstudien über spezielle Teilbereiche der Heilbronner Stadtgeschichte erschienen, die wie die Stadtchronikreihe eine Fülle sehr interessanter Details zu den jeweils abgehandelten Themen und Zeitabschnitten enthalten, doch nicht für einen schnellen Überblick über die wichtigsten historischen Entwicklungen der Stadt geeignet sind. Die Zeit war also reif für eine aktuelle einbändige»geschichte der Stadt Heilbronn«. Denn seit dem Erscheinen der bis zu hundert und mehr Jahren alten Gesamtdarstellungen hat sich nicht nur der Gang der Geschichte fortgesetzt, sondern die moderne historische Forschung hat durch andere Fragestellungen und Methoden auch weitere Ergebnisse zu Tage gebracht. Aufgrund dieser inzwischen dazugewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde in dem nun vorliegenden Band die Heilbronner Stadtgeschichte von ihren Anfängen bis heute neu geschrieben. Herausgekommen ist ein übersichtliches, instruktives, anregendes und zuweilen auch amüsant zu lesendes Buch, über dessen Erscheinen ich mich freue. Ich wünsche mir, daß diese jüngste Publikation des Stadtarchivs, die diesmal in Kooperation mit dem Theiss Verlag entstanden ist, von vielen Menschen zur Hand genommen und mit Freude und Gewinn gelesen werden wird. Dr. Manfred Weinmann Oberbürgermeister Heilbronn, im Januar
10 Vorwort»Von Helibrunna nach Heilbronn«- so haben die drei Autoren die neu herausgegebene Heilbronner Stadtgeschichte überschrieben. Der Band enthält 23 in sich geschlossene Kapitel. Diese fügen sich zu einem Gesamtbild zusammen, sie können jeweils aber auch einzeln stehen. Sie sind alle etwa gleich lang, enthalten eine Zeittafel, welche einen Überblick über die wichtigsten Fakten gibt. Jeweils am Ende rundet ein zusammenfassender Abschnitt das zuvor Geschriebene ab. Zusatzinformationen in Form von»kästen" vertiefen ausgewählte Themenkreise. Natürlich wurden alle Kapitel wissenschaftlich präzise erarbeitet. Bei der schriftlichen Niederlegung haben die Autoren jedoch Wert auf eine flüssige, anschauliche Schreibweise gelegt. Ziel war eine npopuläre«und auch schon rein äußerlich handliche Heilbronner Stadtgeschichte, welche auf dem aktuellen Wissensstand über die wichtigsten Entwicklungslinien informiert. Literaturhinweise und ein Register ergänzen bzw. erschließen den Inhalt. Der nun vorgelegte Band soll kein Heimatbuch sein, und er kann und will auch nicht eine mehrbändige»wissenschaftliche«stadtgeschichte im klassischen Sinne ersetzen. Aber natürlich besteht der Wunsch, ein solch allumfassendes und durchgehend mit Nachweisen versehenes Werk zu erarbeiten, das die Summe allen Wissens über die Heilbronner Geschichte enthält. Es bedeutet keine inhaltliche Wertung, daß nun zuerst der vielseitig geäußerte Wunsch nach einer kurzgefaßten Darstellung für die nicht-wissenschaftliche Leserschaft erfüllt wurde. Ein Wort des herzlichen Dankes darf an dieser Stelle nicht fehlen. Dieser Dank gilt Herrn Siegfried Schilling, Herrn Hubert Weckbach und Frau Dr. Susanne Schlösser für die Mit-Autorenschaft, Frau Traude Weber, Frau Cornelia Weinstock und Frau Christa Haase für die Erfassung der Manuskripte und Herrn Mathäus Jehle für die Fotoarbeit sowie Herrn Hans Schleuning (Theiss Verlag) für die verlegerische Betreuung. Dr. Christhard Schrenk Direktor des Stadtarchivs Heilbronn, im Januar
11 Aus dem Dunkel ins Licht der Geschichte Die»Villa Helibrunna«und ihre Michaelsbasilika Seit 259/260: Das vom Neckar durchflossene Heilbronner Becken ist seit der Jungsteinzeit kontinuierlich besiedelt. Die Menschen fanden des fruchtbaren Bodens und milden Klimas wegen hier vorteilhafte Lebensbedingungen. Zahlreiche Uberlandwege vermittelten den Warenverkehr. Der Ort war jedenfalls schon in vorgeschichtlicher Zeit ein Knotenpunkt wichtiger Straßenführungen, die den Neckar an Furten durchquerten. Die ersten Siedler mit geschichtlich belegtem Namen waren die Kelten, die uns ein beachtliches Spracherbe hinterlassen haben. Am Ende des 1. nachchristlichen Jahrhunderts stießen die Römer in das mittlere Neckarland vor. Sie verlegten die Reichsgrenze an den Fluß und sicherten den Neckarlimes auf der westlichen Uferseite, an den sich von Wimpfen bis zum Main der Odenwaldlimes anschloß, durch Kastelle an Flußübergängen oder Wegen. Das um das Jahr 90 errichtete Böckinger Kastell diente der Überwachung der dortigen Neckarfurt am da- Alemannische Landnahme; zahlreiche Niederlassungen im bisherigen römischen Dekumatland. 496: Schlacht bei Zülpich; die Franken unterwerfen und besiedeln das nördliche Alemannien. Ende 5./Anfang 6. Jh.: Grabfunde vom Heilb"ronner Rosenberg bezeugen Streuchristentum. 741: Schenkung einer königlichen Michaelsbasilika in der»villa Helibrunna«an das Bistum Würzburg. Erstmalige Erwähnung Heilbronns als Königshof. Um 1000: Die Grafen von Calw erhalten den Haupthof des Königsgutes Heilbronn, mit dem königliche Regalien verbunden sind. maligen Hauptarm des Flusses. In der Mitte des 2. Jahrhunderts wurde die Grenze des Römischen Reiches noch weiter gegen das freie Germanien vorgeschoben und durch den Obergermanischen Limes von Miltenberg am Main bis Lorch im Remstal sowie die Rätische Mauer weiter bis zur Donau befestigt. Das gesamte Heilbronner Umland war jetzt römisches Provinzialgebiet. Der militärischen Inbesitznahme des Landes folgte die zivile Besiedlung. Durch die starke Grenzbefestigung vor den Germanen geschützt, hatte das mittlere Neckarland Anteil an der kulturellen und wirtschaftlichen Blüte des Römischen Reiches. Die aufstrebende Entwicklung fand im 3. Jahrhundert jedoch ein jähes Ende, als die Alemannen auf der Suche nach neuen Wohnplätzen seit etwa 259/260 das römische Dekumatland in Besitz nahmen. Im Heilbronner Raum haben sie sich an der Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert niedergelassen, und sie sind sicher bis zum beginnenden 6. Jahrhundert nachzuweisen. Auf alemannische Siedlungen gehen die meisten der in Süddeutschland besonders zahlreichen Ortsnamen mit der Endung -ingen zurück. Es erhebt sich an dieser Stelle die Frage nach der politischen Bedeutung des Heilbronner Gebietes in der alemannischen Zeit. Die ältere Stadtgeschichtsforschung hat aufgrund der aus einem Reihengräberfeld auf dem Rosenberg zutage gebrachten reichen Grabbeigaben auf den Sitz eines alemannischen Fürsten hier geschlossen. Heute sieht man in den reichen Toten vom Rosenberg zwar Angehörige einer wohlhabenden Schicht, keinesfalls aber solche einer fürstlichen Familie.»Damit entfällt auch der... Rückschluß vom späteren frän- 9
12 Ersterwähnung Heilbronns 741 nach der Urkunde Kaiser Ludwigs des Frommen von 822 ". et in ipso pago", nämlich dem Neckargau (Necraugauginse),»basilicam in villa Helibrunna in honore sancti Michahelis archangeli constructam una cum appendiciis suis«(. und in demselben Gau eine zu Ehren des hl. Erzengels Michael gebaute Basilika in der villa Helibrunna mitsamt ihrem Zubehör). Neben der Michaelsbasilika, später St. Kilian, ist mit der»villa«der Königshof angesprochen. kischen Königshof auf früheres alemannisches Fürstengut. " (Oomen). Folgt man der jüngeren Forschung weiter, muß sogar offen bleiben, ob es sich bei jenen Männern und Frauen überhaupt um Alemannen gehandelt hat. Da die Gräber nämlich nicht eindeutig zu datieren waren und sowohl dem ausgehenden 5. als auch dem beginnenden 6. Jahrhundert angehören können, ist die Stammeszugehörigkeit dieser Bestatteten - noch alemannisch oder schon fränkisch? - nicht geklärt. Als die Alemannen nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches ausgangs des 5. Jahrhunderts über den Rhein drängten, stießen sie in der Schlacht bei Zülpich 496 auf die dort ansässigen Franken. Dieses erste zusammentreffen der beiden Völkerschaften endete»in einer für die weitere geschichtliche Entwicklung bedeutsamen Niederlage«(Miller) der Alemannen, die damit ihre Vormachtstellung im deutschen Südwesten einbüßten. Die fränkisch-alemannische Grenze bildete von da an eine von den Vogesen ausgehende, über das Rheintal und quer durch Baden und Württemberg zum Ries führende Linie, die heute noch Sprachgrenze ist. Zwar mußten die alemannischen Bauern das Land nicht verlassen, die Oberschicht aber wurde vertrieben, ihr Besitz fiel linksneckarisch an den fränkischen Adel, rechtsneckarisch legte der König seine Hand darauf. Wie rasch die fränkische Besiedlung voranschritt, läßt sich nicht $agen. Eine durchorganisierte Erfassung des ostfränkischen Raumes ist jedenfalls längs des Neckars erst seit den Karolingern zu beobachten. Dem Handelsverkehr dienten weiterhin die alten Straßenzüge, deren westwärts führende als Verbindungswege zu den großen Wirtschaftszentren jener Zeit bedeutsam waren. Seit dem Ende des 6. Jahrhunderts brachten die Franken das Christentum in das Land, zu dem ihr König Chlodwig sich nach der Schlacht bei Zülpich bekannt hatte. Wann der neue Glaube den mittleren Neckarraum erreichte, wissen wir nicht. Die Christianisierung unseres Raumes wurde früher mit zwei bemerkenswerten Grabfunden vom Rosenberg verknüpft, wo als Beigaben aus einem Frauengrab ein silberner Löffel mit der Inschrift»POSENNA VIVAS" und ein Beinkästchen mit dem von den griechischen Buchstaben "A" und "Q" (Alpha und Omega) begleiteten Christogramm»XP«auf der Deckplatte zum Vorschein kamen. Die Posenna-lnschrift gibt»ein Gebet wieder, das dem Verstorbenen gilt, der ganz sicher Christ war" (Oomen). Aber weder der Löffel noch das Kästchen dürfen als Zeichen einer damals schon allgemeinen Christianisierung gewertet werden, sondern sind Hinweise auf vereinzeltes frühes Christentum. Grabfunde aus Böckingen mit ebenfalls eindeutigen christlichen Hinweisen datieren in das 7. Jahrhundert. Es handelt sich um Gürtelbeschläge mit Runeninschriften, welche auf nunmehr intensiv Beinkästchen vom Rosenberg, Deckel mit Christogramm, Ende 5./Anfang 6. Jahrhundert. Der Fund ist ein Hinweis auf vereinzeltes frühes Christentum. fr. \.,:, '
13 Zur Erstausstattung des Bistums Würzburg 741 gehörte auch eine Michaelsbasilika Hin villa Helibrunria«. Die erste Erwähnung Heilbronns findet sich in einer Bestätigung jener Schenkung durch Kaiser Ludwig den Frommen 822. betriebene Missionierung schließen lassen. Aber erst im 8. Jahrhundert scheint sich das Christentum dauerhaft und allgemein durchgesetzt zu haben. Namentlich tritt Heilbronn erstmals gegen die Mitte des 8. Jahrhunderts in Erscheinung. Als im Jahre 741 der fränkische Hausmeier Karlmann ( ) dem in Gründung befindlichen Bistum Würzburg zur Erstausstattung 25 Kirchen und ein Kloster aus königlichem Eigengut im östlichen F rankenreich mitsamt deren Zubehör schenkte, befand sich darunter im Neckargau auch eine dem heiligen Michael geweihte nbasilica«in der»villa Helibrunna«. Von dem genannten Jahr gibt es allerdings keine schriftliche Überlieferung. Erst eine Bestätigung Kaiser Ludwigs des Frommen von 822, der ein Diplom Kaiser Karls des Großen zugrunde liegt, bringt uns deren Inhalt zur Kenntnis und nennt zum ersten Male Helibrunna - Heilbronn. Der Name geht in seinem zweiten Teil fraglos auf die bei der heutigen Kilianskirche einst aus dem Boden hervorgetretene Quelle zurück. Über die Herleitung des ersten Wortteiles herrscht Unsicherheit ob von heilig, heilend oder Erfrischung bietend. Die ältere Forschung vermutete an jener Örtlichkeit ein alemannisches Kultzentrum, doch gibt es dafür keinerlei Hinweise. Auch jene Sage, Karl der Große habe bei der Quelle, an welcher der heilige Kilian einstmc:ils die Taufe gespendet habe, ein Gotteshaus gestiftet und der Örtlichkeit den Namen»Heiligbrunnen«, also Heilbronn gegeben, ist so nicht zutreffend. Dennoch dürfte sie im Kern der Wahrheit nahekommen, denn es erscheint durchaus wahrscheinlich, daß die Quelle einst als Taufbrunnen gedient hat und die Bildung des Namens aufgrund dieser Gegebenheit erfolgt ist, das heißt aber: erst in fränkischer Zeit. Auch entstand daneben ein Gotteshaus, nämliche diese dem heiligen Michael geweihte Basilika. Unter»Villa«ist der Königshof zu verstehen, der vermutlich schon im 7. Jahrhundert bestanden hat, jedenfalls lange vor der Vergabe der Michaelsbasilika an Würzburg. Mit»Villa nostra«oder nur»villa«findet er weiterhin 832, 845 und 889 Erwähnung, mit»villa dominica«letztmals 923. Ein anderes Wort für den Königshof ist fiscus", und auch dieser Ausdruck ist mit fiscus dominicus«889 einmal belegt. Beide Begriffe beziehen sich auf die zentrale Einrichtung der königlichen Grundherrschaft, nicht auf den gesamten Reichsgutbezirk. Der Königshof war in erster Linie ein Wirtschaftshof. Neben dem Haupthof, dem Herrenhof, gab es noch eine Anzahl landwirtschaftlicher Nebenhöfe. Die Königshöfe bildeten als Landgüter die wirtschaftliche Grundlage für den Aufwand des Herrschers und seines Gefolges. Der Haupthof, dem Mittelpunktsfunktion zukam, an dem verwaltet und Recht gesprochen wurde, hatte die jähr- 11
14 u. )W / lieh aus dem Fiskalbezirk anfallenden Abgaben und Zinsen einzuziehen, die Naturalerträge eventuell auch zu vermarkten. Daneben dürften hier die der Kirche zustehenden Zehnten usw. eingesammelt und an die zuständigen Gotteshäuser weitergeleitet worden sein. Dienstleistungen gegenüber dem reisenden Hof, z.b. dessen Beherbergung oder die Zulieferung von Agrarprodukten sowie die Stellung von Bediensteten, gehörten ebenso zu den Aufgaben des Königshofes wie die Quartierbereitstellung für Königsboten oder Gesandtschaften und deren Versorgung. So fand in der»villa nostra. Heilambrunno«832 eine Zusammenkunft statt des kaiserlichen»missus«(gesandten) H. mit mehreren Grafen und anderen Getreuen des Kaisers. Und von einem Königsaufenthalt hier kündet eine Urkunde Ludwigs des Deutschen von 841, ausgefertigt in»heilicbrunno palatio regio«. Der Ausdruck»palatium regium" steht nach Zotz im frühen Mittelalter stets für das königliche Haus. Heilbronn war also keine Pfalz, und auch die Deutung des Begriffs mit Pfalzversammlung ist nicht zutreffend, da»palatium regium" diese Bedeutung nie hatte. Die Anwesenheit Ludwigs 841 ist im übrigen der einzige bezeugte Aufenthalt eines karolingischen Herrschers in Heilbronn. Dem im Grenzraum zwischen Franken und Alemannien gelegenen Königshof Heilbronn ist demgemäß auch eine politische Funktion zugekommen, er war nicht nur Wirtschaftshof. 832, als das erwähnte Tr. effen mit dem kaiserlichen»missus" hier stattfand, herrschten wegen der Wahrung der in der Ordinatio imperii (Gesetz zur Wahrung der Reichseinheit) von 817 festgelegten Erbfolge erbitterte Auseinandersetzungen zwischen dem Kaiser und seinen Söhnen erster Ehe, nachdem Ludwig diese Ordnung ei- - genmächtig zugunsten eines Sohnes zweiter Ehe geändert hatte. Ludwig der Fromme scheint damals die Unterstützung seiner rechtsrheinischen Getreuen gesucht zu haben, wozu ihm Heilbronn als Versammlungsort geeignet erschien. Dazu mußten allerdings hinreichend Beherbergungs- und Verpflegungsmöglichkeiten vorhanden sein. Und 841 dürfte der Aufenthalt Ludwigs des Deutschen in Heilbronn dazu gedient haben, mit den Alemannen zu verhandeln, die der König in dem Streit mit seinen Brüdern um das Erbe des Vaters wohl auf seine Seite ziehen wollte. Die regionale Verteilung der Königshöfe hing von verschiedenen Voraussetzungen ab. Als Rastplätze des reisenden Königs, der ja keinen festen Regierungssitz kannte, lagen sie im Abstand der durchschnittlichen Tagesrouten. Andererseits wurden sie im Grenzbereich auch unter politischen Gesichtspunkten sowie an strategisch wichtigen Stellen ange- Im Jahre 841 siegelte König Ludwig der Deutsche in Heilicbrunno palatio regio«. Der dam< lige Aufenthalt Ludwigs ist der einzige bezeugte eines karolingischen Herrschers in Heilbronn. Die Karlssage In einer Sage wird die Namensgebung Heilbronns Karl dem Großen zugeschrieben. Der folgende Abdruck ist ein verkürzter Auszug aus Jägers»Handbuch für Reisende in den Neckargegenden.", S :»Als unser Vaterland noch in der. Nacht heidnischen Aberglaubens versunken war, kamen. die Apostel des Friedens, die Lehre des Christenthums. zu pflanzen. Unter ihnen kam auch Kilian. Eine. Quelle war der Sammelplatz derer, die sich zum Evangelium bekehrten. " Nach Kilians Weggang»gewann. gar bald. in den Gegenden des Neckars. die Finsterniß wieder die Oberhand., und die Quelle,. wo nun ein Schüler desselben. das Wort des Herrn verkündete, wurde immer seltener besucht.. Unweit des Neckars. jagte einst Karl. Von Durst getrieben, suchte er... eine Quelle... Da nahete sich ein Priester... >Es ist für mich [eine] gar schlimme Zeit; vor vielen Jahren hat. Kilian hier das Evangelium gepredigt und den Gläubigen mit dem Wasser dieser Quelle die heilige Taufe gegeben; aber nun steht sie verödet, denn Niemand will sich mehr taufen lassen, und auch in den Herzen derer, die einst glaubten, ist es wiederum finsterer geworden «-,sey getrost" entgegnete ihm Karl,,. so wie ich hier an dieser Quelle meinen leiblichen,durst gestillt habe, so will ich sie auch zu einem Borne himmlischen Segens für die Seelen der Menschen machen" Mit. Eifer berief Karl. Arbeiter, und ließ auf der Quelle ein Gotteshaus erbauen, darin das Werk des Evangeliums zu bestellen und wieder. zu beleben.. Dem Gotteshaus mehr Ansehen zu verleihen, ließ er in dessen Nähe sich ein eigen Haus erbauen, und die Quelle nannte er den Heiligbrunnen.." 12
15 Das später vom Spital überbaute Areal des ehemaligen Königshofes (Haupthof} nach dem Altstadtmodell von Karl und Emma Weingand, das die Stadt um 1800 zeigt. legt, die nvilla«heilbronn z.b. an einem Verkehrsknotenpunkt mit Flußübergang. Die nvillae regiae«wiederum gründeten mit Königszinsern Ausbausiedlungen im zugehörigen Fiskalbezirk, der für Heilbronn mit dem Stifts- und Wartberg im Norden, den Höhenzügen im Osten, Sontheim, wahrscheinlich auch Horkheim, Talheim und Flein im Süden und im Westen dem Neckar in etwa zu umreißen ist. Die Frage nach der Lage des Königshofes, d. h. des Haupthofes, ist in der jüngeren Zeit sehr kontrovers diskutiert worden. Jäger hat dafür als erster 1828 das Gelände des späteren Deutschhofs in Anspruch genommen. Grabungen dort in den 50er Jahren haben diese Annahme indessen nicht bestätigt: Es fand sich keine solch frühe Bausubstanz. Der Königshof mußte also an anderer Stelle gesucht werden. Im Jahre 1146 erhielt Kloster Hirsau in Heilbronn im Wege einer Schenkung aus dem Hause der Grafen von Calw u.a. eine ncurtis«, worunter ein Herrenhof mit landwirtschaftlichem Eigenbetrieb zu verstehen ist. Da mit diesem die königlichen Regalien Markt und Münze verbunden waren, darf man ihn wohl als den Haupthof des ehemaligen königlichen Fiskalbezirkes Heilbronn ansehen, der sich nach einer Urkunde Kaiser Ottos III. 992 noch als geschlossener Komplex in königlicher Hand befunden hat, kurz darauf aber der Auflösung preisgegeben worden ist. Die Grafen von Calw scheinen damals zur maßgebenden Herrschaft am Ort geworden zu sein. Von dieser Schenkung ausgehend, haben Helmut Schmolz und HubertWeckbach 1971 anhand der urkundlich belegten Heilbronner Hofgeschichte den Versuch unternommen, die Lage des Königshofes zu bestimmen. Dabei war allerdings zwingende Voraussetzung, daß es sich bei dem Calwer Hof tatsächlich um den Haupthof des Königsgutes Heilbronn handelte. Es würde zu weit führen, den Besitzgang des Calwer = Hirsauer Hofes hier detailliert aufzeigen zu wollen. Hingegen festzuhalten ist, daß Hirsau 1324 diesen Hof um 2500 Pfund Heller 13
16 an das Kloster Maulbronn weiterveräußert hat. Da diese gewaltige Summe von Maulbronn nicht aufgebracht werden konnte, verkaufte das Kloster sofort einen beträchtlichen Teil des neuerworbenen Besitzes weiter an die Abtei Kaisheim. Uber die Lage des Hofes ist in dem Kaufvertrag ausgesagt: nicht weit von der Stadtmauer in der Stadt. Da zugleich von einer nahegelegenen Mühle die Rede ist, heißt das zudem: am Neckar. Über die nun folgenden Nachbesitzer kristallisierte sich für die Lage des Calwer und damit des ehemaligen Königshofes schließlich das Areal zwischen dem Lohtor und dem Brückentor, dem Neckar und der»straße", d.h. der heutigen Gerberstraße, heraus, also jener Bereich, über den sich später das 1306 gestiftete Spital erstreckte, ein überschwemmungsfreier Platz auf dem Hochufer unmittelbar neben einer Furt des damals noch relativ flachen und erst seit 1333 aufgestauten östlichen Neckararmes. Eine in dem Kaufvertrag erwähnte Kapelle, die auch als St. Johannes-Kapelle bezeugt ist, war die ehemalige Königshofkapelle. Diese Erkenntnisse sind in jüngster Zeit in Frage gestellt worden, doch ist die konträre Argumentation keinesfalls überzeugend. Daß es sich bei der von König Rudolf an Kloster Maulbronn gegebenen»curia«nicht um den Dürner Hof gehandelt haben soll, mag angehen, der ehemalige Königshof, wie zur Diskussion gestellt, kann es aber doch wohl nicht gewesen sein. Denkbar wäre bestenfalls, daß sich einer der Nebenhöfe noch in Reichsbesitz befunden hat. An die Hofgemeinde schloß sich gegen Qsten schon früh eine Marktsiedlung an. Uberbaut war seit dem 8. Jahrhundert, nachgewiesen durch archäologische Grabung, zum mindesten der heutige Marktplatz, vermutlich sogar bis in die Zeit um Hof- und Marktgemeinde stellten zunächst unabhängige Rechts- und Lebenskreise dar, die erst im laufe der Zeit zu einer Einheit zusammenwuchsen, wobei die letztere die dominante Rolle übernahm. Begrenzt wurde diese Siedlung, die spätestens_ seit dem 11. Jahrhundert»Stadtähnlichen«Charakter hatte, durch die Kirchbrunnenstraße-Sülmerstraße-Lohtorstraße und den Neckar. Sie war parallel zum Fluß von der genannten»straße«durchzogen, einer aus dem Norden kommenden und zur Donau ziehenden Fernstraße, und vermutlich bereits in einfacher Weise befestigt. Die in der Urkunde Ludwigs des Frommen von 822 für das Jahr 741 angeführte Michaelsbasilika war das Gotteshaus des Königsgutsbezirkes und damit aller dort lebenden Menschen, sie war die Urkirche Heilbronns. Wann diese Kirche gebaut worden ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Ihre Gründung mag aber weit vor 741 liegen. Für die ältere Heilbronner Stadtgeschichtsforschung war klar, daß die Kilianskirche aus jener Michaelsbasilika herausgewachsen ist. Die jüngere Forschung hat eine Zeitlang dieses Gotteshaus als Vorgängerin der Deutschordenskirche, St. Peter und Paul, hingestellt. Heute ist man wieder der Meinung, die Michaelsbasilika an der Stelle von St. Kilian suchen zu müssen. Jedenfalls steckt in der Kilianskirche sehr alte Bausubstanz. Durch Grabungsbefund hat man Kenntnis von einem romanischen Vorgängerbau, dessen Fundamente in die Zeit um 1000 datiert worden sind. Die Identität der Kilianskirche und der zuletzt 889 namentlich erwähnten Michaelsbasilika belegen zudem spätere Urkunden im Zusammenhang mit der Aneignung Würzburger Rechte durch König Rudolf 1. Möglicherweise liefert dafür auch die Verleihung eines dreiwöchigen Jahrmarktes um Michaelis durch den König 1288, die eventuell anläßlich der Fertigstellung des damaligen Neubaus der Pfarrkirche erfolgt ist, einen weiteren Beleg, denn Jahrmärkte schlossen sich im allgemeinen eng an das Patrozinium der Pfarrkirche an. Zur Erstausstattung des Bistums Würzburg gehörte auch der Fiskalzehnte, den König Pippin ( ) wohl 751 ihm übertragen hat. Der Zehnte mußte von den Königszinsern, die auf königlichen Gütern saßen, ursprünglich als Entgelt für die Nutzung ihrer in Erbpacht bewirtschafteten Hufen (Bauernhöfe) an den Fiskus entrichtet werden. Als er das nächste Mal Erwähnung erfährt, 1251, befindet er sich als königliches Lehen in den Händen der Herren von Dürn. Er muß der Würzburger Kirche also von seiten des Reiches entfremdet worden sein. Möglicherweise war Heinrich (VII.), der, 14
17 Blick auf die Neckarlront der Stadt nördlich der Brücke. Hier lag, über dem Fluß, der Königshof (Haupthof}, davor der»portus«, wohl Fähre und Schiffsanlände zugleich. Foto, um 1864/65 wie noch zu zeigen sein wird, den Auflösungsprozeß des Heilbronner Königsgutes rückgängig zu machen suchte, 1225 damit von Würzburg belehnt worden. Halten wir zusammenfassend fest: Die fruchtbare, vom Klima begünstigte Landschaft des Heilbronner Beckens ist seit der Jungsteinzeit kontinuierlich besiedelt. Die ersten namentlich bekannten Siedler waren die Kelten. Der Einbruch der Alemannen in das Dekumatland um 259/260 beendete die römische Herrschaft rechts des Rheins. Mit ihrer Niederwerfung ausgangs des 5. Jahrhunderts wurde das rechtsneckarische Gebiet fränkisches Fiskalland, in dem aus militärstrategischen und politischen, verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Gründen Königshöfe gegründet wurden. Die»Villa Helibrunna«findet erstmals für das Jahr 741 Erwähnung, und zwar mit der königlichen Schenkung einer hier stehenden Michaelsbasilika an das in Gründung befindliche Bistum Würzburg. Über deren Grundmauern ist später St. Kilian gebaut worden. Mit der Auflösung des bis dahin ungeschmälerten königlichen Fiskus seit etwa der Jahrtausendwende gelangten die Grafen von Calw in den Besitz des Haupthofes. Zum Calwer Hof gehörten jedenfalls königliche Regalien, d. h. Hoheitsrechte. Nachbesitzer waren die Klöster Hirsau, Maulbronn und Kaisheim sowie patrizische Familien. Zuletzt breitete sich das Spital auf dem Areal aus. Der Deutschhof war eine Neuanlage des 13. Jahrhunderts. Ein anderer Nutznießer ehemaligen Fiskalbesitzes ist im Würzburger Bischof zu sehen, der zeitweise starken Einfluß hier gewann. An die Hofgemeinde hatte sich bald eine Marktgemeinde angeschlossen, wie Grabungen auf dem Marktplatz zeigten, wo bisher einzig in der Stadt karolingerzeitliche Funde aus dem Boden kamen. Der Königshof war also der Kristallisationspunkt der nachmaligen Stadt Heilbronn. Optimale Bedingungen, nicht zuletzt die verkehrsgünstige Lage am schiffbaren Nekkar und am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen, begünstigten die Entwicklung. Schon in der Mitte des 11. Jahrhunderts hatte Heilbronn»Stadtähnlichen«Charakter, und schließlich wurde die Marktgemeinde politisch zur bestimmenden und führenden Kraft. Ihr Weg führte konsequent zu Freiheit und Unabhängigkeit. 15
18 Vom Dorf zur Stadt Der Aufstieg beginnt Bis um 1000 n. Chr. stand Heilbronn unter dem direkten Einfluß des Königs, danach begann die Auflösung des Königsgutes. Bedeutende Teile gelangten in den Besitz der Grafen von Calw. Aus deren Familiengut verfügte Uta von Calw die Ältere vor 1100 eine umfangreiche Schenkung von Gütern im Heilbronner Raum an das Benediktinerkloster Hirsau bei Calw im Schwarzwald. Dieses Kloster war von den Vorfahren der Uta gegründet worden. In dem in jener Zeit akuten Streit zwischen den Staufern und den Welfen war auch das Haus Calw in sich zerstritten, weil mit beiden Seiten enge verwandtschaftliche Beziehungen bestanden. Die Familienauseinandersetzung übertrug sich auf die Frage, ob die große Heilbronner Schenkung der Uta an das Kloster Hirsau tatsächlich vollzogen werden sollte. Denn der bei der Weibertreu-Auseinandersetzung im Jahre 1140 in Weinsberg unterlegene Welf VI. war mit Uta von Calw der Jüngeren verheiratet, einer Nichte jener älteren Uta, welche die Stiftung an das Kloster Hirsau einst verfügt hatte. Welf VI. versuchte die Besitzübergabe an Hirsau zu verhindern. Denn der Staufer Konrad III. - dieser hatte ihn bei Weinsberg besiegt - hatte sich zum Herrn über dieses Kloster erklärt erfolgte der Vollzug dann doch, wohl weil Welf VI. die alten Probleme bereinigt wissen wollte, bevor er zum Kreuzzug ins Heilige Land aufbrach. Die entscheidende Quelle für diese Schenkung ist der Codex Hirsaugiensis. Er belegt für Heilbronn in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts einen Markt (»mercatum«), eine Münze (»moneta«) und einen»hafen«(»portus«). Über den Markt hinaus bezeugt die für jene Zeit in Süddeutschland einmalige Nennung eines»portus«wohl nicht nur eine Fähre, Furt oder einen Schiffsanlegeplatz, sondern - anschließend daran - wahrscheinlich auch eine Kaufmannssiedlung. Im Hafenbetrieb liegt die Keimzelle einer für Heilbronn äußerst wichtigen Entwicklung. Noch heute befindet sich in der Stadt einer der größten deutschen Binnenhäfen. Entsprechendes gilt für die erstmalige Erwähnung des örtlichen Weinbaus, die ebenfalls im Zusammenhang mit der Schenkung Utas im Codex Hirsaugiensis steht. Denn der Weingärtnerstand wurde später zu einem wesentlichen Faktor der Stadtgeschichte. Die Kommune zählt heute mit ca. 550 Hektar Rebland zu den großen Weinbaugemeinden der Bundesrepublik. Damit laufen im Jahre 1146 viele wichtige Fäden für die Entwicklung und Struktur der späteren Reichsstadt zusammen. Das Vorhandensein einer Heilbronner Münze noch im 15. Jahrhundert und die bereits im 11. Jahrhundert bezeugte Anwesenheit von Juden unterstreichen die Bedeutung der Stadt als Marktort. Die jüdische Gemeinde prägte die Geschichte Heilbronns mit. Der Gedenkstein für Nathan den Gemeindevorsteher aus dem 11. Jahrhundert paßt gut in dieses Bild. Einen weiteren wichtigen Einflußfaktor neben den Grafen von Calw bildeten die Herren von Dürn. Ihnen gehörte neben dem Dürner Hof u.a. ehemaliges Königs- Um 1000: Die Auflösung des Heilbronner Königsgutes beginnt. Vor 1100/1146: Schenkung der Uta von Calw; erster Nachweis von Markt, Münze,»Hafen«und Weinbau in Heilbronn. Um 1225: Ulrich von Dürn und seine Mutter Liutgard stiften dem Deutschen Ritterorden Siedlungsland in Heilbronn. 1225:. Heilbronn wird durch den»nordhäuser Vertrag«wieder zu direktem königlichen Einflußgebiet. Das Gemeinwesen wird erstmals als»oppidum«bezeichnet. 1265: Erstes Heilbronn-Siegel. 1281: Stadtrecht durch Rudolf von Habsburg. 16
19 Für das Jahr 1265 läßt sich erstmals ein Heilbronner Siegel nachweisen. Die selbstbewußte Bürgerschaft wählte sich den Adler als Wappentier und nahm auf diese Weise gewissermaßen den Reichsstadtgedanken vorweg. 17
20 18
21 Im Jahre 1333 hatte Heilbronn mit dem Aufbau des Territoriums begonnen. Dessen östlicher Teil ist in dieser Karte des Heilbronner Stadtmalers Hans Peter Eberlin von 1578 abgebildet. König Rudolf von Habsburg verlieh am 9. September 1281 Heilbronn das Stadtrecht. Dabei setzte der Herrscher einen königlichen Vogt zur Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit ein, daneben stellt er einen Schultheißen für die Zivilgerichtsbarkeit und die Verwaltung. Außerdem schuf er Rats- und Gerichtsgremien, die sich aus 1 dem Patriziat rekrutierten. 19
22 Der Blick, den der junge Gustav Schmoller festgehalten hat, geht von Westen über das Spital. Im Hintergrund ist in der Mitte der Turm des (heutigen) Deutschordensmünsters und links derjenige der Kilianskirche zu erkennen. Rechts überspannt die gedeckte Neckarbrücke den Fluß. Aquarell,
23 In den Bollwerksturm, den diese aquarellierte Federzeichnung um 1586 zeigt, wurde Götz von Berlichingen wegen verweigerter Urfehde gelegt. 21
24 Zwei Seiten aus dem Heilbronner Statutenbuch von 1541, das auch gedruckt vorliegt und bis zum Ende der Reichsstadtzeit in Kraft war. Das aufwendig ausgefertigte handschriftliche Exemplar war ein Repräsentationsstück der Stadt. 22
25 Hoch überragt der Turm der Pfarrkirche St. Kilian Heilbronn fand der Namenspatron des Gotteshauses erstmals urkundliche Erwähnung. Ausschnitt aus der ältesten Stadtansicht, einer aquarellierten Federzeichnung, um
26 24 Muttergottes mit Jesuskind vom Hochaltar der Kilianskirche.
27 Der Hirsauer Codex berichtet darüber, daß im Jahre 1146 eine Schenkung von Gütern im Heilbronner Raum vollzogen wurde, welche Uta von Calw um das Jahr 1100 verfügt hatte. Diese Quelle belegt u.a. einen Markt, eine Münze und einen»hafen«in Heilbronn. Außerdem enthält sie den ältesten Nachweis für Weinbau am Ort. gut, z.b. am Wartberg, und Land südlich des ältesten Siedlungskerns. Dieses stifteten Ulrich von Dürn und seine Mutter Liutgard dem Deutschen Orden, als Ulrich um das Jahr 1225 diesem beitrat. Damit war die Grundlage für den bald darauf in Heilbronn entstehenden Deutschhof gelegt. Dessen frühe Geschichte gibt uns jedoch Rätsel auf. Von der Existenz eines Komturs in Heilbronn erfahren wir nämlich nicht vor 1268, also über 40 Jahre später. Das ist nicht unlogisch, wenn man davon ausgeht, daß die Kommende erst errichtet werden mußte. Eine Deutschhofkapelle wird urkundlich erstmals im Jahre 1291 erwähnt. Allerdings wird man davon ausgehen dürfen, daß der im Jahre 1268 genannte Komtur auch über eine Kirche verfügt hat. Wann genau diese gebaut wurde, muß offen bleiben; der Altar und das romanische Kreuzgewölbe in der heutigen Taufkapelle stammen aus der Zeit um /95 kamen bei der Renovierung des Deutschordensmünsters unter dem Fußboden der alten romanischen Kirche und der Südwand des Turmes Fundamentmauern aus Kalkstein zum Vorschein. Dieses Kalksteinmauerwerk, das nicht wissenschaftlich datiert wurde, setzte sich an der Südostseite des Turmes bis in die Mitte des ersten Obergeschosses fort, während die gesamte Kirchenanlage sonst aus Sandstein besteht. Die Umstände beweisen, daß diese Kalksteinmauern älter als die erste bekannte D e utschhofkapelle sind. Die Mächtigkeit dieser Kalksteinfundamente und die Art der Einfügung der Kalksteinmauerreste in den Turm legen es darüber hinaus nahe, daß sie schon vor dem Baubeginn der Kommende vorhanden waren. Als dritter Machtfaktor in Heilbronn neben Calw und Dürn wirkte der Bischof von Würzburg, der seit der Gründungsausstattung seines Bistums am Ort begütert war. Weitere Besitzungen kamen hier - an der Diözesangrenze zu Worms - nach dem Jahre 1000 hinzu. Durch die zunehmende Zersplitterung der obrigkeitlichen Verhältnisse nach der Jahrtausendwende war der Weg zur Reichsstadt nicht vorgezeichnet. Obwohl der Einfluß des Königs in Heilbronn immer weiter zurückging, konnte sich Heinrich (VII.) hier zu Beginn des 13. Jahrhunderts nochmals eine bemerkenswerte Machtbasis schaffen. Mit einem Trick gelang es dem staufischen König, der 1235 wegen seiner Erhebung gegen Kaiser Friedrich II. abgesetzt wurde und dessen Zählung deshalb in Klammern notiert wird, im Nordhäuser Vertrag von 1225 den Bischof von Würzburg in Heilbronn auszuschalten. Er zwang den Kirchenmann unter Umkehrung der üblichen Lehenspyramide, ihn mit seinem Heilbronner Gut (u.a. Alt-Böckingen) zu belehnen. Damit war Heilbronn wieder zum direkten königlichen Einflußgebiet geworden. Der Vertrag bezeichnet das Gemeinwesen erstmals als»oppidum", das demnach zu 25
28
29 weicht der Wortlaut der Liste jedoch von diesem Schema ab. Hier heißt es nur allgemein, daß der Ort»Wegen des Bauens«von der Reichssteuer befreit sei - die sonst folgende Erwähnung einer Mauer unterbleibt. Mit dem Untergang der Staufer begann der Aufstieg Heilbronns, der im 14. Jahrhundert zur Reichsfreiheit führte. Ein wichtiges Indiz dafür war das dreieckige Siegel, welches das Gemeinwesen ab 1265 führte. Es zeigte einen Adler und trug die Umschrift»SIGILLUM CIVITATIS HAILPRUNEN«(Siegel der Bürgerschaft von Heilbronn). Dies war Ausfluß des Selbstbewußtseins der Heilbronner, welche das Machtvakuum nach dem Untergang der Staufer, in der Zeit des Interregnums, geschickt zum Ausbau der eigenen Stellung ausnutzten. Mit dem Adler, der heute noch als Heilbronner Wappentier gebraucht wird, grenzte sich das Gemeinwesen bewußt von allen lokalen Herren ab und unterstellte sich in gewisser Weise symbolisch direkt dem Reich. Die Aufnahme des Reichsadlers in das Siegel nimmt den Reichsstadtgedanken gleichsam vorweg. Das von Rudolf von Habsburg verliehene Stadtrecht (übersetzt von Adalbert Burkert, Heilbronn) Rudolf, von Gottes Gnaden König der Römer, Mehrer des Reiches. An alle in Ewigkeit.. Es sollen also wie die Gegenwärtigen so die Zukünftigen wissen, daß wir unsere Stadt Heilbronn und die Bürger ebendort schützen und bestätigen mit allen Gesetzen, Rechten und Gewohnheiten, deren sich die Stadt Speyer erfreut.. Besonders wer auch immer einen anderen in der vorgenannten Stadt Heilbronn tötet, der wird als Mörder über das Rad gelegt werden. Der Ehefrau des Getöteten oder ihren Erben darf aber ihr Hab und Gut nicht fortgetragen werden, sondern es muß ihr alles heil verbleiben, damit es nicht den Anschein hat, dem Geschädigten werde noch ein Schaden hinzugefügt. Wenn aber einer einen anderen ohne Lebensgefahr verwundet, so daß er von jener Verwundung geheilt werden könnte, wird der Angeklagte entweder seine Hand verlieren oder Zehn Pfund Speyerer Pfennige zahlen. Von diesen werden drei an den Schultheiß gehen, zwei an die Stadt und fünf an den Vogt. Trotzdem wird der Angeklagte M zehn Monate aus der Stadt gewiesen.. Über Schulden aber und Verträge und Verabredungen welcher Art auch immer, die in der Stadt üblicherweise feierlich geschlossen werden, hat man dem Zeugnis des Schultheißen oder seines glaubwürdigen Boten oder zweier glaubwürdigen Personen zu glauben und muß zu ihnen stehen.. Wer auch immer von den Bäckern außerdem schlecht bäckt oder sich beim Brot an weniger als das Geschuldete hält - wenn er von zwei Bäckern, die hierfür in der Stadt selbst ausgewählt werden müssen, darin überführt worden ist -, dann müssen drei Brote für zwei verkauft werden, und trotzdem wird er zur Wiedergutmachung der Stadt einen Schilling Speyrer Pfennige geben.. Weiterhin, wer auch immer ein aus falscher Wolle gewebtes Tuch verkauft oder zum Verkauf auslegt, so muß dieses Tuch öffentlich im Feuer verbrannt werden, und nichtsdestoweniger werden der Schultheiß und die Räte dafür eine Strafe verlangen und eintreiben, je nach dem wie es ihnen nützlich scheinen wird.. Ebenso werden zwölf Räte, die aus den Besseren und Nützlicheren der Stadt gewählt werden müssen, in den einzelnen Monaten unter sich vier auswählen und aufnehmen, die während des Monats selbst zusammen mit dem Schultheiß alle und auch die einzelnen Geschäfte erledigen, die sich als erledigenswert ergeben. Bei allen und den einzelnen oben beschriebenen Punkten aber wollen wir, daß unserem Vogt und unserem Schultheiß ihre Rechte nicht gemindert, sondern über alles uneingeschränkt erhalten werden. Keinem Menschen überhaupt soll es daher gestattet sein, diese Seite unserer Neuerung und Bestätigung einzuschränken oder ihr in irgendeinem unüberlegten Wagnis entgegenzutreten. Wer dies aber tut, der soll wissen, daß er einen schweren Verstoß gegen die königliche Hoheit begeht. Zum Zeugnis in dieser Sache haben wir befohlen, daß das gegenwärtige Schriftstück mit dem Siegel unserer Majestät bestätigt wird. Gegeben in Gemunden an den 5. Iden des Septembers während der 9. Indiktion im Jahre des Herrn 1281, dem achten Jahr aber unserer Herrschaft. 27
30 Diesen Prozeß derverselbständigung Gmünd an Heilbronn die Rechte seiner versuchte König Rudolf von Habsburg als Lieblingsstadt Speyer. Dabei handelt es erster starker Herrscher nach dem Inter- sich um das erste schriftlich überlieferte regnum zu stoppen. Die Politik Rudolfs Stadtrecht für Heilbronn. Auf diese Weise bedeutete für die aufstrebende Entwick- stellte er den Einfluß des Königtums in lung der Stadt eine Zäsur, wobei dieser der Stadt wieder her, insbesondere inin Heilbronn erst acht Jahre nach seiner dem er einen königlichen Vogt als»ober erfolgten Königswahl massiv ein- sten Beamten" etablierte, der die hohe griff. Zuvor hatte er sich mit dem mäch- Gerichtsbarkeit ausübte. Neben dem tigen Böhmenkönig Ottokar auseinander- Vogt stand ein königlicher Schultheiß, in gesetzt und sich in diesem Zusammen- dessen Zuständigkeit die Zivilgerichtshang mehrere Jahre in Wien aufgehalten. barkeit und die Verwaltung fielen. An die Dabei war die Verbindung zwischen dem ser Verwaltung der Stadt war in Form von Hause Habsburg und Österreich entstan- zwölf Ratsherren aber auch ein (privileden. Im Grunde erst nach seiner Rück- gierter) Teil der Bürgerschaft beteiligt. kehr aus Österreich im Juni 1281 be- Rudolf war es damit gelungen, die spägann Rudolf ernsthaft mit dem Versuch, testens in der Zeit des Interregnums er Landfriedensgesetze im süddeutschen starkte Heilbronner Bürgerschaft wieder Raum und später im ganzen Reich auf- in die königlichen Machtstrukturen einzuzurichten und das schwäbische Herzog- binden. Es handelte sich dabei um nichts turn als traditionelle Machtbasis des Kö- anderes als um den Versuch, Heilbronn nigtums wiederherzustellen. Letzteres in Anknüpfung an Heinrich (VII.) und den brachte ihn u.a. in direkte Auseinander- Nordhäuser Vertrag von 1225 zur Kösetzungen mit dem Grafen Eberhard 1. nigsstadt zu machen. Auf der anderen von Württemberg. Da dieser in seinem Seite gestand er Heilbronn 1288 das Pri Einflußgebiet eine gegenüber den auf- vileg eines dreiwöchigen Marktes zu und strebenden Städten im wesentlichen förderte damit die wirtschaftliche Entfeindliche Politik betrieb, fanden sich Ru- wicklung der Stadt. dolf und die schwäbischen Städte als Vergleicht man Heilbronn um das»natürliche Verbündete" zusammen. An- Jahr 1000 mit der Stadt knapp drei Jahrdere wichtige Elemente kamen noch hunderte später, so ist ein bemerkenshinzu. Rudolf war auf die Städte als Ein- werter Wandel zu erkennen. Um die Jahrnahmequellen angewiesen und belohnte tausendwende und danach übten hier mit sie schon seit seiner Wahl zum König mit Calw, Dürn und dem Bischof von Würzder Bestätigung oder Neuerteilung von burg drei bedeutende Mächte Herrschaft Rechten und Privilegien. Nachdem das aus. Trotzdem gelang es zu Beginn des staufische Pfalzennetz im Interregnum 13. Jahrhunderts dem staufischen König zusammengebrochen war, hielt sich der mit Hilfe des Nordhäuser Vertrags, sei Herrscher auch überwiegend in den Städ- nen direkten Einfluß in der wirtschaftlich ten auf. Sie bildeten eine wesentliche aufstrebenden und verkehrstechnisch Stütze für die Machtbasis des habsbur- günstig gelegenen Gemeinde wieder hergischen Königs. zustellen. Diese königliche Machtkonln diesem Zusammenhang geriet zentration wurde in Heilbronn sicher auch Heilbronn als weitgehend selbstän- nicht gerne gesehen. Nach dem Unterdige und verkehrstechnisch günstig an gang der Staufer ergab sich daraus jeeinem Neckarübergang gelegene Stadt doch eine große Chance. Das plötzlich in das engere Blickfeld Rudolfs. Am 15. entstandene Machtvakuum nutzte Heil August 1281 erwarb der König die nahe bronn, um sich städtische Privilegien zu bei Heilbr.onn gelegene Grafschaft Lö- verschaffen. Nach dem Interregnum trat wenstein und belehnte damit seinen ille- mit Rudolf von Habsburg ein starker gitimen Sohn Albrecht von Schenken- Herrscher auf den Plan. Er setzte den burg. So schaffte sich der Herrscher im Einfluß des Königtums in der Gemeinde Norden des württembergischen Einfluß- wieder durch. Dies gelang ihm aber nur gebietes eine Machtbasis. Noch 1281, dadurch, daß er ihr nun auch offiziell ein Vierteljahr nach seiner Rückkehr aus Stadtrechte verlieh. Der Aufstieg Heilösterreich, verlieh Rudolf in Schwäbisch bronns hatte begonnen. 28
31 Von der Stadt zur Reichsstadt Heilbronn im 14. Jahrhundert Um 1300: Nach dem Tode Rudolfs von Habsburg im Jahre 1291 nahm Heilbronn seinen durch ihn unterbrochenen Weg zur Selbständigkeit wieder auf. Bereits um 1300 zeichnete sich ein erster Höhepunkt in der Entwicklung der Stadt ab. Schon vor hatten die Bürger mit einem Erweiterungsbau der Pfarrkirche begonnen. Diese ist höchstwahrscheinlich aus der alten Michaelskirche hervorgegangen und wurde zu einer frühgotischen, dreischiffigen Säulenbasilika umgestaltet trug jenes Gotteshaus erstmals die Bezeichnung Kilianskirche. Wahrscheinlich hatte vor der Vergrößerung der Pfarrkirche der Marktplatz westlich davon gelegen, also in dem Bereich des heutigen Kirchturmes und der Windgasse und weiter nach Westen. Für diese These sprechen zwei Fakten: Erstens ist dort mit dem Kirchbrunnen das für Marktzwecke unerläßliche Wasser Erster Höhepunkt in der Heilbronner Stadtentwicklung (Erweiterung der Kilianskirche, Rathausneubau mit Marktplatz). 1306: Gründung des Katharinenspitals. 1309: König Heinrich VII. entscheidet sich in Heilbronn zum Zugriff auf Böhmen. 1316: Schuldenerlaß und Steuerbefreiung durch Ludwig den Bayern. 1331: Heilbronn schließt sich mit weiteren Partnern zu einem Städtebund zusammen. 1333: Recht durch Kaiser Ludwig den Bayern, den Neckar nach Belieben zu»wenden und keren«. Ab 1333: Erwerb des späteren reichsstädtischen Territoriums. 1371: Reichsstädtische Verfassung durch Kaiser Karl IV. vorhanden, zweitens weist dieses Areal eine ungewöhnlich regelmäßige Bebauung auf, was darauf schließen läßt, daß es wohl spät und planmäßig auf gesiedelt worden ist. Wo sich das Rathaus damals befunden hat, ist nicht mit Sicherheit geklärt, als Möglichkeit kommt jedoch der Bereich der heutigen Kirchbrunnenstraße in Betracht. Etwa für das Jahr 1300 läßt sich aber ein Rathausneubau an genau der Stelle nachweisen, an welcher sich der Verwaltungssitz noch heute befindet. Ungefähr gleichzeitig muß dann auch der Marktplatz seitlich vom Rathaus angelegt worden sein; der Markt war natürlich für die aufwärtsstrebende Stadt sehr wichtig. Vor 1300 existierte in Heilbronn auch eine jüdische Gemeinde, die immerhin etwa 100 Köpfe zählte. Sie siedelte am Rande der damaligen Stadt im Bereich der jetzigen Lohtorstraße (hinter dem heutigen Rathaus). Der jüdische Friedhof befand sich an der Stelle des späteren Kieselmarktes. Allerdings wurde diese jüdische Gemeinde im Jahre 1298 im Verlauf des sogenannten Rintfleischpogroms nahezu ausgelöscht. Rintfleisch hieß der aus Franken stammende Anführer dieser Ausschreitungen, die gleichzeitig gegen sehr viele jüdische Gemeinden in ganz Franken gerichtet waren. Für 1349 ist ein weiterer Judenpogrom überliefert erhielten die Heilbronner Juden dagegen von König Sigmund einen umfassenden Schutzbrief. In einer Urkunde, die auf die Zeit vor 1291 zu datieren ist, werden für Heilbronn Kawerschen erwähnt, also professionelle Geld.händler aus Südfrankreich. Deren Anwesenheit weist die Stadt als einen Platz von großer wirtschaftlicher Bedeutung aus. Im Zusammenhang mit der Wirtschaftsentwicklung Heilbronns richtet sich der Blick auf das benachbarte Wimp- 29
32 fen. Die dortige große Kaiserpfalz machte den Ort in der Stauferzeit zu einem von Herrschern häufig besuchten Platz, dessen Wichtigkeit diejenige von Heilbronn deutlich überragte. Nach dem Niedergang der Staufer kehrte sich dieses Verhältnis um. Heilbronn überflügelte Wimpfen bald. Ein - allerdings oft überbewertetes - Indiz in diese Richtung hängt mit der Zerstörung der Wimpfener Brücke um das Jahr 1300 durch Eisgang zusammen bzw. mit der Tatsache, daß diese Brücke nicht mehr aufgebaut wurde und der Ost-West-Verkehr (Nürnberg-Speyer) nach Heilbronn auswich. Seit wann jedoch die Stadt über eine eigene Neckarbrücke verfügte, ist nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Man wird davon ausgehen können, daß die 1349 errichtete Holzbrücke bereits eine Vorgängerin hatte. Im Jahre 1306 erfolgte die Gründung des Katharinenspitals, das der selbstbewußte Rat der Stadt in die Trägerschaft der Gemeinde und nicht - wie sonst zu dieser Zeit oft üblich - der Kirche stellte. Drei Jahre später, 1309, fiel in Heilbronn eine Entscheidung von weltpolitischer Bedeutung. König Heinrich VII. (von Luxemburg) traf sich hier am 14. August mit dem Zisterzienserabt Konrad von Königssaal (bei Prag). In Böhmen herrschte zu dieser Zeit eine politisch unklare Situation. Nach dem Tode von König Wenzel II. wurde Heinrich von Kärnten zum neuen Herrscher gewählt. Abt Konrad von Königssaal führte die böhmische Opposition gegen Herzog Heinrich von Kärnten. An dem erwähnten Treffen nahmen noch weitere wichtige Persönlichkeiten teil, z.b. der Reichserzkanzler und Erzbischof Peter Aspelt von Mainz. Erörtert wurde die Frage, ob bzw. wie man Heinrich von Kärnten mit dem Anschein möglichst großer Legalität beseitigen könne. In Heilbronn entschied sich Heinrich VII., in die böhmische Politik direkt einzugreifen und seinen einzigen Sohn, Johann, als Böhmenkönig durchzusetzen. Tatsächlich belehnte Heinrich VII. im folgenden Jahr den damals noch minderjährigen Johann mit Böhmen und verheiratete ihn mit einer Tochter des verstorbenen Böhmenkönigs Wenzel II. Auf diese Weise war die Grundlage der geschichtlich äußerst bedeutenden Machtbasis der Luxemburger in Böhmen geschaffen. Bald sollte Prag ins Zentrum der deutschen Politik rücken - man denke nur daran, daß Karl IV., ein Enkel Heinrichs VII., geradezu in Prag residierte. Sein Heilbronn-Aufenthalt des Jahres 1309 brachte für Heinrich VII. noch einen zweiten politischen Wendepunkt. Hier erreichte ihn nämlich auch die Einladung von Papst Clemens V. zur Kaiserkrönung nach Rom. Seine Krönung zum deutschen König lag zu diesem Zeitpunkt gut ein halbes Jahr zurück. Nach Regelung der böhmischen Angelegenheiten zog der Herrscher im Oktober 1310 nach Italien. Er blieb dort bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahre Natürlich stellt sich die Frage, warum Heinrich VII. gerade Heilbronn als Ort der weltpolitisch bedeutenden Böhmen-Entscheidung gewählt hat. Es spricht viel für die These, daß dies ein genau kalkuliertes und warnendes Zeichen der königlichen Präsenz an den zielbewußten Territorialpolitiker Graf Eberhard 1. von Württemberg«(Jäschke) war, der dem König seine Vormachtstellung im deutschen Südwesten durchaus streitig zu machen versu.chte. Am 23. April 1306 gründete der Rat der Stadt Heilbronn zu Ehren der Heiligen Katharina ein Spital. In diesem konnten u.a. Kranke, Alte und Behinderte Aufnahme finden. Wahrscheinlich aus der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts stammt dieser Gedenkstein für Nathan den Vorsteher. Es handelt sich dabei um das älteste Ze ugnis der Geschichte von Juden in Heilbronn. 30
33 Das Siegel des Heilbronner Katharinenspitals - hier eine Variante aus dem Jahre zeigt die Namensgeberin.. Diese hält als Attribute die beiden Gegenstände in der Hand, durch welche sie zu Tode kam: das zerbrochene Rad und das Schwert. Für die weitere Entwicklung Heilbronns von großer Bedeutung war der Nachfolger Heinrich VII. Im Jahre 1314 war es nach dem Tode des Kaisers zur Doppelwahl zwischen Ludwig IV. (dem Bayern) aus dem Hause Wittelsbach und dem Habsburger Friedrich dem Schönen, einem Enkel Rudolfs von Habsburg, gekommen. Die süddeutschen Städte standen in der Auseinandersetzung zwischen den beiden Gegenkönigen in ihrer Mehrheit auf der Seite des Habsburgers Friedrich, wichtige Ausnahmen bildeten aber z.b. Ulm, Freiburg und Heilbronn. Am 9. März 1316 erließ König Ludwig der Stadt Heilbronn wegen ihrer Treue und Verläßlichkeit die rückständige Reichssteuer. Deren Jahreshöhe lag bei 600 Pfund Heller. Außerdem befreite er die Stadt von dieser Abgabe auf weitere vier Jahre. Gleichzeitig gewährte er Heilbronn die Erhebung einer Judensteuer in Höhe von Pfund Heller für die kommenden sechs Jahre und erließ alle Schulden an die Juden in der Stadt. Zusätzlich befreite er das Gemeinwesen von jeder fremden weltlichen Gerichtsbarkeit. Er tat dies, damit die Stadt ihre»große Schuldenlast bequemer bezahlen und ihm besser dienen könne«. In den nächsten Jahren belohnte er Heilbronn mit zahlreichen weiteren Rechten, z.b mit dem Blutbann. Zu Anfang des 14. Jahrhunderts lasteten also große Schulden auf der Stadt, die sich wohl durch den Bau der Kilianskirche und des Rathauses, vielleicht auch durch die sich wahrscheinlich lange hinziehende Errichtung der Stadtmauer erklären lassen. Der Steuer- und Schuldenerlaß des Jahres 1316 durch Ludwig den Bayern und die beträchtliche Judensteuer scheinen aber zu einer schnellen Erholung der städtischen Finanzen geführt zu haben. Positiv wirkten sich ebenso die erhöhten Einnahmen aus dem Brückenzoll nach der Zerstörung der Wimpfener Neckarbrücke im Jahre 1300 aus. Tatsächlich konnte es sich die Stadt leisten, ab 1333 innerhalb von neun Jahren im Grunde drei Dörfer zu kaufen: Alt Böckingen, Neckargartach und drei Viertel der Vogtei zu Böckingen. Damit hatte Heilbronn bereits einen wesentlichen Teil seines - wenngleich kleinen - Territoriums erworben besiegte Ludwig seinen Gegner Friedrich in der Schlacht bei Mühldorf. In dieser Zeit eskalierte auch die langandauernde Auseinandersetzung zwischen Ludwig und Papst Johannes XXII die sich am päpstlichen Anspruch auf Bestätigung der Wahl zum römischen König entzündet hatte. In diesem Ringen blieben die genannten ludwigtreuen Städte - darunter Heilbronn - auf der Seite des Königs. Sie erkannten ihn 1330 direkt nach seiner Rückkehr aus Italien als Kaiser an. Wegen der aus dem Kampf mit dem Papst resultierenden Unruhe innerhalb des Reiches und als Gegengewicht zu der Macht der Fürsten strebte der Kaiser die Wiederherstellung der Landfriedensverfassung an. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund schlossen sich 1331 in Esslingen acht Städte - u.a. Heilbronn - zusammen. Diesem Bund traten im November 14 weitere Mitglieder bei. Zu allen diesen pflegte Ludwig ein sehr gutes Verhältnis, da er sie als»stutzpunkte der Reichsgewalt«(Mistele) ansah. Sie bedeuteten für ihn und das Haus Wittelsbach eine wichtige Hilfe durch finanzkräftige Partner. Der Bund spiegelte einerseits das neue Selbstbewußtsein der Städte wider. Andererseits trug er deren Schutzbedürfnis gegenüber dem für sie bedrohlich mächtigen Grafen von Württemberg Rechnung. Im Mai 1333 verlieh Ludwig der Bayer Heilbronn das Recht auf einen zweiten 31
34 Jahrmarkt und gab seine Zustimmung zum Verkauf des Dorfes Alt-Böckingen, das Reichslehen war, an die Stadt. Am 16. August weilte der Kaiser persönlich hier, und er stellte für Wolfstein und Kaiserslautern Urkunden aus. Bei dieser Gelegenheit trugen die Stadt Heilbronn und die Deutschherren einen zwischen ihnen ausgebrochenen Streit vor den Herrscher. Elf Tage später wurde in Esslingen in Schriftform gegossen, was diesbezüglich verhandelt worden war: Ludwig verlieh der Stadt das in den folgenden Jahrhunderten wirtschaftlich ungemein bedeutende Recht, den Neckar nach Belieben zu»wenden und [zu] keren«. Durch den Einbau eines Wehres drosselten die Heilbronner den Wasserfluß im Hauptarm des Neckars und vergrößerten dadurch die Wassermenge, die im seitherigen Nebenarm unmittelbar vor der Stadtmauer vorbeigeflossen war. Auf diese Weise konnte die Heilbronner Bevölkerung den gesamten Schiffsverkehr an die Westflanke ihrer Stadt heranführen und damit einerseits die Verteidigungswirkung der Stadtmauer erhöhen. Andererseits festigte sie durch den Bau von Wehren vor der Stadt die Stellung Heilbronns als Endpunkt der Neckarschiffahrt. Daraus resultierte im laufe der Zeit das ungemein wertvolle Stapelrecht und das Vorkaufsrecht für alle Transitwaren. So erwuchs in Verbindung mit den Steuereinnahmen die mächtige wirtschaftliche Stellung der späteren Reichsstadt Heilbronn und deren besondere Struktur als Binnenhafenstadt. Denn nach 1333 war der Neckar bei Heilbronn durch Einbau von Wehren für Schiffe konsequent unpassierbar gemacht worden. Das sollte bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts so bleiben. Die Entwicklung von Heilbronn zur Reichsstadt im 14. Jahrhundert ist eng mit Kaiser Karl IV. verbunden, der als Enkel Heinrichs VII. bereits kurz Erwähnung gefunden hat. Karl IV. begann 1346 als Gegenkönig zu Ludwig dem Bayern, wobei die Städte - unter ihnen Heilbronn - auf der Seite Ludwigs blieben. Bevor es zur großen militärischen Auseinandersetzung zwischen Ludwig und Karl kommen konnte, verstarb unerwartet der Bayer im Jahre Erst danach erkannten die Städte Karl IV. als König an und huldigten ihm. Im Gegenzug be- stätigte er ihnen ihre alten Rechte. Seine große Finanznot zwang ihn allerdings, gerade in seinen ersten Regierungsjahren Reichsstädte und Reichsrechte zu verpfänden. Deshalb war sein Verhältnis zu den Städten, die sich wieder zu Bünden zusammengeschlossen hatten, nie ganz unbelastet. Am Beispiel Heilbronns läßt sich diese Aussage verdeutlichen. Karl IV. verlieh Heilbronn ein Recht, das im Falle von vorsätzlichen Mördern das Asylrecht des Deutschordens in der Stadt brach, und erneuerte das Recht auf eine ausschließliche städtische Gerichtsbarkeit. Außerdem verfügte er, daß auch die Geistlichkeit die üblichen Steuern an die Stadt bezahlen mußte, wenn sie Handel trieb. Andererseits verschenkte er das Patronatsrecht über die Kilianskirche an den Würzburger Bischof, was zu langen Auseinandersetzungen zwischen Heilbronn und Würzburg führen sollte. Karl IV. gab damit bis zu einem gewissen Grad wieder auf, was Heinrich (VII.) im Nordhäuser Vertrag von 1225 dem Würzburger Bischof abgerungen hatte. Außerdem verpfändete der Herrscher z.b. die Reichssteuer der Stadt an die Herren von Weinsberg und das Schultheißenamt an die Grafen von Württemberg konnte Heilbronn das verpfändete Schultheißenamt an sich bringen und letztlich auf Dauer behalten. Das bedeutete einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zur reichsstädtischen Freiheit, auch wenn Karl IV. in seiner Finanznot die Pfandsumme wiederholt aufstockte Die Stadt Heilbronn erhielt am 27. August 1333 durch Kaiser Ludwig den Bayern das Recht, den Neckar nach Belieben nwenden und keren«zu dürfen. Dieses sollte sich in den folgenden Jahrhunderten als ökonomisch unschätzbar wertvoll erweisen und zu einer wesentlichen Säule des Wohlstandes werden. 32
35 Kaiser Karl IV. schlichtete am 28. Dezember 1371 innenpolitische Streitigkeiten in Heilbronn, indem er der Stadt eine neue Verfassung verlieh. Kernpunkt war zwar einerseits die Auflösung der Zünfte, andererseits aber die Beteiligung der Kaufleute und Händler an der Macht. Diese Verfassung trug einen ausgeprägt reichsstädtischen Charakter, da sie keine Instanz zwischen Stadt und Kaiser mehr vorsah. und damit die Heilbronner zu erheblichen Nachzahlungen zwang. Innerstädtisch war zwischenzeitlich jedoch ein Konfliktfeld entstanden, weil die ökonomisch erstarkte Schicht von nichtpatrizischen Kaufleuten, Händlern und Handwerkern zwar Steuern bezahlen mußte, das alteingesessene Heilbronner Patriziat sie aber nicht mitregieren ließ. Diesen Streit um die politischen Mitspracherechte schlichtete Kaiser Karl IV. im Jahre 1371 durch eine Neuordnung der städtischen Verfassung. Der Rat rekrutierte sich danach aus je 13 Vertretern der Patrizier (»Bürger«) einerseits und der Kaufleute und Handwerker (»Gemeind«) andererseits. Diese 26 Männer wählten aus ihrer Mitte ein paritätisch - also zu gleichen Teilen - zusammengesetztes zwölfköpfiges Richterkollegium und zwei Bürgermeister. Alle Ämter wurden formal nur auf ein Jahr vergeben, tatsächlich wurden aber zwei Ratskollegien in jährlichem Wechsel immer wieder bestätigt. Die bislang amtierenden königlichen Vertreter - Vogt und Schultheiß - waren in der Verfassung nicht mehr vorgesehen, es gab also fortan keine Instanz zwischen Stadt und Kaiser mehr. Deshalb kann die Entwicklung zur Reichsunmittelbarkeit im Jahre 1371 faktisch als abgeschlossen gelten, zumal bereits vier Jahre zuvor Heilbronn in einer von Kaiser Karl IV. für Oberschefflenz ausgestellten Urkunde als Reichsstadt bezeichnet wurde. Formaljuristisch war dieser Status jedoch erst 1464 erreicht, als es der Stadt gelang, das längst bedeutungslos gewordene Amt des königlichen Vogtes käuflich zu erwerben. Der Versuch Rudolfs von Habsburg, in Anknüpfung an Heinrich (VII.) Heilbronn zu einer Königsstadt zu machen, war damit endgültig gescheitert. Durch die gleichberechtigte Beteiligung an der Macht schienen 1371 die Kaufleute und Handwerker einen großen Sieg über die alteingesessenen Patrizier errungen zu haben. Dieser Eindruck stimmt jedoch nicht ganz, da der Kaiser gleichzeitig die Handwerker ihrer seitherigen politischen und wirtschaftlichen Organisationsform beraubt hatte: Die Zünfte wurden aufgelöst und in Heilbronn auch nie mehr eingeführt. Fortan existierten nur noch»handwerks-ges e llschaften«. Insgesamt pflegte Heilbronn gute Beziehungen zum jeweiligen König und zu verschiedenen Städten. So schloß sich Heilbronn 1331 mit anderen zum Schwäbischen Städtebund zusammen. Vom mächtigen Hause Württemberg versuchte sich die Stadt jedoch abzugrenzen. Einerseits fühlte sich Heilbronn bedroht, andererseits war den Württembergern der Endpunkt der Neckarschiffahrt ein Dorn im Auge. 33
36 Die durch Mauer, Wall und Graben geschützte Reichsstadt Heilbronn bedeckte eine Fläche von etwa 750 auf 420 Meter (ca. 26 Hektar). Sie war durch eine 2,4 Kilometer lange Stadtmauer geschützt. Rund 60 meist enge Gassen und Straßen durchzogen die Stadt. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts lagen fast 90 Prozent der Häuser innerhalb dieser alten Stadtmauern. Die Einwohnerzahl der Reichsstadt belief sich um das Jahr 1400 etwa auf 5500 Personen. Das Heilbronner Territorium blieb relativ klein und wurde nur auf einige unmittelbar angrenzende Dörfer ausgedehnt. In Böckingen erlangte die Stadt 1342 drei Viertel der Vogtei, den Rest und alle anderen Rechte von den Brüdern Hans und Konrad von Böckingen aber erst In Flein gelang es im Jahre 1385, Vogtei und Gericht von den Herren von Sturmfeder zu kaufen. Frankenbach erwarb die Reichsstadt 1430/38 als gesamtes Dorf von Heinrich von Remchingen. Neckargartach erhielt Heilbronn von den Herren von Weinsberg schon 1341 als Lehen. Die Oberlehensherrlichkeit lag zunächst bei Worms, ab 1504 bei Württemberg. Eine vollständige territoriale Aneignung gelang erst Die Reichsstadt bestimmte in allen ihren sogenannten Herrendörfern jeweils einen Vogt, der jährlich ein Vogtgericht abhielt. Dabei besetzte er das aus Bürgern bestehende Gericht und das Schultheißenamt neu und hörte die Rechnungen ab. Das reichsstädtische Territorium umfaßte in seiner größten Ausdehnung nur etwa 65 km2. Das wirkt sehr bescheiden, wenn man es z.b. mit Ulm (830 km2) oder gar Nürnberg ( 1200 km2) vergleicht. Es ist nicht bekannt, warum die Gemeinde ihr Einflußgebiet nicht weiter ausgebaut hat. Trotzdem zählte Heilbronn über Jahrhunderte zu den politisch stabilsten Städten im süddeutschen Raum - trotz (oder vielleicht auch gerade wegen) des sehr kleinen Territoriums. Zusammenfassend betrachtet, waren die neun Jahrzehnte zwischen 1281 und 1371 für Heilbronn ein äußerst bewegter Zeitabschnitt. Das Gemeinwesen, das sich spätestens ab 1281 offiziell»stadt«nennen durfte, drängte nach dem Tode Rudolfs von Habsburg den königlichen Einfluß schnell wieder zurück und setzte seinen selbstbewußten Weg fort. Große Vorhaben wie Rathausneubau und Erweiterung der Kilianskirche zeigen dies beispielhaft. Sie führten jedoch auch zu einer enormen Schuldenlast. In dieser Situation machte es sich bezahlt,daß Heilbronn schon frühzeitig - im Jahre auf den späteren Sieger im jahrelangen Ringen um die deutsche Königskrone gesetzt hatte: Ludwig den Bayern. Für diese Treue belohnte der Herrscher die Stadt mit einem Steuer- und Schuldenerlaß sowie mit Zusatzeinnahmen. Ihm verdankte Heilbronn 1333 auch das für die spätere Entwicklung ungemein bedeutsame Recht, den Neckar nach Belieben»Wenden und keren«zu dürfen. Nach 1333 erholte sich das zu diesem Zeitpunkt hoch verschuldete Heilbronn wirtschaftlich sehr schnell. Die Stadt erwarb rasch einen großen Teil ihres - wenn auch kleinen - späteren Reichsstadtterritoriums. Das Neckarprivileg des Jahres 1333 Wir Ludewig von gotes genaden romischer keyser, ze allen ziten merer des richs, verliehen offenliche an disem brief, daz wir zwischen den erbern [= ehrbaren] geistlichen tuten, dem conmenter und dem convent des tuetschen hus ze Heilprunnen, und den burgern gemeinelich da selben geret und geregdinget haben und haben si öch also miteinander gantzlich beriht, umb den bruch und stos, so si miteinander hetten von des Neckers wegen. Also daz die burger den Necker sullen wenden und keren wahin si duncket, daz es der stette [= Stadt] aller nutzlichest si, und sullent si die tuetschen herren daran nicht irren; und wan Öch vorsehenlich ist, daz der Necker von dem wenden den tuetschen herren schaden bringe an irm werde, so haben wir in [= ihnen] ze ergetzung gegeben und geben in es Öch mit disem brief den boden und grunt, da der Necker ietze uf pluzzet, was des blos wert ligent von dem kerende und wendenn des Neckers, und geben in daz ledeclich und eigenlich von unsin gewalt, und wellen niht, daz si daran. ieman hinder oder irre in keinem weg; und ist daz in der Necker an dem werde me schaden tut, danne in damit widerleit wirt, den schaden sullen in die burger wider keren, nach rate vier manne, der sullent die herren zwene nemen und die burger zwene und mugent die vier niht uberein komen, so sol es an uns stan, wie si den schaden. widerkern sullent. Were Öch daz der widerswal von den wern und den wern der tuetschen herren müle irre und in schadete, also daz si kein frum wide, so sullen iene in ein ander mülstat in der selben nehe und verre geben uf dem Necker, an der mulstet stat, daz si ein ander mul buwen, si sullen Öch ir vischentz haben in dem Nekker wa er hin pluzzet als Öch vor. Und dar uber ze eine urkunde geben, wir in disen brief versigelen mit unsin keyserlichen insigel, der geben ist ze Esselingen an fritag nach sant bartholomens tag, da man zalt von cristes geburt druzehenhundert iar dar nach 1n dem drui und drissigsten iar, in dem neunzehenden iar unsers richs und in dem sehsten des keysertumes. 34
37 Die reichsstädtische Verfassung des Jahres 1371 Wir Karl von Gotes gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Beheim bekennen und tun kunt offenlich mit diesem briefe allen den, die yn sehent oder horent lesen, das wir umb die stozze, missehelunge und uffleuffe, als die von Heilprunne die burger doselbest an einem teil und die gemeinde doselbest an dem andern teil mit einander bisher uff diesen heutigen tag gehabt han, sie mit einander gerichtet haben lieplich und freuntlich als hernach geschreben stehet. Czu dem ersten so scheiden und richten wir, das die sechsundzwenczig, die yeczund von den burgern und der gemeinde an dem rate und an dem gerichte doselbest siezen, bleiben sullen unz uff sant Johans tage sunnwende der schierest kunfftig ist und acht tage vor demselben sant Johans tag sullen die burger die ussern und die innern unter yn ander dreyzehen, die des jares nicht an dem rate noch an dem gerichte gewesen sein, kiesen und welen uff ir eide und die selben dreizehen, die also us den burgern gekorn werden, sullen sechs richter und einen burgermeister us yn kiesen. So sullen auch die gemeinde, die hiereczwischen an dem rate und gerichte bleiben sullen, auch ander dreiezehen us der gemeinde, die des jares nicht an dem rate noch an dem gerichte gewesen sein, kiesen und welen uff ir eide und dieselben dreizehen, die also us der gemeinde gekorn werden, sullen auch sechs richter und einen burgermeister us yn kiesen und welen uff ir eide. Und wenne sie also gewelt werden, so sullent denne die burgermeister, der rat und die richter zu den heiligen sweren gerechte eide mit uffgeboten vingern zu richten und zu raten dem armen als dem reichen an alles geverde. Und were das sache, das sache, das einer oder mere us den vorgenanten partyen sturbe und abgienge, so sullen die andern derselben partien einen andern oder mere als vil ir gestorben were us irem teil kiesen... Und so der rat also geseczet wirdet, so sullen denne alle burger und gemeinde reich und arme den burgermeistern geloben gehorsam zu sein, wes der rat oder der merer teil zu rate wirdet oder wurden ist, alles ungeverlich... Es sullen die burgermeister und czwene uswendig rates, einer von den burgern und einer von der gemeinde, die der rat dorzu keuset und seczet, alle slussel haben zu toren, zu turmen, zu inzsigel und zu briefen, und das der rat furbas mer alle jar alle ampte uswendig rates von den burgern und von der gemeinde gleich beseczen, und das sie vier rechener seczen alle jar, auch zwene von den burgern und zwene von der gemeinde, die der stette gut alles ynnemen. Tete oder wurbe einer oder mere, die ir burger weren oder ir burger gewesen weren, von den burgern oder von der gemeinde wider diese vorgeschriben sachen dheine, das sal allzumal abe sein und keyn krafft haben und derselbe der das tete und uberfure, sal dorzu meineydig, trewleus und erlos sein und alles sein gut vorvallen sein, halbes in des reiches kamern und das ander halb teil der vorgenanten stat zu Heilprunne, und sal er, sein weib und kinde, die an seinem brote sein auch ewiclich die stat raumen uzzerhalb der mark und nimmermer daryn komen. Auch scheiden wir, das keyn zunft do sein sal, als wir sie mit rechter wissen abgenommen haben. Mit urkunt ditz briefes vorsigelt mit unsir keisirlichen majestat ingsigel, der geben ist zu Budissyn, nach Crists geburte dreizehenhundert jar darnach in dem zweynundsibenzigsten jare an der heiligen kindelin tags unsir reiche in dem sechsundzwenczigsten und des kaisertums in dem sibenczehenden jaren. Außerdem bildete sich eine reiche Gruppe von Kaufleuten, Händlern und Handwerkern, die bald auch politische Mitspracherechte forderten. Weil die Patrizier ihnen diese verwehrten, kam es zum innenpolitischen Streit. Diesen schlichtete Karl IV. im Jahre 1371, indem er die städtische Verfassung Rudolfs abschaffte und durch eine reichsstädtische ersetzte. Darin wurde die Macht zwischen den alteingesessenen Patriziern und den neu emporgekommenen Kaufleuten und Handwerkern geteilt. Heilbronn war damit in einen wichtigen neuen Abschnitt seiner aufwärtsstrebenden Entwicklung eingetreten. 35
38 Bedrohung von allen Seiten Die Stadt in den Fehden und Kriegen des 14. bis 16. Jahrhunderts Der Niedergang des Reiches seit dem Interregnum bot den schwäbischen Reichsstädten Gelegenheit, völlige politische Selbständigkeit zu erlangen. Vom 14. Jahrhundert an brachten sie bisher dem Reich noch vorbehaltene Rechte an sich und stärkten so nachhaltig ihre Machtposition. Andererseits sahen sie sich aber auch genötigt, ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Machtstreben der benachbarten Territorialherren zu verteidigen. In Schwaben waren es vor allem die Grafen von Württemberg, die ihnen gefährlich waren. Zu ihrer Abwehr vereinigten sich z.b acht Städte der Landvogtei Niederschwaben, darunter Heilbronn, in einem schlagkräftigen Bündnis, das gegen den verhaßten Territorialnachbarn erfolgreich agierte. Zum wiederholten Male zu gemeinsamem Handeln fanden sich 1376 schwäbische Reichsstädte zusammen, als Kaiser Karl IV. sie zur Finanzierung seiner Hausmachtpolitik außerordentlich besteuerte und ihnen zudem Verkauf oder Verpfändung drohten. Die Einung war dieses Mal der bedeutende Schwäbische Städtebund, dem 1377 auch Heilbronn beitrat. Vom Kaiser zwar für rechtswidrig erklärt, löste er sich dennoch nicht auf, warf in dem folgenden Reichskrieg vielmehr Graf Ulrich von Württemberg nieder und entwickelte sich danach zu einem starken politischen Machtfaktor im Südwesten Deutschlands von König Wenzel faktisch anerkannt, hatte der Bund den Zenit seiner Macht erreicht. Erneute Spannungen mit den fürstlichen Herren er:itluden sich infolge Landfriedensbruchs durch die Herzöge von Bayern im großen Städtekrieg , einem allgemeinen Verheerungskrieg erschienen der Pfalzgraf und der Markgraf von Baden vor Heilbronn und vernichteten, da sie gegen die stark befestigte Stadt anders nichts ausrichten konnten, die außerhalb der Mauern geie- genen Baum- und Weingärten der Bürger und fügten ihnen damit empfindlichen Schaden zu. Ein Kriegszug gegen Graf Eberhard II. durch Württemberg, den auch Heilbronn mitmachte, endete kurz darauf bei Döffingen mit einer schweren Niederlage, worauf der Bund seine Offensive schließlich einstellte. Dennoch ruinierte der Pfalzgraf im Verein mit dem Bischof von Würzburg und dem Württemberger Grafen im folgenden Jahr noch einmal die Weinberge und Felder 1376: Gründung des Schwäbischen Städtebundes, dem Heilbronn 1377 beitritt : Großer Städtekrieg, wiederholte Verwüstung der Heilbronner Markung. 1392: Schutz- und Hilfebündnis mit der Kurpfalz (bis 1622). Mitte 15. Jh.: Zahlreiche Fehden und Kriegszüge. 1459: Pfälzisch-bayerischer Krieg, Weinberge und Felder der Stadt ruiniert. 1486: Zehnjähriger Landfriede Kaiser Friedrichs III : Gründung des Schwäbischen Bundes zum Schutz des Landfriedens in Schwaben (bis 1534). 1495: Ewiger Landfriede : Landshuter Erbfolgekrieg, Herzog Ulrich überfällt pfälzische Besitzungen und gewinnt den Frucht- und Weinzehnten in Heilbronn. 1519: Herzog Ulrich vom Schwäbischen Bund vertrieben, Götz von Berlichingen in Heilbronn in Haft (bis 1522). 15./16. Jh.: Heilbronn muß wiederholt Beihilfe zum Reichsheer leisten Jh.: Wirtschaftliche Blüte der Stadt. 36
39 Herzog Ulrich von Württemberg ( ) zur Zeit seiner Vertreibung. Holzstich, 1520 Heilbronns. Als der König im Landfrieden von Eger die Städtebünde aufhob, hatte die landesherrliche Territorialpolitik zwar obsiegt, nichtsdestoweniger hatten die Reichsstädte ihre Unabhängigkeit gewahrt. Sie mußten fortan aber auf eine taktierende Politik des Ausgleichs mit ihren mächtigen Territorialnachbarn bedacht sein. Trotz des kaiserlichen Verbots kam es auch weiterhin zu Einungen unter den schwäbischen Reichsstädten, besonders in den großen Fehden um die Mitte des folgenden Jahrhunderts schlossen Heilbronn und Wimpfen ein Bündnis, das immerhin einhundert Jahre währen sollte, und seit 1392 näherten sich beide der Kurpfalz, ihrem wirtschaftspolitisch wichtigsten Nachbarland, mit dem sie 1417 einen vor allem gegen Württemberg gerichteten Schirmvertrag schlossen, der bis 1622 immer wieder erneuert wurde führte der fünf Jahre zuvor ins Leben gerufene Marbacher Bund, dem Heilbronn ebenfalls angehörte, hier zwei große Bundesversammlungen durch engagierte sich der Rat für die Erhaltung der benachbarten Reichsstadt Weinsberg, 1438/39 war die Stadt in eine schwere Auseinandersetzung mit Eberhard von Venningen verwickelt. Ein verheerender Waffengang zwischen den Reichsstädten und den Territorialherren entbrannte 1449 infolge einer Fehde des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach mit der Reichsstadt Nürnberg, dessen Kontrahenten die Fürsten vom St. Georgenschild und ein seit 1446 bestehender Städtebund gewesen sind. Um Esslingen aus der Belagerung Graf Ulrichs von Württemberg zu befreien, unternahm Heilbronn einen gewalttätigen Einfall in das württembergische Gebiet, worauf Ulrich und seine Kriegsgenossen vor die Stadt rückten und einmal mehr die Weinberge und Felder der Bürger ruinierten. Durch sein Bündnis mit der Pfalz wurde Heilbronn 1459 in den pfälzisch-bayerischen Krieg hineingezogen. Wieder rückte Graf Ulrich vor die Stadt. Um sie zu züchtigen", verwüstete er ihr Gebiet. Er hoffte zugleich, sie von dem pfälzischen Bündnis abbringen zu können. In einem Vergleich sicherte er ihr schließlich zu, ihr keinen weiteren Schaden zufügen zu wollen, während Heilbronn dem Pfalzgrafen nur in beschränktem Umfang Unterstützung zukommen zu lassen versprach. Es fehlte zwar nicht am Bemühen, dem Fehdewesen durch eine einheitliche Justiz im Reich ein Ende zu bereiten, aber es war ein langer Weg, bis 1486 endlich Kaiser Friedrich III. zu Frankfurt einen zehnjährigen Landfrieden ausrief, dem sich nach anfänglichem Zögern, da sie nicht zum willenlosen Werkzeug des Kaisers werden wollten, und erst nach kaiserlichen Drohungen auch die Reichsstädte anschlossen. Zum Schutz des Landfriedens in Schwaben, doch ebenso zur Stärkung der kaiserlichen Macht, wurde 1488 in Esslingen der Schwäbische Bund ins Leben gerufen, dem alle Fürsten und Städte Schwabens beitraten, auch Heilbronn. Die Stadt, die sich lange verweigert hatte, mußte sich nach Androhung der Acht und des Entzugs ihrer Privilegien schließlich doch zum Beitritt verstehen. Die Bundesverwandten verpflichteten sich, jedem Angriff auf eines der Mitglieder gemeinschaftlich entgegenzutreten. Der Schwäbische Bund ist schnell weit über Schwaben hinausgewachsen und stellte schon bald die bedeutendste militärische Macht im Reich, aber eben doch nur eine regionale Landfriedenseinung dar. Für Habsburg war er indessen ein wichtiges Exekutionsinstru- 37
40
41 Die»armecc Stadt Heilbronn Als 1544 Heilbronn zur Türkenhilfe veranschlagt wurde, entschuldigte sich der Rat einmal mehr mit der Armut der Stadt und ihrer Bürgerschaft (zitiert nach Dürr, Oberamtsbeschreibung, S. 142 f.):»es ist unverneinliche Wahrheit, daß Heilbronn eine kleine arme Stadt, die nur eine gar kleine Gemarkung hat, und obwohl das Ansehen... ziemliche Fruchtbarkeit zeiget, so ist doch der mehrere Teil der besten Güter und Weingärten, Aecker und Wiesmat der ausländischen Geistlichen und Weltlichen,... über das auch des großen und kleinen Zehenten in der ganzen Markung einem... Rat nicht zuständig ist. ltem so haben sie auch keine Landstraßen, noch viel weniger einigen Zoll, Hantierung oder Gewerb, deren gemeine Stadt ein namhaftes genießen möcht. ltem sie haben weder Land noch Leut, allein 4 kleiner Dörfflin..., darinnen arme, unvermögliche Leut sind, die alle erbbestendet und nichts eigenes haben, und in der ganzen Markung die Güter fast alle der Geistlichen und vom Adel, so daß sie kaum so viel genießen, daß ihre Schultheißen und Amtleut davon erhalten werden mögen. So können sich auch des Neckars... nicht... groß genießen und kaum der Krahn mit Unkosten... erhalten werden. Hat also gemeine Stadt kein ander Einkommen, denn was sie in der Stadt mit Steuer und Milter von einander selber erschwingen. Durchaus ist in der Stadt ein arm Volk, das sich der Weingarten und Güter nährt... Die sich der Weingarten nähren müssen, die müssen das ganze Jahr darin arbeiten, auf ihre künftige Nahrung entlehnen, und wenn das Jahr herum kommt, daß der Wein gewachsen, so ist es vorgenossen Brot, haben sie gar nichts.«dem italienischen Feldzug des Kaisers 1494 zur Sicherung der Südgrenze des Reiches gegen Frankreich, doch kam Heilbronn am Ende nicht umhin, sich zu engagieren. Zu dem geplanten Romzug des Kaisers 1508, der freilich über Trient nicht hinauskam, leistete die Stadt ebenfalls ihren Beitrag. Vor allem die Reichsstädte befürchteten damals eine Unterbrechung ihrer Handelsverbindungen mit Venedig. Die Blütezeit der deutschen Städte ist vom Jahrhundert zu sehen. Heilbronn stand damals finanziell gut da, war jedoch keine reiche Stadt. Die primären Nahrungsquellen der Einwohnerschaft waren seit eh und je der Ackerund vor allem der Weinbau. Die früheste Nachricht für Weinbau auf Heilbronner Markung datiert in das Jahr 1146, in der nächsten Umgebung ist solcher schon für das 8. Jahrhundert belegt (ßöckingen, Frankenbach, Biberach 766, Nekkargartach 788). Allerdings befanden sich die Weingärten zu jener Zeit zum großen Teil im Besitz geistlicher Eigentümer waren 87 Weingärtner unter den wehrfähigen Gewerbetreibenden. Daneben gab es noch andere vom Weinbau.und Weinhandel abhängige Berufe und Amter. Letztlich war die ganze Stadt am Weinbau interessiert, und dieser wiederum gab ihr bis ins 18. Jahrhundert ihr wirtschaftliches Gepräge. Die Verwüstung der Weingärten war deshalb auch etwas vom Schlimmsten, was der Stadt und ihren Bewohnern passieren konnte. Der Rat widmete dem Weinbau stets größte Aufmerksamkeit. Unbau, d.h. Verwahrlosung eines Weinberges, wurde bestraft. Gelesen werden durfte nur bei gehöriger Reife der Trauben. Der Weinhandel brachte den»heilbronner«, der sich eines guten Rufes erfreute, bis in entfernte Gegenden, nach Norddeutschland und Bayern vor allem. Zeitweilig florierte der Weinhandel als Tauschgeschäft gegen bayerisches Salz. Jedenfalls blieb der Weinabsatz durch alle Zeiten die wichtigste Aufgabe im Wirtschaftsleben der Stadt, wobei die günstige Verkehrslage Heilbronns ihm zustatten kam. Andererseits suchten die Territorialnachbarn allezeit, den hiesigen Weinhandel durch Einfuhrverbote oder hohe Durchgangszölle zu schädigen, und sie trafen damit die Wirtschaft der Stadt empfindlich. Großhandelstendenzen unterband der Rat 165 7, da er ein preisdrückendes Monopol, das den Weingärtnerstand gefährdet hätte, nicht wollte. Gegen Weinpanscher ging er mit Strenge vor. Eine Besonderheit sind die 1519 beginnenden Heilbronner»Weinbüchlein«mit Auf- 39
42
43 ldstock von 1514 n Fuß der Armindersteige, dem eg zum Hochgericht rf dem Galgenberg. Herbst veranstaltete er stets das»hasenmahl«. An Fronleichnam wurden die Bürgermeister zu einem Essen in den Pfarrhof geladen. Die öffentliche Fasnachtsfeier, bei der unter Beteiligung des Rats ein Umzug mit einem Riesen und ein Mahl auf dem Rathaus stattgefunden hatten, wurde 1530 eingestellt. Besonders beliebt waren Schützenfeste fand in der Stadt ein großes Turnier statt. Seit 1469 gab es in Heilbronn einen Stadtarzt, dem auch die Beaufsichtigung der Apotheken und Hebammen oblag findet ein Augenarzt Erwähnung, 1504 ein F ranzosenarzt ist von einer neuen Apothekerordnung mit Taxe der Arzneien die Rede. Für die Empfänger öffentlicher Almosen wurde 1541 ein an der Kleidung zu tragendes Abzeichen geschaffen. 1492, endgültig 1530 hat der Rat das Begräbnis auf dem Pfarrkirchhof aufgehoben und den Friedhof an der Weinsberger Straße anlegen lassen. Weitere Begräbnisvorschriften von 1534 und 1542 richteten sich gegen unnötigen Aufwand. Beisetzungen in den Kirchen für alteingesessene Heilbronner waren seit 1479 erlaubt. Ab 1470 wurde eine Ratsmatrikel, d.h. eine Liste der Ratsmitglieder, geführt ging ein Ratsherr seiner Stelle verlustig, weil er»aus dem Rat geschwätzt«hatte wird erstmals ein städtischer Syndikus, zugleich Stadtschreiber, erwähnt. Seit 1500 gehörte Heilbronn zum Schwäbischen Kreis, seit 1521 sollte die Stadt zu allen Reichskriegen 6 Mann zu Pferd und 60 zu Fuß stellen sowie 120 Gulden bezahlen. Von einer Münzstätte ist noch 1424 die Rede, 1476 von Heilbronner Währung. Das Wappen der Stadt findet sich 1487 in einem Glasfenster der Kilianskirche, mit den Stadtfarben 1556 in einem Marksteinbuch. Von den Baumaßnahmen der Stadt sollen nur zwei Erwähnung finden: 1471 errichtete sie anstelle der bisherigen hölzernen Neckarbrücke von 1349 eine steinerne (1691 bei schwerem Eisgang zerstört), und bald nach 1400 erweiterte man das Rathaus, dessen Schauseite nunmehr gegen Süden, dem Marktplatz zu, zeigte (zuvor gegen Osten). Schon früh im 15. Jahrhundert hat eine lateinische Schule hier bestanden. Ein Schulmeister findet erstmals 1431 Erwähnung und mußte damals wie später mit seinen Schülern bei den Gottesdiensten mitwirken. Einern Laufchor unbemittelter Schüler war das Umsingen in der Stadt erlaubt, ebenso Gesang bei Hochzeiten und Leichen. Unter den Schulmeistern des ausgehenden Mittelalters nimmt Konrad Költer die hervorragendste Stellung ein. Zu seiner Zeit wurde die Schule zu einer Pflegestätte des Humanismus, finden aber auch deutsche Schüler Erwähnung wies man den Knaben und Mädchen eigene Schulmeister zu wurde die deutsche Schule von der lateinischen getrennt. Schulzwang bestand nicht, doch empfahl der Rat den Schulbesuch. Um das Schulwesen kümmerten sich zunächst besondere Ratsverordnete, später führte die Aufsicht das Scholarchat, dem auch Geistliche angehörten
44 wurde die lateinische Schule zu einem Gymnasium ausgebaut. Wenn die Stadt Heilbronn heute auf eine lange Theatertradition zurückzublikken vermag, so verdankt sie dies nicht zuletzt dem Schultheater seit dem ausgehenden Mittelalter. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts gehörte die jährliche Aufführung einer Komödie oder Tragödie zum Lehrplan der Lateinschule. Ausgangs des 17. Jahrhunderts wurde das Schultheater von umherziehenden Schauspielgesellschaften verdrängt. Fasnachtspiele waren Sache der Handwerker. Die Heilbronner Studenten bezogen meist die heimischen Universitäten, vor allem Heidelberg, wo mit dem Stock Chrenerschen Stipendium mehrere freie Unterkünfte für arme Stadtkinder zur Verfügung standen. Doch wurden auch andere Universitäten besucht, seit der Reformation gerne Wittenberg. An einigen Hochschulen waren Heilbronner als Lehrer tätig, in Wien z.b. der Mathematiker und Astronom Johannes Vögelin, um nur einen Vertreter zu nennen. zusammenfassend ist zu sagen, daß die zahlreichen Fehden und Kriegszüge des späten Mittelalters Handel und Wandel enorm schädigten. Auch Heilbronn ist davon nicht verschont geblieben. Vordringliche Aufgaben der Stadt waren deshalb wachsame Verteidigungsbereitschaft und die stete Umschau nach einungswilligen Gesinnungsgenossen, mit denen man den Feinden Paroli bieten konnte. Die Reichsgewalt war ja unfähig, den Frieden zu gewährleisten. Für Heilbronn stellte vor allem der unruhige württembergische Nachbar eine immense Gefahr dar. Mit dem pfälzischen Bündnis hat sie zwar ein politisches Gegengewicht gefunden und fortan abwägendes Taktieren und vorsichtiges Lavieren zwischen den beiden Territorialstaaten geübt. Aber erst mit der Gründung des PRACTICA MVSICA HER MANNI FINCKII, EXEMPLA VARIORVM SIGNOR VM, PRO P 0 R TI 0 N V M ET CA N 0 N V M, 1 V DI Cl'" V M DE T 0 N 1 S, A C Q.V AE D A M DE ARTE SVAVITER ET AR T I F 1 C I O S E C A N T A NDI TINENS. CON'" VITBBERGA! EXCVDEBANT H 1E RED ES GE 0 R G II RH A V.. V, A N N 0.M, D, LVI Schwäbischen Bundes wurden stabilere Verhältnisse geschaffen, und die nachbarliche Bedrohung verlor allmählich an Bedeutung. Von einer selbständigen Politik der Stadt im eigentlichen Sinne kann jedoch für die damalige Zeit keinesfalls die Rede sein. Die inneren Verhältnisse wurden durch zahlreiche Vorschriften und Ordnungen geregelt und gewannen im Rahmen dieser obrigkeitlichen Vorgaben zumeist auf Dauer Bestand. Lehrer und Schüler der Lateinschule bildeten den Kirchenchor, wie dieser Holzschnitt von der Titelseite der "Practica Musica«des Hermann Finck, gedruckt 1556 in Wittenberg, zeigt. 42
45 Religiöse Erregtheit und kirchliche Mißstände Heilbronn auf dem Weg zur Reformation 1272: Gründung eines Barfüßerklosters. 1302: Klaranonnen lassen sich in der Stadt nieder. Kirchlich gehörte die Reichsstadt Heilbronn mit ihrem rechtsneckarischen Gebiet zum Bistum Würzburg, ihre Dörfer jenseits des Neckars waren dem Bistum Worms einverleibt. Die Diözesangrenze bildete der Fluß. Daß der Würzburger Bischof sich hinsichtlich des kirchenpolitischen Agierens der Stadt mehr als einmal als Diözesanherr beim Rat in Erinnerung brachte, war sein gutes Recht. Pfarrkirche der Stadt war St. Kilian. Daneben gab es ohne Pfarrechte noch die Nikolai- und die Spitalkirche sowie eine Anzahl Kapellen, außerdem drei Klosterkirchen und die Kirche der Deutschordenskommende. Die Pfarrkirche wurde seit der Mitte des 15. Jahrhunderts durch Hans von Mingolsheim (Langhaus) und Aberlin Jörg (Chor) aus einer frühgotischen Basilika zur gotischen Hallenkirche umgebaut. 1426: Stiftung des Predigtamtes durch Anna Mettelbach. 1447: Nach einer wundersamen Erscheinung der Gottesmutter Gründung eines Karmelitenklosters, 1458 Kirche zu»unserer lieben Frau zur Nessel«. 1449: Stiftung eines Ewigen Almosens zugunsten ortsansässiger Armer. Mitte 15. Jh.: Umbau der Kilianskirche zur gotischen Hallenkirche : Aufstellung des Hochaltars von Hans Seyfer in St. Kilian : Bau des Kiliansturmes durch Hans Schweiner. 1524: Reformatorische Bestrebungen in der Stadt erstmals greifbar. Johann Lachmann predigt den neuen Glauben. Wenige Jahre nach diesen mit»merklich schweren Kosten«veranstalteten Baumaßnahmen hat der Rat dem Meister Hans Bildhauer, d.h. dem hier tätigen Steinbildhauer und Bildschnitzer Hans Seyfer (Syfer) für den neuen Chor des Gotteshauses einen Altar in Auftrag gegeben, der 1498 aufgestellt wurde und nach dem einmütigen Urteil aller namhaften Kunsthistoriker ein Spitzenwerk der spätgotischen Altarkunst und Plastik darstellt. Die Thematik behandelt vor allem Szenen aus der Leidensgeschichte Jesu und dem Marienleben. Als eindrucksvoll beherrschende Figur des Gesamtwerkes steht Maria, das Jesuskind auf dem Arm haltend, im Zentrum des Schreins.»Nichts Formvollendeteres kann Deutschland damals besessen haben als die Figurengruppe dieses Schreins«(Fischei). Mittelpunkt der Predella ist eine Erbärmdegruppe, das Gesprenge beherrscht die Kreuzigung. Seyfer war eine der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten der deutschen Spätgotik,»ein Schöpfer neuer Formwerte«(Schnellbach), dessen Figuren»eine neue Physiognomie der Zeit«(ßiedrzynski) bekunden. Sein Heilbronner Altar ist noch ganz der mittelalterlichen Glaubensauffassung verwachsen und zeugt von tiefer Religiosität. Diese Tradition wirkt nicht mehr fort in dem Westturm der Kilianskirche, den der Rat seit 1513 durch Meister Hans Schweiner, einen fähigen, aus Weinsberg zugewanderten Steinmetz bauen ließ. Es sollte ein den:i Gesamtbauwerk adäquater Turm werden und ist ein repräsentatives Kunstwerk geworden, der erste bedeutende Renaissanceturm nördlich der Alpen, 1529 mit dem Aufsetzen des»männle«, einem Stadtsoldaten, auf die Turmspitze vollendet. Nach Meinung ei- 43
46 nes Zeitgenossen hatte der Meister freilich einen Turm gebaut»bis an den Himmel als ein Bösewicht«. Die Fertigstellung fiel in die Reformationszeit der Stadt, und der dem neuen Glauben anhängende Schweiner hat in der Tat seinem Spott über die Vertreter des alten Glaubens in dem plastischen Schmuck im oberen Teil des Bauwerks optischen Ausdruck verliehen - in»ketzerischer Der Hochaltar von Hans Seyfer, 1498 in der Heilbronner Pfarrkirche aufgestellt, ist ein Spitzenwerk spätgotischer Plastik.
47 Phantasie«. Seine karikierenden Darstellungen verleihen in zahlreichen Details dem Zeitgeist, der Stimmung unter dem Volk beredten Ausdruck. Eine bizarre und groteske Welt tut sich hier auf. Damit steht der Turm konträr zu dem köstlichen Hochaltar. Daß Schweiner in der luftigen Höhe auch sein Konterfei der Nachwelt hinterlassen hat - wen will das wundern? Die Kilianskirche ist eines der großartigsten Bauwerke dieser Epoche. In ihm spiegelt sich das starke Selbstbewußtsein der damaligen Heilbronner, die zu diesem Bau und seiner Ausstattung namhafte Meister verpflichtet haben. Kirchherr von St. Kilian war in der Regel ein Mitglied des Würzburger Domkapitels, er ließ sich vor Ort allerdings stets durch einen Pfarrverweser vertreten. Die Pfarrverweserschaft war sowohl ein geistliches als auch ein Verwaltungsamt. Der Stelleninhaber mußte des Umfangs seiner Aufgaben wegen Mietherren anstellen, die ihn bei der Seelsorge und den gottesdienstlichen Pflichten entlasteten. Die Verwaltungsgeschäfte bezogen sich vornehmlich auf den Besitz der Pfarre an Liegenschaften und anderem. Daß die Pfarrstelle nicht immer zur Zufriedenheit der Gläubigen versehen wurde, belegen Quellen gerade des ausgehenden 15. Jahrhunderts, in denen zu lesen ist, die Pfarre sei mit schlechten Gesellen besetzt, weshalb»viel Murmelung«unter der Gemeinde erwachse. Neben dem Pfarrverweser und seinen Helfern gab es noch ca. 15 weitere Geistliche an der Pfarrkirche und den ihr zugehörigen Kapellen. Sie bildeten die Präsenz, die aus diversen Liegenschaften und Kapitalien Einnahmen bezog, we-lche an die Mitbrüder gingen. Pfründen gab es zu Anfang des 16. Jahrhunderts etwa 28 an der Pfarrkirche und den Kapellen. Einen Teil derselben hatte der Rat zu vergeben, über andere bestimmten private Stifter, die meisten waren in der Hand des Kirchherrn. Mit Hilfe der Besetzung und Verwaltung seiner Pfründen suchte der Rat das Kirchenwesen in der Stadt zu beeinflussen. Unabhängig vom Kirchherrn war das Heilbronner Predigtamt, 1426 von Anna Mettelbach für einen Weltgeistlichen an der Pfarrkirche in die Hände des Rats gestiftet, dem damit die Anstellung des Prädikanten zukam. Das hiesige Predigtamt war eines der ältesten in Württemberg. Es wird vermutet, daß die Witwe Mettelbach zu ihrer Stiftung von dem Geistlichen Johannes Drändorf ermuntert worden war, der seit 1424 in Süddeutschland hussitisches Gedankengut verbreitet hat. Drändorf wurde 1425 in Heilbronn verhaftet und später in Worms als Ketzer verbrannt. Klöster gab es drei in Heilbronn. Das älteste war das der Barfüßer (Franziskaner), die 1272 in die Stadt gekommen waren. Die Kirche dieses Mönchsklosters war 1314 fertiggestellt, 1688 wurde sie von den Franzosen niedergebrannt. Als zweite kamen 1302 aus Flein Klaranonnen hierher. Ihre Kirche wurde 1380 geweiht. Die beiden Niederlassungen wurden wegen gravierender Mißstände 1465 gegen den erbitterten Widerstand ihrer Insassen reformiert. Im Gegensatz zu den Barfüßern, die im religiösen Leben des Volkes eine bedeutende Rolle spielten, war das Klarakloster eine unauffällige Einrichtung. Das bedeutendste der Heilbronner Klöster war das der Karmeliten vor der Stadt an der Straße nach Weinsberg, wo 1442 an einem von Brennnesseln zugewachsenen Marienbild eine Bäuerin eine wundersame Erscheinung der Gottesmutter gehabt hatte, was eine starke Wallfahrtsbewegung mit Gebetserhörungen und Krankenheilungen ausgelöst haben soll war das Kloster gegründet, 1458 seine Kirche zu»unserer lieben Frau zur Nessel«geweiht worden. Neben diesen Ordensniederlassungen gab es in der Stadt noch eine Anzahl Wirtschaftshöfe auswärtiger Klöster, die der Verwaltung des zum Teil umfangreichen Klosterbesitzes auf städtischer Markung und in der Umgebung dienten und dem Einzug der jährlichen Erträgnisse daraus. Ein Sonderdasein führte die Deutschordenskommende. Das Anwesen, als Enklave ein dauernder, schmerzhafter Dorn im Fleisch der Reichsstadt, war Residenz und Fruchtkammer in einem. Die Aufsicht führte ein Komtur. Der Güterbesitz war groß und lag. sowohl auf hiesiger Markung als auch auf den Anbauflächen benachbarter Dörfer. In zwei Beginenhäusern hatten weltliche Schwestern zu einem gemeinsamen Leben zusammengefunden, von denen die»willigen armen Schwestern«der 45
48 Krankenpflege und weiblichen Handarbeiten nachgingen. Das kirchliche Leben war am Ausgang des Mittelalters ungemein rege. Davon zeugen nicht zuletzt die vielen damals getätigten Stiftungen. Als dem ewigen Heil am meisten förderlich, nahm das»seelgerät«einen breiten Raum ein. Wer es ermöglichen konnte, setzte für derartige Meßstiftungen bereitwillig Geld ein. Mit den Seelenmessen verbunden waren nicht selten Schenkungen von Geld oder Naturalien (Brot und Wein) an Bedürftige, fraglos ein wichtiger Beitrag zur Armenpflege. Von den zahlreichen Kapellenstiftungen sei nur an jene der Familie Speydel zur Deutschhofkirche 1484 erinnert. Die Handwerke sammelten sich in Bruderschaften, von denen sich die der Meister an die Pfarrkirche anschlossen, die der Gesellen mehr den Barfüßern zuneigten. In den Fraternitäten hatte der einzelne Anteil an allen guten Werken der Brüder. Sie dienten primär dem Seelenheil, doch fehlen in keiner Ordnung soziale Elemente. Vielfältiges Heiltum, kostbare Reliquien oft, kam in die Gotteshäuser der Stadt und fand bei Prozessionen, deren es zahlreiche gab, die Aufmerksamkeit des gläubigen Volkes, das auch begierig Ablässe erfüllte. Freilich uferte das Ablaßwesen am Ende des 15. Jahrhunderts aus. Die kirchliche Ausstattung war vielfach spendenfreudigen Mitbürgern zu verdanken. Der Fleiner Veitsaltar von wurde von dem Heilbronner Bürgermeister Konrad Erer und seiner Frau gestiftet. Diese Stiftung entsprang wohl einer glühenden Heiligenverehrung, wie sie an der Wende zur Neuzeit allenthalben festzustellen ist. Für die St. Anna-Bruderschaft schnitzte Hans Seyfer eine Altartafel. Zum Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu wurde seit jeden Freitag zur Mittagszeit die große Glocke der Pfarrkirche geläutet. Die seit 1451 veranstaltete Fronleichnamsprozession war ein Höhepunkt der spätmittelalterlichen Volksfrömmigkeit. Beliebt waren Wallfahrten, und mancher nahm den Weg nach Rom als Bußwerk auf sich. Aus der Masse der karitativen Stiftungen für Bedürftige ist an erster Stelle das Ewige Almosen zu nennen. Dieses war 1449 vom Rat ins Leben gerufen worden. Der Ertrag der Stiftung wurde in Hans Seyfer (Syfer) - der Schöpfer des Hochaltars Der Meister des 1498 vollendeten Heilbronner Hochaltars war lange Zeit nicht eindeutig zu benennen. Doch hat bereits Moriz von Rauch das großartige Kunstwerk dem Bildschnitzer Hans Seyfer (Syfer) zugewiesen. In ihm ist der verantwortliche Unternehmer zu sehen, von dem auch die Figuren des Schreins und der Predella stammen, während andere Teile, z.b. die Flügelreliefs, Gehilfenhand seiner Werkstatt zugeschrieben werden. Die bei der Restaurierung des Altars vor der Wiederaufstellung 1968 auf der Rückseite eines der Flügelbilder (Marientod) zutage gekommene Signatur ist als»lenhard h«bzw.»lenhart h" zu lesen, nicht als Namenszug Hans Seyfers, wie ursprünglich falsch interpretiert. Sie soll nach neuerer Erkenntnis auch nicht zeitgenössisch sein. Die Herkunft Hans Seyfers ist nicht gesichert. Vermutlich war er um 1460 in Sinsheim geboren. Die Ausbildung zum Steinbildhauer und Bildschnitzer erfuhr er wahrscheinlich in Worms durch Konrad Seyfer und eventuell Hans von Worms. Jedenfalls weist sein späteres Schaffen auf den ober- und mittelrheinischen Schulkreis der Gerhaert-Nachfolge. Nach Heilbronn, wo er eine größere Werkstatt unterhielt, wird er erst in den 90er Jahren gekommen sein ist er hier Bürger geworden erhielt Seyfer (»Meister Hans Bildhauer«) den Auftrag zu einem steinernen Wegkreuz, von dem wahrscheinlich ein bei den Städtischen Museen Heilbronn aufbewahrter eindrucksvoller Christuskopf stammt, und 1506 von der Heilbronner St. Anna-Bruderschaft den zu einer Altartafel in die Kilianskirche. Über der Arbeit an einem Ölberg in Speyer ist er 1509 gestorben. Von Hans Seyfer stammern fraglos die Skulpturen des Schreins sowie die Halbfiguren der Predella des Heilbronner Hochaltars während in den Statuetten des Gesprenges und in den Flügelreliefs Gehilfenarbeit zu sehen ist. Allerdings scheint an den Figuren des Gesprenges auch der nachmals berühmte Konrad Meit mitgearbeitet zu haben. Der Hochaltar ist nicht in allen Teilen original erhalten. Schrein und Gesprenge sind bei dem schweren Luftangriff auf die Stadt am 4. Dezember 1944 verbrannt (zum Glück ohne die Figuren) und später nachgearbeitet worden. Naturalien ausgeteilt. Berechtigt waren nur Bürger der Stadt, die sogenannten Hausarmen. Das Ewige Almosen war eine der segensreichsten Stiftungen und umfaßte die Gesamtheit des städtischen Armenvermögens. Aber auch den Kranken und Siechen im Spital und im Aussätzigenhaus, den fremden Armen in den Elenden herbergen und im Seelhaus wandte sich die Wohlt tigkeit des Volkes in erstaunlich reichem Maße zu. Im Spital wurden vor allem»speise und Mahl«bedacht. Im Aussätzigenhaus, dem Guteleuthaus vor den Mauern der Stadt, versammelte man die Leprosen, die hier, für die übrige Welt schon»gestorben«, geraume Zeit noch ein gemeinsames Leben führen konnten. Ebenfalls dort untergebracht Christuskopf eines Kruzifixus von Hans Seyfer, 1505 im Auftrag des ehemals pfälzischen Kellers Albrecht Burger, genannt Dinkelsbühl, entstanden. 46
49 Hans Schweiner, der Erbauer des Kiliansturmes , ein genialer Baumeister. Relief (Selbstporträt} am Turm wurden die französischen Leute«, d.h. die an Syphilis Erkrankten, die 1503 hier erstmals Erwähnung erfahren. Den zahllosen heimatlosen Armen, sprich Bettlern, begegnet man in den Elendenherbergen und im Seelhaus. Ihrer unübersehbaren Zahl wegen waren sie eine wahre Landplage. In der Stadt durften sie nicht betteln, in die Herberge nahm man sie nur für eine Nacht auf. Alle mildtätigen Stiftungen und Einrichtungen offenbaren den Geist tiefer Religiosität. Viele Bedürftige und Leidende verdankten ihnen nicht aufzuwiegende Hilfe. Daß die kirchlichen Zustände auch in Heilbronn am Ende des Mittelalters nicht immer erfreulich waren, wurde oben schon angedeutet. So mancher pflichtvergessene Priester machte damals von sich reden. Aber es waren nicht allein Amtsversäumnisse und unbotmäßiges Verhalten, die von der Gemeinde angeprangert wurden, es war vielmehr das ärgerliche Leben der Geistlichen, das den gemeinen Mann empörte. Gerade im Anfang des 16. Jahrhunderts häuften Hans Schweiner - der Erbauer des Kiliansturmes Der Erbauer des Kiliansturmes, Hans Schweiner, war um 1473 in Weinsberg geboren, gegen 1494 nach Heilbronn gekommen und 1496 mit seiner Heirat hier Bürger geworden. Der himmelstrebende Turm der Heilbronner Pfarrkirche ist sein bedeutendstes Werk, das er nach Verfestigung des schon vorhandenen Unterbaus seit 1507 in den Jahren aufführte. In genialer Konzeption schuf er jener Zeit des tiefgreifenden Umbruchs, in der er lebte, ein beredtes Denkmal, wobei das Neue seiner künstlerischen Form der kraftvolle Schmuckstil ist, eine Formensprache, die sich entwicklungsgeschichtlich nirgends recht einordnen läßt, so daß auch eine Bezeichnung wie»renaissance«nur bedingt Geltung haben kann. Schweiner wurde für seine Arbeit mit 30 Pfennig täglich im Sommer und 24 Pfennig im Winter bezahlt. Für»Riß und Aufsehen«erhielt er außerdem jährlich 6 Gulden. Sein Konterfei in luftiger Höhe ist ebenso bemerkenswert wie jenes Habakuk-Porträt an dem von Schweiners Bauhütte 1535 ausgeführten Erker des Käthchenhauses, in dem die lokale Forschung das Bildnis des Heilbronner Reformators Johann Lachmann sehen zu dürfen glaubt. Hans Schweiner, der seit 1531 dem Rat angehörte, war zu dieser Zeit schon nicht mehr am Leben. Er ist 1534 in Armut gestorben. Beim Hüttenkongreß 1515 in Straßburg hatte sich Schweiner als»meister Hans von Heilbrun«eingeschrieben, was vermuten läßt, daß ihm sein Familienname, den er erst in Heilbronn bekommen zu haben scheint, nicht gefiel. In den Quellen taucht er auch als Hans von Weinsberg auf oder als Meister Hans Steinmetz. Steinhilber sieht in ihm einen Vorfahren Robert Mayers. sich die Vorkommnisse erschreckend, doch hat man sich vor Verallgemeinerungen zu hüten. Dennoch - die Sittenlosigkeit nahm zu und riß zwischen Geistlichkeit und Gemeinde eine Kluft auf, die bald unüberbrückbar wurde. Einer der häufigsten Besucher des»frauenhauses«(bordell) war ein Priester. Wegen des frivolen Verhaltens eines anderen wandten sich sogar seine Mitbrüder klagend an den Bischof. Ein dauerndes Ärgernis waren die Konkubinen der Geistlichen. Manche Verhältnisse erreichten sogar die Festigkeit einer Ehe, und von Priesterkindern ist die Rede und 1508 beklagte sich der Rat in ausführlichen Berichten an den Kirchherrn bitter über das Verhalten der Geistlichen innerhalb und außerhalb der Pfarrkirche. Gründe für eine Änderung der kirchlichen und geistlichen Verhältnisse gab es also in hinreichendem Maße. Und so ist anzunehmen, daß man auch in Heilbronn mit wacher Aufmerksamkeit jene Bewegung verfolgte, die mit Martin Luthers Thesenanschlag in Wittenberg ins Leben gerufen wurde. Die tatsächlichen Anfänge der reformatorischen Bewegungen in Heilbronn sind indessen nicht zu benennen. Das Wormser Edikt, mit dem 1521 die Acht über Luther verhängt und seine Lehre, 9eren Widerruf er ablehnte, verboten wurde, ließ der Rat erst nach langem Zögern durch Anschlag publizieren. Die Bevölkerung Heilbronns war in diesen Jahren durchaus noch altgläubig gesinnt warnte Philipp Erer seinen Vater, Bürgermeister Konrad Erer, vor 47
50 des»lautterers" (Luthers) Partei, etwas später die kurpfälzische Regierung den Rat vor aufrührerischen Druckschriften. Und das Gebot des Rats an die Priester 1524, ihre Mägde abzuschaffen, was auf erheblichen Widerstand der Geistlichen stieß, mag durchaus neugläubigen Bestrebungen erwachsen sein. In eben diesem Jahr 1524 wird jedenfalls die reformatorische Bewegung in Heilbronn quellenmäßig erstmals greifbar, indem der aus dem hiesigen Barfüßerkloster ausgetretene Prediger Johannes Güttenberg die Meister und Gesellen der Schuhmacher zu»emsigem Hören des göttlichen Worts«auffordert. Ausgangs des Jahres beschwerten sich die Karmeliten über einen fremden Prediger, den der Rat freilich gewähren ließ,»alldieweil er das Evangelium predigt«. Anfangs 1525 durfte ein Meister Hans, vermutlich der genannte Prädikant, auf Ansuchen etlicher der Gemeinde zu St. Nikolaus predigen, allerdings nur das Evangelium»Und nichts anderes". Im Bauernkrieg ist er dann aus der Stadt gewiesen worden. Noch vor dem Ausbruch des Bauernkrieges hat der Rat die Barfüßer aufgefordert,»das heilige Evangelium«zu verkündigen, die Mönche antworteten aber ausweichend. Seit spätestens 1524 predigte auch Johann Lachmann den neuen Glauben, ja er ist zu dieser Zeit bereits ein erklärter Anhänger Luthers. Lachmann, ein Sohn der Stadt, hatte 1514 die Pfarrverweserschaft an St. Kilian übertragen bekommen und 1521 vom Rat die Prädikatur. Als Prediger wurde er zur Seele der reformatorischen Bewegung in der Stadt, zum Reformator Heilbronns, der mit unermüdlichem Eifer die Einführung der neuen Lehre betrieb. Lachmanns Predigten waren für seine Zuhörer von nachhaltigem Eindruck und erfreuten sich eines starken Zulaufs, nicht zuletzt aus den benachbarten Dörfern. So war denn die Bürgerschaft im Frühjahr 1525 offenbar schon zu einem guten Teil lutherisch gesinnt. In ihrer religiösen Aufbruchstimmung drängte sie den Pfarrverweser, Peter Dietz, ebenfalls ein Sohn der Stadt, der 1521 Lachmanns Nachfolge als Vertreter des Kirchherrn angetreten hatte, das Sakrament unter beiderlei Gestalt zu reichen, worüber der Bischof sich empörte. Der Rat wollte aber von einer Nötigung des Geistlichen nichts wissen. Als Lachmanns Reformationsbestrebungen soweit gediehen waren, überzog der Bauernkrieg Stadt und Land und drohte, das eben erst begonnene Unternehmen zu vernichten. Machtvoll wurde Heilbronn in diese Entwicklung hineingerissen, das reformatorische Vorhaben kam vorerst ganz zum Erliegen. Es wurde oben darauf hingewiesen, daß die Vermögensverhältnisse Heilbronns im späten Mittelalter günstig gewesen sind. Nur so ist zu verstehen, daß die doch relativ kleine Stadt mit ihren ca Einwohnern an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert einen solch enormen Bau- und Ausstattungsaufwand wie für die Pfarrkirche sich leisten konnte. Die Bevölkerung war noch von tiefer Frömmigkeit beseelt und pflegte ein reiches religiöses Leben. Daß dieses farben- und nuancenreiche Bild durch die Verfehlungen auf der geistlichen Seite Schaden leiden mußte, versteht sich, auch daß daraus mehr und mehr Unzufriedenheit in der Gemeinde erwuchs. Eine tiefgreifende Reform der Kirche an Haupt und Gliedern war unvermeidlich geworden, drängte nach Verwirklichung. So war denn dem Rufer in Wittenberg der Boden bereitet, als er 1517 mit dem Anschlag seiner Thesen den»aufstand«g gen die alte Kirche einleitete. Auch in Heilbronn fand der neue Glaube schnell seine Anhänger und Förderer und in Johann Lachmann einen Geistlichen, der mit Verstand und Weitblick die Reformation in seiner Vaterstadt durchzusetzen verstand. Bis zum Beginn des Bauernkriegs war jedenfalls das Fundament gelegt. Ein sonst nicht nachgewiesener Meister Hans durfte zu Anfang des Jahres 1525 in St. Nikolaus das Evangelium predigen. 48
51 Erschütterung der Ordnung Der Bauernkrieg : Bauernkrieg, von Oberschwaben ausgehend. Gerade zehn Jahre waren vergangen seit dem Aufstand des Armen Konrad im württembergischen Remstal 1514, als 1525 in Oberschwaben die Unruhe in der Bauernschaft erneut aufflammte und gewissermaßen als treibende Kraft die nun folgende allgemeine Bauernerhebung auslöste, die in kurzer Zeit gleich einer Flutwelle den gesamten Süden Deutschlands überschwemmte, Heilbronn nicht ausgenommen, und nachmals unter der Bezeichnung Bauernkrieg als»eine Auseinandersetzung zwischen dem genossenschaftlichen Volksrecht und dem ob- 2. April: Bauernversammlung in Flein, Bildung des Neckartaler Haufens unter Führung des Jäklein Rorbach. 4. April: Forderungen der Gemeinde (8 Artikel) an den Rat. 5. April: Erste Ermahnung Lachmanns an die Bauern (zweite 13. April, dritte 12. Mai). 16. April: Weinsberger Bluttat. Aufforderung der Bauern, Heilbronn zu übergeben. 18. April: Der Rat muß 200 Bauern in die Stadt einlassen. 12. Mai: Das»Bauernparlament«tagt in der Stadt, um die Erhebung zu koordinieren und zu lenken. Niederlage des Bauernheeres gegen den Schwäbischen Bund bei Böblingen. 20. Mai: Das bündische Heer vor Heilbronn, Jäklein Rorbach bei Neckargartach verbrannt. 28. Mai: Das bündische Heer nähert sich erneut der Stadt, die Bauern weichen zurück. Der Odenwald-Neckartaler Bauernhaufe bricht auseinander. 2. Juni: Schlacht bei Königshofen, die Bauern werden vernichtend geschlagen. Strafgericht in der Stadt, zahlreiche Hinrichtungen und Stadtverweise. rigkeitlichen Herrschaftsrecht«(Franz) in die Geschichte eingegangen ist. Die in Oberschwaben proklamierten Zwölf Artikel, durch die man einen neuen Rechtszustand auf der Grundlage des Göttlichen Rechts schaffen wollte, fanden auch bei den Bürgern und Untertanen Heilbronns, das wie kaum eine andere Stadt in die Erhebung hineingezogen werden sollte, sofort Anhänger. In der hiesigen Gegend nahm diese sozialpolitische Bewegung mit einer Vielschichtigkeit an Motiven im Frühjahr 1525 ihren Anfang. Die»Brennpunkte politischer und sozialer Weisheit«(Rauch) waren in Heilbronn die Bäckerstuben, wo die unruhigen Geister zusammenfanden. Eine auf den 2. April nach Flein einberufene Bauernversammlung formierte sich zum Neckartaler Haufen. Die dort Versammelten schworen einander zu und wählten den Jäklein Rorbach, der die Seele der Bewegung gewesen ist, zu ihrem Hauptmann, der sie auf die Zwölf Artikel verpflichtete mit dem Vorgeben, die Gerechtigkeit handhaben und dem Evangelium beistehen zu wollen. Die Bauern strebten die Abschaffung der Zehnten, Renten und Gülten, der Frondienste und der Bet an, doch traten hinter dem Verlangen, die Pfaffen zu strafen, weil diese sie»unbillig beschwert«hätten, alle diese Forderungen zurück. Der Haß auf die Geistlichkeit blieb das dominierende Element dieses Haufens. Jäklein Rorbach, ein geborener Bökkinger, war als schwieriger und gewalttätiger Mensch bekannt. Er' bewirtschaftete als Erbpächter einen dem Ritterstift zu Wimpfen im Tal gehörenden Hof in Böckingen, verfügte über Eigenbesitz und galt als vermögend. Auf den 27. März 1525 war er wegen Nichterfüllung seiner Pachtverpflichtungen vor das Bökkinger Gericht zitiert worden. Zu diesem Rechtshandel hatte Rorbach die benachbarte Bauernschaft eingeladen, und aus dem Rechtstag wurde unversehens eine Werbeversammlung für die Bauernsache. 49
52
53 sammlung des hellen lichten Haufens«, wie sich die Neckartäler und Odenwälder nach der Vereinigung nannten, gegen Weinsberg, wo das äußerst schwach besetzte und verteidigte Schloß in kurzer Zeit gestürmt, die Stadt rasch eingenommen wurden. Was danach in Weinsberg geschah, die»weinsberger Bluttat«, hat, wenngleich für sich dastehend, dem gesamten Bauernkrieg ein Brandmal aufgedrückt: Der in der Stadt gefangene Adel, allen voran der württembergische Obervogt Graf Ludwig Helferich von Helfenstein, wurde nebst seinen Knechten über zugesagte Sicherheit durch die Spieße gejagt. Rorbach hat dem Grafen den ersten Streich gegeben, die»schwarze Hofmännin«sich später Jäklein Rorbach Der am 2. April 1525 in Flein zum Anführer des Neckartaler Haufens gewählte Jäklein Rorbach stammte aus dem heilbronnischen Dorf Böckingen. Er war dort Hofmann, d.h. Erbpächter, auf einem dem Ritterstift St. Peter zu Wimpfen im Tal gehörigen Hof. Als Eigenbesitz besaß er eine Hofstatt, mehrere Weingärten, Äcker und Krautgärten, drei Pferde, eine Kuh, Schafe und Schweine. Man kann ihn, der Leibeigener der Herren von Neipperg gewesen ist, also keinesfalls als unvermögend bezeichnen. Rorbach war ein aufsässiger und gewalttätiger Mensch, der gerne zur Selbsthilfe griff und schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Sein Aufbegehren gegen die Obrigkeit war auffällig. Sein eigener Vater hat ihn einmal als»böslichen Mann«bezeichnet. Vor allem Steuern und Abgaben scheinen ihn leicht in Rage gebracht zu haben. So blieb er auch wegen angeblicher Übervorteilung von der nach Wimpfen zu liefernden Gült für 1524 einen Teil schuldig und handelte sich damit eine Klage ein. Den Rechtstag verstand er zu einer Werbeversammlung für die Bauernsache umzufunktionieren, durch die letztlich die Bildung des Neckartaler Haufens in die Wege geleitet wurde. In Flein sollen die Bauern, als sie ihn zu ihrem Hauptmann wählten, die Hüte gezogen und sich vor ihm verneigt haben,»als ob er ein Edelmann wäre". Die Rolle des Jäklein Rorbach im weiteren Verlauf des Bauernkrieges ist in diesem Kapitel hinreichend dargestellt, ebenso sein unrühmliches Ende. Ihn zu heroisieren, wie dies öfter geschehen ist, wird seiner tatsächlichen Rolle nicht gerecht. Die Radikalisierung der bäuerischen Bewegung im Unterland geht nämlich in erster Linie auf ihn zurück, den unübersehbar eigennützige Gründe getrieben haben. Die "schwarze Hofmännimc Die schwarze Hofmännin«, Margarethe Abrecht, geborene Renner, war die Witwe des deutschordenschen Hofmannes Peter Abrecht in Böckingen. Von daher ist auch ihr Übername zu erklären. Mit Jäklein Rorbach hatte sie sich schon früh zusammengefunden. Jetzt hing sie ihm erneut an, ihm ratend,»er soll seynes furnemens nit nachlaßen«. Rauch hat sie einmal als ein»hexenhaftes Weib«bezeichnet. Jedenfalls hat sie die Bauern»Offtermals getrost, sie sollen keck ziehen, sie hab sie gesegnet, das inen weder spieß noch helmparten oder buchsen nichts thon mogen«. Ob sie bei der Weinsberger Bluttat tatsächlich in den Leichnam des Grafen von Helfenstein geschnitten und sich mit dem Ausfluß die Schuhe eingerieben hat, wie sie sich selber rühmte, mag dahingestellt bleiben. Immerhin bestehen Zweifel. Als die Bauern nach Ostern vor Heilbronn zogen, hat diese Frau»in ihrem blöden Haß gegen die städtische Kultur«(Rauch) lauthals gefordert, Heilbronn müsse ein Dorf werden wie Böckingen, kein Stein dürfe auf dem anderen bleiben. Die Ratsfreunde hieß sie»boßwicht und buben". Man solle, schrie sie,»erwurgen und erstechen, was zu Haylprun sey, und den stinckenden gnadigen frawen die heß [Kleider] vorm arß abschneyden, das sie gon wie die beschrotten [gerupften] gens«. Nach dem Bauernkrieg zog der Rat die Frau ihres»unverhüteten Mundes«wegen gefänglich ein, ließ sie aber auf Fürsprache ihres Leibherrn, des Jörg von Hirschhorn, wieder frei. Sie scheint danach Böckingen verlassen zu haben. Die»schwarze Hofmännin" ist in der Dichtung unverdientermaßen verherrlicht worden. 51
54 gebrüstet, sie habe mit einem Messer in dessen Leichnam geschnitten und mit dem herauslaufenden»schmer«ihre Schuhe eingeschmiert. Die Gräfin Helfenstein wurde gezwungen, diesem blutrünstigen Morden, das vornehmlich Rorbach und sein Anhang verlangt hatten, zuzusehen. Später wurde sie auf einem Mistkarren nach Heilbronn gefahren. Die Wut der Bauern war insbesondere dadurch entfacht worden, daß der Graf, als sie am Karfreitag an Weinsberg vorbeigezogen waren, im Übermut auf sie hatte feuern lassen. Die maßlose Erregung der Bauern nützte Rorbach, um sie auf den Weg der blinden Gewalt zu locken. Dies aber war»eine wahnwitzige Herausforderung der herrschenden Gewalten, die sich bitter rächen sollte«(weismann) und Unschuldige wie Schuldige gleichermaßen treffen mußte. Nach Heilbronn gelangte die Nachricht von den Weinsberger Ereignissen bereits um die Mittagszeit und rief helles Entsetzen hervor. Danach forderte ein,l\bgesandter der Bauern die Stadt zur Ubergabe auf - ein Begehren, das der Rat, wäre man sich einig gewesen, durchaus hätte abschlagen können. Als aus dem Lager der Bauern zudem zu hören war, der Rat sei hart gegen die Bauern, er müsse bald weich werden, sie wüßten wohl, wie sie mit der Gemeinde stünden, geriet er über dieser offensichtlichen Drohung nicht wenig in Verlegenheit, denn auf die Verteidigungsbereitschaft seiner Bürgerschaft konnte er sich nicht verlassen. Es ging in der Stadt unüberhörbar das Wort:»Mein Spieß sticht keinen Bauern!«Der Rat war - ratlos: Eine Sitzung mit Vertretern der Gemeinde bestätigte nur, wie sehr die Bürgerschaft gespalten war. Sie zeigte auch keine Verteidigungsbereitschaft, ging doch das Gerücht, die Bauern wollten, so man sie hindere, in die Stadt zu kommen, die Weinberge aushauen. Auf Hilfe von auswärts war nicht zu hoffen. Der Rat stand allein. Am Dienstag nach Ostern rückten die Bauern vor die Stadt, wo die»schwarze Hofmännin«schrie, Heilbronn müsse ein Dorf werden wie Böckingen, kein Stein dürfe auf dem anderen bleiben. In dieser Not ließ der Rat gegen die Warnung Lachmanns, in der Stadt selbst keine Verhandlungen zu führen, die Bauernhauptleute auf das Rathaus einladen - und be- gab sich damit in die Hand der Bauern. Sofort stellten sie ihre Forderungen, die im großen und ganzen auch»bewilligt«werden mußten: Zur»Abstrafung«der Geistlichen, insbesondere der verhaßten Deutschordensherren, waren 200 Bauern in die Stadt einzulassen, die bürgerliches Gut allerdings nicht antasten sollten. Auch mußte die Stadt der Bruderschaft der Bauern beitreten und eine Verpflichtung auf die Zwölf Artikel eingehen. Die Gemeinde stimmte dem allen zu und huldigte den Bauern. Der Rat blieb im Amt, in die inneren Angelegenheiten der Stadt mischten sich die Bauern nicht ein. Rauch nimmt an, daß sie nach der Weinsberger Bluttat ein Zeichen setzen wollten. Jäklein Rorbach hatte sich zwischenzeitlich von dem Odenwald-Neckartaler Haufen getrennt. Mit drei 11Ermahnungen«wandte sich der Hei/ bronner Prediger Johann Lachmann an die ausgezogenen heimischen Bauern und forderte sie zur Umkehr auf. Später, vermutlich noch 1525, ließ er seine Sendschreiben in Speyer drucken. Das Büchlein trägt den Titel 11Drey Christlihe ermanung an die Baüwerschafft " 52
55 Die Bauern lagerten im Norden Heilbronns und hielten im Karmelitenkloster»Wahrlich übel haus", wie ein zeitgenössisches Lied besagt. Die in die Stadt Eingelassenen plünderten die Klöster und Klosterhöfe, vor allem aber die Deutschordenskommende, deren Archiv vernichtet wurde. Was sie nicht mitnehmen konnten, verkauften sie in der Stadt. Die Karmeliten, die Klaranonnen und die Präsenzherren wurden»geschatzt«. Lachmann hatte in diesen Tagen erneut die Rolle des Vermittlers, predigte den Bauern, aß und trank mit ihnen, obgleich er»lieber Steine getragen" hätte, wie er später sagte. Als die Bauern nach vier Tagen aus Heilbronn abzogen, verlangten sie von der Stadt die Stellung eines Fähnleins sowie die Lieferung von Geschütz, Büchsen und Pulver. Zwar blieb dem Rat die Werbung unter der Stadt Namen erspart, doch mußte er verkünden lassen, das Ausziehen mit den Bauern solle keinem Bürger an Ehre oder Gut Schaden bringen. Von Heilbronn aus zogen die Bauern durch den Odenwald nach Amorbach. Dort wurde der Heilbronner Prokurator Hans Berlin, welcher der Vertraute sowohl des Heilbronner Rats als auch der Die Bauern hausen übel im Karmelitenkloster Nach einem zeitgenössischen Lied eines unbekannten Autors haben die Bauern, als sie nach Ostern 1525 vor Heilbronn zogen, in dem vor den Mauern der Stadt an der Straße nach Weinsberg gelegenen Karmelitenkloster»übel gehaust". Es heißt dort (zitiert nach Steiff/Mehring, S. 237 f.):»darnach am mittwoch morgen fruo die bauren hetten gar kein ruo, sie wolten ie gen Heylbronn nein und zugen biß auf den graben rein und schluogen ir lager in die garten. Die andern teten im closter warten; sie hielten warlich übel haus, schluogen den münchen die fenster auß, teten alles sambt zerreißen, teten in auch den brunen zerschmeißen und rieß einer forn, dern ander hinden; es kund einer nicht ein nagel finden, daß einer ein huot hett gehenket dran. Ich mueß es überlaufen schon, dann es wird sich zuo lang verziehen und wird vielleicht manchen muehen, der möcht es mir vor übel han. Bauern war, neben dem ehemaligen hohenlohischen Sekretär Wendel Hipler und dem mainzischen Keller in Miltenberg, Friedrich Weigandt, zur Ausarbeitung der»amorbacher Erklärung" zu den Zwölf Artikeln zugezogen, durch die diese an die fränkischen Verhältnisse angepaßt wurden. Die Autoren suchten die Erhebung in geregelte Bahnen zu lenken und bis zu einer künftigen Reformation einen möglichst gesetzmäßigen Zustand zu schaffen. Am 12. Mai versammelte sich in Heilbronn das sogenannte Bauernparlament. Es war fraglos eine der politisch bedeutsamsten Zusammenkünfte des gesamten Bauernkriegs. Die Abgesandten der verschiedenen Bauernhaufen trafen sich im Schöntaler Hof, um über eine künftige Reformation zu beraten sowie»ein Regiment fürzunehmen«. Die von Wendel Hipler erarbeitete Tagesordnung richtete wie kein anderes Dokument der Zeit den Blick auf die Gesamtheit der Bauernbewegung, wobei es ihm allein»um die Durchführung des Möglichen" ging, was ihm unter den Bauernführern»Seine besondere Stellung" (Franz) gibt. Er war»einer der wenigen politischen Köpfe im Bauernkrieg«(Wunder). Doch sollte es bei dem Versuch, zu einer Koordination der Bewegung, zu einem gemeinsamen Programm zu kommen, sein Bewenden haben, denn an eben diesem 12. Mai wurden die schwäbischen Bauern von dem Heer des Schwäbischen Bundes unter Truchseß Georg von Waldburg bei Böblingen vernichtend geschlagen, und die Bauernführer liefen eiligst auseinander. Der Versuch mit dem Bauernparlament steht für sich allein in der Geschichte des Bauernkrieges. Was an dem einen Tag in Heilbronn verhandelt worden ist, entzieht sich freilich der Nachforschung. Nach dieser Niederlag e, die den verderblichen Fortgang des Unternehmens für die Bauern schon ahnen ließ, richtete Lachmann eine dritte Ermahnung an sie und redete ihnen zu, endlich in sich zu gehen und Gott um Gnade zu bitten. Ihre Niederlage sei die Strafe Gottes für ihre Handlung. Sie aber verkannten die Situation völlig. Der Gunthermathle (Mathis Gunther) eiferte auf dem Marktplatz, man müsse in jedem Dorf Sturm läuten, dann werde man ausreichend Mannschaft 53
56 zusammenbringen, um den Bund niederzuwerfen. Und in der Tat formierte sich bei Weinsberg rasch ein neues Auf gebot. In dieser für Heilbronn erneut bedrohlichen Situation wandte sich die Stadt eiligst an den Schwäbischen Bund und bat um Hilfe. Etwa gleichzeitig forderten die Odenwald-Neckartaler Bauern von Würzburg aus Heilbronn zum Zuzug nach Weinsberg auf und warnten die Stadt, sich mit dem Bund einzulassen. Die Bauern wollten, so schrieben sie, dem Rat mit Leib und Gut beistehen. Der aber scheint das Schreiben unbeantwortet gelassen zu haben, obgleich man zur nämlichen Zeit in der Stadt von den Bauernfreunden zu hören bekam,»sie wollten nit wider die Bauern tun, es habe mancher einen Vater, Bruder, Vetter und Verwandten darunter, und es seien alle christliche Brüder«. Der Bund handelte rasch, am 20. Mai rückte der Truchseß mit dem bündischen Heer vor Heilbronn. Tags darauf ließ er bei Neckargartach den Jäklein Rorbach, nach der Böblinger Schlacht auf der Flucht bei Asperg gefangengenommen, bei lebendigem Leibe braten. Weinsberg wurde niedergebrannt, die heilbronnischen Dörfer Böckingen und Flein wurden ebenfalls»gebrannt«, Frankenbach und Neckargartach geplündert. Danach zog das bündische Heer weiter, und sofort drohte der Stadt wieder Gefahr. Der von Würzburg abgerückte Odenwald-Neckartaler Haufe unter Götz von Berlichingen, der unter starkem Druck der Bauern die Hauptmannschaft angenommen hatte,»um im Interesse des Adels Einfluß auf die Bewegung zu gewinnen und sie in gemäßigtere Bahnen zu leiten«(franz), näherte sich. Die Stadt wurde nicht nur zur Proviantlieferung aufgefordert, drohend gab die Bauernschaft auch ihrer Entrüstung darüber Ausdruck, daß Heilbronn, das doch der Bruderschaft der Bauern anhängig sei, deren Feinde eingelassen habe. Heilbronn solle sich erklären, ob die Stadt sich den Bauern öffnen wolle. Diesmal ließ der Rat sich jedoch nicht einschüchtern. Die Stadt, die inzwischen Kriegsknechte angenommen hatte, wurde in Verteidigungszustand gesetzt. Die Stimmung unter der Bürgerschaft hatte umgeschlagen, erwies sich nun als überwiegend bauernfeindlich. Die Forderun- gen der Bauern stießen bei den Bürgern rundweg auf Ablehnung. Ein Bauernfreund, der sich für die Offnung der Tore aussprach, wurde erstochen. Nun wollten die Bauern die Stadt stürmen, redeten auch davon, den Neckar abzugraben und die Rebstöcke herauszuhauen. Einen Tag und zwei Nächte lang standen die Kriegsknechte mit der Bürgerschaft in Erwartung eines bäuerischen Angriffs in Wehr und Waffen, bis am 28. Mai die vereinigten Heere des Truchseß und des Kurfürsten von der Pfalz sich näherten. Die Bauern wichen zurück, die Gefahr für die Stadt war gebannt - diesmal für immer. Auf dem Rückmarsch durch das Hohenlohische brach der Odenwald-Nekkartaler Bauernhaufe auseinander. Nur ein kleines Häuflein Unverdrossener machte am 2. Juni noch die Schlacht bei Königshofen mit, in der die Bauern endgültig niedergeworfen und zu Tausenden getötet wurden. Der Aufstand war niedergeschlagen - nun mußte Gericht gehalten werden. Auch in Heilbronn machte sich der Rat an die Bestrafung der Bauernanhänger. Nicht weniger als neun Aufwiegler und Rädelsführer ließ er auf dem Marktplatz enthaupten - ein abschreckendes Beispiel für jeden, der noch immer mit den Bauern sympathisieren mochte. Etwa ein halbes Hundert Bürger wurde in anderer Weise abgestraft, einige auch der Stadt verwiesen. Einzelne durften keine Wehr mehr tragen und keine öffentliche Zeche besuchen. Die»schwarze Hofmännin«kam auf Fürsprache aus der Haft. Überhaupt hatte mancher seine milde Strafe einem Fürsprecher zu verdanken. Nicht zuletzt Lachmann hat beschwichtigend auf den Rat eingewirkt. Auch gegen seine Untertanen in den Dörfern ging der Spottverse auf Jäklein Rorbachs Tod Jäklein Rorbach wurde am 21. Mai 1525 bei Neckargartach verbrannt. In einer Handschrift der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe findet sich eine zeitgenössische Abbildung der Exekution. Daneben stehen diese Verse:»Jacob Rohrbach hatt auffruhr gerathen, des muß er werden gebratten, bey Neckergartach an einr weyden must er des feurs flam leyden. Bis er sein leben endt, Sein leib zu puluer ward verbrendt.«54
57 Vermerk im Heilbronner Betbuch für die Jahre über die Enthauptung des Bäckers Wolf Leip, genannt nder böse Wolfe<, am 26. Oktober Rat mit Strenge vor. Ein Neckargartacher und zwei Fleiner wurden hingerichtet, und noch 1571 (!) wurde dem»bauernkrieger«hans Welner von Neckargartach eine Pfründe im Spital verwehrt. Die Strafe für die Dörfer setzte der Rat mit je 700 Gulden für Säckingen und Neckargartach, 500 für Flein und 300 Gulden für F rankenbach fest. Aber auch Rat und Gemeinde hatten sich wegen ihres Verhaltens zu verantworten, und zwar vor dem Schwäbischen Bund. Der Rat wurde 1528 freigesprochen, da er sich, wie der Bund gewiß zu Unrecht fand,»nicht übel, sondern wohl«gehalten habe, die Gemeinde, welcher man alle Schuld zuzuschieben verstand, wurde zu einer Strafe von Gulden verurteilt. Entschädigungsansprüche an die Stadt, die Dörfer bzw. an einzelne ihrer Bürger und Untertanen wurden sowohl von weltlichen und geistlichen Ständen als auch von Einzelpersonen in großer Zahl erhoben. Von der Klage des Deutschmeisters, der von Heilbronn Schadensersatz in Höhe von über Gulden forderte, kam die Stadt erst 1584(!) frei. Zusammenfassend ist noch einmal hervorzuheben, daß die Unruhen in Heilbronn im wesentlichen von zwei Gruppen getragen wurden, deren eine, vorwiegend Weingärtner, auch Handwerker, unter Ausnutzung der Bauernerhebung die rein innerstädtischen Forderungen nach Mitbestimmung durch die Gemeinde bei allen wichtigen Fragen und Entscheidungen des städtischen Regiments und einer Reform des Rats erhob, im übrigen aber keinerlei engere Beziehungen zu der bäuerischen Bewegung unterhielt, während die andere um Jäklein Rorbach und seine Freundschaft sich bäuerisches Gedankengut zu eigen machte und das»göttliche Recht«ihren Forderungen, die sich nicht zuletzt auf eine Änderung des strukturellen Gefüges der Stadt erstreckten, voranstellte. Es ist bemerkenswert, daß die Beteiligten»in keiner Weise identisch mit den vermögensmäßigen Unterschichten«gewesen sind.»das Proletariat... bildete nur die Anhängerschaft«(Mistele). Daß der Aufruhr allein wegen der zögerlichen Haltung des Rats Heilbronn bis in seine Grundfesten erzittern lassen konnte, wird man behaupten dürfen. Bei mehr Beherztheit und Verteidigungsbereitschaft hätte man sicherlich vermeiden können, von dem überschwappenden Aktionismus beider Seiten»überrollt«zu werden. Aber gerade in dieser Hinsicht hat man recht fahrlässig gehandelt. Die Radikalisierung der bäuerischen Bewegung im Unterland, die in der Bluttat von Weinsberg gipfelte, geht fraglos wesentlich auf Jäklein Rorbachs aufwieglerische Umtriebe und das stete Aufputschen der ohnehin erhitzten Gemüter seiner zahlreichen Mitläufer, nicht zuletzt auch durch die»schwarze Hofmännin«, zurück. Daß Rorbach der Bewegung geschadet hat, steht außer Frage. Er suchte vor allem seinen persönlichen Vorteil. Für die Stadt Heilbronn, die eine tiefgreifende Spaltung der Gemeinde erleben mußte, war es sicherlich eine glück- Hinrichtungen nach dem Bauernkrieg Die nachbenannten Heilbronner, die sich bei dem Aufruhr besonders hervorgetan hatten, wurden nach der Niederwerfung des Aufstandes mit dem Schwert gerichtet: Hans Arnold am 9. Juni 1525; Wolf Leip, Bäcker, genannt»der böse Wolf«, am 26. Oktober 1526; Caspar Rosenberger, Weingärtner, am 9. Juni 1525; Heinrich Rotheinz, Weingärtner; Christ Scherer; Job Schneider am 9. Juni 1525; Lutz Taschenmacher, genannt»taschenmännle«, altershalber sitzend; Lienhard Welner, Weingärtner; Hans Werner d. A Weingärtner, genannt»sauhänsle«, am 28. Juli Der ebenfalls zum Tode verurteilte Endris Schneck wurde zu einer Geldstrafe von 600 Gulden begnadigt. Außerdem wurden zwei Fleiner und ein Neckargartacher hingerichtet. 55
58 hafte Wendung, daß Rorbach und sein Anhang nach dem blutigen Weinsberger Osterfest den auf Heilbronn zudrängenden Bauernhaufen verlassen haben. Am Ende konnten Stadt und Bürgerschaft froh sein, glimpflich davongekommen zu sein, so daß der Bauernkrieg in den Annalen der städtischen Geschichte als ein zwar höchst bedrohliches, Furcht und Schrecken verbreitendes Szenario zu sehen ist, das freilich einschneidende, bleibende Veränderungen für das Gemeinwesen, seine Bürgerschaft und den Rat nicht hervorgebracht hat, so gefährlich es fraglos war, daß die Erregung sich nicht auf den Bauernstand beschränkte, sondern mit teils anderen Inhalten auch die Bürgerschaft ergriffen hat. Viel zu verdanken hatte der Rat Johann Lachmann, der mit zunehmendem Vertrauensgewinn eine immer einflußreichere Stellung zwischen den Parteien einnahm, dessen Rat und Verhandlungsgeschick sowohl bei der Obrigkeit als auch beim gemeinen Mann gefragt waren.»wenn die Bürgerschaft überhaupt noch auf jemand hörte, so ist er es gewesen«(rauch). Sein tatkräftiges Wirken, das allezeit und allseits auf Schadensbegrenzung ausgerichtet war, machte ihn eigentlich zum einzigen»gewinner«des Aufruhrs, wie sich bald zeigen sollte. 56
59 Das Kloster der Karmeliten vor den Mauern der Stadt entstand seit 1447 an der Stelle einer wunderbaren Erscheinung der Gottesmutter, die Kirche zu nunserer lieben Frau zur Nessel«war 1458 fertiggestellt. Kolorierte Federzeichnung in einer Abschrift der nchronik von Hall«des Georg Widmann 57
60 58 Gnadenbild nmaria von den Nesseln«aus dem Karmelitenkloster, um 1550 anstelle des verlorenen Originals gefertigt, seit 1661 im Karmelitenkloster Straubing.
61 An einen Weidenbaum gekettet, wurde Jäklein Rorbach aus Böckingen, einer der brutalsten Anführer der Bauern, 1525 bei Neckargartach verbrannt. Kolorierte Zeichnung aus Peter Harrers nbeschreibung des Bauernkriegs«,
62 60
63 Hans Riesser, seit 1528 Bürgermeister, der npolitische Kopf«der Reformation. Ausschnitt aus einem Gemälde der Augsburger Reichsversammlung (Reichstag} 1530 von Andreas Her(r}neisen im Rathaus zu Bad Windsheim aus dem Jahr Die Gesichtszüge Riessers sind sicher nicht authentisch. Tischzucht der Kinder im Hause des Heilbronner Steuerherrn und späteren Bürgermeisters Raimund Vogler. Aquarell im sogenannten nvoglerschen Gebetbuch«, 1575/76 61
64 Heilbronn, älteste erhaltene Stadtansicht aus der Zeit um Aquarellierte Federzeichnung unbekannter Autorschaft 62
65 »Hailbrvnna«, Stadtansicht aus dem Ansichtenwerk von Braun und Hagenberg, Ausgabe von Sie zeigt Heilbronn von Westen aus der Vogelperspektive unmittelbar vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges und vermittelt anschaulich die damalige Situation der Stadt am Neckar und ihrer nächsten Umgebung bis zu den Berghängen im Osten mit der»warte«(links} und dem Hochgericht (Mitte} über der Straße nach Weinsberg. 63
66
67 Bangen und Triumph Heilbronn wird und bleibt evangelisch 1525: Nach dem Bauernkrieg galt es, das zuvor begonnene Reformationswerk wieder aufzunehmen und der Vollendung zuzuführen. Lachmanns Ansehen bei seinen Mitbürgern war in den zurückliegenden gefahrvollen Wochen immens gewachsen, und so konnte er die nunmehrigen Schritte mit Zuversicht tun. Noch 1525 bekannte er sich zusammen mit anderen Predigern im schwäbisch-fränkischen Raum im sogenannten Schwä- Nach dem Bauernkrieg Weiterführung der Reformation. Schwäbisches Syngramma. 1528: Einführung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt. Heilbronner Katechismus. Hans Riesser anstelle Konrad Erers Bürgermeister. 1529: Reichstag zu Speyer: Verwerfung des Reichsabschieds von 1526; Protestationsschrift der Evangelischen, darunter Heilbronn. 1530: Reichstag zu Augsburg: Heilbronn schließt sich der Confessio Augustana an. Beide Räte schwören, in Sachen des Evangeliums beim Rat und seiner Mehrheit zu stehen; auch die Gemeinde will beim Wort Gottes bleiben. 1531: Abstellung der Messe. 1532/43: Neue Gottesdienstordnungen in Heilbronn. 1538: Beitritt zum Schmalkaldischen Bund (seit 1531 ). 1546: Kriegszug der Schmalkaldener gegen Karl V.; Heilbronn muß sich bedingungslos dem Kaiser unterwerfen. 1547: Augsburger Interim als vergleichende Bekenntnisformel. 1548: Spanisches Kriegsvolk in der Stadt. Annahme des Interims. 1552: Neue Regimentsordnung, später Maximilianische Ordnung genannt. 1555: Reichstag zu Augsburg: Religionsfriede unter gleichberechtigter Anerkennung der Augsburger Konfession. bischen Syngramma unmißverständlich zur lutherischen Abendmahlslehre, die damit hierzulande Bestand gewann. Auf dem Reichstag zu Speyer 1526 wollte der Kaiser über die Erhaltung der überkommenen kirchlichen Ordnung sowie die Durchführung des Wormser Edikts beraten lassen. Die dringend benötigte Türkenhilfe von den Reichsständen zwang ihn indessen zu dem Zugeständnis an die Evangelischen, sich bis zu einem künftigen Konzil oder einer Nationalversammlung, wo hinsichtlich der Glaubensfrage endgültig entschieden werden sollte, so zu halten, wie sie es vor Gott und dem Kaiser verantworten zu können glaubten. Damit war die Einheit der Religion vorläufig aufgegeben und den Neugläubigen Bekenntnisfreiheit eingeräumt. Seit 1527 bemühte sich Lachmann um die Einführung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt, welcher der Rat aber erst 1528 zustimmte. Am 7. Mai konnte Doel erstmals in Heilbronn das Sakrament in Brot und Wein reichen. So war die Reformation in der Stadt ein gutes Stück weitergekommen, aber es war immer noch, wie Dürr sich einmal treffend ausdrückte,»eine Zeit der Gärung ohne Klärung«. In eben diesem Jahr 1528 erschien der von Lachmann begonnene, von dem lateinischen Schulmeister Kaspar Gretter fortgeführte und vollendete Heilbronner Katechismus im Druck, der einer der ersten Katechismen der evangelischen Kirche überhaupt ist. Er. diente lange Jahre als Grundlage der Kinderlehre in der Stadt. Gretter hat den Katechismus dem Bürgermeister Hans Riesser gewidmet. Dieser war erst kurz zuvor anstelle des resignierten- Konrad Erer in dieses Amt gewählt worden und ein erklärter Freund der Reformation. Mit seiner Wahl war der Reformation in der Stadt der Sieg gesichert. Moriz von Rauch stellt daher zu Recht die Frage,»Ob Lachmann die Re- 65
68
69 Bürgermeister Konrad Erer war bis zu seiner Resignation 1528 über mehrere Jahrzehnte die führende politische Persönlichkeit im Heilbronner Rat. Die Abbildung zeigt ihn mit seiner zweiten Frau als Stifter auf der Predella des Fleiner Veitsaltars von Seine Gesichtszüge dürften authentisch sein. chen des Evangeliums beim Rat und seiner Mehrheit zu stehen und zu bleiben, Leib und Gut darein zu geben und nach bestem Vermögen zum Nutzen gemeiner Stadt zu handeln. Am 24. November erklärte auch die Gemeinde, beim Wort Gottes und dem Evangelium bleiben und in der Stunde der Gefahr zum Rat ste- Hans Riesser Der um 1490 geborene, aus einfachen Verhältnissen stammende Hans Riesser, von Beruf Sieber, war 1522 in den Rat gewählt worden und wurde 1528 an Konrad Erers Stelle Bürgermeister. Er war ein Freund Lachmanns und erklärter Anhänger des neuen Glaubens und verstand es ganz ausgezeichnet, die Reformation in Heilbronn auf der politischen Ebene durchzusetzen. Der Anschluß Heilbronns 1529 an die protestierenden Stände in Speyer oder der Beitritt der Stadt 1530 zum Augsburger Bekenntnis gingen fraglos auf seinen Aktivismus zurück. Ebenso scheint er die treibende Kraft gewesen zu sein für den Eintritt Heilbronns in den Schmalkaldischen Bund Daß der hochangesehene und kluge Mann, der wie Erer einer der hervorragendsten Köpfe dieses Gemeinwesens gewesen ist, 1552 im Zuge der kaiserlichen Neuordnung des Stadtregiments seines Amtes enthoben worden ist, muß als tragische Wende eines Lebens gesehen werden, das voll und ganz dem Nutzen und Frommen der Vaterstadt gewidmet war. Wenig später, zwischen 1552 und 1554, scheint es zu Ende gegangen zu sein. Riessers Bildnis ist auf einem Gemälde von 1601 im Rathaus zu Bad Windsheim zu sehen, das an die Übergabe der Augsburger Konfession 1530 erinnert, doch sind seine Gesichtszüge gewiß nicht wirklichkeitsnah. hen zu wollen. Der neue Glaube war gefestigt. Schon 1529 hatte Lachmann den Rat wegen Aufhebung der Messe gedrängt. Aber erst 1531 ließ dieser der noch altgläubigen Geistlichkeit auftragen, diese abzutun und dafür wöchentlich einmal»eine evangelische, biblische und christliche Predigt«zu halten. Am 8. Dezember wurde der Entschluß der versammelten Bürgerschaft mitgeteilt, worauf diese gelobte, im Falle der Verfolgung Leib und Gut einzusetzen. Mit dem Verbot der Messe war die Reformation in Heilbronn praktisch vollendet. Es war der letzte bedeutsame Schritt auf dem Weg zum evangelischen Bekenntnis. Nach dem Nürnberger Religionsfrieden 1532, der gütlichen Beilegung des Glaubensstreites, kehrte in die gespannte Situation einstweilen Ruhe ein. Die Türkengefahr hatte den Kaiser erneut zum Nachgeben gezwungen, brauchte er doch alle Stände für die enorme Türkenhilfe, die er gegen den Erzfeind der Christenheit aufwenden mußte. So erhielten die Protestanten freie Religionsausübung zugesichert bis auf das künftige Konzil. Die Reformation in Heilbronn durfte nicht auf die Pfarrkirche und die ihr zugehörigen Kapellen beschränkt bleiben, sondern es sollten auch die geistlichen 67
70 Niederlassungen dem neuen Glauben und der evangelischen Ordnung unterworfen werden. In diesem Bemühen stieß der Rat indessen auf den entschiedenen Widerstand der Ordensangehörigen. Das Karmelitenkloster ging zwar letztlich schadlos aus der Reformationszeit hervor, sein Fortbestand sollte dennoch nicht gesichert sein: Während des Dreißigjährigen Krieges, 1632, haben die Schweden aus Verteidigungsgründen die Anlage vor dem Sülmertor abbrechen lassen. In gleicher Weise schaffte der Rat es nicht, die Klaranonnen der Reformation zu unterwerfen. Dagegen hat das Barfüßerkloster die Stürme der Reformationszeit nicht überdauert. Entscheidend für das Ende des Klosters war, daß der Rat 1538 den Barfüßern die Neuaufnahme von Mönchen und Brüdern untersagte und dieses Verbot auch durchzusetzen verstand - womit er unverkennbar die Absicht verfolgte, das Kloster aussterben zu lassen. Und das ist ihm mit den Jahren in der Tat gelungen: Nach dem Tod des letzten Mönches 1544 hat die Stadt das Kloster aufgehoben. Auch alle Versuche, die Deutschordensniederlassung der Reformation zuzuführen, schlugen fehl. Als der Deutschmeister die Forderungen der Stadt zurückwies, ließ der Rat den Besuch der Gottesdienste in der Kirche des Ordens von Haus zu Haus bei Strafe verbieten. Der katholische Ritus dort blieb aber fortan unbehindert. Von den beiden Beginenkonventen in der Stadt ließ sich einer ohne ernsthaften Einspruch reformieren. Dagegen leistete der andere erbitterten Widerstand, und die Schwestern verließen schließlich die Stadt. In den vier Dörfern seines reichsstädtischen Gebiets setzte der Rat hingegen die Reformation ohne tiefgehende Reibereien durch. Die ursprüngliche Form der evangelischen Liturgie in Heilbronn war der Predigtgottesdienst. Seine Umgestaltung zur evangelischen Messe hat er erst nach der Aufhebung der katholischen Meßfeier ausgangs 1531 durch die Aufnahme seitheriger Riten in eine neue Gottesdienstordnung 1532 erfahren, wobei selbstverständlich Predigt und Abendmahl als dominierende Bestandteile erhalten blieben. Besondere Aufmerksamkeit war vor allem dem Kirchengesang gewidmet, der eine reiche Ausgestaltung erkennen läßt. Diese Ordnung hatte bis 1543 in den Heilbronner Kirchen Geltung, wurde dann stark überarbeitet und blieb in dieser Fassung bis zum Ende der Reichsstadt in Kraft. Mit dem Bekenntnis von Rat und Bürgerschaft zum Evangelium 1530 hatte man in Heilbronn eine Entscheidung für die Zukunft getroffen, deren Sicherung unendliche Mühen erfordern und das Gemeinwesen an den Rand des Ruins führen sollte. Nach dem Augsburger Reichsabschied drohten den evangelischen Ständen nämlich unabwendbar kaiserliche Gewaltmaßnahmen. Die Einheit des Glaubens konnte jetzt nur noch mit Waffengewalt wiederhergestellt werden. Darüber durfte auch der Nürnberger Religionsfriede von 1532 nicht hinwegtäuschen. Zur Verteidigung der evangeli- Der Heilbronner Rat bekannte sich am 18. November 1530 mit Leib und Leben zum Evangelium.
71 sehen Sache schlossen sich daher 1531 mehrere Fürsten sowie Reichsstädte im Schmalkaldischen Bund zusammen. Heilbronn, das aus Gehorsam gegen den Kaiser in der Bündnisfrage zurückhaltend gewesen war, trat erst 1538 dem Bund bei. Die Gegensätze zwischen den beiden Bekenntnissen spitzten sich gerade in diesem Jahr gefährlich zu, und Heilbronn mußte immer deutlicher erkennen, daß ein Waffengang gegen den Kaiser nur eine Frage der Zeit sein konnte. Als Karl in dem erbitterten Ringen mit den Feinden des Reiches die Hände endlich freibekam, drängte es ihn, das Glaubensproblem in Angriff zu nehmen. Seit 1546 galt es auch für Heilbronn, Kriegsrüstung zu betreiben. Mitte des Jahres zogen Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen gegen den Kaiser. Als Karl die Oberhand gewann, geriet Heilbronn in äußerste Sorge. In aller Eile traf man Verteidigungsmaßnahmen. Da fiel Herzog Moritz von Sachsen im benachbarten Kursachsen ein und zwang damit den Kurfürsten zur ungesäumten Heimkehr. Mit dem Abzug des sächsisch-hessischen Heeres aber wurden die oberdeutschen Einungsverwandten schutzlos ihrem Schicksal überlassen und mußten sich auf Gnade und Ungnade dem Kaiser ergeben. Die Sache war ja verloren, Widerstand hätte nur nutzloses Blutvergießen bedeutet. So sah sich auch Heilbronn vor die bittere Tatsache gestellt, sich dem Kaiser zu unterwerfen. Und es war Eile geboten, bekam man doch zu hören, der Kaiser wolle mit seinen Spaniern hier aufziehen und»übel haushalten«. Am 14. Dezember 1546 übergab die Heilbronner Gesandtschaft in Rothenburg ob der Tauber ihre Stadt bedingungslos und erlangte für sie nach einem symbolisch für die gesamte Bürgerschaft ausgeführten Kniefall Gnade. An Heiligabend 1546 zog der Kaiser in Heilbronn ein, am 18. Januar ließ er sich von der Bürgerschaft sowie dem Rat huldigen und schwören. Daß die Stadt nach diesem gefährlichen Waffengang glimpfliche Behandlung erfahren hat, verdankte sie nicht zuletzt dem diplomatischen Geschick ihres Stadtschreibers und Syndikus Gregor Kugler, einem ihrer fähigsten politischen Köpfe. Unangefochtener Sieger des Schmalkaldischen Krieges war der Kaiser. Als solcher trat er 1547 auch auf dem Reichstag zu Augsburg auf, der als der»geharnischte«in die Geschichte eingegangen ist. Um die dem Protestantismus anhängenden Stände zum Gehorsam gegen die Kirche zurückzuführen, hatte er spanische Soldateska nach Deutschland gebracht, die er nun in den evangelischen Städten einquartierte. Mit dieser Form der Strafgarnisonen wollte er die widerspenstigen Neugläubigen gefügig machen. Und das spanische Kriegsvolk wußte sehr wohl, welche Erwartungen ihm zukamen. Solcher Einquartierung zuvorzukommen, scheute der Heilbronner Rat zwar keine diplomatischen Wege und keine»handsalben«, aber es war doch alles umsonst: Am 7. März 1548 zogen acht Fähnlein spanisches Kriegsvolk in Heilbronn ein, vier wurden in die umliegenden Dörfer gelegt. Die spanische Garnison lastete schwer auf der Stadt. Belästigungen und Gewalttätigkeiten nahmen ständig zu, und mancher zog es vor, Haus und Gemeinwesen zu verlassen. Der Rat schickte eine Gesandtschaft an den Kaiser und forderte sie in verzweifelten Briefen zu unablässigem Handeln auf, um ja das Kriegsvolk loszuwerden, freilich ohne Erfolg. So hat der Kaiser endlich den mit der Einquartierung verfolgten Zweck erreicht: Die Stadt wurde mürbe, das Interim anzunehmen. Auf dem erwähnten»geharnischten Reichstag«hatte der Kaiser noch einmal seine Entschlossenheit bekräftigt, den Zwiespalt in der Religion als die primäre Ursache allen Übels und Unglücks des deutschen Volkes rasch zum Austrag zu bringen. Als die Verhandlungen zu keinem Ergebnis führten, überließ man ihm schließlich die Aufrichtung eines von beiden Religionsparteien zu haltenden Interimsstandes bis zur endgültigen Ordnung des Religionswesens durch das Konzil. Mitte Mai 1548 lag als vergleichende Bekenntnisformel das Augsburger Interim vor, das jedoch im Sinne der katholischen Lehre gehalten war und nur den Laienkelch erlaubte sowie bereits geschlossene Priesterehen akzeptierte. Mit der kaiserlichen Aufforderung, das Interim umgehend anzunehmen, ging dessen Wortlaut auch dem Heilbronner 69
72 Rat zu. Was sollte man tun? Der Rat war unschlüssig, wollte nicht übereilt handeln. Konnte man aus Gewissensgründen überhaupt zustimmen? Jedenfalls besaß der Kaiser dank seines spanischen Kriegsvolkes die Macht, das Interim durchzusetzen. Die Welschen lagen ja noch immer in der Stadt, und die Drangsale der spanischen Züchtigung standen einem täglich aufs neue erschreckend vor Augen. Wollte man das Kriegsvolk loswerden, mußte man wohl oder übel das Interim annehmen. Der Kaiser, so hieß es, werde das spanische Kriegsvolk erst aus der Stadt nehmen, wenn der Rat dem Interim glaubhaft nachkomme. Das war nun in der Tat deutlich genug. Der Rat forderte seinen Prediger, seit dem Tod Lachmanns Menrad Molther, und Bürgermeister Hans Riesser zu Stellungnahmen auf, und als beide unter den gegebenen Umständen der kaiserlichen Forderung nachzukommen empfahlen und Kugler ebenfalls in diesem Sinne aus Augsburg schrieb, nahm er am 5. Juni 1548 das Interim an. Daraufhin erhielt das spanische Kontingent in Heilbronn am 18. Juni den Befehl zur Umquartierung nach Hall. Aber erst am 2. Juli verließen die letzten dieser barbarischen Kriegsknechte die Stadt. Ohne Zögern ging der Rat an die Durchführung des Interims, wobei er aus Furcht vor weiteren kaiserlichen Strafmaßnahmen teilweise unglaubliche Härte zeigte. Unter Androhung schwerer Strafe verbot er, mit Worten oder Werken dagegen zu handeln. langwierig gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Meßpriester, der dem Interim nachkommen wollte, da die ortsanwesenden evangelischen Geistlichen dem Rat den Gehorsam verweigerten. Ein vom Kirchherrn in Würzburg geschickter neuer Pfarrverweser wollte zwar Messe lesen, aber nicht das Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichen. So herrschten in der Stadt zeitweise recht chaotische Verhältnisse. Von einschneidender Bedeutung für die Stadt war die vom Kaiser betriebene Verfassungsänderung. Karl V. besaß nach dem Sieg über die Schmalkaldener eine unglaubliche Machtfülle, aus der heraus er im Rahmen seines ausgreifenden Restaurationsvorhabens zur Beseitigung jener»elemente«schritt, die der Reformation Vorschub geleistet hatten, indem er die in den süddeutschen Städten seit dem 14. Jahrhundert eingeführten paritätischen Stadtverfassungen aufheben und durch aristokratische Regimentsordnungen ersetzen ließ. Damit eliminierte er die Handwerke, die an der reformatorischen Bewegung großen Anteil hatten, für die Zukunft vom politischen Leben. In Heilbronn erschien die mit diesem Vorhaben betraute kaiserliche Kommission ausgangs Die aus dem Jahre stammende Regimentsordnung, nach der Patriziat und Gemeinde gemeinsam den Rat gebildet hatten, wurde mit der Begründung abgetan, daß sie nicht gehalten und viele Personen (gemeint war: aus den Handwerken) in den Rat gezogen worden seien, die nur Ungemach verursacht und im Unverstand Neues (nämlich die Reformation) geschaffen hätten. Die seitherigen Ratsfreunde wurden entlassen, so auch der Die Regimentsordnung von 1552 Die neue Ordnung bestimmte anstelle des bisherigen Rats drei neue Gremien: 1. Der innere oder kleine Rat, auch nur Rat genannt, war der Träger der städtischen Regierung und Verwaltung. Ihm gehörten 15 Mitglieder an, von denen drei Bürgermeister waren, die sich im Vorsitz des Kollegiums sowie der Führung der laufenden Amtsgeschäfte abwechselten. Zusammen mit den zwei dienstältesten Ratsherren bildeten sie den "Geheimen Rat«, der dringende und geheime Angelegenheiten von sich aus erledigen durfte. Außerdem wurden aus der Mitte des Gremiums vier Steuerherren bestellt. Das Kollegium wählte und ergänzte sich jährlich oder nach Bedarf selbst. Was der Rat mit Mehrheit beschloß, war gemeiner Beschluß. 2. Vom Rat getrennt war nunmehr das Gericht, dem allerdings nur die Zivilgerichtsbarkeit oblag, während die Kriminalgerichtsbarkeit dem Rat zukam. Dem Gericht gehörten der Schultheiß als Vorsitzender und zwölf Richter an. Es wurde vom Rat ergänzt und gleichfalls jährlich gewählt. Vom Stadtgericht war eine Appellation nur an die Reichsgerichte möglich. 3. Der äußere oder große Rat war ohne politische Funktion und wurde lediglich zu wichtigeren. Beratungen hinzugezogen. Ihm gehörten 13 Mitglieder an, deren Wahl und Ergänzung ebenfalls der Rat besorgte. In das Kollegium sollten nur Angehörige der "Gemeinde«Aufnahme finden. Die Neuwahl und Ergänzung erfolgte zu Anfang jeden Jahres. Am»Schwörtag«, dem Dreikönigstag, versammelte sich _dann die gesamte Bürgerschaft auf dem Marktplatz, wo ihr die bürgerliche Ordnung vorgelesen und der»eid der Gehorsame«abgefordert wurden. 70
73 Johann Lachmann Der nachmalige Heilbronner Reformator Johann Lachmann war ein Sohn des Glocken- und Geschützgießers Bernhard Lachmann d.ä. und 1491 in Heilbronn geboren bezog er die Universität Heidelberg, 1507 wurde er dort Bakkalaureus, 1508 Magister der Künste. Danach wandte er sich der Rechtswissenschaft zu und wurde 1509 Bakkalaureus beider Rechte erhielt Lachmann vom Kirchherrn in Würzburg die Pfarrverweserschaft an der Pfarrkirche seiner Vaterstadt übertragen. In demselben Jahr empfing er die höheren Weihen betraute ihn der Rat mit dem Predigeramt, worauf der ebenfalls aus Heilbronn stammende Magister Peter Dietz Pfarrverweser wurde (bis 1536 im Amt). Kurz darauf erwarb Lachmann in Heidelberg das Lizentiat beider Rechte und das Doktorat. In dem vom Kirchherrn unabhängigen Predigeramt näherte sich Lachmann rasch der lutherischen Lehre. Spätestens seit 1524 predigte er das Evangelium, doch umsetzen konnte er seine reformatorischen Bestrebungen erst nach dem Bauernkrieg bis 1531, als mit der Abschaffung der Messe der letzte Schritt zum evangelischen Glauben getan wurde. Gestorben ist Johann Lachmann, der seit 1526 mit Barbara Wißbronn verheiratet gewesen ist, in den ersten Tagen des Jahres Sein Bildnis ist in der Habakuk-Figur des Käthchenhauserkers auf die Nachwelt gekommen. Jedenfalls ist bekannt, daß Lachmann um 1530 unter Zugrundelegung des Propheten Habakuk gepredigt hat. Lachmanns Predigerstelle wurde nach seinem Tod dem Geistlichen Menrad Molther verliehen, der seit ca hier tätig war, seit 1535 als zweiter Prediger. um die Stadt hochverdiente Bürgermeister Hans Riesser, die neugeschaffenen Gremien, nach ihrer Zusammensetzung und Abhängigkeit völlig neue Einrichtungen, anders besetzt. Die neue Verfassung trat mit der Eidesleistung dieser Kollegien am 12./13. Januar 1552 in Kraft und wurde am 22. Januar der Bürgerschaft verkündet. Mit der Einführung der neuen Regimentsordnung zugleich aufgehoben wurden die Handwerksgesellschaften. Diese Karolinische Ordnung erfuhr in späterer Zeit noch einige Ergänzungen und genauere Bestimmungen, so 1566 durch Kaiser Maximilian II., nach dem sie schließlich als Maximilianische Ordnung bezeichnet wurde, vor allem aber durch den Ferdinandischen Rezeß In dieser letzten Form hatte die Ordnung bis zum Ende der Reichsstadtzeit 1802 Gültigkeit. Als Karl V. sich mit seinen Restaurationsvorhaben Interim und Verfassungsänderung eben am Ziel seiner Vorstellungen sah, erfolgte 1552 unerwartet der Gegenschlag seiner Widersacher, die sich gegen die Gewalt und Übermacht des Kaisers in dem von Moritz von Sachsen angeführten Norddeutschen Fürstenbund zusammengefunden hatten. Im sogenannten Fürstenkrieg wurde neben der machtpolitischen auch insbesondere die religiöse Weichenstellung für die Zukunft gesucht. Gerade darauf wiesen die Verbündeten hin, als sie Heilbronn zum Anschluß aufforderten, daß sie den Krieg nämlich zum Schutze der deutschen Reichsfreiheit, die sie durch die beabsichtigte Änderung der Reichsverfassung bedroht sahen, und zur Erhaltung des evangelischen Bekenntnisses führten. Schließlich mußte die Stadt, nachdem man sie massiv mit Kriegsvölkern bedroht hatte, zum Eintritt in den Bund sich verstehen. Als das bündische Heer vor Innsbruck aufmarschierte, floh der Kaiser aus der Stadt, und der Krieg nahm ein schnelles Ende. Im Passauer Vertrag sicherten danach beide Seiten zu, bis zum nächsten Reichstag jede Gewaltanwendung in Religionsfragen zu unterlassen. Mit dem Zugeständnis der Religionsfreiheit fiel zugleich das Interim. Auf dem Reichstag zu Augsburg 1555 kam dann endlich der so lange ersehnte Religions- und Landfriede zustande. Er stellte die Anhänger der Augsburger Konfession reichsrechtlich den Katholiken gleich und gestand den Reichsstädten das Recht zu, für ihr Gebiet die Glaubens- und Kirchenordnung selber aufzurichten. Mit dem Augsburger Religionsfrieden wurden somit zwei nebeneinander bestehende Konfessionen anerkannt: die römisch-katholische und die augsburgisch-evangelische. Das Ziel früherer Reichstage, die Glaubensspaltung rückgängig zu machen und die Glaubenseinheit zu erhalten, wurde aufgegeben. Damit war auch für Heilbronn das evangelische Bekenntnis endgültig gesichert, zu dem sich die Bevölkerung der Stadt bis zum Ende der reichsstädtischen Selbständigkeit 1802 ausschließlich bekannte. Die Reformation in Heilbronn war das Lebenswerk'Johann Lachmanns, der sie ohne Hast Schritt für Schritt durchzuführen verstanden hat. Er sollte ihre Vollendung nicht lange überleben. Wahrscheinlich zu Anfang des Jahres 1539 ist sein Leben erloschen. Von tiefster. Got- 71
74 tesfurcht beseelt, galt sein unermüdliches Wirken der Wahrheit des Evangeliums. Das Wort Gottes war ihm Lebensinhalt und Aufgabe zugleich. Wenn Moriz von Rauch sagt, Lachmanns Gestalt stehe in der Heilbronner Reformationsgeschichte»Um so größer da, als unter den damaligen Geistlichen weder auf der neugläubigen noch auf der altgläubigen Seite ein ihm auch nur einigermaßen Ebenbürtiger vorhanden war«, so ist das fraglos richtig. Daß er in dem Bürgermeister Hans Riesser einen im Zentrum des städtischen Regiments agierenden klugen Mitstreiter hatte, tut seinem Werk gewiß keinen Abbruch. Im Propheten Habakuk am Erker des Käthchenhauses glaubt die neuere Stadtgeschichtsforschung das Portrait des Reformators sehen zu dürfen. Die zweieinhalb Jahrzehnte nach dem Augsburger Reichsabschied von 1530 waren für die Reichsstadt Heilbronn mit vielen Gefahren verbunden, die teils schadlos an ihr vorübergegangen sind, ihr teilweise aber auch beträchtlich zugesetzt haben. Vor allem der verlorene Krieg gegen den Kaiser und die Strafgarnison des spanischen Kriegsvolkes stürzten sie in höchste Not. Daß sie in dieser aussichtslos erscheinenden, verzweifelten Situation sich zur Annahme des Interims entschloß, war die einzig richtige Entscheidung. Im übrigen hoffte man, den evangelischen Glauben in eine bessere Zeit hinüberretten zu können. Der Rat durfte das Wohl seiner Bürger jedenfalls nicht hintenanstellen. Daß das vielfach gewaltig schwankende»schifflein«gemeinwesen in den stürmischen Wellen dieser Zeit nicht untergegangen ist, verdankte es neben anderen fähigen Köpfen in erster Linie seinem Bürgermeister Hans Riesser, der über ein Vierteljahrhundert hinweg, in einem der bedeutendsten Zeitabschnitte der deutschen Geschichte, die Geschicke seiner Vaterstadt entscheidend mitbestimmt hat und in vieler Hinsicht die treibende Kraft und der sichere Navigator gewesen ist. In der Gestalt des Propheten Habakuk am Erker des Käthchenhauses sieht die Heilbronner Stadtgeschichtsforschung den Reformator Johann Lachmann ( ). Das Relief entstand
75 Der Kriegsfurie ausgeliefert Heilbronns Geschicke bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 1608: Auch nach 1555 währten auf protestantischer Seite die Bemühungen um die Einheitlichkeit der Lehre in den lutherischen Territorialkirchen fort. Die Uneinigkeit der evangelischen Konfessionsverwandten war nach wie vor groß, und auch die nochmalige genaue F eststellung der Augustana 1561, des Augsburger Bekenntnisses von 1530, brachte nicht die innerprotestantische Verständigung. Erst vermochten die Lehrvereinigungsbemühungen den konfessionellen Streit zu beenden. Der Konkordienformel schlossen sich die meisten evangelischen Stände an, Heilbronn leistete die Unterschrift. Mit dem Regierungsantritt des auf Ausgleich bedachten Kaisers Maximilian II kehrte in der Religionsfrage wohltuende Ruhe ein. Das änderte sich, als der protestantenfeindlich gesinnte Ru- Gründung der Union als Defensionsbündnis zum Schutz der evangelischen Sache; Beitritt Heilbronns : Beginn des Dreißigjährigen Krieges. 1622: Schlacht bei Wimpfen; die heilbronnischen Dörfer links des Neckars schwer in Mitleidenschaft gezogen. 1632: Die Schweden besetzen die Stadt. 1633: Heilbronner Konvent der evangelischen Stände, schwedisch-süddeutsches Bündnis (Heilbronner Bund). 1634: Schlacht bei Nördlingen; Belagerung, Beschießung und Einnahme Heilbronns durch die Kaiserlichen. 1648: Westfälischer Friede, Ende des Dreißigjährigen Krieges. 1652: Abzug der letzten Besatzung aus der Stadt. 1688: Heilbronn im Pfälzischen Erbfolgekrieg von Franzosen besetzt. dolf II an die Regierung kam. Gegen die katholisch-habsburgischen Interessen, die er verfolgte, mußten die protestantischen Fürsten schon bald näher zusammenrücken. Der Überfall Bayerns auf die Reichsstadt Donauwörth führte 1608 zur Gründung der Union, eines Defensionsbündnisses zum Schutz der evangelischen Sache, worauf die Gegenseite die katholische Liga ins Leben rief, so daß jetzt zwei gefährliche Machtblökke einander gegenüberstanden. Heilbronn trat der Union unter schweren Bedenken 1609 bei. Bis 1613 schlossen sich ihr auch Frankreich, England und die Generalstaaten, also die ständische Vertretung der in der Republik der Vereinigten Niederlande zusammengeschlossenen nördlichen Provinzen, an tagte sie erstmals in Heilbronn, weitere Unionstage hier folgten. Das Bündnis spielte also in der Geschichte der Stadt eine wesentliche Rolle. Besonders enttäuscht sahen sich ihre Mitglieder von Kaiser Matthias, dessen Wahl 1612 sie gefördert hatten, führte er doch den erhofften Ausgleich zwischen den Religionsparteien nicht herbei. Seinen Befehl, das Bündnis aufzulösen, ignorierten sie. Am 26. Mai 1618 läutete dann der Prager Fenstersturz gewissermaßen den Dreißigjährigen Krieg ein, der rasch eine europäische Dimension gewinnen sollte. Im Jahre 1619 wurde Kurfürst F riedrich von der Pfalz zum König von Böhmen gewählt, verlor die Krone aber schon im Jahr darauf, als er, von der Union im Stich gelassen, in der Schlacht am Weißen Berg dem Heer der Liga unterlag wurde er, der von Anfang an eifriger Betreiber der Union gewesen war, in die Acht erklärt, worauf sich die Einungsverwandten von ihm lossagen mußten. Schon zuvor hatte Heilbronn die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser wäre, die Union einzustellen, weil es»noch Zeit«73
76 sei. Und in der Tat waren 1620 die Feindseligkeiten zwischen den beiden Bündnissen dem Ausbruch nahe gewesen versammelten sich die Unionsmitglieder noch einmal in Heilbronn, aber nur, um unter gegenseitigen Schuldzuweisungen den Bund für aufgelöst zu erklären. Das Unionsheer wurde abgedankt. Wegen ihrer bisherigen treuen Anhänglichkeit an das Bündnis fürchtete die Stadt kaiserliche Maßregeln. Die Sorge in Heilbronn wuchs mit dem Näherrücken der Kriegshandlungen, die 1622 Wimpfen erreichten. Bei Obereisesheim wurde am 6. Mai zwischen dem ligistischen Heer unter Tilly und dem des Markgrafen von Baden die erste große Feldschlacht dieses Krieges Darstellung der Schlacht bei Wimpfen am 6. Mai Kupferstich in Matthäus Merians "Theatrum Europaeum«(Bd. 1, Frankfurt a. M. 1635). Im Mittelpunkt des Bildes wird die große Pulverexplosion gezeigt, links oben das brennende Dorf Neckargartach. Die Pulverexplosion während der Schlacht bei Wimpfen Die Schlacht bei Wimpfen am 6. Mai 1622 ist durch eine Pulverexplosion in der Wagenburg des Markgrafen von Baden zu diesem Zeitpunkt unerwartet entschieden worden. Über das ohrenbetäubende Ereignis ist im»theatrum Europäum", Bd. 1, S. 720, zu lesen: ". weil vnder dem strengsten Treffen durch einen Schuß auß einem groben Geschütz 5 Wägen mit Pulffer im Marggräffischen Läger angezündet worden, dardurch ein schrecklicher Schaden geschehen, also daß das Pulffer auff zween Morgen Ackers im Vmbkreyß Menschen, Vieh vnd Wägen in die Lufft gesprenget, versengt vnd verbrennet, so ein jämmerliche Lücken in die Schlachtordnung vnd Wagenburg gemacht, daß also eins zum andern geholffen, daß die Marggräffische Armada gantz zerschlagen vnd in die Flucht gejagt worden." 74
77 geschlagen. Entscheidend für den Ausgang des Treffens war wohl vor allem eine Pulverexplosion in der Wagenburg des Markgrafen, die eine allgemeine Flucht seiner Truppen über Neckargartach in Richtung Heilbronn auslöste. Die Stadt wahrte jedoch strikte Neutralität und hielt ihre Tore geschlossen. Bei der Verfolgung der Davoneilenden verübte Tillys rohe Soldateska unmenschliche Grausamkeiten, nicht zuletzt auch unter den wehrlosen Landbewohnern. In Neckargartach spielten sich entsetzliche Schreckensszenen ab. Das Dorf wurde geplündert und niedergebrannt. Ausgeraubt wurden auch Frankenbach und Böckingen. Es war das erste Mal in diesem Krieg, daß das Heilbronner Gebiet in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im Jahre 1630 landete König Gustav Adolf von Schweden in Deutschland, um, wie er sagte, die evangelisch-christliche Religion zu retten (wenngleich auch machtpolitische Gründe bei ihm mitspielten), betrieben die katholischen Mächte doch seit geraumer Zeit die kirchliche Gegenreformation. Kaiser Ferdinand hatte zudem mit dem Restitutionsedikt 1629 den Augsburger Religionsfrieden praktisch außer Kraft gesetzt schlossen sich die evangelischen Stände zu einem Verteidigungsbund zusammen, und Untaten in Neckargartach nach der Schlacht Nach der Schlacht bei Wimpfen haben die Spanier das heilbronnische Dorf Neckargartach in Brand gesteckt und die Bevölkerung unmenschlich traktiert und zu Tode gebracht. Das Ratsmitglied Johann Philipp Orth hat den Verlauf der Schlacht und die folgenden Ereignisse 1631 anhand von Aktenmaterial und Zeugenaussagen zu Papier gebracht, Gmelin diese Niederschrift 1880 publiziert. Über die von den Welschen in Neckargartach verübten Greueltaten schreibt Orth u.a. (zitiert nach Gmelin, S. 86):»Vnd als etliche personen. leschens halb nach Neckhergartach gelaufen, seind sie von den Spaniern erbarmlicher weis niedergehawen, jemerlichen zermartert vnd zerstuckt worden,. zwei junge mägdlein, als Wendel Gartachs wittib vnd Wolf Wöbers wittib haben die soldaten genotzwengt, überaus große vnzucht mit ihnen getrieben, vnd als sie ihren teufelischen mutwillen an ihnen verübt vnd sie ganz jämerlich geschendet, haben sie selbige vf die kopf gestelt, die bayn von einander gezörret vnd also in der mitten von einander gespalten vnd gehawen; also nachdem sie zuvor solche weibsleit vmb ihr ehr gepracht, genotzwengt vnd geschendet, ihnen tyrannischer, vnbarmherziger, teufelischer weis das leben mörderisch genohmen vnd solche vnmenschliche that gegen denen verübt, welche ihnen zeit ihres lebens kein leid gethan." die protestantischen Stände Schwabens berieten über die Aufnahme kriegerischer Handlungen. Die strategische Wichtigkeit der Stadt veranlaßte ausgangs 1631 die Schweden, vor Heilbronn zu rücken und die Übergabe zu fordern. Am 2. Januar 1632, nach Abzug der seit 1629 hier gelegenen kaiserlichen Besatzung, marschierten sie ein. Aber es war mühsam gewesen, den seitherigen Kommandanten zum Akkord (Ubereinkommen mit dem Gegner) zu bewegen. Die Stadt behaupten zu wollen, wäre schlichtweg unmöglich gewesen und hätte das Gemeinwesen in den Ruin geführt. In demselben Jahr schenkte der schwedische König Heilbronn den Deutschhof und den Kaisheimer Hof mit allem Zubehör und allen ihren Dorfschaften sowie das Karmeliten- und das Klarakloster mitsamt ihren Gütern. Doch brachen die Schweden das außerhalb der Mauern im Verteidigungsbereich der Stadt gelegene Karmelitenkloster ab. Nach dem Tod König Gustav Adolfs in der Schlacht bei Lützen 1632 schrieb sein Kanzler Axel Oxenstierna, der die schwedische Politik weiterführte und die Kriegsführung auf protestantischer Seite bestimmte, in der Absicht, die Glaubensgenossen in einem schlagkräftigen Bündnis zu vereinen, auf den 11. März 1633 einen Konvent nach Heilbronn aus, an dem neben den Gesandten der evangelischen Stände der vier oberschwäbischen Kreise auch Vertreter Frankreichs, Englands, Hollands und Dänemarks teilnahmen. Im Heilbronner Bund, einem schwedisch-süddeutschen Bündnis, verpflichteten sich die Konföderierten u.a getreu zusammenzuhalten, bis die deutsche Freiheit wiedererlangt und in Religions- und Profansachen Friede geschlossen sei. Kein Bündnismitglied sollte ohne Wissen und Willen der anderen mit dem Feind unterhandeln. Das zwischen Schweden und Frankreich bestehende Bündnis wurde erneuert. Am 6. September 1634 erlitt die weimarisch-schwedische Armee bei Nördlingen eine empfindliche Niederlage, worauf die Kaiserlichen gegen Heilbronn vorrückten, dessen schwedische Garnison die Stadt in Verteidigungszustand versetzte, auch Baulichkeiten vor den Mauern beseitigen ließ. Die Belagerer 75
78 brannten zunächst Böckingen nieder, dann begannen sie mit der Beschießung der Stadt und legten zwischen Götzenturm und Fleiner Tor zahlreiche Gebäude in Schutt und Asche. Darauf ließen die Schweden sich zum Abzug überreden. Eine Ratsabordnung erlangte nach einem Fußfall vor König Ferdinand Gnade für die Bürgerschaft, doch wurden ihr für unterlassene Plünderung und Anzündung Reichstaler abverlangt. Die schwedischen Schenkungen wurden rückgängig gemacht. Für ein paar Jahre hatte danach der Krieg, der inzwischen in eine Phase grauenvoller Unmenschlichkeiten eingetreten war, in anderen Gegenden des Reiches gespielt kehrte er an den Neckar zurück. Gefährlich wurde es 1645, als eine starke französische Armee wegen des günstigen Neckarübergangs hier gegen Heilbronn vorrückte und die Öffnung der Stadt zu erzwingen suchte. Eine förmliche Belagerung und Beschießung scheint allerdings nicht stattgefunden zu haben. Noch einmal 1646 unternahmen die vereinten Franzosen und Schweden vom Main aus einen Vorstoß nach Süddeutschland. Das benachbarte Wimpfen wurde überfallen, und auch in der Gegend von Heilbronn hat die Soldateska sich herumgetrieben, ohne jedoch die Stadt anzugreifen. Dafür setzte sie den Heilbronner Stadtwald in Brand. Dies war die letzte kriegerische Unternehmung in diesem dreißigjährigen Ringen, durch die Heilbronn in Mitleidenschaft geriet. Am 24. Oktober 1648 wurde zu Münster endlich der lang- und heißersehnte Westfälische Friede geschlossen, um den schon seit mehreren Jahren gerungen worden war. Für Heilbronn hieß dies: weiterhin Religionsfreiheit, Bestätigung der altüberkommenen Rechte und Freiheiten und Wahrung des Besitzes der Stadt nach dem Stand von Am 15. November feierte man dieses denkwürdige Ereignis mit einem festlichen Gottesdienst und anderen Freudenbekundungeri. Ihre Besatzer wurde indessen die Stadt noch nicht los, und es ging ihr damals zeitweise schlimmer als während des Krieges. Seit lagen hier französische Soldaten, welche die Bevölkerung unsagbar quälten und in einem fort Gelder erpreßten. Und aus Nürnberg hör- te man, es gewinne immer mehr den Anschein, als wollten die Franzosen Heilbronn dauernd behalten. Als sie 1650 abzogen, rückten für weitere zwei Jahre Kurpfälzer ein, und erst als sie 1652 die Stadt verließen, war diese nach vielen notvollen Jahren endlich wieder frei. Am 16. Mai wurde ein solennes Dankfest begangen. Von hielt sich fast ununterbrochen Militär in der Stadt auf. Die Stärke der Besatzung bewegte sich zwischen 300 und über 1200 Mann;»Wozu aber gewöhnlich noch ein starker Troß mitziehenden und mitfressenden Volks kam«(dürr), und mancher Bürger verzweifelte unter den fortwährenden harten Lasten, welche die Einquartierungen. mit sich brachten. Von hellem Zorn erfüllt über die finanziell vermöglichere Obrigkeit, die von der Quartierlast befreit war, führte die Bürgerschaft 1650 Klage beim Kaiser gegen den Rat. Nach der Schlacht bei Nördlingen zogen die Kaiserlichen vor Heilbronn und beschossen die Stadt vom Rosenberg aus, wobei zahlreiche Gebäude in Schutt und Asche gelegt wurden. Der Ausschnitt aus der Stadtansicht von Johann Sigmund Schlehenried von 1658 zeigt das Ausmaß der Zerstörung zwischen Fleiner Tor (oben} und Götzenturm. 76
79 Heilbronn berechnete seine Kriegsausgaben an barem Geld für die Jahre auf Gulden -eine immense Summe, welche die Stadt aus eigenen Mitteln nicht aufzubringen vermochte, sondern im wesentlichen über Schuldaufnahmen finanzieren mußte. Ein Silberanlehen bei der Bürgerschaft 1631 im Wert von Gulden nimmt sich in dieser Summe nur als ein kleiner Posten aus, spricht aber für Gemeinsinn in der Not. Noch Jahrzehnte später lastete die Bürde der Schulden schmerzlich auf dem Gemeinwesen und seiner Bürgerschaft. Nicht in dem genannten Betrag enthalten waren alle anderen Aufwendungen, die der Krieg der Stadt abverlangt hatte (z.b. die Ausgaben für die Befestigung und Verschanzung der Stadt, für Fuhrleistungen, Verehrungen, Spesen und manches andere mehr) und die sich ebenso gewaltig summieren würden. Vor dem Ausbruch des Krieges waren die finanziellen Verhältnisse Heilbronns noch immer vorteilhaft gewesen, obgleich sich die wirtschaftliche Lage der Stadt seit der Mitte des 16. Jahrhunderts merklich verschlechtert hatte, am Ende war sie ausgeblutet, die Bürgerschaft in erschrekkende Armut gefallen. Von Seuchen heimgesucht Heilbronn wurde im 16. und 17. Jahrhundert mehrfach von der Pest und anderen gefährlichen Seuchen heimgesucht, was bei dem damaligen Stand der Heilkunst für viele Kranke den sicheren Tod bedeutete. Die angepriesenen Allheilmittel halfen nichts oder wenig. Allein eine Verbesserung der hygienischen Verhältnisse wäre von Nutzen gewesen war der Kirchhof bei St. Kilian einer derartigen Epidemie wegen so ergraben, daß das gemeine Volk bei St. Nikolaus bestattet werden mußte sollen an der Pest Personen gestorben sein. Als 1606/07 erneut die Pest ausbrach, ergriff man endlich Maßnahmen gegen die Unsauberkeit. Von 1622 an zog sich eine pestartige Seuche über mehrere Jahre hin und forderte angeblich 3018 Menschenleben, darunter 1407 Kinder sollen an der erneut ausgebrochenen Pest 1609 Personen, gestorben sein, weshalb der Friedhof an der Weinsberger Straße vergrößert werden mußte. Daß die überlieferten Zahlen richtig sind, wurde immer wieder angezweifelt. Daß aber eine sehr hohe Sterblichkeit in diesen Jahren zu verzeichnen war steht außer Frage. Als der Rat nach der Heimsuchung die schul '. pflichtige Jugend (5-16 Jahre alt) feststellen ließ, zählte man gerade noch 97 Mädchen und 138 Knaben. Auf die zahlreichen Seuchen mit ihrer hohen Sterberate ist es zurückzuführen, daß die Bevölkerungszahl Heilbronns zu Anfang des Dreißigjährigen Krieges nicht höher war als an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Auch der Verlust an Menschenleben war groß. Es war ja nicht nur die Kriegsfurie, der die Leute zum Opfer fielen, sondern vor allem deren Verbündete Not und Seuchen, die an dem Massenverderben Schuld trugen. Enormer Teuerung und Hungersnot folgte erstmals 1626 die Pest, ein zweites Mal 1635/36, und bei beiden Ausbrüchen waren viele Tote zu beklagen. Dürr geht von einer Einwohnerzahl von mindestens zu Beginn des Krieges aus, 1648 lebten zwischen Personen in der Stadt. Die Einwohnerzahl war also um wenigstens 2000 Seelen zurückgegangen. Die Bevölkerung der Dörfer war um ca. 2/3 der ursprünglichen Zahl dezimiert und zählte zusammen nur noch 580 Köpfe. Während des Krieges hatten sich in der beengten Stadt weitere Flüchtlinge und schutzsuchende Personen zusammengefunden, vor allem Landvolk, was zu einer ungeheueren Zusammenballung der Menschen führte, aber auch zu weitgehender Brachlage der nicht mehr bebauten, zum Teil auch verwüsteten Ackerflur, die nach dem Krieg erst mühsam wieder rekultiviert werden mußte. Da sich, wie erwähnt, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt in den letzten Dezennien vor dem Ausbruch des großen Krieges stetig verschlechtert hatten, traf dieser kein blühendes Gemeinwesen mehr (Riedle). Er löste also keinesfalls den wirtschaftlichen Niedergang Heilbronns aus, beschleunigte ihn vielmehr nur. Der bedeutendste Handelszweig Heilbronns war seit Jahrhunderten die Weinausfuhr. Zwar besuchten die Heilbronner Kaufleute mit diversen anderen Gütern regelmäßig die Frankfurter Messen, und auch der Güterverkehr nach Nürnberg war stets rege, beherrschend aber war nach wie yor der Weinexport. Freilich wurde der Uberlandverkehr mit allen Handelsgütern durch handelspolitische Maßnahmen der Territorialnachbarn, wie Einfuhrverbote und Zollerhöhungen, stark behindert, teils ganz unmöglich gemacht. Württemberg wollte den Heilbronner Warenverkehr sogar durch die Anlegung eines eigenen Hafens unmittelbar unterhalb der Stadt schädigen. Nicht zuletzt suchten die freundlichen«nachbarn auch den ansehnlichen Eisen- 77
80 Der 1513/14 von Hans Schweiner gebaute Kran am Neckar vor der Stadt, an dem der gesamte Güterumschlag Wasser/ Straße und umgekehrt bewerkstelligt wurde. Ausschnitt aus der Heilbronner Ansicht (Kupferstich) von Matthäus Merian in der 11Topographia Sueviaeu, Frankfurt a.m handel Heilbronns auszuschalten. Das Eisen wurde überwiegend per Schiff hierhergebracht und über zahlreiche Händler weitervertrieben. Wichtigstes Einfuhrgut war das Salz. Hinsichtlich des Salzhandels dachte der Rat mehrfach an eine Monopolisierung, aber erst 1665 nahm ihn die Stadt selber in die Hand, um die Versorgung der Bürgerschaft mit dem»weißen Gold«zu sichern. Ein Vertrag mit Bayern begründete dann den Tauschhandel von Wein gegen Salz. Alle übrigen Handelsgüter waren für Heilbronn von nachrangiger Bedeutung. Wegen der Schiffahrt auf dem Nekkar standen Heilbronn seit der Mitte des 16. Jahrhunderts hartnäckige Auseinandersetzungen mit Württemberg ins Haus verlangte Herzog Christoph von der Stadt die Anlegung einer Wasserstraße durch das Wehr vor den Mauern der Stadt und damit die Öffnung des Flusses für den durchgehenden Schiffsverkehr. Doch kam es zu diesem Wasserbau in reichsstädtischer Zeit nicht. Die Öffnu.ng des Neckars erfolgte erst mit der Fertigstellung des Wilhelmskanals 1821, der für Heilbronn den Beginn einer neuen Ära markiert. Die Stadt konnte ihre Stellung als Endplatz des bergwärts führenden Neckarschiffsverkehrs also bis ins 19. Jahrhundert halten und betrieb den gesamten Güterumschlag an ihrem Kran vor dem Brücken- tor als monopoles Geschäft, verbunden mit dem Stapelrecht. Solch breiter Fürsorge, wie sie seitens der Stadt allzeit dem Weinbau und Weinhandel zukam, konnte sich das Handwerk, das den Bedürfnissen entsprechend vielfältig und breit vertreten war, nie erfreuen, es war vielmehr in mancher Hinsicht ein»stiefkind«im städtischen Wirtschaftsgefüge. Neben der angeblichen Übersetzung mancher Berufe wurde die Konkurrenz fremder, unverbürgerter Meister oft beklagt. Nicht zuletzt erlitten die heimischen Krämer durch die Fremden auf den hiesigen Märkten empfindliche Beeinträchtigungen. Durch ein kleinliches Gästerecht der Territorialnachbarn waren die Krämer ohnehin nahezu auf das städtische Gebiet eingegrenzt, das seiner räumlichen Enge wegen nur einen kleinen Lebensraum bot. Besonders schädigend auf das Handwerk wirkten sich Rohstoffausfuhrverbote der Nachbarländer sowie Verbote für die Fertigwareneinfuhr aus. Der Untergang der Heilbronner Ledergerberei, eines der ältesten eingesessenen Handwerke, seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert ist damit aufs engste verbunden. Aber auch für andere Handwerkszweige war diese territoriale Handelspolitik in hohem Maße schädigend. Es braucht deshalb nicht zu wundern, daß sich seit dem Ende jenes Jahrhun- 78
81 Der Rathausbaumeister Hans Kurz (um ). Ölgemälde ohne Signatur, um 1600 Isaak Habrecht ( ), der Schöpfer der astronomischen Kunstuhr am Rathaus. Kupferstich, 1608 derts die Konkurse im Handwerk häuften, wozu schließlich der lange Krieg noch das Seine beitrug. Selbst in den Nachkriegsjahren trieb das Handwerk noch lange Zeit dem Ruin zu. In dem hier behandelten Zeitraum faßten in Heilbronn mehrere vielversprechende Gewerbe erstmals Fuß. So ist 1604 von der Stadt am Neckar beim Ballwerksturm eine Papiermühle gebaut und pachtweise an einen Papiermacher gegeben worden erlaubte der Rat die Einrichtung einer Bierbrauerei, doch ist eine Ratsverordnung wegen des Bierbrauens schon von 1538 bekannt. Die Herstellung und der Vertrieb von Bier wurden allerdings nicht gerne gesehen, da sie dem Weinkonsum abträglich waren. Eine erste Buchdruckerei richtete 1630 Christoph Krauß aus Kempten ein, dem der Rat sofort einen Zensor setzte. Die Reichsstadt Heilbronn erlebte seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fraglos einen wirtschaftlichen Einbruch und allmählichen Niedergang, dennoch war sie befähigt, noch auf Jahre hinaus größere Finanzmittel in das öffentliche Bauwesen zu investieren, so daß sich eine rege Bautätigkeit entfalten konnte. Hier soll beispielhaft nur der Rathausumbau in den beiden letzten Dezennien des 16. Jahrhunderts Erwähnung finden: Von 1580 bis 1582 wurde die dem Marktplatz zugewandte Schauseite durch den Baumeister Hans Kurz in eine schmucke Renaissancefassade verändert. Von Adam Wagner stammt die schöne Freitreppe mit dem reichen Figurenschmuck, von dem Uhrmacher Isaak Habrecht aus Schaffhausen die großartige astronomische Kunstuhr, die auch heute noch staunende Bewunderung erfährt. Von wurden östlich vom Hauptbau die Neue Kanzlei und das Syndikatshaus erstellt, zwei eindrucksvoll-repräsentative Gebäude. Auch privat konnten noch in manches Bauvorhaben Gelder fließen schuf sich z.b. die Familie Orth im Osten der Stadt, wo jetzt das Trappenseeschlößchen steht, ein ansprechendes Landhaus in einem See. Im Jahre 1567 wurde die Führung von Kirchenbüchern angeordnet, seit 1612 schrieb der deutsche Schulmeister alle Verstorbenen, die mit der deutschen Schüler Gesang zum Gottesacker 79
82 begleitet wurden, in ein gesondertes Totenbuch ein. Für die Aufnahme in das Bürgerrecht mußten ab Gulden Vermögen nachgewiesen sowie als Einkaufsgeld vom Mann 12, von jeder Frau 6 Goldgulden aufgebracht werden erhöhte man die Vermögenssumme sogar auf 200 Gulden in der Stadt und 100 Gulden auf den Dörfern. Die Untertanen in den heilbronnischen Dörfern waren durchwegs städtische Leibeigene. Sie mußten sich jährlich am 26. Dezember in Heilbronn auf dem Rathaus zur Weisung stellen, worauf der Rat sie zum Weismahl einlud. Dieses wurde 1608 abgeschafft, die Weisung hörte 1633 auf. Seit 1619 war der Ritterkanton Kraichgau hier ansässig, dem der Rat ein eigenes Haus allerdings abschlug. Nichtbürgern gestand man grundsätzlich keinen Immobilienbesitz zu erbaute die Stadt für die Kanzlei und das Archiv der Kraichgauer Ritterschaft mit hohem Aufwand einen eigenen Zweckbau am Hafenmarkt - für den Kanton zwar nur ein Mietobjekt, aber eine hübsche Bereicherung des Stadtbildes. Im Jahre 1575 richtete der Rat im Kreuzgang des ehemaligen Barfüßerklosters eine Bibliothek ein, die in erster Linie zum Gebrauch der Geistlichen bestimmt war und für die jährlich auf der Frankfurter Messe für 20 Gulden Bücher gekauft wurden. In ihr gingen verschiedene andere Bibliotheken auf wurden zwei Ratsmitglieder als Bibliothekare verordnet. Dem 1582 eingeführten Gregorianischen Kalender schloß sich die Stadt nicht an, sie verblieb vielmehr bis 1700 beim Julianischen Kalender und hinkte der modernen Zeitrechnung um zehn Tage hinterher. Nach etwa einem halben Jahrhundert, in dem den Menschen nach dem Augsburger Religionsfrieden 1555 in Ruhe zu leben vergönnt gewesen war, brach mit dem Dreißigjährigen Krieg einmal mehr unendliches Leid über sie herein. Mit der Schlacht bei Wimpfen setzte das Elend seinen Fuß auch auf das Heilbronner Gebiet und in die Stadt, die tatenlos zusehen mußte, wie ihre linksneckarischen Dörfer geplündert wurden und deren Bewohner schlimmsten Greueltaten ausgeliefert waren. Vor allem bedeutete der Krieg finanziellen Ruin für die Stadt, Ausblutung und durch Besitzvernichtung Verarmung für die meisten Bür- ger und Untertanen. Am Ende des Krieges war ein Zustand äußerster Erschöpfung erreicht. Die über so viele Jahre hinweg aufzubringenden Leistungen für Kriegsführung und Soldateska schädigten in erheblichem Umfang das Volksvermögen. Daß Heilbronn trotz der ungeheueren Summe von Elend und Leid, die durch den»schwarzen Tod«so sehr vermehrt wurde, letztendlich doch noch glimpflich das Kriegswesen überstanden hat, konnte es weniger politischem Geschick seiner Obrigkeit zuschreiben, als vielmehr glückhaften Umständen, die ihm. wiederholt zuteil wurden. Nicht weniger als zweimal stand die Stadt hart am Abgrund, als ihre Besatzer den überlegenen Belagerern nicht weichen wollten. Nur mit Mühe war das Inferno zu verhin- Justitia von Adam Wagner an der Balustrade der Rathausfreitreppe, um 1581/82 80
83 Schauseite des von Hans Kurz umgebauten Rathauses mit der großartigen astronomischen Kunstuhr von Isaak Habrecht und der schönen Freitreppe von Adam Wagner. 81
84
85 In der Nacht vom 23./24. Juni 1696 legte eine Feuersbrunst zwischen Markt und Kieselmarkt 20 Gebäude in Schutt und Asche. Man vermutete, daß französische Mordbrenner den Brand gelegt hatten, bekam dafür jedoch keine Beweise in die Hand. Aquarellierte zeitgenössische Zeichnung in der Faberschen Chronik (des Stadtarztes und Historiographen Johann Matthäus Faber, Augsburg Heilbronn} 83
86 Die Heilbronner Bürgermeistersgattin Charlotte Sophie von Wacks, geb. von Pflugk ( ) hatte großen Einfluß auf das kulturelle Leben der Stadt. Ölporträt eines unbekannten Malers, undatiert 84
87
88 11Der Markt in Heilbronn«ist diese hübsche Ansicht mit Rathaus (links} und Kilianskirche von Carl Doerr betitelt. Aquatintablatt,um Im Erdgeschoß des Rathauses befanden sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts städtische Lagerräume (11Lagerhaus«}, was den regen Umschlag von Handelsgütern auf dem Marktplatz, den zahlreiche Ansichten zeigen, erklärt. 86
89 Kinderbild von Robert Mayer (links} mit seinem Bruder Carl Gustav und seinen Eltern, dem Apotheker Christian Jakob Mayer und Katharina Elisabeth, geb. Heermann. Ölbild eines unbekannten Malers, um
90 Weinlese in der Gegend um Heilbronn. Im Hintergrund im Tal ist die Stadt zu erkennen. Gouachemalerei von Carl Doerr, um
91 dern gewesen. Die wirtschaftliche Wiederbelebung zog sich über mehrere Jahrzehnte hin. Die insgesamt erfreuliche Entwicklung seit 1648 wurde indessen schon bald wieder durch neue kriegerische Auseinandersetzungen gehemmt und unterbrochen. Dramatischer Höhepunkt der Heilbronner Geschichte in der zweiten Hälfte des 1 7. Jahrhunderts waren zweifellos die Ereignisse im Verlauf des Pfälzischen Erbfolgekrieges besetzten französische Truppen die Stadt, und diese unliebsame Einquartierung fand erst nach elf Wochen ein Ende, als nämlieh kursächsische Truppen zur Befreiung anrückten. In aller Eile zogen die Franzosen ab. Feuer, das sie dabei legten, konnte gelöscht werden, bevor sich ein großer Stadtbrand entwickelte. Folgenschwerer war, daß sie Taler Kontribution forderten - eine Summe, welche Heilbronn nicht sofort aufbringen konnte. Deshalb griffen sich die Franzosen neun angesehene Bürger und führten sie als Geiseln mit sich fort. Sie mußten z.t. fast anderthalb Jahre lang in französischen Gefängnissen ausharren, bis die Stadt das Geld endlich in Raten bezahlt hatte. 89
92 Außeren Widrigkeiten zum Trotz Die Reichsstadt Heilbronn behauptet sich als Handelsplatz»Während des Friedens handelt man hier so, als ob es nie wieder Krieg geben könnte. Militärische Schutzmaßnahmen geraten völlig in Vergessenheit " kritisierte um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein französischer Offizier die hiesige Verteidigungsbereitschaft. Jean de Beault de Beausobre war seit auf den Schauplätzen der bis 1763 mit Unterbrechungen geführten zahlreichen europäischen Kriege zu Hause, und so interessierten ihn während seines Heilbrorin Besuches fast ausschließlich die - in seinen Augen - äußerst mangelhaften Befestigungsanlagen der Stadt:»Über den Neckar führt eine Brücke.... Ich konnte nicht ohne Erstaunen die fehlerhafte Konstruktion dieser Brücke betrachten, an einem militärischen Stützpunkt, welchen die kaiserlichen Truppen so lange als ihren Zufluchtsort ansahen." Heilbronn bekam auch im frühen 18. Jahrhundert immer wieder Auswirkungen dieser vielen kriegerischen Auseinandersetzungen zu spüren. Im Polnischen Erbfolgekrieg war die Stadt wiederholt das Hauptquartier des kaiserlichen Oberbefehlshabers, Prinz Eugen von Savoyen. Dieser wollte sie als Stützpunkt für eine etwaige Stellung am Neckar zur Festung ausbauen lassen. Die entsprechenden Bau- und Schanzarbeiten wurden begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Teilweise fielen sie im Juni 1735 auch einem Hochwasser zum Opfer. Nach Berechnungen der Stadt entstand ihr in diesem Krieg durch die Verschanzungen sowie durch verschiedene Truppeneinquartierungen und Fouragelieferungen ein Schaden von Gulden. Neben diesen durch den Kriegsverlauf bestimmten Kosten mußte die Reichsstadt Heilbronn als Reichsstand und Mitglied des Schwäbischen Reichskreises - auch in Friedenszeiten - ein jeweils unterschiedlich großes Kontigent an Soldaten unterhalten. Sie wurden zu den entsprechenden Kreistruppen abgeordnet, aus denen sich die Armee des Alten Reiches zusammensetzte. Im Polnischen Erbfolgekrieg hatte die Stadt für den Unterhalt von 42 Infanteristen- und 7 1/2 Dragonerstellen, im Siebenjährigen Krieg für : Spanischer Erbfolgekrieg; Truppendurchzüge und -einquartierungen. 1712: Einführung eines Marktschiffs von Mannheim. 1715: Vertrag mit Württemberg über die Neckarschiffahrt; Marktschiff von Cannstatt : Polnischer Erbfolgekrieg; Prinz Eugen von Savoyen hat zeitweilig hier sein Hauptquartier : Österreichischer Erbfolgekrieg; Truppendurchzüge. 1753: Rangschiffordnung«mit Kurpfalz. 1754: Erwerb der Lehenshoheit über Neckargartach und Niederschlagung des dortigen Aufstandes : Der Siebenjährige Krieg wirkt sich in Heilbronn kaum aus. 1770: Einführung besonderer Pferde- und Viehmärkte. Ab 1771: Bau der Straße von Cannstatt. Ab 1783: Bau der Straße nach Heidelberg. 1788: Es gibt hier 46 Handelshäuser. 1790: Senkung der Vermögenssteuer (Bet) wegen der guten Finanzlage. 90
93 die doppelte Anzahl (84 Infanteristen und 15 Dragoner) aufzukommen. Kein Wunder also, daß der städtische Haushalt in der ersten Hälfte des Jahrhunderts immer wieder ein Defizit aufwies, 1739 betrug es beispielsweise Gulden. Weit erstaunlicher ist es, daß sich Heilbronn - im Gegensatz zu vielen anderen Reichsstädten - von diesem Aderlaß erholte und seit der Jahrhundertmitte und vor allem in der zwischen und 1792 herrschenden Friedenszeit zu Wohlstand kam. Schon 1754 war die Stadt in der Lage, Gulden an Württemberg für die Abtretung der Oberlehensherrschaft über Neckargartach zu zahlen. Dieser Kauf war eine wesentliche Voraussetzung für die Niederschlagung des sogenannten Neckargartacher Aufstandes. Seit weigerten sich die dortigen Einwohner, Steuern an Heilbronn zu zahlen. Sie versuchten, aus der komplizierten Situation Kapital zu schlagen, daß der Ort zwar zum Heilbronner Territorium zählte, aber Württemberg dort die Oberlehensherrschaft innehatte. Die Neckargartacher klagten schon seit 1732 immer wieder beim württembergischen Lehenshof und später auch beim Reichskammergericht in Wetzlar und beim Reichshofrat in Wien gegen die nach ihrer Meinung zu hohe Steuerlast. Während sich Württemberg abwartend verhielt und schließlich die Gunst der Stunde nutzte, gegen eine entsprechend hohe Entschädigung seine Rechte an Heilbronn abzutreten - in früheren Verhandlungen war die Reichsstadt nie bereit gewesen, soviel zu zahlen -, entschied der Reichshofrat als das zuständige Reichsgericht, daß die Besteuerung der Dorfbewohner rechtens sei, und ordnete die Exekution, also die notfalls mit Gewalt durchzuführende Einkassierung der rückständigen Steuerzahlungen an. In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai zogen 150 Soldaten des Schwäbischen Reichskreises in Neckargartach ein, verhafteten den Rädelsführer Johann Philipp Hagner und zwangen die Bewohner zum Gehorsam. Bis konnte die Stadt weitere stattliche Ankäufe tätigen: 1772 erwarb sie um Gulden den Lautenbacher und den Mönchshof bei Oedheim, 1785 um 3000 Gulden die F rankenbacher Landacht und schließlich 1789 um Gulden den Neuhof bei Oedheim. Dennoch verfügte die städtische Finanzverwaltung am 31. Dezember 1790 über Gulden Bargeld und hatte Gulden ausgeliehen, z.b. an die lnvalidenkasse des Schwäbischen Reichskreises sowie an die Reichsstädte Ulm und Wimp- Nicht ausgeführter Idealplan der 1735 im Polnischen Erbfolgekrieg projektierten "Festung" Heilbronn. 91
94 fen. Außerdem standen zu diesem Zeitpunkt noch Gulden Bet aus, also Steuerrückstände. Die Einnahmen der Stadt lagen sie bei insgesamt Gulden - wurden zum größten Teil durch die Bet erzielt. Zu dieser Vermögenssteuer wurde, laut der Steuerordnung von 1772, alles herangezogen,»was in eines Bürgers, Bürgerin und verbürgerter Pflegekinder Eigenthum oder Nuzniesung, sowohl im Heilbronnerischen Gebiet, als auserhalb desselben, sich befindet«. Von den unter Eid zu leistenden Vermögensangaben der einzelnen wurde 1/2 Prozent Steuer erhoben; im August wurde sie wegen der guten Finanzlage auf 1/3 Prozent gesenkt. Der Wert der liegenden Güter wurde amtlich geschätzt, bei Gebäuden blieb 1/3 des Schätzwertes steuerfrei. Ein Blick in das Betbuch für die Jahre zeigt, daß die Veranschlagung der einzelnen Bürger weit auseinanderlag. Die überwiegende Mehrzahl der verbürgerten Einwohner zahlte einstellige Guldenbeträge im Jahr, also von der niedrigsten Betzahlung, die bei 1 Gulden 29 Kreuzern lag, bis unter 10 Gulden. Am oberen Ende stand Handelsmann Georg Friedrich Mertz, der reichste Mann der Stadt, der jährlich 675 Gulden 50 Kreuzer entrichten mußte. Die vier zu Heilbronn gehörigen Dörfer Bökkingen, Flein, Frankenbach und Neckargartach zahlten an Bet zusammen die feste Summe von 165 Gulden im Jahr. Unter den indirekten Steuern war das Umgeld, die Verbrauchssteuer für den in der Stadt ausgezapften Wein, mit durchschnittlich Gulden im Jahr die ergiebigste. Weitere Einnahmen wurden aus dem Grundbesitz der Stadt erzielt. Zwei»Standortfaktoren«hatten von alters her die wirtschaftliche Entwicklung Heilbronns bestimmt: Die Fruchtbarkeit des Bodens, die eine über den Eigenbedarf hinausgehende landwirtschaftliche Erzeugung möglich machte, und die günstige Verkehrslage, die - als Knotenpunkt zwischen einem schiffbaren Fluß und alten Handels- und Heerstraßen - nicht nur den Eigen-, sondern auch einen großangelegten Durchgangshandel zuließ. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts verschob sich das Verhältnis zwischen diesen beiden wirtschaftlichen Standbeinen. Jahrhundertelang war der Wein- und Akkerbau weitaus bedeutender gewesen, nun rückte der Handel in den Mittelpunkt. Für den Transitverkehr englischer und holländischer Kolonialwaren, die vorwiegend von den Nordseehäfen nach Süddeutschland und Italien geliefert wurden, gab es damals drei miteinander konkurrierende Handelsrouten: die Maintallinie, die von Frankfurt mainaufwärts und über Nürnberg in den Süden führte; die Rheintallinie, die durch den Oberrheintalgraben und die Schweiz nach Italien verlief; und schließlich die Neckartallinie, die bis Heilbronn den Wasserweg benutzte und von hier aus auf dem Landweg die Verbindung nach Nürnberg und Regensburg herstellte. Für welche dieser drei Strekken die Händler sich jeweils entschieden, hing sehr stark davon ab, welche Rahmenbedingungen die Anrainerstaaten zu bieten hatten. Das bezog sich sowohl auf Zoll- und andere Abgaben wie auf den Zustand der Verkehrswege. Diesbezüglich war die Reichsstadt Heilbronn mit ihrem kleinen Territorium weitgehend abhängig von den wirtschaftspolitischen Maßnahmen ihrer größeren und mächtigeren Nachbarn, Kurpfalz und Württemberg. Für den Heilbronner Rat kam es einer Gratwanderung gleich, mit diesen beiden Territorien gutnachbarschaftliche Verkehrsbeziehungen zu pflegen und dennoch eine möglichst große handelspolitische Selbständigkeit zu bewahren. Im Jahr konnte Württemberg einen Teilerfolg in seinem Bemühen um die Öffnung des Neckars bei Heilbronn erzielen: In einem Vertrag mit der Reichsstadt wurde festgelegt, daß die württembergischen Schiffe künftig bis zur Stadtbrücke fahren durften, wo ihre Waren gelöscht und entweder in ein anderes, oberhalb der Wehre gelegenes Schiff umgeladen oder über Land weitertransportiert wurden. Dafür erhob die Stadt einen Durchgangszoll von 2 1/2 Kreuzern pro Zentner. Andererseits verpflichtete sie sich, die nötigen Verladeplätze und Leinpfade auf eigene Kosten bereitzustellen. Als Gegenleistung durften sich Heilbron-. ner Schiffe ungehindert neckaraufwärts durch württembergisches Territorium bewegen. In diesem Zusammenhang wurde auch erstmals ein regelmäßig verkehrendes Marktschiff zwischen Cannstatt 92
95
96 lerdings, daß die Frachtpreise herabgesetzt wurden: Die Bergfracht von Mainz nach Heilbronn kostete jetzt nur noch 40 Kreuzer pro Zentner, und auch die kurpfälzischen Steuern, die für die Strecke von Oppenheim nach Heilbronn zu zahlen waren, wurden auf 1 1/2 Kreuzer für den Zentner ermäßigt. Tatsächlich erholte sich die Neckarschiffahrt durch diese Maßnahmen wieder, so daß 1789 am Heilbronner Kranen mit Zentnern Durchgangsgütern ein neuer Rekord erreicht werden konnte. Weniger günstig für Heilbronn waren die Beschlüsse, die Kurpfalz und Württemberg bezüglich des Straßenbaus faßten. Die»Oberländer Schiffahrt«nach Cannstatt war inzwischen fast zum Erliegen gekommen, weil ab 1771 die Landstraße von dort über Besigheim nach Heilbronn chaussiert worden war und die Waren auf dieser Strecke nun über den Landweg befördert wurden. Heilbronn hatte sich - neben der eigenen Bauleistung bis zur Grenze nach Sontheim - mit 4000 Gulden Zuschuß daran beteiligt. Bereits seit Ende der 1 750er Jahre bestand in Mannheim der Plan, durch kurpfälzisches Territorium eine neue»kommerzienstraße«von Straßburg nach Nürnberg zu bauen, die der vom Schwäbischen Reichskreis angelegten sogenannten»oberen Nürnberger Straße", welche über Pforzheim, Cannstatt und Dinkelsbühl führte, Konkurrenz machen sollte. Heilbronn war lebhaft daran interessiert, daß diese über Bretten und Eppingen durch das reichstädtische Gebiet gehen und von hier aus die inzwischen durch ihren schlechten Zustand verödete alte Handelsstraße über Schwäbisch Hall nach Nürnberg wieder neu beleben sollte. Im Jahre 1776 entschied sich die Mannheimer Regierung für diese Lösung. Auf Druck des Schwäbischen Reichskreises, dessen Mitglied Heilbronn war, konnte sich die Stadt nicht offiziell am Bau dieser Straße beteiligen, veranlaßte aber 1781 dennoch die notwendigen Chaussierungsarbeiten zwischen der Grenze nach Großgartach und der nach Weinsberg. Nun fiel dieses Straßenprojekt den kurpfälzisch-württembergischen Verhandlungen zum Opfer, wodurch den Heilbronner Speditionen die Lieferungen von ca. 500 Frachtwagen im Jahr entgingen, wie Syndikus Johann Moriz Becht damals ausrechnete. Statt dessen sollte sich die Stadt daran beteiligen, die bereits von Cannstatt hierher führende Straße über Frankenbach, Fürfeld, Sinsheim nach Heidelberg fortzusetzen. Ab baute sie an ihrem Teilstück bis zur Grenze nach Kirchhausen. Der Heilbronner Durchgangshandel vertrieb vorwiegend Kolonialwaren. Auf der»cranen-tafel«von 1738 werden beispielsweise Zucker, Pfeffer, Ingwer, Zimt, Zitronen, Oliven, Spanischer, Rheinund Moselwein sowie Holländisches Leinöl genannt. Da jedoch die Landwirtschaft weiterhin florierte, konnte auch mit einheimischen Produkten Handel getrieben ' 1 4., I 1 Entwurf eines Wegzeigers für die neu gebaute Straße von Heilbronn nach Heidelberg. Bleistiftzeichnung, :.. ' ;'.. 94
97 Zur Prämierung der auf den Viehmärkten präsentieren qualitätsvollen Tiere stiftete der Heilbronner Rat verschiedene Preismünzen. Abgebildet ist die große silberne Medaille, die Siegelschneider und Kupferstecher Jakob Michael Pressei 1770 geschaffen hat. werden. Der eingeführte Vieh- und Pferdemarkt, der zunächst dreimal, ab 1785 viermal im Jahr auf dem Hammelwasen abgehalten wurde, entwickelte sich schnell zu einer bedeutenden überregionalen Viehbörse - Heilbronn wurde zum Umschlagplatz von Tieren aus der Gegend um Schwäbisch Hall und Hohenlohe, die bis nach Baden und Frankreich verkauft wurden. Die Umsätze waren daher beachtlich. Im Jahre 1792 betrugen sie zum Beispiel Gulden. Angesichts dieses Erfolgs wundert es nicht, daß sich an den Markttagen bald auch Krämer, Handwerker und Händler einfanden, um ihre Waren den Besuchern feilzubieten. Daraus wurde eine dauerhafte Kombination von Vieh- und Pferde- sowie gleichzeitigem Krämer- und Handwerkermarkt. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war dieser von großer Bedeutung für Landwirtschaft, Handwerk und Handel des gesamten Unterlandes. Im Zusammenhang mit der Einführung der Märkte wurde auch die hiesige Viehzucht wiederbelebt, die durch die kriegerischen Ereignisse am Beginn des Jahrhunderts besonders gelitten hatte. Sie wurde vorwiegend in den Dörfern und auf den zur Stadt gehörigen Gutshöfen betrieben. Doch hatten auch zahlreiche Stadtbürger Kühe, Schweine oder Hühner im Stall, wie bei Stadtarzt Dr. Friedrich August Weber nachzulesen ist, der Heilbronn als eine»mittelmäßige Stadt von sieben bis achttausend Einwohnern, deren Viehstand nicht unbeträchtlich ist«beschreibt. In Wechselwirkung damit wurde auch der Ackerbau vielfältiger, durch den Anbau von Luzernen, die Bürgermeister Georg Heinrich von Roßkampff einführte, und anderen Kleesorten sowie von Kartoffeln, die man zunächst nur als Futterpflanzen für Schweine verwendete. Außerdem wurde Raps neu angebaut, den die Firma Rund für ihre Ölmühle brauchte. Zwei weitere wichtige Heilbronner Ausfuhrartikel des 18. Jahrhunderts waren Sandstein, der aus dem Steinbruch beim Jägerhaus stammte, und Gips, der in Gruben am Wartberg abgebaut und als Düngemittel benutzt wurde. Das Gipsausstreuen auf den Feldern war etwas Vom Bortenwirker bis zum Zwilchhändler Heilbronner Berufe im Jahr 1788 Wie kaum anders zu erwarten, führten die Weingärtner mit 274 Vertretern die Liste der hier ausgeübten Berufe an. Allerdings hatten viele von ihnen keinen eigenen Weinberg, sondern arbeiteten als Lohnarbeiter. Durch den Weinbau fanden auch 27 Küfer Arbeit und Brot. Platz zwei in der Berufsskala belegten 66 Kärcher, die mit ihren Karren die von den 46 hiesigen Handelshäusern vertriebenen Kolonial- und andere Waren durch die Stadt transportierten. Für die Bedürfnisse der Heilbronner sorgten u.a. je 48 Bäcker, Metzger, Schneider, 43 Schuhmacher, 10 Schreiner, je 8 Buchbinder, Goldarbeiter, Konditoren, Weber, je 6 Färber, Glaser, Hutmacher; je 5 Fischer, Knopfmacher, Leinenweber, Perückenmacher, je 4 Gürtler, Hafner, Tuchmacher, je 3 Büchsenmacher, Kürschner, je 2 Bortenwirker, Goldschmiede, Kottondrucker, Uhrmacher, Zinngießer sowie je ein Bierbrauer, Buchdrucker, Bürstenbinder, Kammacher, Lebküchner, Lederhändler, Tapezierer und Zwilchhändler. Die Viehzucht, bei der Häute und Felle sowie Unschlitt als Rohprodukte anfielen, bildete auch eine gute Voraussetzung für die Arbeit von 13 Weißgerbern sowie je 9 Rotgerbern und Seifensiedern. Unabhängige berufstätige Frauen gab es - wie im 18. Jahrhundert üblich - nur sehr wenige in der Stadt: Mit je 2 Hebammen, Näherinnen, Spinnerinnen und je einer Strickerin und Wäscherin waren aber die - neben der häufigen Verdingung als Magd - für Frauen damals überhaupt möglichen Arbeitsfelder abgedeckt. 95
98 Schild der Rotgerbergesellen von 1782, das in ihrer Trink- und Versammlungsstube hing. Es zeigt in vereinfachter Form die typischen Werkzeuge dieses Handwerks. Neues, über dessen Nützlichkeit oder Gefährlichkeit auch in Heilbronn heftig gestritten wurde. Zwischen den Befürwortern, besonders Stadtarzt Dr. Friedrich August Weber und Pfarrer Johann Friedrich Mayer aus Kupferzell, und den Gegnern, an deren Spitze Stadtschultheiß Georg Heinrich von Pancug stand, kam es im Heilbronner Wochenblatt zeitweilig zu erbitterten Auseinandersetzungen. Die wirtschaftliche Entwicklung Heilbronns im 18. Jahrhundert war gekennzeichnet durch die geschickte Ausnutzung und den gezielten Ausbau der vorhandenen Standortvorteile, durch die das kluge und neuen Entwicklungen aufgeschlossene Stadtregiment den Rahmen für erfolgreiche Unternehmen schuf, die wesentlich zum Wohlstand der Stadt und ihrer Bürger beitrugen. 96
99 Zwischen Aufklärung und Aberglauben Gesellschaft und Geselligkeit im Heilbronn des 18. Jahrhunderts 1700: Hochzeits-, Ta uf- und Leichenordnung.»So viel wahre Gelehrte im Verhältnis zur Kleinheit des Ortes in Heilbronn sich befinden, so wenig ist es einem Reisenden leicht, sich mit ihnen bekannt zu machen.... Soviel bemerkte ich von ihnen überhaupt, daß die meisten sehr frei und aufgeklärt denken, daß aber die meisten 1738 : Ordnungen für das Gymnasium und die Deutsche Schule. 1744: Erstes Erscheinen des»heilbronnischen Nachricht- und Kundschaffts-Blattes« : Amtszeit von Bürgermeister Georg Heinrich von Roßkampff : Amtszeit von Bürgermeister Gottlob Moriz Christian von Wacks. 1773: Aufenthalt von Christian Friedrich Daniel Schubart in der Stadt. 1776: Gründung der Freimauererloge zum Felsen der Wahrheit« : Stadtarzt Dr. Eberhard Gmelin. 1782: Leichenordnung. 1784: Gründung einer Lesegesellschaft : Amtszeit des Bürgermeisters Georg Christoph Kornacher : Stadtarzt Dr. Friedrich August Weber. 1793: Aufenthalt von Friedrich Schiller in der Stadt. 1796: Verbot aller Glücksspiele. 1797: Besuch Johann Wolfgang von Goethes. ihre Gründe haben müssen, ihr Licht mehr vor einem Fremden, als vor einem Mitbürger leuchten zu lassen...«diesen Eindruck von Heilbronn veröffentlichte ein unbekannter Verfasser 1786 im Journal von und für Deutsche«. Etwas anders beschreibt Christian Friedrich Daniel Schubart, der sich - aus Ludwigsburg verwiesen eine Zeitlang hier aufhielt, seine Aufnahme in der Stadt:»Ich war indessen in Heilbronn angelangt und fand gleich einen Klub von neuen Bekanntschaften.... Die hier üblichen großen Speisegesellschaften, häufigen Privatkonzerte, Spazierfahrten und Spaziergänge aufs Land, Hausbesuche, Unterredungen über tausend Gegenstände im freiesten Tone, erhöhen die Reize noch mehr, womit diese Stadt schon von Natur durch ihre herrliche Lage geschmückt ist. Hang zur gesellschaftlichen Freude, scheint beinah das Hervorspringende im Charakter dieser Städter zu sein." Im 18. Jahrhundert kamen immer wieder Fremde zu kürzeren oder längeren Aufenthalten in die Stadt, und der Schreibfreudigkeit jenes Jahrhunderts gemäß, haben viele von ihnen ihre Impressionen in Briefen oder Reisebeschreibungen festgehalten. Auffällig ist, daß darin häufig der freie, aufgeklärte Geist der Heilbronner besonders betont wird. Tatsächlich gab es hier einige von der Aufklärung beeinflußte und zugleich einflußreiche Einwohner, aber aufs Ganze gesehen lebten nicht mehr»aufklärer«in der Stadt als anderswo. Daß sich diese Bemerkung dennoch wie ein roter Faden durch die Beschreibungen zieht, hat einen anderen Grund. Die gebildeten Reisenden des 18. Jahrhunderts hatten konkrete und tendenziell negative Vorstellungen über die Reichsstädte im Kopf: Diese galten als überholt und kleingeistig, als er- 97
100 Diese nicht wirklichkeitsgetreue Gesamtansicht Heilbronns erschien in einer frühen, 1730 publizierten Reisebeschreibung, die den Titel»Reisender Chineserc1 trägt. starrte Überreste einer vergangenen Epoche, die neueren Entwicklungen nicht mehr zu folgen vermochten und die daher oft zur Zielscheibe vernichtenden Spottes wurden. Der zeitgemäße" Stadttyp war die fürstliche Residenz mit großzügigen Straßenzügen und»modernen«- sprich im Stil des Barock und Rokoko erbauten - Gebäuden, wie Mannheim oder Karlsruhe. So hielt es Johann Wolfgang von Goethe, der 1797 seinen 48. Geburtstag in Heilbronn feierte, z.b. für berichtenswert, daß sich in der Stadt nur»einige neue steinerne, aber ganz schlichte Häuser finden..., das übrige ist alles von altem Schlag«. Deshalb waren also alle Fremden höchst erstaunt, in dieser kleinen alten Reichsstadt überhaupt der Aufklärung nahestehende Menschen zu finden, die frei ihre Gedanken äußerten, weltläufig und gebildet waren. Doch ganz ohne spöttische Bemerkungen kamen auch die Heilbronner nicht davon: ". das gesellige Leben war weit weniger steif als in anderen Reichsstädten.; aber die guten Heilbronner, denen man dieses zu oft vorgesagt haben mochte, fielen nun in ein anderes Extrem; - sie wähnten nun wirkliche Großstädter zu seyn!«stellte beispielsweise Carl Julius Weber fest. Ein Blick in das 1788 erstellte Seelenregister belehrt, daß Heilbronn zu dieser Zeit tatsächlich keine Großstadt war: Innerhalb des Stadtmauerrings, am Trappensee, im Jägerhaus und in den Mühlen auf dem Hefenweiler und Hospitalgrün lebten insgesamt 7162 Personen. Die vier Dörfer wiesen zusammen 2944 Bewohner auf, die alle Leibeigene waren. Das etwa 65 Quadratkilometer umfassende Territorium der Reichsstadt Heilbronn war also nur von rund Personen bevölkert. Stuttgart zählte damals Einwohner. Laut Seelenregister verfügten in der Stadt 4559 Personen über das Bürgerrecht: 948 Männer, 1137 Frauen und deren 1131 Söhne und 1343 Töchter Personen waren sogenannte Schutzverwandte, also geduldete Einwohner mit minderem Recht: 208 Männer, 300 Frauen und deren 248 Söhne und 263 Töchter. Weder zu den Bürgern noch zu den Schutzverwandten zählten die 666 männlichen und 449 weiblichen, zusammen also 1115 von auswärts stam-. menden Dienstboten, die als Unselbständige jeweils dem Haushalt ihres Dienstherren zugerechnet wurden. Ebenfalls gesondert gezählt wurden die Insassen des Hospitals (28 männliche, 31 weibli- Der 1779 gefertigte Aufriß des Hauses von Weingärtner Jakob Biber in der Johannisgasse 15 zeigt ein für Heilbronn typisches einfaches Fachwerkhaus. Bei städtischen Neubauten wurde die im 18. Jahrhundert moderne Steinbauweise bevorzugt, wie an diesem Aufriß von 1780 für die Wohnung des Sägknechts zu sehen ist. 98
101
102
103 Grabmal für den 1809 gestorbenen Stadtarzt Eberhard Gmelin, geschaffen von dem bedeutenden Stuttgarter Bild hauer Johann Heinrich Dannecker ( ). Im Zentrum der Darstellung steht Hygieia, die griechische Göttin der Gesundheit, links von ihr ein Äskulapstab, rechts ein Ölzweig. der die Lebensverhältnisse der»gemeinen«heilbronner, denen die Gebildeten des 18. Jahrhunderts gewöhnlich nur wenig Aufmerksamkeit schenkten, nicht völlig außer acht gelassen werden. Sie ist zugleich der Stoßseufzer eines fortschrittlichen, vernünftigen Mannes, dessen Mitmenschen in vielem noch dem Althergebrachten und Irrationalen anhingen: " Aberglaube ist noch ziemlich unter uns,... die Traumdeuterei, die Konsultationen des Kaffeesatzes, der Spielkarten und der Wasserflasche haben ihre stillen Anbeter und Anbeterinnen nicht blos in Betreff der Ereignisse des bürgerlichen Lebens, sondern auch in Betreff medizinischer Gegenstände. Amulete,... Mediziniren mit der Beobachtung der... Mondesbrüche,... Dreckapothekereien, muß sich ein denkender Arzt nicht bloß von den lieben Leutchen anpreißen lassen,... sondern auch von solchen, denen in anderen Dingen reife Einsicht, Geisteskultur... nicht ohne Unbilligkeit abzusprechen ist.«mehr über das Alltagsleben der Mittel- und Unterschichten erfährt man aus zahlreichen Verordnungen, die der Rat im laufe des 18. Jahrhunderts erlassen hat. Die darin ausgesprochenen Verbote, die oft nicht eingehalten und deshalb mehrfach wiederholt wurden, sind ein Spiegelbild für das tatsächliche Verhalten der Bevölkerung. So wurde beispielsweise in einer Hochzeitsordnung die Feierfreude der Heilbronner stark reglementiert. Die Brautleute wurden ihrer sozialen Herkunft gemäß in vier Klassen eingeteilt, denen jeweils sehr genau vorgeschrieben wurde, wie sie das Fest begehen durften. Der Rat wollte damit vor allem erreichen, daß sich die Paare nicht schon bei der Feier finanziell ruinierten. Das Gros der Heilbronner Bevölkerung, die Handwerker, Fuhrleute und Weingärtner, zählte zur unteren Klasse. Sie durften höchstens 16 Gäste laden und nicht mehr als zehn verschiedene Gerichte bei der Mahlzeit servieren lassen. Für alle wurde festgelegt, daß nicht länger als zwei Tage lang gefeiert werden sollte und abends um elf Uhr»die hochzeitfreude«zu enden habe. Sollte die Braut schon»ohnerlaubter weise... den ehrenstand ihrer jungferschafft verschertzet«haben, durfte sie nicht den sonst üblichen Ehrenkranz tragen und der Hochzeitszug nicht von Musikanten angeführt werden. Denn außerehelicher Geschlechtsverkehr war verpönt und wurde von der Obrigkeit mit Geldbußen und/ oder Landesverweisung bestraft. Bekannt wurde das Verhältnis meist erst, wenn eine Schwangerschaft daraus erwuchs. Da uneheliche Geburt für die Mutter Unehre und Schande und für das Kind einen Makel bedeutete, versuchten Betroffene immer wieder, ihren Zustand zu verheimlichen und durch Abtreibung oder Kindstötung den Konsequenzen zu entgehen, so z.b. Anna Maria Vetter, die ihr Neugeborenes den Schweinen zum Fraß vorgeworfen hatte und dafür mit dem Schwert hingerichtet wurde. Um solche Fälle zu verhindern, wurden die ledig schwanger gewordenen»weibspersonen«durch eine Ratsverordnung verpflichtet, sich selbst rechtzeitig zu einer gelinden obrigkeitlichen Bestrafung«anzuzeigen. Die unverheirateten Mütter entstammten überproportional häufig der Unterschicht und hatten sich oft als Mädge verdingt. Im Seelenregister von 1788 findet sich in keinem der vier Stadtquartiere so häufig der Eintrag»ledig, hat ein Kind«wie im»kugeligen Turm Viertel«(gemeint ist die Gegend um den Bollwerksturm), wo damals vorwiegend arme Leute wohnten. 101
104 solche gegeben, wäre der hiesige Rat nicht so weitsichtig gewesen, dem Hamburgischen Lotto-Fachmann, der 1771/ 72 der Stadtkasse Gewinne von mindestens 1000 Gulden jährlich vorgaukelte, eine einmalig zu zahlende Genehmigungsgebühr von 600 Gulden für die Lottokonzession aufzuerlegen, die zu entrichten der Abenteurer nicht in der Lage war. So mußten die Heilbronner weiterhin ihre 5 aus 90-Wetten bei»ausländischen" Lotti tätigen, von denen etliche Kollekturen in der Stadt unterhielten. Es ist nicht bekannt, wie viele Einwohner hier von der»lottosucht" infiziert waren und ob sie ähnliche Ausmaße annahm wie in Württemberg, wo sie als»raserey... unter Hohen und Niedern, auch so gar unter Dienstboten" beschrieben wird. Jedenfalls hatte der Heilbronner Rat sicher Gründe genug, das Lotto 1787 ebenfalls mit einem Verbot zu belegen. Bürgermeister Georg Heinrich von Roßkampff ( ), der führende Kopf des Heilbronner Magistrats im 18. Jahrhundert. Ölporträt von Adam Schlesinger, 1787 Daß sich der Magistrat für die Erziehung der Kinder aus den Mittel- und Unterschichten verantwortlich fühlte, zeigt sich daran, daß er neben einer Gymnasialordnung auch eine für die öffentliche deutsche Schule der Stadt erließ:»weil auch der Kirche und Republique sehr viel daran gelegen, daß die Kinder nicht zu fruezeitig der Schule entzogen werden " wurde darin eine Art von Schulpflicht festgelegt.»indem es eine... thorechte Meynung ist, als wann die Maegdlein des Schreibens nicht sonderlich vonnoethen haetten" sollten alle Kinder, auch die Mädchen, Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Religion erhalten. Die Lehrer wurden angewiesen, den regelmäßigen Schulbesuch zu überwachen, notfalls bei den Eltern nachzufragen und sich auch von groben Antworten der Erziehungsberechtigten nicht einschüchtern zu lassen. Einer Verrohung der Sitten, ausgelöst durch Hazardspiele, glaubte der Heilbronner Rat gleich zweimal und entgegentreten zu müssen. Alle Glücksspiele, außer dem Lotto di Genova, wurden verboten. Dabei ruinierten sich gerade durch diesen Urahn des modernen Lottos im 18. Jahrhundert unzählige, vor allem arme Menschen. In Deutschland gab es zwischen 1760 und 1790 über 20 Lottogesellschaften. Auch in Heilbronn hätte es L!m ein Haar eine Ein aufgeklärter Kopf regiert Heilbronn Bürgermeister Georg Heinrich von Roßkampff Am 21. März wurde mit Georg Heinrich von Roßkampff eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Heilbronner Führungsspitze des 18. Jahrhunderts zum dritten Bürgermeister der Stadt gewählt. Seit 1749 in städtischen Diensten, waren dem studierten Juristen immer verantwortungsvollere Positionen übertragen worden. Ab 1756 war er für den Bau des Waisen-, Zucht- und Arbeitshauses zuständig und reorganisierte zugleich das gesamte städtische Armenwesen. Seit den l 760er Jahren profilierte er sich durch Überlegungen zum Straßenbau sowie durch Neuerungen in der Landwirtschaft und setzte später als»baubürgermeister«städtebauliche Akzente mit einigen ausgezeichneten Rokokobauten wie dem Archiv am Kieselmarkt und dem Schießhaus. Auch außenpolitisch war er für die Reichsstadt Heilbronn tätig, in Verhandlungen mit Württemberg und als Vertreter im Schwäbischen Reichskreis erhielt er den Titel»Wirklicher Geheimer Rat«des Herzogtums Sachsen-Meinigen, wohin er durch seine aktive Mitgliedschaft im F reimaurerorden - er war Mitbegründer der hiesigen Loge - gute Beziehungen hatte. Im Jahre 1781 stieg Roßkampff zum zweiten Bürgermeister auf. Zusammen mit seinen Amtskollegen Gottlob Moriz Christian von Wacks und Georg Christoph Kornacher fuhrte er bis zu seinem Tod 1794 ein den Gedanken der Aufklärung ver-. pflichtetes Stadtregiment. Die Bevölkerung daran zu hindern, sich durch einen zu großen Kostenauf: wand finanziell zu ruinieren, war für den Magistrat auch bei der Erlassung der Leichenordnung im Jahre 1782 ein ausschlaggebender Grund, zumal " unter allen menschlichen Begebenheiten keine 102
105 unschicklicher zum Aufwand eines Geprängs" sei»als die Begräbniß eines Leichnams.". Auf schwarze Trauerkleidung, die extra angeschafft werden mußte, sowie auf Särge aus massivem Holz sollte deshalb künftig verzichtet werden. Und Gastmale,»bei welchen ohnehin des Verstorbenen sehr schnell vergessen wird«, wurden bei einer Strafe von 10 Reichstalern verboten. Ein Charakteristikum der Gesellschaftsordnung des 18. Jahrhunderts war die große soziale und rechtliche Ungleichheit der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Auch in Heilbronn standen einer wohlhabenden und akademisch geprägten Oberschicht, die sich zunehmend den Gedanken der Aufklärung öffnete, ärmere und ungebildete Mittel- und Unterschichten gegenüber, deren Brauchtum und Anschauungen noch stark im Althergebrachten wurzelten. Durch sein Verordnungswesen versuchte das Heilbronner Stadtregiment das»gemeine" Volk zu disziplinieren und es - ganz im Sinne der Aufklärung - zu»vernünftigen" Untertanen zu erziehen. 103
106 Das Ende der Selbständigkeit Heilbronn wird württembergisch Als Friedrich Schiller 1793 in Heilbronn Aufenthalt nahm, lobte er die»blüte des Gemeinwesens unter dem Einfluß einer aufgeklärten Regierung«. Nur wenige Jahre später sollte es damit vorbei sein. Die 1789 in Frankreich ausgebrochene große Revolution erschütterte Europa zutiefst und beschied dem territorialen»fleckerlteppich«deutschland ein anderes Aussehen. Mit der Ausdehnung nach Osten bis zu der»natürlichen Grenze«Rhein erreichte Frankreich ein lange verfolgtes Ziel. Auf der Strecke blieb dabei das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Den 1. Koalitionskrieg (seit 1792) beendeten die kriegführenden Mächte 1797 mit dem Frieden von Campo Formio, wo in geheimen Abmachungen die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich vereinbart wurde. Von dem ausgangs des Jahres nach Rastatt einberufenen Kongreß zur Ordnung der deutschen Reichsangelegenheiten und Festlegung neuer Besitzverhältnisse hörte man bald Bedrohliches hinsichtlich der Entschädigung jener Fürsten, die linksrheinisch Gebietsverluste zu erwarten hatten. Sollten auch die Reichsstädte geopfert werden? Der Heilbronner Rat schickte die Kaufleute August Orth und August Schreiber privatim an die französische Gesandtschaft in Rastatt, wo sie sich bei den Abgeordneten Roberjot und Rosenstiel für den Erhalt der Selbständigkeit ihrer Vaterstadt verwenden sollten. Als offizielle Heilbronner Vertreter folgten ihnen später der Steuerverwalter Christoph Ludwig Schreiber und der Ratskonsulent und Stadtschreiber Anton Flaxland. Im März bewilligte der Kongreß die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich. Danach erbot sich auch noch der Kaufmann Günther Orth, mit Roberjot in private Verhandlungen einzutreten, und schon bald konnte er berichten, dieser habe 104»auf Ehre«versprochen,»daß die Stadt Heilbronn, wenn auch alle benachbarten Fürsten um sie buhlten,. bei ihrer freien Existenz bleiben solle«(dürr). Die Sache Heilbronns stand in Rastatt also nicht schlecht. Da brachen die Feindseligkeiten mit Frankreich erneut aus. Der Rastatter Kongreß fand ein vorzeitiges Ende. Roberjot wurde ermordet. Und damit erstarben auch die Hoffnungen der Heilbronner. Im Frieden von Luneville, der den II. Koalitionskrieg (seit 1799) 1801 be- 1797: Friede von Campo Formio nach dem 1. Koalitionskrieg, Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich vereinbart. 1798: Der Rastatter Kongreß billigt diese Vereinbarung. 1799: Friede von Luneville nach dem II. Koalitionskrieg, Kaiser Franz II. tritt das linke Rheinufer offiziell ab. 1802: Württemberg handelt mit Frankreich Gebietsentschädigungen aus. - September 9: Militärische Besitzergreifung Heilbronns. - November 23: Zivile Besitzergreifung. 1803: Die neuerworbenen lande erhalten eine eigene Regierung. Munizipalverfassung. Kurfürst Friedrich läßt sich huldigen. 1806: Vereinigung von Alt- und Neuwürttemberg, Neueinteilung des Landes. Religionsedikt: Gleichberechtigung aller christlichen Glaubensbekenntnisse, Einrichtung eines katholischen Stadtpfarramtes. 1810: Neueinteilung des Landes nach französischem Vorbild. 1811: Heilbronn erhält das Prädikat»Gute Stadt«. 1817: Abermals Neueinteilung des Landes. Errichtung eines Bürgerkollegiums (später Bürgerausschuß). 1819: Neuer Stadtrat anstelle des Munizipalrates von II j. '
107 endete, trat Kaiser Franz II. namens des Deutschen Reiches das gesamte linke Rheinufer offiziell an Frankreich ab - womit die Auflösung des alten Reiches eingeleitet wurde. Und jetzt gab es auch keinen Zweifel mehr: Die linksrheinisch geschädigten Fürsten sollten rechtsrheinisch sowohl mit den geistlichen Besitzungen als auch den Reichsstädten entschädigt werden. Für Heilbronn hieß dies nichts anderes, als daß das Ende seiner reichsstädtischen Selbständigkeit unmittelbar bevorstand. Der Reichstag ratifizierte die Abmachungen, und der Kaiser berief eine Reichsdeputation, die über die Entschädigungsansprüche und -möglichkeiten beraten und beschließen sollte. Da sich bei der Reichsdeputation die Verhandlungen arg in die Länge zogen, handelte Württemberg im Pariser Frieden mit Frankreich im Mai 1802 gesondert rechtsrheinische Gebietsentschädigungen aus. Herzog Friedrich hatte also, noch bevor die Großmächte sich hatten einigen können, einen eigenen Entschädigungsplan präsentiert und dafür das Plazet der französischen Regierung erhalten. Einen letzten Versuch, die reichsstädtische Verfassung in die Zukunft hinüberzuretten, unternahm der Rat im Sommer 1802, indem er Flaxland und August Schreiber nach Paris schickte, wo sie für Heilbronn Stimmung machen sollten. Doch auf dem Ländermarkt zu Paris hatten die europäischen Staaten Heilbronn bereits endgültig an Württemberg verschachert. So stand es auch im»moniteur«nach einem zwischen Frankreich und Rußland vereinbarten Entschädigungsplan zu lesen. Als die Heilbronner Gesandten vor dem Rat über ihre Mission berichteten, stellte man dort resigniert fest, daß es wohl zweckmäßig sein werde, einmarschierenden fremden Truppen keinen Widerstand entgegenzusetzen. Noch bevor Flaxland und Schreiber aus Paris zurückgekehrt waren, versuchte die hiesige Handlungsgesellschaft, die Dinge in die Hand zu nehmen. Am 1. September brachte sie dem Rat zur Kenntnis, aus ihrer Mitte eine Deputation an den Herzog von Württemberg senden zu wollen,»um sich dessen Huld und Gnade zu empfehlen«. Andere Reichsstädte hätten dies längst getan. Herzog Friedrich empfing die Kaufleute indessen nicht. Eine eigene Deputation lehnte der Rat ab, so lange die Verbindlichkeiten der Stadt gegen Kaiser und Reich noch bestanden. Der Zeitpunkt für die Übernahme der Stadt durch Württemberg war bis zuletzt unbekannt. Da erschien am 7. September der württembergische Regierungsrat Parrot in Heilbronn,»Um von der hiesigen Stadt und deren Gebiet... provisorischen Besitz zu ergreifen«. Friedrich wollte nicht mehr länger auf eine de jure Entscheidung in der Sache warten und mit seinem frühen Zugriff einer fremden Besitznahme zuvorkommen. Parrot übergab dem Rat ein herzogliches Reskript, in dem Friedrich von der Sicherstellung der ihm zugefallenen Rechte sprach, und forderte ihn zugleich auf, dem Herzog eine»schriftliche Erklärung«auf diesen Vortrag abzugeben - und das konnte nach Lage der Dinge nur eine positive Resolution sein. Die militärische Besitzergreifung war für den 9. September, morgens 6 Uhr, festgesetzt. Das württembergische Aufgebot zählte 4 70 Mann und wurde von Generalmajor von Mylius befehligt, der Major Stumpe als Stadtkommandant einsetzte. Rasch freundete sich die Bevölkerung mit dem Militär an, das Zucht und Ordnung wahrte. Die Besitzergreifung ließ der Rat dem Kaiser und der Reichsdeputation in Regensburg mitteilen. In den folgenden Wochen informierte sich Parrot eingehend über die politischen, finanziellen, ökonomischen und kirchlichen Verhältnisse der Stadt u.ä. mehr. Württemberg wollte sich möglichst schnell einen fundierten Überblick verschaffen, um eine einwandfrei funktionierende Administration gewährleisten zu können. Am 23. November erschien Parrot abermals als herzoglicher Kommissär auf dem Rathaus, während auf dem Marktplatz das Militär aufmarschierte, und zeigte dem Rat an, daß Herzog Friedrich nunmehr zur Zivil- und damit zur endgültigen Besitzergreifung der ihm zugeteilten Entschädigungsländer berechtigt und er, Parrot, zur Ergreifung dieses Besitzes der hiesigen Stadt und ihres Gebietes beauftragt sei. Der Rat hielt dem einerseits entgegen, daß man der Pflichten gegen Kaiser und Reich noch nicht 105
108 entlassen sei, andererseits gedachte er sich der verlangten Verpflichtung aber auch nicht zu entziehen. Der bisherige Steuerverwalter Schreiber stellte seine Ratsstelle zur Verfügung und entfernte sich, nachdem der Kommissär seine Resignation angenommen hatte. Dann entband Parrot den Rat von seinen Pflichten und bisherigen Funktionen, beließ ihn aber als Munizipal-Magistrat, dessen Geschäfte sich allerdings»blas auf das Innere der Stadt. erstrecken können«, vorläufig im Amt. Die Ratsmitglieder sowie der Syndikus und der Stadtschreiber leisteten Handtreue, ebenso das Stadtgericht und der äußere Rat. Die erste Sit- Das Besitzergreifungspatent Das Besitzergreifungspatent, das über die staatsrechtliche Veränderung informierte, wurde zur allgemeinen Kenntnisnahme am Rathaus angeschlagen. Es hatte folgenden Wortlaut:»Wir Friderich der zweite von Gottes Gnaden Herzog von Württemberg u. Teck etc. entbieten den Burgermeistern und Magistrat, den geistlichen und weltlichen Beamten und Dienern, so wie den sämtlichen Bürgern, Einwohnern und Unterthanen der Reichs-Stadt Heilbronn und des dazu gehörigen Gebiets Unsere Herzogliche Gnade und alles Gute. Da Uns durch die - in Gefolge des Lünveviller Friedens - gepflogenen Unterhandlungen, unter anderen Ländern, Gebieten und Orten, auch die Reichs-Stadt Heilbronn mit dem dazu gehörigen Gebiet, Landeshoheitlichen und sonstigen Rechten, Einkünften und Appertinenzien zur Entschädigung wegen Unserer bisherigen jenseits des Rheines gelegenen, des Friedens willen aber an die Französische Republik abgetretenen Länder und Herrschaften, als eine erbliche Besizung zugetheilt und zugeeignet worden ist; so haben Wir in dessen Gemäsheit und unter den vorliegenden Umständen beschlossen, nunmehr von gedachter Reichs-Stadt und deren gesammten Gebiet, samt allen Landes-hoheitlichen und anderen Rechten, Einkünften und Zuständigkeiten, wirklichen Besiz nehmen zu lassen. Wir thun solches hiemit, und verlangen daher Kraft dieses Patents, von den Burgermeistern und Magistrat, den geistlichen und weltlichen Beamten und Dienern, so wie den sämtlichen Bürgern, Einwohnern und Unterthanen der Reichs-Stadt Heilbronn und des dazu gehörigen Gebiets, weß Standes und Würden sie seyn mögen, so gnädig als ernstlich, daß sie sich Unserer Landes-Hoheit unterwerfen, und ermahnen sie, sich dieser Besiznehmung und dem zu solchem Ende von Uns abgeordneten Civil-Commissario, Unserem Regierungs-Rath Parrot, samt dem von Uns dazu beorderten Militaire-Commandanten auf keine Weise zu widersezen, sondern vielmehr von nun an, Uns als ihren Landes-Herrn anzusehen und zu erkennen, Uns vollkommenen Gehorsam in Unterthänigkeit und Treue zu leisten, sich alles und jedes Recurses an auswärtige Behörden gänzlich zu enthalten, und demnächst, so bald Wir es fordern werden, die gewöhnliche Huldigung zu leisten. Wir ertheilen Ihnen dagegen die Versicherung, daß Wir Uns stets angelegen seyn lassen werden, das Wohl und die Glükseligkeit Unserer neuen Unterthanen nach allem Vermögen landesväterlich zu befördern und zu vermehren, so wie sie sich, im Fall ihres Wohlverhaltens, Unsere Huld, Gnade und besondere Rücksichtnahme zu versprechen haben werden. Sämtliche Diener und Beamte der Stadt und ihres Gebiets sollen vor der Hand in ihren Stellen bleiben, und ihre Amts-Verrichtungen ordnungsgemäß nach dem bisherigen Geschäftsgange fortsetzen. Wir versprechen Uns dagegen von ihnen um so mehr eiri gutes Betragen, als sie dadurch ihr Schiksal für die Zukunft bestimmen, und sich Unseres besonderen Vertrauens würdig machen werden. Damit diese Unsre Erklärung zu Jedermanns Kenntnis gelange, ist solche zum Druk befördert worden, und wollen Wir, daß sie überall, in der Stadt und auf dem Gebiet verkündigt und gehörigen Orts angeschlagen werde. Gegeben in Unserer Residenzstadt Ludwigsburg den 23. Nov Friderich.«106
109
110 gen wurden in drei Landvogteien eingeteilt, Heilbronn wurde Sitz einer derselben mit sechs Ober- und Stabsämtern. Die Stadt erhielt auch selbst ein Oberamt, dem ein Oberamtmann vorstand, außerdem das Oberkonsistorium für die evangelischen Gläubigen Neuwürttembergs sowie ein Dekanatamt. Am 25. Februar 1803 wurde in Regensburg der Reichsdeputationshauptschluß verkündet, der auf der Grundlage des französisch-russischen Entschädigungsplanes zustande gekommen war. Damit wurde die de facto-besitzergreifung Heilbronns durch Württemberg de iure bestätigt. Zugleich erhielt Friedrich von Kaiser und Reich die Kurfürstenwürde zuerkannt. Ausgangs des Organisationsmanifestes vom 1. Januar 1803 hatte Friedrich eine detaillierte Munizipalverfassung angekündigt, die dann auch nach wenigen Monaten erlassen wurde. Eine eigene Organisationskommission, darunter wieder Parrot, stellte sie in Heilbronn vor. Eingesetzt wurde ein Stadtmagistrat, der aus einem Gerichtskollegium, Stadtgericht genannt, und einem Ratskollegium bestand. Dem aus zwei Bürgermeistern und zehn Gerichtsverwandten zusammengesetzten Stadtgericht, das unter dem Vorsitz des Oberamtmanns tagte und seiner Oberaufsicht unterstellt war, kam die eigentliche Verwaltung der Stadt zu. Die erstmalige Besetzung dieses Kollegiums nahm der Landesherr durch Ernennung vor, später durfte sich das Gremium selbst ergänzen. Die Wahl der Kollegen erfolgte auf Lebenszeit. Das Ratskollegium, das sich aus zwölf Mitgliedern rekrutierte, sollte in seiner Gesamtheit nur in bestimmten, nämlich die Allgemeinheit betreffenden Angelegenheiten vom Stadtgericht zu den Beratungen zugezogen werden. Die Konsultation einzelner Mitglieder war stets möglich. Dem Ratskollegium kam also nur untergeordnete Bedeutung zu. Auch die Ratsverwandten wurden zunächst ernannt, sollten später aber von der Bürgerschaft gewählt werden. Zwecks Besetzung des Stadtmagistrats waren von der Organi- Erster Bürgermeister Heilbronns nach Einführung der Munizipalverfassung 1803 war Georg Christian Franz Kübel ( ), den dieses Gemälde im Kreise seiner Familie zeigt. 108
111 sationskommission am 18. Mai 24 Bürger auf das Rathaus beordert worden, wo sie von den Kommissären zu den Munizipalämtern ernannt und sofort verpflichtet wurden. Bestellt wurde auch ein Aktuar, zugleich Stadt- und Amtsschreiber, der für die gesetzmäßige Geschäftsführung verantwortlich war. Von den ehemals reichsstädtischen Bürgermeistern (3), Steuerherrn (4) und Senatoren (8) waren in dem neuen Kollegium nur noch sechs vertreten (5 Stadtgericht, 1 Rat), mehrere traten in den württembergischen Staatsdienst, die übrigen wurden in Pension geschickt. Aus dem Gericht wurden fünf Mitglieder in den Stadtmagistrat gezogen (4 Stadtgericht, 1 Rat), aus dem großen Rat zwei (Ratskollegium). Der Landesherr wollte ganz offensichtlich keine Mehrheit an reichsstädtisch gesinnten Mitgliedern im Stadtmagistrat sitzen haben. Die vier städtischen Dörfer wurden zu selbständigen Kommunen erklärt mit einem eigenen Schultheiß, der Präses des Dorfmagistrats war und dem Oberamtmann untergeordnet. Er wurde auf Vorschlag des Oberamtmanns und des Dorfmagistrats von der Landesherrschaft eingesetzt. Dem Dorfmagistrat gehörten zwei Bürgermeister und drei Magistratsverwandte an, die von der Bürgerschaft auf Lebenszeit zu wählen waren. Die Bevölkerung der Dörfer erhielt die gleichen Rechte wie die der Stadt. Schon zuvor war eine»sonderung des Staats- und Stadteigentums" erfolgt, und die herrschaftlichen und städtischen Einkünfte waren abgeteilt und verzeichnet worden. Der Staat nahm von der Stadt sofort das Syndikatshaus in Besitz (1878 von der Stadt zurückgekauft), das städtische Archivgebäude (1809 gegen das Kraichgauarchiv eingetauscht) und den Grafenwald auf Gruppenbacher Markung sowie vom Kloster Schöntal den Schöntaler Hof mußte die Stadt ihre ansehnliche Bibliothek an das Gymnasium geben, und Württemberg zog das Senioratshaus an sich. Ebenfalls 1803 erwarb der Staat das ehemalige städtische Waisenhaus und richtete es als fürstliches Palais ein. Außerdem verleibte sich Württemberg 1804 das Konventshaus der Karmeliten an der Sülmerstraße ein, das zu einer Kaserne ge- Der Stadtmagistrat 1803 Gerichtskollegium: Erster Bürgermeister Georg Christian Franz Kübel Zweiter Bürgermeister Johann Gottlob Strauß Gerichtsverwandte Friedrich Jakob Krauser Moriz Weisert Johann Karl Immanuel Sonnenmaier Johann Christian Ludwig Gruis Karl Philipp Sicherer Wilhelm Gottlieb Rueff Karl Ludwig Titot Georg Friedrich Bechtberger Johann Ludwig Schreiber Heinrich Müller Heinrich August Bezold August von Backhaus Karl Ludwig Wolf Johann Ludwig Rosa Gottfried Ludwig Kubach Konrad Christoph Neunhöfer Ratskollegium: Ratsverwandte Friedrich Gottlieb Stang Georg Friedrich Gleich Johann Andreas Fuchs Johann Christoph Rudolph Ludwig Friedrich Scherich Bernhard Künzel Aktuar, Stadt- und Amtsschreiber Clemens Bruckmann Rechnungsrevisor Friedrich August Goez 109
112 macht wurde, während die nebenan stehende Nikolaikirche als Zeughaus diente. (An die Krone Bayern fielen 1803 der Kaisheimer Hof sowie der Hipfelhof.) Am 29. Juli 1803 kam der Kurfürst schließlich selbst nach Heilbronn. Von 24 berittenen Kaufleuten an der Markungsgrenze eingeholt, begrüßten ihn vor dem Sülmertor der Magistrat und die Geistlichkeit. Am folgenden Tag zog er in die Stadt ein, um die Huldigung der auf dem Marktplatz versammelten Bürgerschaft entgegenzunehmen. Am Abend fand auf dem Rathaus ein Ball statt, und zur Erinnerung erhielt jeder Bürger 1 Maß Wein. Den III. Koalitionskrieg (1805) mußte Württemberg auf Napoleons Seite mitmachen. Das trug ihm noch einmal beträchtliche Gebietsgewinne und Friedrich die Königskrone ein. Friedrich zog jetzt die in seinen landen gelegenen Besitzungen des Deutschen Ordens sowie der Ritterschaft an sich. Am 27. November 1805 ergriff der hiesige Oberamtmann Besitz von der Deutschordenskommende Heilbronn und ihren Gütern. In den folgenden Tagen vereinnahmte Württemberg auch die deutschordenschen Dörfer, die jetzt ebenfalls Selbständigkeit erlangten. Der Deutschhof in Heilbronn wurde Kaserne für die hiesige Garnison (1848 aufgehoben). Mit der Besitzergreifung der benachbarten ritterschaftlichen Gebiete gelangte das Kraichgauarchiv in Heilbronn an den Staat, wurde aber umgehend der Stadt überlassen. Die Friedrich im Frieden von Preßburg zugestandene uneingeschränkte Souveränität über sein Land versetzte ihn in die Lage, mit der Aufhebung der Verfassung den altwürttembergischen Ständestaat zu zerschlagen. Die Erhebung Württembergs zum Königreich erfolgte zum 1. Januar Am 7. Januar wurden schließlich Altund Neuwürttemberg zu einem Staatswesen vereinigt, das mit dem Hauptorganisationsmanifest vom 18. März 1806 eine Neueinteilung in zwölf Kreise erfuhr. Heilbronn bildete mit noch anderen Oberämtern den dritten Kreis, dem ein Kreishauptmann vorstand. Aufgehoben wurde das 1803 hier eingerichtete Oberkonsistorium, das Land nun in sechs Generalate eingeteilt. Wenige Monate darauf erhielten durch ein königliches Religionsedikt alle christlichen Glaubensbekenntnisse die gleichen Rechte zugestanden. Danach wurde auch in Heilbronn ein katholisches Stadtpfarramt errichtet unter Zuweisung der früheren Deutschordenskirche als Pfarrkirche (später St. Peter und Paul). Die Gründung des Rheinbundes 1806 mit dem gleichzeitigen Austritt von 16 süd- und südwestdeutschen Staaten aus dem Reichsverband, darunter Württemberg, veranlaßte Kaiser Franz II. zur Niederlegung der Kaiserkrone. Damit hörte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zu existieren auf. Die Arrondierung des württembergischen Staatsgebietes kam 1810 zum Abschluß, worauf das Königreich am 27. Oktober eine Neueinteilung nach französischem Vorbild in zwölf Landvogteien (Departements) erfuhr. Heilbronn bildete die sechste Landvogtei mit dem Zusatz»am unteren Neckar" (Departement du bas Necker). Sie umfaßte die Oberämter (Grands baillages) Backnang, Brackenheim, Heilbronn, Neckarsulm und Weinsberg. Ein Landvogt (Grand dossard) stand ihr vor. Neugebildet wurde in eben diesem Jahr die Generalsuperintendenz (heute: Prälatur) Heilbronn mit den Dekanaten Brackenheim, Heilbronn, Lauffen und Neuenstadt. Ebenfalls nach französischem Muster verlieh König F riedrich am 26. Januar 1811 Heilbronn das Prädikat»Gute Stadt". Seit 1811 führte das Stadtgericht die Bezeichnung Oberamtsgericht, und die Gerichtsverwandten nannten sich Oberamtsgerichtsassessoren. Der Oberamtmann als Vorsitzender des Kollegiums hieß Präses. Im Jahre 1811 wurde auch die letzte geistliche Niederlassung in der Stadt aufgehoben, das Klarakloster. Die Insassen erhielten lebenslängliche Pensionen, die Baulichkeiten und Güter zog der Staat ein. Später (1852) machte man aus dem ehemaligen Kloster ein Frauenzuchhaus. Als letztes Relikt der reichsstädtischen Hochgerichtsbarkeit fiel der Galgen auf dem Galgenberg über der Straße nach Weinsberg. Durch königliches Edikt wurde Württemberg 1817 in vier Kreise mit Kreisre : gierungen als Mittelinstanzen und 64 Oberämter als Bezirksverwaltungen eingeteilt. Heilbronn gehörte zum Neckarkreis, dessen Regierung in Ludwigsburg 110
113 ". -". - \,14' < :_ 1 Das ehemalige städtische Arbeits-, Zucht- und Waisenhaus, seit 1803 fürstliches Palais, in dem Herzog Friedrich anläßlich der Huldigung der Heilbronner Einwohnerschaft 1803 abstieg. Stahlstich aus dem Sammelbild»Heilbronn und seine Umgebungen«im Verlag J. U. Landherr in Heilbronn, gezeichnet und gestochen von Theodor Rausche, nach saß. Es war aber weiterhin Oberamtsstadt. Vom Oberamt getrennt wurde das Oberamtsgericht. An die Stelle des Stadtmagistrats trat 1819 ein Stadtrat (bis 1849), dem jetzt die städtische Verwaltung oblag. Er setzte sich aus 18 von der Bürgerschaft auf Lebenszeit (bis 1849) gewählten Mitgliedern zusammen, denen der Ortsvorsteher präsidierte. Dieser wurde vom König ebenfalls auf Lebenszeit ernannt (bis 1891) und führte zunächst den Titel Oberbürgermeister, seit 1823 Stadtschultheiß (bis 1874). Vorausgegangen war bereits die Bildung eines sogenannten Bürgerkollegiums, bestehend aus 1 7 von der Bürgerschaft gewählten Gemeindedeputierten unter dem Vorsitz eines Obmannes, jetzt als Bürgerausschuß bezeichnet. Der Stadtrat mußte ihm von allen wichtigen Verhandlungsgegenständen Kenntnis geben und die Möglichkeit zur diesbezüglichen Äußerung. Dem Bürgerausschuß kam also ein gewisses Mitspracherecht bei den Beschlüssen zu. Damit war jene bis in dieses Jahrhundert hinein bekannte Form der städtischen Verwaltung mit Stadtrat und Bürgerausschuß erreicht. Im Jahre 1819 erhielt Württemberg eine neue Verfassung, und in demselben Jahr noch trat erstmals die Ständeversammlung zusammen. Aufgrund ihres Prädikats»Gute Stadt«durfte sich Heilbronn dort von einem eigenen Abgeordneten vertreten lassen. Als eine der letzten staatlichen Maßnahmen im Rahmen der Annexion Heilbronns ist die Aushebung aller für den Rechtsnachfolger Württemberg rechtlich noch relevanten Dokumente und historisch wichtigen Urkunden und Akten des Heilbronner Stadtarchivs zu sehen, die 1825 für das neu zu gründende Staatsarchiv erfolgte. Die Besitzergreifung Heilbronns durch Württemberg 1802 beendete die Selbständigkeit der Stadt, die über Jahrhunderte einen beständigen Kampf um das Überleben hatte führen müssen. Niemand außer dem Kaiser. Rechenschaft schuldig und nur der Verfassung verpflichtet, hatte der reichsstädtische Rat souverän die Stadt und ihr Gebiet regiert. Mit der Besitzergreifung fand das nicht selten selbstherrliche Regiment des Rats ein sofortiges Ende. Den Bürgerschaftsvertretern auf dem Rathaus waren von Stund an in irgendeiner Form aufsichtführende württembergische Beamte übergeordnet. Von jetzt ab war immer einer da, der dreinreden konnte. Daß die An- 111
114 nexion nicht allenthalben in der Bürgerschaft Freude auslöste, liegt nahe, und manches republikanische Herz mußte es schmerzlich empfinden, als das Stadtwappen am Rathaus vom württembergischen Militär abgeschlagen wurde. Aber man fügte sich dem Unabänderlichen. Eine neue Zeit hatte die ehrsame Stadtrepublik überholt. Es galt nun, der Zukunft zu leben. Und Heilbronn verstand es, die Gunst der Stunde zu nützen, und hat es nicht zu beklagen gehabt, unter dem Zwang fremder Planspiele Württemberg einverleibt worden zu sein, hat das Gemeinwesen doch als württembergische Stadt im 19. Jahrhundert eine ungeahnte Entwicklung erlebt, die es wegen der ihr schädlichen Handelspolitik der Territorialnachbarn als Reichsstadt in diesem Umfang nicht genommen hätte. 112
115 Heilbronn Ein führender Wirtschaftsstandort Württembergs im 19. Jahrhundert Die Heilbronner Oberamtsbeschreibung aus dem Jahre 1903 vermeldet mit Stolz, daß 1896 in der Stadt Heilbronn 58 Fabriken mit rund 9000 Arbeitern gezählt worden sind. Im übrigen Oberamtsbezirk hatten zu diesem Zeitpunkt nur drei Fabriken mit rund 1000 Arbeitern existiert. Alle zusammen brachten sie es auf einen Jahresproduktionswert von 35 Millionen Mark. Die große württembergische Gewerbestatistik von 1895 weist für die Stadt Heilbronn Beschäftigte nach. Davon arbeiteten 8965 Personen in 361 Unternehmen des Handels, des Gewerbes und der Industrie mit sechs oder mehr Mitarbeitern. Nur die Landeshauptstadt Stuttgart rangierte noch vor Heilbronn; Göppingen und Ulm lagen beinahe gleichauf. Das Fundament für diese Entwicklung der Stadt Heilbronn zu einem führenden Wirtschaftsstandort in Württemberg entstand in den Jahrhunderten ihrer reichsstädtischen Geschichte. Neben den günstigen topographischen, klimatischen und verkehrstechnischen Voraussetzungen sollte insbesondere das Nek- 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts: Die finanzkräftige Heilbronner Großhändlerschicht erwirbt Eigentum an zahlreichen Neckarmühlen, um die von ihr gehandelten Rohstoffe auch verarbeiten zu können. 1832: Heilbronn ist die Stadt mit den meisten Fabriken in Württemberg. In der Folgezeit: Insbesondere in den Bereichen Chemie, Metall sowie Nahrungs- und Genußmittel entstehen zahlreiche neue Firmen, andere gehen unter. 1895: Heilbronn hält einen Spitzenplatz als Industriestandort in Württemberg. 1900: Die Einwohnerzahl ist seit 1803 von 5700 auf angestiegen. Auch die Siedlungsfläche hat sich stark ausgedehnt. Die industrielle Entwicklung verliert jedoch an Schwung. karprivileg aus dem Jahre 1333 die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt über Jahrhunderte prägen und auf diese Weise für eine hervorragende Ausgangsposition für die Industrialisierung sorgen. Aus diesem Neckarprivileg erwuchs innerhalb zweier Jahrhunderte ein ökonomisch unschätzbar wertvolles Stapel-und Vorkaufsrecht für alle Transitwaren. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Kranen-, Transport-, Stapel- und Brückenbenutzungsgebühren trugen im laufe der Zeit wesentlich zum Heilbronner Wohlstand bei. Vor diesem Hintergrund entstanden in der Stadt zahlreiche z.t. international operierende Handelshäuser. Für die gewerbliche und später die industrielle Entwicklung spielten insbesondere die vielen vom Neckar betriebenen Mahlwerke eine entscheidende Rolle. Sie konzentrierten sich auf dem Hefenweiler, einer Neckarinsel direkt vor den Toren der Stadt. Dort sollte später folglich auch die Wiege der Heilbronner Industrie stehen. Die gewerbliche Entwicklung im Sinne einer Vorstufe der Industrialisierung setzte in Heilbronn in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein. In dieser Zeit begannen die örtlichen Großhandelshäuser, sich durch Gründung oder Kauf von Mühlenbetrieben im Produktionsbereich zu engagieren. Sie schufen sich damit die Möglichkeit, ihre Handelsprodukte - insbesondere Rohstoffe wie Ölsaaten, Tabak, Gips und Farbhölzer - selbst weiterzuverarbeiten. So bekamen sie neben dem Transport auch die Veredelung in die Hand. Handelshäuser wie Rauch, Rund, Orth, Hahn oder Baumann beschritten diesen Weg und sollten auf diese Weise batd zum Motor der Heilbronner Industrialisierung werden. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur sonst in Württemberg geltenden Regel, daß sich die Industrie meistens aus Handwerksbetrieben entwickelt hat. 113
116 Die Geburtsstunde der chemischen Industrie in Heilbronn schlug Mit der Firma Rund war es erneut ein Handelshaus, das seinen bereits bestehenden Handels- und Fabrikationszweigen die Bleiweißherstellung hinzufügte. Bleiweiß war eine beim Anstreichen häufig verwendete weiße Deckfarbe, die durch Zersetzung von Blei mit Hilfe von Essig- und Kohlensäure erzeugt wurde. Die Farbenherstellung war so erfolgreich, daß die Firma Rund bald alle anderen Geschäftszweige aufgab und ab 1832 nur noch Bleiweiß und Essig produzierte errichtete der Seifensieder und Lichterdreher Friedrich Michael Münzing die erste Schwefelsäurefabrik in Württemberg. Im Bereich der Nahrungs- und Genußmittelindustrie gesellten sich zu der bereits erwähnten Olproduktion auch Tabakfabriken. Als erste engagierte sich hierbei 1803 die Kolonial- und Spezereiwarenhandelsfirma Orth. Für die Folgezeit als sehr bedeutsam sollte sich auch der ab etwa 1840 erfolgte Anbau der Zichorienwurzel als Kaffeezusatz- bzw. -ersatzstoff erweisen. Der aus Braunschweig stammende Kaufmann Carl Heinrich Knorr hatte dies angeregt. Bereits zuvor jedoch hatten die Gebrüder Moriz und Adolf von Rauch als Inhaber eines traditionsreichen Handelshauses einen extremen Schritt der Diversifikation gewagt. Sie hatten sich 1822 entschlossen, ihre Handelsgeschäfte aufzugeben und statt dessen ihre im Familienbesitz befindliche 01- und Tabakmühle für die Papierfabrikation umzurüsten. Sie waren die ersten im süddeutschen Raum, die den Versuch unternahmen, Papier in endlosen Bahnen industriell herzustellen. Und der Erfolg gab ihnen recht. Die althergebrachten Papiermühlen versuchten vergeblich, sich der neuen Konkurrenz zu erwehren. Innerhalb weniger Jahre waren sie durch einen ebenso radikalen wie raschen Umstrukturierungsprozeß fast vollständig vom Markt verdrängt, wenn sie sich nicht selbst auf die neue Technik umgestellt hatten. Während in Württemberg in dieser Phase die Textilindustrie eine Schlüsselstellung einnahm, wurde in Heilbronn die Papierherstellung zum eigentlichen Motor der Industrialisierung. Sie führte auch zum Bau von Heilbronner Papiermaschinen durch Gustav Schaeuffelen und Johann Jakob Widmann. Den Motor der Industrialisierung in Heilbronn bildete der Papiersektor. Die Ansicht der Heilbronner Gebrüder Wolff zeigt auf der linken Seite die Rauchsehe Papierfabrik, rechts die Schaeuffelensche Papiermühle. Lithographie, 1825/35 114
117 Georg Peter Bruckmann ( ) übernahm 1805 die Werkstatt seines Vaters und entwickelte sie zielstrebig zur ersten deutschen Fabrik des Silberwarengewerbes. Ö lgemälde, um 1810 Friedrich Michael Münzing ( ) führte als erster in Württemberg 1830 in Heilbronn die Schwefelsäurefabrikation ein. Er wurde damit zu einem der nväter der chemischen Industrie«. Foto, um 1860 Adolf ( ) und Moriz ( ) von Rauch wagten 1824 einen mutigen Schritt der Diversifikation: Sie wandelten ihr Handelshaus ngebrüder Rauch«in eine Papierfabrik um, indem sie die erste Papiermaschine in Süddeutschland in Betrieb nahmen. Sie verliehen damit der Industrialisierung in Heilbronn und weit darüber hinaus einen wesentlichen Impuls. Ö lgemälde von Carl Doerr, 1815 Natürlich trug aber auch das örtliche Handwerk zur Heilbronner Industrialisierung bei. So gründete Peter Bruckmann 1805 eine Silberwarenfabrik für Bestekke usw. Diese wuchs rasch und sollte für lange Zeit die größte ihrer Art in Deutschland bleiben. Die politische Situation Heilbronns hatte sich 1802/03 durch den Verlust der Reichsfreiheit grundlegend geändert. In den anderen Reichsstädten wandte sich die alte, entmachtete Führungsschicht nach 1803 entsetzt, enttäuscht oder gar angewidert von der Politik ab und zog sich ins biedermeierliche Privatleben zurück. Die Heilbronner reagierten völlig anders. Sie konzentrierten ihre Kräfte auf die Intensivierung von Handel, Gewerbe und Industrie. Der Einsatz von Handelskapital zur Rohstoffbearbeitung mittels Mühlen hatte die Entwicklung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geprägt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verstärkte sich das Engagement der kapitalkräftigen Handelshäuser im gewerblich-industriellen Bereich weiter. Nun traten aber noch neue Elemente hinzu, insbesondere in den Bereichen Chemie, Nahrungsmittel und Papier, wobei jedoch auch hier wieder reiche Großhändler die Initiative ergriffen. 115
118 In der württembergischen Gewerbestatistik des Jahres 1832 stand Heilbronn mit 17 Fabriken vor Stuttgart (14), wurde jedoch mit 450 Arbeitern u.a. von Esslingen mit 640 Arbeitern in sieben Fabriken übertroffen. Zu den Trägern dieser Heilbronner Industrie zählten nach wie vor kapitalkräftige Handelsleute aus der alten Reichsstadtzeit. Denn diese besaßen außer dem Geld auch die Neckarmühlen. Mit Wasserkraft wiederum wurden fast alle um 1830 in Heilbronn laufenden Maschinen angetrieben. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts beschleunigte sich der lndustrialisierungsprozeß. Einige Zweige blühten auf, andere starben ab, neue kamen hinzu. Heilbronn avancierte zu einem Zentrum der Seifen-, Kerzen-, Leim- und später auch der Lackfabrikation. Die Öl-, Tabak-, Zichorien-, Essig- und Branntweinindustrie setzte ihren Aufschwung fort, außerdem begann die Zuckerherstellung aus Zukkerrüben. Die ohnehin nicht bedeutende Heilbronner Textilindustrie ging zurück. Im Bereich des Maschinenbaus und der Eisengießereien entwickelte sich eine sehr breite Basis. Diverse Firmen fertigten eine umfangreiche Produktionspalette: von Lokomotiven über Straßenbaumaschinen bis zu landwirtschaftlichen Maschinen. Das Auf und Ab verschiedener Branchen setzte sich auch in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts fort. Die Nährmittelfabrikation erlebte einen starken Aufschwung. Ab etwa 1870 begann Carl Heinrich Knorr mit der Herstellung von Suppenpräparaten. Andere Nährmittel- und Konservenfabriken folgten. Die Salzwerk Heilbronn AG nahm 1885 die Förderung auf. Die chemische Industrie differenzierte sich aus, und auch die Metallbranche setzte ihren Trend zur Spezialisierung fort. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Heilbronner Industrie einen Höhepunkt und den eingangs erwähnten herausragenden Platz in Württemberg erreicht. Eirie große, von Mai bis September 1897 in Heilbronn abgehaltene Industrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung war für diese exponierte Stellung ein deutliches Symbol. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ebbte die Firmengründungswelle ab. Der eigentliche lndustrialisierungsprozeß kann vor dem Ersten Weltkrieg als abgeschlossen gelten. Trotzdem vollzog sich ständig weiterer Wandel. So brach z.b. die traditionsreiche Kerzenproduktion durch neue technische Entwicklungen etwa im Bereich der Gas- und Elektrolampen plötzlich und schnell zusammen. Dagegen entstanden bedeutende neue Kapazitäten, z.b. im Bereich des Fahrzeug- und Karosseriebaus. Die rasante industrielle Entwicklung in Heilbronn im 19. Jahrhundert ging mit einer enormen Bevölkerungszunahme einher - die Stadt gehörte in Württemberg zu den Orten mit der höchsten Wachstumsrate. Für 1803 läßt sich die Heilbronn er Bevölkerung mit etwa Menschen beziffern, im Jahre 1900 mit Innerhalb eines Jahrhunderts hat sich also die Zahl auf das 6,6fache gesteigert, wobei sich das stärkste Wachstum mit jährlich etwa 3,0 Prozent erst ab 1864 ergab. Der Zuwachs resultierte sowohl aus einem großen Geburtenüberschuß als auch - per saldo - aus Wanderungsgewinnen. Die später nach Heilbronn eingemeindeten Orte Sontheim, Neckargartach und Böckingen wuchsen ebenso merklich an, am extremsten der letztgenannte. Seine Einwohnerzahl explodierte von 1834 bis 1910 auf das 8,4fache. Böckingen entwickelte sich in dieser Zeit zu einer klassischen Arbeiterwohngemeinde. Ein großer Teil seiner in Fabriken arbeitenden Bevölkerung pen- Carl Heinrich Knarr ( ) gründete 1860 eine Großhandelsfirma für Landesprodukte, die sich nach wenigen Jahren auch im Bereich der Nahrungsmittelproduktion betätigte und insbesondere in der Herstellung von Suppenpräparaten hervortrat. Rasch entwickelte sich dieses Haus zur Weltfirma. Ölgemälde von Arthur Geissler, 1944, nach einem zeitgenössischen Foto von Friedrich Berrer 116
119 Das Salzwerk Heilbronn nahm 1885 die Förderung auf. Dem war ein spannender Wettlauf zwischen der Stadt Heilbronn und anderen Mitbewerbern um die Mutungsrechte vorangegangen, den die Kommune für sich entscheiden konnte. Das Salzwerk entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Rechnung vom 9. Juni 1897 :f /.;. /,t', --, -<. -- j# - -f f/,.? 1- delte täglich nach Heilbronn. Die daraus resultierenden Probleme sollten schließlich im Jahre 1933 zur Eingemeindung Böckingens führen. Natürlich nahm nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Siedlungsfläche zu. Noch im Jahre 1830 befanden sich außerhalb des alten reichsstädtischen Kerns keine Wohnsiedlungen und nur wenige gewerbliche Anlagen. Bereits 1856 wurde in Heilbronn die erste gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Württembergs gegründet, um die Wohnungsnot der Industriearbeiter zu lindern. Dies geschah auf Initiative des industriellen Adolf von Rauch. Bis 1870 wuchs die Stadt langsam über die alten Begrenzungen hinaus. Erst danach begann eine stärkere Ausdehnung. Links des Neckars entstand die Bahnhofsvorstadt, auf der rechten Flußseite ein breiter Siedlungsgürtel um die Altstadt. Betrachtet man die Entwicklungslinien der Heilbronner Industriegeschichte des 19. Jahrhunderts, so fallen einige Besonderheiten auf. Üblicherweise geht man davon aus, daß die Industrialisierung aus handwerklichen Wurzeln entstand und zunächst im Textilsektor einsetzte. Für Heilbronn trafen weder die handwerklichen Wurzeln noch die Grund- 117
120 lagen im Textilsektor zu. Träger am Beginn waren hier die reichen Handelshäuser. Diese hatte sich im 18. Jahrhundert - also schon deutlich zuvor - in großer Zahl Neckarmühlen erworben oder errichtet, um mit den von ihnen transportierten Rohstoffen nicht nur handeln, sondern diese auch gleich veredeln zu können. In dieser Rohstoffverarbeitung lag bereits im 18. Jahrhundert aber auch ein Hauptprodukte der wichtigsten Heilbronner Industriebetriebe des 19. Jahrhunderts 1. Nahrungs- und Genußmittel a) Öl: Baumann, Hagenbucher, Hahn, Hauber, Hofmann, Messer, Rund, Sperling und Messer, Volz b) Tabak: Orth, Rainer c) Kaffee-Ersatzstoffe: Cloß, Knarr, Seelig d) Zucker: Zuckerfabrik e) Nährmittel und Konserven: Kaiser-Otto, Knorr, Löwenwerke, Neckarring, Wecker f) Essig und Senf: Lindenmeyer, Lützelberger, Rund, Wecker g) Branntwein, Schaumwein, Sprit, alkoholfreie Getränke: Brüggemann, Kreß, Landauer & Macholl, Löwengardt, Schnitzer, Steigerwald, Strauß, Zeller & Rauch h) Bier: Cluß, Frank, Jakob, Löwen und Adler, Rosenbrauerei 2. Chemische Industrie a) Bleiweiß und Bleizucker: Bläß, Reuß, Rund b) Schwefelsäure und Soda: Böhringer & Klemm (später: Wohlgelegen), Münzing c) Seifen, Kerzen: Heilbronner & Cie., Krämer & Flammer, Münzing, Volz d) Leim bzw. Gelatine: Arnold, Metz (später: Gebr. Victor), Reuß & Söhne (später: Lichtenberger, Firma Wolff & Söhne, Gebr. Koepff) e) Lacke, Firnis, Ölfarben: Krämer & Flammer, Salzer, M. Volz 3. Papierindustrie a) Papierherstellung: Gebr. Rauch, Schaeuffelen b) Vervielfältigungsgewerbe und Verlagswesen: Landerer, Leucht, C. F. Müller, Rembold, Rastert, Salzer, Schell, Schilling, Weber, Gebr. Wolff c) Papierwaren: Baier & Schneider, Berberich, Holzwarth, Koch, Kübler, E. Mayer, C. Müller (später: Backhaus & Cie.), Zimmermann & Moell 4. Textil- und Bekleidungsindustrie a) Spinnerei und Weberei: Begner & Fischer, Bläß, Cotta, J. F. Maier, Oppenheimer & Söhne, Orth & Scheuermann, Pilger, M. Volz b) Tuchmacherei und Bleicherei: Bläß, Krauß, Orth & Scheuermann, Veit (später: Veit & Lutz) c) Zwirnerei: Ackermann d) Bekleidung und übrige Textilverarbeitung: Rieleder, Schwarzenberger, Weppler 5. Metallverarbeitende Industrien a) Sehrotgießerei, Glockengießerei: Hafer, Kiesel, Marchtaler b) Eisengießerei, Maschinenindustrie, Apparate- und Werkzeugbau: Hahn & Göbel, Hoffmann, Maschinenbaugesellschaft Heilbronn, Schaeuffelen, Weipert & Söhne, Widmann, F. A. Wolff & Söhne, J. Wolff & Cie. c) Fahrzeugindustrie: Boie, NSU-Automobilwerke d) Metallwaren: Boie, Bruckmann, Gebr. Dittmar, Kämpff, Martin 6. Sonstige Industrie a) Salzbergbau: Salzwerk Heilbronn b) Schiffs- und Wagenbau: Bauhardt, Diem, Drück c) Orgelbau- und Pianofortefabriken: Berdux, Glaß & Cie., Kulmbach, Nagel, Riedmüller, Schäfer, Uebel & Lechleiter 118
121 Die rasante Entwicklung der Stadt Heilbronn im 19. Jahrhundert spiegelt sich in der flächenmäßigen Größe des Gemeinwesens. Vom 14. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war die übersiedelte Markungsfläche fast unverändert geblieben. Im 19. Jahrhundert beginnt diese jedoch sich rasch auszudehnen. Flächennutzungsplan, 1965 Ansatz zur Industrialisierung. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts sahen die Heilbronner Großhändler eine schlechte wirtschaftliche Zukunft auf sich zukommen. Schuld daran waren Napoleons Kontinentalsperre einerseits und die Aufhebung des Heilbronner Stapelrechts in Verbindung mit dem Bau des Wilhelmskanals andererseits. Dadurch wurde der Neckar bei Heilbronn erstmals seit Jahrhunderten wieder passierbar, und die Handelshäuser waren aller ihrer örtlichen Standortvorteile beraubt. Einige risikofreudige HeilbronnerGroßhändler setzten in dieser Situation das vorhandene Kapital für die Schaffung technologisch völlig neuer Industriezweige ein. Sie schufen sich dadurch jeweils einen beachtlichen Technologievorsprung vor ihrer Konkurrenz. Dabei nutzten sie geschickt die ihnen via Mühlräder zur Verfügung stehende Wasserkraft für den Maschinenantrieb. Als besonders erfolgreich erwies sich der in Süddeutschland erstmals unternommene Versuch der industriellen Papierherstellung. Diese Sparte wurde zum eigentlichen Motor der Industrialisierung in Heilbronn. Trotzdem entwickelte sich keine Monostruktur, sondern eine bunte Branchenvielfalt - nicht zuletzt auch deshalb, weil der Heilbronner Wirtschaftsstandort so attraktiv war, daß potentielle Firmengründer und sogar schon bestehende Unternehmen in die Stadt kamen. Die Industrialisierung verlief so stürmisch, daß die Stadt zum Ende des 19. Jahrhunderts einen Spitzenplatz im Königreich Württemberg einnahm. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sie ihren Höhepunkt jedoch überschritten. 119
122 »Edle Menschen und nützliche Bürger«Schulwesen, Lehrer und berühmt gewordene Schüler»Der Endzweck der hiesigen Lehranstalt ist: den Verstand der Zöglinge zu erleuchten, Herz und Willen derselben zum Guten hinzuleiten und sie mit schätzbaren Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten, damit sie edle Menschen und nützliche Bürger des Vaterlandes werden mögen." In einer 1831 erlassenen Schulordnung wurde das als Erziehungsziel des hiesigen Carolinums formuliert. So hieß seit die Nachfolgeeinrichtung des alten reichsstädtischen Gymnasiums. In den l 820er Jahren hatte die Stadt weder Mühen noch finanzielle Lasten gescheut, um diese althergebrachte Schultradition zu bewahren, die sie durch Pläne der württembergischen Schulbehörde gefährdet sah. Die drohende Herabstufung des Heilbronner Gymnasiums in ein Lyceum konnte durch zwei Maßnahmen verhindert werden: durch den Neubau eines Schulhauses an der inneren Karlstraße und durch eine Neustrukturierung. Zu den Gymnasialklassen kamen nun erstmals sogenannte Realklassen hinzu. Schon im Verlauf des 18. Jahrhunderts war das Bewußtsein dafür gewachsen, daß angesichts der Fortschritte in Industrie und Wissenschaft die traditionellen Formen der Schulbildung nicht mehr ausreichend seien. Jahrhundertelang hatte es nur zwei Möglichkeiten gegeben: entweder in den sogenannten Deutschen Schulen lediglich Grundkenntnisse in der Religion, im Lesen, Schreiben, in der deutschen Sprache und im Rechnen zu erwerben oder die Lateinschulen/Gymnasien zu besuchen und dort vor allem Latein und Griechisch zu lernen, die als unablässige Voraussetzung für jede höhere Bildung sowie für ein wissenschaftliches Studium angesehen wurden. Die sogenannten»realien«wie Geographie, Geschichte, Mathematik, Naturlehre, moderne Sprachen kamen in beiden Einrichtungen zu kurz. Bereits im 18. Jahrhundert forderten deshalb Verfechter des Realunterrichtes, daß der Lehrstoff vorwiegend an der praktischen Brauchbarkeit für die späteren Berufe der Schüler ausgerichtet sein sollte.»so kamen... zu den früher bestehenden Schulen noch... hinzu... Real : Julius Robert Mayer, Stadtarzt, Naturforscher : Ludwig Pfau, Schriftsteller. 1827: Aus dem städtischen Gymnasium wird das staatlich anerkannte Carolinum : Gustav von Schmoller, Nationalökonom : Hugo Heermann, Geigenvirtuose. 1845: Helene Heermann, Harfenistin, in Heilbronn geboren : Alfred Schliz, Stadtarzt, Prähistoriker. 1854: Gründung der Gewerblichen und Kaufmännischen Fortbildungsschule. 1871: Einrichtung der landwirtschaftlichen Winterschule. 1873: Trennung von Karlsgymnasium und Realanstalt in zwei eigene Schulen. 1876: Gründung der Mädchenmittelschule und der Frauenarbeitsschule. 1879: Das bisher private Töchterinstitut wird zur staatlich anerkannten öffentlichen Höheren Mädchenschule. 120
123
124 chenklassen in den umgebauten Resten des Franziskanerklosters am Hafenmarkt. Die drei höheren Schulen erhielten im Verlauf der l 880er Jahre Neubauten in dem damals gerade erst erschlossenen Viertel jenseits der Allee: Das Karlsgymnasium bezog 1880 sein Domizil an der Ecke Karl- und Friedensstraße (heute: Gymnasiumstraße), die Höhere Mädchenschule das ihrige an der Ecke Turm- und Gartenstraße im Jahre Zuletzt fertiggestellt wurde 1889 das Gebäude für die Realanstalt am Kaiser-Wilhelm-Platz (heute: Friedensplatz). Dort erhielt auch die Gewerbliche und Kaufmännische Fortbildungsschule ihre Räumlichkeiten, die am 1. September 1854 als zweite ihrer Art in Württemberg ins Leben gerufen worden war. Lediglich Stuttgart war dem Aufruf einer»königlichen Kommission für gewerbliche Fortbildungsschulen«schneller gefolgt als Heilbronn wurde die kaufmännische Abteilung als selbständige Handelsschule abgetrennt und mit in dem Gebäude des Karlsgymnasiums untergebracht. Ende des 19. Jahrhunderts befanden sich die landwirtschaftliche Winterschule in der Karlstraße 4 und die Frauenarbeitsschule in der Lohtorstraße 36. Ganz gleich, wie ihre jeweilige Schullaufbahn ausgesehen haben mag und was sie über ihre hiesige Schulzeit dachten - das Heilbronner Gymnasium kann sich einiger Schüler rühmen, die in ihren späteren Lebensjahren in den unterschiedlichsten Bereichen höchst erfolgreich und weit über Heilbronn hinaus bekannt und bedeutend wurden. Fünf von ihnen sollen hier vorgestellt werden.»der jüngste Sohn,... Robert, wurde früh schon zum Studium der Medizin bestimmt. In frühen Knabenjahren waren ihm schon chemische und physikalische Experimente, die Konstruktion der Wassermühlen seiner Vaterstadt viel anziehender als das vorgeschriebene Studium der lateinischen und griechischen Sprache, was ihm vielfältig die Unzufriedenheit seiner Lehrer zuzog." So erinnerte sich der wohl bedeutendste Heilbronner, Julius Robert Mayer, ein Jahr vor seinem Tode in einem autobiographischen Text an seine wenig glückliche Schulzeit. Bis 1829 besuchte er das Heilbronner Gymnasium, wechselte dann bis 1831 in das Seminar Kloster Schöntal, wo er sich allerdings ebenso intensiv und erfolglos mit den alten Sprachen beschäftigen mußte. Die Fächer, die den späteren Arzt und Naturwissenschaftler wirklich inter- Die Realanstalt (heute: Robert-Mayer-Gymnasium) am Kaiser-Wilhelm Platz (heute: Friedensplatz) kurz nach ihrer Fertigstellung. Foto,
125 Ein um 1850 hergestelltes hämodynamisches Modell aus dem Nachlaß von Robert Mayer. Foto, l., essierten, Physik und Chemie, wurden nicht gelehrt, lediglich in Mathematik konnte er zeigen, was in ihm steckte, und mit guten Noten aufwarten. Nach der Reifeprüfung in Stuttgart studierte er Medizin in Tübingen und promovierte 1838 zum Dr. med. et chir. Während seiner ersten Anstellung als Schiffsarzt auf einem holländischen Segelfrachtschiff, das von Rotterdam nach Java unterwegs war, machte er die Beobachtungen, die den gedanklichen Ausgangspunkt für seine spätere grundlegende Erkenntnis über die Umwandlung von Wärme in Bewegung und von Bewegung in Wärme bildeten. Es dauerte viele Jahre, bevor die bereits 1842 erstmals veröffentlichten Entdeckungen des ab 1841 als Heilbronner Stadtarzt tätigen Robert Mayer Anerkennung durch die Fachwissenschaft erlangten. Der lange Kampf um eine gerechte Beurteilung seiner Leistung trug zusammen mit anderen persönlichen Gründen dazu bei, daß Robert Mayer 1850 einen körperlichen und seelischen Zusammenbruch erlebte, der ihn zu mehreren Aufenthalten in Nervenheilanstalten zwang. Dennoch hatte er das Glück, alt genug zu werden, um seinen späten Ruhm noch miterleben zu können: Ab 1858 wurde er mit Orden und Anerken- Robert Mayer über seine Entdeckungen, 1874:». der junge Mann kam... in seine Vaterstadt zurück, voll von der auf dieser Reise [nach Java] ihm klar gewordenen Idee, daß Bewegung und Wärme nur verschiedene Erscheinungsformen einer und derselben Kraft seien und daß folglich auch Bewegung oder mechanische Arbeit und Wärme, welche man bis dahin meistens als ganz verschiedenartige Dinge angesehen hatte, sich ineinander umsetzen und verwandeln lassen müssen. Die Hauptfrage i!:lt hierbei aber die: Wie viel braucht man Bewegung, um ein bestimmtes Maß von Wärme hervorzubringen, oder aber wie viel Wärme muß aufgewendet werden, um ein bestimmtes Quantum von Bewegung zu erzeugen?... Mayer [berechnete] diese Verhältniszahl, welche man das mechanische Äquivalent der Wärme heißt, so genau es zu jener Zeit möglich war, aus der Wärmemenge..., welche sich bei der Gaskompression entwickelt. «In einer späteren Abhandlung legte er dar,»... wie sämtliche mechanische Leistungen des Tierkörpers auf Kosten eines langsamen Verbrennungsprozesses vor sich gehen, daß also bei den Tieren wie bei den Dampfmaschinen die Bewegungsproduktion an einen Wärmekonsum geknüpft ist.«auch beschrieb er die»dymanik des Himmels«:»Bis dahin hatte man sich nur über die Bahnen der Himmelskörper mittels des Gravitationsgesetzes Rechenschaft geben können, das Leuchten der Sterne, das Wärmen der Sonne als selbstredende Tatsachen hingenommen. Die mechanische Wärmetheorie erst lehrt diese Tatsachen begreifen und berechnen.«123
126 nungen geradezu überschüttet. Durch das Ritterkreuz des Verdienstordens der württembergischen Krone, das er verliehen bekam, wurde er in den persönlichen Adelsstand erhoben und konnte sich fortan»von Mayer«schreiben. Eigentlich war das Prädikat»Cum laude«für sein Abiturzeugnis vorgesehen. Doch weil Ludwig Pfau, einer der begabtesten Schüler des Heilbronner Gymnasiums, eine bissige Satire über den Rektor geschrieben hatte, wurde als Strafe dafür dieser Zusatz wieder gestrichen. Der Abiturient des Jahres 1838, vom Vater, dem Kunstgärtner Philipp Pfau, zum Studium der Theologie bestimmt, verweigerte sich diesen Plänen und trat in die väterliche Gärtnerei ein. Während eines Volontariats in einem großen französischen Gartenbetrieb verlagerten sich seine Interessen. Er zog ins nahgelegene Paris und beschäftigte sich mit Literatur und Kunst. Nach seiner durch den Militärdienst erzwungenen Rückkehr nach Heilbronn studierte Ludwig Pfau Philosophie in Tübingen und Heidelberg. Vor allem in der badischen Universitätsstadt machte er Bekanntschaft mit dem Gedankengut des Vormärz und schloß sich der demokratischen Bewegung an. Ab Ende gab er in Stuttgart die illustrierte satirische Wochenzeitung»Eulenspiegel«heraus, das erste politische Karikaturblatt in Deutschland. Dieses gewann bald große Popularität, und Pfau wurde zu einem führenden Kopf des schwäbischen Aufstandes 1848/49. Für seine revolutionären Aktivitäten wurde er 1852 zu 21 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die saß er allerdings nicht ab, da ihm bereits 1850 die Flucht in die Schweiz gelungen war. Später lebte er in Paris. Im Jahre 1863 eröffnete ihm eine Amnestie den Weg zurück nach Württemberg. Doch der weiterhin überzeugte Achtundvierziger fühlte sich unter den hier herrschenden politischen Verhältnissen nicht wohl. So pendelte er oft zwischen Paris und Stuttgart und veröffentlichte Zeitungsartikel in beiden Ländern. Beim Ausbruch des deutsch-französischen Krieges 1870 aus Frankreich ausgewiesen, kehrte er endgültig nach Stuttgart zurück. Noch zweimal mußte er sich wegen politischer Publikationen vor Gerichten verantworten und wurde jeweils zu Haftstrafen verurteilt. Gegen Ende sei-?lboiji 3u mcrfcn! -!ljltin lit!itt.f.im Q:lrofeffor, fönnm 6it mir nidit 3rmonten a!g.f.iof mti tr iür n tmpfef)fen? a!m tinrn orbrnllicf/m 'ljlmjcf/m, feinrn fo brmofratifrf/ 91jinnt <U tf)ut mit hib, ba fonn id/ nicf;t birnrn; bit orbm1licf/rn!ljlen i en jinb aue bemofmiid/ 91jinnt. nes Lebens wurde es ruhig um ihn. Doch ganz vergessen war er nicht. So verlieh ihm seine Heimatstadt Heilbronn in Anerkennung seiner hervorragenden Bedeutung als Schriftsteller und Dichter zu seinem siebzigsten Geburtstag 1891 das Ehrenbürgerrecht.»Von den Lehrern des Untergymnasiums habe ich bis heute die Empfindung, daß sie alle nicht sehr viel taugten.. Um so höher standen die Lehrer des Obergymnasiums; zwar fehlten auch da die Nieten nicht: Prof. Finkh tat alles, was er konnte, um uns die griechische Lektüre langweilig zu machen.. Um so höher stand der Unterricht von Prof. Rieckher, und das Beste war der Unterricht von Rektor Mön[ni]ch in Geschichte und deutscher Literatur.«So erinnerte sich der 1908 geadelte Gustav von Schmoller an»meine Heilbronner Jugendjahre«. Er wuchs im Kameralamtsgebäude am Ende der östlichen Kramstraße auf, das 1894 abgebrochen wurde. Sein Vater, Ludwig Schmoller, war 1833 als Kame- Karikatur aus der von Ludwig Pfau herausgegebenen illustrierten satirischen Wochenzeitung neulenspiegel«, Jahrgang 1849, Nr
127 Das 1702 erbaute, 1894 abgebrochene Kameralamt am Ende der Kramstraße zwischen Schulund Präsenzgasse, in dem Gustav von Sehmol /er seine Kindheit verbrachte. Foto, um 1890 ralverwalter nach Heilbronn gekommen und erhielt»als Zeichen der Hochachtung und des Dankes der bürgerlichen Kollegien«für seine hier geleistete Arbeit 1863 das ehrenhalber verliehene Bürgerrecht der Stadt. Gustav Schmoller legte nach dem Besuch des Heilbronner Gymnasiums in Frühjahr 1856 in Stuttgart seine Reifeprüfung ab. Bis zum Herbst arbeitete er in der Kanzlei seines Vaters mit, wo er praktische Erfahrungen für sein dann in Tübingen aufgenommenes Studium der Kameralwissenschaft sammeln konnte. In das Heilbronner Kameralamt kehrte er nochmals 1861 als Referendar zurück, nachdem er seine Studien erfolgreich abgeschlossen hatten. Den zweiten Teil des Referendariats absolvierte er beim Württembergischen Statistischen Amt, dessen Leiter damals Gustav Rümelin war. Dieser hatte ebenfalls vielfältige Beziehungen nach Heilbronn, wo er als Sohn des langjährigen Oberamtsrichters Ernst Gustav Rümelin zusammen mit seinem Jugendfreund Robert Mayer aufgewachsen war. Später lehrte er einige Jahre lang Latein am hiesigen Gymnasium und heiratete 1847 Gustav Schmollers Schwester Marie. Rümelin übertrug seinem jungen Schwager die Auswertung der 1861 durchgeführten württembergischen Gewerbezählung, die 1862 veröffentlicht wurde.»diese Arbeit wurde für mich deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie wesentlich dazu beitrug, mir im Frühjahr 1864 einen Ruf als außerordentlicher Professor in Halle einzutragen«, erinnerte sich Gustav von Schmoller am Ende seines Lebens. Damit begann seine wissenschaftliche Laufbahn, die ihn über Zürich und Straßburg schließlich nach Berlin führen sollte. Schmollers Forschungen basierten auf einem beschreibend-statistischen Ansatz und beschäftigten sich weniger mit Theoriebildung. Er wurde zum führenden Vertreter der jüngeren historischen Schule der deutschen Volkswirtschaftslehre, die- im Gegensatz zum klassischen Liberalismus - der Auffassung war, daß der Staat zur Entschärfung der Klassengegensätze und zur Förderung des sozialen Friedens wirtschafts- und sozialpolitisch eingreifen müsse. Durch zahlreiche Publikationen, durch die von ihm herausgegebenen Jahrbücher und als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des 1872 ins Leben gerufenen Vereins für Socialpolitik gewann Schmoller großen Einfluß sowohl auf die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland wie auf die praktische Politik des Kaiserreiches.»Vorerst mußte für meine allgemeine Bildung Sorge getragen werden. Im Heilbronner Gymnasium, das ich besuchte, waltete damals noch ein... Lehrsystem, bei dem körperliche Züchtigung eine große Rolle spielte.... Mit großem Jubel begrüßte ich daher meines Vaters Entschluß, mir Privatunterricht erteilen zu lassen.«so berichtete ein musikalisches Wunderkind von dem großen Einschnitt in seinem Leben. Der Heilbronner Hugo Heermann trat bereits als Elfjähriger gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Helene - er spielte Geige, sie Harfe - öffentlich in Wildbad auf. Unter den Zuhörern befand sich auch Gioacchino Rossini, der sich dort gerade zur Kur aufhielt. Der berühmte Komponist war von dem jungen Geiger so begeistert, daß er dem Knaben dringend empfahl, sein Geigenspiel am Konservatorium in Brüssel zu vervollkommnen. Anläßlich seiner Weiterreise von Wildbad nach Bad Kissingen machte Rossini sogar extra in Heilbronn Station, um Heermann mit einem entsprechenden Empfehlungsschreiben zu versehen. Und er hatte sich nicht getäuscht, was das Talent des Heilbronners anging. Heermann wurde erfolgreich und berühmt als Geigenvirtuose und -lehrer. Er gehörte zum Freundeskreis von Klara Schumann, Pauline Viradot und Johan- 125
128 nes Brahms. Auch Helene Heermann, über deren weiteren Lebensweg weniger bekannt ist, war überdurchschnittlich musikalisch begabt und erhielt ebenfalls qualifizierten Unterricht. Zumindest bis zu ihrer Heirat 1875 trat sie als Künstlerin auf, immer wieder auch in gemeinsamen Konzerten mit ihrem Bruder, dessen Berühmtheit sie allerdings nicht erreichte. Die Musikalität der Geschwister und deren Förderung gingen auf ihre Mutter, Sofia Albertina Heermann, geb. Rümelin, eine Cousine des erwähnten Gustav Rümelin, zurück, wie der Sohn in seinen Erinnerungen berichtet:»ihre ganze Hoffnung setzte sie aber auf die musikalische Begabung ihrer Kinder, denn ihre Musikfreudigkeit war auf sie übergegangen."»geschichte und Naturkunde hatten das besondere Interesse des Jungen.. Seinen Lehrern fiel oft die Originalität seiner Gedanken und eine angeborene künstlerische Begabung auf, die sich im Zeichnen und Modellieren kundtat«, berichtet Alexander Renz über die Gymnasialzeit von Alfred Schliz. Nach dem Abitur studierte der Sohn des Heilbronner Stadtarztes Dr. Adolf Schliz Medizin in Tübingen, Freiburg, Leipzig, Berlin, Prag und Wien. Dann kehrte er nach Heilbronn zurück, wo er 1877 beruflich die Nachfolge seines Vaters antrat. In dieser Position kümmerte er sich intensiv um die öffentliche Gesundheitspflege, besonders wichtig waren ihm die Tuberkulosefürsorge und das Desinfektionswesen. Das war zwar verdienstvoll, machte aber nicht den Kern seiner späteren Berühmtheit aus. Im Jahre 1899, als Fünfzigjähriger, veröffentlichte er einen Artikel»Die Bevölkerung des Oberamts Heilbronn, ihre Abstammung und Entwicklung«, durch den er seinen Ruf als Prähistoriker und Anthropologe begründete und der ihm den Titel Hofrat eintrug. Bis zu seinem Tod 1915 publizierte er ingesamt rund hundert weitere Schriften und Abhandlungen über seine umfangreichen frühgeschichtlichen Forschungen. Gleichzeitig war er der Vorsitzende des Historischen Vereins Heilbronn und maßgeblich an der Neuordnung und Vervollständigung der Bestände des Historischen Museums beteiligt, dem er alle bei seinen Ausgrabungen, die er auf eigene Kosten durchführte, gefundenen Gegenstände vermachte. Auf sein Betreiben hin wurde in der Leichenhalle des Alten Friedhofs zum 100. Geburtstag von Robert Mayer, am 25. November 1914, ein naturkundliches Museum eröffnet, das zunächst den Namen seines großen Vorgängers im Amt des Stadtarztes trug, 1935 aber in Alfred Schliz-Museum umbenannt wurde. Am 4. Dezember 1944 ging mit der Stadt nahezu die gesamte Hinterlassenschaft von Hofrat Schliz in den Flammen des Bombenangriffs unter. Im Zusammenhang mit den technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die das 19. Jahrhundert mit sich brachte, fand auch im Bereich des Schulwesens ein erheblicher Wandel statt. Neben die traditionellen Gymnasien und Volksschulen, deren Lehrpläne ebenfalls erweitert wurden, traten neue Schultypen: an den»realien«ausgerichtete Mittelschulen sowie berufliche Fortbildungsanstalten, die sowohl den kaufmännischen und gewerblichen wie den landwirtschaftlichen Sektor abdeckten. Die von der Industrialisierung geprägte bürgerliche Gesellschaft hatte qualitativ völlig andere Erwartungen und Ansprüche an das Grund- und Fortbildungswesen als die ihr vorausgegangene ständische Gesellschaft des Alten Reiches. Daß der Erneuerungsprozeß der Schulen langsam vor sich ging und für einige speziell begabte Schüler möglicherweise zu spät kam, zeigen die vorgestellten Lebensläufe. Trotz schulischer Unzulänglichkeiten ist es dennoch allen von ihnen gelungen, ihre ganz besonderen Talente zu entwickeln und auszuüben. 126
129 Vereine, Feste, Zirkel Die moderne bürgerliche Gesellschaft formiert sich 1814: Gründung der Harmoniegesellschaft. 1818: Gründung des Singkranzes. 1840: Heilbronner Sänger- und Musikfest. Das freie Vereinswesen gilt als ein wesentliches, ja konstitutives Merkmal der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Dessen waren sich auch schon die Vertreter eben dieser bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert bewußt. Gerade in der Zeit des Vormärz entfaltete sich in Deutschland das Vereinswesen in starkem Maße. Diese Entwicklung ist in Heilbronn besonders deutlich zu beobachten. Hier entstanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschiedene Vereinsformen. Dabei lassen sich vier Typen unterscheiden: der allgemeine, gesellige Verein, der Gesangverein, der Turnverein und der Honoratiorenzirkel. Als Beispiel für einen allgemeinen, geselligen Verein sei die Harmonie-Gesellschaft angeführt. Sie ist heute in Heilbronn durch den Namen der Stadthalle noch gegenwärtig. Deren Vorgängerbau wurde 1876/78 von der Harmoniegesellschaft als»vereinshaus«errichtet. Diese Harmoniegesellschaft hatte sich 1814 gebildet. An den Gesellschaftsabenden durften junge Männer ab 18 Jahren teilnehmen. Die»jungen Frauenzimmer«, so die Satzung, mußten das 15. Lebensjahr zurückgelegt haben. Die Vereinsaktivitäten zielten in verschiedene Richtungen. Erstens wurde für Lesestoff gesorgt. In den l 840er Jahren hatte die Harmoniegesellschaft ungefähr 20 Zeitungen und Journale abonniert, 1845: Gründung der Turngemeinde und der Gräßle-Gesellschaft. 1846: Heilbronner Turnfest. davon zwei in französischer Sprache. Auch eine Bibliothek existierte. Deren Bestand wuchs bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf über Bände an. Zweitens wurden jeden Freitag Herrenabende abgehalten. Angesagt waren dabei»wirtschaft, Tabakrauchen und Spiel«. Drittens fanden dienstags unterhaltende Abende statt - hier waren auch die»frauenzimmer«dabei, und viertens organisierte die Harmoniegesellschaft große Einzelveranstaltungen wie Maskenbälle oder Feuerwerke. Der zweite Typ, der Gesangverein, entstand in Heilbronn im Jahre Damals wurde der Singkranz gegründet, der heute zu den ältesten noch bestehenden Gesangvereinen in Deutschland zählt. In den ersten zwei Jahrzehnten seines Bestehens stand als Vereinsziel aber die Geselligkeit deutlich mehr im Vordergrund als die Musik. Öffentliche musikalische Auftritte fanden nur sehr selten statt. Dessen ungeachtet war der Andrang von Sängern groß. So konnte man es sich leisten, das Mindestalter für die Aufnahme in den Chor auf 30 Jahre festzusetzen und von den Aktiven einen spürbaren Monatsbeitrag zu verlangen. Wenn sich auch die Männer in der Überzahl befanden, so öffnete sich der Singkranz früher als andernorts üblich den Frauen. Insgesamt wirkten im Gesangverein bald etwa 70 bis 80 aktive Personen mit. Ab den 1840er Jahren gab der Chor verstärkt auch öffentliche Konzerte. Dadurch schwoll die Zahl der passiven Mitglieder kräftig an. Ebenso wurde der Zuhörerandrang bei den Aufführungen immer größer. Der Konzertsaal war sogar regelmäßig überfüllt. Offenbar gelang es nicht einmal mehr, allen passiven Mitgliedern die gewünschten Eintrittskarten zu geben - von den sonstigen Interessenten ganz zu schweigen. So sah sich der Verein dazu genötigt, beitrittswillige passive Interessenten abzu- 127
130 weisen bzw. eine Höchstzahl von Mitgliedern (100 männliche Personen) zu definieren. Der Singkranz spielte im kulturellen Leben der Stadt eine bedeutende Rolle. Insbesondere dessen Oratorien-Aufführungen gehörten zu den musikalischen Höhepunkten. In diesem Zusammenhang kam es 1863 zu einer schweren Auseinandersetzung. Der Singkranz wollte Haydns»Schöpfung«in der Kilianskirche aufführen. Er formulierte deshalb ein Gesuch zur Überlassung des Gotteshauses. Dieses Ansinnen wurde vom Kirchengemeinderat jedoch abgelehnt, weil die Schilderung des ersten erschaffenen Menschenpaares in den Bereich der»getrübten erotischen Poesie«gehöre. Dieser Einschätzung wollte der Singkranz aber nicht folgen und wandte sich deshalb an die vorgesetzte Stuttgarter Kirchenbehörde. In der Landeshauptstadt hob man das Verbot des Heilbronner Gremiums wieder auf. So durfte Haydns Werk in Kilian erklingen. Aus Protest gegen diese Entscheidung aus Stuttgart traten aber konsequenterweise fast alle Kilians-Kirchengemeinderäte zurück. Der dritte Typ, der Turnverein, entstand in Heilbronn 1845 als Turngemeinde. Deren Vereinsziel war die»bildung von Körper und Geist«. Es wurde also nicht nur geturnt; darüber hinaus fungierte man bei Feuersbrünsten auch als Hilfsmannschaft der Feuerwehr. Außerdem wurden historische Vorträge veranstaltet, Theaterstücke aufgeführt und Gedichte vorgetragen. In der allgemeinen Begeisterung am Beginn der 1848er Revolution wurden die Mitglieder sogar bewaffnet und die Turngemeinde in eine T urnerwehr umfunktioniert. Mit dem Ende der Revolution brach der Verein allerdings beinahe zusammen. Die Mitgliederzahl war von über 200 auf zwölf geschrumpft. Trotzdem konnte er sich konsolidieren und in der Folgezeit zu neuer Größe aufsteigen. Der vierte Vereinstyp, der Honoratiorenzirkel, wird in Heilbronn repräsentiert durch die Gräßle-Gesellschaft. Am 1. März 1845 gründeten verschiedene angesehene Männer mit beruflich exponierter Stellung in der Wirtschaft des Bäckers Christoph David Gräßle eine geschlossene Gesellschaft, die sich nach ihrem Versammlungslokal benannte. Sie trafen sich regelmäßig und pflegten den interessanten, oft lustigen und immer tiefgehenden Gedankenaustausch - jenseits aller politischen und religiösen Bindungen. Vom spezifischen Wissen jedes einzelnen konnten immer alle anderen profitieren. Als zentrale Figur und führender Kopf der Gründungszeit wirkte der Heilbronner Spitalarzt Dr. Philipp Friedrich Sicherer ( ). Der rothaarige, bärtige und später eher massiv gebaute Mann ging breit gestreuten Interessen nach. Er war witzig, temperamentvoll, derb, aber gütig und bis zum Schrullenhaften originell. Als Mediziner trat er u.a. dadurch hervor, daß er als erster Im Jahre 1845 gründeten Männer mit exponierter beruflicher Stellung die Heilbronner Gräßle-Gesellschaft. Dieser Honoratiorenzirkel trifft sich bis zum heutigen Tage regelmäßig zum Gedankenaustausch. Foto,
131
132 Gräßle-Bundeslied David Friedrich Strauß dichtete folgende Verse, die zum»bundeslied" der Gräßle-Gesellschaft wurden: Hellauf, da sind wir wieder Im weiten Ahnensaal Wir engverbundnen Brüder, Beim trauten Bundesmahl. Es blickt auf uns herunter Sein Auge wie ein Stern Drum Brüder, frisch und munter1 Das freut den hohen Herrn. Nein, wir sind keine Gleißner, Das Lautre lieben wir, Drum haben wir zum Meißner Verlegt das Hauptquartier. Sein Wein geht ein, wie Honig, So lieblich und so glatt, Und läuft er einst auch konig, Wir werden ihn nicht satt. Und tun die Feuergeister Des edlen Weins sich kund, Dann öffnet unser Meister Den lang verschlossnen Mund: Die Zeiten, die nicht mehr sind, Macht seine Rede neu, Und wo wir alle her sind, Sagt er uns ohne Scheu. Jetzt ohne viel Geplänkel Im edlen Kraftgefühl Setzt Schubarts hoher Enkel Sich zu Gesang und Spiel. Auf goldner Töne Flügeln Führt uns sein Zauberstab Von Schwabbachs Rebenhügeln Zum fernen Hoffnungskap. Und ist das Lied verschollen, Verglüht des Tages Strahl, So heben wir die vollen Pokale noch einmal: Noch oft, wie heute, werde Uns solcher Hochgenuß! - Jetzt Meister, du zu Pferde - Und wir in Omnibus. Großkaufmann, Landtagsabgeordneter und Finanz-Staatsrat (»Minister«) in der Stuttgarter Märzregierung. Seinem unermüdlichen Bemühen war es mit zu verdanken, daß Heilbronn an die erste württembergische Eisenbahnstrecke angeschlossen wurde. Für die lokale Politik von besonderer Bedeutung war Gräßle-Mitglied Heinrich Titot ( ). Er lenkte seit 1835 die Geschicke von Heilbronn als Stadtschultheiß, mußte im Revolutionsjahr 1848 zurücktreten und versah später die Stelle des Oberamtspflegers. Außerdem verfaßte er verschiedene Schriften, etwa die erste Heilbronner Oberamtsbeschreibung. Die Vereine und Gesellschaften hatten für das Leben in Heilbronn und z.t. auch in seinem Umland enorme Bedeutung. Die großen Turner- und Sängerfeste in den 1840er Jahren entfalteten darüber hinaus überregionale Wirkung. Sie waren Ausdruck einer neuen nationalen Gesinnung, die sich in der Zeit des Vormärz insbesondere in den Städten ausbreitete und sportliche bzw. musikalische Zielsetzungen mit politischen und sozialen Ideen verband. So wurde z.b. das Heilbronner Sänger- und Musikfest an Pfingsten 1840 zu einem Großereignis, wel.ches die ganze Stadt mit Stolz erfüllte. Uber 1200 Sänger aus verschiedenen Staaten in Süddeutschland zogen durch die Straßen von Heilbronn. Zu einem Höhepunkt wurde die Aufführung des ersten Teils des Mendelssohn-Oratoriums Paulus in der Kilianskirche. Dabei wirkten fast 200 Aktive mit. Nie zuvor hatte dieses Gotteshaus ein solch gewaltiges Aufgebot erlebt Zuhörer sollen dem Großereignis beigewohnt haben. Noch eindrucksvoller verlief das Turnfest Es war das erste seiner Art mit nationalem Anspruch. Die Heilbronner Stadtverwaltung formulierte den Turnern als Willkommensgruß:»Ihr stählt den Leib zum starken Geisteskleid von Deutschlands jungem Stamm das Mark zu werden.«und sogar Turnvater Jahn ließ ein Gedicht überbringen:»wahrhaft und wehrhaft im Wandel Ehrlich und wehrlich im Handel Rein und ringfest im Rath Tugendhaft tüchtig zur That Keusch und kühn in der Kunst Unbekümmert um Gunst Hoch lebe das deutsche Jungthum!«Es wurde geturnt - in Riegen und an Geräten, es wurde marschiert - in gro- 130
133
134 Katzenmusiken, Volksversammlungen, Meuterei Die 1848er Revolution Revolutionen haben in Heilbronn keine große Tradition. Der Stadt ging es - unter dem Strich betrachtet - spätestens seit dem 15. Jahrhundert immer wieder so gut, daß innerstädtische Umsturzgedanken kaum je die Oberhand gewannen. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts bestand eine andere Situation. Heilbronn sah sich 1802/03 seiner reichsstädtischen Rechte und Freiheiten beraubt. Der noch nicht erloschene alte Freiheitsgedanke führte teilweise zu einer latent vorhandenen Oppositionshaltung gegenüber der neuen württembergischen Obrigkeit. Zu der Änderung der politischen Großwetterlage gesellten sich tiefgreifende wirtschaftliche und soziale Umwälzungen durch die in Heilbronn besonders stürmisch verlaufende Industrialisierung und das damit verbundene starke Bevölkerungswachstum. Zu den in anderen Städten, wie Stuttgart oder Ulm, 1847 auftretenden Brotunruhen oder Hungerkrawallen infolge der Wirtschaftskrise und Mißernten 1846/47 kam es hier nicht. Trotzdem hatte auch hier vielerorts die Not zugenommen. Ende Februar erfuhr man in Heilbronn von der Einführung der Republik in Frankreich. Diese Nachricht wirkte wie eine Aufforderung zur Nachahmung. Ab Anfang März kam es in der Stadt - wie in vielen anderen Orten auch - zu den typischen Aktionen der Revolution. Überall beliebte Ausdrucksformen waren dabei die Volksversammlungen. Anfänglich noch illegal, mußten sie bald von den Regierungen sanktioniert werden. In Heilbronn beteiligten sich meist mehr als 1000 Menschen daran, einmal sollen es sogar gewesen sein. Sie wurden üblicherweise am Wochenende und unter freiem Himmel anberaumt. Es traten Redner auf, welche die Gedanken der Revolution mit pathetisehen Worten unter das Volk brachten bzw. einen aktuellen Vorgang diskutierten. Blumen und Girlanden schmückten oft die Stadt bzw. den Versammlungsplatz, die Veranstaltungen nahmen z.t. beinahe Festcharakter an. Diese Volksversammlungen gehörten zu den typischen Errungenschaften der Revolution. Befand sich das revolutionäre Geschehen auf einem Höhepunkt, so fanden sie in dichter Folge und mit großer Teilnehmerzahl statt. Ebenso häufig griffen die Menschen zum Mittel der Katzenmusik. Auch hierin stand Heilbronn den vielen anderen Stätten der Revolution in nichts nach. Bei 2. März 1848: Erste Bürgerversammlung. ab Anfang März 1848: Zahlreiche Katzenmusiken und Volksversammlungen. 9. März 1848: Der Heilbronner Adolf Goppelt übernimmt als Märzminister«in Stuttgart das Departement der Finanzen März 1848: Die zu gründende Bürgerwehr erhält Waffen aus Stuttgart; Stadtschultheiß Titot tritt zurück. 25. April 1848: Louis Hentges wird als Abgeordneter in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt Juni 1848: Das in Heilbronn stationierte 8. Regiment stellt sich auf die Seite der Revolutionäre. Württembergische Truppen beenden den Aufstand. Mitte September 1848: Die Frankfurter September-Unruhen greifen auf Heilbronn über. Sie werden durch Verhaftungen beendet. 5. Juni 1849: Die bewaffnete Turnerwehr rückt nach Baden aus Juni 1849: Die Bürgerwehr greift zu den Waffen. Württembergische Truppen besetzen daraufhin Heilbronn. Der Aufruhrzustand wird verhängt. Die Revolution ist für die Stadt damit beendet. 132
135
136 Diese Taktik erwies sich jedoch sehr schnell als Mißerfolg. Deshalb entstand hier, wie auch in anderen Zentren der Revolution, bald doch eine Bürgerwehr. In ihr gingen hauptsächlich die bereits vorhandenen vier wehrhaften Vereinigungen auf: die Bürgergarde zu Fuß (1830 gegründet, ca. 110 Mann), die Bürgergarde zu Pferd (1836 gegründet, ca. 30 Mann), die Turnerwehr (ein Ableger der 1845 gegründeten Turngemeinde) und die Feuerwehr (1847 ins Leben gerufen). Die Mitgliederzahl der Bürgerwehr wuchs bis Oktober 1848 auf über 1250 an. Ihr Auftrag lautete, Verfassung und Gesetz zu schützen sowie öffentliche Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Wenn die Revolution in Heilbronn hohe Wellen schlug, blieb die Bürgerwehr regelmäßig unsichtbar - nicht zuletzt deshalb, weil viele ihrer Mitglieder selbst auf der Gegenseite mitmarschierten. Erst im Juni 1849 sollte sie durch einen militärischen Einsatz Schlagzeilen machen. Die Idee der Volksbewaffnung löste bereits im März 1848 den Rücktritt des Heilbronner Stadtschultheißen Heinrich Titot aus. Als sein Nachfolger wurde Rechtskonsulent August Klett gewählt. Dieser hatte sich zuvor in seinen Funktionen als örtlicher Stadtrat und Landtagsabgeordneter als Liberaler profiliert. Ein anderer örtlicher Abgeordneter kam in den ersten Tagen der Revolution zu noch größeren politischen Ehren. Am 9. März berief der König führende Oppositionelle in die Regierung; in diesem Zusammenhang übernahm Adolf Goppelt als»märzminister«das Departement der Finanzen. Er war eine weithin geachtete Persönlichkeit, die sich große Verdienste um ihre Vaterstadt erworben hatte. Ganz anders verlief dagegen die politische Karriere von Louis Hentges. Der Heilbronner Bierbrauer und Gastwirt war vor den Tagen der Revolution politisch noch kaum in Erscheinung getreten. Aber bei den örtlichen Volksversammlungen fiel er rasch als leidenschaftlicher Redner auf. Hentges erlangte schnell enorme Popularität, so daß er am 25. April mit großer Mehrheit als Abgeordneter in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt wurde. Im Februar 1849 legte er sein Mandat jedoch wieder nieder, weil er mit dem damaligen Gang der Verhandlungen nicht einverstanden war. Die Anhänger der Revolution bildeten in Heilbronn - wie auch andernorts - keine homogene Einheit. Der eher gemäßigten Gruppe um Louis Hentges stand eine radikalere Ausrichtung um August Ruoff gegenüber. Ihre Entsprechung fand diese Polarisierung weiter Teile der Bevölkerung in der inhaltlichen Ausrichtung der beiden örtlichen Tageszeitungen. Die eine Seite sah sich im traditionsreichen, gemäßigt-liberalen»intelligenzblatt«repräsentiert. Es ist sicher kein Zufall, daß Der Bierbrauer und Löwenwirt Louis Hentges ( ) trat 1848 in der Revolutionsbewegung als begabter Redner hervor. Am 25. April 1848 wurde er für die Oberämter Heilbronn und Neckarsulm in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt. Er legte sein Mandat am 1. Februar 1849 aus Protest gegen den Gang der Frankfurter Verhandlungen nieder. Stahlstich von L. Barth nach einem Foto von Vogel, 1848 Adolf Goppelt ( l 800- l 875) hat sich auf verschiedenen Gebieten große Verdienste um seine Vaterstadt Heilbronn erworben. Er wurde 1848 von König Wilhelm 1. als»märzminister«zum Chef des Departements der Finanzen berufen. Foto, um
137 dieses nach 104jähriger Tradition ausgerechnet im April 1848 seinen Namen änderte und fortan die neutralere Bezeichnung»Heilbronner Tagblatt«führte. Auf der anderen Seite agierte das wesentlich revolutionärer gesinnte»neckar Dampfschiff«. Diese Zeitung war 1842 vom Heilbronner Bürger und Buchdrukker August Ferdinand Ruoff gegründet worden. Der hatte das Blatt zwar kurz vor Beginn der Revolution verkauft, er heizte die Stimmung aber durch dort veröffentlichte entsprechende Artikel kräftig an. Die Spaltung in der Bevölkerung prägte auch die Gründung von politischen Vereinen, die ebenfalls zu den typischen Elementen der Revolution zählten. Noch im März 1848 entstand nach badischem Vorbild ein Vaterländischer Verein, dessen Führung mehrheitlich der radikaleren Richtung zuneigte. Er stellte jedoch spätestens Mitte 1848 seine Tätigkeit wieder ein. Statt dessen bildete sich der»demokratische Verein", welcher sich am 4. August seine Statuten gab. Betrachtet man den zeitlichen Ablauf der Revolution, so lassen sich in Heilbronn verschiedene Phasen voneinander unterscheiden. Die Bewegung begann am 2. März 1848 mit einer Bürgerversammlung. In den nächsten Tagen folgten mehrere Katzenmusiken, z.b. gegen Stadtschultheiß Titot und unliebsame Beamte wie den Ungeldkommissär (Finanzbeamter) Nast und den Oberfeuerschauer Omeis. Später war u.a. auch Kameralverwalter Schmoller an der Reihe. Innerhalb weniger Tage spitzte sich die Situation so zu, daß der Stadtschultheiß zurücktrat. Gleichzeitig begann die Bildung der Bürgerwehr, die dann Anfang April formal abgeschlossen war. In dieser Zeit fanden fast wöchentlich Volksversammlungen im»löwen" statt. Das Geschehen verdichtete sich immer mehr, um schließlich im Juni einen ersten Höhepunkt zu erreichen. Die Vertreter der Revolution hatten erkannt, daß es wichtig wäre, das Militär auf ihre Seite zu ziehen. Am 14. Juni fanden zwei Bürgerversammlungen statt. Daran nahmen auch zahlreiche Soldaten des in Heilbronn stationierten 8. Regiments teil. Es wurden Forderungen an die Staatsregierung formuliert, welche auf die Stärkung der Rechte und die Verbesserung der Situation der Soldaten zielten. Beinahe 500 Regimentsangehörige traten dieser Resolution bei. Niedergeschrieben hatte die Forderungen Fourier Hartmann, der auch an einer Bürgerversammlung teilnahm. Er hätte zum Zeitpunkt der Versammlung jedoch eigentlich Dienst gehabt, wurde deshalb von dort weggeholt und wegen Dienstversäumnisses arre- 1 Jahre 1805 kam der aditionsreiche Deutsch >f in den Besitz Würt 'mbergs und wurde zur aserne umfunktioniert. n Juni 1848 verbrüderte eh das dort stationierte. Regiment mit den evolutionären. Dies er- 1gte weithin Aufsehen nd rief die württemberische Militärmacht auf en Plan. Die Heilbronner leuterer wurden nach udwigsburg abgeführt nd z. T. vor ein Kriegsericht gestellt. Lithograhie der Gebrüder Wo/ff,
138 stiert. Diese Maßnahme wiederum heizte die bereits emotionsgeladene Stimmung weiter an. Eine große Menschenmenge zog vor die Deutschhofkaserne. Der Militärbefehlshaber forderte bei der Bürgerwehr Hilfe an. Diese griff jedoch nicht ein, weil sich viele ihrer Mitglieder ebenfalls unter den Demonstranten befanden. Die Menge erzwang die Freilassung Hartmanns und zweier weiterer Soldaten, die wegen Ausschreitungen gefangengesetzt waren. Im Triumph zogen sie zum»löwen«zurück und feierten ihren Sieg. Gegen Abend marschierte unter einer schwarz-rot-goldenen Fahne das Militär zusammen mit zahlreichen Bürgern auf den Turnplatz beim Schießhaus. Dort unterzeichneten viele weitere Soldaten das am Vormittag erstellte Dokument. Danach begaben sich alle zusammen über den Marktplatz zum»löwen«zur Schlußversammlung, bei der sich schließlich eine bisher in der Stadt noch nie gesehene Menschenmenge eingefunden haben soll. Anschließend kehrten die Soldaten in die Kaserne zurück. Am Abend des folgenden Tages zogen Arbeiter und einige Soldaten nach Weinsberg und erzwangen die Freilassung von vier inhaftierten Bauernführern. Ihren Höhepunkt erreichte die Bewegung am 16. Juni mit der»völligen Verbrüderung zwischen Militär und Volk«. In dieser Situation wurden in Stuttgart 3400 Soldaten in Bewegung gesetzt, um das revolutionär gesinnte 8. Regiment aus der Stadt zu entfernen. Gegen 8 Uhr am nächsten Morgen marschierten die regierungstreuen Truppen in Heilbronn ein. Sie wurden angesichts ihres militärischen Potentials freundlich empfangen und bewirtet - vor allem mit Alkohol. Dies geschah möglicherweise, um den übermächtigen Militärapparat gnädig zu stimmen, vielleicht sogar auch, um die fremden Soldaten auf die Seite der Revolution zu ziehen. Unabhängig davon boten umliegende Städte und Gemeinden, insbesondere Hall, den Heilbronnern ihre Hilfe an. All di s nützte jedoch genauso wenig wie der Versuch der Menge, das Kasernentor zu blockieren. Die aus Stuttgart angerückte Militärmacht war zu stark. Bald führten die Soldaten aus der Landeshauptstadt ihre rebellierenden Kollegen ab. In Ludwigsburg wurde das 8. Regiment»gesäubert«. Ein Kriegsgericht sprach im Dezember 1848 gegen 25 Regimentsangehörige z.t. harte Strafen aus. Mit der Meuterei des 8. Regiments hatten die Vorgänge den lokalen Rahmen gesprengt und weithin Aufsehen erregt. Nach deren militärischer Beendigung kühlte die revolutionäre Stimmung in der Stadt deutlich ab. Es folgte eine Phase der relativen Ruhe. Im September spitzte sich die Lage ein zweites Mal zu. Den Grund dafür lieferten äußere politische Ereignisse. Einerseits zeitigte die Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung über die Daseinsberechtigung des Adelsstandes Auswirkungen. Unter diesem Aspekt wurde z.b. das württembergische Parlament als nicht mehr zeitgemäß abgelehnt. Andererseits gab die Abtretung von Schleswig im Rahmen des am 26. August zwischen Preußen und Dänemark geschlossenen Waffenstillstandes von Malmö Anlaß zur Unzufriedenheit - die»nationale Entrüstung«erfaßte auch Heilbronn. Die in diesem Zusammenhang stehenden»september-krawalle«in Frankfurt griffen schnell auch hierher über. Am 10. September sah die Stadt erstmals wieder eine sehr große Volksversammlung Menschen sollen daran teilgenommen haben. Dabei trat unter anderen Theobald Kerner als Redner auf. Er äußerte den berühmten Satz Lorenz Brentanos:»Der, den man Hochverräter nennt, ist mein Freund.«Am 18. und 19. September kam es zu Ruhestörungen. Etwa gleichzeitig bildete sich der»verein patriotisch gesinnter Jungfrauen zur Fertigung scharfer Munition«, was ebenfalls ein überregionales Echo auslöste - überhaupt beteiligten sich die Frauen aktiv am revolutionären Geschehen. Stuttgart setzte in den nächsten Tagen unter einem Vorwand Soldaten Richtung Heilbronn in Bewegung. Ende des Monats wurden die Hauptredner der Septemberversammlung und die sonstigen Anführer verhaftet. Zumindest äußerlich kehrte danach wieder Ruhe ein. Auch der Anstoß für das dritte Aufflammen der Revolution in Heilbronn kam von außerhalb. Es ging um die Problemfelder»Staatsoberhaupt«und»Reichsverfassung«. Während hier in einer Volksversammlung am 24. Februar 1849 die 136
139 Blick auf den Wartberg, das beliebte Ausflugsziel der Heilbronner, mit Gasthof und Turm. Im Hintergrund liegt Neckargartach. Gouachemalerei von Carl Doerr; um
140 rilbrowr SftrgtrwtlJr wurde in Heilbronn - wie auch andernorts - eine Bürgerwehr ins leben gerufen. In ihr gingen verschiedene bereits bestehende wehrhafte Vereinigungen auf. Sie sollte die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Im Gegensatz zu diesem Auftrag blieb sie jedoch meist gerade dann unsichtbar, wenn die Revolution hohe Wellen schlug. Erst im Juni 1849 machte sie durch ihren militärischen Auszug nach Baden Schlagzeilen. Die Typendarstellung zeigt von links nach rechts: Turnerschütze, Turnersensenträger, Pompierwehrmann, Adjudant der reitenden Bürgerwehr, Oberjäger der Scharfschützenwehr, Feuerwehroffizier. Scharfschütze, Pompier Sappeur, Feuerwehrtrommler, Scharfschützenhornist. Auf der Abbildung fehlen die Wehrmänner des 1. Banners, welche ein»käppi«trugen. Kolorierte Lithographie 138
141 Im Jahre 1842 wurde ein regelmäßiger Dampfbootverkehr mit Heidelberg aufgenommen (in der Bildmitte links ist der Heilbronner Hafen zu sehen), 1848 erhielt Heilbronn eine Eisenbahnverbindung nach Stuttgart (in der Bildmitte rechts fährt ein Dampfzug in den Bahnhof). Die Stadt, die hier von Westen dargestellt ist, war somit auf der Achse Stuttgart - Heidelberg zur Verbindungsdrehscheibe zwischen den beiden damals modernsten Verkehrsmitteln geworden. Kolorierte Lithographie, um 1855, lithographiert von Eberhard fmminger, gezeichnet von Johannes Läpple 139
142 Nach Fertigstellung einer Eisenbahnverbindung von Stuttgart nach Heidelberg brach der Heilbronner Güterschiffsverkehr stromabwärts sofort zusammen. Als Reaktion ersann man die Neckar Kettenschleppschiffahrt, die im Bereich des Transports von Massengütern konkurrenzfähig arbeiten konnte. Die Darstellung zeigt Heilbronn von Südwesten, auf dem Neckar ist im Vordergrund ein Ketten-Schleppschiffzug zu erkennen. Chromlithographie, nach
143 Die Revolutionsfahne der Turner Nachdem die Turngemeinde zu Beginn der Revolution in eine Turnerwehr umfunktioniert worden war, erboten sich die»jungfrauen Heilbronns", für die wehrhaften Turner eine Fahne anzufertigen. Die Vereinsführung nahm dankend an und äußerte den Wunsch nach den»deutschen Farben«Schwarz-Rot-Gold. So machten sich über 100 junge Damen ans Werk und nähten. Als die Revolution kippte, war natürlich auch die symbolhafte Fahne aufs höchste gefährdet. Zum Schutz vor dem Zugriff der Reaktion wurde sie deshalb in die Schweiz gebracht. Nach einiger Zeit kam sie heimlich wieder nach Heilbronn zurück, und zwar in den Besitz der Jungfrauen. Dadurch wurde die Fahne zum Auslöser schwerster Verwicklungen. Es kam wegen der Eigentumsfrage zur Zerreißprobe. In der Revolutionszeit war ja die Turngemeinde zur Turnerwehr geworden, und die Jungfrauen hatten die Fahne für die Turnerwehr genäht. Nach der Revolution gab es selbstverständlich keine Turnerwehr mehr und somit auch keinen Fahneneigentümer. Aber natürlich betrachtete sich die Turngemeinde als Rechtsvorgängerin und Rechtsnachfolgerin der Turnerwehr. Die Turngemeinde bat deshalb die Jungfrauen, ihren Besitzanspruch durch Unterschrift zu bestätigen und die Fahne wieder herauszugeben. Dieses Hin und Her erregte die Aufmerksamkeit der politisch reaktionären Obrigkeit, denn eine schwarz-rot-goldene Fahne konnte von dieser selbstverständlich nicht geduldet werden. So kam es zur Hausdurchsuchung bei Henriette Betz, die sich bezüglich der Fahne besonders engagiert hatte und wohl deshalb aufgefallen war. Die Aktion verlief jedoch ergebnislos. Henriette Betz hatte das inkriminierte Stück nämlich in ihr Sofa eingenäht und auf diese geniale Weise dem Zugriff der Häscher entzogen. Dieser mutigen und listigen Frau ist es wohl auch zu verdanken, daß schließlich fast alle der 104 Fahnenproduzentinnen damit einverstanden waren, dieses Symbol des ungebrochenen Widerstandes der Turngemeinde zu übergeben. Einsetzung eines vom Volk gewählten Präsidenten gefordert wurde, fiel die Entscheidung in der Nationalversammlung am 27. März für das Erbkaisertum. Auserkoren wurde der Preußenkönig, Friedrich Wilhelm IV der jedoch am 3. April die ihm angetragene Würde ablehnte. Die nächste Heilbronner Volksversammlung fand am 15. April in der Nikolaikirche statt. Hauptforderung war die Annahme und Umsetzung der Reichsverfassung durch Württemberg. Jeden Tag reisten Ausschußmitglieder des Demokratischen Vereins per Eisenbahn nach Stuttgart, um sich eine unmittelbare Anschauung vom dortigen Gang der Ereignisse zu verschaffen. Sie kehrten mit dem letzten Zug zurück und schilderten der allabendlich auf dem Marktplatz versammelten Menge die neuesten Entwicklungen. Die Situation spitzte sich erneut zu. Zwar erkannte der württembergische König am 24. April die Reichsverfassung an, er ergriff jedoch keine Maßnahmen zu deren konkreten Umsetzung. Die Anfang Mai in Baden und der Rheinpfalz ausgebrochenen Aufstände heizten die Stimmung in Heilbronn weiter an. Versammlungen, Katzenmusiken und Aktionen der Bürgerwehr hielten die Bevölkerung in Atem. Am 5. Juni griff die Turnerwehr zu den Waffen und rückte unter Führung von August Bruckmann zur Unterstützung der badischen Freischaren aus. Sie schloß sich damit dem Ausmarsch von Hanauer Turnern an. Diese beiden Turnergruppen hatten sich nämlich drei Jahre zuvor beim 1846 in der Neckarstadt abgehaltenen großen Turnfest des Schwäbischen Kreises kennengelernt und angefreundet. Knapp 40 der Turner aus Heibronn fanden sich im Juli 1849 nach verschiedenen Kampfhandlungen in einem Berner Internierungslager wieder. Am Morgen des 9. Juni wurden die noch in der Stadt verbliebenen Bürgerwehreinheiten auf dem Exerzierplatz auf die Reichsverfassung vereidigt. Über 1000 Bewaffnete bekundeten durch Unterschrift ihre Solidarität mit dem Frankfurter Parlament, dessen Rest inzwischen als»rumpfparlament«nach Stuttgart übergesiedelt war. Die württembergische Regierung beobachtete diese jüngste Entwicklung in 141
144 Heilbronn mit Argwohn. Am 12. Juni ließ sie die Stadt mit 4000 Soldaten besetzen. Das Militär sollte die Bürgerwehr entwaffnen. Mit seiner Anwesenheit erreichte es jedoch zunächst nur eine völlige Solidarisierung der Bevölkerung mit der Bürgerwehr. Fast unverrichteter Dinge verließen die Soldaten abends Heilbronn wieder. Zwei Stunden später versammelte sich die bewaffnete Bürgerwehr, etwa 900 Mann, auf dem Marktplatz. Einige zu diesem Zeitpunkt noch unbewaffnete Fabrikarbeiter und Handwerker stürmten das Rathaus und brachten sich gewaltsam in den Besitz darin gelagerter Waffen. Danach zog die Schar zum Exerzierplatz weiter. Ein Teil der Revolutionäre kehrte vor Mitternacht wieder in die Stadt zurück. Der Rest teilte sich in zwei Gruppen auf. Etwa 200 Mann marschierten als»westkorps«über Wimpfen ins Badische. Sie beteiligten sich dort an den Auseinandersetzungen und wurden Ende des Monats teilweise in der Festung Rastatt eingeschlossen. Etwa 300 Bewaffnete zogen als»ostkorps«nach Löwenstein. Sie zerstreuten sich aber schnell und versuchten, nach Heilbronn zurückzukehren. Etwa 10 Prozent der Leute schlugen sich ebenfalls in Richtung Baden durch. Der Rückzug des württembergischen Militärs am Abend des 12. Juni war nur ein taktisches bzw. sicherheitstechnisches Manöver gewesen. Am nächsten Morgen wurde die Stadt erneut besetzt, der Aufruhrzustand verhängt und die verbliebene Bürgerwehr vollständig entwaffnet. Für Heilbronn war die Revolution, die turbulent bzw. teilweise sogar spektakulär verlaufen ist, damit beendet. Der Aufruhrzustand wurde zwar bereits am 9. Juli 1849 wieder aufgehoben, das Militär verließ die Stadt aber erst am 23. Februar Die Gemeinde mußte die Quartierkosten übernehmen. Bis 1852 fanden viele Prozesse auch gegen die örtlichen Anführer der Revolution statt, einige von ihnen erhielten harte Strafen. So wurde August Bruckmann, der mit der Turnerwehr ausgerückt war, zu einer lebenslangen Zuchthaushaft verurteilt /52 erfolgte schließlich die Aufhebung der 1848/49 errungenen Grundrechte. Damit war die Revolution - zumindest kurzfristig betrachtet - vollkommen gescheitert. Faßt man das Heilbronner Geschehen während der Revolutionszeit 1848/49 zusammen, so ergibt sich ein vielschichtiges Bild. Zahlreiche Ereignisse wie die Volksversammlungen, Katzenmusiken und Aufmärsche fanden in vergleichbarer Weise auch andernorts statt. Sie waren örtliche Reaktionen auf lokale, nationale oder internationale Vorkommnisse. Trotzdem hob sich Heilbronn aber durch deren Intensität, Häufigkeit und Umfang zumindest von der umliegenden Region ab. Besonders deutlich aus diesem Rahmen des Üblichen fallen jedoch drei Ereignisse: die Verbrüderung des 8. Regiments mit dem Volk im Juni 1848, der militärische Ausmarsch der Turner im Juni 1849 und die Beteiligung der Bürgerwehr an der badischen März-Revolution Sie gehen weit über das durchschnittliche Maß an revolutionärem Geschehen hinaus und weisen Heilbronn als durchaus besondere Stätte der Revolution von 1848/49 aus. 142
145 Technologieregion Heilbronn Glanzlichter aus dem 19. Jahrhundert 1842: Die Begeisterung für zukunftsweisende Technologien schlug in Heilbronn erstmals vor der Mitte des 19. Jahrhunderts hohe Wellen. Dabei ging es um die von James Watt ab 1765 in Maschinen gebändigte Dampfkraft. Diese wurde zunächst in Form von stationären Dampfmaschinen für die rasch aufstrebende Heilbronner Industrie nutzbar gemacht. Ab etwa 1830 begeisterte man sich in der Stadt für den Gedanken der Dampfschiffahrt, ab 1835 kam zusätzlich die Dampfeisenbahn ins Spiel. Die Dampfschiffahrt war auf dem Bodensee und auf dem Rhein bereits in Gang gekommen. Nun strebte Heilbronn die Einrichtung einer solchen auch auf dem Neckar an. Gedacht war dabei in diesem Zusammenhang sowohl an den Personenverkehr als auch an das Schleppen von Güterschiffen. Als Hauptprobleme bei der Umsetzung dieses Vorhabens erwiesen sich einerseits die zu geringe Wassertiefe und andererseits die oft engen Kurven des Flusses. Gutachten ergaben, daß eine Neckardampfschiffahrt nur realisierbar sei, wenn praktisch das Regelmäßige Dampfschiffahrten zwischen Heilbronn und Heidelberg. 1848: Heilbronn erhält einen Eisenbahnanschluß. 1852: Erste öffentliche Gaslampen. 1878: Kettenschleppschiffahrt auf dem Neckar. 1886: Öffentliches Telefonnetz. 1892: Heilbronn wird von außerhalb mit Drehstrom versorgt. 1897: Gewerbeausstellung; elektrische Straßenbahn. gesamte Flußbett korrigiert würde. Dies wiederum hätte einen enormen finanziellen Aufwand erfordert, und somit war die Verwirklichung des gesamten Projektes in weite Ferne gerückt. Zu diesen finanziellen Schwierigkeiten gesellten sich bürokratische und technische Probleme, die insgesamt beinahe unüberwindlich schienen. Aber Heilbronn gab nicht auf, sondern setzte auf Kreativität. Um die Geldprobleme in den Griff zu bekommen, wurde 1839 eine Aktiengesellschaft zur Finanzierung gegründet. Abgesehen davon, suchten die Kaufleute und die Stadtspitze zusammen nach einer intelligenten technischen Lösung, um das teure und schwierige Projekt von einer ganz anderen Seite her realisieren zu können. Diese Lösung fanden sie schließlich in Frankreich. Dort waren sie nämlich auf Dampfschiffe mit besonders geringem Tiefgang gestoßen. Die extrem flache Konstruktion dieser Boote machte die meisten der bisher für zwingend gehaltenen Korrekturen am Neckar-Flußbett unnötig. Allerdings stellten sich der Einführung der Neckardampfschiffahrt noch viele weitere Hindernisse in den Weg. Trotzdem verfolgte Heilbronn sein Ziel hartnäckig weiter und schuf Mitte 1841 mit der Bestellung eines Dampfbootes in Nantes (Frankreich) Fakten. Als dieses noch im selben Jahr auf dem Wasserweg in Heilbronn eintraf, wurde es begeistert begrüßt. Zum ersten Male war ein Schiff - es war vom Typ»Inexplosible«-»aus eigener Kraft«den Neckar aufwärts bis nach Heilbronn gefahren. Im Frühjahr 1842 begannen dann die regelmäßigen Fahrten: Täglich konnte man nun per Schiff nach Heidelberg gelangen. Schon Ende 1841 war ein zweites, 1843 ein drittes Dampfboot bestellt worden - am Kauf des letzteren beteiligte sich der württembergische Staat sogar finanziell in erheblichem Umfang. 143
146 Massive Probleme bereitete in der Praxis jedoch der sehr hohe und damit enorm teure Kohleverbrauch der Schiffe. Heilbronn versuchte diese Schwierigkeit mit Hilfe einer revolutionären umwelttechnologischen Idee zu lösen. Man plante, in den Kessel der Dampfmaschine ein Röhrensystem einzubauen, durch das nicht nur die Heizwärme, sondern auch die Abgase und der Rauch geleitet wurden. Damit sollte die Dampferzeugungsfläche vergrößert und folglich der Wirkungsgrad deutlich heraufgesetzt werden. Die wirklich erfolgreiche Realisierung dieser Idee gelang 1846 mit französischer Hilfe. Die Betriebskosten konnten dadurch so stark gesenkt werden, daß die Schiffe fortan Gewinn abwarfen wurde sogar ein täglicher Doppeldienst zwischen Heilbronn und Heidelberg eingerichtet. Im gleichen Jahr fuhr die erste Dampflokomotive in Heilbronn ein. Auch dafür hatte man hier hart und engagiert gekämpft. Als also 13 Jahre zuvor - zwischen Nürnberg und Fürth die erste deutsche Dampfeisenbahn verkehrt hatte, war auch in Heilbronn ein regelrechtes Eisenbahnfieber ausgebrochen. Wie schon beim Dampfschiff machten sich wiederum insbesondere die örtlichen Kaufleute zusammen mit der Stadtspitze für einen Eisenbahnanschluß stark. Zunächst brachten diese Bemühungen keinen Erfolg. Die Heilbronner Idee, eine Privateisenbahn nach Stuttgart zu bauen, wurde vom württembergischen König abgelehnt. Kurzfristig betrachtet, verliefen alle Heilbronner Bemühungen erfolglos im Sande. Als sich der Staat Württemberg im Jahre 1843 aber dann zum Bau einer Eisenbahn in staatlicher Regie entschloß, konnte die Neckarstadt doch noch die Früchte ihrer Aktivitäten ernten. Sie wurde zum Endpunkt der (zunächst einzigen) württembergischen Strecke, die den Nekkar bei Heilbronn über Stuttgart mit der Donau bei Ulm und dem Bodensee verband. Ahnlich wie 1841 das erste Dampfschiff, wurde 1848 auch der erste Eisenbahnzug begeistert aufgenommen. Die beiden Schwestern - Dampfboot und Dampflokomotive - ergänzten sich hervorragend. Die Eisenbahn aus Richtung Stuttgart endete in Heilbronn, die Schiffahrt in Richtung Heidelberg begann hier. Ihre Fahrpläne wurden aufeinander abgestimmt. Die Züge brachten Fahrgäste aus Richtung Stuttgart zum Neckarschiff in Richtung Heidelberg. Umgekehrt wurden die Schiffe zu Zubringern aus dem nördlich von Heilbronn gelegenen Nekkartal in Richtung Stuttgart. Die Stadt war - aus eigener Initiative - zur Verbindungsdrehscheibe zwischen den beiden zu diesem Zeitpunkt modernsten Transportsystemen geworden. Heilbronn profitierte davon sehr. Der Güterumschlag schnellte von also dem Beginn des örtlichen Eisenbahnzeitalters - bis 1852 auf das Fünffache empor. Die Passagierzahlen nahmen ebenfalls rapide zu. Heilbronn erschien den Zeitgenossen sogar als»hamburg des Neckars«. Die Kapazität des hiesigen Hafens wurde erweitert, Am 7. Dezember 1841 traf in Heilbronn das erste Dampfschiff ein, das ab dem folgenden Jahr eine tägliche Verbindung nach Heidelberg herstellte. Dieses viel bejubelte Ereignis war der Auftakt einer - leider nur für etwas mehr als ein Jahrzehnt - äußerst erfolgreichen Heilbronner Verkehrspolitik. Lithographie der Gebrüder Wolff, 1841
147 Im Jahre 1892 war Heilbronn die erste Stadt der Welt, die von außerhalb mit elektrischem Drehstrom versorgt wurde. Im Jahr zuvor hatte Oskar von Miller einen aufsehenerregenden Großversuch durchgeführt. Er übertrug am 24. August 1891 elektrische Energie mittels eines eigens gezogenen Kupferdrahtes von Lauffen am Neckar nach Frankfurt am Main. Dabei handelte es sich um Strom, welcher in Lauffen der Neckarwasserkraft abgewonnen war und der in Frankfurt seinerseits neben zahlreichen Glühbirnen auch wiederum einen Wasserfall (rechts hinten) antrieb. Reproduktion aus uoffizielle Zeitung der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung«, 1891 das gesamte Wirtschaftsleben bekam einen entscheidenden Impuls. Es ist wohl auch kein Zufall, daß auf dem Zenit dieser Entwicklung - erstmals öffentliche Gaslampen die Stadt erleuchteten. Auch in diesem Punkt befand man sich eben ganz auf der Höhe der Zeit. Doch die Freude über die glanzvolle Entwicklung sollte nicht lange anhalten. Denn schon 1853 bekam die Stadt Heilbronn unangenehm deutlich zu spüren, was passieren kann, wenn man in den Verkehrsschatten gerät. Zu diesem Zeitpunkt war nämlich die sogenannte Westbahn fertiggestellt worden, also eine direkte Eisenbahnverbindung von Stuttgart über Bietigheim und Bruchsal nach Heidelberg und Mannheim. Natürlich erfolgte der Zugverkehr wesentlich schneller und zuverlässiger als die Neckarschiffahrt. Deshalb erlebte die Wasser straße schlagartig einen schweren Einbruch. Die Personen- und Warenströme aus dem Raum Heidelberg/Mannheim in Richtung Stuttgart wichen großenteils sofort auf das modernere Transportmittel aus und wurden somit der Heilbronner Neckarschiffahrt und dem hiesigen Umschlagplatz entzogen. Die Neckardampfschiffahrtsgesellschaft verlor innerhalb kurzer Zeit ihre wirtschaftlich solide Basis und mußte 1857 vom württembergischen Staat aufgekauft werden. Während in den Folgejahren neue Eisenbahnlinien gebaut wurden, nahm der Neckarschiffsverkehr weiter ab wurde er eingestellt, als eine direkte Eisenbahnverbindung von Heilbronn über Jagstfeld nach Heidelberg entstanden war. Die Stadt fand sich jedoch mit dieser herben Niederlage nicht ab. Man überlegte, auf welche Weise bzw. für welche Zwecke die Neckarschiffahrt doch wieder konkurrenzfähig gemacht werden könnte. Es lag nahe, sich auf den Transport von Massengütern zu konzentrieren und eine Technik einzusetzen, die in Frankreich schon seit Jahrzehnten erprobt war: die Dampfschleppschiffahrt. Dabei bewegte sich ein Schleppschiff als schwimmende Dampfwinde an einer Kette entlang vorwärts. Diese im Flußbett verlegte Kette wurde - genauer gesagt - vom Schleppschiff aus dem Wasser gehoben, lief über dampfmaschinengetriebene Trommeln und dann wieder ins Wasser zurück. Das sehr flach konstruierte Schleppschiff zog seinerseits eine ganze Reihe von Frachtschiffen. Solche Kettenschleppschiffe wurden»neckaresel«genannt. Sie verkehrten ab 1878, nachdem zuvor eine 110 Kilometer lange Eisenkette im Bett des Neckars zwischen Mannheim und Heilbronn verlegt worden war. Mit dieser intelligenten technischen Lösung gelang es tatsächlich, in einer ausweglos erscheinenden Situation in dem dafür geeigneten Bereich des Transports von Massengütern wieder konkurrenzfähig zu werden. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts erlebte Heilbronn erneut einen technologischen Innovationsschub von imponierender Intensität. Das entscheidende Medium war dabei jedoch nicht nochmals die Dampfkraft, sondern die Elektrizität. Als erstes Beispiel aus dem Bereich der Elektrizität sei auf das Telefon eingegangen. Im Jahre 1860 waren mit Hilfe des von Philipp Reis konstruierten Fernsprechers die berühmt gewordenen Worte»Das Pferd frißt k e inen Gurkensalat«zumindest teilweise verständlich übertragen worden. Seither wurde diese Technik ständig verbessert. Ab 1883 begannen in Heilbronn verschiedene Firmen wie Schaeuffelen, Knorr, G. F. Rund und das Salzwerk mit der Einrichtung privater Telefonverbindungen in ihren Geschäftsräumen erfolgte der nächste Schritt: Die privaten Telefonanlagen von zwölf Heilbronner Firmen (einschließ- 145
148 lieh der Stadtverwaltung) wurden in Form einer»lokaltelefonanstalt«miteinander verbunden. Gleichzeitig nutzte man die entlang der Eisenbahnlinien inzwischen vorhandenen Telegrafenleitungen, um einen direkten Fernsprechkontakt zwischen Heilbronn und Stuttgart herzustellen. Damit war die erste Telefonfernverbindung in Württemberg in Betrieb genommen worden. Die beiden Städte waren darüber hinaus zu diesem Zeitpunkt die einzigen im Königreich, die über ein öffentliches Telefonnetz verfügten. Im folgenden Jahr zogen u.a. Ulm und Friedrichshafen nach. Die Telefontechnik konnte mit Hilfe schwacher Gleichströme schon recht große Entfernungen überwinden. Dagegen bereitete die Ubertragung von stärkeren, technisch nutzbaren Wechselströmen erhebliche Schwierigkeiten. Außerdem herrschte unter den Fachleuten Streit darüber, ob dem Gleich- oder dem Wechselstrom die Zukunft gehören sollte. Um 1890 war eine technisch anwendbare Entwicklung vom zweiphasigen Wechselstrom zum dreiphasigen Drehstrom gelungen. Das war von großer Bedeutung, denn nun sah der Ingenieur Oskar von Miller die Chance gekommen, dem Drehstrom zum Durchbruch zu verhelfen. Ausgangspunkt dafür war der Wunsch des Portland-Cementwerkes in Lauffen, überschüssige Energie aus der Wasserkraft der Fabrik ins zehn Kilometer nördlich liegende Heilbronn zu übertragen. von Miller überzeugte die Beteiligten, daß dabei die Drehstromtechnik eingesetzt werden sollte. Doch die Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit bzw. am Sinn dieser Entscheidung wollten nicht verstummen. Deshalb entschloß sich der Ingenieur zu einem für damalige Verhältnisse geradezu ungeheuerlichen Experiment. Er realisierte eine Stromfernübertragung nicht nur über zehn Kilometer, sondern von Lauffen via Heilbronn bis nach Frankfurt a. M., also 175 Kilometer weit. Dort fand 1891 eine Internationale Elektrotechnische Ausstellung statt. Im Rahmen dieses historischen Experiments schickte von Miller Strom durch dicke Kupferdrähte auf 3000 mit Totenköpfen gekennzeichneten Masten. Es war elektrische Energie, die in Lauffen der Neckarwasserkraft abgewonnen worden war und die in Frankfurt neben zahlreichen Glühbirnen ihrerseits wieder einen Wasserfall antrieb. Dieses revolutionäre Ereignis fand am 24. August 1891 statt. Um eine geradlinige Straßenbahntrasse vom Bahnhof via Marktplatz zur Harmonie zu schaffen, wurde 1897 die (heutige) Kaiserstraße bis zur Allee verlängert. Dazu mußten Häuser abgerissen werden. Das Foto zeigt im Vordergrund verschiedene Schaulustige, u.a. in der Dreiergruppe links von der Bildmitte einen Schüler mit Büchern im rechten Arm und einem Hut auf dem Kopf. Hierbei handelt es sich um den späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss. Foto,
149
150 fener Stromlieferungsvertrag an die Spitze einer weltweiten Bewegung, die bald alle Lebensbereiche durchdringen sollte. Der Bedarf an Strom nahm rasch zu, und das Lauffener Zementwerk erhöhte seine Kapazität ging in Heilbronn an der Badstraße ein zusätzliches Dampfkraftwerk in Betrieb, denn es zeichnete sich nach eingehenden Diskussionen ab, daß es bald einen neuen Großabnehmer für elektrischen Strom in der Stadt geben würde: die Straßenbahn. Zur Debatte hatten als deren Antrieb aber ebenso Dampf-, Gas- und Pferdekraft gestanden. In Heilbronn entschied man sich in bemerkenswerter Weitsicht für die zukunftsträchtigste aller Möglichkeiten: für die elektrische Straßenbahn. Anlaß zur Diskussion gab neben der Antriebsart auch der Verlauf insbesondere der Stammlinie vom Bahnhof über das Rathaus bis zur Karlstraße. Die (heutige) Kaiserstraße wies noch keine Anbindung an die Allee auf. Hier mußte erst durch den Abriß von Häusern ein Durchbruch geschaffen werden. Innerhalb weniger Monate gelang die Zwangsenteignung der Hausbesitzer, das Abbrechen der Gebäude und der Bau der Straßenbahn. Der Zeitdruck war deshalb so groß, weil das neue Verkehrsmittel bereits im Mai 1897 betriebsbereit sein sollte. Dafür wiederum existierte ein einleuchtender Grund: Zu diesem Zeitpunkt wurde in Heilbronn eine Kunst-, Industrie- und Gewerbeausstellung eröffnet. Diese besaß nicht nur für die Stadt, sondern für das gesamte Königreich Württemberg und darüber hinaus große Bedeutung. Alles, was Rang und Namen hatte, präsentierte sich und seine Produkte hier einem internationalen Publikum. Und diese Interessierten sollten nach dem Willen der Heilbronner Stadtväter mit der technisch neuartigen elektrischen Straßenbahn bequem vom Bahnhof direkt zum Ausstellungseingang fahren können. Die überaus großen Anstrengungen wurden belohnt. Die Eröffnungsfahrt der Heilbronner Straßenbahn konnte am 29. Mai 1897 stattfinden. Das Großereignis»Gewerbeausstellung«hatte in Heilbronn also einen enormen Innovationsschub ausgelöst. Auf die- Heilbronner Eisenbahnaktien Am 13. Januar 1836, also wenige Wochen nach dem Start der ersten deutschen Eisenbahn, warb der Heilbronner Kaufmann Reuß in einer Bürgerversammlung in einem Grundsatzreferat für eine Eisenbahn auch in Heilbronn. Er beschrieb die Nachteile, die dem Heilbronner Raum ohne dieses neue Verkehrsmittel erwachsen würden, mit folgenden Worten:»Stellen wir uns aber die Lage unseres Acker- und Weinbaus, unserer Gewerbe und unseres Handels vor, wenn diese schnellste und billigste Beförderungsweise uns nicht, sondern nur benachbarte Gegenden zu Theil würde! Wie würde sich aller Verkehr nach und nach von hier entfernen, wie würde der Werth der Natur- und Kunstprodukte, wie würde der Werth unsrer Güter, unsrer Häuser, unsrer Mühlen etc. im Preise fallen! Erhält uns aber eine zahlreiche Actien-Unterzeichnung das uns zugesagte Recht einer Eisenbahnverbindung und kommt letztere wirklich zu Stande, so dürfen wir gewiß seyn, daß ohne großes Risiko für den Actien-Unterzeichner der Verkehr sich außerordentlich vermehren werde.«sem Erfolg ruhte man sich jedoch nicht aus, sondern nahm schnell Seitenlinien der Straßenbahn in Betrieb, die 1926 eine Verbindung auch nach Böckingen und 1928 nach Neckargartach herstellte. Sie tat bis zum 31. März 1955 ihren Dienst, als sie von Omnibussen und Obussen verdrängt wurde. Betrachtet man das 19. Jahrhundert in Heilbronn unter dem Aspekt der neuen Technologien, so läßt sich eine besondere Dynamik erkennen. Dabei zeichneten sich zwei große Innovationsschübe ab. Der erste - ab war geprägt von der Dampfkraft, der zweite - ab von der Elektrizität. Das ganze Jahrhundert über befand sich Heilbronn immer»am Puls der Zeit«. Die Stadt setzte technische Innovationen aus eigenem Antrieb rasch und zielstrebig um, indem sie Chancen auslotete und nach intelligenten Lösungen suchte. Sie riskierte dabei aber auch Fehlschläge, in jedem Fall hielt sie jedoch zäh am gesteckten Ziel fest. Auf diese Weise entwickelte sie sich zu einer führenden Technologieregion, und es ist kein Zufall, daß die heimische Industrie in dieser fruchtbaren Atmosphäre zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Spitzenstellung im ganzen Königreich Württemberg errungen hatte. 148
151 »Das fortschrittliche Heilbronn...«Politik und Kultur am Beginn des 20. Jahrhunderts : Überregionale Bedeutung der Neckarzeitung. 1902: Gründung des Frauenvereins Heilbronn.»Der charakteristische Mangel an Eigenart... hat aber seinen tiefsten Grund wohl darin, daß diese Stadt allen brennenden Fragen der Zeit ungewöhnlich lebendig aufgeschlossen ist.... Kurz es ist 1903: Erste öffentliche SPD-Kundgebung zum Tag der Arbeit (1. Mai) : Amtszeit von Stadtschultheiß und Oberbürgermeister Dr. Paul Göbel. 1907: Eröffnung des ersten Kinos (Union-Theater am Kieselmarkt). 1908: Gründung der sozialdemokratischen Tageszeitung Neckar-Echo : Geheimrat Dr. Peter Bruckmann Vorsitzender des Deutschen Werkbundes. 1913: Eröffnung des Stadttheaters. 1918: Generalstreik; Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrats. 1919: Anna Ziegler wird als erste Frau in den Gemeinderat gewählt. 1919: Mit der Auflösung des Füsslierregiments Nr. 122 verliert Heilbronn seinen Status als Garnisonsstadt : Amtszeit von Stadtschultheiß und Oberbürgermeister Emil Beutinger. 1926: Adolf Hitler spricht in der Harmonie. 30. Januar 1933: Die Stadtverwaltung weigert sich, auf dem Rathaus die Hakenkreuzfahne zu hissen. etwas los,... aber, aber - hinter dieser von verhältnismäßig wenigen getragenen Entwicklung bleibt... die Masse aller Stände zurück.... Das fortschrittliche Heilbronn ist überhaupt zu guten Teilen noch eine Kleinstadt... «Diese Beschreibung stammt aus der Feder des Güglingers Otto Linck und war eine Antwort auf die von der Neckarzeitung zu Weihnachten 1926 als Preisausschreiben gestellten Fragen:»Was gefällt Dir an Heilbronn? Was wünschest Du besser?«linck thematisierte in seinem Beitrag sehr gut die für Heilbronn in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als typisch zu bezeichnende Spannung zwischen Provinzialität und Weltoffenheit, die sich in einer erstaunlich aktiven geistigen Auseinandersetzung mit den damals aktuellen politischen und kulturellen Strömungen ausdrückte. Auf der politischen Ebene war es vor allem die»soziale Frage«, um die heftig gestritten wurde. Der im laufe des 19. Jahrhunderts vollzogene Umbruch von der Agrar- zur Industriegesellschaft hatte dazu geführt, daß sich die traditionellen Sozialstrukturen aufzulösen begannen, ohne daß an deren Stelle schon allgemein anerkannte neue Gesellschaftsformen hatten Fuß fassen können. Gerungen wurde um eine Neuverteilung der politischen Einflußmöglichkeiten und um die Verbesserung der wirtschaftlich wie sozial schwierigen Lage der immer größer werdenden Gruppe der lohnabhängigen Fabrikarbeiter. Deren Interessen vertrat seit 1869 die aus der Arbeiterbewegung erwachsene.spd, die sich seit der Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890 eines zunehmenden Zulaufes erfreuen konnte. Diese Tatsache war eine Herausforderung für die anderen politische Gruppierungen, die sich ebenfalls in der 149
152 zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Parteien im heutigen Sinn entwickelten. In Heilbronn waren neben der SPD vor allem die nationalliberale Deutsche Partei (DP) und die fortschrittliche Volkspartei (VP) erfolgreich, während das katholisch geprägte Zentrum nur eine geringe Rolle spielte. Im Oberamt Heilbronn verfügte darüber hinaus der konservative Bauernbund über zahlreiche Anhänger. Diese politische Kräfteverteilung hing natürlich auch mit der sozialen Gliederung der Heilbronner Bevölkerung zusammen, wobei zu berücksichtigen ist, daß bis 1918 nur Männer wahlberechtigt waren. Im Dezember 1900 lebten hier männliche und weibliche, insgesamt also Einwohner. Davon waren Personen evangelisch und 5152 katholisch, 813 gehörten der israelitischen Religionsgemeinde an und 348 einer sonstigen Konfession. Rund Menschen, also mehr als ein Viertel der hiesigen Bevölkerung, verdienten ihren Lebensunterhalt als Arbeiter in den zahlreichen Fabriken. Der Weinbau hatte seine Bedeutung weitgehend erhalten können, und so gab es noch immer viele alteingesessene Weingärtnerfamilien. Dazu kamen industrielle, Gewerbetreibende, Angehörige der freien Berufe und die Beamtenschaft. Außerdem hielten sich Soldaten und Offiziere der hier stationierten Teile des 4.württembergischen lnfanterie_-regiments Nr. 122 in der Stadt auf. Uber das Zeitgeschehen konnten sich die Heilbronner um die Jahrhundertwende durch die Lektüre von drei Tageszeitungen informieren: Die Heilbronner Zeitung wurde seit 1894 von Karl Wulle, der der Volkspartei nahestand, herausgegegeben; bereits seit 1881 wurde der Generalanzeiger publiziert, den die Schellsche Druckerei aufkaufte. Dort erschien auch die seit 1744 unter verschiedenen Namen existierende Neckarzeitung. Nach längerer Teilhaberschaft führte Viktor Krämer seit 1898 die Druckerei und den dazugehörigen Verlag alleine weiter holte er den damals 27jährigen Dr. Ernst Jäckh nach Heilbronn. Diese Personalentscheidung machte aus der bisher provinziellen Neckarzeitung ein weit über Württemberg hinaus beachtetes und gelesenes Blatt. Jäckh erhielt von seinem Verleger völlig freie Hand und konnte unabhängig entscheiden, über was und wie in der Zeitung berichtet werden sollte. Bereits wenige Tage nach seinem Amtsantritt veröffentlichte der junge Chefredakteur gleich mehrere programmatische Artikel, in denen er seine Vorstellungen von Pressearbeit darlegte:»wir halten es für eine der wichtigsten Aufgaben der Presse, daß sie nicht nur Nachrichten mitteilt, D.er Blick vom Wartberg auf Heilbronn zeigt deutlich die fortschreitende Ausdehnung der Stadt nach Osten sowie die Industriebetriebe im Süden. Tonlithographie von Wilhelm Knittel, um
153 Der oft als»weltbürger«bezeichnete Ernst Jäckh hatte gute Beziehungen in die Türkei, deshalb machte eine türkische Studienkommission 1911 bei ihrer Reise durch Deutschland auch in Heilbronn Station. Das Erinnerungsfoto wurde im Rathaus-Innenhof aufgenommen. sondern Kritik übt.... Aber die Kritik muß sachlich sein und bleiben " heißt es da zum Beispiel. Freie Meinungsäußerung, Kritikfähigkeit und Bereitschaft zur Diskussion - ganz gleich ob es sich um»große«oder»lokale«politik und Ereignisse handelte -waren die Eckpfeiler, auf denen die journalistische Tätigkeit von Jäckh aufbaute. Auch sein Nachfolger Theodor Heuss setzte diese Arbeit von 1912 bis 1917 in gleichem Sinne fort. Für die damalige Zeit war dies keine Selbstverständlichkeit. Obwohl die Neckarzeitung ausdrücklich ihre parteipolitische Unabhängigkeit betonte und wahrte, blieb dennoch nicht verborgen, daß sowohl Jäckh wie Heuss Schüler und Anhänger des Sozialpolitikers Friedrich Naumann waren, der zu dieser Zeit dem linksliberalen Lager zuzurechnen war. Nicht zuletzt durch die publizistische Unterstützung der Neckarzeitung wurde Naumann - ein in Berlin lebender Sachse im württembergischen Wahlkreis Heilbronn erstmals in den Reichstag gewählt. Bei der notwendigen Stichwahl zwischen ihm und Theodor Wolff, der für den Bauernbund antrat, hatten die Heilbronner Sozialdemokraten sich auf Naumanns Seite geschlagen, dem ihr eigener Kandidat, Franz Feuerstein, im ersten Wahlgang knapp unterlegen war. Die hiesige SPD zog aus dieser Niederlage eine logische Konsequenz: Sie gründete die»genossenschaft Vereinsdruckerei Heilbronn" mit dem Ziel, eine eigene Zeitung herauszugeben. Am 26. Februar 1908 erschien die Nummer 1 des als»tageszeitung für das werktätige Volk«untertitelten Nekkar-Echos. Und tatsächlich blieb der erhoffte Erfolg nicht aus. Das neue Blatt wurde ein ernstzunehmender Konkurrent der bestehenden Zeitungen, und bei der nächsten Reichstagswahl 1912 siegte Feuerstein vor Naumann. Doch nicht nur in der Politik waren die Heilbronner Publikationsorgane und ihre Redakteure - beim Neckar-Echo schrieb ab 1912 Fritz Ulrich, der spätere langjährige Heilbronner SPD-Landtagsabgeordnete, die Leitartikel - einflußreich. Durch qualifizierte Kunst- und Theaterkritiken fand eine lebhafte Auseinandersetzung mit den kulturellen Strömungen der Zeit statt, wobei auch der Volksbildungsgedanke eine große Rolle spielte. So gründete Ernst Jäckh zusammen mit Peter Bruckmann 1903 einen Zweigverein des Stuttgarter Goethebundes, der es sich - als Vorläufer der späteren Volkskochschule - zur Aufgabe gemacht hatte,»die Kunst ins Volk zu tragen«. Die beiden zählten auch zu den eifrigsten Befürwortern und Initiatoren für den Neubau des Stadttheaters. Das von Theodor Fi- 151
154 Das 1913 fertiggestellte Stadttheater am nördlichen Ende der Allee. Foto, 1913 scher (München) entworfene Jugendstil Gebäude, das wesentlich durch Spenden aus der Bevölkerung finanziert wurde, konnte allerdings erst am 30. September 1913 seiner Bestimmung übergeben werden. Da hatte Jäckh Heilbronn bereits verlassen, um Geschäftsführer des 1907 gegründeten Deutschen Werkbundes in Berlin zu werden, der sich»die Veredelung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk«zum Ziel gesetzt hatte und dessen Vorsitzender seit 1909 der Heilbronner Peter Bruckmann war. Auch die Heilbronner Zeitungsjahre von Theodor Heuss zeichneten sich durch eine rege Berichterstattung über das lokale wie überregionale kulturelle Geschehen aus. Doch wurden sie noch weit mehr durch den Ersten Weltkrieg und die damit zusammenhängenden Ereignisse beeinflußt. Es wirft ein interessantes Licht auf die Bedeutung der Neckarzeitung und ihres Chefredakteurs, daß er am 1. August 1914 vom Fenster seines Redaktionszimmers noch einige Minuten früher als Oberbürgermeister Paul Göbel vom Rathaus herab der wartenden Bevölkerung die Mobilmachung Deutschlands verkündete. Während der Kriegszeit von August 1914 bis November 1918 war der Alltag bestimmt von der Sorge um die zum Kampf eingezogenen Väter, Söhne und Brüder aus Heilbronn stammende Soldaten verloren im Ersten Weltkrieg ihr Leben - sowie zunehmend von Hunger und Not, ausgelöst durch die wirtschaftlichen Probleme. In der optimistischen Erwartung, daß nur mit einem kurzen Waffengang gerechnet werden müsse, waren keinerlei Vorkehrungen für die Organisation einer»kriegswirtschaft«getroffen worden. Das führte zu immensen Versorgungsschwierigkeiten, die kaum in den Griff zu bekommen waren. In Heilbronn begann man am 11. März 1915 mit der Ausgabe von Bezugskarten für Mehl und Brot, später wurden auch andere Lebensmittel rationiert. Durchgeführt wurde die Bezugskartenverteilung von ehrenamtlichen Helfern. Der freiwillige Liebesdienst«der in der Heimat zurückgebliebenen Frauen und der Männer, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht als Soldaten eingezogenen waren, war im Ersten Weltkrieg sehr ausgeprägt. In Heilbronn wur de er vor allem vom Roten Kreuz in Zusammenarbeit mit den Behörden organi- """" siert. In der 1921 erschienenen Kriegs Chronik bescheinigt das Rote Kreuz den Heilbronnern,»daß sie stets sehr gebefreudig und opferwillig waren; namentlich hat uns die Industrie mit sehr großen Gaben reichlich unterstützt. Zuweilen freilich war immer wieder ein vorübergehendes Nachlassen der Geldeingänge zu verspüren, erklärlich aus der langen Dauer des Krieges, der immer stärker werdenden Belastung jeder einzelnen Familie und der Verteuerung der' gesamten Lebenshaltung.«Deshalb wurde nach neuen Möglichkeiten gesucht, die Opferfreudigkeit der Bevölkerung anzuregen. Eine Maßnahme dazu war auch der so- Karikatur von nlpft< anläßlich der Gemeinderatswahl Hinter diesem Kürzel verbarg sich Hauptlehrer Hermann Siegmann, der während der zwanziger und dreißiger Jahre in den Heilbronner Zeitungen das lokale Geschehen zeichnerisch kommentierte. 152
155 Während der Inflation von 1923 druckte auch die Stadt Heilbronn ihr eigenes Geld, um mit der galoppierenden Entwertung mithalten zu können. genannte Eisenhart, der am 7. Mai 1915 in Anwesenheit von Königin Charlotte von Württemberg vor dem Rathaus aufgestellt wurde. In diese Holzfigur konnte jeder bis zum Jahresende 1915 Nägel im Wert von 50 Pfennigen oder 1 Mark einschlagen. Der Eisenhart war eine der ersten Figuren dieser Art in Deutschland. Die Idee stammte aus Wien und wurde in vielen Städten nachgeahmt. Je länger der Krieg dauerte, je mehr militärische Niederlagen für Deutschland er mit sich brachte und je schlechter die Versorgungslage der Bevölkerung wurde, desto lauter wurden die Stimmen, die nicht nur ein baldiges Kriegsende, sondern auch den Sturz der Monarchie forderten. Im Lauf des Jahres 1918 spitzte sich die Situation zu. Vor allem in der Arbeiterschaft gärte es, was in immer wieder aufflackernden Revolten und Streiks zum Ausdruck kam. Das Ziel des politischen Umsturzes verfolgte vor allem die USPD, der linksradikale Flügel der SPD, der sich im Herbst zu einer eigenen Partei formiert hatte. Auch in Heilbronn spaltete sich eine solche Gruppe um Friedrich Reinhardt und Wilhelm Schwan von der SPD ab. Der entscheidende Tag für die weitere Entwicklung in Deutschland war der 9. November Während in Berlin der Thronverzicht Kaiser Wilhelms II. verkündet und die Republik ausgerufen wurde, kam es - wie in vielen Städten - auch in Heilbronn zu einer Massendemonstration, an der sich die Belegschaften der größeren Industriebetriebe beteiligten. Eine Abordnung von führenden SPD- und USPD-Angehörigen begab sich in das Amtszimmer von Oberbürgermeister Göbel und erklärte, daß nun ein aus 21 Mitgliedern bestehender Arbeiter- und Soldatenrat die vollziehende Gewalt übernehmen werde. In der Folgezeit versuchte dieser, Einfluß auf die Stadtverwaltung, die allerdings personell unverändert blieb, zu nehmen. Durch einige Zugeständnisse von seiten der Stadt kam es zu einer Zusammenarbeit ohne größere Auseinandersetzungen. Die am 9. November auf dem Marktplatz versammelten gut 5000 Personen zogen anschließend zum Zellengefängnis in die Steinstraße und verlangten dort die Freilassung der»wegen politischer oder militärischer Vergehen verurteilten Gefangenen«. Während eine acht Personen zählende Führungsgruppe noch mit dem Gefängnisdirektor über das praktische Vorgehen der Gefangenenbefreiung, von der die»normalen«straftäter ausgenommen sein sollten, verhandelte, hatte sich die Menge bereits gewaltsam Zugang zum Gefängnis verschafft und viele Zellentüren geöffnet. Befreite und Befreier nahmen beim Verlassen des Geländes alles mit, was sie vorfanden: Lebensmittelvorräte, Stiefel, Uniformtuchballen und die Zivilkleider der Inhaftierten. Es entstand ein Schaden von 9200 Mark, den später die Stadt Heilbronn dem Land teilweise ersetzen mußte, weil die städtische Polizei nichts zur Abwehr der Plünderungen unternommen hatte. Dieser in ganz Deutschland unruhige und umstürzlerische Beginn, in dem viele damalige Zeitgenossen einen Verrat der Heimat an den im Feld stehenden Truppen sahen, war - ebenso wie die harten, als»schmach«empfundenen Friedensbedingungen des Versailler Vertrags von eine schwere und letztlich nicht abzuschüttelnde Hypothek für die junge Weimarer Republik, deren staatliche Ordnung nun nach und nach Gestalt annahm. Im Frühjahr 1919 fanden zunächst Wahlen statt: zur Verfassunggebenden Landesversammlung für Württemberg und zur Nationalversammlung in Weimar, bei denen hier jeweils die SPD die meisten Stimmen erhielt, sowie zum Heilbronner Gemeinderat, aus der die Deutsche Demokratische Partei (DDP) knapp als Sieger hervorging. Im Verlauf der 153
156 Emilie Hiller war von SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Heilbronn. Anna Ziegler zog 1919 als erste Frau in den Heilbronner Gemeindrat ein und war von auch Reichstagsabgeordnete für die USPD. zwanziger Jahre entwickelte sich die SPD zur stärksten Partei in der Stadt, die hier über deutlich mehr treue Anhänger verfügte als im Reichsdurchschnitt. Bis 1933 kam keine der zahlreichen anderen Parteien an die Ergebnisse der SPD heran. Auch die DDP hatte, obwohl sie stetig Wählerstimmen verlor, in Heilbronn wesentlich mehr Zulauf als im Reich. In den zwanziger Jahren ging es in der lokalen Politik vor allem um drei Aufgabenbereiche: die Beschaffung von Arbeit für die große Zahl der Erwerbslosen, die Behebung der Wohnungsnot und den Ausbau der Verkehrswege sowie der Gas- und Wasserversorgung als Grundvoraussetzungen für die Fortentwicklung der Stadt. Als nach dem Tod von Oberbürgermeister Göbel 1921 ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden mußte, entschied sich die Mehrheit der Wähler für den parteilosen Architekten Professor Emil Beutinger, der sich selbst als»demokrat aus Überzeugung«bezeichnete. Er unterzog sich diesen Aufgaben - nicht immer unumstritten - mit großem Elan und Weitblick und es gelang ihm, trotz der äußerst schwierigen Zeiten, die mit dazu beitrugen, daß viele seiner Vorhaben unvollendet blieben, dennoch Grundlagen für die Zukunft zu legen. Auch dem kulturellen Sektor versagte Beutinger seine Unterstützung nicht und sorgte mit dafür, daß das Theater, die 1919 gegründete Volkshochschule, die Museen sowie die Kunst-, Musik- und Gesangvereine im Rahmen ihrer zumeist zwar eher bescheidenen finanziellen Möglichkeiten von der Stadt unterstützt wurden. So lebten in den zwanziger Jahren viele der kulturellen Vorkriegsaktivitäten wieder auf, wie ehedem angeregt und mitgetragen von den Redakteuren der Heilbronner Zeitungen-zu den schon genannten kamen nun noch die Heilbronner Abendzeitung ( ) und die Heilbronner Sonntagszeitung ( , dann in Stuttgart) hinzu. Vor allem der Feuilletonist der Neckarzeitung, Hans Franke, trat dabei vielfältig in Erscheinung: als Autor - sein Schauspiel»Opfer«wurde am 30. März 1920 im Heilbronner Stadtteater uraufgeführt - und als Initiator von Kammerspielen, die ausschließlich dem modernen, zeitkritischen Drama vorbehalten waren. Das machte das Heilbronner Stadttheater zwar überregional bekannt, stieß aber bei der Mehrzahl der einheimischen Theaterbesucher, die lieber Lustspiele und Klassiker sehen wollten, eher auf Ablehnung. Die Weimarer Republik erlebte nach den sehr schwierigen Anfangsjahren, die mit der galoppierenden Inflation von 1923 ihr Ende fanden, zwischen 1924 und 1929 eine Phase der Konsolidierung, die aber die Weltwirtschaftskrise und ihre Folgen nicht überdauerte. Die 154
157 Arbeitslosenzahlen stiegen wieder an - in Heilbronn und Umgebung wurde im März 1932 mit arbeitssuchenden Männern und Frauen der Höchsstand erreicht. Bis zum Ende des Jahres war mit einer Gesamtzahl von 7864 erwerbslosen Personen bereits eine leichte Besserung eingetreten. Durch die wirtschaftliche Not und die ungelöste Frage, wie ihr zu begegnen sei, traten nicht nur in den Verhandlungen des Gemeinderats die vorhandenen politischen Gegensätze sehr deutlich zu Tage. Unversöhnlich und zu gewaltsamen Auseinandersetzungen bereit, stan- Frauenbewegung und Frauenwahlrecht Heilbronnerinnen engagieren sich und gehen in die Politik Bei den Wahlen von 1919 konnten sich erstmals auch Frauen aktiv und passiv beteiligten. Zwei Heilbronnerinnen gelang es, auf Anhieb ein Mandat zu erringen: Emilie Hiller zog für die SPD in die Verfassunggebende Landesversammlung ein und wurde 1920 in den Landtag gewählt, dem sie bis 1933 angehörte. Anna Ziegler vertrat die USPD im Gemeinderat, über deren Landesliste sie 1920 auch in den Reichstag gelangte. In beiden Gremien blieb sie bis 1924, als sie nicht wieder in den Reichstag gewählt wurde und auch ihr Gemeinderatsmandat niederlegte. Es war kein Zufall, daß die beiden ersten Heilbronner Mandatsträgerinnen dem linken Parteienspektrum entstammten. Die hiesige SPD, der auch Anna Ziegler ursprünglich und nach der Auflösung der USPD 1922 wieder angehörte, hatte schon vor dem Ersten Weltkrieg damit begonnen, Frauen in die Parteiarbeit mit einzubinden und sie politisch zu schulen. Außerdem setzte sie sich für das Frauenwahlrecht ein, auch weil sie sich davon die Vergrößerung des eigenen Wählerpotentials versprach. Die Diskussion um eine stärkere weibliche Beteiligung am öffentlichen und politischen Leben wurde durch die erste Frauenbewegung ausgelöst. Im Zusammenhamg mit ihr wurde 1902 auch der Frauenverein Heilbronn gegründet, in dem sich überwiegend aus dem Bürgertum stammende Frauen mit Aufgaben im Wohlfahrtsbereich beschäftigten. Mit der eigens eingerichteten Rubrik»Frauenfragen und Frauengedanken" unterstützte Ernst Jäckh in der Neckarzeitung diese Bestrebungen publizistisch. den sich auch in den Heilbronner Straßen die»kampfgruppen«der verschiedenen politischen Richtungen gegenüber: Stahlhelm, SS und SA drohten von rechts, der Rote Frontkämpferbund der KPD von links und dazwischen standen die im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold organisierten Demokraten. Ab 1931 schlossen sich Reichsbanner, SPD, Gewerkschaften und Arbeitersportverbände zur Eisernen Front zusammen mit dem gemeinsamen Ziel, für den Erhalt der Weimarer Republik zu kämpfen. Doch gingen der Wille und die Fähigkeit zu einem Ausgleich zwischen den politischen Blöcken immer mehr verloren. Das Scheitern der Weimarer Republik war nicht mehr aufzuhalten. Daran änderte auch nichts, daß die Heilbronner Wahlergebnisse im Jahre entgegen dem Trend im Reich - noch immer einen deutlichen Vorsprung der SPD aufwiesen oder daß sich die hiesige Stadtverwaltung noch am 30. Januar 1933 weigerte, auf dem Rathaus die Hakenkreuzfahne zu hissen. Die ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren in Heilbronn eine Zeit der Gegensätze: Im kulturellen Bereich stand der Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit einer Minderheit die Provinzialität der Mehrheit gegenüber. In der Politik verfestigten sich die widerstreitenden Weltanschauungen der verschiedenen Blöcke, die schon vor dem Ersten Weltkrieg spürbar waren, im Verlauf der zwanziger Jahre so sehr, daß sie kaum noch zu überbrücken waren. Zwar verfügten in Heilbronn die demokratischen Parteien lange über eine stabile Mehrheit, doch drückte sich die zunehmende Unzufriedenheit großer Teile der Bevölkerung mit der Weimarer Republik und ihren zahlreichen Regierungskrisen auch hier durch eine anwachsende Unterstützung der radikalen Parteien aus. 155
158 »Zur Ehre des Judentums und des deutschen Vaterlandes... «Blütezeit und Zerstörung der Jüdischen Gemeinde Heilbronn»Eine lange Zeit friedlicher und ungestörter Entwicklung möge diese führenden Männer instand setzen, ihr hohes Ziel zu verwirklichen: die israelitische Gemeinde Heilbronn zu immer größerer Blüte zu bringen, zur Ehre des Judentums und zur Ehre des deutschen Vaterlandes.«Mit diesen hoffnungsvollen Zeilen schloß Oskar Mayer 1927 die von ihm verfaßte Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Heilbronner Synagoge. Er beschrieb darin die sehr wechselvolle»geschichte der Juden in Heilbronn«von ihren Anfängen, die - soweit bekannt - in der Mitte des 11. Jahrhunderts lagen, bis zur damaligen Gegenwart. Nur sechs Jahre vor dem Beginn der nationalsozialistischen Judenverfolgung, die in der sogenannten»endlösung der Judenfrage«, dem systematisch geplanten und durchgeführten Massenmord an sechs Millionen deutschen und europäischen Juden, ihren schrecklichen Höhepunkt finden sollte, hatten die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens noch wenig Veranlassung, an einer auch für sie glücklichen Zukunft in ihrer Heimat zu zweifeln. Bot ihnen doch gerade die Weimarer Republik ein bis dahin ungewöhnlich hohes Ausmaß an bürgerlicher, sozialer und beruflicher Gleichberechtigung. Zwar flakkerte auch in den zwanziger Jahren in Heilbronn und anderswo der Antisemitismus, der schon seit dem Kaiserreich ( ) in Teilen der Bevölkerung mehr oder weniger offen vorhanden war, immer wieder auf. Dennoch waren die meisten deutschen Juden fest davon überzeugt, daß seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts eine stabile Grundlage für ein friedliches Zusammenleben zwischen ihnen und ihren christlichen Nachbarn entstanden sei.»emanzipation«und»assimilation«hießen die beiden Schlagworte, die für die jüdische Geschichte im 19. Jahrhundert bestimmend gewesen waren und die auch das Erscheinungsbild der»israelitischen Gemeinde Heilbronn«bis zu ihrer Zerstörung im»dritten Reich«prägten. Die»Emanzipation«, also die bürger- Um 1050: Erster Nachweis für eine jüdische Gemeinde in der Lohtorstraße. 1476: Der Magistrat der Stadt vertreibt die Juden auf Dauer. 1828: Württembergisches Judenemanzipationsgesetz. 1857: Der Israelitische Wohltätigkeitsverein hält hier erstmals jüdische Gottesdienste ab. 1861: Errichtung der Israelitischen Gemeinde Heilbronn. 1867: Verlegung des für das Oberamt zuständigen Rabbinats von Lehrensteinsfeld nach Heilbronn. 1877: Einweihung der Synagoge an der Allee : 191 der 861 Heilbronner Juden nehmen als Soldaten am Ersten Weltkrieg teil, 28 von ihnen fallen. 1. April 1933: Boykott jüdischer Geschäfte. 10. November 1938 : Zerstörung der Heilbronner Synagoge anläßlich des November Pogroms. 26. November August 1942: Deportation der Heilbronner Juden in vier Transporten. 156
159 er erste jüdische Bürger eilbronns nach 1828, sidor Veit, liegt auf dem 'Judenfriedhof in Sontheim begraben. liehe Gleichstellung der Juden, wurde im Rahmen der durch die Französische Revolution auch in Deutschland ausgelösten staatlichen Reformen»Von oben«dekretiert: In Württemberg trat das»gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen Glaubensgenossen«am 25. April 1828 in Kraft. Dadurch erhielten die Juden das Bürgerrecht, dem bis 1861 auch die Gewerbefreiheit und das aktive und passive Wahlrecht folgten. Die»Assimiliation«, also die Angleichung der Lebensweise an die christliche Umwelt, war dagegen eine innerjüdische Angelegenheit. Sie führte zu heftigen Auseinandersetzungen darüber, wie viel von der jüdischen Tradition für eine wirtschaftliche und soziale Integration geopfert werden sollte. Im laufe der Zeit bildeten sich drei Fraktionen heraus: Eine politisch orientierte Gruppe, deren Bestreben es war,»nichts zu belassen, was... der Eingliederung in die deutsche Staatlichkeit und das deutsche Volkstum hinderlich werden könnte«. Diese Haltung führte vom jüdischen Bekenntnis weg und endete oft im Übertritt zum Christentum. Daneben gab es Anhänger des orthodoxen und des liberalen Judentums. Die gesetzestreuen Juden bemühten sich, die seit Jahrtausenden überlieferten religiösen Gebote streng einzuhalten. Für die christliche Umwelt wahrnehmbar waren vor allem die Heiligung des Sabbats als absoluten Ruhetag und die Befolgung der rituellen Reinheits- und Speisevorschriften. Die liberalen Juden - sie stellten in den meisten Gemeinden die Mehrheit dar - versuchten dagegen,»eine mit dem Lebensgefühl der Zeit in Einklang stehende jüdische Frömmigkeit zu begründen«, und das führte zu zahlreichen Reformen im Gottesdienst und im Alltagsleben. In Heilbronn ließen sich ab 1831 wieder Juden nieder. Bis in die 1850er Jahre lebten so wenige Familien hier, daß diese zur Israelitischen Gemeinde in Sontheim gehörten. Nachdem sich die Zahl der hiesigen Juden auf 65 Personen ( 1858) erhöht hatte, versuchten sie zu einer eigenen Gemeindegründung zu gelangen. Auf Initiative des Israelitischen Wohltätigkeitsvereins fanden zunächst in einem Privathaus, später in angemieteten Räumen im Deutschhof regelmäßig Gottesdienste statt. Nach Überwindung einiger Schwierigkeiten bewilligte die Israelitische Oberkirchenbehörde im Königreich Württemberg am 21. Oktober 1861 die Bildung einer Israelitischen Religionsgemeinde Heilbronn. Nach und nach entstanden hier die für ein jüdisches Gemeindeleben unverzichtbaren Einrichtungen: 1862 wurden ein Lehrer und Vorbeter angestellt und eine Religionsschule eröffnet, für die der Heilbronner Kirchenkonvent einen Raum in der Knabenschule (Karlstraße 2) zur Verfügung stellte. Im gleichen Jahr begann man mit den städtischen und staatlichen Behörden über den Erwerb eines Grundstücks zur Anlegung eines Friedhofs zu verhandeln. Das passende Gelände im Gewann Breitenloch wurde 1867 gefunden, am 1. August 1868 wurde dort die erste Beerdigung durchgeführt. Inzwischen ließen sich immer mehr Juden in der Stadt nieder: In den Jahren 1864 bis 1875 stieg ihre Zahl von 369 auf 825 Personen an. Durch die am 1. Juli 1867 erfolgte Verlegung des Rabbinats für das Oberamt Heilbronn von Lehrensteinsfeld hierher gewann die Gemeinde zusätzliches Gewicht. Im April 1871 wurde für die schon länger beabsichtigte Errichtung einer Synagoge ein Areal an der Allee erworben. In den Jahren erfolgte dann 157
160 Die 1877 eingeweihte Synagoge an der Allee. Foto, um 1900 der Bau nach Plänen des Architekten Wolf in dem für Synagogen damals sehr beliebten maurisch-byzantinischen Stil. Die Gemeindeversammlung beschloß mit 60 zu vier Stimmen den Einbau einer Orgel, obwohl Instrumentalmusik im traditionellen jüdischen Gottesdienst keinen Platz hatte. Wie überall führte das zu einem ernsten Konflikt mit den orthodoxen Gemeindemitgliedern, der bis zur Abspaltung einer gesetzestreuen Minderheit eskalierte. Der daraufhin in einer Privatwohnung abgehaltene Separatgottesdienst wurde allerdings nach einigen Jahren mangels Teilnehmern wieder eingestellt. Ab 1910 fand sich jedoch erneut eine orthodoxe israelitische Religionsgesellschaft unter dem Namen»Adas Jeschurun«zusammen, die einen eigenen Rabbiner und einen Betsaal in der Uhlandstraße 7 hatte. Von den 790 Juden, die 1933 in der Stadt lebten, gehörten etwa 60 zu dieser Minderheit. Im laufe der Zeit wurde die Beteiligung der Heilbronner Juden am wirtschaftlichen, politischen sowie am kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt zu einer Selbstverständlichkeit. Es gab hier viele jüdische Firmen, Gewerbebetriebe und Geschäfte wie zum Beispiel die Brennerei Landauer & Macholl, die Leinenwarenfabrik Oppenheimer und Söhne, die Tabakfabrik Gebr. Kahn, die Seifenfabrik Madaform, die Spirituosenfabriken Steigerwald, Löwengardt und Wollenberger, das Kaufhaus Landauer, das Schuhhaus Mandellaub und die Adlerbrauerei Würzburger. Die jüdischen Geschäftsleute ebenso wie die zahlreichen jüdischen Arzte und Rechstanwälte übernahmen oft ehrenamtliche Aufgaben in ihren jeweiligen Berufsverbänden wie der IHK, dem Handelsverein, dem Industriellenverband, dem Anwaltsverein oder dem Ärzteverband. Mit Moritz Kallmann, von Mitglied des Gemeinderats, trat erstmals auch ein Jude in der Lokalpolitik in Erscheinung. Ab den 1880er Jahren gehörten dann Wolf M. Wolf, Rechtsanwalt Dr. Jakob Schloss und Rechstanwalt Max Rosengart, dem 1930 das Ehrenbürgerecht der Stadt verliehen wurde, dem Bürgerausschuß bzw. dem Gemeinderat an. Als letzter jüdischer Mandatsträger war dort Dr. Siegfried Gumbel tätig, der auf massiven Druck der NSDAP am 18. März 1933 zurücktrat. Ihre politische Heimat fanden die Juden vor allem bei den liberalen, demokratischen und sozialistischen Parteien, da diese in der Regel weniger antisemitisch eingestellt waren als konservative und deutschnationale Organisationen. Eigene politische Ziele verfolgte der 1893 gegründete»centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (C. V.)«, von dem es seit 1920 auch eine Heilbronner Ortsgruppe gab. Er kämpfte für die»idee des Deutschtums der Juden«und gegen antisemitische Vorurteile. Daneben existierten hier zahlreiche weitere jüdische Vereinigungen, die wohltätigen oder kulturellen Zwecken dienten oder sich an be- 158
161 m Tag des Judenboyotts ( l. April 1933) ostierten sich in der Sül- 1erstraße Angehörige on SA und SS vor dem :ingang des jüdischen :aufhauses Wohlwert, im die Bevölkerung am '.inkauf dort zu hindern. stimmte Zielgruppen wandten, wie jüdische Jugend- oder Frauenvereine. zugleich traten aber auch viele Juden und Jüdinnen als aktive Mitglieder den verschiedenen allgemeinen Heilbronner Vereinen bei. Durch die»machtergreifung«von Adolf Hitler und der NSDAP am 30. Januar 1933 begann sich dieses alltägliche Neben- und Miteinander von jüdischen und christlichen Deutschen grundlegend zu verändern. Für die nun staatstragende Partei war Antisemitismus Programm und damit eine der Grundlagen ihres politischen Handelns. Es dauerte folglich nicht lange, bis die nationalsozialistische Regierung damit begann, die deutschen Juden durch eine Flut von insgesamt mehr als 250 Gesetzen aus der von ihnen angestreben»deutschen Volksgemeinschaft«auszugrenzen. Deutlich sichtbar wurde das bereits am 1. April 1933 mit dem reichsweiten Boykott jüdisch.er Geschäftsleute, Rechstanwälte und Arzte. Auch in Heilbronn postierten sich SA- und SS-Leute mit Spruchbändern, auf denen Parolen wie»die Juden sind unser Unglück«oder»Kauft nicht beim Juden«standen, vor den Eingängen der entsprechenden Läden, um die Bevölkerung am Einkauf dort zu hindern. In der Folgezeit wurde es für die Juden immer schwieriger und schließlich unmöglich, ihre Geschäfte fortzuführen oder ihre Berufe weiter auszuüben. Deshalb entstand bereits 1933 die Reichsvertretung der Juden in Deutschland, die den einzelnen israelitischen Religionsgemeinden dabei half, eine jüdische Selbsthilfe zu organisieren. Zum Beispiel empfahl sie die Gründung jüdischer Bezirksschulen, um den Kindern die Diskriminierung in den öffentlichen Schulen zu ersparen und sie gezielt auf die Auswanderung vorbereiten zu können, die sich immer mehr als einzige Möglichkeit, der Verfolgung zu entgehen, herauskristallisierte. In Heilbronn wurde vergleichsweise spät - in der früheren Gaststätte»Adlerkeller«(Klarastraße 21) eine jüdische Privat-Mittelschule eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt waren die sogenannten»nürnberger Rassegesetze«vom 15. September 1935 schon in Kraft. Die Nationalsozialisten sahen Juden nicht als Angehörige einer anderen Religion, sondern als die einer anderen Rasse an. Deshalb fielen unter diese Sondergesetzgebung nicht nur die Mitglieder der israelitischen Religionsgemeinden, sondern auch Personen, die entweder selbst oder deren Eltern und Großeltern zum Christentum übergetreten waren. Diese weitgespannte Definition unterschied die nationalsozialistische Judenverfolgung ebenso wie die konsequente Durchführung des Massenmordes als»endlösung der Judenfrage«von allen vorausgegangenen. Sie ließ dem einzelnen keine Möglichkeit, sich durch einen Religionswechsel den Nachstellungen zu entziehen, und sie erklärte Menschen zu Juden, die es weder aus eigener noch aus jüdischer Sicht waren. Denn einem alten rabbinischen Gesetz zufolge ist allein die Geburt durch eine jüdische Mutter maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Judentum. Ansonsten steht noch der Übertritt dazu offen, der aber einer gründlichen Vorbereitung bedarf. Nach der NS-Terminologie gab es nun»voll-, Halb-, Viertel- und Achteljuden«, denen als»nicht-arier«der Reichsbürgerstatus aberkannt wurde und die alle auch von der weiteren Judengesetzgebung mehr oder weniger mitbe- troffen waren. Bis zum Beginn des Krieges war es durchaus im Sinn der nationalsozialistischen Machthaber, daß die Juden Deutschland verließen. Doch entschlossen sich viele nur langsam zu diesem einschneidenden Schritt. Aus Heilbronn (mit Sontheim) konnten insgesamt 634 Juden emigrieren. Zwischen 1933 und 1937, als es noch vergleichsweise einfach war, taten es aber nur 263 Personen. Erst die
162 Zwischen Duldung und Vertreibung Heilbronner Juden im Mittelalter An der Lohtorstraße und am Kieselmarkt entdeckte Räumlichkeiten und Steinfunde lassen den Schluß zu, daß hier von der Mitte des 11. Jahrhunderts an eine blühende jüdische Gemeinde existierte. Es gibt Hinweise auf eine Synagoge, auf eine Mikwe (rituelles Ta uchbad) und auf einen Judenfriedhof. Am 19. Oktober 1298 verloren 143 bis 200 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Heilbronn ihr Leben durch ein sogenanntes»rintfleischpogrom", benannt nach einem Adligen, der mit seinen Anhängern zwei Jahre lang versuchte, möglichst viele Judengemeinden auszulöschen. Nach diesem blutigen Aderlaß erreichte die hiesige Gemeinde nie wieder ihre bisherige Größe und Bedeutung. Im Frühjahr 1349, als die Ausbreitung der Pest in Europa das Gerücht von der Brunnenvergiftung durch die Juden entstehen ließ, kam es auch hier erneut zu Massakern unter der jüdischen Bevölkerung. Diese Judenverfolgungen waren jeweils von fanatischen Bevölkerungsgruppen ausgelöst worden. Ab dem 15. Jahrhundert ordneten in der Regel die Regierenden die Vertreibung der Juden aus ihrem Herrschaftsbereich an versuchte der Heilbronner Magistrat dies zum ersten Mal. Als»Kammerknechte" hatten alle Juden des Heiligen Römischen Reichs dem Kaiser erhebliche Abgaben zu zahlen. Die Heilbronner Judensteuer war an Konrad von Weinsberg verpfändet, der auf die ihm zustehenden Einnahmen nicht verzichten wollte und deshalb dafür sorgte, daß die Juden zunächst hierher zurückkehren konnten gelang es Bürgermeister und Rat dann aber doch, den Juden»auf ewige Zeiten«die Niederlassung in der Stadt zu verbieten. sogenannte»reichskristallnacht", das Judenpogrom vom November 1938, führte die unausweichliche Notwendigkeit, sich ein neues Heimatland zu suchen, auch den Zögerlichsten vor Augen. Danach gelang noch 371 Heilbronner und Sontheimer Juden die Auswanderung. Anders als an den meisten Orten im übrigen Reich, wo am Abend des 9. und in der darauffolgenden Nacht zum 10. November die Synagogen brannten und zugleich unzählige jüdische Geschäfte und Wohnungen mutwillig demoliert wurden, fand in Heilbronn das Novemberpogrom etwas später und in zwei Phasen statt. Zwar ging die hiesige Synagoge schon in den frühen Morgenstunden des 10. November in Flammen auf, doch folgten die Anschläge auf Geschäfts- und Wohnhäuser von Juden erst am späten Abend desselben Tages. Auf Befehl von NSDAP-Kreisleiter Richard Drauz versammelten sich 50 bis 60 führende und überzeugte Parteimitglieder in Zivil in der Harmonie und stellten Trupps von ca. sechs Personen zusammen, die dann jeweils unter der Leitung eines ortskundigen NS-Funktionärs zu 15- bis 30minütigen Zerstörungseinsätzen aufbrachen. Die führenden Heilbronner Nationalsozialisten hatten sich schon vor diesem reignis mit der»arisierung«, also der Ubernahme des jüdischen Besitzes durch»arier" beschäftigt. Viele von Juden betriebene Geschäfte und Firmen waren bereits in»deutsche«hände übergegangen. Durch die nun rapide ansteigenden Auswanderungen standen in Heilbronn Ende 1938 auf einen Schlag 80 Wohn- und/oder Geschäftshäuser sowie ein unbebautes Grundstück, die bisher Die brennende Synagoge am Morgen des 10. November
163 heim Murr und mit der Württembergischen Ministerialabteilung für Bezirksund Körperschaftsverwaltung, daß ihnen - trotz dort bestehender Bedenken - erlaubt wurde, etwa Anwesen an verdiente»alte Kämpfer" weitergeben zu dürfen. Zunächst zogen diese als Mieter dort ein und sollten dann nach 3-5 Jahren das Recht haben, die Häuser von der Stadt zu erwerben. Die Kriegsereignisse verhinderten allerdings in der Regel diesen Weiterverkauf, so daß die meisten Ausweis von Bertha Eisenmann mit dem Zwangsvornamen Sara und dem aufgedruckten "J". Sie wurde nach Theresienstadt und Maly Trostinec deportiert und bei einer Vernichtungsaktion im Raum Minsk ermordet. Ehrenbürger Max Rosengart, Rechtsanwalt und langjähriger Gemeinderat ( ). Eigentum von Juden gewesen waren, zum Verkauf an. Ohne Beteiligung der städtischen Preisbehörde unter Leitung von Bürgermeister Hugo Kölle, welche die Verkaufspreise - in der Regel lagen sie bei etwa 2/3 des Einheitswertes - zu genehmigen hatte, war keiner dieser Verkäufe möglich. Die Stadt bekam auf ihr Ansuchen hin von der Gauwirtschaftskammer ein Vorkaufsrecht auf alle jüdischen Anwesen eingeräumt. Man wollte etwa Gebäude in den städtischen Besitz übernehmen, die in ihrer Mehrzahl für öffentliche Zwecke verwendet werden sollten. Außerdem erreichten es die Heilbronner Parteioberen durch zähe Verhandlungen mit NSDAP-Gauleiter Wil-»Auch der Gegner achtete seinen politischen Charakter«Willy Dürr über Max Rosengart anläßlich dessen 100. Geburtstags, 1955: nln Würdigung der hervorragenden Verdienste, die Max Rosengart in seiner mehr als 30jährigen Gemeinderatstätigkeit um die Stadt und ihre Bewohner sich erworben hatte, wurde ihm zu seinen 75. Geburtstag 1930 das Ehrenbürgerrecht der Stadt Heilbronn verliehen. Schon 1927 war ihm... die Ehre zuteil geworden, daß eine Straße... nach ihm benannt wurde.... Es gab kaum ein Gebiet, auf dem er nicht durch seinen scharfen Verstand, seine rasche Auffassungsgabe, seine Sachkenntnis, seine glänzende Beredsamkeit, seine Schlagfertigkeit führend wirkte.... Dank seiner persönlichen Liebenswürdigkeit, seiner allumfassenden Bildung, namentlich auch auf allen Gebieten der Kunst, seiner frischen lebendigen, geistvollen freundlichen Art wurde er auch als Mensch überall geschätzt. Manchen guten, freundschaftlichen Rat habe ich von ihm noch empfangen, als ich ihn im Gemeinderat sozusagen abzulösen die Ehre hatte.... Max Rosengart ging 1939 nach Stockholm... Im Alter von 88 Jahren ist er 1943 dort ohne Groll im Herzen, ruhig und gefaßt gestorben ist ihm seine Gemahlin [Emma geb. Dannheiser] im Alter von 80 Jahren im Tode nachgefolgt, die... für ihre Mitwirkung bei der Feier zum 100. Todestag Schillers mit der Schillerplakette ausgezeichnet wurde, und die ich selbst noch in der Theaterkommission als sachverständige Beraterin erlebt habe.«161
164 dieser Gebäude, die fast alle der Stadtzerstörung zum Opfer fielen, schließlich doch im städtischen Besitz verblieben. Den Juden, denen eine Auswanderung nicht mehr gelang, wurde das Leben in Deutschland - vor allem nach Kriegsbeginn - durch ständig verschärfte, bewußt demütigende Einschränkungen und Schikanen immer unerträglicher gemacht: Sie durften nicht mehr ins Theater und Kino gehen, nicht mehr auf Parkbänken sitzen, keine Telefone und öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen, sie mußten in sogenannten Judenhäusern«auf engstem Raum zusammenwohnen, ihren eigenen Vornamen den Beinamen»Sara«oder»Israel«hinzufügen, sich ein großes»j«in Kennkarte oder Paß stempeln lassen und ab dem 1. September 1941 den gelben Judenstern tragen. Lebensmittelzuteilungen wurden ihnen gekürzt, vom Bezug von Tabakwaren und Spirituosen sowie von Kleidungsstücken wurden sie ausgeschlossen. Der Weg in den Tod begann für die noch in Heilbronn gebliebenen Juden mit der ersten Deportation am 26. November Die dazu bestimmten Personen mußten sich auf dem Wollhausplatz einfinden und wurden per Bus nach Stuttgart ins Lager Killesberg gebracht. Am 1. Dezember wurden sie in Güterwaggons nach Riga transportiert, wo alle Angekommenen später erschossen wurden. Am 23. März 1942 wurden weitere Heilbronner Juden zunächst nach Haigerloch und von dort nach Theresienstadt deportiert. Der dritte Transport verließ Heilbronn am 24. April 1942 und ging nach lzbica in Polen und von dort weiter in verschiedene Vernichtungslager. Schließlich wurden aus dem jüdischen Altersheim in Sontheim am 20. August 1942 nochmals 22 Personen über Stuttgart nach Theresienstadt gebracht. Weitere Opfer wurden über Eschenau nach Theresienstadt deportiert bzw. in Einzeltransporten am 11. Januar 1944 und am 12. Februar 1945 fortgebracht. Insgesamt verloren 234 in Heilbronn und Sontheim ansässige Juden durch die nationalsozialistische Verfolgung ihr Leben. Die Mehrzahl von ihnen starb in Vernichtungs- und Konzentrationslagern, sechs Personen wählten angesichts des ungewissen Schicksals den Freitod in der Heimat. Zehn aus Heilbronn Deportierte überlebten das KZ Theresienstadt und konnten 1945 befreit werden. Seit es antisemitischer Propaganda gelang, aus»den Deutschen«und»den Juden«zwei scheinbar gegensätzliche Bevölkerungsgruppen zu machen, ist es nur noch schwer vorstellbar, wie selbstverständlich auch in Heilbronn Christen und Juden zeitweilig mit- und nebeneinander gelebt hatten. Die schrecklichen Geschehnisse zwischen 1933 und 1945, die die Betroffenen entweder in die Emigration oder in den Tod führten, beendeten die mehr als tausendjährige deutschjüdische Geschichte. Denn nach 1945 kehrten verständlicherweise nur sehr wenige derer, welche die Greuel der nationalsozialistischen Verfolgung hatten erleiden müssen und deren Verwandte und Freunde einen grausamen Tod in den Vernichtungslagern gefunden hatten, in ihre alte Heimat zurück. 162
165 »Mit Gewalt auf nationalsozialistischen Kurs... «Machtergreifung und Drittes Reich Oktober 1932:»Wenn unsere gute Stadt Heilbronn... gegenüber den Jahren vor 1933 geistig ein völlig neues Gesicht bekommen hat und heute wirklich nationalsozialistisch handelt, denkt und arbeitet, so ist das das hervorragendste Werk unseres Kreisleiters, das ihn mit stolzer Genugtu- Richard Drauz wird NSDAP-Kreisleiter und Verlagsleiter des Heilbronner Tagblatts. 5. Februar 1933: Kundgebung von Hitlergegnern. 7. März 1933: Verbot der sozialdemokratischen Ta geszeitung»neckar-echo". 16. März 1933:»Machtübernahme" der NSDAP im Heilbronner Gemeinderat. 1. Juni 1933: Eingemeindung von Böckingen. 26. Juli 1933: Entlassung von Oberbürgermeister Emil Beutinger. 16. August 1933: Ernennung des bisherigen Staatskommissars Heinrich Gültig zum Oberbürgermeister. 1934/1 935: Auseinandersetzungen innerhalb der NSDAP über den Führungsstil von Kreisleiter Richard Drauz. 1935: Inbetriebnahme der Ludendorff- und der Schlieffenkaserne; Heilbronn ist wieder eine Garnisonsstadt. 28. Juli 1935: Eröffnung des Kanalhafens und der Großschiffahrtsstraße Heilbronn - Mannheim. 30. September 1935: Ablösung des Gemeinderats durch ein ernanntes Ratsherrengremium. 1937: Inbetriebnahme der Priesterwaldkaserne. 1. Oktober 1938: Eingemeindung von Neckargartach und Sontheim. Bildung von Stadtkreis und Landkreis Heilbronn anstelle des bisherigen Oberamts Heilbronn. ung erfüllen darf.«diese 1944 anläßlich seines fünfzigsten Geburtstags von der NS-Zeitung Heilbronner Tagblatt formulierte Laudatio auf den hiesigen NSDAP Kreisleiter Richard Drauz läßt nur indirekt erahnen, daß die Nationalsozialisten anfangs große Schwierigkeiten hatten, hier Fuß zu fassen. Zwar gab es bereits seit 1922 eine Ortsgruppe der NSDAP. Sie blieb aber bis zum Beginn der dreißiger Jahre zahlenmäßig klein und unbedeutend. Dann setzte zwar ein gewisser Aufschwung in der Mitgliederzahl ein, der jedoch im Vergleich zu den anderen Parteien weiterhin bescheiden genannt werden muß. Erstmals erfolgreich war die NSDAP bei der Gemeinderatswahl am 6. Dezember 1931, als drei ihrer Kandidaten in dieses Gremium einzogen. Doch noch bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 unterlag hier die Hitlerpartei der SPD knapp mit 9598 zu 9625 Stimmen. Angesichts dieser Ausgangssituation ist es nicht erstaunlich, daß es in der Anfangszeit des Dritten Reiches in Heilbronn zu heftigen Auseinandersetzungen und harten Zusammenstößen kam. Wenige Tage nach der»machtergreifung«durch Hitler, am 5. Februar 1933, organisierte die Eiserne Front einen Demonstrationszug und eine Kundgebung auf dem Marktplatz gegen die neue Regierung. Laut dem sozialdemokratischen Neckar-Echo und der bürgerlich-liberalen Heilbronner Abendzeitung nahmen daran mehrere tausend Menschen teil, während das nationalsozialistische Heilbronner Tagblatt verlauten ließ, daß die Veranstaltung nur auf wenig Resonanz gestoßen sei. Auch im Wahlkampf für die Reichstagswahl am 5. März 1933 traten die Parteien und Gruppierungen, die gegen Hitler waren, in Heilbronn vielfältig und massiv in Erscheinung. Die Zerschlagung dieser recht starken Opposition war deshalb das erste 163
166 Anliegen der führenden Heilbronner Nationalsozialisten. Zur Erreichung dieses Ziels wurden zunächst einmal publizistische und propagandistische Mittel eingesetzt. Das Heilbronner Tagblatt polemisierte fast täglich gegen mißliebige Personen. Es hatte dabei sowohl die im Rampenlicht stehenden Persönlichkeiten wie beispielweise die SPD- und KPD-Gemeinderäte im Visier als auch»einfache" Leute, die es wagten, eine kritische Meinung zu äußern. Außerdem versuchte man, die publizistische Konkurrenz auszuschalten und dem Heilbronner Tagblatt das Zeitungsmonopol zu sichern. So wurde das Neckar-Echo zum 7. März 1933 zunächst befristet, faktisch aber dauerhaft verboten, am 12. März dessen Verlagsgebäude von SA- und SS-Einheiten besetzt und beschlagnahmt. Haus und Einrichtung wurden dem Heilbronner Tagblatt zur weiteren Nutzung überlassen. Bis 1934 gelang es durch zahlreiche Uberfälle, massive Abwerbemethoden und»lnschutzhaftnahme«von Anzeigenkunden, Redakteuren und Verlegern, sämtliche andere hier erscheinenden Zeitungen und ihre Infrastruktur in die Hand des Heilbronner Tagblatts zu bringen. Bei der Durchsetzung des nationalsozialistischen Herrschaftsanspruchs spielten auch in Heilbronn Einschüchterungen, körperliche wie seelische Mißhandlungen sowie die Androhung und Durchführung von»schutzhaft«gegenüber den Personengruppen, die dem neuen Regime nicht genehm waren, immer wieder eine große Rolle. Die davon Betroffenen erlitten die gegen sie gerichteten Anschläge sowohl tagsüber auf offener Straße als auch bei»nacht- und Nebelaktionen". Ein berüchtigter Tatort für brutale Gewaltanwendung war der Keller des»braunen Hauses«in der Fleiner Straße 1. Die Täter, zumeist»alte Kämpfer«von SA und SS, brauchten strafrechtliche Konsequenzen nicht zu fürchten. Das zeigen mehrere Fälle von Ausschreitungen in Heilbronn und Umgebung, die auf Veranlassung des damaligen Polizeidirektors, Josef Georg Wilhelm, zwar untersucht und zur Anzeige gebracht, dann aber in der Regel durch Intervention von NSDAP Gauleiter Wilhelm Murr oder NSDAP Kreisleiter Richard Drauz niedergeschlagen wurden. Letzterem war der Polizeidirektor, der offensichtlich ein korrekter Beamter war und es für seine Pflicht hielt, alle Straftäter ohne Berücksichtigung ihrer politischen Herkunft zu verfolgen, ein Dorn im Auge, und so führte er ständig und massiv Beschwerde gegen ihn. Drauz erreichte schließlich, daß Wilhelm im Oktober 1935 von seinem Posten abgelöst und zum Polizeipräsidium nach Stuttgart versetzt wurde. Die Konflikte zwischen Kreisleiter und Polizeidirektor sind auch ein gutes Beispiel für die unklaren Kompetenzabgrenzungen zwischen staatlichen oder kommunalen Behörden und der NSDAP, die charakteristisch waren für das»dritte Reich«. Die Parteirepräsentanten griffen oft in das Handeln der Behörden ein und waren der Meinung, daß dort zu geschehen hätte, was sie für richtig hielten. Die»Machtergreifung" im Heilbronner Rathaus fand während einer Gemeinderatssitzung am 16. März 1933 statt. Einige KPD- und SPD-Gemeinderäte waren bereits im Vorfeld in»schutzhaft«genommen worden. Die beiden SPD-Stadträte Ernst Riegraf und Karl Britsch wurden noch auf dem Weg ins Rathaus auf dem Marktplatz überfallen, zusammengeschlagen und verhaftet. Oberbürgermeister Emil Beutinger war nicht anwesend, weil er im Krankenhaus lag. In dieser Sitzung gelang es den drei NSDAP Gemeinderäten, zahlreiche Forderungen durchzusetzen, die darauf zielten, eine für ihre Partei günstigere Position in diesem Gremium zu erreichen. Die bisherigen Oberbürgermeister-Stellvertreter, Karl Wulle (DDP) und Karl Britsch (SPD), wurden von Heinrich Gültig (NSDAP) und Am 12. März 1933 besetzten SA und SS das Verlagsgebäude der bereits seit dem 6. März verbotenen sozialdemokratischen Tageszeitung Neckar-Echo (Allee 40) und beschlagnahmten Haus und Inventar. 164
167 Das Heilbronner Rathaus, anläßlich der Reichstagswahl vom 29. März 1936 mit Hakenkreuzfahnen beflaggt. Theodor Krauß (Allgemeine Bürgervereinigung) abgelöst. Am 1 7. März wurde Stadtrat Gültig von Gauleiter Murr, der inzwischen zugleich württembergischer Ministerpräsident und Innenminister war, als Staatskommissar eingesetzt und mit der Ausübung der Geschäfte für den erkrankten Oberbürgermeister beauftragt. In einem Brief, der vermutlich unter Druck geschrieben wurde, hatte Beutinger das Innenministerium um die Bestellung eines Staatskommissars gebeten. Der bisherige Amtsinhaber stand im Schußfeld der neuen Machthaber, die ihm Mißbrauch seiner Position unterstellten und deshalb ein Gerichtsverfahren einleiteten. Am 24. April erfolgte seine vorläufige Dienstsuspendierung. Obwohl Beutinger am 22. Juni 1933 vom Vorwurf der Veruntreuung freigesprochen wurde, verlor er am 26. Juli durch Verfügung von Murr endgültig sein bisheriges Amt, und zwar auf der Grundlage des neuerlassenen»gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«, das den Nationalsozialisten die Handhabe gab, ihnen nicht genehme Beamte zu entfernen. An Beutingers Stelle wurde am 16. August 1933 Heinrich Gültig zum neuen Oberbürgermeister der Stadt ernannt. Dieser hatte in seiner Funktion als Staatskommissar bereits am 27. März 1933 verfügt, daß der Gemeinderat bis zu einer Neuregelung der Gemeindeordnung nicht mehr zusammentreten sollte, am 5. April wurde das Gremium dann durch eine Regierungsverordnung ganz aufgelöst. Aufgrund der Stimmenverteilung bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933 wurden am 4. August die Sitze im Gemeinderat neu vergeben, wobei die Anteile der inzwischen verbotenen und handlungsunfähig gemachten SPD und KPD nicht mehr berücksichtigt wurden. Danach konnte die NSDAP über 18 Mandate und damit über die absolute Mehrheit verfügen. Die Inhaber der übrigen 12 Sitze, die alle keine Parteigenossen waren, sollten laut dem Heilbronner Tagblatt»einfach als Vertreter der Gemeindebürger«anzusehen sein. Am 1. Oktober 1935 wurden dann aufgrund der wiederum geänderten Gemeindeordnung der Gemeinderat völlig aufgehoben und statt dessen 24 sogenannte Ratsherren in ihr Amt eingeführt. Sie wurden nicht gewählt, sondern von der NSDAP-Kreisleitung ernannt, und hatten nur beratende, keine beschließenden Funktionen mehr. Ihre Amtszeit war ursprünglich auf sechs Jahre begrenzt, doch wurde nach Kriegsbeginn gesetzlich festgelegt, daß mit einer Neubestellung bis zum Ende des Krieges gewartet werden sollte, so daß die 1935 ernannten Ratsherren bis 1945 im Amt blieben. Mangels entsprechender Quellen ist es relativ schwierig zu erkennen, ob und gegebenenfalls welche kommunalpolitischen Pläne und Ziele die hiesige NS Parteileitung und der Oberbürgermeister verfolgten. Viele der wichtigen lokalen Ereignisse der dreißiger Jahre, wie die Eingemeindungen von Böckingen ( 1933), Neckargartach und Sontheim (1938), die Umwandlung des Oberamtes in den Stadt- und den Landkreis Heilbronn (1938) oder die Fertigstellung des Nekkarkanals und -kanalhafens (1935), waren Projekte, die alle schon lange vor 1933 geplant und begonnen worden waren und lediglich unter nationalsozialistischer Leitung zu Ende geführt wurden. Ähnliches gilt für den Autobahnbau, der - obwohl oft als die erfolgreiche und»gute«maßnahme des NS-Regimes gerühmt - ebenfalls ein bereits in der Weimarer Republik in Angriff genommenes Unternehmen gewesen ist. Daß allerdings die Autobahn Stuttgart-Nürnberg über Heilbronn und nicht über Backnang-Crailsheim geführt wurde, scheint ein Verdienst der nationalsozialistischen Stadtoberen gewesen zu sein, die sich dafür rechtzeitig bei den entsprechenden Stel- 165
168 len stark gemacht hatten. Ein tatsächlich rein»nationalsozialistisches«bauobjekt war das Freibad in der Neckarhalde. Der NS-Staat hatte den Anspruch, alle Lebensbereiche zu durchdringen und überall entscheidend mitzuwirken. An diesem Ziel arbeiteten die Heilbronner Parteiführer ganz offensichtlich einvernehmlich. Das zeigt sich zum Beispiel sehr deutlich bei der sogenannten Gleichschaltung der Vereine und Verbände. Drauz und/oder Gültig sowie weitere lokale Parteigrößen beteiligten sich an allen wesentlichen Sitzungen, in denen es um die Neuorganisation der Gremien im nationalsozialistischen Sinn und um die ß.esetzung der wichtigen Positionen und Amter mit NSDAP-Parteigenossen ging. Auch übernahmen sie oft so lange kommissarisch die Führung, bis geeignete Parteikandidaten für die Neubesetzung gefunden waren. Die exponierten Heilbronner Nationalsozialisten trugen die Politik ihres»führers«adolf Hitler mit, ohne daß sie - zumindest nach außen hin - je irgendwelche Zweifel an deren Richtigkeit erkennen ließen. Die überwiegende Mehrzahl derjenigen, die hier zwischen 1933 und 1945 in der Partei oder in den ihr angeschlossenen Formationen Verantwortung trugen, waren überzeugte nationalsozialistische»alte Kämpfer", also deutlich vor 1933 zur»völkischen Bewegung«gestoßen. In der Regel waren sie in Heilbronn geboren oder lebten doch schon vor dem»dritten Reich«viele Jahre hier, kamen also nicht von außen in die Stadt. Richard Drauz war seit Anfang der zwanziger Jahre ein enger Freund von Wilhelm Murr, gehörte seit 1928 der Hitlerpartei an und wurde 1932 vom Gauleiter zugleich zum Verlagsleiter des Heilbronner Tagblatts wie zum NSDAP-Kreisleiter ernannt. Oberbürgermeister Heinrich Gültig und sein Stellvertreter Bürgermeister Hugo Kölle waren beide jeweils seit 1930 Parteimitglieder. Das Bestreben der Heilbronner Parteileitung, möglichst viele»alte Kampfgenossen«mit Posten in Partei oder Verwaltung zu versorgen, wird aus den vorhandenen Quellen klar ersichtlich. Dennoch waren nicht alle von ihnen mit den lokalen»führern«völlig einverstanden und 1935 kam es deshalb zu mehreren innerparteilichen Auseinandersetzungen und Machtkämpfen. Sie entzündeten sich vor allem an dem willkürlichen Führungsstil von Richard Drauz und gelangten teilweise bis vor das NSDAP-Gaugericht Württemberg-Hohenzollern. Der Kreisleiter ging daraus aber letztlich immer als Sieger hervor, obwohl seine Methoden - auch im Umgang mit innerparteilichen Gegnern - tatsächlich äußerst fragwürdig waren. Zahlreich überlieferte Fälle zeigen deutlich, daß er sich nicht scheute, die Grenze zu Unrecht und Gewalt zu überschreiten, wenn es für seine Ziele dienlich zu sein schien. Diejenigen, die gegen ihn opponierten, verloren jeden politischen Einfluß. Wer sich in Heilbronn zwischen 1933 und 1945 in einer verantwortlichen NS-Position halten wollte, mußte sich mit Richard Drauz arrangieren. Es spricht vieles dafür, daß Gauleiter Wilhelm Murr mit der Ernennung von Heinrich Gültig zum Oberbürgermeister dem machtbewußten Kreisleiter in voller Absicht einen mäßigenden Partner zur Seite stellen wollte. Damit sollten dessen Härte und Brutalität, die von der württembergischen Parteileitung durchaus gewollt waren und immer wieder gegen Widerstände unterstützt wurden, ausgeglichen werden. Doch auch der zumeist als konziliant und gesprächsbereit charakterisierte Gültig trat ohne erkennbare Vorbehalte für die»nationalsozialistische Weltanschauung«ein, und es gibt keinerlei Hinweise darauf, daß er sich z.b. von Gewaltakten in irgendeiner Weise distanziert hätte. Um das Zusammengehörigkeitsgefühl der»volksgemeinschaft«zu stärken, die Bevölkerung auf die NS-Ideologie einzuschwören und den einzelnen über den Führende Heilbronner NSDAP-Funktionäre am 21. März 1933 im Rathaus: Kreisleiter Richard Drauz, Stadtrat Alfred Faber, Oberbürgermeister Heinrich Gültig, 1. Beigeordneter Hugo Kölle, Polizeistaatskommissar Dr. Otto Sommer, Polizeihauptmann Wachter (von rechts). 166
169 bescheidenen Alltag hinauszuheben, fanden sehr häufig Kundgebungen, Aufmärsche, Appelle und andere Veranstaltungen der verschiedenen NS-Organisationen statt. Heilbronn war bis 1938 Sitz des Oberamtes und dann»hauptstadt«des neugebildeten Landkreises, der sich im wesentlichen aus den Gemeinden der bisherigen Oberämter Heilbronn, Brakkenheim und Neckarsulm zusammensetzte. Da die Stadt also Zentralfunktionen in der Region innehatte, unterhielten die NSDAP und ihre Gliederungen hier nicht nur örtliche, sondern auch übergeordnete Dienststellen. So war die hiesige Kreisleitung der Partei mit ihren 24 verschiedenen Ämtern seit dem 1. Juni 1937 für den neugebildeten NSDAP-Großkreis Heilbronn zuständig, zu dem die Oberämter Heilbronn, Neckarsulm, Brackenheim, Besigheim, Marbach, die badische Exklave Schluchtern und die hessische Exklave Bad Wimpfen zählten. Der Stadtkreis Heilbronn war 1938 in 15 NSDAP Ortsgruppen aufgeteilt. Im Adolf-Hitler Haus (Kaiserstraße 2) unterhielt die NS Frauenschaft eine Kreisamtsleitung. Die SA-Standarte 122 mit den Sturmbannen 1/1 22, 11/122 und 111/1 22 war im sogenannten Horst-Wessel-Heim in der Schaeuffelenstraße 7 untergebracht. Dagegen gab es von der SS hier nur einen Sturmbann, der zunächst die Bezeichnung 111/13, ab April /8 1 trug. Die ihm vorgesetzte SS-Standarte 81 befand sich in Würzburg. Die Motorstandarte 155 des Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps (NSKK) und die Standarte 102 des Nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) komplettierten die hier ansässigen NSDAP-Gliederungen, ebenso wie der HJ-Bann 121 Unterland und die dazugehörigen Untergaue des BDM und der Jungmädel. Von den der NSDAP angeschlossenen Verbänden waren in Heilbronn einige Kreisgruppen von Berufsvereinigungen (NS-Ärztebund, -Rechtswahrerbund, -Lehrerbund, -Bund deutscher Techniker und Reichsbund der deutschen Beamten) sowie eine Kreisdienststelle der NS-Kriegsopferversorgung und sogenannte Kreiswaltungen der NS-Volkswohlfahrt und der Deutschen Arbeitsfront (DAF) einschließlich der NS-Gemeinschaft»Kraft durch Freude«(KdF) vertreten. In all diesen Organisationen gab es auf den verschiedenen Ebenen zahlreiche Positionen zu besetzen. Von einem guten nationalsozialistischen»volksgenossen«wurde erwartet, daß er Mitglied in mindestens einer dieser NS-Gruppierungen wurde und si h dort durch die Ubernahme solcher Amter aktiv beteiligte. Das sollte mit dazu beitragen, den einzelnen noch stärker in die NS-Maschinerie einzubinden. Daß Adolf Hitler vom Beginn seiner Herrschaft an das Ziel hatte, Krieg zu führen, läßt sich im Rückblick auch in Heilbronn an verschiedenen Einzelheiten erkennen. Schon im Herbst 1933 wurden hier Luftschutzübungen und Informationsveranstaltungen zu diesem Thema durchgeführt. Im Januar 1934 fand ein Luftschutzkurs für Lehrerinnen statt. Da - wie im Heilbronner Tagblatt zu lesen war -»ein großer Teil des Luftschutzes im Ernstfall der Frau" zufallen werde, sei es nötig,»sie schon heute mit den Gefahren eines Luftangriffes bekannt«zu B. März 1936 bee Hitlers Stellvertre- 1dolf Heß Heilbronn ug sich in das Go/ Buch ein. Links 1 ihm in der ersten : Oberbürgermeileinrich Gültig, Gau ' Reichsstatthalter Im Murr und Kreis Richard Drauz (von s). 167
170 Widerstand gegen das NS-Regime in Heilbronn Eine Bestandsaufnahme von Markus Dieterich (S ):»Aus dem Lager der Sozialdemokraten waren es. einzelne, vor allem Jüngere, die sich zu... antifaschistischen Gruppen zusammenfanden. Zwar erschien es ihnen zu gefährlich, eine illegale Organisation aufzubauen, aber sie versuchten..., durch das sporadische Verteilen illegaler Schriften dem NS-Regime entgegenzuwirken und zugleich eine lose Verbindung untereinander aufrechtzuerhalten. Demgegenüber waren die Kommunisten in Heilbronn nach der lllegalisierung ihrer Partei bestrebt, die Parteiorganisation als Grundlage für den Widerstand wieder aufzubauen... Dies gelang... trotz immer wieder einsetzender massiver Verhaftungswellen, zumindest bis zum Sommer 1934; danach konnte der Widerstand nur noch sehr begrenzt in organisierter Form weitergeführt werden.... Im Gegensatz zum Widerstand aus SPD und KPD... waren die Initiatoren der sozialistischen >Kaiser/Riegraf-Gruppe' vorwiegend Intellektuelle. Diese zahlenmäßig zunächst kleine Widerstandsgruppe... ging beim Aufbau ihrer illegalen Organisation äußerst... konspirativ vor. Die Aktionen... waren nicht auf Massenwirksamkeit, sondern auf gezielte Aufklärung ausgerichtet. Es gab deshalb nur wenige spektakuläre Aktionen. Dafür konnte die Gruppe aber relativ straff organisiert bis zum Sommer 1938 illegal arbeiten. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Bedingungen für illegale Widerstandsarbeit noch schwieriger. Die Quellenlage für diese Periode ist äußerst spärlich." machen. Am 16. März 1935 befreite sich Hitler mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht von den 1919 im Versailler Vertrag festgelegten Truppenbeschränkungen. Es wurde angekündigt, die Reichswehr, die seither nicht mehr als Berufssoldaten für Marine und Heer hatte umfassen dürfen, in eine»deutsche Wehrmacht" genannte Armee umzuwandeln, der auch eine bislang verbotene Luftwaffe angegliedert sein würde. Der Personalbestand sollte bis 1939 auf Mann in 36 Divisonen ansteigen. In diesem Zusammenhang wurde Heilbronn wieder zu einer Garnisonsstadt und erhielt damit einen Status zurück, den es durch die 1919 festgelegten Friedensbedingungen verloren hatte. Bereits 1935 wurde die alte Füssilierkaserne in Moltkekaserne umbenannt und wieder mit Truppen belegt. Außerdem wurden zwei Neubauten fertiggestellt und in Betrieb genommen: die Ludendorff- und die Schlieffenkaserne (später: Badener Hof bzw. Teil der Wharton Barracks) kam noch die Priesterwaldkaserne (später: Teil der Wharton Barracks) hinzu waren dort insgesamt 3355 Angehörige des Infanterie-Regiments 34 sowie des Artillerie Regiments 71 untergebracht. Zwar ist es den hiesigen Nationalsozialisten mit Sicherheit nicht gelungen, aus dem ehemals»rot-liberalen" Heilbronn eine»braune Musterstadt" zu machen. Noch bis weit in die dreißiger Jahre hinein gab es Widerstandsgruppen, und auch während des Krieges kam es immer wieder zu Verhaftungen und Verurteilungen wegen verbotener Parteibetätigungen. Zugleich konnten die braunen Machthaber aber auch hier auf Parteigänger und Mitläufer zählen, die sie aus Uberzeugung oder anderen Gründen unterstützten, mit ihnen paktierten und dadurch mit dazu beitrugen, daß sich das nationalsozialistische Unrechtsregime zwölf Jahre lang an der Macht halten konnte. Die Musikkapelle des Infanterie-Regiments Nr. 34 marschiert durch die Stadt. Foto, um
171 »Heilbronn ist vollkommen zerstört und scheint ohne Leben zu sein«der Zweite Weltkrieg 26. September 1939:»Liebe Soldaten! Vor über einem viertel Jahr seid Ihr dem Ruf unseres Führers gefolgt und zu den Waffen geeilt... Die zu Hause Gebliebenen sind oft in Gedanken bei Euch... Das ganze Leben hat sich bereits auf den Kriegsbetrieb eingestellt. Es ist beinahe selbstverständlich, daß wir abends im dunkeln tappen, daß uns die Straßenbahnschaffnerinnen mit ihren >Schiffchen< auf der Straßenbahn fahren lassen..., daß die Frau Briefträgerin uns in ihrer männlichen Uniform die Post ins Haus bringt.... So geht bei uns das Leben seinen geordneten Gang. Es ist von der Sorge getragen, daß diesmal die innere Front ihren Mann voll und ganz stellt und nie versagt.... Möge die kom- Auf Erkundungsflügen befindliche feindliche Flugzeuge werden von der bei Neckargartach stationierten Flak-Batterie vertrieben. 1940/1 941: Vier kleinere Bombenangriffe der Royal Air Force auf Heilbronn; 3 Tote. 7. Mai 1942: Bombenangriff auf Heilbronn, Böckingen und Sontheim; 7 Tote. August/September Ende März 1945: In Neckargartach besteht ein Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler /Elsaß. 10. September 1944: Bombenangriff der 8th US Air Force auf den Rangierbahnhof und den Hafen; ca. 280 Tote. 4. Dezember 1944: Stadtzerstörung durch einen Bombenangriff der Royal Air Force; ca Tote April 1945: Kampf um Heilbronn. 12./1 3. April 1945: Besetzung Heilbronns durch amerikanische Truppen. Übernahme der Zivilverwaltung durch die amerikanische Militärregierung. mende Zeit noch weitere Entbehrungen und Opfer von uns verlangen: Wir sind zu allem bereit, komme was da wolle!«diesen Bericht über den Kriegsalltag in der Heimat erhielten alle als Soldaten verpflichteten Mitglieder der NSDAP-Ortsgruppe Heilbronn-Böckingen (Mitte) im Dezember 1939 als Weihnachtsgruß des dortigen Ortsgruppenleiters, der damit die enge Verbundenheit zwischen»äußerer«und»innerer«front dokumentieren wollte. Der»Führer«Adolf Hitler forderte in diesem vom ihm entfesselten, später zum»totalen«krieg erklärten Waffengang nicht nur von den zum Wehrdienst herangezogenen, sondern auch von den daheim gebliebenen»volksgenossen«den vollen Einsatz aller Kräfte, damit sich die»schmach«von 1918 nicht noch einmal wiederhole. Denn laut der sogenannten»dolchstoßlegende«war der Erste Weltkrieg allein deshalb verloren gegangen, weil die»heimatfront«nicht standgehalten und durch ihre Kapitulationsbereitschaft der kämpfenden Truppe - bildlich gesprochen - den Dolch in den Rükken gestoßen hatte. Diese Interpretation der damaligen Ereignisse entsprach zwar nicht den historischen Tatsachen, wurde aber von großen Teilen der deutschen Bevölkerung geglaubt. Das erklärt, weshalb darauf bezogene Appelle an die Opferbereitschaft und den Durchhaltewillen der»volksgemeinschaft«lange Zeit und auch angesichts wachsender Schwierigkeiten nicht ohne Erfolg blieben, obgleich - anders als 1914-die Menschen von Anfang an keinerlei Begeisterung für diesen Krieg aufbringen konnten. Die schnellen militärischen Erfolge der Jahre 1939/40 ließen wohl eine gewisse Siegeszuversicht entste- 169
172 hen, die aber ab dem Jahreswechsel 1941/42, als der deutsche Vormarsch auf Moskau ins Stocken geriet, zunehmend geringer wurde. Angesichts einer ungewissen Kriegsdauer, der großen Zahl von Gefallenen sowie der schlechten Lebensverhältnisse, die durch die rapide steigende Zahl der Luftangriffe und die dadurch verursachten immensen Zerstörungen in den letzten Kriegsjahren noch schwieriger wurden, machte sich Hoffnungslosigkeit breit. Trotzdem glaubten erstaunlich viele bis kurz vor dem katastrophalen Ende an den»führer«adolf Hitler und seine Fähigkeit, das Kriegsglück für Deutschland doch noch zum Guten zu wenden und den»endsieg«herbeizuführen. Die Heilbronner Bevölkerung wurde erstmals am 26. September 1939 kurz vor Mitternacht mit feindlichen Flugzeugen konfrontiert, die zu Erkundungsflügen unterwegs waren. Laut einem Bericht im Heilbronner Tagblatt zündete die bei Neckargartach stationierte zweite Flak-Batterie 16 Granaten zu Abwehr und schlug damit die Angreifer erfolgreich in die Flucht. Weil sehr viele Menschen die Häuser verlassen hatten, um zu schauen, was los sei, hielt die Zeitung die Ermahnung für angebracht,»daß bei Flak Feuer jedermann gegen Sprengstücke Deckung suchen muß«. Als am 16./1 7. Dezember 1940 hier der erste wirkliche Luftangriff erfolgte, war die Stadt nur noch durch eine leichte Flak-Batterie geschützt. Die Flak-Gruppe Heilbronn war im Mai 1940 aufgelöst worden, weil durch die Ausweitung der Kriegsschauplätze die schweren Flak Einheiten nur noch an strategisch wichtigeren Orten eingesetzt werden konnten. Die britische Royal Air Force warf ungehindert Bomben auf das Altstadtviertel am Neckar. Besonders getroffen wurden die Johannis-, die Zehent- und die Wolfganggasse. An drei Stellen aufflammende Brände konnten erst mit ziemlicher Verzögerung eingedämmt werden und zerstörten 20 meist kleine und alte Fachwerkbauten. Zwei Menschen wurden im Bett von Schuttmassen totgedrückt, elf Personen trugen Verletztungen davon. Die vier britischen Bombenabwürfe des Jahres 1941 (in den Nächten vom 25. auf 26. August, vom 17. auf 18. September, vom 12. auf 13. Oktober und vom 7. auf 8. November) brachten nur geringe Gebäudeschäden in der Kernstadt, in Neckargartach und Sontheim mit sich. Dagegen verloren am 7. Mai 1942 bei einem nächtlichen Luftangriff auf das Wohnviertel zwischen lnnsbrukker, Prager (heute: Cäcilien-), Solothurner, Mönchsee-, Stein- und Bismarckstraße sowie auf Böckingen und Sontheim sieben Menschen ihr Leben. Zur Löschung der 200 Schadens- und Brandstellen mußten Feuerwehren aus dem Landkreis herangezogen werden. 150 Häuser wurden ganz oder teilweise zerstört. Mehr als zwei Jahre blieb Heilbronn danach von Bombardierungen verschont. Trotzdem wurde der Alltag der Zivilbevölkerung natürlich auch weiterhin durch den Krieg bestimmt. Im Zusammenhang mit der Wiedereinrichtung einer Garnison in Heilbronn war ab 1936 an der Jägerhausstraße auch ein Wehrmachtslazarett im Bau, das allerdings erst im Oktober 1939 eröffnet werden konnte und damit gleich für Kriegszwecke benutzt wurde standen im Reserve-Lazarett Heilbronn insgesamt 1130 Betten zur Verfügung, die sich nicht nur im Hauptgebäude an der Jägerhausstraße, sondern auch im Hauswirtschaftlichen Seminar an der Der idyllische Blick vom Marktplatz in die Kaiserstraße trügt. Es war Krieg, und Lebensmittel gab es nur noch auf Bezugsmarken. Der nicht zu übersehende Pfeil am Käthchenhaus wies einen öffentlichen Luftschutzraum aus. Foto, um
173 Am 17. Dezember 1940 waren die ersten beiden Heilbronner Luftkriegsopfer zu beklagen. Das Foto zeigt die Bergung von Wilhelm von Olnhausen, der in seiner Wohnung in der Wolfganggasse ums Leben kam. Wartbergstraße, in der Dammschule, in der Privatklinik Dr. Geyer und im Städtischen Krankenhaus Neckarsulm befanden. Vertreter der NSDAP-Kreisleitung, der verschiedenen Ortsgruppen und der NS-Frauenschaft besuchten die dort behandelten Verwundeten regelmäßig und brachten kleine Geschenke mit, während die NS-Volkswohlfahrt oft Unterhaltungsabende für die Genesenden organisierte. Die ständig wachsende Zahl von verwundeten und gefallenen Soldaten und die damit einhergehende Ausweitung des Wehrdienstes auf sehr junge und alte Männer, brachte es mit sich, daß immer mehr Frauen und Mädchen zu kriegswichtigen Arbeiten in Landwirtschaft und Industrie herangezogen wurden:»dienstverpflichtung: sehr bald spürte ich, was dieses Wort bedeutete.... Mein neuer Arbeitsplatz war in der Stanzerei. Eine riesige Halle mit Maschinen, so groß und mächtig, wie ich sie noch nie vorher gesehen hatte.... Die Einarbeitung war schwer. Die Bedienung der Maschine kostete viel Kraft.... Ich war sehr unglücklich. Und doch stellte ich mich, um den Dienst fürs Vaterland zu tun, um monotone Löcher zu stanzen in Teile von Panzern... Meine Hände wurden mit der Zeit so wund, daß ich kaum noch den Lenker meines Fahrrades anfassen konnte.«so erinnerte sich mehr als vierzig Jahre später die Heilbronnerin Erna Weidenbacher an ihre Kriegsdienstverpflichtung bei den NSU-Werken. Dort traf sie auch auf sogenannte Fremdarbeiter. Das waren zum einen Kriegsgefangene und zum anderen -vorwiegend aus der Sowjetunion, aus Polen, Frankreich, Holland, Italien und aus dem Baltikum - gezielt nach Deutschland zum erzwungenen Arbeitseinsatz verschleppte Zivilisten, Männer wie Frauen. Auch in Heilbronn und Umgebung wurden diese sowohl in den Industriebetrieben wie bei den Unterländer Bauern als Arbeitskräfte eingesetzt. Kontakte zwischen der deutschen Bevölkerung und den von der nationalsozialistischen Propaganda zu minderwertigen Menschen erklärten F remden, die zwar für die deutsche Wirtschaft arbeiten»durften«, aber über keinerlei Rechte verfügten, waren streng verboten. Entdeckte Zuwiderhandlungen wurden hart bestraft. Untergebracht waren sie getrennt nach Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern in von deutschen Mannschaften bewachten, einfachen Barackenlagern, meist in der Nähe der Betriebe, denen sie zugteilt waren. Auch wenn der Gedanke naheliegt, so waren diese doch keine Konzentrationslager (KZ) in dem Sinn, wie der Begriff im Dritten Reich verwendet wurde. Zwischen 1933 und 1945 gab es drei unterschiedliche Kategorien von KZs: In den frühen dreißiger Jahren hießen so die Umerziehungslager, in denen politisch Andersdenkende inhaftiert wurden, mit dem Ziel, sie dort zur nationalsozialistischen Weltanschauung zu bekehren. Unter der Bezeichnung am bekanntesten und berüchtigtsten wurden die Vernichtungslager, in denen aus rassistischen Motiven systematischer Massenmord an Juden sowie an Sinti und Roma begangen wurde. Schließlich gab es noch die Arbeitslager, von denen vor allem in den letzten Kriegsjahren Hunderte im Herrschaftsgebiet der Nationalsozialisten errichtet wurden. Die dort aus politischen wie kriminellen Gründen Inhaftierten, die zumeist aus Polen, Italien, Rußland, Jugoslawien, Frankreich, Luxemburg, Österreich und Deutschland stammten, wurden gezielt für kriegswichtige Zwecke ausgebeutet. Dabei wurde ihr Tod - verursacht durch Unterernährung und miserable hygi nische Zustände - billigend in Kauf genommen. Das Ende August 1944 zwischen Böllinger und Wimpfener Straße in Neckargartach errichtete Außenlager»Steinbock«des Konzentrationslagers Natzweiler /Elsaß gehörte
174 zu diesem zuletzt beschriebenen Typ. In sechs bis sieben größeren Holzbaracken waren dort bis zu 1200 Gefangene untergebracht. Außerhalb des durch einen übermannshohen Bretterzaun und zweibis dreifachen Stacheldraht umgrenzten Lagerareals befanden sich die Unterkünfte für die Wachmannschaften - Angehörige der Waffen-SS und der Luftwaffe - sowie für die Mitarbeiter der Organisation Todt, deren Aufgabe es war, den als kriegswichtig angesehenen Arbeitseinsatz zu koordinieren und durchzuführen. Die Häftlinge bereiteten im Heilbronner Salzbergwerk Salzkammern und Zugänge für die Auslagerung von Rüstungsindustrie dorthin vor. Nach den beiden schweren Bombenangriffen auf die Stadt wurden sie außerdem zum Bergen der Leichen, zum Trümmerräumen und Entschärfen von Sprengkörpern eingesetzt. Der Luftkrieg der westlichen Alliierten, der bereits seit 1942 uneingeschränkt auch gegen die deutsche Zivilbevölkerung geführt worden war, hatte am Jahresbeginn 1943 eine neue Dimension erhalten. In Casablanca einigten sich der britische Premierminister Winston Churchill und der US-Präsident Franklin D. Roosevelt auf eine gemeinsame Bomberoffensive gegen deutsche Städte, die mit dazu beitragen sollte, das ebenfalls beschlossene weitergehende Ziel, nämlich Deutschland zu einer bedingungslosen Kapitulation zu zwingen, zu erreichen. Die Aufgaben wurden zwischen der britischen Royal Air Force (R.A.F.) und der amerikanischen United States Army Air Force (U.S.A.A.F.) folgendermaßen aufgeteilt: die R.A.F. war für die Flächenbombardierung der großen Industriestädte und Ballungszentren zuständig, die U.S.A.A.F. für die Zerstörung der Schlüsselindustrien und Verkehrsknotenpunkte, durch die der deutsche Militärapparat aufrecht erhalten wurde. Nachdem schon 1942 und 1943 sehr schwere Luftangriffe stattgefunden hatten, gab das Reichsministerium des Innern am 21. Februar 1944 Richtlinien für die Umquartierung wegen Luftgefährdung und Fliegerschäden an die ihm nachgeordneten Behörde bekannt:»keine deutsche Stadt wird aufgegeben«ist darin zu lesen, und:»die Umquartierungen sind auf das unbedingt notwendige Maß einzuschränken... zu großzügig betriebene vorsorgliche Umquartierungen führen zu Produktionsausfällen, zur Entwurzelung großer Bevölkerungsteile, zu unerwünschten Wanderungserscheinungen innerhalb der Heimatgemeinde und zur Schwächung des Luftschutzes und des Abwehrkampfes der Bevölkerung.«Was diese Bestimmungen konkret bedeuten konnten, bekamen am Ende des Jahres 1944 Tausende Heilbronner Männer, Frauen und Kinder am eigenen Leibe zu spüren. Kurz nach dem verheerenden Angriff am 4. Dezember 1944 flohen Überlebende vorbei an dem brennenden Hauptbahnhof. Das Bild stamm von dem Militärfotografen Platte, der sich zufällig in Heilbronn aufhielt. 172
175 'Chrichten über Lebenund Tote auf der Ruides Stadtarchivs am iselmarkt, in der sich ute die Ehrenhalle für i Heilbronner Opfer von rfolgung, Vernichtung d Krieg befindet. Bereits am 15. Januar 1944 hatte der hiesige Polizeidirektor Karl d'angelo gleichlautende Schreiben an NSDAP Kreisleiter Richard Drauz und an Oberbürgermeister Heinrich Gültig gerichtet, in denen er ausführte, daß er eine Räumung des dicht besiedelten Altstadtkerns angesichts der zunehmenden Luftgefahr für geboten halte. Zumindest Frauen und Kinder sollten evakuiert werden, da bei einem Angriff mit Flächenbränden gerechnet werden müsse, die nicht leicht zu löschen sein würden, so daß große»menschenverluste«zu befürchten seien. Drauz wandte sich daraufhin am 27. März im Einvernehmen mit Gültig an das württembergische Innenministerium in Stuttgart und legte einen entsprechenden Plan zur Genehmigung vor. Danach sollten Frauen und Kinder von Amts wegen aus der Heilbronner Altstadt in den Landkreis umgesiedelt werden. Doch sowohl Gauleiter Wilhelm Murr in Stuttgart wie der für Evakuierungsfragen zuständige Interministerielle Luftkriegsschädenausschuß in Berlin lehnten diesen Vorschlag ab. Sie hielten eine Auflockerung innerhalb des Stadtgebietes, also den freiwilligen Umzug der Altstadtbewohner in weniger eng bewohnte Stadtteile, für ausreichend. Drauz und Gültig waren mit dieser Entscheidung unzufrieden, getrauten sich aber ohne Rückendeckung von oben nicht, die Altstadtbewohner mit Nachdruck auf die drohende Katastrophe aufmerksam zu machen und die von ihnen für nötig gehaltenen Maßnahmen in eigener Verantwortung zu veranlassen. Am Sonntag, den 10. September 1944 um Uhr, erhielt die Bevölkerung der Stadt einen Vorgeschmack auf das, was noch schlimmer kommen sollte: Die U.S.A.A.F. bombardierte den Rangierbahnhof, der danach ebenso wie der Hauptbahnhof vier Wochen lang nicht voll betriebsfähig war. Getroffen wurden aber auch die angrenzenden Wohngebiete und der Ortskern von Böckingen, das Südviertel und das Gebiet zwischen Kiliansplatz und Hauptbahnhof, wo zahlreiche Brände entstanden. lngesamt starben 279 Menschen durch diesen Angriff. In der Zeit zwischen dem 27. September und dem 31. Oktober warfen an sieben Abenden Mosquito-Flugzeuge, die jeweils nur in kleinen Formationen bis zu sechs Maschinen unterwegs waren, Bomben auf das Bahngelände und das Stadtgebiet ab. Sie hatten eine Flughöhe von und mehr Metern, waren deshalb kaum zu hören und mußten die Bombenladungen stets schon weit vor dem Ziel auslösen. Für die Heilbronner kamen die Angriffe daher immer völlig überraschend, zumal in dieser Zeit für einzelne Flugzeuge auch kein Fliegeralarm mehr gegeben wurde. Der Volksmund nannte diese geheimnisumwitterten Flugzeuge»Bombenkarle«, und Spekulationen wurden angestellt, z.b. daß die Maschinen von emigrierten Heilbronner Juden gesteuert würden, die sich durch die Abwürfe für ihre Verfolgung rächen wollten. Nach dem ersten Mosquito-Angriff in der Nacht vom 27. auf den 28. September machte Oberbürgermeister Gültig noch einen letzten wiederum vergeblichen Versuch, vom Stuttgarter Innenministerium die Erlaubnis zur Evakuierung der Heilbronner Altstadt zu erhalten. In den Abendstunden des 4. Dezember 1944 geschah, was d'angelo, Drauz und Gültig seit Monaten befürchtet hatten. Bei einem 37 Minuten dauernden Luftangriff der R.A.F. wurden auf Heilbronn insgesamt kg Sprengbomben und kg Brand- und Markierungsbomben abgeworfen. Die gezielt getroffene Altstadt wurde durch den entstehenden Feuersturm völlig zerstört, der Vernichtungsgrad in der gesamten Stadt betrug 62 Prozent. Mehr als 6500 Menschen verloren ihr Leben, die meisten von ihnen erstickten in den Luftschutzkellern. Eine Überlebende des Infernos, Gertrud Hofstetter, erinnerte sich später an 173
176 »Aus der Toten Gedächtnis erwachse der Wille,... dem Frieden der Erde zu dienen«die Heilbronner Opfer von Verfolgung, Vernichtung und Krieg Aus rassischen, politischen oder weltanschaulichen Gründen wurde außer den Heilbronner Juden (s. S. 162 ) eine bisher nicht zu rekonstruierende Anzahl hier ansässiger Menschen von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet. Während des Zweiten Weltkriegs starben in Heilbronn bei verschiedenen Bombenangriffen nachgewiesenermaßen mindestens Männer, Frauen und Kinder, unter ihnen 326 ausländische Zwangsarbeiter und 22 vorwiegend französische und russische Kriegsgefangene einen gewaltsamen Tod. Die Kampfhandlungen in den letzten Kriegstagen forderten das Leben von 212 deutschen und von 60 amerikanischen Soldaten sowie von 68 Zivilisten. Von den aus Heilbronn stammenden Soldaten sind 3252 gefallen, das Schicksal von weiteren 637 Heilbronner Wehrmachtsangehörigen ist bis heute unbekannt geblieben, sie gelten als vermißt. In dem Außenlager Neckargartach des Konzentrationslagers Natzweiler/Elsaß fanden 191 namentlich bekannte, insgesamt aber schätzungsweise 295 Häftlinge den Tod durch allgemeine Entkräftung, Lugenentzündungen und Flecktyphus. diese schreckliche Nacht:»Die Stadt brannte lichterloh... Aus allen Bombenlöchern schlugen mir die Flammen entgegen... Gräßliche Todesschreie kamen aus den Luftschutzkellern. Die Luftschutzwarte hatten den Befehl, die Türen geschlossen zu halten. Durch den Brand war es nun nicht mehr möglich, die Menschen zu befreien... Ungefähr acht Tage blieben wir [in der Ludendorff-Kaserne]... Von der Kaserne aus... konnte wir mit dem Fernglas sehen, wie die Toten mit Schubkarren und Lastwagen in den Ehrenfriedhof gebracht wurden. In riesige Löcher wurden sie hineingeworfen. Männer in weißen Kitteln haben nach jeder Fuhre Kalk über die Leiber geworfen: eine Schicht Kalk, eine Schicht Menschen, Kalk, Menschen, Kalk, Menschen... so ging das tagelang." Seit dem 6. Dezember fanden im Köpfer zunächst mit einem, später mit drei Baggern durchgeführte Aushebungsarbeiten für ein Massengrab statt, in dem alle Todesopfer des 4. Dezember beigesetzt werden sollten. Doch der Krieg war für die aufs schwerste zerstörte Stadt noch lange nicht zu Ende. Zwischen dem 27. Dezember 1944 und dem 31. März 1945 fanden noch 13 weitere Luftangriffe statt. Ab dem 3. April wurde um Heilbronn hart und unerbittlich gekämpft. Als amerikanische Truppen an diesem Tag, ohne auf Widerstand zu stoßen, Neckargartach besetzten, begann die»schlacht um Heilbronn", die erst am 13. April 1945 mit der Eroberung Sontheims durch die Amerikaner abgeschlossen wurde, was für Heilbronn de facto das Ende des Krieges bedeutete. NSDAP-Kreisleiter Richard Drauz, der an der Entscheidung, Heilbronn zu verteidigen, wesentlichen Anteil hatte, befolgte bis zuletzt auch noch den absurdesten Befehl seines»führers«. So beschäftigte er sich Ende März 1945 mit verschiedenen Maßnahmen von»verbrannter Erde«in der ohnehin schon stark verwüsteten Stadt, die er allerdings nicht mehr durchsetzen konnte. Außerdem scheint er noch ernsthaft Evakuierungspläne für die Bevölkerung des Stadt- und des Landkreises Heilbronn in Erwägung gezogen zu haben. Die NSDAP-Ortsgrup-.,.. <.,, -. Der nach dem Krieg errichtete Gedenkstein auf dem KZ-Ehrenfriedh1 in Neckargartach. 174
177 penleiter in den Gemeinden des Landkreises wies er an, jedes Dorf in eine Festung zu verwandeln und zu verteidigen, wozu die meisten aber nicht mehr bereit waren, obwohl er allen mit Erschießung drohte, die sich Kapitulationshandlungen erlaubten. Fünf Heilbronner Bürger, darunter auch der hauptamtliche Beigeordnete Karl Kübler, der für den zum Volkssturm eingezogenen Oberbürgermeister Gültig kommissarisch die Geschäfte führte, mußten deshalb in den letzten Kriegstagen auf den willkürlichen Befehl des Kreisleiters hin ihr Leben lassen, weil sie ihre Häuser weiß beflaggt bzw. weil sie nicht verhindert hatten, daß Panzersperren abgebaut wurden. Am Ende des Krieges war keiner der führenden Heilbronner Nationalsozialisten mehr in der Stadt. Bürgermeister Hugo Kölle war seit 1942 als Soldat eingezogen, Oberbürgermeister Heinrich Gültig seit dem 1. April 1945 beim Volkssturm. Kreisleiter Richard Drauz hatte am 6. April die Heilbronner Geschäftsstelle der NSDAP-Kreisleitung aufgelöst und die Stadt in Richtung Gaffenberg verlassen. Später floh er in den Westerwald, wo ihn im Juni 1945 der amerikanische militärische Abwehrdienst CIC aufspürte und verhaftete. Wegen seiner Beteiligung an der Erschießung eines abgestürzten US-Piloten wurde er von einem amerikanischen Militärgericht in Dachau als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und am 4. Dezember 1946 in Landsberg durch Erhängen hingerichtet. Wie viele deutsche Städte mußte Heilbronn einen sehr hohen Preis für die Eroberungsgelüste des nationalsozialistischen Regimes bezahlen. Kam die Stadt in den ersten Kriegsjahren noch glimpflich davon, so war das Ende um so schlimmer. Besonders tragisch ist die Tatsache, daß die große Zahl von Todesopfern hätte vermieden werden können, wenn rechtzeitig entsprechende Maßnahmen getroffen worden wären. Nach der Heilbronner Katastrophe unterschätzte Gauleiter Murr die Luftgefährdung der württembergischen Städte nicht länger und ließ beispielsweise in Ulm wirksame Luftschutzvorkehrungen treffen, die mit dazu beitrugen, daß dort bei einem hinsichtlich der abgeworfenen Bombenmenge vergleichbaren Angriff am 1 7. Dezember 1944 die»bevölkerungsverluste«75 Prozent niedriger lagen als in Heilbronn. 175
178 »Das Wunder von Heilbronn«Nachkriegszeit und Wiederaufbau Jeder sollte sich erinnern, was er 1945 dachte, wenn er auf den schmalen Trampelpfaden durch die Ruinenlandschaft ging. Keiner von uns, auch der Zuversichtlichste nicht, hat geglaubt, daß eine Stadt, die in Jahrhunderten gebaut worden ist, nach ihrer Zerstörung so schnell wiedererstehen könnte.«kurt Schatz drückt in diesen 1955 formulierten Sätzen sehr gut aus, was wohl die meisten Menschen, die Zerstörung und Wiederaufbau miterlebt haben, damals bewegte. Das»Wunder von Heilbronn«war bereits in den fünfziger Jahren auch überregional in aller Munde, obwohl zu dieser Zeit selbstverständlich noch lange nicht alle Schäden behoben waren, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hatte. Zu ihrem Abschluß kamen die Aufbauanstrengungen der Stadt erst am Beginn der siebziger Jahre. Dennoch war das rasche Wiedererstehen Heilbronns eine erstaunliche Leistung, die natürlich nicht das Werk eines einzelnen gewesen ist. Sie konnte nur möglich werden durch spezifische politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und dadurch, daß ein breiter Konsens in Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft vorhanden war, der eine konstruktive Zusammenarbeit aller zuließ. Trotzdem bleibt vor allem der Name einer wichtigen Heilbronner Persönlichkeit untrennbar mit dem Wiederaufbau der Stadt verbunden: Oberbürgermeister Paul Meyle, der von 1948 bis 196 7, also in den wesentlichen Aufbaujahren, die Geschicke der Stadt lenkte und diesem Gemeinwesen»einprägsam den Stempel... [seiner) markanten Persönlichkeit aufgedrückt«hat, wie es Stadtrat Eduard Hilger bei Meyles Verabschiedung in den Ruhestand formulierte. Es kann also mit einer gewissen Berechtigung von der»ära Meyle«gesprochen werden, wenn es um die beiden ersten Nachkriegsjahrzehnte in Heilbronn geht. An deren Anfang, nämlich am 13. April 1945, wurde allerdings zunächst einer anderen, nicht weniger bedeutenden Heilbronner Persönlichkeit die schwere Last der Verantwortung für die stark zerstörte Stadt übertragen.»wer war der Bürgermeister hier, ehe Hitler zur Macht kam?«fragten die amerikanischen Offiziere, die im Gefolge der kämpfenden Truppen am 12. April Heilbronn erreichten und als amerikanische Militärregierung die lokale Zivilverwaltung übernahmen. ßeutinger - Professor Beutinger«erhielten sie zur Antwort. Und so wurde Emil Beutinger - fast genau zwölf Jahre, nachdem ihn die Nationalsozialisten als Oberbürgermeister entlassen hatten - von den Amerikanern wieder in dieses Amt eingesetzt. Zugleich wurde er auch zum Landrat und zum Polizeidirektor ernannt. Alles, was die Militärregierung unter Major Harry M. Montgomery und die von ihr bestimmten deutschen Amtsträger in 13. April 1945: Die zerstörte Heilbronne1 Altstadt zwischen Necka1 und Allee. Vorn im Bild die von den deutschen Truppen in der Nacht vom 2. auf 3. April 1945 gesprengte Neckarbrücke. Foto, 1945 Die Altstadt im Wiederaufbau. Luftbild, 1957 Die amerikanische Militärregierung setzt Emil Beutinger als Oberbürgermeister ein : Kriegsgefangenen- bzw. lnterniertenlager in Böckingen. 26. Mai 1946: Erste Gemeinderatswahl : Amtszeit von Oberbürgermeister Paul Metz : Amtszeit von Oberbürgermeister Paul Meyle. 5. März 1948: Gemeinderatsbeschluß über den Rahmenplan für den Wiederaufbau. 20. September 1949: Aufhebung der amerikanischen Militärregierung. 6. Juni 1953: Einweihung des wiederaufgebauten Rathauses. 2. Dezember 1965: Einweihung des wiederaufgebauten Chörs der Kilianskirche. 7. September 1967: Oberbürgermeister Paul Meyle wird feierlich verabschiedet und zum Ehrenbürger ernannt. 176
179
180 den ersten Nachkriegsmonaten tun konnten, war die möglichst gerechte Verwaltung und Verteilung des Mangels. Seit dem Bombenangriff vom 4. Dezember 1944 war die Stadt weitgehend zerstört. Die bis zum Schluß harten Kämpfe um Heilbronn hatten zu weiteren Verwüstungen geführt. Vor ihrem Rückzug hatten die deutschen Truppen in der Nacht zum 3. April 1945 noch alle Neckarbrücken gesprengt und somit auch die Verkehrsverbindungen von der Kernstadt nach Böckingen und Neckargartach abgeschnitten. Es funktionierte weder die Wasser- noch die Gas- und Stromversorgung, auch alle Telefonleitungen waren unterbrochen. Eine geregelte Verteilung von Lebensmitteln an die Bevölkerung fand nicht mehr statt, Plünderungen ließen sich noch geraume Zeit nicht verhindern. In der Kernstadt hielten sich im April 1945 lediglich ca Menschen auf, bis zum Jahresende erhöhte sich die Einwohnerzahl hier durch die Rückkehr vieler, die sich nach der Zerstörung in die umliegenden Ortschaften geflüchtet hatten, auf rund Einwohner (1939: ). Im ganzen Stadtkreis Heilbronn (also mit Böckingen, Neckargartach und Sontheim) zählte man Ende 1945 insgesamt Personen (1939: ohne, mit Wehrmachtsangehörigen). Von den Wohnungen, die es vor dem Krieg in der Stadt gegeben hatte, war etwa die Hälfte nicht mehr bewohnbar: Wohnungen waren total zerstört, 3261 weitere aufs schwerste beschädigt. Da die amerikanische Militärregierung zahlreiche der noch intakten Häuser für ihre Zwecke beschlagnahmt hatte, kamen viele Heilbronner nur in Provisorien wie z.b. Kellern sowie Garten- und Weinbergshäuschen am Stadtrand unter. Von Anfang an gehörten die Organisation und Planung der Trümmerräumung und des Wiederaufbaus zu den Hauptaufgaben der Stadtverwaltung. Als erste Maßnahme wurde von Oberbürgermeister Beutinger eine Bausperre verhängt. Dann begann das systematische Abtragen der Ruinen. Angesichts der ungeheuren Schuttmasse von 1,75 Millionen Kubikmetern mußte dafür ein effektives Verfahren gefunden werden. Der sogenannte Ehrendienst verpflichtete alle arbeitsfähigen männlichen Einwohner des Stadtkreises und bestimmter Landkreisgemeinden im Alter von 16 bis 55 Jahren dazu, zwölf Arbeitstage lang bei der Enttrümmerung zu helfen, ehemalige NSDAP-Mitglieder mußten 18 Arbeitstage ableisten. Vom 18. Februar 1946 bis zum 30. September waren insgesamt rund 9000 Helfer im Einsatz. Genutzt wurden die Stein- und Mörtelreste zum Aufschütten von Straßen und Plätzen, zur Auffüllung von Hohlwegen im Rahmen der ab durchgeführten Weinbergumlegungen und zur Neckarverschmälerung sowie in der Trümmerverwertungsanlage der Firma Paul Ensle, die daraus Bau- und Füllmaterialien, zum Beispiel Hohlblocksteine, produzierte. Für die Planung des Wiederaufbaus der Altstadt und die Entwicklung eines neuen Verkehrskonzeptes wurden die Stuttgarter Professoren Karl Ganser und Hans Volkart als Experten hinzugezogen. Im Jahr schrieb man einen diesbezüglichen Ideenwettbewerb aus, zu dem 28 Entwürfe eingingen. Am 5. März 1948 stimmte der Gemeinderat dem Aufbaurahmenplan zu, den das Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit einem Beirat, der aus den Wettbewerbsteilnehmern gebildet worden war, erarbeitet hatte. Berücksichtigt wurden auch Vorschläge von Ganser und Volkart. Um dieses Konzept realisieren zu können, waren Baulandumlegungen vonnöten, da für die vorgesehenen Straßenverbreiterungen zusätzliche öffentliche Flächen gebraucht wurden. Deshalb beschloß der Gemeinderat am 9. November 1948, von Blick in eine einräumige Kellerwohnung, wie es si1 in den ersten Nachkriegs jahren zahlreich in Heilbronn gab. Foto,
181 Einsatz des Ehrendienstes in der Roßkampffstraße. Foto, um 1946/4 7 jedem Grundstück in der Altstadt 15 Prozent für diesen Zweck zu enteignen, wobei die jeweiligen Besitzer der Stadt 10 Prozent unentgeltlich, 5 Prozent gegen Entschädigung überlassen mußten. Es ist erstaunlich, daß diese Maßnahme, die den bereits durch die Zerstörung geschädigten Ruinengrundstücksbesitzern neue Opfer auferlegte, nicht auf massiven Widerstand stieß. Von den 889 Beteiligten erhoben lediglich 37 Einspruch gegen die Baulandumlegung, während sich 81 nicht mit dem Rahmenplan einverstanden erklärten. Bei den unzähligen Grundstücksverhandlungen, die sich bis 1955 hinzogen, kam es zu 14 Anfechtungsklagen, von denen elf wieder zurückgenommen und drei abgewiesen wurden. Bis 1944 war die bebaute Fläche von 20, 7 Hektar in der Altstadt in 1100 Parzellen eingeteilt gewesen, die 889 Eigentümern gehörten. Durch die Baulandumlegung verringerten sich diese Zahlen deutlich auf 582 Parzellen und rund 500 Grundbesitzer. Das heißt, daß der Stadtkern sehr viel lockerer und großzügiger wieder aufgebaut wurde als das vor der Zerstörung der Fall gewesen war. Grundsätzlich hatte man sich dafür entschieden, daß nur wenige markante und historisch bedeutsame Gebäude wie z.b. das Rathaus, die Kilianskirche und der Deutschhof in ihrem alten Erscheinungsbild wiedererstehen sollten. Ansonsten wurden noch stehende Fassadenreste abgetragen und neue Hä.user gebaut, so daß bis heute die Heilbronner Innenstadt vom Stil der fünfziger Jahre geprägt wird. Dazu zwangen auch die durch die Baulandumlegung veränderten Baulinien und Grundstücksgrenzen, die erkennbar anders verliefen als früher. Einige Straßen und Gäßchen verschwanden durch diese Umstrukturierung völlig. In den großen Zügen jedoch blieb der althergebrachte Straßenverlauf in der Altstadt bestehen. Erst 1958 wurde der Vorkriegsstand an Wohnungen wieder erreicht. Da allerdings die Einwohnerzahl mit im Jahr 1958 deutlich über der von 1939 ( , ohne Wehrmacht) lag, reichten die nun vorhandenen Wohnungen trotzdem nicht aus. Da sich der Anstieg der Bevölkerungszahlen kontinuierlich fortsetzte, blieben das Bauen und die Bauförderung, allerdings zunehmend am Stadtrand und in eigens dazu ausgewiesenen Neubaugebieten, auch die sechziger Jahre hindurch ein wichtiger Faktor, wobei sich der Akzent langsam aber sicher vom reinen Wiederaufbau zum Neubau wegen wachsenden Bedarfs verschob. Das galt auch für öffentliche Gebäude wie Schulen oder Behörden. Ohne die äußerst günstige Entwicklung, welche die westdeutsche wie die Heilbronner Wirtschaft seit 1948 zu verzeichnen hatten, wäre diese Aufbauleistung allerdings nicht möglich gewesen. In Heilbronn gab es im Frühjahr 1945 keinen Industriebetrieb, der nicht durch Kriegseinwirkungen mehr oder weniger umfassende Schäden davongetragen hätte. Mit der Altstadt war außerdem eine große Anzahl von Läden und Geschäften zugrunde gegangen, ebenso von Handwerks- und Gewerbebetrieben. Das Fehlen geeigneter Räumlichkeiten, Energie-und Rohstoffknappheit sowie Arbeitskräftemangel machten die Wiederingangsetzung der Wirtschaft direkt nach Kriegsende äußerst schwierig. Erst mit der Währungsreform vom 20. Juni 1948 setzte bekanntlich ein ungeheurer wirtschaftlicher Aufschwung ein, der natürlich auch in Heilbronn wirksam wurde. So stieg hier beispielsweise die Zahl der in der Industrie beschäftigten Personen von rund im Sommer 1948 auf Ende Oktober Neben der Währungsreform war es vor allem das amerikanische»european Recovery Program (ERP)«- besser bekannt unter dem Namen Marshallplan -, das zu diesem grundlegenden Wandel in der wirtschaft- 179
182 Menscnenscntange vor der DM-Auszahlungsstelle an der Alleepost am Tag der Währungsreform, 20. Juni liehen Entwicklung Westdeutschlands beitrug. Der Stadt- und der Landkreis Heilbronn erhielten von 1948 bis 1950 insgesamt DM aus ERP-Mitteln. Davon entfielen unter anderen auf die Stadtsiedlung DM, die hiesige Wohnsiedlung der Diözese Rottenburg DM, die Kreissiedlung Heilbronn egmbh DM, auf den Wiederaufbau und Ausbau der Industrie, unter Mitberücksichtigung der städtischen Betriebe (Gaswerk, Straßenbahn), 5 Millionen DM, der gewerbetreibenden Betriebe DM und auf die Landwirtschaft DM. Die Hochkonjunktur mit Vollbeschäftigung und überdurchschnittlichen Wachstumsraten hielt bis in die frühen sechziger Jahre an standen in den rund 120 Heilbronner Industriebetrieben zusammen durchschnittlich Personen in Arbeit und Brot wurde mit Beschäftigten in 145 Fabriken ein Höchststand erreicht, der bis 196 7, als die erste Rezession in der Bundesrepublik zu verzeichnen war, absteigende Tendenz aufwies: in 142 Fertigungsstätten fanden Menschen ihr Auskommen..Der prozentuale Anteil der einzelnen Branchen an den Beschäftigtenzahlen hatte sich zwischen 1951 und 1963 erkennbar verschoben, was auf Strukturveränderungen innerhalb der Heilbronner Wirtschaft hinweist: Er sank bei der chemischen Industrie und der Herstellung von Kohlenwertstoffen von 9,3 auf 5,5 Prozent, der Nahrungsmittelbranche von 14,3 auf 12,9 Prozent, den Textilbetrieben von 8, 7 auf 6,8 Prozent und bei verschiedenen sonstigen Fabrikationsbereichen von 3 7 auf 19 Prozent. Dagegen erhöhte er sich im Maschinen- und Fahrzeugbau von 18,1 auf 31, 5 Prozent, im Stahl- und Leichtmetallbau von 2,8 auf 4, 7 Prozent und im Bereich Papier und Druck von 9, 7 auf 10, 9 Prozent. In der Elektrotechnik, die erstmals 1956 mit 1,3 Prozent in Heilbronn zu Buche schlug, waren 1963 schon 8, 7 Prozent aller Arbeitnehmer untergekommen, und sie legte, im Gegensatz zu allen anderen Bereichen, die entweder stagnierten oder leicht zurückgingen, bis 1967 noch weiter zu und erreichte 10,3 Prozent. Auch im Handwerk lassen sich in diesem Zeitraum Strukturveränderungen beobachten. Von 1949 bis 1968 ging die Zahl der Betriebe im Stadtkreis Heilbronn von 1593 auf 1239 zurück, während sich die Beschäftigtenzahl von 7750 auf deutlich erhöhte. Das heißt, die durchschnittliche Größe verdoppelte sich von 4,9 auf 9,9 Personen pro Werkstatt. In diesen knapp 20 Jahren verringerte sich allerdings der prozentuale Anteil an Arbeitnehmern im holz- und lederverarbeitenden sowie im Bekleidungs- und Textil-Handwerk jeweils etwa um die Hälfte. Dieser Rückgang ist sicher der Tatsache zuzuschreiben, daß sich die Herstellung von Möbeln, Stoffen, Kleidern 180
183 Plakat zur Oberbürgermeisterwahl am 9. Mai Der Amtsinhaber Paul Meyle (FDP) wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt. Sein Gegenkandidat Walter Vielhauer (KPD) war von Anfang an chancenlos, wie es der Text des Plakates schon andeutet. Samstäglicher Autostau in der Innenstadt. Blick vom Kiliansplatz in die Fleiner Straße. Foto, um 1965 und Schuhen zunehmend vom handwerklichen auf den industriellen Sektor verlagerte. Dagegen fanden im Bau- und Ausbaugewerbe immer mehr Leute Arbeitsplätze, was angesichts der Bedeutung des Bauens in diesen Jahrzehnten nicht verwundert. Noch weitaus größer war - analog zur Entwicklung bei den Heilbronner Industriebetrieben - der Anstieg bei den Beschäftigten in der Metallverarbeitung, nämlich von 1147 auf Personen. Man kann wohl davon ausgehen, daß hier Zulieferungsarbeiten für die Industrie zu Buche schlugen. Ebenfalls steigend war die Tendenz in Handwerken, die mit Nahrungsmitteln, Gesundheits- und Körperpflege, mit Reinigung sowie mit Glas, Papier und Keramik zu tun hatten. In diesen Bereichen verdoppelte oder verdreifachte sich der Mitarbeiterstamm. Diese Expansion hatte sicher mit dem steigenden Lebensstandard und der dadurch verursachten größeren Nachfrage nach Artikeln zu tun, die vorher als Luxus galten. In den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten läßt sich auch in Heilbronn an vielen Beispielen zeigen, daß der allgemeine Wohlstand wuchs: In dieser Zeit erhöhte sich der Gas-, Wasser- und Stromverbrauch ständig. Das hing natürlich eng damit zusammen, daß die zahlreichen Wiederauf- und Neubauten von vornherein mit weitaus moderneren Installationen versehen wurden, als das in der Vorkriegszeit üblich gewesen war. Je länger der Krieg zurücklag, um so höher wurde der diesbezügliche Standard in Küche und Bad: Toiletten mit Wasserspülung waren nun keine Seltenheit mehr, sondern gehörten zur selbstverständlichen Grundausstattung einer Neubauwohnung ebenso wie eine Badewanne und eine Waschmaschine. Ein weiteres Indiz für diese Entwicklung ist die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge in Heilbronn: Sie stieg vom Dezember 1946 von 1506 (512 Personenwagen, einschließlich Omnibusse, 475 Kräfträder und 519 Lastwagen) auf (484 Krafträder, PKWs, 2359 LKWs und 759 sonstige Kraftfahrzeuge) am Ende des Jahres kamen auf ein Kraftfahrzeug 35 Einwohner, 1967 nur noch 3, 7,.was eine immense Verdichtung des Fahrzeugaufkommens in der Stadt bedeutete.»wiederaufbau«ist ein Begriff, der zunächst vermuten läßt, daß es sich dabei um einen rückwärts gewandten Vorgang
184 Von alten und neuen Heilbronnern Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden keine Statistiken geführt, aus denen die Zusammensetzung der Heilbronner Bevölkerung abzulesen wäre. Neben den hier Geborenen gab es natürlich immer einen gewissen Prozentsatz Zugezogener. Doch war damit jahrhundertelang keine so grundlegende Veränderung in der Einwohnerstruktur der Stadt verbunden wie seit 1945: Durch Verfolgung und Krieg hatten mehr als Heilbronner Bürger das Leben verloren. Ab 1950 kamen verstärkt Heimatvertriebene und DDR-Übersiedler als Neubürger hierher. Bis 1960 pendelte sich deren Anteil an der hiesigen Gesamtbevölkerung auf knapp 1 7 bzw. 8 Prozent ein, während der Ausländeranteil in der Stadt bis 1959 unter 1 Prozent lag. Das änderte sich, als in der Bundesrepublik die Vollbeschäftigung erreicht wurde. Wegen des weiteren Bedarfs an Arbeitskräften wurden Italiener, Griechen, Spanier, Jugoslawen, Portugiesen und Türken für deutsche Betriebe und Fabriken angeworben. Anfangs wurde nicht an einen dauerhaften Aufenthalt gedacht. Da jedoch die bundesdeutsche Wirtschaft langfristig auf ausländische Mitarbeiter angewiesen war, kamen kontinuierlich weitere hinzu, so daß ihr Anteil an der Heilbronner Bevölkerung bis 1970 auf 9,2 Prozent anstieg. In dieser Statistik nie mitberücksichtigt wurden die hier von 1951 bis 1992 stationierten amerikanischen Soldaten, deren Anwesenheit ebenso mit dazu beigetragen hat, daß auch in Heilbronn der Weg in die multikulturelle Gesellschaft" begann hatten 19, 9 Prozent der Einwohner einen ausländischen Paß. handelt: etwas Altes, das zerstört wurde, wird hergestellt. Und tatsächlich hatten vor allem die frühen fünfziger Jahre ganz deutlich den Charakter einer Restaurationszeit, in der man sich auf die»guten Kontinuitäten«aus den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen besann, die für die meisten damals lebenden Menschen den Maßstab für die»normalität«darstellten, die es wiederzugewinnen galt. Da aber die weltpolitischen und -wirtschaftlichen Rahmenbedingungen völlig andere waren als in der Zwischenkriegszeit und auch die technische Entwicklung einen enormen Fortschritt erlebt hatte, wurde zugleich ein ungeheurer Modernisierungsschub in Gang gesetzt, der schließlich in allem zu grundlegenden Veränderungen führen sollte und dessen Ende bis heute nicht abzusehen ist. 182
185 Die überschaubare Großstadt Heilbronn seit Mai 1967: Nach der Wiederaufbau-Phase, während der man in Heilbronn wesentlich mit sich selbst beschäftigt war, galt es für die Stadt, sich bei der bevorstehenden Verwaltungs- und Gemeindereform zu behaupten und den Platz als politische und wirtschaftliche Metropole des württembergischen Unterlandes zu sichern und zu festigen. Bevor in und um Heilbronn hektische Eingemeindungs-Diskussionen einsetzten, wurde nach neunzehn Jahren der mit Spannung erwartete Machtwechsel vollzogen und der Nachfolger von Oberbürgermeister Paul Meyle gewählt. Mit Unterstützung der SPD gewann der 5 ljährige Dr. Hans Hoffmann, vormals dreizehn Jahre Bürgermeister in der Nachbarstadt Neckarsulm, am 21. Mai die nach einem Rechtsstreit zu wiederholende Oberbürgermeister-Wahl gegen Dr. Karl Nägele (CDU), den langjährigen Ersten Bürgermeister der Stadt. Wegen Anfechtung Wiederholung der Oberbürgermeister-Wahl vom Vorjahr, aus der Dr. Hans Hoffmann als Sieger hervorgeht : Eingemeindung von Klingenberg, Kirchhausen, Biberach, Frankenbach und Horkheim. Heilbronn wird Großstadt. 8. Juni 1975: Wiederwahl von Oberbürgermeister Dr. Hoffmann. 16. November 1982: Eröffnung des neuen Stadttheaters. 11. September 1983: Wahl von Dr. Manfred Weinmann zum Oberbürgermeister. 11. Januar 1985: Pershing-Unglück auf der Waldheide. Sommer 1985: Landesgartenschau im Wertwiesenpark am Neckar. 15. September 1991: Wiederwahl von Oberbürgermeister Dr. Weinmann. 1992: Abzug der seit 1951 hier stationierten Einheiten der US-Army. Gestärkt mit einem 57prozentigen Stimmenanteil im ersten Wahlgang, packte der tatkräftige Diplomvolkswirt Dr. Hoffmann nach der feierlichen Amtseinsetzung am 7. September seine Aufgabe auch recht forsch an. Durch die rasch überbauten Wohngebiete Sachsenäcker (Neckargartach) und Schanz (Böckingen) schnellte bis Ende der sechziger Jahre die Heilbronner Einwohnerzahl nach oben. Deshalb beschloß der Gemeinderat, in dem ab 1968 die SPD mit 17 von 36 Sitzen dominierte, einvernehmlich ein großes Schul- und Sporthallen-Bauprogramm in diesen beiden Stadtteilen sowie im Osten Sontheims. Daß die kleine Gemeinde Klingenberg per Landtags-Sondergesetz zum 1. Januar 1970 in den Stadtkreis eingegliedert wurde, fand ebenfalls die einhellige Zustimmung der Gemeinderäte. Die Klingenberger machten Heilbronn statistisch zur Großstadt, da durch sie die Bevölkerung von auf Personen anwuchs. Dies war bereits die Ouvertüre zur Kommunalreform, die nach dem Willen des baden-württembergischen Landtags bis zum Jahre 1975 abgeschlossen sein sollte. Die Zielplanung des Landes sah zunächst vor, dem Stadtkreis neun Umlandgemeinden einzugliedern. Schließlich schlossen sich Heilbronn nach Klingenberg freiwillig noch die Gemeinden Kirchhausen (1972), Biberach, Frankenbach und Horkheim (197 4) an. Der Stadtkreis umfaßte nun Hektar Markungsfläche und zählte am 31. Dezember Einwohner. Im Zuge der gesamten baden-württembergischen Verwaltungsreform behielt Heilbronn den 1938 verliehenen Status eines selbständigen Stadtkreises und erhielt zum 1. Januar 1973 das Prädikat Oberzentrum. Damit verbunden war, daß hier der Sitz des Regional- 183
186 verbandes Franken eingerichtet wurde, dem neben dem Stadtkreis Heilbronn die Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Main-Tauber angehören. Sowohl die Industrie- und Handelskammer wie auch die Handwerkskammer paßten ihren Einzugsbereich den Regionsgrenzen an. Die Zentralen beider Wirtschaftskammern blieben in der neuen Regionshauptstadt. So ging Heilbronn aus den bewegten Reformjahren wesentlich gestärkt hervor. Nach den fünf Eingemeindungen löste die Stadt bald ihre Investitionszusagen, die in Vereinbarungen genauest festgelegt worden waren, ein. Beispiele hierzu sind der Ausbau der Ortsdurchfahrt für Klingenberg, der Bau der Deutschordenshalle in Kirchhausen (197 4), der Stauwehrhalle in Horkheim (1975), des Hallenbades in Biberach (1976) und der Leintalsporthalle in Frankenbach (1978). Die Jahreszahlen belegen, wie schnell die Heilbronner Planungs- und Bauämter für die neu eingeliederten Ortschaften arbeiteten: Bis 1978 waren bereits fünfzig Millionen Mark investiert. Erstaunt beobachtete man damals in den»alten«stadtteilen Böckingen, Nekkargartach und Sontheim das städtische Engagement bei den»neuen«. Doch auch dort wurden nun markante Zeichen für einen Aufbruch gesetzt. In Alt-Böckingen war es das 1975 fertiggestellte Bürgerhaus, und in Sontheim und Neckargartach hieß das Zauberwort Stadtsanierung. Die siebziger Jahre waren im gesamten Heilbronn geprägt von einem ungeheueren Bauboom. In der Amtszeit von Oberbürgermeister Dr. Hoffmann reihte sich bis 1983 Richtfest an Richtfest, Einweihung an Einweihung: Es entstanden städtische Schulbauten für 162, sechzehn Turn- und Sporthallen sowie siebzehn Sportanlagen für 77 Millionen Mark. In jenen Jahren war freilich auch ein positiver Wandel in der Kernstadt zu verzeichnen: 1969 wurde das neue Horten-Warenhaus an die Stelle des alten Merkur-Kaufhauses in der Fleiner Straße gesetzt; 1971 wurden das siebzehngeschossige Allee-Shoppinghaus, die Harmonie-Tiefgarage und die Allee-Unterführungen Moltkestraße und Hafenmarkt, denen 1980 unter der Allee die Postpassage folgte, fertiggestellt, das achtgeschossige Landratsamt an der Klarastraße gebaut und die Fleiner-, Kirchbrunnen- und Sülmerstraße in Fußgängerzonen umgewandelt folgte dann die Einweihung des Hallenbades am Ballwerksturm wurde mit der Instandsetzung des südlichen Chorturms der Wiederaufbau der Kilianskirche vollendet. Und mit der Eröffnung des Wollhauszentrums - Kaufhof, 30 Einzelhändler, Büroturm und Tiefgarage - wurde im Herbst 1975 der stärkste neue Akzent Blick über die Altstadt vom Frankenstadion (vorne} zum Wartberg (hinten}. Luftbild,
187 1971 wurde die Fleiner Straße in eine Fußgängerzone umgewandelt. Blick in Richtung Kilianskirche. jener Jahre in der Innenstadt gesetzt. Der Archivneubau war 1977 der dritte Deutschhof-Abschnitt, den die Stadt fertigstellte. Als das Landratsamt 1978 in den Neubau des Landkreises an der Lerchenstraße umgezogen war, erweiterte die Kreissparkasse Heilbronn ihre Zentrale am Wollhaus entscheidend. Zitieren wir Oberbürgermeister Dr. Hans Hoffmann zur Halbzeit seiner beiden Amtsperioden (er wurde 1975 wiedergewählt):»nur eine Stadt, die rege ist, die sich müht und sich auf zeitgemäße Entwicklungen einstellt, hat heute wie einst echte Lebenschancen. Das soll nicht heißen, daß wir bedingungslos dem Neuen nachjagen. Heilbronn muß Heilbronn bleiben, unverwechselbar in seinem Aussehen und seiner Ausstrahlung, geprägt von Kiliansturm und Rathaus, Deutschhof und Käthchenhaus; aber es darf auch nicht in einem Dornröschenschlaf nur der Vergangenheit nachträumen." Davon konnte natürlich keine Rede sein. In den siebziger Jahren entwickelte sich Heilbronn zu einer attraktiven Einkaufsstadt, deren Umsatz innerhalb von anderthalb Jahrzehnten verdreifacht wurde, und wandelte sich von einer Industriezusehends zu einer Handelsstadt, in der auch der Großhandel allmählich eine immer stärkere Rolle spielte. Ausschlaggebend waren hierfür nicht nur die verbesserte innerstädtische Infrastruktur, sondern gleichfalls die überörtliche Verkehrsanbindung durch drei neue Autobahnen. Im Zeitraum von 1968 bis 1983 gab die Stadt für Hoch- und Tiefbauten, für Sport- und Grünflächen ziemlich genau eine Milliarde Mark aus. Gleichzeitig wurden Bebauungspläne für 700 Hektar Fläche genehmigt, Baugesuche bearbeitet, Wohnungen und nahezu gewerbliche Objekte erstellt. Hochgerechnet flossen etwa vier Milliarden Mark in Heilbronner Bauten. Nach dem unvergleichlichen Wiederaufbauwunder unter der Regie von Oberbürgermeister Paul Meyle folgte also die fruchtbare Das 1982 fertiggestellte Stadttheater am Berliner Platz. Blick von der Allee. 185
188 Bauepoche in der Ära des Oberbürgermeisters Dr. Hans Hoffmann. Trotzdem blieb Heilbronn mit seiner optisch aufgewerteten City eine kleine, überschaubare Großstadt, die ihre Erweiterungschancen nach den Eingemeindungen optimal nutzte. Unter den bundesdeutschen Großstädten war sie 1983 diejenige mit der geringsten Verschuldung und den niedrigsten Steuerhebesätzen. Hohe Gewerbesteuer-Einnahmen, einträgliche Beteiligungen beim Zementwerk Lauffen - Elektrizitätswerk Heilbronn AG und bei der Südwestdeutschen Salzwerke AG waren wichtige Gründe für das gute finanzielle Polster der Stadt. Oberbürgermeister Dr. Hoffmann krönte seine Amtszeit schließlich im November 1982 mit der Einweihung eines symbolträchtigen Projektes, um das die Heilbronner Kommunalpolitiker jahrzehntelang gestritten hatten: Auf dem Berliner Platz eröffnete das Stadttheater in seinem neuen Gebäude die erste Spielzeit mit dem Musical»My fair Lady«. Die Ruine des 1944 zerstörten alten Theaters war 1970 gesprengt worden. Nun gab es also ein»großes Haus«für 705 Zuschauer sowie kleinere Kammerspiele, ausgerüstet mit modernster Technik, deren Bau und Einrichtung zusammen 67 Millionen Mark verschlungen hatten, zu denen das Land Baden-Württemberg 23 Millionen beisteuerte. Als das Stadttheater nach seiner ersten, verkürzten Saison im Sommer 1983 einen unerwartet hohen Besucherandrang registrierte, strebte gerade der Oberbürgermeister-Wahlkampf dem Höhepunkt entgegen. Am 11. September setzte sich der 49jährige Erste Bürgermeister der Stadt Heilbronn, Dr. Manfred Weinmann, mit knapp 52 Prozent der gültigen Stimmen gegen den Neckarsulmer Oberbürgermeister Dr. Erhard Klotz (46,5 Prozent) durch. Das politische Gesicht Heilbronns, das 1967 beim Amtsantritt von Oberbürgermeister Dr. Hoffmann noch eindeutig von der SPD geprägt wurde, da die Sozialdemokraten auch die Abgeordneten in Stuttgart und Bonn stellten, wandelte sich mit diesem Wahlergebnis endgültig und verschob sich zugunsten der CDU. Im Gemeinderat, in dem die CDU Fraktion mit 18 von 40 Mandaten inzwischen die größte war, führte nun der CDU-Oberbürgermeister Dr. Weinmann den Vorsitz; CDU-Stadtrat Ulrich Stechele war zugleich der direkt gewählte Heilbronner Landtagsabgeordnete, und Christdemokrat Egon Susset vertrat mit Direktmandat den Wahlkreis Heilbronn im Bundestag. Dr. Hans Hoffmann, dem gebürtigen Spreewälder und betont wirtschaftlich agierenden Stadtmanager, folgte der ortsverbundene gebürtige Neckargartacher Dr. Manfred Weinmann, Diplomvolkswirt und Doktor der Politikwissenschaften, auf dem Oberbürgermeister Sessel. Eine Bilderbuchkarriere, die über das Stadtratsmandat samt Fraktionsvorsitz und Bürgermeisterstelle geführt hatte, brachte ihn an die Spitze der Stadt. Aber schon bald wehte dem neuen Oberbürgermeister politischer Gegenwind ins Gesicht. Der Heilbronner Raketenstandort Waldheide rückte immer stärker in den tagespolitischen Mittelpunkt. Anfang 1985 verunglückten dort drei amerikanische Soldaten durch den Brand der ersten Motorstufe einer Pershing-II-Rakete tödlich. Im Zeichen leidenschaftlich geführter Debatten um die sogenannte Nachrüstung fand dieses tragische Ereignis ein weltweites Medienecho. Bei einer denkwürdigen Sitzung mit Unterländer Kommunalvertretern informierte sich im April 1985 Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner zusammen mit Militärs im Heilbronner Rathaus ausführlich über die Unfallursache. Die Proteste gegen die Raketenstationierung erreichten in Form von Großkundgebungen und Märschen zur Waldheide Am 3. November 1983 übergab der seit 1967 amtierende Oberbürgermeister Dr. Hans Hoffmann die Amtsgeschäfte und als deren Symbol die Amtskette seinem Nachfolger Dr. Manfred Weinmann. 186
189 1986 ihren Höhepunkt. Bei den Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und der UdSSR in Genf wurde dann über den Abzug der Raketen entschieden. Von 1988 bis 1990 wurden alle vierzig Pershing-Raketen aus Heilbronn entfernt und vernichtet. Auch in den achtziger Jahren hatte der Bausektor in Heilbronn Konjunktur. Rund ums Rosenberg-Hochhaus entstanden neben Wohngebäuden das Arbeitsamt und das Fernmeldeamt. Die Industrie- und Handelskammer etablierte sich an der Rosenbergstraße weihte man die erweiterte Fachhochschule am Rande des großen Wohngebietes Sontheim-Ost ein. Block sieben des EVS Kohlekraftwerkes mit den 250 m hohen Kaminen und dem 140 m hohen Kühlturm wuchs bis 1986 zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt empor folgte die Einweihung des Frankenstadions, 1989 die der Hauptfeuerwache. Mit dem City-Center Süd, dem jetzigen Multi Media-Markt (damals: Flachsmann) am Europaplatz, den Möbelhäusern an der Saarlandstraße in Böckingen und dem innerstädtischen Käthchenhof wurden weitere Einzelhandelsflächen geschaffen. Trotzdem mußte man 1989 feststellen, daß der Umsatz in diesem Bereich nur noch zu 42 Prozent von auswärtigen Käufern bestritten wurde, zehn Jahre zuvor waren es immerhin 50 Prozent gewesen. Herausragendes Heilbronner Ereignis war in diesem Jahrzehnt zweifellos die Landesgartenschau 1985, für die am Neckar der Wertwiesenpark geschaffen wurde. Eine Million Besucher erlebten die Gründemonstration mit 1500 Veranstaltungen, dazu eine vielbeachtete Skulpturenallee entlang des Neckarufers fiel der Startschuß für das Gesamtklinikum Gesundbrunnen, in das 1989 die Chirurgie einzog. Im September 1996 wechselten die letzten Abteilungen vom Haus an der Jägerhausstraße ins neue Städtische Krankenhaus, das mit 290 Millionen Mark Kosten das teuerste Hochbauprojekt der Stadt Heilbronn wurde. Die städtische Finanzlage war bis zum Beginn der neunziger Jahre relativ gut. Einer hohen Zuführungsrate stand eine geringe Verschuldung gegenüber. Dann jedoch, vor allem in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, verschlechterte sich die Situation dramatisch, obgleich die Steuereinnahmen - insbesondere die Gewerbesteuer - stabil blieben. Aber ein nicht zuletzt durch Zuwanderungen und Arbeitslosigkeit explodierender Sozialetat, hohe zusätzliche Kosten durch neue gesetzlich vorgeschriebene Leistungen sowie ein starker Rückgang der Finanzzuweisungen z.b. im Zusammenhang mit den Kosten für die deutsche Einheit schwächten die Finanzkraft der Stadt im Vergleich mit den Vorjahren erheblich. Mit den neuen Städtischen Museen wurde 1991 das Kulturzentrum im Deutschhof-Areal vollendet. Daneben wurden ebenfalls 1991 die Deutschhof- Blick auf das zwischen 1983 und 1996 gebaute Gesamtklinikum Gesundbrunnen, der Nachfolgeeinrichtung des Städtischen Krankenhauses an der Jägerhausstraße. Luftbild,
190 Tiefgarage und 1993 das Technische Rathaus fertiggestellt. Hohe Beträge mußte die Stadt für den Ausbau der Kläranlage und für die Müllentsorgung bereitstellen. Nach zwanzigjähriger Bauzeit konnte zu Beginn des Jahrzehnts die gesamte Neckartalstraße zwischen Obereisesheim und Talheim befahren werden; sie ist der wichtigste neue Straßenstrang im Heilbronner Stadtgebiet. Gleich zu Beginn der zweiten Amtszeit von Oberbürgermeister Dr. Manfred Weinmann - zur Wahl im September 1991 hatten sich 21 Bewerber gestellt - stand die Stadt Heilbronn plötzlich vor einer ganz neuen Situation. Sämtliche von der US-Armee genutzten Flächen im Stadtgebiet wurden frei. Als die Heilbronner US-Militärgemeinde nach über vier Jahrzehnten Ende 1992 aufgelöst und gleich 1100 Wohnungen leer wurden, konnte die Stadt vom Bund 300 Hektar Flächen kaufen - eine große städtebauliche Chance. Die Stadtsiedlung übernahm die Wohnhäuser der Amerikaner im Heilbronner Süden, wo das Gelände der Wharton-Barracks künftig auch gewerblich, von Behörden und Institutionen genutzt werden soll. Das Areal der Badenerhof-Kaserne im Osten der Stadt wurde zum Wohngebiet um-, die Waldheide zum Naturpark zurückgewandelt. Auch den Pfühlpark richteten die Landschaftsgärtner. Und in Böckingen entstand auf dem Areal der früheren Ziegelei ein großer Park mit einem neuen Böckinger See. Die Böckinger Ziegelei zählt zu einer langen Reihe Heilbronner Traditionsfirmen, die während der letzten Jahrzehnte ihren Betrieb einstellten. Dazu gehören auch die Fabriken Bruckmann und Flamm er, deren Aufgabe ebenso wie die Aussiedlung der Zuckerfabrik zugleich das Ende der Industrieproduktion in der Innenstadt symbolisiert. Dagegen haben im Neckargartacher Gewerbegebiet Böllinger Höfe innerhalb zweier Jahrzehnte sechzig Betriebe ihren neuen Standort gefunden. Jetzt beginnt die Stadt, das hundert Jahre alte klassische Industrieareal im Norden zu sanieren und neu zu ordnen. Und wenn sich irgendwann auf dem Gelände der früheren Kali-Chemie, die ihr Werk 1993 aufgelöst hat, wie geplant Logistikfirmen etablieren werden, Vierzehn Bürgermeister Während den vier Amtsperioden der Oberbürgermeister Dr. Hans Hoffmann und Dr. Manfred Weinmann gehörten vierzehn Bürgermeister der Verwaltungsspitze an: Dr. Karl Nägele (Erster Bürgermeister, Ordnung, Bau, ); Erwin Fuchs (Kultur, Soziales, ); Adolf Gebhardt (Finanzen, Wirtschaft, ); Hermann Bosch (Finanzen, Wirtschaft, ); Herbert Haldy (Bau, ); Dr. Manfred Weinmann (Erster Bürgermeister, Ordnung, Krankenhaus, ); Peter Giebler (Finanzen, Wirtschaft, , ab 1983 Erster Bürgermeister); Paul Pfister (Kultur, Soziales, ); Ulrich Bauer (Bau, ); Harald Friese (Ordnung, Krankenhaus, ab 1984, Kultur, Soziales ab 1997); Reiner Casse (Kultur, Soziales, ); Ulrich Frey (Bau, ab 1990); Werner Grau (Erster Bürgermeister, Finanzen, Wirtschaft, ab 1992); Artur Kübler (Ordnung, Krankenhaus, ab 1997). wird die Tendenz der Wirtschaftsmetropole Heilbronn hin zum Schwerpunkt Dienstleistung noch weiter zunehmen. Schon heute sind hier 60 Prozent der Beschäftigten im sogenannten tertiären Sektor tätig. Unter der Regie von Oberbürgermeister Dr. Weinmann entwickelte sich die Stadt seit 1983 kontinuierlich weiter - wenn auch aufrund enger gewordener Finanzen einige Wunschprojekte noch nicht verwirklicht werden konnten. Doch gegen Ende des Jahrhunderts kommt von außen mehr Lob, als es manche kritische und nörgelnde Einwohner wahrhaben wollen. Jüngst setzten zwei deutsche Magazine Heilbronn beim Städtevergleich in der Finanzreihenfolge auf Platz sechs, nach der Lebensqualität unter 543 Städten auf Platz 39. Alle acht Außenstadtteile verfügen inzwischen über eine gleichmäßig gute Ausstattung; in Sontheim wurde im Neubaugebiet Ost mit dem Jörg-Rathgeb Platz ein neues Zentrum geschaffen. Nun konzentriert sich das städtische Engagement wieder gezielter auf Verbesserungen in der Innenstadt und ihren Fußgängerzonen, vor allem auch auf den Ausbau der Festhalle Harmonie zu einem Kongreßzentrum. Der bis Herbst 1999 amtierende Oberbürgermeister Dr. Manfred Weinmann sagt dazu:»wir wollen ein wirklich integriertes, unverwechselbares und attraktives Stadtzentrum gewinnen, in dem sich Bürger und Geschäftsleute gleichermaßen wohlfühlen." 188
191 Blick auf den Wertwiesenpark, das Gelände der Landesgartenschau in Heilbronn. Luftbild,
192 Blick auf die Heilbronner Innenstadt. Luftbild, 1997
193
194 Astronomische Rathausuhr von Isaak Habrecht. Foto von
195 »Nicht weit von der Stadt liegt das freundliche Dorf«Die Heilbronner Stadtteile vor ihrer Eingemeindung 766/767: Die Stadt Heilbronn besteht heute nicht mehr nur aus dem alten reichsstädtischen Kern, der im 19. Jahrhundert eine Erweiterung erfahren hat, sondern außerdem aus acht Stadtteilen, die zwischen 1933 und 1974 eingemeindet wurden. Beim Blick auf die Geschichte dieser ehe- Böckingen, Biberach und Frankenbach werden erstmals schriftlich erwähnt. 767: Früheste urkundliche Nennung von Neckargartach. 10. Jahrhundert: Der Name Kirchhausen erscheint zum ersten Mal in einer Quelle. 976: Horkheim tritt ins Licht schriftlicher Überlieferung. 1188: In ein und derselben Urkunde werden sowohl Flein wie Sontheim erstmals erwähnt. 1293: Frühester schriftlicher Hinweis auf Klingenberg. 1341: Heilbronn bekommt Neckargartach als Lehen. 1342/1431: Böckingen wird ein Heilbronner Dorf. 1385: Flein gelangt unter Heilbronner Herrschaft. 1438: Heilbronn rundet mit Frankenbach sein Territorium ab. 1504: Horkheim wird württembergisch. 1802/03: Böckingen, Flein, Frankenbach und Neckargartach werden selbständige württembergische Gemeinden. 1805/06: Biberach, Kirchhausen, Klingenberg und Sontheim kommen unter württembergische Herrschaft. 1919: Böckingen wird zur Stadt erhoben. mals selbständigen Ortschaften wird ein kleiner Ausschnitt des legendären territorialen»fleckenteppichs«sichtbar, wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wegen seiner Vielfalt an großen bis winzigen Herrschaftsgebieten, die zumeist auch noch sehr zersplittert waren, im Rückblick gerne bezeichnet wird. Bökkingen, Neckargartach, Sontheim, Klingenberg, Kirchhausen, Biberach, Frankenbach und Horkheim gehörten im Verlauf ihrer schriftlich überlieferten Geschichte vielen unterschiedlichen Herrschaften an und haben wechselvolle, teilweise von Heilbronn völlig unabhängige Entwicklungen hinter sich, auf die im folgenden für jed n Stadtteil gesondert in einem kurzen Uberblick eingegangen werden soll. Dorf - Stadt - Stadtteil: Böckingen Die erste schriftliche Erwähnung von Böckingen findet sich in dem bekannten Lorscher Kodex. Die Datierung der verschiedenen darin gesammelten Rechtsansprüche des Klosters Lorsch an der Bergstraße wurde - wie im Mittelalter üblich - nach den Regierungsjahren der jeweiligen Herrscher vorgenommen. In der Gründungsphase dieses Klosters war das König Pippin, der im September 768 gestorben ist. Ob dieser aber seine Regierung 751 oder 752 angetreten hat, ist in der Forschung umstritten und somit sind es auch die Datierungen der zu seinen Lebzeiten ausgestellten Urkunden. Der Ortsname»Beckingen«erscheint erstmals am 25. Juli im 15. Regierungsjahr Pippins in den Quellen, und das kann also entweder 766 oder 767 gewesen sein. Die Böckinger Markung war aber auf jeden Fall schon seit der jüngeren 193
196 Steinzeit Siedlungsland, wie Bodenfunde aus verschiedenen historischen Epochen bezeugen. Die Römer bauten hier 90 n. Chr. ein Kastell. Der Ortsname ist alemannischen Ursprungs. Wer im frühen Mittelalter neben dem Kloster Lorsch in Böckingen noch über Besitz und Rechte verfügen konnte, ist nicht überliefert. Die ab dem 13. Jahrhundert nachzuweisenden adeligen Herren von Böckingen hatten jedenfalls Vogteirechte von den Grafen von Württemberg (3/4) und den Grafen von Eberstein (1/4) als Lehen erhalten sowie Anteile am Kirchenpatronat von den Grafen von Zweibrücken und 1431 gelangte die Reichsstadt Heilbronn an die württembergischen bzw. ebersteinischen Vogteirechte und wurde so zum Ortsherrn in Böckingen erwarb sie auch noch das Kirchenpatronatsrecht in dem 1530 mit ihr zusammen evangelisch gewordenen Dorf. Bis zum Ende der Reichsstadt 1802/03 blieben die Böckinger Heilbronner Untertanen, dann wurden sie Bürger einer selbständigen württembergischen Gemeinde, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts»nächst der Oberamtsstadt unter den Orten des Bezirks die stärkste Veränderung. und die größte Ausdehnung«erlebte. Die Bevölkerung wuchs von 1820 bis 1900 von auf Personen an, bei der Eingemeindung 1933 lebten in dem 1919 zur Stadt erhobenen Ort Einwohner. Die meisten Berufstätigen unter ihnen arbeiteten in den großen Fabriken von Heilbronn, Neckarsulm, Neckargartach und Sontheim, während sich in Bökkingen selbst neben den traditionell vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben nur wenige gewerbliche oder industrielle Firmen ansiedelten. Die drei größten waren die Dampfziegelei Böckingen, die Schuchmannsche Brauerei AG und die Zigarrenfabrik Gebrüder Sorg. Diese Entwicklung wurde auf die Dauer zu einer schweren Belastung für die Gemeinde. Denn die stetig wachsenden Bevölkerungszahlen verlangten nach einer ständigen Ausweitung der Infrastruktur (Schulen, Straßen usw.), die mit den geringen Steuereinnahmen nicht zu finanzieren war. Deshalb wurde schon um die Jahrhundertwende der Wunsch laut, wieder der Stadt Heilbronn angegliedert zu werden, was aber erst 1933 in Form einer Zwangseingemeindung realisiert wurde. Der damit älteste Heilbronner Stadtteil außerhalb der Kernstadt ist heute (31. Juli 1997) mit Einwohnern mit Abstand der größte der acht ehemals eigenständigen Ortschaften. Am Zusammenfluß zweier Gewässer: Neckargartach Neckargartach verdankt seinen Namen der Mündung des im Mittelalter Gartach genannten Leinbaches in den Neckar. Doch erst ab 1161 erscheint der Ort als»neccargardacha«in den Quellen, vorher wurde er nur»gardach«genannt, was leicht zu Verwechslungen mit den ähnlich lautenden Ortschaften Großund Kleingartach am selben Wasserlauf führen konnte. Im Lorscher Kodex finden sich 29 Einträge, die einen Ort namens Gartach betreffen. Nach dem heutigen Erkenntnisstand sind jedoch nur fünf davon auf den Heilbronner Stadtteil zu beziehen, der im 8. Jahrhundert eine kleine Ausbausiedlung der damals weitaus wichtigeren Ortschaft Böllingen (heute: Alt-Böllinger Hof) gewesen ist. Der erste dieser Einträge stammt vom 11. November 767. Vermutlich im 11. Jahrhundert kam Neckargartach in die Oberlehensherrschaft des Hochstifts Worms, das seine Rechte 1323 an die Herren von Weinsberg abtrat gaben die Böckingen von Osten aus gesehen. Rechts fällt besonders die Kirche ins Auge, links vorne der Böckinger See. Ansicht aus dem Forstlagerbuch von Kieser, 1684 Eng um die Kirche gruppiert sich das Dorf Nekkargartach, an dem der Neckar vorbeifließt. Ansicht aus dem Forstlagerbuch von Kieser,
197 Weinsberger den Ort der Stadt Heilbronn zu Lehen. Das blieb auch so, nachdem das Dorf mit dem gesamten Weinsberger Besitz 1504 an Württemberg fiel. Erst 1754 gelang es der Reichsstadt im Zusammenhang mit dem Neckargartacher Aufstand (s. S. 91 ), die Oberlehenshoheit über das Dorf an sich zu bringen. Dagegen blieb das Patronatsrecht der Neckargartacher Kirche in den Händen des katholischen Deutschen Ordens, obwohl die Ortseinwohner 1530 protestantisch geworden waren. Das führte zu ständigen Auseinandersetzungen zwischen der Reichsstadt und der Deutschordens-Kommende in Heilbronn. 1802/ 03 wurde auch Neckargartach zu einer selbständigen württembergischen Gemeinde. Seine Entwicklung im 19. Jahrhundert ist der von Böckingen nicht unähnlich. Die Bevölkerungszahlen stiegen von 1650 Personen 1863 auf im Jahre 1900 und auf rund bei der Eingemeindung arbeiteten ca Neckargartacher in Heilbronner Industriebetrieben. Zwar hatte der Ort mit der 1851 gegründeten chemischen Fabrik»Wohlgelegen«, zwei Hammerschmieden, einer Ziegelei, drei Mahlmühlen und einer Sägemühle sowie drei Bierbrauereien in gewerblicher Hinsicht eine bessere Grundlage als Böckingen, doch stand Neckargartach am Anfang der l 930er Jahre ebenso und aus denselben Gründen vor dem finanziellen Ruin. Die Zwangseingemeindung nach Heilbronn erfolgte 1938, heute (31. Juli 1997) leben 9881 Menschen in diesem Stadtteil. Einst berühmt für Garn und Schuhe: Sontheim Hochpolitischen Heiratsplänen verdankt Sontheim seine erste schriftliche Erwähnung. Kaiser Friedrich 1. Barbarossa und König Alfons VIII. von Kastilien besiegelten am 23. April 1188 in Seligenstadt den Ehevertrag zwischen ihren Kindern, dem l 6jährigen Konrad und der neunjährigen Berengaria. Darin wurden die Teile des staufischen Hausgutes, die als Morgengabe des Bräutigams an die Braut gehen sollten, genau aufgelistet und beschrieben, u.a. auch Besitz in Sontheim. Der Ort, dessen Endsilbe -heim darauf hindeutet, daß er zu den im 7./8. Jahrhundert angelegten fränkischen Ausbausiedlungen zählt, war wohl in seiner Frühgeschichte weitgehend in königlichem Eigentum. Das änderte sich im laufe des 13. und 14. Jahrhunderts. Spätestens 1427 muß von einem neuen Ortsherrn ausgegangen werden, da sich Sontheim in diesem Jahr zu drei Vierteln in der Hand des Deutschen Ordens befand. Bis 1805/06 Württemberg die Herrschaft übernahm, bestimmten und prägten der Komtur der Heilbronner Deutschordens-Kommende und in seiner Vertretung der Amtmann des Deutschen Ordens in Talheim die Geschicke des folglich auch nach der Reformation katholisch gebliebenen Dorfes. Im 19. Jahrhundert veränderten sich nicht nur die politischen Verhältnisse. Aus Sontheim, dessen Bewohner traditionell Acker- und Weinbau betrieben hatten, wurde ein Industriestandort. Die zwei größten Unter- ontheim von Osten aus esehen. In der Mitte die irche, im Hintergrund er Neckar. Luftbild,
198 nehmen waren die 1868 gegründete»mechanische Zwirnerei Ackermann und Co.«und die 1891 von Öhringen hierher verlegte Schuhfabrik Wolf und Co. (Wolko), die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in ihrer jeweiligen Branche überregionale Bedeutung und Bekanntheit erlangten. Diese und weitere aufstrebende Industriebetriebe, in denen viele Arbeitskräfte benötigt wurden, trugen dazu bei, daß die Bevölkerungszahl des Ortes anstieg: Von 1051 Personen 1841 auf 2164 im Jahre wurde Sontheim nach jahrzehntelangem Ringen und entgegen seinem Willen ein Stadtteil von Heilbronn. Die damals 4002 Ortseinwohner zählende Gemeinde, die über einen soliden Finanzhaushalt verfügte, sollten die Oberamtsstadt dafür entschädigen, daß diese gezwungenermaßen die verschuldeten Arbeiterwohngemeinden Böckingen und Neckargartach unter ihre Fittiche hatte nehmen müssen. Mit Einwohnern ist Sontheim heute (31. Juli 1997) nach Böckingen der zweitgrößte der acht Stadtteile. Zwischen Baden und Württemberg: Klingenberg Der Heilbronner Anthropologe Dr. Alfred Schliz entdeckte 1908 unter den Klingenberger T uffsteinfelsen ausgedehnte Höhlen mit Spuren menschlichen Lebens aus der mittleren Steinzeit. Archäologische Funde aus späteren Epochen belegen, daß auf der Klingenberger Markung eine gewisse Siedlungskontinuität vorhanden war, auch wenn es dazwischen wohl Zeiten der Verödung gegeben hat. Gemessen an dieser langen Vor- und Frühgeschichte, tritt der Ort vergleichsweise spät ins Licht schriftlicher Uberlieferung: In einer Urkunde vom 10. August 1293 wird der Edelknecht Reinbot von Klingenberg als Zeuge genannt und damit auch sein Herkunftsort erstmals in einer Quelle erwähnt. Die Adelsfamilie der Klingenberger hatte die dortige Burg als Lehen von den badischen Markgrafen erhalten und dieses bis zu ihrem Aussterben im 15. Jahrhundert inne. Das Haus Baden belehnte dann die in Schwaigern ansässigen Herren von Neipperg mit Klingenberg. Unterhalb der Burg hatte sich nach und nach ein Dorf entwickelt, in dem bis 1805 ebenfalls die Grafen von Neipperg das Sagen hatten. Mit ihnen, die auch das Patronatsrecht der Kirche innehatten, wurden die Klingenberger in der Reformationszeit evangelisch. Der südliche Rand der Markung Klingenbergs war die Grenze zwischen den Territorien Baden und Württemberg. Im 15. Jahrhundert ließ der württembergische Graf Eberhard im Barte entlang dieser Grenze vom Heuchelberg zum Neckar hinab einen Landgraben bauen, um an dessen Durchgangsstellen besser Zoll einkassieren zu können. Dies wurde hinfällig, als Baden im Jahre 1806 durch einen Staatsvertrag u.a. Klingenberg an Württemberg abtrat. Zunächst dem Oberamt Kirchhausen zugehörig, zählte der Ort nach dessen Auflösung bis 1938 zum Oberamt Brackenheim, welches dann in dem neugebildeten Landkreis Heilbronn aufging. Im 19. Jahrhundert war Klingenberg ein armes Dorf:»Die Einwohner finden ihre Erwerbsquellen in Feldbau, Weinbau, Viehzucht und viele unter ihnen als Arbeiter in den Fabriken zu Heilbronn und auf dem gräflichen Schloßgut«, berichtet die Beschreibung des Oberamts Brackenheim von Um die Jahrhundertwende lebten rund 500 Menschen im Ort. Bei der Eingemeindung 1970 waren es Klingenberger. Am 31. Juli 1997 zählte der kleinste Stadtteil 2011 Einwohner. Das Dorf der Deutschordensritter: Kirchhausen Die Kirchhausener Markung ist uraltes Siedlungsland. Früheste Bodenfunde stammen aus der Altsteinzeit, und Blick über den Neckar auf Schloß und Kirche von Klingenberg. Am Ufer liegen die Nachen für den Fährbetrieb nach Horkheim. Foto,
199 Das Deutschordensschloß in Kirchhausen. Der mächtige Renaissancebau erhebt sich malerisch aus dem umlaufenden Graben. Foto, um 1935 weitere belegen mit Unterbrechungen menschliche Niederlassungen bis in die Römerzeit. Der Name»Kirchhusen«findet sich erstmals in schriftlichen Quellen des Klosters Weißenburg im Elsaß aus dem 10. Jahrhundert. Dieses verfügte im nördlichen Württemberg über einen stattlichen Besitz, der - wie Kirchhausen - durch den Ungarnsturm 926 teilweise zerstört wurde. Danach fiel der Ort an die Grafen von Calw, die ihn mit seiner Kirche wieder aufbauten, später gehörte er den Grafen von Vaihingen. Nach unübersichtlichen Besitzverhältnissen im 14. Jahrhundert kaufte der Deutsche Orden 1433 bzw sowohl die obere wie die untere Burg, welche zuvor zwei verschiedenen ritterschaftlichen F amilien gehört hatten, und bestimmte für die nächsten Jahrhunderte die Geschikke Kirchhausens. Sichtbares Zeichen für die Herrschaft der Deutschordensritter ist bis heute das imponierende Renaissanceschloß (erbaut ) mit seinen vier mächtigen Ecktürmen. Das Amt Kirchhausen, das allein aus diesem Ort bestand, wurde zum zweitwichtigsten Getreidelieferanten für das Deutschordensland am unteren Neckar, dessen Zentrum in Gundelsheim lag fiel das katholisch gebliebene Kirchhausen im Zuge der Säkularisierung der geistlichen Herrschaftsgebiete an Württemberg und war 1807 /08 kurzfristig der Sitz eines Oberamtes. Durch die Einrichtung einer Unteramtsarztstelle 1814 und des Amtsnotariats 1826 wurde der Gemeinde auch noch später eine gewisse Mittelpunktsfunktion für die umliegenden Ortschaften zuerkannt. Die Landwirtschaft, deren Schwerpunkt auf dem Anbau von Getreide, Futterfrüchten und Kartoffeln lag, in geringerem Umfang auch von Tabak, Hopfen, Zichorie und Zuckerrüben, blieb bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die wirtschaftliche Grundlage des Ortes. Im Jahre 1901 hatte Kirchhausen Einwohner. Ein deutlicher Bevölkerungsanstieg fand nach dem Zweiten Weltkrieg statt, als sich viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus den Ostgebieten dort niederließen, so daß deren Anteil an der Bevölkerung 1950 bei 20 Prozent lag. Kurz nach der Eingemeindung 1972 lebten 2949 Personen in Kirchhausen, am 31. Juli 1997 waren es 3546 Männer, Frauen und Kinder. Von Wimpfen nach Heilbronn: Biberach Das früheste schriftliche Zeugnis für Biberach ist die im Lorscher Kodex wiedergegebene Urkunde, in der Böckingen ebenfalls zum ersten Mal erwähnt wird. Somit ist auch hier die Datierungsfrage oder ungelöst. Fest steht allerdings, daß das Kloster Lorsch zu dieser Zeit bereits Besitz in Biberach sein eigen nennen konnte. Ein Jahrhundert später war es der Bischof von Worms, dem das halbe Dorf gehörte. Biberach war aber auch Teil des königlichen Reichsgutes. Im Jahre 1298 verlieh König Adolf den Ort an seinen Gefolgsmann Konrad von Weinsberg kaufte die Reichsstadt Wimpfen das Dorf um 2000 Gulden. Bis 1650 blieb es im reichsstädtischen Besitz, dann veräußerte Wimpfen den Ort aus Geldnot an den französischen Generalmajor Thomas von Klug, der zusammen mit seiner Familie 30 Jahre lang ein verschwenderisches und lebenslustiges Regiment ausübte erwarb der Deutsche Orden das unter Wimpfener Herrschaft evangelisch gewordene Biberach, das damals 293 Einwohner zählte. Bis zum Übergang an Württemberg 1805 kam es immer wieder zu Streitigkeiten und gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen den protestantischen Dorfbewohnern und dem Ortsherrn, durch dessen»katholische«
200 Politik sie sich benachteiligt und in ihren Rechten eingeschränkt fühlten. Auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert blieb Biberach das, was es immer gewesen war: ein reines Bauerndorf. Die Bevölkerungszahl stagnierte zwischen und 1939 bei rund 1200 Einwohnern. Diejenigen Biberacher, die sich nicht durch die Landwirtschaft im Ort ernähren konnten, zogen nämlich entweder in die nahegelegenen Industriestädte Neckarsulm und Heilbronn oder entschlossen sich zu dem weitergehenden Schritt einer Auswanderung nach Übersee. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Dorfbevölkerung durch die Aufnahme von Heimatvertriebenen und Ostflüchtlingen sprunghaft auf 1734 Personen (1950) an. 1974, im Jahr der Eingemeindung nach Heilbronn, hatte der Ort Einwohner, am 31. Juli 1997 lebten dort Menschen. Fränkisch wie sein Name: Frankenbach Auf der Frankenbacher Markung ausgegrabene Bodenfunde lassen darauf schließen, daß es dort seit der Steinzeit immer wieder Besiedlungsphasen gegeben hat. Der heutige Ort entstand aber erst in fränkischer Zeit, worauf auch sein Name hinweist. Dieser erscheint als»francunbach«- wie Böckingen und Biberach - erstmals in der schon mehrfach erwähnten Urkunde vom 25. Juli im 15. Regierungsjahr Pippins (766 oder 767) im Lorscher Kodex, wo noch weitere Hinweise auf den Ort zu finden sind. Dann schweigen die Quellen jahrhundertelang über Frankenbach. Erst aus dem 13. und 14. Jahrhundert sind wieder Einzelheiten bekannt: Das Stift Nonnenmünster in Worms, der Deutsche Orden, das Klarakloster, die Pfarrpflege und das Katharinenspital in Heilbronn sowie das Dominikanerkloster und das Heiliggeistspital in Wimpfen verfügten dort über Besitzungen. Wichtig waren auch die Adelsfamilien von Gemmingen und Remchingen. Letztere gelangte am Beginn des 15. Jahrhunderts an die eigentliche Ortsherrschaft. Doch bald darauf verkaufte Heinrich von Remchingen in mehreren Schritten bis 1438 seine gesamten Vogtei- und Gerichtsrechte an die Reichsstadt Heilbronn, die damit auf Dauer zum alleinigen Herr des Dorfes wurde. Ihr gelang es schließlich auch, das eigentlich dem Deutschen Orden zustehende Patronatsrecht der Kirche an sich zu ziehen und 1530 ungehindert die Reformation in Frankenbach durchzuführen. Am Ende der Reichsstadtzeit 1802/03 wurde das Dorf ebenfalls eine württembergische Gemeinde. Frankenbach erlebte im 19. Jahrhundert sogar eine Vergrößerung seiner Markung durch die politische und kirchliche Eingliederung des bis dahin eigenständigen Hipfelhofs. Am Ende des Jahrhunderts war dieser an die Zuckerfabrik Heilbronn verpachtet. Die Landwirtschaft blieb auch in Frankenbach der vorherrschende Erwerbszweig, daneben wurden noch Sand-und Kiesgruben wichtig. Außerdem verdienten immer mehr Frankenbacher - zwischen 1834 und 1901 stieg ihre Zahl von 829 auf 1688 Personen - ihren Lebensunterhalt in den Fabriken von Heilbronn und Neckarsulm. Im Jahr der Eingemeindung, 197 4, lebten 5193 Menschen in F rankenbach, heute (31. Juli 1997) sind dort 5861 Einwohner registriert. Biberach von Osten her gesehen. Der Charakter des Haufendorfes ist gut zu erkennen. Im Vordergrund die alte Straße nach Neckargartach. Luftbild, 1930 Auch Frankenbach war ein eng um die Kirche herum gebautes Haufendorf. Ansicht aus dem Forstlagerbuch von Kieser,
201 Selbständig geblieben: Flein»Flein, Flein, du edler Fleck... " beginnt ein Gedicht, das die vier Heilbronner Dörfer, die bis 1802/03 zum Te rritorium der Reichsstadt zählten, benennt. Böckingen, Frankenbach und Neckargartach sind auch heute wieder Heilbronner Stadtteile. Das vierte Dorf im Bunde, Flein, ist dagegen eine selbständige Gemeinde geblieben. Fleins erste Erwähnung findet sich in derselben Urkunde wie die von Sontheim (23. April 1188), der Ort war also ursprünglich Königsgut wurde ein Großteil der die Fleiner Kirche betreffenden Rechte dem Heilig-Geist-Spital in Wimpfen geschenkt, während im 14. Jahrhundert die auf Stettenfels sitzende Familie Sturmfeder Vogtei und Gericht im Ort als Reichslehen innehatten. Dieses verkauften sie 1385 an die Stadt Heilbronn, die von da an bis 1802/03 die Ortsherrschaft ausübte. Wie von alters her blieben die Landwirtschaft und vor allem der Weinbau in Flein auch im 19. Jahrhundert vorherrschend. Letzterer stellt dort bis heute eine wichtige Erwerbsquelle dar. Eine Ansiedlung von Industrie fand nicht statt, doch arbeiteten viele Fleiner in den Heilbronner und Sontheimer Fabriken. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts entwickelten sich etliche Gewerbebetriebe, die z.b rund 1060 Arbeitsplätze zur Verfügung stellten. Der Großteil der Bevölkerung Fleins - die Gemeinde ist ein beliebter Wohnort - arbeitet aber auch heute in Heilbronn. Dieser Tatsache wurde durch die Anbindung des Ortes an den Stadtbusbereich Rechnung getragen. Die historisch gewachsenen Verbindungen zur nahen Großstadt sind also nicht abgebrochen. Die Hauptstraße (heute: Schleusenstraße} mit Rathaus in Horkheim, welche die West-Ost Achse des alten Dorfkerns darstellt. Dieser weist die Form eines fast regelmäßigen Vierecks auf. Foto, um 1950 Ein Ort auf»schmutzigem«boden: Horkheim Durch eine Urkunde Kaiser Ottos II. vom Jahr 976 wurde der Bischofskirche St. Peter in Worms die bis dahin in königlichem Besitz befindliche Abtei Mosbach mit all den ihr zugehörigen Orten geschenkt. In der darauffolgenden Aufzählung findet sich auch das Dorf»Horegeheim«- sein Name leitet sich von dem mittelhochdeutschen Wort hor, horwes, d.h. schmutziger Boden, ab. Gemeint ist damit sumpfiges, morastiges Gelände wie z.b. an der alten Neckarfurt bei Horkheim. Diesem Flußübergang verdankt der Ort auch seine Entstehung. Schon in der Römerzeit gab es hier eine Niederlassung, wie Bodenfunde belegen. Nach der Vertreibung der Römer durch die Alemannen scheint eine Verödung eingetreten zu sein. Im 5./6. Jahrhundert wurde eine neue fränkische Siedlung angelegt. Bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts gehörte Horkheim zum Bistum Worms und fiel dann wieder in den königlichen Eigenbesitz zurück. Seit der Mitte desselben Jahrhunderts gelang es Württemberg, immer mehr Herrschaftsrechte in dem Ort für sich geltend zu machen. Dennoch wurde Horkheim um 1450 zunächst kurpfälzisch, ehe das Dorf 1504 auf Dauer dem Herzogtum Württemberg zugeschlagen wurde. Die seit dem 14. Jahrhundert in Urkunden erwähnte Burg Horkheim, die 1461 ebenfalls Kurpfalz zugefallen war, blieb auch nach 1504 unter kurpfälzischer Lehensherrschaft, so daß Ort und Burg bis 1806 zwei unterschiedlichen Territorien zugehörig waren. Welche konkreten Auswirkungen das haben konnte, zeigte sich, als Ende des 17. Jahrhunderts die Kurpfälzer Lehensleute damit begannen, in der Burg Juden anzusiedeln. Jedesmal, wenn diese das Tor durchschritten, begaben sie sich»ins Ausland«und mußten Leibzoll an Württemberg bezahlen. Erst nach 1806 konnten sie sich auch als Nachbarn der seit der Reformationszeit evangelischen Ortsbevölkerung niederlassen. Obwohl Hork- 199
angereichert wurde. Alemannien war damit, wie kurz zuvor schon das Herzogtum Würzburg, von der fränkischen Herrschaftsorganisation erfasst, die sich
 angereichert wurde. Alemannien war damit, wie kurz zuvor schon das Herzogtum Würzburg, von der fränkischen Herrschaftsorganisation erfasst, die sich nun nach den aus den Hausmeiern hervorgegangenen Königen
angereichert wurde. Alemannien war damit, wie kurz zuvor schon das Herzogtum Würzburg, von der fränkischen Herrschaftsorganisation erfasst, die sich nun nach den aus den Hausmeiern hervorgegangenen Königen
St. Maria Magdalena. Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße. Teil 1 -bis 1390-
 St. Maria Magdalena Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße Teil 1 -bis 1390- Seit wann gab es in (Ober)-Bergstraße eine Kapelle? Wo hat sie gestanden? Wie hat sie ausgesehen? Größe? Einfacher Holzbau
St. Maria Magdalena Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße Teil 1 -bis 1390- Seit wann gab es in (Ober)-Bergstraße eine Kapelle? Wo hat sie gestanden? Wie hat sie ausgesehen? Größe? Einfacher Holzbau
Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen II. Herkunft und Ansehen der Karolinger
 Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen 1. Wie groß war das Frankenreich Karls, und wie viele Menschen lebten darin? 11 2. Sprachen die Franken französisch? 13 3. Wie war die fränkische Gesellschaft
Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen 1. Wie groß war das Frankenreich Karls, und wie viele Menschen lebten darin? 11 2. Sprachen die Franken französisch? 13 3. Wie war die fränkische Gesellschaft
Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum?
 Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Die Ausgrabungen auf der Ortenburg
 Die Ausgrabungen auf der Ortenburg www.archsax.sachsen.de Die Ausgrabungen auf der Ortenburg Im Januar 2002 wurden die 1999 begonnenen Grabungen auf der Ortenburg planmässig abgeschlossen. Die Untersuchungen
Die Ausgrabungen auf der Ortenburg www.archsax.sachsen.de Die Ausgrabungen auf der Ortenburg Im Januar 2002 wurden die 1999 begonnenen Grabungen auf der Ortenburg planmässig abgeschlossen. Die Untersuchungen
Hermann Ehmer. Geschichte der Grafschaft Wertheim
 Hermann Ehmer Geschichte der Grafschaft Wertheim Verlag E. Buchheim, Nachf., Wertheim 1989 Inhaltsverzeichnis Vorwort 9 Einleitung 12 I. Vorgeschichte 19 1. Der Main-Tauber-Raum bis zum frühen Mittelalter
Hermann Ehmer Geschichte der Grafschaft Wertheim Verlag E. Buchheim, Nachf., Wertheim 1989 Inhaltsverzeichnis Vorwort 9 Einleitung 12 I. Vorgeschichte 19 1. Der Main-Tauber-Raum bis zum frühen Mittelalter
Das Ende des Dreißigjährigen Krieges
 I Das Ende des Dreißigjährigen Krieges 1660 In Marxheim Marxheim gehörte in diesen Zeiten zu dem Gebiet, das im Jahre 1581 von Kaiser Rudolph dem Erzstift Mainz übertragen worden war. Nach Beendigung des
I Das Ende des Dreißigjährigen Krieges 1660 In Marxheim Marxheim gehörte in diesen Zeiten zu dem Gebiet, das im Jahre 1581 von Kaiser Rudolph dem Erzstift Mainz übertragen worden war. Nach Beendigung des
Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut
 Geschichte Rudi Loderbauer Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut Studienarbeit Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Bayerische Geschichte Sommersemester 2004 Proseminar: Bayerns
Geschichte Rudi Loderbauer Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut Studienarbeit Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Bayerische Geschichte Sommersemester 2004 Proseminar: Bayerns
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burg Wart- Eine Wanderung von Burg zu Bergwerk Von Frank Buchali
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Spiegelberg Burg Wart- Eine Wanderung von Burg zu Bergwerk Von Frank Buchali Folgt man der Landstraße
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Spiegelberg Burg Wart- Eine Wanderung von Burg zu Bergwerk Von Frank Buchali Folgt man der Landstraße
Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit?
 Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit? Plan der Stadt Gernsbach aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deutlich kann man die Murg und den ummauerten Stadtkern
Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit? Plan der Stadt Gernsbach aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deutlich kann man die Murg und den ummauerten Stadtkern
Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. zur Eröffnung der Ausstellung Wenzel von. Böhmen. Heiliger und Herrscher in der
 Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zur Eröffnung der Ausstellung Wenzel von Böhmen. Heiliger und Herrscher in der Österreichischen Nationalbibliothek am Mittwoch, dem 25. November 2009 Sehr geehrte
Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zur Eröffnung der Ausstellung Wenzel von Böhmen. Heiliger und Herrscher in der Österreichischen Nationalbibliothek am Mittwoch, dem 25. November 2009 Sehr geehrte
Zum Archivale der Vormonate bitte scrollen!
 Archivale des Monats Juni 2013 Wohnungsvermietung vor 700 Jahren Dechant und Domkapitel zu Köln vermieten dem Goswin gen. von Limburch gen. Noyge auf Lebenszeit ihr Haus, das zwei Wohnungen unter seinem
Archivale des Monats Juni 2013 Wohnungsvermietung vor 700 Jahren Dechant und Domkapitel zu Köln vermieten dem Goswin gen. von Limburch gen. Noyge auf Lebenszeit ihr Haus, das zwei Wohnungen unter seinem
Wir feiern heute ein ganz außergewöhnliches Jubiläum. Nur sehr wenige Kirchengebäude
 Sperrfrist: 19.4.2015, 12.45 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 1200- jährigen
Sperrfrist: 19.4.2015, 12.45 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 1200- jährigen
Bayerns Könige privat
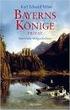 Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
UR- UND FRÜHGESCHICHTE DES FELDKIRCHER RAUMES POLITIK, WIRTSCHAFT, VERFASSUNG DER STADT FELDKIRCH
 Hermann Fetz Christine Spiegel UR- UND FRÜHGESCHICHTE DES FELDKIRCHER RAUMES Benedikt Bilgeri POLITIK, WIRTSCHAFT, VERFASSUNG DER STADT FELDKIRCH bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Jan Thorbecke Verlag
Hermann Fetz Christine Spiegel UR- UND FRÜHGESCHICHTE DES FELDKIRCHER RAUMES Benedikt Bilgeri POLITIK, WIRTSCHAFT, VERFASSUNG DER STADT FELDKIRCH bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Jan Thorbecke Verlag
Lebenslauf von Graf Ulrich I von Schaunberg
 Lebenslauf von Graf Ulrich I von Schaunberg Datum Ort Ereignis 1330 Schaunberg Graf Ulrich wird geboren 1.5.1331 München Kaiser Ludwig der Bayer bestätigt die 31.10.1340 Passau Kaiser Ludwig und Herzog
Lebenslauf von Graf Ulrich I von Schaunberg Datum Ort Ereignis 1330 Schaunberg Graf Ulrich wird geboren 1.5.1331 München Kaiser Ludwig der Bayer bestätigt die 31.10.1340 Passau Kaiser Ludwig und Herzog
Graf Adolf von Altena befreit Gut Kasewinkel, das dem Kloster St. Aegidii zu Münster gehört, von Diensten und Abgaben, 1213
 Archivale des Monats Mai 2013 Graf Adolf von Altena befreit Gut Kasewinkel, das dem Kloster St. Aegidii zu Münster gehört, von Diensten und Abgaben, 1213 Die Urkunde über diesen Rechtsakt wurde 1213 von
Archivale des Monats Mai 2013 Graf Adolf von Altena befreit Gut Kasewinkel, das dem Kloster St. Aegidii zu Münster gehört, von Diensten und Abgaben, 1213 Die Urkunde über diesen Rechtsakt wurde 1213 von
4. vorchristlichen Jahrhunderts stammen. Die Funde geben überraschende Hinweise auf eine eisenzeitliche Besiedlung im Tal der mittleren Wupper, deren
 4. vorchristlichen Jahrhunderts stammen. Die Funde geben überraschende Hinweise auf eine eisenzeitliche Besiedlung im Tal der mittleren Wupper, deren Bewohner von Ackerbau und Viehzucht lebten. Vermutlich
4. vorchristlichen Jahrhunderts stammen. Die Funde geben überraschende Hinweise auf eine eisenzeitliche Besiedlung im Tal der mittleren Wupper, deren Bewohner von Ackerbau und Viehzucht lebten. Vermutlich
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgstall Gleichen- Burghügel in den Löwensteiner Bergen
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Pfedelbach-Gleichen Burgstall Gleichen- Burghügel in den Löwensteiner Bergen Von Frank Buchali und
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Pfedelbach-Gleichen Burgstall Gleichen- Burghügel in den Löwensteiner Bergen Von Frank Buchali und
 Meerssen Meerssen ist das Zentrum eines uralten Siedlungsgebietes. Ausgrabungen in der Umgebung von Meerssen stießen auf die Spuren einer villa rustica und auf die Überreste von römischen Töpfereien. Für
Meerssen Meerssen ist das Zentrum eines uralten Siedlungsgebietes. Ausgrabungen in der Umgebung von Meerssen stießen auf die Spuren einer villa rustica und auf die Überreste von römischen Töpfereien. Für
Huch, M., Wolodtschenko, A. Exkursion im Rahmen des DGS-Kongresses 2014 in Tübingen. Leitung: Monika Huch, Sektion Ökosemiotik
 Ein landschaftsbezogener Bildatlas Huch, M., Wolodtschenko, A. Lese. Zeichen Tübingen Exkursion im Rahmen des DGS-Kongresses 2014 in Tübingen Leitung: Monika Huch, Sektion Ökosemiotik Adelheidsdorf Dresden
Ein landschaftsbezogener Bildatlas Huch, M., Wolodtschenko, A. Lese. Zeichen Tübingen Exkursion im Rahmen des DGS-Kongresses 2014 in Tübingen Leitung: Monika Huch, Sektion Ökosemiotik Adelheidsdorf Dresden
Limes- Forschungen -kurzer Überblick-
 Limes- Forschungen -kurzer Überblick- Quelle: LDA, 2004, Seite 10 Nach Abzug der Römer aus Württemberg (etwa 260 n.chr.) verschwand auch die Erinnerung an sie aus dem Gedächtnis der Menschen. Namen wie
Limes- Forschungen -kurzer Überblick- Quelle: LDA, 2004, Seite 10 Nach Abzug der Römer aus Württemberg (etwa 260 n.chr.) verschwand auch die Erinnerung an sie aus dem Gedächtnis der Menschen. Namen wie
Der Aufstieg Nürnbergs im 12. und 13. Jahrhundert
 Geschichte Christian Plätzer Der Aufstieg Nürnbergs im 12. und 13. Jahrhundert Studienarbeit Christian Plätzer Der Aufstieg Nürnbergs im 12. und 13. Jahrhundert INHALT Vorbemerkung... 2 1. Einleitung...
Geschichte Christian Plätzer Der Aufstieg Nürnbergs im 12. und 13. Jahrhundert Studienarbeit Christian Plätzer Der Aufstieg Nürnbergs im 12. und 13. Jahrhundert INHALT Vorbemerkung... 2 1. Einleitung...
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 4.-8. Schuljahr
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 4.-8. Schuljahr
Propyläen Geschichte Deutschlands
 Propyläen Geschichte Deutschlands Herausgegeben von Dieter Groh unter Mitwirkung von Hagen Keller Heinrich Lutz Hans Mommsen Wolfgang J. Mommsen Peter Moraw Rudolf Vierhaus Karl Ferdinand Werner Dritter
Propyläen Geschichte Deutschlands Herausgegeben von Dieter Groh unter Mitwirkung von Hagen Keller Heinrich Lutz Hans Mommsen Wolfgang J. Mommsen Peter Moraw Rudolf Vierhaus Karl Ferdinand Werner Dritter
Aus der Geschichte unseres Heimatortes
 Aus der Geschichte unseres Heimatortes Funde zeigen, dass unsere Gegend bereits ab der Steinzeit besiedelt ist und erstes dörfliches Leben mit Viehzucht und Ackerbau entsteht. Ab 15 v. Chr. wird die Donau
Aus der Geschichte unseres Heimatortes Funde zeigen, dass unsere Gegend bereits ab der Steinzeit besiedelt ist und erstes dörfliches Leben mit Viehzucht und Ackerbau entsteht. Ab 15 v. Chr. wird die Donau
Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit?
 Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit? Plan der Stadt Gernsbach aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deutlich kann man die Murg und den ummauerten Stadtkern
Was waren die Kennzeichen einer Stadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit? Plan der Stadt Gernsbach aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deutlich kann man die Murg und den ummauerten Stadtkern
HGM Hubert Grass Ministries
 HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 5/18 Gottes Herrlichkeit in uns Gott ist ein guter Vater und will seine Kinder glücklich machen. Er füllt uns täglich mit seiner Liebe, seinem Frieden und seiner
HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 5/18 Gottes Herrlichkeit in uns Gott ist ein guter Vater und will seine Kinder glücklich machen. Er füllt uns täglich mit seiner Liebe, seinem Frieden und seiner
Rudelsdorf, ein uraltes Dorf an der Bernsteinstraße
 Rudelsdorf, ein uraltes Dorf an der Bernsteinstraße Mit seinen mehr als 400 Einwohnern, der Kirche mit Friedhof, der Schule und seinen verschiedenen Geschäften, war Rudelsdorf der Hauptort eines Kirchspiels,
Rudelsdorf, ein uraltes Dorf an der Bernsteinstraße Mit seinen mehr als 400 Einwohnern, der Kirche mit Friedhof, der Schule und seinen verschiedenen Geschäften, war Rudelsdorf der Hauptort eines Kirchspiels,
Karl IV. zugleich König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ist eine Leitfigur und ein Brückenbauer.
 Sperrfrist: 27. Mai 2016, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung
Sperrfrist: 27. Mai 2016, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung
EIMAR. GOETHE Genius in Weimar BUCHENWALD Ort des Schreckens NATIONALVERSAMMLUNG Geburt der Republik BAUHAUS Kurze Geschichte mit Langzeitwirkung
 BAEDEKER WISSEN GOETHE Genius in Weimar BUCHENWALD Ort des Schreckens NATIONALVERSAMMLUNG Geburt der Republik BAUHAUS Kurze Geschichte mit Langzeitwirkung EIMAR WISSEN Weimar auf einen Blick Bevölkerung
BAEDEKER WISSEN GOETHE Genius in Weimar BUCHENWALD Ort des Schreckens NATIONALVERSAMMLUNG Geburt der Republik BAUHAUS Kurze Geschichte mit Langzeitwirkung EIMAR WISSEN Weimar auf einen Blick Bevölkerung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Karl der Groe - Vater Europas? Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Karl der Groe - Vater Europas? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de III Mittelalter Beitrag 6 Karl der Große (Klasse
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Karl der Groe - Vater Europas? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de III Mittelalter Beitrag 6 Karl der Große (Klasse
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter - Das Leben von Bauern, Adel und Klerus kennen lernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter - Das Leben von Bauern, Adel und Klerus kennen lernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Die Heilig-Blut-Legende
 Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest
 15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen
15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN, Priester, Ordensgründer Hochfest ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen
NORDHAUSEN BILDERBUCH EINER TAUSENDJÄHRIGEN STADT
 NORDHAUSEN BILDERBUCH EINER TAUSENDJÄHRIGEN STADT Die Geschichte der Stadt Nordhausen ist beeindruckend lang und blickt sowohl auf Blütezeiten als auch schwarze Tage zurück. Anhand des Stadtzentrums mit
NORDHAUSEN BILDERBUCH EINER TAUSENDJÄHRIGEN STADT Die Geschichte der Stadt Nordhausen ist beeindruckend lang und blickt sowohl auf Blütezeiten als auch schwarze Tage zurück. Anhand des Stadtzentrums mit
für Ihre Heiligkeit Papst Benedikt XVI Seehausen am Staffelsee Eine Kurzvorstellung unseres Ortes
 für Ihre Heiligkeit Papst Benedikt XVI Seehausen am Staffelsee Eine Kurzvorstellung unseres Ortes Seehausen am Staffelsee Der Name Seehausen wird im 6./7.Jahrh. entstanden sein. Er ist eine Bezeichnung
für Ihre Heiligkeit Papst Benedikt XVI Seehausen am Staffelsee Eine Kurzvorstellung unseres Ortes Seehausen am Staffelsee Der Name Seehausen wird im 6./7.Jahrh. entstanden sein. Er ist eine Bezeichnung
Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig
 Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
die Schlacht am Teutoburger Wald, in der die germanischen Verbände von dem cheruskischen Fürstensohn Hermann (wenn er denn so hieß in die deutschen
 die Schlacht am Teutoburger Wald, in der die germanischen Verbände von dem cheruskischen Fürstensohn Hermann (wenn er denn so hieß in die deutschen Sagen hat er als Siegfried Einzug gehalten) befehligt
die Schlacht am Teutoburger Wald, in der die germanischen Verbände von dem cheruskischen Fürstensohn Hermann (wenn er denn so hieß in die deutschen Sagen hat er als Siegfried Einzug gehalten) befehligt
Gottesdienst am Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Joh 1
 Glockengeläut / Musik Begrüßung Gottesdienst am 26.12. 2016 Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Joh 1 Lied: EG 40 Dies ist die Nacht, darin erschienen Psalm 96;
Glockengeläut / Musik Begrüßung Gottesdienst am 26.12. 2016 Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Joh 1 Lied: EG 40 Dies ist die Nacht, darin erschienen Psalm 96;
Version 8. Juli 2015 Völlige Freude 1. Völlige Freude durch Gehorsam und Bruderliebe
 www.biblische-lehre-wm.de Version 8. Juli 2015 Völlige Freude 1. Völlige Freude durch Gehorsam und Bruderliebe Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt; bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr
www.biblische-lehre-wm.de Version 8. Juli 2015 Völlige Freude 1. Völlige Freude durch Gehorsam und Bruderliebe Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt; bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr
Wer schrieb die Bibel?
 Richard Elliott Friedman Wer schrieb die Bibel? So entstand das Alte Testament Aus dem Amerikanischen von Hartmut Pitschmann Anaconda Verlag qáíéä=çéê=~ãéêáâ~åáëåüéå=lêáöáå~ä~ìëö~äéw=tüç têçíé íüé _áääé
Richard Elliott Friedman Wer schrieb die Bibel? So entstand das Alte Testament Aus dem Amerikanischen von Hartmut Pitschmann Anaconda Verlag qáíéä=çéê=~ãéêáâ~åáëåüéå=lêáöáå~ä~ìëö~äéw=tüç têçíé íüé _áääé
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burg Hoheneck - Ruinenreste in alten Weinbergen
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Ludwigsburg-Hoheneck Burg Hoheneck - Ruinenreste in alten Weinbergen von Frank Buchali und Marco
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Ludwigsburg-Hoheneck Burg Hoheneck - Ruinenreste in alten Weinbergen von Frank Buchali und Marco
3. Sonntag der Fastenzeit B 8. März 2015 Oculi - Lesejahr B - Lektionar II/B, 76: Ex 20,1 17 (oder 20, ); 1 Kor 1,22 25; Joh 2,13 25
 3. Sonntag der Fastenzeit B 8. März 2015 Oculi - Lesejahr B - Lektionar II/B, 76: Ex 20,1 17 (oder 20,1 3.7 8.12 17); 1 Kor 1,22 25; Joh 2,13 25 Was ist uns heilig? Wo ist unser Allerheiligstes? Kein ganz
3. Sonntag der Fastenzeit B 8. März 2015 Oculi - Lesejahr B - Lektionar II/B, 76: Ex 20,1 17 (oder 20,1 3.7 8.12 17); 1 Kor 1,22 25; Joh 2,13 25 Was ist uns heilig? Wo ist unser Allerheiligstes? Kein ganz
Rede von Herrn Minister Dr. Behrens aus Anlass des Festaktes zum Stadtjubiläum der Stadt Mettmann am 04. Juli 2004, Uhr
 Rede von Herrn Minister Dr. Behrens aus Anlass des Festaktes zum Stadtjubiläum der Stadt Mettmann am 04. Juli 2004, 11.00 Uhr - Es gilt das gesprochene Wort - - 2 - Anrede, als einmal eine Schreibkraft
Rede von Herrn Minister Dr. Behrens aus Anlass des Festaktes zum Stadtjubiläum der Stadt Mettmann am 04. Juli 2004, 11.00 Uhr - Es gilt das gesprochene Wort - - 2 - Anrede, als einmal eine Schreibkraft
Geschichte und Baukultur des Deutschen Ordens im Stadt- und Landkreis Heilbronn
 Geschichte und Baukultur des Deutschen Ordens im Stadt- und Landkreis Heilbronn Bernhard J. Lattner Joachim J. Hennze Edition Lattner Inhalt 60 Seiten, fadengebunden im Hardcover 52 Abbildungen, vierfarbig,
Geschichte und Baukultur des Deutschen Ordens im Stadt- und Landkreis Heilbronn Bernhard J. Lattner Joachim J. Hennze Edition Lattner Inhalt 60 Seiten, fadengebunden im Hardcover 52 Abbildungen, vierfarbig,
Römer 14, Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. 8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir
 Römer 14, 7-9 7 Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. 8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir
Römer 14, 7-9 7 Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. 8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir
Predigt über Römer 14,7-9 am in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen)
 Das Copyright für diese Predigt liegt beim Verfasser Bernhard Philipp, Alleestraße 40, 89564 Nattheim Predigt über Römer 14,7-9 am 07.11.2010 in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen) Die Gnade unseres Herrn
Das Copyright für diese Predigt liegt beim Verfasser Bernhard Philipp, Alleestraße 40, 89564 Nattheim Predigt über Römer 14,7-9 am 07.11.2010 in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen) Die Gnade unseres Herrn
Zeittafel Römisch-Deutsche Kaiser und Könige 768 bis 1918
 Röm.Deut. Kaiser/König Lebenszeit Regierungszeit Herkunft Grabstätte Bemerkungen Karl der Große Fränkischer König Karl der Große Römischer Kaiser Ludwig I., der Fromme Römischer Kaiser Lothar I. Mittelfränkischer
Röm.Deut. Kaiser/König Lebenszeit Regierungszeit Herkunft Grabstätte Bemerkungen Karl der Große Fränkischer König Karl der Große Römischer Kaiser Ludwig I., der Fromme Römischer Kaiser Lothar I. Mittelfränkischer
Kinder kennen Koblenz
 Kinder kennen Koblenz 1. Zuerst ein paar Sätze zur Geschichte der Stadt Koblenz Die Römer gründeten vor über 2000 Jahren Koblenz. Die Franken brachten den christlichen Glauben mit und bauten die Kastorkirche
Kinder kennen Koblenz 1. Zuerst ein paar Sätze zur Geschichte der Stadt Koblenz Die Römer gründeten vor über 2000 Jahren Koblenz. Die Franken brachten den christlichen Glauben mit und bauten die Kastorkirche
Königsfelden: Psychiatrische Klinik und Klosterkirche
 Königsfelden: Psychiatrische Klinik und Klosterkirche N 3 4 1 2 Schweizer Luftwaffe, Sept. 2011 1 Psychiatrische Klinik 2 Klosterkirche 3 Brugg 4 Aare Königsfelden, Seite 1 Königsfelden: Kirche, Doppelkloster,
Königsfelden: Psychiatrische Klinik und Klosterkirche N 3 4 1 2 Schweizer Luftwaffe, Sept. 2011 1 Psychiatrische Klinik 2 Klosterkirche 3 Brugg 4 Aare Königsfelden, Seite 1 Königsfelden: Kirche, Doppelkloster,
Das Dorf Wiedikon. Aufgabe: Suche das Wort VViedinchova auf der Urkunde. Kleiner Tipp: es steht am Anfang einer Zeile.
 Das Dorf Wiedikon Als Geburtsschein einer Ortschaft wird ihre erste schriftliche Erwähnung be- zeichnet. Der Name existiert schon früher, sonst hätte er nicht aufgeschrieben werden können. Der Geburtsschein
Das Dorf Wiedikon Als Geburtsschein einer Ortschaft wird ihre erste schriftliche Erwähnung be- zeichnet. Der Name existiert schon früher, sonst hätte er nicht aufgeschrieben werden können. Der Geburtsschein
LANGE NACHT DER KIRCHEN Unterlagen und Tipps aus der Pfarre Waidhofen/Thaya zum Programmpunkt Rätselralley für Kinder (2014)
 Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
DAS RÖMISCHE ERBE UND DAS MEROWINGER- REICH
 DAS RÖMISCHE ERBE UND DAS MEROWINGER- REICH VON REINHOLD KAISER 3., überarbeitete und erweiterte Auflage R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 2004 Inhalt Vorwort des Verfassers XI /. Enzyklopädischer Überblick
DAS RÖMISCHE ERBE UND DAS MEROWINGER- REICH VON REINHOLD KAISER 3., überarbeitete und erweiterte Auflage R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 2004 Inhalt Vorwort des Verfassers XI /. Enzyklopädischer Überblick
Manchmal geben uns die Leute einen Spitznamen.
 8 Lektion Ein neuer Name und ein neuer Freund Apostelgeschichte 11,19-26; Das Wirken der Apostel, S.129-131,155-164 Manchmal geben uns die Leute einen Spitznamen. Vielleicht hast du auch so einen Spitznamen.
8 Lektion Ein neuer Name und ein neuer Freund Apostelgeschichte 11,19-26; Das Wirken der Apostel, S.129-131,155-164 Manchmal geben uns die Leute einen Spitznamen. Vielleicht hast du auch so einen Spitznamen.
Das Reich. Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher
 Das Reich Gottes Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher Das Reich Gottes ist prinzipiell dasselbe wie das Reich der Himmel Reich Gottes antwortet auf die Frage: Wem gehört das Reich? Reich der Himmel antwortet
Das Reich Gottes Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher Das Reich Gottes ist prinzipiell dasselbe wie das Reich der Himmel Reich Gottes antwortet auf die Frage: Wem gehört das Reich? Reich der Himmel antwortet
Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich
 Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich Name Lebenszeit König Kaiser Karl der Große Sohn des Königs Pippin d. J. Ludwig I. der Fromme Jüngster Sohn Karls d. Großen Lothar I. Ältester Sohn Ludwigs
Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich Name Lebenszeit König Kaiser Karl der Große Sohn des Königs Pippin d. J. Ludwig I. der Fromme Jüngster Sohn Karls d. Großen Lothar I. Ältester Sohn Ludwigs
Stauferstele im Kloster Denkendorf
 Stauferstele im Kloster Denkendorf Die erste Stauferstele in unserem Gaugebiet ist am letzten Aprilwochenende vor der Klosterkirche in Denkendorf aufgestellt worden. Stauferstelen sind oktogonale Gedenksteine,
Stauferstele im Kloster Denkendorf Die erste Stauferstele in unserem Gaugebiet ist am letzten Aprilwochenende vor der Klosterkirche in Denkendorf aufgestellt worden. Stauferstelen sind oktogonale Gedenksteine,
man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum
 man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum Christentum bekehren. Wenn der Westfale sich aber mal
man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum Christentum bekehren. Wenn der Westfale sich aber mal
Gnade sei mit euch. Liebe Gemeinde! Immer auf den Stern schauen, alles andere wird sich finden.
 Gnade sei mit euch Liebe Gemeinde! Immer auf den Stern schauen, alles andere wird sich finden. Das Evangelium für den Epiphaniastag steht bei Matthäus, im 2. Kapitel: Da Jesus geboren war zu Bethlehem
Gnade sei mit euch Liebe Gemeinde! Immer auf den Stern schauen, alles andere wird sich finden. Das Evangelium für den Epiphaniastag steht bei Matthäus, im 2. Kapitel: Da Jesus geboren war zu Bethlehem
Das große Landeswappen von Baden-Württemberg
 Das große Landeswappen von Baden-Württemberg Baden-Württemberg ist als deutsches Bundesland erst im Jahr 1952 entstanden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es auf dem Gebiet von Baden-Württemberg
Das große Landeswappen von Baden-Württemberg Baden-Württemberg ist als deutsches Bundesland erst im Jahr 1952 entstanden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es auf dem Gebiet von Baden-Württemberg
Zeittafel der Altstadtkirchen
 Informationen für die Lehrpersonen Zeittafel der Altstadtkirchen Zeit St. Peter Grossmünster Fraumünster Wasserkirche 6. Jh. 7. Jh. 8. Jh. Funde von (vermutlich alemannischen) Gräbern an der Stelle der
Informationen für die Lehrpersonen Zeittafel der Altstadtkirchen Zeit St. Peter Grossmünster Fraumünster Wasserkirche 6. Jh. 7. Jh. 8. Jh. Funde von (vermutlich alemannischen) Gräbern an der Stelle der
Neues aus Alt-Villach
 MUSEUM DER STADT VILLACH 47. Jahrbuch 2010 Neues aus Alt-Villach Dieter Neumann Beiträge zur Stadtgeschichte INHALT Vorwort... Aus der Geschichte der traditionsreichen Stadt... Länder und Völker... Bis
MUSEUM DER STADT VILLACH 47. Jahrbuch 2010 Neues aus Alt-Villach Dieter Neumann Beiträge zur Stadtgeschichte INHALT Vorwort... Aus der Geschichte der traditionsreichen Stadt... Länder und Völker... Bis
MEHR ALS DU SIEHST HIRTENWORT. Ein Leitwort für die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg
 MEHR ALS DU SIEHST Ein Leitwort für die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg HIRTENWORT zur Österlichen Bußzeit 2018 von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg 1 Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Limburg!
MEHR ALS DU SIEHST Ein Leitwort für die Kirchenentwicklung im Bistum Limburg HIRTENWORT zur Österlichen Bußzeit 2018 von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg 1 Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Limburg!
Stuttgart deine Weinberge. Geführte Pedelec-Tour
 Stuttgart deine Weinberge Stuttgart deine Weinberge Geführte Pedelec-Tour Dauer ca. 2 Stunden Maximale Teilnehmerzahl 10 Personen Veranstalter SWE-Mobility (haftungsbeschränkt) Alle Rechte, insbesondere
Stuttgart deine Weinberge Stuttgart deine Weinberge Geführte Pedelec-Tour Dauer ca. 2 Stunden Maximale Teilnehmerzahl 10 Personen Veranstalter SWE-Mobility (haftungsbeschränkt) Alle Rechte, insbesondere
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgruine Hofen- Größte Burgruine Stuttgarts von Frank Buchali
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Stuttgart Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgruine Hofen- Größte Burgruine Stuttgarts von Frank Buchali Im Stuttgarter Vorort Hofen
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Stuttgart Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgruine Hofen- Größte Burgruine Stuttgarts von Frank Buchali Im Stuttgarter Vorort Hofen
Putbus. Liebe Gemeinde,
 24.06.18 Putbus Liebe Gemeinde, Johannes der Täufer wird oft als der letzte Prophet des Alten Testaments bezeichnet. Er war so radikal wie die alten Propheten in dem, was er den Leuten an den Kopf geworfen
24.06.18 Putbus Liebe Gemeinde, Johannes der Täufer wird oft als der letzte Prophet des Alten Testaments bezeichnet. Er war so radikal wie die alten Propheten in dem, was er den Leuten an den Kopf geworfen
Regensburg, Stift zu Unserer Lieben Frau
 Klöster in Bayern: Seite 1 von 5, Stift zu Unserer Lieben Frau BASISDATEN Klostername Ortsname Regierungsbezirk Landkreis Orden Diözese Patrozinium, Stift zu Unserer Lieben Frau Oberpfalz Kollegiatstift
Klöster in Bayern: Seite 1 von 5, Stift zu Unserer Lieben Frau BASISDATEN Klostername Ortsname Regierungsbezirk Landkreis Orden Diözese Patrozinium, Stift zu Unserer Lieben Frau Oberpfalz Kollegiatstift
Er E ist auferstanden
 Er ist auferstanden Zeugnisse über Jesus Christus Das Zeugnis von Johannes dem Täufer Jesus Christus ist einmalig! Er starb am Kreuz, um Sünder zu erretten. Doch drei Tage danach ist Er aus dem Tod auferstanden.
Er ist auferstanden Zeugnisse über Jesus Christus Das Zeugnis von Johannes dem Täufer Jesus Christus ist einmalig! Er starb am Kreuz, um Sünder zu erretten. Doch drei Tage danach ist Er aus dem Tod auferstanden.
Arbeitsblatt 7: Verbindung nach oben zum 10. Textabschnitt
 Kontakt: Anna Feuersänger 0711 1656-340 Feuersaenger.A@diakonie-wue.de 1. Verbindung nach oben Arbeitsblatt 7: Verbindung nach oben zum 10. Textabschnitt Hier sind vier Bilder. Sie zeigen, was Christ sein
Kontakt: Anna Feuersänger 0711 1656-340 Feuersaenger.A@diakonie-wue.de 1. Verbindung nach oben Arbeitsblatt 7: Verbindung nach oben zum 10. Textabschnitt Hier sind vier Bilder. Sie zeigen, was Christ sein
Freyenstein ist größter OT der Stadt Wittstock/Dosse, mit knapp 800 EW Wittstock insgesamt hat 18 OT; Kernstadt und OT zusammen haben knapp 15.
 Übersichtskarte Freyenstein ist größter OT der Stadt Wittstock/Dosse, mit knapp 800 EW Wittstock insgesamt hat 18 OT; Kernstadt und OT zusammen haben knapp 15.000 EW, Tendenz fallend Während die Einwohnerzahl
Übersichtskarte Freyenstein ist größter OT der Stadt Wittstock/Dosse, mit knapp 800 EW Wittstock insgesamt hat 18 OT; Kernstadt und OT zusammen haben knapp 15.000 EW, Tendenz fallend Während die Einwohnerzahl
Die Kroaten: Geschichtsschreibung (Mythologisierung)
 Die Kroaten: Geschichtsschreibung (Mythologisierung) Tadija Smičiklas: Poviest hrvatska (Kroatische Geschichte) 2 Bde. Zagreb 1879, 1882 Die erste Periode sei gekennzeichnet vom Aufeinanderprallen zweier
Die Kroaten: Geschichtsschreibung (Mythologisierung) Tadija Smičiklas: Poviest hrvatska (Kroatische Geschichte) 2 Bde. Zagreb 1879, 1882 Die erste Periode sei gekennzeichnet vom Aufeinanderprallen zweier
Das Schottenstift Benediktinerabtei Unserer Lieben Frau zu den Schotten in Wien
 Das Schottenstift Benediktinerabtei Unserer Lieben Frau zu den Schotten in Wien Als Herzog (1) II. Jasomirgott das Kloster 1155 gründete, lud er iroschottische (2). In der ältesten erhaltenen Urkunde aus
Das Schottenstift Benediktinerabtei Unserer Lieben Frau zu den Schotten in Wien Als Herzog (1) II. Jasomirgott das Kloster 1155 gründete, lud er iroschottische (2). In der ältesten erhaltenen Urkunde aus
Zeittafel von Helmstadt. Vorabdruck aus der Chronik von Helmstadt (erscheint Dez. 2004) mit freundlicher Genehmigung von Bertold Baunach, Helmstadt
 Vorabdruck aus der Chronik von Helmstadt (erscheint Dez. 2004) mit freundlicher Genehmigung von Bertold Baunach, Helmstadt 6000-4000 vor Christus (Jungsteinzeit) Bereits in diesem Zeitraum leben Menschen
Vorabdruck aus der Chronik von Helmstadt (erscheint Dez. 2004) mit freundlicher Genehmigung von Bertold Baunach, Helmstadt 6000-4000 vor Christus (Jungsteinzeit) Bereits in diesem Zeitraum leben Menschen
Voransicht. Karl der Große Vater Europas? Das Wichtigste auf einen Blick. Stefanie Schwinger, Bühl
 Mittelalter Beitrag 6 Karl der Große (Klasse 6) 1 von 18 Karl der Große Vater Europas? Stefanie Schwinger, Bühl arl der Große ist die wohl bekannteste KHerrscherpersönlichkeit des Mittelalters. Wer war
Mittelalter Beitrag 6 Karl der Große (Klasse 6) 1 von 18 Karl der Große Vater Europas? Stefanie Schwinger, Bühl arl der Große ist die wohl bekannteste KHerrscherpersönlichkeit des Mittelalters. Wer war
Geschichte Brehna. Heimat- und Geschichtsverein Brehna e.v Brehna. Veröffentlichung auf Homepage:
 Heimat- und Geschichtsverein Brehna e.v. Brehna Veröffentlichung auf Homepage: www.sandersdorf-brehna.de Gestaltung und Satz neu überarbeitet: Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna, 2012. Inhaltsverzeichnis 3
Heimat- und Geschichtsverein Brehna e.v. Brehna Veröffentlichung auf Homepage: www.sandersdorf-brehna.de Gestaltung und Satz neu überarbeitet: Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna, 2012. Inhaltsverzeichnis 3
Grundlagen des Glaubens
 Grundlagen des Glaubens Einheit 4 Jesus Christus Mehr als ein Mythos? Was sagen die Leute? Jesus hat nie existiert Die Gestalt Jesus war nur eine Fiktion Selbst wenn er je gelebt hätte, wissen wir nichts
Grundlagen des Glaubens Einheit 4 Jesus Christus Mehr als ein Mythos? Was sagen die Leute? Jesus hat nie existiert Die Gestalt Jesus war nur eine Fiktion Selbst wenn er je gelebt hätte, wissen wir nichts
Im Original veränderbare Word-Dateien
 Der Anfang deutscher Geschichte Q1 Kaisersiegel Ottos I: Otto mit Krone, Zepter und Reichsapfel Q2 Kaisersiegel Ottos II.: Otto hält einen Globus in der Hand. Aufgabe 1 Q3 Kaiser Otto III. mit Reichsapfel
Der Anfang deutscher Geschichte Q1 Kaisersiegel Ottos I: Otto mit Krone, Zepter und Reichsapfel Q2 Kaisersiegel Ottos II.: Otto hält einen Globus in der Hand. Aufgabe 1 Q3 Kaiser Otto III. mit Reichsapfel
ein Wahrzeichen Mühlhausens
 Der Alte Turm ein Wahrzeichen Mühlhausens Der Alte Turm ist ein Relikt der ehemaligen Pfarrkirche St. Vitus in Mühlhausen. Deren Anfänge reichen bis in die Zeit der Romanik im 12. Jahrhundert zurück. Die
Der Alte Turm ein Wahrzeichen Mühlhausens Der Alte Turm ist ein Relikt der ehemaligen Pfarrkirche St. Vitus in Mühlhausen. Deren Anfänge reichen bis in die Zeit der Romanik im 12. Jahrhundert zurück. Die
2. Der Dreißigjährige Krieg:
 2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Seite Vorwort 5 1 Deutschland in den ersten 1½ Jahrzehnten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Seite Vorwort 5 1 Deutschland in den ersten 1½ Jahrzehnten
Der Weg in die Moderne
 Der Weg in die Moderne Begleitbroschüre zur Wanderausstellung 200 Jahre Ulm, Ravensburg, Friedrichshafen und Leutkirch in Württemberg Uwe Schmidt Inhalt 7 8 9 13 21 29 45 57 Vorwort Einleitung Die Gemeindeverwaltung
Der Weg in die Moderne Begleitbroschüre zur Wanderausstellung 200 Jahre Ulm, Ravensburg, Friedrichshafen und Leutkirch in Württemberg Uwe Schmidt Inhalt 7 8 9 13 21 29 45 57 Vorwort Einleitung Die Gemeindeverwaltung
Steinheim a.d. Murr - Kleinbottwar
 (6) (5) (4) (7) (8) (3) (2) (1) (9) Start Steinheim a.d. Murr Seite 1 (1) (2) (3) Seite 2 Wanderung 42 ( 24.01.09 ) (4) (5) Planung: Dokumentation: Hagen Hildenbrand Manfred Schiefers www.manfredschiefers.de
(6) (5) (4) (7) (8) (3) (2) (1) (9) Start Steinheim a.d. Murr Seite 1 (1) (2) (3) Seite 2 Wanderung 42 ( 24.01.09 ) (4) (5) Planung: Dokumentation: Hagen Hildenbrand Manfred Schiefers www.manfredschiefers.de
Übersicht über die Herrscher in der Mark Brandenburg
 Übersicht über die Herrscher in der Mark 1157-1918 1. Herrschaft der Askanier (1157-1320) Die Askanier waren ein in Teilen des heutigen Sachsen-Anhalt ansässiges altes deutsches Adelsgeschlecht, dessen
Übersicht über die Herrscher in der Mark 1157-1918 1. Herrschaft der Askanier (1157-1320) Die Askanier waren ein in Teilen des heutigen Sachsen-Anhalt ansässiges altes deutsches Adelsgeschlecht, dessen
Das Zeitalter Bismarcks Deutschland im 19. Jahrhundert Erzählt von dem Historiker Helmut Rumpler
 Das Zeitalter Bismarcks Deutschland im 19. Jahrhundert Erzählt von dem Historiker Helmut Rumpler Teil 1 5 Ö1 - Betrifft:Geschichte Redaktion: Martin Adel und Robert Weichinger Sendedatum: 12. 16. April
Das Zeitalter Bismarcks Deutschland im 19. Jahrhundert Erzählt von dem Historiker Helmut Rumpler Teil 1 5 Ö1 - Betrifft:Geschichte Redaktion: Martin Adel und Robert Weichinger Sendedatum: 12. 16. April
Ps. 24,3-6 Predigt in Landau, Osternacht Taufe Paul. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
 Ps. 24,3-6 Predigt in Landau, Osternacht 2013 - Taufe Paul Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 3. Wer darf auf des HERRN Berg gehen, und wer darf stehen
Ps. 24,3-6 Predigt in Landau, Osternacht 2013 - Taufe Paul Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 3. Wer darf auf des HERRN Berg gehen, und wer darf stehen
Weimert, Helmut: Heidenheimer Chronik 1618 bis 1648 nach den Quellen des Stadtarchivs
 Weimert, Helmut: Heidenheimer Chronik 1618 bis 1648 nach den Quellen des Stadtarchivs 2012 304 Seiten 19,00 17,00 für Mitglieder Heimat- und Altertumsverein Heidenheim 17,00 für Mitglieder Förderverein
Weimert, Helmut: Heidenheimer Chronik 1618 bis 1648 nach den Quellen des Stadtarchivs 2012 304 Seiten 19,00 17,00 für Mitglieder Heimat- und Altertumsverein Heidenheim 17,00 für Mitglieder Förderverein
#ferdinand Jubiläumsjahr. Eine gemeinsame Initiative von Kultur- und Bildungsinstitutionen
 #ferdinand 2017 Jubiläumsjahr Eine gemeinsame Initiative von Kultur- und Bildungsinstitutionen WWW.FERDINAND2017.AT Tirol steht das ganze Jahr 2017 im Zeichen von Erzherzog Ferdinand II., der vor 450
#ferdinand 2017 Jubiläumsjahr Eine gemeinsame Initiative von Kultur- und Bildungsinstitutionen WWW.FERDINAND2017.AT Tirol steht das ganze Jahr 2017 im Zeichen von Erzherzog Ferdinand II., der vor 450
VORANSICHT. Das Frankenreich die Wiege Europas? Das Wichtigste auf einen Blick. Anja Merz, Zöbingen
 III Mittelalter Beitrag 13 Das Frankenreich (Klasse 6) 1 von 30 Das Frankenreich die Wiege Europas? Anja Merz, Zöbingen ieso ist die Taufe eines Frankenherrschers vor Wüber 1500 Jahren für uns heute noch
III Mittelalter Beitrag 13 Das Frankenreich (Klasse 6) 1 von 30 Das Frankenreich die Wiege Europas? Anja Merz, Zöbingen ieso ist die Taufe eines Frankenherrschers vor Wüber 1500 Jahren für uns heute noch
100 Jahre Fatima. und heller als die Sonne" gewesen.
 100 Jahre Fatima Am 13. Mai 2017 werden es 100 Jahre, dass die drei Kinder Lucia, Francisco und Jacinta im äußersten Westen Europas, in Portugal in einem kleinen Ort Dorf Namens Fatima eine Frau gesehen
100 Jahre Fatima Am 13. Mai 2017 werden es 100 Jahre, dass die drei Kinder Lucia, Francisco und Jacinta im äußersten Westen Europas, in Portugal in einem kleinen Ort Dorf Namens Fatima eine Frau gesehen
Pleidelsheim Beihingen am Neckar Ingersheim
 Wanderung 27 ( 24.05.08 ) (9) Start (1) (8) (2) (3) (5) (7) (6) (4) Altarm des Neckars bei Beihingen Planung: Dokumentation: Hagen Hildenbrand Manfred Schiefers www.manfredschiefers.de Seite 1 Wanderung
Wanderung 27 ( 24.05.08 ) (9) Start (1) (8) (2) (3) (5) (7) (6) (4) Altarm des Neckars bei Beihingen Planung: Dokumentation: Hagen Hildenbrand Manfred Schiefers www.manfredschiefers.de Seite 1 Wanderung
Inhalt. Vorwort... ix
 Inhalt Vorwort... ix Wer hat euch behext?... 1 Das Vorbild des Glaubens... 21 Die Unerbittlichkeit des Gesetzes... 39 Der Gerechte wird aus Glauben leben... 47 Losgekauft vom Fluch des Gesetzes... 59 Was
Inhalt Vorwort... ix Wer hat euch behext?... 1 Das Vorbild des Glaubens... 21 Die Unerbittlichkeit des Gesetzes... 39 Der Gerechte wird aus Glauben leben... 47 Losgekauft vom Fluch des Gesetzes... 59 Was
Der Weise König Salomo
 Bibel für Kinder zeigt: Der Weise König Salomo Text: Edward Hughes Illustration: Lazarus Adaption: Ruth Klassen Auf der Basis des englischen Originaltexts nacherzählt von Markus Schiller Produktion: Bible
Bibel für Kinder zeigt: Der Weise König Salomo Text: Edward Hughes Illustration: Lazarus Adaption: Ruth Klassen Auf der Basis des englischen Originaltexts nacherzählt von Markus Schiller Produktion: Bible
Geschichte der Christenheit
 Kurt Aland Geschichte der Christenheit Band I: Von den Anfängen bis an die Schwelle der Reformation Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn Inhalt Vorwort 9 Die Anfänge der Christenheit 11 I. Die Auseinandersetzung
Kurt Aland Geschichte der Christenheit Band I: Von den Anfängen bis an die Schwelle der Reformation Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn Inhalt Vorwort 9 Die Anfänge der Christenheit 11 I. Die Auseinandersetzung
HGM Hubert Grass Ministries
 HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 1/14 Gott will durch dich wirken Gott möchte dich mit deinen Talenten und Gaben gebrauchen und segnen. Er hat einen Auftrag und einen einzigartigen Plan für dich
HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 1/14 Gott will durch dich wirken Gott möchte dich mit deinen Talenten und Gaben gebrauchen und segnen. Er hat einen Auftrag und einen einzigartigen Plan für dich
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Christkönigsfest in München-Herz-Jesu am 22. November 2015
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Christkönigsfest in München-Herz-Jesu am 22. November 2015 Wir erleben heute Flüchtlingsströme ungeheuren Ausmaßes. Sie kommen zu uns, weil sie
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum Christkönigsfest in München-Herz-Jesu am 22. November 2015 Wir erleben heute Flüchtlingsströme ungeheuren Ausmaßes. Sie kommen zu uns, weil sie
Allerheiligen Heilig sein heilig werden. Allerheiligen Heiligkeit für alle?! Es gibt einige Worte der religiösen Sprache, die für
 Allerheiligen 2007 Heilig sein heilig werden Liebe Schwestern und Brüder, Allerheiligen Heiligkeit für alle?! Es gibt einige Worte der religiösen Sprache, die für manche Christen in einer Schamecke gelandet
Allerheiligen 2007 Heilig sein heilig werden Liebe Schwestern und Brüder, Allerheiligen Heiligkeit für alle?! Es gibt einige Worte der religiösen Sprache, die für manche Christen in einer Schamecke gelandet
25. Sonntag im Jahreskreis A Gerechtigkeit oder: Worauf es ankommt
 25. Sonntag im Jahreskreis A 2017 Gerechtigkeit oder: Worauf es ankommt Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch ungerecht! Das kann Jesus doch nicht so gemeint haben! Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
25. Sonntag im Jahreskreis A 2017 Gerechtigkeit oder: Worauf es ankommt Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch ungerecht! Das kann Jesus doch nicht so gemeint haben! Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Die Dreikönigskirche Bad Bevensen
 Die Dreikönigskirche Bad Bevensen Ein kleiner Kirchenführer Herzlich willkommen in der Dreikönigskirche Bad Bevensen! Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Eindruck macht; sie befinden sich an einem
Die Dreikönigskirche Bad Bevensen Ein kleiner Kirchenführer Herzlich willkommen in der Dreikönigskirche Bad Bevensen! Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Eindruck macht; sie befinden sich an einem
Stadttopographie. Stadtansicht von Mühldorf Aquarell, um 1765
 Stadttopographie Stadtansicht von Mühldorf Aquarell, um 1765 Die Stadt Mühldorf a. Inn ist eine der ältesten Städte Alt bayerns. Der an einem wichtigen Inn über gang gelegene Ort wurde erstmals 935 urkundlich
Stadttopographie Stadtansicht von Mühldorf Aquarell, um 1765 Die Stadt Mühldorf a. Inn ist eine der ältesten Städte Alt bayerns. Der an einem wichtigen Inn über gang gelegene Ort wurde erstmals 935 urkundlich
