Die Täublinge. - Beiträgezu ihrer Kenntnis und Verbreitung (IV)
|
|
|
- Ralph Kästner
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ~ Zeitsehr. f. Pilzkunde Dezember 1975 Die Täublinge. - Beiträgezu ihrer Kenntnis und Verbreitung (IV) Heterophyllae (Fr. emend. Roma~,) Von H. S c h w ö bel Wie die Ingratae (Fg~t~ntinIG + Fellinae) werden die Heterophyllae an die Basis des Russu/a-StammbamnQs verwiesen. S eh a e f f e r s Aussage, daß Foetentinae und Heterophylla.c;~wet parallele Gruppen mit scharfem Hutrand, genabelter Hutrnitte, oft radialer Qberhaut, meist beiderseits ausspitzenden Lamellen, ausspitzendem Stiel und blassem Sporenstaub darstellen, hat auch heute noch Gültigkeit. In beiden Sektionen dominieren mehr oder weniger die als urspriinglich angesehenen Merkmale. Als solche gelten z. B. weißer oder sehr blaß gelber Sporenstaub, schwach ausgebildetes Sporenornament, wenig differenzierte Huthaut, scharfer, nicht geriefter Hutrand, Vorhandensein von Huthautcystiden u. a. m. Gemeinsam ist allen Arten der Heterophyllae milder oder allenfalls leicht schärflicher Geschmack, festes Fleisch, überwiegend gedrungene Gestalt, ausspitzender Stiel, halbkugelig-genabelterhut (fast alle Arten mit ausgeprägtem sog. "vesca-habitus"), das Fehlen lebhaft roter oder orangeroter Farben, weißliche bis cremegelbliche, seltener bis buttergelbe Lamellen und weißer bis :t hellgelber Sporenstaub. Die Sporen sind relativ klein, nur vereinzelt 10 Jlm etwas überschreitend, schwach bis mäßig ornamentiert. Sporen mit langen spitzen Stacheln kommen nicht vor. Die Epikutishyphen sind häufig stark verzweigt und septiert, die einzelne Zelle bei vielen Arten oft bauchig erweitert (Fäßchen- oder Tonnenform) und dadurch nicht selten 5-10 Jlm in die Breite gehend. Die Endzelle oder Hyphen ist dagegen in der Regel wieder schmaler, verlängert - pfriemlieh - zugespitzt. Dermatocystiden nicht septiert, also einzellig, selten fehlend. Rom a g n e s i weist auf ein intrazelluläres, griin- bis blauschwärzliches, festes, relativ großkörniges Huthautpigment hin, das neben einem manchmal vorhandenen vakuolären Pigment bei der Mehrzahl der Arten zu beobachten ist. Die Heterophyllae unterteilt man in mehrere Formenkreise, denen man den Rang von Untersektionen beimessen kann. 1. Heterophyllinae (R. Maire); mit den unkritischen, weißsporigen Arten Russu/a vesca und Russu/a heterophyl/a, sowie der cremesporigen Russula mustelina. Ihr Fleisch verfärbt sich mit 10 % FeS04-Lösung satt fleischrosa bis fast indischrot, mit Anilin (rein oder eine wäßrige Aufschüttelung) vor allem in den Lamellen zitronengelb. Die Dermatocystiden sind atypisch unscheinbar und heben sich von den sie umgebenden Hyphen kaum ab. Sie reagieren mit den Reagenzien auf Sulfo-AIdehyd-Basisnicht oder nur wenig, deshalb auch - so von J. S eh a e f f er - als "Wimpern" definiert. 2. Indolentinae (Melz.-Zv.); hierher gehört der allbekannte Frauentäubling, Russula cyanoxantha, um den sich einige wenig studierte, nahe verwandte Sippen gruppieren,
2 124 die teils als selbständige Arten, teils als Varietäten oder Formen aufgefaßt werden. Die Indolenz des Fleisches gegenüber Eisensulfat ist für alle Formen charakteristisch. Die Huthauthyphen, auch die der Epikutis, sind extrem schmal, ebenso die Dermatocysti. den, die deshalb schwer auszumachen sind. 3. Griseinae (1. Schaeffer); der größte und fraglos auch der schwierigste Formenkreis! Alle Arten haben typische, durch ihre Form und Größe nicht zu übersehende Dermatocystiden, welche sich in Sulfovanillin (S. V.) mehr oder minder intensiv anfarben. Das Sporenpulver ist irgendwie gelblich gefarbt, doch gibt es neuerdings zwei seltene (und noch unvollständig bekannte) Arten mit weißen Sporen, welche aber aufgrund der Huthautmerkmale (große Dermatocystiden) hierher zu stellen sind. Die Eisensulfatreaktion verläuft unterschiedlich von Art zu Art, von fast negativ bis lebhaft positiv. Heterophyllinae, Indolentinae und Griseinae bilden eine sehr natürliche Einheit nahe verwandter Arten. Das wird jedem klar, der eine Russula cyanoxantha,eine Russulll grisea und eine Russulll vesca nebeneinander auf dem Tisch liegen hat. So dürfte es im allgemeinen keine Schwierigkeiten bereiten, "aus der Hand" zu entscheiden, ob ein Täublings-Fruchtkörper zu dieser Gruppierung gehört oder ob er nicht dazu gehört. 4. Virescentinae (Sing.); die wenigen Arten dieser Untersektion rücken von den vorigen weiter ab. Hierher zählen nach Rom ag n e s i: Russulll virescens als monotypische Art und der Formenkreis (Stirps) Russulll amoena mit drei Arten in Mitteleuropa. Russula amoena (sensu lato) ist durch ihren fischartigen, an den des Brätlings,Lactarius volemus, erinnernden Geruch bemerkenswert. Ebenso auffallend sind die bauchiglanzettlichen oder pfriemlichen Cystiden auf Hut- und Stielhaut, an Schneide und Fläche der Laplellen. Gegenüber Sulfovanillin, Sulfobenzaldehyd usw. sind diese unempfindlich und besser nur als Pseudocystiden, oder cystidenähnliche Haare bzw. Wimpern anzusprechen. S c h a e f f ersah in den Oberhautwimpern der Russulll anoenaein Analogon zu der blasig-flaschigenoberschicht der Russulll virescens. Ich stelle den Formenkreis der Russulll grisea voran. Während ich für Nigricantinae und Foetentinae aufgrund eigener Kenntnis eine annähernd vollständige Darstellung der aus Mitteleuropa bekannt gewordenen Arten geben konnte, ist mir Gleiches rur Russula grisea mit ihren verwandten Arten nicht möglich, weil ich von diesen einige (allerdings sehr seltene) nicht, andere nur unvollständig kenne. Trotzdem hoffe ich, einen kleinen, sich vor allem auf die Forschungen von Rom ag n e s i stützenden Beitrag zur Kenntnis dieser sehr diffizilen Gruppe von Täublingen liefern zu können. Die meisten der rund ein Dutzend Arten sind selten, nur wenige, wie Russulll ionochlora und Russulll parazurea werden gebietsweise häufiger angetroffen. Die größte Artendichte ist in den Laubmischwäldern auf kalkreichem Untergrund zu beobachten. Von den 4 Arten, welche S c h a e f f e r in seiner Monographie bildlich dargestellt hat, ist nur seine Russulll basifurcata, die der jetzigen Russula subterfurcata entspricht, ein neutrophiler Pilz. Berlin als Standort war rur die Erforschung gerade dieses Formenkrei. ses denkbar ungünstig. Damit haben sich seit S c h a e f f e r leider auch die rur jede Art gegebenen Verwechslungsmöglichkeitenverdreifacht. Russula ionochlora Romagn. (syn.: Russulll grisea sensu J. Schaeffer; Russulll palumbina var. ionochlora, Moser, Kryptogamenflora 1967) Der Cremeblättrige Bunttäubling, in der volkstümlichen
3 - 125 Pilzliteratur auch unter den Namen Taubentäubling, Papageitäubling, Kleiner Frauentäubling zu finden, ist bei uns durch Julius S c h a e f f e r einem größeren Kreis von Pilzfreunden bekannt geworden. Ich erinnere an die ausgezeichnete Darstellung im Führer für Pilzfreunde, kurz "M ich a e I" genannt, an dessen Neubearbeitung im Jahr 1939 S c h a e f f e r noch mitgewirkt hat. Die damaligen Figuren sind von Bruno H e n n i g in das Handbuch für Pilzfreunde (Band V) übernommen worden, in der Qualität jetzt leider weniger gut. Russula ionochlora ist ein Pilz des kalkarmen, sandig-humosen Laubwaldes. Ein Vorkommen in Nadelwäldern ist"wahrscheinlich, aber gewiß recht selten. Im norddeutschen FlacWand in Rotbuchen- und Eichenbeständen eine der häufigsten Täublings-Arten. "Um Potsdam und Berlin von Juni an besonders unter Buchen sehr häufig" (S c h a e f f er); "Von Juni bis Oktober in Laubwäldern, besonders auf kalkarmem Boden, sehr verbreitet" (N e u hof f). Im Süden der Bundesrepublik dagegen nur da und dort häufiger. Im diluvialen Sand- und Kiesgebiet am Oberrhein in Laubmischwaldungen (z. B. im Stellarieto-Carpinetum und Violeto- Quercetum) ziemlich verbreitet. In der collinen und montanen Stufe (pfälzer Wald, Odenwald, Schwarzwald) dagegen sehr sporadisch, in Kalkgebieten sehr selten, auch für Württemberg und Bayern nachgewiesen(h aas, Ein hell i n ger), aber nicht häufig. Man achte auf den sehr blassen cremegelblichen Sporenstaub (Ha nach der Staubfarbenskala von Rom a g n e s i, etwas satter als B nach deijenigen von S c h a e f f e r bzw. Crawshay), auch mit der Farbe mancher cremegelblicher Margarinesorten vergleichbar, heller als buttergelb. Violette oder fleischrosarote Farbtöne auf dem Hut oder wenigstens unter der Huthaut gestatten fast immer eine sichere Abgrenzung gegen Russula parazurea, J. Schfr., welche nicht selten den Standort mit Russula ionochlora teilt und ein ähnlich blasses Sporenpulver abwirft. Im Zweifelsfall sollte man Sporen und Huthaut überprüfen. Die Sporen der Russula ionochlora sind überwiegend isoliertpunktiert, nur vereinzelt mit kurzen feinen Graten und reihig verschmelzenden Wärzchen. Die der Russula parazurea dagegen sind netzig skulptiert, mit wenigen isoliert stehenden Stachelwärzchen. Charakteristisch für die Huthaut der Russula ionochlora scheint zu sein, daß ein Großteil der Epikutishyphen mehr oder weniger bauchig angeschwollen (bis etwa 10 J..Im)und stark septiert sind, elliptische bis fast rundliche Zellglieder bildend, entfernt an Hefesproßzellen erinnernd (Fig. 1). Als Verwechslungsmöglichkeit kommt insbesondere noch Russula grisea (sensu Romagn. non Schaeffer) in Frage, welche nach den bisherigen Beobachtungen nur auf kalkreichen Lehm- und Tonböden fruktifiziert, unterschieden u. a. durch satter gelben Sporenstaub, lebhafter ornamentierte Sporen und nur ganz vereinzelt geringfügig angeschwolleneepikutishyphen. Russula parazurea J. Schaeffer Wie Russula ionochlora bevorzugt der Blaugrüne Täubling, Russula parazurea, kalkarmen Untergrund. Sie ist vielleicht noch etwas mehr an leichte Sandböden gebunden als jene. Im norddeutschen FlacWand vielerorts häufig, im Südwesten in der Oberrheinebene ziemlich verbreitet, nach Osten rasch seltener werdend, um scwießlich ganz zu fewen. "Den äußersten Westen von Württemberg in Einzelexemplaren gerade noch erreichend" (H aas). In Bayern von A. Ein hell i n ger (München) noch nicht gesehen, müßte im bayrischen Norden aber aufzufinden sein. In den Wäldern der Hardt (südlich und nördlich von Karlsruhe) regelmäßig in Gesellschaft mit Russula amoenolens, pectinatoides sensu Romagn. 1967, vesca, ionochlora, violeipes, emetica var. silvestris, und der bodenvagen chamaeleontina (= lutea sensu Schaeff.). An kalkreiche
4 126 Böden gebundene Arten wie Russula farinipes, anatina, luteotacta, rubra, maculata, alutacea sensu Melz.-Zv. fewen hier stets. Rom a g n e s i beschreibt neben der als weißstielig angesehenen Typus-Art aus dem Laubwald eine forrna dibapha Romagn. aus Kiefernwald mit :!: grau, grauviolettlich getöntem Stiel. Nach meiner Beobachtung haben aber auch Fruchtkörper von reinen Laubholzstandorten grauviolettlich gefärbte Stiele, mit allen Übergängen zu solchen mit rein weißem Stiel. Die Hutfarbe ist, wie deutscher und lateinischer Name zum Ausdruck bringen, blaugriin, graugriin, blaugrau; grüne, blaue und graue Farbtöne stark gemischt und sich überlagernd. S c h a e f f er s Vergleich mit der Farbe von Sturmwolken ist sehr zutreffend. Manche Exemplare zeigen eine dazu kontrastierende bräunliche Eintriibung, in der Regel von der Hutrnitte ausgehend und nur selten bis zum Rand reichend. (S c h a e f fe r: mikado-, verona- bis lividbraun, selbst fleischbräunlich). Die schorfig-rnewige Bereifung ist typisch, kann aber bei älteren Fruchtkörpern fewen oder durch Einwirkung von Regen verlorengehen. Im übrigen verweise ich auf die Literatur, vor allem auf die ausftihrlichedarstellung in Sc h a e f fe r s Monographie. Der Text ist nicht ganz fewerfrei (vgl. Anmerkung zu Russula medullata) und die dazu gehörenden Figuren auf der Tafel IV sind extrem blau, stellen aber unzweifelhaft Russula parazurea dar. Der große, dunkelolivbraun gemalte Fruchtkörper mit der kleinfeldrig aufgesprungenen Huthaut und die Schnittfigur sind gleichfalls uncharakteristisch. Russula grisea (Pers. ex Secr.) Fr., sensu Gill., Romagn. (syn.: Russula palumbina Quel., Moser, Kryptogamenflora; Russula furcata Cooke sensu Melzer-Zvara)Die französischen Autoren verstehen unter Russula grisea eine Art, deren Sporenstaub lebhafter gelb ausfällt als derjenige des Schaefferschen Pilzes gleichen Namens. Diese "französische" Russula grisea hat nach dem Krieg auch Eingang in die deutsche Literatur gefunden. Im ftinften Band des Handbuches für Pilzfreunde ist sie auf Tafel 86 dargestellt. Doch sind die Figuren nicht naturgetreu und für meine Funde unkenntlich. Wer weiß, wie die meisten Täublingsbilder zustande gekommen sind, den wird dies nicht wundernehmen. Ich lasse zunächst eine kurze Beschreibung aufgrund der eigenen Funde folgen. Hut halbkugelig, meist schon friih flach genabelt (vesca-habitus), scwießlichverflachend, zuletzt leicht bis mäßig niedergedriickt, 5-13 cm breit; der Rand ist zuletzt mehr oder minder faltig gerieft. Seine Farbe spielt zwischen violett und olivgrün; die Mitte ockergriinlich bis lebhaft olivgrün, nach dem Rand zu mehr und mehr mit beigemischtem Violett, äußerster Rand überwiegend rein violett. Es kommen aber auch einheitlich violett oder olivgrün gefärbte Fruchtkörper vor. Die violetten aber noch fleckweise mit Spuren von Olivgriin, die grünen mit millimeterbreiter violettlich angehauchter Randzone oder wenigstens unter der abgezogenen Huthaut violettlich. Oberhaut bei Regenwetter schmierig-klebrig, glänzend, rasch trocknend und glanzlos werdend, in bester Entwicklung feinst velutin ("glanzlos überduftet"), nur wenig und oft undeutlich dunkler eingewachsen-faserig, alt oder nach längerem Regen mit verschwindender Velutinität, :!:halb abziehbar, selbst unter griiner Haut meist deutlich violettlich durchgefärbt. L am e 11e n erst blaß creme, scwießlich satt creme mit buttergelbem Schein aus der Tiefe, Schneide manchmal in Hutrandnähe violettlich, gerade oder leicht ausgebuchtet angewachsen, am Stiel etwa die Hälfte gegabelt, spröde, leicht splitternd.
5 I 127 S t i e I überwiegend weiß, doch oft schon am Standort ein wenig stroh-wachsgelblich angelaufen, durch Abgreifen noch deutlicher fleckweise gilbend, seltener da und dort, vereinzelt auf ganzer Länge zart lila überwaschen, gegen die Basis manchmal mit olivgelben, olivgrünen Flecken, die sich am vom Standort entfernten Fruchtkörper noch ausbreiten und satterfarbig werden können; jung fein mehlig-flockig (oft sehr auffallend!), darüber hinaus mehr oder minder zart längsadrig, später :!: verkahlend; zylindrisch, in den Hut etwas erweitert, Basiskurz ausspitzend, 4-8 cm lang, 1,2-3,5 cm dick, fest, jung fast hart. F lei s c h weiß, SchneckenfraßsteIlen am Hut violettlich gefärbt oder mit violettlicher Umrandung, in der Stielbasis öfters rostig, fest und im Hut relativ dickfleischig. Eisensulfat: lebhaft fleischrosa, annähernd so satt wie dasjenige der Russula vesca reagierend. Geruch unbedeutend, Geschmack in den Lamellen vorübergehend etwas schärflich, sonst mild. Sporenstaub creme, in dicker Schicht hell buttergelb, zwischen C und D auf der Skala nach Crawshay, Hc nach Rom a g n e s i. S P 0 ren 6,5-8,5 x 5,5-6,5 11m(Sporenmaße immer ohne die Protuberanzen wiedergegeben), kräftiger und weniger isoliert ornamentiert als die der Russula ionochlora, teils stumpfliche Punkte und Warzen, unter 111m in der Höhe bleibend, vereinzelt mit spitzlichen, 111m in der Höhe erreichenden Stacheln. Protuberanzen ungleich über die Oberfläche der Spore verteilt, häufig reihig oder reihig-gratig zusammenfließend, nur vereinzelt unvollständig netzig verbunden. Lamellencystiden spindelig bis bauchig-spindelig,lanzettlich zugespitzt. Hut hau t (Epikutis) mit Dermatocystiden; diese zylindrisch, ihre Spitze:!: keulig angeschwollen, nur ganz vereinzelt bis kopfig erweitert, 4-10(-14) 11m breit; begleitende Hyphen:!: strauchig verzweigt, häufig septiert, ihre Glieder nur vereinzelt etwas bauchig angeschwollen (nie so ausgeprägt bauchig-elliptische Zellreihen bildend wie bei Russula ionochlora), die Endzelle der Hyphen häufig verlängert, pfriemlich zugespitzt. (Fig. 2) Vor kom m e n: Laubwälder, viel seltener im Nadelwald, aufgrund der bisherigen Beobachtungen in Baden-Württemberg anders als Russula ionochlora nur auf kalkreichen Böden, bei Carpinus (z. B. Wöschbach), Quercus (in Württemberg), in Frankreich vor allem bei Fagus, Juni bis September, nicht häufig. Durchschnittlich größer, fleischiger und dickstieliger als Russula ionochlora, Hut und Stiel entschiedener bereift bzw. mehlig, Lamellen und Sporenstaub satter gelb, Fleisch mit FeS04 lebhafter fleischrosa, Sporen kräftiger ornamentiert, in der Hutfarbe aber sehr an jene erinnernd. Versucht man die Art nach der Kryptogamenflora zu bestimmen, dann wird man wegen der lebhaft violett-olivgrünen Farbe auf Russula ionochlora und nicht auf Russula grisea bzw. palumbina verwiesen, was die Unmöglichkeit beweist, beide Arten aufgrund der Hutfarbe trennen zu wollen. Doch müssen in Frankreich viel weniger lebhaft gefärbte Formen vorkommen: grauviolettlich, stahlgrau, selbst olivschwärzlich. Die in Württemberg gesammelten Fruchtkörper sind ganz ähnlich schön olivgrün bis violett gefärbt, ebenso die von M e I zer und Z v ara - als Russula furcata - aus der Tschechoslowakei beschriebenen. S c h a e f f e r meinte, daß der Name grisea fur einen so schönfarbigen Pilz denkbar unpassend sei (griseus=grau). Dasselbe gilt auch fur die "französische" Russula grisea. Der Name palumbina Quel. (von Ringeltaube, Columba palumbus, wie die Ringeltaube gefärbt) wäre treffender und vielleicht auch eindeutiger gewesen. Ich glaube nicht, daß die var. pictipes Cke. mit
6 128 zwei- bis dreifarbig buntem Stiel eine Existenzberechtigung hat. Diese Varietät wird von B 1u m sogar als selbständige Art aufgefiihrt. Aufgrund eigener Beobachtung habe ich die Meinung, daß diese Abweichung in die Variationsbreite der Art fällt. Eine zunächst nur angedeutete olivgrüne und violette Tönung des Stieles kann sich durch Liegenlassen des Fruchtkörpers an einern kühlen Ort so intensivieren, daß man schließlich die "var." pictipes erhält. Der gleiche Effekt kann wahrscheinlich schon am Standort, etwa durch Besonnung eintreten. G. Kr i e gis te i n e r hat in unserer Zeitschrift (1974, Heft 1-2, Seite 20) auf Russula grisea unter der Bezeichnung Russula "palumbina" aufmerksam gemacht. Der von ihm vorgeschlagene deutsche Name "Eichentäubling" wäre jedoch nicht passend. Das von Kr i e gis t ein er beobachtete frühzeitige Fruktifizieren nur in der Nähe von Eichen mag eine regionale Eigentümlichkeit sein. Auch darf palumbina nicht im Sinne von M e I zer und Z v ara angewandt werden, weil diese tschechischen Autoren unsere Art unzweifelhaft als Russula furcata beschrieben haben. Wir können dies sogar bei S eh a e f f e r nachlesen (Monographie, Seite 92). Hier finden wir auch den Hinweis, daß S eh a e f f e r von Russula furcata ss. Melz.-Zv.keine eigene Vorstellung gehabt hat. Rom ag n es i gibt seiner Verwunderung darüber Ausdruck, daß Sc h a e f fe r die Russula grisea entgangen ist ("il est surprenant que cette espece, assez commune, soit ignoree de J. S c h a e f f er"). Nun, aufgrund der geologischen Verhältnisse muß man vermuten, daß Russula grisea im Raum Berlin fehlt und darüber hinaus fur das norddeutsche Flachland eine Seltenheit sein wird. Die Begleitpilze sind ganz andere als die der Russula ionochlora. In meinem Hauswald, wo Russula grisea im Eichen-Hainbuchen-Rotbuchen-Mischwaldwächst (z. B. im August und September 1969 nach und nach um eine siebenstämmige Hainbuche mehr als 30 Fruchtkörper gezählt), habe ich in der Umgebung der Standorte u. a. notiert: Russula delica, foetens, farinipes, cyanoxantha, vesca, luteotacta, olivacea, alutacea ss. Melz.-Zv., chamaeleontina (= lutea ss. Schff.), maculata, veternosa, cuprea, Lactarius acris, pterosporus, ichoratus ss. Neuh., Inocybe fastigiata, corydalina, atripes, phaeoleuca, später im Jahr Hygrophorus cossus, eburneus, leucophaeus und arbustivus. Russula vesca und chamaeleontina, bis zu einern gewissen Grad auch Russula foetens und cyanoxantha sind bodenvag, alle übrigen erwähnten Täublinge, die Milchlinge, Rißpilze und Schnecklinge sind Kalk- oder wenigstens Lehrnzeiger. Russula medullata Romagn. (syn.: Russula subcompacta Britz. sensu Kühn.-Romagn., Moser-Kryptogamenflora; Singer, Monographie der Gattung Russula (pp?), nec Britz.!) Russula medullata ist wenig bekannt. Das liegt an ihrem sporadischen Vorkommen und an den zahlreichen Verwechslungsmöglichkeiten (mit Russula parazurea, anatina, aeruginea, pseudoaeruginea, selbst mit cyanoxantha). Die Art hat von allen Griseinae den dunkelsten Sporenstaub;:!:E nach der Tafel in der Monographievon S c h a e f f e r, illa bis IIIb nach der Skala von Rom a g n e s i;,,hellocker" wie derjenige der RussuJa e:xalbicans, einmal annähernd an den der Russula curtipes (welche gleichzeitig aussporte) heranreichend, fast F, "mittelocker", jedenfalls dunkler als ein normales Buttergelb. Die Lamellen machen aber die fur eine Griseinae bemerkenswerte Sporenstaubfarbe nicht recht mit, weshalb sich bei älteren Fruchtkörpern bisweilen Sporenhäufchen auf der Lamellenfläche gut sichtbar abheben. Überhaupt färben sich die Lamellen nur zögernd
7 129 ein, bleiben lange creme bis hell buttergelb und zeigen erst spät ein etwas graustichigtriibes Buttergelb - "bleichocker" schreibt S i n ger. Leider werden die Begriffe ockergelb und gelb bzw. buttergelb nicht einheitlich angewandt. Für S c ha e f f er ist generell gelb oder buttergelb die hellere, ocker (oder ockergelb) die dunklere Gelbstufe; bei Rom a g n e s i ist es gerade umgekehrt, ocker die hellere, gelb die dunklere Stufe. Welche Standortsanspriiche Russula medullata stellt, ist mir noch nicht klar. Sicher scheint zu sein, daß man sie besonders in solchen Wäldern antrifft, in denen sich andere Arten der Griseinae seltener einstellen. Meine erste Bekanntschaft mit Russula medullata machte ich vor etwa 20 Jahren bei Rötenbach (Kreis Neustadt) im südlichen Hochschwarzwald. Außerhalb des Waldes hatte man bei einem Feldkreuz zwei Fichten und zwei Zitterpappeln gepflanzt. An dieser Stelle fand ich zwei Fruchtkörper, die auf den ersten Blick wie etwas blaßhütige Russula cyanoxantha aussahen. Die manchmal frappierende Ähnlichkeit mit cyanoxantha-formen hat mir auch Frau M art i, unsere vorzügliche Täublingskennerin aus der benachbarten Schweiz, bestätigt. Gelbe, spröde Lamellen und positive FeS04-Reaktion schlossen aber Russula cyanoxantha rasch aus. Ein Bestimmungsversuch nach der damals eben erschienenen "Flore analytique des champignons superieurs" fiihrte dann richtig zu Russula subcompacta. Schon damals vermutete ich, daß für das Vorkommen an dieser Stelle nicht die Fichten, sondern die Zitterpappeln verantwortlich sein mußten. Dies sollte sich in der Folgezeit bestätigen. Bald gelangen weitere und reichlichere Funde im Pfälzer Wald (anfangs zusammen mit Dr. B ä ß I er); Bad Bergzabern-Pleisweiler,Dimbach und Waldfischbach: Frische, wenig begangene, zum Teil etwas verwilderte Birken-Zitterpappel-Bestände (Bauernwald), nur bei Bergzabern noch andere Baumarten darunter. Am Dimbacher Standort zusammen mit der kleinen Russula pelargonia. Zuletzt (1974) im südlichen Hochschwarzwald (Feldberg - Titisee) von Familie Lab e r gefunden, ohne daß die Standortsverhältnisse bekannt wären. Nach Rom ag n e si in Frankreich nicht selten gefunden und hauptsächlich bei Birke, ferner bei Haselnuß, Pappel, Esche, Edelkastanie, Eiche und Rotbuche. Nachfolgend die Notizen, welche ich mir von den Aufsammlungen aus der Pfalz und dem Schwarzwald gemacht habe. Hut graugriin wie Russula parazurea, olivgrau, (so bisweilen wie Russula anatina), stahlblau bis stahlgrau, selten fast oliv- bis lauchgriin und dann evtl. mit Russula aeruginea und Russula pseudoaeruginea zu verwechseln, besonders die Mitte ~it fleisch-rosalichen oder lilabräunlichen Eintriibungen (aber nie lebhaft violett wie Russula grisea und Russula ionochlora), insgesamt aufhellend, blaßfarbigen Formen der Russula cyanoxantha sehr ähnlich; die Mitte manchmal bis ocker-fleischfarbenblaß entfärbend, graugriine, stahlblaue usw. Farbtöne auf der Randzone des Hutes lange erhalten bleibend, selten einmal ganz fleischfarbenblaß werdend (an eine ausgebleichte Russula vesca erinnernd), aber nie wirklich albinotisch beobachtet. - Oberhaut bei Regenwetter schmierig, trocken noch lang :t glänzend (nicht velutin und auffallend glanzlos werdend wie Russula anatina, nie bereift beobachtet wie Russula parazurea), manchmal kaum, manchmal deutlich dunkler eingewachsen- radialfaserig, sonst kahl und glatt; Rand erst mäßig scharf, schließlich mäßig rundrandig, alt :t faltig gerieft; die Oberhaut läßt sich etwa halb abziehen, mehr oder minder deutlich in der Farbe des Hutes durchgefärbt (nie lebhaft violett wie bei Russula grisea). Fruchtkörper bis gut mittelgroß, 5-13 cm breit. L a m e 11e n spröd, leicht splitternd, schmal sichelig, schließlich breiter und bei zuletzt vertiefter Hutform auch bauchig, bis max. 1,5 cm breit, am Stiel :t stark gegabelt, vereinzelt löcherig, angewachsen bis schwach herablaufend, cremeweißlich, schließlich
8 130 elfenbeingelblich bis hell buttergelb, alt trüb buttergelblich, "bleichocker" (S in ger), aus der Lamellentiefe mit hellockerlichem Schein, durch die Sporen bisweilen dunkler bestäubt. S t i e I oft kräftig, 4-10 cm lang, 1,2-3,5 cm dick, :t zylindrisch, in den Hut in der Regel etwas erweitert, stets weiß, die Basis manchmal rostfleckig, zart längsadrig, kahl oder etwas mewig-flockig,fest, scwießlichweicher. F lei s eh rein weiß (Schneckenfraßstellen nicht violett), im Hut relativ fleischig, mit FeS04-Lösung positiv fleischrosa, etwa wie bei Russula ionochlora, oder auch etwas blasser wie Russula parazurea verfärbend, mit Guajak-Tinktur nach wenigen Sekunden positiv, aber nicht sehr kräftig, mehr blaugrün als blau. Geruch unbedeutend, obst- bis holzartig; Geschmack mild, junge Lamellen manchmal für Sekunden schärflich. S p 0 ren s tau b,,hellocker", etwa E nach C r a w s h a y, wie Russula exalbicans, Russula nitida, lila oder bis IIIc nach Rom a g n e s i. S P 0 ren 6-8,5 x 5,5-6,5 J.1.m,rundlich bis fast länglich, selbst ausgesprochen länglich (z. B. 8,3 x 6 J.1.m),mit isolierten stumpflichen Stachelwärzchen (vereinzelt bis 0,6 J.1.m hoch), über die Oberfläche der Spore relativ gleichmäßig verteilt, nur selten mit geschwänzten oder reihig zusammenfließenden Wärzchen. C y s t i den der Lamellen cylindrisch, etwas bauchig, ihre Spitze überwiegend mit kleinem, scharf abgesetztem Schnabel oder Knopf. Dermatocystiden kleiner als bei voriger Art, kaum einmal 10 J.1.min der Breite erreichend, in der Regel 3,5-7 J.1.mbreit, zylindrisch, schwach keulig, ein Großteil mehr oder minder griffelig zugespitzt. Epikutishyphen vielleicht etwas auffallender strauchig bis korallenartig verzweigt als bei den übrigen Arten, oft septiert, ihre Einzelglieder kurzzylindrisch, seltener und dann meist nicht besonders auffallend bauchig angeschwollen, Endzelle oft verlängert, vereinzelt mit polymorphen Zellen (mit in Form und Größe variablen Auswüchsen - Fig. 3). Jüngere und dann zumeist noch satterfarbige Exemplare können - wie ich das wiederholt beobachtet habe - Russula parazurea sehr ähnlich sehen. Russula parazurea hat jedoch viel helleren Sporenstaub, deutlicher gratig-netzige Sporen, meistens, wenn auch nicht völlig konstant, bereiften Hut und gewöhnlich auch anderen Standort. Ich bin davon überzeugt, daß Julius S c h a e f f e r Russula medullata in der Hand gehabt und mit seiner Russula parazurea vermengt hat. Seine Bemerkungen (Seite 89) zu Russula parazurea "... Lamellen... eirunalnach längeremtransport fast ocker..."; "... Sporenstaub einmal aus Upsala fast E erreichend"; "... ja ihre Lamellen- und Staubfarbe, die (auf langer Reise?) fast ockerfarbige Tönung annehmen zu können scheint" sind nur auf Russula medullata zu deuten. Russula anatina, welche in der Hutfarbe bisweilen der Russula medullata nahekommen kann, unterscheidet sich durch auffallend glanzlosen, wenigstens teilweise punktiert-samtigen oder selbst körnig-grindigen Hut, negative oder schwach positive FeS04-Reaktion, voluminösere Dermatocystiden und Epikutishyphen, helleren Sporenstaub und wahrscheinlich auch durch anderen Standort (unter Eiche auf Kalkboden). Russula grisea und Russula ionochlora sind wow immer lebhafter olivgrün-gelbgrün-violettgefärbt, Sporenstaub heller, besonders derjenige der Russula ionochlora. Russula aeruginea ist reiner olive, gelb- bis grasgrün, Sporen nicht so klar isoliert bestachelt, Geschmack in den Lamellen wow immer schwach scharf; Russula pseudoaeruginea hat gratige bis partiell netzige Sporen und breitere z. T. kurzgliedrig-bauchigeepikutishyphen. Für alle Arten, welche als Verwechslungsmöglichkeit in Frage kommen können, ist ein mehr oder weniger heller gelb
9 131 gefarbter Sporenstaub anzunehmen. Man lasse deshalb vermeintliche Funde von Russu/a medul/ata auf jeden Fall aussporen. Zu empfehlen ist, sich von anderen Arten der Griseinae Staubproben bereitzuhalten (möglichst alljährlich erneuern), um so zu einer besseren Beurteilung zu gelangen. Die etwas länglichen Sporen mit ihren (fast) isoliert stehenden, kräftigen, stumpflichen Wärzchen können die Bestimmung weiter absichern. Russulagalochroa Fr. (sensu Lange, Kühn.-Romagn., Romagn.) Konstant blasse, ja farblose Arten sind zumindest für die europäischen Eurussulae ungewöhnlich. Fruchtkörper mit weißlichem Hut findet man nicht gerade selten, doch handelt es sich in fast allen Fällen um Bläßlinge von normalerweise gefärbten Arten. Dagegen ist der farblos-blasse Hut für Russu/a galochroa kennzeichnend. In Wäldern, in denen zu gleicher Zeit der Pfeffermilchling fruktifiziert, kann man an Russu/a galochroa als vermeintlichem Pfeffermilchling vorübergehen. In Größe und Habitus stimmt Russu/a galochroa mit Russu/a vesca und den meisten Arten aus der grisea-verwandtschaft überein. - Hut jung halbkugelig mit wenigstens angedeuteter Depression, schließlich genabelt - flach bis j: trichterig, mittelgroß, 4-8 cm breit. Die einzigen "Farbtupfer" auf dem Hut sind dann und wann kleine Rostflecke, ansonsten ist der Hut milchweiß, elfenbeinweiß gefarbt. Ältere, besonnte oder schon längere Zeit vom Standort entfernte Fruchtkörper zeignen eine meist nur fleckweise fleischockerliche oder grauockerliche Trübung, welche aber an dem farblosen Gesamteindruck des Hutes nichts zu ändern vermag. Eintrocknend verfärbt sich der Hut elfenbeingelblich, strohgelblich, die Mitte auch bis blaß semmelockergelb. Die Exsikkate erinnern so an Russu/a [arinipes. Oberhaut schließlich matt oder schwach glänzend, nur im Bereich evtl. vorhandener Rostflecke manchmal etwas körnig aufgelöst, sonst kahl und glatt, kaum eingewachsen-faserig,vereinzelt schwach erhaben radialadrig (Lupe), nicht feinst velutin oder gar körnig samtig wie Russula subterfurcata und insbesondere wie Russu/a anatina. Hutrand scharf bis mäßig scharf, zuletzt faltig gerieft. Die L am e 11e n sind cremegelb, etwas satter als die der Russu/a ionochlora, schließlich satt creme, kaum bis hell buttergelb, eintrocknend oder an verletzten Stellen etwas gilbend, am Stiel j: gegabelt. Der S t i e 1 bleibt im allgemeinenkürzer, als der Hut in der Breite mißt, stets weiß, zart längsadrig, in den Hut geringfügigerweitert. Nur die Lamellen schmecken für einige Sekunden schärflich, das weiße F 1eis c h reagiert mit FeS04 mittelmäßig positiv. Nach Rom a g n e s i unbedeutend riechend, während mir ein angenehmer, mehr zedernholz- als obstartiger Geruch aufgefallen ist, an Russu/a lepida oder Russu/a macu/ata erinnernd. S p 0 ren s tau b satt creme bis hell buttergelb, knapp D nach der Skala von C r a w s h a y, 11c bis 11d nach Rom a g n e s i. S P 0 ren ca. 6-8 x 5-6,5 p.m, rundlich bis breitelliptisch, mit Protuberanzen unterschiedlichen Ausmaßes (punkte, Warzen, stumpfliche Stacheln, auch letztere kaum 1p.m in der Höhe erreichend), überwiegend isoliert stehend, bisweilen geschwänzt, auch einmal durch eine feine Linie verbunden, aber nicht partiell netzig, manchmal in undeutlichen Reihen. Der m at 0 c y s ti den sind reichlich vorhanden, z. T. punkt artig gehäuft, überwiegend kurz, in der Form mäßig variabel, zylindrisch, keulig verbreitert, an der Spitze abgerundet, auch griffelig zugespitzt, auch mit aufgesetztem schmalen Spitzchen oder kleinem Knopf. E pik u t i s h y p h e n etwas weniger voluminös und septiert beobachtet als von Romagnesi, mehr vereinzelt breitellpitisch-rundlich, 3-9 p.m breit (Fig. 5). Vor kom m e n: Sehr zerstreut und oft nur einzeln in Laubmischwäldern,gem ent-
10 132 lang der Wege oder am Waldrand, bisher von mir nur auf kalkreichen Böden gefunden. Mit Arten wie Russula ionoehlora, grisea, medullata, aeruginea nicht zu verwechseln, auch kaum mit Russula anatina, die, wenn einmal atypisch hell, doch nie so farblos-blaß ist und dann gewöhnlich kräftig nachdunkelt - um so leichter jedoch mit Russula subterfureata (siehe dort). La n g e, Flora Agaricina Danica, Tafel 188 A, möchte ich als eine gute Darstellung dieser weißhütigen Art empfehlen. Nach La n g e mit gelblich getöntem Sporenstaub, deshalb gewiß kein Albino von Russula vesea. Russula anatina Romagn. Hut halbkugelig-verflachend, schon frühzeitig mehr oder minder flach genabelt, alt schalig vertieft oder seicht trichterig, 4-10-(13) cm breit; Hutrand zunächst glatt, schließlich faltig gerieft und zuletzt auch schwach höckerig gerippt, eine knapp 1 mm breite Randzone - wie bei Russula vesea - nicht selten von der Huthaut entblößt. Die Grundfarbe ist ein helles oder helleres Lehmbraun, Lehmgrau, Grauocker, darauf die verschiedensten dunkleren Abtönungen nach olivgrau, olivrußig, stahlgrau, grüriiichgrau, selbst etwas fleischviolettlich, oft fleckig, wobei dunklere und hellere Partien unscharf ineinander übergehen, generell die Randpartie des Hutes dunkler als die bis zu strohgelblich und ockergraulich aufhellende Mitte. Oberhaut bei nasser Witterung klebrig und :!: glänzend, trocknend stets auffallend glanzlos-matt werdend. Jetzt wird eine schon mit bloßem Auge feine dunklere Punktierung sichtbar, welche sich bis zur körnig-grindigen Auflösung der Epikutis steigern kann. Dem Hut wird dadurch ein leicht samtiges Aussehen verliehen (wie Russula amoena, violeipes, oder wie manche Arten mit Primordialhyphen, etwa Russula lilaeea oder Russula turez); nicht dunkler eingewachsen-faserig,wie das fur die Oberhäute vieler Heterophyllae mehr oder minder bezeichnend ist; etwa halb abziehbar, nicht oder nur wenig in der Farbe des Hutes durchgefarbt. L a m e 11e n blaßcreme, creme, alt auch buttergelblich oder wenigstens mit buttergelbem Schein aus der Tiefe, spröde, am Stiel öfters gegabelt, sonst ohne besonders hervorhebenswerte Merkmale. S ti e cm lang, 1-2,2(-3) cm dick, insgesamt zylindrisch, in den Hut in der Regel etwas trichterig erweitert, nach der Basis ausspitzend, fest, fast hart, schließlich berindet-schwammig, das Innere porös, feinaderig, nicht oder nur wenig mehlig-flockig, rein weiß, durch Abgreifen etwas gelblich oder bräunlich fleckend, an der Basis häufig mit Rostflecken. F 1eis c h weiß, im Bereich der Lamellen vorübergehend leicht schärflich, selten (ganz junge Fruchtkörper) auch im Hutfleisch fur Sekunden schärflich; Geruch unbedeutend, vielleicht etwas obst- bis gebäckartig. Reaktion mit Eisensulfat nicht ganz einheitlich, $eltener fast völlig negativ, überwiegend positiv, aber sehr blaß und zögernd einsetzend, karottengelblich bis blaß rosalich auf der Stielhaut, im Stiel- und Hutfleisch oft etwas deutlicher rosa, mit Guajak positiv nach wenigen Sekunden, z. B. auf der Stielrinde nicht sehr satt blaugrün,im Stielfleisch mehr grünlichblau. S p 0 ren s tau b hell buttergelb, D oder wenig heller nach der Skala von C r a w- s h a y -S c h a e f f e r, 11c-d nach derjenigen von Rom ag n e s i.
11 133 S p 0 ren rundlich, breitelliptisch, ca. 6-7,5 x 5-6,5 11m,mit Punkten, Warzen, seltener mit kurzen, 111m in der Höhe nicht erreichenden spitzlichen Stacheln, etwas variabel von Population zu Population. Alle Protuberanzen isoliert stehend, z. T. unvollständig amyloid. e y s t i den der Lamellen meist spindelig-bauchig, überwiegend mit kleinem gut abgesetztem Kopf und (oder) Schnabel an der Spitze. Dermatocystiden ziemlich groß und auffallend, zylindrisch, zylindrisch-keulig, recht häufig oder sogar überwiegend gegen die Spitze verschmälert oder noch stärker griffelig zugespitzt, auch mit :t gut abgesetztem spateiförmigem Knopf, häufig mehr im oberen Drittel etwas bauchig aufgetrieben und dann mbreit. Auch die Epikutishyphen sind groß bzw. relativ breit ( m),kürzer oder länger elliptisch bis zylindrisch, die Zellglieder manchmal bauchig angeschwollen, ein Teil der Endzellen verlängert und dann weniger breit, nicht selten mit Neigung zu Auswüchsen(polymorph) - Fig. 4. Vor kom me n: Im Laubwald, wahrscheinlich nur bei Eichen, auf kalkreichen Böden, in einzelnen Jahren nicht selten, dann wieder über mehrere Jahre fast ausbleibend. Jahrelang hatte ich vergeblich nach Russu/a anatina Ausschau gehalten. Unter Eichen heißt es in der Flore analytique. Einige Male glaubte ich sie gefunden zu haben. Doch die ÜberpIÜfung offenbarte immer nur untypische Formen von Russu/a parazurea oder Russu/a ionochlora. Erst viel später kam ich dahinter, daß ich zwar unter den richtigen Bäumen, aber in den falschen Wäldern, nämlich in den sandig-kalkarmen Wäldern auf der Rheinniederterrasse nach Russu/a anatina gesucht hatte. Im Juli 1963 fand ich schließlich die ersten "echten" Fruchtkörper in meinem Wöschbacher Hauswald. Bis in den September hinein kamen noch viele weitere hinzu. So reichlich wie in dem ausnehmend guten Pilzjahr 1963 habe ich Russu/a anatina später nicht mehr gesehen. Am 10. Juli 1971 fanden wir hier zusammen mit H. Rom ag n e si trotz Hitze und Trockenheit zwei schöne Fruchtkörper. Auffallend glanzlos werdender Hut, mehr oder minder samtig-körnig auflösende Epikutis (was gewiß bis zu einem gewissen Grad auf die bemerkenswert breiten, zum Teil kurzgliedrigen oder polymorph-rundlichen Epikutishyphen bzw. -zellen zuiückgeflihrt werden kann), schwächste FeS04-Reaktion und isoliert bestachelte Sporen legen die Art gut fest. Russu/a parazurea hat wesentlich helleren Sporenstaub, gratig-netzige Sporen, schmälere Epikutishyphen, entschiedener positive FeS04-Reaktion, anderen Standort (zwar bei Eiche, aber nicht auf Kalkboden) und gewöhnlich auch anders und satter gefärbten Hut. Russu/a ionochlora und Russu/a grisea sind viel lebhafter fleischrosa-violett-olivgrün gefärbt, Russu/a ionochlora hat blassesten Sporenstaub und anderen Standort, das Fleisch von Russu/a grisea reagiert mit Eisensulfat sehr lebhaft fleischrosarot. Russu/a medul/ata sport noch satter gelb ab und bekommt nie die glanzlos-samtigehuthaut, Epikutishyphen und Dermatocystiden durchschnittlich kleiner bzw. schmäler, oft auch anderer Standort (im Bereich von Birke und Zitterpappel). Russu/a galochroa ist weißoder fast weißhütig. Albinotische Formen von Russu/a anatina (unter Laubstreu versteckte Fruchtkörper) dunkeln im Verlauf von ein bis zwei Tagen nach. Auch Russu/a aeruginea und Russu/a pseudoaeruginea haben glatte Huthaut und sind viel reiner grün gefärbt, erstere mit schmalen Epikutishyphen und Dermatocystiden, wohl immer auch mit anderen Begleitbäumen (Birke u. Nadelholz), letztere mit gratigen bis gratig-netzigen Sporen. Am leichtesten dürfte Russu/a anatina mit der folgenden, mir leider nicht genügend bekannten Art zu verwechseln sein, die deshalb zu vergleichen ist...
12 134 RussuIa subterfurcata Romagn. (syn.: Russula basifurcata sensu J. Schaeffer, Moser-Kryptogamenflora1;Russula grisea var. basifurcata sensu Kühn.-Romagn.) Was die Hutfarbe und die Beschaffenheit der Huthaut anbelangt, steht Russula subterfurcata zwischen Russula galochroa und Russula anatina; nicht so farblos und nicht so glatt wie jene, aber blaßhütiger und nicht so samtig-feingrindigals diese. Gäbe es diese Russula subterfurcata nicht, wären Russula galochroa und Russula anatina ziemlich unproblematisch zu bestimmende Arten. Blasse Formen sind von Russula galochroa nicht ohne weiteres zu unterscheiden. Immerhin scheinen solche Bläßlinge nachzufärben, wenn man sie einige Zeit liegen läßt. Exsikkate zeigen eine olivockerliche, messingockerliche Hutfarbe (fast wie eine olivstichige Russula ochroleuca) und nicht die rein strohockerblassen Farbtöne, wie sie rur die Exsikkate der Russula galochroa charakteristisch zu sein scheinen. Nach S c h a e f f e rund Rom ag n e s i ohne besonderen Geruch, während mir wiederholt ein leicht zedernholzartiger Geruch aufgefallen ist, den ich auch rur Russula galochroa notiert habe. Der Hut ist :I: strohockerblaß (in der Mitte), nach dem Rand fleischviolettlich, olivlich, leichtest graurußig oder graugelblich überwaschen; alle Farben sehr blaß und ineinanderfließend, manchmal hellere und dunklere Partien abwechselnd, kaum einmal wirklich farblos, zumindest ältere oder einige Zeit vom Standort entfernt gewesene Fruchtkörper deutlich gefärbt. Der Vergleich mit einer ausgebleichten Russula vesca kann durchaus zutreffend sein, der Rand kann von der Huthaut entblößt sein, Größe und Haltung entsprechen gleichfalls einer Russula vesca. Die Oberhaut bzw. Epikutis ist teils glatt (so in der Mitte), teils sehr fein mehlig-körnig aufgelöst, oft kaum angedeutet (am sichersten mit einer Lupe an etwas lebhafter gefärbten Exemplaren zu diagnostizieren), wie Russula anatina bald trocken und glanzlos werdend. Lamellen blaß, schließlich satt creme, kaum die Stufe hell buttergelb erreichend, am Stiel mäßig bis stark gegabelt, auch in einer Entfernung von einigen Millimetern vom Stiel noch öfters gabelig, ganz vereinzelt auch einmal löcherig im Bereich von wenigen Lamellen. Der stets weiße Stiel bietet keine Merkmale, welche der besonderen Erwähnung bedürften. Das Fleisch reagiert mit Eisensulfat normal, wenn auch nicht lebhaft, fleischrosa-blaß, lang so bleibend, erst spät mit olivlicher Eintrübung. Sporenstaub satt creme, nicht ganz D nach der Staubfarbenskala nach er a w s ha y. S c h a e f f er, 11c nach derjenigenvon Romagnesi. Sporen (nach Rom a g ne s i-von mir noch wenig untersucht) überwiegend klein, ca. 5,5-7(-8) x 5-6 p.m, mit von Population zu Population variabler und ziemlich polymorpher Skulpturierung; teils mit isolierten Punkten, Warzen und kleinen Stacheln, teils - so häufiger - diese durch feinere oder gröbere Grate verbunden, die größeren Protuberanzen auch hin und wieder kommaförmig geschwänzt. Punkte und Warzen gern reihig angeordnet und reihig miteinander verschmelzend. Die Huthautstruktur stimmt weitgehend mit derjenigen der Russula anatina überein, vor allem die Epikutishyphen sind kaum wirklich verschieden, nur Dermatocystiden durchschnittlich weniger voluminös (Fig. 6). Russula subterfurcata ist Laubwaldbewohner und nach den bisherigen Beobachtungen nur auf kalkhaltigen Böden zu finden. Im Verlauf der erwähnten Exkursion mit Rom ag n es i am 10. Juli 1971 ein einzelner Fruchtkörper gefunden. "Peck sensu Lange" ist zu streichen und durch "sensu Schaeffer" zu ersetzen
13 135 Von Russukzgalochroadurch den in der Regeldeutlich,wenn auch sehr blaß gefärbten Hut zu unterscheiden; des weiteren durch die mehr oder minder - gegen den Hutrand zu - sehr feinkörnig-mehlig auflösende Epikutis, wahrscheinlich durchschnittlich breitere Epikutishyphen, sowie durch die partiell gratigen Sporen. - Insgesamt etwas dürftige Unterscheidungsmerkmale, und man wünschte sich, daß weitere aufgefunden würden. Russukz anatina unterscheidet sich durch lebhafter gefärbten Hut, schwächste FeS04-Reaktion, stärker körnig-grindig auflösende Epikutis und vor allem durch die isoliert-warzigen Sporen. Der Komplex galochroa - subterfurcata - anatina bedarf noch eines gründlichen Studiums. Die nordamerikanische Russukz basifurcata Peck würde nach der Originalbeschreibung des Autors fast widerspruchslos auf unsere Funde passen. (,,Pileus dingy-white, sometimes tinged with yellow or reddish-yellow...; lamellae... many of them forked near the base..., white, becoming yellowish...") Doch die Beschreibung ist - der damaligen Zeit entsprechend - zu wenigsagend, weder beweisbar noch widerlegbar. J. E. La n geglaubte, Russukz basifurcata in Dänemark gefunden zu haben. Ein ziemlich großer, weißer, auf Hut und Stiel grauender Pilz, nach La n ge unter Rotbuche und Kiefer auf sandigem Boden. Diese Russukz basifurcata sensu Lange ist bis heute nicht geklärt, und ihre Identität mit der nordamerikanischen Art ist höchst zweifelhaft. S c h a e f f e r wiederum glaubte, seine blaßhütigen und gelblichsporigen Funde mit der La n g eschen Russukz basifurcata identifizieren zu dürfen, was sich inzwischen als falsch herausgestellt hat. Rom ag n es i hält es deshalb fur vernünftig, den Namen basifurcata für eine europäische Art aufzugeben. S c h a e f f e r s Aquarelle (Monographie, Tafel IV, 15 a) sind in der Qualität nur mäßig, zu grünstichig, aber doch kenntlich. Seine Beschreibung nach den in Dänemark zusammen mit M ö 11e r gesammelten Fruchtkörpern schließt nach meiner Meinung Russukz anatina und auch Russukz galochroa aus. Vor allem die Bemerkungen, welche er zu den Sporen gemacht hat (punktiert-kleinwarzig, Punkte wohl immer mit feinen Ausläufern oder mit kürzeren unklar verschmelzenden Reihchen, recht häufig auch mit längeren und selbst verzweigten domzweigartigen Reihen und Graten) läßt eigentlich nur die Deutung auf Russukz subterfurcata zu. Ob auch seine späteren Funde aus Bayern immer zur gleichen Art gehörten, sei dahingestellt. Neuerdings von A. Ein hell i n ger in der Nähe von München gefunden, und früher wiederholt in Württemberg beobachtet. Russula aeruginea Lindbl. ex Fr. Der Grasgrüne Täubling ist die am längsten und besten bekannte hierher gehörende Art, fur die es viele Beschreibungen und Abbildungen gibt. In der näheren und weiteren Umgebung von Karlsruhe merkwürdigerweise eine Rarität, auch in Birkenwäldern nur selten einmal. Man achte auf den einfarbig grasgrünen, gelblichgrünen oder hell olivgrünen Hut und auf die glatte, auch trocken noch :!: glänzende Huthaut. Als Begleitbaum kommt in erster Linie die Birke in Frage, seltener sind Vorkommen bei Kiefer und Fichte. Am Standort der Russukz medulkzta bei Bergzabern-Pleisweiler (pfälzer Wald) fanden wir gleichzeitig Russukz aeruginea, welche sich durch ihre hell grasgrünen bis olivlich-gelbgrünenhüte von denen der Russukz medulkzta leicht auseinander sehen ließen. Sporenpulver :!: D, heller gelb als das der Russukz medulkzta, Sporen teils mit isolierten, teils mit durch feine Anastomosen verbundenen Stacheln. Dermatocystiden schlank, schmal, zylindrisch-spindelig, z. T. mit :!:kopfig abgesetzter
14 136 Spitze, +-5, vereinzelt bis gegen 7 Ilm breit. Epikutishyphen gleichfalls schmal, kaum 4 Ilm in der Breite überschreitend, weniger septiert, elliptisch-zylindrischbis zylindrischfädig, nicht oder nur ganz vereinzelt etwas bauchig erweitert (Fig. 7). Dies festzustellen kann unter Umständen wichtig sein, weil leider auch Russula aeruginea "Nachwuchs" bekommen hat, nämlich Russula stenotricha Romagn. und Russula pseudoaeruginea Romagn. Erstere ist mir unbekannt und v~rmutlich selten (2 Funde in Frankreich). Epikutishyphen ähnlich denen der Russula aeruginea, aber Dermatocystiden abweichend, relativ kurz und breit, zylindrisch-keulig, wie diejenigen der folgenden Art, soll ansonsten sehr an Russula aeruginea erinnern. Russula pseudoaemginea Romagn. Diese Art scheint etwas häufiger als Russula stenotricha vorzukommen. Am 28. Juni 1971 glaube ich 5 Exemplare in einem Wäldchen bei einem Autobahnrastplatz nördlich von Riegel (Kaiserstuhl) gefunden zu haben. Die Möglichkeit, mich mit diesem Fund zu beschäftigen, hatte ich nicht. Im August 1972 fand ich einen Fruchtkörper in meinem Hauswald, der zunächst wie eine Russula aeruginea aussah. Doch der Standort ließ Zweifel aufkommen: Waldwegrand mit Vincetoxicum officinale und Helleborus foetidus, Eiche, Rot- und Hainbuche, keine Birke und keine Nadelliölzer. Die alsbald vorgenommene Untersuchung der Huthaut offenbarte ein, verglichen mit Russula aeruginea, sehr abweichendes Bild: Breite und überwiegend kurz-keulige Huthautcystiden, sowie kurzgliedpge, bauchig angeschwollene Epikutishyphen, wie sie fiir mehrere Arten der Griseinae recht charakteristisch sind. Zu diesem einen Exemplar habe ich mir ein paar Notizen gemacht, die ich hier wiedergebe. Hut fast flach, die Mitte leicht genabelt, Rand etwas gewölbt, an drei Stellen lappig eingeschnitten, dadurch mit unregelmäßigem Umfang, fast difform, 6 cm breit; Rand schwach höckerig gerieft, darüber hinaus bis fast zur Mitte sehr zart strahlig geadert (Lupe), ansonsten kahl und glänzend; blaß grasgrün, die Mitte mehr ockerlichgrün, das Grün durch beigemischtes Grau etwas abgestumpft, nirgendwö mit rosalichen oder violettlichen Tönen, auch nicht unter der Huthaut. La m e 11e n fast buttergelb, jung vermutlich blaßcreme, zumindest mit buttergelbem Schein aus der Tiefe, relativ sattfarbig, vorübergehend minimal schärflich schmeckend. S t i e I kurz, weiß, an der Basis mit kleinen Rostflecken, die Spitze schwach mehlig bereift, etwas glänzend. F lei s c h weiß, minimal gilbend, mild, kaum riechend, mit FeS04 blaß fleischrosa, weit weniger lebhaft als d~jenige der Ru~sulagr:iseareagierend. S p 0 ren pul ver hell buttergelb, etwa D nach C r a w s h a y -S c h a e f fe r, 11c oder 11d nach Rom a g n e s i. S P 0 ren rundlich bis breitelliptisch, 6,5-8 x 5-7 Ilm, mit relativ kräftigen, stumpflich-halbkugeligen Warzen, vereinzelt Illm in der Höhe erreichend, teils isoliert stehend, mitunter kurz geschwänzt, teils durch Grate miteinander verbunden, mehr vereinzelt bis zu unvollständig netzig-gratig. Der m a t 0 c Ys t i den variabel, die längeren :t zylindrisch-spindelig, die kürzeren und dann oft breiteren länger oder kürzer zylindrisch-keulig(z. B Ilm lang), zum Teil an Spitze aus keuliger Verbreiterung wieder kurz griffelig verschmälert
15 J 137 (projektilförmig oder wie ein Suppositorium), vereinzelt bis gegen 10 pm breit. Epikutishyphen :!: stark septiert, Hyphenglieder :!:bauchig angeschwollen (reichlich typische Fäßchenform vorhanden), bei einem Teil der Hyphen die Enzelle stark verlängert und pfriemlich verschmälert; 2,5-7(-11) pm breit (Fig. 8). Russu/a pseudoaeruginea wird sich wahrscheinlich als Kalkzeiger erweisen. Nach R 0- mag n es i in Frankreich auf:!: kalkreichen Böden mit Orchis purpurea und Listera ovata. Ihre Hutfarbe variiert stärker, als dies in meiner Beschreibung aufgrund eines einzelnen Fruchtkörpers zum Ausdruck gekommen ist. Nach Rom ag n e s i kann die Hutmitte wie bei blasser Russula vesca ockerlich-fleischbräunlich gefarbt sein, auch schmutziger graugrün wie Russu/a anatina oder Russu/a medul/ata, welche. sich aber durch die isoliert bestachelten Sporen unterscheiden; Russu/a anatina ist zudem durch glanzlose, fast samtige oder selbst grindige Huthaut charakterisiert. Grüne Formen der Russu/a grisea sind (soweit ich das beobachten konnte) wenigstens am Rand unter der Huthaut violett gefarbt, Stiel und Hut (wenn typisch) entschiedener bereift, Fleisch mit FeS04 lebhafter reagierend, Huthautelemente abweichend. Russu/a ionochlora und Russu/a parazurea haben heller gelben Sporenstaub und wohl auch anderen Standort. Die gemachten Ausfuhrungen mögen als erste Information über den auch nach den Worten Rom ag n e s i s schwierigen Formenkreis der Griseinae verstanden werden. Infolge der Seltenheit und der ungleichen Verbreitung der meisten Arten ist ihre Variationsbreite nur schwer zu erfassen. Für die bis heute mehr oder minder gut bekannten Arten wäre ein Ausbau und eine Verfeinerung der unterscheidenden Merkmale wünschenswert. Ich glaube aber, daß sich die allermeisten der hierzu gehörenden Funde nach der Monographie von Rom a g n e s i einordnen lassen. Aus meinem Wöschbacher Wald wartet eine etwas fragliche Russu/a medul/ata auf die Klärung, eine Russu/a grisea var. parazuroides Romagn. ist gleichfalls noch mit einem Fragezeichen versehen. Für die Zukunft bleibt demnach noch einiges zu tun. wird fortgesetzt Figuren 1-8: Dermatocystiden (rechts) und Hyphen der Huthaut bzw. der Epikutis (links) in ca. looofacher Vergrößerung sowie die Sporen, ca. 2000fach vergrößert, von: 1. Russula ionochlora, Hardtwald bei Karlsruhe 2. Russula grisea, Waldgebiet des Stranzenberges bei Wöschbach 3. Russula medullata, bei Bergzabern-Pleisweiler (Pfälzer Wald) 4. Russula anatina, Waldgebiet des Stranzenberges bei Wöschbach 5. Russula galochroa, Waldgebiet des Stranzenberges bei Wöschbach 6. Russula subterfurcata, Waldgebiet des Stranzenberges bei Wöschbach 7. Russula aeruginea, bei Titisee/Schwarzw. 8. Russula pseudoaeruginea, Waldgebiet des Stranzenberges bei Wöschbach.
16 138 Fjg.1
17 139
18 111I' Fig.5
19 141,
Renate Volk Fridhelm Volk. Pilze. sicher bestimmen lecker zubereiten
 Renate Volk Fridhelm Volk Pilze sicher bestimmen lecker zubereiten Sicher bestimmen 16 Butterpilz Suillus luteus (Butterröhrling, Schälpilz, Schleimchen, Schlabberpilz, Schmalzring) Hut: 4 10 cm. Jung
Renate Volk Fridhelm Volk Pilze sicher bestimmen lecker zubereiten Sicher bestimmen 16 Butterpilz Suillus luteus (Butterröhrling, Schälpilz, Schleimchen, Schlabberpilz, Schmalzring) Hut: 4 10 cm. Jung
Renate Volk Fridhelm Volk. Pilze. sicher bestimmen lecker zubereiten. 3. Auflage 231 Farbfotos von Fridhelm Volk
 Renate Volk Fridhelm Volk Pilze sicher bestimmen lecker zubereiten 3. Auflage 231 Farbfotos von Fridhelm Volk 20 Pfefferröhrling Chalciporus piperatus Hut: 2 7 cm. Halbkugelig, orange bis zimtbraun oder
Renate Volk Fridhelm Volk Pilze sicher bestimmen lecker zubereiten 3. Auflage 231 Farbfotos von Fridhelm Volk 20 Pfefferröhrling Chalciporus piperatus Hut: 2 7 cm. Halbkugelig, orange bis zimtbraun oder
Die Täublinge. - Beiträge zu ihrer Kenntnis und Verbreitung (111) Von H. Sc h w ö bel
 Zeitsehr. f. Pilzkunde 145-158 Dezember 1974 Die Täublinge. - Beiträge zu ihrer Kenntnis und Verbreitung (111) Von H. Sc h w ö bel Ingratae Quel. - Stink- und Gallentäublinge Ingratae heißt hier soviel
Zeitsehr. f. Pilzkunde 145-158 Dezember 1974 Die Täublinge. - Beiträge zu ihrer Kenntnis und Verbreitung (111) Von H. Sc h w ö bel Ingratae Quel. - Stink- und Gallentäublinge Ingratae heißt hier soviel
Die TäuDlinge. - Beiträge zu ihrer Kenntnis und Verbreitung (11)
 Zeit sehr. f. Pilzkunde 175-190 Februar 1974 Die TäuDlinge. - Beiträge zu ihrer Kenntnis und Verbreitung (11) Von H. Sc h w ö bel Mit meinen einleitenden Ausführungen habe ich anzudeuten versucht, wie
Zeit sehr. f. Pilzkunde 175-190 Februar 1974 Die TäuDlinge. - Beiträge zu ihrer Kenntnis und Verbreitung (11) Von H. Sc h w ö bel Mit meinen einleitenden Ausführungen habe ich anzudeuten versucht, wie
Zwei. Pilzspiele für Gruppen. Pilzbestimmungsspiel Material: Pilze, weißes Laken
 Zwei Pilzspiele für Gruppen Pilzbestimmungsspiel Material: Pilze, weißes Laken Um erworbene Pilzkenntnisse spielerisch zu festigen, werden zwei gleich große Gruppen gebildet, die sich etwa in einem Abstand
Zwei Pilzspiele für Gruppen Pilzbestimmungsspiel Material: Pilze, weißes Laken Um erworbene Pilzkenntnisse spielerisch zu festigen, werden zwei gleich große Gruppen gebildet, die sich etwa in einem Abstand
Der :Sommer-Steinpil z Boletus edulis subsp. reticulatus SUHFF. BAUD. fit Bildbeilag e H. Jahn, Recklinghause n Die Abgrenzung der Formen unseres
 Der :Sommer-Steinpil z Boletus edulis subsp. reticulatus SUHFF. BAUD. fit Bildbeilag e H. Jahn, Recklinghause n Die Abgrenzung der Formen unseres vielgestaltigen Steinpilzes hat den Mykologen seit jeher
Der :Sommer-Steinpil z Boletus edulis subsp. reticulatus SUHFF. BAUD. fit Bildbeilag e H. Jahn, Recklinghause n Die Abgrenzung der Formen unseres vielgestaltigen Steinpilzes hat den Mykologen seit jeher
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein
 Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
GU NATURFÜHRER. Die wichtigsten Arten entdecken und bestimmen
 GU NATURFÜHRER Die wichtigsten Arten entdecken und bestimmen 6 PILZE Die faszinierende Welt der Pilze Pilze gehören zu den am weitest verbreiteten Lebewesen dieser Erde. Je nach Quelle schätzt man zwischen
GU NATURFÜHRER Die wichtigsten Arten entdecken und bestimmen 6 PILZE Die faszinierende Welt der Pilze Pilze gehören zu den am weitest verbreiteten Lebewesen dieser Erde. Je nach Quelle schätzt man zwischen
Bestimmungsschlüssel Pinus. Hier die wichtigsten für uns
 Hier die wichtigsten für uns 2 nadelige Kiefern Pinus sylvestris Gewöhnliche Waldkiefer Pinus nigra Schwarzkiefer Pinus mugo Latsche oder Bergkiefer 3 nadelige Kiefern Pinus ponderosa Gelb-Kiefer Pinus
Hier die wichtigsten für uns 2 nadelige Kiefern Pinus sylvestris Gewöhnliche Waldkiefer Pinus nigra Schwarzkiefer Pinus mugo Latsche oder Bergkiefer 3 nadelige Kiefern Pinus ponderosa Gelb-Kiefer Pinus
Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten. Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach
 Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach Nr 1: Farbe (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend) a) weißlich b) gelblich c) grünlich
Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach Nr 1: Farbe (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend) a) weißlich b) gelblich c) grünlich
Einige Arten die aber neu unter "Homophron" klassifiziert sind weisen kristalltragende Zystiden auf. chemisch
 Agaricales, ceae Zärtlinge, Faserlinge Wichtiges Bestimmungsmerkmal für den Einstieg ist, ob die Art wurzelnd ist oder nicht, deshalb am besten ausstechen. Ebenfalls ist die Farbe der Schneiden ein weiteres
Agaricales, ceae Zärtlinge, Faserlinge Wichtiges Bestimmungsmerkmal für den Einstieg ist, ob die Art wurzelnd ist oder nicht, deshalb am besten ausstechen. Ebenfalls ist die Farbe der Schneiden ein weiteres
Gattung und Art. Koralle, Ziegenbart
 Koralle, Ziegenbart Link Art sanguinea rubella pallida obtusissima myceliosa fumigata flavescens eumorpha botrytis abietina Link Gattung: Lentaria Corallium http://www.giftpilze.ch/pilze/6887.htm http://www.giftpilze.ch/pilze/7419.htm
Koralle, Ziegenbart Link Art sanguinea rubella pallida obtusissima myceliosa fumigata flavescens eumorpha botrytis abietina Link Gattung: Lentaria Corallium http://www.giftpilze.ch/pilze/6887.htm http://www.giftpilze.ch/pilze/7419.htm
Aufruf zur Interessensbekundung zur. Merkmalserfassung von Pilzen
 Grafenau, Februar 2018 Aufruf zur Interessensbekundung zur Merkmalserfassung von Pilzen Im Projektgebiet des Böhmerwalds werden ca. 4.000 Taxa von Pilzen aller Gilden erwartet. Dies entspricht ca. 1/3
Grafenau, Februar 2018 Aufruf zur Interessensbekundung zur Merkmalserfassung von Pilzen Im Projektgebiet des Böhmerwalds werden ca. 4.000 Taxa von Pilzen aller Gilden erwartet. Dies entspricht ca. 1/3
Gattung und Art. Lamellenfarbe Lamellenfarbe rosa Sporenfarbe (Abwurf / Mikroskop) Rosasporer
 Dachpilz Gattung die meist auf Totholz wächst. Rosalamellen und auffällige Zystidenformen und die Form der HDS Zellen lassen diese Gattung und die Arten gut eingrenzen. Innerhalb gewisser Arten gibt es
Dachpilz Gattung die meist auf Totholz wächst. Rosalamellen und auffällige Zystidenformen und die Form der HDS Zellen lassen diese Gattung und die Arten gut eingrenzen. Innerhalb gewisser Arten gibt es
 Aufgrund molekularbiologischer Data von Coprinus ausgeschiedene und neu benannte Arten. Link Art stercorea picacea patouillardii melanthina macrocephala lagopus laanii cinereofloccosa cinerea atramentaria
Aufgrund molekularbiologischer Data von Coprinus ausgeschiedene und neu benannte Arten. Link Art stercorea picacea patouillardii melanthina macrocephala lagopus laanii cinereofloccosa cinerea atramentaria
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
 Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale Thallus relativ fest angeheftet, 2-12 cm; Lappen 1-3 mm, zusammenschließend bis dachziegelig, im Alter manchmal randlich schwarz und im Zentrum mit Sekundärläppchen;
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale Thallus relativ fest angeheftet, 2-12 cm; Lappen 1-3 mm, zusammenschließend bis dachziegelig, im Alter manchmal randlich schwarz und im Zentrum mit Sekundärläppchen;
BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL.
 XXIII. ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI 926. BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL. Von Dr. LADISLAUS SZALAY. (Mit 3 Textfiguren.) In dem Moment, als eine Hydracarine aus
XXIII. ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI 926. BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL. Von Dr. LADISLAUS SZALAY. (Mit 3 Textfiguren.) In dem Moment, als eine Hydracarine aus
Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und
 Ent. Arb. Mus. Frey 25, 1974 131 Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und Bolivien (Col. Melolonthidae Sericinae) Von G. Frey Astaena iridescens n. sp. (Abb. 1) Ober- und Unterseite braun bis
Ent. Arb. Mus. Frey 25, 1974 131 Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und Bolivien (Col. Melolonthidae Sericinae) Von G. Frey Astaena iridescens n. sp. (Abb. 1) Ober- und Unterseite braun bis
Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis
 Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (Kiel. Not. Pflanzenkd.) 41: 98 104 (2015/2016) Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis Hans-Oluf Martensen Kurzfassung Vom häufigen Rubus plicatus sind vom Typischen
Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (Kiel. Not. Pflanzenkd.) 41: 98 104 (2015/2016) Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis Hans-Oluf Martensen Kurzfassung Vom häufigen Rubus plicatus sind vom Typischen
Der Lederstiel-Täubling (Russula viecid, KUD.), ein in Westfalen neu gefundener Pil z
 Der Lederstiel-Täubling (Russula viecid, KUD.), ein in Westfalen neu gefundener Pil z H. Jahn, Recklinghause n J. SCHAEFFER schreibt in seiner Russula-Monographie (1934), daß er den Lederstiel-Täubling
Der Lederstiel-Täubling (Russula viecid, KUD.), ein in Westfalen neu gefundener Pil z H. Jahn, Recklinghause n J. SCHAEFFER schreibt in seiner Russula-Monographie (1934), daß er den Lederstiel-Täubling
 Glimmertintlinge Kleine Tintlinge sind für eine einigermassen sichere Bestimmung immer zu mikroskopieren. Eine ganz interessante Gattung für die Mikroskopie, deshalb ist wichtig, diese sorgfältig und kühl
Glimmertintlinge Kleine Tintlinge sind für eine einigermassen sichere Bestimmung immer zu mikroskopieren. Eine ganz interessante Gattung für die Mikroskopie, deshalb ist wichtig, diese sorgfältig und kühl
Star. Amsel. langer, spitzer Schnabel. grün-violetter Metallglanz auf den Federn. gelber Schnabel. schwarzes G e fi e d e r. längerer.
 Star Amsel grün-violetter Metallglanz auf den Federn langer, spitzer gelber schwarzes G e fi e d e r längerer kürzerer silbrige Sprenkel im Gefieder (weniger zur Brutzeit, viel im Herbst und Winter) 19
Star Amsel grün-violetter Metallglanz auf den Federn langer, spitzer gelber schwarzes G e fi e d e r längerer kürzerer silbrige Sprenkel im Gefieder (weniger zur Brutzeit, viel im Herbst und Winter) 19
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume. Acer platanoides. Diplomarbeit von Jennifer Burghoff. Fachbereich Gestaltung. Kommunikationsdesign
 Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
Täuberlunterm scharfen Glas
 Täuberlunterm scharfen Glas Färbetechniken bei der Russula-Mikroskopie Reichenberg, 10.8.2016, Dr. Hans-Jürgen Stahl Beobachtungsobjekte bei der Russula-Mikroskopie A Sporen: B Huthaut(HDS): C ggf. Hymenium(z.B.
Täuberlunterm scharfen Glas Färbetechniken bei der Russula-Mikroskopie Reichenberg, 10.8.2016, Dr. Hans-Jürgen Stahl Beobachtungsobjekte bei der Russula-Mikroskopie A Sporen: B Huthaut(HDS): C ggf. Hymenium(z.B.
Pilz-Neuigkeiten 2013
 Pilz-Neuigkeiten 2013 Albert Landgraf, Schönwald Blauer Klumpfuß (Cortinarius caerulescens) - RL B 3! Hutbr. 50-100 mm, St. 40-60 (80) mm hoch, 10-20 mm dick, Knolle bis 45 mm dick. Farbe: Hut blauviolett,
Pilz-Neuigkeiten 2013 Albert Landgraf, Schönwald Blauer Klumpfuß (Cortinarius caerulescens) - RL B 3! Hutbr. 50-100 mm, St. 40-60 (80) mm hoch, 10-20 mm dick, Knolle bis 45 mm dick. Farbe: Hut blauviolett,
Gattung und Art. Russula. Russula - Russulaceae - Russulales - Basidiomycetes - Täublinge
 - ceae - les - Basidiomycetes - Täublinge Täubling taxonomisch A-G-F-O-(U)-K-Gattung - ceae - les - Basidiomycetes - Täublinge Art, Namen, Synonyme Täubling Einführung Die Gattung ist gross und ohne mikroskopische
- ceae - les - Basidiomycetes - Täublinge Täubling taxonomisch A-G-F-O-(U)-K-Gattung - ceae - les - Basidiomycetes - Täublinge Art, Namen, Synonyme Täubling Einführung Die Gattung ist gross und ohne mikroskopische
Der. Gesellige Schwefelkop f Naematoloma dispersum (Fr.) Karst.
 Der. Gesellige Schwefelkop f Naematoloma dispersum (Fr.) Karst. Von Hermann ja h n, Recklinghausen (Mit Bildbeilage ) In den Kiefernforsten des nordwestdeutschen Tieflandes ist der auf unsere r Photo-Bildtafel
Der. Gesellige Schwefelkop f Naematoloma dispersum (Fr.) Karst. Von Hermann ja h n, Recklinghausen (Mit Bildbeilage ) In den Kiefernforsten des nordwestdeutschen Tieflandes ist der auf unsere r Photo-Bildtafel
ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN
 ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN UITGEGEVEN DOOR HET RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN (MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK) Deel 54 no. 5 14 augustus 1979 EINE NEUE ALBINARIA
ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN UITGEGEVEN DOOR HET RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN (MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK) Deel 54 no. 5 14 augustus 1979 EINE NEUE ALBINARIA
MITTELGROSSER ANGLO-FRANZÖSISCHER LAUFHUND (Anglo-français de petite vénerie)
 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 28. 04. 1997 / DE FCI - Standard Nr. 325 MITTELGROSSER ANGLO-FRANZÖSISCHER LAUFHUND (Anglo-français
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 28. 04. 1997 / DE FCI - Standard Nr. 325 MITTELGROSSER ANGLO-FRANZÖSISCHER LAUFHUND (Anglo-français
noch befinden wir uns mitten in der Pilzsaison, höchste Zeit also, die Pilze in diesem Rundbrief zu thematisieren!
 Neustadt, 19.10.2015 Liebe Artenfinderinnen und Artenfinder, noch befinden wir uns mitten in der Pilzsaison, höchste Zeit also, die Pilze in diesem Rundbrief zu thematisieren! Viele von Ihnen wagen sich
Neustadt, 19.10.2015 Liebe Artenfinderinnen und Artenfinder, noch befinden wir uns mitten in der Pilzsaison, höchste Zeit also, die Pilze in diesem Rundbrief zu thematisieren! Viele von Ihnen wagen sich
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) / DE
 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 03. 03. 1997 / DE FCI - Standard Nr. 290 BEAGLE-HARRIER 2 ÜBERSETZUNG Originalsprache (FR).
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 03. 03. 1997 / DE FCI - Standard Nr. 290 BEAGLE-HARRIER 2 ÜBERSETZUNG Originalsprache (FR).
Pilze. Schopftintling. zusammengestellt von Ingrid Chyna/2002
 Schopftintling Die Tintlinge haben ihren Namen von einer besonderen Eigenschaft erhalten, die sie deutlich von anderen Pilzen unterscheidet. Mit zunehmender Reife verfärben sich die Lamellen dieser Pilze
Schopftintling Die Tintlinge haben ihren Namen von einer besonderen Eigenschaft erhalten, die sie deutlich von anderen Pilzen unterscheidet. Mit zunehmender Reife verfärben sich die Lamellen dieser Pilze
WELCHE BRILLE PASST ZU IHREM GESICHT?
 WELCHE BRILLE PASST ZU IHREM GESICHT? Informationen von OPTIK GRONDE Kennen Sie das? Das haben Sie bestimmt schon einmal erlebt: Sie sehen eine schöne Fassung, die Ihnen gut gefällt. Und Sie probieren
WELCHE BRILLE PASST ZU IHREM GESICHT? Informationen von OPTIK GRONDE Kennen Sie das? Das haben Sie bestimmt schon einmal erlebt: Sie sehen eine schöne Fassung, die Ihnen gut gefällt. Und Sie probieren
Farbenzwerg-Silber (FZw-S)
 Farbenzwerg-Silber (FZw-S) Zwergrasse in verschiedenen Farben Mindestgewicht Idealgewicht Höchstgewicht Reinerbig 1,1 kg 1,25 1,4 kg 1,5 kg Ursprungsland Deutschland Entstanden aus Farbenzwergen und Kleinsilber-Kaninchen
Farbenzwerg-Silber (FZw-S) Zwergrasse in verschiedenen Farben Mindestgewicht Idealgewicht Höchstgewicht Reinerbig 1,1 kg 1,25 1,4 kg 1,5 kg Ursprungsland Deutschland Entstanden aus Farbenzwergen und Kleinsilber-Kaninchen
Neuseeländer rot. 1. Körperform, Typ und Bau. 5. Deckfarbe und Gleichmäßigkeit. 5 Punkte
 Neuseeländer rot 1. Körperform, Typ und Bau 2. Gewicht 3. Fellhaar 4. Kopf und Ohren 5. Deckfarbe und Gleichmäßigkeit 6. Unterfarbe 7. Pflegezustand 20 Punkte 10 Punkte 20 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 15
Neuseeländer rot 1. Körperform, Typ und Bau 2. Gewicht 3. Fellhaar 4. Kopf und Ohren 5. Deckfarbe und Gleichmäßigkeit 6. Unterfarbe 7. Pflegezustand 20 Punkte 10 Punkte 20 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 15
Einheimisch oder zugezogen? Der Orangerote Träuschling Stropharia aurantiaca und seine beringten, schuppigen Brüder
 Einheimisch oder zugezogen? Der Orangerote Träuschling Stropharia aurantiaca und seine beringten, schuppigen Brüder Text und Bilder von Fredi Kasparek, Forststr. 24, 45699 Herten Vorbemerkung: in dieser
Einheimisch oder zugezogen? Der Orangerote Träuschling Stropharia aurantiaca und seine beringten, schuppigen Brüder Text und Bilder von Fredi Kasparek, Forststr. 24, 45699 Herten Vorbemerkung: in dieser
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Juchu, ich durfte wieder testen :)
 Juchu, ich durfte wieder testen :) Diesmal keine Maschine, sondern Material: das matte Stickgarn von Madeira: Frosted Matt. Die Box wurde mir vom nähpark zur Verfügung gestellt und geht nun nach dem Test
Juchu, ich durfte wieder testen :) Diesmal keine Maschine, sondern Material: das matte Stickgarn von Madeira: Frosted Matt. Die Box wurde mir vom nähpark zur Verfügung gestellt und geht nun nach dem Test
Zoologische Ergebnisse der Mazedonienreisen Friedrich Kasys
 Zoologische Ergebnisse der Mazedonienreisen Friedrich Kasys Lepidoptera II. Teil Scythridae Von H. J. H a n n e m a n n, Berlin (Mit 4 Abbildungen) (Vorgelegt in der Sitzung am 9. November 1961) Scythris
Zoologische Ergebnisse der Mazedonienreisen Friedrich Kasys Lepidoptera II. Teil Scythridae Von H. J. H a n n e m a n n, Berlin (Mit 4 Abbildungen) (Vorgelegt in der Sitzung am 9. November 1961) Scythris
Grundsätzliches zum Spargel
 Grundsätzliches zum Spargel Drei Farben: weiß, violett oder grün Das Sonnenlicht bestimmt die Farbe Spargel gibt es in drei unterschiedlichen Farben. Durch die Sonnenstrahlung verfärben sich die zunächst
Grundsätzliches zum Spargel Drei Farben: weiß, violett oder grün Das Sonnenlicht bestimmt die Farbe Spargel gibt es in drei unterschiedlichen Farben. Durch die Sonnenstrahlung verfärben sich die zunächst
Verschiedene Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsiedel i. F.
 Verschiedene Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsiedel i. F. Größter Scheibling (Discina perlata) Dieser Pilz ist für Speisezwecke wertlos, jedoch zu schonen. Größe: Durchmesser 3 15 cm, Stiel 1 3 cm hoch.
Verschiedene Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsiedel i. F. Größter Scheibling (Discina perlata) Dieser Pilz ist für Speisezwecke wertlos, jedoch zu schonen. Größe: Durchmesser 3 15 cm, Stiel 1 3 cm hoch.
Die beiden Verzeichnisse von 1905/1906 sind identisch. Diese Büchlein sind nur noch antiquarisch zu bekommen.
 Verschollene Kernobstsorten in Vorarlberg Für die Geschichte des Obstbaues sind die alten Verzeichnisse (Sortenempfehlungen) eine wichtige Quelle. Dort finden sich auch Sortennamen, die bei der Bestimmung
Verschollene Kernobstsorten in Vorarlberg Für die Geschichte des Obstbaues sind die alten Verzeichnisse (Sortenempfehlungen) eine wichtige Quelle. Dort finden sich auch Sortennamen, die bei der Bestimmung
Lehmprobentests der mitgebrachten Lehme
 Lehmprobentests der mitgebrachten Lehme 1. Weimar: Baugrube 2. Agdz: A- Horizont, Oase Farbe Grau bis braun hellbraun Grobanteil abgeflachtes, rundes Gestein abgeflachtes, eckiges Gestein Fremdanteil Kies,
Lehmprobentests der mitgebrachten Lehme 1. Weimar: Baugrube 2. Agdz: A- Horizont, Oase Farbe Grau bis braun hellbraun Grobanteil abgeflachtes, rundes Gestein abgeflachtes, eckiges Gestein Fremdanteil Kies,
Waldeidechse. Zootoca vivipara (JACQUIN, 1787)
 6 Eidechsen von MARTIN SCHLÜPMANN Im Grunde sind die wenigen Eidechsenarten gut zu unterscheiden. Anfänger haben aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung. Die wichtigsten Merkmale
6 Eidechsen von MARTIN SCHLÜPMANN Im Grunde sind die wenigen Eidechsenarten gut zu unterscheiden. Anfänger haben aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung. Die wichtigsten Merkmale
OWV-Kohlberg
 20180915-OWV-Kohlberg Amanita muscaria, Fliegenpilz H: 8-16 cm, jung kugelig mit weisser, würfelig eingerissener Hülle, später ausgebreitet gewölbt, orange bis rot, meist mit konzentrischen, weissen Hüllresten,
20180915-OWV-Kohlberg Amanita muscaria, Fliegenpilz H: 8-16 cm, jung kugelig mit weisser, würfelig eingerissener Hülle, später ausgebreitet gewölbt, orange bis rot, meist mit konzentrischen, weissen Hüllresten,
Pilz in Sicht und dann im Topf
 Renate Volk, Fridhelm Volk 2 in 1 Bestimmungsund Kochbuch Pilz in Sicht und dann im Topf Merkmale bei Pilzen Hut Hüll- / Velumreste Schuppen Riefen Hutunterseite mit Lamellen Röhren Ring / Manschette geflockt
Renate Volk, Fridhelm Volk 2 in 1 Bestimmungsund Kochbuch Pilz in Sicht und dann im Topf Merkmale bei Pilzen Hut Hüll- / Velumreste Schuppen Riefen Hutunterseite mit Lamellen Röhren Ring / Manschette geflockt
Eine Sandwüste malen. Arbeitsschritte
 Dies ist eine Anleitung der Künstlerin und Autorin Efyriel von Tierstein (kurz: EvT) Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch gedacht und EvT übernimmt keine Garantien dafür, dass eine Arbeit nach
Dies ist eine Anleitung der Künstlerin und Autorin Efyriel von Tierstein (kurz: EvT) Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch gedacht und EvT übernimmt keine Garantien dafür, dass eine Arbeit nach
Lamellenfarbe Lamellenfarbe jung rosa Sporenfarbe (Abwurf / Mikroskop) braunschwarz - schwarz mikroskopisch
 Egerlinge makroskopisch Lamellenfarbe Lamellenfarbe jung rosa Sporenfarbe (Abwurf / Mikroskop) braunschwarz - schwarz mikroskopisch Sporenform apfelkernartig, dickwandig Sporen Schwarzsporer chemisch Schäffer
Egerlinge makroskopisch Lamellenfarbe Lamellenfarbe jung rosa Sporenfarbe (Abwurf / Mikroskop) braunschwarz - schwarz mikroskopisch Sporenform apfelkernartig, dickwandig Sporen Schwarzsporer chemisch Schäffer
Beschreibung der M. sphaerica aus dem Buch von J. Pilbeam: Mammillaria (1999,
 Mammillaria sphaerica Text und Fotos von Elton Roberts, Ripon/California-USA Deutsche Übersetzung: Othmar Appenzeller Beschreibung der M. sphaerica aus dem Buch von J. Pilbeam: Mammillaria (1999, S. 277):
Mammillaria sphaerica Text und Fotos von Elton Roberts, Ripon/California-USA Deutsche Übersetzung: Othmar Appenzeller Beschreibung der M. sphaerica aus dem Buch von J. Pilbeam: Mammillaria (1999, S. 277):
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt.
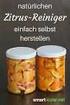 ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
Russula cistoadelpha sp.n. - eine mit Cistus assoziierte Russula- Art
 Russula cistoadelpha sp.n. - eine mit Cistus assoziierte Russula- Art M. MOSEB Institut f. Mikrobiologie, Universität, A-6020 Innsbruck, Austria & J. TRIMBACH Museum d'histoire Naturelle de Nice, F-06300
Russula cistoadelpha sp.n. - eine mit Cistus assoziierte Russula- Art M. MOSEB Institut f. Mikrobiologie, Universität, A-6020 Innsbruck, Austria & J. TRIMBACH Museum d'histoire Naturelle de Nice, F-06300
Gattung und Art. Agrocybe. Agrocybe - Strophariaceae - Agaricales - Basidiomycetes - Ackerlinge
 - Strophariaceae - Agaricales - Basidiomycetes - Ackerlinge Klassifikation - Strophariaceae - Agaricales - Basidiomycetes - Ackerlinge Art, Namen, Synonyme Ackerlinge Mikroskop zellige HDS Pleurozystiden
- Strophariaceae - Agaricales - Basidiomycetes - Ackerlinge Klassifikation - Strophariaceae - Agaricales - Basidiomycetes - Ackerlinge Art, Namen, Synonyme Ackerlinge Mikroskop zellige HDS Pleurozystiden
Havanna & Französische Havanna
 15. EE Preisrichterschulung 23.-25. März 2018 Oksböl- Dänemark & Französische Einfarbige, schokoladen bzw. kastanienbraune Kaninchenrasse mit braunen, rot durchleuchtenden Augen (Achatrot) Erbformel: ABcDg
15. EE Preisrichterschulung 23.-25. März 2018 Oksböl- Dänemark & Französische Einfarbige, schokoladen bzw. kastanienbraune Kaninchenrasse mit braunen, rot durchleuchtenden Augen (Achatrot) Erbformel: ABcDg
Bestimmungshilfe für die häufigen Amphibienarten
 Bestimmungshilfe für die häufigen Amphibienarten Silvia Zumbach Feb 2011 Fotos: Kurt Grossenbacher Erkennungsmerkmale Grasfrosch - Gestalt plump - glatte Haut - eher lange Beine - Grundfarbe graun, Rötlich
Bestimmungshilfe für die häufigen Amphibienarten Silvia Zumbach Feb 2011 Fotos: Kurt Grossenbacher Erkennungsmerkmale Grasfrosch - Gestalt plump - glatte Haut - eher lange Beine - Grundfarbe graun, Rötlich
Satz über implizite Funktionen und seine Anwendungen
 Satz über implizite Funktionen und seine Anwendungen Gegeben sei eine stetig differenzierbare Funktion f : R 2 R, die von zwei Variablen und abhängt. Wir betrachten im Folgenden die Gleichung f(,) = 0.
Satz über implizite Funktionen und seine Anwendungen Gegeben sei eine stetig differenzierbare Funktion f : R 2 R, die von zwei Variablen und abhängt. Wir betrachten im Folgenden die Gleichung f(,) = 0.
Notizen zur Flora der Steiermark
 Notizen zur Flora der Steiermark Nr. 4 1978 Inhalt HAEELLNER J.: Zur Unterscheidung der steirischen Fu/naria-Arten... 1 TRACEY R.: Festuca ovina agg. im Osten Österreichs- Bestimmungsschlüssel und kritische
Notizen zur Flora der Steiermark Nr. 4 1978 Inhalt HAEELLNER J.: Zur Unterscheidung der steirischen Fu/naria-Arten... 1 TRACEY R.: Festuca ovina agg. im Osten Österreichs- Bestimmungsschlüssel und kritische
HASE - HASENFARBIG LIÈVRE HARE
 HASE - HASENFARBIG LIÈVRE HARE 141 37 Hasen Bewertungsskala 1. Typ und Körperform 20 Punkte 2. Gewicht 10 Punkte 3. Fell 20 Punkte 4. Läufe und Stellung 15 Punkte 5. Deckfarbe und Schattierung 15 Punkte
HASE - HASENFARBIG LIÈVRE HARE 141 37 Hasen Bewertungsskala 1. Typ und Körperform 20 Punkte 2. Gewicht 10 Punkte 3. Fell 20 Punkte 4. Läufe und Stellung 15 Punkte 5. Deckfarbe und Schattierung 15 Punkte
- 2 - Inzwischen ist anerkannt, dass sich der moderne Mensch aus einer Urform entwickelt hat.
 Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
HANS E. LAUX. Kosmos Pilz führer. für unterwegs
 HANS E. LAUX Kosmos Pilz führer für unterwegs 2 HANS E. LAUX Kosmos Pilz führer für unterwegs K 3 Was ist ein Pilz? Da dem Pilz das Blattgrün fehlt, mit dessen Hilfe sich unsere Pflanzen er nähren, kann
HANS E. LAUX Kosmos Pilz führer für unterwegs 2 HANS E. LAUX Kosmos Pilz führer für unterwegs K 3 Was ist ein Pilz? Da dem Pilz das Blattgrün fehlt, mit dessen Hilfe sich unsere Pflanzen er nähren, kann
Pflanzen in den Lebensräumen
 Arbeitsbeschrieb Arbeitsauftrag: Anhand eines Exkursionsschemas versuchen die Sch gewisse Pflanzen in unserem Wald / in unserer Landschaft zu bestimmen. Ziel: Die Sch unterscheiden und bestimmen 10 in
Arbeitsbeschrieb Arbeitsauftrag: Anhand eines Exkursionsschemas versuchen die Sch gewisse Pflanzen in unserem Wald / in unserer Landschaft zu bestimmen. Ziel: Die Sch unterscheiden und bestimmen 10 in
Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana
 Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Gehölze Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Blütenfarbe: grünlich Blütezeit: März bis April Wuchshöhe: 400 600 cm mehrjährig Die Hasel wächst bevorzugt in ozeanischem
Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Gehölze Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Blütenfarbe: grünlich Blütezeit: März bis April Wuchshöhe: 400 600 cm mehrjährig Die Hasel wächst bevorzugt in ozeanischem
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4)
 Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
Ein kleiner Ausflug in die Genetik
 Rote Kater kennt jeder! Dreifarbige Katzen sind auch weit verbreitet. Doch was ist mit roten Katzen und? Schon mal gesehen? Ein kleiner Ausflug in die Genetik In jeder Körperzelle von einer Katze liegen
Rote Kater kennt jeder! Dreifarbige Katzen sind auch weit verbreitet. Doch was ist mit roten Katzen und? Schon mal gesehen? Ein kleiner Ausflug in die Genetik In jeder Körperzelle von einer Katze liegen
Kompendium der Blätterpilze VI. Laccaria. Eingegangenam
 --- ZETSCHRFT FÜR MYKOLOGE, Band 50(1). 1984 3 Kompendium der Blätterpilze V. Laccaria H. CLEMENc;ON r ~! Universite de Lausanne nstitut QeBotanique Systematique, Batiment de Biologie CH-015 Lausanne,
--- ZETSCHRFT FÜR MYKOLOGE, Band 50(1). 1984 3 Kompendium der Blätterpilze V. Laccaria H. CLEMENc;ON r ~! Universite de Lausanne nstitut QeBotanique Systematique, Batiment de Biologie CH-015 Lausanne,
BEOBACHTUNGSBOGEN T O M AT E N 2014
 BEOBACHTUNGSBOGEN T O M AT E N 2014...... Sortenname Patin/Pate Herkunft (lt. Patenschaftserklärung)... Bei mir im Anbau seit... und in den Jahren... Wie war die Witterung im diesjährigen Anbaujahr? Temperaturen
BEOBACHTUNGSBOGEN T O M AT E N 2014...... Sortenname Patin/Pate Herkunft (lt. Patenschaftserklärung)... Bei mir im Anbau seit... und in den Jahren... Wie war die Witterung im diesjährigen Anbaujahr? Temperaturen
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
Tagfalter in Bingen Das Landkärtchen -lat. Araschnia levana- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Das Landkärtchen -lat. Araschnia levana- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 4 Beobachten... 4 Zucht... 4 Artenschutz... 4 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Das Landkärtchen -lat. Araschnia levana- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 4 Beobachten... 4 Zucht... 4 Artenschutz... 4 Literaturverzeichnis...
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de BESONDERHEITEN DES GRAFISCHEN
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Grafisches Gestalten, Druck und Bleistifttechnik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de BESONDERHEITEN DES GRAFISCHEN
Cantharidae. 22. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Malacodermata. Von W. Wittmer, Herrliberg-Zürich
 Ent. Arb. Mus. Frey 12, 1961 357 22. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Malacodermata (Col.) Von W. Wittmer, Herrliberg-Zürich Cantharidae Oontelus pioi n. sp. (5 Schwarzbraun, 2 bis 3 erste Fühlerglieder
Ent. Arb. Mus. Frey 12, 1961 357 22. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Malacodermata (Col.) Von W. Wittmer, Herrliberg-Zürich Cantharidae Oontelus pioi n. sp. (5 Schwarzbraun, 2 bis 3 erste Fühlerglieder
Schau mal, wer da blüht...
 Schau mal, wer da blüht... Das strahlendste Weiß, das nachts sogar zu leuchten scheint, haben unsere ersten Frühlingsboten: Dem Schneeglöckchen macht es nicht aus, wenn es in voller Blüte unter einer tiefen
Schau mal, wer da blüht... Das strahlendste Weiß, das nachts sogar zu leuchten scheint, haben unsere ersten Frühlingsboten: Dem Schneeglöckchen macht es nicht aus, wenn es in voller Blüte unter einer tiefen
Mykologisches Grundwissen
 Mykologisches Grundwissen Die Sporen Im Gegensatz zum Samen der Grünpflanzen, welcher bereits die junge Pflanze inklusive Keimblätter enthält, besitzen die Sporen nur Keimanlagen. Sie sind winzig klein
Mykologisches Grundwissen Die Sporen Im Gegensatz zum Samen der Grünpflanzen, welcher bereits die junge Pflanze inklusive Keimblätter enthält, besitzen die Sporen nur Keimanlagen. Sie sind winzig klein
Der Verfärbende Scbneckling, Hygrophorus chrysaspis.m6trod (H. melizeus ss. Ricken)
 Der Verfärbende Scbneckling, Hygrophorus chrysaspis.m6trod (H. melizeus ss. Ricken) Von H. ja h n, Recklinghause n In den westfälischen Buchenwaldgesellschaften auf kalkhaltigem Untergrun d ist-von August
Der Verfärbende Scbneckling, Hygrophorus chrysaspis.m6trod (H. melizeus ss. Ricken) Von H. ja h n, Recklinghause n In den westfälischen Buchenwaldgesellschaften auf kalkhaltigem Untergrun d ist-von August
aus Deutschland Die Qualität einer Treppenanlage zeigt sich nicht zuletzt an der Belastbarkeit und Langlebigkeit der Stufen. Ganz gleich, ob Sie
 WERTARBEIT aus Deutschland Die Qualität einer Treppenanlage zeigt sich nicht zuletzt an der Belastbarkeit und Langlebigkeit der Stufen. Ganz gleich, ob Sie Massivholz, oder Multicolor bevorzugen bei Fuchs-Treppen
WERTARBEIT aus Deutschland Die Qualität einer Treppenanlage zeigt sich nicht zuletzt an der Belastbarkeit und Langlebigkeit der Stufen. Ganz gleich, ob Sie Massivholz, oder Multicolor bevorzugen bei Fuchs-Treppen
Über Graue Ritterlinge
 Über Graue Ritterlinge und ihren kulinarischen Wert Mit diesem Beitrag wird eine Artikelserie gestartet, die vornehmlich den Speisepilzfreunden gewidmet ist. Der Themenbereich wird vielfältig, aber willkürlich
Über Graue Ritterlinge und ihren kulinarischen Wert Mit diesem Beitrag wird eine Artikelserie gestartet, die vornehmlich den Speisepilzfreunden gewidmet ist. Der Themenbereich wird vielfältig, aber willkürlich
Hebeloma edurum Metrod, der Kakaofälblin g ein häufiger, leicht kenntlicher Fälblin g
 Hebeloma edurum Metrod, der Kakaofälblin g ein häufiger, leicht kenntlicher Fälblin g Von Frieder G r ö g e r, Brühei m (Mit 1 Abbildung ) Die Gattung der Fälblinge Hebeloma muß als eine der zur Zeit am
Hebeloma edurum Metrod, der Kakaofälblin g ein häufiger, leicht kenntlicher Fälblin g Von Frieder G r ö g e r, Brühei m (Mit 1 Abbildung ) Die Gattung der Fälblinge Hebeloma muß als eine der zur Zeit am
LEIMHOLZPLATTEN HOLZARTEN & SONDERQUALITÄTEN
 LEIMHOLZPLATTEN HOLZARTEN & ANSPRECHPARTNER INHALT Ansprechpartner TBI GmbH Treppen- und Bauelementewerk Siemensstr. 22 D - 30916 Isernhagen Tel. (05 11) 22 88 60-12 Fax (05 11) 22 88 60-79 Internet www.tbi-treppen.de
LEIMHOLZPLATTEN HOLZARTEN & ANSPRECHPARTNER INHALT Ansprechpartner TBI GmbH Treppen- und Bauelementewerk Siemensstr. 22 D - 30916 Isernhagen Tel. (05 11) 22 88 60-12 Fax (05 11) 22 88 60-79 Internet www.tbi-treppen.de
Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand
 Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand Aus der Vielzahl an neuen Sorten für den Anbau von Sommerhimbeeren stachen in den letzten Jahren Tulameen und Glen Ample als besonders anbauwürdig hervor und
Neue Sommerhimbeersorten auf dem Prüfstand Aus der Vielzahl an neuen Sorten für den Anbau von Sommerhimbeeren stachen in den letzten Jahren Tulameen und Glen Ample als besonders anbauwürdig hervor und
Die Holzarten Wichtige Informationen über Farbe, Eigenschaften und Verwendung
 Die Holzarten Wichtige Informationen über, und AHORN Das Holz des Ahorns ist weiß bis gelblich weiß. Älteres Holz wird grauweiß. Es ist mittelschwer, elastisch, zäh und nicht besonders hart. Es lässt sich
Die Holzarten Wichtige Informationen über, und AHORN Das Holz des Ahorns ist weiß bis gelblich weiß. Älteres Holz wird grauweiß. Es ist mittelschwer, elastisch, zäh und nicht besonders hart. Es lässt sich
Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche
 Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche Wolfgang Staeck Ende Januar ist der seit Jahren angekündigte und daher lange überfällige zweite Band vom Cichliden Atlas aus dem Mergus Verlag ausgeliefert
Neue Namen für südamerikanische Zwergbuntbarsche Wolfgang Staeck Ende Januar ist der seit Jahren angekündigte und daher lange überfällige zweite Band vom Cichliden Atlas aus dem Mergus Verlag ausgeliefert
KostProbe Seiten. So bestimmst du Blütenpflanzen
 Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Waldrallye Haus Dortmund
 Waldrallye Haus Dortmund Die Waldralle umfasst drei verschiedene Aufgabenformen: a) Stationen: Mit Zahlen markierte Punkte, an denen Fragen beantwortet werden müssen. b) Übungen: Stationen, an denen Aufgaben
Waldrallye Haus Dortmund Die Waldralle umfasst drei verschiedene Aufgabenformen: a) Stationen: Mit Zahlen markierte Punkte, an denen Fragen beantwortet werden müssen. b) Übungen: Stationen, an denen Aufgaben
Newsletter. Krummzähniger Tannenborkenkäfer. 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5.
 Newsletter Newsletter 4/2016 WBV Bad Kötzting Krummzähniger Tannenborkenkäfer 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5. Bekämpfung 1 1. Beschreibung Der Krummzähniger
Newsletter Newsletter 4/2016 WBV Bad Kötzting Krummzähniger Tannenborkenkäfer 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5. Bekämpfung 1 1. Beschreibung Der Krummzähniger
[Text eingeben] Steinobst.
![[Text eingeben] Steinobst. [Text eingeben] Steinobst.](/thumbs/64/50697423.jpg) Steinobst Als Steinobst bezeichnet man jene Früchte, die einen verholzten Kern besitzen. In diesem harten Kern befindet sich der tatsächliche Samen; außen ist er von dem essbaren Fruchtfleisch umgeben.
Steinobst Als Steinobst bezeichnet man jene Früchte, die einen verholzten Kern besitzen. In diesem harten Kern befindet sich der tatsächliche Samen; außen ist er von dem essbaren Fruchtfleisch umgeben.
HE-Pflanzen in unseren Sammlungen
 HE-Pflanzen in unseren Sammlungen Fortsetzung aus Heft 1, Jg. 10 - (10 (1) 2013) Gerd Köllner Bild 1: S. steinbachii HE 5/01 Bild 2: S. steinbachii HE 5/03 Bei seinen Exkursionen in Bolivien richtete E.
HE-Pflanzen in unseren Sammlungen Fortsetzung aus Heft 1, Jg. 10 - (10 (1) 2013) Gerd Köllner Bild 1: S. steinbachii HE 5/01 Bild 2: S. steinbachii HE 5/03 Bei seinen Exkursionen in Bolivien richtete E.
Bestimmungshilfe Krautpflanzen
 Bestimmungshilfe Krautpflanzen Buschwindröschen Wald-Schlüsselblume Blüte weiss mit 6 bis 8 Blütenblättern 3 gestielte, dreigeteilte und grob gezähnte Blätter Höhe: 10-25 cm wächst an schattigen, humusreichen
Bestimmungshilfe Krautpflanzen Buschwindröschen Wald-Schlüsselblume Blüte weiss mit 6 bis 8 Blütenblättern 3 gestielte, dreigeteilte und grob gezähnte Blätter Höhe: 10-25 cm wächst an schattigen, humusreichen
Kleinrexkaninchen (KlRex) Kleine Rasse mit Kurzhaarfaktor
 Kleinrexkaninchen (KlRex) Kleine Rasse mit Kurzhaarfaktor Mindestgewicht 1,8 kg Idealgewicht 2,0 2,3 kg Höchstgewicht 2,5 kg Reinerbig Spalterbig: Dalmatiner Ursprungsland Amerika Entstanden durch Mutation
Kleinrexkaninchen (KlRex) Kleine Rasse mit Kurzhaarfaktor Mindestgewicht 1,8 kg Idealgewicht 2,0 2,3 kg Höchstgewicht 2,5 kg Reinerbig Spalterbig: Dalmatiner Ursprungsland Amerika Entstanden durch Mutation
SÜDRISSISCHER OVTSCHARKA
 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard Nr. 326 / 30. 09. 1983 / D SÜDRISSISCHER OVTSCHARKA (Ioujnorousskaia Ovtcharka)
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard Nr. 326 / 30. 09. 1983 / D SÜDRISSISCHER OVTSCHARKA (Ioujnorousskaia Ovtcharka)
SORTENKATALOG. Zucchini Zucchetti und Kürbis. Saison Daniela und Thomas Glos. Schnann Pettneu am Arlberg
 SORTENKATALOG Zucchini Zucchetti und Kürbis Saison 2017 Daniela und Thomas Glos www.gartli.at Schnann 78 info@gartli.at 6574 Pettneu am Arlberg Telefon 0664 540 67 57 Hinweis zu den verwendeten Bildquellen:
SORTENKATALOG Zucchini Zucchetti und Kürbis Saison 2017 Daniela und Thomas Glos www.gartli.at Schnann 78 info@gartli.at 6574 Pettneu am Arlberg Telefon 0664 540 67 57 Hinweis zu den verwendeten Bildquellen:
Zwei nicht alltägliche Täublinge
 -- - ZEITSCHRIFT FÜR MYKOLOGIE, Band 73/1, 2007 105 Zwei nicht alltägliche Täublinge FRITZ KRAUCH KRAUCH,F. (2007): Two rare Russula-species. Z. Mykol. 73/1: 105-110 Key words: R.jlavispora, R. roseicolor
-- - ZEITSCHRIFT FÜR MYKOLOGIE, Band 73/1, 2007 105 Zwei nicht alltägliche Täublinge FRITZ KRAUCH KRAUCH,F. (2007): Two rare Russula-species. Z. Mykol. 73/1: 105-110 Key words: R.jlavispora, R. roseicolor
Russula pumila Rouzeau & Massart, ein Täubling unter Alnu s glutinosa, in Norddeutschland und Westfalen gefunde n
 Russula pumila Rouzeau & Massart, ein Täubling unter Alnu s glutinosa, in Norddeutschland und Westfalen gefunde n H. Ja h n, Detmold-Heiligenkirche n (in Zusammenarbeit mit W. S c h u l z, Dahlenburg-Sommerbeck,
Russula pumila Rouzeau & Massart, ein Täubling unter Alnu s glutinosa, in Norddeutschland und Westfalen gefunde n H. Ja h n, Detmold-Heiligenkirche n (in Zusammenarbeit mit W. S c h u l z, Dahlenburg-Sommerbeck,
Seltene Boleten im Rheinland und in der Eifel
 Seltene Boleten im Rheinland und in der Eifel Text und alle Fotos von Frank Röger, Am Wasserwerk 16 c, 53840 Troisdorf * Als ich vor nunmehr zehn Jahren damit begann, gezielt nach seltenen Boletusarten
Seltene Boleten im Rheinland und in der Eifel Text und alle Fotos von Frank Röger, Am Wasserwerk 16 c, 53840 Troisdorf * Als ich vor nunmehr zehn Jahren damit begann, gezielt nach seltenen Boletusarten
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010
 Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010 Wer kennt sie nicht, diese besonders im Frühjahr und Herbst attraktive und ökologisch äußerst wertvolle Baumart unserer Waldränder, die Vogel-Kirsche,
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010 Wer kennt sie nicht, diese besonders im Frühjahr und Herbst attraktive und ökologisch äußerst wertvolle Baumart unserer Waldränder, die Vogel-Kirsche,
Südholländer. DKB Deutscher Kanarien- und Vogelzüchter-Bund e.v. Seite 1 von 11 Ulrich Völker DKB Foto: Paul Pütz.
 Südholländer Seite 1 von 11 Südholländer Diese Rasse kleinerer, gebogener Frisierter stammt wahrscheinlich aus dem Süden Frankreichs. Hollandais du Sud, übersetzt als Südlicher Frisierter, könnte aus dem
Südholländer Seite 1 von 11 Südholländer Diese Rasse kleinerer, gebogener Frisierter stammt wahrscheinlich aus dem Süden Frankreichs. Hollandais du Sud, übersetzt als Südlicher Frisierter, könnte aus dem
Weisse Landkaninchen Hvid Land
 15. EE Preisrichterschulung 23.-25. März 2018 Oksböl- Dänemark Hvid Land Eine dänische Rasse Rassegeschichte Weisse, albinotische Kaninchen sind in Dänemark seit langem bekannt. Bildausschnitt Museum Kopenhagen
15. EE Preisrichterschulung 23.-25. März 2018 Oksböl- Dänemark Hvid Land Eine dänische Rasse Rassegeschichte Weisse, albinotische Kaninchen sind in Dänemark seit langem bekannt. Bildausschnitt Museum Kopenhagen
3 Holzvorräte in Bayerns Wäldern
 3 Holzvorräte in Bayerns Wäldern 3.1 Internationaler Vergleich Deutschland hat unter allen europäischen Ländern abgesehen von Russland die größten Holzvorräte (Abb.1). Die Voraussetzungen für die Forst-
3 Holzvorräte in Bayerns Wäldern 3.1 Internationaler Vergleich Deutschland hat unter allen europäischen Ländern abgesehen von Russland die größten Holzvorräte (Abb.1). Die Voraussetzungen für die Forst-
Christine Schneider Maurice Gliem. Pilze finden. Der Blitzkurs für Einsteiger
 Christine Schneider Maurice Gliem Pilze finden Der Blitzkurs für Einsteiger Das A und O ist das Wo! 15 Des Pilzes Lebensraum Zu wissen, wo Pilze am liebsten und am prächtigsten gedeihen, ist die wahre
Christine Schneider Maurice Gliem Pilze finden Der Blitzkurs für Einsteiger Das A und O ist das Wo! 15 Des Pilzes Lebensraum Zu wissen, wo Pilze am liebsten und am prächtigsten gedeihen, ist die wahre
Anerkannte Farbenschläge und ihre Reihenfolge auf Schauen
 Anerkannte Farbenschläge und ihre Reihenfolge auf Schauen Blau ohne Binden: Farblich wird ein reines mittleres Taubenblau mit dunkler Schwingenfarbe verlangt, wobei die Täubinnen in der Schildfarbe geschlechtsbedingt
Anerkannte Farbenschläge und ihre Reihenfolge auf Schauen Blau ohne Binden: Farblich wird ein reines mittleres Taubenblau mit dunkler Schwingenfarbe verlangt, wobei die Täubinnen in der Schildfarbe geschlechtsbedingt
