Geologische Beschreibung des Druckstollens Vallüla- Vermunt (Zaverna-Stollen)
|
|
|
- Emma Gerhardt
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 105 Geologische Beschreibung des Druckstollens Vallüla- Vermunt (Zaverna-Stollen) Von Otto Reithofer (Mit 2 Tafeln XV und XVI, 3 Diagrammen und 1 Abb. [Textfig.J) Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 105 Einleitung 106 Der Fensterstollen Vallüla Süd" 106 Der Stichstollen 108 Der Druckstollen 108 Der Seestollen 115 Der Zugangsstollen. 116 Die Beschaffenheit des Zaverna-Stollens und die Lage der Gesteine 117 Vergleich mit den geologischen Verhältnissen ober Tag., 119 Die Wasserverhältnisse 121 Vorwort Im Jahre 1938 haben die Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft in Bregenz mit dem Bau des Obervermunt- und Rodundwerkes begonnen. Sie ermöglichten vom Baubeginn an die geologische Aufnahme des Freispiegelstollens von Gaschurn nach Latschau, des Druckschachtes und Entlastungsstollens von Latschau nach Rodund und sonstiger bemerkenswerter Aufschlüsse. Im Jahre 1946 wurde die Aufnahme des Stollens für die Beileitung des Rellsbaches beendet. In den Jahren 1948 bis 1950 wurde die Aufnahme aller Stollenstrecken für die Wasser Überleitungen aus Tirol-1 (vom Jamtal bis zum Vermunt-Stausee) einschließlich des Verbellenstollens ermöglicht. Als erstes Ergebnis dieser Arbeiten wird die geologische Beschreibung des Zaverna-Stollens veröffentlicht. Herrn Dipl.-Ing. A. Ammann, Direktor der Vorarlberger Illwerke, erlaube ich mir für die rege Anteilnahme, die Unterstützung meiner Arbeit und die Gewährung eines Druckkostenbeitrages herzlich zu danken. Den Herren Oberingenieuren E. Hoyer und W. Steinbock, Bauleiter der Hauptbauleitung Obervermuntwerk-Rodundwerk der E. A. G. vorm. Lahmeyer & Co. in Schruns, und den Herren Ingenieuren der örtlichen Bauleitungen und der Baufirmen danke ich für ihre vielfältige Unterstützung verbindlichst.
2 106 Zu ganz besonderem Danke bin ich aber Herrn Dipl.-Ing. J. Hämmerle, Leiter der Projektierungsabteilung der Vorarlberger Illwerke in Schruns, für manchen Rat und zahlreiche Hilfeleistungen verpflichtet. Einleitung Der Druckstollen Valülla-Vermunt liegt im hintersten Teil des Montafontales südöstlich ober Parthenen, nahe dem N-Rande der der Silvrettagruppe (auf Blatt Silvrettagruppe 5244 der österreichischen Spezialkarte 1': ). Im Frühjahr 1943 wurde mit dem Stollenbau begonnen, der dann gegen Kriegsende eingestellt werden mußte. Im Jahre 1946 konnten die Bauarbeiten wieder fortgesetzt und im Sommer 1949 beendet werden. Dem beigegebenen Lageplan ist der Verlauf der Stollentrasse zu entnehmen. Die Stollensohle liegt beim Schnittpunkt des Fensterstollens mit dem Stichstollen (in Vallüla) in einer Seehöhe von zirka m, bei der Einmündung des Zaverna-Fensterstollens in zirka 1716 m und bei der Einmündung in den Vermunt-Stausee in zirka 1720 m Höhe. Zur Erzielung einer möglichst genauen Aufnahme wurden jeweils nur die frisch gewaschenen Stollenstrecken aufgenommen. Bei dieser Aufnahme gelangen die beiden Ulmen und der First zur Darstellung. Der Einfachheit halber wurden die Ulmen immer als senkrechte Wände angenommen, was aber nur stellenweise zutrifft. In allen anderen Fällen wurde dies bei der Darstellung entsprechend berücksichtigt, da größter Wert darauf gelegt wurde, möglichst univerzerrte Profile zu erhalten. Um nicht zu sehr unübersichtliche Profile zu bekommen, wurde auf die Darstellung der Klüfte, von denen sich besonders die Querklüfte ± _L B stellenweise ziemlich stark bemerkbar machen, verzichtet. Es wurden nur solche Klüfte verzeichnet, längs denen Bewegungen stattgefunden haben. Sehr erstaunlich ist die große Anzahl von Bewegungsflächen, von denen die Gesteine durchschnitten werden, die aber ober Tag meist nicht zu sehen sind. Bei den Bewegungsflächen finden sich alle Übergänge von messerscharfen Verwerfungen bis ein paar Dezimeter starken Lettenklüften und noch mächtigeren, vielfach weichen Mylonitzonen. Sowohl bei den Bankungs- als auch bei den Bewegungsflächen handelt es Bich teils um ebene, teils um gekrümmte Flächen. Bei den Stollenprofilen ist noch zu beachten, daß nur in den Strecken ohne Einbau alle Eintragungen lückenlos durchgeführt werden konnten, während in den mit Einbau teils nur wenig, teils nichts eingezeichnet werden konnte. Bei der Betrachtung der Stollenprofile ist außerdem noch zu berücksichtigen, daß der Nullpunkt der StoUenkilometrierung auf der Profiltafel in der linken oberen Ecke liegt, während er sich auf dem Lageplan am Q-Rande desselben (am rechten Rande) befindet. Alle in der folgenden Beschreibung angeführten Angaben beziehen sich, falls nichts anderes angegeben wird, auf die nördliche, bzw. nordwestliche Ulme an der Sohle. Der Fensterstollen Vallüla Süd". Dieser Stollen verläuft ungefähr von NO gegen SW (siehe Lageplan!) bis zur Einmündung des Stichstollens beim Stollenmeter 65. Am Portal steht junger Moränenschutt mit kleinen bis großen, z. T. gut gerundeten
3 o
4 108 Blöcken an, der bis zum Stollenmeter 17 reicht, wo der anstehende Fels beginnt. Es handelt sich um grobkörnigen Biotitaugengneis (1, siehe Profiltafel!), der wegen der zahlreichen Lettenklüfte zunächst weniger standfest ist, von 61 m an aber fester wird. Der Stichstollen Dieser Stollen verläuft annähernd von O gegen W. Der Nullpunkt der Stationierung liegt im Schnittpunkt der beiden Rohrachsen (Einmündung Vallülabach). Die Schieberkammer steht auf anstehendem Fels, nachdem der Moränenschutt entfernt worden war. Die Grenze zwischen der Blockmoräne und dem Biotitaugengneis liegt bei 2-4 m. Der letztere ist z. T. stärker gestört und im äußeren Teil ziemlich stark zerklüftet, daher nicht ganz standfest. Das Gestein ist frisch, nur entlang einzelner Störungen bis über Stollenmeter 20 etwas verwittert. Es treten auch verschiedene Querklüfte ± J_ B auf. Ab 29-5 m war in dem festen Gestein kein Einbau erforderlich. Der Druckstollen Der Druckstollen verläuft von der Einmündung des Fensterstollens bei m bis fast 1-25 km über die Einmündung des Zaverna-Fensterstollens hinaus ± gegen SW und biegt dann allmählich bis in die NW- Richtung ab, während sein westlichster Teil, der Seestollen, mehr gegen W gerichtet ist. Von 60-2 m an ist der Granitgneis fest (ohne Einbau). Bei 69 m tritt an der SO-Ulme derber weißer Quarz. (2) auf. Zwischen 96-4 und 98-2 m steht fester, feinkörniger Biotitgranitgneis (3) an, dem 2 bis 20 cm starke weiße Aplitgneislagen (4) zwischengelagert sind. An den Biotitgranitgneis grenzt bis m vorwiegend Muskowitgranitgneis an (6), der stark gestört und gefaltet ist. Zwischen und m ist das Gestein sehr stark gestört und zertrümmert, z. T. mylonitisch und weich (= m. u. w.) und auffallend weiß (6). Die südlich anschließenden Partien dieses Gesteins sind stark gestört, gefaltet und nicht fest (7). Einbau zwischen 99-5 und m. Der Muskowitgranitgneis wird von mächtigem, z. T. weniger stark gestörtem, mehr massigem, feinkörnigem, festem Biotitgranitgneis mit kleinen Biotiten unterlagert, dessen Bankung vielfach undeutlich oder nicht erkennbar ist (8). Von 250 m an wird dieser Granitgneis gegen N sehr biotitarm. Stellenweise treten dünne grünliche Kluftbeläge auf. Bei 116 m (SO-Ulme) zieht ein Zerrüttungsstreifen (9) durch, in dem das Gestein nicht so stark gestört ist wie zwischen und m. Sehr stark gestörte Verrnschelungszonen, die z. T. m. u. w. sind (10), treten zwischen und m auf. Kopfschutz zwischen und m. Bei 204 m helle Aplitgneislage (11). Zwei stark gestörte Quetschzonen (12) finden sich zwischen und m und eine schmälere bei 248 m. Daneben treten mehrere, etwas weniger stark gestörte Zonen (13) auf. Sehr stark gestörte, z. T. m. u. w. Quetschzonen liegen zwischen und m (Einbau von bis m) und bei m (14). Von 280 bis m wird fester, grobkörniger Biotitaugengneis mit Biotitnestern (15) durchörtert, der z. T. stärker gestört ist (16). Dieser wird von einer 0-8 m starken Lage von feinkörnigem Biotitgranitgneis
5 109 mit zahlreichen, ganz dünnen, bis 2 cm dicken Zwischenlagen von hellem Aplitgneis (17) unter lagert. Der daran angrenzende feste, feinkörnige, ziemlich massige Biotitgranitgneis (18) ist undeutlich gebankt. Seine südlichsten Lagen sind stärker gestört und bei 288 m tritt eine stark gestörte, z. T. m. u. w. Rusehelzone (19) auf. Zwischen 296 und m steht sehr fester, grobkörniger Biotitaugengneis mit Biotitnestern (20) an. Nur von 308 bis 310 m ist das Gestein an der NW-Ulme feinkörnig. Die nördlichste Grenzlage ist eine sehr stark gestörte, z. T. m. u. w. Quetschzone (21), an die gegen S angrenzen: eine stark gestörte, aber feste Zone (22), eine stark geschieferte, nicht sehr feste Zone (23), eine äußerst stark geschieferte und z. T. w. Zone (24) und eine teilweise m. u. w. Zone (25), in der von einer weißen Aplitgneislage nur noch linsenförmige, z. T. zu Sand zerdrückte Nester erhalten sind. Bei 345 m wurde eine bis 0-8 m mächtige Lage von feinkörnigem Biotitgranitgneis (26) durchstoßen, die an ihrer Südgrenze von einer dünnen, und an der Nordgrenze von einer dünnen bis 0-25 m starken und ein paar ganz dünnen weißen Aplitgneislagen (27) begleitet wird. Zwischen und 424 m steht fester, mehr feinkörniger Biotitaugengneis (28) an, dem bei 350 m eine feste Muskowitgranitgneislage (29) zwischengeschaltet ist, an deren N-Grenze das Nebengestein z. T. stark geschiefert und gestört ist (30). Eine weitere Muskowitgranitgneislage findet sich bei m, die im Liegenden von ein paar dünnen solchen Lagen begleitet wird. Zwischen 424 und m handelt es sich überwiegend um Muskowitgranitgneis, der stark gefaltet und gestört ist (31). An diesen grenzt fester, meist mehr feinkörniger Biotitgranitgneis (32), an dessen Liegend- (= Süd-) Grenze verschiedene dünne, bis über 10 cm starke Muskowitgranitgneislagen auftreten. Auch innerhalb des Biotitgranitgneises finden sich verschiedene Muskowitgranitgneislagen (33). Bei m sind im Liegenden der Muskowitgranitgneislage (34) mehrere ± dünne, weiße, z. T. stark gefaltete Lagen zu beobachten, die nicht ausgeschieden werden konnten. Bei 472 m konnte von drei dünnen, bis zusammen über 3 dm starken solchen Lagen (35) nur eine, eingezeichnet werden. An der SO-Ulme zieht eine ± 1 dm mächtige ebensolche Lage (36) entlang, in derem Liegenden verschiedene solche dünne, kieingefältelte Lagen auftreten. Bei diesen ganz dünnen, häufig nur ein paar mm bis + le«starken Lagen handelt es sich um Quarzfeldspatgesteine in allen Abstufungen von reinen Quarzlagen, Quarziten bis zu Aplitgneisen und Muskowitgranitgneisen. Wegen ihrer geringen Stärke läßt sich oft nicht gleich feststellen, welche dieser Bezeichnungen zutrifft und da diese verschiedenen und auch durch alle Übergänge verbundenen Gesteine oft ganz nahe nebeneinander vorkommen und nicht jede Lage eigens ausgeschieden und angeführt werden kann, werden sie im folgenden der Einfachheit halber als weiße Lagen zusammengefaßt. Zwischen und m wurde sehr fester, dünn- bis diekgebankter Muskowitgranitgneis aufgefahren, der mit ganz dünnen bis einige cm und mehr starken, dunklen, glimmerreichen Zwischenlagen gebändert ist. In den letzteren treten wieder ganz dünne weiße Lagen auf, die z. T. stark Heingefältelt sind. Gegen N werden die Bänke des Muskowitgranitgneises (37) viel mächtiger und erreichen Stärken bis über 1 m. Bei und bei 563 m treten je eine dünnere Biotitgranitgneislage (38) und nördlich davon
6 110 zwei dünne, bis über 2 dm starke ebensolche Lagen mit ganz dünnen weißen Zwisehenlagen auf. Bei m beginnt wieder fester, deutlich geschieferter Biotitaugengneis mit einzelnen großen Feldspataugen (39). Innerhalb dieser Zone treten mehrere dünne, bis über 3 dm starke Muskowitgranitgneislagen mit =fc dünnen dunklen Zwisehenlagen (40), zwei dünnere Muskowitgranitgneislagen (41), ein größtenteils diskordanter weißer Aplitgang (42) und eine Aplitgneislage (43) auf. Von m an herrscht fester, feinkörniger, stärker geschieferter Biotitgranitgneis (44) vor. Zwischen 675 und 695 m treten größere Feldspataugen auf und das Gestein ist zwischen 675 und 691 m auch etwas grobkörniger. Bei 620 und 647 m ziehen zwei stärkere Zonen mit vorwiegend Muskowitgranitgneis (45) durch. Eine dünnere Muskowitgranitgneislage (46) ist z. T. stark gefaltet und ausgewalzt. Eine einige und eine bis 15 cm starke solche Lage findet sich bei 639*5 m. Mehrfach treten weiße Aplitgneislagen (47) auf. Die bei m ist leichtgefaltet und die zwischen 671 und 677 m lassen erkennen, wie stark das Gestein hier gefaltet ist. Bei 610 m handelt es sich um zwei dünne, bis 10 cm starke Lagen. Von 690 m an geht der Biotitgranitgneis rasch ohne erkennbare Grenze in festen, weniger typischen, mehr feinkörnigen Biotitaugengneis (48) mit zahlreichen Klüften über. Zwischen 748 und 758 m finden sich einzelne große Feldspataugen. Die Bankung ist meist nicht deutlich erkennbar. Außer dünnen bis dickeren Aplitgneislagen (49), die z. T. stark gefaltet und ausgequetscht sind (die bei m ist nur bis 1 cm stark), treten auch einige Aplitgänge (50) auf. Nahe der S-Grenze wurden an zwei Stellen Einlagerungen von Muskowitgranitgneis mit etwas Biotit (50) angetroffen. Zwischen und m und zwischen und m steht ziemlich feinkörniger, glimmerreicher, stark geschieferter und" z. T. stark gefalteter Biotitgranitgneis mit dünnen weißen Zwischenlagen (51) an. Die letzteren sind z. T. stark kleingefältelt und teilweise auch intensiv mit dem dunklen Gestein verfaltet. Zwischen diesen beiden Gesteinszonen findet sich fester, mehr feinkörniger, massiger, z. T. stärker gefalteter Biotitgranitgneis mit einzelnen dünnen weißen Lagen (52), dessen N-Grenze ziemlich unscharf ist. Diesen Granitgneisen sind Aplitgneislagen (53) und Muskowitgranitgneislagen (54) zwischengeschaltet. Bei m beginnt wieder sehr fester, ziemlich grobkörniger, weniger stark gestörter Biotitaugengneis mit Biotitnestern, einzelnen großen Feldspataugen und zahlreichen Klüften (55), an den bei m fester, mehr feinkörniger Biotitaugengneis mit zahlreichen, ganz dünnen und einigen stärkeren, sehr feinkörnigen Aplitgneislagen (56), die z. T. intensiv gefaltet und auch meist kleingefältelt sind, grenzt. An die südlich davon folgende, nur seh wach durch dünne biotitreiche Lagen gebänderte Aplitgneislage (57) schließt bei 856 m wieder eine mächtigere Zone von festem, mehr feinkörnigem, ziemlich massigem Biotitaugengneis (58) an, dessen Bankung nicht recht erkennbar ist. Wie die ganz feinkörnigen Aplitgneislagen (59) und der Muskowitgranitgneis (60) erkennen lassen, ist diese Zone stark gefaltet. Bei 880 m wechsellagern z. T. intensiv gefaltete, ganz dünne weiße Lagen mit stärkeren Muskowitgranitgneis- und dunklen, biotitreichen Lagen (61). Der Muskowitgranitgneis zwischen und m ist etwas biotithaltig. In dem südlich davon anschließenden Biotitaugengneis, der z. T. stark geschiefert und gestört ist, treten nur zwischen 893 und
7 m viele, ganz dünne weiße Lagen auf, die meist intensiv kleingefältelt sind. Zwischen 931 und m zieht eine sehr stark gestörte, z. T. m. u. w. Zerrütterungszone (Einbau!) (62) durch, an die nach S wieder fester, mehr feinkörniger Biotitaugengneis (63) mit einzelnen dünnen bis starken Aplitgneis- und Muskowitgranitgneislagen (64) grenzt. Der Verlauf der letzteren, von denen nur die wichtigsten ausgeschieden werden konnten, läßt die sehr starke Faltung erkennen. Die starke Muskowitgranitgneislage zwischen 932 und m (SO-Ulme) führt auch etwas Biotit. Ebensolcher Muskowitgranitgneis, der auf den Klüften rostbraun anwittert (65), findet sich bei 979 m. Von 979'6 bis m steht mehr feinkörniger Biotitgranitgneis mit dünnen bis über 5 cm starken Aplitgneislagen an, die teilweise kleingefältelt sind (66). Der Biotitgranitgneis und der zwischengeschaltete Muskowitgranitgneis mit etwas Biotit (67) sind stark bis sehr stark gefaltet. Muskowitgranitgneis mit etwas Biotit, durch einzelne bis 10 cm starke biotitreiche, dunkle Lagen gebändert (68), reicht von bis m. Eine 0-7 bis 1 m mächtige Partie unmittelbar über der Liegend- (= N-) Grenze ist durch verschiedene dünnere, biotitreiche, dunkle Lagen besonders deutlich gebändert. An den Muskowitgranitgneis grenzt wieder mehr feinkörniger, z. T. etwas gefalteter Biotitgranitgneis mit zahlreichen dünnen bis ein paar cm starken weißen Lagen (69), die besonders gegen die Hangendgrenze hin häufiger werden. Der Biotitgranitgneis und der südlich davon folgende Muskowitgranitgneis mit etwas Biotit und einigen dünnen biotitreichen Zwischenlagen (70) werden zwischen und 1034 m (SO-Ulme) von zwei stärker gestörten Quetschstreifen (71) durchsetzt. Zwischen und m steht sehr fester, nicht sehr grobkörniger, weniger stark gestörter Biotitaugengneis mit einzelnen großen Feldspataugen und Querklüften ± J_ B (72) an. Diesem Biotitaugengneis sind Muskowitgranitgneislagen mit etwas Biotit (73) und solche, die auf den Klüften rostbraun anwittern (74) und auch ganz dünne (75) zwischengeschaltet. Außer diesen Lagen sind noch eine 3 cm dicke Aplitgneislage (76), eine an der Hangendgrenze auf den Klüften rostbraun anwitternde Aplitgneislage, unter derem Liegenden noch mehrere Aplitgneis- und Muskowitgranitgneislagen mit einigen dünnen, biotitreichen, dunklen Zwischenlagen (77) auftreten und endlich noch mehrere ganz dünne Aplitgneislagen (78) zu erwähnen, von denen nur eine ausgeschieden wurde. Bei m wurde eine stärkere Muskowitgranitgneislage mit zwei bis über 10 cm dicken, biotitreichen, dunklen Zwischenlagen (79) angefahren, an die fester, ziemlich feinkörniger, z. T. stärker geschieferter Biotitgranitgneis mit viel Muskowit (= zweiglimmeriger Granitgneis) (80) anschließt. Etwa 0-3 m über der Hangendgrenze des Muskowitgranitgneises tritt eine bis über 0-5 m mächtige Zone mit ganz dünnen weißen Lagen auf, die z. T. stark kleingefältelt sind. Bei m (SO-Ulme) handelt es sich um mehrere ganz dünne, stark gefältelte weiße Lagen (81). Von hier an wird der Biotitgranitgneis ganz massig und er führt auch vereinzelt große Feldspataugen. Von bis m folgt wieder fester, feinkörniger, z. T. stark geschieferter Biotitgranitgneis mit zahlreichen dünnen weißen Lagen (82), die z. T. stark kleingefältelt sind. Mehrere dünne weiße Lagen bilden die N-Grenze des südlich davon angrenzenden festen, feinkörnigen, mehr massigen Biotitgranitgneises, in dem nur einzelne stärker geschieferte
8 112 Partien und nur einzelne kürzere Stücke von gefältelten dünnen weißen Lagen auftreten (83). Nur bei »» (SO-Ulme) findet sich eine längere, bis 10 cm starke Muskowitgranitgneislage (84), die intensiv gefältelt ist. In ihrem Hangenden ziehen noch einige ganz dünne solche Lagen durch. Zwischen und m (SO-Ulme) hat derselbe, z. T. stark geschieferte und stärker gestörte Granitgneis stellenweise reichlich dünne weiße, meist stark gefaltete Lagen, während südlich davon der Granitgneis mehr massig und sehr arm an weißen Lagen ist und von m an z. T. wieder stärker geschiefert ist und teils einzelne, teils zahlreiche dünne weiße, teilweise stark gefaltete Lagen führt. Bei 1210 und bei 1221 m (SO-Ulme) ziehen stark gestörte, z. T. m. u. w. Ruschelzonen (85) durch. Vielfach handelt es sich bei den ausgeschiedenen dünnen weißen Lagen nicht um eine einzige, sondern um mehrere, öfters treten stärkere Vorkommen von vorwiegend Muskowitgranitgneis mit etwas Biotit (86) auf, die meist intensiv gefaltet sind. Bei 1260 m treten auch einige dünne, biotitreiche, dunkle Zwischenlagen innerhalb des weißen Granitgneises auf. Bei m beginnt sehr fester, ziemlich feinkörniger, massiger Biotitaugengneis (87) mit einzelnen großen Feldspataugen, nur wenigen stärker geschieferten Lagen und zahlreichen Querklüften ± J_ B. Von 1368 m an geht das Gestein in festen, vorwiegend feinkörnigen, ziemlich massigen, weniger gestörten Biotitgranitgneis (88) über, der gegen den südlich davon folgenden, mehr feinkörnigen, stark geschieferten, gefalteten und gestörten Biotitgranitgneis (89), der stellenweise reich an dünnen weißen Lagen ist, nicht scharf abgegrenzt werden kann. Wo die Granitgneise mehr massig ausgebildet sind, treten meist reichlieh Störungen auf, während sie dort, wo sie stark geschiefert und gefaltet sind, seltener von Bewegungsflächen durchsetzt werden. Zwischen und 1389 m ist der Granitgneis weniger stark gestört. Von bis m ist er stärker geschiefert und bei 1375 (hier Einbau) und 1403 m treten sehr stark gestörte, z. T. m. u. w. Quetschzonen (90) auf. Bei 1383 m (SO-Ulme) findet sich eine kleinere Scholle von festem Biotitaugengneis (91). Mehrfach treten Lagen von Muskowitgranitgneis (92) auf. Die bei m ist durch dünne, biotitreiche, dunkle Lagen gebändert. Bei 1381 m (SO-Ulme) ist der etwas biotithaltige Muskowitgranitgneis sehr stark gestört, z. T. m. Auch zwischen 1397 und 1403 m ist dieser Granitgneis etwas biotitführend. Bei 1302 m ist der weiße Äplitgneis (93) stark ausgewalzt. Bei 1375 m führt die bis über 5 cm starke Apütgneislage etwas Hornblende, Auch im Biotitgranitgneis treten hier mehrere, bis über 1 cm starke Lagen mit reichlich Hornblende auf. Bei 1336 m zieht eine dünne, bis über 10 cm mächtige, äußerst biotitreiche Lage (= Bewegungshorizont) durch, die in ihrem Liegenden von einer bis 5 cm starken Muskowitgranitgneislage (94) begleitet wird. Eine ähnliche, sehr biotitreiche Lage findet sich bei 1349 m (94'). Zwischen 1407 und m stehen vier bis über 10 cm starke und mehrere dünne weiße Aplitgneislagen (95) an, die mit biotitreichen, dunklen Lagen gebändert sind. An diese schließt fester, mehr feinkörniger Biotitaugengneis mit einzelnen großen Feldspataugen an (96), dem nahe seiner N-Grenze weißer Äplitgneis mit etwa Biotit (97), eine Muskowitgranitgneislage (98) und eine schmale Zone von stark geschieferteni Granitgneis mit dünnen weißen Zwischenlagen (99) eingeschaltet ist. Zwischen und m ist der Biotitaugengneis stark gestört, z. T. m, u. w., und
9 113 nicht standfest. Diese gestörte Zone ist gegen N nicht scharf abgrenzbar. Nach S schließt eine weniger stark gestörte und zertrümmerte, aber feste Zone mit einer Muskowitgranitgneislage (98) an, an die bei m fester, z. T. stärker gestörter und zertrümmerter weißer Aplitgneis grenzt (100). Bei m beginnt eine mächtige Biotitgranitgneiszone (101). Zwischen seiner N-Grenze und m ist dieses Gestein (mit zwei Muskowitgranitgneislagen = 102) stärker geschiefert. Von der N-Grenze bis 1456 m ist das Gestein trotz einer schmäleren, stark gestörten Ruschelzone (103, Einbau von bis 1447 m) etwas weniger stark gestört und meist fest. Südlich davon treten zwei sehr stark gestörte, z. T. m. u. w. Quetschstreifen (104) und zwei breitere, stark gestörte und zerhackte, z. T. nicht standfeste Partien (105, Einbau von bis m) auf. Südlich davon ist das Gestein bis etwa 1475 m (keine scharfe Grenze!) stärker gestört, aber fest. Der sehr feste, ± feinkörnige, massige Biotitgranitgneis, dessen Bankung meist nicht recht erkennbar ist, ist mit Ausnahme seiner südlichsten Lagen größtenteils weniger stark gestört. Zwischen 1541 und 1562 m (keine scharfe Grenze!) ist das Gestein wieder stärker gestört und z. T. grob zerhackt. Von 1530 m an wird der Granitgneis gegen N gröber und ist ab 1520 m z. T. grobkörnig. In dieser Zone treten noch eine dünne und eine stärkere, z. T. ausgewalzte Aplitgneislage (106), drei dünne bis über 5 cm starke, weiße quarzitische Lagen (107, nur eine davon ausgeschieden, nur z. T. // s) und ein Pegmatitgang (108) auf. Bei 1595 m zieht ein stark gequetschter, z. T. m. u. w. Störungsstreifen (109) durch, an den feinkörniger Biotitgranitgneis (110) grenzt. Bei etwa 1680 m findet ein allmählicher Übergang in den mehr feinkörnigen Biotitaugengneis (111) statt. Da das Streichen hier ziemlich parallel zur Stollenachse verläuft, lassen sieh einzelne feinkörnige Biotitgranitgneislagen bis zur Einmündung des Zaverna-Fensterstollens bei m nach S verfolgen. Zwischen 1596 und 1615 m ist der Biotitgranitgneis stärker gestört und etwas grob zertrümmert, aber fest. Südlich davon ist das feste Gestein weniger stark gestört, doch treten an der NW-Ulme stark geschieferte Lagen auf, besonders zwischen 1660 und 1670 m. Zwischen 1631 und 1651 m finden sich dünne, z. T. ausgequetschte und gefaltete Aplitgneislagen (112), während dieselben Lagen bei 1660 und m rostbraun anwittern, wobei sie z. T. von Störungen begleitet werden. Zwischen 1750 und 1800 m geht der sehr feste, feinkörnige Biotitaugengneis allmählich in mehr grobkörnigen mit Biotitnestern über, der ziemlich massig ist und die Bankung nicht deutlich erkennen läßt. Bei 1691 m ist der Granitgneis zerdrückt (113). Südlich davon treten mehrere quarzitische Lagen (114) meist ± // s auf. Zwischen 1727 und 1737 m ist eine dieser Lagen zu Linsen ausgewalzt. Zwischen 1825 und 1848 m treten zwei, bis ein paar dm starke, feinkörnigere Zwischenlagen im groben Biotitaugengneis auf, wodurch die Bankung wieder deutlich zu erkennen ist. Bei m findet sich eine bis einige cm -weit geöffnete Verwerfungsspalte (115). Bei und m sind stärker gestörte, noch standfeste Quetschzonen (116) zu beobachten. Zwischen denselben treten drei Pseudotachylytgänge auf, was um so bemerkenswerter ist, als solche bisher nur vom Überschiebungsrande der Silvrettadecke bekannt waren. Bei m findet sich ein ganz dünner, bis über 10 cm starker, grünlicher Pseudotaehylytgang mit rostbraunem Spiegel (H), bei m ein dünner und bei m Jahrbuch Geol. B. A. (1949/51), Bd. XCIV, 2. Teil. 8
10 114 ein dünner, bis ein paar cm starker ebensolcher Gang. Diese drei schmalen Gänge sind an Bewegungsflächen gebunden, worauf auch die an ihnen erhaltenen Harnischflächen hinweisen. Die zwischen 1930 und 1946 m aufgefahrenen Quarzgänge sind durch die Störungen teilweise etwas ver* worfen worden. Bei m wurde ein weiterer, bis 1 cm starker, grünlicher Pseudotachylytgang (H) angetroffen. Südlich davon folgt eine stärkere, am N-Ende mehrfach gefaltete und eine dünne Aplitgneislage (117), die beide größtenteils // s verlaufen. Zwischen 2004 und 2008 m treten im Biotitaugengneis unregelmäßige, biotitarme, stark saure Partien auf. Bei m (SO-Ulme) ist der Granitgneis stärker gestört. Auf derselben Ulme zieht bei 2076*5 m eine stärker quarzitische und biotitärmere Lage (118) durch, während bei 2086 m ein Aplitgang (119) zu beobachten ist. Zwischen 2106 und 2113 m ist der Granitgneis wegen der vielen Störungen nicht so fest wie in den wenig gestörten Partien, aber doch standfest. Zwischen und m zieht eine breitere Mylonitzone (120, Einbau von 2141 bis 2154 m) durch. Das Gestein ist teils zu feinkörnigem, teils zu ganz dichtem, weichen, hellgrauen Material zerrieben. Das feinkörnige Material läßt noch deutlich erkennen, daß es sich um völlig zerdrückten Granitgneis handelt. Innerhalb dieser nicht standfesten Mylonitzone treten eine größere (121) und einzelne kleine, weniger stark gestörte Partien auf. Zwischen und m steht wieder grobkörniger Biotitaugengneis mit großen Feldspataugen und Biotitnestern an (122), dem nahe seiner S-Grenze, nicht scharf abgrenzbar, feinkörniger Biotitaugengneis (123) zwischengeschaltet ist. Bei m tritt eine dünne, weiße, quarzitische Lage (124) auf. Bei m zieht ein stark gefalteter, weißer, rostbraun anwitternder Aplitgang (125) durch. Südlich davon folgen mit gleichen Farben zwei, z. T. ausgequetschte Aplitgneislagen ziemlich // s verlaufend (126). Ohne scharfe Grenze beginnt bei m wieder mehr feinkörniger Biotitaugengneis, der nahe seiner N-Grenze von einer stärker gestörten Zone (128) durchsetzt wird. 7 m südlich davon folgt eine ganz dünne, weiße Aplitgneislage (129). Bei m schließt mit unscharfer Grenze sehr fester, grobkörniger Biotitaugengneis mit Biotitnestern (130) an.. Dieser läßt die B-Achsen meist nicht deutlich, vielfach auch gar nicht erkennen, während sie im feinkörnigen meist sehr deutlich ausgeprägt 'sind. Bei 2421 m (SO-Ulme) tritt ein bis 10 cm starker, geschieferter und gefalteter Aplitgang (131) auf, bei 2500 m auf derselben Ulme weißer Quarzit mit rostbraunen Flecken (132, nicht // s) und bei m eine bis 2 cm weite, mit grünem Chlorit verheilte Kluft (133). Die Punkte zwischen 2517 und 2523 m (SO-Ulme) deuten weiße Quarzlinsen (134) an, und die Schraffen um 2530 m eine ein paar dm mächtige, stärker geschieferte Lage mit sehr deutlichen B-Achsen (135). Bei m quert eine bis 10 cm starke quarzitische Lage (136) den Stollen. Bei 2555 und 2618 m zieht je eine stärker gestörte, aber noch feste Zone (137) durch. Der weiße Aplitgang (138) bei m verläuft quer zum Streichen, ist aber in der gleichen Weise geschiefert wie das Nebengestein. Zwischen 2643 und 2670 m handelt es sich um eine zusammengehörende, bis ein paar cm starke weiße Aplitgneislage (139). Bei 2714 m (SO-Ulme) ist ein kleiner Pegmatitgang (140) zu beobachten. Bei 2780 m ist das Gestein stark gestört, aber fest (141), und bei 2831 m sehr stark gestört, aber fest (142).
11 115 Zwischen und 2790 m ist dem groben Biotitaugengneis stark geschieferter Biotitaugengneis (143) diskordant zwischengeschaltet. An der S-Grenze dieser Einschaltung tritt eine 1 2 dm mächtige, stark geschieferte Lage mit zwei bis drei ganz dünnen, weißen Quarzitlagen (144) auf. Zwischen 2480 und 2830 m ist der Granitgneis mehr massig entwickelt, meist ohne deutliche Bankung, während er weiter südlich großenteils ± deutlich gebankt ist. Von bis m steht z. T. sehr stark geschieferter Granitgneis (145) an, der bis 2848 m standfest ist, dann rasch stärker gestört, aber weniger geschiefert und nicht ganz standfest wird. Daran schließt eine sehr stark gestörte, z. T. m. u. w. Zerrüttungszone (146) an, in der eine größere, ganz m. u. w. und auffallend weiße Partie (147) auftritt (Einbau von 2848 bis 2870 m). Bei m beginnt wieder mächtiger, sehr fester, grobkörniger Biotitaugengneis mit Biotitnestern (148), die aber vom Stollenmeter 3080 an gegen S ganz zurücktreten. Bei 2907 m (SO-Ulme) findet sich eine bis über 2 dm starke, weiße Aplitgneislage (149) und um 2980 m zeichnet sich eine Lage durch besonders große Feldspataugen (150) aus. Die in den Granitgneisen häufig auftretenden Querklüfte ± senkrecht zu den B-Achsen wurden später vielfach zu Bewegungsflächen umgestaltet, wie dies z. B. auch zwischen 2990 und 3000 m der Fall ist. Bei 3005 m tritt ein bis über 1 dm starker und bei m ein bis 5 cm starker, weißer Aplitgang (151) auf. Der geschieferte weiße Aplitgang mit rostbraunen Flecken bei 3039 m ist z. T. gefaltet und stark ausgequetscht. Bei m sind zwei dünne bis 2 dm starke Aplitgneislagen // s zu beobachten, die durch eine Schubfläche getrennt werden (152). Bei m findet sich eine bis 2 dm und südlich davon eine bis 8 cm starke, weiße Quarzitlage (153). Zwischen 3128 und 3133 m treten einzelne Lagen mit Muskowit auf, der zwischen 3133 und 3142 m ganz den Biotit vertritt, so daß das Gestein hier als Muskowitgranitgneis bis Muskowitaugengneis zu bezeichnen wäre. Bei m findet sich ein besonders deutlicher Harnisch, auf dessen S-Seite das Gestein ein paar dm breit ganz mylonitiseh ist. Nahe 3210 m zieht eine fein zertrümmerte und w. Quetschzone (154) durch, auf deren N-Seite das Gestein stark zerklüftet und weniger fest ist, während es auf der S-Seite z. T. stärker zertrümmert und ebenfalls weniger fest ist. Bei m (SO-Ulme) tritt eine bis 1 dm mächtige, grünliche Mylonitlage (siehe Punkte!) auf. Bei m ist der Schnittpunkt der Achse des m langen Zugangsstollens mit der des Druckstollens. Der von hier gegen W verlaufende Teil des Druckstollens, der in den Vermunt-Stausee mündet, wird Seestollen bezeichnet. Der SeestoUen Der Stollen verbleibt bis m in festem, typischem Biotitaugengneis, der meist reich an Klüften ist. Je weniger der Granitgneis von Störungen durchsetzt wird, um so fester ist er, wie dies z. B. zwischen 3260 und 3320 m der Fall ist. Bei m folgt eine Störung einer bis 3 cm starken gelblichen, quarzitischen Lage (155) entlang, wobei letztere teilweise ausgequetscht wurde. Bei m folgen ein paar Meter Muskowitaugengneis (156), der zusammen mit dem Nebengestein auf der O-Seite z. T. stärker gestört und weniger standfest ist (Kopfschutz von bis
12 m). An den Muskowitaugengneis schließt fester Biotitaugengneis an, in dem lagenweise auch Muskowit auftritt (157). Entlang einzelner Störungen ist das Gestein etwas zertrümmert und daher weniger fest. Zwischen und 3399 m und zwischen 3424 und m findet sich je ein Gang von festem, grauem, ganz dichtem Diabas (158). Zwischen diesen beiden Gängen und westlich des zweiten steht sehr fester, wenig gestörter Biotitaugengneis (159) an. Nur die östlichen Grenzlagen des Biotitaugengneises gegen den östlichen Diabasgang sind stärker gestört, z. T. etwas zertrümmert, aber noch standfest. Bei m ist dem Biotitaugengneis weißer, auf den Klüften rostbraun anwitternder Aplitgneis (160) zwischengeschaltet. Von m an ist das Gestein oberflächlich etwas aufgelockert und im äußersten Teil des Stollens nicht ganz standfest (geringe Überlagerung!). Die stark eisüberschliffene Felsoberfläche wird bei 3472 m von gering mächtiger Würm-Grundmoräne (161) überlagert, die von erdigem Gehängeschutt mit einzelnen eckigen Blöcken (162) überdeckt wird. Der Zugangsstollen Das Mundloch dieses Stollens liegt unterhalb der Winkelstation, nördlich (auf der Außenseite) der Staumauer des Vermunt-Stausees. Von der Abzweigung des Seestollens bei 354 m verbleibt der Stollen bis m im festen, harten Biotitaugengneis, der zwischen 326 und 328 m von zwei, z. T. feinkataklastisch zertrümmerten und w. Quetschzonen (163) durchsetzt wird. Bei m zieht eine bis 15 cm starke, helle, quarzitische Lage (164) durch, die teilweise ausgequetscht ist. Zwischen und m tritt ein Diabasgang (165) auf. Das feste, dichte, graugrüne Gestein ist teilweise etwas grob zertrümmert, besonders bei 280 m (SO-Ulme, siehe Schraffen!). An der O-Grenze des Diabases ist dem Granitgneis eine ±5cm starke Lage von derbem weißen Quarz mit Kiesspuren (166) zwischengelagert. Von m an wird wieder Biotitaugengneis durchörtert, der zunächst noch fest, von 252 m an aber nicht mehr ganz standsicher ist. Bei m verläßt der Stollen den anstehenden Fels und durchquert einen aus Feinsand-Grobsand-Grobkies mit kleinen bis großen eckigen Blöcken bestehenden Schuttkegel (167). Auch alle kleinen Stücke sind eckig, nur selten etwas kantengerundet (Einbau von 252 bis 194 m). Bei 210 m erreicht der Stollen wieder den anstehenden, harten Biotitaugengneis (148) und verbleibt in ihm bis nahe an das W-Portal. Bis 194 m ist das Gestein wegen zu geringer Überdeckung nicht ganz standfest. Zwischen 199 und 197 m kann es sich an der östlichen Ulme nur um eine offene, ±lm breite Spalte handeln, die sich nach der Tiefe rasch verengte. Diese Spalte, die im oberen Teil mit Moränenmaterial (gut gerollte Geschiebe bis H- 0-5 m Durchmesser) ausgefüllt war, weist ebenfalls auf die geringe Mächtigkeit der Felsüberdeckung in diesem Bereiche hin. Zwischen 136 und m ist das Gestein z. T. stärker geschiefert, sieht mehr einem Schiefergneis ähnlich, ist aber doch nicht vom übrigen Granitgneis abzutrennen. Bei und bei m tritt je eine bis 1 dm starke Lettenkluft auf. Bei m findet sich eine mehrere cm starke, gelbliche Quarzitlage (168), die von einer dünnen Lettenkluft begleitet wird. Bei m sind zwei dünne, mehrere cm starke, gelbliche Quarzitlagen zu beobachten. Weitere solche Lagen treten bei 61-1 m (± 5 cm stark), bei 50 m (bis 3 dm mächtig), bei 22-7 m (bis 5 cm stark, nicht // s) und bei
13 m (3 5 cm stark) auf. Bei 47-5 m steht nur an der südlichen Ulme bis 1 dm starker, gelblicher Quarzit an. Das Auftreten dieser quarzitischen Lagen, die meist konkordant den Biotitaugengneislagen zwischengeschaltet sind und teilweise in ihrem Liegenden oder Hangenden (bei 50 m auf beiden Seiten) von dünnen Schmierlassen begleitet werden, ist eigenartig. Bei 4-4 m wird der sehr feste Biotitaugengneis mit seinen meist zahlreichen Klüften von Gehängeschutt aus Biotitaugengneismaterial (169) überlagert. Die Felsoberfläche ist hier deutlich eisüberschliflen. Die Beschaffenheit des Zaverna-Stollens und die Lage der Gesteine Die geologischen Verhältnisse des Druckstollens sind, soweit er im anstehenden Granitgneis verläuft und eine genügend große Überlagerung hat, als außerordentlich günstig zu bezeichnen, da es sich bei diesem Gestein um eines der festesten der Silvrettadecke handelt, das hier verhältnismäßig wenig tektonisch beansprucht worden ist. Die schlechten Gesteinsstrecken lassen sich vielfach nicht recht abgrenzen, da es sich nur teilweise um scharfe Grenzen, z. T. aber auch um allmähliche Übergänge handelt. Als erschwerend kommt noch hinzu, daß die Störungszonen vielfach unregelmäßig umgrenzte Gebilde sind und daß sie den Stollen häufig Hb schräg queren. Außerdem können auch stark gestörte Partien mitunter noch standfest sein. Ein annähernd richtiges Bild über den Anteil der schlechten Gesteinsstrecken vermitteln die Strecken mit Einbau, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß schmale schlechte Zonen vielfach ohne einen solchen geblieben sind. Die hier beschriebenen Stollenstrecken haben eine Länge von zusammen rund 3885 m. Die Strecken mit Einbau einschließlich Kopfschutz haben eine Gesamtlänge von etwa 232 m. Rechnet man davon die Schuttstrecken mit einer Länge von rund 52 m ab, so verbleiben 180 m Einbau auf einer Felsstrecke von 3833 m Länge. Da das Gebirge in den durchörterten Stollenstrecken nirgends druckhaft war und da das Gestein nur auf nicht ganz 5 % der Gesamtlänge der Stollenstrecken im anstehenden Fels nicht standfest ist, können die Gesteinsverhältnisse dieser Strecken als sehr günstig bezeichnet werden. Die Lage der Gesteine kann, soweit sie erkennbar ist, den Stollenaufnahmen entnommen werden. Mit Benützung des beiliegenden Lageplanes kann das Streichen der Gesteinsbänke aus dem Stollenprofil unmittelbar abgelesen werden, nachdem die Aufnahme der betreffenden Stollenstrecke parallel zu dem entsprechenden Abschnitt des Lageplanes orientiert worden ist. Das Fallen kann nur dann unmittelbar aus dem Stollenprofil abgemessen werden, wenn das Streichen senkrecht zur Stollenachse verläuft. Eine Ausnahme bildet die saigere Stellung der Gesteinsbänke, die unabhängig von der Streiclirichtung aus dem Profil abgelesen werden kann. Bei allen Streichrichtungen ± schräg zur Stollenachse und einem Fallwinkel <90 läßt sich das Fallen jeweils mittels einer einfachen Konstruktion ermitteln, während sich alle Gesteinslagen parallel zur Stollenachse in der hier verwendeten Darstellungsweise nicht eindeutig einzeichnen lassen. Neben der Eintragung der Gesteinsbankung, der Gesteinsgrenzen und der Störungen wurde auch das Streichen und Fallen der Bankung (s-flächen) und der B-Achsen, soweit es möglich war, etwa alle 20 m mittels des Kompasses eingemessen. Auf der beiliegenden Tafel wurden alle Messungen von s-flächen mittels Fallzeichen an der Meßstelle zur Darstellung gebracht.
14 118 Dabei zeigt sich, daß das Streichen vielfach ganz spitzwinklig, mitunter ± parallel zur Stollenachse verläuft, wobei das Einfallen meist ± mittelsteil gegen NW erfolgt. Außerdem macht sich etwa zwischen Stollenmeter 500 und 1500 und östlich der Abzweigung des Seestollens ein besonders starkes Pendeln der Streichrichtungen bemerkbar, das auf die Faltung der Gesteine zurückzuführen ist. In gleicher Weise wurden auch die B-Achsen dargestellt. Abb. 3. Alle eingemessenen Bankungs- und Schieferungsflächen' (= s-fläehen) und Falten- und Streckachsen (= B-Achsen) wurden auch mit Hilfe der flächentreuen Azimutalprojektion dargestellt. Bei dieser werden die Darstellungen einer unteren Halbkugel, von innen gesehen, flächentreu auf die Azimutalebene projiziert. Diagramm Fig. 1 wurde durch einprozentige Auszählung der Normalen-Darstellung der Schieferungsflächen gewonnen und Diagramm Fig. 2 durch einprozentige Auszählung der Durchstichpunkte der B-Achsen. Da bei der Eintragung der Lote, bzw. Durchstichpunkte in die Teildiagramme die Besetzung derselben ziemlich gleichmäßig erfolgte, genügt
15 119 für die Darstellung aller s-flächen und B-Achsen des Stollens je ein Sammeldiagramm. Diagramm 1 stellt 215 Lote von s-flächen dar mit folgender Besetzungsdichte: 0 0-5, 0-5 1, 1 2, 2 3, 3 5, 5 7, 7 9, über 9% (bis 27%), Das Streichen pendelt so stark, daß fast alle Streichrichtungen beobachtet werden können. Dagegen pendelt das Fallen nur zwischen 16 und 65 gegen N bis W. In dem Diagramm tritt ein sehr starkes Maximum ungemein deutlieh hervor, das N O corr. streicht und NNW bis NW fällt. Am häufigsten sind also Streichrichtungen, die zwischen NNO SSW und OW pendeln, wobei wieder die ± ONO WSW verlaufenden Streichrichtungen überwiegen. Diagramm 2 stellt 120 Durchstichpunkte von B-Achsen mit folgender Besetzungsdiehte dar: 0 1, 1 2, 2 3, 3 5, 5 7, 7 9, 9 11, über 11% (bis 21%). Auch bei den B-Achsen können fast alle Streichrichtungen festgestellt werden. Das Fallen schwankt zwischen 0 und 53 und erfolgt vorwiegend gegen W. Auch in diesem Diagramm tritt ein sehr ausgeprägtes Maximum hervor, das N W corr. streicht und W fällt. Die B-Achsen streichen also überwiegend ± WNW OSO bis WSW ONO. An sieben Stellen konnten je zwei Systeme von B-Achsen deutlich wahrgenommen werden. Bei fünf dieser Stellen fallen die jüngeren B-Achsen ± flach gegen O ein. Nachdem alle eingemessenen s-flächen mittels Fallzeichen dargestellt waren (siehe Profiltafel!), wurde von jeder s-fläche mit der ihr unmittelbar benachbarten die Sehnittgerade x ) konstruiert. Die Besetzung der Durchstichpunkte der Schnittgeraden auf der Lagenkugel erfolgte derart gleichmäßig, daß für ihre Darstellung ein Sammeldiagramm genügt. Diagramm 3 stellt 213 Durchstichpunkte von p-sehnittlinien mit folgender Besetzungsdichte dar: 0 0-5, 0-5 1, 1 2, 2 3, 3 5, 5 7, 7 9, über 9% (bis 12%). Dieses Diagramm stimmt mit Diagramm 2 sehr gut überein. Die ß- Achsen-Häufungen fallen mit solchen der B-Achsen zusammen, somit ist erwiesen, ^daß sie einem gleichen Deformationsplan angehören. Vergleich mit den geologischen Verhältnissen ober Tag Eine Begehung der Stollentrasse ist nur auf einem kurzen Teil der Strecke möglich, da sie der NW-Wand der Zaverna-Spitze mit ihren steilen Plattenschüssen und tief eingeschnittenen Schluchten entlang führt. Deshalb sind hier meist nur die Fußpartien der Felswände begehbar. Als weitere Schwierigkeit kommt noch die große Ungenauigkeit des hier in Betracht kommenden Teiles der Originalaufnahmesektion 1: hinzu, die ganz unzulänglich ist und deshalb jede detailliertere Darstellung unmöglich macht. Die Stollenaufnahme wurde auch in einem sehr vereinfachten Profil im Maße 1:5000 dargstellt. Da in dem Lageplan gleichen Maßstabes die Schichtenlinien nur in der nächsten Umgebung der Stollenportale eingetragen sind, mußte das viel längere Zwischenstück mit Hilfe der Originalaufnahmesektion ergänzt werden, wobei sich die starke Vergrößerung ebenfalls ungünstig auswirkt. Während das Stollenprofil lückenlos ist, sind ober Tag mehrfach längere Strecken mit Gehänge- oder Moränenschutt verdeckt. Außerdem sind die geologischen Verhältnisse des Druck- 1 ) B. Sander: Einführung in. die öefügekvmd der geologischen Körper I, Wien 1948,
16 120 Stollens teilweise recht kompliziert, da stellenweise starke Faltungen, Verknetungen und Ausquetschungen auftreten. Ferner werden die Gesteine von einem dichten Netz von Bewegungsflächen durchsetzt. Aus allen hier angeführten Gründen ist es daher unmöglich, die Gesteinslagen des Stollens mit jenen der Oberfläche zu verbinden, um auf diese Weise ein geschlossenes Profil zu erhalten. Im Gegensatz zu den Verhältnissen des Druckstollens ist die Lagerung der Gesteine an der Oberfläche eine viel ruhigere. Die Gesteinsbänke liegen größtenteils ± parallel zur Gehängeoberfläche, wie dies auch sehr schön von der Höhenbahn aus auf der gegenüberliegenden Talseite (== W-Seite des Groß-Vermunttales) zu beobachten ist. Soweit die Aufschlüsse erkennen lassen, herrschen ober Tag die Biotitaugengneise bei weitem vor. Daneben treten noch feinkörnigere Granitgneise auf, u. zw. Biotitgranitgneise und zweiglimmerige Granitgneise. Muskowitgranitgneis wurde nur am Grat N unter der Zaverna-Spitze, SW ober Punkt 1845 der Karte 1: , wo der Grat so stark nach N abfällt, beobachtet. Die Biotitaugengneise bauen östlich der 111 die Zaverna-Spitze, Oisper- Spitze, Breiter Spitze, Ballun-Spitze und Valiüla auf, reichen wahrscheinlich aber nicht auf die O-Seite des Kleinvermunttales hinüber. Ihre N-Grenze verläuft von Parthenen über Außer Ganifer nördlich der Punkte und 2016 zur Bell Alpe. Die gewölbeförmig gegen Kf untertauchenden Biotitaugengneise werden von meist gering mächtigen Schiefergneisen und sehr mächtigen Amphiboliten überlagert. Auf der W-Seite des Groß- Vermunttales bauen die meist dickgebankten Biotitaugengneise die Felsgehänge bis hoch hinauf auf. Die W-Grenze gegen die im Hangenden folgenden Schiefergneise und Amphibolite folgt ungefähr der Schrägaufzugtrasse von Parthenen nach Obertromenir entlang und von dort bis knapp unter den Gipfel des Breitfieler Berges. Die oberen Partien des StriUkopfes und die obersten Teile des Hochmaderer werden von Amphiboliten gebildet. Die Biotitaugengneise lassen sieh südlich vom Hochmaderer ohne Überlagerung bis ins Garneratal hinab verfolgen und reichen auf der O-Seite dieses Tales mindestens bis westlich des Schaf boden Berges nach N. Die Amphibolite reichen auf der W-Seite des Hochmaderer und des StriUkopfes viel weiter (nach W) hinab als auf der O-Seite. Diese schräge Lagerung im südlichen Teil des Garneratales läßt auf ein deutliches Untertauchen der Biotitaugengneise gegen W sehließen. Wie weit sich diese Granitgneise gegen W und S erstrecken, ist derzeit noch nicht bekannt. Während die Biotitaugengneise oberflächlich meist nur leicht gefaltet sind, nimmt die Intensität der Faltung nach der Tiefe stellenweise beträchtlich zu. Auch die schwache Faltung kann schon ein ziemlich starkes Pendeln von Streichen und Fallen zur Folge haben. In den tieferen Teilen der Granitgneismasse treten auch Zwischenlagen von Muskowitgranitgn eisen und Aplitgneisen viel häufiger auf. Die geologische Vorhersage für den Druckstollen hat sich als ziemlich, richtig erwiesen. Die geologischen Verhältnisse waren recht günstig, aber nur teilweise einfach. Druckhafte Stellen wurden nicht angetroffen, wohl aber wurden verschiedene Zertrümmerungszonen aufgefahren. Vor der Absenkung des Vermunt-Stausees wurde mit dem eventuellen Auftreten von mächtigerem jungen Moränenschutt beim Portal des Seestollens gerechnet, da solcher auf der O-Seite dieses Stausees weit verbreitet
17 121 ist. Tatsächlich wurden nur ein paar Meter Gehängeschutt durchörtert, an dessen Liegendgrenze eine ganz gering mächtige Wurm-Grundmoräne angetroffen wurde. Die Wasserverhältnisse Beim Vortrieb des Richtstollens erfolgte zwischen Stollenmeter 927 und 933 ein Wassereinbruch mit Ijsek. Das Wasser ist dann allmählich bis auf etwa 1 Ijsek. zurückgegangen. Ein weiterer Wassereinbruch mit anfangs 8 10 Ijsek. erfolgte bei zirka 1445 m aus einer Ruschelzone (103). Die Wassermenge hat sich langsam bis auf etwa 2 Ijsek. vermindert. Von der Bauleitung wurden im Druckstollen nach Fertigstellung des Vollausbruches 20 Quellen, bzw. besonders starke Tropfstellen beobachtet. Von diesen wurden 10 Quellen gemessen. Die stärkste lieferte 2-6 Ijsek. und die schwächste 0-25 Ijsek. Die Schüttung aller 10 Quellen ergab 9-45 Ijsek. Die geologische Aufnahme der oben angeführten Stollenstrecken erfolgte in der Zeit vom Juni 1948 bis April 1949, wobei die einzelnen Strecken jeweils erst knapp vor der Betonierung aufgenommen werden konnten. Wie in den meisten Stollen im Bereiche der Silvrettadecke wurde auch in den hier beschriebenen Stollen ein ständiger Wechsel zwischen trockenen und sehr nassen Strecken mit allen möglichen Übergängen, wie feucht, schwach tropfend usw. festgestellt. Die ganz trockenen Strecken erreichen nur eine Länge von 30 m, die feuchten eine solche von 336 m. Die Länge der trockenen bis feuchten Strecken mit stellenweisen schwachen Tropfstellen betrug 2701 m. Dazu kommen noch verschiedene längere schwache Tropfstellen mit zusammen 264 m Länge. Eine 20 m lange Strecke hatte schwache bis mittelstarke Tropfstellen. Die mittelstarken Tropfstellen erreichten eine Länge von m, die starken eine solche von 61 m und die sehr starken 27-5 m. Auf einer 62 m langen Strecke wurde stellenweise mittelstarkes bis starkes Tropfen beobachtet und auf einer Strecke von 43 m Länge ebensolches Tropfen mit einzelnen schwachen Quellen (bei m an der SO-Ulme, bei 2207 m an der NW-Ulme, bei 2212 m am First, bei 2223 m an der NW-Ulme 1 2 Ijsek., bei m an der NW-Ulme, bei 2229 m an der NW-Ulme 1 2 Ijsek., bei m an der SO-Ulme und bei 2244 m an der NW-Ulme). Außerdem ist noch eine größtenteils stark tropfende bis rinnende Strecke mit 47 m Länge, eine stark rinnende mit 5 m Länge und eine sehr stark rinnende mit 2 m Länge und eine ganz schwache Quelle bei 1023 m (an der NW-Ulme) zu erwähnen. Die hier gemachten Angaben haben aber nur für die oben angeführte Zeit Gültigkeit, da sich die Wasserverhältnisse im Stollen vielfach innerhalb kurzer Zeit stark ändern können. So konnten z. B. von den von der Bauleitung beobachteten Quellen und starken Tropfstellen nur mehr zwei an derselben Stelle angetroffen werden. Die Quellen, Tropf- und Sickerwässer sind teilweise von der Jahreszeit und den Witterungsverhältnissen stark abhängig. Besonders lästig für den Stollenbau ist die nicht selten beobachtete Tatsache, daß das an der Stollenbrust auftretende Wasser beim Vortrieb oft auf einer dt langen Strecke mitwandert. Die beigegebenen, von der Materialprüfungsanstalt der Vorarlberger Illwerke in Parthenen zusammengestellten Tabellen vermitteln einen Einblick in den Chemismus der Stollenwässer, soweit dies für die Zwecke der Bauleitung erforderlich war.
18 122 Übersicht über die Ergebnisse der ehem. Untersuchung der im Druckstollen Tag der Probeentnahme Stollenkilometer Härte in deutschen Graden Karbonat Mineral Gesamt Sulfat-Ion SO ä ' ' mg S0 3 / zirka 21 mg SOJl wenig vorhanden mg SO a /l mg S0 3 / mg S0 3 / mg S0 3 / , vorhanden mg S0 3 / mg SO s /l 10., S.'ll ,, mg SOJl mg SOJl Zugangsst O-U vorhanden wenig vorhanden mg SOJl mg SOJl _ wenig vorhanden mg SOJl Umg SOJl mg SOJl
19 123 Vallüla-Vermunt in den Jahren entnommenen Wasserproben Nitrit-Ion Nitrat-Ion Chlor-Ion Freie Kohlensäure NO ä NO s Cl co 2 nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden -- _ 2-2 mgß nieht vorhanden nieht vorhanden 2-2 mgß nieht vorhanden._ 2-2 mgß nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden. nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden nieht vorhanden
20 124 Tag der Probeentnahme Stollenkilometer Härte in deutschen Graden. Karbonat Mmeral Gesamt Sulfat-Ion so mg SO a /l <4 2-5 zirka 21 mg SO,/l wenig vorhanden mg SO,/l »ff SOj/ , zirka 21 mg SO»/l ' wenig. vorhanden wenig vorhanden mg S0 3 / mg S0 3 / , tag SO s /l , M 2-8 wenig vorhanden Tag der Probeentnahme Härte in deutsches Graden Stollen- Sulfat-Ion kilometer S0 4 Karbonat Mineral Gesamt SW-F '. 1, NO-IT SW-U _ : HO-TJ SW-U , 1, First ,.' NO-U 9. 3, , wenig vorhanden ' wenig vorhanden wenig vorhanden
21 125 Nitrit-Ion N0 2 Nitrat-Ion N0 3 Chlor-Ion Cl Freie Kohlensäure co 2 Nitrit-Ion NO, Nitrat-Ion. N0 3 Chlor-Ion Cl Bemerkungen wenig vorhanden Alkalität 19-3 wenig vorhanden Wiederholung, da Proben vom verunreinigt wenig vorhanden wenig vorhanden vorhanden
22 126 Alle untersuchten Stollenwässer sind als sehr weich zu bezeichnen. Diese weichen Wässer mit ihrer ganz geringen Karbonathärte besitzen -+- beton- und metallangreifende Eigenschaften, zumal es sich um fließende Wässer handelt. Trotz des geringen Sulfatgehaltes bilden sich an der Betonauskleidung im Bereiche nasser Stellen vielfach schon in kurzer Zeit Ausblühungen und Sinterbildungen.
23
24
Geologische Beschreibung des Predigstollens (Paznaun, Tirol)
 R. T. Klebelsbcrg-Festschrift der Geologischen Gesellschaft in Wien Band 48 der Mitteilungen, 1955 s 207-220, mit 3 Tafeln, Wien 195 Geologische Beschreibung des Predigstollens (Paznaun, Tirol) (Mit 3
R. T. Klebelsbcrg-Festschrift der Geologischen Gesellschaft in Wien Band 48 der Mitteilungen, 1955 s 207-220, mit 3 Tafeln, Wien 195 Geologische Beschreibung des Predigstollens (Paznaun, Tirol) (Mit 3
Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter Von Otto Reithofer. (Mit 1 Abbildung und 16 Diagrammen auf Tafel XII)
 153 Über Flächen- und Achsengefiige in den Triebwasserstollen der Silvrettagruppe. Von Otto Reithofer (Mit 1 Abbildung und 16 Diagrammen auf Tafel XII) Die hier folgende Abhandlung stellt die Fortsetzung
153 Über Flächen- und Achsengefiige in den Triebwasserstollen der Silvrettagruppe. Von Otto Reithofer (Mit 1 Abbildung und 16 Diagrammen auf Tafel XII) Die hier folgende Abhandlung stellt die Fortsetzung
Zur Geologie des Krestakopfes (Montafon)
 RUCHHOLZ, K.: Ein oberdevonisches Kalkvorkommen am Stollborn südwestlich Benneckenstein als Beispiel einer extremen stratigraphischen Kondensation. Geologie, 12, 1039' 1047. Berlin 1963. SPENGLER, E.:
RUCHHOLZ, K.: Ein oberdevonisches Kalkvorkommen am Stollborn südwestlich Benneckenstein als Beispiel einer extremen stratigraphischen Kondensation. Geologie, 12, 1039' 1047. Berlin 1963. SPENGLER, E.:
Zur Geologie des Krestakopfes (Montafon)
 RUCHHOLZ, K.: Ein oberdevonisches Kalkvorkommen am Stollborn südwestlich Benneckenstein als Beispiel einer extremen stratigraphischen Kondensation. Geologie, 12, 1039' 1047. Berlin 1963. SPENGLER, E.:
RUCHHOLZ, K.: Ein oberdevonisches Kalkvorkommen am Stollborn südwestlich Benneckenstein als Beispiel einer extremen stratigraphischen Kondensation. Geologie, 12, 1039' 1047. Berlin 1963. SPENGLER, E.:
Kraftwerksprojekt Obervermunt II
 Kraftwerksprojekt Obervermunt II Die Vorarlberger Illwerke AG errichtet in der Silvretta im hinteren Montafon/Vorarlberg zwischen dem Speichersee Silvretta und dem Speichersee Vermunt das Pumpspeicherwerk
Kraftwerksprojekt Obervermunt II Die Vorarlberger Illwerke AG errichtet in der Silvretta im hinteren Montafon/Vorarlberg zwischen dem Speichersee Silvretta und dem Speichersee Vermunt das Pumpspeicherwerk
Bildanhang. Bildanhang
 Bildanhang Bildnachweis: Tafel 1-24: HÖSEL 1964 Tafel 25-27: GALILÄER 1964 Tafel 28: LfUG 1995 Tafel 29: HÖSEL 2000 85 Tafel 1 Bild 1: Bild 2: Bild 3: Bild 4: Dolomitvarietäten (Hangendes: Dolomit, hellgrau,
Bildanhang Bildnachweis: Tafel 1-24: HÖSEL 1964 Tafel 25-27: GALILÄER 1964 Tafel 28: LfUG 1995 Tafel 29: HÖSEL 2000 85 Tafel 1 Bild 1: Bild 2: Bild 3: Bild 4: Dolomitvarietäten (Hangendes: Dolomit, hellgrau,
Übung 4, Lösung. Frage 7) In welcher Tiefe ab Geländeoberkante GOK treffen Sie bei der Bohrung auf die Schichtgrenze C-D?
 Übung 4, Lösung Frage 7) In welcher Tiefe ab Geländeoberkante GOK treffen Sie bei der Bohrung auf die Schichtgrenze C-D? Streichlinien Bohrung Streichlinien Übung 4, Lösung 1) Streichrichtung: ca. 135
Übung 4, Lösung Frage 7) In welcher Tiefe ab Geländeoberkante GOK treffen Sie bei der Bohrung auf die Schichtgrenze C-D? Streichlinien Bohrung Streichlinien Übung 4, Lösung 1) Streichrichtung: ca. 135
Geophysikalische Prospektion auf Graphit im Revier. Hochadler bei St.Lorenzen im Paltental. Südlich von St.Lorenzen bei Trieben im Paltental liegt das
 Geophysikalische Prospektion auf Graphit im Revier Hochadler bei St.Lorenzen im Paltental H.J.MAURITSCH Einleitung Südlich von St.Lorenzen bei Trieben im Paltental liegt das untersuchungsgebiet, das dem
Geophysikalische Prospektion auf Graphit im Revier Hochadler bei St.Lorenzen im Paltental H.J.MAURITSCH Einleitung Südlich von St.Lorenzen bei Trieben im Paltental liegt das untersuchungsgebiet, das dem
SL Windenergie GmbH. Windkraftanlage Neuenrade - Giebel. Hydrogeologisches Gutachten. Projekt-Nr Bonn, Dipl.-Geol.
 Windkraftanlage Neuenrade - Giebel Projekt-Nr. 2160011 Bonn, 10.02.2016 Dipl.-Geol. Beate Hörbelt Inhaltsverzeichnis: 1 Auftrag und Unterlagen... 1 2 Geologie... 1 2.1 Allgemein... 1 2.2 Tektonik... 2
Windkraftanlage Neuenrade - Giebel Projekt-Nr. 2160011 Bonn, 10.02.2016 Dipl.-Geol. Beate Hörbelt Inhaltsverzeichnis: 1 Auftrag und Unterlagen... 1 2 Geologie... 1 2.1 Allgemein... 1 2.2 Tektonik... 2
Haliw-Serie des distalen Hawasina-Beckens
 1 /12 Sonntag, 17. Februar 2002 4. Exkursionstag Haliw-Serie des distalen Hawasina-Beckens Fahrstrecke des 4. Exkursionstages 1 23 4 5 6 Auf der nächsten Seite folgt die entsprechende geologische Karte
1 /12 Sonntag, 17. Februar 2002 4. Exkursionstag Haliw-Serie des distalen Hawasina-Beckens Fahrstrecke des 4. Exkursionstages 1 23 4 5 6 Auf der nächsten Seite folgt die entsprechende geologische Karte
Information zur Sichtbarkeit der Raumstation ISS am Abend- und Morgenhimmel
 I. Allgemeines Die Internationale Raumstation (ISS) kann zu bestimmten en von jedermann als hell leuchtender und sich relativ schnell über den Himmel bewegender Punkt gesehen werden. Informationen hierüber
I. Allgemeines Die Internationale Raumstation (ISS) kann zu bestimmten en von jedermann als hell leuchtender und sich relativ schnell über den Himmel bewegender Punkt gesehen werden. Informationen hierüber
Arbeitsgeräte eines Feldgeologen
 Geologie Grundlagen und Anwendung Arbeitsblatt 15 Arbeitsgeräte eines Feldgeologen Zum Kartieren im Feld braucht ein Geologe ein paar einfache Hilfsmittel. Schau dir die Liste an und überlege dir, wozu
Geologie Grundlagen und Anwendung Arbeitsblatt 15 Arbeitsgeräte eines Feldgeologen Zum Kartieren im Feld braucht ein Geologe ein paar einfache Hilfsmittel. Schau dir die Liste an und überlege dir, wozu
Wunder Land Binntal. Faszination. Stein. Kleiner Führer zum Gesteinserlebnisweg Fäld-Lengenbach und zur Geologie und Mineralogie des Binntals
 Faszination Stein Binn ist bekannt als Mineraliendorf. Zu Recht denn das Binntal ist tatsächlich sehr reich an Mineralien. Diese lagern in den vielfältigen Gesteinen, welche das Tal aufbauen. Während die
Faszination Stein Binn ist bekannt als Mineraliendorf. Zu Recht denn das Binntal ist tatsächlich sehr reich an Mineralien. Diese lagern in den vielfältigen Gesteinen, welche das Tal aufbauen. Während die
Leidse Geologische Mededelingen, XVII, Tafel 1. E. Niggli GEOLOGISCH-PETROGRAPHISCHE KARTENSKIZZE. SEPT-LAUX (BELLEDONNE-MASSIV s.l.
 E. Niggli Leidse Geologische Mededelingen, XVII, Tafel 1 GEOLOGISCH-PETROGRAPHISCHE KARTENSKIZZE DER SEPT-LAUX (BELLEDONNE-MASSIV s.l.) E. Niggli Leidse Geologische Mededelingen, XVII, Tafel 2 Geologisches
E. Niggli Leidse Geologische Mededelingen, XVII, Tafel 1 GEOLOGISCH-PETROGRAPHISCHE KARTENSKIZZE DER SEPT-LAUX (BELLEDONNE-MASSIV s.l.) E. Niggli Leidse Geologische Mededelingen, XVII, Tafel 2 Geologisches
Strahlengang und Brennweite bei einer Konkavlinse
 Lehrer-/Dozentenblatt Strahlengang und Brennweite bei einer Konkavlinse (Artikelnr.: P1065500) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Optik Unterthema:
Lehrer-/Dozentenblatt Strahlengang und Brennweite bei einer Konkavlinse (Artikelnr.: P1065500) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Optik Unterthema:
Der Untergrund des Krafthauses Latschau (Lünerseewerk) und seiner Umgebung
 (14) Tectonic Development of Czechoslovakia. Collected Papers, Praha 1960. (15) THIELE, C: Bericht 1959 und 1960 über geologische Aufnahmen auf den Blättern Engelhartszell (13), Schärding (29) und Neumarkt
(14) Tectonic Development of Czechoslovakia. Collected Papers, Praha 1960. (15) THIELE, C: Bericht 1959 und 1960 über geologische Aufnahmen auf den Blättern Engelhartszell (13), Schärding (29) und Neumarkt
Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier
 Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Erlanger Beitr.Petr. Min. 2 15-34 9 Abb., 5 Tab. Erlangen 1992 Mineralogische, geochemische und farbmetrische Untersuchungen an den Bankkalken des Malm 5 im Treuchtlinger Revier Von Frank Engelbrecht *)
Zum Bau der Ruitelspitzen (Lechtaler Alpen)
 Zum Bau der Ruitelspitzen (Lechtaler Alpen) Von OTTO REITHOPER Die älteste Angabe über das Gebiet der Ruitelspitzen findet sich bei F. v* RICHT- HOFEN (1861/62, S. 122), der anführt, daß sich der Dolomit
Zum Bau der Ruitelspitzen (Lechtaler Alpen) Von OTTO REITHOPER Die älteste Angabe über das Gebiet der Ruitelspitzen findet sich bei F. v* RICHT- HOFEN (1861/62, S. 122), der anführt, daß sich der Dolomit
K & P 2: Einfallende Schichten
 K & P 2: Einfallende Schichten Diese Vorlesung esprechung Übung 1 Schräg einfallende Schichten Kartbild Einfallsrichtung und Einfallswinkel Streichlinien Profil zeichnen mit Hilfe von Streichlinien Karte
K & P 2: Einfallende Schichten Diese Vorlesung esprechung Übung 1 Schräg einfallende Schichten Kartbild Einfallsrichtung und Einfallswinkel Streichlinien Profil zeichnen mit Hilfe von Streichlinien Karte
Lage. Entdeckung. Beschreibung. Das Jahresheft 1997/98 der Arge Grabenstetten Seite Abb. Grabenstetten 1998.
 Das Jahresheft 1997/98 der Arge Grabenstetten Seite 23-28 6 Abb. Grabenstetten 1998 Walter Albrecht Lage Die Mahlberghöhle befindet sich östlich von Grabenstetten, wenige Meter südlich der Kläranlage und
Das Jahresheft 1997/98 der Arge Grabenstetten Seite 23-28 6 Abb. Grabenstetten 1998 Walter Albrecht Lage Die Mahlberghöhle befindet sich östlich von Grabenstetten, wenige Meter südlich der Kläranlage und
B - Probenverzeichnis und Koordinaten der Probenahmepunkte
 Anhang B - Probenverzeichnis und Koordinaten der Probenpunkte A 3 B - Probenverzeichnis und Koordinaten der Probenahmepunkte In dem Probenverzeichnis sind alle im Rahmen der vorliegenden Arbeit genommenen
Anhang B - Probenverzeichnis und Koordinaten der Probenpunkte A 3 B - Probenverzeichnis und Koordinaten der Probenahmepunkte In dem Probenverzeichnis sind alle im Rahmen der vorliegenden Arbeit genommenen
Bildkonstruktion an Konvexlinsen (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Bildkonstruktion an Konvexlinsen (Artikelnr.: P065400) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Linsengesetze Experiment:
Lehrer-/Dozentenblatt Bildkonstruktion an Konvexlinsen (Artikelnr.: P065400) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Linsengesetze Experiment:
Geotechnik 10 2 Gebirgseigenschaften
 10 2 Gebirgseigenschaften Felsmechanik 2.1 Entstehung der Gesteine 11 Bild 2.4: Benennen und Beschreiben der Gesteine (DIN 4022 Teil 1, Tab. 5) 12 2 Gebirgseigenschaften 2.2 Korngefüge Neben dem Mineralbestand
10 2 Gebirgseigenschaften Felsmechanik 2.1 Entstehung der Gesteine 11 Bild 2.4: Benennen und Beschreiben der Gesteine (DIN 4022 Teil 1, Tab. 5) 12 2 Gebirgseigenschaften 2.2 Korngefüge Neben dem Mineralbestand
Die Verwitterung der Rapakiwis: (oder: Wie das Gestein zu seinem Namen kam.)
 Die Verwitterung der Rapakiwis: (oder: Wie das Gestein zu seinem Namen kam.) Die Zersetzung des Rapakiwi ist eine der Seltsamkeiten, die dieses Gestein begleiten. Das Phänomen ist bereits seit Jahrhunderten
Die Verwitterung der Rapakiwis: (oder: Wie das Gestein zu seinem Namen kam.) Die Zersetzung des Rapakiwi ist eine der Seltsamkeiten, die dieses Gestein begleiten. Das Phänomen ist bereits seit Jahrhunderten
Gotschna Tunnel Klosters Geologische Abklärungen 2013
 Gotschna Tunnel losters Geologische Abklärungen 2013 Untersuchung Schadensursache 03.04.2014, Folie 0 Tektonik: Lithologie Geologisch-tektonischer Überblick Tunnelgebirge - Sandkalke - Phyllite - / Rauhwacke
Gotschna Tunnel losters Geologische Abklärungen 2013 Untersuchung Schadensursache 03.04.2014, Folie 0 Tektonik: Lithologie Geologisch-tektonischer Überblick Tunnelgebirge - Sandkalke - Phyllite - / Rauhwacke
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein
 Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Sachsen, Etzdorf, Gemeinde Striegistal. Steinbruch in Betrieb, Natursteine, Mischanlage
 Aufschluss Granulitgebirge Datum: 15.10.2011 Ort: Koordinaten: Höhe: Betreiber/ Eigentümer: Sachsen, Etzdorf, Gemeinde Striegistal GK 4581310 rechts, 5657585 hoch 210 m NHN (Niveau Betriebshof) Walther
Aufschluss Granulitgebirge Datum: 15.10.2011 Ort: Koordinaten: Höhe: Betreiber/ Eigentümer: Sachsen, Etzdorf, Gemeinde Striegistal GK 4581310 rechts, 5657585 hoch 210 m NHN (Niveau Betriebshof) Walther
ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN
 ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN UITGEGEVEN DOOR HET RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN (MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK) Deel 54 no. 5 14 augustus 1979 EINE NEUE ALBINARIA
ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN UITGEGEVEN DOOR HET RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN (MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK) Deel 54 no. 5 14 augustus 1979 EINE NEUE ALBINARIA
Massenhaushaltsuntersuchungen am JAMTALFERNER
 Massenhaushaltsuntersuchungen am JAMTALFERNER Zusammenfassung der Messungen der Jahre 1990/91 bis 1999/2000 G. Markl, M. Kuhn, F. Pellet Institut für Meteorologie und Geophysik, Universität Innsbruck 1
Massenhaushaltsuntersuchungen am JAMTALFERNER Zusammenfassung der Messungen der Jahre 1990/91 bis 1999/2000 G. Markl, M. Kuhn, F. Pellet Institut für Meteorologie und Geophysik, Universität Innsbruck 1
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG
 Kurzbericht zu den geologischen Kartierungen Gemeindegebiet Silbertal im Montafon Vorarlberg/Österreich Geländearbeiten vom 10.8.2002 bis 29.9.2002 Dr. Christian WOLKERSDORFER () Inhaltsverzeichnis Kartiergebiet
Kurzbericht zu den geologischen Kartierungen Gemeindegebiet Silbertal im Montafon Vorarlberg/Österreich Geländearbeiten vom 10.8.2002 bis 29.9.2002 Dr. Christian WOLKERSDORFER () Inhaltsverzeichnis Kartiergebiet
Eine Sandwüste malen. Arbeitsschritte
 Dies ist eine Anleitung der Künstlerin und Autorin Efyriel von Tierstein (kurz: EvT) Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch gedacht und EvT übernimmt keine Garantien dafür, dass eine Arbeit nach
Dies ist eine Anleitung der Künstlerin und Autorin Efyriel von Tierstein (kurz: EvT) Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch gedacht und EvT übernimmt keine Garantien dafür, dass eine Arbeit nach
Versuchsprotokoll. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Physik. Versuch O10: Linsensysteme Arbeitsplatz Nr.
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Physik Physikalisches Grundpraktikum I Versuchsprotokoll Versuch O10: Linsensysteme Arbeitsplatz Nr. 1 0. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2.
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Physik Physikalisches Grundpraktikum I Versuchsprotokoll Versuch O10: Linsensysteme Arbeitsplatz Nr. 1 0. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2.
Subtile Strömungswirkungen
 Norbert Harthun Leipzig, im Juni 2005 Subtile Strömungswirkungen Es ist eindeutig, dass der Wechsel von einer Wasserlaufkrümmung in die andere besondere Wirkung auf die Umgebung hat. Im vergangenen PKS-Seminar
Norbert Harthun Leipzig, im Juni 2005 Subtile Strömungswirkungen Es ist eindeutig, dass der Wechsel von einer Wasserlaufkrümmung in die andere besondere Wirkung auf die Umgebung hat. Im vergangenen PKS-Seminar
Landesgesetzblatt für Wien
 195 Landesgesetzblatt für Wien Jahrgang 2002 Ausgegeben am 18. September 2002 39. Stück 39. Gesetz: Änderung der Grenze zwischen dem 21. und 22. Bezirk 39. Gesetz über eine Änderung der Grenze zwischen
195 Landesgesetzblatt für Wien Jahrgang 2002 Ausgegeben am 18. September 2002 39. Stück 39. Gesetz: Änderung der Grenze zwischen dem 21. und 22. Bezirk 39. Gesetz über eine Änderung der Grenze zwischen
Übungen zur Allgemeine Geologie
 Übungen zur Allgemeine Geologie heute: Lagerung von Gesteinen und Deformation Diskordanz Eifel: steil gestellte (gefaltete) Sand- und Siltsteine werden von Tephralagen diskordant überlagert Raumlage age
Übungen zur Allgemeine Geologie heute: Lagerung von Gesteinen und Deformation Diskordanz Eifel: steil gestellte (gefaltete) Sand- und Siltsteine werden von Tephralagen diskordant überlagert Raumlage age
LESEFASSUNG (rechtskräftig seit )
 Beschluss- Nr. 748-33/92 vom 10.12.1992 LESEFASSUNG (rechtskräftig seit 14.05.1994) Satzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes Innenstadt/ Fleischervorstadt nach 142 Abs. 1 und 3 BauGB: 1
Beschluss- Nr. 748-33/92 vom 10.12.1992 LESEFASSUNG (rechtskräftig seit 14.05.1994) Satzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes Innenstadt/ Fleischervorstadt nach 142 Abs. 1 und 3 BauGB: 1
Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten
 Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG Kreisstr Warstein-Suttrop
 Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.v. Annastrasse 67-71 50968 Köln D CLJ ~RSCHUNG Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-72 Telefax: +49 (0) 22 1/9346 74-14 Datum: 08.06.2016- Ho/AB Prüfbericht: 37111200416114
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.v. Annastrasse 67-71 50968 Köln D CLJ ~RSCHUNG Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-72 Telefax: +49 (0) 22 1/9346 74-14 Datum: 08.06.2016- Ho/AB Prüfbericht: 37111200416114
Geologie der Berge nördlich Pols (Katzlingberg, Offen burger Wald)
 Verh. Geol. B.-A. Jahrgang 1975 Heft 2 3 S. 35 43 Wien, September 1975 Geologie der Berge nördlich Pols (Katzlingberg, Offen burger Wald) Von ANDREAS THURNER, Graz Mit 8 Abbildungen Österreichische Karte
Verh. Geol. B.-A. Jahrgang 1975 Heft 2 3 S. 35 43 Wien, September 1975 Geologie der Berge nördlich Pols (Katzlingberg, Offen burger Wald) Von ANDREAS THURNER, Graz Mit 8 Abbildungen Österreichische Karte
Rundwanderung um das mittlere Brexbachtal
 Rundwanderung um das mittlere Brexbachtal I. Kurze Text-Info: Rundwanderung durch das mittlere Brexbachtal abwärts (der so genannte Brexbach- Schluchtweg) ist ein offizieller Rundweg, der abschnittsweise
Rundwanderung um das mittlere Brexbachtal I. Kurze Text-Info: Rundwanderung durch das mittlere Brexbachtal abwärts (der so genannte Brexbach- Schluchtweg) ist ein offizieller Rundweg, der abschnittsweise
Ober einen eiszeitlichen Sand- und Kieszug im Teutoburger Wald bei Halle (Westfalen)
 20. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld, S. 61 65, 1971 Ober einen eiszeitlichen Sand- und Kieszug im Teutoburger Wald bei Halle (Westfalen) Mit 4 Abbildungen Julius Hesemann, Krefeld
20. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld, S. 61 65, 1971 Ober einen eiszeitlichen Sand- und Kieszug im Teutoburger Wald bei Halle (Westfalen) Mit 4 Abbildungen Julius Hesemann, Krefeld
~~~!~~~_~~~~_~!~~_~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~E~~!~~~~~~~~_!~
 Proj. P-30 ~~~!~~~_~~~~_~!~~_~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~E~~!~~~~~~~~_!~ ~~~~-~~~~~~~~~ Von W. PROCHASKA 1) ZUSAMMENFASSUNG Im Zuge der vorliegenden Arbeit wurde das Gebiet zwischen Rettenegg (Feistritztal)
Proj. P-30 ~~~!~~~_~~~~_~!~~_~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~E~~!~~~~~~~~_!~ ~~~~-~~~~~~~~~ Von W. PROCHASKA 1) ZUSAMMENFASSUNG Im Zuge der vorliegenden Arbeit wurde das Gebiet zwischen Rettenegg (Feistritztal)
Naturwissenschaften+ Korrekturschema. Projekt HarmoS. Steine in Bewegung. N d 9. N_9d_13_E1. Name: Schule: Klasse: IDK: ID:
 N d 9 Projekt HarmoS Naturwissenschaften+ Steine in Bewegung N_9d_13_E1 Korrekturschema Name: Schule: Klasse: IDK: ID: Steine in Bewegung Wohin bewegen sich Steine, die sich in Felswänden lösen? In der
N d 9 Projekt HarmoS Naturwissenschaften+ Steine in Bewegung N_9d_13_E1 Korrekturschema Name: Schule: Klasse: IDK: ID: Steine in Bewegung Wohin bewegen sich Steine, die sich in Felswänden lösen? In der
Warum gibt es überhaupt Gebirge?
 Gebirge Es gibt heute viele hohe Gebirge auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Alpen in Europa, die Rocky Mountains in Nordamerika und der Himalaya in Asien. Wie sind diese Gebirge entstanden
Gebirge Es gibt heute viele hohe Gebirge auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Alpen in Europa, die Rocky Mountains in Nordamerika und der Himalaya in Asien. Wie sind diese Gebirge entstanden
Leiferer Höhenweg (mittel)
 Leiferer Höhenweg (mittel) https://www.suedtirol-kompakt.com/leiferer-hoehenweg/ Der Leiferer Höhenweg ist ein schöner Höhenweg mit leichten Kletterstellen im Süden Südtirols. Er bietet tolle Ausblicke
Leiferer Höhenweg (mittel) https://www.suedtirol-kompakt.com/leiferer-hoehenweg/ Der Leiferer Höhenweg ist ein schöner Höhenweg mit leichten Kletterstellen im Süden Südtirols. Er bietet tolle Ausblicke
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH JAHRESBERICHT 2018
 HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH JAHRESBERICHT 2018 Die aktuellen Auswertungen für 2018 auf Basis des qualitativ hochwertigen homogenen HISTALP-Datensatzes der ZAMG für das gesamte Bundesgebiet sowie
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH JAHRESBERICHT 2018 Die aktuellen Auswertungen für 2018 auf Basis des qualitativ hochwertigen homogenen HISTALP-Datensatzes der ZAMG für das gesamte Bundesgebiet sowie
9. Tantal SIMS-Ergebnisse RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN OFENGETEMPERTE SBT-PROBEN
 9. Tantal 9.1. SIMS-Ergebnisse 9.1.1. RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN In Abbildung 32 sind die Tantal-Tiefenprofile nach Tempern der SBT-Proben im RTP dargestellt, in Abbildung 32 a) mit und in Abbildung 32
9. Tantal 9.1. SIMS-Ergebnisse 9.1.1. RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN In Abbildung 32 sind die Tantal-Tiefenprofile nach Tempern der SBT-Proben im RTP dargestellt, in Abbildung 32 a) mit und in Abbildung 32
Rabenkopf. Uwe-Carsten Fiebig Münchner Hausberge Rabenkopf
 Rabenkopf Wegbeschreibung: Höhe: 1555 m Ausgangspunkt: Parkplatz in Pessenbach an der Kreuzung von B11 und Ötzgasse (645 m). Charakter des Weges: Leichter Aufstieg auf oft grobsteinigem Weg bis zur Orterer-Alm;
Rabenkopf Wegbeschreibung: Höhe: 1555 m Ausgangspunkt: Parkplatz in Pessenbach an der Kreuzung von B11 und Ötzgasse (645 m). Charakter des Weges: Leichter Aufstieg auf oft grobsteinigem Weg bis zur Orterer-Alm;
Die Hohe Straße zwischen Kocher und Jagst. Karten
 Die Hohe Straße zwischen Kocher und Jagst von Leo Michels, Untereisesheim 2007 Karten In acht Karten wird als farbige Linie der Verlauf der Hohen Straße von Bad Friedrichshall-Jagstfeld am Neckar bis Mulfingen-Heimhausen
Die Hohe Straße zwischen Kocher und Jagst von Leo Michels, Untereisesheim 2007 Karten In acht Karten wird als farbige Linie der Verlauf der Hohen Straße von Bad Friedrichshall-Jagstfeld am Neckar bis Mulfingen-Heimhausen
1. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen
 Klausur Klasse 2 Licht als Wellen (Teil ) 26..205 (90 min) Name:... Hilfsmittel: alles verboten. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen Lichtstrahls durch eine Glasplatte, bei dem Reflexion
Klausur Klasse 2 Licht als Wellen (Teil ) 26..205 (90 min) Name:... Hilfsmittel: alles verboten. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen Lichtstrahls durch eine Glasplatte, bei dem Reflexion
Erhöhte Wasserstande/ Hochwasser am
 Erhöhte Wasserstande/ Hochwasser am 25.12.2014 Da gerade Weihnachten war, wurde schon sehr zeitig, am 24.12. gegen 11:00 Uhr, vor erhöhten Wasserständen an der gesamten Ostseeküste gewarnt. Die numerischen
Erhöhte Wasserstande/ Hochwasser am 25.12.2014 Da gerade Weihnachten war, wurde schon sehr zeitig, am 24.12. gegen 11:00 Uhr, vor erhöhten Wasserständen an der gesamten Ostseeküste gewarnt. Die numerischen
Kompass mit Sonnenuhr
 115.420 Kompass mit Sonnenuhr Benötigtes Werkzeug: Schere Bastelmesser Bleistift + Stahllineal Laubsäge mit Zubehör Hammer Holzleim Alleskleber Schmirgelpapier Hinweis Bei den OPITEC Werkpackungen handelt
115.420 Kompass mit Sonnenuhr Benötigtes Werkzeug: Schere Bastelmesser Bleistift + Stahllineal Laubsäge mit Zubehör Hammer Holzleim Alleskleber Schmirgelpapier Hinweis Bei den OPITEC Werkpackungen handelt
Spessart, Rhönvorland und Buntsandstein des Odenwalds
 Bayerisches Landesamt für Umwelt Hydrogeologischer Teilraum Spessart, Rhönvorland und Buntsandstein des Odenwalds Verbreitungsgebiet von überwiegend Buntsandstein-Einheiten im NW Bayerns. Diskordantes
Bayerisches Landesamt für Umwelt Hydrogeologischer Teilraum Spessart, Rhönvorland und Buntsandstein des Odenwalds Verbreitungsgebiet von überwiegend Buntsandstein-Einheiten im NW Bayerns. Diskordantes
Die Strahlensätze machen eine Aussage über Streckenverhältnisse, nämlich:
 Elementargeometrie Der. Strahlensatz Geschichte: In den Elementen des Euklid wird im 5.Buch die Proportionenlehre behandelt, d.h. die geometrische Theorie aller algebraischen Umformungen der Proportion.
Elementargeometrie Der. Strahlensatz Geschichte: In den Elementen des Euklid wird im 5.Buch die Proportionenlehre behandelt, d.h. die geometrische Theorie aller algebraischen Umformungen der Proportion.
Hinein in die Bergwelt. Lange Frühjahrs- und Spätfrühjahrstour auf die Aglsspitze mit hochalpinem Charakter.
 Aglsspitze SKITOUR Dauer Strecke 6:00 h 16.6 km Höhenmeter Max. Höhe 1810 hm 3190 m Kondition Technik Erlebnis Landschaft Hinein in die Bergwelt. Lange Frühjahrs- und Spätfrühjahrstour auf die Aglsspitze
Aglsspitze SKITOUR Dauer Strecke 6:00 h 16.6 km Höhenmeter Max. Höhe 1810 hm 3190 m Kondition Technik Erlebnis Landschaft Hinein in die Bergwelt. Lange Frühjahrs- und Spätfrühjahrstour auf die Aglsspitze
Geometrie Jahrgangsstufe 5
 Geometrie Jahrgangsstufe 5 Im Rahmen der Kooperation der Kollegen, die im Schuljahr 1997/98 in der fünften Jahrgangstufe Mathematik unterrichteten, wurde in Gemeinschaftsarbeit unter Federführung von Frau
Geometrie Jahrgangsstufe 5 Im Rahmen der Kooperation der Kollegen, die im Schuljahr 1997/98 in der fünften Jahrgangstufe Mathematik unterrichteten, wurde in Gemeinschaftsarbeit unter Federführung von Frau
Ueber Bergstürze bei Lanersbach (Tuxer Tal, Tirol) (Mit 2 Figuren.)! Von Alfred Fuchs, Wattens.
 R. v. Klebelsberg-FestsÄrift der Geologischein Gesellschaft in Wien Band 48 der Mitteilungen, 195S S. 29-32, mit 2 Figuren, Wien 1956 Ueber Bergstürze bei Lanersbach (Tuxer Tal, Tirol) (Mit 2 Figuren.)!
R. v. Klebelsberg-FestsÄrift der Geologischein Gesellschaft in Wien Band 48 der Mitteilungen, 195S S. 29-32, mit 2 Figuren, Wien 1956 Ueber Bergstürze bei Lanersbach (Tuxer Tal, Tirol) (Mit 2 Figuren.)!
Für die Bearbeitung wurden der ingeo-consult GbR Lagepläne, Maßstab 1 : 500/1.000, zur Verfügung
 ingeo-consult GbR Am Truxhof 1 44229 Dortmund Weßlings Kamp 19 48653 Coesfeld Gesellschafter Dipl.-Ing. Rolf Funke Dipl.-Geol. Karsten Weber A m Truxhof 1 44229 Dortmund fon 0231/9678985-0 fax 0231/9678985-5
ingeo-consult GbR Am Truxhof 1 44229 Dortmund Weßlings Kamp 19 48653 Coesfeld Gesellschafter Dipl.-Ing. Rolf Funke Dipl.-Geol. Karsten Weber A m Truxhof 1 44229 Dortmund fon 0231/9678985-0 fax 0231/9678985-5
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt.
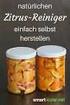 ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
Abgeschlossen in Bern am 23. Dezember 1948 Zustimmung des Landtags: 30. Dezember 1948 Inkrafttreten: 15. August 1949
 0.142.191.011 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt Jahrgang 1949 Nr. 19 ausgegeben am 3. September 1949 Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der schweizerischen Eidgenossenschaft über eine
0.142.191.011 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt Jahrgang 1949 Nr. 19 ausgegeben am 3. September 1949 Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der schweizerischen Eidgenossenschaft über eine
Verhalten von Konservendosen auf einer schiefen Ebene
 Julia Dischinger Verhalten von Konservendosen auf einer schiefen Ebene 2. Hausarbeit in Physik, Klasse 7b by Julia Dischinger Versuch [10]: Konservendosen Aufgabe: Man braucht zu diesem Experiment zwei
Julia Dischinger Verhalten von Konservendosen auf einer schiefen Ebene 2. Hausarbeit in Physik, Klasse 7b by Julia Dischinger Versuch [10]: Konservendosen Aufgabe: Man braucht zu diesem Experiment zwei
Bodentemperaturen in Liechtenstein
 in Liechtenstein Dietmar Possner 1. Einleitung sind für Landwirtschaft, Meteorologie, Biologie, Bauwesen und Heizsysteme von Interesse. In Liechtenstein sind erst seit Mai 2008 online zugänglich. Die vorliegende
in Liechtenstein Dietmar Possner 1. Einleitung sind für Landwirtschaft, Meteorologie, Biologie, Bauwesen und Heizsysteme von Interesse. In Liechtenstein sind erst seit Mai 2008 online zugänglich. Die vorliegende
Aufgaben zur Einführung in die Physik 1 (Ergebnisse der Übungsaufgaben)
 Aufgaben zur Einführung in die Physik 1 (Ergebnisse der Übungsaufgaben) WS 2009/10 1 Die Lochkamera 2. (a) Durch maßstabsgetreue Zeichnung oder durch Rechnung mit Strahlensatz ergibt sich: Die Größe der
Aufgaben zur Einführung in die Physik 1 (Ergebnisse der Übungsaufgaben) WS 2009/10 1 Die Lochkamera 2. (a) Durch maßstabsgetreue Zeichnung oder durch Rechnung mit Strahlensatz ergibt sich: Die Größe der
Temperatur von Quellwässern langjährige Temperaturtrends
 Temperatur von Quellwässern langjährige Temperaturtrends W4 WOLF-PETER VON PAPE Quellen werden in der Regel von Grundwasser gespeist, das in unterschiedlicher, meist aber geringer Tiefe zuläuft. Sie haben
Temperatur von Quellwässern langjährige Temperaturtrends W4 WOLF-PETER VON PAPE Quellen werden in der Regel von Grundwasser gespeist, das in unterschiedlicher, meist aber geringer Tiefe zuläuft. Sie haben
Eiserfey Keldenich Urft Urfey Tour mit sehr schönen Blicken durch das Veybachtal.
 Eiserfey Keldenich Urft Urfey Tour mit sehr schönen Blicken durch das Veybachtal. Länge, Dauer, besondere Hinweise: 24 Kilometer, 6 Stunden. Abkürzung 22 Kilometer. Einkehrmöglichkeiten: - Karte: Eifelverein
Eiserfey Keldenich Urft Urfey Tour mit sehr schönen Blicken durch das Veybachtal. Länge, Dauer, besondere Hinweise: 24 Kilometer, 6 Stunden. Abkürzung 22 Kilometer. Einkehrmöglichkeiten: - Karte: Eifelverein
Kartenkunde bei den BOS
 bei den BOS Einteilung der Erdkugel Die Erdkugel wird von einem gedachten Kreis umspannt, dem Äquator. Er teilt die Erde in eine nördliche und südliche Halbkugel. Weiterhin ist die Erde in 360 Längengrade
bei den BOS Einteilung der Erdkugel Die Erdkugel wird von einem gedachten Kreis umspannt, dem Äquator. Er teilt die Erde in eine nördliche und südliche Halbkugel. Weiterhin ist die Erde in 360 Längengrade
Extremwertaufgaben. 3. Beziehung zwischen den Variablen in Form einer Gleichung aufstellen (Nebenbedingung),
 Extremwertaufgaben x. Ein Landwirt will an einer Mauer einen rechteckigen Hühnerhof mit Maschendraht abgrenzen. 0 Meter Maschendraht stehen zur Verfügung. Wie groß müssen die Rechteckseiten gewählt werden,
Extremwertaufgaben x. Ein Landwirt will an einer Mauer einen rechteckigen Hühnerhof mit Maschendraht abgrenzen. 0 Meter Maschendraht stehen zur Verfügung. Wie groß müssen die Rechteckseiten gewählt werden,
Körper erkennen und beschreiben
 Vertiefen 1 Körper erkennen und beschreiben zu Aufgabe 6 Schulbuch, Seite 47 6 Passt, passt nicht Nenne zu jeder Aussage alle Formen, auf die die Aussage zutrifft. a) Die Form hat keine Ecken. b) Die Form
Vertiefen 1 Körper erkennen und beschreiben zu Aufgabe 6 Schulbuch, Seite 47 6 Passt, passt nicht Nenne zu jeder Aussage alle Formen, auf die die Aussage zutrifft. a) Die Form hat keine Ecken. b) Die Form
Reflexion am Hohlspiegel (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Reflexion am Hohlspiegel (Artikelnr.: P1063900) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Reflexion und Brechung Experiment:
Lehrer-/Dozentenblatt Reflexion am Hohlspiegel (Artikelnr.: P1063900) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Reflexion und Brechung Experiment:
Bildkonstruktion an Konkavlinsen (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Bildkonstruktion an Konkavlinsen (Artikelnr.: P065600) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Linsengesetze Experiment:
Lehrer-/Dozentenblatt Bildkonstruktion an Konkavlinsen (Artikelnr.: P065600) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Linsengesetze Experiment:
Temperatur des Grundwassers
 Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Fläschenspitz SZ-014
 Fläschenspitz - wie man ihn, etwas unterhalb von Nöllen auf dem abgehenden Kultur-Strässli nach der zweiten Hütte, sieht. Anfahrt Rapperswil, Pfäffikon, Etzel, Willerzell. Euthal, woandersher einfach Studen,
Fläschenspitz - wie man ihn, etwas unterhalb von Nöllen auf dem abgehenden Kultur-Strässli nach der zweiten Hütte, sieht. Anfahrt Rapperswil, Pfäffikon, Etzel, Willerzell. Euthal, woandersher einfach Studen,
Arbeitsübersetzung Verlängerung der Betriebszeit des Atomkraftwerk Paks
 Beilage 2 Meteorologische Daten der Umgebung des AKW Paks Beilage 2.2. Daten bezüglich Windgeschwindigkeit, Windrichtung und atmosphärische Stabilität in der Region Paks Beilage 2.1 1/37 15.11.2004 Ausgangsdaten
Beilage 2 Meteorologische Daten der Umgebung des AKW Paks Beilage 2.2. Daten bezüglich Windgeschwindigkeit, Windrichtung und atmosphärische Stabilität in der Region Paks Beilage 2.1 1/37 15.11.2004 Ausgangsdaten
Lösungen. Christian Haas. Durchdringungen. Ausbildungseinheit für Anlagen- und Apparatebauer/innen. Reform Lernziele:
 Durchdringungen Ausbildungseinheit für Anlagen- und Apparatebauer/innen EFZ Reform 2013 13 Lösungen Lernziele: Durchdringungen im Zusammenhang mit den Abwicklungen konstruieren Christian Haas Zeichnungstechnik
Durchdringungen Ausbildungseinheit für Anlagen- und Apparatebauer/innen EFZ Reform 2013 13 Lösungen Lernziele: Durchdringungen im Zusammenhang mit den Abwicklungen konstruieren Christian Haas Zeichnungstechnik
A (S, g, u, h'), Schlacke, Ziegelbruch, Asche, umgelagerter Boden, durchwurzelt, schwarzgrau, ++, 0-1,0 m: BS 60 1,0-4,8 m: BS 50
 DPH 0 m u. GOK (, m NN) BS0 0 0 0 0 0,0 ; 0- ; -,0 ;,0-,0,0,0 A (S, g, u, h'), Schlacke, Ziegelbruch, Asche, umgelagerter Boden, durchwurzelt, schwarzgrau, ++, 0-,0 m: BS 0,0-, m: BS 0 A (G, u, s), Asche,
DPH 0 m u. GOK (, m NN) BS0 0 0 0 0 0,0 ; 0- ; -,0 ;,0-,0,0,0 A (S, g, u, h'), Schlacke, Ziegelbruch, Asche, umgelagerter Boden, durchwurzelt, schwarzgrau, ++, 0-,0 m: BS 0,0-, m: BS 0 A (G, u, s), Asche,
Ergebnisse der transmissionselektronenmikroskopischen (TEM) Untersuchungen
 4 Ergebnisse 101 4.2.2. Ergebnisse der transmissionselektronenmikroskopischen (TEM) Untersuchungen Anhand der TEM- Aufnahmen sollte untersucht werden, welche Schäden Albendazolsulfoxid allein beziehungsweise
4 Ergebnisse 101 4.2.2. Ergebnisse der transmissionselektronenmikroskopischen (TEM) Untersuchungen Anhand der TEM- Aufnahmen sollte untersucht werden, welche Schäden Albendazolsulfoxid allein beziehungsweise
Das Foucaultsche Pendel
 Das Foucaultsche Pendel Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort 2. Einleitung 3. Material und Methoden 4. Resultate 5. Diskussion 6. Schlusswort 7. Literaturliste Vorwort Wir beschäftigen uns mit dem Foucaultschen
Das Foucaultsche Pendel Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort 2. Einleitung 3. Material und Methoden 4. Resultate 5. Diskussion 6. Schlusswort 7. Literaturliste Vorwort Wir beschäftigen uns mit dem Foucaultschen
Eine Anleitung. Zuerst ein paar Worte zur Geschichte. Und jetzt gibt es den Qwürfel! Für die Teilnehmer des Känguru-Wettbewerbs 2019
 QWÜRFEL Für die Teilnehmer des Känguru-Wettbewerbs 09 Eine Anleitung Vielleicht hast du ganz vorsichtig gedreht, einmal, zweimal,..., aber auch gleich wieder zurück. Doch plötzlich vielleicht eine Drehung
QWÜRFEL Für die Teilnehmer des Känguru-Wettbewerbs 09 Eine Anleitung Vielleicht hast du ganz vorsichtig gedreht, einmal, zweimal,..., aber auch gleich wieder zurück. Doch plötzlich vielleicht eine Drehung
Bastelidee des Monats: Falt-Schildkröte
 Bastelidee des Monats: Falt-Schildkröte Du brauchst ein quadratisches Blatt Papier. Am besten in einer bunt leuchtenden Farbe, damit deine Schildkröte hinterher so richtig schön aussieht. Falte das Papier
Bastelidee des Monats: Falt-Schildkröte Du brauchst ein quadratisches Blatt Papier. Am besten in einer bunt leuchtenden Farbe, damit deine Schildkröte hinterher so richtig schön aussieht. Falte das Papier
8,90 10,20. , Kernverlust
 91,0 91,10 90,80 0,30 Quartär, kein Wasser Ton (feinsandig, organisch, durchwurzelt), Mutterboden, schwarzbraun, sehr schwach kalkhaltig, steif, Schluff, organisch 0,60 Weichsel-Kaltzeit, Feinsand (schluffig,
91,0 91,10 90,80 0,30 Quartär, kein Wasser Ton (feinsandig, organisch, durchwurzelt), Mutterboden, schwarzbraun, sehr schwach kalkhaltig, steif, Schluff, organisch 0,60 Weichsel-Kaltzeit, Feinsand (schluffig,
SC-PROJEKT EISWÜRFEL: HÖHE = 21MM. Patrick Kurer & Marcel Meschenmoser
 SC-PROJEKT EISWÜRFEL: HÖHE = 21MM Patrick Kurer & Marcel Meschenmoser 2.1.2013 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis... 1 Allgemeine Parameter... 2 Aufgabe A Allgemeine Berechnung des Eiswürfels... 2 Aufgabe
SC-PROJEKT EISWÜRFEL: HÖHE = 21MM Patrick Kurer & Marcel Meschenmoser 2.1.2013 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis... 1 Allgemeine Parameter... 2 Aufgabe A Allgemeine Berechnung des Eiswürfels... 2 Aufgabe
Mögliche Bewegungsabläufe in Störungsbereichen im Rheinischen Braunkohlenrevier
 Mögliche Bewegungsabläufe in Störungsbereichen im Rheinischen Braunkohlenrevier Informationsveranstaltung RWE Power AG Univ.Prof. Dr.-Ing. Axel Preuße Inhalt Übersicht der Präsentation Beschreibung der
Mögliche Bewegungsabläufe in Störungsbereichen im Rheinischen Braunkohlenrevier Informationsveranstaltung RWE Power AG Univ.Prof. Dr.-Ing. Axel Preuße Inhalt Übersicht der Präsentation Beschreibung der
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Beugung. Durchgeführt am Gruppe X. Name 1 und Name 2
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Beugung Durchgeführt am 01.12.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Beugung Durchgeführt am 01.12.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
HINWEISE ZUR BEARBEITUNG DER HAUSARBEIT LINIENFÜHRUNG
 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nils Nießen HINWEISE HINWEISE ZUR BEARBEITUNG DER HAUSARBEIT LINIENFÜHRUNG EISENBAHNWESEN I Ausgabe: 2016 Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis 1 Onlinekontrolle... 1 2 Anwendung
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nils Nießen HINWEISE HINWEISE ZUR BEARBEITUNG DER HAUSARBEIT LINIENFÜHRUNG EISENBAHNWESEN I Ausgabe: 2016 Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis 1 Onlinekontrolle... 1 2 Anwendung
Lernzirkel A Station 1: Winkel schätzen mit Winkelkarten
 Stationenlernen Winkel schätzen, messen, zeichnen Name: Dieses Stationenlernen besteht aus zwei Lernzirkeln: Im Lernzirkel A werden Winkelgrößen geschätzt und gemessen und im Lernzirkel B werden Winkel
Stationenlernen Winkel schätzen, messen, zeichnen Name: Dieses Stationenlernen besteht aus zwei Lernzirkeln: Im Lernzirkel A werden Winkelgrößen geschätzt und gemessen und im Lernzirkel B werden Winkel
Ausgewählte Beobachtungen Juli bis Dezember (Aktuellstes am Schluß)
 Ausgewählte Beobachtungen Juli bis Dezember 2016 (Aktuellstes am Schluß) Im Text Verwendete Kürzel der Fernrohrkonfiguration Kontinuum (Weißlicht) W1 Refraktor 102 f=714mm Sonnenfilterfolie Kontinuums-
Ausgewählte Beobachtungen Juli bis Dezember 2016 (Aktuellstes am Schluß) Im Text Verwendete Kürzel der Fernrohrkonfiguration Kontinuum (Weißlicht) W1 Refraktor 102 f=714mm Sonnenfilterfolie Kontinuums-
Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien. Musteraufgaben 2017 Hilfsmittelfreier Teil Seite 1-2. = 0. (2 VP) e
 MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien Prüfungsfach: M a t h e m a t i k Musteraufgaben 2017 Hilfsmittelfreier Teil Seite 1-2 1. Bilden Sie die erste
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien Prüfungsfach: M a t h e m a t i k Musteraufgaben 2017 Hilfsmittelfreier Teil Seite 1-2 1. Bilden Sie die erste
Pertes de la Valserine
 Dép. Ain Bellegarde - Pertes Valserine -1- Pertes de la Valserine Photos: J. Stobinsky 1. Lage, Zufahrt 1.1. Lage Région Auvergne-Rhône-Alpes, 01200 Bellegarde-sur-Valserine; Rég. Auvergne-Rhône-Alpes
Dép. Ain Bellegarde - Pertes Valserine -1- Pertes de la Valserine Photos: J. Stobinsky 1. Lage, Zufahrt 1.1. Lage Région Auvergne-Rhône-Alpes, 01200 Bellegarde-sur-Valserine; Rég. Auvergne-Rhône-Alpes
Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Tappenbecker Moor Untergrundhydraulische Berechnung
 GGU mbh Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Herr Dipl.-Ing. Klaeden Sophienstraße 5 38304 Wolfenbüttel 10.05.2014 Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Untergrundhydraulische
GGU mbh Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Herr Dipl.-Ing. Klaeden Sophienstraße 5 38304 Wolfenbüttel 10.05.2014 Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Untergrundhydraulische
Bericht zur Grabung Schwanberg 2012
 Bericht zur Grabung Schwanberg 2012 Bernhard Schrettle 61057.12.01 KG Schwanberg Parz. 1809 VB Deutschlandsberg STMK 1 Die archäologische Grabung sowie die Sanierungsmaßnahme auf der Altburgstelle Schwanberg
Bericht zur Grabung Schwanberg 2012 Bernhard Schrettle 61057.12.01 KG Schwanberg Parz. 1809 VB Deutschlandsberg STMK 1 Die archäologische Grabung sowie die Sanierungsmaßnahme auf der Altburgstelle Schwanberg
DOWNLOAD. Sachtexte verstehen: Texte, Grafiken und Tabellen. Der Wetterbericht. Ulrike Neumann-Riedel. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Sachtexte verstehen: Texte, Grafiken und Tabellen Der Wetterbericht Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich
DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Sachtexte verstehen: Texte, Grafiken und Tabellen Der Wetterbericht Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich
Stationenlernen Raumgeometrie
 Lösung zu Station 1 a) Beantwortet die folgenden Fragen. Begründet jeweils eure Antwort. Frage 1: Hat jede Pyramide ebenso viele Ecken wie Flächen? Antwort: Ja Begründung: Eine Pyramide mit einer n-eckigen
Lösung zu Station 1 a) Beantwortet die folgenden Fragen. Begründet jeweils eure Antwort. Frage 1: Hat jede Pyramide ebenso viele Ecken wie Flächen? Antwort: Ja Begründung: Eine Pyramide mit einer n-eckigen
Brecherspitze: Ostgrat und Jägersteig
 Brecherspitze: Ostgrat und Jägersteig Die ausführliche Beschreibung ist unter http://www.familiesteiner.de/wandern/brecherspitze/ zu finden. Hier stellen wir nur die Schlüsselstellen vor, die man zur Wegfindung
Brecherspitze: Ostgrat und Jägersteig Die ausführliche Beschreibung ist unter http://www.familiesteiner.de/wandern/brecherspitze/ zu finden. Hier stellen wir nur die Schlüsselstellen vor, die man zur Wegfindung
Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen
 Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen Dipl.-Geologe Marcus Richter HGC Hydro-Geo-Consult GmbH Gliederung 1.
Gemessene Schwankungsbreiten von Wärmeleitfähigkeiten innerhalb verschiedener Gesteinsgruppen Analyse der Ursachen und Auswirkungen Dipl.-Geologe Marcus Richter HGC Hydro-Geo-Consult GmbH Gliederung 1.
LANDESVERFASSUNGSGESETZ ÜBER ÄNDERUN- GEN DER STAATSGRENZE ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER TSCHECHO- SLOWAKISCHEN SOZIALISTISCHEN REPUBLIK
 LANDESVERFASSUNGSGESETZ ÜBER ÄNDERUN- GEN DER STAATSGRENZE ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER TSCHECHO- SLOWAKISCHEN SOZIALISTISCHEN REPUBLIK Stammgesetz 9/75 1975-01-22 Blatt 0 Ausgegeben am 22.
LANDESVERFASSUNGSGESETZ ÜBER ÄNDERUN- GEN DER STAATSGRENZE ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER TSCHECHO- SLOWAKISCHEN SOZIALISTISCHEN REPUBLIK Stammgesetz 9/75 1975-01-22 Blatt 0 Ausgegeben am 22.
Mittel- und Oberstufe - MITTEL:
 Praktisches Arbeiten - 3 nrotationsgeschwindigkeit ( 2 ) Mittel- und Oberstufe - MITTEL: Ein Solarscope, Eine genau gehende Uhr, Ein Messschirm, Dieses Experiment kann in einem Raum in Südrichtung oder
Praktisches Arbeiten - 3 nrotationsgeschwindigkeit ( 2 ) Mittel- und Oberstufe - MITTEL: Ein Solarscope, Eine genau gehende Uhr, Ein Messschirm, Dieses Experiment kann in einem Raum in Südrichtung oder
Gipskarstlandschaften zwischen Steinthaleben und Rottleben. Steppenrasen, Karstbuchenwälder. und Höhlen
 Gipskarstlandschaften zwischen Steinthaleben und Rottleben Steppenrasen, Karstbuchenwälder und Höhlen A. Müller, 2015 Der Kyffhäuser ist ein kleines, aber geologisch und botanisch sehr interessantes Gebirge.
Gipskarstlandschaften zwischen Steinthaleben und Rottleben Steppenrasen, Karstbuchenwälder und Höhlen A. Müller, 2015 Der Kyffhäuser ist ein kleines, aber geologisch und botanisch sehr interessantes Gebirge.
