Beton nach 20jähriger Einwirkung von kalklösender Kohlensäure
|
|
|
- Tristan Waldemar Bayer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Beton nach 20jähriger Einwirkung von kalklösender Kohlensäure Von Friedrlch W. Locher, Wolfram Rechenberg und Siegbert Sprung, Düsseldorf Übersicht Wasser mit einem Gehalt an kalk/ösender Kohlensäure von mehr als 60 mg CO~I gilt nach DIN 4030 als " sehr stark betonangreifend". Nach DfN 1045 muß Beton vor dem unmittelbaren Zutritt solchen Wassers geschützt werden. Bei der Festlegung der Grenzwerte, nach denen die angreifende Wirkung zu beurteilen ist, standen nur wenige ältere Erfahrungen zur Verfügung. Daher war es erforderlich, zunächst Regelungen zu treffen, die sehr weit auf der sicheren Seite liegen. Darüber hinaus wurden Langzeituntersuchungen eingeleitet mit dem Ziel, diese Grenzwerte zu überprüfen. Hierzu wurden Feinbetonprismen unterschiedlicher Zusammensetzung in Wasser mit mehr als 100 mg kalk/ösender Ko hlensäure je Uter gelagert. Nach einer Einwirkungsdauer von rd. 20 Jahren ergab sich, daß bei dichtem Feinbeton mit Quarz als Zuschlag nur der oberflächennbhe Be reich bis zu einer Tiefe von höchstens etwa 6 mm abgetragen wurde. Für den chemischen Widerstand maßgebend war in erster Linie die Dichtigkeit des Betons. Zementart und -menge hatten einen geringeren Einfluß. Kalkstein als Zuschlag beeinträchtigte merklich die Dauerhaftigkeit des Betons. Als Schlußfolgerung ergab sich, daß dichter Beton mit säureunlöslichem Zuschlag dem lösenden Angr;tt von Wasser mit einem Gehalt bis 100 mg kalklösender Kohlensäure je Uter ohne zusätzlichen Schutz widerstehen kann. Die für die Beurteilung des Angritfsgrades von Wasser in Tab elle 2 der DIN 4030 genannten Grenzwerte gelten für Wasser mit vorwiegend natürlicher Zusammensetzung. Für die Beurteilung anderer betonangreifender Wässer, z. B. industrielles Abwasser, reichen die Kriterien der Tabelle 2 nicht immer aus, sondern es müssen dann bei einem Säureangriff neben dem ph-wertauch die Konzentration, die Art der Reaktion und der gebildeten Reaktionsprodukte sowie die Umgebungsbedingungen für eine gesicherte Beurteilung einbezogen werden. 1. Einleitung Seit 1963 werden im Forschungsinstitut der Zementindustrie Untersuchungen durchgeführt, bei denen Feinbetonprismen mit den Abmessungen 4 x 4 x '6 cm in Wasser mit kalklösender Kohlen- 41
2 säure lagern. Ober die Ergebnisse nach einer Lagerungsdauer von 11 Jahren wurde bereits berichtet [1]. Nachstehend wird der Stand der Untersuchungen nach 20jähriger Lagerung beschrieben. 2. Versuchsdurchführung Eine vollständige Darstellung der Versuchsdurchführung findet sich in der ersten Veröffentlichung [1]. Daher werden hier nur die Angaben nochmals aufgeführt, die zum Verständnis der Ergebnisse unmittelbar erforderlich sind. Das Zuschlaggemisch des Feinbetons mit einem Größtkorn von 7 mm bestand aus den vier Kornfraktionen 0/0,2 mm, 0/1 mm 1/3 mm und 3/7 mm und war so zusammengesetzt, daß seine Sieblinie etwa in der Mitte des "besonders guten" Bereichs zwischen den Grenzsieblinien A und B des Bildes 1 der DIN 1045 (Fassung Nov. 1959) verlief. Für den Anteil bis 1 mm war Quarzmehl bzw. Quarzsand und für den Anteil" 1/7 mm Rheinsand oder Kalksteinbruchsand eines devonischen, dichten Massenkalks verwendet worden. Als Bindemittel enthielt der Feinbeton Portlandzement mit unterschiedlichem Gehalt an Tricalciumaluminat, Hochofenzement mit unterschiedlichem Hüttensandgehalt sowie Traßzement und Traßhochofenzement. Der Wasserzementwert betrug 0,50 oder 0,70, derzementgehalt350 kg/m 3, 375 kg/m 3 oder 500 kg / m 3 Diese Versuchsbedingungen waren gewählt worden, um einen möglichen Einfluß der Zementart, der Zementmenge, des Wasserzementwerts und der Art des Zuschlags auf den chemischen Widerstand von Beton gegen kalklösende Kohlensäure beurteilen zu können. Die Feinbetonprismen lagerten vollständig untergetaucht in Wasser, dessen Gehalt an kalklösender Kohlensäure im Mittel etwa 100 bis 120 mg C0 2 1l betrug. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen [2J wurde der Versuchsablauf den in der Praxis herrschenden Bedingungen so angenähert, daß durch Einleiten von Kohlenstoffdioxid in das Wasser des Lagerungsbehälters und Umwälzen des Wassers die Konzentration an kalklösender Kohlensäure etwa konstant blieb. Das durch Calciumhydrogencarbonat im Verlauf derzeit abgepufferte Wasser wurde in monatlichem Abstand erneuert und durch Frischwasser ersetzt. 3. Ergebnisse 3.1 Beurteilung nach Augenschein Nach 20jähriger Lagerung in Wasser mit einem Gehalt an kalklösender Kohlensäure von im Mittel mehr als 100 mg CO 2 /1 konnten deutliche Unterschiede im Aussehen der Prismen beobachtet werden, wie aus den Bildern 1 bis 4 hervorgeht. Unabhängig von Zementart oder -gehalt, dem Wasserzementwert oder der Art des Zuschlags war die Wirkung des lösenden Angriffs deutlich festzustellen. Sie machte sich durch eine Aufrauhung der Oberfläche und im fortgeschrittenen Stadium auch durch verstärkte Abrundungen der Ecken und Kanten bemerkbar. 42
3 In den Bildern 1,2 und 3 sind Pnsmen dargestellt, deren Feinbeton mit Quarz als Zuschlag hergestellt wurde. Die Feinbetone unterscheiden sich in der Zementart (Bild 1), im Wasserzementwert (Bild 2) und im Zementgehalt (Bild 3). In Bild 1 sind Prismen aus Feinbeton mit 5 verschiedenen Zementen, jedoch ei nheitlichem Zementgehalt von 375 kg / m 3 und einheitlichem Wasserzementwert von 0,50 dargestellt. Alle Prismen zeigen deutliche Anzeichen eines lösenden Angriffs, kenntlich an abgetragener Oberfläche und abgerundeten Ecken und Kanten. Das gilt auch für die hier nicht dargestellten Prismen aus den anderen Zementen. Bei den Prismen aus Portlandzement war der Abtrag etwas stärker fortgeschritten. Der Feinbeton aus Traßzement nahm eine MittelsteJlung zwischen Hochofen- und Portlandzement ein, während der Feinbeton aus Traßhochofenzement dem Feinbeton aus Hochofenzement ähnelte. Bild 2 läßt erkennen, daß ein Feinbeton mit ei nem höheren Wasserzementwert von 0,70 (rechter Bildteil) stärker abgetragen wurde als Feinbeton mit niedrigerem Wasserzementwert von 0,50 und entsprechend dichterem Gefüge (linker Bildteil). Aus Bild 3 geht hervor, daß bei gleichem Wasserzementwert von 0,50 der Beton mit dem höheren Zementgehalt von 500 kg/m 3 (rechter Bildteil) etwas stärker angegriffen wurde als der Beton mit einem zur Herstellung eines dichten Gefüges ausreichend hohen ZementgehaJt von 375 kg/ m 3 (linker Bildteil). Die Feinbetonprismen, die aus dichtem Kalkstein als Zuschlag hergestellt worden waren, w urden deutlich stärker angegriffen als Prismen mit Quarzzuschlag. Das ist an den in Bild 4 dargestellten Prismen deutlich zu erkennen. Bei den Prismen mit Quarz als Zuschlag (l inker Bildteil) war nur der Zementstein teilweise gelöst worden, nicht jedoch der Zuschlag. Bei den Prismen mit Kalkstein als Zuschlag löste sich demgegenüber der Kalkstein wesentlich stärker als der Zementstein (rechter BiJdteil). Das führte, besonders von den Ecken und Kanten ausgehend, zu einem verstärkten Abtrag und damit zu einer entsprechend größeren Querschnitlsverminderung. 3.2 Quantitative Auswertung Berechnungsmodefle Zur Übertragung der Untersuchungsergebnisse an 4 x 4 x 16-cm Feinbetonprismen auf Beton in der Praxis wählten F. W. Locher und S. Sprung [ 1] ein Modell - im folgenden Prismenmodell genannt-, mit dem auch die einzelnen Punkte in Bild 5 berechnet wu rden. Dabei wurde mit der jeweiligen Rohdichteaus dem Gewichtsverlust ein entsprechender, auf die ursprüngliche Oberfläche bezogener Abtrag in mm berechnet. Mit den entsprechend verringerten Abmessungen ergab sich ein neues, kleineres Prisma mit entsprechend kleinerer Oberfläche, auf die der neuerliche Gewichtsverlust beim nächsten Prüftermin bezogen wurde. Nach diesem Modell wird der berechnete Abtrag einheitlich auf alle vor dem betreffenden Prüftermin gegebenen Flächen bezogen. Dadurch wird auch dem vermehrten Abtrag an Ecken und Kanten der Prüfkörper Rechnung getragen. Oie Bilder 2 bis 4 in [1] zeigen bereits eine entsprechende Abrundung. Dabei war nach 11jähriger Lagerung bei allen Prüfkör- 43
4 pern noch die ursprüngliche Form des Prismas erkennbar. Das ist auch noch bei ei ner Reih e von Prismen in den Bildern 1 bis 4 (Abschnitt 3.1) nach einer Einwirkungsdauer der kalklösenden Kohlensäure von rund 20 Jahren erkennbar. Bei einigen Prüfkörpern war der Abtrag aber bereits so weit fortgeschritten, daß eine zylindrische Form entstanden war. Das ist besonders deutlich an den kalksteinhaitigen Prüfkörpern im rechten Teil von Bifd 4 erkennbar. Es ist demnach anzunehmen, daß alle PZ ß75* PZ875 TrZ 30/70 IIOZ ß 75 IIOZil75 * 375 kg Zement / m 3 W/Z=0,50 Zuschlag Quarz Bil d 1 Feinbetonprismen nach 20 Jahren Lagerung in Wasser mit ka lkfösender Koh lensäure; Einfluß der Zementart ") Zement mit hohem Sulfatwiderstand 375 kg Zement / m 3 W/Z =0,50 Zuschlag Quar z 350 kg Zement /mß w/z = 0,70 Zuschlag Quarz Bild 2 Feinbetonprismen nach 20 Jahren Lagerung in Wasser mit kalklösender KOhlensäure; Einfluß des Wasserzementwerts 44
5 Prismen im Laufe der Zeit in Zylinder umgewandelt werden. Von einem bestimmten, aber unbekannten Zeitpunkt an, der auch für jeden Prüfkörper unterschiedlich sein dürfte, wäre demnach ein Zylindermodell besser zur Berechnung des fortschreitenden Abtrags geeignet. Dabei wären zwei unterschiedliche Zylindermodelle zu berücksichtigen. Bei dem ersten wäre der aus dem Gewichtsverlust berechnete Abtrag auf die Oberfläche eines Zylinders mit gleich großer Oberfläche wie beim Prisma und bei dem zweiten auf die 375 kg Zement / m 3 W/Z=O:5~ Zuschlag Q~ I I 500kg Zement/mg. W/Z=0,50 Zuschlag Quarz Bild 3 Feinbetonprismen nach 20 Jahren Lagerung in Wasser mit kalklösender Kohlensäure; Einfluß der Zementmenge 375 kg Zement / m 3 W/Z=O,50 Zuschlag Quarz 375 kg Zement Im? wlz = 0,50 Zusct71ag kalkstein Bild 4 Feinbetonprismen nach 20 Jahren Lagerung in Wasser mit kalklösender Kohlensäure; Einfluß der Zuschlagart 45
6 ~ 8r'--r------,------,------, m 81 I I Zemenfmenge ~ 7 I I.1;;. 1 J LageruITflsdauep in Bild 5 Dicke der abgetragenen Schicht nach 20 Jahren; Einwirkung von Wasser mit kalklösender Kohlensäure
7 Oberfläche eines Zylinders mit gleichem Volumen wie das Prismazu beziehen. Auf eine graphische Darstellung der Auswertung nach den Zylindermodellen wurde verzichtet, da sich herausstellte, daß der nach dem Zylindermodell mit gleicher Oberfläche berechnete Abtrag stets um etwa 0,1 bis 0,6 mm kleiner war und der nach dem Zylindermodell mit gleichem Volumen berechnete Abtrag stets um etwa 0,2 bis 1,0 mm größer war als der nach dem Prismenmodell be~ rechnete Abtrag. Durch die zwei unterschiedlichen Zylindermodelle ergibt sich ein Bereich, von dem erwartet werden kann, daß er den wahren, aber unbekannten Abtrag einschließt. Da die Ergebnisse der Berechnung nach dem Prismenmodell praktisch in der Mitte zwischen den Rechnungen nach den beiden Zylindermodellen liegen, kann davon ausgegangen werden, daß die Rechnung nach dem Prismenmodell die beste Annäherung darstellt. Der an den Prismen ermittelte Gewichtsverlust wurde daher nach dem Prismenmodell auf den Oberflächenabtrag umgerechnet Quantitative Prüfung Für eine quantitative Beurteilung des lösenden Angriffs der kalklösenden Kohlensäure wurde der Gewichtsverlust der Prismen nach jeweils 3 Monaten Lagerungsdauer ermittelt und über die Rohdichte der Prismen in die Dicke der abgetragenen Schicht in mm umgerechnet. Dabei wurde berücksichtigt, daß sich die Oberfläche der Prismen ständig verringert (Abschn ). Die Ergebnisse sind in Bild 5 dargestellt; sie zeigen von links nach rechts den Einflußdes Zementgehalts, der Zementart, des Wasserzel}1entwerts und der Art des Zuschlags auf die Abtragung für eine Prüfdauer von 20 Jahren. Die unterschiedlich schraffierten Flächen stellen jeweils den Be~ reich dar, in den die entsprechenden Betone fielen. Aus dem Verlauf der Kurven geht allgemein hervor, daß der aus dem Gewichtsverlust errechnete Abtrag mit der Lagerungsdauer zunimmt. Die Abtragungsgeschwindigkeit geht aber mit der Zeit zurück. Das läßt darauf schließen, daß die Diffusion der kalklösenden Kohlensäure erschwert wird und infolgedessen die Lösungsgeschwindigkeit abnimmt. Neben Calciumhydroxid und Calciumcarbonat werden auch die Si-, AI- und Fe~ha1tigen Hydratationsprodukte des Zements gelöst. Während bei der Lösung des Hydroxids und des Carbonats kein Rückstand bleibt, lagern sich nach der Zer~ setzung der anderen Hydrate und nach dem Abtransport der leicht löslichen Bestandteile die in kalklösender Kohlensäure unlöslichen Reste überwiegend als Gemisch aus Kieselgel und Aluminium~ und Eisenhydroxid auf der Oberfläche ab. Sie bilden dort einen rostfarbenen Überzug, dessen Zusammensetzung und Dichtigkeit E. Koelliker näher untersuchte (3]. Der Überzug bremst den Angriff der kalklösenden Kohlensäure. Da diese Schicht die Oberfläche des Betons nicht diffusionsdicht abdeckt, sondern porös und damit für die kalklösende Kohlensäure aus dem Wasserreservoir durchlässig bleibt, kann der Säureangriff nicht vollständig unterdrückt werden. Der verlangsamt fortschreitende Angriff der kalklösenden Kohlen~ säure bewirkt auf Dauer an der Oberfläche des Betons auch eine zunehmende Lockerung des Verbunds zwischen Zementstein und Zuschlag. Nach längerer Einwirkdauer lösen sich die Zuschlag körner 47
8 aus dem Verbund, fallen ab und ergeben beim folgenden Prü ftermin einen erhöhten Gewichtsverlust, der als scheinbar beschleunigter Oberflächenabtrag bei den in Bild 5 für quarzhaitigen Zuschlag dargestellten Ners,uchser:gebnissen erscheint. Anschließend bestimmt wieder die sich mit der Zeit verlangsamende Auflösung der Hydratphasen des Zementsteins die Abtragungsgeschwindigkeit. Eine kritische Überprüfung früherer Ergebnisse [1] zeigte in der Tendenz ähnliche Schwankungen der Abtragungsgeschwindigkeit. Der in Bild 5 dargestellte Kurvenverlauf gibt unabhängig von den Schwankungen der Einzeimeßwerte Aufschluß darüber, in welchem Maße sich die Zusammensetzung auf d ie Widerstandsfähigkeit des Feinbetons gegen den lösenden Angriff der kalklösenden Kohlensäure auswirkt. Aus d em Di agramm links, in dem der Einfluß des Zementgehalts dargestellt ist, geht hervor, daß sich bei Erhöhung des Zementgehalts im Feinbeton von 375 kg/m 3 auf 500 kg/m 3 der Abtrag von maximal 4,4 mm auf maximals,b mm nach 20 Jahren erhöhte. Das ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß bei gleich bleibendem Wasserzementwert der Anteil des durch kalklösende Kohlensäure angreifbaren Zementsteins gleicher Dichtigkeit au f Kosten des Anteils von säureu nlöslichem Quarzzuschlag erhöht worden war. Im 2. Diagramm des Bildes 5 (von links) ist der Einfluß derzementart dargestellt. Bei gleichbjeibendem Zementgehaltvon 375 kg/m 3 und einheitlichem Wasserzementwert von 0,50 war der Abtrag bei den Feinbetonen mit Hochofenzement mit rund 2 mm bis maximal 2,9 mm nach 20 Jahren geringer als bei den Fei nbetonen mit Portlandzement von 4,4 mm bis rund 6,2 mm. Mit einem Abtrag von 3,7 mm nahm der Traßzement ei ne mittlere Stellung zwischen den Hochofen- und Portlandzementen ein. Dieses Verhalten ist offenbar auf die erhö hte Dichtigkeit des aus Hochofenzement bei ausreichender Nachbehandlung entstehenden Zementsteins zurückzuführen. Darauf wurde in anderem Zusammenhang bereits früher hingewiesen [4]. In Gegenwart von Traß entsteht ebenfalls ein dicht erer Zementstein, der jedoch nicht die Dichtigkeit des Zementsteins aus Hochofenzement erreicht. Für den erhöhten Diffusionswiderstand von Zementstein aus Hochofenzement gegenüber kalklösender Kohlensäure könnte außerdem der verminderte Gehalt an Calciumhydroxid eine wesentliche Rolle spielen. Der Einfluß des Wasserzementwerts auf den chemischen Widerstand des Feinbetons geht aus dem 3. Diagramm des Bildes 5 hervor. Es zeigt, daß der Abtrag generell bei dichterem Zementstein mit einem Wasserzementwert von 0,50 geringer war als bei dem Zementstein mit dem höheren Wasserzementwert von 0,70. Bei dichtem Feinbeton aus Hochofen- bzw. Portlandzement (w/z = 0,50) wurde im Verlauf von rund 20 Jahren eine Schicht von rund 2 mm bis 4,4 mm und bei weniger dichtem Feinbeton eine Schicht von rund 3,1 mm bis 6,7 mm abgetragen. Ein deutlich höherer Abtrag ergab sich, wenn anstelle des säurebeständigen Quarzes säurelöslicher Kalkstein als Zuschlag verwendet wurde (Diagramm rechts). Bei sonst gleicher Zusammensetzung wurde beim Feinbeton mit Kalkstein als Zuschlag eine Schicht von 6,1 mm bis 8,9 mm gegenüber einer Schicht von 2 mm bis 4,4 mm beim Feinbeton mit Quarzzuschlag abgetragen. Die größere Abtra- 48
9 gung der Feinbetone mit Kalkstein als Zuschlag ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß sich der Kalkstein schneller auflöst als der Zementstein. Das geht aus Bild 4 hervor, in dem je zwei Feinbetonprismen mit Quarz und mit Kalkstein als Zuschlag dargestellt sind. Man erkennt, daß der grobe Kalkstein wesentlich stärker gelöst wu rde als der Feinmörtel, so daß die Betonoberfläche deutliche Vertiefungen aufweist. Im Gegensatz dazu ragt der grobe Quarzzuschlag als säureunlöslicher Bestandteil des Betongefüges aus dem Feinmörtel heraus. Die höhere Auflösungsgeschwindigkeit des Kalksteinzuschlags gegenüber dem Feinmörtel beruht darauf, daß Calciumhydrogencarbonat (Ca(HC0 3 h) als leicht wasserlösliches Reaktionsprodukt bei der Einwirkung von kalklösender Kohlensäure entsteht, das bei den hier gewählten Versuchsbedingungen mit dem Wasser abtransportiert wird. Die Kalksteinoberfläche ist auf diese Weise ständig dem ungehemmten Angriff ausgesetzt. Demgegenüber bildet sich auf dem Feinmörtel eine Schutzschicht aus Lösungsrückständen, die den Kohlensäureangriff hemmt. Wie Bild 4 zeigt, war bei sonst gleicherzusammensetzung die Oberflächenabtragung bei den kalksteinhaitigen Feinbetonen insgesamt deutlich höher als bei den Feinbetonen, die ausschließlich Quarzzuschlag enthielten. Das ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß der Kalkstein als Zuschlag den Anteil der säurelöslichen Bestandteile im Betongefüge erhöht. Auf diese Weise wird der kalklösenden Kohlensäure eine insgesamt größere Angriffsfläche geboten als bei einem Beton, in dem die säurelöslichen Bestandteile des Zementsteins durch unlöslichen Zuschlag verdünnt sind. Außerdem dürfte von Bedeutung sein, daß säureunlöslicher Zuschlag den unter den Zuschlagkörnern liegenden Zementstein zeitl ich begrenzt, aber insgesamt länger vor einem direkten Zutritt der kalklösenden Kohlensäure abschirmen kann als säurelöslicher Zuschlag. Ein Vergleich der Bilder 1 bis 3 zeigt dementsprechend, daß Quarzkörner so lange erhaben auf der angegriffenen Oberfläche erhalten bleiben, bis der Zementstein auf der Rückseite durch Hinterspülen herausgelöst ist und das Zuschlagkorn abfällt. Hierdurch ergibt sich eine insgesamt geringere Abtragungsgeschwindigkeit als bei einem Beton mit säurelöslichern Kalkstein. Zu ähnlichen Schlußfolgerungen gelangte auch E. Koelliker [3]. 4. Diskussion Bei der Beurteilung der betonangreifenden Wirkung von Wasser nach DIN 4030 wird vorausgesetzt, daß das Wasser in großer Menge ansteht, sein Gehalt an angreifenden Bestandteilen sich daher laufend erneuern kann und infolgedessen seine betonangreifende Wirkung durch Reaktion mit dem Beton nichtoder nur unwesentlich gemindert wird. Die hier beschriebene Untersuchung des Angriffs der kalklösenden Kohlensäure wurde in der Weise durchgeführt, daß diese Voraussetzungen zutreffen. Versuchstechnisch mußte zwar hingenommen werden, daß sich die Zusammensetzung der angreifenden Lösung durch die Reaktion mit dem Beton veränderte. Durch Lagerung aller Prüfkörper in einem Behälter, eine regelmäßige Umlagerung der Prüfkörper sowie durch ständige Zufuhr von 49
10 Kohlensäure und den in regelmäßigen Zeitabständen vorgenommenen Wechsel des Wassers war aber andererseits gewährleistet, daß alle Prüfkörper im Mittel stets von Wasser mit einem etwa gleichbleibenden Gehalt an kalklösender Kohlensäure von 100 bis 120 mgll angegriffen wurden. Unter diesen Versuchsbedingungen, die demnach den bei der Beurteilung des Angriffsgrades nach DIN 4030 zugrunde liegenden Voraussetzungen entsprechen, selzt Kalkstein als Zuschlag die Widerstandsfähigkeit des Betons gegen den Angriff kalklösender Koh lensäure herab. Im Gegensatz dazu haben Untersuchungen von J. H. P. van Aardt [2] ergeben, daß Kalkstein als Zuschlag den Säu reangriff auf Beton abschwächt. Als angreifendes Medium wurde jedoch nicht kalklösende Kohlensäure, sondern 1- bzw. 5%ige Schwefelsäurelösungen (10 bzw. 50 g H 2 S0 4 /1) verwendet. Außerdem wurde eine andere Art der Lagerung gewählt, und zwar lagerte jeweils ein Mörtelprisma für sich in 850 ml der 1- bzw. 5 %igen Schwefelsäurelösung, die nur wöchentlich 1 mal erneuert wurde. Es ist anzunehmen, daß sich bei dieser Art der Lagerung der Angriffsgrad der Säurelösungen durch Reaktion mit den Betonen auf unterschiedliche Weise verändert. Der Kalkstei nzuschlag neutralisierle die angreifende Säure sehr schnell, so daß die Prüfkörper danach bis zum nächsten Lösungswechsel in einer neutralen Sulfatlösung lagerten, die zwar noch einen Sulfatangriff, aber keinen Säureangriff mehr hervorrufen konnte: infolgedessen wurde der Zementstein praktisch nicht gelöst. Bei den Prüfkörpern mit Quarzzuschlag stand demgegenüber die in dem Lagerungsbehälter enthaltene Säure ausschließlich für das Auflösen des Zementsteins zur Verfügung. Bei dieser Art der Lagerung traten demnach Unterschiede in der Neutralisationskapazität des Betons deutlich hervor, d. h., daß sich die Abschwächung des Säureangriffs durch Reaktion eines verhältnismäßig geringen Volumens der angreifenden lösung mit dem Beton in starkem Maß auf das Verhalten des Betons auswirkte. Außerdem unterscheidet sich der Angriff der Schwefelsäure vom Angriff der kalklösenden Kohlensäure oder anderer Säuren durch die Art der Reaktion. Schwefelsäure reagiert mit Kalkstein oder anderen löslichen Calciumverbindungen unter Bildung von Gips. Gips weist als Reaktionsprodukt im Gegensatz zu Calciumhydrogencar bonat aus der Kohlensäurereaktion eine ve rhältnismäßig geringe Löslichkeit in Wasser auf, so daß ein weiterer Säureangriff auf den Kalkstein durch Ausbildung einer Schutzschicht gehemmt wird. In den ze mentsteinhalt igen Bereichen bildet sich zwar ebenfalls Calciumsulfat; Eisen und Aluminium aus den Hydratationsprodukten des Zements reagieren aber mit der Schwefelsäure unter Bildung leichtlöslicher Sulfate und tragen daher nicht mehr wie beim Angriff der kalklösenden Kohlensäure zur Bildung einer Schutzschicht bei. Die unterschiedlichen Ergebnisse und Schlußfolgerungen sind demnach im wesentlichen auf nicht vergleichbare Versuchsbedingungen zurückzuführen. Versuchsbedingungen, die für die Untersuchung des Angriffs kalklösender Kohlensäure gewählt wurden, entspre chen weitgehend den Voraussetzungen, die der DIN 4030 zugrunde liegen. Unter diesen Voraussetzungen hat Beton mit Kalkstein als Zuschlag unter sonst gleichen Bedingungen eine geringere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Angriff von kalklösender Kohlensäure als Beton mit unlöslichem Zuschlag. 50
11 In der Praxis ist eine angriffshemmende Wirkung des Kalksteinzuschlags nur denkbar, wenn der chemische Angriff in seinem Ablauf der von J. H. P. van Aardt gewählten Versuchsdurchführung entspricht. Das könnte insbesondere dann zutreffen, wenn die angreifende Säure trotz ho her Konzentration nur in geringer Menge vorliegt oder sich nur langsam erneuern kann. Infolge der neutralisierenden Wirkung des Kalksteins würde das Ausmaß des Angriffs dann wesentlich herabgesetzt werden. Solche Bedingungen könnten möglicherweise bei der Bildung von Schwefelwasserstoff und einem Angriff der daraus entstehenden Schwefelsäure in schwach gefüllten, langsam fließenden und schlecht belüfteten Abwassersammlern vorherrschen. Das Verhältnis aus einwirkender Säuremenge und der für die Neutralisierung zurverfügung stehenden Betonmasse würde unter solchen, an sich unerwünschten Bedingungen durch Einsatz von Kalksteinzuschlag vermindert. 5. Langzeitverhalten Die Schlußfolgerungen aus den hier beschriebenen Untersuchungen des Angriffs von kalklösender Kohlensäure auf Betone gelten für eine Versuchsdauer von 20 Jahren. Die Lagerungsversuche werden noch fortgesetzt. Um schon jetzt das künftige Verhalten abschätzen zu können, wurde der zeitliche Verlauf der Oberflächenabtragung durch eine mathematische Funktion beschrieben. Aus dem Kurvenverlauf der in Bild 5 zusammengestellten Diagramme geht hervor, daß der Abtrag während einer Lagerungsdauer zwischen 8 und 20 Jahren annähernd linear mit der Zeit ansteigt. Die statistische Berechnung ergab für die entsprechenden Regressionsgeraden Bestimmtheitsmaße [5} zwischen 90 und 98 %. ' Mit der Regressionsgeraden ist es in einfacher Weise möglich, aus den bisherigen Ergebnissen den zukünftig zu erwartenden Abtrag zu berechnen. Die Rechenergebnisse für ein Alter von 30 Jahren sind in Tafel 1 aufgeführt. Dabei wurde eine Zusammenstellung gewählt, die den Diagrammen in Bild 5 entspricht. Aus den in Tafel 1 aufgeführten Rechenergebnissen geht hervor, daß nach 30jähriger Einwirkung von kalklösender Kohlensäure mit einer Konzentration von etwa 1 00 bis 120 mg CO 2 /1 mit einem Abtrag von im Mittel 6,4 mm zu rechnen ist, wenn zur Herstellung des Betons ein normaler Portlandzement verwendet wurde, und von im Mittel 3 mm, wenn zur Herstellung des Betons ein Hochofenzement mit einem Hüttensandgehalt von über70 Gew.-% verwendet wurde. Voraussetzung für diesen niedrigen Abtrag ist ein dichter Beton, kenntlich an einem ausreichend hohen Zementgehalt (z = 375 kg/m 3 ), einem ausreichend niedrigen Wasserzementwert (w/z = 0,50) und einem säureunlöslichen Zuschlag. Diese Vorhersage basiert auf einer Extrapolation der Ausgleichsgeraden durch die Ergebnisse an Prismen aus normalem Portlandzement (offene Kreise in den Diagrammen des Bildes 5) und aus Hochofenzement mit hohem Hüttensandgehalt (offene Vierecke). Wird derzementgehalt auf 500 kg/m 3 erhöht, so ist mit einem höheren Abtrag zu rechnen (Zeilen 1 und 2 in Tafel 1 ). Wird der Wasserzementwert von 0,50 auf 0,70 erhöht und der Zementgehalt entspre- 51
12 Tafel 1 Abtrag von Feinbeton nach 30 Jahren; berechnet aus Meßergebnissen nach 20jähriger Einwirkung von kalklösender Kohlensäure; Angaben in mm Zylinder Zylinder Zeile Berechnungsmodell mit gleicher Prisma mit gleichem Oberfläche Volumen Einfluß der Zementmenge: w / z = 0,50; Zuschlag Quarz 1 obere Kurve 8,1 8,5 9,4 I kg / m3 2 untere Kurve 3,5 3,5 3,9 3 obere Kurve 6,3 6,4 7,2 375 kg/m3 4 untere Kurve 2,9 3,0 3,3 r-- Ein fluß der Zementart: z '" 375 kg/m 3 ; w/z = 0,50: Zuschlag Quarz 5 obere Kurve 8,5 8,9 9,8 PZ 6 untere Kurve 6, ,2 r-- 7 Traßzement 30/70 5,4 5,5 6,1 8 obere Kurve 4,5 4,5 5,1 - HOZ 9 untere Kurve 2,9 3,0 3,3 Einfluß des Wasserzementwerts: z "" 350 kg/ m 3 ; Zuschlag Quarz 10 obere Kurve 9,1 9,6 10,5 - w / z = 0, untere Kurve 3,9 4,5 4,9 12 obere Kurve 6, ,2 r--- w/z = 0,50 13 untere Kurve 2,9 3,0 3,3 Einfluß der Zuschlag art: z = 375 kg/ m 3 ; w/z = 0,50 14 obere Kurve 11,2 12, 1 13,6 I-- Kalkstein 15 untere Kurve 7,9 8,3 9,1 16 obere Kurve 6, ,2 r-- Quarz 17 untere Kurve 2,9 3,0 3,3 chend ve rmindert, so ist zu erwarten, daß sich der Abtrag deutlich erhöht, und zwar von etwa 3,0 auf 4,5 mm (Zei len 11 und 13) bzw. von etwa 6,4 auf 9,6 mm (Zeilen 10 und 12). Wenn für die Herstellung von dichtem Beton als Zuschlag säurelöslicher Kalkstein statt säureunlöslichem Quarz verwendet wird, so erhöht sich der berechnete Abtrag nach 30 Jahren von 3,0 auf 8,3 mm bzw. von 6,4 auf 12,1 mm. Über das Ergebnis ähnlicher Lageru ngsversuche, bei denen nur der Einfluß der Zementart näher untersucht wurde, beri chteten Y. Efes und H. P. Lühr [6]. Entsprechende Untersuch ungen an Betonbalken (10 x 10 x 50 cm) und -zylindern (35 cm Durchmesser, 50 cm Höhe) 52
13 ausschließlich mit Quarzzuschlag und einem Größtkorn Von 30 mm führten H. Friede, P. Schubert und H. P. Lühr [7] durch. Die Prüfkörper lagerten in Wasser mit einem Gehalt an kalklösender Kohlensäure von im Mittel 92 mg C0 2 /1. Nähere Angaben zum Zementgehalt wurden nicht gemacht. Aus dem Mischungsverhältnis von 1,00 : 5,64 : 0,49 (z : g : w) kann jedoch geschlossen werden, daß es sich um eine zementreiche Betonmischung mit niedrigem Wasserzementwert handelte. Die Untersuchungsergebnisse bis zu einer Lagerungsdauer von 5 Jahren wurden nochmals von H. Friede und P. Schubert [8] ausgewertet. In die Auswertung wurden auch die Ergebnisse früherer Untersuchungen [1} einbezogen. Als Schlußfolgerung ergab sich, daß der Abtrag durch kalklösende Kohlensäure dem 1. Ficksehen Diffusionsgesetz gehorcht und etwa vom 5. Einwirkungsjahr an näherungsweise linear verläuft. Eine Extrapolation des Abtrags auf eine Einwirkungsdauer von 30 Jahren ergab einen Höchstwert von 11 mm, der in ähnlicher Größenordnung liegt wie die Meßwerte für zementreiche Feinbetone in Tafel Schlußfolgerungen Die Untersuchungen haben ergeben, daß dichtf!r Beton mit einem Wasserzementwert von 0,50 und mit Quarz als Zuschlag von Wasser mit einem Gehalt an kalkösender Kohlensäure von rd. 100 mg CO 2 /l bei 20jähriger Einwirkung nur mäßig angegriffen wird. Die Abtragungen betrugen rd. 2 bis 6 mm. Der Einfluß derzementart war zwar erkennbar, er war aber insgesamt verhältnismäßig gering. Die Widerstandsfähigkeit des Betons verminderte sich, wenn der Zementgehalt über die für die Herstellung eines dichten Betons erforderliche Menge erhöht oder der Wasserzementwert angehoben wurde. Beton mit säurelöslichem Kalkstein als Zuschlag wurde wesentlich stärker angegriffen als Beton mit säureunlöslichem Quarz. Der Abtrag nahm nach einem zunächst rascheren Anstieg später etwa linear mit der Zeit zu. Das heißt, daß von einem bestimmten Zeitpunkt an im Mittel mit einem konstanten Abtrag je Jahr zu rechnen ist. Als wesentliche Schlußfolgerung ergibt sich daraus, daß dichter Beton mit Quarzzuschlag dem Angriff von kalklösender Kohlensäure in einer Konzentration bis etwa 100 mg C0 2 /1 auch auf Dauer zu widerstehen vermag. Voraussetzung für die Herstellung eines solchen Betons ist, daß der Beton sachgerecht zusammengesetzt, hergestellt und eingebaut wird, sich dabei nicht entmischt, vollständig verdichtet und wenigstens 7 bis 14 Tage nachbehandelt wird. Er muß so dicht sein, daß eine größte Wassereindringtiefe von 3 cm bei der Wasserundurchlässigkeitsprüfung nach DIN 1048 nicht überschritten wird. Beim Betonieren in Wasser oder im durchfeuchteten Boden ist eine ausreichende Nachbehandlung in jedem Fall gewährleistet [9}. Da sich außerdem gezeigt hat, daß die Lagerung des jungen Betons auch in stark angreifendem Wasser den chemischen Widerstand nicht beeinträchtigt [10], braucht eine Wasserhaltung, die aus anderen Gründen erforderlich sein kann, nicht über das Ende des Betonierens ausgedehnt zu werden. Für die Herstellung eines Betons, der diesen Anforderungen genügt, sollte ausschließlich Quarzsand und -kies als Zuschlag ve r- 53
14 wendet werden. Außerdem ist eine Zusammensetzung des Zuschlags im günstigen Bereich nach den Bildern 1 bis 4 der DIN 1045 zu wählen, ein möglichst niedriger Wasserzementwert von höchstens 0,50 einzuhalten und ein ausreichend hoher Zementgehalt von etwa320 kg Zement je m 3 Beton vorzusehen [1]. Der Zementgehalt sollte aber etwa 350 kg Zement je m 3 Beton [7] nicht wesentlich übersteigen. Ist der Gehalt des Wassers an kalklösender Kohlensäure höher als 100 mg CO 2 /I, so ist der Beton vor dem unmittelbaren Zutritt zu schützen. In Fällen, in denen das nicht möglich ist, wie z. B. bei Pfahlgründungen, kann dem sehr starken chemischen Angriff auch dadurch begegnel werden, daß die Betondeckung der Bewehrung weiter erhöht wird. Der zusätzliche Beton ist dann als Schutzschicht anzusehen; er darf bei statischen Berechnungen nicht berücksichtigt werden. Für die Abschätzung der erforderlichen Dicke dieser Schicht können in Abhängigkeit von der vorgesehenen Lebensdauer des Bauwerks die ermittelten Abtragungen herangezogen werden. Für die Beurteilung eines Wassers auf sei ne betonangreifende Wirkung nach DIN 4030 kann demnach der Grenzwert zwischen dem " starken" und dem " sehr starken" Angriff von derzeit 60 mg CO 2 /I ohne Gefahr für die Dauerhaftigkeit erhöht werden. In der DIN Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase - wird im ersten Abschnitt ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sie namentlich für angreifende Grundwässer, Sickerwässer aus Halden und Aufschüttungen, Abwässer und Meerwasser gilt, nicht jedoch für konzentrierte Lösungen. Im zweiten und dritten Abschnitt dieser Norm werden zwar auch solche betonangreifenden Stoffe und ihre Wirkung beschrieben, wie sie bei industriellen Abwässern vorkommen können. jedoch wird in Abschnitt ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die für die Beurteilung des Angriffsgrads von Wasser in Tabelle 2 genannten Grenzwerte für Wasser mit vorwiegend natürlicher Zusammensetzung gelten. ZurBeurteilung des Säureangriffs auf Beton von Wässern oder Lösungen, die in ihrer Zusammensetzung davon wesentlich abweichen, und zur Festlegung dagegen ausreichender Maßnahmen bedarf es daher einer wesentlich differenzierteren Betrachtung. Dabei müssen insbesondere die nachfolgenden Gesichtspunkte beachtet werden. Konzentration: Neben dem ph-wert ist die Konzentration der Säure von Bedeutung, die ständig auf den Beton einwirkt. Bei gleichem ph-wert kann der Angriff durch eine hohe und ständig erneuerte Konzentration verstärkt werden. Säurereaktion: Säuren, wie z. B. kalklösende Kohlensäure oder Salpetersäure, wirken ausschließlich lösend auf den Beton. Bei anderen Säuren, wie z. B. Schwefelsäure, tritt - verursacht du reh das Reaktionsprodukt - zusätzlich ein Sulfatangriff auf. Reaktionsprodukt: Die durch die Reaktion mit Säuren ents te~ henden Reaktionsprodukte weisen eine unterschiedliche Löslichkeit in Wasser auf. Bei der Bildung leicht wasserlöslicher Reaktionsprodukte ist der Angriff bei konstant bleibender Säurekonzentration in der Regel sehr groß. Ursache hierfür ist die fehlende Schulzschicht auf der angegriffenen Oberfläche. In Wasser schwer 54
15 lösliche Reaktionsprodukte des Säureangriffs hemmen den weiteren Angriff durch die Bildung von Schutzschichten auf der Betonoberfläche. Umgebungsbedingungen: Neben Druck und Temperatur, die häufig die Angriffsleistung von Säuren steigern können. sind die Austauschgeschwindigkeit und das Volumen der säurehaitigen Lösung im Verhältnis zum Volumen oder der Oberfläche des Betonkörpers von Bedeutung (Neutralisationskapazität). Die Austauschgeschwindigkeit wird durch die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers beeinflußt: Bei stehendem oder sehr langsam strömendem Wasser, wie z. B. in Böden mit einem Durchlässigkeitsbeiwert kvon 10-1 oder weniger, ist mit einer Minderung des Angriffs zu rechnen. Die Beurteilungskriterien für den Säureangriff sollten nicht nur auf den Zementstein, sondern auch auf den Zuschlag angewendet werden, wenn dieser säurelöslich ist oder säurelösliche Bestandteile enthält. Das gilt in besonderem Maß für Kalkstein. 7. Zusammenfassung Untersuchungen an Feinbetonprismen (4 x 4 x 16 cm) unterschiedlicher Zusammensetzung, die in Wasser mit einem Gehalt an kalklösender Kohlensäure von mehr als 100 mg CO 2 /llagerten, führten zu den nachfolgenden Ergebnissen und Folgerungen. 7.1 Die 20jährige Einwirkung von kalkösender Kohlensäure bewirkte bei den Prüfkörpern einen Abtrag an der Oberfläche, im fortgeschrittenen Stadium auch Abrundungen an Ecken und Kanten. 7.2 Der Abtrag wurde aus dem Gewichtsverlust berechnet. Er nahm anfangs stärker, später nur noch langsam zu. Vom 8. Jahr an ist der jährliche Abtrag etwa konstant. 7.3 Für den Widerstand gegen den " starken Angriff" durch kalklösende Kohlensäure ist in erster Linie die Dichtigkeit des Betons maßgebend. Bei einem Wasserzementwertvon 0,50, einem Zementgehalt von 375 kg / m 3 und einem besonders gut abgestuften Zusch lag aus Quarz wurde nach 20 Jahren ein Abtrag von höchstens rd. 6 mm festgestellt. 7.4 Bei den Prüfkörpern mit Kalkstein als Zuschlag war der Abtrag deutlich größer, da der Kalkstein schneller aufgelöst wurde als der Zementstein. 7.5 Die Ergebnisse dieser Untersuchungen an Feinbeton mit einem Zuschlag 0/7 mm, einem Wasserzementwert von 0,50 und einem Zementgehalt von 375 kg / m 3, der sich als ausreichend widerstandsfähig gegen Wasser mit im Mittel mehr als 100 mg C0 2 /1 erwiesen hat, können auf Beton üblicher Zusammensetzung übertragen werden. Beton mit Quarzzuschlag entsprechend der Sieblinie 8 3 :<.> einem Zementgehalt von etwa 320 kg/ m 3 und einem Wasserzementwertvon 0,50 ist bei einer Konsistenz an der oberen Grenzevon K 1 praktisch vollständig verdichtbar. Von ihm kann mindestens der gleiche Widerstand gegen den Angriff der kalklösenden Kohlensäure erwartet werden. 7.6 Aufgrund der Untersuchungsergebnisse kann empfohlen werden, den in der DIN 4030 festgelegten oberen Grenzwert des " star- 55
16 ken Angriffs" der kalklösenden Kohlensäure von derzeit 60 mg CO z/l auf 100 mg CO 2 /1 zu erhöhen. 7.7 Oie in DIN 4030 festgelegten Grenzwerte gelten für Wasser mit vorwiegend natürlicher Zusammensetzung. Andere Verhältnisse, z. B. hochkonzentrierte Säuren, erfordern weitergehende Untersuchllngen und Überlegungen, bei denen neben dem ph-wert auch die Säurekonzentration, die Art der Reaktion und der gebildeten Reaktionsprodukte sowie die Umgebungsbedingungen einzubeziehen sind. Dabei ist häufig ausschlaggebend, ob sich auf dem Zementstein oder dem Zuschlag eine den Angriff mindernde Schutzschicht bilden kann. SCH RI FTTUM [li Locher, F. W., und S. Sprung: Die Beständigkeit von Beton gegenüber kalklösender Kohlensäure. belon 25 (1975) H. 7, S ; ebenso Betontechnische Berichte 1975, Beton.Verlag, D~sseldorf S. 91 / 104. (2) van Aardt, J. H. P. : Säureangritr auf Beton bei kalkhaltigen Zuschlagstoffen. Zement-Kalk-Gips 14 (1961) H. 10, S. 440/ 447. [3J Koelliker, E.: Über die Wirkung von Wasser und wäßriger Kohlensäure auf Beton. Intern. Koll. Techn. Akad. Esslingen : Werkstoffwissenschaften und Bausanierung, Berichtsband S. 195/200. [4J Locher, F. W.: Zur Frage des Surfatwiderstands von Hüttenzementen. Zement-Kalk-Gips 19 (1966) H. 9, S. 395/401. [5] Sachs, S.: Angewandte Statistik. 5. Auf!., Springer-Verlag, Berlin/HeidelberglNew York (6) EIes, Y., und H. P. Lühr: Beurteilung des Kohlensäure-Angriffs auf Mörtel au s Zementen mit verschiedenem Klinker- Hüttensand-Verhältnis. TIZ-Fachber. 104 (1980) H. 3, S. 153/ 167. (7) Friede, H., P. Schubert und H. P. Lühr: Angriff kalklösenderkohlensäure auf Beton. beton 29 (1979) H. 7, S. 250/253. [8] Friede, H., und P. Schuber!: Zur Bestimmung der Dicke der korrodierten Schicht von Beton bei Angriff kalklösender Kohlensäure. TIZ-Fachber. 107 (1983) H. 1, S. 38/43. [91 Bonzel, J.: Der Einflu8 des Zements, des W/Z-Wertes, des Alters und der Lagerung auf die Wasserundurchlässigkeit des Betons. beton 16 (1966 ) H. 9, S. 379/ 383, und H. 10, S. 417/ 421 ; ebenso Betontechnische Beric hte 1966, Beton-Verlag, Düsseldorf 1967, S. 145/ 168. (10) Rechenberg, W.: Junger Beton in " stark" angreifendem Wasser. be ton 25 (1975) H. 4, S. 143/ 145; ebenso Betontechnische Berichte 1975, Beton-Verlag, Düsseldorf 1976, S. 57/65. 56
Schäden durch chemisch lösenden Angriff
 Schäden durch chemisch lösenden Angriff Einleitung Ein chemisch lösender Angriff kann durch die Einwirkung von Säuren, austauschfähigen Salzen, weichem Wasser oder starken Basen stattfinden (Tab. 8.6.1).
Schäden durch chemisch lösenden Angriff Einleitung Ein chemisch lösender Angriff kann durch die Einwirkung von Säuren, austauschfähigen Salzen, weichem Wasser oder starken Basen stattfinden (Tab. 8.6.1).
M. Brianza: Empfehlungen zu den Expositionsklassen XA FSKB Frühjahrstagung FSKB Empfehlungen zu den Expositionsklassen XA
 Frühjahrstagung FSKB 2006 Empfehlungen zu den 1 Beanspruchung von Beton Angriff auf die Bewehrung Schädigung des Betongefüges Meerwasser S F Frost (mit/ohne Taumittel) Chloride D 0 A chemischen Angriff
Frühjahrstagung FSKB 2006 Empfehlungen zu den 1 Beanspruchung von Beton Angriff auf die Bewehrung Schädigung des Betongefüges Meerwasser S F Frost (mit/ohne Taumittel) Chloride D 0 A chemischen Angriff
Einfluss verschiedener Auftausalze auf den Frost- Tausalz-Widerstand von Beton
 ASTRAD SYMPOSIUM 2011 Einfluss verschiedener Auftausalze auf den Frost- Tausalz-Widerstand von Beton 13. April 2011 C. Milachowski, F. Götzfried*, J. Skarabis, C. Gehlen Technische Universität München
ASTRAD SYMPOSIUM 2011 Einfluss verschiedener Auftausalze auf den Frost- Tausalz-Widerstand von Beton 13. April 2011 C. Milachowski, F. Götzfried*, J. Skarabis, C. Gehlen Technische Universität München
Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen
 Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen VII Inhaltsverzeichnis Einführung 1 1 Kenngrößen und Einflussfaktoren
Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Farb- und 192 sw-abbildungen und 42 Tabellen VII Inhaltsverzeichnis Einführung 1 1 Kenngrößen und Einflussfaktoren
Untersuchungen zur Ausgleichsfeuchte unbeheizter Zementestriche
 1 zusammengestellt von Herrn Dipl.-Ing. Egbert Müller Der Bundesverband Estrich und Belag e.v., Troisdorf, beauftragte das Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung, Troisdorf, mit der Durchführung
1 zusammengestellt von Herrn Dipl.-Ing. Egbert Müller Der Bundesverband Estrich und Belag e.v., Troisdorf, beauftragte das Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung, Troisdorf, mit der Durchführung
Chemischer Angriff auf Beton *)
 Chemischer Angriff auf Beton *) Von F. W. Locher, Düsseldorf übersicht Säuren und bestimmte Salze, z. a. Magnesium- und Ammoniumsalze, lösen den Zementstein von der Oberfläche her auf. Weiches Wasser greift
Chemischer Angriff auf Beton *) Von F. W. Locher, Düsseldorf übersicht Säuren und bestimmte Salze, z. a. Magnesium- und Ammoniumsalze, lösen den Zementstein von der Oberfläche her auf. Weiches Wasser greift
Über die Herstellung von Beton höchster Festigkeit *)
 Über die Herstellung von Beton höchster Festigkeit *) Von Kurt Walz, Düsseldorf Übersicht Beton, der bei niederen Temperaturen und unter Druck erhärtet, liefert bei sonst gleicher Zusammensetzung höhere
Über die Herstellung von Beton höchster Festigkeit *) Von Kurt Walz, Düsseldorf Übersicht Beton, der bei niederen Temperaturen und unter Druck erhärtet, liefert bei sonst gleicher Zusammensetzung höhere
Schwinden von Beton. Frank Jacobs, Fritz Hunkeler, Lorenzo Carmine, André Germann und Thomas Hirschi
 Schwinden von Beton Für das Schwinden von Beton gibt es verschiedene Ursachen. Versuche haben nun gezeigt, dass mit dem Einsatz von Fliessmitteln das Zementleimvolumen und damit das Schwindmass reduziert
Schwinden von Beton Für das Schwinden von Beton gibt es verschiedene Ursachen. Versuche haben nun gezeigt, dass mit dem Einsatz von Fliessmitteln das Zementleimvolumen und damit das Schwindmass reduziert
Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff
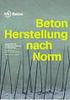 Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Färb- und 192 sw-abbildungen
Jochen Stark Bernd Wicht Dauerhaftigkeit von Beton Der Baustoff als Werkstoff Herausgegeben vom F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar Mit 29 Färb- und 192 sw-abbildungen
END B E R ICH T ÖSTERREICHISCHER TRASS VON GOSSENDORF BEI GLEICHENBERG, OSTSTEIERMARK. vorgelegt von H.Höller D.Klamrner
 =========== P 64/84 =========== END B E R ICH T ÖSTERREICHISCHER TRASS VON GOSSENDORF BEI GLEICHENBERG, OSTSTEIERMARK vorgelegt von H.Höller und D.Klamrner "österreichischer TRASS" VON GOSSENDORF BEI GLEICHENBERG,
=========== P 64/84 =========== END B E R ICH T ÖSTERREICHISCHER TRASS VON GOSSENDORF BEI GLEICHENBERG, OSTSTEIERMARK vorgelegt von H.Höller und D.Klamrner "österreichischer TRASS" VON GOSSENDORF BEI GLEICHENBERG,
Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS
 Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten SCHWENK Mischmeisterschulung 2015 Wolfgang Hemrich SCHWENK Zement KG hemrich.wolfgang@schwenk.de Entwicklung des Zementes Projekt
Hochofenzement CEM III/A 52,5 N-HS Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten SCHWENK Mischmeisterschulung 2015 Wolfgang Hemrich SCHWENK Zement KG hemrich.wolfgang@schwenk.de Entwicklung des Zementes Projekt
Kalkausscheidungen bei Flachdächern
 Kalkausscheidungen bei Flachdächern Autor(en): Trüb, U. Objekttyp: Article Zeitschrift: Cementbulletin Band (Jahr): 34-35 (1966-1967) Heft 15 PDF erstellt am: 31.01.2017 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-153465
Kalkausscheidungen bei Flachdächern Autor(en): Trüb, U. Objekttyp: Article Zeitschrift: Cementbulletin Band (Jahr): 34-35 (1966-1967) Heft 15 PDF erstellt am: 31.01.2017 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-153465
In der Norm SN EN wird eine Klassifizierung aufgrund des chemischen Angriffsgrades in drei Expositionsklassen XA (Acid) vorgenommen:
 Chemisch beständiger Beton Einleitung Betone können sowohl in natürlichen als auch in industriellen Umgebungen schädlichen, chemischen Einflüssen ausgesetzt sein. Bei chemischem Angriff auf Beton wird
Chemisch beständiger Beton Einleitung Betone können sowohl in natürlichen als auch in industriellen Umgebungen schädlichen, chemischen Einflüssen ausgesetzt sein. Bei chemischem Angriff auf Beton wird
Schäden durch Alkali-Aggregat-Reaktion Einleitung
 Schäden durch Alkali-Aggregat-Reaktion Einleitung Unter Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR) wird die Reaktion der Gesteinskörner mit den Alkalien der Porenlösung des Betons verstanden. Voraussetzungen für die
Schäden durch Alkali-Aggregat-Reaktion Einleitung Unter Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR) wird die Reaktion der Gesteinskörner mit den Alkalien der Porenlösung des Betons verstanden. Voraussetzungen für die
Diskussion der Ergebnisse
 5 Diskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Basiseigenschaften der Gläser beider Versuchsreihen lieferte folgende Ergebnisse: Die optische Einteilung der hergestellten Gläser konnte in zwei Gruppen
5 Diskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Basiseigenschaften der Gläser beider Versuchsreihen lieferte folgende Ergebnisse: Die optische Einteilung der hergestellten Gläser konnte in zwei Gruppen
9. Tantal SIMS-Ergebnisse RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN OFENGETEMPERTE SBT-PROBEN
 9. Tantal 9.1. SIMS-Ergebnisse 9.1.1. RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN In Abbildung 32 sind die Tantal-Tiefenprofile nach Tempern der SBT-Proben im RTP dargestellt, in Abbildung 32 a) mit und in Abbildung 32
9. Tantal 9.1. SIMS-Ergebnisse 9.1.1. RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN In Abbildung 32 sind die Tantal-Tiefenprofile nach Tempern der SBT-Proben im RTP dargestellt, in Abbildung 32 a) mit und in Abbildung 32
1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport
 1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport Der Einsatzbereich von ZM-Auskleidungen als Korrosionsschutz ist sehr weitreichend. Derartig ausgekleidete Rohre sind geeignet zum Transport
1 Einsatzgrenzen von ZM-Auskleidungen für den Trinkwassertransport Der Einsatzbereich von ZM-Auskleidungen als Korrosionsschutz ist sehr weitreichend. Derartig ausgekleidete Rohre sind geeignet zum Transport
Fluvio 5. Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 52,5 N. Produktinformation der Holcim (Süddeutschland) GmbH. Produktinformation Fluvio5 Holcim 1
 Fluvio 5 Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 52,5 N Produktinformation der Holcim (Süddeutschland) GmbH Produktinformation Fluvio5 Holcim 1 Fluvio 5 Fluvio 5 ist ein Portlandkalksteinzement, der einen
Fluvio 5 Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 52,5 N Produktinformation der Holcim (Süddeutschland) GmbH Produktinformation Fluvio5 Holcim 1 Fluvio 5 Fluvio 5 ist ein Portlandkalksteinzement, der einen
Flugasche und Sulfatwiderstand
 47. Aachener Baustofftag, 9. April 214 Flugasche und Sulfatwiderstand Johannes Haufe Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University (ibac) Gliederung Sulfatbeanspruchung von Beton Schadensmechanismen
47. Aachener Baustofftag, 9. April 214 Flugasche und Sulfatwiderstand Johannes Haufe Institut für Bauforschung der RWTH Aachen University (ibac) Gliederung Sulfatbeanspruchung von Beton Schadensmechanismen
E 2-24 Setzungsprognosen für nicht bodenähnliche Abfälle
 E 2-24 1 E 2-24 Setzungsprognosen für nicht bodenähnliche Abfälle Stand: GDA 1997 1 Allgemeines Bei bodenähnlichen körnigen Abfällen nach E 1-8 werden die zu erwartenden Setzungen aus Spannungs-Verformungsuntersuchungen
E 2-24 1 E 2-24 Setzungsprognosen für nicht bodenähnliche Abfälle Stand: GDA 1997 1 Allgemeines Bei bodenähnlichen körnigen Abfällen nach E 1-8 werden die zu erwartenden Setzungen aus Spannungs-Verformungsuntersuchungen
Untersuchungen zur Wirksamkeit von MasterPel 708 im Hinblick auf einen Frost-Taumittel-Angriff auf Beton
 Untersuchungen zur Wirksamkeit von MasterPel 78 im Hinblick auf einen Frost-Taumittel-Angriff auf Beton I.) Welchen Einfluss hat die MasterPel 78 auf den Frost-Taumittel- Widerstand und die Wasseraufnahme
Untersuchungen zur Wirksamkeit von MasterPel 78 im Hinblick auf einen Frost-Taumittel-Angriff auf Beton I.) Welchen Einfluss hat die MasterPel 78 auf den Frost-Taumittel- Widerstand und die Wasseraufnahme
TB-BTe B2312-A/2011 Untersuchung des Frost-Tausalz-Widerstands von PAGEL-VERGUSSBETON V80C45
 Forschungsinstitut der Zementindustrie Betontechnik Verein Deutscher Zementwerke e.v. Tannenstraße 2 40476 Düsseldorf Telefon: (0211) 45 78-1 Telefax: (0211) 45 78-219 info@vdz-online.de www.vdz-online.de
Forschungsinstitut der Zementindustrie Betontechnik Verein Deutscher Zementwerke e.v. Tannenstraße 2 40476 Düsseldorf Telefon: (0211) 45 78-1 Telefax: (0211) 45 78-219 info@vdz-online.de www.vdz-online.de
Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftabscheidern in Anlehnung DIN Inhalt
 Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftabscheidern in Anlehnung DIN 11622 Inhalt Inhalt... 1 Abbildungsverzeichnis... 1 Tabelle B 1 Normenverzeichnis... 2 Tabelle B 2 Symbole... 2 Tabelle B 3 Expositionsklassen...
Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftabscheidern in Anlehnung DIN 11622 Inhalt Inhalt... 1 Abbildungsverzeichnis... 1 Tabelle B 1 Normenverzeichnis... 2 Tabelle B 2 Symbole... 2 Tabelle B 3 Expositionsklassen...
Untersuchungsergebnisse
 Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbh Herr Hoffmann An der Pikardie 8 01277 Dresden Prüfberichtsnr.: COP130059511 Auftragsnr.: COP0140013 Ansprechpartner: J. Kärmer Durchwahl: (0351) 8 8382068 email:
Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbh Herr Hoffmann An der Pikardie 8 01277 Dresden Prüfberichtsnr.: COP130059511 Auftragsnr.: COP0140013 Ansprechpartner: J. Kärmer Durchwahl: (0351) 8 8382068 email:
Junger Beton in " stark" angreifendem Wasser
 Junger Beton in " stark" angreifendem Wasser Von Wolfram Rechenberg, Düsseldorf *) Übersicht Im allgemeinen wird empfohlen, frisch eingebauten Beton mindestens 7 Tage lang gegen Zutritt von chemisch angreifendem
Junger Beton in " stark" angreifendem Wasser Von Wolfram Rechenberg, Düsseldorf *) Übersicht Im allgemeinen wird empfohlen, frisch eingebauten Beton mindestens 7 Tage lang gegen Zutritt von chemisch angreifendem
Einwirkung von Biodiesel auf Betonflächen
 Einwirkung von Biodiesel auf Betonflächen Prof. Dr.-Ing. K.-Ch. Thienel (UniBw) Dr. J. Junggunst (TÜV SÜD Industrie Service GmbH) Gliederung Motivation Formen des chemischen Angriffs auf Beton Einfluss
Einwirkung von Biodiesel auf Betonflächen Prof. Dr.-Ing. K.-Ch. Thienel (UniBw) Dr. J. Junggunst (TÜV SÜD Industrie Service GmbH) Gliederung Motivation Formen des chemischen Angriffs auf Beton Einfluss
Zielsichere Herstellung von weichen Betonen durch Mehlkornoptimierung
 Zielsichere Herstellung von weichen Betonen durch Mehlkornoptimierung Jürgen Macht, Peter Nischer Forschungsinstitut der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie A 1030 Wien, Reisnerstr. 53 Zusammenfassung
Zielsichere Herstellung von weichen Betonen durch Mehlkornoptimierung Jürgen Macht, Peter Nischer Forschungsinstitut der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie A 1030 Wien, Reisnerstr. 53 Zusammenfassung
BETON IN AGGRESSIVEN WÄSSERN
 TASCHENBÜCHER FÜR DAS BAUWESEN BETON IN AGGRESSIVEN WÄSSERN Erläuterungen und Beispiele zur TGL 11357 und 11456 Abschnitt 3 und 4 Zweite, überarbeitete und ergänzte Auflage von Helmut Liesche und **- i!.'
TASCHENBÜCHER FÜR DAS BAUWESEN BETON IN AGGRESSIVEN WÄSSERN Erläuterungen und Beispiele zur TGL 11357 und 11456 Abschnitt 3 und 4 Zweite, überarbeitete und ergänzte Auflage von Helmut Liesche und **- i!.'
Diplomarbeit Nachbehandlung von Beton durch Zugabe wasserspeichernder Zusätze 3 Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung
 2,50 Serie 1, w/z=0,45 Serie 3, w/z=0,45, mit FM Serie 5, w/z=0,60 Serie 7, w/z=0,60, mit FM Serie 2, w/z=0,45, mit Stab. Serie 4, w/z=0,45, mit Stab.+FM Serie 6, w/z=0,60, mit Stab. Serie 8, w/z=0,60,
2,50 Serie 1, w/z=0,45 Serie 3, w/z=0,45, mit FM Serie 5, w/z=0,60 Serie 7, w/z=0,60, mit FM Serie 2, w/z=0,45, mit Stab. Serie 4, w/z=0,45, mit Stab.+FM Serie 6, w/z=0,60, mit Stab. Serie 8, w/z=0,60,
Mischungsentwurf für Beton mit rezyklierten Zuschlägen Nachweis der Änderungen der Betoneigenschaften
 1 Mischungsentwurf für Beton mit rezyklierten Zuschlägen Nachweis der Änderungen der Betoneigenschaften Frischbetoneigenschaften: Veränderung des Wasseranspruchs Festbeton: Festbeton: Festbeton: Veränderung
1 Mischungsentwurf für Beton mit rezyklierten Zuschlägen Nachweis der Änderungen der Betoneigenschaften Frischbetoneigenschaften: Veränderung des Wasseranspruchs Festbeton: Festbeton: Festbeton: Veränderung
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau
 Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Normo 4. Portlandzement CEM I 42,5 N Produkt-Information der Holcim (Schweiz) AG
 Portlandzement CEM I 42,5 N Produkt-Information der Holcim (Schweiz) AG Normo 4 ist ein reiner Portlandzement. Er erfüllt alle Anforderungen an Portlandzement CEM I 42,5 N nach SN EN 197-1. Normo 4 besitzt
Portlandzement CEM I 42,5 N Produkt-Information der Holcim (Schweiz) AG Normo 4 ist ein reiner Portlandzement. Er erfüllt alle Anforderungen an Portlandzement CEM I 42,5 N nach SN EN 197-1. Normo 4 besitzt
Raum- und Flächenmessung bei Körpern
 Raum- und Flächenmessung bei Körpern Prismen Ein Prisma ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche kongruente Vielecke sind und dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Ist der Winkel zwischen Grund-
Raum- und Flächenmessung bei Körpern Prismen Ein Prisma ist ein Körper, dessen Grund- und Deckfläche kongruente Vielecke sind und dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Ist der Winkel zwischen Grund-
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Wasser und Beton Ein zwiespältiges Verhältnis
 Wasser und Beton Ein zwiespältiges Verhältnis Dr. Andreas Saxer Universität Innsbruck Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften Arbeitsbereich Materialtechnologie Janus: römischer Gott des Anfangs
Wasser und Beton Ein zwiespältiges Verhältnis Dr. Andreas Saxer Universität Innsbruck Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften Arbeitsbereich Materialtechnologie Janus: römischer Gott des Anfangs
Moderate Betontemperatur.
 Moderate Betontemperatur. Riteno 4 Beton für massige Bauteile Holcim (Süddeutschland) GmbH Massenbeton mit Riteno und Flugasche Bei großen Bauteilstärken, wie bei Tunnelsohlen, -decken, massigen Bodenplatten
Moderate Betontemperatur. Riteno 4 Beton für massige Bauteile Holcim (Süddeutschland) GmbH Massenbeton mit Riteno und Flugasche Bei großen Bauteilstärken, wie bei Tunnelsohlen, -decken, massigen Bodenplatten
Betonersatz mit erhöhter Säuretoleranz
 Betonersatz mit erhöhter Säuretoleranz Ein Ansatz Lösender Angriff auf Beton - Problemstellung - Ausgangssituation - Entwicklung und Verifizierung - Umsetzung Seite 2 1 Lösender Angriff auf Beton Lösender
Betonersatz mit erhöhter Säuretoleranz Ein Ansatz Lösender Angriff auf Beton - Problemstellung - Ausgangssituation - Entwicklung und Verifizierung - Umsetzung Seite 2 1 Lösender Angriff auf Beton Lösender
Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie
 Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie Hinweis Viele der in dieser Präsentation gemachten Angaben basieren auf einem vorläufigen Wissenstand. Insbesondere sind die
Normative Neuigkeiten und Interpretationen aus dem Bereich Betontechnologie Hinweis Viele der in dieser Präsentation gemachten Angaben basieren auf einem vorläufigen Wissenstand. Insbesondere sind die
F2 Volumenmessung Datum:
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Physik Physikalisches Grundpraktikum Mechanik und Thermodynamik Datum: 14.11.005 Heiko Schmolke / 509 10 Versuchspartner: Olaf Lange / 507 7
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I Institut für Physik Physikalisches Grundpraktikum Mechanik und Thermodynamik Datum: 14.11.005 Heiko Schmolke / 509 10 Versuchspartner: Olaf Lange / 507 7
Prüfbericht P Prüfung der Kohlenstoffdioxid- Diffusionsstromdichte von. Evocryl 200. gemäß DIN EN
 Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45-5 97 10 Fax +49 (0)61 45-5 97 19 www.kiwa.de Prüfbericht P 9168 Prüfauftrag: Prüfung der Kohlenstoffdioxid- Diffusionsstromdichte
Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45-5 97 10 Fax +49 (0)61 45-5 97 19 www.kiwa.de Prüfbericht P 9168 Prüfauftrag: Prüfung der Kohlenstoffdioxid- Diffusionsstromdichte
Bewilligungszeitraum: Wirkungsweise von schwindreduzierenden Zusatzmitteln in Beton
 Forschungsinstitut der Zementindustrie, IGF-Vorhaben: 15681 N Seite 1 von 10 IGF-Vorhaben: 15681 N Bewilligungszeitraum: 01.06.2008-30.11.2010 Forschungsthema: Wirkungsweise von schwindreduzierenden Zusatzmitteln
Forschungsinstitut der Zementindustrie, IGF-Vorhaben: 15681 N Seite 1 von 10 IGF-Vorhaben: 15681 N Bewilligungszeitraum: 01.06.2008-30.11.2010 Forschungsthema: Wirkungsweise von schwindreduzierenden Zusatzmitteln
Hinweise zu Betonkonsistenz 2016
 Hinweise zu Betonkonsistenz 2016 Beton-Sortenschlüssel Verdichtungsmass-Klasse Ausbreitmass-Klasse Klasse Verdichtungsmass Klasse Ausbreitmass (Durchmesser in mm) C0 1.46 F1 340 C1 1.45 1.26 F2 350 410
Hinweise zu Betonkonsistenz 2016 Beton-Sortenschlüssel Verdichtungsmass-Klasse Ausbreitmass-Klasse Klasse Verdichtungsmass Klasse Ausbreitmass (Durchmesser in mm) C0 1.46 F1 340 C1 1.45 1.26 F2 350 410
Die spezifische Leitfähigkeit κ ist umgekehrt proportional zum Widerstand R:
 Institut für Physikalische Chemie Lösungen zu den Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II im WS 205/206 Prof. Dr. Eckhard Bartsch / M. Werner M.Sc. Aufgabenblatt 3 vom 3..5 Aufgabe 3 (L) Leitfähigkeiten
Institut für Physikalische Chemie Lösungen zu den Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II im WS 205/206 Prof. Dr. Eckhard Bartsch / M. Werner M.Sc. Aufgabenblatt 3 vom 3..5 Aufgabe 3 (L) Leitfähigkeiten
F Rolf Breitenbücher, Björn Siebert
 F 2769 Rolf Breitenbücher, Björn Siebert Verbreitung und Schadenspotenzial saurer und sulfatreicher Grundwässer in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Wiederanstiegs des Grundwassers Teil
F 2769 Rolf Breitenbücher, Björn Siebert Verbreitung und Schadenspotenzial saurer und sulfatreicher Grundwässer in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Wiederanstiegs des Grundwassers Teil
1 Einleitung und Problemstellung 1
 1 Einleitung und Problemstellung 1 2 Stand der Kenntnisse 2 2.1 Schwinden von Zementstein und Beton 2 2.1.1 Allgemeines 2 2.1.2 Kapillar-oder Frühschwinden 2 2.1.3 Gesamtschwinden 3 2.1.3.1 Autogenes Schwinden
1 Einleitung und Problemstellung 1 2 Stand der Kenntnisse 2 2.1 Schwinden von Zementstein und Beton 2 2.1.1 Allgemeines 2 2.1.2 Kapillar-oder Frühschwinden 2 2.1.3 Gesamtschwinden 3 2.1.3.1 Autogenes Schwinden
Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftbehältern DIN Inhalt
 Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftbehältern DIN 11622 Inhalt Inhalt.1 Abbildungsverzeichnis..1 Tabelle B 1 Normenverzeichnis2 Tabelle B 2 Symbole..2 Tabelle B 3 Expositionsklassen..4 Tabelle B 4
Festlegung der Eigenschaften von Gärsaftbehältern DIN 11622 Inhalt Inhalt.1 Abbildungsverzeichnis..1 Tabelle B 1 Normenverzeichnis2 Tabelle B 2 Symbole..2 Tabelle B 3 Expositionsklassen..4 Tabelle B 4
Trägheitsmoment (TRÄ)
 Physikalisches Praktikum Versuch: TRÄ 8.1.000 Trägheitsmoment (TRÄ) Manuel Staebel 3663 / Michael Wack 34088 1 Versuchsbeschreibung Auf Drehtellern, die mit Drillfedern ausgestattet sind, werden die zu
Physikalisches Praktikum Versuch: TRÄ 8.1.000 Trägheitsmoment (TRÄ) Manuel Staebel 3663 / Michael Wack 34088 1 Versuchsbeschreibung Auf Drehtellern, die mit Drillfedern ausgestattet sind, werden die zu
Mittelwert, Standardabweichung, Median und Bereich für alle durchgeführten Messungen (in Prozent)
 3. Ergebnisse 3.1 Kennwerte, Boxplot Die Kennwerte der deskriptiven Statistik sind in der Tabelle 1 für alle Messungen, in der Tabelle 2 für die Messungen, bei denen mit der Referenzmethode eine festgestellt
3. Ergebnisse 3.1 Kennwerte, Boxplot Die Kennwerte der deskriptiven Statistik sind in der Tabelle 1 für alle Messungen, in der Tabelle 2 für die Messungen, bei denen mit der Referenzmethode eine festgestellt
Baustofftechnologie Mikrostruktur von Zementstein
 Baustofftechnologie Mikrostruktur von Zementstein Thomas A. BIER Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, Leipziger Straße 28, 09596 Freiberg, Mikrostruktur von Zementstein Gefüge Zementstein Klassifizierung
Baustofftechnologie Mikrostruktur von Zementstein Thomas A. BIER Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik, Leipziger Straße 28, 09596 Freiberg, Mikrostruktur von Zementstein Gefüge Zementstein Klassifizierung
Analytische Chemie. B. Sc. Chemieingenieurwesen. 8. Juli 2015, Uhr. Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M. Sc.
 Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 8. Juli 2015, 12.30 15.30 Uhr Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M. Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges
Analytische Chemie B. Sc. Chemieingenieurwesen 8. Juli 2015, 12.30 15.30 Uhr Prof. Dr. T. Jüstel, Stephanie Möller M. Sc. Name: Matrikelnummer: Geburtsdatum: Denken Sie an eine korrekte Angabe des Lösungsweges
Praktikumsprotokoll Physikalisch-Chemisches Anfängerpraktikum
 Praktikumsprotokoll Physikalisch-Chemisches Anfängerpraktikum Tobias Schabel Datum des Praktikumstags: 02.12.2005 Matthias Ernst Protokoll-Datum: 12/20/2005 Gruppe A-11 11. Versuch: Schmelzdiagramm Assistent:
Praktikumsprotokoll Physikalisch-Chemisches Anfängerpraktikum Tobias Schabel Datum des Praktikumstags: 02.12.2005 Matthias Ernst Protokoll-Datum: 12/20/2005 Gruppe A-11 11. Versuch: Schmelzdiagramm Assistent:
Prüfungsfach: Werkstoffe des Bauwesens II am:
 Fakultät für Bauingenieur und Vermessungswesen Institut für Werkstoffe des Bauwesens Bachelorprüfung Prüfungsfach: Werkstoffe des Bauwesens II am: 25.06.2012 Die Aufgaben sind nachvollziehbar (mit Rechengang)
Fakultät für Bauingenieur und Vermessungswesen Institut für Werkstoffe des Bauwesens Bachelorprüfung Prüfungsfach: Werkstoffe des Bauwesens II am: 25.06.2012 Die Aufgaben sind nachvollziehbar (mit Rechengang)
V 2 Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration und der Temperatur bei der Reaktion von Kaliumpermanganat mit Oxalsäure in Lösung
 V 2 Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration und der Temperatur bei der Reaktion von Kaliumpermanganat mit Oxalsäure in Lösung Bei diesem Versuch geht es darum, die Geschwindigkeit
V 2 Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration und der Temperatur bei der Reaktion von Kaliumpermanganat mit Oxalsäure in Lösung Bei diesem Versuch geht es darum, die Geschwindigkeit
Baulehrschautag Haus Düsse. 05. Januar Referat: Schweinespaltenboden. Klaus Kroker Vertriebsleiter Tel:
 Baulehrschautag Haus Düsse 05. Januar 2006 Referat: Schweinespaltenboden Agenda: -Der neue Querschlitz-Spaltenboden von Greten -Qualitätsansprüche am Schweinespaltenboden -Verlegung von Spaltenböden -Problem
Baulehrschautag Haus Düsse 05. Januar 2006 Referat: Schweinespaltenboden Agenda: -Der neue Querschlitz-Spaltenboden von Greten -Qualitätsansprüche am Schweinespaltenboden -Verlegung von Spaltenböden -Problem
Rietveldverfeinerung Anwendung in der Zementindustrie
 Rietveldverfeinerung Anwendung in der Zementindustrie C. Schneider und S. Baetzner, Düsseldorf Technisch-wissenschaftliche Zementtagung Nürnberg, 27./28. Oktober 25 Gliederung Prinzip und Voraussetzungen
Rietveldverfeinerung Anwendung in der Zementindustrie C. Schneider und S. Baetzner, Düsseldorf Technisch-wissenschaftliche Zementtagung Nürnberg, 27./28. Oktober 25 Gliederung Prinzip und Voraussetzungen
C Säure-Base-Reaktionen
 -V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
-V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen
 Strength. Performance. Passion. Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen Dr. Peter Lunk Holcim (Schweiz) AG Inhalt Einleitung Betonsorten Expositionsklasse und schweizerische Dauerhaftigkeitsprüfungen
Strength. Performance. Passion. Praktische Erfahrungen mit den neuen Betonnormen Dr. Peter Lunk Holcim (Schweiz) AG Inhalt Einleitung Betonsorten Expositionsklasse und schweizerische Dauerhaftigkeitsprüfungen
Versuch 5. Kinetik der Kaliumaufnahme durch Getreidewurzeln
 Versuch Kinetik der Kaliumaufnahme durch Getreidewurzeln Till Biskup Matrikelnummer: 67. Juni Aufgaben. Geben Sie die Kaliumkonzentration an, die am Ende der ersten Meßserie im Medium festgestellt wurde.
Versuch Kinetik der Kaliumaufnahme durch Getreidewurzeln Till Biskup Matrikelnummer: 67. Juni Aufgaben. Geben Sie die Kaliumkonzentration an, die am Ende der ersten Meßserie im Medium festgestellt wurde.
Betonerosion in Biologiebecken: Massnahmen und Empfehlungen. Dr. Heinrich Widmer cemsuisse, Bern
 Betonerosion in Biologiebecken: Massnahmen und Empfehlungen Dr. Heinrich Widmer cemsuisse, Bern Inhalt 1. Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse 2. Einflüsse auf die Betonerosion in der Praxis 3.
Betonerosion in Biologiebecken: Massnahmen und Empfehlungen Dr. Heinrich Widmer cemsuisse, Bern Inhalt 1. Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse 2. Einflüsse auf die Betonerosion in der Praxis 3.
Klausur Ver- und Entsorgungstechnik von Energieanlagen
 Klausur Ver- und Entsorgungstechnik von Energieanlagen Datum: 22.03.2004 Dauer: 1,5 Std. Der Gebrauch von nicht-programmierbaren Taschenrechnern und schriftlichen Unterlagen ist erlaubt. Aufgabe 1 2 3
Klausur Ver- und Entsorgungstechnik von Energieanlagen Datum: 22.03.2004 Dauer: 1,5 Std. Der Gebrauch von nicht-programmierbaren Taschenrechnern und schriftlichen Unterlagen ist erlaubt. Aufgabe 1 2 3
Bestimmung des Massenverhältnisses bei der Reaktion von Magnesium mit Sauerstoff
 8 0 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 8 0 6 0 4 0 2 0 L m 1.1 Konstante Massenproportionen Untersuche, welches Volumen Sauerstoff für die Reaktion mit verschiedenen Massen Magnesium jeweils benötigt wird. Geräte 2
8 0 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 8 0 6 0 4 0 2 0 L m 1.1 Konstante Massenproportionen Untersuche, welches Volumen Sauerstoff für die Reaktion mit verschiedenen Massen Magnesium jeweils benötigt wird. Geräte 2
4.2 Beton und Mörtel: (Hilfsmittel: Script S )
 4.2 Beton und Mörtel: (Hilfsmittel: Script S. 66-72) Zusammensetzung von Beton und Mörtel: 1. Beton setzt sich zusammen aus: 2. Dies unterscheidet Mörtel und Beton: Der Zement: 1. Zement ist ein... Bindemittel.
4.2 Beton und Mörtel: (Hilfsmittel: Script S. 66-72) Zusammensetzung von Beton und Mörtel: 1. Beton setzt sich zusammen aus: 2. Dies unterscheidet Mörtel und Beton: Der Zement: 1. Zement ist ein... Bindemittel.
Zugversuch - Versuchsprotokoll
 Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch
Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch
Festlegung für Beton nach Eigenschaften. Beton nach SN EN 206. Dmax = 32. Grösstkorn. Rohdichte. Zusätzliche Anforderungen
 Vorwort Diese Preisliste enthält die wichtigsten Angaben zur Norm, inklusive der Nationalen Elemente NE. Informationen werden ausschliesslich für Beton nach Eigenschaften gegeben. Grundlegende Anforderungen
Vorwort Diese Preisliste enthält die wichtigsten Angaben zur Norm, inklusive der Nationalen Elemente NE. Informationen werden ausschliesslich für Beton nach Eigenschaften gegeben. Grundlegende Anforderungen
Keine Berücksichtigung der Art aggressiver Stoffe und weiterer wesentlicher Einflussfaktoren
 Chemischer Angriff auf Betonbauwerke Bewertung und Schutzprinzipien Dr.-Ing. Björn Siebert Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V. DAfStb-Jahrestagung Düsseldorf, 26.11.2014 Kontakt des Betons mit
Chemischer Angriff auf Betonbauwerke Bewertung und Schutzprinzipien Dr.-Ing. Björn Siebert Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V. DAfStb-Jahrestagung Düsseldorf, 26.11.2014 Kontakt des Betons mit
Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie)
 Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie) Teilnehmer/in:... Matrikel-Nr.:... - 1. Sie sollen aus NaCl und Wasser 500 ml einer Lösung herstellen, die
Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie) Teilnehmer/in:... Matrikel-Nr.:... - 1. Sie sollen aus NaCl und Wasser 500 ml einer Lösung herstellen, die
4 Ergebnisse. Ergebnisse
 4 4.1 Entwicklung der Körpertemperatur und der Wärmeproduktion bei Enten- und Hühnerembryonen in Abhängigkeit vom Alter bei normaler Bruttemperatur Im untersuchten Abschnitt der Embryonalentwicklung stieg
4 4.1 Entwicklung der Körpertemperatur und der Wärmeproduktion bei Enten- und Hühnerembryonen in Abhängigkeit vom Alter bei normaler Bruttemperatur Im untersuchten Abschnitt der Embryonalentwicklung stieg
LeWis» ph-wert Berechnungen «Kapitel 5
 Additum 5. Wässrige Lösungen mehrprotoniger Säuren und Basen Ziel dieses Kapitels ist es, eine weitere Anwendungsmöglichkeit des bisher erlernten Vorgehenskonzepts vorzustellen. Die Berechnung von ph-werten
Additum 5. Wässrige Lösungen mehrprotoniger Säuren und Basen Ziel dieses Kapitels ist es, eine weitere Anwendungsmöglichkeit des bisher erlernten Vorgehenskonzepts vorzustellen. Die Berechnung von ph-werten
Festlegung der Anforderungen Verfasser / Ausschreibender Verfasser / Ausschreibender
 BETONARTEN UND VERANTWORTLICHKEITEN Festlegung des Betons nach Eigenschaften nach Zusammensetzung Festlegung der Anforderungen Verfasser / Ausschreibender Verfasser / Ausschreibender Festlegung der Betonzusammensetzung
BETONARTEN UND VERANTWORTLICHKEITEN Festlegung des Betons nach Eigenschaften nach Zusammensetzung Festlegung der Anforderungen Verfasser / Ausschreibender Verfasser / Ausschreibender Festlegung der Betonzusammensetzung
ESTROLITH - Temporex-Spezial P 114
 ESTROLITH - Temporex-Spezial P 114 Farbe: Grün-grau / Trübe Kurzbeschreibung ESTROLITH-Temporex-Spezial ist ein flüssiges, chlorid- und lösungsmittelfreies Estrich-Zusatzmittel, welches insbesondere die
ESTROLITH - Temporex-Spezial P 114 Farbe: Grün-grau / Trübe Kurzbeschreibung ESTROLITH-Temporex-Spezial ist ein flüssiges, chlorid- und lösungsmittelfreies Estrich-Zusatzmittel, welches insbesondere die
Stationäre Betrachtung der Temperatur- und Oberflächenfeuchteverhältnisse
 III/1.1 Einfluss von Ecken und Möblierung auf die Schimmelpilzgefahr Martin Krus, Klaus Sedlbauer Ecken stellen durch die geometrischen Verhältnisse bedingte Wärmebrücken in den Umfassungsflächen eines
III/1.1 Einfluss von Ecken und Möblierung auf die Schimmelpilzgefahr Martin Krus, Klaus Sedlbauer Ecken stellen durch die geometrischen Verhältnisse bedingte Wärmebrücken in den Umfassungsflächen eines
NORM für das Kanalnetz Juni 2012 Abwasserkanäle auf Betonbettung sowie mit Betonummantelung, Aushubbreiten für Betonbettungen
 NORM für das Kanalnetz Juni 2012 Abwasserkanäle auf Betonbettung sowie mit Betonummantelung, Aushubbreiten für Betonbettungen Regelblatt 11 Sachgebiet: Baugruben und Gräben Schlagwörter: Abwasserkanal,
NORM für das Kanalnetz Juni 2012 Abwasserkanäle auf Betonbettung sowie mit Betonummantelung, Aushubbreiten für Betonbettungen Regelblatt 11 Sachgebiet: Baugruben und Gräben Schlagwörter: Abwasserkanal,
Nachweis. s D = 0,3 m *) Prüfbericht Nr PR01. Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl. Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
 Nachweis Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten Prüfbericht Nr. 13-001930-PR01 (PB-K05-09-de-01) Produkt Bezeichnung Materialbasis Bemerkung Torggler Chimica S.p.A. Via
Nachweis Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten Prüfbericht Nr. 13-001930-PR01 (PB-K05-09-de-01) Produkt Bezeichnung Materialbasis Bemerkung Torggler Chimica S.p.A. Via
Club Apollo Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3. Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012).
 Club Apollo 13-14. Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3 Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012). Aufgabe a) 1) 70000,0000 Temperatur 60000,0000 50000,0000 40000,0000
Club Apollo 13-14. Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3 Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012). Aufgabe a) 1) 70000,0000 Temperatur 60000,0000 50000,0000 40000,0000
DEFINITIONEN REINES WASSER
 SÄUREN UND BASEN 1) DEFINITIONEN REINES WASSER enthält gleich viel H + Ionen und OH Ionen aus der Reaktion H 2 O H + OH Die GGWKonstante dieser Reaktion ist K W = [H ]*[OH ] = 10 14 In die GGWKonstante
SÄUREN UND BASEN 1) DEFINITIONEN REINES WASSER enthält gleich viel H + Ionen und OH Ionen aus der Reaktion H 2 O H + OH Die GGWKonstante dieser Reaktion ist K W = [H ]*[OH ] = 10 14 In die GGWKonstante
Statistische Untersuchung zum Auftreten von Wind mit 70 -Komponente am Flughafen Frankfurt
 Statistische Untersuchung zum Auftreten von Wind mit 70 -Komponente am Flughafen Frankfurt Dipl.-Meteorol. Thomas Hasselbeck Dipl.-Geogr. Johannes W olf GPM Büro für Geoinformatik, Umweltplanung, neue
Statistische Untersuchung zum Auftreten von Wind mit 70 -Komponente am Flughafen Frankfurt Dipl.-Meteorol. Thomas Hasselbeck Dipl.-Geogr. Johannes W olf GPM Büro für Geoinformatik, Umweltplanung, neue
Die spezifische Leitfähigkeit κ ist umgekehrt proportional zum Widerstand R:
 Institut für Physikalische Chemie Lösungen zu den Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II im WS 206/207 Prof. Dr. Eckhard Bartsch / M. Werner M.Sc. Aufgabenblatt 3 vom..6 Aufgabe 3 (L) Leitfähigkeiten
Institut für Physikalische Chemie Lösungen zu den Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II im WS 206/207 Prof. Dr. Eckhard Bartsch / M. Werner M.Sc. Aufgabenblatt 3 vom..6 Aufgabe 3 (L) Leitfähigkeiten
Versuchsprotokoll Kapitel 6
 Versuchsprotokoll Kapitel 6 Felix, Sebastian, Tobias, Raphael, Joel 1. Semester 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung...3 Versuch 6.1...3 Einwaagen und Herstellung der Verdünnungen...3 Photospektrometrisches
Versuchsprotokoll Kapitel 6 Felix, Sebastian, Tobias, Raphael, Joel 1. Semester 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung...3 Versuch 6.1...3 Einwaagen und Herstellung der Verdünnungen...3 Photospektrometrisches
Zement nach DIN EN 197-1:
 Zement nach DIN EN 197-1:2004-08 Holcim (Süddeutschland) GmbH D-72359 Dotternhausen Telefon +49 (0) 7427 79-300 Telefax +49 (0) 7427 79-248 info-sueddeutschland@holcim.com www.holcim.de/sued Zement Zement
Zement nach DIN EN 197-1:2004-08 Holcim (Süddeutschland) GmbH D-72359 Dotternhausen Telefon +49 (0) 7427 79-300 Telefax +49 (0) 7427 79-248 info-sueddeutschland@holcim.com www.holcim.de/sued Zement Zement
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches
Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches
4.1 Brinellhärte, Expansion und mikroskopische Analyse des Artikulationsgipses
 4. Ergebnisse 4.1 Brinellhärte, Expansion und mikroskopische Analyse des Artikulationsgipses Die bei der Brinell-Härteprüfung ermittelten Werte sind der Tabelle 8 zu entnehmen. Bei den Einzelmesswerten
4. Ergebnisse 4.1 Brinellhärte, Expansion und mikroskopische Analyse des Artikulationsgipses Die bei der Brinell-Härteprüfung ermittelten Werte sind der Tabelle 8 zu entnehmen. Bei den Einzelmesswerten
Konsequenzen der Ozeanversauerung
 Thema: Stoffkreisläufe Jahrgang 9 & 10 Konsequenzen der Ozeanversauerung Lies den Ausschnitt aus dem nachfolgenden Zeitungsartikel eines Wissenschaftsmagazins aufmerksam durch und betrachte im Diagramm
Thema: Stoffkreisläufe Jahrgang 9 & 10 Konsequenzen der Ozeanversauerung Lies den Ausschnitt aus dem nachfolgenden Zeitungsartikel eines Wissenschaftsmagazins aufmerksam durch und betrachte im Diagramm
Sinterversuch / Dilatometrie
 Sinterversuch / Dilatometrie Name: Matthias Jasch Matrikelnummer: 2402774 Mitarbeiter: Mirjam und Rahel Eisele Gruppennummer: 7 Versuchsdatum: 12. Mai 2009 Betreuer: Stefanie Rehm 1 Aufgabenstellung Es
Sinterversuch / Dilatometrie Name: Matthias Jasch Matrikelnummer: 2402774 Mitarbeiter: Mirjam und Rahel Eisele Gruppennummer: 7 Versuchsdatum: 12. Mai 2009 Betreuer: Stefanie Rehm 1 Aufgabenstellung Es
7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern
 Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
LIEFERVERZEICHNIS 2017
 LIEFERVERZEICHNIS 2017 SCHWENK Beton Heidenheim Gültig ab 1. Februar 2017 SCHWENK Beton Heidenheim GmbH & Co. KG LIEFERVERZEICHNIS 2017 SCHWENK Beton Heidenheim Sortenauswahl gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2
LIEFERVERZEICHNIS 2017 SCHWENK Beton Heidenheim Gültig ab 1. Februar 2017 SCHWENK Beton Heidenheim GmbH & Co. KG LIEFERVERZEICHNIS 2017 SCHWENK Beton Heidenheim Sortenauswahl gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Erprobung einer Versuchsanordnung für horizontal eingebaute Polystyrol-Hartschaumplatten
 Erprobung einer Versuchsanordnung für horizontal eingebaute Polystyrol-Hartschaumplatten Kurzbericht Bei dem Flughafenbrand in Düsseldorf wurde offenkundig, dass bei Polystyrol-Hartschaum unter bestimmten
Erprobung einer Versuchsanordnung für horizontal eingebaute Polystyrol-Hartschaumplatten Kurzbericht Bei dem Flughafenbrand in Düsseldorf wurde offenkundig, dass bei Polystyrol-Hartschaum unter bestimmten
FD und FDE - Betone. Prof. Dr.-Ing. R. Dillmann Institut für Bauphysik und Materialwissenschaft IBPM Universität Duisburg - Essen
 Institut für n FD und FDE - Betone Prof. Dr.-Ing. R. Dillmann Institut für Universität Duisburg - Essen 2004 Prof. Dr. Dillmann 1 Beton beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Institut für Für das sekundäre
Institut für n FD und FDE - Betone Prof. Dr.-Ing. R. Dillmann Institut für Universität Duisburg - Essen 2004 Prof. Dr. Dillmann 1 Beton beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Institut für Für das sekundäre
SCHOLZ-ATI Schwarzeinfärbung II
 SCHOLZ-ATI Schwarzeinfärbung II Anwendungstechnische Informationen zur Wechselwirkung von schwarzen Eisenoxidpigmenten mit PCE-haltigen Betonzusatzmitteln Die zur Betoneinfärbung eingesetzten Metalloxidpigmente
SCHOLZ-ATI Schwarzeinfärbung II Anwendungstechnische Informationen zur Wechselwirkung von schwarzen Eisenoxidpigmenten mit PCE-haltigen Betonzusatzmitteln Die zur Betoneinfärbung eingesetzten Metalloxidpigmente
Technische Mitteilung
 In Bodenplatten von Wohnhäusern u.ä., die durch Wände belastet sind, ist zur Sicherung der Lastquerverteilung eine ausreichende Bewehrung für die Biegebeanspruchung, die auf der Wechselwirkung zwischen
In Bodenplatten von Wohnhäusern u.ä., die durch Wände belastet sind, ist zur Sicherung der Lastquerverteilung eine ausreichende Bewehrung für die Biegebeanspruchung, die auf der Wechselwirkung zwischen
Der statische Elastizitätsmodul von Recyclingbeton und seine Berücksichtigung bei der Bemessung von Stahlbetonbauteilen
 Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg Seite 1/5 Der statische Elastizitätsmodul von Recyclingbeton und seine Berücksichtigung bei der Bemessung von Stahlbetonbauteilen Dipl.-Ing. Norbert
Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg Seite 1/5 Der statische Elastizitätsmodul von Recyclingbeton und seine Berücksichtigung bei der Bemessung von Stahlbetonbauteilen Dipl.-Ing. Norbert
Betonieren bei extremer Witterung Frischbetontemperatur
 Betonieren bei extremer Witterung Frischbetontemperatur Die Frischbetontemperatur beeinflusst das Ansteifen und Erstarren und damit die Verarbeitbarkeit des Frischbetons. Von besonderer Bedeutung ist die
Betonieren bei extremer Witterung Frischbetontemperatur Die Frischbetontemperatur beeinflusst das Ansteifen und Erstarren und damit die Verarbeitbarkeit des Frischbetons. Von besonderer Bedeutung ist die
Untersuchungsbericht
 Untersuchungsbericht Überprüfung der Reduktion von Emissionen durch den Einsatz von SCAT Safety-Aufsätzen bei der Nutzung von Lösungsmittelflaschen in Laboratorien Auftraggeber: Opelstraße 3 64546 Mörfelden-Walldorf
Untersuchungsbericht Überprüfung der Reduktion von Emissionen durch den Einsatz von SCAT Safety-Aufsätzen bei der Nutzung von Lösungsmittelflaschen in Laboratorien Auftraggeber: Opelstraße 3 64546 Mörfelden-Walldorf
lg k ph Profil Versuchsprotokoll Versuch Flüssig D2 1. Stichworte
 Paul Elsinghorst, Jürgen Gäb, Carina Mönig, Iris Korte Versuchsprotokoll Versuch Flüssig D2 lg k ph Profil 1. Stichworte Reaktionskinetik, Reaktionsordnung, Reaktionsmolekularität Stabilität von wässrigen
Paul Elsinghorst, Jürgen Gäb, Carina Mönig, Iris Korte Versuchsprotokoll Versuch Flüssig D2 lg k ph Profil 1. Stichworte Reaktionskinetik, Reaktionsordnung, Reaktionsmolekularität Stabilität von wässrigen
Experimente Anweisungen und Beschriebe
 1/8 Papier-Brücke Aufgabe: Konstruiere aus Kopierpapier eine tragfähige Brücke, welche einen Meter Spannweite aufweist! Dabei musst du ohne Leim, Schnur oder sonst einer Hilfe auskommen lediglich das Papier
1/8 Papier-Brücke Aufgabe: Konstruiere aus Kopierpapier eine tragfähige Brücke, welche einen Meter Spannweite aufweist! Dabei musst du ohne Leim, Schnur oder sonst einer Hilfe auskommen lediglich das Papier
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung. Durchgeführt am Gruppe X
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung Durchgeführt am 02.02.2012 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung Durchgeführt am 02.02.2012 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
E1: Bestimmung der Dissoziationskonstante einer schwachen Säure durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Elektrolytlösung
 Versuch E1/E2 1 Versuch E1/E2 E1: Bestimmung der Dissoziationskonstante einer schwachen Säure durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Elektrolytlösung E2: Konduktometrische Titration I Aufgabenstellung
Versuch E1/E2 1 Versuch E1/E2 E1: Bestimmung der Dissoziationskonstante einer schwachen Säure durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Elektrolytlösung E2: Konduktometrische Titration I Aufgabenstellung
