Juden in Leipzig und Sachsen. Modulare Unterrichtsangebote. Modul
|
|
|
- Bärbel Küchler
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Juden in Leipzig und Sachsen Modulare Unterrichtsangebote Modul Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR EPHRAIM CARLE BAC H STIFTU NG LEIPZIG
2 JUDEN IN LEIPZIG UND SACHSEN MODULARE UNTERRICHTSANGEBOTE Modul ERINNERUNG AN DIE NATIONALSOZIALISTISCHE JUDENVERFOLGUNG UND DEN HOLOCAUST IN DER DDR Inhalt Teil 1 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR Darstellungstext und Quellen 3 Aufgaben 7 Arbeitsblatt 8 Vorschlag zur Stundengestaltung 9 Erwartungshorizonte zu den Aufgaben 10 Erwartungshorizonte zum Arbeitsblatt 12 Teil 2 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig Darstellungstext und Quellen 13 Aufgaben 16 Arbeitsblätter 17 Vorschlag zur Stundengestaltung 19 Erwartungshorizonte zu den Aufgaben 20 Erwartungshorizonte zu den Arbeitsblättern 21 Lehrplanbezug Gymnasium: sächsischer Lehrplan, Fach Geschichte, Jahrgangsstufe 11/12 Kontakt: Ephraim Carlebach Stiftung Leipzig Löhrstraße 10, Leipzig Förderer des Gesamtprojekts: Leo Baeck Programm der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft Landesprogramm Weltoffnes Sachsen für Demokratie und Toleranz LeipzigStiftung GESELLSCHAFT DER FREUNDE der Ephraim Carlebach Stiftung e.v. Ephraim Carlebach Stiftung, Leipzig 2015 Projektleitung: Dr. Kerstin Plowinski Redaktion: Lina Bosbach, Dirk Haupt, Dr. Kerstin Plowinski Autor: Dirk Haupt Photographien: Silvia Hauptmann, Archiv Satz und Gestaltung: grafikdesign JBWolff Alle Rechte vorbehalten! EPHRAIM CARLE BAC H STIFTU NG LEIPZIG
3 M O D U L T E I L 1 ERINNERUNG AN DIE NATIONAL- SOZIALISTISCHE JUDENVERFOLGUNG UND DEN HOLOCAUST IN DER DDR Die nationalsozialistische Diktatur ( ) und der staatlich organisierte millionenfache Völkermord an den europäischen Juden wurden nach 1945 in Ostund Westdeutschland gesellschaftlich, politisch und historisch in unterschiedlicher Weise aufgearbeitet. Im Gegensatz zur Bundesrepublik lehnte die DDR prinzipiell die historische Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten an den europäischen Juden ab. M1 Erstes Pessachfest der Jüdischen Gemeinde in Leipzig nach dem 2.Weltkrieg im April 1946 Pessachfest Jüdisches Frühlingsund Erntefest zur Erinnerung der Errettung der Juden aus der Gefangenschaft in Ägypten ARC HIV E PHRAIM CARLE BAC H STIFTUNG Gesellschaftlicher Umgang mit der Vergangenheit die Nachkriegssituation Holocaust Griechische Wortabstammung, steht für vollständig verbrannt, bezeichnet seit den 1960/70er-Jahren die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten Die deutsche Bevölkerung hatte unterschiedliches Wissen über die Entrechtung und das Ausmaß der Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Wenngleich ein prinzipielles Unrechtsempfinden zum Holocaust vorhanden war, so wurde es für die Mehrzahl der Deutschen durch die Umstände des Krieges und das damit im Zusammenhang stehende eigene Leid relativiert. Die meisten Deutschen waren nicht direkt in den Holocaust verstrickt, was die Übernahmebereitschaft von kollektiver Verantwortung auch in moralischer Sicht nicht unterstützte. Hinzu kam, dass Juden als Fremde galten, die industrielle Vernichtung der jüdischen Menschen auf polnischem und weißrussischem Gebiet stattgefunden hatte, was wiederum die Zuordnung von Schuld verklärte, Distanz schuf und letztlich zur mehrheitlichen Verdrängung der Vergangenheit führte einer weit verbreiteten Schlussstrichmentalität der Deutschen. 3
4 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 Politisch-historischer Umgang mit der Vergangenheit NSDAP/NS Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/ Nationalsozialismus Auschwitz-Prozesse Gerichtsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland gegen die Täter im nationalsozialistischen Konzentrationsund Vernichtungslager Auschwitz Vernichtungslager Lager, in denen bestimmte Bevölkerungsgruppen, Juden, Sinti und Roma u.a. Minderheiten, durch die Nationalsozialisten systematisch ermordet wurden; die Lager waren ausschließlich zu diesem Zweck geschaffen worden In beiden deutschen Staaten gab es einen Entnazifizierungsprozess. In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bzw. der späteren DDR war dieser Prozess den Zahlen der Verurteilungen nach umfänglicher. Dennoch nahmen sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR ehemalige NS-Funktionskräfte, Mitläufer oder Anhänger bzw. Mitglieder der NSDAP erneut wichtige Positionen in Staat und Gesellschaft ein. Besonders in der DDR wurde dieser Umstand aber bestritten. Ende der 1950er-Jahre kam mit den NS-Prozessen in der Bundesrepublik ein fortdauernder Prozess der Vergangenheitsbewältigung in Gang. Die Auschwitz-Prozesse brachten Tatsachen hervor, die zuvor nicht verbreitet waren und die Aufklärung und das historische Bewusstsein der Deutschen schärften der Gesamtkomplex der systematischen Ermordung von über sechs Millionen Juden wurde hier ins Zentrum gerückt. Wiedergutmachung und Gedenkkultur in der DDR In der DDR gab es eine Ungleichbehandlung von NS-Opfern, die sich zum einen symbolisch bei den Gedenkorten, aber auch materiell in den Wiedergutmachungs-, Rückgabe- und Entschädigungsleistungen/Renten äußerte. Vor allem kommunistische Antifaschisten wurden durch die Ausschüsse für die Opfer des Faschismus mit Lebensmittelkarten, Kleidung, Hausrat und Zuweisung von Wohnraum bedacht. Juden, Sinti und Roma oder auch Homosexuelle wurden ausgegrenzt bzw. bekamen einen zweitrangigen Opferstatus. In offiziellen Stellungnahmen wurde zwar den über sechs Millionen ermordeten Juden gedacht, im Zentrum der Verlautbarungen stand aber die Ausrottung des deutschen Militarismus und Nazismus. Bei der Ehrung einzelner Verfolgter und antifaschistischer Widerstandskämpfer wurde deren jüdische Herkunft verschwiegen. Vereinzelt wurde jüdischen Gruppen gedacht, zum Beispiel den ermordeten Kindern des jüdischen Kinderheims in Niederschönhausen bei In den NS-Prozessen in der DDR war der Holocaust kaum ein Thema. Die von den Nationalsozialisten so bezeichnete Endlösung der Judenfrage galt nicht als zentraler Bestandteil der NS-Ideologie, zentral war vielmehr der Antikommunismus der Nationalsozialisten. Erinnerung und die historisch-politische Aufarbeitung in der DDR zielten in erster Linie auf den antifaschistischen und kommunistischen Widerstand. Eine historische Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten an den europäischen Juden und den Holocaust lehnte die DDR mit dem Hinweis auf die eigene antifaschistische Tradition ab. Stattdessen wurde ein starker Antisemitismus und Neonazismus in der Bundesrepublik angeprangert, den es in der DDR nicht gäbe. Berlin oder zerstörter jüdischer Friedhöfe und Gebetshäuser. Erst zum Ende der 1970er-Jahre änderte sich die Erinnerungskultur in der DDR erkennbar. Zum 40. Jahrestag der Pogromnacht 1938 gab es eine zunehmende gesellschaftliche Anerkennung der gesamtdeutschen Verantwortung für den Holocaust, vor allem von kirchlichen Kreisen und Schriftstellern. In verschiedenen Städten gab es ab Beginn der 1980er-Jahre Ausstellungen und schriftliche Dokumentationen, die sich mit jüdischem Leben in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigten. Thematisiert wurden auch die negativen Folgen der mangelnden Geschichtsaufarbeitung in der DDR sowie neue Formen des Neonazismus und Antisemitismus. Staatliche Stellen registrierten diese Entwicklungen und starteten eigene Programme, um den Umgang mit Geschichte wieder stärker kontrollieren zu können. So sollten zum Beispiel Jugendliche jüdische Friedhöfe pflegen und auf diese Weise mehr über das Judentum lernen. 4
5 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 Im Jahr 1988 wurde das Gedenken an den 50. Jahrestag der Reichskristallnacht erstmals staatlich organisiert und zum Ausgangspunkt für ein Gedenkjahr. Die Stiftung Neue Synagoge Berlin Centrum Judaicum wurde zur Pflege und Bewahrung jüdischen Kulturerbes errichtet. Sie sollte das Andenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, an Verfolgung und antifaschistischen Widerstand bewahren. Die mangelnde Vergangenheitsbewältigung mit dem Nationalsozialismus in der DDR ging einher mit geringen gesellschaftlichen Kenntnissen über das Judentum vor allem bei der jüngeren Generation. Im Geschichtsunterricht und den Schulbüchern wurde der Holocaust bzw. die nationalsozialistische Judenverfolgung nur am Rande dargestellt. Erst die letzte aber erste demokratisch gewählte Regierung der DDR unter Lothar de Maizière 1990 bekannte sich zur Verantwortung für die NS-Judenverfolgung und den Holocaust. Dieser Schritt führte zu einer Annäherung zwischen der DDR und Israel. Die DDR folgte damit dem Vorgehen der Bundesrepublik Deutschland in den 1950erund 1960er-Jahren. M2 Einweihung des Gedenksteins am Partheufer am 16. November 1988 ARC HIV E PHRAIM CARLE BAC H STIFTUNG M3 Aus dem Wort der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitung in der DDR an die Gemeinden anlässlich des 40. Jahrestages der sogenannten Kristallnacht vom 24. September 1978 Auf unserem Volk liegt die Last einer großen Schuld. Diese Schuld erledigt sich nicht dadurch, dass wir sie verdrängen, verschweigen oder unsere Mitverantwortung bestreiten. Zit. nach Jutta Illichmann: Die DDR und die Juden. Die deutschlandpolitische Instrumentalisierung von Juden und Judentum durch die Partei- und Staatsführung der SBZ/DDR von 1945 bis Frankfurt am Main 1997, S
6 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 M4 Beginn einer gemeinsamen Vortragsreihe der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum und der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig Zu den Referenten gehörten die israelitischen Gemeinderepräsentanten von Leipzig (Eugen Golomb) und Dresden (Helmut Eschwege). Quelle: Steffen Held, Juden in der DDR. Das Beispiel Leipzig. Lehr- und Lernmaterialien, hg. von der Ephraim Carlebach Stiftung, Leipzig 2011, S. 48 6
7 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 Aufgaben 1 Erklären Sie, warum die meisten Deutschen in der Nachkriegszeit nichts vom Völkermord an den Juden wissen wollten. 2 M1 zeigt ein Bild der jüdischen Gemeinde Leipzigs kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Beschreiben Sie die Situation und die Menschen, die auf dem Foto dargestellt werden. Versetzen Sie sich in deren Lage und diskutieren Sie, wie Sie als jüdische Überlebende damals gehandelt hätten. 3 Erläutern Sie, mit welcher Begründung die DDR eine Übernahme der Verantwortung für den Völkermord an den Juden ablehnte. 4 Fassen Sie stichpunktartig zusammen, wie sich das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der DDR entwickelte (M2 M4). Begründen Sie, warum die DDR in den 1980er-Jahren ihr Vorgehen änderte und eine aktivere Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung betrieb. 7
8 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 Arbeitsblatt: Antisemitismus in der DDR M5 Antisemitismus unter Oberschülern in Leipzig 1978 Quelle: Steffen Held, Juden in der DDR. Das Beispiel Leipzig. Lehr- und Lernmaterialien, hg. von der Ephraim Carlebach Stiftung, Leipzig 2011, S Fassen Sie den Inhalt des Briefes zusammen. 2 Bewerten Sie die Äußerung des Klassenlehrers, wonach die Kinder selbst Schuld an den Verunglimpfungen hätten, da sie sich doch selbst als Juden zu erkennen geben würden. 3 Beurteilen Sie, worauf diese Formen des Antisemitismus zurückzuführen sind. Berücksichtigen Sie dabei, dass in den offiziellen Darstellungen der SED die DDR stets als antifaschistischer Staat dargestellt wurde, in dem es im Gegensatz zur Bundesrepublik weder Neonazismus, Rassismus noch Antisemitismus gäbe. 8
9 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 Vorschlag zur Stundengestaltung (Doppelstunde) SCHWERPUNKT Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie in der DDR mit der Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und dem Holocaust gesellschaftlich, historisch und politisch umgegangen wurde. Einstieg Kurzer Lehrervortrag anhand des Einleitungstextes. Im Unterrichtsgespräch können mögliche Hypothesenbildungen zu den Gründen der Ablehnung der Verantwortung der DDR für die nationalsozialistischen Verbrechen an den Juden geäußert werden. Erarbeitung 1 Die Schülerinnen und Schüler betrachten das Foto M1 und lesen in Einzelarbeit den Abschnitt 1 zum gesellschaftlichen Umgang mit der Vergangenheit in Ostund Westdeutschland. Sicherung 1 Einzelarbeit zur Frage, warum die meisten Deutschen in der Nachkriegszeit nichts vom Völkermord an den Juden wissen wollten (Aufgabe 1). Im Anschluss findet eine kurze Auswertung im Unterrichtsgespräch statt (siehe auch Differenzierung). Erarbeitung 3 Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten selbstständig die Aufgabe 4. Sicherung 3 Die Ergebnisse werden mit dem Partner/ der Partnerin besprochen, ggf. ergänzt und im Unterrichtsgespräch zusammengetragen (siehe auch Differenzierung unten). Differenzierung Zur Sicherung 1 kann differenzierend für schnellere Schülerinnen und Schüler zusätzlich die Aufgabe 2 gegeben werden. Bei Sicherung 3 könnten leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler zusätzlich M2 bis M4 miterarbeiten bzw. auswerten und in das Unterrichtsgespräch einfließen lassen. Bei einigen Aufgaben und Textabschnitten finden sich bestimmte Fachbegriffe. Die Lehrkraft sollte auf die Begriffserklärung in der Randspalte verweisen und ggf. weitere Hilfestellungen geben. Erarbeitung 2 Im Folgenden sollen der politisch-historische Umgang mit der Vergangenheit erarbeitet werden. Die Schülerinnen und Schüler lesen in Einzelarbeit den Abschnitt 2 des Autorentextes. Sicherung 2 Die Schülerinnen und Schüler machen sich Kurznotizen. Zusammenfassende Auswertung im Unterrichtsgespräch und Rückgriff auf die Hypothesenbildung aus dem Stunden-Einstieg. Lehrplanbezug Thema: Erinnerung in der DDR an die nationalsozialistische Judenverfolgung Gymnasium: sächsischer Lehrplan, Fach Geschichte, Jahrgangsstufe 11/12, Wahlpflicht 3: Formen von Geschichtskultur Rezeptionsgeschichte am Beispiel des Zweiten Weltkriegs Lerninhalt: Aufarbeitung des NS-Unrechts nach 1945: Umgang mit dem Gedenken an die Judenverfolgung 9
10 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 Erwartungshorizonte zu den Aufgaben 1 Die meisten Deutschen wollten in der Nachkriegszeit nichts vom Völkermord an den Juden wissen, da die Umstände des Krieges und das damit im Zusammenhang stehende eigene Leid im Vordergrund standen. Eine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung bestand in moralischer Hinsicht nicht. Juden galten als Fremde, die industrielle Vernichtung der jüdischen Menschen hatte auf polnischem und weißrussischem Gebiet stattgefunden, was wiederum die Zuordnung von Schuld verklärte, Distanz schuf und letztlich zur mehrheitlichen Verdrängung der Vergangenheit führte einer weit verbreiteten Schlussstrichmentalität der Deutschen. 2 M1 zeigt ein Bild der Jüdischen Gemeinde Leipzigs kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Gesichter und Minen sind ernst und nachdenklich. Der Schock über die Geschehnisse der vergangenen Jahre saß tief. Die meisten der abgebildeten Menschen werden den überwiegenden Teil der eigenen Familie, ihrer Freunde und Kollegen im Holocaust verloren haben. Es ist deshalb als sehr beachtlich anzusehen, dass es Menschen jüdischen Glaubens gab, die nach diesen Erfahrungen des Völkermords an den Juden im Land der Täter blieben, sich versuchten in der Gesellschaft neu zu finden und ihr Leben neu aufzubauen. Viele überlebende Jüdinnen und Juden verließen Deutschland nach dem Krieg für immer. 3 Eine historische Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten an den europäischen Juden und den Holocaust lehnte die DDR mit dem Hinweis auf die eigene antifaschistische Tradition ab. Nach der eigenen Auslegung gab es in der DDR keine ehemaligen Nationalsozialisten, die etwa in führender politischer oder gesellschaftlicher Position gewesen wären. Menschen, die sich während der Zeit des Nationalsozialismus etwas hatten zu Schulden kommen lassen, galten als abgeurteilt. Die Täter lokalisierte man in der Bundesrepublik, dort oftmals immer noch in einflussreichen politischen und gesellschaftlichen Positionen. Insofern verwies man im Hinblick auf die Verantwortungsübernahme für den Völkermord an den Juden in den westlichen Teil Deutschlands. 4 Ungleichbehandlung von NS-Opfern in der DDR, die sich zum einen symbolisch bei den Gedenkorten, aber auch materiell in den Wiedergutmachungs-, Rückgabe- und Entschädigungsleistungen/Renten äußerte im Zentrum staatlichen Gedenkens stand die Ausrottung des deutschen Militarismus und Nazismus durch antifaschistische Widerstandskämpfer, nur vereinzelt andere Opfergruppen des Nationalsozialismus Ende der 1970er-Jahre zunehmende gesellschaftliche Anerkennung der deutschen Verantwortung für den Holocaust, vor allem von kirchlichen Kreisen und Schriftstellern 10
11 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 mit Beginn der 1980er-Jahre Ausstellungen und schriftliche Dokumentationen, die sich mit jüdischem Leben in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigten zunehmend gesellschaftliche Kritik an den negativen Folgen der mangelnden Geschichtsaufarbeitung in der DDR sowie neuen Formen des Neonazismus und Antisemitismus staatliche Reaktion durch eigene Programme, um den Umgang mit Geschichte wieder stärker kontrollieren zu können (Friedhofspflege durch Jugendliche, staatlich organisiertes Gedenkjahr zum 50. Jahrestages des Judenpogroms 1938) Regierung der DDR unter Lothar de Maizière 1990 bekannte sich erstmals zur Verantwortung für die NS-Judenverfolgung und den Holocaust 11
12 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in der DDR M O D U L T E I L 1 Erwartungshorizonte zum Arbeitsblatt: Antisemitismus in der DDR 1 Zusammenfassung des Briefinhalts: Der Brief der Israelitischen Religionsgemeinde in Leipzig an den Rat der Stadt berichtet von konkreten antisemitischen Ausfällen von Schülern in der DDR So wurde u.a. auf der Fahrt zur Gedenkstätte Buchenwald, eines ehemaligen Konzentrationslagers, durch Mitschüler zweier jüdischer Jugendlicher geäußert, dass sie diese in die Gaskammer bringen werden. Darüber hinaus wurden abfällige Bemerkungen in der Gedenkstätte selbst geäußert. Ferner gab es Beschimpfungen gegen diese jüdischen Mitschüler wie du alte Judensau. Außerdem wurden Ressentiments gegen den jüdischen Staat Israel geäußert, der dem Erdboden gleichgemacht werden sollte. Die Lehrkraft machte den Eltern deutlich, dass die Kinder selbst Schuld am Verhalten ihrer Mitschüler seien, wenn sie doch selber äußerten, dass sie Juden seien. Außerdem wird am Ende des Briefes von einem Moritz Engelberg berichtet, der zusammengeschlagen worden sei. 2 Die Äußerungen des Klassenlehrers zur eigenen Schuld der Kinder aufgrund der Angabe ihres Jüdischseins belegt, dass er selbst weder Mitgefühl noch historisches Bewusstsein hat. Die Aussage selbst ist als antisemitisch zu bewerten. Nicht die Verunglimpfungen stellen ein Problem für den Lehrer dar, sondern die Existenz von Menschen jüdischen Glaubens, die dies auch noch zum Ausdruck bringen. 3 Antisemitismus ist ein grundlegendes gesellschaftliches Problem in Deutschland, das eine lange bis ins Mittelalter reichende negative Tradition hat. Der Rassenwahn der Nationalsozialisten hatte die gesellschaftlichen Vorbehalte gegen Juden weiter verstärkt und in die Köpfe eingebrannt. Auch in der späteren DDR gab es folglich Antisemitismus unabhängig von der Frage, welches politische System dort bestand. Dass die SED sich und die DDR als das bessere Deutschland ohne Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus darstellte, war allein auf die herrschende Ideologie zurückzuführen, hatte aber mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit nichts zu tun wie der Brief ja auch belegt. 12
13 M O D U L T E I L 2 ERINNERUNG AN DIE NATIONAL- SOZIALISTISCHE JUDENVERFOLGUNG UND DEN HOLOCAUST IN LEIPZIG Leipzig hatte im Jahr 1933 die sechstgrößte jüdische Gemeinde Deutschlands Jüdinnen und Juden lebten damals in der Stadt, wobei unter die Nürnberger Rassengesetze rund Menschen fielen. Im Jahr 1939 lebten noch etwa 5800 Juden in der Stadt, 1941 noch ca Zwischen 1942 und 1945 wurden fast alle dieser letzten Leipziger Juden in Vernichtungslager deportiert, von ihnen überlebten etwa 220 den Holocaust. Auf der letzten Deportationsliste 1945 standen 24 Leipziger Jüdinnen und Juden zum Abtransport kam es jedoch nicht mehr. M1 Gedenkstein in der Leipziger Gottschedstraße für die ermordeten Juden in der Stadt Leipzig Nürnberger Rassengesetze Gesetzliche Regelungen zum Verhältnis von Juden und Nichtjuden bzw. juristische Grundlage für die Verfolgung und Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung Deutschlands; Menschen jüdischen Glaubens wurden zu Menschen minderen Rechts (Juden hatten keine politischen Rechte, durften keine Nichtjuden ehelichen usw.) Opfer des Faschismus und ihre Anerkennung in der DDR Kurz nach Kriegsende wurde in der Leipziger Stadtverwaltung die Kommunalabteilung Opfer des Faschismus gegründet, wobei der jeweilige Verfolgtenstatus in Kämpfer gegen den Faschismus und Opfer des Faschismus unterteilt wurde. Die erste Gruppe der Kämpfer, vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten, erhielt eine SILVIA HAUPTMANN, LEIPZIG höhere materielle Unterstützung zum Beispiel in Form von Renten, Wohnraum, Studienbeihilfen für Kinder als die letztgenannte, in die Jüdinnen und Juden als Rassenverfolgte mehrheitlich eingeteilt wurden. In der DDR wurden jüdische Vermögenswerte, die während der Zeit des Nationalsozialismus eingezogen und nun in sozialistisches Volkseigentum überführt worden waren, von einer Rückgabe an ihre Besitzer ausgeschlossen. Den jüdischen Gemeinden wurden vor allem ihre Gemeindehäuser, Friedhöfe und Grundstücke von zerstörten Synagogen übertragen, so auch in Leipzig. Diese Behandlung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger in der direkten Nachkriegszeit, ihre Einordnung als Opfer zweiter Klasse, waren die direkten Vorzeichen für die Art des Umgangs mit dem Gedenken an diese Opfergruppe in den späteren Jahren der DDR. Gedenken an die jüdischen Opfer des NS-Regimes in Leipzig Bereits am Anfang des Jahres 1946 hatte die jüdische Gemeinde Leipzigs einen öffentlichen Aufruf für die Errichtung eines Denkmals für die Leipziger jüdischen Opfer gefordert. Während die Planungen seitens der jüdischen Gemeinde vorangingen, war die Umsetzung beim Bau sehr schwierig es fehlten Material und geeignete Transportmittel wurde dann ein Bau 13
14 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Judenhaus Bezeichnung im nationalsozialistischen Deutschland für Wohnhäuser aus jüdischem Eigentum in die jüdische Mieter zwangsweise eingewiesen wurden, Ziel war die Isolierung der jüdischen von der nichtjüdischen Bevölkerung weiterer Denkmäler für die Opfer des Faschismus durch staatliche Stellen bis auf Weiteres untersagt. Erst im Mai 1951 konnte das Denkmal auf dem Neuen Israelitischen Friedhof eingeweiht werden. Den überwiegenden Teil der Kosten übernahm die Stadt Leipzig. Im November 1966 wurde auf Antrag der jüdischen Gemeinde Leipzigs ein weiterer Gedenkstein am Standort der 1938 zerstörten Hauptsynagoge in der Leipziger Gottschedstraße eingeweiht. Die SED instrumentalisierte die Einweihung des Denkmals für ihre politischen Zwecke. So wurde eine Massenveranstaltung mit Menschen inszeniert, bei der das Orchester der Volkspolizei den musikalischen Rahmen schuf (siehe M2). In den Staatsmedien wurde das Denkmal als Zeichen der Vergangenheitsbewältigung überschwänglich gefeiert, wobei durch die jüdische Gemeinde angeregte weitere Erinnerungsorte abgelehnt wurden. Vor allem die Evangelische Kirche hinterfragte in dieser Zeit die Erinnerungspolitik in der DDR bezüglich der Judenverfolgung und des Holocausts. Bereits ab 1967 führte sie regelmäßig Gedenkgottesdienste durch wurde durch die Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum in Leipzig und den Ökumenischen Arbeitskreis der christlichen Gemeinden Leipzigs ein weiterer Gedenkstein finanziert und errichtet, der an die Stelle erinnern sollte, an der am 10. November 1938 Jüdinnen und Juden misshandelt und in das trockene Flussbett der Parthe hineingetrieben worden waren. Mit der zunehmenden gesellschaftlichen Kritik an der staatlichen Vergangenheitsbewältigung entschloss sich die DDR, dem 50. Jahrestag des Pogroms an den Juden 1938 staatlich zu gedenken. Auch in Leipzig sollte dieses Gedenken sichtbar werden, sodass man auf dem Grundstück der ehemaligen Höheren Israelitischen Schule in der Gustav-Adolf-Straße 7, die während der Zeit des Nationalsozialismus als sogenanntes Judenhaus missbraucht worden war, eine Gedenktafel anbrachte. Darüber hinaus wurde vom Rat der Stadt Leipzig im sogenannten Kroch-Hochhaus, dem Ausstellungszentrum der Karl-Marx-Universität Leipzig, eine sehr ausführliche Dokumentation zu den damaligen Pogrom-Ereignissen gezeigt. Die Ausstellung erinnerte erstmals öffentlich an jüdisches Leben vor 1933 in Leipzig. Herausgehoben wurden dabei die Bedeutung der jüdischen Gemeinde seit dem Spätmittelalter und ihre Präsenz in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. M2 Einweihung des von der Leipziger Stadtverwaltung finanzierten Gedenksteins für die ermordeten Leipziger Juden am 10. November 1966 QUE LLE : STE FFE N HEL D : JUDEN IN DER DDR, DA S BEI S PIE L LEIPZIG, S
15 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Neues Forum Eine der Bürgerbewegungen in der Wendezeit der DDR Gedenken in der Zeit der Friedlichen Revolution in Leipzig Zum Ende der DDR und durch bürgerliche Reformkräfte wie das Neue Forum initiiert, bekam das Erinnern an die Verbrechen der Nationalsozialisten und den Völkermord an den Juden einen neuen Schub. So fand am 9. November 1989 ein Schweigemarsch anlässlich des 51. Jahrestages der faschistischen Pogromnacht und gegen Rechtsradikalismus in der DDR statt. Nach einem Friedensgebet in der Nikolaikirche führt er durch die Innenstadt zum Gedenkstein der ermordeten Juden Leipzigs. Tausende Leipziger erinnerten mit Kerzen, ohne Plakate, in aller Stille. In der Leipziger Stadtgeschichte gilt dieser Tag des Gedenkens als einmaliger Vorgang der Anteilnahme am Schicksal der europäischen Juden. M3 Vom Neuen Forum initiiertes Gedenken an den Novemberpogrom 1938 am Gedenkstein in der Gottschedstraße am 9. November 1989 VOLK MAR HEINZ QUE LLE : STE FFE N HEL D : E B D., S
16 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Aufgaben 1 Fassen Sie das Schicksal der Juden Leipzigs in der Zeit zwischen 1933 und 1945 zusammen. 2 Beschreiben Sie, wie die jüdischen Opfer der Nationalsozialsten in der DDR öffentlich dargestellt wurden und in welchem Rahmen ihrer gedacht wurde. 3 Im Autorentext wird von einer Instrumentalisierung des Gedenkens an den Holocaust durch die DDR gesprochen. Diskutiern Sie in der Klasse mögliche Gründe für dieses Vorgehen. 4 Charakterisieren Sie in kurzen Stichpunkten das staatliche und gesellschaftliche Gedenken an den Holocaust in der DDR und gehen Sie dabei insbesondere auf die Zeit der Friedlichen Revolution ein. 16
17 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Arbeitsblatt 1: Flucht aus Leipzig M4 Schreiben von Josef Ardel über seine Flucht aus Leipzig und den hier zurückgelassenen Besitz 1 Fassen Sie das Anliegen von Josef Ardel an die Israelitische Religionsgemeinde Leipzig zusammen. 2 Erklären Sie, weshalb Josef Ardel diesen Brief verfasst hat und was seine Befürchtungen sind. 3 Diskutieren Sie in der Klasse mögliche Gründe für die angekündigte Verhaftung Josef Ardels. Beurteilen Sie anschließend, ob eine Flucht aus der DDR ein hinreichender Grund dafür ist, dass das Eigentum von Josef Ardel zu Staatseigentum werden kann. 17
18 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Arbeitsblatt 2: Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus M5 M6 SILVIA HAUPTMANN, LEIPZIG (1,2) QUELLE: JUDEN IN LEIPZIG. EINE DOKUMENTATION, LEIPZIG 1988 Gedenktafel am Gebäude der ehemaligen Höheren Israelitischen Schule in der Gustav-Adolf-Straße 7 in Leipzig, angebracht vom Rat der Stadt Leipzig 1988 Gedenkstein für Leipziger Juden in der Leipziger Parthestraße, errichtet von der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum in Leipzig und dem Ökumenischen Arbeitskreis der christlichen Gemeinden Leipzigs 1988 Auf den Abbildungen sehen Sie zwei Gedenkorte in Leipzig, die anlässlich des 50. Jahrestages der Pogromnacht im Jahr 1988 eingeweiht wurden. Versetzen Sie sich in die Rolle eines Journalisten und erarbeiten Sie eine schriftliche Reportage zur Würdigung des 50. Jahrestages der Reichspogromnacht in der DDR am Beispiel von Leipzig ausgehend von der jeweiligen Hintergrundgeschichte der beiden Denkmale. Recherchieren Sie dazu auch im Internet und gehen Sie auf die Veränderungen in der Erinnerungskultur der DDR ein. 18
19 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Vorschlag zur Stundengestaltung (Doppelstunde) SCHWERPUNKT Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie in Leipzig mit der Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust gesellschaftlich, historisch und politisch umgegangen wurde. Einstieg Kurzer Lehrervortrag anhand des Einleitungstextes zum Schicksal und den Opferzahlen der Leipziger Juden während der nationalsozialistischen Diktatur 1933 bis Betrachtung des Fotos M1 und lautes Vorlesen des Textes auf dem Gedenkstein mit Verweis auf die Stundenthematik. Erarbeitung 1 Die Schülerinnen und Schüler lesen in Einzelarbeit den Abschnitt 1 zur Anerkennung der Opfer des Faschismus und dem zuerkannten Verfolgtenstatus der Juden. Im Anschluss wird die Aufgabe 2 in Einzelarbeit gelöst (siehe Differenzierung). Sicherung 1 Auswertung der Aufgabe 2 (und ggf. 1) im Unterrichtsgespräch. Erarbeitung 2 Im Folgenden soll das Gedenken der jüdischen Opfer des NS-Regimes in Leipzig im Mittelpunkt stehen. Die Schülerinnen und Schüler lesen in Einzelarbeit Abschnitt 2 des Autorentextes und werten das Foto M2 aus. Sicherung 2 Die Schülerinnen und Schüler machen sich Notizen. Zusammenfassende Auswertung im Unterrichtsgespräch und gemeinsame Lösung der Aufgabe 3. Die Schülerinnen und Schüler machen sich Notizen. Zusammenfassende Auswertung im Unterrichtsgespräch und gemeinsame Lösung der Aufgabe 3. Erarbeitung 3 Die Schülerinnen und Schüler lesen den dritten Abschnitt des Autorentextes und werten das Foto M3 aus. Lösen der Aufgabe 4 in Partnerarbeit. Sicherung 3 Die Ergebnisse werden mit dem Partner/ der Partnerin besprochen, ggf. ergänzt und im Unterrichtsgespräch zusammengetragen (siehe auch Differenzierung unten). Differenzierung Zur Erarbeitung 1 kann differenzierend für schnellere Schülerinnen und Schüler zusätzlich die Aufgabe 1 gegeben werden. Vertiefend und differenzierend kann das Arbeitsblatt Flucht aus Leipzig eingesetzt werden. Bei einigen Aufgaben und Textabschnitten finden sich bestimmte Fachbegriffe. Die Lehrkraft sollte auf die Begriffserklärung in der Randspalte verweisen und ggf. weitere Hilfestellungen geben. Lehrplanbezug siehe Teil 1, S. 9 19
20 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Erwartungshorizonte zu den Aufgaben 1 Zusammenfassung des Schicksals der Leipziger Juden zwischen 1933 und 1945: Nahezu die gesamte jüdische Gemeinde Leipzigs fiel dem Holocaust zum Opfer oder wurde vertrieben und emigrierte. Wenige Hundert Leipziger Juden überlebten den Holocaust bzw. die Vernichtungslager. 2 / 3 Überlebende jüdische Opfer des Nationalsozialismus galten nicht als Kämpfer gegen den Faschismus, sondern ausschließlich als Opfer des Faschismus. Die erste Gruppe, zu der v. a. nichtjüdische Sozialdemokraten und Kommunisten gehörten, erhielt eine höhere materielle Unterstützung als die zweitgenannte Gruppe, in die Rasseverfolgte mehrheitlich eingeordnet wurden. Jüdische Vermögenswerte, die während der Zeit des Nationalsozialismus eingezogen und nun in sozialistisches Volkseigentum überführt worden waren, wurden von einer Rückgabe an ihre Besitzer ausgeschlossen. Das Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus fand in der DDR auf staatliche Initiative hin so gut wie nicht statt. Zögerlich beteiligte man sich allerdings finanziell an verschiedensten Gedenkstätten. Im Vordergrund stand dabei aber v. a. das Gedenken der kommunistischen Kämpfer gegen den Faschismus, was man für die eigenen Zwecke und die Darstellung der antifaschistischen Tradition (M2) instrumentalisierte. V. a. die Kirchen und zivilgesellschaftliche Gruppen sowie die jüdischen Gemeinden hielten das Andenken an die Opfer des Holocaust aufrecht. Erst zum Ende der DDR veränderte sich die Erinnerungskultur von staatlicher Seite aufgrund gesellschaftlichen Drucks. 4 Staatliches Gedenken an den Holocaust Einteilung in Opfergruppen, Juden und andere rassisch Verfolgte als Opfer zweiter Klasse kaum materielle Wiedergutmachung so gut wie keine Erinnerungskultur im Hinblick auf den Holocaust, erst am Ende der DDR entwickelte sich zögerlich eine Gedenkkultur Gesellschaftliches Gedenken an den Holocaust v. a. durch kirchliche Gruppen, die jüdischen Gemeinden insbesondere zum Ende der DDR bekam das Gedenken an die Verbrechen der Nationalsozialisten und den Völkermord an den Juden einen neuen Schub Reformgruppen initiierten Gedenkveranstaltungen, an denen viele Menschen öffentlich teilnahmen 20
21 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Erwartungshorizonte zum Arbeitsblatt 1: Flucht aus Leipzig 1 Anliegen von Josef Ardel an die Israelitische Religionsgemeinde Leipzig Er äußert die Bitte an die Israelitische Religionsgemeinde Leipzig, sich um den zurückgelassenen Besitz zu kümmern im Einzelnen: 5½-Zimmer-Wohnung, Bankkonto bei der Stadtsparkasse, die Grundstücke Pölitzstraße 27, Eisenacher Straße 65 und Wettiner Straße 20, eine Altersrente in Höhe von 530 DM monatlich und eine Hinterbliebenenrente in unbekannter Höhe. Falls die jüdische Gemeinde diese Treuhänderschaft nicht übernehmen könne, bittet er, eine geeignete Person zu finden, die sich seinem Anliegen bzw. seiner Interessenvertretung annimmt. Ferner soll dieses Schreiben einer Behörde bzw. der VDN (Organisation Verfolgte des Naziregimes ) vorgelegt werden, damit diese den Grund der Flucht erfahren. 2 Grund des Briefes von Josef Ardel Offizielle Verlautbarungen in den Medien halten Flüchtlinge aus der DDR dazu an, Vertrauenspersonen zu bevollmächtigen, sich um zurückgelassene Vermögenswerte zu kümmern. Befürchtungen von Josef Ardel Seine Flucht und das Zurücklassen der familiären Vermögenswerte geschah unfreiwillig. Josef Ardel befürchtet, dass er ohne eine Vertrauensperson, die sich um seinen zurückgelassenen Besitz kümmert, den Anspruch darauf verliert und alles in Staatseigentum der DDR übergeht. 3 Mögliche Gründe für die angekündigte Verhaftung Josef Ardels: Die Drohung seiner Verhaftung, die ihm anonym zukam, lässt den Schluss zu, dass man die Familie vorsätzlich zur Flucht drängte, um ihn aus dem Land zu vertreiben. Dies geht zwar nicht direkt aus dem Brief hervor, kann aber dem beschriebenen Kontext so entnommen werden. In der Beurteilung können Schülerinnen und Schüler einen Gegenwartsbezug herstellen, indem sie die Frage aufgreifen, welchen Stellenwert Eigentum und die Freiheit der Person in unserer heutigen Gesellschaft hat (Bezug Grundgesetz). Außerdem kann die Frage der Flucht vor dem DDR-Staat bzw. der inhärente Unrechtscharakter aufgegriffen werden. Hätte Josef Ardel Vertrauen in ein bestehendes demokratisches Rechtssystem haben können, hätte er nicht fliehen müssen. 21
22 Erinnerung an die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust in Leipzig M O D U L T E I L 2 Erwartungshorizonte zum Arbeitsblatt 2: Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus Aufbauend auf den vermittelten Grundinformationen dieses Moduls werden individuelle Lösungsansätze durch die Schülerinnen und Schüler erwartet. 22
Schmerzhafte Erinnerung Die Ulmer Juden und der Holocaust
 Den jüdischen Bürgern im Gedächtnis der Stadt ihre eigene Geschichte und ihren Anteil an der Stadtgeschichte zurückzugeben. Dies ist der Anspruch von Alfred Moos und Silvester Lechner, langjähriger Leiter
Den jüdischen Bürgern im Gedächtnis der Stadt ihre eigene Geschichte und ihren Anteil an der Stadtgeschichte zurückzugeben. Dies ist der Anspruch von Alfred Moos und Silvester Lechner, langjähriger Leiter
Imperialismus und Erster Weltkrieg Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus und Erster Weltkrieg
 Imperialismus Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus Inhaltsfeld 6: Imperialismus Inhaltsfeld 8: Imperialismus 8. Inhaltsfeld: Imperialismus Inhaltliche Schwerpunkte
Imperialismus Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus Inhaltsfeld 6: Imperialismus Inhaltsfeld 8: Imperialismus 8. Inhaltsfeld: Imperialismus Inhaltliche Schwerpunkte
Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17
 Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17 Das Jugendforum denk!mal bietet seit 14 Jahren Berliner Jugendlichen die Chance, öffentlich ihr Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung
Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17 Das Jugendforum denk!mal bietet seit 14 Jahren Berliner Jugendlichen die Chance, öffentlich ihr Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung
Gedenken hat auch einen mahnenden Charakter.
 Wir von der Initiative begrüßen alle Anwesenden herzlich und freuen uns das ihr gekommen seid. Ganz besonders begrüßen wir die Überlebenden des faschistischen NS-Regimes und ihre Angehörigen. Wir sind
Wir von der Initiative begrüßen alle Anwesenden herzlich und freuen uns das ihr gekommen seid. Ganz besonders begrüßen wir die Überlebenden des faschistischen NS-Regimes und ihre Angehörigen. Wir sind
Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums
 Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums 1. Einleitung 2. Zielgruppen unserer Bildungsangebote 3. Inhalte und Ziele unserer Arbeit 4. Grundsätze für das Lernen 1 1. Einleitung Das Max Mannheimer Studienzentrum
Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums 1. Einleitung 2. Zielgruppen unserer Bildungsangebote 3. Inhalte und Ziele unserer Arbeit 4. Grundsätze für das Lernen 1 1. Einleitung Das Max Mannheimer Studienzentrum
Modulare Unterrichtsangebote für Schulen
 AG Juden und Christen Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Jüdisch-christlicher Think Tank seit 1961 https://www.ag-juden-christen.de Modulare Unterrichtsangebote
AG Juden und Christen Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Jüdisch-christlicher Think Tank seit 1961 https://www.ag-juden-christen.de Modulare Unterrichtsangebote
Nichts ist verloren wenn Du es erzählst
 Nichts ist verloren wenn Du es erzählst Familie Rosenberg im Zwangslager Berlin-Marzahn, um 1938 Jugendforum denk!mal 16 Seit vielen Jahren bietet das Jugendforum denk!mal Berliner Jugendlichen die Chance,
Nichts ist verloren wenn Du es erzählst Familie Rosenberg im Zwangslager Berlin-Marzahn, um 1938 Jugendforum denk!mal 16 Seit vielen Jahren bietet das Jugendforum denk!mal Berliner Jugendlichen die Chance,
Rede zum Volkstrauertag Dieter Thoms
 Rede zum Volkstrauertag 18.11.2018 Dieter Thoms Sehr geehrte Anwesende, wir gedenken am heutigen Volkstrauertag den Opfern der Kriege und erinnern an das Leid der Bevölkerung. Dieses Jahr bietet die Gelegenheit
Rede zum Volkstrauertag 18.11.2018 Dieter Thoms Sehr geehrte Anwesende, wir gedenken am heutigen Volkstrauertag den Opfern der Kriege und erinnern an das Leid der Bevölkerung. Dieses Jahr bietet die Gelegenheit
2.1 Bezug zu den Bildungsplänen in Baden-Württemberg
 2.1 Bezug zu den Bildungsplänen in Baden-Württemberg Von Ina Hochreuther In Baden-Württemberg treten im Schuljahr 2016 / 2017 neue Bildungspläne für die Grundschulen, die Werkrealschulen/Hauptschulen,
2.1 Bezug zu den Bildungsplänen in Baden-Württemberg Von Ina Hochreuther In Baden-Württemberg treten im Schuljahr 2016 / 2017 neue Bildungspläne für die Grundschulen, die Werkrealschulen/Hauptschulen,
Fächer: Geschichte, Politik Themenbereich Schulst/Jg Nationalsozialismus vor Ort
 Fächer: Geschichte, Politik Themenbereich Schulst/Jg. 5-12 Nationalsozialismus vor Ort Lernort/Lernanlass: Bensheim/Gedenkstätten an die Zeit des Nationalsozialismus Lage: Der Stolperstein befindet sich
Fächer: Geschichte, Politik Themenbereich Schulst/Jg. 5-12 Nationalsozialismus vor Ort Lernort/Lernanlass: Bensheim/Gedenkstätten an die Zeit des Nationalsozialismus Lage: Der Stolperstein befindet sich
Stoffverteilungsplan. Pflichtmodul: Nationalsozialismus und deutsches Selbstverständnis
 Buchner informiert C.C.Buchner Verlag Postfach 12 69 96003 Bamberg Stoffverteilungsplan Pflichtmodul: Nationalsozialismus und deutsches Selbstverständnis Epoche: Perspektive: Kategorien: Dimensionen: Neuzeit
Buchner informiert C.C.Buchner Verlag Postfach 12 69 96003 Bamberg Stoffverteilungsplan Pflichtmodul: Nationalsozialismus und deutsches Selbstverständnis Epoche: Perspektive: Kategorien: Dimensionen: Neuzeit
Es gilt das gesprochene Wort!
 Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 24. Juni 2015, 14 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt das gesprochene
Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 24. Juni 2015, 14 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt das gesprochene
Sehr geehrte Vertreter/innen der Jüdischen Gemeinde. und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit,
 Ansprache von Bürgermeister Reiner Breuer bei der Gedenkstunde zur Pogromnacht von 1938 am 09.11.2015 an der Promenadenstraße in Neuss Sehr geehrte Vertreter/innen der Jüdischen Gemeinde und der Gesellschaft
Ansprache von Bürgermeister Reiner Breuer bei der Gedenkstunde zur Pogromnacht von 1938 am 09.11.2015 an der Promenadenstraße in Neuss Sehr geehrte Vertreter/innen der Jüdischen Gemeinde und der Gesellschaft
Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen Curriculum des Faches Geschichte für die Kursstufe (2-stündig)
 Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen Curriculum des Faches Geschichte für die Kursstufe (2-stündig) Jahrgangsstufe Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans 1. PROZESSE DER MODERNISIERUNG IN WIRTSCHAFT, POLITIK
Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen Curriculum des Faches Geschichte für die Kursstufe (2-stündig) Jahrgangsstufe Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans 1. PROZESSE DER MODERNISIERUNG IN WIRTSCHAFT, POLITIK
Ereignis-Chronologie
 www.juedischesleipzig.de Ereignis-Chronologie Zusammengestellt von Steffen Held 13. 17. Jahrhundert Um 1250 Existenz einer jüdischen Siedlung ( Judenburg ) außerhalb der Stadtmauern 1349 Judenverfolgungen
www.juedischesleipzig.de Ereignis-Chronologie Zusammengestellt von Steffen Held 13. 17. Jahrhundert Um 1250 Existenz einer jüdischen Siedlung ( Judenburg ) außerhalb der Stadtmauern 1349 Judenverfolgungen
Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends
 VI 20./21. Jahrhundert Beitrag 14 Schindlers Liste (Klasse 9) 1 von 18 Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends Thomas Schmid, Heidelberg E uropa am Beginn der 40er-Jahre
VI 20./21. Jahrhundert Beitrag 14 Schindlers Liste (Klasse 9) 1 von 18 Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends Thomas Schmid, Heidelberg E uropa am Beginn der 40er-Jahre
Denn Joseph Goebbels selbst organisierte das Geschehen vom Münchner Rathaus aus und setzte die schrecklichen Ereignisse von dort aus in Szene.
 Sperrfrist: 10. November 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Gedenkveranstaltung
Sperrfrist: 10. November 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Gedenkveranstaltung
Es gilt das gesprochene Wort!
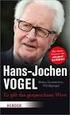 Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 10. September 2014, 11:30 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt
Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 10. September 2014, 11:30 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt
Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod
 Ausstellung der Initiative Stolpersteine für Konstanz Gegen Vergessen und Intoleranz Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod 22. Oktober 30. November 2012 Verfolgte und deportierte Kinder
Ausstellung der Initiative Stolpersteine für Konstanz Gegen Vergessen und Intoleranz Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod 22. Oktober 30. November 2012 Verfolgte und deportierte Kinder
Schulinterner Lehrplan Geschichte Görres-Gymnasium
 Schulinterner Lehrplan Geschichte Görres-Gymnasium 1 2 3 4 5 6 Jahrgangsstufe 9 1. Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus Die USA und Europa Februar 1917: Die bürgerliche
Schulinterner Lehrplan Geschichte Görres-Gymnasium 1 2 3 4 5 6 Jahrgangsstufe 9 1. Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus Die USA und Europa Februar 1917: Die bürgerliche
Widerstand und Überleben
 Widerstand und Überleben Die Poträts der 232 Menschen, die aus dem 20. Deportationszug in Belgien befreit wurden, am Kölner Hauptbahnhof 26./27.1. 2008 Eine Aktion der Gruppe Bahn erinnern GEDENKEN UND
Widerstand und Überleben Die Poträts der 232 Menschen, die aus dem 20. Deportationszug in Belgien befreit wurden, am Kölner Hauptbahnhof 26./27.1. 2008 Eine Aktion der Gruppe Bahn erinnern GEDENKEN UND
Sehr geehrte Vertreter der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, in der Zeit um den 9. November gehen unsere Gedanken in jedem Jahr
 Rede von Bürgermeister Herbert Napp bei der Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht von 1938 am Montag, 10. November 2014, 11.30 Uhr, an der Gedenkstätte Promenadenstraße Sehr geehrte Vertreter der Jüdischen
Rede von Bürgermeister Herbert Napp bei der Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht von 1938 am Montag, 10. November 2014, 11.30 Uhr, an der Gedenkstätte Promenadenstraße Sehr geehrte Vertreter der Jüdischen
Rede von Bürgermeister Reiner Breuer zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht am Mahnmal an der Promenadenstraße am 9.
 Rede von Bürgermeister Reiner Breuer zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht am Mahnmal an der Promenadenstraße am 9. November 2017 Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler
Rede von Bürgermeister Reiner Breuer zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht am Mahnmal an der Promenadenstraße am 9. November 2017 Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler
Büro des Oberbürgermeisters - AZ: Sü OB Rede zur Gedenkstunde anlässlich der Reichspogromnacht am
 Büro des Oberbürgermeisters - AZ: 000.020.001 - Sü OB Rede zur Gedenkstunde anlässlich der Reichspogromnacht am 09.11.2015 Sehr geehrte Frau Pfarrerin Busch-Wagner, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates
Büro des Oberbürgermeisters - AZ: 000.020.001 - Sü OB Rede zur Gedenkstunde anlässlich der Reichspogromnacht am 09.11.2015 Sehr geehrte Frau Pfarrerin Busch-Wagner, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
 Rede von Bürgermeister Olaf Cunitz bei der Gedenkfeier zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2013 um 10.30 Uhr in der Henry- und Emma-Budge-Stiftung, Wilhelmshöher Straße
Rede von Bürgermeister Olaf Cunitz bei der Gedenkfeier zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2013 um 10.30 Uhr in der Henry- und Emma-Budge-Stiftung, Wilhelmshöher Straße
Rede von Bürgermeister Reiner Breuer zur Gedenk- Veranstaltung zur Pogromnacht am 9. November 2016 an der Promenadenstraße in Neuss
 Rede von Bürgermeister Reiner Breuer zur Gedenk- Veranstaltung zur Pogromnacht am 9. November 2016 an der Promenadenstraße in Neuss Sehr geehrte Vertreter der Jüdischen Gemeinde, lieber Herr Römgens, verehrte
Rede von Bürgermeister Reiner Breuer zur Gedenk- Veranstaltung zur Pogromnacht am 9. November 2016 an der Promenadenstraße in Neuss Sehr geehrte Vertreter der Jüdischen Gemeinde, lieber Herr Römgens, verehrte
Diese Zeilen stehen auf dem 1948 auf dem Zittauer Friedhof errichteten Gedenkstein, der an die ermordeten Zittauer Jüdinnen und Juden erinnert.
 Ein Licht Gottes ist der Menschen Seele. Zum Gedenken der vierzig jüdischen Seelen der Städte Zittau und Löbau, die in den Jahren 1933-1945 hingerichtet, ermordet, vergast und verbrannt wurden. Weil sie
Ein Licht Gottes ist der Menschen Seele. Zum Gedenken der vierzig jüdischen Seelen der Städte Zittau und Löbau, die in den Jahren 1933-1945 hingerichtet, ermordet, vergast und verbrannt wurden. Weil sie
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Strukturierender Aspekt: Herrschaft und politische Teilhabe; Gewaltsame Konflikte, Verfolgung und Kriege Thema (kursiv = Additum) Die Gegner der Demokratie gewinnen
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Strukturierender Aspekt: Herrschaft und politische Teilhabe; Gewaltsame Konflikte, Verfolgung und Kriege Thema (kursiv = Additum) Die Gegner der Demokratie gewinnen
Plenarsitzung Freitag, 27. Januar 2017, 10 Uhr: Es gilt das gesprochene Wort
 Plenarsitzung Freitag, 27. Januar 2017, 10 Uhr: Es gilt das gesprochene Wort Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, I. Als am 27. Januar 1945 sowjetische Truppen das
Plenarsitzung Freitag, 27. Januar 2017, 10 Uhr: Es gilt das gesprochene Wort Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, I. Als am 27. Januar 1945 sowjetische Truppen das
Juden in Leipzig und Sachsen. Modulare Unterrichtsangebote. Leipziger Juden in der DDR. Modul. (Modul für Klassenstufen 9/10)
 Juden in Leipzig und Sachsen Modulare Unterrichtsangebote Modul Leipziger Juden in der DDR (Modul für Klassenstufen 9/10) EPHRAIM CARLE BAC H STIFTU NG LEIPZIG JUDEN IN LEIPZIG UND SACHSEN MODULARE UNTERRICHTSANGEBOTE
Juden in Leipzig und Sachsen Modulare Unterrichtsangebote Modul Leipziger Juden in der DDR (Modul für Klassenstufen 9/10) EPHRAIM CARLE BAC H STIFTU NG LEIPZIG JUDEN IN LEIPZIG UND SACHSEN MODULARE UNTERRICHTSANGEBOTE
Geschichte erinnert und gedeutet: Wie legitimieren die Bolschewiki ihre Herrschaft? S. 30. Wiederholen und Anwenden S. 32
 Stoffverteilungsplan Nordrhein-Westfalen Schule: 978-3-12-443030-4 Lehrer: Kernplan Geschichte 9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 1) Vom Zarenreich
Stoffverteilungsplan Nordrhein-Westfalen Schule: 978-3-12-443030-4 Lehrer: Kernplan Geschichte 9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 1) Vom Zarenreich
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Mahnmal Tor des Lebens
 Mahnmal Tor des Lebens Name: Mahnmal Tor des Lebens Standort: Friedhof Bulach in Beiertheim-Bulach Erbauungsjahr: 1988 n.chr Künstler: Gerhard Karl Huber Inschrift: "Tor des Lebens ist Liebe und Verstädnis
Mahnmal Tor des Lebens Name: Mahnmal Tor des Lebens Standort: Friedhof Bulach in Beiertheim-Bulach Erbauungsjahr: 1988 n.chr Künstler: Gerhard Karl Huber Inschrift: "Tor des Lebens ist Liebe und Verstädnis
30. Januar 2009 Thomas Lutz - Stiftung Topographie des Terrors 1
 30. Januar 2009 Thomas Lutz - Stiftung Topographie des Terrors 1 Entdecken und Verstehen Bildungsarbeit mit Zeugnissen von Opfern des Nationalsozialismus Seminar der Stiftung Erinnerung, Verantwortung
30. Januar 2009 Thomas Lutz - Stiftung Topographie des Terrors 1 Entdecken und Verstehen Bildungsarbeit mit Zeugnissen von Opfern des Nationalsozialismus Seminar der Stiftung Erinnerung, Verantwortung
Qualifikationsphase 1 und 2: Unterrichtsvorhaben III
 Qualifikationsphase 1 und 2: Unterrichtsvorhaben III Thema: Die Zeit des Nationalsozialismus Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und Deutungen I Übergeordnete Kompetenzen Die Schülerinnen
Qualifikationsphase 1 und 2: Unterrichtsvorhaben III Thema: Die Zeit des Nationalsozialismus Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und Deutungen I Übergeordnete Kompetenzen Die Schülerinnen
Volkstrauertag 13. November 2016
 Volkstrauertag 13. November 2016 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! Wir haben uns heute hier versammelt, um an die Menschen, die im Krieg und durch Gewaltherrschaft starben, zu erinnern. Für die unter
Volkstrauertag 13. November 2016 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! Wir haben uns heute hier versammelt, um an die Menschen, die im Krieg und durch Gewaltherrschaft starben, zu erinnern. Für die unter
Sperrfrist: 17. April 2016, Uhr Es gilt das gesprochene Wort.
 Sperrfrist: 17. April 2016, 14.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, am Befreiungstag des KZ
Sperrfrist: 17. April 2016, 14.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, am Befreiungstag des KZ
Landtag Brandenburg 6. Wahlperiode. Drucksache 6/1123. Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 Landtag Brandenburg 6. Wahlperiode Drucksache 6/1123 Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE, der
Landtag Brandenburg 6. Wahlperiode Drucksache 6/1123 Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE, der
Eröffnungsrede Gedenkveranstaltung am 8. Mai 2015 in Bergen-Belsen Hartmut Meine, Bezirksleiter IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
 Eröffnungsrede Gedenkveranstaltung am 8. Mai 2015 in Bergen-Belsen Hartmut Meine, Bezirksleiter IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (Es gilt das gesprochene Wort) Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Eröffnungsrede Gedenkveranstaltung am 8. Mai 2015 in Bergen-Belsen Hartmut Meine, Bezirksleiter IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (Es gilt das gesprochene Wort) Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges
 Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH
Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH
Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden
 Klaus Euhausen Waldrandsiedlung 28 16761 Hennigsdorf Tel. / Fax: 03302-801178 E-Mail: euhausen@aol.com DOKUMENTATION Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden Klaus Euhausen Wrangelstraße 66 10 997 Berlin
Klaus Euhausen Waldrandsiedlung 28 16761 Hennigsdorf Tel. / Fax: 03302-801178 E-Mail: euhausen@aol.com DOKUMENTATION Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden Klaus Euhausen Wrangelstraße 66 10 997 Berlin
Rede von Frau Bürgermeisterin Maria Unger anlässlich des Beitritts der Stadt Gütersloh zum Riga-Komitee, , Uhr, Haus Kirchstraße 21
 Seite 1 von 12 1 Rede von Frau Bürgermeisterin Maria Unger anlässlich des Beitritts der Stadt Gütersloh zum Riga-Komitee, 9.11.2009, 14.30 Uhr, Haus Kirchstraße 21 Meine sehr geehrten Herren und Damen,
Seite 1 von 12 1 Rede von Frau Bürgermeisterin Maria Unger anlässlich des Beitritts der Stadt Gütersloh zum Riga-Komitee, 9.11.2009, 14.30 Uhr, Haus Kirchstraße 21 Meine sehr geehrten Herren und Damen,
Es erfüllt mich mit Stolz und mit Freude, Ihnen aus Anlass des
 Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler, zum Festakt anlässlich des 10. Jahrestages der Weihe in der Neuen Synagoge Dresden am 13. November 2011 Sehr geehrte Frau Dr. Goldenbogen,
Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler, zum Festakt anlässlich des 10. Jahrestages der Weihe in der Neuen Synagoge Dresden am 13. November 2011 Sehr geehrte Frau Dr. Goldenbogen,
Selbstüberprüfung: Europa und die Welt im 19. Jahrhundert. 184
 3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
Deutschland, Europa und die Welt bis zur Gegenwart. herausgegeben von Dieter Brückner C.C.BUCHNER
 Deutschland, Europa und die Welt bis zur Gegenwart herausgegeben von Dieter Brückner und Harald Focke C.C.BUCHNER Inhalt 7 Mit diesem Buch erfolgreich lernen Imperialismus und Erster Weltkrieg 11 Positionen:
Deutschland, Europa und die Welt bis zur Gegenwart herausgegeben von Dieter Brückner und Harald Focke C.C.BUCHNER Inhalt 7 Mit diesem Buch erfolgreich lernen Imperialismus und Erster Weltkrieg 11 Positionen:
erzähl davon! beginnt vor deiner tür
 Geschichte erzähl davon! beginnt vor deiner tür »FOTO: ABGEORDNETENHAUS VON BERLIN Berliner Kinder und Jugendliche zeigen im Rahmen des Jugendforums denk!mal mit vielfältigen Beiträgen, wie ernsthaft,
Geschichte erzähl davon! beginnt vor deiner tür »FOTO: ABGEORDNETENHAUS VON BERLIN Berliner Kinder und Jugendliche zeigen im Rahmen des Jugendforums denk!mal mit vielfältigen Beiträgen, wie ernsthaft,
Betr.: Einführung eines Europäischen Gedenktages für die Opfer aller totalitärer und autoritärer Regime am 23. August
 Arbeitskreis der Oranienburg, den 19. Januar 2012 Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin und Brandenburg Der Vorsitzende Prof. Dr. Günter Morsch c/o Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
Arbeitskreis der Oranienburg, den 19. Januar 2012 Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin und Brandenburg Der Vorsitzende Prof. Dr. Günter Morsch c/o Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur
 Reihe 17 S 1 Verlauf Material Der 17. Juni 1953 Geschichtskonstrukt und Identitätsstiftung Darstellung und Deutung des Volksaufstandes in DDR und BRD Elisabeth Gentner, Stuttgart Eine Szene vom 17. Juni
Reihe 17 S 1 Verlauf Material Der 17. Juni 1953 Geschichtskonstrukt und Identitätsstiftung Darstellung und Deutung des Volksaufstandes in DDR und BRD Elisabeth Gentner, Stuttgart Eine Szene vom 17. Juni
Sehr verehrte Frau Glassman-Simons, sehr geehrter Herr Glassman, sehr geehrte Vertreter der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und der
 Rede von Bürgermeister Reiner Breuer zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht vor 80 Jahren am Mahnmal an der Promenadenstraße / Freitag, 9. November 2018, 11.30 Uhr Sehr verehrte Frau Glassman-Simons,
Rede von Bürgermeister Reiner Breuer zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht vor 80 Jahren am Mahnmal an der Promenadenstraße / Freitag, 9. November 2018, 11.30 Uhr Sehr verehrte Frau Glassman-Simons,
Geschichte und Geschehen für das Berufskolleg. 1 Lebensformen früher und heute. 1.1 Fit für die Zukunft? Jugend in einer Gesellschaft im Wandel
 Stoffverteilungsplan Geschichte und Geschehen Baden-Württemberg Band: Berufskolleg (978-3-12-416450-4) Schule: Lehrer: Std. Lehrplan für das Berufskolleg (2009) Geschichte mit Gemeinschaftskunde Geschichte
Stoffverteilungsplan Geschichte und Geschehen Baden-Württemberg Band: Berufskolleg (978-3-12-416450-4) Schule: Lehrer: Std. Lehrplan für das Berufskolleg (2009) Geschichte mit Gemeinschaftskunde Geschichte
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: , Uhr -
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 20.08.2013, 18.45 Uhr - Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Besuchs der Bundeskanzlerin
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 20.08.2013, 18.45 Uhr - Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Besuchs der Bundeskanzlerin
Gedenkveranstaltung am Lagerfriedhof Sandbostel
 Gedenkveranstaltung am 29. 4. 2017 Lagerfriedhof Sandbostel - Begrüßung zunächst möchte ich mich bei der Stiftung Lager Sandbostel bedanken, dass ich heute anlässlich des72. Jahrestages der Befreiung des
Gedenkveranstaltung am 29. 4. 2017 Lagerfriedhof Sandbostel - Begrüßung zunächst möchte ich mich bei der Stiftung Lager Sandbostel bedanken, dass ich heute anlässlich des72. Jahrestages der Befreiung des
Gedenkveranstaltung Pogromnacht
 Präsidialamt Gedenkveranstaltung Pogromnacht Ansprache des Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Walter Rosenthal zur Gedenkveranstaltung Reichspogromnacht, 09.11.2017, Westbahnhof,
Präsidialamt Gedenkveranstaltung Pogromnacht Ansprache des Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Walter Rosenthal zur Gedenkveranstaltung Reichspogromnacht, 09.11.2017, Westbahnhof,
Stellungnahme zu den Anträgen auf symbolische Entschädigung noch lebender sowjetischer
 Stellungnahme zu den Anträgen auf symbolische Entschädigung noch lebender sowjetischer Kriegsgefangener von Professor Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein Ich bin gebeten worden, zu den Vorschlägen auf eine
Stellungnahme zu den Anträgen auf symbolische Entschädigung noch lebender sowjetischer Kriegsgefangener von Professor Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein Ich bin gebeten worden, zu den Vorschlägen auf eine
Es gilt das gesprochene Wort
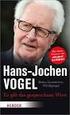 Es gilt das gesprochene Wort Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis anlässlich des nationalen Gedenktages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1.2005, 19.30 Uhr, Hugenottenkirche
Es gilt das gesprochene Wort Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis anlässlich des nationalen Gedenktages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1.2005, 19.30 Uhr, Hugenottenkirche
Tunnelbauprojekt über das Gelände der ehemaligen Synagoge in der Kanalstraße 9, Diez
 An die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises Untere Denkmalschutzbehörde Insel Silberau 56130 Bad Ems Tunnelbauprojekt über das Gelände der ehemaligen Synagoge in der Kanalstraße 9, 65582 Diez Diez/Limburg,
An die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises Untere Denkmalschutzbehörde Insel Silberau 56130 Bad Ems Tunnelbauprojekt über das Gelände der ehemaligen Synagoge in der Kanalstraße 9, 65582 Diez Diez/Limburg,
Dolchstoßlegenden Das politische Mittel der Verschwörungstheorie als effektives Propagandamittel?
 Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien 08.06.2017 Studienseminar Koblenz Fachseminar Geschichte Entwurf für die vierte Unterrichtsmitschau im Fach Geschichte Referendarin: Schule: Klasse:
Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien 08.06.2017 Studienseminar Koblenz Fachseminar Geschichte Entwurf für die vierte Unterrichtsmitschau im Fach Geschichte Referendarin: Schule: Klasse:
Schulcurriculum 2/3 der Zeit 1/3 der Zeit II III IV V Kompetenzen Thema Inhalt Monat/ Jahr
 I Geschichte Klasse 9 Kerncurriculum Hinweise auf das Schulcurriculum 2/3 der Zeit 1/3 der Zeit II III IV V Kompetenzen Thema Inhalt Monat/ Jahr Das deutsche Kaiserreich - darstellen, dass die Reichsgründung
I Geschichte Klasse 9 Kerncurriculum Hinweise auf das Schulcurriculum 2/3 der Zeit 1/3 der Zeit II III IV V Kompetenzen Thema Inhalt Monat/ Jahr Das deutsche Kaiserreich - darstellen, dass die Reichsgründung
I. Wer Yad Vashem besucht hat, den lässt dieser Ort nie mehr los.
 Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Ich bin meines Bruders Hüter Die Ehrung der Gerechten unter den Völkern 24. April 2018, 13.30 Uhr, Wandelhalle des Landtags I. Wer Yad Vashem besucht hat, den
Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Ich bin meines Bruders Hüter Die Ehrung der Gerechten unter den Völkern 24. April 2018, 13.30 Uhr, Wandelhalle des Landtags I. Wer Yad Vashem besucht hat, den
Die Weimarer Republik (16 Stunden)
 Die Weimarer Republik (16 Stunden) Vom Kaiserreich zur Republik Die Revolution Der Weg zur Nationalversammlung Weimarer Verfassung (1919) und Parteien Verfassungsschema erklären Verfassungs- und grundrechtliche
Die Weimarer Republik (16 Stunden) Vom Kaiserreich zur Republik Die Revolution Der Weg zur Nationalversammlung Weimarer Verfassung (1919) und Parteien Verfassungsschema erklären Verfassungs- und grundrechtliche
ERINNERN, VERSTEHEN UND HANDELN
 Sperrfrist: 09.01.2013 ERINNERN, VERSTEHEN UND HANDELN Rede von Günter Saathoff, Vorstand der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) zur Eröffnung der internationalen Wanderausstellung Zwangsarbeit.
Sperrfrist: 09.01.2013 ERINNERN, VERSTEHEN UND HANDELN Rede von Günter Saathoff, Vorstand der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) zur Eröffnung der internationalen Wanderausstellung Zwangsarbeit.
Erinnerungskultur und Genozid im Schulunterricht in Deutschland: Ein vergleichender Überblick über Rahmenrichtlinien
 Erinnerungskultur und Genozid im Schulunterricht in Deutschland: Ein vergleichender Überblick über Rahmenrichtlinien Jasmin Grakoui, 17.11.2017 Ablauf 1. Konzepte zur Behandlung des Osmanischen Genozids
Erinnerungskultur und Genozid im Schulunterricht in Deutschland: Ein vergleichender Überblick über Rahmenrichtlinien Jasmin Grakoui, 17.11.2017 Ablauf 1. Konzepte zur Behandlung des Osmanischen Genozids
Ausführungen von Gert Hager, Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim, anlässlich der Gedenkfeier am auf dem Hauptfriedhof
 Dezernat I Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Pressereferent Tel: 07231-39 1425 Fax: 07231-39-2303 presse@stadt-pforzheim.de ES GILT DAS GESPROCHENE WORT Ausführungen von Gert
Dezernat I Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Pressereferent Tel: 07231-39 1425 Fax: 07231-39-2303 presse@stadt-pforzheim.de ES GILT DAS GESPROCHENE WORT Ausführungen von Gert
Ansprache bei der Veranstaltung der Gemeinschaft Sant Egidio zum Gedenken an die Deportation der Juden aus Würzburg am 28.
 1 Ansprache bei der Veranstaltung der Gemeinschaft Sant Egidio zum Gedenken an die Deportation der Juden aus Würzburg am 28. November 2016 Begrüßung, namentlich - Dr. Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats
1 Ansprache bei der Veranstaltung der Gemeinschaft Sant Egidio zum Gedenken an die Deportation der Juden aus Würzburg am 28. November 2016 Begrüßung, namentlich - Dr. Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats
Rede anlässlich der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der Ungarischen Revolution Budapest, 22. Oktober 2006
 Rede anlässlich der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der Ungarischen Revolution Budapest, 22. Oktober 2006 Sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke Ihnen, Herr Staatspräsident, aufrichtig für die ehrenvolle
Rede anlässlich der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag der Ungarischen Revolution Budapest, 22. Oktober 2006 Sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke Ihnen, Herr Staatspräsident, aufrichtig für die ehrenvolle
Unterrichtsentwurf: Die Ideologie des Nationalsozialismus
 Geschichte Andreas Dick Unterrichtsentwurf: Die Ideologie des Nationalsozialismus Weltanschauung - Grundprinzip und gesellschaftliche Ordnung Unterrichtsentwurf RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG Historisches
Geschichte Andreas Dick Unterrichtsentwurf: Die Ideologie des Nationalsozialismus Weltanschauung - Grundprinzip und gesellschaftliche Ordnung Unterrichtsentwurf RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG Historisches
Beispiele jüdischen Lebens in Baden-Württemberg. Sekundarstufe I: Geschichte Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen
 Beispiele jüdischen Lebens in Baden-Württemberg Sekundarstufe I: Geschichte Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klasse 5/6 3.1.3 Griechisch-römische Antike Zusammenleben in der Polis und im Imperium
Beispiele jüdischen Lebens in Baden-Württemberg Sekundarstufe I: Geschichte Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen Klasse 5/6 3.1.3 Griechisch-römische Antike Zusammenleben in der Polis und im Imperium
Inhalt. 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus. So findet ihr euch im Buch zurecht... 10
 Inhalt So findet ihr euch im Buch zurecht................................ 10 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus Das Deutsche Kaiserreich im Zeitalter des Imperialismus Orientierung gewinnen........................................
Inhalt So findet ihr euch im Buch zurecht................................ 10 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus Das Deutsche Kaiserreich im Zeitalter des Imperialismus Orientierung gewinnen........................................
Die Erinnerung an den beispiellosen Zivilisationsbruch
 Sperrfrist: 12. Mai 2017, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung
Sperrfrist: 12. Mai 2017, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 96-2 vom 23. September 2008 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim Fundraising Dinner zugunsten des Denkmals für die ermordeten Juden Europas am 23. September
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 96-2 vom 23. September 2008 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim Fundraising Dinner zugunsten des Denkmals für die ermordeten Juden Europas am 23. September
Sperrfrist: 21. Dezember 2014, Uhr Es gilt das gesprochene Wort.
 Sperrfrist: 21. Dezember 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Chanukka-Fest der
Sperrfrist: 21. Dezember 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Chanukka-Fest der
Doppelte Solidarität im Nahost-Konflikt
 Doppelte Solidarität im Nahost-Konflikt Im Wortlaut von Gregor Gysi, 14. Juni 2008 Perspektiven - unter diesem Titel veröffentlicht die Sächsische Zeitung kontroverse Kommentare, Essays und Analysen zu
Doppelte Solidarität im Nahost-Konflikt Im Wortlaut von Gregor Gysi, 14. Juni 2008 Perspektiven - unter diesem Titel veröffentlicht die Sächsische Zeitung kontroverse Kommentare, Essays und Analysen zu
Was versteht man unter Weimarer Verfassung? Was versteht man unter Inflation? Was versteht man unter Hitler- Ludendorff-Putsch 1923?
 1 Weimarer Verfassung: Weimarer Verfassung? ab 1919 Festlegung der Republik als Staatsform Garantie von Grundrechten starke Stellung des Reichspräsidenten als Problem 2 Inflation? Inflation: anhaltende
1 Weimarer Verfassung: Weimarer Verfassung? ab 1919 Festlegung der Republik als Staatsform Garantie von Grundrechten starke Stellung des Reichspräsidenten als Problem 2 Inflation? Inflation: anhaltende
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27.
 Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27. Januar 2009, 12:00 Uhr Schloß Oberhausen, Konrad Adenauer Allee
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27. Januar 2009, 12:00 Uhr Schloß Oberhausen, Konrad Adenauer Allee
15 Minuten Orientierung im Haus und Lösung der Aufgaben, 30 Minuten Vorstellung der Arbeitsergebnisse durch die Gruppensprecher/innen.
 Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Fächer Themenbereich Schulst/Jg Geschichte, Religion
 Fächer Themenbereich Schulst/Jg. 5-12 Geschichte, Religion Jüdische Geschichte vor Ort Lernort/Lernanlass: Rimbach Lage: Zugang/Anreise: Geschichte der jüdischen Gemeinde Jüdische Einrichtungen (Synagoge,
Fächer Themenbereich Schulst/Jg. 5-12 Geschichte, Religion Jüdische Geschichte vor Ort Lernort/Lernanlass: Rimbach Lage: Zugang/Anreise: Geschichte der jüdischen Gemeinde Jüdische Einrichtungen (Synagoge,
Buchner informiert. Stoffverteilungsplan. Pflichtmodul: Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges
 Buchner informiert C.C.Buchner Verlag Postfach 12 69 96003 Bamberg Stoffverteilungsplan Pflichtmodul: Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Epoche: Perspektive: Kategorien:
Buchner informiert C.C.Buchner Verlag Postfach 12 69 96003 Bamberg Stoffverteilungsplan Pflichtmodul: Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Epoche: Perspektive: Kategorien:
Projektbeschreibung Februar 2011
 Projektbeschreibung Deutsch-polnisch-russisches Seminar für StudentInnen: Multiperspektivität der Erinnerung: deutsche, polnische und russische Perspektiven und gesellschaftliche Diskurse auf den Holocaust
Projektbeschreibung Deutsch-polnisch-russisches Seminar für StudentInnen: Multiperspektivität der Erinnerung: deutsche, polnische und russische Perspektiven und gesellschaftliche Diskurse auf den Holocaust
Rahmenthema 3: Wurzeln unserer Identität. Strukturierung des Kurshalbjahres
 4 Rahmenthema 3: Wurzeln unserer Identität Einstieg Orientierung: Wurzeln unserer Identität Kernmodul: Die Frage nach der deutschen Identität Die Frage nach der deutschen Identität Nation und Nationalismus
4 Rahmenthema 3: Wurzeln unserer Identität Einstieg Orientierung: Wurzeln unserer Identität Kernmodul: Die Frage nach der deutschen Identität Die Frage nach der deutschen Identität Nation und Nationalismus
Qualifikationsphase - GK
 Unterrichtsvorhaben I: Q1 Grundkurs Thema: Beharrung und Wandel Modernisierung im 19. Jahrhundert treffen selbstständig zentrale methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1), erläutern
Unterrichtsvorhaben I: Q1 Grundkurs Thema: Beharrung und Wandel Modernisierung im 19. Jahrhundert treffen selbstständig zentrale methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1), erläutern
Ich möchte meine Ansprache zum heutigen Gedenktag an die. Opfer des Nationalsozialismus an diesem Ehrenhain in
 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haustein, liebe Anwesende! Ich möchte meine Ansprache zum heutigen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus an diesem Ehrenhain in Dittersbach mit zwei persönlichen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haustein, liebe Anwesende! Ich möchte meine Ansprache zum heutigen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus an diesem Ehrenhain in Dittersbach mit zwei persönlichen
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation
 Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation Sinti
Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation Sinti
KZ-Gedenkstätten und andere Lernorte zur Geschichte des. Am 30. Januar kommenden Jahres werden 80 Jahre vergangen sein,
 Dr. Barbara Distel Ehemalige Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau KZ-Gedenkstätten und andere Lernorte zur Geschichte des nationalsozialistischen Terrors Überlegungen Am 30. Januar kommenden Jahres werden
Dr. Barbara Distel Ehemalige Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau KZ-Gedenkstätten und andere Lernorte zur Geschichte des nationalsozialistischen Terrors Überlegungen Am 30. Januar kommenden Jahres werden
Initiative 27.JANUAR. Für das Gedenken an den Holocaust. Gegen Antisemitismus. Für die Stärkung der deutsch-israelischen Beziehungen.
 Initiative 27.JANUAR Für das Gedenken an den Holocaust. Gegen Antisemitismus. Für die Stärkung der deutsch-israelischen Beziehungen. Gedenken und Begegnen Wir tragen mit Gedenkveranstaltungen zum 27. Januar
Initiative 27.JANUAR Für das Gedenken an den Holocaust. Gegen Antisemitismus. Für die Stärkung der deutsch-israelischen Beziehungen. Gedenken und Begegnen Wir tragen mit Gedenkveranstaltungen zum 27. Januar
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richard von Weizsäcker - "Zum 40. Jahrestag der Beendigung Gewaltherrschaft" (8.5.1985 im Bundestag in Bonn) Das komplette Material
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richard von Weizsäcker - "Zum 40. Jahrestag der Beendigung Gewaltherrschaft" (8.5.1985 im Bundestag in Bonn) Das komplette Material
(Modulbild: 1972 LMZ-BW / Ebling, Ausschnitt aus LMZ603727)
 Modulbeschreibung Schularten: Fächer: Zielgruppen: Autor: Zeitumfang: Werkrealschule/Hauptschule; Realschule; Gymnasium Fächerverbund Welt-Zeit-Gesellschaft (WRS/HS); Geschichte (RS); Geschichte (Gym);
Modulbeschreibung Schularten: Fächer: Zielgruppen: Autor: Zeitumfang: Werkrealschule/Hauptschule; Realschule; Gymnasium Fächerverbund Welt-Zeit-Gesellschaft (WRS/HS); Geschichte (RS); Geschichte (Gym);
Inhaltsverzeichnis. Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10. Nach dem Ersten Weltkrieg: Neue Entwürfe für Staat und Gesellschaft
 Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Bildungsarbeit an den Orten nationalsozialistischen Terrors
 Bildungsarbeit an den Orten nationalsozialistischen Terrors»Erziehung nach, in und über Auschwitz hinaus«bearbeitet von Wolf Ritscher 1. Auflage 2013. Taschenbuch. 474 S. Paperback ISBN 978 3 7799 2884
Bildungsarbeit an den Orten nationalsozialistischen Terrors»Erziehung nach, in und über Auschwitz hinaus«bearbeitet von Wolf Ritscher 1. Auflage 2013. Taschenbuch. 474 S. Paperback ISBN 978 3 7799 2884
I. EINLEITUNG I.1 Fragestellung und Vorgehensweise I.2 Forschungsbericht I.3 Quellenlage... 31
 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS... 5 VORWORT... 11 I. EINLEITUNG... 13 I.1 Fragestellung und Vorgehensweise... 13 I.2 Forschungsbericht... 19 I.3 Quellenlage... 31 II. PROLOG: KIRCHE, BÜRGERTUM,
INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS... 5 VORWORT... 11 I. EINLEITUNG... 13 I.1 Fragestellung und Vorgehensweise... 13 I.2 Forschungsbericht... 19 I.3 Quellenlage... 31 II. PROLOG: KIRCHE, BÜRGERTUM,
Aktiv gegen Antisemitismus. Themenfeld 3. Verfolgung und Widerstand
 Aktiv gegen Antisemitismus Themenfeld 3 Verfolgung und Widerstand in der NS Zeit Überblick Dieses Themenfeld führt in das Thema Verfolgung und Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus ein. Dabei
Aktiv gegen Antisemitismus Themenfeld 3 Verfolgung und Widerstand in der NS Zeit Überblick Dieses Themenfeld führt in das Thema Verfolgung und Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus ein. Dabei
Aufgabe 4. Wie war der holocaust möglich? Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert.
 Aufgabe 4 Wie war der holocaust möglich? Lies dir die folgenden Textkarten aufmerksam durch. Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert. Fasse nach der
Aufgabe 4 Wie war der holocaust möglich? Lies dir die folgenden Textkarten aufmerksam durch. Auf den Karten werden die einzelnen Phasen der Judenverfolgung im Dritten Reich geschildert. Fasse nach der
Vom Alliierten zum Gefangenen Das Schicksal Italienischer Militärinternierter Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin Schöneweide,
 1 Vom Alliierten zum Gefangenen Das Schicksal Italienischer Militärinternierter Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin Schöneweide, 12.09.2013 Grußwort Günter Saathoff, Vorstand der Stiftung EVZ
1 Vom Alliierten zum Gefangenen Das Schicksal Italienischer Militärinternierter Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin Schöneweide, 12.09.2013 Grußwort Günter Saathoff, Vorstand der Stiftung EVZ
Internet-Seite
 Internet-Seite www.havemann-gesellschaft.de Herzlich willkommen auf der Internet-Seite der Robert-Havemann-Gesellschaft: www.havemann-gesellschaft.de. Robert-Havemann-Gesellschaft wird so abgekürzt: RHG.
Internet-Seite www.havemann-gesellschaft.de Herzlich willkommen auf der Internet-Seite der Robert-Havemann-Gesellschaft: www.havemann-gesellschaft.de. Robert-Havemann-Gesellschaft wird so abgekürzt: RHG.
I. Auschwitz Symbol für Kernschmelze unserer Zivilisation. Worum es heute hier im Bayerischen Landtag geht?
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 15.11.2012, 16:30 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Die
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 15.11.2012, 16:30 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Die
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt! Zum 67. Mal stehen wir heute, 66 Jahre nach. gedenken der Zerstörung der Stadt Pforzheim
 Ausführungen Oberbürgermeister Gert Hager anlässlich der Gedenkfeier 23.02.2011 auf dem Hauptfriedhof Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt! Zum 67. Mal stehen wir heute, 66 Jahre nach dem Geschehen 1, an
Ausführungen Oberbürgermeister Gert Hager anlässlich der Gedenkfeier 23.02.2011 auf dem Hauptfriedhof Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt! Zum 67. Mal stehen wir heute, 66 Jahre nach dem Geschehen 1, an
Gedenkveranstaltung im Rathaus für geladene Gäste Grußwort durch Herrn Polizeipräsidenten Andrä 13. März 2018, 19:00 Uhr, Großer Sitzungssaal
 Gedenken an die Deportation der Münchner Sinti und Roma am 13. März 1943 Polizeipräsidium München Polizeipräsident Gedenkveranstaltung im Rathaus für geladene Gäste Grußwort durch Herrn Polizeipräsidenten
Gedenken an die Deportation der Münchner Sinti und Roma am 13. März 1943 Polizeipräsidium München Polizeipräsident Gedenkveranstaltung im Rathaus für geladene Gäste Grußwort durch Herrn Polizeipräsidenten
ANNE FRANK TAG JAHRE TAGEBUCH
 ANNE FRANK TAG 2017 75 JAHRE TAGEBUCH Am 12. Juni ist Anne Franks Geburtstag. Vor 75 Jahren, zu ihrem 13. Geburtstag, hat sie von ihren Eltern ein Tagebuch geschenkt bekommen. Darin schrieb sie ihre Erlebnisse,
ANNE FRANK TAG 2017 75 JAHRE TAGEBUCH Am 12. Juni ist Anne Franks Geburtstag. Vor 75 Jahren, zu ihrem 13. Geburtstag, hat sie von ihren Eltern ein Tagebuch geschenkt bekommen. Darin schrieb sie ihre Erlebnisse,
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig)
 Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
