In Verantwortung vor dem Evangelium
|
|
|
- Renate Lorentz
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2
3 Karin Moskon-Raschick In Verantwortung vor dem Evangelium Gert Leipski Pfarrer und Kommunalpolitiker in Bochum-Werne Luther-Verlag
4 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über abrufbar. ISBN Luther-Verlag, Bielefeld 2016 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt ins besondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung und Satz: Luther-Verlag GmbH, Bielefeld Druck und Bindung: ROSCH-Buch Druckerei GmbH, Scheßlitz Printed in Germany
5 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 9 Wichtiger ist der Mensch! Kindheit und Jugend in Ostpreußen In der Hitlerjugend Reichsarbeitsdienst und Wehrdienst Krieg, Gefangenschaft und Studium Kriegseinsatz Kriegsgefangenschaft Neubeginn Theologiestudium von 1000 Meter unter Tage Verlobung Die Weichen werden gestellt Vikariat Erlaubnis zur Heirat Arbeiterpriester als Vorbild Appelle der Synoden Pastor und Gedingeschlepper Antrag auf Freistellung Beurlaubung oder Entsendung? Arbeit unter Tage Ende des Einsatzes Rückblick und Ausblick: der Erfahrungsbericht Würdigung des Einsatzes
6 Gemeindearbeit im Schatten von Robert Müser Auf Umwegen nach Bochum-Werne Anfänge der Gemeindearbeit Visitation durch den Kirchenkreis Erste Anzeichen für eine Kohlekrise Gemeindezentrum Ludwig-Steil-Haus Parteinahme für die Bergleute Waffelbacken im Ruhr-Park Schwarze Fahnen an der Ruhr Schließung von Robert Müser und die Folgen Nachfolge Christi konkret Ein Wort zum Sonntag Neue Herausforderungen Junge Kollegen Ratsherr der Stadt Bochum Visitation durch den Kirchenkreis Bußtagsbriefe Weltweite Kontakte Wendepunkte Rückschläge und Verluste Abschied aus Bochum-Werne Im Ruhestand Bundesverdienstkreuz In Memoriam Literaturverzeichnis Anmerkungen
7 »Man sagt von alters her, dass das Leben eines jeden Menschen für den Durchschnittsleser interessant und lehrreich wäre, könnte man es gewissenhaft nach erzählen. Die Überzeugung, dass diese Betrachtungsweise voll und ganz der Wahrheit entspricht, hat den Autor dazu bewogen, die Schicksalsschläge, Er ret tungen und Ansichten eines alten Schiffskameraden zu Papier zu bringen, um so der Öffentlichkeit auf verlässliche Weise einige genaue Vorstellungen vom Lebenslauf eines gewöhnlichen Seemanns zu vermitteln.«james Fenimore Cooper 1»Der Einzelne, richtig verstanden, ist eine ganze Welt, die sich nicht ausschöpfen lässt.«rüdiger Safranski 2 7
8
9 Vorwort Der Bochumer Alt-Superintendent Wolfgang Werbeck hielt 1993 einen Vortrag zur Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Bochum- Werne. Gegen Ende seiner Ausführungen erinnerte er an Gert Leipski, den kurz zuvor verstorbenen Pfarrer dieser Gemeinde. Er fügte an:»es ist zu hoffen, daß einmal jemand eine Biographie dieses ungewöhnlichen Mannes schreibt «Ein»ungewöhnlicher«Mensch war Gert Leipski in der Tat. Man kannte ihn in Bochum und Umgebung als unkonventionellen Pastor, als ein flussreichen Ratsherrn der SPD, als Gewerkschaftler und sozial en ga gierten Bürger. Er hatte viel bewegt in seiner Kirchengemeinde, im Stadt teil Werne, aber auch in der Stadt Bochum. Er galt als ein Ori gi nal, war aber keineswegs unumstritten. Man erzählte Anekdoten von ihm, die, je nach dem eigenen Standpunkt, ein Schmunzeln oder ein Kopfschütteln auslösten. Aber mehr noch: Die Lebensgeschichte dieses Mannes ist, bei aller Individualität, signi fikant für seine Generation. An ihr lässt sich ablesen, wie er und seine Zeitgenossen in seinem jeweiligen Lebensumfeld dachten und leb ten, was ihnen wichtig war und worunter sie litten. Er selbst unterlag den Einflüssen der Zeit und wurde von ihnen geprägt. Aber an wichtigen Stationen seines Lebens wird deutlich, dass auch er seiner Zeit einen ganz persönlichen Stempel aufgedrückt hat. Was trieb Gert Leipski an, sich in seinem Lebens- und Berufsumfeld genau so und nicht anders zu verhalten? Was hob ihn aus der Masse heraus und machte seine Originalität aus? Gert Leipski wurde 1926 in Ostpreußen geboren und verstarb 1993 in Bochum. 9
10 Diese Lebensspanne umgreift historisch bedeutende Zeitabschnitte: das Dritte Reich und den 2. Weltkrieg, den Wiederaufbau nach dem Krieg, die Konsolidierung der Gesellschaft im»wirtschaftswunder«und deren Infragestellung durch die»68er«, Strukturveränderungen des Arbeitslebens und des soziologischen Gefüges, kulturelle Verunsicherungen und das Aufbrechen neuer sozialer und wirtschaftlicher Probleme. Gert Leipski hatte an all diesen Entwicklungen Anteil, hat sie erlitten oder als eine Chance genutzt. Jedenfalls ist er mit den jeweiligen Herausforderungen der Zeit aktiv und zumeist gestaltend umgegangen begann er mit dem Vikariat seinen pastoralen Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen ging er als Pfarrer in den Ruhestand. In der evangelischen Kirche waren die ersten Nachkriegsjahre vorwiegend eine Zeit der Vergangenheitsbewältigung und der Selbstvergewisserung. Zerstörte Gebäude sowie kirchliche Strukturen mussten neu aufgebaut werden. Anfang der 50er Jahre wurde der Blick aber verstärkt auf die»welt«gerichtet. Alte, unerledigte Probleme, wie das Verhältnis von Kirche und Arbeiterschaft, wurden wieder aufgenommen und neue kirchliche Aufgaben in einer sich verändernden Welt beschrieben. Es folgte eine Zeit des Wachstums mit vielen Gemeindegliedern und neuen Gemeindegründungen, mit dem Bau von Kirchen und Gemeindezentren und einer Expansion der Anzahl kirchlicher Mitarbeiter auf allen Ebenen. Doch bald schon wurde aus wirtschaftlichen und demografischen Gründen ein Rückbau der kirchlichen Infrastruktur erforderlich. Damit einher ging ein deutlicher Relevanzverlust der evangelischen Kirche in der Gesellschaft. Gert Leipski hat als Pfarrer auf diese kirchlichen Entwicklungsphasen sehr flexibel reagiert, sie beeinflusst und streckenweise, zumindest an seinem Ort, entscheidend geprägt. Als Pfarrer einer Bergarbeitergemeinde im Ruhrgebiet bedeutete das für ihn auch, sich den»weltlichen«pro blemen zu stellen, so z.b. der Bergbaukrise und ihren Folgen. Als Ratsherr der Stadt Bochum übernahm er politische Verantwortung in seiner Stadt. 10
11 Das Leben von Gert Leipski nachzuzeichnen ist gleichzeitig der Versuch, die gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen in den ersten Jahrzehnten nach Ende des 2. Weltkriegs in Erinnerung zu behalten, zumindest soweit sie sein Lebensumfeld im Ruhrgebiet betreffen. Diese Zeit liegt noch nicht sehr fern, droht aber in Vergessenheit zu geraten. Durch Biografien ist sie bisher nur ansatzweise aufgearbeitet worden, obwohl noch viele Zeitzeugen leben, die über das Vergangene Auskunft geben können. Ich danke sehr herzlich denen, die sich als Zeitzeugen an Gert Leipski erinnert haben und mir davon erzählten, ehemalige Amtsbrüder, Gemeindeglieder aus Bochum-Werne, kirchliche Weggenossen. Be son ders dankbar bin ich Superintendent i.r. Helmut Disselbeck, der mir zusätzlich zu seinen Erinnerungen umfangreiches Quellenmaterial zur Verfügung gestellt hat. Ich danke Dr. Jens Murken vom Lan des kirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen für die Erschließung des dortigen Archivmaterials und für manchen guten Rat. Ute Leipski hat mir sehr hilfsbereit Daten und Fakten zum Kriegseinsatz und zur Gefangenschaft ihres Vaters zugänglich gemacht. Viele andere, die hier nicht einzeln genannt werden können, haben freundlich und entgegenkommend dazu beigetragen, das Lebensbild abzurunden. Mein Dank gilt der Evangelischen Kirche von Westfalen und dem Evange lischen Kirchenkreis Bochum für freundliche Unterstützung bei den Druckkosten. Diese Arbeit wäre nicht zustande gekommen ohne meinen Ehemann, Gerd Raschick. Fast zwei Jahrzehnte war er Gemeindeglied im Pfarrbezirk Leipskis in Bochum-Werne. Durch seine Erzählungen aus dieser Zeit entstand das Interesse an der Person Gert Leipski und dann auch an seiner Biografie. Bielefeld, im Dezember 2015 Karin Moskon-Raschick 11
12
13 Wichtiger ist der Mensch!»Gesucht wird ein Mensch, der einen anderen Menschen nicht nur von den Paragraphen her sieht, sondern als Menschen! Es ist gut, daß wir in einem geordneten Staatswesen leben. Wenn der Mensch aber nur durch die Paragraphenbrille gesehen wird, ist die Gefahr groß. Darum suche ich einen Menschen, der bereit ist, über die Paragraphen hinweg den Menschen zu sehen, der mehr tut, als es die Vorschriften be sagen, der das Schicksal eines Menschen vom Worte Christi her begreift: Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan!«3 Diesen Aufruf richtet Pfarrer Gert Leipski aus Bochum-Werne in einem»wort zum Sonntag«an die Leser einer Bochumer Tageszeitung. Es ist die Zeit der Kohlekrise in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Menschen im Ruhrgebiet sind verunsichert. Was wird aus dem Kohlebergbau und damit aus ihrer Existenzgrundlage? Kleinere Zechen existieren schon nicht mehr, die Schließung größerer Schachtanlagen steht bevor. In Bochum-Werne ist die zentrale Zeche Robert Müser mit 4000 Beschäftigten betroffen. Als sich ab Sommer 1966 erste Gerüchte einer be vor stehenden Schließung dieser Schachtanlage verdichten, schreibt Leip ski einen Offenen Brief, ebenfalls als»wort zum Sonntag«, an den da maligen nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Kienbaum. Er for dert ihn auf, die Sorgen der Bergarbeiter und ihre existenzielle Verun sicherung ernst zu nehmen und ihnen klare und verlässliche Auskunft über die geplanten Maßnahmen zu geben. 4 Ende März 1968 wird die Schachtanlage geschlossen. Schon im Vorfeld ist Pfarrer Leipski an den Verhandlungen über den Sozialplan für Robert Müser beteiligt. Er nutzt die örtliche und überörtliche Presse, um auf das Schicksal der Bergarbeiter aufmerksam zu machen. 5 Er beeinflusst 13
14 Stel lungnahmen der westfälischen Landeskirche zur Bergbaukrise. Er beteiligt sich an unterstützenden Strukturmaßnahmen. In seiner Kir chengemeinde stellt er Räume für Umschulungen zur Verfügung. Im engen Kontakt zu den Menschen seiner Gemeinde muss er jedoch feststellen, dass trotz aller hilfreichen Gesetze, Regelungen und Paragraphen immer wieder Einzelne und ganze Gruppen der Bergarbeiter unzumutbar benachteiligt oder in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz gefährdet werden. Ihnen gilt sein besonderes Augenmerk und sein Engagement. Für sie wendet er sich unermüdlich und bisweilen aufdringlich an Minister des Landes und des Bundes, an die Vorsitzenden von Parteien und Gewerkschaft, an Direktoren und Vorstandsvorsitzende der Bergbaugesellschaft. Für seine Bergarbeiter kämpft er und oftmals mit Erfolg. Was ihn antreibt, das ist ein Wort Christi aus dem Matthäus-Evangelium:»Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan!«(matthäus 25,40). Mit diesem Wort will er auch andere in die Pflicht nehmen, das Leid des einzelnen bedrängten Menschen wahrzunehmen und sich um ihn zu kümmern. Als Pfarrer Leipski sich 1990 in den Ruhestand verabschiedet, wird er ganz unterschiedlich charakterisiert. Er wird als»streitbarer Politpastor «6 bezeichnet, als»soziales Gewissen der Kirche«7 gewürdigt und als ein Mensch beschrieben, den eine»tief geprägte Frömmigkeit«8 auszeichnet. Wer aber war Gert Leipski und wie wurde er zu dem Menschen, den seine Zeitgenossen so unterschiedlich erlebten? 14
15 Kindheit und Jugend in Ostpreußen Gerhard Ernst Friedrich Michael (Gert) Leipski wurde am 1. Oktober 1926 in Guttstadt (Ermland/Ostpreußen), dem heutigen Dobre Miasto, geboren. Er war das einzige Kind des Schuhmachers Ernst Leipski und seiner Ehefrau Wilhelmine, geb. Adamy. Die Mutter stammte»aus bäuer lichen Kreisen Masurens«. 9 Die Familie gehörte zur protestantischen Minderheit der ostpreußischen Kleinstadt, und so wurde der Sohn am in der Evangelischen Pfarrkirche zu Guttstadt getauft. 10 Der Vater, der als Soldat im 1. Weltkrieg verwundet worden war, hat später in diesem Städtchen ein Schreibwarengeschäft betrieben. Deutschland war im Geburtsjahr Gert Leipskis, acht Jahre nach dem Ende des 1. Weltkriegs, ein nach innen und außen instabiles Land. Ostpreußen war durch den Polnischen Korridor vom deutschen Kernland getrennt. Grenzgebiete standen noch unter Besatzung. Die vielen Parteien im Reichstag fanden nicht zu tragfähigen Koalitionen und konnten die junge Demokratie nicht ausreichend festigen. Seit 1925 war von Hindenburg Reichspräsident gab es mehrere Regierungskrisen und Kabinettsumbildungen. Das rechte wie das linke Lager radikalisierten sich und verhinderten solide, von großen Mehrheiten getragene Entscheidungen. Etliche europäische Staaten, die UdSSR, Italien, Spanien u.a., wurden diktatorisch regiert und stellten die Demokratie als Regierungsmodell in Frage. Im Mai 1926 putschte im benachbarten Polen das Militär und brachte Pilsudski an die Macht. Wirtschaftlich litt Deutschland stark unter den Kriegsfolgen, un ter Besatzung und Reparationen. Im Februar 1926 gab es 2,4 Mill. Ar beits lose. Durch ein umfangreiches Arbeitsbeschaffungsprogramm wurde die Zahl bis zum Oktober auf 1,24 Mill. reduziert
16 In der Außenpolitik sah man noch am ehesten Schritte hin zu einer Konsolidierung. Die letzten französischen und belgischen Truppen ver lie ßen Anfang 1926 die Kölner Zone. Vor allem im Rheinland gab es daraufhin zahl reiche»befreiungsfeiern«. Die»Erzfeinde«Deutschland und Frankreich vereinbarten ein Handelsabkommen, und die Außen mi nis ter beider Länder, Aristide Briand und Gustav Stresemann, erhielten 1926 den Friedens nobelpreis. Nach Osten hin sorgte der im April 1926 geschlossene Freund schaftsvertrag mit der UdSSR für relative Ent spannung. Im September wurde Deutschland in den Völkerbund aufgenommen.»als einziges Kind verlebte ich bis zum Schulanfang frohe Kinder jahre «12 Gert Leipski wird in seiner Kindheit von diesen unsicheren Zeiten wenig gespürt haben. Er wuchs umsorgt und behütet auf. Zeitlebens hatte er eine innige Beziehung zu seinen Eltern, besonders zur Mutter. Bei ihr lernte er eine tiefe, schlichte Frömmigkeit kennen, die ihn wohl nachhaltiger prägte, als es ihm in jungen Jahren bewusst wurde. Sein enges Verhältnis zu den Eltern fand in den Nachkriegsjahren Ausdruck in seiner liebevollen Fürsorge für sie. Er selbst führte diese Bindung darauf zurück, dass er schon mit 13 Jahren das Elternhaus verlassen musste, um die Oberschule in Allenstein zu besuchen. Die Oberschule in Guttstadt, die er ab 1937 besucht hatte, war in eine Mittelschule umgewandelt worden, was den Schulwechsel in die nächstgrößere Stadt notwendig machte.»als echtes Kind Ostpreußens waren die Wälder und Seen meine Welt.«13 Man muss sich die Kinderzeit Gert Leipskis nicht zwingend so vorstellen, wie der ebenfalls 1926 in Ostpreußen geborene Siegfried Lenz seine Kindheit in Masuren literarisch verklärt in»so zärtlich war Suleyken«schildert. Dennoch deuten seine Erinnerungen darauf hin, dass er die Freiheit in der Natur genossen hat und vielleicht auch Begegnungen mit urtümlichen, originellen Menschen hatte. Aber in seinem Rückblick klingt auch Trauer mit, nicht klischeehaft über eine verlorene Kindheit, sondern ganz existentiell über die verlorene Heimat. 16
17 In der Hitlerjugend»Weil ich als richtiger Junge Lust an Spiel und Sport hatte, fand ich schon früh den Anschluß an die HJ.«14 Nicht gerade zum Wohlgefallen seiner Mutter, die ihn»zu Christus hinführen wollte«15, aber mit einer gewissen Zwangsläufigkeit geriet der junge Gert Leipski unter den Einfluss der nationalsozialistischen Welt anschauung und ihrer Organisationen. Ab 1933 setzte die Hitler-Jugend (HJ), die Nachwuchsorganisation der NSDAP, ihren Anspruch um, die einzige und alle Kinder und Jugend lichen erfassende Jugendorganisation in Deutschland zu sein. Die Mäd chen wurden im»bund Deutscher Mädel«(BDM) erfasst, die 10 bis 14-jährigen Jungen gehörten als»pimpfe«zum»jungvolk«und ab 14 Jah ren dann zur HJ. Es gab keinen direkten Zwang zur Mitgliedschaft, aber einen starken indirekten Druck in der Schule, durch Gleichaltrige oder auch durch ältere organisierte Hitlerjungen, die solche, die nicht mitmachten, gezielt verprügelten oder auf andere Weise schikanierten. Die meisten Kinder dürften jedoch freiwillig und gerne in den Jugendgruppen mitgemacht haben. Der Bochumer Hannes Bienert, geb. 1928, schildert seine Erlebnisse in der HJ in Königsberg so:»natürlich waren wir alle uniformiert Wir hatten dunkelblaue Kniehosen, das Braunhemd, so wie die Nazis das trugen dann einen Knoten aus Leder, da musste ich den Schlips durchziehen Man hatte noch einen Schulterriemen und einen Köppel, ein Schloss mit einem breiten Ring, darauf war das Hakenkreuz. Das war die Uniform. Ab HJ war jeder dann schon gekennzeichnet. Wir hatten eine Armbinde mit dem Hakenkreuz Wenn man mit Uniform in die Schule musste, kontrollierte der Lehrer, der auch organisiert war, erst einmal die Schulklasse 17
18 Regelmäßig gab es natürlich für uns in der Hitlerjugend zwei Mal in der Wo che Dienst. Am Mittwoch hatten wir Heimdienst und am Freitag hatten wir län ger Dienst, weil samstags nur ein halber Tag Schule war. Am Heimabend be ka men wir politischen Unterricht (Dazu) gehörte auch die Judenhetze Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht es uns noch mal so gut!, das war der Standard-Song bei diesen Heimabenden, wenn Ju den hetze war Wenn wir den Heimabend hatten, quatschten wir vorher im Chor so eine Art Gelöbnis herunter Hitlerjungen sind zäh wie Leder, flink wie die Windhunde und hart wie Kruppstahl! Das mussten wir richtig brüllen Ein Hitlerjunge weint nicht, ein Hitlerjunge ist nicht schwach und ein Hitlerjunge, ein echter Hitlerjunge übernimmt immer die Führung, versucht immer das Beste, das Maximum heraus zu holen.«16 So ähnlich wie der zwei Jahre jüngere Hannes Bienert in Königsberg wird auch Gert Leipski in Guttstadt und Allenstein die HJ erlebt haben. Außer der weltanschaulichen Indoktrination auf den Heimabenden standen an Freitagen und Wochenenden auch sportliche Veranstaltungen, Mut proben, Wanderungen, Abende am Lagerfeuer und anderes auf dem Pro gramm. Später kam eine paramilitärische Ausbildung hinzu. Das diente der körperlichen Ertüchtigung, sollte den Bewegungsdrang der Jungen in Bahnen lenken, sie an hierarchische Strukturen mit Befehl und Gehorsam gewöhnen, ihren Kampfgeist stärken und sie auf ihre späteren militärischen Aufgaben vorbereiten. Für einen abenteuerlustigen Jungen wie Gert Leipski, der ohne Geschwister aufgewachsen war, tat sich in der Gemeinschaft der HJ eine ganz neue Welt auf. Hier gehörte er dazu, hier konnte er sich beweisen und seine Leis tungsfähigkeit testen. Offenbar gingen bei der ideologischen Beeinflus sung der Kinder HJ und Schule Hand in Hand, denn er erinnert sich:»durch den Geschichtsunterricht ist mein Interesse für nationale und weltanschauliche Fragen früh geweckt worden. So kam es, daß ich mir dann im Laufe der Zeit die nationalsozialistische Weltanschauung zueigen machte Mein höchstes Ideal war das Volk und der Staat.«17 18
19 Reichsarbeitsdienst und Wehrdienst Bei dieser intensiven nationalsozialistischen Prägung in Kindheit und Ju gend, die seit Kriegsbeginn 1939 noch militaristischer geworden sein dürfte, verwundert es nicht, dass Gert Leipski anfällig geworden war für die Kriegspropaganda. Den Jungen wurden Abenteuer versprochen, Kame rad schaft, Bewährung im Kampf und Heldentum. Dafür verlangte man von ihnen ganzen persönlichen Einsatz, Unterordnung und Gehor sam und harte Arbeit unter gefährlichen Bedingungen. Der Reichsarbeits dienst (RAD), der der Einberufung zum Wehrdienst unmittelbar vorausging, bot, besonders seit Ausbruch des Krieges, eine Vorbereitung dafür. Seit 1942 wurden die jungen Männer bevorzugt kriegsnah als halb militärische Kampftruppe eingesetzt. In ihren Reihen wurde gezielt für einen späteren Einsatz bei der Waffen-SS geworben. Mit dem November 1943 begann für Gert Leipski, der gerade 17 Jahre alt geworden war, sein viermonatiger Reichsarbeitsdienst. Da nach wurde er, wie viele Jungen seines Alters,»als Freiwilliger zur Waffen SS einberufen«. 18 Es folgte eine etwa halbjährige militärische Grund aus bildung. Er dürfte seinem Kriegseinsatz entgegengefiebert haben und war stolz darauf, bei den richtigen Soldaten mitzumachen, bei denen, die die nationalsozialistische Kriegspropaganda dem Jungen jahrelang als nationale Helden vor Augen gestellt hatte.» dort sah ich den Platz, um für meine Ideale einzustehen«. 19 Um für seine Ideale einzustehen, scheute Gert Leipski nicht den Einsatz seines Lebens. Er stand bereit. Was er für richtig erkannt hatte, das vertrat er mit seiner ganzen Existenz und im Blick auf die eigene Person ohne Rücksicht auf Verluste. Er begnügte sich nicht mit Worten und Parolen, für ihn zählten Taten. In dieser Entschiedenheit und Bereitschaft zum Handeln zeigte sich schon in jungen Jahren ein Charak ter zug, der, jedoch unter völlig anderen Vorzeichen, auch sein späteres Leben prägen sollte. 19
20
21 Krieg, Gefangenschaft und Studium Wie viele Männer, die am Krieg teilgenommen haben und in Kriegsgefangenschaft geraten sind, hat auch Gert Leipski später nur wenig über seine Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Zeit erzählt. Was darüber bekannt geworden ist, basiert auf einer knappen Schilderung der Fakten in einem Lebenslauf, den er im Juli 1949 geschrieben hat, und auf einigen wenigen Dokumenten bei der Deutschen Dienststelle (WASt) in Berlin. Es ist aber zu vermuten, dass die Kriegserlebnisse und die Erfahrungen in der Gefangenschaft für ihn traumatisch waren. Kriegseinsatz Nach der militärischen Grundausbildung wurde der junge Soldat an die Westfront verlegt. Die Stationen seines Einsatzes, die er selber nennt Arnheim, Aachen, Straßburg 20 markieren entscheidende und verlustreiche Kämpfe des letzten Kriegsjahres im Westen. Gert Leipski war dem SS-Panzergrenadier Ausbildungs- und Ersatzbataillon 10 zugeteilt worden. 21 Die 10. SS-Panzerdivision Frundsberg, zu der sein Bataillon gehörte, war ab Mitte September 1944 daran beteiligt, den Vormarsch der Alliierten im Rahmen der Operation Market Garden aufzuhalten. Beson ders heftig umkämpft war die Rheinbrücke bei Arnheim. Freunden hat er später erzählt, dass er an den schweren Kämpfen um die Brücke von Arnheim unmittelbar beteiligt war und großes Glück hatte, lebend davongekommen zu sein. 22 Am 1. Oktober 1944 wurde Gert Leipski 18 Jahre alt. 21
22 Truppenteile der Waffen-SS 23, die bei Arnheim im Einsatz waren, wurden im Oktober in die Gegend um Aachen verlegt und waren an der Schlacht um Aachen beteiligt. Aachen kapitulierte am 21. Oktober Nördlich von Aachen, bei Linnich, fanden zwischen dem 22. November und 6. Dezember 1944 Kämpfe an der Rurfront statt, auch hier mit Unterstützung der 10. SS-Panzer-Division Frundsberg. Mit Beginn des Winters 1944/45 startete die Ardennen-Offensive. Kampf gruppen, die aus Aachen abgezogen worden waren, bildeten zunächst eine Reserve für die an den Ardennenkämpfen beteiligte 6. Panzer armee, bevor sie im Januar und Februar 1945 bei dem Unternehmen Nordwind im Nordelsass wiederum an Kampfhandlungen teilnahmen. Besonders hart umkämpft war hier der Brückenkopf bei Gambsheim, nördlich von Straßburg. Die Angriffe bei Gambsheim und Ende Januar bei Hagenau blieben im feindlichen Abwehrfeuer stecken. Ab Februar 1945 wurden die Kampfgruppen von diesem Teil der Westfront abgezogen. Gert Leipski war Ende Februar für einige Wochen zu einem Lehrgang in Böhmen geschickt worden, wahrscheinlich eine Zeit der Erholung und Entspannung, die er bitter nötig hatte. Im April 1945 kam er erneut an die Front, diesmal mit der 710. Infanterie Division in Oberösterreich. Reste dieser Division gingen in den ersten Maitagen im Raum Steyr in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Kriegsgefangenschaft Leipski gibt an, dass er am 8. Mai 1945 im Raum Linz in amerikanische Gefangenschaft kam. Er hatte zu der Zeit den Dienstgrad Sturmmann. Das war ein Mannschaftsrang in der Waffen-SS, der dem Gefreiten im Heer entsprach. Er kam zunächst ins Kriegsgefangenenlager Lambach in der Nähe von Steyr. 22
23 »Das Lager Lambach, auf einer großen Wiese am linken Traunufer unterhalb des Bahnhofes gelegen, hatte keine Gebäude. In größeren und kleineren Zelten bis zum Einmannzelt sowie in Blech- und Pappbehausungen lebten zeitweise über Menschen dort. Sanitäre Anlagen fehlten oder waren primitivst. Es gab aufbereitetes Wasser. Beim Eingang wurden an langen Tischen die Personalien aufgenommen. Jedem wurde DDT in großen Mengen in den Halsausschnitt, den Hosenbund und in die Hemdsärmel gegen Läuse und Ungeziefer eingeblasen. SS-Angehörige wurden sogleich nach Erkennung in ein Sonderlager etwa einen Kilometer östlich von Lambach neben der Bundesstraße I oder in Aich kirchen bei Lambach abgesondert.«24 Die Blutgruppentätowierung an der Innenseite des linken Oberarms wies Gert Leipski als Mitglied der Waffen-SS aus. Später hat er einem Freund erzählt, die Tätowierung habe»mal jemand entfernt«, 25 wann genau ist unklar. Aber die Narbe jedenfalls blieb und war noch lange eindeutig zu identifizieren. In Lambach verlebte er seinen 19. Geburtstag und blieb dort bis gegen Ende Oktober Dann wurde er nach Deutschland verlegt, in das ame rikanische Kriegsgefangenenlager Babenhausen in der Nähe von Darm stadt. Ein etwa gleichaltriger Mitgefangener erinnert sich:»mitte Oktober wurden wir aus Österreich verlegt und in Viehwaggons mit jeweils 40 Mann, ohne Toilette und Verpflegung, ins Kriegsgefangenenlager Babenhausen bei Darmstadt gebracht. Zum Glück dauerte diese Fahrt nur zwei Tage. Dort wurden wir aussortiert. Alle Gefangenen unter 21 Jahren kamen in ein separates Lager für Jugendliche, aber alles nur Männer der Waffen-SS. Da wir alle stark abgemagert waren, sollten wir eine etwas bessere Verpflegung bekommen. Tatsächlich bekamen wir ab diesem Zeitpunkt täglich zum Frühstück einen Schlag süße Kekssuppe zusätzlich. Wir lagen in US-Mannschaftszelten, ohne Boden auf der blanken Erde, darüber lediglich eine Lage Stroh. Darauf legten wir unsere Zeltplane, als Kopfkissen benutzten wir den Tornister oder den Wäschebeutel. Ich hatte 23
24 außerdem eine Decke dabei. In jedem Zelt waren 26 Mann untergebracht. Nachts hatten wir eine Birne als Beleuchtung, welche die ganze Nacht brannte. Heizung hatten wir keine. Zum Waschen stand ein Waschzelt bereit, aber nur mit kaltem Wasser.«26 Als die Amerikaner Zug um Zug die Kriegsgefangenenlager in ihrer Besatzungszone auflösten, wurde Gert Leipski im Februar 1946 zu sam men mit anderen Gefangenen den Franzosen überstellt. Sie wurden nach Südfrankreich in das Lager Castre, östlich von Toulouse, im Lan guedoc transportiert. Das Gebiet um die Stadt Castre herum war land wirtschaftlich geprägt, und so wurden die Kriegsgefangenen u.a. zur Mitarbeit bei den Bauern, dem sog. Bauernkommando eingesetzt. Bei dieser Arbeit erlitt er am , wenige Tage nach seinem 20. Geburtstag, bei einem Unfall eine Verletzung mit erheblichen Auswirkungen. 27 Durch den Hufschlag eines Pferdes wurde sein Unterkiefer gebrochen. Er war kurzzeitig bewusstlos. Zunächst wurde die Wunde an der rechten Gesichtshälfte genäht, aber Entzündungen im Kieferbereich erforderten eine chirurgische Weiterbehandlung. So wurde er zwei Wochen später in das Kriegsgefangenen-Lazarett Castelsarrasin nordöstlich von Toulouse verlegt. Die Behandlung dort dauerte mehrere Monate und der Heilungsprozess war sehr langwierig, was ihm wohl für längere Zeit die sprachliche Artikulation erschwerte. Als er so weit genesen war, dass nur noch die Zahnbehandlung durchgeführt werden musste, wurde er in das Kriegsgefangenen-Lazarett Weis - sen au, nördlich des Bodensees in der französisch besetzten Zone über - stellt. Dort traf er am 25. Juli 1947 ein. Wegen»Materialmangels«konn te man ihm dort aber auch nicht weiterhelfen und entließ ihn am 2. September 1947 kurzerhand ganz aus der Kriegsgefangenschaft. In sei ner Erinnerung behielt der sicherlich schmerzhafte Unglücksfall darum immer eine positive Seite: Er führte zu einem relativ schnellen Ende seiner Gefangenschaft. 24
25 Krankenblatt aus dem Kriegsgefangenen-Lazarett Castelsarrasin. Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin. Neubeginn Seit seiner Einberufung zum Reichsarbeitsdienst waren knapp vier Jahre vergangen. Die einstigen Ideale waren untergegangen im Elend von Krieg und Gefangenschaft. Auch körperlich behielt er Narben zurück. Aber er war noch jung, seine Tatkraft war ungebrochen, und mit seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft öffnete sich für ihn das Tor in die Zukunft. Doch wohin sollte er entlassen werden? Seine Heimatstadt Guttstadt gehörte inzwischen zu Polen. Seine Eltern waren nach Berlin geflüchtet und hatten die Absicht in den Westen umzusiedeln. Verwandte in Wattenscheid waren darum für ihn eine erste Anlaufstelle. So kam er ins Ruhrgebiet, in eine Region, die vom Bergbau und von der Stahlindustrie geprägt war. Mit Elan ging er daran, seine Zukunft zu organisieren und in geregelte Bahnen zu leiten. 25
26 »Im Okt. 47 trat ich in die Prima der hiesigen Oberschule ein, um das Abitur nachzumachen.«28 Die Reifeprüfung bestand er im Februar Zwischenzeitlich war es ihm gelungen, ein Zimmer zugewiesen zu bekommen und die Zuzugsgenehmigung für die Eltern zu erhalten. Seit Ende 1948 war die Familie wieder vereint und wohnte zusammen, und zwar in Wattenscheid-Günnigfeld. Der Vater, 62 Jahre alt und krank, bekam keine Arbeit. Er erhielt Unterstützung vom Arbeitsamt und vom Soforthilfeamt. Den Verlust der Heimat konnte er nur schwer verwinden und lebte sich in der neuen, völlig anderen Umgebung nicht mehr richtig ein. Am 4. Februar 1953 verstarb er ganz plötzlich an einem Herzschlag. Der Sohn, der studieren wollte, konnte nicht auf finanzielle Unter stützung durch seine Eltern rechnen. Schon während der Oberschulzeit hatte er auf der Zeche Hannover in Bochum-Hordel als Lehrhauer gearbeitet. So suchte er sich gleich nach dem Abitur wieder Arbeit auf einer Zeche. Auch während des Studiums und in fast allen Semesterferien leistete er Werksarbeit auf einer Zeche oder in einem Stahlwerk am Ofen bzw. in der Gussgrube. Mit dem Verdienst, etwa 300,- DM pro Monat, sicherte er in den nächsten zwei Jahren seinen eigenen Lebensunterhalt und unterstützte davon auch seine Eltern. Theologiestudium von 1000 Meter unter Tage Mit dem Sommersemester 1949 begann Gert Leipski ein Studium der Theo logie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal mit dem Ziel, Pfarrer zu werden. Wie war es zu diesem Berufswunsch gekommen? Er selber schildert den Umbruch in seinem Leben, die Abwendung von der na tio- 26
27 nalsozialistischen Ideologie und die Hinwendung zum christlichen Glau - ben so:»das Ende des Krieges hatte mich nicht nur heimatlos gemacht, sondern hatte auch meine Weltanschauung zerbrochen. Die Fragen in mir nach dem Warum und Weshalb forderten Antwort. In vielen Mußestunden war Zeit, darüber nachzudenken. Jetzt wurde die Erinnerung an meine Mutter mit ihrem Glauben wach. Ich hatte plötzlich sehende Augen. Je mehr ich darüber nachdachte, um so klarer wurden mir die Antworten. Von da ab war Jesus Christus in mir immer lebendiger. Und weil es mich nicht mehr losgelassen hat, deshalb studiere ich jetzt Theologie, um später die frohe Botschaft zu verkündigen.«29 Nach dem Ende des Krieges haben viele junge Männer aufgrund ihrer Erfahrungen im Krieg und in Gefangenschaft den christlichen Glauben für sich entdeckt und ein Theologiestudium aufgenommen. Nicht alle konnten dabei, wie Gert Leipski an Kindheitserfahrungen mit einer frommen Mutter anknüpfen. Aber trotz dieses Anknüpfungspunktes muss die Kehrtwendung in seinem Leben radikal gewesen sein. Er wollte nicht mehr dem Tod dienen, sondern dem Leben, nicht Menschenleben zerstören, sondern helfen und heilen. In diese Richtung weist auch eine Bemerkung, die er einige Jahre später in einem Zeitungsinterview machte:»eigentlich wollte ich Arzt werden, aber bei einem religiösen Vortrag in der Gefangenschaft traf es mich und ich wurde dann Pastor.«30 Diese Motivation, nun nicht als Arzt, sondern als Pastor sich für den einzelnen Menschen einzusetzen und alles zu fördern, was dem Leben dienlich ist, war so tief verankert, dass sie sein weiteres Leben und Wirken entscheidend bestimmte. Die Aufnahme des Studiums hat Gert Leipski, vor allem angesichts sei ner finanziellen Situation, als Wagnis empfunden. Die ersten Semester waren dem Erlernen des Griechischen und Hebräischen gewidmet. Ler nen 27
28 im Semester und Werksarbeit in den Semesterferien wechselten sich ab. Das war belastend, gelang ihm aber insgesamt besser, als er ge dacht hatte. Rückblickend konnte er mit einem Augenzwinkern und wohl auch mit Stolz sagen:»ich habe von 1000 Meter unter Tage aus Theo lo gie studiert.«31 Seine wirtschaftliche Lage besserte sich, als er ab dem 4. Semester wegen der 28 Monate in Kriegsgefangenschaft eine Heim kehrerhilfe erhielt. 32 Gert Leipski hat mit Fleiß studiert. Da er kaum theologische oder auch nur biblische Vorkenntnisse mitbrachte, musste er viel lernen. Pfarramtliche Voten aus dieser Zeit attestieren ihm Fleiß und Zielstrebigkeit und großes Bemühen, sich auf den Pfarrberuf vorzubereiten. Außerdem sei er»von zäher Gesundheit und energisch veranlagt«. 33 Nachdem Graecum und Hebraicum erfolgreich abgelegt waren, traten die Inhalte des Theologiestudiums stärker in den Vordergrund. Noch in Wuppertal wurde ihm durch Lic. Hans Walter Wolff das Alte Testament nahegebracht. Besonders die Propheten beeindruckten ihn. Ihre soziale Botschaft empfand er als hoch aktuell. Später hat er eine Seminararbeit verfasst zum Thema»Die soziale Schichtung des Volkes Israel nach dem Deuteronomium, wie sie ist und wie sie sein soll«. 34 Bei der Werksarbeit in den Semesterferien lernte er die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Arbeiter im Bergbau und in der Stahlindustrie kennen. Er hatte Kontakt zu Gewerkschaftlern und kommunistischen Kumpels. Diese Eindrücke brachte er mit ins Studium und suchte nach Antworten auf die ihn bedrängenden Fragen nach sozialer Gerechtigkeit. Die Botschaft der Propheten, wohl auch ihr unerschrockenes Auftreten und ihr energisches Eintreten für die Rechte der Armen und Unterdrückten, waren eine biblische Antwort. Aber er las auch in einem klei nen Kreis der Studentengemeinde Texte von Stalin und Lenin. Er dis ku tierte die Frage der Wiederaufrüstung Deutschlands, besuchte politische Ver sammlungen, so wie ein Seminar zum Thema»Christentum und Mar xis mus«. Die soziale Problematik, die er so hautnah erlebte, ließ ihn nicht los, und die Beschäftigung damit machte einen inhaltlichen Schwer punkt seines Theologiestudiums aus. 28
29 An den Universitäten Tübingen und Münster, wo er, nach drei Semestern in Wuppertal, weitere sechs Semester verbrachte, kam noch ein ganz anderes, aber auch existenziell berührendes Interessengebiet hinzu. Mit Kommi li tonen zusammen suchte er nach verbindlichen Formen geist li chen Lebens. Er kannte wohl eine Praxis persönlicher Frömmigkeit, hat te aber nie in einer wie auch immer gearteten geistlichen Gemeinschaft gelebt. In seiner damaligen Heimatgemeinde Wattenscheid hatte er einen guten Kontakt zu seinem Gemeindepastor, der sich offenbar intensiv um ihn, wie auch um andere Theologiestudenten der Gemeinde kümmerte. Durch ihn lernte er auch»sorgen und Nöte«35 einer Kirchengemeinde kennen. Er half mit im Kindergottesdienst und bei Veranstaltungen für die männliche Jugend. Auf der Zeche war die Tatsache, dass er als Theologiestudent dort arbeitete, häufig ein Anlass für mehr oder weniger freundliche Bemer kungen der Kollegen. Er hat sie als Gesprächseinstieg und wohl auch als missio narische Gelegenheit genutzt und z.b.»in großer Zahl«36 Predigten des Essener Jugendpfarrers Wilhelm Busch verteilt. An der Universität nun suchte er nach geistlicher Gemeinschaft. Die Studentengemeinde, in der er zwei Semester lang mitarbeitete, be friedig te seine Bedürfnisse in dieser Hinsicht nicht. In Münster fand er dann Gleichgesinnte im Christlichen Studenten Verein, einer Nach folge organisation der Studentischen Arbeitsgemeinschaft im CVJM. Dort wur den zeitgemäße spirituelle Formen erprobt. Parallel dazu besuchte er Vor lesungen und Seminare zum Thema»der christlichen Bruderschaft«, zum»verhältnis von Gesetz und Evangelium (Heiligung)«und zum Gebet 37. Geistliche Bruderschaft und Formen spiritueller Gemeinschaft blie ben viele Jahre wichtige Themen für ihn. Eine beständige und tra gende geist liche Gemeinschaft hat er nie gefunden. Die Frage nach verbindlicher, christlicher Lebensgestaltung, theologisch ge sprochen nach Heiligung, ließ ihn das ganze Leben lang nicht los. Die Glaub würdigkeit seiner Verkündigung sollte durch die ent sprechen den Ta ten unterstrichen werden. Er wollte nicht nur reden, sondern 29
30 han deln, und das mit ganzem persönlichen Einsatz. Es lag sicher auch an seiner cha rakterlichen Veranlagung, dass er hier einen theologischen Schwer punkt setzte. Er eignete sich nicht zum Theoretiker, Gert Leipski war ein Prak tiker. Im Hinblick auf die evangelische Theologie war die Zeit seines Studiums eine unruhige Zeit. Vieles war im Umbruch. Die Auseinandersetzungen an den theologischen Fakultäten, etwa um Rudolf Bultmanns Programm der Entmythologisierung oder um die Methoden der historisch-kritischen Bibelauslegung, haben ihn zwar am Rande gestreift, aber nicht im Kern berührt. 38 Verlobung Ein besonderes persönliches Ereignis fiel noch in die Studienzeit: Am 1. Oktober 1950, zu Beginn seines vierten Semesters, das ihn aus dem Umfeld des Ruhrgebietes weg nach Tübingen führte, verlobte er sich mit Ruth Sadzio. Ruth stammte aus einer Bergarbeiterfamilie in Wattenscheid- Günnigfeld. Nach Rückkehr aus der Gefangenschaft 1947 hatte Gert Leipski bei ihren Eltern Aufnahme gefunden, so kannten sich beide also schon mehrere Jahre. Ruth war etwa eineinhalb Jahre jünger als Gert und Friseurin von Beruf. Dieser Umstand sollte später, als sie heiraten wollten, noch zu besorgten Nachfragen seitens des Landeskirchenamtes führen. Während des Studiums war jedoch an eine Heirat noch nicht zu denken. Jetzt aber war es wohl beiden wichtig, ihre Beziehung öffentlich und verbindlich zu machen, bevor Gert sein Studium weit entfernt in Süddeutschland fortsetzte. 30
31 Die Weichen werden gestellt Vikariat Im März 1954 legte Gert Leipski sein Erstes Theologisches Examen bei der Evangelischen Kirche von Westfalen ab. Er erhielt die Gesamtnote»gut«. Sein Vikariat begann am 1. Mai Für ein Jahr wurde er zu Pfarrer Egert eingewiesen, in die Evangelische Kirchengemeinde Dortmund- Eichlinghofen. Seine Mitarbeit in der Gemeinde wurde offenbar dringend gebraucht, denn laut Vikariatsbericht wurde er dort keineswegs geschont. Er hielt in dieser Zeit 26 Gottesdienste, für die er 24 neue Predigten anfertigte, und zwei Passionsandachten. Er hat 16 Kindergottesdienste vor bereitet und geleitet, an den übrigen Sonntagen als Helfer in der Katechumenengruppe mitgewirkt. Neun Beerdigungen musste er durchführen, und seit Oktober 1954 unterrichtete er wöchentlich eine Stunde in der Berufschule für Metallgewerbe. Dazu nahm er seelsorgliche Dienste wahr, half in der Jugendarbeit mit, inklusive der Begleitung einer Freizeit, hielt zwei Vorträge beim Männerdienst, drei Frauenhilfsstunden u.a. 39 Das war ein beachtliches Pensum, aber in der damaligen Zeit des Pfarrermangels für einen Vikar nicht ganz ungewöhnlich. Die Beurteilung durch den Vikariatsleiter am Ende dieses Praxisjahres fällt sehr differenziert aus. Die Zusammenarbeit war offenbar angenehm und konfliktfrei, denn Gert Leipski war»sehr fleißig«und»zuverlässig«,»ließ sich leicht leiten«, war»anhänglich«,»hilfsbereit«und holte sich auch in persönlichen Fragen gerne Rat. Gelobt werden seine gewissenhafte Predigtvorbereitung und seine Bemühungen,»das rechte Verhältnis zum 31
32 Amt zu finden«, wozu das Vikariat u.a. auch gedacht ist. Auffällig war seine»temperamentvolle und redegewandte Art«, die es ihm ermöglichte, leicht Zugang zu Menschen zu bekommen eine Eigenschaft, die ihm auch später noch manche Tür öffnen sollte. Der Vikariatsleiter be mängelt jedoch den kameradschaftlichen und für seinen Geschmack allzu»saloppen«ton. Er befürchtet, dies sei eine Kompensation für einen Mangel an echter Autorität, vor allem gegenüber Jugendlichen. Und er sieht die Gefahr, dass die natürliche Redegabe Leipskis und sein»saloppes Auftreten«ihn davon abhalten könnten, sich mit Verständnis auf Menschen und Lebensverhältnisse einzulassen, die nicht seinem eigenen Erfahrungshintergrund entsprechen. Hier hat der Vikariatsleiter mit sehr viel Menschenkenntnis etwas herausgespürt, was Gert Leipski Zeit seines Lebens charakterisieren sollte. Seine offene und direkte Art hat ihn schnell mit Menschen in Kirche, Gewerk schaft und Politik in Kontakt gebracht, Kontakte, die er erfolg reich nutzte zum Wohl der Menschen in seiner Gemeinde. Seine Rede weise, die hier»salopp«genannt wird, hat es ihm erleichtert, dass die Bergar beiter und ihre Familien, deren Pastor er später wurde, ihn als einen der Ihren akzeptierten. Er begegnete jedoch bei Amtshandlungen oder in der Seelsorge auch Menschen mit einem anderen Lebenshintergrund. Bei ihnen konnte seine lockere Art des Umgangs dazu führen, dass sie sich in ihrer spezifischen Situation nicht angemessen gewürdigt und verstanden fühlten. Aber noch war Gert Leipski erst auf dem Weg ins Pfarramt und hatte weitere Ausbildungsabschnitte vor sich. Auf das Gemeindevikariat in Eichlinghofen folgten knapp sechs Monate Schulvikariat in Dortmund- Lütgendortmund, bevor Mitte November 1955 der halbjährige Kurs im Predigerseminar Soest begann. 32
33 Erlaubnis zur Heirat Gert Leipski ging als verheirateter Mann und Vater ins Predigerseminar. Das war in der damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Nach Vorstellung der Landeskirche sollten die jungen Theologen frühestens nach Abschluss der Ausbildung und Ablegung der Zweiten Theologischen Prüfung heiraten. Dann würden sie bald ihre erste Pfarrstelle antreten und voraussichtlich länger an einem Ort wohnen. Es wurde gern gesehen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt dann aber auch wirklich heirateten und bald als Familie mit etlichen Kindern das zugewiesene Pfarrhaus bewohn ten. Soweit die Theorie und das landeskirchliche Wunschdenken. Gerade für die Männer, die Jahre im Krieg und in Gefangenschaft verbracht hatten und nicht mehr so ganz jung in den kirchlichen Dienst kamen, war diese Vorgabe eine Zumutung. Lange Verlobungszeiten machten manchen jungen Paaren zu schaffen. Die Landeskirche erwartete außerdem, dass die zukünftige Ehefrau selbstverständlich die Aufgaben einer Pfarrfrau übernahm und in der Gemeinde ihres Mannes»für Gotteslohn«mitarbeitete. Es war erwünscht, wenn sie dazu eine Ausbildung im sozialen oder hauswirtschaftlichen Bereich mitbrachte, Kindergärtnerin oder gar Lehrerin war. Gert Leip skis Verlobte nun war Friseurin. Das hatte schon bei der Verlobung zu Irri tationen geführt. In einem für die Landeskirche verfassten Votum hatte der Wattenscheider Superintendent Kluge damals geschrieben:»als ich die Nachricht empfing, daß er sich mit einer Friseuse verlobt hätte, war ich etwas erschrocken. Vor etlichen Wochen hat er mir aber seine Braut vorgestellt, und ich habe einen guten Eindruck von diesem jungen Mädchen gewonnen. Sie selber steht fleißig mitten in der Gemeindearbeit, und über ihrem ganzen Wesen liegt etwas Helles und Unberührtes. Wenn man sich auch wünschen möchte, daß eine kommende Pfarrfrau in einem anderen Arbeitsbereich steht als nun ausgerechnet in einem Friseurladen, 33
34 so darf das ja nicht ausschlaggebend sein für die Bewertung dieser Persönlichkeit.«40 Nachdem Gert Leipski am 1. Mai 1954 im Alter von 27 Jahren sein Vi kariat angetreten hatte und von nun an über ein wenn auch nicht üppiges, so doch regelmäßiges Einkommen verfügte, wollte er seine langjährige Verlobte Ruth Sadzio heiraten. Dazu brauchte man die Zu stimmung des Landeskirchenamtes, um die er pflichtgemäß bat. Die Ant wort des Landeskirchenamtes enthielt eine recht schroffe Ablehnung. Offenbar hatte der Vikar Leipski sich auf ein früheres Gespräch mit dem Per - sonaldezernenten berufen und recht formlos den Heiratskonsens beantragt. So einfach ging das aber nicht. Man verlangte von ihm, er solle 1.»kla - re Gründe«angeben, die ihn veranlassen, schon vor dem Zweiten Examen die Ehe schließen zu wollen, 2. schriftlich erklären, dass er nicht beabsichtigt, schon im Vikariat an einem seiner Einsatzorte einen ge meinsamen Haushalt mit seiner Frau zu führen und 3. bestätigen, dass er weiß, dass sich aus der Erteilung des Heiratskonsenses während des Vikariats keine rechtliche Verpflichtung für die Landeskirche ergibt, im Falle sei ner Invalidität seine zukünftige Frau wirtschaftlich zu unterstützen. Außerdem müsse er seinem neuen Antrag eine Stellungnahme seines Vika ri atsleiters und des zuständigen Superintendenten beifügen. 41 Postwendend stellte Gert Leipski ein erneutes Gesuch. Darin gab er die ver langten Erklärungen ab und begründete ausführlich, warum sich gera de jetzt die Eheschließung nahelegte. Er verwies u.a. auf die fast vierjäh rige Verlobungszeit und darauf, dass seine Braut beabsichtigte, in die Wohnung seiner Mutter zu ziehen, damit diese nach dem Tod ihres Eheman nes vor einem Jahr als alleinstehende Frau nicht das Wohnrecht in ihrer Dreizimmerwohnung verlöre. Noch immer unterstützte er seine Mut ter auch finanziell, denn von 65,- DM Sozialleistung monatlich konn te sie nicht leben. 34
35 Seinem Ärger über die zunächst verweigerte Heiratserlaubnis hat er münd lich Luft gemacht. Es wird überliefert, er habe»denen in Bielefeld«gesagt:»Wenn Ihr nicht wollt, dass wir heiraten, dann werde ich dafür sorgen, dass wir müssen.«der Brief des Vikars jedoch ist höflich im Ton, man spürt ihm aber ab, dass er schon wiederholt die Erfahrung gemacht hat, dass man»in Bielefeld«keine Vorstellung hat von den wirtschaftlichen Verhältnissen, in denen er lebt, und offenbar auch nicht gewillt ist, diese bei den je weils anstehenden Entscheidungen zu berücksichtigen. Der einzelne Mensch mit seinen ganz spezifischen Problemen wird nicht angemessen wahrge nommen, so erlebte er es jedenfalls. 42 Später, als Pfarrer, wird er sich be mühen, anders zu handeln. Die Heiratserlaubnis wurde aber nun erteilt 43, und die Hochzeit konnte am 25. Juli 1954 stattfinden. Ein Jahr später wurde die erste Tochter, Brigitte, geboren. So ließ er seine Frau und seine kleine Tochter zurück, als er im November 1955 zum obligatorischen Halbjahreskurs nach Soest ins Predigerseminar zog. Ein freies Wochenende mit der Möglichkeit zur Heimfahrt gab es nur alle vier Wochen. Arbeiterpriester als Vorbild In Soest traf Gert Leipski einen alten Schulfreund wieder. Helmut Disselbeck, geb. am , hatte mit ihm zusammen das Gymnasium in Wattenscheid-Günnigfeld besucht. Nach dem Abitur begannen beide gemeinsam das Theologiestudium an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Die jungen Männer verstanden sich gut, hatten sie doch eine vergleichbare soziale Herkunft. Helmut Disselbeck war in einer Bergarbeiterfamilie groß geworden und war ebenso wie Gert Leip- 35
36 ski darauf angewiesen, sich das Geld fürs Studium mit Arbeit im Bergbau oder in einem Industriebetrieb zu verdienen. Diese Herkunft und Erfahrungen, die sie von den meisten anderen Kandidaten der Theo logie unterschieden, stellten schnell wieder die alte Nähe her, als sie sich im Predigerseminar erneut trafen. Beide wollten mit ganzem Ernst ihr Leben in den kirchlichen Dienst stellen, und sie wollten es dort tun, wo sie sich auskannten bei den Menschen im Ruhrgebiet. Sie strebten mit dem Pfarramt nicht den sozia len Aufstieg an und einen Wirkungskreis im bürgerlichen Milieu, son dern wollten gerade auch als Pastoren dort unten bleiben, sie wollten Ar beiterpastoren werden. Ihr Vorbild waren die katholischen Arbeiterpriester in Frankreich 44. Diesen war Anfang der 50er Jahre eine große öffentliche Aufmerksamkeit zuteil geworden. Nach Rücksprache in Rom hatten die französischen Bischöfe die Bedingungen für die Tätigkeit der Arbeiterpriester so stark eingeschränkt, dass ihnen eine Fortsetzung ihrer bisherigen Arbeit und Lebensweise nicht mehr möglich war. Begründet wurde dies damit, dass den Priestern, wenn sie vollzeitlich in der Fabrik arbeiteten, weder Zeit noch Kraft für ihr verpflichtendes spirituelles Leben und für ihre priesterlichen Aufgaben bliebe. Dazu missfiel es der Katholischen Kirche, dass etliche der Arbeiterpriester sich in der kommunistischen Gewerkschaft engagierten, dort sogar Funktionen übernahmen und gleichzeitig heftige Kritik übten am Verhalten der katholischen Gewerkschaft in Arbeitskämpfen. Die Pries ter sollten sich auf ihre priesterlichen Pflichten konzentrieren und das gewerkschaftliche und politische Engagement den Laien überlassen. Aber das wollten die meisten der Arbeiterpriester nicht. Für sie ging es darum, Präsenz und Solidarität glaubhaft zu leben. 45 Diese in der Öffentlichkeit geführte Auseinandersetzung wurde von den protestantischen Theologen in Deutschland mit Spannung verfolgt, gewiss auch von den jungen Kandidaten in Soest. Das Thema Kirche und Arbeiterschaft brannte der Evangelischen Kir che schon seit geraumer Zeit unter den Nägeln. Die Wurzeln dieser 36
37 37
38 Pro blematik lagen bereits im 19.Jahrhundert. 46 Versuche, die entstehende Kluft zwischen Kirche und Arbeiterschaft zu überbrücken, konnten sich wegen der beiden Weltkriege und der Nazidiktatur nicht kontinuierlich entwickeln. Es blieb auch in Westfalen bei Vorstößen einzelner Personen oder kleiner Gruppen. 47 Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Thematik neu aufgenommen. Ab 1946 gab es in Westfalen wieder, wie schon vor 1933, einen landeskirchlichen Sozialausschuss. Im September 1946 beschloss die Kirchen leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen die Errichtung eines Sozialamtes, dessen erster Leiter Pfarrer Gerhard Stratenwerth war wurde Klaus von Bismarck zum Leiter des Sozialamtes berufen. Er erhielt die besondere Beauftragung sich um den Bergbau im Ruhrgebiet zu kümmern, nach dem Krieg eine Schlüsselindustrie für den Wiederaufbau. 48 Durch seine vielfältigen Kontakte auf allen Ebenen der Indus trie betriebe und durch regelmäßig durchgeführte Bergbautagungen bekam er einen weitreichenden Einblick in die Situation vor Ort. Schon 1951 berichtete er voller Besorgnis der Kirchenleitung:»An dieser Stelle bin ich genötigt, mit großem Ernst auf die Tatsache hinzuweisen, daß wenn man von einigen erfreulichen Ausnahmen absieht die im wesentlichen dem Kleinbürgertum oder Mittelstand angehörenden Ruhrgebietsgemeinden nur zu einem sehr geringen Prozentsatz wirkliche Bergarbeiter einbeziehen. Lebendige Zellen der Verkündigung im Bereich der eigentlichen Kumpel, im Bereich der Neubergleute und so weiter sind nur dort anzutreffen, wo einzelne, für diese Sonderaufgabe freigestellte und geeignete Persönlichkeiten (Menschenfischer!) unmittelbare Verbindung mit den Kumpeln besitzen, das heißt vereinzelte Pfarrer, einige Volksmissionare und Einzelpersönlichkeiten. Ich kann nicht ernst genug darauf hinweisen, daß es an solchen Frontkämpfern der Evangelisation fehlt.«49 38
39 Appelle der Synoden Auch im Bereich der Ökumene sowie auf den Synoden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) wurde die Problematik behandelt. Im August 1954 tagte in Evanston / USA die Zweite Welt kir chen kon ferenz des Ökumenischen Rates der Kirchen unter dem Motto»Chris tus die Hoffnung für die Welt«. Sowohl in der Sektion III»So zia le Probleme«als auch in der Sektion VI, die sich mit der Be deu tung der Laien beschäftigte, wurde das Verhältnis Kirche und Ar bei ter schaft thematisiert. Sehr eindrücklich wurde beschrie ben, wie stark sich die Lebenswelt der Industriearbeiter von der Le bens welt der Kir chen gemeinde unterschied und dass es kaum noch Ver bindungen zwi schen ihnen gab. Christliche Laien in den Betrieben soll ten hier eine Brücken funktion wahrnehmen. 50 Die Beschlüsse von Evan ston zu diesem Thema wurden in Deutschland mit großem Interesse auf genommen und auf den Westfälischen Landessynoden von 1954 und 1955 sowie auf der Synode der EKD 1955 in Espelkamp rezipiert. Auf der Westfälischen Landessynode im Oktober 1954 wurde das Proponendum der Kirchenleitung mit dem Titel»Die Verkündigung der Kirche heute«, das in den Monaten zuvor schon in den Kreissynoden beraten worden war, als Hauptthema behandelt. Es ging u.a. um neue Formen einer missionarisch-evangelistisch ausgerichteten Verkündigung. 51 Auch hier stand die Erfahrung im Hintergrund, dass der Mensch von heute nicht mehr mit der Botschaft des Evangeliums erreicht wurde und am wenigsten wohl der Arbeiter von heute. Das einleitende Referat hielt Prof. D. Heinz-Dietrich Wendland. Er nannte das Beispiel der katholischen Arbeiterpriester»einen Mahnruf für uns«und forderte: 39
40 »Wir brauchen Mannschaften, Bruderschaften in unserer Kirche, die nichts anderes wollen, als dem Dienste der Verkündigung zu leben in einer dem Evangelium verschlossenen Welt «52 In einer Stellungnahme des Kirchenkreises Gelsenkirchen wurde konstatiert: Und:»Nicht außerkirchliche und außertheologische Gründe haben zum Verlust des Weltbezuges der Verkündigung geführt, sondern kirchliche und theologische. Es liegt in der Sache ein schuldhaftes Versagen der Kirche vor. Kirche und Christen (sind) in der Nachfolge des menschensuchenden Gottes gewiesen, zunächst einmal dort wirklich zu leben und sich gründlich damit zu beschäftigen, was die Menschen von heute bewegt, und daß die Ausrichtung der Botschaft wesenhaft die Solidarität des Boten mit seiner Umwelt voraussetzt.«53 Die gelebte Solidarität als Kriterium für die Glaubwürdigkeit der Boten und der Botschaft des Evangeliums wurde auch in den Referaten und Beschlüssen der Synode der EKD im März 1955 betont. Die Tagung fand in Espelkamp statt und wurde von dem Synoden-Präses Dr. Gustav Heinemann geleitet. Ihr Hauptthema war»die Kirche und die Welt der Arbeit«. Landesbischof D. Dr. Lilje würdigte in seinem Referat ausdrücklich die katholischen Arbeiterpriester: 40»Der Versuch, den diese Männer unternommen haben, hat die Bedeutung, die wir nach reformatorischem Verständnis dem Leben der Heiligen beimessen. Sie machen auf eine stellvertretende Weise eine Pflicht deutlich, die der ganzen Kirche obliegt.«54 Horst Symanowski, einer der Referenten 55, der drei Jahre lang in unterschiedlichen Industriebetrieben gearbeitet hatte, schilderte sehr ein-
41 drücklich seine Erfahrungen als Pastor in der Arbeitswelt und seine Begegnungen mit den kirchenfremden Arbeitern. Theologisch begründete er das Engagement der Kirche in der Arbeitswelt mit der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Wenn es seit Jesus Christus keine Trennung von Gott und Mensch mehr gebe, dann müsse die Kirche in der Nachfolge Jesu ganz nah bei den Menschen in ihrer jeweiligen Lebenswelt sein, müsse ihre Sorgen und Nöte teilen. Mit bewegenden Worten appellierte er an die christlichen Laien in den Betrieben, aber auch an die»amtsträger«: Wir müssen» in der Nachfolge dieses Jesus unseren Standort verlassen und an die Seite der Kirchenfremden, der Nichtverstehenden, der Religiösen und der Religionslosen, ja der Gottlosen treten Das Gebot solcher Nächstenliebe gilt allen Christen, die selbst in der Arbeitswelt stehen. Sind sie aber nicht vorhanden oder erfüllen sie diesen Dienst nicht, so werden die kirchlichen Amtsträger die Aufgabe anpacken müssen Es scheint uns unrealistisch und unbarmherzig zu sein, die wenigen christlichen Arbeiterbrüder auf das Kampffeld zu schicken, auf dem wir Amtsträger der Kirche noch nicht erschienen sind oder uns so wenig bewähren So wird uns die Fabriksirene zum Ruf in den uns von Gott verordneten Dienst in dieser Welt.«56 In der Aussprache formulierte der Synodale Metzger, was wohl viele dachten:»bevor wir die Möglichkeit haben, durch die Predigt die Menschen zu erreichen, muß ihr Vertrauen gewonnen werden. Wenn junge Theologen in die Fabrik gehen, mit den Arbeitern zusammenleben, so tun sie das, damit die Menschen Vertrauen gewinnen «57 Im Beschluss der Synode hieß es dann schließlich:»die Mauern kirchlicher Tradition und Gewohnheit dürfen uns nicht hindern, den Weg zu Menschen in der heutigen Arbeitswelt zu suchen. Christus ist 41
42 gekommen, um in der Welt zu leben und für sie sich hinzugeben. So schafft Gott mitten in der Welt der Arbeit seine neue Welt.«58 Die wenige Monate später tagende Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen versuchte dann den jungen Theologen den»weg zu Menschen in der heutigen Arbeitswelt«zu ebnen. Es wurde u.a. eine»sonderausbildung in den Fragen der modernen Arbeitswelt«beschlossen, an der einzelne Gemeindepfarrer in dem von Horst Symanowski geführten Seminar in Mainz-Kastel teilnehmen sollten. 59 Die Appelle der Synoden in den Jahren 1954 und 1955 waren eindring lich. Es sollten neue Wege ausprobiert werden, um die Arbeiter im Bergbau und in der Industrie zu erreichen. Die Sonderausbildung in Mainz-Kastel war dabei nur ein Baustein. Es gab bis in die Leitung der Kirche hinein, besonders auch bei Präses Wilm, die Bereitschaft, un konventionell vorzugehen und zu experimentieren. Das Modell der fran zö - sischen Arbeiterpriester spielte in vielen Diskussionsbeiträgen eine Rol le. Gesucht wurden nun junge Theologen, die bereit waren, sich auf solche Experimente einzulassen. Wo waren die»frontkämpfer der Evan ge li sation«60, wie Klaus von Bismarck sie genannt hatte? Zwei Theologen, seit November 1955 im Soester Predigerseminar, fühl ten sich unmittelbar angesprochen. Die Welt der Bergarbeiter war ihnen nicht fremd. Sie kannten das Milieu, waren darin beheimatet und sahen dort ihre kirchliche Aufgabe. Sie stammten aus einer anderen sozia len Schicht als die meisten der Kandidaten, konnten aber gerade auf Grund ihrer Herkunft und ihrer bisherigen Erfahrungen hier Besonderes leisten und ihren Platz in der Kirche finden. Gert Leipski und Helmut Disselbeck fassten einen folgenreichen Entschluss. 42
43 Pastor und Gedingeschlepper Antrag auf Freistellung Am 30. Mai 1956 stellten Leipski und Disselbeck den Antrag auf Freistellung für eine Vollzeitanstellung im Bergbau nach ihrem Zweiten Theologischen Examen 61. In der Begründung verwiesen sie auf ihre Werk arbeit vor und während des Studiums. Hier hatten sie die Erfahrung gemacht, dass die Arbeiter auf Grund der Schichtarbeit und der hohen kör perlichen Belastung, aber auch aus weltanschaulichem Desinteresse keinen Kontakt zur Kirche haben.»es ist immer noch die Meinung zu spüren, Kirche bedeute einen Raum jenseits der Arbeit und damit jenseits des Arbeiters.«62 Aber sie hatten auch erlebt, dass den Arbeitern»die Kirche in einem anderen Licht erschein(t)«, wenn»angehende Pfarrer sich mit den Arbeitern unter die Arbeit stellen, nicht auf sie einreden, sondern ihre Arbeit, ihre Sorgen und Mühen teilen «. 63 Ermutigt zu ihrem Vorhaben fühlten sie sich durch die Diskussionen der vorangegangenen Landessynoden.»So sagt Prof. Wendland, das(s) der Prediger immer aus der Solidarität des Mitmenschseins sprechen muß Sup. Schönherr sagt in seinem Vortrag: Wer Zeuge Christi sein will, muß wirklich teil nehmen an den Nöten, Verlegenheiten und Ausweglosigkeiten der Welt. «64 Auch auf das Referat von Bischof Lilje auf der Synode der EKD in Espel kamp nahmen sie Bezug:»Wie es eine grundsätzliche symbolische Bedeutung hat, daß der Priester und Prediger mit einer vollen beruflichen Tätigkeit in der Welt der modernen Arbeit steht, so hat es auch eine symbolische Bedeutung, wenn Männer der Kirche den ihnen aufgetragenen kirchlichen Dienst so auszurichten versuchen, daß sie sich primär der Welt der Arbeit einordnen.«65 43
44 Die Entschließung der Landessynode von 1955, so meinten sie, habe den organisatorischen Rahmen für ihre Entsendung zur Werkarbeit ge schaffen. 66 Die beiden Vikare benannten auch Einwände, die gegen ihr Vorhaben geltend gemacht werden könnten, so vor allem die Sorge,» daß man bei dem Versuch, ganz mit der Welt solidarisch zu werden sich nicht zuletzt wiederfindet als einer, der von der Welt ist, statt als Christ in der Welt zu sein«. 67 Aber:»Weil wir die Gefahren kennen, meinen wir, daß dieser Dienst weder von einem Einzelnen alleine getragen werden kann, noch ohne Auftrag der Kirche, die einfach tragend hinter solchem Dienst stehen muß.«68 Sie beschlossen ihren Antrag mit den Worten:»Darum machen wir den Vorschlag, diese von mehreren Synoden als wichtig erkannte Aufgabe in unserer Landeskirche aufzugreifen. Wir sind bereit, diesen Weg nach bestandenem zweiten Examen zu beschreiten und in und durch die Werkarbeit den uns aufgetragenen Dienst der Verkündigung an den der Kirche entfremdeten Arbeitern zu tun. Das wäre eine Antwort auf die Frage des Herrn Präses : Gibt es irgendwo in ihren Gemeinden neue Ansätze in der Solidarität mit der Welt, für die Jesus gestorben ist, als Kirche für die Brüder da zu sein? «69 Leipski und Disselbeck gaben ihren Antrag beim Ephorus des Predi gerseminars Dr. Hans Thimme ab. Der war»sehr bewegt«von dem Vorhaben, verhielt sich»aber zunächst sehr zurückhaltend und abwartend«, um»die Ernsthaftigkeit des Vorschlags der Beiden«zu prüfen und um Kontakt mit dem Leiter des Sozialamtes, Klaus von Bismarck, aufzunehmen. 70 Am 27. September 1956 waren die Vorüberlegungen aber so weit gediehen, dass Dr. Thimme den Antrag mit seiner ausdrücklichen Unterstützung an Präses Wilm weiterleitete. So»empfehlen Herr von Bismarck und ich, auf den Vorschlag der beiden Kan didaten einzugehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, für eine ge- 44
45 wis se Zeit als Arbeiter unter Arbeitern zu leben. Diese Entscheidung ist von großer Tragweite und kann für die westfälische Kirche etwas Wichtiges be deu ten. Selbstverständlich läßt sich der Entschluß der Beiden in keiner Wei se verallgemeinern. Es sollte auch gar nicht viel darüber geredet, geschwei ge denn in der Presse darüber geschrieben werden. Aber es ist ein mit Dank barkeit zu begrüßendes Zeichen für die innere Lebendigkeit der jun gen Gene ration, daß sich solche finden, die bereit sind, um des Dienstes der Kir che willen, einen unkonventionellen, mit großen Opfern verbundenen Weg zu ge hen.«71 Der Kommentar des Ephorus atmete gleichermaßen Bewunderung für den Entschluss der beiden Kandidaten, sowie Hoffnung auf ein wegweisendes Zeichen aus der westfälischen Kirche und die Sorge, dieses Experiment könne auch misslingen. Darum wohl der Hinweis auf eine gewisse Zurückhaltung in der Öffentlichkeit. Um aber diesem Versuch gute Start- und Rahmenbedingungen zu verschaffen, machte Dr. Thimme, dabei auch Ratschläge von Bismarcks aufnehmend, im Brief an den Präses sehr konkrete, umsichtige und fürsorgliche Vorschläge:»Die Durchführung läßt sich m.e. in folgender Weise verwirklichen: 1. Beide Vikare werden zunächst für die Dauer eines Jahres beurlaubt. Hinsichtlich eines etwaigen Anschlusses an kirchliche Versorgungskassen aber werden sie wie andere Hilfsprediger der Landeskirche behandelt. Eine kirchliche Gehaltszahlung entfällt. 2. Beide Hilfsprediger nehmen zunächst noch an der Ordinanten-Rüstzeit teil und werden sobald als möglich ordiniert, damit auf solche Weise sichtbar wird, daß sie im Auftrage ihres Amtes und entsandt durch ihre Kirche ihren besonderen Weg in die Arbeiterwelt hinein auf sich nehmen. 3. Das Sozialamt wird beauftragt, endgültig zu entscheiden, ob der Dienst in der Gemeinde Suderwich oder in der Gemeinde Gladbeck die bes seren Einsatzmöglichkeiten bietet. Das Landeskirchenamt entscheidet als dann auf Grund des Vorschlages des Sozialamtes. 4. Superintendent Geck als zuständiger Superintendent des Kirchenkreises sollte gebeten wer den, sich der beiden Hilfsprediger besonders anzunehmen und die Ver- 45
46 bin dung der Pfarrbruderschaft mit ihnen zu pflegen. Am Ende des Ur laubsjahres soll geprüft werden, ob eine Verlängerung des Urlaubs wün schenswert ist. Gegebenenfalls wird das in der Werkarbeit verbrachte Jahr als Hilfs dienstjahr angerechnet Da beide Kandidaten ihre Arbeit im Be trieb erst im Anschluß an die Ordinanden-Rüstzeit übernehmen können, müßte die Übergangszeit bis dahin finanziell in der gleichen Weise gesichert werden, wie das bei den übrigen Kandidaten, die jetzt das Examen gemacht haben und Anfang November ihren Dienst antreten, geschieht.«72 Der Ephorus äußerte sich auch zu der charakterlichen Eignung der beiden Kandidaten für dieses Experiment. Helmut Disselbeck bescheinigte er»eine gefestigte, klare, verantwortungsbewußte Persönlichkeit«. 73 Bei Gert Leipski hingegen sah er»eine labilere Natur (die) eher den Be ein - flussungen seiner Umwelt«74 unterliegt. Schon in seinem Bericht nach Abschluss des Predigerseminarkurses in Soest hatte er kritisch festgehalten:»mancherlei Antiaffekte bestimmen bis heute die Haltung des aus einfachen Verhältnissen stammenden und durch das Flüchtlingsschicksal besonders betroffenen Leipski. Er denkt, meistens freilich unbewußt, in den traditionellen Klassengegensätzen, und ist nicht in der Lage, sich über die an sich sehr verständlichen Ressentiments hinwegzusetzen. Diese Milieubindung wird durch das impulsive Temperament und die Neigung, gelegentlich auch Undurchdachtes vorschnell auszusprechen und herausfordernd zu ver tre ten, weiter unterstrichen.«75 Aber er hatte auch beobachtet:»l. ist von echtem Eifer beseelt, der Sache Christi in der Welt von heute und gerade in der Arbeiterwelt zu dienen. Nach dem Beispiel der katholischen Arbeiterpriester möchte er gern auf diesem Wege besondere Opfer bringen. Er ist fleißig, beweglich und anpassungsfähig.«76 Im Blick auf das Projekt Werkarbeit kam er dann zu dem Schluss: 46
47 » darum ist es gut, daß beide [d.i. D. und L., d. Vf.] an gleichem Ort eingewiesen werden und sich auf solche Weise gegenseitig stützen kön nen.«77 Beurlaubung oder Entsendung? Bei Präses Wilm traf der Vorschlag Dr. Thimmes auf bereitwillige Zustimmung. Auf dessen Brief an den Präses findet sich mit Datum vom 9. Oktober 1956 ein handschriftlicher Vermerk, der an den für die Einweisung in den Hilfsdienst zuständigen Oberkirchenrat Niemann gerichtet war:»eilt! L. Br. Niemann! Über diese Angelegenheit möchte ich mit dir noch sprechen. Ich begrüße den Entschluß der beiden jungen Brüder u. meine, daß wir sie dazu freigeben sollten. Jedenfalls bitte ich dich, sie nicht anderswo ein zu set zen ehe wir miteinander hierüber gesprochen und entschieden haben. Wilm.«78 In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt der Evangelischen Kirche von West falen nahmen die Verfahrensvorschläge von Ephorus Dr. Thimme nun zügig Gestalt an. Anfang Oktober 1956 hatten beide Kandidaten ihr Zweites Theologisches Examen bestanden. Als Einsatzorte für ihre Werkarbeit waren vom Sozialamt aus für Leipski die Zeche Nordstern in Gelsenkirchen-Horst und für Disselbeck die Schachtanlage Mathias Stinnes III/IV in Gladbeck ausgesucht worden. Ihre Gemeindeanbindung sollte in der Kirchengemeinde Gladbeck-Brauck erfolgen, begleitet von den Pfarrern von Bremen (Leipski) und Philipps (Disselbeck). Die organisatorische Umsetzung dieser Pläne fand unter einem erheblichen Zeitdruck statt und führte zu beträchtlichen Irritationen in der 47
48 kirchlichen Verwaltung. Das lag zum einen daran, dass die Beur laubung von Hilfspredigern für eine Anstellung im Bergbau ein Novum darstellte und es dafür keine Vorlagen gab. Aber man sperrte sich wohl auch dagegen, dieses kirchenpolitisch gewollte Experiment unbürokratisch und mit wohlwollender Kreativität zu realisieren. Der Dienst der beiden Hilfsprediger im Bergbau begann am 15. November 1956, aber erst am 16. November beschloss das Landeskirchenamt: 48»Die Pfarramts-Kandidaten Leipski und Disselbeck werden für die Zeit ihrer Werkarbeit ohne Bezüge beurlaubt. Diese Zeit wird als kirchlicher Dienst angerechnet. Ihre Ordination soll alsbald erfolgen.«79 Bis zum März 1957 zog sich ein Streit hin über Gehaltszahlungen der Landeskirche für die Übergangszeit zwischen Mitte Oktober und dem Beginn der Werkarbeit Mitte November. Zu Recht beharrten Leipski und Disselbeck darauf, wie die anderen Hilfsprediger ab dem 15. Oktober 1956 von der Landeskirche bezahlt zu werden, in ihrem Fall ein Monatsgehalt für den Zeitraum 15. Oktober bis 15. November. Mündlich war ihnen dies auch zugesagt worden, aber ausgezahlt wurde ihnen nur der Betrag für die erste Hälfte des November. Angesichts des notwendigen Umzuges, der Beschaffung von Arbeitskleidung etc. brachte das Fehlen dieses Geldes die jungen Familien in finanzielle Schwierigkeiten. Mehrfach wandten sie sich deswegen an die Landeskirche, Ephorus Dr. Thimme schaltete sich zu ihrer Unterstützung ein, aber noch im März 1957 verstand die landeskirchliche Verwaltung nicht oder wollte nicht verstehen, dass das Gehalt für die zweite Hälfte Oktober und nicht für die zweite Hälfte November eingefordert wurde. 80 Endlich wurde dann aber doch gezahlt. Ende November 1956, Leipski und Disselbeck arbeiteten schon vier Wochen unter Tage, fragte das Landeskirchenamt nach, ob die beiden denn über die Zeche gegen Berufsunfälle, Krankheit und Invalidität ver sichert seien. Dies wurde im Januar 1957 positiv beantwortet. Im Dezember
49 1956 gewährte das Landeskirchenamt jedem eine Un terstützung von DM 150,- für die Anschaffung einer»berg bau aus rüstung«. 81 Zu einer ernsthaften Kontroverse führte es aber, als die beiden Hilfs prediger im Beschluss des Landeskirchenamtes vom 16. November lasen, dass sie für die Zeit ihrer Werkarbeit»beurlaubt«wurden. Sie hatten auf Grund vorheriger Äußerungen fest mit einer offiziellen kirch lichen Entsendung zu ihrem Dienst gerechnet. 83 Hier war ein Punkt berührt, an dem sie sehr empfindlich reagierten. Schon in ihrem An trag hatten sie betont,»daß dieser Dienst weder von einem Einzelnen alleine getragen werden kann, noch ohne Auftrag der Kirche, die einfach tragend hinter solchem Dienst stehen muß«. 84 Sie wollten ja nicht als Privatleute unter Tage arbeiten, sondern als Pastoren und damit auch als Repräsentanten ihrer Kirche. Sie wollten zeigen, dass die Arbeiter der Kirche nicht gleichgültig sind, ja mehr noch, dass Christus sie liebt, sie wert achtet und kei nes wegs abgeschrieben hat, selbst wenn viele Arbeiter Religion und Kir che abgeschrieben haben sollten. An der Frage der Entsendung durch die Kirche hing für Leipski und Disselbeck das ganze Projekt, sie war entscheidend für ihr Selbst ver ständnis, sowie für ihren Auftrag und für ihre Rückendeckung. Die For mulierung im Beschluss des Landeskirchenamtes hat sie darum ge kränkt und verärgert, und sie haben ihrem Ärger Luft gemacht. Daraufhin gab es etliche beschwichtigende Reaktionen von Seiten der Landeskirche. Zunächst erklärte OKR Niemann sehr sachlich, dass aus juristischen Gründen keine»zuweisung«von Pastoren in einen kirchenfremden Betrieb, hier in den Bergbau, möglich sei. Sie könnten formal nur beurlaubt werden. Ein Gespräch mit dem Präses über diesen Sachverhalt stellte er in Aussicht. 85 Zwischen Weihnachten 1956 und Neujahr kamen aber noch mehr Briefe an. Von Bismarck schrieb:»ein längeres Gespräch mit dem Präses hat mir noch einmal bestätigt, dass er jedenfalls voll als Kirche hinter Ihrem Einsatz steht. Wir müssen es mit 49
50 realistischem Humor hinnehmen, wenn es in den Gemeinden und im Landes kirchenamt noch viele Kräfte gibt, deren Denken als Kirche offenbar in finanziellen und juristischen Vorstellungen verengt ist.«86 OKR Niemann begründete in einem weiteren langen und sehr per sön lich gehaltenen Schreiben nochmals ausführlich den Rechtsakt der Beur laubung und versicherte die beiden Pastoren seiner vollen Unter stützung. 87 Im Januar 1957 gab es dann anlässlich der Ordinandentagung in Soest das avisierte Gespräch mit Präses Wilm. Es muss eine sehr intensive und berührende Begegnung gewesen sein. Helmut Disselbeck erinnert sich:»ernst Wilms Worte waren: Laßt die doch reden. Ich sende euch! Laßt uns beten. Wir 3 knieten nieder, der Präses legte uns die Hände auf und segnete uns.«88 Präses Wilm lag sehr viel daran, die Sendung durch die Kirche deutlich zu machen, denn er wusste, dass dieser Dienst im Bergbau für die jungen Männer nicht einfach sein würde. Er hatte die beiden Menschen und ihr Ergehen im Blick. Wenn er schon die rechtlichen Gegebenheiten nicht ignorieren konnte, so wollte er ihnen doch ganz persönlich und in Ausübung der geistlichen Autorität des Präsesamtes die Unterstützung ihrer Kirche zusagen und sie senden. 89 Aber auch Dr. Thimme kümmerte sich um die beiden. Um den Jahres wechsel 1956/57 herum reiste er spontan nach Gladbeck, um sie zu ermutigen und zu stärken und ihnen zu zeigen, dass ihre Kirche sie nicht allein lässt. 90 Dennoch blieb die Tatsache der offiziellen Beurlaubung statt der erwünsch ten Entsendung ein Stachel im Fleisch. Die tatsächliche Sendung geriet, vor allem in der veröffentlichten Meinung, je länger je mehr in Vergessenheit. Hier wurde unterstellt, das Projekt von Leipski und Dis sel beck sei ohne Unterstützung der Landeskirche oder gar gegen deren Willen durchgeführt worden: 50
51 »Ein interessantes Modell ist immer noch der Versuch von Gerhard Leipski und Helmut Disselbeck von 1956 in Gladbeck. Ohne offizielle kirchliche Zustimmung und kirchenrechtliche Absicherung versuchten sie nach Abschluß ihrer Theologenausbildung, Arbeit unter Tage und Gemeindearbeit miteinander zu verbinden in einem Zweier-Team.«91 Die zeitgenössische Presse hatte hingegen noch von den beiden Pastoren im Bergbau berichtet,» die sich mit ausdrücklicher Genehmigung der Kirchenleitung, ja auf deren Wunsch hin freiwillig dazu entschlossen hatten Präses Wilm, der beide Pastoren in ihrer Eigenschaft als vollwertige Gedingeschlepper besuchte, sprach seine Anerkennung und Zustimmung zu dieser Maßnahme aus.«92 Arbeit unter Tage Der Beginn der Werkarbeit selbst war recht unspektakulär verlaufen. Die Bewältigung der Alltagsprobleme stand im Vordergrund. Gert Leipski musste in den ersten Monaten von Gelsenkirchen aus einen langen Weg bis zur Zeche Nordstern absolvieren. Erst im März 1957 wurde ihm und seiner Familie eine Wohnung in der für die Arbeiter auf Nordstern errichteten Siedlung zugewiesen. Der Wohnort in Nähe des Arbeitsplatzes und in Nachbarschaft zu den Kumpeln machte die Bewältigung der Arbeits anforderungen und die Kontakte einfacher, verschärfte jedoch die Be lastungen innerhalb der Familie. Bisher hatten alle in der Wohnung seiner Mutter gewohnt und brauchten dort keine Miete zu zahlen. Von nun an belastete die monatliche Miete von DM 70,- das Familienbudget. Außerdem mussten die Kosten für den Umzug aufgebracht werden. Für die junge Frau Leipski brachte der Umzug erhebliche Erschwernisse mit 51
52 sich. Im Juli 1957 erwartete sie ihr drittes Kind und musste nun weit gehend auf die bisherige Unterstützung und»rückendeckung«durch die Großeltern verzichten.93 In der neuen Umgebung und unter den Ar beiterfrauen galt es sich zurechtzufinden und einzuleben. Die Pastoren Gert Leipski (r.) und Helmut Disselbeck arbeiten unter Tage (1957; LkA EKvW, Nachlass Disselbeck, Diss 4. dpa). 52
53 Aber auch die Männer mussten sich zurechtfinden mit den neuen Arbeitsbedingungen und den Kollegen. Diese betrachteten den Einsatz der beiden Pastoren unter Tage überwiegend mit Zurückhaltung und Misstrauen. Helmut Disselbeck erinnerte sich:»sie können sich ausmalen, wie die Kumpel zunächst reagiert haben, als sie davon erfuhren: Na ja, der eine ist jung verheiratet, der will sich etwas Geld dazu verdienen, damit er sich ein paar Möbel anschaffen kann. Ob der wohl zu doof ist für ein Pfarramt? Der wird sicher etwas ausgefressen haben, darum hat man den hierher verdonnert. Ich sage euch, seid vorsichtig, vielleicht will der nur spionieren. «94 Gert Leipski berichtete über die erste Zeit:»Die Arbeit als solche steht am Anfang. Die geht oftmals über die Kraft eines Menschen. Sehen Sie mich an: ich bin jetzt dreierlei zugleich. Bergmann, Pastor und Familienvater Und es ist vorgekommen, daß der Kumpel Leipski am Sonntagmorgen um sieben Uhr von der Nachtschicht nach Hause kam, körperlich völlig zerschlagen, und um 10 Uhr als Pastor Leipski auf der Kanzel stand Der verdient sein Geld ja mit Lügen, sagte kürzlich ein Kumpel über Leipski. Und der erwiderte: Hältst du mich für so doof, daß ich hier arbeiten würde, wenn ich mein Geld mit Lügen verdienen könnte? «95 Aber auch der Betriebsrat zeigte kein Verständnis und verhielt sich eher ablehnend.» beide traten sofort, als sie ihre Arbeit aufnahmen, der In dus trie ge werkschaft Bergbau bei, haben vor einiger Zeit versucht, mit dem Be triebs rat ins Gespräch zu kommen. Der Betriebsrat lehnte das Gespräch rundweg ab. Ich sehe keinen Sinn in einem solchen Gespräch, sagte der Vorsitzende.«96 Am 24. Februar 1957 wurden Gert Leipski und Helmut Disselbeck in der Kirchengemeinde Gladbeck-Brauck von Superintendent Geck ordiniert. 53
54 Jetzt nahm plötzlich die Presse und damit eine größere Öffentlichkeit Notiz von dem Experiment der beiden Pastoren. Man wurde neugierig. Das war jedoch nicht im Sinne aller Beteiligten. Der Ausgang dieses Unter nehmens war noch ungewiss, und es hatte bessere Erfolgschancen im Schutze einer begrenzten Öffentlichkeit. Damit war es nun vorbei. Pfar rer von Bremen hatte eine solche Entwicklung schon gleich zu Anfang befürchtet und darum bereits im November 1956 den Vorschlag ge macht, die Ordination nicht in Gladbeck, sondern im entfernteren Reck ling hausen durchzuführen, denn, so von Bremen:»Hier in Gladbeck bestünde die Gefahr, daß aus diesem ungewöhnlichen Ein satz der Brüder an der Öffentlichkeit leicht großes Aufsehen gemacht wer den könnte und das wollen wir im Interesse dieses Dienstes gerne vermeiden.«97 Einige Monate später nun, als das Projekt gut angelaufen war, wurden diese Bedenken zurückgestellt, und die Ordination fand in Gladbeck- Brauck statt. Das öffentliche Interesse ging dann aber doch über das erwartete Maß hinaus. In etlichen, auch überregionalen Zeitungen wurde von den beiden Pastoren berichtet, die als Gedingeschlepper arbeiteten. Man fragte vor allem nach ihrer Motivation und ihren Zielen. Gert Leipski stellte klar:»wir wollen weder das Milieu im Pütt kennenlernen noch Erfahrungen für späteren Gemeindedienst im Kohlenpott sammeln Unsere Mitarbeit versucht, das etwas ungünstige Verhältnis zwischen Kirche und Arbeiter schaft zu ändern und den durch den Rhythmus der Industrie von der Kirche entfernten Menschen zu zeigen, daß wir überall dabei sind.«98 Die Dauer des Einsatzes sei noch ungewiss, aber sie wollten zeigen, dass die Kirche»nicht nur predigt, sondern auch etwas tut. Und sei es vor Kohle, mit der Hände Arbeit.«99 54
55 Noch am Tag der Ordination wurde ein Rundfunkinterview mit beiden Pastoren geführt, an dem u.a. auch zwei Bergleute teilnahmen. Diese be grüßten als Vertreter der Arbeiterschaft den Dienst von Leipski und Disselbeck unter Tage. Der Beitrag wurde am selben Abend in den Nachrichten»Zwischen Rhein und Weser«gesendet. 100 Angestoßen durch die Presseberichte ergaben sich für Leipski und Dis selbeck wichtige Kontakte und Korrespondenzen, u.a. mit Hans Ehren berg in Heidelberg 101 und dem Heidelberger Arzt Dr. Jacob, der sich auf Tagungen in Referaten und Diskussionen sachkundig mit dem Verhältnis Kirche und Arbeiterschaft beschäftigte. 102 Brief Hans Ehrenberg an Leipski (LkA EKvW, Nachlass Disselbeck, Diss 7). Auch von der Landeskirche wurde das Projekt weiterhin mit großem Interesse und mit Wohlwollen verfolgt. Als Präses Wilm der Bericht von der kreiskirchlichen Visitation der Kirchengemeinde Brauck vorgelegt 55
56 wurde, zu der auch eine Grubenfahrt auf der Zeche Stinnes gehört hatte, nahm er dies zum Anlass, den beiden Pastoren seine Freude über ihren Einsatz und Ermutigung für ihren Dienst auszusprechen. 103 Am intensivsten war wohl der Kontakt zum Leiter des Sozialamtes, Klaus von Bismarck, und zu OKR Dr. Thimme, der das Experiment der Werkarbeit von Anfang an befürwortet und gefördert hatte. Als sich im Laufe des Sommers 1957 Schwierigkeiten bei dem Einsatz un ter Tage ab zeichneten, war dieser der erste Ansprechpartner. 104 Es gab ge sundheitliche und familiäre Probleme. Die harte und ungewohnte kör perliche Beanspruchung forderte ihren Tribut, aber auch die Doppel aufgabe Pastor und Gedingeschlepper zugleich zu sein, war nicht so zu bewältigen, wie die beiden Männer sich das gewünscht hatten. Über einen Termin für die Beendigung ihres Einsatzes wurde beraten. Auf der Landessynode im Oktober 1957 informierte Präses Wilm die Synodalen über die Werkarbeit der beiden jungen Brüder und betonte da bei die theologische Bedeutung ihres Dienstes:»Zu dem Thema Kirche in der Welt der Arbeit sei hier noch erwähnt... daß zwei unserer Hilfsprediger für ein Jahr ins Bergwerk gegangen sind und mit ihren Familien als Bergleute leben. Das Landeskirchenamt hat diese beiden Brüder dazu ausgesandt, damit sie in dieser sehr leiblichen und ganzen Solidarität mit ihren Arbeitskameraden ein Stück der Sendung der Gemeinde Jesu in die Welt durchleben und vielleicht uns etwas davon sagen können, wie die Ausrichtung der Botschaft von dem menschgewordenen Gottessohn aus der Erfahrung solcher Nähe zum andern und der Mitmenschlichkeit mit ihm auf eine andere Weise geschehen kann und muß «105 56
57 Ende des Einsatzes Zu diesem Zeitpunkt war jedoch schon klar, dass dieser Einsatz nach Ab lauf eines Jahres beendet werden musste. Bei Gert Leipski gab es u.a. er heb liche gesundheitliche Probleme. Helmut Disselbeck musste sich um seine schwer erkrankte Frau kümmern. OKR Dr. Thimme schrieb ihm dazu:»es ist wahrlich ein besonderes Verhängnis, daß Ihr Versuch, dem Menschen unserer Tage auf neue Weise an der Stätte seiner Arbeit unmittelbar zu begeg nen, durch immer neue schwere äußere und innere Belastungen erprobt worden ist. Man wird sich sehr fragen müssen, was damit gesagt sein soll.«106 Auch Dr. Jacob aus Heidelberg kommentierte und analysierte das Ende des Einsatzes:»Die sehr idealistische Intention hat der Wirklichkeit nicht standhalten kön - nen, sie war gezwungen, sich entsprechend den erfahrenen und er lit te nen Wirklichkeiten am Ort zu verändern. Aus der Mission wurde Symbol und Zeichen, aus der Stärke der Position die innere Gefährdung und Un terlegenheit in den Bewegungen im wirklichen Raum, den die Kirche verloren hat «107 Nach einem Gespräch mit Leipski und Disselbeck hatte Klaus von Bismarck sich an die Kirchenleitung gewandt und darum gebeten, beide formell aus dem Einsatz zurückzurufen, da sie auch offiziell entsandt worden wären. Als Gründe für den Rückruf zu diesem Zeitpunkt nannte auch er familiäre und gesundheitliche Schwierigkeiten. In einem ersten Rückblick und Ausblick wies er aber auch schon auf kritische Punkte dieses Einsatzes hin. Er sei von Anfang an zu breit angelegt gewesen. Es sei eine Überforderung, gleichzeitig»solidarität mit dem Arbeiter«und 57
58 » Repräsentation der Kirche«zu erwarten. Bei möglichen künftigen Entsendungen sollten die Aufgaben stärker begrenzt werden und man sollte eine leichtere Arbeit aussuchen. Er schlug vor, zwar keine Institution aus der Werkarbeit von Pastoren zu machen, aber man könne einen sol chen Ein satz schon wiederholen, wenn zwei geeignete Kandidaten ge fun den wer den könnten. Im Blick auf Leipski und Disselbeck empfahl er eine vier wöchige Erholungspause, möglicherweise verbunden mit der Teilnah me an Seminaren in Mainz-Kastel. 108 Auch die Braucker Gemeindepfarrer Philipps und von Bremen, die den Dienst der beiden Hilfsprediger begleitet hatten, schrieben an die Kirchen leitung. Sie berichteten, dass Leipski und Disselbeck ihren Dienst im Berg bau zum gekündigt hätten. Sie empfahlen, ebenso wie von Bismarck, eine längere Erholungspause und außerdem ge nügend Zeit für eine gezielte Nacharbeit: Ein ausführlicher Bericht an die Kir chenleitung sei nötig, die Teilnahme an Gewerkschaftsseminaren oder an Veranstaltungen in Mainz-Kastel, Besuche in Bergwerksbetrieben über Tage und Gespräche mit Direktoren, sowie Gemeindebesuche, damit»der Son dereinsatz«keine»sensationelle, bald vergessene Episode wird«. 109 Die Landeskirche entsprach diesen begründeten Vorschlägen nur zum Teil. In einem Schreiben an Leipski und Disselbeck vom wurde der»urlaub zum praktischen Dienst im Ruhrkohlenbergbau«mit Wirkung vom (!) für beendet erklärt. 110 Beiden wurde herzlich gedankt für ihre»schwere Arbeit«und»Opferbereitschaft«. Ihnen wurde ein Erholungsurlaub vom bis gewährt, unter Zahlung der Hilfspredigerbezüge aus landeskirchlichen Mitteln. Auch für die Zeit danach war schon Vorsorge getroffen. Helmut Disselbeck wurde in Marl-Drewer Süd zum Pfarrer gewählt und bereits im Februar 1958 in die Pfarrstelle eingeführt. Gert Leipski wurde zunächst ab als Hilfsprediger in die Kirchengemeinde Bochum-Hamme eingewiesen. Viel Zeit für die erwünschte und angemahnte Nacharbeit blieb da nicht. Dabei war mit der Beendigung ihres Einsatzes auch das öffentliche Interesse an ihren Erfahrungen wieder stark angestiegen. Man 58
59 Mitteilung des Landeskirchenamtes an Helmut Disselbeck zur Beendigung des Bergbaujahres (LkA EKvW, 1 neu 0488). wollte wissen, was sie bewirkt und verändert hatten, welches Fazit sie zo gen und ob es eine Fortsetzung dieses Projektes geben würde. Leip ski und Disselbeck wurden von Zeitungsjournalisten interviewt und waren ge fragte Referenten bei Veranstaltungen des Sozialamtes, bei Ge werkschafts seminaren, Begegnungstagungen zwischen Kirche und Arbeitswelt, in in teressierten Arbeitskreisen, etc. Dabei ging die Auf merk samkeit der Öffent lichkeit weit über Westfalen und das Ruhr gebiet hinaus. Der Evangelische Pressedienst (EPD) berichtete von den noch frischen Erfahrungen der»gedingeschlepper in etwa 1000 Meter Tiefe«111 : Sie wollten als ordinierte Pfarrer, als Kirche, einfach für die Kumpel da sein. Die Schwere der Arbeit bestimmte ihr Leben ebenso wie das der anderen Arbeiter. Nach anfänglicher Zurückhaltung der Kumpel ent stand langsam ein Vertrauensverhältnis. So hörten sie von der Angst der Bergleute vor früher Arbeitsunfähigkeit (Silikose u.a.), und sie konn- 59
60 ten das berechtigte Bedürfnis nach»einem behaglichen Heim«nachvollziehen, nach Wohnkomfort und etwas Wohlstand. Ausdruck dafür war u.a. der Wunsch nach einem Fernseher. Auf Dauer bedrückte sie aber die Unvereinbarkeit von Bergarbeit und geistlichem Leben. Von Mainz-Kastel aus blickte man aufmerksam auf die zu erwartende Auswertung dieses Experimentes. Aber auch die im Januar 1956 unter Leitung von Harald Poelchau konstituierte ASIA, die bundesweite Arbeits gemeinschaft der Sozial-, Industrie- und Arbeiterpfarrer, hatte großes Interesse an dem Projekt und seinen möglichen Konsequenzen. 112 Rückblick und Ausblick: der Erfahrungsbericht Während ihres Erholungsurlaubes trugen Leipski und Disselbeck ihre Er fahrungen zusammen und schrieben an einem ausführlichen Bericht für die Kirchenleitung. Die erste Fassung stand noch ganz unter dem Ein druck ihres subjektiven Erlebens. Sie schilderten Begegnungen und Er lebnisse und begründeten damit ihre pointierten Einschätzungen. Sie gaben eine lebendige Beschreibung des Arbeitsalltags, des Denkens, Lebens und Handelns der Bergleute, aber auch der Arbeitsorganisation der Betriebe. Das strukturelle wie persönliche Verhalten von Betriebsrat, Füh rungspersonal und Betriebsleitung wurden kritisch betrachtet. Sie beleuch teten das Familienleben der Arbeiter, ihre Einstellung zu Politik und Kir che und zogen daraus Konsequenzen für kirchliches Handeln. Diese präg nanten Schilderungen, erwachsen aus gleichermaßen solidarischem Mit erleben und kritischem Betrachten, vermittelten Außenstehenden einen so authentischen Einblick in die Welt der Bergarbeiter, wie es ihn bis her in dieser Form kaum gegeben hatte. In einer»einleitung«gaben Leipski und Disselbeck Rechenschaft über die Gründe für ihren Einsatz unter Tage, blickten dann kritisch auf 60
61 Er reichtes und unterbreiteten Vorschläge für eine Weiterarbeit. Darauf folgten die Kapitel»I. Der Mensch und seine Arbeit«,»II. Der Mensch und sein Mitmensch«,»III. Der Mensch außerhalb des Betriebes«und»IV. Der Mensch und die Kirche«. 113 Diese Kapitel waren jeweils in mehrere Unterabschnitte unterteilt. Am umfangreichsten waren die Kapitel I und IV. Zunächst aber begründeten sie ihren Schritt unter Tage : Sie wollten die»einheit von Wort und Tat«leben, damit» die Arbeiterschaft selbst etwas von der Echtheit und Wahrhaftigkeit kirchlichen Denkens und Handelns spürt «Sie erhofften sich einen» Abbau des Vorurteils gegenüber der Kirche durch ein tathaftes Zeugnis in der gemeinsamen Arbeit«und wollten unter Beweis stellen,» daß die Kirche den Arbeiter neu, besser und richtiger sieht «114 Letzteres Ziel wurde ihrer Ansicht nach auch erreicht, denn:»durch unseren Einsatz ist das Bewußtsein entstanden, daß man sich um den Ar beiter wirklich kümmert Man hat es verstanden, daß die Kirche nicht nur redet, sondern auch ihr Wort ernst nimmt und es zur Tat werden läßt an einigen Stellen (wurde) ein beträchtlicher Abbau des Mißtrauens und der vielfachen Vorurteile «beobachtet. 115 Kritisch merkten sie an: Es war» nicht gut, auf verschiedene Schachtanlagen zu gehen straffere Schwerpunktarbeit wäre besser gewesen Man hätte uns nicht so schnell für verkrachte Existenzen gehalten.«im Blick auf ihre Gemeindeanbindung hielten sie es für wünschenswert,» mehr als bisher Amtshandlungen in Bergmannsfamilien «durchzuführen und häufiger zu predigen. Sie beklagten,» daß in demselben Maße, in dem sich die Einordnung in das Bergmannsdasein vollzieht, geistiges Interesse und geistliches Leben nachlassen «und erkannten, daß wir in stärkerem Maße gemeinsames Leben in einer Bruderschaft brauchten, als das bisher geschehen ist.«116 Sie ziehen daraus das Fazit:»Wir sind der Meinung, daß man solchen Dienst schwerpunktartig tun soll. Man sollte also im Raum Gladbeck bleiben, daß man von vornherein einen 61
62 leichteren Arbeitsplatz suchen soll, (und) daß eine gelebte Bruderschaft da ist, die durch ein gemeinsames geistliches Leben den ganzen Dienst trägt.«117 In den folgenden Kapiteln wurden sehr realistisch die Belastungen der Kumpel geschildert, die sich aus der körperlich schweren Arbeit, dem Schicht - system und der Betriebsorganisation ergeben, so wie die Aus wir kun gen dieser Beanspruchungen auf die»seelisch-geistige«verfassung der Berg leute. Hier beklagen die Pastoren eine»roheit«im Reden und im Ver hal ten:» das alles ist äußerst brutal und grenzt vielfach an Sadis mus.«diese Roh heit geht einher mit einer geistigen Müdigkeit, mit In tole ranz und Radi ka lismus. Ein Verhaltenskodex, der über Tage noch ak zep tiert wird, gilt unter Tage nicht mehr. Ein Beispiel dafür ist der belie bi ge Umgang mit Wahrheit und Lüge. Alles eine Folge der Menschen ver ach tenden Arbeits- und Lebensbedingungen, diagnostizieren die Be richt erstatter. 118 Auch wenn es um das Verhältnis der Kumpel untereinander, zum Betriebsrat oder zur Zechenleitung geht, nahmen die Pastoren kein Blatt vor den Mund. Ihre Schilderungen der Missstände sind drastisch, aber immer geprägt von Solidarität und dem Bemühen um Verständnis. Das betrifft auch die sog.»mittelschicht«im Betrieb, die Steiger und andere Verantwortliche der Mittelebene, die»von oben nach unten und von unten nach oben«zu vermitteln haben.»diese Leute der Mittelschicht tragen die Hauptlast des Kampfes um den Menschen im Betrieb. Hier muß die Kirche helfen.«119 Außerhalb der Zeche sehne sich der Bergmann nach Behaglichkeit und Ruhe.»Die ganze Familie muß sich notwendigerweise auf den Mann einstellen Von hieraus kommt der Frau in der Bergarbeiterfamilie eine ungemein wich tige und schwierige Rolle zu. Wichtig ist ihre Aufgabe insofern, als die gan ze Haushaltsführung ihr zufällt Verwaltung des Geldes Erziehung der Kinder Planung von Neuanschaffungen, Einhalten von Terminen für Ver sicherungen, für Ratenkäufe, für Geburtstage der Verwandten, das Ver- 62
63 hält nis zu den Nachbarn Wo diese vielfachen Aufgaben nicht bewältigt werden, wird der Haushalt schlampig, wie der Kumpel sagt.«120 Gert Leipski, der während seiner Bergarbeiterzeit eine Familie mit drei Kin dern zu versorgen hatte, kannte diese Probleme nicht nur vom Hören sagen. Hinzu kamen die häufig beengten Wohnverhältnisse. Selbst Leip skis eigene, relativ große und neue Zechenwohnung bot nicht ausreichend Platz für die fünfköpfige Familie. Sehr ausführlich behandelten die Pastoren die Frage, welche Konsequenzen ihre Erfahrungen für das kirchliche Handeln haben sollten. Sie konstatierten bei den Bergleuten eine grundsätzliche Akzeptanz der Institution Kirche, soweit sie sich als Erziehungshilfe für die Kinder bewährte und den Frauen und Alten Sinnstiftung, Betätigung und Hilfe bot. Außer bei den Amts handlungen zeigten sie jedoch kein eigenes Teilnahmeverhalten, ja begegneten den Repräsentanten von Kirche eher mit einem großen, auch ideologisch begründeten Misstrauen.»Immer da, wo das Mißtrauen gegen über der Kirche sich Luft macht, wird der Pastor angegriffen Wir fan den, daß nur eine echte Menschlichkeit der Gemeinde das Mißtrauen über haupt beseitigen kann.«121 Diese»Menschlichkeit«müsse darin ihren Ausdruck finden, dass man dem Bergmann»mit viel Liebe und Barm herzigkeit«begegne.»wer in der Welt der Arbeit verkündigen will, muß sich mit dem einen Thema begnügen Gott hat die Welt lieb «122»Liebe üben«müsse darum zur Handlungsmaxime für die Kirche, für die Gemeinde wie auch für die Pastoren werden. Was»Liebe üben«für den Pastor bedeuten kann, wurde in etlichen Variationen konkretisiert:»liebe üben heißt menschlich werden heißt, die Wirklichkeit sehen und in Rechnung stellen bedeutet, den anderen nicht überfordern einfach reden die Art des Anderen gelten lassen «123 Im Blick auf die Kirchengemeinde wurde das»liebe üben«vorrangig konkretisiert als ein stellvertretendes Leben für Andere.»Stellvertretung greift in alle Bereiche der Welt hinein und ist wahrzunehmen in der Verantwortung politischer, wirtschaftlicher und betrieblicher Gegebenheiten, soweit sie die Ebene 63
64 der Gemeinde angehen.«auch die»übernahme fremder Schuld«im Sinne der Ethik Bonhoeffers könne dazugehören. 124 Für die Kirche insgesamt wurden strukturelle Veränderungen angemahnt: eine Verstärkung der Sozialarbeit der Kirche, die Verpflichtung des theologischen Nachwuchses, sich mit den Fragen der Arbeitswelt ver - traut zu machen und die theologische Bearbeitung der Probleme der Gegenwart. 125 Würdigung des Einsatzes Eine erste fundierte Stellungnahme»zum Bericht der Pastoren Disselbeck und Leipski«verfasste am das Presbyterium der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gladbeck-Brauck:»Alle Presbyter stehen oder standen in Grossbetrieben und bestätigen, dass der Bericht die Welt des Bergmanns nicht zu schwarz malt Das Presbyterium ist beiden Pastoren um der Bergleute willen dankbar, dass sie die menschliche Not aufgesucht und im Bericht beim Namen genannt haben Über den Bericht hinaus scheinen uns 3 Fragen wichtig: Was ist an unserer Verkündigung falsch, wenn im Blickfeld des Bergar beiters das Evangelium erst durch den besonderen Dienst dieser beiden Pastoren eine Beziehung zum Leben des Bergmanns bekommen hat? Wenn aber bei zunehmender körperlicher Anspannung die geistige Leistungsfähigkeit bis auf den Nullpunkt absinken kann stehen wir dann wirklich vor der Alternative: entweder Christ oder Bergmann? Inhalt, Rhythmus, die ganze Struktur der Parochie stehen zur Arbeitswelt in so starkem Gegensatz, dass beide anscheinend unvereinbar sind. Sieht die Kirchenleitung dieses Problem?«126 64
65 Die Kirchenleitung erhielt jedenfalls, ebenso wie das Sozialamt, den Erfahrungsbericht, und er verfehlte seine Wirkung dort nicht. In Fortsetzung der Thematik»Verkündigung der Kirche heute«, die auf den Landessynoden 1954 und 1955 einen Schwerpunkt gebildet hatte, wollte die Kirchenleitung sich auch in Fragen der Seelsorge der veränderten Lebenswirklichkeit in den Gemeinden stellen. Bedrückend war weiterhin die Erkenntnis, dass sich ganze Bevölkerungsgruppen, vor allem in der Industriegesellschaft, von der Kirche entfernt hatten und durch die traditionelle Gemeindearbeit kaum noch erreicht wurden. Da rum suchte man nicht nur nach neuen Formen der Verkündigung, son dern auch nach neuen Formen der Seelsorge. Präses Wilm, aber auch Mitgliedern der Kirchenleitung, stand dabei in besonderer Wei se die Problematik im Industrierevier Ruhrgebiet vor Augen. Die Aktivi tä ten Klaus von Bismarcks und seine regelmäßigen Berichte an die Kir chen leitung hatten für die Entwicklungen dort sensibilisiert. Der Er fahrungsbericht von Leipski und Disselbeck lieferte zusätzlich authen tisches und aktuelles Anschauungsmaterial. Als dann 1958 ein lan des kirch liches Proponendum mit dem Titel»Neue Aufgaben der Seel sorge«den Gemeinden zur Diskussion gestellt wurde, bildete das Ka pitel»seel sorge in der Industriegesellschaft«einen deutlichen Schwer - punkt. 127 In seinem Bericht vor der Landessynode 1958 zitierte Präses Wilm um fangreich aus der ersten Fassung des noch unredigierten und nicht veröffentlichten Erfahrungsberichtes. 128 Er leitete es ein mit den Worten:»Hier müssen wir auch hören, was uns d i e b e i d e n j u n g e n P a s t o re n, die ein Jahr lang a l s B e r g l e u t e gearbeitet und gelebt haben, zu sagen haben. Sie wollten mit den Kumpels solidarisch werden und dieses eben doch in der Nachfolge dessen, der unser Bruder geworden ist Es geht dabei um die Solidarität der Barmherzigkeit mit dem andern, bei der ich mich ganz in seine Lage begebe, um ihm ganz nahe zu sein, ihn zu verstehen und ihn so dann auch liebhaben zu können «65
66 Es folgte ein langes Zitat aus»dem Bericht eines dieser beiden Pas toren«,u.a.:» Was wir als Verkündiger des Wortes Gottes diesen Menschen zu sagen haben, ist die Liebe Gottes zur Welt, ist: Gott hat dich lieb. Indem wir das sagen, wird dieser Mensch unser Bruder und Nächster, den man liebt. Wenn nun schon von Liebhaben die Rede ist, wird man auch davon sprechen müssen, daß Liebhaben und Liebe-Üben dasselbe sind. Die Einheit von Wort und Tat wird nirgends so deutlich wie bei dem Wort Agape. Die theologische Re flexion über Agape ist einwandfrei. Gearbeitet ist über diesen Begriff genug. Die Schwierigkeit fängt da an, wo wir den Menschen, der um Christi willen zu lieben ist, nun leibhaftig vor uns haben, mit seiner Rauheit, mit seinem Radikalismus und mit seiner Dummheit. Da wird die zweckfreie und spontane Liebe schwer. Und das ist gut so. An dieser Stelle werden wir nämlich daran erinnert, daß Zeugnisablegen und Liebe-Üben nicht anders sich ereignen kann als durch den Heiligen Geist. Und ureigenste Sache desselben Geistes ist es auch, wenn unser Zeugnis, unser Zuspruch und unsere Liebe gehört und bekannt und als Anspruch anerkannt wird «129 Präses Wilm berichtete auch, wie der Einsatz der beiden Pastoren von dem Braucker Gemeindepfarrer von Bremen beurteilt wurde, der den Te nor des Presbyteriumsbeschlusses seiner Gemeinde aufnahm:»der Einsatz dieser beiden Pastoren hat gezeigt, daß trotz aller Bemühungen noch eine weite Distanz zwischen der Arbeiterschaft und der Kirche besteht. Es ist bei diesem Einsatz gelungen, viele Mißverständnisse und Mißtrauen gegenüber der Kirche und den Pastoren abzubauen. Die Arbeiter bei uns beginnen, ohne sich selbst am Gemeindeleben zu beteiligen, die Kirche zu beobachten, soweit sie im öffentlichen Leben eine Rolle spielt und dem Arbeiter helfen kann. Man will feststellen, ob die Kirche sich wirklich verändert hat und man als Arbeiter ihr Vertrauen schenken kann. Die Meinung, dass die Kirche nur zur Klasse der Besitzenden hält, ist durch diesen Einsatz in 66
67 Frage gestellt worden. Eine sichtbare Vergrößerung der Kerngemeinde ist nicht erfolgt Der Einsatz hat der Gemeinde deutlich gezeigt, daß wir falsche Anforderungen an den Arbeiter bezüglich seiner Mitarbeit am Gemeindeleben stellen. Ein Bergmann, der in Wechselschicht arbeitet, kann nicht regelmäßig am Gottes dienst, an der Bibelstunde und am Männerkreis teilnehmen. Wir pflegen noch weithin treue Gemeindeglieder solche Personen zu nennen, die regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen und darüber hinaus einen Gemein dekreis besuchen. Die beiden Pastoren konnten in unserer Gemeinde in diesem Sinne nicht als treue Gemeindeglieder bezeichnet werden, nur weil sie in Wechselschichten gearbeitet haben und in ihrer Freizeit oft so müde waren, daß sie nicht mehr die Kraft hatten, einen Gemeindekreis zu besuchen.«130 Von Bismarck hatte in einem Vortrag pastorale Schlussfolgerungen aus dem Erfahrungsbericht gezogen. Diese nahm der Präses auf:» Die Bewußtwerdung der eigenen soziologischen Einbindung ist aber gefordert, wenn man mit Menschen sprechen will, die an einer anderen Stelle des sozialen Gefüges eingebunden sind als normalerweise der Theo loge oder kirchliche Mitarbeiter. Der Arbeiter hat beispielsweise viele Lebensprobleme, die dem Pfarrer fremd sind, und der kirchenfremde Mensch spricht in anderer Weise über Fragen des inneren Lebens als das Gemeindeglied Es geht hier um mehr für die Kirche als um eine bestimmte Aktion der Sozialarbeit. Denn die Bemühung, die Sprache von Menschen außerhalb der christlichen Gärten kennenzulernen, sich an andere Menschen aufgrund ihrer eigenen Fragen heranzutasten, ist Bemühung um Sendung der Kirche, ist Bemühung der Christen, Nächster zu werden.«131 Diese Schwerpunktsetzung des Präses in seinem Bericht bestimmte auch im Fortgang die Diskussionen und Beschlüsse der Synode zum Thema. So weist die Entschließung zur»seelsorge in der Industriegesellschaft«in der Beschreibung der Situation, der Herausforderungen und der kon- 67
68 kreten Aufgaben deutliche Parallelen zum Erfahrungsbericht aus dem Bergbau auf. Dessen realitätsnahe Schilderungen werden zum Teil wörtlich aufgenommen. 132 Das Proponendum, die Entschließungen und Beschlüsse der Lan dessynode hierzu und der für den Druck überarbeitete Erfahrungs bericht von Leipski und Disselbeck erschienen noch 1958 in einer eigenen Ver öffent lichung und wurden so einer größeren kirchlichen, aber auch ge sellschaftlichen Öffentlichkeit bekannt. 133 Der Einfluss ihrer Schil derun gen auf die kirch liche Meinungsbildung zur Arbeiterfrage kann kaum überschätzt wer den. Die Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit der Bergarbeiter und der Arbeitsstrukturen auf den Zechenanlagen bildete eine solide Basis, als wenige Jahre später die Kohlekrise das Revier erschütterte und auch die Kir che zur Positionierung herausforderte. Der Erfahrungsbericht fand aber auch ein breites Echo bei den Zechenleitungen und in der Gewerkschaft. Von Bismarck hatte den Bericht schon vor der Veröffentlichung vervielfältigt, um ihn bei verschiedenen Veranstaltungen zu diskutieren, so im»koordinierungsausschuß der Gemeinsamen Sozialarbeit der Konfessionen im Bergbau«oder im sog.»kommen dekreis«, einem Gesprächsforum, dem etwa 100 Werks direk toren und einige Betriebsdirektoren angehörten. 134 In diesen Kreisen wurde der Bericht nicht durchweg wohlwollend und positiv aufgenommen. Die Betriebsleitungen hielten einige der Schilderungen für übertrieben und die Urteile für zu pauschal, zum Teil auch für verletzend. Der Bericht erschien ihnen nicht geeignet, in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert zu werden. 135 Für eine Verbreitung in der Arbeiterschaft sorgte, jedoch erst einige Jahre später, die Gewerkschaft. In der»gewerkschaftlichen Rundschau«1963 wurde der vollständige Erfahrungsbericht unter der Überschrift»Wir sind ja nur moderne Sklaven «in drei Folgen abgedruckt. 136 Das Experiment von Gert Leipski und Helmut Disselbeck wurde in der Evangelischen Kirche von Westfalen so nicht wiederholt. Es gab jedoch zwei Theologen, die in einer deutlich modifizierten Konstellation 68
69 noch einmal versuchten, die Arbeit im Bergwerk mit dem Dienst als Pas tor zu verbinden. Wilhelm Huft und Christian Schröder hatten im Son dervikariat an dem Projekt der kirchlichen Industriearbeit von Horst Sy manowski in Mainz-Kastel teilgenommen haben sie dann im Hilfs dienst in der Kirchengemeinde Gelsenkirchen-Buer-Hassel das Arbei ten unter Tage mit dem Gemeindepfarramt kombiniert, und zwar alter nierend im halbjährigen Wechsel. Einer arbeitete jeweils auf der Ze che, der andere in der Gemeinde. Aus ihren Erfahrungen ergab sich dann die Konzeption für ein»gemeindenahes«industrie- und Sozialpfarr amt im Kirchenkreis Gelsenkirchen, das Christian Schröder 1963 übernahm. 137 In der Ausbildungsordnung für die Theologiestudenten der Evange lischen Kirche von Westfalen stand schon seit Längerem:»Die Werkarbeit bietet eine wertvolle Möglichkeit, die wissenschaftliche und geistliche Zurüstung auf das Pfarramt nach der praktischen Seite zu ergänzen. Es ist für zukünftige Amtsträger unerläßlich, daß sie unmittelbare Anschauung vom Leben der Menschen erhalten, denen ihr späterer Dienst gilt, und daß sie die Bereitschaft aufbringen, die Arbeitsbedingungen gerade der handarbeitenden Menschen zu teilen. Es wird erwartet, daß bei der Meldung zur ersten theologischen Prüfung sechs Werkarbeitsmonate nachgewiesen werden können, sei es, daß sie als ein besonderes Werksemester, sei es, daß sie während der Semesterferien abgeleistet werden.«138 Ab 1960 wurde nun ein sechswöchiges Industriepraktikum verpflichtend, das vom Sozialamt begleitet wurde. Abgesehen von diesen Einzelphänomenen aber blieb das Jahr, das Gert Leipski und Helmut Disselbeck im Bergbau verbracht hatten, in der kirchlichen Landschaft eine Episode. 69
70
71 Gemeindearbeit im Schatten von Robert Müser Für Gert Leipski allerdings war das Jahr im Bergbau alles andere als eine Episode. Vielmehr hatte er seinen Platz in der Kirche gefunden, und der war an der Seite der Bergleute und ihrer Familien. Darum kam für ihn nichts anderes in Frage, als Pfarrer in einer Bergarbeitergemeinde zu werden. Auf Umwegen nach Bochum-Werne Die erste Einweisung 1957 als Hilfsprediger nach Bochum-Hamme trug dem nur zum Teil Rechnung. Die Kirchengemeinde war in ihrer Sozial- und Frömmigkeitsstruktur wenig homogen. Es gab zwar einen beträcht lichen Anteil Arbeiter, die im Stahl- und Hüttenwerk Bochumer Ver ein oder auf der Zeche Carolinenglück beschäftigt waren. Es war aber auch ein eher bürgerliches Milieu vertreten, das über Einfluss in der Kirchengemeinde verfügte. Diese Gemeindeglieder hatten Schwierigkeiten mit dem unkonventionell und gelegentlich impulsiv auftretenden Hilfs prediger Gert Leipski. 139 Harry Nodorf 140 schrieb damals besorgt an Helmut Disselbeck:»Etwas Sorge habe ich um den Einsatz von Gerd. Die mit vielen Schwierigkeiten verbundene Pfarrerstelle in Bochum-Hamme scheint mir nicht die richtige Be heim atung unseres liebenswerten, aber an manchen Stellen ex plosiven Gerd zu sein Ohne eine gelassene und weise Hilfe durch einen älteren Amts bruder, der auch die persönliche und familiäre Situation 71
72 von Gerd mit voll in den Blick nimmt, wird sich Gerd möglicherweise nach kurzer Zeit für eine Weitergabe der Erfahrungen des Arbeitsjahres selbst disqualifizieren «141 Als die Pfarrstelle der Gemeinde neu zu besetzen war, wurde darum nicht, wie weitgehend üblich, der Dienst tuende Hilfsprediger, sondern ein anderer Kandidat gewählt. Die Gemeinde war darüber gespalten, und es gab Einsprüche gegen die Wahl. Gert Leipski wollte erst die Ent scheidung über die Einsprüche abwarten und zögerte, sich woanders wäh len zu lassen. Die Einsprüche führten jedoch nicht zu einer Änderung des Wahlergebnisses. Dem Landeskirchenamt lag sehr daran, Leipski so schnell wie möglich aus der konfliktreichen Situation in Hamme abzuziehen und ihm an anderer Stelle einen Neuanfang zu ermöglichen. Man beabsichtigte, ihn zunächst noch im Hilfsdienst nach Bochum-Werne zu schicken und ihn dann auf die dort frei gewordene Pfarrstelle zu präsentieren. Leipski, der in Hoffnung auf die Pfarrstelle in Hamme etwas voreilig in die dortige Gemeinde gezogen war, wollte nicht noch einmal auf Verdacht um ziehen. Darum bestand er darauf, erst nach Werne zu ziehen, wenn dort die Einspruchsfrist für seine Pfarrwahl abgelaufen wäre. So blieb er noch bis Oktober in Hamme wohnen. Die gegen den Wunsch von Leipski vom Landeskirchenamt verfügte Einweisung zum als Hilfsprediger nach Werne wurde vom Bochumer Superintendenten Bach bis zur weiteren Klärung der Situation zunächst zurückgehalten. 142 Die Kirchenleitung wollte so schnell wie möglich Fakten schaffen und präsentierte ihn darum schon im September für die durch den Ruhestand von Pfarrer Wilhelm Schmerkotte frei gewordene 1. Pfarrstelle der Kirchen gemeinde Bochum-Werne. Gemeinden reagieren gewöhnlich mit Zu rück haltung oder gar Misstrauen darauf, wenn ihnen ein Kandidat durch die Kirchenleitung präsentiert wird. Wen wollte die Landeskirche da»unter bringen«und welche Gründe gab es dafür? Nach der persönlichen Vor stellung Leipskis wurden solche Bedenken jedoch zurückgestellt, und das Presbyterium wählte ihn zum Pfarrer seiner Gemeinde. 72
73 Am 26. Oktober 1958 erfolgte in einem feierlichen Gottesdienst die Einführung in die Pfarrstelle. Die fünfköpfige Familie zog in das alte Pfarrhaus neben der Kirche in der Kreyenfeldstraße 32. Bald wohnte auch Leipskis Mutter bei ihnen. Im Sommer 1959 wurde die vierte Toch ter geboren. Was fand der neue Pfarrer in seiner Gemeinde vor? Werne war, wie so viele Stadtteile im Ruhrgebiet, ursprünglich eine Bauerschaft. Im Bochumer Osten gelegen, zwischen Harpen und Langen dreer, veränderte Werne sich etwa ab 1860 grundlegend im Zuge der industriellen Entwicklung.»Es war die Zeit, in der die Schächte der Zechen Heinrich-Gustav, Amalia und Vollmond abgeteuft wurden und wenig später die Drahtwerke die Produktion aufnahmen. Das sorgte dafür, dass immer mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit nach Werne kamen, und dass auch baulich eine Verstädterung einsetzte, die dem Ort ihren Stempel aufdrückte Werne war bis in die jüngste Zeit vor allem ein Bergarbeiter-Vorort. Zentrale Schachtanlage war zuletzt die Zeche Robert Müser, die als Verbundbergwerk aus mehreren älteren, bis dahin selbstständigen Zechen der Harpener Bergbau AG entstanden war. Das Bergwerk, das seinen Namen am 1. Juli 1929 nach dem langjährigen Vorstands- bzw. Aufsichtsratsvorsitzenden der Har pe ner AG Robert Müser erhalten hatte, war der größte Arbeitgeber in Werne.«143 Als Gert Leipski 1958 nach Werne kam, hatte die Bevölkerung mit etwa Einwohnern ihren Höchststand erreicht. In dem Stadtteil, der 1929 nach Bochum eingemeindet worden war, waren große Teile der ehemaligen Siedlungsfläche durch die In dus trie - anlagen belegt. Der Rest wurde zerschnitten durch die Gleise von Eisenbahn und Werksbahnen, durch städtische Durchgangsstraßen und den Ruhrschnellweg, die spätere A 40. Jeweils dazwischen waren mehr oder weniger kleine Wohnsiedlungen, die Bergarbeiter-Kolonien, entstanden: 73
74 Postkarte von ganz im Norden, bei der Zeche Amalia, die Siedlung Kreta, in der Nähe des Dorfkerns, aber nördlich des Werner Hellwegs die Siedlungen Deutsches Reich und 12 Apostel, sowie der sogenannte D-Zug. Südwestlich der Schachtanlage Robert Müser und der Eisenbahn gab es die Vollmond-Siedlung. Diese Siedlungslage bildete auch die Grundstruktur für die Aufteilung der Kirchengemeinde Bochum-Werne in die Pfarrbezirke war die 4. Pfarrstelle und damit der vierte Pfarrbezirk in der Gemeinde ein gerichtet worden. Die Gemeindegliederzahl lag 1958 bei und hatte damit fast ihren Höchststand erreicht, bevor sie seit Anfang der 60er Jahre wieder kontinuierlich abnahm hatte die Kirchengemeinde nach großen Anstrengungen die Kriegs schäden an ihren Gebäuden im Wesentlichen beseitigt. Die Kirche, das Ge meindehaus und die Pfarrhäuser waren mehrfach durch Bomben be schädigt worden, aber inzwischen wieder aufgebaut und gründlich reno- 74
75 viert. 145 Nun ging man daran, für die Zukunft zu planen. Im Ge meindeteil Kreta sollte ein kleines Gemeindezentrum gebaut werden. Für den 1. Pfarrbezirk, in dem Gert Leipski Pfarrer wurde, war bereits 1957 ein Architekt mit der Planung eines Gemeindezentrums beauftragt worden. Der 1. Pfarrbezirk lag im Südwesten des Stadtteils. Von der Kirche, dem Gemeindehaus und dem Pfarrhaus war er durch das Zechengelände von Robert Müser und durch breite Gleisanlagen getrennt. Wer etwa in der Vollmondsiedlung wohnte, hatte einen weiten Weg zur Kirche. Der Konfirmandenunterricht fand darum in der nächstgelegenen Volksschule statt. Es legte sich nahe, für diesen Bezirk einen eigenen Got tesdienstraum zu schaffen. Wie zu der Zeit üblich, plante man gleich ein ganzes Gemeindezentrum, mit Gruppenräumen, Pfarrhaus, Mit ar bei terwohnungen und Kindergarten. In der Kirchengemeinde hatte Gert Leipski zwei ältere Amtsbrüder. Helmuth Beckmann im 2. Pfarrbezirk war fast 50 Jahre alt. Seit 1937 war er zunächst als Hilfsprediger in der Gemeinde, 1938 konnte er dann in die Pfarrstelle eingeführt werden. Während des Krieges wurde er zum Waffendienst eingezogen und kam erst 1946 aus der Kriegsgefangenschaft in die Gemeinde zurück. Er blieb noch bis zum November 1972 in der Werner Pfarrstelle. Pfarrer des 3. Pfarrbezirks war Alfred Thieme, damals schon 65 Jahre alt. Er ging im folgenden Jahr in den Ruhestand. Sein Nachfolger, Heinz Herden, war der Amtsbruder, mit dem Leipski bis zu seinem Ruhe - stand in Werne trotz aller Unterschiede der Persönlichkeiten gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten würde. Die erst 1955 eingerichtete 4. Pfarrstelle war mit dem dritten Kollegen, Walter Rey, besetzt. Er war nur zwei Jahre älter als Gert Leipski und blieb bis 1962 in Werne. Danach kam der etwas jüngere Karl-Heinz Supplie, der bis 1969 blieb. Die evangelische Kirchengemeinde Bochum-Werne war eine typische Ruhr gebietsgemeinde, geprägt durch das Leben der Bergarbeiter. An fang 75
76 des 20. Jahrhunderts hatte es hier, wie auch in anderen Teilen West falens, eine Erweckungsbewegung gegeben. In der Folge wurde ein Blau kreuzverein gegründet und die Jünglingsarbeit intensiviert. Darü ber hinaus gab es bald einen Frauenverein und ein Bibelkränzchen für hö here Schüler. 146 Wenn sich auch die Formen einer individuellen, erwecklichen Fröm migkeit nicht nachhaltig etablieren konnten, so haben die in der Zeit und im Geist der Erweckung gegründeten Gemeindekreise doch prägenden Einfluss auf Struktur und Selbstverständnis der Gemeinde gehabt. Schon mehrfach in der Gemeindegeschichte hatten die evangelischen Christen in Werne selbstbewusst ihre Ziele verfolgt und durchgesetzt. Im Dritten Reich widerstanden sie zusammen mit ihren Pfarrern den Versuchen der Deutschen Christen, Einfluss zu gewinnen. Mit Entschieden heit schlossen sie sich der Bekennenden Kirche an. Pfarrer und Gemein de wuchsen in der Zeit der Bedrängnis zusammen. In dieser Geschlos senheit stand man auch den Bombenkrieg und den Wiederaufbau nach Kriegsende durch. Die neue Zeit hielt aber nun auch neue Herausforderungen bereit. Mit Gert Leipski hatte die Gemeinde einen Pfarrer bekommen, der diese Heraus forderungen erkannte und sich ihnen stellte. Anfänge der Gemeindearbeit Leipski bekam schnell Kontakt zu seinen Gemeindegliedern. Vielen der Bergarbeiter schien er einer der Ihren zu sein. Er sprach ihre Sprache, kannte die Arbeit unter Tage, war Mitglied in der Gewerkschaft und stand der SPD nahe. 147 Er zeigte nicht ansatzweise ein Verhalten, das man als pastoral hätte bezeichnen können. Mindestens einmal im Mo- 76
77 Evangelische Kirche Bochum-Werne. Foto: privat. 77
78 nat fuhr er auf Robert Müser unter Tage ein und hielt so Kontakt zu den Bergleuten an ihrem Arbeitsplatz, aber auch zu den Steigern und der Unternehmensleitung. Aus aktuellen Anlässen traf man sich in Gesprächsgruppen oder zu Diskussionen im Pfarrhaus. Jährlich im Mai wurden besondere Bergmannsgottesdienste gefeiert. Bald schon galt Gert Leipski als der Bergmannspastor und wurde als solcher geachtet. 148 Der Knappenverein Glück Auf Bochum-Werne 1884 ernannte ihn per Beschluss zum»bergmannspfarrer«. 149 Bei allem Engagement für die Bergarbeiter war Leipski aber ein ganz normaler Pfarrer seiner Gemeinde. Er feierte Gottesdienste, taufte Kin der, traute Paare, beerdigte die Verstorbenen. Er hielt Andachten in der Frauenhilfe, unterrichtete eine große Zahl von Katechumenen und Kon firmanden und machte Hausbesuche. Bei vielen Gemeindegliedern kam seine unkonventionelle und saloppe Art des Umgangs gut an. Mal an zu ecken galt im Ruhrgebiet nicht grundsätzlich als Nachteil. Man sagte höchstens:»besser so, als aalglatt.«andere meinten jedoch von einem Pfarrer ein wenig mehr Zurückhaltung und Bedachtsamkeit und ins gesamt ein konventionelleres, kurz pastorales Verhalten erwarten zu dürfen. In seinen Erinnerungen schildert Leipski humorvoll einige Begeg nungen aus seiner ersten Zeit in Werne:»Im Sommer es war ein sehr heißer gewesen machte ich Ge meindebesuche. Ich war normal gekleidet, hatte die Sonnenbrille meiner Frau auf (ich glaube, sie war rot!). Als ich bei einer Familie schellte [und mich als Pastor vorstellte, Erg. d. Vf.], da fing die Frau an zu lachen, stemmte die Hände in die Seite und sagte: Machen Sie nochmal so einen Witz! «150 Oder:»Um die Gemeinde besser und schneller kennenzulernen, machte ich bei den Sammlungen für die Innere Mission mit So kam ich dann einmal in eine Familie, es war ein älteres Ehepaar. Auf meine Bitte um eine Spende antworteten sie nur, daß sie selber nichts hätten. Aber da war gerade ein 78
79 Zechenmaurer in der Wohnung, der etwas reparierte. Der kannte mich schon. Er begrüßte mich und fragte, was ich hier machte. Ich erzählte ihm, daß ich für die Innere Mission sammle. Da meinten die Eheleute: Selbstverständlich geben wir ihnen auch etwas. Meine Antwort: Jeder, der von der Gemeinde kommt, ist genauso viel wert. Haben Sie vorher nichts gegeben, dann brauchen Sie es jetzt für den Pastor auch nicht zu tun! «151 In der Seelsorge konnte er frei und innig mit Menschen beten oder auch mit ihnen einen Liedvers singen, Frömmigkeitsformen, die ihm seit seiner Kindheit von seiner ostpreußischen Mutter vertraut waren. Im Got tesdienst traute er sich, Neues und Ungewohntes auszu pro bie ren:»so hatten wir in einem Jahr zur Konfirmationspredigt mit Jugendlichen besprochen, was wir wohl machen könnten. Wir kamen überein, daß gleich nach Verlesung des Predigttextes einer von ihnen nach vorne stürmt und so einen kurzen Kommentar dazu beginnen sollte: Das glauben Sie doch selber nicht! Sofort wurden Stimmen laut: Schmeißen Sie ihn raus! So geht das nicht! Aber es war sofort die richtige Stimmung da, die dann auch alle zuhören ließ.«152 Zum Erntedankfest lag mal statt der üblichen Kartoffeln und Kohlköpfe ein unlackierter Kotflügel aus dem Opel-Werk am Altar. Gert Leipski war in seiner Gemeinde angekommen. Er fühlte sich am rechten Ort und die Gemeinde war der Meinung, den für sie richtigen Pfarrer gefunden zu haben. Im Mai 1962 wurde am Anemonenweg der Grundstein für das Gemeindezentrum seines Pfarrbezirks gelegt. Das würde ihm noch bessere Möglichkeiten für eine wohnortnahe Gemeindearbeit eröffnen. So schien alles bestens zu laufen in der Bergarbeitergemeinde mit ihrem Bergmannspastor wenn nicht die Krise des Bergbaus selbst immer stärker auch in Werne zu spüren gewesen wäre. 79
80 Visitation durch den Kirchenkreis 1962 Im November 1962 fand in der Kirchengemeinde Werne eine Visitation durch den Kirchenkreis statt. Der ausführliche Visitationsbericht spiegelt schon die noch diffuse, aber doch deutlich spürbare Angst der Bergleute vor möglichen Zechenschließungen:»Werne ist eine Bergarbeitergemeinde. Die wenigen Klein- und Mittelbetriebe fallen kaum ins Gewicht. Wenn ein neuer Direktor der Zeche im Volksmund als Totengräber bezeichnet wird, so kennzeichnet sich darin die Not, daß man auch in diesem Teil der Stadt Bochum die Schließung des Bergwerks befürchtet. Selbst wenn die Zeche in Werne nicht stillgelegt wird, so hat man davor Angst, daß durch Stillegung anderer Gruben für die dortige An lage Nachteile und Schwierigkeiten (z.b. Wassereinbruch etc.) entstehen könnten. Unsere Pfarrbrüder haben eine ernste seelsorgerliche Aufgabe.«153 Mit großer Anerkennung stellten die Visitatoren fest, dass der»pfarr bruder«gert Leipski sich dieser Aufgabe stellte:»bruder Leipski fühlt sich in besonderer Weise für die werktätige Be völkerung verantwortlich Er hält es für seine Pflicht in jedem Monat mindestens ein Mal anzufahren im Bergwerk. Bei unserem Besuch auf der Zeche zeigte es sich, daß er dort sehr bekannt war Bei der Grubenfahrt wurde Pfarrer Leipski an vielen Stellen von den Bergleuten begrüßt Auch beim Betriebsrat ist Bruder Leipski ein gern gesehener Mann. Er selbst gehört der I.G.-Bergbau als Mitglied an. In einer Gewerkschaftsversammlung, an der wir teilnahmen, hielt er das Referat. Wir freuten uns, wie schnell man zu zentralen Fragen kam und vom Christentum her sich eine Antwort geben ließ, nun nicht mit frommen Worten, aber im Geiste des Evangeliums. 80 Die Kontaktfreudigkeit von Bruder Leipski ist sehr erfreulich Manches Mißtrauen gegen die Kirche wird auf solchen Wegen abgebaut. Bei einer
81 Zusammenkunft mit Bergleuten im Hause Leipski hatten wir den Eindruck, daß die Bergleute das geistliche Anliegen ihres Pfarrers ernstnehmen.«154 Aber auch die Kritik, die Leipski durch sein parteiliches Engagement und seine Amtsführung provozierte, blieb den Visitatoren nicht verborgen:»natürlich muß man fragen, ob die äußeren Belange nicht überwiegen und es nicht zu einer Einseitigkeit kommt. Klar ist uns aber geworden, daß das Hauptanliegen von Pfarrer Leipski ist, Menschen mit dem Wort zu kon frontieren und Seelsorge zu üben. Der Gottesdienst steht im Mittelpunkt. Gewiß bewegen unseren Amtsbruder neue Formen, das alte Evangelium soll neu werden und Kraft bekommen. Gewiß wird es immer wieder Gemeindeglieder geben, die an dem jugendlichen Stürmer Anstoß nehmen. Wer ihn aber ernst nimmt, der erkennt, daß hier ein glühendes Herz für Christi Sache ist.«155 Dankbar wurde auch wahrgenommen, dass er über die Gewerkschaft Menschen ansprechen konnte, mit denen die Kirche sonst nicht so leicht ins Gespräch kam, und dass auch sachlich kontrovers mit ihm diskutiert werden konnte:»außerdem brachte P.L. den 20 Kollegen (d.i. bei der I.G.-Bergbau-Versammlung) sehr schön die Auffassung unsrer evang. Denkschrift über die Eigentumsbildung in sozialer Verantwortung bei, obwohl er über einen Artikel aus der Gewerkschaftszeitschrift Der Funktionär referierte Wir fragten, ob nicht bei P.L. gewerkschaftliche Einseitigkeit vorläge, konn ten aber keine mangelnden Bemühungen um die Unternehmerseite fest stellen Die 90 % Anderen, das ist P.L. s Frage Dies und seine jugendliche Kompromißlosigkeit in seiner Seelsorge für den Bergmann führen naturgemäß hie und da zu Verstimmungen altförmlich eingestellter Gemeindeglieder und Unternehmer. Doch allgemein wird von seinen sachlichen Gegnern anerkannt: Der Pfarrer gefällt uns, denn er tut wenigstens was! «156 81
82 Dennoch musste die Frage gestellt werden, wie er bei seinem sozial politischen Engagement und seiner Parteinahme für die Bergleute als Mann der Kirche erkennbar blieb. Ihre Sorge in dieser Hinsicht ver banden die Visitatoren mit einem ganz praktischen Ratschlag für das im Bau befindliche Gemeindezentrum:»Wenn bei dem notwendigen Suchen P.L. s nach neuen Wegen der Verkündigung nicht die Kirche doch zum Schluss entkirchlicht werden soll, muss alles getan werden, um sein neues Zentrum wirklich auch als Kirche sichtbar zu machen: In den Kirchenraum keine Rohrstühle, sondern Kirchenbänke, und vor allem ein Kirchturm mit Glocken!«157 Beides wurde so nicht umgesetzt. Aber ein großes Kreuz an der Außenwand des Gottesdienstraumes zeigte deutlich den kirchlichen Charakter des Gemeindezentrums. Die Visitatoren verstanden ihre Aufgabe u.a. auch als Seelsorge an den Seel sorgern. Darum gab es Besuche in den Pfarrhäusern und Einzel gesprä che mit den Amtsbrüdern. Selbstverständlich war nicht alles, was man da sah und hörte, für die Öffentlichkeit bestimmt, aber einige Punkte wurden doch im Visitationsbericht festgehalten. Über Gert Leip ski berichteten sie:»sein Lebenswandel ist aufrichtig und maßvoll. Seine Frau ist trotz ihrer vier kleinen Kinder eine tüchtige Pfarrfrau, die ganz zu ihrem Manne steht und aktiv am Gemeindeleben teilnimmt.«158»das Pfarrhaus Leipski ist für alle Gemeindeglieder sehr offen. Insbesondere Kreise, die sich mit sozialen Fragen beschäftigen, tagen dort. Man hat den Ein druck, daß alle sich wohlfühlen. Bruder Leipski hat oft mit dem Kon ventionellen gebrochen. Dadurch schockiert er manche Gemeindeglieder. Aber man freut sich, daß man ihm alles sagen kann.«159 Zum Verhältnis der Amtsbrüder untereinander wurde angemerkt: 82
83 »Zur Zeit noch äußerlich einwandfrei brüderlich. Doch steht P.L. bereits innerlich in der Gefahr, einsamer zu werden durch sein Ernstnehmen des missio narischen Auftrages und seine Aktivität. Solange seine jüngeren Brü der noch immer Ja sagen und keine eigene sonderliche Aktivität ent wickeln, mag s noch gehn. Schritthalten mit P.L. können sie nicht. Er ist bereits inner lich etwas einsam. Wir haben ihn ganz herzlich an den älteren Bruder P. Beckmann gewiesen und P. Beckmann besonders um seine Liebe und Hilfsbereitschaft für den Bergmannspastor L. gebeten. Das bestehende Vertrauensverhältnis ermutigte uns dazu.«160 Die Visitatoren waren mit offenen Augen und Ohren durch Werne gegangen und hatten mit Achtung und Wohlwollen wahrgenommen, was für einen besonderen Pfarrer sie mit Gert Leipski in der Gemeinde hatten. Sie spürten»seine Liebe zu seiner Gemeinde«und eine»nicht alltägliche Zuneigung«seitens weiter Teile der Gemeinde zu ihm. Ja sogar» daß seine Konfirmanden ihn lieben war im Unterricht zu merken«. 161 Man sah die besonderen Gaben, die er mitbrachte, seine aus tiefer Frömmigkeit gespeiste Sorge um die ihm anvertrauten Menschen, gepaart mit der Fähigkeit, diese Menschen in ihrer Sprache anzureden und ihr Vertrauen zu gewinnen. Dazu kamen große Energie und Uner müdlichkeit in seinem so weit verstandenen pastoralen Dienst. Man sah aber auch die Grenzen, die sein Charakter und seine Impulsivität ihm setzten, und die Grenzen, an die er bei der Bewältigung seiner Aufgaben stieß. So sprach man am Schluss des Berichtes noch eine Empfehlung aus:»wenn P.L. ohne Vernachlässigung seiner allgemeinen Pfarrbezirksarbeit seinen Bergmanns- und Industriesonderauftrag erfüllen soll, müßte die Gemeinde Werne eine vollbeschäftigte Bürokraft bekommen «162 Sie bekam sie aber nicht, jedenfalls nicht sofort. Dabei stand die größte Belastungsprobe für den Bergmannspastor Gert Leipski noch bevor. 83
84 Erste Anzeichen für eine Kohlekrise Seit Mitte der 50er Jahre zeichnete es sich ab, dass der Bergbau im Ruhrgebiet stark von einer Struktur- und Absatzkrise betroffen werden könnte. Die Ruhrkohle war auf dem Weltmarkt zu teuer und wurde selbst auf dem heimischen Markt zunehmend von billigerer Importkohle verdrängt. Außerdem trat das Erdöl seinen Siegeszug an als kostengünstiger Ener gieträger. Auch wirtschaftspolitische Interessen der Bundesrepublik spielten eine Rolle. 163 In der Folge türmten sich im Ruhrgebiet die Kohlehalden auf und auf den Zechen wurden unbezahlte Feierschichten für die Bergleute eingeführt. Da der Ruhrkohlebergbau im Laufe seiner Geschichte schon ganz andere Krisen überstanden hatte, hofften wohl viele, dass die Lage sich nach der Schließung kleinerer und unrentabler Schachtanlagen und nach Rationalisierungsmaßnahmen wieder entspannen werde. Die Stadt Bochum war im Revier am stärksten vom Bergbau abhängig und wurde darum auch am heftigsten erschüttert, als das Zechensterben begann.»1957 förderten auf dem Stadtgebiet noch 15 große Bergwerke mit zusammen Beschäftigten Nur fünf Jahre später hatte sich diese Zahl halbiert. Den Anfang machte die Bochumer Kleinzeche Lieselotte, die am 30. September 1958 als erste Schachtanlage im Ruhrgebiet stillgelegt wurde In den ersten Jahren der Kohlekrise traf es keine Stadt heftiger.«164 In Bochum begannen darum schon im Januar 1959 die großen Protestversammlungen der verunsicherten Kumpel. 165 Aber Gewerkschaft und Politik schienen zunächst ratlos zu sein, wie man der aufziehenden Krise begegnen könne. In dieser Situation hat die Stadt Bochum die Initiative ergriffen. Im Fe bru ar 1959 begann sie Verhandlungen mit General Motors über die Ansiedlung eines Opel-Werkes auf dem Gelände der Zeche Dannebaum in Bochum-Laer (Werk I) und dem Areal der nicht mehr betriebenen 84
85 Schachtanlage Bruchstraße in Bochum-Langendreer (Werk II+III). Diese geplante Industrieansiedlung, zu ihrer Zeit die größte Industriebaustelle Europas, betraf auch den Stadtteil Bochum-Werne an seinen östlichen und südlichen Rändern. Im August 1960 war Baubeginn. Die Zeche Dannebaum war inzwischen stillgelegt worden. Im Oktober 1962 rollte der erste Kadett A vom Band. Das Opel-Werk sorgte für etwa neue Arbeitsplätze in Bochum. Viele Bergarbeiter fanden hier eine neue berufliche Perspektive. Im Januar 1963 wurde in Bochum die Zeche Mansfeld geschlossen. Die Schachtanlage gehörte zwar nach Langendreer, grenzte aber direkt an die Werner Vollmondsiedlung, in der viele Bergleute von Mansfeld wohnten. Damit waren Gemeindeglieder aus dem Bezirk von Gert Leip ski direkt betroffen. Angst um den Arbeitsplatz und existentielle Un sicherheit nahmen zu, die Bergarbeiterfamilien fragten sich, wie es mit ihnen weitergehen würde. Ihre bangen Blicke gingen in Richtung der Großzeche Robert Müser in Werne, auf der etwa Menschen ar bei te ten. Klare und verlässliche Aussagen bekamen sie weder von dem Be trei ber, der Harpener Bergbau AG, noch von der Gewerkschaft oder den politisch Verantwortlichen wurde noch verlautbart, Robert Müser sei gesund und die Förderleistung steige an. Gemeindezentrum Ludwig-Steil-Haus Nach der Visitation, die in Vorbereitung und Auswertung viele Kräfte gebunden hatte, stand im Bezirk von Gert Leipski zunächst der Bau des Gemeindezentrums auf der Tagesordnung. Vor allem die Finanzierung bereitete Sorgen und forderte Einsatz, Kreativität und Hartnäckigkeit bei der Beschaffung zusätzlicher finanzieller Mittel. 85
86 Gert Leipski erinnerte sich: 86»Es war nicht leicht, soviel Geld aufzutreiben, wie das Ludwig-Steil-Haus kosten sollte, auch wenn man in der Bauausführung mehr als sparte. Wir sind jedem Hinweis nachgegangen, der uns evtl. zu einer Geldquelle führte. So hörten wir auch von einem Fonds für Zonenflüchtlinge So kamen wir nach Arnsberg mit unseren Unterlagen. Der Baudirektor hatte tolle Ideen, was man nicht noch alles machen könnte, sollte, müßte. Aber dann zuckte er selber zurück: eigentlich so viel geben wir auch nicht! Ich konnte nur erwidern: Eine tolle Erkenntnis. Ich bin Ihnen dafür dankbar! Zwischendurch bekam ich zu hören: das ist doch kein Pastor, sondern ein Geschäftsmann! Darauf konnte ich nur antworten: Seit wann ist das Wort Geschäftsmann ein Schimpfwort. Ich muß mit dem Geld anderer Leute umgehen, warum wirft man mir da das Rechnen vor. «166 Nach Baubeginn mussten die ständig steigenden Baukosten erklärt werden. Der Bau des Gemeindezentrums Anemonenweg war zunächst mit DM veranschlagt worden. Der Bauantrag vom August 1961 wies schon DM aus, finanziert durch den Gesamtverband Bochum, die Kirchliche Aufbauhilfe, den Landschaftsverband Münster u.a. Dazu kamen Darlehen aus Kohleabgabemitteln des Wiederaufbauministeriums, aus Bergarbeiterwohnungsbaumitteln und wiederum von der Kirchlichen Aufbauhilfe. Die Baukosten erhöhten sich bis 1963 jedoch auf insgesamt ca DM, bis 1967 um weitere ca DM, was beim lan deskirchlichen Bauamt»berechtigtes Befremden«auslöste. 167 Die Gemeinde hatte große Mühe, diese Kosten zu decken. Leipski ging»betteln«, und etliche Familien, die selber kein Geld über hatten, spen deten doch für»ihr«gemeindezentrum, und wenn es nur eine Mark pro Monat war. Zuletzt fehlten noch DM für die Einrichtung der Schwesternstation. Auf einen Dringlichkeitsantrag des Kirchenkreises hin wurde dieses Geld vom Landeskirchenamt aus Kollektenmitteln bewilligt. 168 So war das Ende dieser großen Aufgabe bald abzusehen.
87 Im September 1963 beschloss das Presbyterium, das neue Gemeindehaus solle den Namen»Ludwig-Steil-Haus«bekommen.»Mit dieser Benennung unseres Gemeindezentrums will das Presbyterium die Gemeinde auf ein Glaubensvorbild unserer Zeit hinweisen; Ludwig Steil hat sich ja als unerschrockener Kämpfer und Seelsorger seiner Gemeinde im Ruhrgebiet (Wanne) in schwerer Zeit bewährt.«169 Mit dieser Namensgebung erinnerte die Gemeinde auch an ihre eigene Zu gehörigkeit zur Bekennenden Kirche während der Nazi-Diktatur. Gleich zeitig war der Name Programm und Verpflichtung für die Zukunft, sich unerschrocken gegen Unrecht zur Wehr zu setzen und für die Menschen zu streiten, denen Unrecht geschah oder die in Not gerieten. Noch bevor das Gemeindezentrum am 1. November 1963 durch OKR Dr. Reiß als Ludwig-Steil-Haus eingeweiht wurde, feierte Leipski bereits Anfang September mit seiner Gemeinde den ersten Gottesdienst dort. 170 Zur Ausstattung des Hauses wie des gesamten Komplexes, die im Septem ber noch keineswegs vollständig war, hält die Gemeindechronik fest:»es umfaßt einen Gottesdienstraum, ausgestattet mit ca. 300 Plätzen, Altartisch, Predigtpult, Wandkreuz aus gepreßter Kohle und einer elektronischen Orgel, ferner einen Versammlungsraum, einen Trakt mit fünf Gruppenräumen, einen Kindergarten mit drei Gruppenräumen und einen Wohntrakt für den Bezirkspfarrer, den Hausmeister und die Gemeindeschwester.«171 Da der Kindergarten aus bautechnischen Gründen unterkellert werden musste, ergab sich die Gelegenheit, dort zusätzlich einen Jugendkeller einzurichten. Gert Leipski hatte nun auch die räumlichen Möglichkeiten, um in seinem Pfarrbezirk fast wie in einer eigenen Gemeinde seine Vorstellungen von kirchlicher Arbeit zu verwirklichen. Die Jugendarbeit bildete dabei einen Schwerpunkt. Hier fand u.a. der erste kirchliche Ju gendtanz in Bochum statt. 87
88 Ludwig-Steil-Haus, Bochum-Werne, Anemonenweg Der Keller unter dem Kindergarten wurde ein Anziehungspunkt für die Jugendlichen des Stadtteils. Es gründete sich der Jugendclub»Höhle 17«.»Die Glanzzeiten waren immer dann, wenn renoviert werden musste, weil alles im Eimer war wieder einmal! Die Jugendlichen lernten Demokratie. Es gab kein Modell von Mitbestimmung, das wir nicht praktiziert hätten. Es wurde sogar einmal abgestimmt, ob ich überhaupt mit abstimmen dürfte. Das waren noch Zeiten gewesen!«172 Parteinahme für die Bergleute Gert Leipski kümmerte sich um die Menschen seiner Gemeinde. Insbesondere vertrat er die Interessen der Bergleute. In diesem Sinne handelte er parteilich. Aber gleichzeitig war er bemüht, in Konfliktfällen zwischen den Verantwortlichen auf beiden Seiten zu vermitteln und sie in die Pflicht zu nehmen, für eine sozialverträgliche Lösung zu sorgen. Er scheute nicht die Auseinandersetzung, aber sein Ziel war der soziale Frieden in 88
89 gemeinsamer Verantwortung. So brachte er z.b. auf dem Höhepunkt der Kohlekrise hochrangige Vertreter des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau und der IG Bergbau und Energie dazu, in dem jährlich statt findenden Bergmannsgottesdienst in Werne ihre Positionen zur Situation des Bergbaus und der Energiepolitik darzulegen. 173 Wenn es jedoch darum ging, auf Missstände aufmerksam zu machen, die Menschen in konkrete Not brachten, kannte er keinerlei Zurück haltung. Damit machte er sich nicht nur Freunde.»Vom Betriebsrat der Zeche Robert Müser bekam ich zu hören: Es geht nicht an, daß Du Dich um betriebliche Dinge kümmerst! Das werde ich solange tun, bis Ihr die Rolle spielt, die Euch zukommt! Anfang der 60iger Jahre war einmal der Höhepunkt: Der Betriebsrat hatte den Antrag gestellt, mich aus der Gewerkschaft auszuschließen, die Zechendirektion hatte mir das Zechengelände verboten und die Knappschaft wollte mich verklagen. Das kam so: Anläßlich einer Beerdigung sagte ich am Grab: Der Verstorbene könne noch leben, wenn die Knappschaft mehr für den Menschen wäre Aber die Menschen haben es böse gemeint, Gott hingegen meinte es gut. Es kam zu keiner Klage; aber ich hatte die Kontakte, die ich brauchte. Wenn ich danach in Langendreer (d.i. bei der Knappschaft, d.vf.) anrief, sagte die Sekretärin: Sagen Sie schon, um wen es geht, dann können wir die Akten raussuchen. « hatte Gert Leipski ein Treffen zwischen dem neuen Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie (IGBE), Walter Arendt und Präses Wilm vermittelt. 175 Das Treffen fand am 16. Dezember 1964 statt und Präses Wilm bat Leipski an dem Gespräch teilzunehmen. 176 Der Präses hatte schon den Einsatz von Leipski und Disselbeck im Bergbau gefördert und sehr wohlwollend begleitet. Der Kontakt zwischen ihm und dem jetzigen Bergmannspfarrer aus Bochum-Werne war offenbar nicht abgerissen. Als die Kohlekrise im Ruhrgebiet begann und in das Zechensterben mündete, hörte der Präses u.a. von Leipski, worin die 89
90 konkreten Probleme vor Ort bestanden. Beide hatten offene Augen und Ohren für die Nöte der betroffenen Menschen. Die kirchlichen Stellungnahmen aus dieser Zeit stellten darum auch diese Sicht in den Mittelpunkt. Noch im Vorfeld des Gespräches mit Walter Arendt richtete Präses Wilm ein gleichlautendes Schreiben an verantwortliche Politiker im Bund und Land NRW, an den Unternehmensverband Ruhrbergbau und an die IGBE. Darin schrieb er:»große Entscheidungen, wie sie in der Energiepolitik z.z. anstehen, tragen die Tendenz in sich, dass über politischen Interessen die menschlichen Probleme in den Hintergrund gedrängt werden Wir bitten deshalb in der Verpflichtung unseres kirchlichen Amtes alle Verantwortlichen, bei den Entscheidungen um die Zukunft des Kohlebergbaus die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, deren Existenz mit dem Bergbau verbunden ist. Jede Entlassung bedeutet eine Existenzkrise für den Betroffenen und seine Familie, vor allem wenn es sich um ältere Bergleute, Teilinvaliden oder um Familien mit Kindern handelt Bedrohlich erscheint uns die allgemeine Ungewißheit und das Mißtrauen, von dem die Menschen im Ruhrbergbau ergriffen sind Die Bergleute dürfen erwarten, daß die Probleme des Bergbaues offen dargelegt und auch mit ihnen erörtert werden, damit möglichst bald Klarheit über die Zukunft des Bergbaues geschaffen wird «177 Als der Präses seine inzwischen siebte Grubenfahrt für den Februar 1965 vorbereitete, wurde er von Leipski gebrieft. Der schrieb:» in der Einheit (Organ der IGBE) wird darüber Klage geführt, daß nach dem Besuch des Herrn Präses Beckmann (Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, d.vf.) auffallend wenig über Kontakte mit den Bergleuten ge sagt wurde es steht sehr viel darüber, daß der Präses über die Me chani sierung von Lohberg beeindruckt war Es wäre gut, wenn Sie möglichst viele 1) nach der Wohnung fragen würden und welche Konsequenzen sich aus der Wohnungsbindung ergeben; 90
91 2) ob nach der letzten Lohnerhöhung neue Gedingeabschlüsse getätigt wur den und ob sie tatsächlich 7,5 % Lohnerhöhung erhalten haben; 3) ob ähnlich gesprochen und gehandelt wird, wie es der Betriebsführer un serer Werner Anlage in einer Belegschaftsversammlung gesagt hatte: Bei mir zählen nur die Kohlenhauer! 4) Auf Grund der Rationalisierung und Zentralisierung hat weithin eine Veränderung der Aufgaben bzw. Funktion der Steiger stattgefunden. 5) Zum Zeitpunkt Ihrer Grubenfahrt sind gerade Betriebsratswahlen! Es wäre gut, wenn Sie sich nach der Tätigkeit des BR [Betriebsrat, d. Vf.] bei den Kumpels erkundigten!...«178 Nach der Grubenfahrt berichteten die Ruhr-Nachrichten:»Als ein Vertreter der Zeche als eine Ursache für die Verbesserung des Betriebsklimas unter Tage die Mechanisierung anführt und die Tatsache, daß die körperliche Schwerarbeit immer seltener wird, wendet Präses Wilm ein: Na, die Stempelsetzer haben aber immer noch Knochenarbeit! Präses Wilm läßt keinen Zweifel daran, daß für ihn trotz der Mechanisierung und Arbeitsvereinfachung der Beruf des Bergmannes etwas Besonderes ist, schon weil die Arbeit tief in der Erde verrichtet wird «179 Den Vorteilen der Mechanisierung stellte der Präses, wohl auch auf Grund des Hinweises von Leipski, die bleibende hohe Belastung des Bergmanns unter Tage entgegen. Noch 1967, als die Westfälische Landessynode einen Beschluss»Zur Lage im Ruhrgebiet«veröffentlichte, atmete der Text diesen Geist der Sorge um den einzelnen Menschen. So standen neben Strukturüberlegungen die Nöte der betroffenen Bergleute und ihrer Familien im Mittelpunkt der Stellungnahme.» Wir weisen darauf hin, daß bei allen wirtschaftlichen Überlegungen der Mensch in seiner schweren, mit Unsicherheit und Lebensangst belasteten Lage nicht vergessen werden darf Für das zukünftige wirtschaftliche und soziale Handeln resultiert hieraus, daß den betroffenen Arbeitnehmern 91
92 in ganz anderer Weise als bisher und rechtzeitig Informationen über einzel ne Maßnahmen gegeben und die Gründe hierfür einsichtig gemacht werden Die Landessynode erbittet erneut Maßnahmen zur Förderung der be ruflichen Mobilität. Hindernisse wie Beschränkungen des Wohnrechts, Verluste sozialer Leistungen und die Bindung der Inanspruchnahme sozialer Maßnahmen an den Stillegungstermin müssen abgebaut werden.«180 Waffelbacken im Ruhr-Park So bedrängend die Probleme des Bergbaus in Werne auch waren, der Blick des Pfarrers Leipski ging weit über die Ortsgemeinde hinaus begann er mit einer Aktion, deren Erlös Brot für die Welt zugutekam. In der Adventszeit stellte er im neu erbauten Einkaufszentrum Ruhr-Park einen Stand auf und backte Waffeln. Ein Pfarrer, der das Waffeleisen bediente und leutselig die warmen Waffeln verkaufte, gelegentlich auch dazu auf dem Schifferklavier spielte, das war zu der Zeit eine kleine Sensation in Bochum, von der die Öffentlichkeit Notiz nahm. Das Waffelbacken wurde zu einer jährlich wiederkehrenden Tradition. Neben Brot für die Welt wurden im Laufe der Zeit mit dem eingespielten Geld auch eine Gemeinde in Lüderitz/Namibia, diakonische Initiativen in Bochum sowie andere Hilfsprojekte unterstützt. Mit großem Einfallsreichtum verstand es Gert Leipski, das öffentliche Interesse an der Aktion wachzuhalten. Dazu gehörte auch, Prominente zum Waffelbacken einzuladen, sei es der Bochumer Oberbürgermeister Heinz Eikelbeck oder der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Hans-Martin Linnemann. Sie alle banden die Schürze um und hantierten mit Teigkelle und Waffeleisen. Seit 1975 beteiligte sich der Bochumer Bäcker-Sohn und damalige Stadtrat Norbert Lammert regelmäßig am 92
93 Präses Hans-Martin Linnemann hilft beim Waffelbacken (Kreiskirchliches Zentralarchiv Bochum, 6-21 Fotomappe Werne). Waffelbacken. Selbst als Bundestagspräsident ließ er sich diesen Einsatz im Advent, wenn immer möglich, nicht entgehen.» Pfarrer Gert Leipski heuerte mich 1975 an, erinnerte er sich, während er im Einkaufszentrum fleißig Waffeln bepuderte und verteilte.«das berichtete die WAZ im Jahr 2007, also schon lange nach Leipskis Tod, unter dem Titel»Veteran am Waffeleisen«. Und weiter:»rund 60 Helfer machen in diesem Jahr mit. Dazu kommen 42 Prominente aus Politik, Verwaltung, Kultur, Wissenschaft und Kirche, die mit den Ehrenamtlichen aus Gemeinde und Diakonie zusammen am Waffeleisen stehen.«181 Eine Aktion mit Nachhaltigkeit. Seit 1981 fand das jährliche Waffelbacken zusätzlich auf dem Werner Markt statt. 93
94
95 Schwarze Fahnen an der Ruhr Als Leipski im Advent 1966 mit dem Waffelbacken begann, waren schon düstere Wolken über Robert Müser und anderen Zechen im Revier aufgezogen. Das Zechensterben erreichte nun auch die Schachtanlagen, die bis dahin noch als profitabel galten. DER SPIEGEL berichtete über die Situation im Revier und in dem Zusammenhang über einen Bergmannsgottesdienst in Bochum-Werne am Sonntag vor Pfingsten 1966:»Die kleine evangelische Kirche am Markt in Bochum-Werne war festlich geschmückt. Große Wappenschilder mit Hammer und Schlägel hingen im Schiff. Vor dem Altar war eine kleine Kohlenhalde aufgeschüttet, und Traditionsfahnen der Knappenvereine flankierten den segnenden Christus. Die Bochumer Bergleute waren in ihren Uniformen zu einem Bergmannsgottesdienst eingezogen und sangen: Wir treten vor Dein Angesicht, o Gott, und lobsingen Dir, Du warst mit uns in jeder Schicht auf unserem Bergrevier. Vor dem Vaterunser trat ein alter Bergmann neben Pfarrer Leipski und betete: Herr, wir bitten Dich für alle, die im Bergbau Entscheidungen treffen müssen: Steh ihnen bei, und schütze den Bergbau. Der Ton war neu. Hundert Jahre lang und länger waren die Gebete der Bergleu te immer nur von dem frommen Wunsch erfüllt gewesen, daß ihnen so eine Festschrift der Kameradschaft St. Babara bei ihrer nicht un ge fährlichen Arbeit gütiges Schicksal und göttlicher Schutz zur Seite stehen möge. Was aber die Bergleute am Sonntag vor Pfingsten in Bochum-Werne die schwieligen Finger zu falten zwang, war nicht Sorge um das Leben und den ohnehin geschundenen Leib. Es war die jähe Angst vor einer Zukunft, die den Bergleuten dunkler erscheint als der dunkelste Streb in ihrem Schacht. Von dem Mann starken Bergarbeiter-Heer sind seit 1956 rund demobilisiert und aus den Pütts entfernt worden. Statt damals 175 Schachtanlagen sind heute nur noch 106 in Betrieb. Auf mindestens weiteren 18 Zechen mit einer jährlichen Fördermenge von 14 Millionen Tonnen Kohle werden während der nächsten zwei Jahre die großen Turmräder stillstehen. 95
96 Schon jetzt legt ein Drittel der Zechen einmal im Monat eine Sonnabend- Feierschicht ein.«182 Gert Leipski selbst erinnerte sich an diese Zeit:»Das Gespenst der Zechenschließungen ging um. Ministerpräsident Kühn plante zusammen mit dem damaligen 1. Vorsitzenden der IGBE eine Grubenfahrt auf Robert Müser. Als die ersten Gerüchte über eine mög liche Schlie ßung von Robert Müser aufkamen, wollte man die geplante Grubenfahrt am liebsten nicht machen. Als ich davon erfuhr, teilte ich dann schnell den Termin der Presse mit. Nachdem es in der Zeitung stand, konnte man nicht mehr absagen. Ich durfte allerdings nur mit anfahren, wenn ich vor her zusagte, nichts zu sagen. Als man mir dann beim Mittagessen doch Ge legen heit geben wollte, konnte ich nur erwidern: Was ich zu sagen hatte, das habe ich längst gesagt. «183 Die Ungewissheit machte den Bergarbeiterfamilien sehr zu schaffen. Ihre Existenz war gefährdet und niemand gab ihnen verlässliche Auskunft darüber, was geplant war. Die Politik fürchtete die Demonstrationen der Bergleute und die schwarzen Fahnen an der Ruhr. Die Verantwortlichen hielten sich bedeckt. Es wurde zwar auf verschiedenen Ebenen verhandelt, aber die Betroffenen blieben im Dunkeln. Gert Leipski versuchte in dieser Situation seine persönlichen Kontakte in Gewerkschaft und Politik zu intensivieren und zu nutzen. Seit 1964 war Walter Arendt der 1. Vorsitzende der IG Bergbau und Energie (IGBE), ein Duzfreund Gert Leipskis. Beide kannten sich schon seit Ende der 40er Jahre, als Arendt bei der Presseabteilung der IGBE in Bochum arbeitete und Leipski während seiner Schulzeit und zu Beginn des Studiums Werkarbeit u.a. auf der Zeche Hannover in Bochum-Hordel leistete wurde Walter Arendt Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Ebenfalls aus der Nachkriegszeit rührte Leipskis Bekanntschaft mit Heinz Oskar Vetter. Vetter stammte aus einer Baptistenfamilie aus Bo- 96
97 chum-werne und arbeitete seit 1946 wieder in seinem erlernten Beruf als Schlosser im Bergbau. Seit 1964 war er 2. Vorsitzender der IGBE, 1969 wurde er zum Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes 97
98 ge wählt. Als Vorsitzender des Sozialausschusses der Evangelischen Kirche von Westfalen prägte er in den 60er Jahren die kirchliche Position hinsichtlich der Strukturveränderungen im Revier. Die Bekanntschaft mit beiden Gewerkschaftlern und zur Zeit der Bergbaukrise verantwortlichen Politikern nutzte Gert Leipski hem mungs los aus, um für die Belange der Bergarbeiter einzutreten. Er wurde tele fonisch, schriftlich und persönlich bei ihnen vorstellig. Bei seinen oft überraschenden Besuchen nahm er gelegentlich betroffene Bergleute mit, um seinem Anliegen ein Gesicht und einen Namen zu geben. Wenn er früh morgens mit dem eher kirchenfernen Walter Arendt telefonierte, konnte er das Gespräch schon mal mit der Verlesung von Losung und Lehr text beginnen. 184 Sein Verhalten erinnerte an die biblische Geschichte von der bittenden Witwe aus dem Lukas-Evangelium, die schon um ihrer Hartnäckigkeit und Unverschämtheit willen erhört wird (Lukas 18,1 8). Schließung von Robert Müser und die Folgen Leipskis Einsatz für die Belange der Bergleute auf den unterschiedlichen Ebenen von Politik, Gewerkschaft, Betriebsleitung und Kirche muss ihn viel Zeit gekostet haben. Das konnte nur auf Kosten seiner pfarramtlichen Verpflichtungen gehen. Dennoch nahm die Kirchengemeinde das Engagement ihres Pfarrers und seine zahlreichen Kontakte überwiegend dankbar zur Kenntnis, war man doch bald selbst vom Zechensterben betroffen.»bereits im Juli 1966 kommt es zu ersten ernstzunehmenden Gerüchten über eine Schließung der Schachtanlage Robert Müser. Pfarrer Leipski schreibt schon am einen offenen Brief an den damaligen Wirt schaftsminister von NRW, Kienbaum, in dem er nach dem Schicksal der Bergleute fragt. Am 98
99 31. März 1967 beschließt der Aufsichtsrat der Harpener Bergbau AG mit 8 zu 7 Stimmen die Schließung von Robert Müser zum 31. März Damit hat die Großschachtanlage im 112. Jahr ihres Bestehens trotz günstiger Kohlevorräte und guter Kohlequalitäten ihr unrühmliches Ende gefunden.«185 Im Vorfeld des Schließungsbeschlusses vom März 1967 hatte Leipski den direkten Kontakt zu Aufsichtsratsmitgliedern gesucht, um die Situation der Bergleute bei allen Entscheidungen mit in die Waagschale zu werfen. 186 Als feststand, dass die Schachtanlage geschlossen würde, war er in den folgenden Wochen und Monaten an den harten Verhandlungen über den Sozialplan beteiligt,»der später bei der Ruhrkohle als Vorbild diente«. 187 Als praktische Hilfsmaßnahme nahm er»kontakt zur Volkshochschule auf, um Umschulungsmaßnahmen für ehemalige Berg leute zu organisieren und durchzuführen. Im Ludwig-Steil-Haus fin den Umschulungskurse zum Volksschullehrer, Gewerbeinspektor, Hochbau ingenieur, Krankenpfleger usw. statt.«188 Bis Ende 1968 waren die 13 Schächte von Robert Müser verfüllt, aber die Probleme der ehemaligen Bergleute der Großzeche hatten sich keineswegs erledigt. Trotz verlässlicher Regelungen im Sozialplan zeigte es sich, dass Einzelne oder kleine Gruppen von ihnen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, die bei den Regelungen nicht bedacht worden waren. Für Gert Leipski Anlass genug, sich für ihre Belange einzusetzen, denn im Vordergrund stand für ihn immer der einzelne, notleidende Mensch. Ein Problem bestand darin, dass die entlassenen älteren Bergarbeiter bei einer Neuvermittlung ihre Mitgliedschaft in der Knappschaft verloren. In einem Schreiben an den Hauptvorstand der IGBE machte Leipski auf diese Problematik aufmerksam. Adolf Schmidt, Mitglied des Ge schäftsführenden Vorstandes der IGBE, hatte bei einem Treffen bereits signalisiert, dass es kaum möglich sein werde, diese Bergleute in der Knappschaft zu halten, da die Lage dieser Versicherung schon schwierig genug sei. Dennoch schrieb Leipski: 99
100 »Ich bitte doch dringend darum, sich für die älteren Kollegen einzusetzen und eine Möglichkeit zu suchen, damit ihre Situation die Unsicherheit verliert, in der sie im Augenblick sind. Ihnen werden so niedrig bezahlte Vermitt lungsangebote gemacht, bei denen sie dann noch ihre erworbenen Rech te verlieren. Es muß doch ein[en] Weg geben!«189 Ein weiteres Problem betraf ältere Kumpel von Robert Müser, die sich im Rahmen des Sozialplans hatten entlassen lassen, um den jüngeren Kol legen, wenn eben möglich, den Transfer zu einer anderen Schachtan lage und damit einen Arbeitsplatz zu sichern. Einige Jahre nach der Zechenschließung, als die Arbeitslosenzahlen im Revier noch hoch waren, aber für die Aufschwung nehmende Wirtschaft wieder Arbeits kräfte gesucht wurden, fühlten sich diese Älteren vom Arbeitsamt wie Arbeitsscheue behandelt und gedrängt, jedwede Arbeit anzunehmen. Leipski fand, diese Behandlung entspreche nicht der Lebens- und Arbeitsleistung der ehemaligen Bergleute. In mehreren Schreiben an Minister, aber auch in persönlichen Gesprächen schilderte er ihm bekannte Einzelfälle und mahnte einen würdigeren Umgang mit diesen Menschen an. 190 Die Adressaten seiner Briefe, Anrufe und unangekündigten Besuche waren sicher oftmals genervt, so wie der Ministerialbeamte, an den er sich erinnerte:»einmal war ich bei der IGBE in Bochum. Es kam der persönliche Referent eines Ministers hinzu und begann sofort: Hier in Bochum wohnt so ein komischer Pastor, der schreibt andauernd Briefe! Alle feixten, weil ich selber, der komische Pastor dabeistand.«191 Aber zu nerven und unkonventionelle Wege zu gehen, das machte Gert Leipski nichts aus. Im Gegenteil, er hielt es für einen Teil seines Auftrags als Pastor. Dort, wo andere Angst hatten anzuecken oder sich unbeliebt zu machen, spürte er, gestärkt durch seinen Glauben, die große Freiheit eines Christenmenschen. 100
101 »Es ist immer unsere Angst, die uns einredet: Du darfst das nicht und das nicht Der Spielraum, den wir haben, der ist immer wesentlich größer. Darauf zu vertrauen, d.h. glauben!«und so handelte er aus christlicher Freiheit und Liebe zu den Menschen:»Wenn man in Werne leben will, dann muß man die Menschen hier gern haben!«192 Nachfolge Christi konkret Leipski kümmerte sich aber nicht nur punktuell um die Belange einzelner Menschen. Die Verhandlungen über den Sozialplan von Robert Müser und dessen Folgen hatten gezeigt, dass man auch auf Strukturmaßnahmen Einfluss nehmen musste, wenn man Menschen nachhaltig helfen wollte. Man musste politisch agieren und andere befähigen, politisch ver antwortlich zu handeln. So hat er z.b. im Vorfeld der Bundestagswahl 1969 mit anderen zusammen einen Fragenkatalog zu drängenden Pro ble men der Zeit ausgearbeitet. Der wurde an die Kandidaten seines Wahl kreises verschickt. In einem Gemeindebrief wurde dieser Katalog ver öffentlicht, und die Gemeindeglieder aufgefordert, entsprechend der Ant worten der Kandidaten ihre Wahlentscheidung zu treffen. Dieses tagespolitische Enga gement begründete er so:» Jesu Ruf in die Nachfolge enthält auch heute noch die Aufforderung sich zu engagieren, sich reflektierend, das heißt nachdenkend, seiner Umwelt zuzu wenden und in den alltäglichen Situationen und Entscheidungen danach zu fragen, ob sie der Gerechtigkeit dienen, die Freiheit fördern, der Liebe Raum geben Vielleicht wird uns die politische Dimension der biblischen 101
102 Texte deshalb nicht deutlich, weil wir sie immer bloß auf das fromme Ich beziehen. Hören wir doch einmal einige Begriffe auf die politische Seite hin ab: Liebe! Heißt das nicht Eintreten für den Mitmenschen, besonders für Minderheiten, die sich selber schwer helfen können? Wo geht es um solche Gruppen im Wahlkampf (Entwicklungspolitik, Sozialpolitik, Wehr dienst verwei gerung)? Friede! Wie steht es damit beim Nationalismus, bei der Ostpolitik, beim Atomwaffensperrvertrag, bei der Kontrolle der Macht?«193 Gert Leipski hatte wohl auch gelernt, dass es nicht immer ausreicht, als Einzelkämpfer und sei er noch so unerschrocken und originell gegen Missstände vorzugehen. Darum begann er Verbündete zu suchen und aktivierte ganze Gruppen von Betroffenen oder Interessierten. Die ersten Bürgerinitiativen entstanden, so z.b. als es nach der Schließung von Robert Müser um die Nutzung des m² großen Brachgeländes der Zechenanlage ging. Ziel der Aktion war die baldige Erschließung dieses Areals und die Ansiedlung neuer Betriebe in Bochum-Werne.»Die Initiative zu den Gesprächen und Bürgerversammlungen ging von Pastor Leipski aus, der damit in mancherlei Hinsicht demonstriert hat, wie lebensnah Arbeit für die Gemeinde, für den Bürger aussehen kann «194 Ein weiterer Konflikt ergab sich, als die Harpener Bergbau AG plante, Werkswohnungen in Werne zu verkaufen. In Leipskis Pfarrbezirk ging es um die Häuser der Vollmondsiedlung.»Die Treuhand-Gesellschaft wollte nur verkaufen, wenn beide Hälften [eines Doppelhauses, d. Vf.] zugleich von den jetzigen Bewohnern erworben wurden. Dagegen liefen wir Sturm! Wir machten die Aktionäre jener Gesellschaft, die IGBE und das Land / der Bund darauf aufmerksam und wollten ihre Unterstützung. Es kam dann in Essen zu einem Gespräch mit der Direktion jener Gesellschaft. Weil ein Mitglied der Direktion wußte, daß ich mit anwesend war, wollte er einen biblischen Zusammenhang herstellen. Das müßte ich doch einsehen. 102
103 Ich erinnerte ihn daran, daß die meisten Sätze in der Bibel über die Reichen mit einem»wehe!«beginnen. Als er dann im Verlauf des Gespräches sagte: Arthur (das war ein rede gewandter Kumpel und Bewohner der Siedlung), sei ruhig!, wußte ich, daß wir gewonnen hatten.«195 Einige Jahre später, 1981, gab es noch einmal eine ähnliche Auseinandersetzung, diesmal wegen des Verkaufs der Häuser in der Siedlung Deutsches Reich. Mit einem Offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Harpener AG machte Leipski das Problem der Siedlungsbewohner weiten Kreisen bekannt, nachdem er wochenlang vergeblich versucht hatte, einen Gesprächstermin zu bekommen. Er forderte vor allem eine zeitnahe und umfassende Information der Bewohner über die Pläne der Harpener. Wieder einmal nahm er Anstoß daran, dass über die Köpfe der Betroffenen hinweg geplant und entschieden werden sollte und dadurch Ängste und Unsicherheiten entstanden, vor allem die Sorge,»Spekulanten«zum Opfer zu fallen. Und wieder einmal war er nicht zim perlich in seiner Wortwahl und seinen Argumenten. Er konstatierte, die Harpener AG habe einen»miserablen Ruf«und machte ihr den Vorwurf:»Hätten Sie seinerzeit das Robert-Müser-Gelände an die Stadt zu ver nünftigen Konditionen veräußert, dann wäre dort jetzt mehr als nur ein Trümmerfeld. Ihre Gesellschaft kann doch nicht überall da, wo sie sich zurückzieht, ein Trümmerfeld hinterlassen.«196 Zusätzlich zu der Veröffentlichung dieses Problems wurden Mieter versammlungen einberufen und Fachleute hinzugezogen, die den Betroffenen mit Rat und Hilfe zur Seite standen. Am Ende kaufte die Bochumer Wohnungsgenossenschaft die Siedlung auf. 197 So wurden auch hier akzep table Lösungen für die Mieter gefunden. 103
104 Ein Wort zum Sonntag In den auch für die Kirchengemeinde Werne so bewegten 60er Jahren trat ihr Pfarrer Gert Leipski noch auf andere Weise an die Öffentlichkeit. Er schrieb für die in Bochum erscheinende Westfälische Rundschau etliche Male»Ein Wort zum Sonntag«. 198 In diesen Artikeln stellte er eine Verbindung her zwischen aktuellen Ereignissen und Worten der Bibel, die für ihn in der jeweiligen Situation wegweisend waren. Hier gab er auch Rechenschaft über seinen Glauben, die Kraft, die ihn motivierte und zum Handeln trieb. Wie ein Leitvers stand über diesen Andachten der Satz:»Wichtiger ist der Mensch!«, ein Zitat aus einem Maiaufruf des DGB, das Leipski dann jedoch in einen biblischen Zusammenhang brachte.» wichtiger ist der Mensch. Dies hat Jesus in seiner Zeit gegenüber einem wichtigen Lebensgesetz seiner Umwelt genauso behauptet! Nämlich ge genüber der religiösen und kultischen Ordnung seiner Tage, das Gesetz, das alle umschloß Gegenüber allen, denen die religiöse Ordnung wichtiger war als der Mensch, sagte er: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Alle Produktion ist um der Menschen willen da und nicht der Mensch um der Produktion willen!... wichtiger ist der Mensch. Jesus Christus, der um der Menschen willen nicht daran festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte, wurde ein Mensch. Dem Menschen seine geknechtete und verlorene Würde wiederzugeben, hatte er gelebt. Er nahm das Schicksal von uns Menschen auf sich, bis in die Tiefe des Todesschicksals, damit wir Kraft und Mut gewönnen, als heile Menschen zu leben Laßt uns darum ihm nachfolgen, in der Sorge um den Menschen. Das Bild des Menschen Jesus Christus will uns verwandeln und uns bewegen, von uns selber abzusehen, ja, uns zu vergessen, entgegen unserem Eigennutz, unserer Selbsterhaltung. Entgegen allem soll dies Bedeutung in unserem Leben gewinnen: wichtiger ist der Mensch! möge das uns alle beseelen! Die Arbeitnehmer und ihre Vertreter, die Arbeitgeber, die, die Gesetze geben und die, die den Buchstaben Leben geben 104
105 müssen; die, die Arbeitsbedingungen verantworten; die, die neue Pro duktions formen erdenken und organisieren; die, die ihr Geld oder ihren Ver stand oder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen um alle miteinander Men schen werden zu lassen.«199 Die Würde des Menschen, die er aus der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ableitete, galt es in allen Lebensbezügen zur Geltung zu bringen und zu verteidigen, gerade auch in den industriellen Arbeitsprozessen. In diesem Sinne war seine christliche Verkündigung immer zugleich parteilich und politisch.»es geht darum, um des Menschen willen kritisch zu fragen, wie die heutige Gesellschaft zu ordnen sei, damit unter den Bedingungen der industriellen Produktionsverhältnisse menschliches Leben in freiheitsbegründender Soli darität und Partnerschaft gelebt werden können Es drängt sich der Ver dacht auf, daß die Gewerkschaft den Menschen im Betrieb schon längst aufgegeben hat, wenn man bedenkt, daß die wichtigsten gewerkschaftlichen Forderungen der letzten Jahre nicht den sozialen Status des Menschen im Betrieb im Blickpunkt hatten Wenn das Kriterium der Mitmenschlichkeit das bestimmende ist, dann kann man sich nicht mit einer Eigentumsordnung abfinden, in der die Masse der Arbeitnehmer in der Industrie am Mitbesitz an den Produktionsmitteln bzw. am Produktionskapital ausgeschlossen ist.«200 In biblischen Texten fand er die Kriterien für ein sozialethisches Ver halten, das er in die jeweilige Situation hinein konkretisierte. Wenn es in der Bergpredigt heißt:»selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden«, dann forderte er alle Christen in den Betrieben, Direktoren wie Arbeitnehmer dazu auf, mit dieser biblischen Verheißung Ernst zu machen und z.b. für mehr Gerechtigkeit bei der Eigentumsbildung einzutreten.»denn an der Lösung dieser Fragen mitzuarbeiten, wie Freiheit und Gerechtigkeit bei uns Menschen und durch uns Menschen im Zusammenleben und 105
106 Zusammenarbeiten zu verwirklichen sind, das scheint uns einfach auf ge tragen zu sein.«201 In diesem Kontext nahm er wiederholt Bezug auf die Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland»Eigentumsbildung in sozialer Verantwortung«. So sehr er einerseits Partei ergriff für die Arbeiter, sie als Partner im Pro duktionsprozess stark machte und davor warnte, sie»zu reinen Lohnem pfängern«zu degradieren, so eindringlich ermahnte er aber auch Arbeit nehmer und Arbeitgeber, offen zu sein für die Position des jeweils anderen:»nur so kann sich ein Wollen herauskristallisieren, das jenseits des Eigennutzes, aber auch eines Gruppenegoismus liegt Zu echter Soli darität wäre Umkehr, Umdenken notwendig und nötig: Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist «202 Obwohl ihm die Probleme der Arbeitswelt besonders am Herzen lagen, wandte er sich in diesen Kolumnen doch auch anderen Themen zu, wie etwa dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 1963 in Dortmund, der Rolle der Väter in den Familien oder, aus Anlass der Einweihung der Ruhr- Universität Bochum, den Bildungschancen von Arbeiterkindern. Oftmals kommentierte er aktuelle Ereignisse, z.b. das Unglück von Lengede, die Ermordung J.F. Kennedys oder die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an C.F. von Weizsäcker. Alle diese Themen und Ereignisse brachte er mit biblischen Texten in Verbindung. Häufig stand am Ende ein ethischer Appell zum Handeln oder eine Warnung vor Feigheit, Unwahrhaftigkeit und dem Streben nach eigener Ehre, kurz gesagt:»wir sind gerufen, Jesus von Nazareth nachzufolgen! Denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben.«
107 Neue Herausforderungen Junge Kollegen Anfang der 70er Jahre ergaben sich personelle Veränderungen in der Kirchen gemeinde Werne. Die Pfarrstelle des 4. Bezirks war seit dem Weg gang von Pfarrer Supplie im Mai 1969 vakant. Erst 1972 konnte sie neu besetzt werden. Im August 1972 wurde Johannes Lohmann in die Pfarr stelle eingeführt. Als Helmuth Beckmann, Pfarrer des 2. Bezirks und lang jäh ri ger Weggefährte von Gert Leipski im Oktober desselben Jahres in den Ruhestand ging, folgte ihm Reinhard Wolters in der Pfarrstelle nach. Er wurde im April 1973 in Werne ordiniert und gleichzeitig in sein Amt eingeführt. Lohmann und Wolters hatten sich um die Pfarrstellen beworben, um dort gemeinsam ihre Vorstellungen einer gemeinwesen-orientierten, emanzi pa torischen Gemeindearbeit umzusetzen. Johannes Lohmann hat te be reits während seines Studiums an der Ruhr-Universität Bochum im Rah men eines Katechetikseminars im Konfirmandenunterricht von Leip ski hospitiert und einen lebhaften Eindruck von den Verhältnissen vor Ort und der unkonventionellen Gemeindearbeit Leipskis bekommen. Im Vikariat lernte er Reinhard Wolters kennen und beide trafen Gert Leip ski bei verschiedenen Gelegenheiten, in Gesprächskreisen zur Sozial ethik oder bei Veranstaltungen der Gewerkschaft. Leipski fragte sie, ob sie nicht zusammen nach Werne kommen wollten, wo zeitnah zwei Pfarr stellen zu besetzen waren. Das große, alte Pfarrhaus neben der Kirche stand leer. Interessenten für die vakante Pfarrstelle des 4. Bezirks hat te dieser Backsteinbau mit mehr als zehn Zimmern wohl eher abgeschreckt. Aber für die beiden jungen Pfarrer war es reizvoll, darin mit ihren Familien eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft zu verwirklichen. 107
108 Mit den Schwerpunkten, die sie setzten, kam frischer Wind in die Kirchen gemein de. Ein Besuchsdienstkreis und ein Ehepaarkreis wurden gegrün det, und es gab neue Veranstaltungen im Bereich der Erwachsenenbil dung.»friedenswochen«fanden statt mit einem viel seitigen Angebot an Diskussionen, Vorträgen und Begeg nungen. Ein Höhepunkt war der Festball»Friedensfest«. Der Ostermarsch machte Station in der Werner Kirche. Im neu erbauten Gemeindezentrum Erich-Brühmann-Haus wur de mit der Offenen-Tür-Arbeit ein Neuanfang in der Jugendarbeit gewagt. 204 Gert Leipski ließ die jungen Amtsbrüder gewähren. Er gab ihnen Raum, ihre Vorstellungen in der Praxis zu erproben und hat sie gegen An griffe verteidigt, wenn sie unbedacht gehandelt haben oder übers Ziel hinausgeschossen sind. Das galt auch, wenn eine Aktion zu öffentlichen Protesten führte, wie in dem Fall, den die Gemeindechronik festhält:»aufregung gibt es wegen einer Andacht von Pfarrer Wolters am Volkstrauertag bei der traditionellen Gedenkfeier am Ehrenmal Pfarrer Wolters bringt zum Ausdruck, daß nicht die Heldenverehrung, sondern die Trauer um die Opfer der Kriege, die durch grausame Vernichtungswaffen umgekommen sind, im Vordergrund stehen müsse. Erboste Bürger schreiben ihren Ärger über die ihrer Meinung nach zu kurz gekommene Würdigung der Toten der Weltkriege mit großen Buchstaben an die Kirchenmauer.«205 Gert Leipski ermutigte die jüngeren Kollegen, ihre Meinung offen zu vertreten, auch wenn diese nicht seiner eigenen entsprach. Seine tolerante Hal tung und seine Rückendeckung wurden auch vom Presbyterium über nommen, in dem es einen Stamm an Mitgliedern gab, die uner schütter lich hinter Leipski standen. Wenn er sagte:»es ist alles in Ordnung«, dann war alles in Ordnung
109 Ratsherr der Stadt Bochum Der engagierte Einsatz der beiden jungen Pfarrer brachte für Gert Leipski wohl so viel Freiraum in der Gemeindearbeit mit sich, dass er sich neuen Aufgaben widmen konnte. In der WAZ vom wurde berichtet:»in Werne hat der SPD Ortsverein Vollmond mit großer Mehrheit Pfarrer Gert Leipski als Direktkandidaten für den Kommunalwahlkreis 14 vor geschlagen.«207 Gert Leipski kandidiert für den Rat der Stadt Bochum (Zeitungsausschnitt vom März 1975, Archiv der Ev. Kirchengemeinde Bochum-Werne). 109
110 Das öffentliche, parteipolitische Engagement eines evangelischen Pfarrers war zu der Zeit ebenso ungewöhnlich, wie eine Kandidatur für den Stadtrat. Da wurde besonders in kirchlichen Kreisen schon gefragt, ob dies denn überhaupt erlaubt sei und wenn ja, ob es sich denn auch gehörte. Der damalige Bochumer Superintendent, Wolfgang Werbeck, sah sich zu einer Klarstellung veranlasst. In einem Brief an die Pfarrer seines Kirchenkreises schrieb er:»daß sich auch Pfarrer um einen Sitz im Stadtparlament bemühen, ist nach dem Pfarrerdienstgesetz nicht untersagt. Es mangelt mir persönlich auch nicht an Verständnis für einen solchen Entschluß, jedenfalls im konkreten Fall.«208 Leipski selbst stellte sich den Wählern in einem Zeitungsartikel vor. Darin begründet er seinen Schritt: 110»Zur aktiven politischen Arbeit kam ich über die menschlichen, sozialen und kommunalen Probleme der Zechenschließung von Robert Müser, dem großen Einschnitt in der Entwicklung unseres Ortsteils. Mir wurde damals deutlich, wenn ich den Menschen helfen will, muß ich in den politischen Raum hineinwirken. Meine eigenen sozialethischen Vorstellungen als Christ sah ich am besten in der SPD verwirklicht.«209 Leipski wurde gewählt und nahm ab dem 4. Mai 1975 für die SPD einen Sitz im Rat der Stadt Bochum wahr und 1984 wurde er wiedergewählt. Seine Mitarbeit im Rat dauerte insgesamt bis zum 1. Oktober In dieser Zeit gehörte er dem Haupt ausschuss und dem Gesundheits- und Sozialausschuss an, des sen Vor sitzender er etliche Jahre war. 211 Außerdem fungierte er einige Jah re als Sprecher der Ratsfraktion. In seiner ersten Amtsperiode wurde im Rat über Strukturmaßnahmen im Bereich Bochum-Langendreer-Werne beraten und das sogenannte
111 »Stand ort-programm«beschlossen. In dem Zusammenhang wurden u.a. das Gelände der ehemaligen Zeche Robert Müser, sowie der Sied lungsbereich Vollmond zum Sanierungsgebiet erklärt. Das war für die Entwicklung des Stadtteils und seiner Infrastruktur von großem Vorteil. Hier brachte Leipski seine Orts- und Sachkenntnis erfolgreich mit ein. Aber auch wenn es um Altenpflegeeinrichtungen und Seniorenwohnanlagen ging, um die Situation von Behinderten oder um Übergangsheime für Aus siedler, waren seine Erfahrungen und sein Engagement oftmals von entscheidender Bedeutung. 212 In der Tat konnte er als Ratsmitglied einiges bewegen, nicht nur für den Ortsteil Werne, sondern insgesamt für die Stadt Bochum, denn in diesen Jahren galt es, neuen sozialen Herausforderungen zu begegnen. Visitation durch den Kirchenkreis 1983 Als 1983 wieder eine Visitation der Kirchengemeinde durch den Kirchen kreis stattfand, würdigte der Bochumer Superintendent Wilhelm Win kel mann in seinem Bericht ausdrücklich die sozialen Aktivitäten der Ge mein de und maßgeblich ihres Pfarrers Gert Leipski:»Die Kirchengemeinde Bochum-Werne ist vor anderen Kirchengemeinden durch ihre soziale Sensibilität ausgezeichnet. Ihre Geschichte ist eng mit dem Bergbau verknüpft. Sie war eine Arbeitergemeinde und ist eine Gemein de geblieben, die sich der sozial Schwachen annimmt Die Ge meinde gewann neue öffentliche Konturen, als sie sich den sozialen Herausfor derungen stellte, die sich durch die Stillegung der Zeche Robert Müser der Harpener Bergbaugesellschaft ergeben haben. Sie entwickelte einen ers ten Arbeitslosentreff im Ludwig-Steil-Haus. Bürgerinitiativen wurden ge gründet, um Bergarbeiter-Siedlungen in Eigenheim-Siedlungen umzu- 111
112 wandeln In Zusammenarbeit mit der Initiative Nahverkehr konnte eine für ältere Menschen günstigere Linienführung der BOGESTRA er reicht werden. Die steigende Zahl türkischer Mitbürger im 1. Bezirk führte zur Bildung des Jugendsozialwerks zunächst im Ludwig-Steil-Haus, dann in an gemie te ten Räumen. Die Türken kommen mit ihren Problemen zur evange li schen Kirchengemeinde Für Spätaussiedler wurde eine Kleider kammer ein gerichtet, die zugleich informelle Beratungsstelle für Hilfe suchen de ist. Die ses soziale und oft auch parteiliche Handeln der Gemeinde ist vornehm lich dem Einsatz von Pastor Gerd Leipski zu danken. Besondere Beach tung verdient, daß dieses Engagement weder ideologischen noch par teipolitischen Konzeptionen entspringt, sondern der unmittelbaren Sor ge um die anvertrauten Menschen. So hat die Gemeinde immer wieder ein An walt der Schwachen gegenüber den sozial Stärkeren sein können Die Sorge um den Menschen in der Gemeinde Bochum-Werne ist ver wurzelt im Hören auf Gottes Wort.«213 In der Tat war das fürsorgende Handeln Gert Leipskis aus dem Glauben motiviert. Er behielt bei aller Mitarbeit an strukturellen Verbesserungen immer den einzelnen Menschen im Auge, und er machte auch gegenüber seinen Parteigenossen keinen Hehl aus seinen christlichen Überzeugungen. Auch als Ratsherr blieb er Pastor. In seiner Solidaritätsadresse auf einer Protestkundgebung der IG Metall in Bochum sagte er einmal:»ich spreche nicht als Privatperson, sondern in Verantwortung vor dem Evangelium Jesu Christi.«
113 Bußtagsbriefe Anfang der 80er Jahre begann er jeweils zum Buß- und Bettag»Bußtags briefe«an seine SPD-Ratsfraktion zu schreiben. 215 Darin zeigte er sich nicht nur als christlicher Mahner, sondern auch als Seelsorger seiner Parteigenossen. Er benannte zwar sehr hellsichtig die konkreten sozialen Herausforderungen und forderte, je nachdem, zum Umdenken oder zum Handeln auf. Aber ebenso thematisierte er die Hilflosigkeit der Kommu nalpolitiker, die mit ihren begrenzten Möglichkeiten nur selten dem not leidenden Einzelnen gerecht werden können. In dem Brief von 1980 benannte er das Unbehagen, das die politisch Verantwortlichen beschleichen kann, wenn ihnen die sozialen Pro bleme, mit denen sie konfrontiert sind, über den Kopf zu wachsen dro hen: die Lebenssituation kinderreicher Familien in städtischen Un ter künften, Einfachstwohnungen und Asylen; die Schwierigkeiten, aus län dische Kinder in Kindergärten unterzubringen; die Lage der psy chisch Kran ken. Er hat die Erleichterung registriert, wenn im Rat die Be schäfti gung mit diesen Problemen einer Institution, etwa»einem Ausländerkoordinierungs kreis«, zugewiesen werden konnte oder darauf hin ge wiesen wurde, dass die Fachleute sich in der Beurteilung der pro ble ma ti schen Situation nicht einig seien. Aber er wollte die Probleme nicht ab schie ben, sondern den einzelnen notleidenden Menschen im Blick be hal ten. So schrieb er:»am Rande unseres Gemeinwesens tauchen also immer mehr Menschengruppen auf, die für uns eine Herausforderung darstellen. Immer mehr Menschen geraten unter uns an den Rand! Jetzt bin ich beim Buß- und Bettag! Müssen wir unseren Blick nicht ändern, müssen wir nicht umdenken? Alle Planung so wichtig sie für die Gesamtentwicklung einer Kommune ist, kann auf die Dauer nicht an den Menschen am Straßenrand vorbeiblicken! Wir kommen nicht daran vorbei, von den Menschen her zu denken, die in un serer Gesellschaft das ist zu allgemein, zu anonym, die in unserer 113
114 Stadt liegenbleiben. Scheinbar kommen nicht alle mit dem Tempo, mit den Anforderungen, mit den Leistungen mit. Scheinbar können nicht alle das Leben, so wie es sich unter uns entwickelt hat und im Augenblick darstellt, bewältigen, weil ihnen dazu die Kräfte fehlen. Was geht eigentlich um uns herum vor? Warum steigt die Zahl der Opfer? (Dazu gehören z.b. auch die Alkohol- und Drogenkranken!)«216 Ein Jahr später mahnte er mehr Mitmenschlichkeit an:»unser Reden und Diskutieren über die anstehenden Entscheidungspunkte in den Sitzungen und der Ausschüsse ist so rational, kühl bis unterkühlt, von technischen, finanziellen, sachlichen, verwaltungstechnischen bis bürokratischen Sachzwängen bestimmt, daß der Mensch, Mitmensch, Mit bür ger verlorenzugehen droht. Der schwache Mitmensch, der hilfsbedürftige Mitmensch, ist in Gefahr, Manö vriermasse zu werden. Einmal ist er der Gegenstand unserer großen sozialen Leistungen und dann der Gegenstand unserer Kritik deshalb, weil er oft nichts anderes tut, was die Kommune u.u. auch tut, die Gesetze zu seinem Vorteil auszunutzen.«217 Konkret benannte er als Beispiele die pflegebedürftigen Alten, Studenten, die keine Wohnung finden,»sonderschüler«und Obdachlose. Für all diese Menschen muss seiner Ansicht nach»das soziale Netz durch das Netz der Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit ergänzt werden«. 218 In den folgenden Jahren gab er in seinen Bußtagsbriefen häufig Lesefrüchte weiter: u.a. aus Erich Fromm»Haben oder Sein«und»Die Kunst des Liebens«, Hoimar von Ditfurth»So lasst uns denn ein Apfelbäum chen pflanzen«oder Horst-Eberhard Richter»Die hohe Kunst der Korruption«. 219 Leipski las viel, reflektierte das Gelesene und brachte es mit Erlebnissen und Erfahrungen im politischen Alltag in Verbindung. Sensibel für die Nöte der Menschen, sah er sehr frühzeitig Probleme auf- 114
115 kommen. Sein Verständnis für die Notlagen war so elementar, dass er rein administrative oder strukturelle Maßnahmen selten als eine ausreichende Lösung empfand. Buße konkretisierte er dann als Bereitschaft zu Veränderung und zu Versöhnung, als Abkehr von Vorurteilen, als ein Mehr an Transparenz und Beteiligung von Betroffenen bei Entscheidungen der Politik und immer wieder als Wahrnehmung des einzelnen Menschen. Als theologische Begründung verwies er hier, wie auch an anderer Stelle auf die biblische Geschichte vom Barmherzigen Samariter (Lukas 10, 29 37). Ein weiterer biblischer Text, auf den er sich häufig berief, waren die Worte Jesu aus seiner Rede zum Endgericht:»Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan«(matthäus 25,40). Dem, der in Not geraten ist, zum Mitmensch, zum Nächsten werden, und in denen, die gering geachtet werden, Jesus Christus selbst erkennen, das war Gert Leipskis Credo. Darüber wollte er nicht nur von der Kanzel reden, das schrieb er auch in Briefen, darüber sprach er in Sitzungen und am Telefon und das war für ihn das Wichtigste das setzte er in die Tat um. Darin realisierte sich für ihn Nachfolge Christi. 220 Für diese Aufgabe nahm er auch die Kirchengemeinde in die Pflicht. Er selbst erlebte als Christ und Pfarrer eine große Freiheit, die ihn furchtlos machte gegenüber denen, die Macht hatten, die als Autoritäten galten oder glaubten, über andere Menschen verfügen zu können. Ihnen gegenüber hat er immer wieder das Schicksal des Einzelnen starkgemacht, auf Notlagen hingewiesen, auf Ungerechtigkeiten und unwürdige Behandlung sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Hierbei wollte er auch die Men schen seiner Gemeinde an seiner Seite haben: Eine christliche Gemeinde»muß für die sprechen, die aus Furcht vor nicht zu reden wagen, die mit Paragraphen mundtot gemacht werden. Eine Gemeinde muß Mut machen, selber den Mund aufzutun. Zugleich aber wird die Gemeinde so selbstkritisch 115
116 sein, um den Wurzeln des eigenen Handelns nachzuspüren, ob eigene Ehre mit im Spiele ist. Allerdings hängt auch dies wahrscheinlich miteinander zusammen: die Furcht vor und die eigene Ehre.«221 Die eigene Ehre suchte Gert Leipski mit seinem Eintreten für andere nicht. Weltweite Kontakte Dabei ging sein Blick zunehmend über die eigene Gemeinde, den Kirchenkreis, ja über Deutschland hinaus. Die Erlöse der Waffelback-Ak tion waren von Anfang an für»brot für die Welt«bestimmt, später auch für Einzelprojekte, z.b. eine Kinderklinik, die die Stadt Bochum in Gambia förderte. 222 Damit verbunden waren Informationen über Not lagen und Nothilfen in der Dritten Welt, wie es damals hieß. Aber auch die Gemeindebriefe, die in den 80er Jahren regelmäßig erschienen, nutzte er zur Information und berichtete immer wieder über die notvolle Lebenssituation der Menschen in Südamerika oder in Afrika. Einen ihm be kannten Ökologen, dessen Eltern in Leipskis Pfarrbezirk wohnten und der als Entwicklungshelfer in Nicaragua arbeitete, lud er zu einem Vortrag ins Ludwig-Steil-Haus ein. Im Gemeindebrief konnte man darüber lesen:»bei dieser Gelegenheit gaben wir eine Spende von 4.000,--DM mit. Für dieses Geld sollte Saatgut und notwendiges landwirtschaftliches Gerät gekauft werden. Mich haben am meisten diese Sätze bewegt: Das Vertrauen in die eigene Kraft ist vielen Nicaraguanern noch nicht selbstverständlich Für sie ist es neu, daß sich jemand um sie kümmert und für sie interessiert Viele Nicaraguaner sind so bettelarm, daß sie sich Samen und Geräte für die Anlage eines Hausgartens nicht kaufen können. «
117 Leipski selbst knüpfte in dieser Zeit verstärkt Kontakte zu Gemeinden in anderen Teilen Europas und unternahm Gemeindereisen dorthin. Ein erstes Ziel war Ostpreußen, wo er Kindheit und Jugendjahre verbracht hatte. Hier ergab sich eine Beziehung zur Gemeinde in Rastenburg, die er über viele Jahre pflegte. Aber auch Gemeinden in Prag und Budapest und anderswo wurden besucht. Zu einer Tradition in der Gemeinde entwickelten sich die Familienfreizeiten nach Canyadell in Spanien. Bei diesen Reisen entstanden enge Kontakte zwischen dem Pfarrerehepaar Leipski und den mitreisenden Familien, die auch dem Zusammenhalt der Gemeinde in Werne zugute kamen. 117
118
119 Wendepunkte Bei aller Wertschätzung, die Leipski zuteil wurde und bei aller Aner kennung, die sein Einsatz für Bürgerbelange vor Ort wie für die Notleidenden weltweit fand, musste er zunehmend Rückschläge und Enttäuschungen verkraften. Rückschläge und Verluste Besonders nah ging es ihm, dass er den Jugendkeller schließen musste. Probleme mit den Jugendlichen, die sich am Ludwig-Steil-Haus trafen, hatte es immer gegeben, aber seit Anfang der 70er Jahre spitzte sich die Situation zu. Kleinere Raufereien, bei denen auch gelegentlich das Mobiliar zu Bruch ging, hatte der Pastor noch großzügig geduldet. Aber die Art des Umgangs miteinander veränderte sich. Hatte er noch anti autoritäres Aufbegehren der Jugendlichen, das in der Zeit üblich war, mit getragen, fühlte er sich doch persönlich getroffen, als dann seine eigene, eher kumpelhafte Autorität nicht mehr respektiert wurde. Als sich im Jugendkeller immer öfter Rockerbanden einfanden, sah er sich kör perlichen Angriffen ausgesetzt. Die Gemeindechronik hält fest:»in der Jugendarbeit stellen jugendliche Rockerbanden die Verantwortlichen vor erhebliche Probleme. Im Jugendkeller des Ludwig-Steil-Hauses kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf Pfarrer Leipski mehrfach körperlich bedroht wird Wegen der anhaltenden Probleme werden die Jugendarbeit und der Jugendtanz am Ludwig-Steil-Haus eingestellt.«224 Nach etwa 12 Jahren war sein Konzept der Jugendarbeit gescheitert. 119
120 Sehr viel schwerer und dauerhafter belastete ihn jedoch ein familiärer Schicksalsschlag. Für den 25. Juli 1979 hatten Gert und Ruth Leipski die Feier ihrer Silbernen Hochzeit geplant. Alles war für das Fest vorbe reitet. Da erreichte sie am Morgen des Festtages die Nachricht, dass in der Nacht ihre jüngste Tochter, gerade 20-jährig, ihrem Leben durch Selbst mord ein Ende gemacht hatte. 225 Von diesem Schlag hat sich die Familie lange nicht erholt. Gert Leipski versuchte so weiterzumachen wie bisher, verfügte aber nicht mehr über den Elan wie früher. Kränkung, Trauer und Schuldgefühle, die mit solch einem Ereignis verbunden sind, lähmten seine Kräfte. Enge Mitarbeiter nahmen die Veränderungen in seinem Verhalten wahr. Sie meinten später, unterscheiden zu können zwischen der Art und Weise, wie er vor diesem Schicksalsschlag seine Ar beit tat, und der Zeit danach. Im April 1982 verließ Reinhard Wolters die Kirchengemeinde, ein Jahr später auch Johannes Lohmann. Wolters war durch Vermittlung von Helmut Disselbeck, der inzwischen Pfarrer in Kiel war, ebenfalls in eine Pfarrstelle in Kiel gewählt worden. Leipski erfuhr erst davon, als schon alles entschieden war. Diese Heimlichkeit hat er seinem alten Freund Disselbeck, wie auch seinem langjährigen Kollegen Wolters übelgenommen. Aber Wolters wie auch Lohmann empfanden die fast väterliche Haltung Leipskis ihnen gegenüber, so hilfreich sie auch anfangs war, zunehmend als eine patriarchale Dominanz, aus der sie sich lösen wollten. Die Pfarrstelle von Johannes Lohmann im 4. Bezirk wurde nach einem halben Jahr mit Peter Scheffler besetzt. Die Stelle von Reinhard Wolters im 2. Pfarrbezirk wurde zunächst pastoral versorgt. Erst im Dezember 1985, also nach dreieinhalb Jahren, konnte mit Peter Baukloh-Dalheimer ein neuer Pfarrer eingeführt werden. Damals zeichnete sich schon ab, dass die Kirchengemeinde Bochum- Werne wegen eines bevorstehenden drastischen Rückgangs der Ge meinde gliederzahlen die vier Pfarrstellen nicht auf Dauer würde halten können. Leipski ging davon aus, dass mit seinem Eintritt in den Ruhestand die Pfarrstelle des 1. Bezirks mit der des 2. Bezirks zusammengelegt werden 120
121 würde und mit Baukloh-Dalheimer aller Voraussicht nach sein direkter Nachfolger gewählt worden war. So geschah es dann später auch. Diese personellen Veränderungen betrafen aber zunächst Leipskis Ar beit im 1. Pfarrbezirk nur am Rande. Er hatte sich rund um das Lud wig- Steil-Haus, in Werne-Vollmond, wie der Bezirk auch genannt wurde, eine eigene Gemeinde gesammelt. Man konnte fast von einer Per so nalge meinde sprechen. Aufgrund seines sozialen Engagements und seiner par tei politischen Tätigkeit im SPD-Ortsverein Werne-Vollmond waren die Gren zen zwischen Kirchengemeinde und Bürgergemeinde flie ßend. Die Som merfeste am Ludwig-Steil-Haus, die aufwändiger wa ren als die an der Kir che, wurden von Dutzenden Helferinnen und Hel fern vorbereitet und ausgerichtet. Es waren richtige Stadtteilfeste. Im Ge mein dehaus trafen sich auch außerkirchliche Gruppen. Als erste dieser Art hatte der Männergesangverein»Einigkeit«dort Aufnahme gefunden, zu dem Leipski einen engen Kontakt pflegte. 226 Viele Gemeindeglieder waren stolz, dass ihr Pastor Mitglied im Stadtrat war. Mit ihren Problemen und Sorgen kamen sie zu ihm, wobei es manchmal nicht eindeutig war, ob sie zu ihrem Pastor kamen oder zum SPD-Mann und Ratsmitglied. Auch Leipski selbst unterschied nicht immer klar zwischen seinen verschiedenen Rollen. Man beobachtete, dass alte Genossen aus dem Bergbau, der Partei oder der Gewerkschaft re gelmä ßig zum Geburtstag besucht wurden, andere Gemeindeglieder weniger regelmäßig. Zu denen, die nicht aus der Bergbautradition kamen oder eine andere politische Richtung vertraten, hielt er Distanz. Mit der damals aufkommenden Partei der Grünen und deren Mitgliedern konn te er nicht viel anfangen. Um sich nicht zu streiten, ging man sich aus dem Weg. 227 Es wurde spürbar, dass sich auch in Werne-Vollmond die Zeiten und die Menschen änderten. Gert Leipski verlor zunehmend seine Integrationskraft, die über viele Jahre seine Stärke gewesen war. Seine kumpelhafte und gleichzeitig patri ar chalische Art des Umgangs kam nicht mehr bei allen an. Seine ge- 121
122 le gentliche Schroffheit, die früher häufig mit einem Lachen quittiert worden war, stieß nun Menschen vor den Kopf. So zog er sich von sich aus stärker auf die Menschen zurück, die seiner Gesinnung waren und seine Sprache sprachen oder denen er helfen konnte. Sozial sensibel und einsatzbereit war er nach wie vor. Aber etwas Nachhaltiges zu bewirken wurde immer schwieriger, je mehr seine politisch einflussreichen Duzfreunde aus dem politischen Tagesgeschehen, aus ihren Ämtern oder aus seinem Lebensumfeld verschwanden. Seine Mitarbeit im Stadtrat war nützlich für die Bewältigung sozialer Probleme auch in Werne, führte aber naturgemäß nur sehr selten zu schnellen Erfolgen konnte Gert Leipski sein 30-jähriges Ortsjubiläum als Pfarrer in Bochum-Werne feiern. Seine Erinnerungen an diese lange Zeit fasste er in einer kleinen Broschüre mit dem Titel»Heiteres und Besinnliches aus der Kirchengemeinde Werne«zusammen. Die zumeist amüsanten Anekdoten lassen ausschließlich Ereignisse aus der ersten Hälfte seiner Amtszeit aufleuchten. Als er gegen Ende dann doch noch eine menschliche Enttäuschung erwähnt, stellt er diese Erfahrung in den Horizont der Glaubenshoffnung:»Aber das alles können wir ertragen, weil Gott der große Verwandler ist, er wird unsere Traurigkeit in Freude verwandeln. Damit beginnt er schon jetzt!«228 Abschied aus Bochum-Werne 30 Jahre Pfarrdienst in Werne waren wohl genug überraschte Leipski das Presbyterium und die Gemeinde mit der Ankündigung im kommenden Jahr in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Obwohl er erst am 1. Oktober 1991 die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht hätte, wurde er am 10. Juni 1990 aus seinem Amt verabschiedet. Gründe für diesen vorzeitigen Rückzug hat er öffentlich nicht genannt. 122
123 Als seine Verabschiedung bevorstand, wurden im Gemeindebrief die Erinnerungen zweier langjähriger Weggefährten abgedruckt. Der Pres byter Hans Heusener 229 erzählte:» Gert Leipski hat sich immer wieder für Menschen eingesetzt, die keine Lobby hatten. Ich denke vor allem an die Zeit der Zechenstillegungen In diesem Zusammenhang hat mich ein Erlebnis besonders stark bewegt: Einmal sind einige Herren aus Düsseldorf mit einigen betroffenen Arbeitslosen in der Wohnung von Gert Leipski zusammengetroffen Da sagte einer der Herren: Wie kommt es, daß sie als Pfarrer sich so für die Leute einsetzen? Darauf Gert Leipski: In meiner Bibel steht: Was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan, darum bin ich dazu verpflichtet. Natürlich hat es mit Pfarrer Leipski im Presbyterium auch die eine oder andere Auseinandersetzung gegeben, aber nach solchen Sitzungen hatte ich immer das Gefühl, es bleibt kein Stachel zurück. Ich kann nur sagen, ich bin froh, daß er mit seiner sozialen Einstellung solange unser Pfarrer geblieben ist.«230 Heinz Herden, seit 1960 mit Leipski zusammen Pfarrer in Werne, fügte aus seiner Sicht Erinnerungen hinzu, die von der gegenseitigen Achtung zeugen, die diese beiden Amtsbrüder verband:»er wollte Ernst machen mit der Nachfolge Christi und den Glauben an Jesus Christus in seinem Leben und Dienst verwirklichen Es kam Gert Leipski immer darauf an, alle Dinge in unserer Kirchengemeinde gemeinsam zu verantworten. Daß jeder Pfarrer von seinen Gaben und Fähigkeiten her die Prioritäten seines Dienstes anders setzen muß, versteht sich von selbst. So sah er auch keinen Unterschied zwischen dem Kern der Gemeinde und denen, die an den Rand der Gesellschaft und oft auch des Lebens gedrängt wurden. Nachfolge Christi hieß für ihn in seinem Dienst, sich jeder Sorge anzunehmen Daß er bei der Bewältigung dieser Fragen oft wenig Dank er warten durfte und vielfach auch mißverstanden wurde, wußte er von vornherein. Seine tief geprägte Frömmigkeit gab ihm die Kraft und die Bereit- 123
124 schaft auch bei schwersten persönlichen Belastungen, für die Men schen jederzeit und überall im Dienst zu sein «231 Am 10. Juni 1990 wurde Gert Leipski ein großes Abschiedsfest bereitet.»mehr als 300 Gemeindeglieder, Vertreter der Stadt mit Oberbürgermeister Heinz Eikelbeck und Oberstadtdirektor Herbert Jahofer, der Parteien, Gewerkschaften und Verbände waren dazu ins Ludwig-Steil-Haus gekommen. In seiner Abschiedspredigt über das Gleichnis vom verlorenen Sohn legte Gert Leipski seinen Zuhörern ans Herz, immer wieder neu auf den Mitmenschen zuzugehen.«232 Der Superintendent des Kirchenkreises Bochum, Wilhelm Winkelmann, würdigte ihn als»soziales Gewissen der Kirche«. 233 Das Abschiedsgeschenk der Kirchengemeinde war u.a. ein Scheck über DM. 124»Die Summe soll nach Leipskis Willen für die Nichtseßhaftenarbeit verwendet werden.«234 Zu seinem großen Leidwesen bedeutete der Abschied aus dem Pfarramt für Gert Leipski aber auch den Abschied aus Werne. Er hatte sich gewünscht und es wohl auch erwartet, im Ruhestand mit seiner Frau in Werne wohnen zu bleiben, denn dort lebten die Freunde und die Menschen, die ihnen am Herzen lagen. Hier fühlten sie sich zugehörig, hier waren sie heimisch. Diese Pläne aber stießen auf den Widerstand der Amtsbrüder. Die drei Kollegen bestanden darauf, dass er im Ruhestand aus der Gemeinde wegzog. 235 Sie hatten die wohl nicht unberechtigte Befürchtung, dass sein Nachfolger Baukloh-Dalheimer ansonsten große Schwierigkeiten hätte in Werne-Vollmond»ein Bein an die Erde«zu bekommen. Heinz Herden, sein langjähriger Kollege und Freund, wurde gebeten, ihm diesen Standpunkt nahezubringen. Gert Leipski verstand das nicht, er war sehr gekränkt. Es war ja nicht seine Absicht, jemandem das Leben schwer zu machen. Aber er fügte sich und zog mit seiner Frau zusammen nach Querenburg, einem benachbarten Stadtteil Bochums. 236
125 Im Ruhestand Aus der Gemeindearbeit in Werne hielt er sich weitgehend heraus, aber am Leben der ihm vertrauten Menschen dort nahm er selbstverständlich noch Anteil. Er fuhr mit bei Gemeindefreizeiten. Er machte Besuche im Altenheim und spielte auf seinem Schifferklavier die alten Lieder und Melodien. 237 Besonders intensiv kümmerte er sich um Nichtsesshafte. Als 1991 der 24. Deutsche Evangelische Kirchentag im Ruhrgebiet stattfand, wurde unter Mitarbeit Leipskis ein Videofilm gedreht, der die Geschichte des Stadtteils Werne dokumentierte. Im Mittelpunkt stand dabei die Schachtanlage Robert Müser, die das Leben der Menschen in Werne über viele Jahrzehnte geprägt hatte und dies noch Jahre nach ihrer Stilllegung tat. Erwähnung fand dabei auch das Engagement der Kirchengemeinde und ihres Pfarrers Leipski für die Bergleute und ihre Familien. 238 Aber auch für die SPD und die Gewerkschaft oder für kommunale Belange engagierte er sich weiterhin ehrenamtlich. So gehörte er z.b. zu den Gründungsmitgliedern des Vereins»Humanitäre Irakhilfe Bochum«, der versuchte, eine medizinische Behandlung für schwer verletzte, zivile Opfer des Golf-Krieges in Bochumer Krankenhäusern zu organisieren. 239 Bundesverdienstkreuz Ein Jahr nach seinem Eintritt in den Ruhestand wurde ihm eine große persönliche Ehrung zuteil. Am wurde ihm das Bundes verdienst kreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Er erhielt die Auszeichnung für sein soziales Engagement,»besonders im Zusammenhang mit der Bewältigung der Probleme um die Stillegung 125
126 der Zeche Robert Müser«240. In der Begründung wurden aber auch seine politische Tätigkeit, 15 Jahre im Stadtrat und vier Jahre Vorsitz im Sozialausschuss, seine Gewerkschaftsarbeit und sein vielfacher Einsatz für die Belange der Bergleute genannt. 241 Der damalige Superintendent des Kirchenkreises Bochum, Wilhelm Winkelmann, der im Vorfeld um eine Stellungnahme gebeten worden war, begrüßte die geplante Ehrung ausdrücklich. In seiner Begründung verwies er darauf, dass Leipski das sozialpolitische Engagement des Kirchenkreises entscheidend mitgeprägt habe:»das Gespräch zwischen Kirche und Gesellschaft wurde von ihm wesentlich mit entwickelt und mitbestimmt. Er half entscheidend mit, daß sich das so ziale Bewußtsein in unserem Kirchenkreis von einem mehr diakonisch bestimmten zu einem diakonisch und gesellschaftspolitisch bestimmten Bewußtsein weiter entwickelte.«242 Außerdem betonte er: Und:»Pfarrer Gert Leipski war und ist ein sozial engagierter Pfarrer, der mutig und eindeutig Partei ergriff für die Benachteiligten in seiner Gemeinde und in unserer Stadt. Dabei war er bereit in die Rolle des Störenfrieds gedrängt zu werden bzw. die Verantwortlichen auch zu brüskieren.« »Die besondere Stärke seines Engagements liegt in seiner Konkretheit. Er entwickelte sein Engagement aus dem Zusammenleben mit den Menschen, die auf verschiedene Weise zu Opfern von verschiedenen Entwicklungen wurden.«244 Leipski selbst kommentierte die Ehrung mit dem Hinweis, dass» die Pastoren die einzigen freien Menschen sind, die sich engagieren können, ohne vor jemandem Angst haben zu müssen«. 245
127 Einige Zeit nach seinem Eintritt in den Ruhestand konnte er die ge sundheitlichen Probleme nicht mehr ignorieren oder bagatellisieren, wie es bisher seine Art war. Während einer Reise ins Ausland im Sommer 1992 fragte er einen befreundeten Arzt nach möglichen Ursachen. Der riet ihm dringend, sich zuhause gründlich untersuchen zu lassen. Seit dem Herbst 1992 wussten er selbst, sowie seine Familie und enge Freun de, dass seine Krebserkrankung unheilbar war. Am Abend des 23. Februar 1993 starb Gert Leipski in einem Bochumer Krankenhaus. 127
Inhaltsverzeichnis. Vorwort Wichtiger ist der Mensch! Kindheit und Jugend in Ostpreußen Krieg, Gefangenschaft und Studium...
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 9 Wichtiger ist der Mensch!... 13 Kindheit und Jugend in Ostpreußen... 15 In der Hitlerjugend... 17 Reichsarbeitsdienst und Wehrdienst... 19 Krieg, Gefangenschaft und Studium...
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 9 Wichtiger ist der Mensch!... 13 Kindheit und Jugend in Ostpreußen... 15 In der Hitlerjugend... 17 Reichsarbeitsdienst und Wehrdienst... 19 Krieg, Gefangenschaft und Studium...
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
PREDIGT: Epheser Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
 PREDIGT: Epheser 2.17-22 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde! In den letzten Jahre sind viele Menschen
PREDIGT: Epheser 2.17-22 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde! In den letzten Jahre sind viele Menschen
Domvikar Michael Bredeck Paderborn
 1 Domvikar Michael Bredeck Paderborn Das Geistliche Wort Entdeckungsreise zu Jesus Christus Sonntag, 20.02. 2011 8.05 Uhr 8.20 Uhr, WDR 5 [Jingel] Das Geistliche Wort Heute mit Michael Bredeck. Ich bin
1 Domvikar Michael Bredeck Paderborn Das Geistliche Wort Entdeckungsreise zu Jesus Christus Sonntag, 20.02. 2011 8.05 Uhr 8.20 Uhr, WDR 5 [Jingel] Das Geistliche Wort Heute mit Michael Bredeck. Ich bin
Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig
 90. Geburtstag Dr. Werner Ludwig Seite 1 von 6 Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig, im Pfalzbau. Es gilt das
90. Geburtstag Dr. Werner Ludwig Seite 1 von 6 Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig, im Pfalzbau. Es gilt das
... und um mich kümmert sich keiner!
 Kolumnentitel 3 Ilse Achilles... und um mich. kümmert. und um sich mich keiner! kümmert sich keiner! Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder Mit einem Geleitwort von Waltraud
Kolumnentitel 3 Ilse Achilles... und um mich. kümmert. und um sich mich keiner! kümmert sich keiner! Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder Mit einem Geleitwort von Waltraud
Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder. Mit einem Geleitwort von Waltraud Hackenberg
 Kolumnentitel 3 Ilse Achilles und um mich kümmert sich keiner! Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder Mit einem Geleitwort von Waltraud Hackenberg 5., aktualisierte Auflage
Kolumnentitel 3 Ilse Achilles und um mich kümmert sich keiner! Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder Mit einem Geleitwort von Waltraud Hackenberg 5., aktualisierte Auflage
PERSONEN MARIA: lebt mit ihrer Familie in Astenberg/
 VON ROSMARIE THÜMINGER Sie wurde am 6.7.1939 in Laas, in Südtirol, geboren. Zehn Tage im Winter war ihr drittes Jugendbuch. Es entstand auf Grund eigener Erlebnisse. PERSONEN MARIA: lebt mit ihrer Familie
VON ROSMARIE THÜMINGER Sie wurde am 6.7.1939 in Laas, in Südtirol, geboren. Zehn Tage im Winter war ihr drittes Jugendbuch. Es entstand auf Grund eigener Erlebnisse. PERSONEN MARIA: lebt mit ihrer Familie
Können Sie sich vielleicht auch noch daran erinnern, wie Sie sich fühlten, als Sie diesen Brief lasen?
 Liebe Gemeinde, wann haben Sie das letzte Mal einen Liebesbrief erhalten? War das gerade erst? Oder ist es schon längere Zeit her? Ihr, die Konfirmanden und Konfirmandinnen, vielleicht einen kleinen, zusammengefalteten
Liebe Gemeinde, wann haben Sie das letzte Mal einen Liebesbrief erhalten? War das gerade erst? Oder ist es schon längere Zeit her? Ihr, die Konfirmanden und Konfirmandinnen, vielleicht einen kleinen, zusammengefalteten
Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler)
 Archivale im August 2013 Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler) 1. Brief von Hanna Fries aus Ludwigshafen vom 7.2.1917 an Jakob Ziegler, Weyher (Quellennachweis: Landesarchiv Speyer, Bestand
Archivale im August 2013 Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler) 1. Brief von Hanna Fries aus Ludwigshafen vom 7.2.1917 an Jakob Ziegler, Weyher (Quellennachweis: Landesarchiv Speyer, Bestand
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Der Nationalsozialismus - Die Geschichte einer Katastrophe
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Nationalsozialismus - Die Geschichte einer Katastrophe Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Ab 7. Schuljahr
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Nationalsozialismus - Die Geschichte einer Katastrophe Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Ab 7. Schuljahr
Krieger des Lichts. Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola
 Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola Krieger des Lichts Prolog Höre mich, Mensch. Was machst du mit der Erde? Wenn du dich darum nicht kümmerst, Wird alles bald
Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola Krieger des Lichts Prolog Höre mich, Mensch. Was machst du mit der Erde? Wenn du dich darum nicht kümmerst, Wird alles bald
Der Knirps aus Kasachstan
 Nickstories - Vielfältiger als jeder Regenbogen PetraPan Der Knirps aus Kasachstan Herausgeber: Nickstories e.v. Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kaiserslautern unter der Registernummer
Nickstories - Vielfältiger als jeder Regenbogen PetraPan Der Knirps aus Kasachstan Herausgeber: Nickstories e.v. Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kaiserslautern unter der Registernummer
Adolf Hitler. Der große Diktator
 Adolf Hitler Der große Diktator Biografie Die frühen Jahre Herkunft, Kindheit und erster Weltkrieg Aufstieg Polit. Anfänge, Aufstieg und Kanzlerschaft Der Diktator Politische Ziele und Untergang Hitlers
Adolf Hitler Der große Diktator Biografie Die frühen Jahre Herkunft, Kindheit und erster Weltkrieg Aufstieg Polit. Anfänge, Aufstieg und Kanzlerschaft Der Diktator Politische Ziele und Untergang Hitlers
André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
 André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Gelebte Reformation Die Barmer Theologische Erklärung 11. Oktober 2017, 9.00 Uhr, Wandelhalle Meine sehr
André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Gelebte Reformation Die Barmer Theologische Erklärung 11. Oktober 2017, 9.00 Uhr, Wandelhalle Meine sehr
Schüleraustausch Düsseldorf - Moskau 2006: Hommage an Klawdija Petrowna
 Schüleraustausch Düsseldorf - Moskau 2006: Hommage an Klawdija Petrowna Biographische Angaben Klavdija Petrovna wurde 1925 geboren. Ihr Vater war Abteilungsleiter in einer Firma, die Kanonen herstellte,
Schüleraustausch Düsseldorf - Moskau 2006: Hommage an Klawdija Petrowna Biographische Angaben Klavdija Petrovna wurde 1925 geboren. Ihr Vater war Abteilungsleiter in einer Firma, die Kanonen herstellte,
von Klaus-Peter Rudolph mit Illustrationen von Heidi und Heinz Jäger RHOMBOS-VERLAG
 von Klaus-Peter Rudolph mit Illustrationen von Heidi und Heinz Jäger RHOMBOS-VERLAG 1 Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
von Klaus-Peter Rudolph mit Illustrationen von Heidi und Heinz Jäger RHOMBOS-VERLAG 1 Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Ihnen allen gemeinsam ist die Trauer, die sie erfüllt hat und jetzt noch in Ihnen ist. Niemand nimmt gerne Abschied von einem lieben Menschen.
 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen Liebe Gemeinde viele von Ihnen sind heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen, weil sie einen lieben Menschen verloren haben, einen Menschen, mit dem
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen Liebe Gemeinde viele von Ihnen sind heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen, weil sie einen lieben Menschen verloren haben, einen Menschen, mit dem
Flucht aus dem Sudetenland
 Brigitte Lenz Flucht aus dem Sudetenland Eine wahre Geschichte Ebozon Verlag 1. Auflage September 2016 Copyright 2016 by Ebozon Verlag ein Unternehmen der CONDURIS UG (haftungsbeschränkt) www.ebozon-verlag.com
Brigitte Lenz Flucht aus dem Sudetenland Eine wahre Geschichte Ebozon Verlag 1. Auflage September 2016 Copyright 2016 by Ebozon Verlag ein Unternehmen der CONDURIS UG (haftungsbeschränkt) www.ebozon-verlag.com
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER
 ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012
 Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012 Sehr geehrte Frau Dekanin Kling de Lazer, sehr geehrte Herren Pfarrer Reiner und Huber, sehr
Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012 Sehr geehrte Frau Dekanin Kling de Lazer, sehr geehrte Herren Pfarrer Reiner und Huber, sehr
1 Die Ausgangssituation: Die Wohnung in Trümmern und Trümmer im Gehirn
 1 Die Ausgangssituation: Die Wohnung in Trümmern und Trümmer im Gehirn Für Menschen von heute ist es selbstverständlich, Weiterbildungseinrichtungen nutzen zu können. Es gibt vielfältige Angebote und auch
1 Die Ausgangssituation: Die Wohnung in Trümmern und Trümmer im Gehirn Für Menschen von heute ist es selbstverständlich, Weiterbildungseinrichtungen nutzen zu können. Es gibt vielfältige Angebote und auch
Wiederverheiratete Geschiedene. Für einen offenen Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten in der Kirche. Seite 3
 Katholischer Deutscher FRAUENBUND Wiederverheiratete Geschiedene Für einen offenen Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten in der Kirche Seite 3 1. Ehe zwischen Frau und Mann Leben und Glaube in
Katholischer Deutscher FRAUENBUND Wiederverheiratete Geschiedene Für einen offenen Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten in der Kirche Seite 3 1. Ehe zwischen Frau und Mann Leben und Glaube in
13.n.Tr Mk.3, Familie mit allen Ehe für alle?!
 1 13.n.Tr. 10.9.2017 Mk.3,31-35 Familie mit allen Ehe für alle?! Wie stand es bei Jesus selbst um die Ehe und die Familie? Aus binnen-familiärer und eigentlich auch aus binnen-kirchlicher Sicht ist unser
1 13.n.Tr. 10.9.2017 Mk.3,31-35 Familie mit allen Ehe für alle?! Wie stand es bei Jesus selbst um die Ehe und die Familie? Aus binnen-familiärer und eigentlich auch aus binnen-kirchlicher Sicht ist unser
PROMOS Stipendium Erfahrungsbericht
 PROMOS Stipendium Erfahrungsbericht 1. Planung Da ich mein Praktikum, das ebenfalls Teil meines Studiums war, bei der gleichen Organisation absolviert hatte, hatte ich dadurch während meines Forschungsprojekts
PROMOS Stipendium Erfahrungsbericht 1. Planung Da ich mein Praktikum, das ebenfalls Teil meines Studiums war, bei der gleichen Organisation absolviert hatte, hatte ich dadurch während meines Forschungsprojekts
Über die Ethik des Engagements. Der kleine König Jay C. I. Deutsche Version
 www.littlekingjci.com Deutsche Erstausgabe Titel: Über die Ethik des Engagements 2018 Friedhelm Wachs Umschlag/Illustration: strichfiguren.de (Adobe Stock) Autor: Friedhelm Wachs Lektorat, Korrektorat:
www.littlekingjci.com Deutsche Erstausgabe Titel: Über die Ethik des Engagements 2018 Friedhelm Wachs Umschlag/Illustration: strichfiguren.de (Adobe Stock) Autor: Friedhelm Wachs Lektorat, Korrektorat:
Version 8. Juli 2015 Völlige Freude 1. Völlige Freude durch Gehorsam und Bruderliebe
 www.biblische-lehre-wm.de Version 8. Juli 2015 Völlige Freude 1. Völlige Freude durch Gehorsam und Bruderliebe Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt; bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr
www.biblische-lehre-wm.de Version 8. Juli 2015 Völlige Freude 1. Völlige Freude durch Gehorsam und Bruderliebe Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt; bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr
GOTTES FÜR UNSERE GEMEINDE. Evangelische Gemeinschaft
 GOTTES FÜR UNSERE GEMEINDE Evangelische Gemeinschaft EVANGELISCHE GEMEINSCHAFT HAMMERSBACH HAUTNAH: BEFREIT GLAUBEN BEDINGUNGSLOS DIENEN MUTIG BEKENNEN Wir freuen uns Ihnen mit diesen Seiten Gottes Geschenk
GOTTES FÜR UNSERE GEMEINDE Evangelische Gemeinschaft EVANGELISCHE GEMEINSCHAFT HAMMERSBACH HAUTNAH: BEFREIT GLAUBEN BEDINGUNGSLOS DIENEN MUTIG BEKENNEN Wir freuen uns Ihnen mit diesen Seiten Gottes Geschenk
Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW
 Seite 0 Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW Rede Bundesministerin Dr. Kristina Schröder anlässlich der Eröffnung des Festaktes
Seite 0 Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW Rede Bundesministerin Dr. Kristina Schröder anlässlich der Eröffnung des Festaktes
Es gilt das gesprochene Wort! Gnade sei mit Euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus!
 Ökumenischer Gottesdienst aus Anlass des Gedenktages zu Flucht und Vertreibung in Stuttgart am 20.06.2017, Predigt: Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July Es gilt das gesprochene Wort! Gnade sei mit
Ökumenischer Gottesdienst aus Anlass des Gedenktages zu Flucht und Vertreibung in Stuttgart am 20.06.2017, Predigt: Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July Es gilt das gesprochene Wort! Gnade sei mit
Evangelische Kirchengemeinde Köln - Brück - Merheim
 Evangelische Kirchengemeinde Köln - Brück - Merheim Pfarrerin Wilma Falk-van Rees Predigt über 1.Johannes 1,1-4 PREDIGT Liebe Gemeinde, in diesem Jahr feiern wir Weihnachten in der XXL Version. Nach Heiligabend
Evangelische Kirchengemeinde Köln - Brück - Merheim Pfarrerin Wilma Falk-van Rees Predigt über 1.Johannes 1,1-4 PREDIGT Liebe Gemeinde, in diesem Jahr feiern wir Weihnachten in der XXL Version. Nach Heiligabend
Umschau. Umschau 243. Holger Sonntag:
 243 Pfarrer Dr. Holger Sonntag stammt selbst aus der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe und studierte zu Zeiten von Bischof Joachim Heubach Theologie, um sich auf das geistliche Amt
243 Pfarrer Dr. Holger Sonntag stammt selbst aus der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe und studierte zu Zeiten von Bischof Joachim Heubach Theologie, um sich auf das geistliche Amt
Anke Kallauch. Das große Buch der Glaubensfragen. Mit Illustrationen von Amelia Rosato
 Anke Kallauch Weiß Gott, Das große Buch der Glaubensfragen wer ich bin? Mit Illustrationen von Amelia Rosato Für meine Mutter Shirley Rosato und meine Töchter Louisa und Emma Inwood Amelia Rosato Dieses
Anke Kallauch Weiß Gott, Das große Buch der Glaubensfragen wer ich bin? Mit Illustrationen von Amelia Rosato Für meine Mutter Shirley Rosato und meine Töchter Louisa und Emma Inwood Amelia Rosato Dieses
Was suchst du? Predigt zu Joh 1,35-42 (GrE, 13. So n Trin, )
 Was suchst du? Predigt zu Joh 1,35-42 (GrE, 13. So n Trin, 10.9.17) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die vier Evangelien des Neuen
Was suchst du? Predigt zu Joh 1,35-42 (GrE, 13. So n Trin, 10.9.17) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die vier Evangelien des Neuen
weder die Farbe Deiner Augen, noch weiß ich, wie Du ausgesehen hättest.
 Ich kenne weder die Farbe Deiner Augen, noch weiß ich, wie Du ausgesehen hättest. Aber eines spüre ich: Du hast tiefe Spuren in meinem Herzen und meiner Seele hinterlassen. Spuren, die untrennbar zu mir
Ich kenne weder die Farbe Deiner Augen, noch weiß ich, wie Du ausgesehen hättest. Aber eines spüre ich: Du hast tiefe Spuren in meinem Herzen und meiner Seele hinterlassen. Spuren, die untrennbar zu mir
Magie Die Kraft des Mondes
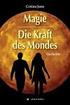 Corina June Magie Die Kraft des Mondes Gedichte edition fischer Unverkäufliche Leseprobe der Verlags- und Imprintgruppe R.G.Fischer Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise,
Corina June Magie Die Kraft des Mondes Gedichte edition fischer Unverkäufliche Leseprobe der Verlags- und Imprintgruppe R.G.Fischer Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise,
Gemeinsame Grundlagen... nach 40 Jahren. Christusträger Bruderschaft Triefenstein - Ralligen - Kabul - Vanga
 Gemeinsame Grundlagen... nach 40 Jahren Christusträger Bruderschaft Triefenstein - Ralligen - Kabul - Vanga Nach gut 40 Jahren gemeinsamen Lebens haben wir Brüder der Christusträger Bruderschaft gemeinsam
Gemeinsame Grundlagen... nach 40 Jahren Christusträger Bruderschaft Triefenstein - Ralligen - Kabul - Vanga Nach gut 40 Jahren gemeinsamen Lebens haben wir Brüder der Christusträger Bruderschaft gemeinsam
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
 Jahresempfang der Bremischen Evangelischen Kirche in der Kirche Unser Lieben Frauen am 1. Dezember 2014 Pastor Renke Brahms Schriftführer in der BEK Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat
Jahresempfang der Bremischen Evangelischen Kirche in der Kirche Unser Lieben Frauen am 1. Dezember 2014 Pastor Renke Brahms Schriftführer in der BEK Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat
Ihr. Familienstammbaum
 As Ihr Familienstammbaum Sein Vater Seine Mutter Ihr Vater Ihre Mutter Sandor Friedmann Rachel Friedmann (geb. Rechnitzer) Schmuel Deutsch Perl Deutsch (geb. Schwartz) Vater des Interviewten Gyula Friedmann
As Ihr Familienstammbaum Sein Vater Seine Mutter Ihr Vater Ihre Mutter Sandor Friedmann Rachel Friedmann (geb. Rechnitzer) Schmuel Deutsch Perl Deutsch (geb. Schwartz) Vater des Interviewten Gyula Friedmann
Spiritualität in der Seelsorge
 Arbeitsgemeinschaft Theologie der Spiritualität Spirituelle Theologie Band 1 Cornelius Roth (Hg.) Spiritualität in der Seelsorge echter Arbeitsgemeinschaft Theologie der Spiritualität Spirituelle Theologie
Arbeitsgemeinschaft Theologie der Spiritualität Spirituelle Theologie Band 1 Cornelius Roth (Hg.) Spiritualität in der Seelsorge echter Arbeitsgemeinschaft Theologie der Spiritualität Spirituelle Theologie
da machen sich die Hirten auf, weil sie dem Ruf eines Engels folgen und die drei Weisen aus dem Morgenland folgen einem Stern.
 Liebe Gemeinde, da machen sich die Hirten auf, weil sie dem Ruf eines Engels folgen und die drei Weisen aus dem Morgenland folgen einem Stern. Sie alle haben nur ein Ziel. Sie wollen das Kind in der Krippe
Liebe Gemeinde, da machen sich die Hirten auf, weil sie dem Ruf eines Engels folgen und die drei Weisen aus dem Morgenland folgen einem Stern. Sie alle haben nur ein Ziel. Sie wollen das Kind in der Krippe
Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen
 Maria auf der Spur Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen Namen höre, dann gehen mir die unterschiedlichsten Vorstellungen durch den Kopf. Mein Bild von ihr setzt sich zusammen aus dem, was ich in
Maria auf der Spur Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen Namen höre, dann gehen mir die unterschiedlichsten Vorstellungen durch den Kopf. Mein Bild von ihr setzt sich zusammen aus dem, was ich in
Rede zur Verabschiedung. von Pfarrer Georg-Peter Kreis. am 21. April 2013 um 14 Uhr. Grußwort des Oberbürgermeisters
 Rede zur Verabschiedung von Pfarrer Georg-Peter Kreis am 21. April 2013 um 14 Uhr Grußwort des Oberbürgermeisters Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist bis zu Beginn der Veranstaltung! Sehr geehrter
Rede zur Verabschiedung von Pfarrer Georg-Peter Kreis am 21. April 2013 um 14 Uhr Grußwort des Oberbürgermeisters Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist bis zu Beginn der Veranstaltung! Sehr geehrter
Säkularinstitute RUF BERUF BERUFUNG
 RUF BERUF BERUFUNG Wo und wie leben die Mitglieder von Säkularinstituten? Mehr als 40.000 Mitglieder gehören zu weltweit rund 200 kirchlich anerkannten Säkularinstituten. Es gibt Mitglieder in Frauen-,
RUF BERUF BERUFUNG Wo und wie leben die Mitglieder von Säkularinstituten? Mehr als 40.000 Mitglieder gehören zu weltweit rund 200 kirchlich anerkannten Säkularinstituten. Es gibt Mitglieder in Frauen-,
Predigt zur Profanierung der Kirche St. Pius X in Neunkirchen. am 1. Nov (Allerheiligen) (Liturgische Texte vom Hochfest Allerheiligen )
 1 Predigt zur Profanierung der Kirche St. Pius X in Neunkirchen am 1. Nov. 2015 (Allerheiligen) (Liturgische Texte vom Hochfest Allerheiligen ) Liebe Schwestern und Brüder, es ist nicht einfach, an solch
1 Predigt zur Profanierung der Kirche St. Pius X in Neunkirchen am 1. Nov. 2015 (Allerheiligen) (Liturgische Texte vom Hochfest Allerheiligen ) Liebe Schwestern und Brüder, es ist nicht einfach, an solch
Es war einmal... mit diesen und vielen anderen Merkmalen von Märchen hat sich die Klasse 2b in den letzten Wochen beschäftigt.
 Es war einmal... mit diesen und vielen anderen Merkmalen von Märchen hat sich die Klasse 2b in den letzten Wochen beschäftigt. Nachdem einige bekannte Märchen der Gebrüder Grimm gelesen und erzählt wurden,
Es war einmal... mit diesen und vielen anderen Merkmalen von Märchen hat sich die Klasse 2b in den letzten Wochen beschäftigt. Nachdem einige bekannte Märchen der Gebrüder Grimm gelesen und erzählt wurden,
GEBET ÖFFNET NEUES. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Hesekiel 36,26
 GEBET ÖFFNET NEUES Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Hesekiel 36,26 1. Tag Rückblick auf das vergangene Jahr Wir loben und danken Gott für: Gottes Allmacht
GEBET ÖFFNET NEUES Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Hesekiel 36,26 1. Tag Rückblick auf das vergangene Jahr Wir loben und danken Gott für: Gottes Allmacht
Gertrud war gern bei ihrer Großmutter. Sie konnte gar nicht genug hören, wenn diese ihr Geschichten erzählte. Das waren keine erfundenen Geschichten,
 Gertrud Gertrud war gern bei ihrer Großmutter. Sie konnte gar nicht genug hören, wenn diese ihr Geschichten erzählte. Das waren keine erfundenen Geschichten, keine Sagen, keine Mythen, auch keine Fantasie-Geschichten,
Gertrud Gertrud war gern bei ihrer Großmutter. Sie konnte gar nicht genug hören, wenn diese ihr Geschichten erzählte. Das waren keine erfundenen Geschichten, keine Sagen, keine Mythen, auch keine Fantasie-Geschichten,
Gemeinde aktuell: Archiv 11 (vom Februar 2004)
 Gemeinde aktuell: Archiv 11 (vom Februar 2004) "Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen" - Pastor Rainer Petrowski auf Fortbildung - Das Pastoralkolleg in Ratzeburg "Leben mit den Toten"
Gemeinde aktuell: Archiv 11 (vom Februar 2004) "Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen" - Pastor Rainer Petrowski auf Fortbildung - Das Pastoralkolleg in Ratzeburg "Leben mit den Toten"
Hinweis Die Schreibweise wurde an die Richtlinien der aktuellen Rechtschreibung angepasst.
 Dr. Hermann Kunst 1, Herford, 23.7.1957» Abschrift (PDF) Hinweis Die Schreibweise wurde an die Richtlinien der aktuellen Rechtschreibung angepasst. DER BEVOLLMÄCHTIGTE DES RATES DER EVANGELISCHEN KIRCHE
Dr. Hermann Kunst 1, Herford, 23.7.1957» Abschrift (PDF) Hinweis Die Schreibweise wurde an die Richtlinien der aktuellen Rechtschreibung angepasst. DER BEVOLLMÄCHTIGTE DES RATES DER EVANGELISCHEN KIRCHE
Modulare Fortbildung 2017
 Modulare Fortbildung 2017 1 2 Licht und Schatten in Stettin Mit Kirche stärkt Demokratie auf Bildungsfahrt. Im Rückblick auf die Wende 1989/90 denke ich oft, wie hat ein Außenstehender, jemand aus einem
Modulare Fortbildung 2017 1 2 Licht und Schatten in Stettin Mit Kirche stärkt Demokratie auf Bildungsfahrt. Im Rückblick auf die Wende 1989/90 denke ich oft, wie hat ein Außenstehender, jemand aus einem
1. LESUNG Apg 4, 8-12 In keinem anderen ist das Heil zu finden Lesung aus der Apostelgeschichte
 Texte für den 4. Ostersonntag B Schrifttexte 1. LESUNG Apg 4, 8-12 In keinem anderen ist das Heil zu finden Lesung aus der Apostelgeschichte Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr Führer
Texte für den 4. Ostersonntag B Schrifttexte 1. LESUNG Apg 4, 8-12 In keinem anderen ist das Heil zu finden Lesung aus der Apostelgeschichte Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr Führer
Predigt über Römer 14,7-9 am in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen)
 Das Copyright für diese Predigt liegt beim Verfasser Bernhard Philipp, Alleestraße 40, 89564 Nattheim Predigt über Römer 14,7-9 am 07.11.2010 in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen) Die Gnade unseres Herrn
Das Copyright für diese Predigt liegt beim Verfasser Bernhard Philipp, Alleestraße 40, 89564 Nattheim Predigt über Römer 14,7-9 am 07.11.2010 in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen) Die Gnade unseres Herrn
Diakonie Standortbestimmung und Herausforderung
 Diakonie Standortbestimmung und Herausforderung Was bedeutet und macht Diakonie? Christinnen und Christen sind Menschen, die an Gott, an Jesus und an den Heiligen Geist glauben. Es gibt verschiedene Christinnen
Diakonie Standortbestimmung und Herausforderung Was bedeutet und macht Diakonie? Christinnen und Christen sind Menschen, die an Gott, an Jesus und an den Heiligen Geist glauben. Es gibt verschiedene Christinnen
Kirchentag Barrierefrei
 Kirchentag Barrierefrei Leichte Sprache Das ist der Kirchen-Tag Seite 1 Inhalt Lieber Leser, liebe Leserin! Seite 3 Was ist der Kirchen-Tag? Seite 4 Was gibt es beim Kirchen-Tag? Seite 5 Was ist beim Kirchen-Tag
Kirchentag Barrierefrei Leichte Sprache Das ist der Kirchen-Tag Seite 1 Inhalt Lieber Leser, liebe Leserin! Seite 3 Was ist der Kirchen-Tag? Seite 4 Was gibt es beim Kirchen-Tag? Seite 5 Was ist beim Kirchen-Tag
SINOLOGICA COLONIENSIA. Herausgegeben von Martin Gimm. Band 32
 SINOLOGICA COLONIENSIA Herausgegeben von Martin Gimm Band 32 2013 Harrassowitz Verlag. Wiesbaden Martin Gimm Georg von der Gabelentz zum Gedenken Materialien zu Leben und Werk 2013 Harrassowitz Verlag.
SINOLOGICA COLONIENSIA Herausgegeben von Martin Gimm Band 32 2013 Harrassowitz Verlag. Wiesbaden Martin Gimm Georg von der Gabelentz zum Gedenken Materialien zu Leben und Werk 2013 Harrassowitz Verlag.
Die wahre Familie. Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert. Bibel lesen Bibel auslegen
 Die wahre Familie Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert Bibel lesen Bibel auslegen 1 Bibel lesen Persönliche Resonanz! Was macht der Text mit mir?! Was lerne ich durch den Text?! Welche Fragen löst
Die wahre Familie Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert Bibel lesen Bibel auslegen 1 Bibel lesen Persönliche Resonanz! Was macht der Text mit mir?! Was lerne ich durch den Text?! Welche Fragen löst
Predigt im Familiengottesdienst zum 1. Advent, Cyriakuskirche Illingen Pfarrer Wolfgang Schlecht
 1 Predigt im Familiengottesdienst zum 1. Advent, 3.12.17 Cyriakuskirche Illingen Pfarrer Wolfgang Schlecht Vorne in der Kirche stand ein großes Wagenrad mit Kerzen darauf. Was hat es für eine Bedeutung?
1 Predigt im Familiengottesdienst zum 1. Advent, 3.12.17 Cyriakuskirche Illingen Pfarrer Wolfgang Schlecht Vorne in der Kirche stand ein großes Wagenrad mit Kerzen darauf. Was hat es für eine Bedeutung?
Jesaja 54, Predigt in Hessental am , H. Bullinger Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
 Jesaja 54, 7-10 - Predigt in Hessental am 2.3.08, H. Bullinger Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für heute steht in Jesaja 54, 7-10;
Jesaja 54, 7-10 - Predigt in Hessental am 2.3.08, H. Bullinger Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für heute steht in Jesaja 54, 7-10;
Hirtenwort zum Dialogprozess
 Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck Hirtenwort zum Dialogprozess Zu verlesen in allen Sonntagsmessen am Dreifaltigkeitssonntag im Jahreskreis A, 18./19. Juni 2011. 1 Liebe Schwestern und Brüder! Bei vielen
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck Hirtenwort zum Dialogprozess Zu verlesen in allen Sonntagsmessen am Dreifaltigkeitssonntag im Jahreskreis A, 18./19. Juni 2011. 1 Liebe Schwestern und Brüder! Bei vielen
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6 Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche
 Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Anfänge der Kirche (IHF 5); Bildliches Sprechen von Gott (IHF 2) Lebensweltliche Relevanz:
Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus die frühe Kirche Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Anfänge der Kirche (IHF 5); Bildliches Sprechen von Gott (IHF 2) Lebensweltliche Relevanz:
Phil. 1,3-11 Predigt zum 22.S.n.Trinitatis, in Landau und Crailsheim
 Phil. 1,3-11 Predigt zum 22.S.n.Trinitatis, 22-23.10.2016 in Landau und Crailsheim Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Gottes aus der Heiligen
Phil. 1,3-11 Predigt zum 22.S.n.Trinitatis, 22-23.10.2016 in Landau und Crailsheim Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Gottes aus der Heiligen
125 Jahre KV-Ortszirkel Sprudel
 Rede Oberbürgermeister Anlässlich 125 Jahre KV-Ortszirkel Sprudel am 24.05.2013, 18:00 Uhr, Casino Uerdingen - das gesprochene Wort gilt Seite 1 von 11 Sehr geehrter Herr Dr. Labunski, sehr geehrte Damen
Rede Oberbürgermeister Anlässlich 125 Jahre KV-Ortszirkel Sprudel am 24.05.2013, 18:00 Uhr, Casino Uerdingen - das gesprochene Wort gilt Seite 1 von 11 Sehr geehrter Herr Dr. Labunski, sehr geehrte Damen
Kaspar Maase. Was macht Populärkultur politisch?
 Kaspar Maase Was macht Populärkultur politisch? Otto-von-Freising-Vorlesungen der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Herausgegeben von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Kaspar
Kaspar Maase Was macht Populärkultur politisch? Otto-von-Freising-Vorlesungen der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Herausgegeben von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Kaspar
Œ J J œj œ œ J œ œ # œ# œ # œ œ J œ œ œ œ œ œœ. J J œ œ J œ # œ œ. # œ # œ œ œ. œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ. œ œj nœ œ œ J œ œ # œ œ œ œ
 10.Sinfonia Ÿ 12 Ÿ Ÿ 8 j j j 9 2 26 0 0 8 7 60 nd es waren Hirten in der selben Gegend BWV 28/2 Kantate für den 2.Weihnachtstag Ó n j 1 Ÿ j j j 19 Ÿ Ÿ Ÿ j j j j j j n 2 Ú n n n n j b b Ÿ Ÿ Ÿ n j j j j
10.Sinfonia Ÿ 12 Ÿ Ÿ 8 j j j 9 2 26 0 0 8 7 60 nd es waren Hirten in der selben Gegend BWV 28/2 Kantate für den 2.Weihnachtstag Ó n j 1 Ÿ j j j 19 Ÿ Ÿ Ÿ j j j j j j n 2 Ú n n n n j b b Ÿ Ÿ Ÿ n j j j j
Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein
 Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein Aufgewachsen bin ich als der Ältere von zwei Kindern. Mein Vater verdiente das Geld, meine Mutter kümmerte sich um meine Schwester und mich. Vater war unter der
Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein Aufgewachsen bin ich als der Ältere von zwei Kindern. Mein Vater verdiente das Geld, meine Mutter kümmerte sich um meine Schwester und mich. Vater war unter der
3 Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt.
 2. Buch Mose, 3, 1-10 1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. 2 Und der
2. Buch Mose, 3, 1-10 1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. 2 Und der
Matthäus 28, Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten.
 Matthäus 28, 16-20 Liebe Gemeinde, Ich lese den Predigttext aus Matthäus 28, 16-20 16Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17Und als sie ihn sahen, fielen
Matthäus 28, 16-20 Liebe Gemeinde, Ich lese den Predigttext aus Matthäus 28, 16-20 16Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17Und als sie ihn sahen, fielen
Deutsche im spanischen Bürgerkrieg
 Deutsche im spanischen Bürgerkrieg von Werner Abel - erschienen in der Litterata am Donnerstag, Juli 09, 2015 Neuerscheinung: Biographisches Lexikon. Deutsche im spanischen Bürgerkrieg. Werner Abel und
Deutsche im spanischen Bürgerkrieg von Werner Abel - erschienen in der Litterata am Donnerstag, Juli 09, 2015 Neuerscheinung: Biographisches Lexikon. Deutsche im spanischen Bürgerkrieg. Werner Abel und
GAE-TV. Die GESCHICHTE der GESELLSCHAFT ZUR AUSBREITUNG DES EVANGELIUMS. auf dem Kirchentag in Berlin Folge. von 15
 GAE-TV auf dem Kirchentag in Berlin 2017 Die GESCHICHTE der GESELLSCHAFT ZUR AUSBREITUNG DES EVANGELIUMS Folge 14 von 15 oder auf Worauf kommt es an? Auf prachtvolle Entfaltung und die Verdienste der Heiligen?
GAE-TV auf dem Kirchentag in Berlin 2017 Die GESCHICHTE der GESELLSCHAFT ZUR AUSBREITUNG DES EVANGELIUMS Folge 14 von 15 oder auf Worauf kommt es an? Auf prachtvolle Entfaltung und die Verdienste der Heiligen?
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum 2. Adventssonntag und zum Fest des hl. Franz Xaver in Rottenbuch am 7.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum 2. Adventssonntag und zum Fest des hl. Franz Xaver in Rottenbuch am 7. Dezember 2008 Genau vor einem Monat war ich in Macao im Süden Chinas.
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter zum 2. Adventssonntag und zum Fest des hl. Franz Xaver in Rottenbuch am 7. Dezember 2008 Genau vor einem Monat war ich in Macao im Süden Chinas.
Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen
 GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen Moritz Stetter, geboren 1983, ist freiberuflicher Trickfilmzeichner und Illustrator. Er hat an der Akademie für Kommunikation und an
GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen Moritz Stetter, geboren 1983, ist freiberuflicher Trickfilmzeichner und Illustrator. Er hat an der Akademie für Kommunikation und an
Evangelisch in Ständestaat und Nationalsozialismus
 Margit Mayr Evangelisch in Ständestaat und Nationalsozialismus Zur Geschichte der evangelischen Kirche in Österreich unter besonderer Berücksichtigung oberösterreichischer Gemeinden im Ständestaat und
Margit Mayr Evangelisch in Ständestaat und Nationalsozialismus Zur Geschichte der evangelischen Kirche in Österreich unter besonderer Berücksichtigung oberösterreichischer Gemeinden im Ständestaat und
Unsere christliche Identität: Erinnern und bekennen, danken und barmherzig sein
 Unsere christliche Identität: Erinnern und bekennen, danken und barmherzig sein Hirtenwort zum 14. Februar 2016 + Felix Gmür Bischof von Basel 1. Fastensonntag, Lesejahr C 14. Februar 2016 1. Lesung: Dtn
Unsere christliche Identität: Erinnern und bekennen, danken und barmherzig sein Hirtenwort zum 14. Februar 2016 + Felix Gmür Bischof von Basel 1. Fastensonntag, Lesejahr C 14. Februar 2016 1. Lesung: Dtn
LEITBILD. Kloster Gemünden. Kreuzschwestern Bayern. Provinz Europa Mitte
 LEITBILD Kloster Gemünden Kreuzschwestern Bayern Provinz Europa Mitte Kloster Gemünden Präambel Die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz (Kreuzschwestern) sind eine internationale franziskanische
LEITBILD Kloster Gemünden Kreuzschwestern Bayern Provinz Europa Mitte Kloster Gemünden Präambel Die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz (Kreuzschwestern) sind eine internationale franziskanische
Merkblatt zur Biografie unserer Heimbewohner
 Merkblatt zur Biografie unserer Heimbewohner Eine Ihnen nahe stehende Person ist im Maria-Stadler-Haus aufgenommen worden oder sie soll in nächster Zeit aufgenommen werden. Es ist für uns wichtig etwas
Merkblatt zur Biografie unserer Heimbewohner Eine Ihnen nahe stehende Person ist im Maria-Stadler-Haus aufgenommen worden oder sie soll in nächster Zeit aufgenommen werden. Es ist für uns wichtig etwas
Eine Themapredigt am Anfang der Schulferien
 1 Reisebüro Sehnsucht Eine Themapredigt am Anfang der Schulferien Es ist kaum auszuschöpfen, was das Stichwort Urlaub bei uns auslösen kann. Was da an Träumen, Wünschen, aber auch an Ängsten alles wach
1 Reisebüro Sehnsucht Eine Themapredigt am Anfang der Schulferien Es ist kaum auszuschöpfen, was das Stichwort Urlaub bei uns auslösen kann. Was da an Träumen, Wünschen, aber auch an Ängsten alles wach
Deserteure an Front und Heimatfront? NS-Justiz in Westfalen-Lippe. Hugo Nölke
 72 Deserteure an Front und Heimatfront? NS-Justiz in Westfalen-Lippe Hugo Nölke Hugo Nölke wurde 1894 in Kamen geboren. Sein Vater, ein Bergmann, verstarb 1901 bei einem Grubenunglück, so dass seine Mutter
72 Deserteure an Front und Heimatfront? NS-Justiz in Westfalen-Lippe Hugo Nölke Hugo Nölke wurde 1894 in Kamen geboren. Sein Vater, ein Bergmann, verstarb 1901 bei einem Grubenunglück, so dass seine Mutter
Elisabeth Stiefel MEIN HERR KÄTHE
 Elisabeth Stiefel MEIN HERR KÄTHE Elisabeth Stiefel Mein Herr Käthe Katharina von Boras Leben an der Seite Luthers Über die Autorin: Elisabeth Stiefel, Jg. 1958, ist verheiratet und hat vier Kinder. Neben
Elisabeth Stiefel MEIN HERR KÄTHE Elisabeth Stiefel Mein Herr Käthe Katharina von Boras Leben an der Seite Luthers Über die Autorin: Elisabeth Stiefel, Jg. 1958, ist verheiratet und hat vier Kinder. Neben
Weinfelder. Predigt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Juni 2016 Nr Römer 8,38-39
 Weinfelder Juni 2016 Nr. 777 Predigt Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes Römer 8,38-39 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 27. Juni 2016 Römer 8,38-39 Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von
Weinfelder Juni 2016 Nr. 777 Predigt Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes Römer 8,38-39 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 27. Juni 2016 Römer 8,38-39 Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von
Jesus kommt zur Welt
 Jesus kommt zur Welt In Nazaret, einem kleinen Ort im Land Israel, wohnte eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war verlobt mit einem Mann, der Josef hieß. Josef stammte aus der Familie von König David,
Jesus kommt zur Welt In Nazaret, einem kleinen Ort im Land Israel, wohnte eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war verlobt mit einem Mann, der Josef hieß. Josef stammte aus der Familie von König David,
Predigt im Gottesdienst zur Konfirmation am in der Cyriakuskirche in Illingen Pfarrer Wolfgang Schlecht
 1 Predigt im Gottesdienst zur Konfirmation am 6.5.18 in der Cyriakuskirche in Illingen Pfarrer Wolfgang Schlecht Thema des Gottesdienstes: Wer sucht, der findet Predigt nach verschiedenen Aktionen und
1 Predigt im Gottesdienst zur Konfirmation am 6.5.18 in der Cyriakuskirche in Illingen Pfarrer Wolfgang Schlecht Thema des Gottesdienstes: Wer sucht, der findet Predigt nach verschiedenen Aktionen und
Hitlers Krieg im Osten
 Rolf-Dieter Müller /Gerd R. Ueberschär Hitlers Krieg im Osten 1941-1945 Ein Forschungsbericht Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt Inhalt Vorwort IX I. Politik und Strategie (Rolf-Dieter Müller)
Rolf-Dieter Müller /Gerd R. Ueberschär Hitlers Krieg im Osten 1941-1945 Ein Forschungsbericht Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt Inhalt Vorwort IX I. Politik und Strategie (Rolf-Dieter Müller)
Erich Kleeberg. ca (Privatbesitz Ruth Gröne)
 Erich Kleeberg ca. 1939 (Privatbesitz Ruth Gröne) Erich Kleeberg * 3.5.1902 (Boffzen/Weser), Ende April 1945 (Sandbostel) Ausbildung zum Bankkaufmann; 1931 Eheschließung nach jüdischem Brauch mit einer
Erich Kleeberg ca. 1939 (Privatbesitz Ruth Gröne) Erich Kleeberg * 3.5.1902 (Boffzen/Weser), Ende April 1945 (Sandbostel) Ausbildung zum Bankkaufmann; 1931 Eheschließung nach jüdischem Brauch mit einer
Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe.
 Ich lese aus dem ersten Johannesbrief 4, 7-12 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt
Ich lese aus dem ersten Johannesbrief 4, 7-12 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: 12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: 12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Dirk Schliephake (Hg.) 12
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: 12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Dirk Schliephake (Hg.) 12
2. Der Dreißigjährige Krieg:
 2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
Bibel für Kinder zeigt: Samuel, Gottes Kindlicher Diener
 Bibel für Kinder zeigt: Samuel, Gottes Kindlicher Diener Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Lyn Doerksen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Bibel für Kinder zeigt: Samuel, Gottes Kindlicher Diener Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Lyn Doerksen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
bindet Gott Maria unlösbar an Jesus, so dass sie mit ihm eine Schicksalsgemeinschaft bildet.
 1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Anzing und Patroziniumssonntag zum Fest Mariä Geburt am 9. September 2012 Auf dem Weg durch
1 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Festgottesdienst zur 1200-Jahrfeier der Gemeinde Anzing und Patroziniumssonntag zum Fest Mariä Geburt am 9. September 2012 Auf dem Weg durch
Kostenfreier Abdrucktext
 Kostenfreier Abdrucktext Die folgende Geschichte Allein mit vier Kindern von Uta Holz ist dem Buch Als wir Frauen stark sein mußten entnommen. Den Text stellen wir zum kostenfreien Abdruck zu Verfügung.
Kostenfreier Abdrucktext Die folgende Geschichte Allein mit vier Kindern von Uta Holz ist dem Buch Als wir Frauen stark sein mußten entnommen. Den Text stellen wir zum kostenfreien Abdruck zu Verfügung.
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck. Wort des Bischofs zum 01. Januar 2018
 Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck Wort des Bischofs zum 01. Januar 2018 Zu verlesen in allen Sonntagsgottesdiensten am zweiten Sonntag im Jahreskreis B, 13./14. Januar 2018 Liebe Schwestern und Brüder!
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck Wort des Bischofs zum 01. Januar 2018 Zu verlesen in allen Sonntagsgottesdiensten am zweiten Sonntag im Jahreskreis B, 13./14. Januar 2018 Liebe Schwestern und Brüder!
Kirche und Heimat? Kirche wirft eine neue Wertigkeit des Begriffs in die Diskussion.
 Predigt zum Psalm 84,4-9 Textlesung: Liebe Gemeinde! Wo bin ich zu Hause? Ein alter Freund zeigte mir mal die Gegend in der er seine Jugend verbracht hatte und sagte stolz: Das ist mein Revier!!! Wo sind
Predigt zum Psalm 84,4-9 Textlesung: Liebe Gemeinde! Wo bin ich zu Hause? Ein alter Freund zeigte mir mal die Gegend in der er seine Jugend verbracht hatte und sagte stolz: Das ist mein Revier!!! Wo sind
I. Begrüßung Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Begrüßung auch im Namen von MPr Seehofer
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 10.03.2012, 19:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Jahresempfangs des Erzbischofs
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 10.03.2012, 19:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Jahresempfangs des Erzbischofs
VIP-TRAINING VIP-TRAINING SMALLGROUP STÄRKE ZUSAMMEN MIT DEINER KLEINGRUPPE DEINEN EVANGELISTISCHEN LEBENSSTIL.
 VIP-TRAINING VIP-TRAINING SMALLGROUP STÄRKE ZUSAMMEN MIT DEINER KLEINGRUPPE DEINEN EVANGELISTISCHEN LEBENSSTIL. VIP-TRAINING SMALLGROUP VIP-TRAINING SMALLGROUP INHALTSVERZEICHNIS Lektion 1 // Wie gross
VIP-TRAINING VIP-TRAINING SMALLGROUP STÄRKE ZUSAMMEN MIT DEINER KLEINGRUPPE DEINEN EVANGELISTISCHEN LEBENSSTIL. VIP-TRAINING SMALLGROUP VIP-TRAINING SMALLGROUP INHALTSVERZEICHNIS Lektion 1 // Wie gross
Über das Vilmarhaus Marburg und die Bewerbung
 Über das Vilmarhaus Marburg und die Bewerbung Schön, dass du im Vilmarhaus wohnen möchtest: Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Nimm dir bitte etwas Zeit zum Lesen, bevor du den Aufnahmeantrag ausfüllst.
Über das Vilmarhaus Marburg und die Bewerbung Schön, dass du im Vilmarhaus wohnen möchtest: Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Nimm dir bitte etwas Zeit zum Lesen, bevor du den Aufnahmeantrag ausfüllst.
Die deutsch-französischen Beziehungen von der Wiedervereinigung zum Maastrichter Vertrag
 Bachelorarbeit Johannes Müller Die deutsch-französischen Beziehungen von der Wiedervereinigung zum Maastrichter Vertrag Die Rolle Helmut Kohls und François Mitterrands Bachelor + Master Publishing Müller,
Bachelorarbeit Johannes Müller Die deutsch-französischen Beziehungen von der Wiedervereinigung zum Maastrichter Vertrag Die Rolle Helmut Kohls und François Mitterrands Bachelor + Master Publishing Müller,
Wer das noch mehr fühlen will, findet diese ganze Botschaft auf unsere Seite unter Botschaften/Channelings als Hördatei. St.
 In Hannover an einem offenen Abendseminar war in der Anfangsrunde die Problematik mit den Flüchtlingen in Europa so aktuell, dass St. Germain einen ganzen Abend diesem Thema widmete. Dieser zweite Teil
In Hannover an einem offenen Abendseminar war in der Anfangsrunde die Problematik mit den Flüchtlingen in Europa so aktuell, dass St. Germain einen ganzen Abend diesem Thema widmete. Dieser zweite Teil
