Der Mikrowellenofen im Physikunterricht der Sekundarstufe I
|
|
|
- Irmgard Vogt
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Der Mikrowellenofen im Physikunterricht der Sekundarstufe I Einleitung Mikrowellengeräte sind heute aus vielen Haushalten nicht wegzudenken. Für die meisten der Schülerinnen und Schüler ist deren Nutzung eine Selbstverständlichkeit, von nicht wenigen wird er sogar jeden Tag verwendet. Damit eröffnet sich dem Physikunterricht die günstige Gelegenheit, wichtige physikalische Inhalte in einem motivierenden Alltagskontext zu behandeln. Der Mikrowellenofen als Lerngegenstand bietet außerdem die Gelegenheit, Aspekte aus der Elektrizitätslehre mit Inhalten der Wärmelehre zu verbinden. Ein Unterrichtsvorschlag für die Sekundarstufe II wurde bereits vielfach erfolgreich umgesetzt (Berger, 2007). Man kann sich nun fragen, ob die dem Mikrowellenofen zugrunde liegenden physikalischen Prinzipien auch in der Sekundarstufe I zu vermitteln sind. Wir sind zu der Auffassung gelangt, dass dies dadurch ermöglicht wird, dass man sich im Wesentlichen auf die Phänomene beschränkt, die beim Betrieb des Mikrowellenofens zu beobachten sind. Eine eingehende Interpretation dieser Phänomene z. B. auf der Ebene des Teilchenmodells kann unabhängig davon als Vertiefung hinzugenommen werden. Um dieses Vorgehen zu illustrieren, wird ein entsprechender Unterrichtsgang vorgestellt. Einiges an Hintergrundwissen ist in den InfoKästen zusammengestellt. Weiter reichende Informationen finden sich im Beitrag von Berger (2002) und auf unserer Internetseite 1. Wir schlagen vor, die Grundlagen des Mikrowellenofens in frontaler Form zu unterrichten und weiterführende Aspekte im Rahmen eines Lernzirkels oder ähnlicher Gruppenarbeitsformen zu vermitteln. Die Erarbeitung des Themas erfolgt anhand verschiedener Leitfragen, die sich unmittelbar aus dem Betrieb des Mikrowellenofens ergeben und die bei entsprechender Nachfrage von vielen Schülerinnen und Schülern als für sie interessant beurteilt werden. Inhalte des einführenden Frontalunterrichts Leitfrage 1 (phänomenologische Ebene): Was sind mikrowellentaugliche Behälter? Im Rahmen dieser Leitfrage wird das Verhalten unterschiedlicher Substanzen (Wasser, Aluminium und Kunststoff) bei Bestrahlung von Mikrowellen geklärt. Unterrichtsmethodisch ist es wohl sinnvoll, diese Frage in frontaler Form zu bearbeiten, da in diesem Rahmen die grundlegenden Inhalte vermittelt werden, die für alle nachfolgenden Leitfragen bereitstehen müssen. Im zentralen Demonstrationsversuch werden zwei kleine, identische Becher (oder Tassen) mit Wasser gefüllt und einer der Becher zusätzlich in Aluminiumfolie eingepackt. Die Becher werden anschließend in einen mikrowellentauglichen Kunststoffbehälter gestellt, der mit seinem Deckel verschlossen wird. Stellt man den Behälter in den Mikrowellenofen und führt (für ca. 20 Sekunden) Energie zu, so macht man vier wesentliche Beobachtungen: 1. Das Wasser im Becher ohne Aluminiumfolie hat sich deutlich erwärmt. 2. Das Wasser im Becher mit Aluminiumfolie ist praktisch nicht wärmer geworden. 3. Die Aluminiumfolie bleibt kalt. 4. Der mikrowellentaugliche Behälter hat sich praktisch nicht erwärmt 2. Im Unterrichtsgespräch werden daraus die folgenden Schlüsse gezogen: 1. Wasser absorbiert Mikrowellen. 2. Metalle (exemplarisch gezeigt an der Aluminiumfolie) reflektieren Mikrowellen (bei Absorption hätte sich die Folie erwärmt). 3. Mikrowellentaugliche Kunststoffe lassen die Mikrowellen passieren. Wasser ist sogar die entscheidende Substanz bei der Erwärmung von Speisen. Enthalten Substanzen überhaupt kein Wasser, so bleiben sie in der Regel kalt. Optional kann darüber hinaus gezeigt werden, dass dünne Metallschichten (z. B. Goldbeschichtungen auf Tellern) im Mikrowellenofen zerstört werden. Dies lässt sich im Versuch mit Hilfe einer CD demonstrieren, die eine etwa einen Mikrometer dünne Metallbeschichtung hat (vgl. InfoKasten Was geschieht mit Metallen? ). An dieser Stelle sollte nun zweckmäßigerweise ein Hinweis auf eine Sicherheitsmaßnahme erfolgen, die für die Durchführung von Versuchen mit dem Mikrowellenofen wichtig ist: Wird der Ofen im Leerlauf, also ohne ausreichend absorbierende Substanz betrieben, so werden die Mikrowellen aus dem Garraum zum so genannten Magnetron zurückreflektiert, in dem die Mikrowellen erzeugt werden. Dies kann das Gerät beschädigen. Aus Um dies noch weiter zu verdeutlichen, kann experimentell gezeigt werden, dass sich die Temperatur einer bestimmten Menge Wasser in einer Tasse um einen Betrag erhöht, der praktisch unabhängig davon ist, ob die Tasse allein oder im mikrowellentauglichen Behälter eingeschlossen in den Mikrowellenofen eingebracht wird. Dabei ist neben der gleichen Zeit für die Energiezufuhr darauf zu achten, dass die Tasse in beiden Fällen an derselben Stelle des Garraums steht (z. B. in der Mitte des Drehtellers), um unterschiedliche Erwärmungen in der stehenden elektromagnetischen Welle zu verhindern (vgl. auch Leitfrage 3). 1
2 diesem Grund ist es geraten, beim Versuch mit der CD eine Tasse Wasser in den Garraum einzustellen. Außerdem sollte z. B. ein Teelöffel in die mit Wasser gefüllte Tasse gestellt werden. Denn in besonders ungünstigen Fällen wird das Wasser sonst auf über 100 Grad Celsius erhitzt, und verdampft dann beim Herausnehmen schlagartig. Dies hat vereinzelt zu schweren Verletzungen geführt. Ein Löffel (oder ähnliches) verhindert einen solchen Siedeverzug, denn er stellt in aller Regel genügend mikroskopisch kleine Lufteinschlüsse als Siedekeime zur Verfügung. Dies sollten die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause beachten, z. B. wenn sie sich ein Getränk heiß machen. Nebenbei bemerkt erkennt man daran auch, dass ein pauschales Verbot von Metallen im Mikrowellenofen wenig sinnvoll ist. Der bisher vorgestellte Unterrichtsverlauf beschränkt sich auf eine phänomenologische Darstellung. Möchte man nun einen Schritt weitergehen, so lassen sich die Befunde des Demonstrationsversuchs durch physikalische Interpretationen vertiefen. Ob dies gemacht werden sollte hängt von den Vorgaben der Kerncurricula und den Interessen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ab. Leitfrage 1 (interpretative Ebene): Warum wird Wasser im Mikrowellenofen heiß? Um die Frage nach der Ursache der besonderen Rolle des Wassers zu klären, ist die Heranziehung des Teilchenmodells sinnvoll. Die Erwärmung von Substanzen ist auf atomarer bzw. molekularer Ebene immer mit einer schnelleren Bewegung verbunden 3. Im Falle des Wassers werden die Wassermoleküle durch die Mikrowellen in Rotation versetzt. Die Rotationsenergie wird durch Stöße an die umgebenden Molekülen zum Beispiel des Fleisches weitergegeben, die sich dadurch auch schneller bewegen. Dies äußert sich als Temperaturerhöhung der Speise. In diesem Zusammenhang kann auch die Frage diskutiert werden, warum sich ein Mikrowellenofen zum Auftauen von Speisen im Grunde nicht eignet (vgl. InfoKasten Warum taut Eis schlecht auf? ). Wie können Mikrowellen Wassermoleküle in Rotation versetzen? Ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoff und einem Sauerstoffatom (H 2 OMolekül). Die Elektronen der Wasserstoffatome werden etwas vom Sauerstoffatom angezogen, sodass sich dort ein kleiner Ladungsüberschuss, bei den Wasserstoffatomen hingegen ein entsprechend kleiner Mangel an negativer Ladung ergibt, obwohl das Wassermolekül als Ganzes elektrisch neutral ist. Man spricht davon, dass ein Wassermolekül ein elektrischer Dipol ist. Diese Dipoleigenschaft ist für eine Vielzahl besonderer Eigenschaften des Wassers verantwortlich (vgl. z. B. Bergmann & Schäfer, 2006). In einem äußeren elektrischen Feld z. B. eines Kondensators wird der Dipol daher ausgerichtet: Die negative Seite des Wassermoleküls wird von der positiven Platte angezogen und die positive Seite von der negativ geladenen Kondensatorplatte. Schließt man an den Kondensator eine Wechselspannung geeigneter Frequenz an, so kann man Wassermoleküle in Rotation versetzen (vgl. Abb. 1). a. b. Abb. 1: Orientierung von Dipolen im elektrischen Feld. Ohne äußeres elektrisches Feld sind die Wassermoleküle ungeordnet: die positiven bzw. negativen Enden zeigen in alle möglichen Richtungen (a.). Bringt man die Dipole in ein starkes elektrisches Feld eines Plattenkondensators, so werden die positiven Enden von der negativen Platte angezogen und die negativen Enden von der positiven Platte. Es kommt zu einer Ausrichtung der Dipole, die nur durch die Wärmebewegung der Dipole gestört wird (Abb. b. und c.). Die Pfeile geben die Richtung des elektrischen Feldes an. c. Dieser Effekt lässt sich auch in einem Modellversuch demonstrieren. Eine Beschreibung mit einem kurzen Film findet sich auf der angegebenen Internetseite. Da Mikrowellen wie Licht elektromagnetische Wellen sind, verfügen sie über ein elektrisches Feld 4 sehr hoher Frequenz 5. Die Existenz des elektrischen Feldes lässt sich eindrucksvoll im Versuch demonstrieren. Legt man eine Energiesparlampe in den Mikrowellenofen und schaltet kurz ein, so leuchtet die Lampe hell auf 6 (Abb. 2). 3 In vielen populärwissenschaftlichen Darstellungen wird ein kausaler Mechanismus nahe gelegt (oder gar explizit mitgeteilt), wonach aufgrund der höheren Geschwindigkeit eine stärkere Reibung entstehe, die zur beobachteten Temperaturerhöhung führe. Auf molekularer Skala gibt es jedoch keine Reibung und damit keine derartige Ursachenkette. Schnellere Bewegung auf atomarer Skala äußert sich makroskopisch als Temperaturerhöhung, ohne dass dies weiter erklärt werden könnte. 4 Das magnetische Feld von Mikrowellen spielt für die Erwärmung im Mikrowellenofen keine Rolle. 5 Im Internet gibt es zahlreiche Applets zu elektromagnetischen Wellen (z. B. ). 6 Wir empfehlen, die Lampe nur ca. 12 Sekunden zu zünden. In seltenen Fällen wird die Energiesparlampe sonst zerstört und geringe Mengen an Quecksilber gelangt in den Garraum. Falls mit dem Mikrowellenofen wieder Speisen erwärmt werden sollen, so muss er dann sorgfältig gereinigt werden. Es ist jedoch grundsätzlich ratsam, einen Mikrowellenofen für die Physiksammlung anzuschaffen. Es gibt nur wenige Lehrmittel, die derart preisgünstig sind! 2
3 Abb. 2: Das elektrische Feld der elektromagnetischen Welle regt die Energiesparlampe im Mikrowellengerät zu starkem Leuchten an. Die Energiesparlampe befindet sich in einer als Halterung dienenden leeren Tasse. (Dahinter steht eine weitere, für alle Versuche obligatorische, wassergefüllte Tasse. Das Wasser absorbiert die Mikrowellen und verhindert damit eine Rückreflexion zum Magnetron, welches dadurch beschädigt werden könnte. In der Tasse ist ein Löffel zur Verhinderung eines Siedeverzugs.) Dies liegt daran, dass das elektrische Feld der Mikrowelle freie Elektronen beschleunigt. Sie stoßen gegen die Quecksilberatome und regen diese zur Emission von UVStrahlung an. In der weißen Beschichtung der Energiesparlampe wird das ultraviolette Licht in sichtbares Licht konvertiert. Der Vorgang der Rotationsanregung ist sehr anschaulich in einer Animation des Projekts Physik 2000 im Internet zu finden 7. Im Mikrowellenofen regt das elektrische Feld der Mikrowelle die Wassermoleküle zu 2,45 Milliarden Rotationen pro Sekunde an. Wird die vorgeschlagene Vertiefung durch Betrachtung der mikroskopischen Verhältnisse zusätzlich im Unterricht behandelt, so werden insgesamt etwa ein bis zwei Schulstunden in Anspruch genommen. Vertiefung im Rahmen von Gruppenarbeit Der im Folgenden vorgestellte Lernzirkel benötigt etwa eine weitere Doppelstunde an Zeit. Dabei werden vier weitere Teilthemen behandelt, deren Inhalte aus den Arbeitsblättern am Ende des Beitrags hervorgehen. Die Materialien lassen sich aber leicht auch an andere Gruppenarbeitsformen anpassen wie z. B. das Gruppenpuzzle (vgl. Berger, 2007 für die Sekundarstufe II). Im Folgenden werden die Leitfragen kurz beschrieben, die im Rahmen der Gruppenarbeit behandelt werden. Leitfrage 2: Wozu dient das Metallgitter an der Tür des Mikrowellenofens? Für diesen Versuch ist ein Mikrowellensender und empfänger notwendig, bei dem die Mikrowellen mit einer hörbaren Frequenz moduliert sind. Ein solches Gerät gibt es bei den einschlägigen Lehrmittelfirmen 8. Mithilfe dieses Geräts lässt sich für die Tür eines Mikrowellenofens sowie weitere Materialien prüfen, ob sie für Mikrowellen durchlässig sind oder nicht (Abb. 3) Z. B. das in Abb. 3 dargestellte Mikrowellengerät der Firma Elwe (ArtikelNr ). Online unter 3
4 Abb. 3: Nachweis der abschirmenden Wirkung der Ofentür. Der Mikrowellenempfänger im Bild links empfängt vom Sender rechts keine Mikrowellen mehr, wenn sich die Tür zwischen beide Geräten befindet. Im Rahmen des Versuchs wird gezeigt, dass die abschirmende Wirkung der Ofentür auf das Metallgitter und nicht auf die Kunststoffscheibe zurückzuführen ist. Wasserhaltige Substanzen, wie zum Beispiel die Hand, sind ebenfalls undurchlässig, da sie absorbieren. Damit werden zentrale Befunde des einleitenden Demonstrationsversuchs wiederholt (vgl. Leitfrage 1). Zusätzliche Informationen finden sich im InfoKasten Bleiben die Mikrowellen im Gerät?. Leitfrage 3: Wozu dient der Drehteller im Mikrowellenofen? Mithilfe von nassem Thermofaxpapier lässt sich zeigen, dass es Bereiche im Mikrowellenofen gibt, die heiß werden und andere, die kühl bleiben (Abb. 4). Abb. 4: Durch die Interferenz der zwischen den Wänden des Garraums reflektierten elektromagnetischen Wellen kommt es an einigen Stellen zur besonders starken Erwärmung des nassen Papierhandtuchs. Diese Bereiche erkennt man an den dunklen Verfärbungen des darüber liegenden ThermofaxPapiers. Für den Versuch wurde der Drehteller entfernt. Die Unterlage (Styropor oder Holz) dient nur dazu, das Thermofaxpapier gut ausbreiten zu können. Aus diesem Grund sollte die Speise gedreht werden, um eine möglicht gleichmäßige Erwärmung zu erreichen. Hinter diesem Phänomen steckt physikalisch die Ausbildung einer stehenden elektromagnetischen Welle. Sie bildet sich dadurch, dass die Mikrowellen an den Metallwänden reflektiert werden und sich so überlagern. Dabei 4
5 entstehen Knoten und Bäuche, die entsprechend zu kalten und heißen Stellen auf der Speise führt. Dieser Sachverhalt wird in Aufgabe 3 auf dem Arbeitsblatt vertieft. Die Ausbildung einer stehenden elektromagnetischen Welle lässt sich mit einem Applet 9 demonstrieren. Hintergrundinformationen zu den stehenden Wellen befinden sich im InfoKasten Warum bilden sich stehende Wellen im Mikrowellenofen?. Leitfrage 4: Ist der Mikrowellenofen Energie sparend? Zur Klärung dieser Frage ist ein so genannter Energiemonitor notwendig, der für ca. 20 Euro im Fachhandel zu erwerben ist. Damit lässt sich die elektrische Leistung von Haushaltsgeräten bestimmen. Um die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler einfach zu halten, wird in der Aufgabe der Mikrowellenofen mit einem Wasserkocher gleicher Leistungsaufnahme (ca Watt) verglichen. Eine bestimmte Menge von Wasser wird im Mikrowellenofen bzw. im Wasserkocher in einer vorgegeben Zeitspanne erwärmt. Die Temperaturerhöhung kann als Maß für die jeweilige Effizienz interpretiert werden. Eine Vertiefung der Aufgabe könnte darin bestehen, dass aus der Temperaturzunahme einer bestimmten Wassermenge mithilfe der Formel U = c m ϑ auf die zugeführte innere Energie des Wassers geschlossen wird. Der erhaltene Wert kann mit der vom Mikrowellengerät aufgenommenen elektrischen Energie (elektrische Leistung multipliziert mit der Dauer der Energiezufuhr) verglichen werden. Man erhält einen typischen Wirkungsgrad von etwa 50%. Wasserkocher sind dagegen viel effizienter. Bei dieser Vertiefung lassen sich wichtige Begriffe der Wärmelehre wie die innere Energie und die Wärmekapazität behandeln. Zwar werden im Mikrowellenofen üblicherweise Speisen erwärmt, sodass der ermittelte Wirkungsgrad sich zunächst nur auf die Wasser bezieht. Wasser eignet sich für diesen Versuch jedoch besonders gut, da auf einfache Weise qualitative und eben auch quantitative Aussagen gewonnen werden können. Da viele Speisen einen großen Anteil Wasser enthalten, sind die Ergebnisse in der Praxis auch relevant. Leitfrage 5: Erhitzt der Mikrowellenofen vitaminschonend? Die Frage nach möglichen Nährwertveränderungen beim Erhitzen mit dem Mikrowellenofen geht über den engeren Kanon der Physik hinaus in Richtung eines fächerübergreifenden Unterrichts. Aus unserer Erfahrung heraus stößt die Frage auf sehr großes Interesse. Mithilfe von geeigneten Teststäbchen 10 wird der Vitamingehalt von Wasser ermittelt, in dem eine VitaminC Tablette gelöst ist. Aufgrund der hohen Konzentration an Vitamin C verfärbt sich das Teststäbchen maximal. Der auf der Packung angegebenen Farbskala lässt sich entnehmen, dass die Konzentration an Vitamin C mindestens 2000mg/l beträgt. Die nächste Farbstufe entspricht einer Konzentration von 1000 mg/l. Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, dass ein Verlust daher nur dann nachweisbar ist, wenn mindestens die Hälfte des Vitamins bei der Erwärmung zerstört würde. Das zentrale Anliegen des Versuchs ist es, die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, dass für die Prüfung einer naturwissenschaftlichen Fragestellung die Genauigkeit des eingesetzten Messverfahrens bei der Interpretation der Messung zu berücksichtigen ist. Erprobung der Unterrichtseinheit Der Unterricht wurde in der dargestellten Form einschließlich der molekularen Deutung in einer 10. Klasse einer Osnabrücker Realschule (15 Schülerinnen und Schüler) erprobt. Nach einer vom Lehrer durchgeführten, einführenden Frontalstunde wurden die Leitfragen 2 bis 5 in einer Doppelstunde im Rahmen eines Lernzirkels bearbeitet. Um das Interesse der Schülerinnen und Schüler zu erfassen wurde der Fragebogen des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel zur motivierenden Wirkung von Unterricht eingesetzt (Hoffmann, Häußler & PetersHaft, 1997, S. 116). Auf einer 5stufigen Skala von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft ganz genau zu) wurden Aussagen zur Interessantheit des Lerngegenstands eingeschätzt. Das Resultat ist überaus erfreulich. Der Durchschnitt war mit etwa 3,5 recht hoch. Die folgenden Aussagen stießen auf große Zustimmung (im Durchschnitt 4 oder höher): Der Unterricht war abwechslungsreich Ich war neugierig darauf, was in der nächsten Stunde behandelt wird. Der Unterricht beschäftigte sich mit Dingen, die mir im täglichen Leben begegnen Im Unterricht gab es etwas Neues für mich zu entdecken Ich konnte mich leicht auf die Sache konzentrieren Ich hatte das Gefühl, für mich selbst etwas dazugelernt zu haben Die Schule würde mir mehr Spaß machen, wenn wir öfter solche Themen behandeln würden Es hat mir Spaß gemacht, mein Verständnis für dieses Thema zu vertiefen 9 Z. B Wir haben den AscorbinsäureTest der Firma Merck verwendet. 5
6 Dem entsprechend fielen auch die frei formulierten Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zur Frage, was ihnen besonders gut gefallen habe aus. Dabei wurden insbesondere die Versuche, aber auch deren selbstständige Bearbeitung besonders hervorgehoben: Die Versuche mit der CD in der Mikrowelle; der Versuch mit dem ThermofaxPapier Die Experimente Die Versuche waren sehr gut aufgebaut und sie waren gut zu verstehen. Die Versuche Die Versuche Dass wir mit einem alltäglichen Hausgegenstand gearbeitet haben Dass man selber lernen konnte wie die Mikrowelle funktioniert Abwechslungsreich und viele eigene Versuche Eigentlich alles, da wir alles selber machen konnten. Versuch 1 Dass man mit seiner Gruppe mehrere Sachen machen musste und auch darüber reden konnte. Dass wir auf uns allein gestellt waren. Dass alles ganz gut aufgebaut und vorbereitet war. Die ganzen Versuche / Dass man viel Neues gelernt hat Die Versuche Die Frage, was nicht gefallen habe, antworteten nur vier Schülerinnen und Schüler: Die Zeit war etwas knapp finde ich Die manchmal zu ungenaue Erklärung der Versuche Manche Erklärungen waren unverständlich, da wir uns nicht so auskannten Die Gruppenarbeit Der im direkten Anschluss an den Lernzirkel geschriebene Wissenstest (vgl. Anhang) zeigte einen ausreichenden Lernerfolg. Der durchführende Lehrer war davon überzeugt, dass die Leistungen deutlich besser gewesen wären, wenn für die Erprobung etwa eine Stunde mehr an Unterrichtszeit zur Verfügung gestanden hätte, um den behandelten Stoff zu festigen. In dieser Richtung zielen auch einige der kritischen Kommentare der Schülerinnen und Schüler. Zusammenfassung Der Mikrowellenofen ist ein für Schülerinnen und Schüler hoch interessanter Lerngegenstand. Im Rahmen dieses Kontexts lassen sich eine Reihe von physikalischen Inhalten aus der Elektrizitäts und Wärmelehre behandeln. Mit dem dargestellten Unterrichtsvorschlag können physikalische Phänomene von einer vertiefenden, modellbasierten physikalischen Reflexion weitgehend entkoppelt werden, sodass ein Unterricht auf unterschiedlichem Anspruchsniveau ermöglicht wird. Die Erprobung zeigte die erhoffte, stark motivierende Wirkung des Mikrowellenofens. Wie die Ergebnisse eines Leistungstests zeigen, sollte der Lernprozess noch stärker unterstützt werden. Dies könnte durch zusätzliche Hilfen, z. B. durch Bereitstellung von Lösungen zu den Aufgaben (z. B. mit Hilfeumschlägen ) und einem etwas umfangreicheren Zeitbudget gelingen. Möglicherweise sind auch andere unterrichtsmethodische Elemente hilfreich, wie z. B. die Anpassung der Materialien an das Konzept des Gruppenpuzzles. InfoKästen mit Hintergrundinformationen Warum taut Eis schlecht auf? Der molekulare Mechanismus der Erwärmung des Wassers ist im Text beschrieben. Die im Ofen erzeugten Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen einer Frequenz von 2,45 GHz 11. Dies bedeutet auch, dass sich die Richtung des elektrischen Feldes der Mikrowellen 2,45 Milliarden Mal pro Sekunde ändert. Die Wassermoleküle sind elektrische Dipole. Dies bedeutet, dass sie dieser Richtungsänderung folgen und somit in Rotation versetzt werden. Die Rotationsenergie wird durch Stöße mit umgebenden Molekülen einer Speise rasch wieder abgegeben. Durch Wärmeleitung breitet sich die Energie so in der Speise weiter aus. Hat man diese mikroskopische Beschreibung vor Augen so ist klar, dass Eis im Mikrowellengerät nur schwer aufgetaut werden kann. Denn die meisten Wassermoleküle sind im Eis an ihre Positionen gebunden, können also nicht rotieren. Legt man eine gefrorene Pizza in das Mikrowellengerät, so wird sie an den Stellen sehr schnell heiß, an denen sich bereits etwas Wasser in flüssiger Form befindet. Die anderen Bereich bleiben gefroren. Um die damit verbundenen großen Temperaturunterschiede zu vermeiden, gibt es bei vielen Geräten eine Auftaueinstellung: Das Gerät schaltet sich periodisch für kurze Zeit bei maximaler Leistung ein und dann wieder aus. Bevor es sich wieder einschaltet, kühlen sich die heißen Stellen durch Wärmeleitung ab und schmelzen das umgebende Eis. Die Erwärmung ist dadurch homogener. Bemerkenswert ist, dass sich die Leistung, die für die jeweilige Auftaustufe angegeben ist, auf den zeitlichen Mittelwert der zugeführten Leistung bezieht: Je länger die Periode der Ab 11 Die Wellenlänge beträgt bei dieser Frequenz ca. 12 cm, es handelt sich also um Mikrowellen. 6
7 schaltung dauert, desto geringer ist der Wert. Der zeitliche Verlauf der Leistungszufuhr lässt sich sehr schön mit einem EnergieMonitor beobachten. Die maximale Absorption von Wasser liegt nicht bei 2,45 GHz, sondern bei 22 GHz. Verwendet man wesentlich höhere Frequenzen, so können die Wasserdipole der schnellen Änderung des elektrischen Feldes nicht mehr folgen und die Absorption der Mikrowellen durch das Wasser wird schwächer. Warum verwendet man im Mikrowellenofen nicht diese höhere Frequenz? Dann würde die Welle bereits in einer dünnen Oberflächenschicht der Speise absorbiert und könnte nicht bis ins Innere vordringen. Damit hätte man jedoch den Vorteil gegenüber anderen Verfahren wie z. B. dem Erwärmen in einem Kochtopf verschenkt. Denn auch dort muss sich die Energie durch Wärmeleitung von der Oberfläche ins Innere fortpflanzen. Dieser Prozess dauert vergleichsweise lang. Bei der in Mikrowellengeräten verwendeten Frequenz von 2,45 GHz beträgt die Eindringtiefe jedoch einige Zentimeter und die elektromagnetischen Wellen erhitzen das Wasser im ganzen Lebensmittel praktisch gleichzeitig (vgl. auch InfoKasten Wozu braucht man noch einen Grill? ). Warum bilden sich stehende Wellen im Mikrowellenofen? Die Mikrowellen, die auf einer Seite in den Garraum eindringen, werden an allen Seiten des Ofens reflektiert. Dies liegt daran, dass die Wände des Mikrowellenofens aus Metall sind und Mikrowellen (wie alle elektromagnetischen Wellen nicht zu hoher Frequenz) daher reflektiert werden. Durch die Überlagerung der einlaufenden und reflektierten Wellen bildet sich eine stehende Welle. Dieses Phänomen tritt bei allen Arten von Wellen auf. Befestigt man z. B. ein Seil auf einer Seite und bringt die andere Seite periodisch in Auf und AbBewegungen, so bilden sich je nach Schwingungsfrequenz ein oder mehrere Knoten und dazwischen Bäuche. Die Knoten bleiben weitgehend in Ruhe, die Bäuche schwingen hingegen auf und ab. Elektromagnetische Wellen wie das Licht der Sonne oder Mikrowellen können sich auch im Vakuum ausbreiten. Bei ihnen schwingt keine Materie auf und ab, sondern das elektrische (und magnetische) Feld ändert seine Richtung. Bei Wellen, die nur auf einer Seite reflektiert werden, ist der Abstand der Knoten gerade gleich der halben Wellenlänge der sich ausbreitenden Welle und die gesamte Ausdehnung des Resonanzsystems ist gleich einem ganzzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge. Misst man die Ausdehnung eines Mikrowellenofens ab, so stellt man fest, dass die Kantenlängen des Garraumes nicht Vielfache der halben Wellenlänge der Mikrowellen, also etwa 6 Zentimeter betragen. Im Unterschied zu der Seilwelle, die nur an einem Ende reflektiert wird, werden die Mikrowellen von allen Seiten des Mikrowellenofens zurückgeworfen. Es bildet sich daher eine dreidimensionale stehende Welle. Dort ist die Resonanzbedingung etwas weniger streng als bei eindimensionalen stehenden Wellen. Bleiben die Mikrowellen im Gerät? Damit die Mikrowellen nicht aus dem Gerät austreten können, ist auch die Tür mit Metall versehen. Um die Speisen auch während des Garvorgangs beobachten zu können, wird in der Regel ein Metallgitter verwendet. Zunächst erscheint es überraschend, dass die Mikrowellen nicht durch dessen Löcher entweichen können. Mit Hilfe eines schulüblichen Mikrowellensenders und empfängers lässt sich zeigen, dass das Metallgitter die Mikrowellen tatsächlich nicht passieren lässt. Befindet sich die Tür nämlich zwischen Sender und Empfänger, so wird die Transmission unterdrückt. Es ist klar, dass die Maschenweite des Metallgitters nicht beliebig groß werden darf. Eine Analogieüberlegung führt auf die Spur für ein passendes Kriterium: Elektromagnetische Wellen im sichtbaren Bereich können das Gitter passieren, denn sonst könnte man die Speisen im Mikrowellengerät nicht beobachten. Sichtbares Licht unterscheidet sich von Mikrowellen aber nur in der Frequenz bzw. Wellenlänge. Ist die Wellenlänge groß gegen die Maschengröße des Gitters, so werden die Wellen wie an einem Spiegel praktisch vollständig reflektiert. Dies ist bei den verwendeten Mikrowellen der Fall, ihre Wellenlänge beträgt wie gesagt etwa 12 cm. Was geschieht mit Metallen? Elektromagnetische Wellen werden an Metallen nie ganz vollständig reflektiert. Sie dringen immer in eine mehr oder weniger dünne Schicht des Metalls ein ( Skintiefe ). Im sichtbaren Bereich beträgt die Skintiefe an Spiegeln nur wenige Atomlagen. Dort wird die Welle außerordentlich stark absorbiert. Da dieser Bereich aber so dünn ist, wird trotzdem der größte Teil reflektiert. Innerhalb der Skintiefe beschleunigt das elektrische Feld der elektromagnetischen Welle die Metallelektronen, die diese Energie durch Stöße an das Metallgitter abgeben. Dies führt zu einer Erwärmung des Metalls. Ist das Metallvolumen groß, so verteilt sich die Wärmeenergie aufgrund der guten metallischen Wärmeleitfähigkeit rasch und die gesamte Temperaturerhöhung bleibt gering. In dünnen Metallschichten kommt es aber zu erheblichen Temperaturerhöhungen. Daher sind z.b. Teller mit Goldrand nicht geeignet. Auch darf man die Temperatur der Speisen im Mikrowellengerät auf keinen Fall mit Hilfe eines Quecksilberthermometers messen. Auf der anderen Seite nutzen manche Hersteller von Mikrowellenkost diesen Effekt, damit ihr Lebensmittel gebräunt werden kann: auf der Oberfläche sind dünne Metallstreifen aufgebracht, die sich stark erwärmen. Der Effekt lässt sich sehr eindrucksvoll auch in der Schule demonstrieren: Legt man eine (anderweitig nicht mehr benötigte) CD in das Mikrowellengerät (Unterlage aus Plastik verwenden!), so wird nach dem Einschalten auf ihrer Oberfläche ein Muster eingebrannt, welches den Einzugsgebieten von Flusssystemen ähnelt und als Lichtenbergsche Figur bezeichnet wird (Nordmeier, 1999; vgl. Abb. 5). 7
8 Abb. 5: Legt man eine CD in einen Mikrowellenofen und schaltet ihn für kurze Zeit ein, so wird die dünne Metallschicht zerstört. Ein Metalllöffel in einer wassergefüllten Tasse ist dagegen unkritisch, da er effektiv durch das Wasser gekühlt wird. Hier wird für Schülerinnen und Schüler deutlich, wie nützlich physikalische Kenntnisse sind. Die pauschale Aussage, dass keine Metalle in das Mikrowellengerät eingebracht werden dürfen ist in dieser Form nicht sinnvoll. Die elektrische Feldstärke in einem Mikrowellenofen ist mindestens um einen Faktor zehn kleiner als die Durchschlagsfeldstärke von 10 6 V/m für Luft. An metallischen Spitzen kann der Wert wie bei einem Blitzableiter natürlich wesentlich größer werden und die Durchschlagsfeldstärke überschreiten. Man kann dann Funkenüberschläge zum Beispiel an den Spitzen einer Gabel beobachten. Wozu braucht man noch einen Grill? Wasser in der Gasphase kann im Gegensatz zur flüssigen Form nur Mikrowellen einer Frequenz von etwa 22 GHz absorbieren. Ist das Wasser im Mikrowellenofen vollständig verdampft, so erhitzt sich der Dampf nicht mehr weiter. Diese Beschränkung der Kochtemperatur im Mikrowellengerät auf die Siedetemperatur des Wassers bringt aber einen bedauerlichen Nachteil mit sich: Fleisch wird an der Oberfläche nicht knusprigbraun, da die dafür verantwortlichen chemische Reaktionen erst bei Temperaturen weit oberhalb von 100 Grad Celsius einsetzen. Bei diesen so genannten MaillardReaktionen reagieren Aminosäuren, also die einfachsten Bausteine der Eiweiße, mit Kohlehydraten, die derselben Familie wie der Haushaltszucker angehören. Im Verlaufe von komplizierten Reaktionsketten entstehen geruchs und geschmacksverbessernde Stoffe und eben die Bräunungsstoffe mit ihrer intensiven Färbung 12. Daher haben einige Mikrowellengeräte auch einen Grill eingebaut, mit dem man bei hoher Temperatur zunächst eine Kruste erzeugen und anschließend mit den Mikrowellen das Fleisch bis ins Innere rasch erhitzen kann, ohne dass sich die Aromastoffe verflüchtigen. Wie werden Mikrowellen erzeugt? In den herkömmlichen Schulgeräten für die Mikrowellenversuche werden die Mikrowellen in einem Klystron erzeugt. Dessen Leistung reicht für den Mikrowellenofen aber nicht aus. Daher wird ein so genanntes Magnetron eingesetzt. Dieses Bauteil wurde in England 1940 bis zur Fertigungsreife entwickelt und führte zum entscheidenden Durchbruch zur modernen Radartechnik. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Schwingkreise, wie sie üblicherweise im Unterricht der gymnasialen Oberstufe diskutiert werden. Der technische Aufbau eines Magnetrons ist in Abb. 6 zu sehen. 12 Die MaillardReaktion ist z.b. auch verantwortlich für die Entstehung der Brotkruste beim Backen, dass geröstete Kaffee und Kakaobohnen so gut riechen und Bier goldgelb ist. 8
9 Abb. 6: Technischer Aufbau eines Magnetrons zur Erzeugung von Mikrowellen (aus Dorn & Bader, 2000, S. 169). Die Funktionsweise ist im Text beschrieben. Aus der Glühkathode K werden durch Glühemission Elektronen freigesetzt, die durch eine konstante Hochspannung von einigen tausend Volt zum metallischen Anodenring A beschleunigt werden. In diesen Ring sind acht Schwingkreise eingelassen. Um Frequenzen im GigaHertzBereich zu erhalten müssen die Werte der Kapazität und Induktivität entsprechend klein sein. Jede Spule besteht daher nur noch aus einer Windung, ihre offenen Enden bilden den Kondensator. Senkrecht zum elektrischen Gleichfeld zwischen Kathode und A node wird mit einem Dauermagneten ein konstantes Magnetfeld erzeugt. Dadurch werden die Elektronen auf ihrem Weg zu den Schwingkreisen im Uhrzeigersinn abgelenkt. Elektronen, welche im elektrischen Wechselfeld eines Schwingkreiskondensators beschleunigt werden, werden aufgrund der dadurch vergrößerten Lorentzkraft zur Glühkathode zurückgeführt. Dies ist in Abb. 6 für ein Elektron in der Nähe des Schwingkreises 2 dargestellt. Elektronen, die im elektrischen Feld hingegen abgebremst werden und dadurch Energie verlieren (z.b. Schwingkreis 1) gelangen auf spiralförmigen Bahnen zur Anode (vergrößerter Ausschnitt in Abb. 6), da die Lorentzkraft im Mittel entsprechend kleiner ist. Insgesamt wird dadurch erreicht, dass die von einer Glühkathode emittierten Elektronen bevorzugt dann in das elektrische Feld der Schwingkreiskondensatoren gelangen, wenn sie Energie an den Schwingkreis abgegeben. Die Verstärkung des elektrischen Wechselfeldes der Schwingkreiskondensatoren geschieht durch Influenz und ist in Abb. 7 schematisch dargestellt und beschrieben. Die so erregte ungedämpfte elektromagnetische Schwingung induziert in einer in den Schwingkreis eingebrachten Auskoppelspule eine Induktionsspannung im Gigahertzbereich. Über einen Wellenleiter gelangen die so erzeugten Mikrowellen in den Garraum. t= 0 t= T/2 a. b. Abb. 7: Erzeugung einer ungedämpften Schwingung (schematisch). Bewegt sich ein aus der Glühkathode freigesetztes Elektron an der unteren Kondensatorplatte des Schwingkreises ( Spulen windung nicht eingezeichnet) vorbei, so influenziert es dort durch die Abstoßung von Plattenelektronen eine positive Aufladung (a.). Durch diese Ladungsverschiebung wird die obere Platte entsprechend negativ aufgeladen. Der Vorgang wiederholt sich an der oberen Kondensatorplatte (b.). Die Geschwindigkeit des Elektrons wird durch geeignete Wahl des elektrischen Feldes zwischen Glühkathode und Kondensator und dem dazu senkrecht überlagerten statischen Magnetfeld so eingestellt, dass es nach einer halben Schwingungsperiode die obere Platte erreicht und dadurch die Schwingung anfacht. 9
10 Literatur Berger, R. (2007). Das Gruppenpuzzle am Beispiel des Mikrowellenofens. Praxis der Naturwissenschaften, 2/56, 511. Berger, R. (2002). Das Mikrowellengerät ein interessanter Küchenhelfer. Praxis der Naturwissenschaften Physik, 2/51, 917. Bergmann, L. & Schäfer, C. (2006). Lehrbuch der Experimentalphysik. Band 5: Gase Nanosysteme Flüssigkeiten. Berlin: de Gruyter Dorn, F. & Bader, F. (2000). Physik Gymnasium Sek II. Hannover: Schroedel Hoffmann, L., Häußler, P. & PetersHaft, S. (1997). An den Interessen von Mädchen und Jungen orientierter Physikunterricht. Kiel: Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel (IPN Buch 155). Nordmeier, V. (1999). Zugänge zur nichtlinearen Physik am Beispiel fraktaler Wachstumsphänomene. Münster: LitVerlag 10
EM-Wellen. david vajda 3. Februar 2016. Zu den Physikalischen Größen innerhalb der Elektrodynamik gehören:
 david vajda 3. Februar 2016 Zu den Physikalischen Größen innerhalb der Elektrodynamik gehören: Elektrische Stromstärke I Elektrische Spannung U Elektrischer Widerstand R Ladung Q Probeladung q Zeit t Arbeit
david vajda 3. Februar 2016 Zu den Physikalischen Größen innerhalb der Elektrodynamik gehören: Elektrische Stromstärke I Elektrische Spannung U Elektrischer Widerstand R Ladung Q Probeladung q Zeit t Arbeit
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
1. Theorie: Kondensator:
 1. Theorie: Aufgabe des heutigen Versuchstages war es, die charakteristische Größe eines Kondensators (Kapazität C) und einer Spule (Induktivität L) zu bestimmen, indem man per Oszilloskop Spannung und
1. Theorie: Aufgabe des heutigen Versuchstages war es, die charakteristische Größe eines Kondensators (Kapazität C) und einer Spule (Induktivität L) zu bestimmen, indem man per Oszilloskop Spannung und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Einstieg in die Physik / 1.-2. Schuljahr
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einstieg in die Physik / 1.-2. Schuljahr Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Vorwort 4 Hinweise zum Einsatz
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einstieg in die Physik / 1.-2. Schuljahr Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Vorwort 4 Hinweise zum Einsatz
Anleitung über den Umgang mit Schildern
 Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
18. Magnetismus in Materie
 18. Magnetismus in Materie Wir haben den elektrischen Strom als Quelle für Magnetfelder kennen gelernt. Auch das magnetische Verhalten von Materie wird durch elektrische Ströme bestimmt. Die Bewegung der
18. Magnetismus in Materie Wir haben den elektrischen Strom als Quelle für Magnetfelder kennen gelernt. Auch das magnetische Verhalten von Materie wird durch elektrische Ströme bestimmt. Die Bewegung der
Schriftliche Abschlussprüfung Physik Realschulbildungsgang
 Sächsisches Staatsministerium für Kultus Schuljahr 1992/93 Geltungsbereich: für Klassen 10 an - Mittelschulen - Förderschulen - Abendmittelschulen Schriftliche Abschlussprüfung Physik Realschulbildungsgang
Sächsisches Staatsministerium für Kultus Schuljahr 1992/93 Geltungsbereich: für Klassen 10 an - Mittelschulen - Förderschulen - Abendmittelschulen Schriftliche Abschlussprüfung Physik Realschulbildungsgang
Chemie Zusammenfassung KA 2
 Chemie Zusammenfassung KA 2 Wärmemenge Q bei einer Reaktion Chemische Reaktionen haben eine Gemeinsamkeit: Bei der Reaktion wird entweder Energie/Wärme frei (exotherm). Oder es wird Wärme/Energie aufgenommen
Chemie Zusammenfassung KA 2 Wärmemenge Q bei einer Reaktion Chemische Reaktionen haben eine Gemeinsamkeit: Bei der Reaktion wird entweder Energie/Wärme frei (exotherm). Oder es wird Wärme/Energie aufgenommen
ONLINE-AKADEMIE. "Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" Ziele
 ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits
ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits
Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie
 Name: Matrikelnummer: Bachelor Biowissenschaften E-Mail: Physikalisches Anfängerpraktikum II Dozenten: Assistenten: Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in ärmeenergie Verantwortlicher
Name: Matrikelnummer: Bachelor Biowissenschaften E-Mail: Physikalisches Anfängerpraktikum II Dozenten: Assistenten: Protokoll des Versuches 7: Umwandlung von elektrischer Energie in ärmeenergie Verantwortlicher
Wie funktioniert eine Glühlampe?
 Wie funktioniert eine Glühlampe? Sobald du eine Lampe anknipst, fließt ein Strom von elektrisch geladenen Elementarteilchen, den Elektroden, durch das Kabel zur Glühlampe. Durch den Strom wird der Glühfaden
Wie funktioniert eine Glühlampe? Sobald du eine Lampe anknipst, fließt ein Strom von elektrisch geladenen Elementarteilchen, den Elektroden, durch das Kabel zur Glühlampe. Durch den Strom wird der Glühfaden
Im Prinzip wie ein Fotokopierer
 Im Prinzip wie ein Fotokopierer Mit diesem Experiment kannst Du das Grundprinzip verstehen, wie ein Fotokopierer funktioniert. Du brauchst : Styropor-Kügelchen Im Bild sind welche abgebildet, die es in
Im Prinzip wie ein Fotokopierer Mit diesem Experiment kannst Du das Grundprinzip verstehen, wie ein Fotokopierer funktioniert. Du brauchst : Styropor-Kügelchen Im Bild sind welche abgebildet, die es in
FAQ Spielvorbereitung Startspieler: Wer ist Startspieler?
 FAQ Spielvorbereitung Startspieler: Wer ist Startspieler? In der gedruckten Version der Spielregeln steht: der Startspieler ist der Spieler, dessen Arena unmittelbar links neben dem Kaiser steht [im Uhrzeigersinn].
FAQ Spielvorbereitung Startspieler: Wer ist Startspieler? In der gedruckten Version der Spielregeln steht: der Startspieler ist der Spieler, dessen Arena unmittelbar links neben dem Kaiser steht [im Uhrzeigersinn].
Physik & Musik. Stimmgabeln. 1 Auftrag
 Physik & Musik 5 Stimmgabeln 1 Auftrag Physik & Musik Stimmgabeln Seite 1 Stimmgabeln Bearbeitungszeit: 30 Minuten Sozialform: Einzel- oder Partnerarbeit Voraussetzung: Posten 1: "Wie funktioniert ein
Physik & Musik 5 Stimmgabeln 1 Auftrag Physik & Musik Stimmgabeln Seite 1 Stimmgabeln Bearbeitungszeit: 30 Minuten Sozialform: Einzel- oder Partnerarbeit Voraussetzung: Posten 1: "Wie funktioniert ein
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung
 Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016
 L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
Inhalt. Allgemeine Einführung. Argumentationsvermögen. Räumliches Vorstellungsvermögen. Begabungen und Fähigkeiten messen
 Beispielheft Inhalt Allgemeine Einführung Test Eins: Test Zwei: Test Drei: Test Vier: Test Fünf: Argumentationsvermögen Auffassungsvermögen Zahlenvermögen Sprachverständnis Räumliches Vorstellungsvermögen
Beispielheft Inhalt Allgemeine Einführung Test Eins: Test Zwei: Test Drei: Test Vier: Test Fünf: Argumentationsvermögen Auffassungsvermögen Zahlenvermögen Sprachverständnis Räumliches Vorstellungsvermögen
2.1 Präsentieren wozu eigentlich?
 2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
1 Aufgabe: Absorption von Laserstrahlung
 1 Aufgabe: Absorption von Laserstrahlung Werkstoff n R n i Glas 1,5 0,0 Aluminium (300 K) 25,3 90,0 Aluminium (730 K) 36,2 48,0 Aluminium (930 K) 33,5 41,9 Kupfer 11,0 50,0 Gold 12,0 54,7 Baustahl (570
1 Aufgabe: Absorption von Laserstrahlung Werkstoff n R n i Glas 1,5 0,0 Aluminium (300 K) 25,3 90,0 Aluminium (730 K) 36,2 48,0 Aluminium (930 K) 33,5 41,9 Kupfer 11,0 50,0 Gold 12,0 54,7 Baustahl (570
Anleitung Scharbefragung
 Projekt Evaline Anleitung Scharbefragung v.1.2 Inhalt Anleitung Scharbefragung... 1 1 Einleitung... 2 1.1 Vorlagen... 2 1.2 Journal... 2 2 Befragung Veranstaltungen / Angebote... 3 2.1 Methode... 3 2.2
Projekt Evaline Anleitung Scharbefragung v.1.2 Inhalt Anleitung Scharbefragung... 1 1 Einleitung... 2 1.1 Vorlagen... 2 1.2 Journal... 2 2 Befragung Veranstaltungen / Angebote... 3 2.1 Methode... 3 2.2
Optik: Teilgebiet der Physik, das sich mit der Untersuchung des Lichtes beschäftigt
 -II.1- Geometrische Optik Optik: Teilgebiet der, das sich mit der Untersuchung des Lichtes beschäftigt 1 Ausbreitung des Lichtes Das sich ausbreitende Licht stellt einen Transport von Energie dar. Man
-II.1- Geometrische Optik Optik: Teilgebiet der, das sich mit der Untersuchung des Lichtes beschäftigt 1 Ausbreitung des Lichtes Das sich ausbreitende Licht stellt einen Transport von Energie dar. Man
ELEXBO. ELektro - EXperimentier - BOx
 ELEXBO ELektro - EXperimentier - BOx 1 Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung.3 Grundlagen..3 Der elektrische Strom 4 Die elektrische Spannung..6 Der Widerstand...9 Widerstand messen..10 Zusammenfassung der elektrischen
ELEXBO ELektro - EXperimentier - BOx 1 Inhaltsverzeichnis 2 Einleitung.3 Grundlagen..3 Der elektrische Strom 4 Die elektrische Spannung..6 Der Widerstand...9 Widerstand messen..10 Zusammenfassung der elektrischen
Erstellen einer Collage. Zuerst ein leeres Dokument erzeugen, auf dem alle anderen Bilder zusammengefügt werden sollen (über [Datei] > [Neu])
![Erstellen einer Collage. Zuerst ein leeres Dokument erzeugen, auf dem alle anderen Bilder zusammengefügt werden sollen (über [Datei] > [Neu]) Erstellen einer Collage. Zuerst ein leeres Dokument erzeugen, auf dem alle anderen Bilder zusammengefügt werden sollen (über [Datei] > [Neu])](/thumbs/29/13170670.jpg) 3.7 Erstellen einer Collage Zuerst ein leeres Dokument erzeugen, auf dem alle anderen Bilder zusammengefügt werden sollen (über [Datei] > [Neu]) Dann Größe des Dokuments festlegen beispielsweise A4 (weitere
3.7 Erstellen einer Collage Zuerst ein leeres Dokument erzeugen, auf dem alle anderen Bilder zusammengefügt werden sollen (über [Datei] > [Neu]) Dann Größe des Dokuments festlegen beispielsweise A4 (weitere
Die Wärmepumpe funktioniert auf dem umgekehrten Prinzip der Klimaanlage (Kühlsystem). Also genau umgekehrt wie ein Kühlschrank.
 WÄRMEPUMPEN Wie funktioniert die Wärmepumpe? Die Wärmepumpe funktioniert auf dem umgekehrten Prinzip der Klimaanlage (Kühlsystem). Also genau umgekehrt wie ein Kühlschrank. Die Wärmepumpe saugt mithilfe
WÄRMEPUMPEN Wie funktioniert die Wärmepumpe? Die Wärmepumpe funktioniert auf dem umgekehrten Prinzip der Klimaanlage (Kühlsystem). Also genau umgekehrt wie ein Kühlschrank. Die Wärmepumpe saugt mithilfe
Hausaufgabe: Der Energieeffizienz auf der Spur
 Bevor du startest, lass bitte die folgenden Zeilen deine Eltern lesen und unterschreiben: Ihre Tochter/ Ihr Sohn hat heute ein Energiemessgerät für Energiemessungen zu Hause erhalten. Achten Sie bitte
Bevor du startest, lass bitte die folgenden Zeilen deine Eltern lesen und unterschreiben: Ihre Tochter/ Ihr Sohn hat heute ein Energiemessgerät für Energiemessungen zu Hause erhalten. Achten Sie bitte
Mehr Geld verdienen! Lesen Sie... Peter von Karst. Ihre Leseprobe. der schlüssel zum leben. So gehen Sie konkret vor!
 Peter von Karst Mehr Geld verdienen! So gehen Sie konkret vor! Ihre Leseprobe Lesen Sie...... wie Sie mit wenigen, aber effektiven Schritten Ihre gesteckten Ziele erreichen.... wie Sie die richtigen Entscheidungen
Peter von Karst Mehr Geld verdienen! So gehen Sie konkret vor! Ihre Leseprobe Lesen Sie...... wie Sie mit wenigen, aber effektiven Schritten Ihre gesteckten Ziele erreichen.... wie Sie die richtigen Entscheidungen
Simulation LIF5000. Abbildung 1
 Simulation LIF5000 Abbildung 1 Zur Simulation von analogen Schaltungen verwende ich Ltspice/SwitcherCAD III. Dieses Programm ist sehr leistungsfähig und wenn man weis wie, dann kann man damit fast alles
Simulation LIF5000 Abbildung 1 Zur Simulation von analogen Schaltungen verwende ich Ltspice/SwitcherCAD III. Dieses Programm ist sehr leistungsfähig und wenn man weis wie, dann kann man damit fast alles
Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken?
 UErörterung zu dem Thema Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken? 2000 by christoph hoffmann Seite I Gliederung 1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 2.
UErörterung zu dem Thema Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken? 2000 by christoph hoffmann Seite I Gliederung 1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 2.
Der -Online- Ausbilderkurs
 Der -Online- Ausbilderkurs Machen Sie Ihren Ausbilderschein mit 70% weniger Zeitaufwand Flexibel & mit 70% Zeitersparnis zu Ihrem Ausbilderschein Mit Videos auf Ihre Ausbilderprüfung (IHK) vorbereiten
Der -Online- Ausbilderkurs Machen Sie Ihren Ausbilderschein mit 70% weniger Zeitaufwand Flexibel & mit 70% Zeitersparnis zu Ihrem Ausbilderschein Mit Videos auf Ihre Ausbilderprüfung (IHK) vorbereiten
Geld Verdienen im Internet leicht gemacht
 Geld Verdienen im Internet leicht gemacht Hallo, Sie haben sich dieses E-book wahrscheinlich herunter geladen, weil Sie gerne lernen würden wie sie im Internet Geld verdienen können, oder? Denn genau das
Geld Verdienen im Internet leicht gemacht Hallo, Sie haben sich dieses E-book wahrscheinlich herunter geladen, weil Sie gerne lernen würden wie sie im Internet Geld verdienen können, oder? Denn genau das
Informatik Kurs Simulation. Hilfe für den Consideo Modeler
 Hilfe für den Consideo Modeler Consideo stellt Schulen den Modeler kostenlos zur Verfügung. Wenden Sie sich an: http://consideo-modeler.de/ Der Modeler ist ein Werkzeug, das nicht für schulische Zwecke
Hilfe für den Consideo Modeler Consideo stellt Schulen den Modeler kostenlos zur Verfügung. Wenden Sie sich an: http://consideo-modeler.de/ Der Modeler ist ein Werkzeug, das nicht für schulische Zwecke
Wärmebildkamera. Aufgabe 1. Lies ab, wie groß die Temperatur der Lippen (am Punkt P) ist. ca. 24 C ca. 28 C ca. 32 C ca. 34 C
 Wärmebildkamera Ob Menschen, Tiere oder Gegenstände: Sie alle senden unsichtbare Wärmestrahlen aus. Mit sogenannten Wärmebildkameras können diese sichtbar gemacht werden. Dadurch kann man die Temperatur
Wärmebildkamera Ob Menschen, Tiere oder Gegenstände: Sie alle senden unsichtbare Wärmestrahlen aus. Mit sogenannten Wärmebildkameras können diese sichtbar gemacht werden. Dadurch kann man die Temperatur
Handbuch Fischertechnik-Einzelteiltabelle V3.7.3
 Handbuch Fischertechnik-Einzelteiltabelle V3.7.3 von Markus Mack Stand: Samstag, 17. April 2004 Inhaltsverzeichnis 1. Systemvorraussetzungen...3 2. Installation und Start...3 3. Anpassen der Tabelle...3
Handbuch Fischertechnik-Einzelteiltabelle V3.7.3 von Markus Mack Stand: Samstag, 17. April 2004 Inhaltsverzeichnis 1. Systemvorraussetzungen...3 2. Installation und Start...3 3. Anpassen der Tabelle...3
Kreativ visualisieren
 Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns
Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns
Lichtbrechung an Linsen
 Sammellinsen Lichtbrechung an Linsen Fällt ein paralleles Lichtbündel auf eine Sammellinse, so werden die Lichtstrahlen so gebrochen, dass sie durch einen Brennpunkt der Linse verlaufen. Der Abstand zwischen
Sammellinsen Lichtbrechung an Linsen Fällt ein paralleles Lichtbündel auf eine Sammellinse, so werden die Lichtstrahlen so gebrochen, dass sie durch einen Brennpunkt der Linse verlaufen. Der Abstand zwischen
2.9 Aufbau und Funktion eines Bunsenbrenners. Aufgabe. Wie ist der Bunsenbrenner aufgebaut?
 Naturwissenschaften - Chemie - Anorganische Chemie - 2 Luft und andere Gase (P75400) 2.9 Aufbau und Funktion eines Bunsenbrenners Experiment von: Seb Gedruckt: 24.03.204 ::49 intertess (Version 3.2 B24,
Naturwissenschaften - Chemie - Anorganische Chemie - 2 Luft und andere Gase (P75400) 2.9 Aufbau und Funktion eines Bunsenbrenners Experiment von: Seb Gedruckt: 24.03.204 ::49 intertess (Version 3.2 B24,
Wie sieht unsere Welt im Kleinen aus?
 Skriptum Wie sieht unsere Welt im Kleinen aus? 1 Wie sieht unsere Welt im Kleinen aus? Atom- und Quantenphysik für Kids Seminar im Rahmen der KinderUni Wien, 12. 7. 2005 Katharina Durstberger, Franz Embacher,
Skriptum Wie sieht unsere Welt im Kleinen aus? 1 Wie sieht unsere Welt im Kleinen aus? Atom- und Quantenphysik für Kids Seminar im Rahmen der KinderUni Wien, 12. 7. 2005 Katharina Durstberger, Franz Embacher,
2.8 Grenzflächeneffekte
 - 86-2.8 Grenzflächeneffekte 2.8.1 Oberflächenspannung An Grenzflächen treten besondere Effekte auf, welche im Volumen nicht beobachtbar sind. Die molekulare Grundlage dafür sind Kohäsionskräfte, d.h.
- 86-2.8 Grenzflächeneffekte 2.8.1 Oberflächenspannung An Grenzflächen treten besondere Effekte auf, welche im Volumen nicht beobachtbar sind. Die molekulare Grundlage dafür sind Kohäsionskräfte, d.h.
DIE IEDLE VON CATAN THEMEN-SET ZUM ARTENSPIE FÜR ZWEI SPIELER WIND & WETTER. Stefan Strohschneider Stephan Leinhäuser
 K S DIE IEDLE VON CATAN R THEMEN-SET ZUM ARTENSPIE FÜR ZWEI SPIELER L WIND & WETTER www.das-leinhaus.de Stefan Strohschneider Stephan Leinhäuser Das Themenset Wind & Wetter Idee Stefan Strohschneider hatte
K S DIE IEDLE VON CATAN R THEMEN-SET ZUM ARTENSPIE FÜR ZWEI SPIELER L WIND & WETTER www.das-leinhaus.de Stefan Strohschneider Stephan Leinhäuser Das Themenset Wind & Wetter Idee Stefan Strohschneider hatte
SEK II. Auf den Punkt gebracht!
 SEK II Profil- und Kurswahl Einbringungspflicht Abitur-Bestimmungen Gesamtqualifikation Auf den Punkt gebracht! 1 Inhaltsverzeichnis Sinn und Zweck dieses Dokuments...3 Profil- und Kurswahl für den 11.
SEK II Profil- und Kurswahl Einbringungspflicht Abitur-Bestimmungen Gesamtqualifikation Auf den Punkt gebracht! 1 Inhaltsverzeichnis Sinn und Zweck dieses Dokuments...3 Profil- und Kurswahl für den 11.
Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen
 Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen Häufig werden bei 3D-Druck-Filamenten die Kunststoff-Festigkeit und physikalischen Eigenschaften diskutiert ohne die Einflüsse der Geometrie und der Verschweißung der
Festigkeit von FDM-3D-Druckteilen Häufig werden bei 3D-Druck-Filamenten die Kunststoff-Festigkeit und physikalischen Eigenschaften diskutiert ohne die Einflüsse der Geometrie und der Verschweißung der
Pädagogik. Melanie Schewtschenko. Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe. Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig?
 Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Ein süsses Experiment
 Ein süsses Experiment Zuckerkristalle am Stiel Das brauchst du: 250 Milliliter Wasser (entspricht etwa einer Tasse). Das reicht für 4-5 kleine Marmeladengläser und 4-5 Zuckerstäbchen 650 Gramm Zucker (den
Ein süsses Experiment Zuckerkristalle am Stiel Das brauchst du: 250 Milliliter Wasser (entspricht etwa einer Tasse). Das reicht für 4-5 kleine Marmeladengläser und 4-5 Zuckerstäbchen 650 Gramm Zucker (den
Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU
 Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU 2 DIE MEDIZINISCH-PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG (MPU) IST HOCH ANGESEHEN Das Image der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) ist zwiespältig: Das ist
Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU 2 DIE MEDIZINISCH-PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG (MPU) IST HOCH ANGESEHEN Das Image der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) ist zwiespältig: Das ist
Animationen erstellen
 Animationen erstellen Unter Animation wird hier das Erscheinen oder Bewegen von Objekten Texten und Bildern verstanden Dazu wird zunächst eine neue Folie erstellt : Einfügen/ Neue Folie... Das Layout Aufzählung
Animationen erstellen Unter Animation wird hier das Erscheinen oder Bewegen von Objekten Texten und Bildern verstanden Dazu wird zunächst eine neue Folie erstellt : Einfügen/ Neue Folie... Das Layout Aufzählung
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl
 Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Gutes Leben was ist das?
 Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Waggonbeleuchtung. Stützkondensatoren
 Waggonbeleuchtung Hier finden Sie alle Informationen, wie Sie Ihre Waggons eindrucksvoll beleuchten können. Diese Anleitung basiert auf die Verwendung von PCB-Streifen als Leiterbahn und SMD zur Beleuchtung.
Waggonbeleuchtung Hier finden Sie alle Informationen, wie Sie Ihre Waggons eindrucksvoll beleuchten können. Diese Anleitung basiert auf die Verwendung von PCB-Streifen als Leiterbahn und SMD zur Beleuchtung.
1. Was ihr in dieser Anleitung
 Leseprobe 1. Was ihr in dieser Anleitung erfahren könnt 2 Liebe Musiker, in diesem PDF erhaltet ihr eine Anleitung, wie ihr eure Musik online kostenlos per Werbevideo bewerben könnt, ohne dabei Geld für
Leseprobe 1. Was ihr in dieser Anleitung erfahren könnt 2 Liebe Musiker, in diesem PDF erhaltet ihr eine Anleitung, wie ihr eure Musik online kostenlos per Werbevideo bewerben könnt, ohne dabei Geld für
Platinen mit dem HP CLJ 1600 direkt bedrucken ohne Tonertransferverfahren
 Platinen mit dem HP CLJ 1600 direkt bedrucken ohne Tonertransferverfahren Um die Platinen zu bedrucken, muß der Drucker als allererstes ein wenig zerlegt werden. Obere und seitliche Abdeckungen entfernen:
Platinen mit dem HP CLJ 1600 direkt bedrucken ohne Tonertransferverfahren Um die Platinen zu bedrucken, muß der Drucker als allererstes ein wenig zerlegt werden. Obere und seitliche Abdeckungen entfernen:
1 topologisches Sortieren
 Wolfgang Hönig / Andreas Ecke WS 09/0 topologisches Sortieren. Überblick. Solange noch Knoten vorhanden: a) Suche Knoten v, zu dem keine Kante führt (Falls nicht vorhanden keine topologische Sortierung
Wolfgang Hönig / Andreas Ecke WS 09/0 topologisches Sortieren. Überblick. Solange noch Knoten vorhanden: a) Suche Knoten v, zu dem keine Kante führt (Falls nicht vorhanden keine topologische Sortierung
A. Werkstattunterricht - Theoretisch 1. Zum Aufbau der Werkstätten
 A. Werkstattunterricht - Theoretisch 1. Zum Aufbau der Werkstätten Die vorliegenden Werkstätten sind für die 1. Klasse konzipiert und so angelegt, dass eine handlungsorientierte Erarbeitung möglich ist.
A. Werkstattunterricht - Theoretisch 1. Zum Aufbau der Werkstätten Die vorliegenden Werkstätten sind für die 1. Klasse konzipiert und so angelegt, dass eine handlungsorientierte Erarbeitung möglich ist.
Auswertung JAM! Fragebogen: Deine Meinung ist uns wichtig!
 Auswertung JAM! Fragebogen: Deine Meinung ist uns wichtig! Im Rahmen des Projekts JAM! Jugendliche als Medienforscher wurden medienbezogene Lernmodule für den Einsatz an Hauptschulen entwickelt und bereits
Auswertung JAM! Fragebogen: Deine Meinung ist uns wichtig! Im Rahmen des Projekts JAM! Jugendliche als Medienforscher wurden medienbezogene Lernmodule für den Einsatz an Hauptschulen entwickelt und bereits
Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation
 Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation Einführung Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche eigentlich in ihre Ausbildung? Wir haben zu dieser Frage einmal die Meinungen von Auszubildenden
Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation Einführung Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche eigentlich in ihre Ausbildung? Wir haben zu dieser Frage einmal die Meinungen von Auszubildenden
Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache
 Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Baden-Württemberg ist heute besser als früher. Baden-Württemberg ist modern. Und lebendig. Tragen wir Grünen die Verantwortung?
Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Baden-Württemberg ist heute besser als früher. Baden-Württemberg ist modern. Und lebendig. Tragen wir Grünen die Verantwortung?
Mean Time Between Failures (MTBF)
 Mean Time Between Failures (MTBF) Hintergrundinformation zur MTBF Was steht hier? Die Mean Time Between Failure (MTBF) ist ein statistischer Mittelwert für den störungsfreien Betrieb eines elektronischen
Mean Time Between Failures (MTBF) Hintergrundinformation zur MTBF Was steht hier? Die Mean Time Between Failure (MTBF) ist ein statistischer Mittelwert für den störungsfreien Betrieb eines elektronischen
Copyright Sophie Streit / Filzweiber /www.filzweiber.at. Fertigung eines Filzringes mit Perlen!
 Fertigung eines Filzringes mit Perlen! Material und Bezugsquellen: Ich arbeite ausschließlich mit Wolle im Kardenband. Alle Lieferanten die ich hier aufliste haben nat. auch Filzzubehör. Zu Beginn möchtest
Fertigung eines Filzringes mit Perlen! Material und Bezugsquellen: Ich arbeite ausschließlich mit Wolle im Kardenband. Alle Lieferanten die ich hier aufliste haben nat. auch Filzzubehör. Zu Beginn möchtest
75 Jahre Kolleg St. Blasien Projekttage 2008
 75 Jahre Kolleg St. Blasien Projekttage 2008 Wir bauen ein Radio Ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Firma Testo, Lenzkirch, in dem wir theoretisch und praktisch gelernt haben, wie ein Radio funktioniert.
75 Jahre Kolleg St. Blasien Projekttage 2008 Wir bauen ein Radio Ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Firma Testo, Lenzkirch, in dem wir theoretisch und praktisch gelernt haben, wie ein Radio funktioniert.
Comenius Schulprojekt The sun and the Danube. Versuch 1: Spannung U und Stom I in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke E U 0, I k = f ( E )
 Blatt 2 von 12 Versuch 1: Spannung U und Stom I in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke E U 0, I k = f ( E ) Solar-Zellen bestehen prinzipiell aus zwei Schichten mit unterschiedlichem elektrischen Verhalten.
Blatt 2 von 12 Versuch 1: Spannung U und Stom I in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke E U 0, I k = f ( E ) Solar-Zellen bestehen prinzipiell aus zwei Schichten mit unterschiedlichem elektrischen Verhalten.
Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann
 UNIVERSITÄT ZU KÖLN Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Psychologie Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann Ablauf eines Referates Einleitung Gliederung
UNIVERSITÄT ZU KÖLN Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Psychologie Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann Ablauf eines Referates Einleitung Gliederung
Welches Übersetzungsbüro passt zu mir?
 1 Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 2 9 Kriterien für Ihre Suche mit Checkliste! Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Übersetzungsbüro das Internet befragen, werden Sie ganz schnell feststellen,
1 Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 2 9 Kriterien für Ihre Suche mit Checkliste! Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Übersetzungsbüro das Internet befragen, werden Sie ganz schnell feststellen,
Outlook. sysplus.ch outlook - mail-grundlagen Seite 1/8. Mail-Grundlagen. Posteingang
 sysplus.ch outlook - mail-grundlagen Seite 1/8 Outlook Mail-Grundlagen Posteingang Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zum Posteingang zu gelangen. Man kann links im Outlook-Fenster auf die Schaltfläche
sysplus.ch outlook - mail-grundlagen Seite 1/8 Outlook Mail-Grundlagen Posteingang Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zum Posteingang zu gelangen. Man kann links im Outlook-Fenster auf die Schaltfläche
BROTTEIG. Um Brotteig zu machen, mischt ein Bäcker Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Nach dem
 UNIT BROTTEIG BROTTEIG Um Brotteig zu machen, mischt ein Bäcker Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Nach dem Mischen wird der Teig für mehrere Stunden in einen Behälter gegeben, um den Gärungsprozess zu ermöglichen.
UNIT BROTTEIG BROTTEIG Um Brotteig zu machen, mischt ein Bäcker Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Nach dem Mischen wird der Teig für mehrere Stunden in einen Behälter gegeben, um den Gärungsprozess zu ermöglichen.
Programme im Griff Was bringt Ihnen dieses Kapitel?
 3-8272-5838-3 Windows Me 2 Programme im Griff Was bringt Ihnen dieses Kapitel? Wenn Sie unter Windows arbeiten (z.b. einen Brief schreiben, etwas ausdrucken oder ein Fenster öffnen), steckt letztendlich
3-8272-5838-3 Windows Me 2 Programme im Griff Was bringt Ihnen dieses Kapitel? Wenn Sie unter Windows arbeiten (z.b. einen Brief schreiben, etwas ausdrucken oder ein Fenster öffnen), steckt letztendlich
Projekt 2HEA 2005/06 Formelzettel Elektrotechnik
 Projekt 2HEA 2005/06 Formelzettel Elektrotechnik Teilübung: Kondensator im Wechselspannunskreis Gruppenteilnehmer: Jakic, Topka Abgabedatum: 24.02.2006 Jakic, Topka Inhaltsverzeichnis 2HEA INHALTSVERZEICHNIS
Projekt 2HEA 2005/06 Formelzettel Elektrotechnik Teilübung: Kondensator im Wechselspannunskreis Gruppenteilnehmer: Jakic, Topka Abgabedatum: 24.02.2006 Jakic, Topka Inhaltsverzeichnis 2HEA INHALTSVERZEICHNIS
Der Kälteanlagenbauer
 Der Kälteanlagenbauer Band : Grundkenntnisse Bearbeitet von Karl Breidenbach., überarbeitete und erweiterte Auflage. Buch. XXVIII, S. Gebunden ISBN 00 Format (B x L):,0 x,0 cm Zu Inhaltsverzeichnis schnell
Der Kälteanlagenbauer Band : Grundkenntnisse Bearbeitet von Karl Breidenbach., überarbeitete und erweiterte Auflage. Buch. XXVIII, S. Gebunden ISBN 00 Format (B x L):,0 x,0 cm Zu Inhaltsverzeichnis schnell
Qualitätsbereich. Mahlzeiten und Essen
 Qualitätsbereich Mahlzeiten und Essen 1. Voraussetzungen in unserer Einrichtung Räumliche Bedingungen / Innenbereich Für die Kinder stehen in jeder Gruppe und in der Küche der Körpergröße entsprechende
Qualitätsbereich Mahlzeiten und Essen 1. Voraussetzungen in unserer Einrichtung Räumliche Bedingungen / Innenbereich Für die Kinder stehen in jeder Gruppe und in der Küche der Körpergröße entsprechende
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen!
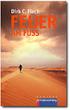 Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Schritt 1. Anmelden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden
 Schritt 1 Anmelden Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden Schritt 1 Anmelden Tippen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein Tipp: Nutzen Sie die Hilfe Passwort vergessen? wenn Sie sich nicht mehr
Schritt 1 Anmelden Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden Schritt 1 Anmelden Tippen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein Tipp: Nutzen Sie die Hilfe Passwort vergessen? wenn Sie sich nicht mehr
Versetzungsgefahr als ultimative Chance. ein vortrag für versetzungsgefährdete
 Versetzungsgefahr als ultimative Chance ein vortrag für versetzungsgefährdete Versetzungsgefährdete haben zum Großteil einige Fallen, die ihnen das normale Lernen schwer machen und mit der Zeit ins Hintertreffen
Versetzungsgefahr als ultimative Chance ein vortrag für versetzungsgefährdete Versetzungsgefährdete haben zum Großteil einige Fallen, die ihnen das normale Lernen schwer machen und mit der Zeit ins Hintertreffen
AGROPLUS Buchhaltung. Daten-Server und Sicherheitskopie. Version vom 21.10.2013b
 AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele
 Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele Was hat Modellbildung mit der Schule zu tun? Der Bildungsplan 1994 formuliert: "Die schnelle Zunahme des Wissens, die hohe Differenzierung und
Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele Was hat Modellbildung mit der Schule zu tun? Der Bildungsplan 1994 formuliert: "Die schnelle Zunahme des Wissens, die hohe Differenzierung und
Info zum Zusammenhang von Auflösung und Genauigkeit
 Da es oft Nachfragen und Verständnisprobleme mit den oben genannten Begriffen gibt, möchten wir hier versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Stück Wasserrohr mit der
Da es oft Nachfragen und Verständnisprobleme mit den oben genannten Begriffen gibt, möchten wir hier versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Stück Wasserrohr mit der
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen
 geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen
 Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen Sie möchten im Betreuten Wohnen leben. Dafür müssen Sie einen Vertrag abschließen. Und Sie müssen den Vertrag unterschreiben. Das steht
Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen Sie möchten im Betreuten Wohnen leben. Dafür müssen Sie einen Vertrag abschließen. Und Sie müssen den Vertrag unterschreiben. Das steht
Das Leitbild vom Verein WIR
 Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Nicht kopieren. Der neue Report von: Stefan Ploberger. 1. Ausgabe 2003
 Nicht kopieren Der neue Report von: Stefan Ploberger 1. Ausgabe 2003 Herausgeber: Verlag Ploberger & Partner 2003 by: Stefan Ploberger Verlag Ploberger & Partner, Postfach 11 46, D-82065 Baierbrunn Tel.
Nicht kopieren Der neue Report von: Stefan Ploberger 1. Ausgabe 2003 Herausgeber: Verlag Ploberger & Partner 2003 by: Stefan Ploberger Verlag Ploberger & Partner, Postfach 11 46, D-82065 Baierbrunn Tel.
Anschauliche Versuche zur Induktion
 Anschauliche Versuche zur Induktion Daniel Schwarz Anliegen Die hier vorgestellten Versuche sollen Schülerinnen und Schüler durch die Nachstellung von Alltagstechnik für das Thema Induktion motivieren.
Anschauliche Versuche zur Induktion Daniel Schwarz Anliegen Die hier vorgestellten Versuche sollen Schülerinnen und Schüler durch die Nachstellung von Alltagstechnik für das Thema Induktion motivieren.
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Geometrische Optik. Durchgeführt am 24.11.2011
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Geometrische Optik Durchgeführt am 24.11.2011 Gruppe X Name1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuerin: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Geometrische Optik Durchgeführt am 24.11.2011 Gruppe X Name1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuerin: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Wasserkraft früher und heute!
 Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Versuchsprotokoll - Michelson Interferometer
 Versuchsprotokoll im Fach Physik LK Radkovsky August 2008 Versuchsprotokoll - Michelson Interferometer Sebastian Schutzbach Jörg Gruber Felix Cromm - 1/6 - Einleitung: Nachdem wir das Interferenzphänomen
Versuchsprotokoll im Fach Physik LK Radkovsky August 2008 Versuchsprotokoll - Michelson Interferometer Sebastian Schutzbach Jörg Gruber Felix Cromm - 1/6 - Einleitung: Nachdem wir das Interferenzphänomen
OECD Programme for International Student Assessment PISA 2000. Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest. Deutschland
 OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben
Elternzeit Was ist das?
 Elternzeit Was ist das? Wenn Eltern sich nach der Geburt ihres Kindes ausschließlich um ihr Kind kümmern möchten, können sie bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit beantragen. Während der Elternzeit ruht das
Elternzeit Was ist das? Wenn Eltern sich nach der Geburt ihres Kindes ausschließlich um ihr Kind kümmern möchten, können sie bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit beantragen. Während der Elternzeit ruht das
Professionelle Seminare im Bereich MS-Office
 Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Stationsunterricht im Physikunterricht der Klasse 10
 Oranke-Oberschule Berlin (Gymnasium) Konrad-Wolf-Straße 11 13055 Berlin Frau Dr. D. Meyerhöfer Stationsunterricht im Physikunterricht der Klasse 10 Experimente zur spezifischen Wärmekapazität von Körpern
Oranke-Oberschule Berlin (Gymnasium) Konrad-Wolf-Straße 11 13055 Berlin Frau Dr. D. Meyerhöfer Stationsunterricht im Physikunterricht der Klasse 10 Experimente zur spezifischen Wärmekapazität von Körpern
In der Folge hier nun einige Bilder, welche bei der Herstellung der Modellier Ständer entstanden sind.
 Der Bau von Modellier - Ständern in der Schule Seon Ausgangslage Methodisches Absicht Eigenbau Planung Herstellung Zuschneiden Ich habe beobachtet, dass Schülerinnen und Schüler an der Schule Seon oft
Der Bau von Modellier - Ständern in der Schule Seon Ausgangslage Methodisches Absicht Eigenbau Planung Herstellung Zuschneiden Ich habe beobachtet, dass Schülerinnen und Schüler an der Schule Seon oft
Kulturelle Evolution 12
 3.3 Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution 12 Seit die Menschen Erfindungen machen wie z.b. das Rad oder den Pflug, haben sie sich im Körperbau kaum mehr verändert. Dafür war einfach
3.3 Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution 12 Seit die Menschen Erfindungen machen wie z.b. das Rad oder den Pflug, haben sie sich im Körperbau kaum mehr verändert. Dafür war einfach
Kapitel 13: Laugen und Neutralisation
 Kapitel 13: Laugen und Neutralisation Alkalimetalle sind Natrium, Kalium, Lithium (und Rubidium, Caesium und Francium). - Welche besonderen Eigenschaften haben die Elemente Natrium, Kalium und Lithium?
Kapitel 13: Laugen und Neutralisation Alkalimetalle sind Natrium, Kalium, Lithium (und Rubidium, Caesium und Francium). - Welche besonderen Eigenschaften haben die Elemente Natrium, Kalium und Lithium?
Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern
 Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November
Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November
Kreatives Occhi. - V o r s p a n n - Alle Knoten und Knüpfelemente sowie ihre Verwendbarkeit. Die Knoten
 Kreatives Occhi - V o r s p a n n - Alle Knoten und Knüpfelemente sowie ihre Verwendbarkeit Die Knoten Der Doppelknoten: Er wird mit nur 1 Schiffchen gearbeitet (s. page Die Handhabung der Schiffchen )
Kreatives Occhi - V o r s p a n n - Alle Knoten und Knüpfelemente sowie ihre Verwendbarkeit Die Knoten Der Doppelknoten: Er wird mit nur 1 Schiffchen gearbeitet (s. page Die Handhabung der Schiffchen )
Gitterherstellung und Polarisation
 Versuch 1: Gitterherstellung und Polarisation Bei diesem Versuch wollen wir untersuchen wie man durch Überlagerung von zwei ebenen Wellen Gttterstrukturen erzeugen kann. Im zweiten Teil wird die Sichtbarkeit
Versuch 1: Gitterherstellung und Polarisation Bei diesem Versuch wollen wir untersuchen wie man durch Überlagerung von zwei ebenen Wellen Gttterstrukturen erzeugen kann. Im zweiten Teil wird die Sichtbarkeit
Universal Gleismauer Set von SB4 mit Tauschtextur u. integrierten Gleismauerabschlüssen!
 Stefan Böttner (SB4) März 2013 Universal Gleismauer Set von SB4 mit Tauschtextur u. integrierten Gleismauerabschlüssen! Verwendbar ab EEP7.5(mitPlugin5) + EEP8 + EEP9 Abmessung: (B 12m x H 12m) Die Einsatzhöhe
Stefan Böttner (SB4) März 2013 Universal Gleismauer Set von SB4 mit Tauschtextur u. integrierten Gleismauerabschlüssen! Verwendbar ab EEP7.5(mitPlugin5) + EEP8 + EEP9 Abmessung: (B 12m x H 12m) Die Einsatzhöhe
Überlege du: Wann brauchen wir Strom. Im Haushalt In der Schule In Büros/Firmen Auf Straßen
 Jeden Tag verbrauchen wir Menschen sehr viel Strom, also Energie. Papa macht den Frühstückskaffee, Mama fönt sich noch schnell die Haare, dein Bruder nimmt die elektrische Zahnbürste zur Hand, du spielst
Jeden Tag verbrauchen wir Menschen sehr viel Strom, also Energie. Papa macht den Frühstückskaffee, Mama fönt sich noch schnell die Haare, dein Bruder nimmt die elektrische Zahnbürste zur Hand, du spielst
1 Einleitung. Lernziele. automatische Antworten bei Abwesenheit senden. Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer. 4 Minuten.
 1 Einleitung Lernziele automatische Antworten bei Abwesenheit senden Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer 4 Minuten Seite 1 von 18 2 Antworten bei Abwesenheit senden» Outlook kann während
1 Einleitung Lernziele automatische Antworten bei Abwesenheit senden Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer 4 Minuten Seite 1 von 18 2 Antworten bei Abwesenheit senden» Outlook kann während
PCD Europe, Krefeld, Jan 2007. Auswertung von Haemoccult
 Auswertung von Haemoccult Ist das positiv? Nein! Ja! Im deutschen Krebsfrüherkennungsprogramm haben nur etwa 1 % der Frauen und 1,5 % der Männer ein positives Haemoccult -Ergebnis, da dieser Test eine
Auswertung von Haemoccult Ist das positiv? Nein! Ja! Im deutschen Krebsfrüherkennungsprogramm haben nur etwa 1 % der Frauen und 1,5 % der Männer ein positives Haemoccult -Ergebnis, da dieser Test eine
Reizdarmsyndrom lindern
 MARIA HOLL Reizdarmsyndrom lindern Mit der Maria-Holl-Methode (MHM) Der ganzheitliche Ansatz 18 Wie Sie mit diesem Buch Ihr Ziel erreichen Schritt 1: Formulieren Sie Ihr Ziel Als Erstes notieren Sie Ihr
MARIA HOLL Reizdarmsyndrom lindern Mit der Maria-Holl-Methode (MHM) Der ganzheitliche Ansatz 18 Wie Sie mit diesem Buch Ihr Ziel erreichen Schritt 1: Formulieren Sie Ihr Ziel Als Erstes notieren Sie Ihr
Kurzanleitung für eine erfüllte Partnerschaft
 Kurzanleitung für eine erfüllte Partnerschaft 10 Schritte die deine Beziehungen zum Erblühen bringen Oft ist weniger mehr und es sind nicht immer nur die großen Worte, die dann Veränderungen bewirken.
Kurzanleitung für eine erfüllte Partnerschaft 10 Schritte die deine Beziehungen zum Erblühen bringen Oft ist weniger mehr und es sind nicht immer nur die großen Worte, die dann Veränderungen bewirken.
Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP.
 Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP. Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! Im ersten Theorieteil der heutigen Woche beschäftigen wir uns mit der Entstehungsgeschichte des NLP. Zuerst aber eine Frage: Wissen
Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP. Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! Im ersten Theorieteil der heutigen Woche beschäftigen wir uns mit der Entstehungsgeschichte des NLP. Zuerst aber eine Frage: Wissen
Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien
 Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Peter Hettlich MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin/Sehr geehrter Herr Präsident,
 Rede zu Protokoll TOP 74 Straßenverkehrsrecht Peter Hettlich MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Sehr geehrte Frau Präsidentin/Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen
Rede zu Protokoll TOP 74 Straßenverkehrsrecht Peter Hettlich MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Sehr geehrte Frau Präsidentin/Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen
