Die Macht. der Angeber
|
|
|
- Leon Maurer
- vor 4 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Nr. 1 für die Studienwahl! Weitere Informationen unter DIE ZEIT PREIS DEUTSCHLAND 5,70 WOCHENZEITUNG FÜR POLITIK WIRTSCHAFT WISSEN UND KULTUR 2. JULI 2020 N o 28 Die Macht Was macht das mit der Polizei? der Angeber Politiker, Manager, Partylöwen: Immer wieder werden die Menschen von Blendern getäuscht. Und doch gibt es Selbstdarsteller, die in ihrer Eitelkeit den Fortschritt vorantreiben WISSEN Wie die Bürgerpolizei in Leipzig-Connewitz mit Anfeindungen umgeht Wirtschaft, Seite 26 Ist man ein schlechter Demokrat, wenn man der Polizei nicht traut? Feuilleton, Seite 45 Titelfoto: Shara Henderson Warum sind viele Schwaben so wütend? Unterwegs in Stuttgart Entdecken, Seite 55 NAHOSTKONFLIKT AUSTRITTSWELLE Wut und Weitsicht Israel will ein Drittel des Westjordanlandes annektieren. Die Empörung ist riesig und birgt auch eine Chance VON JOSEF JOFFE Corona kann auch helfen. Ab Monatsbeginn will die Regierung Netanjahu die Annexion von 30 Prozent des Westjordanlandes»diskutieren«. Doch Großkoalitionär Benny Gantz, der Verteidigungsminister, betrachtet das Juli-Datum nicht als»heilig«und hält dagegen. Wichtiger sei es, die Covid-19-Katastrophe der Wirtschaft zu bekämpfen. EU, UN und Arabische Liga toben, die Palästinenser-Behörde wütet:»nicht einen Zentimeter!«Derlei Protest hat Israel als rituelle Routine eingepreist. Ignorieren kann Netanjahu freilich nicht den Schaden, den Israel sich selbst zufügen würde. Vorweg aus realpolitischer Sicht. Israel will sich einen langen Streifen (17 Prozent der anvisierten Fläche) entlang der Ostgrenze zu Jordanien greifen. Der strategische Gewinn wäre gleich null, der politische Preis unkalkulierbar. Israel kontrolliert diese Barriere seit 50 Jahren im stillen Einvernehmen mit Amman. Für König Abdullah ist das Jordantal eine Lebensversicherung, trennt es doch die Palästinenser- Mehrheit im eigenen Land von den Brüdern am West ufer. Ein Aufstand könnte den Monarchen den Thron und Israel einen verlässlichen Verbündeten kosten. Im Westen will Netanjahu 13 Prozent kassieren. Auf palästinensischem Gebiet bliebe ein Flickenteppich von Siedlungen unter Israels Souveränität, jede einzelne müsste von der Armee gesichert werden. Jedem Siedler seinen Body guard. Die moralische Beschädigung hätte realpolitische Konsequenzen Israels Armee (IDF) und die Sicherheitsdienste sind nicht begeistert. Seit Jahrzehnten arbeiten sie mit den Palästinenser-Kräften zusammen. Jetzt droht ein grimmiges Szenario: In Ramallah fegt der Aufstand Präsident Mahmud Abbas davon; Israels Todfeinde Hamas und IS machen sich mit iranischer Hilfe breit. Die IDF, eine kompakte Prä senz armee, müsste Reservisten einberufen, warnt die Generalität. Schließlich riskiert Israel sein größtes Plus: die stille Allianz mit den Saudis und den Golfstaaten, mit Kairo und Amman. Im Mai flog zum ersten Mal ein Frachtflugzeug nonstop von Abu Dhabi nach Tel Aviv. Nun droht der Außenminis ter der Emirate:»Entweder Annektierung oder Normalisierung.«In Amerika verlöre Israel die Demokratische Partei, in Europa Regierungen, die starke islamische Minderheiten besänftigen müssen. Nicht einmal zu Hause kann sich»bibi«sicher fühlen. Gerade mal ein Viertel des Wahlvolks bejaht die Annexion ohne Wenn und Aber. Nun vom Strategischen zum Moralischen. Eine ur alte Einsicht nach der Eroberung des Westjordanlandes im Sechstagekrieg 1967 besagt: Israel kann nicht sowohl ein jüdischer als auch ein demokratischer Staat bleiben. Entweder haben alle die gleichen Rechte, oder das Land zerfällt in Bürger erster und zweiter Klasse die einen oben, die anderen unten. Niemand kennt die neue Landkarte, wenn sie denn angesichts des weltweiten Widerstands überhaupt gezeichnet wird. Aber eine 30-Prozent-Annexion würde an die hunderttausend Palästinenser eingemeinden. So wüchse die Zahl der Staatenlosen ohne klassische Bürgerrechte. Das Si gnal? Ende der Zweistaatenlösung. Sodann würde die Annexion all jene bestätigen, die ohnehin wähnen, Israel die einzige Demokratie in Nahost verkomme zum Kolonialstaat. Die moralische Beschädigung hätte wiederum realpolitische Konsequenzen: Verlust von Glaubwürdigkeit und Partnern in der gefährlichsten Ecke der Weltpolitik. Annexion wäre Symbolpolitik, die keine Regierung anerkennen würde, nicht einmal die amerikanische, die sich schon leise davonschleicht. All das, weil Netanjahu aus innerem Kalkül am äußeren Status quo rüttelt? Der ist so stabil wie ein Papphaus. Netanjahu ist trickreich genug, um sich aus der selbst gestellten Falle zu befreien. Hier lauern terrorbereite Palästinenser, die nichts mehr zu verlieren hätten, europäische Sanktionen und arabische Potentaten, die sich nicht mehr trauen, mit Israel zu paktieren. In letzter Minute hat die Palästinenser-Führung das auf alle Beteiligten zurollende Desaster erkannt und die Bremse gezogen. Nach sechs Jahren beinharter Gesprächsverweigerung will sie wieder direkt mit Israel reden, sogar»mindere Grenzkorrekturen«und partielle Entwaffnung akzeptieren, wenn Jerusalem auf Annexion verzichtet. Netanjahu steht plötzlich unter Zugzwang. Er sollte die neue Chance ergreifen. A A Glaube ohne Worte Noch nie haben so viele Menschen die Kirche verlassen wie heute. Daran ist sie selbst schuld, aber nicht sie allein VON EVELYN FINGER Bevor wir darüber spekulieren, was die Kirchen nun wieder alles falsch gemacht haben, wollen wir uns kurz an dem Gedanken erfrischen, dass es auch ein Fehler der Kir chenmitglie der sein könnte, wenn sie massenhaft austreten. Es ist wie mit dem Massenansturm auf die Ostsee. Tout le monde flieht auf der Suche nach Freiheit an überfüllte Strände, statt mal in die Provinz abzubiegen, etwa nach Havelberg in Sachsen-Anhalt, wo sich aus dem Nichts plötzlich einer dieser ur alten Dome erhebt, die einen glauben machen, mindestens in Sevilla zu sein. Tatsächlich ist dies der deutsche Nordosten, eine als ärmlich und atheistisch verschriene Gegend, wo jedoch vor tausend Jahren die Bischofsmacht so groß war, dass eine Vielzahl imposanter Kirchen entstand. Ihre Aura hat sich seither nicht abgeschwächt; und der Glaube, dem sie einst Gestalt gaben, überstrahlt noch die Gegend. Das erinnert uns daran, dass Deutschland zu den Ländern mit dem reichsten christlichen Kultur erbe gehört. Wer denkt, dass den Deutschen ihre Kirchen gleichgültig wären, bloß weil die Kirchenmitgliederzahlen seit Jahren sinken, der stelle sich vor, was los wäre, wenn der himmelhohe Havelberger Dom wegen Baufälligkeit einstürzte. Oder wenn der Berliner Dom pleiteginge, was wegen Corona durchaus möglich ist. Heimlich wird gedacht: Je weniger wir sind, desto mehr haben wir recht Dann würden alle jammern, wie beim Brand von Notre Dame, statt zu fragen, warum sie sich selbst nicht rechtzeitig um die Kirche geschert haben um ihren Erhalt, ihre Erneuerung. Also, Frage an die frisch ausgetretenen Kirchenmitglieder: War es vielleicht bequemer, abzuhauen? Nein, natürlich war das nach den Missbrauchsskandalen unbequem, ja schmerzlich. Zu sehen, dass die Kirchen noch immer keine so harte Aufklärung zulassen, wie sie unausweichlich wäre nach all dem Vertuschen und der Strafvereitelung. Und doch ist das nicht die ganze Erklärung für die Austritte. Noch nie haben so viele Protestanten und Katholiken in Deutschland ihre Kirche verlassen wie im Jahr 2019, sage und schreibe Nun könnte man sagen, dass noch genug Christen übrig sind. So gehören der EKD 20,7 Millionen Protestanten an, fast ein Viertel der Bevölkerung (24,9 Prozent). Die Katholiken stellen mit 22,6 Millionen sogar mehr als ein Viertel (27,2 Prozent). Dennoch geben sich die Chefs beider Kirchen zerknirscht. Und nun? Kirchentreue hängt nicht mehr unbedingt am Glauben. Denn die Gretchenfrage, ob einer glaubt, beantwortet manch Getaufter mit»na ja«und manch Ausgetretener mit»na klar«. Zwar behaupten einige letzte Erzkonservative tapfer, heutige Pfarrer müssten einfach mehr vom Glauben reden und weniger von Politik, dann werde das wieder. Es hat sich aber gezeigt, dass das Heil des Kirchenwachstums weder auf diese noch auf jene Weise herbeizupredigen ist. Manche Christen wollen die Kirche frommer, andere noch politischer. Manche wollen sie traditionsstolz, andere reformerisch. Auf dieses Problem reagierten beide Kirchen bislang mehr ängstlich als beherzt. Die Katholiken, grob gesagt, sind seit einem halben Jahrhundert tief zerstritten, ob sie die Moderne verteufeln sollen oder sich der modernen Menschen annehmen, wie sie sind. Die Protestanten, grob gesagt, haben es sich bequem gemacht in der Illusion, die fortschrittlichere Kirche zu sein und dank der Reformation keine echten Reformen mehr nötig zu haben. Zugleich ist in beiden schrumpfenden Kirchen ein heimliches Überlegenheitsgefühl gewachsen, ein Verliererstolz, der an der Basis ebenso vorkommt wie in der Hierarchie. Joseph Ratzingers trotziges Wort von der Kirche der kleinen Schar drückte aus, was nicht nur seine Fans empfanden: Je weniger wir sind, desto mehr haben wir recht. Vielleicht ist es dieser mit Scham gemischte Stolz, der das kirchliche Reden erschwert. Man hat eine Botschaft, die nicht von dieser Welt ist, aber weltbewegend will man schon sein. Man ist anders, aber fürchtet sich, anzuecken. Man hat ein jenseitiges Heilsversprechen, aber hienieden ankommen will man auch, am liebsten bei allen. Das Ergebnis: Man redet salbungsvoll über die Köpfe der Leute hinweg und wundert sich, dass sie davonlaufen. Was hilft? Erstens: der Satz, den eine Marketingexpertin auf einem Pfarrkonvent sagte dass»alle«keine Zielgruppe sei. Zweitens: mal nach Havelberg fahren und das Wunder der Kirchbauvereine im Nordosten bestaunen, die unbedingt ihre Kirchen erhalten wollen, obwohl sie selbst keine Kirchenmitglieder sind. Drittens: dran denken, dass die Größe der Kirche sich nicht nach Mitgliederzahlen bemisst. A A PROMINENT IGNORIERT Gut zu Fuß Die Firma Segway stellt die Produktion ihres Personal Transporters (PT) ein, jenes großrädrigen Stehrollers, auf dem Touristen zuweilen in Gänsekolonne die Stadt durchquerten. Das Ding war teuer und erlag der Konkurrenz vieler anderer elektrischer Gefährte, zumal der Mensch immer noch dazu neigt, sich Schusters Rappen anzuvertrauen. Dieses Tier ist meistens brav und preiswert. GRN. Kleine Fotos (v. o.): EyeEm/Getty Images; nnattalli/shutterstock Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg Telefon 040 / ; DieZeit@zeit.de, Leserbriefe@zeit.de ZEIT ONLINE GmbH: ZEIT-Stellenmarkt: ABONNENTENSERVICE: Tel. 040 / , Fax 040 / , abo@zeit.de PREISE IM AUSLAND: DK 60,95/FIN 8,50/E 7,10/ CAN 7,60/F 7,10/NL 6,60/ A 5,90/CH 8.20/I 7,10/GR 7,60/ B 6,60/P 7,40/L 6,60/H 2990,00 N o JAHRGANG C 7451 C
2 2 POLITIK 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Schön ist das nicht Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagt, das Tierwohl in den Ställen liege ihr am Herzen. Aber seit sie vor zwei Jahren ihr Amt antrat, sind die Missstände dieselben geblieben. Will Klöckner nichts ändern oder kann sie es gar nicht? VON MERLIND THEILE Julia Klöckner wuchs mit Tieren auf, ihre Eltern hielten Kühe, Schweine, Hühner. Auf dem Hof in Rheinland-Pfalz sah Julia als Kind dem Leben zu, sie sah die Kälber trinken, die Ferkel spielen, die Küken schlüpfen. Und irgendwann sah sie dort auf dem Hof auch den Tod. Als sie begriffen habe, dass diese Tiere aus ihrem Stall ja geschlachtet würden, sei das traumatisch gewesen, sagt Klöckner, ein Schock. Tief frustriert sei sie gewesen, damals als Kind. Einmal habe sie einen Eimer voll Schweineblut umrühren müssen, für die Blutwurst. Das Bild habe sich ihr eingebrannt. Seitdem, sagt Klöckner, esse sie keine Blutwurst mehr. Julia Klöckner, jetzt 47 Jahre alt, erzählt diese Geschichte bei einer Begegnung vergangene Woche in Berlin, in einer Zeit, in der das Töten von Tieren sich aus dem kollektiv Verdrängten mit Wucht ins allgemein Bewusste schiebt. Das Coronavirus zwingt zum Hinsehen, weil es massiv unter Schlachtarbeitern grassiert, und vom Schicksal ausgebeuteter Osteuropäer ist es zum Dasein entwerteter Nutztiere nicht weit. Die billigen Arbeiter produzieren billiges Fleisch, dessen Preise mit Tierleid erkauft sind, zu viele Ställe sind Teil des Übels. Womit das Thema nun auch die zuständige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner trifft. Vergangenen Freitag lud sie mit ihren beiden CDU-Kolleginnen, den Agrarministerinnen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, eilig zu einem Fleischgipfel nach Düsseldorf. Gesandte der Schlachtereien und des Handels kamen, dazu Ernährungsexperten, Verbrauchervertreter, Tierschützer. Es gehe nicht nur um Schlachtunternehmen wie das von Clemens Tönnies, sagte Klöckner hinterher. Man habe heute eine»systemfrage«behandelt. Zu den Tieren sagte sie, dass eine»tierwohlabgabe«notwendig sei, 40 Cent Aufschlag pro Kilo Fleisch, für ein besseres Leben in den Ställen. Ihren Entwurf für ein»tierwohllabel«, das die Lebensbedingungen von Schweinen auf der Fleischverpackung anzeigen und damit zu einer»tiergerechteren«kaufentscheidung führen soll, habe sie dem Bundestag ja schon vorgelegt, Kriterien für weitere Tierarten sollen folgen. Klöckner klang wie eine Politikerin, die entschieden anpackt. Das Problem ist, dass sie dazu als Ministerin schon mehr als zwei Jahre Zeit hatte. Dass es den allermeisten Nutztieren in Deutschland schlecht geht, ist weithin bekannt. Nur drei Beispiele: Ein Großteil der Hochleistungsmilchkühe leidet an Euterentzündungen. Konventionell gehaltene Muttersauen verbringen ihr Dasein überwiegend fixiert in engen Kastenständen. Die männlichen Küken der gängigen Legehennen leben gar nicht erst, sondern werden millionenfach getötet, weil der Markt sie nicht gebrauchen kann. Das alles ist Alltag in der deutschen Landwirtschaft, obwohl es den meisten Menschen ein Graus ist und der Tierschutz seit 2002 als Staatsziel im Grundgesetz steht. Julia Klöckner trat als Ministerin im März 2018 auch an, das Leben der Nutztiere zu verbessern, doch die Missstände in der Landwirtschaft blieben dieselben. Wie kann das sein? Will Klöckner in Wahrheit nichts ändern? Oder kann sie es gar nicht? Berlin Mitte Januar, Auftakt zur Grünen Woche, der größten Landwirtschaftsmesse der Welt. Julia Klöckner führt eine Gruppe Journalisten durch die Halle ihres»lebensministeriums«, wie sie es taufte. Überall Stände mit gesundem Essen, bunte Schautafeln, bienenfreundliche Blumen. Alles hübsch.»ich bin sehr, sehr zufrieden und auch happy damit«, sagt Klöckner. Während sie spricht, sieht sie, wie Greenpeace-Aktivisten an einer Seitenwand der Halle ein Plakat entrollen. Die Worte Klimaschutz, Artenschutz, Tierschutz stehen darauf und:»machen Sie Ihren Job, Frau Klöckner«.»Ach, kommen Sie«, sagt die Ministerin genervt und führt die Journalisten in eine andere Ecke der Halle, wo sie die Idee ihres Tierwohllabels veranschaulichen will. Von ihrem Vorgänger Christian Schmidt (CSU) erbte Klöckner das Projekt, Schweinefleisch mit einem freiwilligen Kennzeichen zu versehen, von Stufe 1 bis 3. Das Label berücksichtigt etwa Platz, Beschäftigung und Behandlung der Tiere. Je besser für das Tier, desto höher die Stufe und folglich auch der Preis. Am Stand»Digitale Fleischtheke«lässt Julia Klöckner einen Fachmann auf einem Bildschirm die Zusammenhänge erklären. Er zoomt in einen computeranimierten Schweinestall, Modell gesetzlicher Mindeststandard. Kein Auslauf ins Freie, kaum Platz. Die Schweine stehen auf nackten Böden jeweils im Dutzend so eng in ihren Buchten, dass sie fast aneinanderstoßen. Dann drückt der Fachmann die Buttons Stroh, Auslauf, extra viel Platz. Es sieht nun alles ein bisschen luftiger aus. Kosten für die Landwirtin (in der Animation eine sanftmütig lächelnde Frau mit Ferkel im Arm): 1,69 Euro pro Kilo Schweine fleisch. Und die muss irgendwer bezahlen. Klöckner weiß auch, wer das sein soll: der Verbraucher.»Du entscheidest«heißt das Motto ihres Messeauftritts, man könnte damit aber auch ihre bisherige Amtszeit überschreiben. Wer mehr Tierwohl will, muss eben an der Kasse mehr bezahlen, das ist im Grundsatz Klöckners Haltung. Die Bereitschaft dazu ist theoretisch da: In Umfragen sagen regelmäßig vier von fünf Deutschen, zwischen 50 und 100 Prozent mehr für Fleisch ausgeben zu wollen, wenn dieser Preis eine bessere Tierhaltung garantierte. Im jüngsten Ernährungsreport des Landwirtschaftsministeriums heißt es jedoch auch,»dass es sich hierbei um eine grundsätzlich geäußerte Zahlungsbereitschaft handelt, die aber nicht notwendigerweise auch in ein entsprechendes Kaufverhalten umgesetzt wird«. Der Verbraucher, auf den Klöckner so stark setzt, ist ein schizophrenes Wesen. Teureres Fleisch aus tiergerechterer, ökologischer Erzeugung gibt es ja längst, auch mit entsprechender Kennzeichnung. Es wird bloß kaum gekauft. Billiges Fleisch flutet weiterhin die Supermärkte, Fast-Food-Ketten und Kantinen, der Fleischkonsum des Durchschnittsdeutschen ist mit jährlich knapp 60 Kilo doppelt so hoch wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Und fast scheint es, als sei es den Leuten durchaus recht, beim Fleisch essen nicht Fotos: Julia Sellmann/laif (gr.); Joerg Sarbach/dpa (kl.) noch durch Labels auf mögliche Probleme gestoßen zu werden. Die Blutwurst schmeckt eben besser, wenn man nicht um ihre Entstehung weiß oder es schafft, das Wissen auszublenden. Wenn es dem Einzelnen allein nicht gelingt, die gute Absicht umzusetzen, schlägt eigentlich die Stunde der Politik. Die Atomkraft beispielsweise verlor in Deutschland nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl bei vielen massiv an Zustimmung, aber für grünen Strom im eigenen Haushalt waren die meisten dann doch zu geizig also führte die Politik die EEG-Umlage ein und schob mit deren Einnahmen die Energiewende an. Wäre es so abwegig, sich vorzustellen, dass eine ähnliche Art von Umbau auch in der Nutztierhaltung möglich sein könnte? Für eine marktgläubige CDU-Politikerin wie Julia Klöckner war das lange so. Dem Wohl der meisten Nutztiere aber hat ihr Mantra der Freiwilligkeit bislang nichts gebracht. Dabei hat auch Klöckner die gesellschaftliche Tragweite des Themas offenbar längst erkannt. Am 2. März besucht sie eine Klausur der schleswig- holsteinischen CDU-Fraktion in Norderstedt. Teilnehmern zufolge sagt sie in ihrer Ansprache, dass sie ihrer Partei nur raten könne, sich beim Thema Tierwohl an die Spitze der Bewegung zu stellen. Schlachtkrise Die jüngsten Hotspots der Corona-Pandemie sind Schlachthöfe: Allein im Betrieb von Clemens Tönnies im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen infizierten sich mehr als 1500 Arbeiter. Der Ausbruch lenkt den Blick auf die gesamte Kette der Fleischerzeugung. Bringt Corona eine Wende in der Nutztierhaltung? Julia Klöckner ist CDU-Landeschefin von Rheinland-Pfalz und stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei Nutztiere In Deutschland werden über 200 Millionen Schweine, Rinder und Hühner gehalten. Vielen geht es schlecht: Tierschutzorganisationen zufolge stammt fast jedes vierte tierische Produkt von einem kranken Tier. In der späteren Pressekonferenz sagt sie vor einer Handvoll Journalisten:»Ich will einfach mal so die These aufstellen: Das, was die Atomkraft war, also die emotionale Debatte darum, dafür, dagegen, so richtig aufgeheizt das wird in Zukunft sicherlich das Thema Tierwohl sein.«der Satz ist ein ziemlicher Hammer. Klöckner beschwört damit die Erinnerung an einen jahrzehntelangen gesellschaftlichen Kampf herauf, der schließlich damit endete, dass eine CDUgeführte Bundesregierung im Angesicht der Katastrophe von Fu ku shi ma einen radikalen Umschwung in der Energiepolitik vollzog. An diesem Montag Anfang März aber verpufft Klöckners Hammersatz. Die drohende Pandemie überlagert alle anderen Themen. Und Julia Klöckner führt nicht weiter aus, wie dieser Satz eigentlich zu ihrer eigenen Politik passen soll. In Klöckners Amtszeit fiel die Entscheidung, Ferkel weitere zwei Jahre lang betäubungslos kastrieren zu dürfen. Im Streit um die tierquälerische Kastenstandhaltung von Muttersauen gab sie der Lobby nach und wollte erlauben, die Praxis noch weitere 17 Jahre anwenden zu können (der Bundesrat wird voraussichtlich diesen Freitag die Übergangszeit auf acht Jahre begrenzen). Das Töten von Eintagsküken sollte laut Koa li tions ver trag bis Mitte der Legislaturperiode be endet sein die Frist ist verstrichen, das Töten geht weiter. Es wäre ungerecht, so zu tun, als sei all dies allein Klöckners Schuld. Als Ministerin bewegt sie sich in einem politischen Umfeld, das ihr kaum Macht überlässt. Viele Zuständigkeiten für die Nutztiere sind Sache der Bundesländer, viele Auflagen, etwa für den Lebensmittelhandel und seinen Wettbewerb, betreffen letztlich EU-Recht. In Klöckners Fall kommt hinzu, dass ihre Bundestagsfraktion sie in puncto Tierwohl kaum unterstützt. Ähnlich wie ihr eigenes Ministerium ist auch die Unions frak tion von Lobbyinteressen geprägt. Die meisten Agrarpolitiker haben selbst konventionell betriebene Höfe oder vertreten die Belange entsprechender Gruppen. Dass Klöckner aktuell kein Bundestagsmandat hat, macht es ihr noch schwerer, die Abgeordneten für sich zu gewinnen. Bei Abstimmungen ist sie nie dabei. Nicht mal für ihr freiwilliges Tierwohllabel, dessen Einführung sie als Erfolg hätte verkaufen können, gibt es in der Fraktion eine Mehrheit. Klöckner hatte einst angekündigt, dass ihr Label im Laufe dieses Jahres im Handel sein solle. Nun heißt es unter CDU-Agrarpolitikern, dass der Bundestag es bis zur nächsten Wahl wohl nicht mehr verabschieden werde. Dieser Misserfolg wird aber nicht an der Fraktion hängen bleiben, sondern an Klöckner. Angezählt wirkt sie ohnehin. Der Verdacht, höheren Aufgaben nicht gewachsen zu sein, begleitet Klöckner schon länger. Nach der Niederlage gegen Malu Dreyer (SPD) bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2016 schwand in Klöckners eigenem Landesverband der Rückhalt für sie. Das Berliner Ministeramt war auch eine Art Rettungsinsel. Als mögliche Erbin von Angela Merkel aber, als die sie tatsächlich einmal galt, sieht sie heute niemand mehr. Gewogen und für zu leicht befunden, heißt es in der CDU. Wenn Klöckner nach der nächsten Bundestagswahl politisch noch irgendetwas anderes werden will als eine einfache Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz, müsste sie sich als Ministerin beweisen. Aber Klöckner findet sich in einer Lage wieder, in der nicht nur Tierschützer und Umweltverbände gegen sie demonstrieren, sondern im Streit um Düngemittelverordnung und Insektenschutz selbst die Bauern. Auch in der CDU muss man nicht lange suchen, um Leute zu finden, die über Klöckner schimpfen.»so etwas wie die betäubungslose Ferkelkastration hätte sie nie länger zulassen dürfen. Die politischen Ergebnisse des Ministeriums sind eine Katastrophe. Weil sie es nicht versteht«, sagt jemand aus ihrem eigenen Landesverband, der Klöckner seit Beginn ihrer Karriere kennt. Ein früherer Staatssekretär spricht wohlwollender über sie. Oftmals habe er von ihr noch nachts um zwei Mails zu Detailfragen erhalten. Im Gespräch zeichnet er das Bild einer Ministerin, die ihr Fachgebiet beherrschen will und durchdrungen hat. Ob Klöckner für das Tierwohl genauso brennt wie für die Digitalisierung der Landwirtschaft, bleibt dabei allerdings unklar. Warum hat Julia Klöckner bisher so wenig für das Wohl der Nutztiere erreicht? Vielleicht auch deshalb, weil es ihr an etwas fehlt, das sie beim politischen Gegner wahrscheinlich»ideologie«nennen würde. Jemand wie die Grünenpolitikerin Renate Künast schaffte in ihrer Zeit als Bundeslandwirtschaftsministerin womöglich auch deshalb mehr für das Tierwohl, etwa durch das Verbot der Käfighaltung für Legehennen, weil es an ihrem Kompass in dieser Frage niemals einen Zweifel gab. Was Klöckner bei diesem Thema wirklich umtreibt, ist dagegen schwer zu sagen. Man weiß nun, dass sie keine Blutwurst mehr isst, vielleicht aus Ekel, vielleicht aus Empathie. Aber was ist ihre innere Haltung gegenüber dem Nutztier, dem»mitgeschöpf«, wie sie es selbst gern nennt,»als Christdemokratin«? Wenn man Klöckners Vorgängern Aufnahmen von geschundenen Tieren gezeigt habe, Ilse Aigner etwa oder Christian Schmidt, sei echte Bestürzung zu spüren gewesen, ist aus dem Ministerium zu hören. Klöckner dagegen reagiere kühler auf Belege krassen Tierleids, typischerweise mit einem Satz wie: Na, schön ist das nicht. Wenn Klöckner in Sachen Tierwohl nun als Vorreiterin der Bewegung auftritt, dann vermutlich deshalb, weil sie eine»begnadete Kennerin der Stimmungslage«ist, wie eine Parteifreundin es ausdrückt. Die große Empörung über die Praktiken der Schlachtindustrie ist ein politisches Momentum, das Klöckner zu nutzen versucht. Die von ihr zuletzt im Zuge des Fleischgipfels beworbene Tierwohlabgabe wäre ein Kurswechsel und so ziemlich das Gegenteil von Freiwilligkeit. Den Punkt, dass eine Wende in der Nutztierhaltung durchaus mit der Wende in der Energiepolitik zu vergleichen ist, machte nach dem Gipfel vergangenen Freitag allerdings nicht Klöckner, sondern Barbara Otte-Kinast, die CDU-Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen:»Ähnlich einer EEG-Umlage müssen wir jetzt so frech sein und in die Richtung denken und prüfen, ob man analog zur EEG-Umlage diese Tierwohlabgabe auf den Weg bringt.«klöckner bleibt jetzt noch Europa. Im Rahmen der Ratspräsidentschaft, die Deutschland nun sechs Monate innehat, will sie ein EU-weites Tierwohllabel anstoßen, womöglich sogar ein verpflichtendes. Die Erwartungen daran dämpft sie im Vorfeld allerdings schon selbst: In diesem Halbjahr werde so ein Label sicher nicht kommen, sagt sie, dieser Prozess werde Jahre dauern. Vergangenen Montag fliegt sie nach Zagreb, um mit der Landwirtschaftsministerin von Kroatien den Stabwechsel der Ratspräsidentschaft zu zelebrieren. Zum Abschluss des Tages überreicht sie der Kroatin einen schweren Präsentkorb mit Spezialitäten aus den Bundesländern. Zwischen Weinflaschen, Salz und Räucherfisch findet sich auch ein Glas Würstchen. Lesen Sie auch im Ressort Streit, Seite 10: Eine Landwirtschaft ganz ohne Tiere geht das? A A
3 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 POLITIK 3 Zu Beginn dieser Woche meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), weltweit seien eine halbe Million Menschen durch die Covid-19-Pandemie gestorben. Zugleich gaben die Berliner Verkehrsbetriebe bekannt, täglich fänden in den Bussen und Bahnen der deutschen Hauptstadt eine halbe Million Fahrten ohne Maske statt. Ein Viertel der Passagiere ignoriere die Maskenpflicht, trotz Bußgeld, Tendenz steigend. Nie zuvor gab es so viel Gleichzeitigkeit in der Welt wie während dieser Krise und doch leben die Menschen nicht mehr im gleichen Jetzt. Die täglichen Corona-Zahlen beziffern vielmehr das Aus ein an der drif ten der Welt in gegensätzliche Realitäten und Covid-19-Gefühlszonen. In Deutschland macht sich der Eindruck breit, mit dem Virus einigermaßen durch zu sein. Einzelne Ausbrüche wie in Neukölln oder Gütersloh ändern daran nichts. In weiten Teilen der Welt jedoch weisen die ominösen Kurven, die Neuinfektionen, R-Werte und Todeszahlen abbilden, in diesen Tagen steil nach oben. Während der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ab der kommenden Woche maskenfreie Kulturveranstaltungen in Aussicht stellen kann, steht der Höhepunkt der Pandemie global erst noch bevor. In den vergangenen zwei Wochen haben doppelt so viele Länder einen Anstieg der Fallzahlen gemeldet wie einen Rückgang. Die Schwelle von 10 Millionen Infizierten wurde überschritten, seit Mitte Juni liegen die täglichen Neuinfektionen weltweit bei über Die Geografie der Seuche wandelt sich rapide. Während die Lage in den Epizentren der ersten Phase Wuhan, Norditalien, Spanien, New York weitgehend unter Kontrolle ist, breitet sich das Virus nun gleichzeitig über weite Teile von Lateinamerika, Nordamerika, Asien und Afrika aus. In den USA trifft es massiv den Süden und den Westen. In Afrika hatte es hundert Tage gedauert, bis die Schwelle von registrierten Fällen überschritten wurde. Bis zur Verdoppelung der Zahl waren es nur 19 Tage. Indien mit seinen 1,3 Mil liar den Einwohnern liegt nun bei den nachgewiesenen Fällen an vierter Stelle nach den USA, Brasilien und Russland.»Das Schlimmste haben wir leider noch vor uns«, warnte diese Woche der Chef der WHO. Diese Pandemie ist ein globaler politischer Stresstest. Der Zwischenstand: Länder mit fähigen, verantwortungsvollen Regierungen (und genügend Ressourcen) kommen vergleichsweise gut durch. Staaten mit schwachen Institutionen und inkompetenter oder korrupter Führung müssen Sta gna tion, Instabilität oder Verarmung befürchten. Und dies gilt so die vielleicht wichtigste Erkenntnis dieser Monate unabhängig davon, ob ein Land dem reichen Norden oder dem armen Süden angehört (siehe das Debakel der USA), ob es ein demokratisches oder autoritäres politisches System hat. Staatliche Handlungsfähigkeit hängt vor allem an einem Faktor: Alle Gesellschaften, die Covid-19 erfolgreich bekämpft haben, zeichnen sich durch großes öffentliches Vertrauen in ihre Institutionen aus. Noch etwas wird durch die Eskalation dieser Tage klar: Weil sich eine Pandemie nicht in einem Land allein besiegen lässt, ist es wichtiger denn je, die weniger begünstigten Regionen der Welt nicht aus dem Blick zu verlieren. JÖRG LAU Das Virus der anderen In Deutschland glauben viele, die Corona-Krise sei überwunden. Dabei geht sie in vielen Weltregionen jetzt erst richtig los USA Nigeria Indien Chile Fallzahlen 2.6 Mio Einwohner 326 Mio. 18,7 Mio. 202 Mio. 1,35 Mrd. ZEIT-Grafik/Quellen: covid19.who.int; nytimes.com; data.worldbank.org (2018) Zu früh wieder geöffnet? Und der Präsident kauft Wein Die Ärzte arbeiten woanders Es geht auch anders In den USA leben nur vier Prozent der Weltbevölkerung, aber mit mehr als 2,6 Millionen Infizierten zählt das Land derzeit ein Viertel aller weltweit bislang bestätigten Covid- 19-Fälle. Die Gesundheitsbehörde Center of Disease Control geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen sogar 24-mal so groß sein könnte. Vor allem in den konservativen Bundesstaaten im Süden der USA sind die Infektionen zuletzt stark gestiegen. Dort hatten die republikanischen Gouverneure auf Anraten von Präsident Donald Trump Geschäfte, Betriebe und Freizeiteinrichtungen sehr früh wieder geöffnet. Das schien nicht völlig abwegig zu sein, denn in diesen Staaten gab es zu Beginn der Epidemie erheblich weniger Infizierte als etwa in New York. Florida verzeichnet momentan die meisten neuen Fälle. Allein am Samstag vergangener Woche waren es knapp Die Corona-Test-Center sind völlig überfordert, vor einer Drive-through-Station in Jacksonville mussten die Menschen bis zu sechs Stunden warten. Dennoch spielte Gouverneur Ron DeSantis die Krise herunter: Die ansteigenden Zahlen seien lediglich auf die vielen jungen Leute zurückzuführen, die sich nicht an die Abstandsregeln hielten. Die Stadt Jacksonville hat unterdessen eine Masken pflicht verhängt, was nicht ohne politische Bedeutung ist. Denn ausgerechnet dort will Donald Trump im August auf einer Großveranstaltung die Nominierung seiner Partei zum Präsidentschaftskandidaten annehmen. Die Stadt Charlotte in North Carolina, wo der eigentliche Parteitag der Republikaner stattfindet, hatte Trump strenge Gesundheitsauflagen gemacht, an die dieser sich nicht halten wollte. KERSTIN KOHLENBERG Vermutlich haben Urlauber das Virus eingeschleppt, wohlhabende Landsleute, die aus den Skiferien in Europa nach Hause zurückkehrten. Sie steckten ihre Haushälterinnen an, ihre Fahrer, ihre Gärtner. Mittlerweile frisst sich Corona durch ganz Lateinamerika, am gierigsten durch die Slums und die vernachlässigten Ränder der Gesellschaft. Naheliegend erscheint das in Brasilien und Mexiko, wo die Präsidenten die Gefahr lange geleugnet haben. Doch warum kämpft ausgerechnet Chile so schwer mit der Krise? 9000 Menschen sind dem Virus dort bislang zum Opfer gefallen prozentual betrachtet sind das mehr Tote als in Brasilien. Die schweren sozialen Unruhen im vergangenen Jahr haben gezeigt, wie tief die Kluft ist, die sich zwischen der neoliberalen Regierung von Präsident Sebastián Piñera und Regierten aufgetan hat. Der inzwischen zurückgetretene Gesundheitsminister erklärte in einem Interview, er habe keine Ahnung gehabt, wie groß das Ausmaß von Armut und Enge in einigen Quartieren der Hauptstadt Santiago sei. Die Erkenntnis, dass Homeoffice für Tagelöhner keine Option ist, hat die Führung kalt erwischt. Der Staat versagt dabei, die Armen während des Lockdowns auch nur geringfügig zu unterstützen. Oft sehen sich die Menschen vor die unmögliche Wahl gestellt, eine Ansteckung zu riskieren oder zu hungern. Viele Unternehmen hielten den Betrieb trotz Pandemie lange aufrecht. Mittlerweile ist die Ausgangssperre verschärft worden, Verstöße werden mit bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet. Chiles Präsident Piñera sah man unterdessen Anfang der Woche beim Einkauf in einer Vinothek. KARIN CEBALLOS BETANCUR Für Subsahara-Afrika hatte die Corona-Krise am 25. Februar auf dem Flughafen von Lagos begonnen. Ein Italiener, Mitarbeiter einer Firma in Nigeria, war infiziert von seinem Heimaturlaub aus Mailand zurückgekommen. Keine Panik, alles unter Kontrolle, erklärten die nigerianischen Behörden was zunächst auch stimmte. Dutzende Mediziner standen längst an den Flughäfen bereit, mehrere Testlabore waren eingerichtet. Nigeria schien alles richtig zu machen. Vier Monate später ist das Land ein Zentrum der Corona-Krise in Afrika. Über bestätigte Infektionen verzeichneten die Africa Centres for Dis ease Control Anfang dieser Woche, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Was sich in Nigeria anbahnt, gilt für den gesamten Kontinent: Afrikas Staaten hatten dank guter Frühwarnsysteme den Ausbruch der Pandemie deutlich verlangsamt. Doch jetzt steigt die Kurve in immer mehr Ländern immer steiler an. Nur wenige sind gerüstet, um das schlimmste Szenario der WHO zu verhindern: bis zu 44 Millionen Infizierte und Tote in diesem Jahr. Auch Nigeria, das mit rund 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Afrikas, hat nie ausreichend in sein Gesundheitswesen investiert. Die Versorgung in den Armenvierteln ist meist katastrophal. Die Reichen flogen bislang zur Behandlung ins westliche Ausland, wo sich oft ausgewanderte nigerianische Ärzte und Pfleger über sie beugten. Laut WHO fehlen dem Land Pflegekräfte. Die, die geblieben sind, kämpfen mit Streiks immer wieder für höhere Gehälter oder bessere Ausrüstung zuletzt im Juni mitten in der Corona-Krise. ANDREA BÖHM Das Unheimlichste an der Corona-Epidemie in Indien ist die Ungewissheit über ihr Ausmaß und ihre Dynamik. Anfang der Woche lag die Zahl der bestätigten Fälle bei knapp , die der Todesopfer bei nicht ganz Das sind im Vergleich mit viel kleineren europäischen Ländern immer noch überschaubare Opferzahlen. Aber die Ausbreitung der Seuche ist ungebrochen. Dabei ist die Wucht, mit der Covid-19 einzelne indische Regionen trifft, eindeutig abhängig von der Qualität ihrer Regierung und Verwaltung. In der Hauptstadt Delhi etwa ist die Lage trotz überdurchschnittlicher Klinikkapazitäten besonders kritisch. Regional- und Zentralregierung werden von verfeindeten Parteien geführt und stehen in permanenter Konkurrenz zueinander. In einem Klima des Misstrauens wurden offenbar längerfristige Ziele wie die Verbesserung der Kontakt verfolgung vernachlässigt. Als Musterregion der Corona-Bekämpfung gilt dagegen der südwestindische Bundesstaat Kerala: Kaum hatte im Januar die Corona- Krise die chinesische Provinz Wuhan erfasst, war den regionalen Behörden klar, dass indische Rückkehrer aus China das Virus mit nach Hause bringen würden. Mit Tests und Quarantänemaßnahmen wurde die Ausbreitung unter Kontrolle gehalten. Entscheidend aber dürfte sein, dass Kerala überhaupt ein kompetent regierter Bundesstaat ist. Es gibt praktisch keine Analphabeten, und die allgemeine Gesundheitsversorgung ist deutlich besser als im Rest des Landes. Keralas Bürger sind besser aufgeklärt und kooperationswilliger und das ist für den Erfolg der Seuchen-bekämpfung entscheidend. JAN ROSS Foto: Sergio Flores/Reuters Foto: Ivan Alvarado/Reuters Foto: Olukayode Jaiyeola/NurPhoto/dpa Foto: Adnan Abidi/Reuters In Austin wird ein Mann auf Corona getestet Covid-Patient in einem Krankenhaus in Santiago Eine Helferin in Lagos Angehörige bei einer Bestattung in Delhi
4 Abb.: Airbus (o.); kl. Foto (u., Archiv): Fabrizio Bensch/Reuters 4 POLITIK Tödliche Fracht: Die Heron TP kann mit Luft-Boden-Raketen ausgestattet werden 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Schutzengel oder Killermaschine? Nach jahrelangem Streit will die Bundesregierung künftig bewaffnete Drohnen einsetzen. Was ein Bundeswehrpilot von seinen Einsätzen erzählt und was ihm Sorge bereitet VON CATERINA LOBENSTEIN Martin Zeitler sieht die Welt, wie andere sie nicht sehen. Die rotbraunen Dünen der malischen Wüste, die schneebedeckten Gipfel Afghanistans. Er sieht Städte, die sich an riesige Berghänge schmiegen, und Dörfer, die wirken, als hätte jemand ein paar einzelne Hütten in die Landschaft gestreut. Er sieht Straßen und Schotterpisten, die sich wie feine Linien durch die Hügel ziehen. Martin Zeitler sieht die Welt von oben. Wenn er näher heranzoomt, erkennt er, wie Lastwagen und Pick-ups über die Pisten holpern, dann erblickt er Wohn- und Krankenhäuser, Schulen und Moscheen, hochaufgelöst mithilfe elektrooptischer Sensoren und präziser Infrarotkameras. Zeitler kann dann beobachten, wie kleine Kinder spielen, wie verschleierte Frauen spazieren gehen oder gebückte Männer ihr Feld bestellen. Das sind die guten Tage. An schlechten Tagen sieht Zeitler Gestalten, die nur auf den ersten Blick wie Zivilisten anmuten. Die keine Uniform tragen, aber Waffen und Munition. Die sich in entlegenen Höhlen verschanzen und von dort ihre Angriffe planen. Sie vergraben Sprengfallen auf wichtigen Versorgungswegen, sie verstecken sich schwer bewaffnet am Straßenrand, um feindlichen Konvois aufzulauern jenen Konvois, die Martin Zeitler schützen soll. Mit etwas Glück kann er seine Leute rechtzeitig warnen. Manchmal aber muss er dabei zusehen, wie sie angegriffen werden. Wie Raketen explodieren und Staub aufwirbelt, wie Fahrzeugteile zerbersten, wie Menschen sterben. Zeitler kann das alles live verfolgen. Eingreifen kann er nicht.»solche Situationen habe ich zuhauf erlebt«, sagt er.»das sind Momente, in denen man sich wünschen würde, man hätte eine Bewaffnung dabei.«zeitler aber kann nicht schießen, nicht einmal, wenn es sich um Nothilfe handeln würde. Er ist zum Zuschauen verdammt. Er wirkt, als komme er damit klar. Manche seiner Kameraden aber hat das krank gemacht. Zeitler, 37 Jahre alt, Oberstleutnant der Luftwaffe, ist Drohnenpilot. Er steuert die unbemannten Flugkörper, eingesetzt von der Bundeswehr in Afghanistan und im westafrikanischen Mali. Zeitler heißt eigentlich anders, er will, wie die meisten Soldaten, nicht mit seinem Namen in der Zeitung erscheinen. Mitte Juni sitzt er vor seinem Laptop und winkt in die Kamera. Er trägt an diesem Tag keine Uniform, sondern ein Ringelshirt, er sitzt nicht in seiner Heimatkaserne in Norddeutschland, sondern in einem Hotel in Köln, das er nicht verlassen darf. Zeitler steht unter Quarantäne, um sicherzugehen, dass er nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Wenn er wieder rausdarf, wird er nach Masar-i Scharif im Norden Afghanistans fliegen, ins Camp Marmal, eines der größten Feldlager der deutschen Truppen im Ausland. Zeitler nennt das Camp seinen»zweitwohnsitz«. Es ist sein 16. Einsatz in Afghanistan. Die Bundeswehr bildet dort als Teil der Nato- Operation Resolute Support einheimische Sicherheitskräfte aus. Zeitlers Aufgabe ist es, die Bodentruppen der Afghanen und der Nato-Partner aus der Luft zu unterstützen. Bislang heißt das: Aufklärung betreiben, also Angreifer erspähen. Es heißt nicht: Angreifer bekämpfen. Bundeswehrdrohnen sind unbewaffnet, diese Regelung galt lange als unumstößlich. Nun aber wird sie kippen. Die Unionsparteien drängen schon seit Jahren darauf, die Drohnen der Bundeswehr mit Waffen auszustatten, um das Leben deutscher Soldaten und ihrer Verbündeten besser zu schützen. Mit bewaffneten Drohnen, so sagen sie, hätte es weniger tote Bundeswehrsoldaten am Hindukusch gegeben. Die SPD hingegen hat stets die Gefahren dieses Schrittes betont: Was, wenn bewaffnete Drohnen nicht in erster Linie Leben retten, sondern die Hemmschwelle zum Töten senken? Wenn durch sie die Bereitschaft, in den Krieg zu ziehen, steigt? Was, wenn Deutschland in einen Drohnenkrieg schlittert, wie ihn die USA seit Langem führen, unter Missachtung des Völkerrechts, mit gezielten Hinrichtungen und Tausenden zivilen Toten? Und was, wenn das alles nur der Anfang ist? Wenn der Einsatz unbemannter Drohnen eine Entwicklung anstößt, an deren Ende ein dystopisches Szenario steht: Eigenständig handelnde Roboter schießen auf Menschen. Der Streit währte jahrelang. Bis zum vergangenen Wochenende. Da signalisierte die SPD plötzlich Zustimmung. Damit ist die Bewaffnung deutscher Drohnen so gut wie beschlossen. Was auf den ersten Blick wie ein Tabubruch der Sozialdemokraten wirkt, erscheint bei näherer Betrachtung eher wie ein logischer Schritt. Denn die SPD hat zwar laut über den Einsatz von Kampfdrohnen geschimpft, aber still dabei zugesehen, wie die Union und die Bundeswehr diesen Einsatz in den vergangenen Jahren gründlich vorangetrieben haben. Wie gründlich, das kann man in Jagel sehen, einem Dorf in Schleswig-Holstein, nicht weit von der Ostsee entfernt. Hinter dem Ortsausgang, zwischen stoppeligen Feldern, beginnt ein umzäuntes Areal mit grasüberwucherten Hangars und hohen Wellblechhallen. Start- und Landebahnen durchschneiden das Gelände, Kampfjets donnern über das Rollfeld, ein Tower thront über der Ebene. Hier liegt der Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51, der größte Militärflughafen Deutschlands. Mehr als 1500 Soldaten und Soldatinnen sind hier stationiert. In Jagel werden die Drohnenpiloten der Bundeswehr ausgebildet, mithilfe von Flugsimulatoren. Für die Drohnen des Typs Heron 1, mit denen Martin Zeitler seit Jahren Einsätze fliegt. Aber auch für das Nachfolgemodell, eine Drohne namens German Heron TP. Sie ist 14 Meter lang und mehr als vier Tonnen schwer. Sie kann nicht nur höher und länger fliegen als ihre Vorgängerin, sie verfügt auch über eine Vorrichtung, an der sich Raketen und Lenkbomben anbringen lassen. Mit der Heron TP könnte Martin Zeitler nicht mehr nur Angreifer erspähen, er könnte mit einem entsprechenden Mandat auch auf sie schießen. Den Leasingvertrag für die Heron TP hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits im Jahr 2018 eingetütet: fünf Exemplare für die Bundeswehr, zu liefern im Sommer 2020 von einer israelischen Firma. Ende 2019 dann stellte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den deutschen Soldaten in Afghanistan in Aussicht, die neuen Drohnen nicht nur zu beschaffen, sondern auch möglichst schnell zu bewaffnen. Demnächst sollen die ersten Heron-TP-Drohnen ausgeliefert und von Israel aus in die deutschen Einsatzgebiete gebracht werden. Bis 2027 will die Bundesregierung sogar eigene Kampfdrohnen anschaffen, die bewaffnungsfähigen»eurodrohnen«. Etwa 20 davon sollen laut der Bundesregierung dann im Fliegerhorst Jagel stationiert werden. Schon jetzt seien»kräftige Investitionen«in den Standort geplant, berichtete die Lokalpresse. Bis zu 250 Millionen Euro seien allein für die Stationierung der Drohnen eingeplant. Dass die SPD ihren Kurs geändert hat, dürfte einer seits mit dem moralischen Druck zusammenhängen, den sie vonseiten der Bundeswehr und ihrer Verbände zu spüren bekam: Keiner in der Partei will sich vorwerfen lassen, der nächste gefallene deutsche Soldat gehe auf das Konto der SPD. Andererseits könnte auch der Fliegerhorst Jagel eine Rolle gespielt Alles im Blick: Drohnenpiloten im Einsatz haben: Während die Politiker in Berlin noch über das Für und Wider der Bewaffnung stritten, wurden hier Fakten geschaffen. Fakten, die sich politisch kaum mehr wegdiskutieren lassen.»warum sollte die Bundeswehr für viel Geld bewaffnungsfähige Drohnen anschaffen und diese Drohnen dann nicht bewaffnen?«, fragt Anja Dahlmann.»Das wäre aus Sicht der Regierung massive Geldverschwendung.«Dahlmann ist Politologin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), die die Bundesregierung in außenund sicherheitspolitischen Fragen berät. Sie erforscht die möglichen Gefahren unbemannter Waffensysteme. Auch jenes Schreckensszenario, vor dem sich viele Drohnen-Kritiker besonders fürchten: dass ferngesteuerte Flugkörper irgendwann zu autonomen Systemen mutieren könnten, die nicht mehr auf der Grundlage menschlicher Befehle agieren, sondern eigenständig Ziele erspähen und im Zweifelsfall auf sie schießen. Vor dem Fliegerhorst in Jagel haben sie schon mehrmals protestiert, Aktivisten und Friedensbewegte, die auf bunten Plakaten vor»killerdrohnen«warnen und Roboterkriege heraufbeschwören. Auch als das Verteidigungsministerium im Mai zu einem Drohnen-Symposium lud, protestierten Aktivisten vor dem Berliner Bendlerblock. Die Politologin Dahlmann hält deren Schreckensszenarios für überzogen, aber nicht für vollkommen unbegründet.»langfristig könnte die Drohne ein Einstieg in autonome Waffensysteme sein«, sagt sie. Das liege unter anderem an ihrer störanfälligen Fernsteuerung: Das System, das die Daten vom Steuerungsmodul hinauf zur Drohne übertrage, könne relativ einfach gehackt werden, sagt Dahlmann. Außerdem koste der Datentransfer wertvolle Zeit. Deshalb sei der Anreiz groß, die Drohne so weiterzuentwickeln, dass sie mithilfe künstlicher Intelligenz eigenständig Entscheidungen trifft und damit die Fernsteuerung überflüssig wird. Mit allen ethischen und völkerrechtlichen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt:»roboter wissen nicht, was es bedeutet, einen Menschen zu töten, für sie ist der Mensch ein Datenpunkt«, sagt Dahlmann.»Deshalb verletzen autonome Waffen die Würde des Menschen, und deshalb ist menschliche Kontrolle unabdingbar.«dahlmann warnt jedoch davor, das Potenzial künstlicher Intelligenz zu überschätzen. Anders als beim autonomen Fahren, wo selbstlernende Maschinen mit den Bewegungsdaten von Millionen Verkehrsteilnehmern gefüttert werden, sei längst nicht klar, woher die Daten, auf deren Basis autonome Waffensysteme das Kämpfen lernen könnten, überhaupt kommen sollen und wer deren Nutzung reguliert. Wie unrealistisch das Szenario einer eigenständig agierenden Drohne zum heutigen Zeitpunkt ist, kann man in Jagel sehen, in einer Halle, die am Rand des Rollfelds steht. Hier, in olivgrün lackierten fensterlosen Containern, werden die Luftaufnahmen der deutschen Drohnen in Mali ausgewertet. In einem der Container steht ein Soldat vor einem Bildschirm. Er klickt mit der Maus auf Luftaufnahmen: ein versteckter Höhleneingang, mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Ein Pick-up, der einen bizarren Schatten wirft. Erfahrene Analysten können anhand der Form des Schattens erahnen, dass auf der Ladefläche des Pick-ups ein Geschütz aufgebaut ist. Computer können das bislang nicht.»wir müssen da realistisch bleiben«, sagt Anja Dahlmann.»Nach der Heron TP kommt nicht automatisch der sogenannte Killerroboter. Für die Politik gibt es da schon noch Möglichkeiten, die Notbremse zu ziehen.«kritiker der Kampfdrohnen müssten dafür jedoch, statt unentwegt vor dystopischen Horrorszenarios zu warnen, auch auf die Regulierung von Technologien drängen, die längst im Einsatz sind. Das US-amerikanische System Skynet zum Beispiel, eine Datenbank, die dabei hilft, Todeslisten für Drohnenangriffe zu erstellen. Das System trackt Handydaten, und wessen Bewegungsprofil dem eines Terroristen ähnelt, der kann schnell auf einer der Listen landen. Der Drohnenpilot Martin Zeitler sagt:»wir wollen keine autonomen Systeme, bei denen der Mensch aus dem Loop raus ist. Wir wollen immer, dass in letzter Instanz der Mensch die Entscheidung trifft.«er sagt aber auch, dass Deutschland mit anderen Staaten mithalten müsse und sich die Bundeswehr, so wie alle Armeen, im Sog einer Rüstungsspirale befinde. Tatsächlich verfügen derzeit mehr als 40 Staaten über bewaffnete Drohnen. Am Montag vergangener Woche erscheint Zeitler noch einmal vor seiner Kamera. Er hat die Ärmel seiner sandbraunen Uniform hochgekrempelt. Vor ein paar Tagen ist er im Camp Marmal gelandet, im Norden Afghanistans. Die ersten Drohnenflüge hat er schon hinter sich, er sei über Kundus geflogen, sagt er. Jeden Kreisverkehr, jeden Marktplatz habe er wiedererkannt. Dann erzählt er von einem Video, das er auf You Tube gefunden habe. Man könne darauf erkennen, wie eine von Taliban-Kämpfern gesteuerte Drohne, beladen mit rund zehn Kilo Sprengstoff, ein Camp der afghanischen Armee zerstört. Die Drohne, von der Zeitler spricht, ist kein großer Flugkörper wie die Heron TP, sondern ein handelsüblicher Oktokopter. Für seine Beschaffung braucht es kein Mandat. Man kann ihn bei Amazon kaufen. Doch über diese Killermaschinen redet kaum jemand. A A wollen immer, dass in letzter Instanz der Mensch die Entscheidung trifft«
5 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 POLITIK 5 Der Staatspräsident schreitet durch grünes Gebüsch, hinter ihm sein Premierminister: Emmanuel Macron hat Sinn für Symbolik. Die Aufnahme ist am vergangenen Montag im Garten des Élysée-Palasts entstanden. Tags darauf war sie an Frankreichs Kiosken und im Netz zu sehen. Der Staatschef will ergrünen, so sollte die Botschaft lauten. Jeden Montag sind die beiden zum Mittagessen verabredet, doch diesmal hatte Macron seinen Premier Édouard Philippe zuvor noch zu einem Termin im Freien gebeten: Zusammentreffen mit»den 150«. Das ist die per Losverfahren zusammengesetzte»bürgerversammlung für das Klima«, mit der Emmanuel Macron im vergangenen Herbst auf die Protestbewegung der Gelbwesten reagiert hatte und die jetzt ein 460 Seiten umfassendes Papier veröffentlicht hat. Das ambitionierte Programm umfasst Landwirtschaft, Verkehr, Bauwesen, Wettbewerbs- und Vergaberecht und vieles mehr. Macron beeilte sich zu versichern, er werde alles»ohne Filter«dem Parlament, der Regierung sowie den Gebietskörperschaften weiterleiten, mit Ausnahmen: kein Tempolimit von 110 Stundenkilometern auf den Autobahnen, keine Dividendensteuer und keine Aufnahme von Umweltzielen in die Präambel der Verfassung. Wohl aber müsse die Verfassung ökologisch umgeschrieben werden, weshalb er sich ein Referendum vorstellen könne oder auch zwei. Festgelegt hat sich Macron da nicht; Referenden sind riskant, und 2022 finden Präsidentschaftswahlen statt. Er wolle sich neu erfinden, das hatte der Präsident wiederholt angekündigt. Seit dem vergangenen Sonntag hat er allen Grund dazu. Im zweiten Durchgang der landesweiten Kommunalwahlen erlebten die Kandidaten seiner Partei La République en Marche (LReM) ausgerechnet in den Großstädten ein Desaster. Dort, wo Macron in der Präsidentschaftswahl vor drei Jahren die meisten Stimmen bekam, erzielte stattdessen die grüne Partei»Europe Écologie Les Verts«(EELV) einen Durchbruch. Unter den Städten mit mehr als Einwohnern zählen nur Le Havre und Angers noch zur Macronie. In den Metropolen Lyon, Bordeaux und Straßburg setzten sich die EELV-Kandidaten durch, meist im Bündnis mit Linken. In Paris konnte die Sozialistin Anne Hidalgo mit offensiver Umweltpolitik ihr Amt als Bürgermeisterin verteidigen. In Marseille wiederum gelang es einem in den Stadtvierteln gewachsenen linksgrünen Bündnis, die konservative Favoritin zu schlagen. Wahrscheinlich wird der dortige Stadtrat am kommenden Samstag die feministische Armenärztin Michèle Rubirola mit dem Bürgermeisteramt betrauen. Mag sich das grüne Phänomen auch auf die größeren und großen Städte beschränken, lässt es sich dennoch Foto (Ausschnitt): Christian Hartmann/ Reuters Verloren im Grün Frankreichs Präsidenten laufen die Wähler weg jetzt versucht er es mit Ökologie VON GERO VON RANDOW Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Premier Édouard Philippe im Élysée-Garten nicht mit dem üblichen Abwehrvokabular von urbanen Eliten oder Hipstern wegerklären. Sie allein brächten nicht dermaßen viele Stimmen zusammen. Es kommen andere Faktoren hinzu. Einer ist Corona: Seit Ausbruch der Krise diskutiert Frankreichs Öffentlichkeit über Nachhaltigkeit und Solidarität, Ernährung und Natur, grüne Themen also. Die Pandemie dürfte überdies zur niedrigen Wahlbeteiligung beigetragen haben. Rund sechs von zehn Wahlberechtigten blieben den Wahllokalen fern, ein Negativrekord. Da aber die Grünen und ihre Partner besser mobilisieren können als andere, war die geringe Wahlbeteiligung für sie von Vorteil. Außerdem konnte LReM nicht wie 2017 von einer»haut ab!«-stimmung gegen die Regierung profitieren, schließlich stellt sie derzeit die Regierung. Zur Niederlage der LReM hat weiterhin beigetragen, dass ihr Misserfolg absehbar war, und wer wählt schon sichere Verlierer. Nicht einmal in die Stadtverordnetenversammlung schafften es Macrons Spitzenkandidaten in Paris und Marseille. Unzufrieden muss auch die bürgerliche Rechte sein (Les Républicains), sie bleibt zwar in den kleinen und mittleren Städten verankert, aber stagniert. Ma rine Le Pens Partei wiederum, die derzeit Rassemblement National heißt, konnte im südfranzösischen Perpignan (ca Einwohner) das Bürgermeisteramt ergattern, aber nur mit betont bürgerlichem, unpolemischem Auftreten. In Marseille verlor die Partei überraschenderweise ihren wichtigsten Bezirk, insgesamt konnte sie ihre raren Bastionen knapp halten. Die erhoffte Präsenz in der Fläche bleibt aus. Gut möglich dennoch, dass Marine Le Pen es 2022 in die Stichwahl schafft. Wer immer dann gegen sie antritt, hat beste Aussichten, ins Élysée einzuziehen. Das muss nicht notwendigerweise Macron sein. Eine gemäßigte linksgrüne Kandidatin hätte ebenfalls Chancen, etwa Anne Hidalgo, die Siegerin von Paris. Auch ein Michèle-Rubirola-Effekt wie in Marseille kommt infrage: dass im Verlauf der kommenden Auseinandersetzungen (um die Gesundheits-, Umwelt- und Rentenpolitik) eine Persönlichkeit erscheint, die von einer basisdemokratischen Welle getragen wird. Ein Szenario für eine Konkurrenz von rechts kursiert ebenfalls: Macrons Premierminister Philippe wirft irgendwann das Handtuch (etwa wenn ihm alles zu grün wird), verständigt sich mit dem weniger verbohrten Flügel der bürgerlichen Rechten und strebt selbst das höchste Amt an. Schließlich war es Philippe, der am Sonntag Le Havre gewann, gegen den Trend. Wenn nun Macron demnächst wie erwartet die Regierung umbildet, soll er dann seinen populären Premier halten oder entlassen? Der kann ihm sowohl in Paris als auch von Le Havre aus gefährlich werden. Doch das ist Taktik. Die strategische Frage lautet: Wie grün kann, muss, will Macron bis 2022 werden? Torten der Wahrheit VON KATJA BERLIN Was uns dazu bringt, auch weiterhin eine Maske zu tragen Masken schützen die Allgemeinheit. Masken entlasten das medizinische Personal. Masken verringern deutlich das Risiko, die eigenen Kinder im Herbst weiterhin selbst unterrichten zu müssen! Wann sich Deutsche brennend für die Herkunft interessieren bei Straftätern bei ihrem Schnitzel Berichtigung In unserem Doppelporträt über Ursula von der Leyen und Angela Merkel in der vergangenen Ausgabe der ZEIT ist uns leider ein Fehler unterlaufen: Die EU- Ratspräsidentschaft dauert ein halbes Jahr, nicht ein Jahr. DZ ANZEIGE THE 5 new PLUG-IN-HYBRID. BMW 530e: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 2,1 1,9; CO2-Emission in g/km(kombiniert): 47 43; Stromverbrauch in kwh/100 km(kombiniert): 15,9 14,9. Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. Voraussichtlich verfügbar ab November 2020.Technische Daten, Angaben zu CO2-Emission, Verbrauch, Effizienzklasse und Fahrzeugpreis sind vorläufig, Änderungen sind vorbehalten. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
6 6 POLITIK 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Jetzt aber! Schon zweimal hat die CSU in ihrer Geschichte sich um das Kanzleramt bemüht, beide Male ging es schief. Hat Markus Söder bessere Chancen? VON MATTHIAS GEIS ANZEIGE Sie wollten, wurden es aber nicht: Die CSU- Politiker Franz Josef Strauß (oben) und Edmund Stoiber Er weiß noch nicht, was er wollen soll: Markus Söder Reporter gesucht(m/w/d) Storiesschreiben,dienachhallen.Etwasbewegen.VondenBestender Branchelernen.SicheinJahrohneKompromissedemSchreibenwidmen. IdealismusundAbenteuer.DuhastersteErfahrungenimJournalismus gesammelt,jetztwillstduvorankommen,alsmensch,alsautor:in. Bist du bereit für die Reportageschule in Reutlingen? Jetzt bis zum 15. August bewerben reportageschule.de Der eine wollte lieber»eine Ananas-Farm in Alaska«betreiben, der andere eher»trainer von Bayern München«werden. Jahrelang dementierten die CSU- Vorsitzenden Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber jegliches Interesse an einer Kanzlerschaft. Als»Gegenstand inneren Horrors«beschrieb Strauß die bloße Vorstellung.»Ich bin nicht Kanzlerkandidat, und ich werde es auch nicht«, wehrte sich Stoiber. Strauß kandidierte 1980, Stoiber Bei allem Gerede hat Strauß nie Zweifel aufkommen lassen, dass er sich als Bestbesetzung für das bundespolitische Spitzenamt sah. Und Stoiber wollte das Amt erobern, das Strauß verpasst hatte, um endlich aus dem Schatten seines großen Mentors zu treten. Zwanzig Jahre später sagt jetzt auch Markus Söder:»Ich bin nicht Kandidat.«Zwei vergebliche Anläufe auf das Kanzleramt habe die CSU unternommen. Dabei werde es bleiben. Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise versichert Söder seinen Anhängern:»Hier stehe ich als Ministerpräsident. Ich kann nicht anders. Und ich will auch nicht anders.«söder, so behaupten manche, die ihn gut kennen, sei als CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident dort angekommen, wo er immer hingewollt habe. Zudem gibt er sich überzeugt, dass die Deutschen Bayern lieben, aber keinesfalls von einem Bayern regiert werden wollen. Doch seit das Corona-Management, inklusive dessen gelungener Inszenierung, Söder zu bundesweiter Popularität verholfen hat und er im demoskopischen Kampf um die Kanzlerkandidatur die Konkurrenz deklassiert, ist die Debatte um seine Perspektiven nicht mehr totzukriegen. Damit stellt sich die Frage neu: Ist die Lehre aus den beiden vergeblichen CSU-Anläufen so verheerend, dass sich Söder unter keinen Umständen auf einen weiteren Versuch einlässt? Oder sind die Aussichten auf eine Kanzlerkandidatur heute nicht doch so vielversprechend, dass er am Ende antreten wird? Kanzlerambitionen eines CSU-Politikers sind per se eine diffizile Angelegenheit. Denn die CSU ist eben die kleine, auf Bayern beschränkte Schwesterpartei, die ihren bundespolitischen Einfluss nur im Bündnis mit der CDU gewinnt. Der natürliche Anspruch auf die Kanzlerkandidatur und damit auf die Führung der Republik liegt bei der größeren Schwester. Deren Vorrecht muss erst gebrochen werden, bevor ein CSUler überhaupt antreten kann. Einvernehmlich, ohne ein Gemetzel in den Reihen der Union, ist das nicht zu haben. Helmut Kohl war der Erste, der dies leidvoll erfahren hat. Obwohl der CDU-Vorsitzende 1976 den Machtwechsel nur knapp verpasste, begann Strauß noch am Wahlabend mit der Demontage: Kohl fehlten»die politischen, geistigen und charakterlichen Voraussetzungen«, um jemals Kanzler zu werden. Damit setzte Strauß den Ton für die kommenden Jahre. Zerrieben zwischen seinem brutalen bayerischen Konkurrenten und dem schneidend-brillanten Amtsinhaber Helmut Schmidt, verzichtete Kohl 1980 auf eine erneute Kandidatur und brachte stattdessen Ernst Albrecht ins Spiel. Doch mit der offenen Drohung, man werde die Einheit der Union aufkündigen und der CDU im ganzen Bundesgebiet Konkurrenz machen, setzte die CSU ihren Vorsitzenden durch. Wie zwei Jahrzehnte später im Kampf zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber zeigte sich schon in der Auseinandersetzung Kohl gegen Strauß, dass ein CSU- Kandidat auf Hilfe aus der Schwesterpartei zählen kann. So wie 1979 konservative und liberale CDU-Politiker die Kandidatur von Strauß betrieben, so schlugen sich Anfang 2002 neben Roland Koch und Friedrich Merz auch Peter Müller und Christian Wulff auf Stoibers Seite. Die einen waren erklärte Merkel-Gegner, die anderen hielten sie einfach nur für eine aussichtslose Konkurrentin gegen Gerhard Schröder. So wurde die CDU-Chefin von den eigenen Leuten bis an den Abgrund getrieben. Sie wäre gestürzt, hätte sie nicht, ganz nach dem Vorbild Helmut Kohls, den Verzicht auf die eigenen Ansprüche als souveränen Akt politischer Klugheit ausgegeben. Für beide wurde die Niederlage zum Ausgangspunkt ihres späteren Erfolges. Immerhin hatte die CDU 1980 und 2002 noch Vorsitzende, die mit der CSU um die Kandidatur streiten konnten. Heute ist die Lage prekärer. Zwar hat die Pandemie der CDU ein überraschendes Zwischenhoch in den Umfragen beschert und die Krise der Partei in den Hintergrund gerückt. Doch was es für die CDU bedeutet, wenn zu Beginn des Wahlkampfes im kommenden Jahr den Deutschen klar wird, dass Angela Merkel nun endgültig die politische Bildfläche verlässt, ist noch gar nicht abzusehen. Hinzu kommen die unwägbaren Risiken der Corona- Strauß wurde unter Alkoholeinfluss zur Kandidatur getrieben Krise. Die CDU jedenfalls könnte eine Führung mit Autorität und Orientierung gebrauchen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die erste CDU- Vorsitzende der Nach-Merkel-Ära, ist an diesem Anspruch schnell gescheitert. Ob ihr Nachfolger mehr Erfolg haben wird, ist heute völlig offen. Mit der Führungskrise der Schwesterpartei ist Söder fast zwangsläufig ins Zentrum der Union gerückt. Die Lage erinnert an das Ende der Ära Kohl, als die CDU in den Abgrund blickte und Stoibers CSU die Union stabilisierte. Heute gerät Söder in diese Rolle. Noch vor zwei Jahren, im beginnenden Landtagswahlkampf, konkurrierte er mit der AfD um rechte Wähler. Seither prügelt er auf die Rechtspopulisten ein und verordnet seiner Partei einen Modernisierungskurs. Wieder kann man mit Söder einen Konservativen erleben, der nicht zuletzt aus Gründen des Machterhalts Erneuerung propagiert auch dort, wo er sich mit einer klassischen Klientel wie der Bauernschaft oder dem CSU-Patriarchat anlegen muss. Wie weit er damit schon gekommen ist, in seiner Partei und in Bayern, ist noch nicht klar zu beantworten. Aber dass da einer in der Schwesterpartei die Richtung vorgibt, wird in der CDU schon deshalb bewundernd registriert, weil sie selbst so führungslos wirkt. Nach der jüngsten Umfrage favorisieren weit über 60 Prozent der Unions-Anhänger Söder als Kanzlerkandidaten. Überraschender noch: Selbst bei Sympathisanten der Grünen kommt er auf 30 Prozent, weit vor allen anderen Unions-Bewerbern. Immer wieder hat Söder das Mitspracherecht der CSU in der Kandidatenfrage angemahnt. Auch wenn die CDU in der Regel den Kandidaten stellt, muss sich die CSU einverstanden erklären. In normalen Zeiten ist das nur ein gesichtswahrendes Prozedere. Doch egal, ob Söder nur die Form gewahrt sehen will oder sich wirklich eine eigene Kandidatur offenhält, die Führungssituation der Schwesterpartei wird dadurch weiter verkompliziert. Zwar darf die CDU darauf hoffen, auf ihrem Parteitag Anfang Dezember einen neuen Vorsitzenden zu wählen Armin Laschet, Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder vielleicht doch noch Jens Spahn. Aber das Mitspracherecht der CSU wird auf jeden Fall verhindern, dass der CDU- Chef automatisch zum Kandidaten wird. Normalerweise würde der neue Vorsitzende auf dem Parteitag als künftiger Kanzler in Szene gesetzt. Nun aber kann es passieren wenn Söder nicht mit Rücksicht auf die Kalamitäten der Schwesterpartei auf sein Grußwort verzichtet, dass die auf Führung hoffenden Delegierten ihm per Akklamation die Kanzlerkandidatur antragen. In den beiden früheren Fällen war die Kandidatur eines CSU-Politikers nicht nur eine machtpolitische, sondern auch eine ideologische Frage. Denn die CSU markierte traditionell den rechten Flügel der Union,»das letzte Hindernis auf dem Weg zum Sozialismus«, wie Strauß seine Rolle charakterisierte. Dass er im Kampf ums Kanzleramt scheiterte, hatte nicht nur mit dem bayerischen Exzeptionalismus zu tun, der außerhalb des Freistaats nicht gut ankommt, sondern eben auch mit dem aggressiveren Konservatismus, den die CSU damals noch unverstellt propagierte. Der taugte nicht als Gesamtlinie der Union, weswegen die CSU-Kandidaten sich gezwungen sahen, ihrem Image entgegenzuarbeiten. Doch Strauß, der instinktiv spürte, dass sein öffentliches Bild so unerschütterlich feststand, dass jegliche Moderation scheitern musste, stürmte konfrontativ und authentisch in die Niederlage. Stoiber dagegen hielt sein weltoffen-mildes Wahlkampf- Profil eisern durch, was ihn nicht nur in Berliner Szeneclubs, sondern während der Irak-Debatte auch auf Schröders national-pazifistische Spuren führte. Solche Verrenkungen muss Markus Söder nicht mehr vollführen. Allenfalls sein Dominanzgebaren und die allfällige Frage, wie viel Glaubwürdigkeit in seiner politischen Neuerfindung steckt, könnten Kanzlerambitionen hinderlich sein. Aber er dementiert sie ja unablässig, wie seine Vorgänger. Wahrscheinlich wissen alle Kanzlerkandidaten der CSU die längste Zeit wirklich nicht, was sie wollen sollen. Für jeden bedeutet die Kandidatur das größte politische Abenteuer der eigenen Karriere. Da darf man schon zögern. Franz Josef Strauß musste am Himmelfahrtstag 1979 unter Alkoholeinfluss von seinen engsten Helfern, darunter Edmund Stoiber, zur Kandidatur getrieben werden. Zwei Jahrzehnte später konnte Stoiber den Zauderer in sich nur mit seinem unbändigen Ehrgeiz niederringen. Beide kandidierten aus der Opposition, beide scheiterten an starken Kanzlern. Wenn Söder anträte, wäre das anders. Das macht die Sache selbst für einen auf Bayern fixierten Machtpolitiker verlockend. Nur, um zu erfahren, ob er am Ende erfolgreicher wäre als seine beiden Vorgänger, müsste er eben springen wie sie. Sonst macht es doch der neue CDU- Vorsitzende. Wer immer das sein wird. Foto: Wolf Heider-Sawall/laif; kl. Fotos: Kucharz/ullstein (o.); Ulrich Baumgarten/Getty Images (u.)
7 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 POLITIK 7 Dasselbe in Rot Die Grünen spielen in der Corona-Krise nur eine Nebenrolle. Nun wollen sie wieder in die Offensive kommen als Partei des sozialen Zusammenhalts VON ROBERT PAUSCH Wenn Friedrich Merz, ein Mann, der bekanntermaßen gerne Bundeskanzler wäre, den Spiegel zum Interview trifft, sich hierfür einen grünen Schlips zum grünen Anzug umbindet, um danach, Überraschung, zu verkünden, dass er ein idealer schwarz-grüner Kanzler wäre, dann zeigt das mindestens zweierlei: Wer in Exekutivzeiten kein Exekutivamt hat, der braucht schon Signalkleidung, um sich bemerkbar zu machen. Zweitens und wichtiger: Trotz Corona-Krise, Umfragedelle und pandemiebedingtem Aufmerksamkeitseinbruch sind die Grünen die Partei, an der voraussichtlich niemand vorbeikommt, der vom nächsten Jahr an das Land regieren will. Diese Tatsache rückt wiederum eine andere Frage ins Zentrum: Wer wollen die Grünen sein? Dies schon einmal vorweg: Die Grünen sind eine Partei, die sich gerade so rasant verändert wie keine andere, was erhebliche Folgen für das Parteiensystem und für die Statik der Republik hat. Ihr Plan ist es, sich an die Spitze eines politisch-psychologischen Hegemoniewechsels in der Gesellschaft zu setzen, der mit der Ökologie eher am Rande zu tun hat, dafür umso mehr mit höchstens mittelgrünen Begriffen: Sicherheit, Schutz, Kollektivität. Für die Grünen gehe es um den»kampf um die Mehrheitsfähigkeit«, sagt der Vorsitzende Robert Habeck. Die Co-Chefin Annalena Baerbock spricht von einem»führungsanspruch«für die Gesellschaft. Man könnte das als Selbstanfeuerung eines Zwanzigprozentvereins abtun, aber damit würde man der Sache möglicherweise nicht gerecht. Eher hilft es, sich kurz von den Grünen zu entfernen, um sich ihnen so zu nähern, und mit einem Soziologen zu beginnen, der für das Denken und Handeln der überbauambitionierten Grünenspitze derzeit eine wichtige Rolle spielt. Andreas Reckwitz ist in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten und gefragtesten Gegenwartsdeuter geworden. Vor drei Jahren hat er eine Gesellschaftstheorie veröffentlicht, die zugleich eine Charakterstudie des Grünenmilieus ist und in der Partei aufmerksam gelesen wurde. In der Gesellschaft der Singularitäten beschreibt Reckwitz, wie der Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft eine Gruppe von Fortschrittsgewinnlern hervorgebracht habe: akademisch gebildete, kulturell liberale Großstadtbewohner in Kopfarbeiterberufen. Die Werte dieser»neuen Mittelklasse«würden nun den gesellschaftlichen Ton bestimmen. Selbstverwirklichung, Authentizität, Nonkonformismus, Individualität, also das, was einstmals gegenkulturelles und grün-alternatives Markenzeichen war. Der hedonistisch verfeinerte Lebensstil dieser Gruppe stehe im Gegensatz zur Traditionsverhaftung einer»alten Mittelklasse«aus Facharbeitern, Handwerkern, kleinen Angestellten, die sich nun kulturell im Hintertreffen wähnten, was wiederum zu Wut, Populismus und sonstigen Krisensymptomen führe. Man kann über die Tauglichkeit der Kategorien streiten, aber weil es hier um die Grünen gehen soll, ist es wichtiger, festzuhalten, dass sich führende Leute in der Partei auf Grundlage der Reckwitzschen Klassensoziologie ein paar konkrete strategische Fragen stellen. Zum Beispiel: Ist unser Aufstieg das Produkt einer Polarisierung, die den Grünen nützt, aber der Gesellschaft schadet? Lässt sich das verändern? Und wenn ja: wie? Robert Habeck etwa sagt:»es geht darum, eine solche Klassenstruktur zu überwinden.«und:»unsere Aufgabe ist es, für eine Gemeinsamkeit in der Gesellschaft zu arbeiten.«in anderen Worten bedeutet dies: Die Zeit der Selbstgenügsamkeit ist vorbei. Wer Mitte sein will, kann es sich nicht mehr leisten, nur auf sich zu schauen. Was aber bedeutet das für die Grünen? An dieser Stelle kommt der zweite Reckwitz- Begriff ins Spiel. Denn der Soziologe hat nicht nur den Aufstieg der neuen Mittelklasse beschrieben, sondern auch die Verwerfungen, die mit ihm einhergehen. Die Zeit, in der das weltgeschichtliche Pendel in Richtung Entgrenzung, Ökonomisierung und Deregulierung schwang, so lautet seine These, neige sich dem Ende entgegen. Alle wesentlichen Krisen der vergangenen Jahre seien Reaktionen auf Illustration: Nadine Redlich für DIE ZEIT einen übersteigerten»dynamisierungsliberalismus«, der alles um ihn herum beschleunige, auf Widerruf stelle und so seine eigene Substanz verzehre. Die westlichen Gesellschaften stünden, so Reckwitz, nun an einer Epochenschwelle. Es beginne eine neue Ära der aktiven Staatlichkeit, und was es in dieser Zeit brauche, sei eine Denkrichtung, die der Soziologe»einbettender Liberalismus«nennt: Eine Politik, welche die Freiheitszuwächse der vergangenen Jahrzehnte bewahrt, aber zugleich die Bedürfnisse nach Kollektivität, Schonung und Ausgleich bediene. Belege für diesen Hegemoniewechsel muss man derzeit nicht lange suchen: Die schwarze Null, das Symbol für ökonomische Austerität, ist Geschichte. Werkverträge gelten nicht mehr als Flexibilitätsverheißung, sondern als Ausweis unternehmerischer Verantwortungsflucht. In der Fleischindustrie, der Maskenbeschaffung und der Impfmittelforschung gilt: Unterregulierung erzeugt Freiheitsverluste, staatliches Zu-spät- oder Nicht-Handeln produziert Nebenfolgen, die sich rasch zu Krisen auswachsen können. Die Grünen registrieren diese Entwicklung, und sie reagieren auf sie. Mehr noch: Sie wollen die Partei sein, die am frühesten und am entschiedensten die Schubumkehr verkörpert: vom Privaten zum Öffentlichen, von der Deregulierung zur Regulierung, von der Nachsorge zur Prävention. In der vergangenen Woche stellte die Parteiführung ihr neues Grundsatzprogramm vor, das nach beinahe zwanzig Jahren die Selbst- und Weltanschauung der Partei in die Gegenwart rücken soll. Von einer»politik einer neuen Phase«ist dort zu lesen, in der es darum gehe,»sicherheit neu zu definieren«. Vorsorge sei als politisches Leitprinzip zu verankern, und es gelte,»die Politik in allen Bereichen«darauf auszurichten. Die Grünen wenden sich gegen die Profitlogik in der Daseinsvorsorge, sie fordern, Grund und Boden verstärkt in öffentlichen Besitz zu überführen, sie möchten Produktionen rückverlagern, und sie wollen, dass Waren und Dienstleistungen»von allgemeinem Interesse«von»Marktmechanismen und Wettbewerb ausgenommen bleiben«. Viel ist bei den Grünen nun die Rede von sogenannten kollektiven Gütern: der Krankenversorgung, dem Verkehrsnetz, der Energie, dem Wohnen, jenen Bereichen der Wirtschaft also, die in den letzten Jahrzehnten großflächig vom Gemein- ins Privateigentum überführt wurden. Ein Prinzip, das die Grünen nun umkehren wollen. Robert Habeck spricht von einer»feuerwehrgesellschaft«: Eine Feuerwehr leiste man sich schließlich auch, obwohl man hoffe, dass es nicht brennt. Statt»Effizienz schafft Wachstum«solle nun gelten: Vorsorge schafft Sicherheit. Im Juli will die Parteiführung unter dem Motto»zu achten und zu schützen«zu einer Sommerreise aufbrechen.»zentral ist, den Schutz unserer Gesellschaft zu stärken. Das ist die Aufgabe«, sagt Annalena Baerbock. Auf der Reise soll es um die Krisenfestigkeit der Gesellschaft gehen. Um das Präventionsprinzip als Gegenentwurf zu kurzfristiger Bewältigungspolitik. Und während die anderen noch knietief in der Gegenwart stecken, wollen die Grünen die Ersten sein, die das Danach in den Blick nehmen. Allerdings treten an dieser Stelle die Probleme der Strategie hervor. Denn den grünen Veränderungswünschen steht zunächst ein ausgeprägtes Normalitätsbedürfnis in der Gesellschaft entgegen. Der Raum für Deutungsoffensiven wird durch die Tatsache begrenzt, dass eine zweite Infektionswelle oder ein ökonomischer Kollaps eine Sache von wenigen Wochen sein kann. Krisenfestigkeit ist ein schönes Ziel. Aber gibt es gerade jemanden, der sich für Ziele interessiert? Außerdem: Je tiefer die Rezession zu werden droht und je rascher die Rettungspakete zusammenschmelzen, desto lauter dürften jene werden, die der Meinung sind, dass der Gürtel nun erst recht enger geschnallt werden müsse, dass jetzt nicht die Zeit für Vorsorgedebatten sei, sondern für Konsolidierung. Die Präventionspolitik hätte es mit mächtigen Gegnern zu tun. Hinzu kommt, dass das ästhetische Erfolgsmodell der Grünen (Konstruktivität vor Kritik, Zusammenarbeit statt Zuspitzung) die Partei zumindest in der ersten Phase der Corona-Krise ANZEIGE geradewegs in die Bravheitsfalle führte. Denn wie jeder Stil lebt auch jener der Grünen von der Differenz: War die Koalition wieder einmal besonders unleidlich mit sich selbst, wirkten die Grünen in der Opposition staatstragender als die Regierung. Agieren Union und SPD dagegen krisenpolitisch konzentriert, hat es bisweilen den Anschein, als eskortierten die Grünen die Regierungspolitik. Noch entscheidender, weil grundsätzlicher und weitgehend ungeklärt, ist die Frage nach dem inneren Zusammenhang von Strategie, Milieu und Wirklichkeit. Denn weder historisch noch soziologisch waren die Grünen eine Partei, die sich selbst dafür vorgesehen hatte, eine»neue Logik des Allgemeinen«(Reckwitz) beziehungsweise eine»politik der Gemeinsamkeit«(Habeck) ins Zentrum zu rücken. Dem Staat, zumal dem vorsorgenden Wohlfahrtsstaat, standen die Grünen meist skeptisch gegenüber. Eigenverantwortung war ihnen näher als Sicherheit, Deliberation wichtiger als Organisation. Und nun soll ausgerechnet die grüne Individualistenpartei zur Kraft des Kollektiven werden? Seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren verkünden die Vorsitzenden, ihre Partei»aus der Nische«führen zu wollen. Doch die Grenzen des Wachstums verlaufen für die Grünen noch immer ziemlich genau zwischen Gymnasium und Realschule. Überhaupt besteht zwischen der neuen grünen Sicherheits- und Gemeinsinnrhetorik und dem Liberalitäts- und Distinktionssinn ihrer Anhänger eine VERABSCHIEDEN VOM SIE HP ELITE DRAGONFLY SICH Spannung, die sich etwa dann entladen könnte, wenn es um die Frage geht, wer für das ausgebaute Gemeinwesen eigentlich bezahlt. Doch vielleicht geht es auch ganz anders. Im Abiturientenland Deutschland kann man schließlich auch als Abiturientenpartei ziemlich erfolgreich sein. Zumindest dann, wenn ihre Gegner aus der Abgrenzung zu den Grünen kein Mobilisierungsmodell machen können. Ein Wahlkampf, bei dem die Grünen das eigene Milieu bei Laune halten, ohne auf der anderen Seite gehasst zu werden, könnte für zwanzig Prozent gut sein. Oder sogar für mehr. Es wäre die asymmetrische Demobilisierung durch Freundlichsein. Und klänge das nicht nach einer ziemlich grünen Strategie? S TECKDOSEN- SUCHEN Dank HP Fast Charge,und bis zu 24 Stunden Laufzeit. Intel Core i5 vpro Prozessor 10U29EA HP Notebooks. Work better. Mehr erfahren: hp.com/workbetter Intel,das Intel-Logo, Intel Core,Intel vpro,core Inside und vpro Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
8 8 POLITIK 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28»Wir können mehr tun«der Regierungsberater Tom Krebs rechnet mit deutlich mehr Arbeitslosen und hält ein zweites Konjunkturprogramm für notwendig. Der Staat müsse den Kommunen das Geldausgeben erleichtern DIE ZEIT: Herr Krebs, in dieser Woche wird das größte Konjunkturpaket in der Geschichte des Landes verabschiedet. Reicht das? Tom Krebs: Nein, wahrscheinlich nicht. Wir werden im Herbst voraussichtlich enttäuscht feststellen müssen, dass wir noch ein weiteres Paket brauchen. ZEIT: Weshalb? Die Innenstädte füllen sich mit Menschen, die Unternehmen fahren die Pro duktion wieder hoch. Die Bundesbank sagt, dass jetzt die Wende da sei. Krebs: Es geht wieder aufwärts, insofern ist die Wende tatsächlich da. Aber das Wirtschaftswachstum wird nach allem, was wir beobachten können, nicht stark genug sein, um einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Unternehmenspleiten zu verhindern. Man wird das schon bald in den Fußgängerzonen sehen, wenn mehr und mehr Läden schließen. Die ersten haben das ja auch schon angekündigt, Galeria Karstadt Kaufhof etwa. Ich rechne damit, dass wir Ende des Jahres über drei Millionen Arbeitslose haben werden, das wäre fast eine Million mehr als zu Jahresbeginn. ZEIT: Genau das sollte mit dem Konjunkturpaket aber doch verhindert werden. Krebs: Das Konjunkturpaket stützt die Wirtschaft im Inland, aber es wird trotzdem keine vollständige Erholung geben. Deutschland ist extrem abhängig vom Export. In den meisten anderen europäischen Ländern, in die die deutschen Firmen ihre Produkte verkaufen, läuft es wirtschaftlich viel schlechter als bei uns. Auf Amerika kann man auch nicht zählen, zumal dort die Zahl der Corona-Fälle weiter steigt. Und China hat ebenfalls Probleme. Das ist ein wichtiger Unterschied zur Situation nach der internationalen Finanzkrise. Damals kauften die aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens enorm viele deutsche Maschinen und Fahrzeuge. Das hat uns geholfen, heute fehlt diese Nachfrage. ZEIT: Wären dann nicht globale Maßnahmenpakete statt nationaler Konjunkturprogramme sinnvoll? Krebs: Dazu bräuchte es eine Weltregierung, und die gibt es nicht. Kümmern wir uns also um die Dinge, die wir selbst beeinflussen können. Für Europa werden wir hoffentlich einen europäischen Wiederaufbaufonds auf den Weg bringen. Das Geschlossenes Geschäft in Berlin: Die Krise trifft den Handel hart Foto: Stefan Boness/Visum hilft Ländern wie Spanien und Italien. Und im eigenen Land können wir auch mehr tun damit werden wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht komplett verhindern, aber abbremsen können. Ich finde es gut, dass der Staat sich gegen die Krise stemmt. Allerdings ist das Konjunkturpaket nicht transformativ genug, wir geben jetzt sehr viel Geld aus, und das sollte in den nötigen Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft fließen ZEIT: Das setzt voraus, dass die Regierung weiß, was die richtige Richtung ist. Kritiker sagen: Politiker liegen oft falsch und geben unnötig Geld aus. Krebs: Der Staat sollte den Unternehmen nicht im Detail vorschreiben, worin genau ihr Geschäftsmodell zu bestehen hat. Er soll aber dafür sorgen, dass die nötige Infrastruktur für zukunftsfähige Geschäftsmodelle entsteht. So etwas hat im Übrigen auch in der Vergangenheit immer wieder für Technologieschübe gesorgt. In den USA hat der staatlich angeschobene Ausbau des Erie Kanals zwischen dem Hudson-River und den großen Seen die Küstenregionen des Ostens mit den Weiten des Mittleren Westens verbunden und damit den Grundstein für den wirtschaftlichen Aufstieg der Nation gelegt. Ich würde jetzt ganz konkret zehn Milliarden Euro zusätzlich für die Kommunen bereitstellen, damit die ihre Investitionen nicht aus Geldmangel zurückfahren müssen. ZEIT: In der Vergangenheit sind solche Gelder oft nicht abgeflossen, zum Beispiel weil die Baufirmen ohnehin schon volle Auftragsbücher hatten. Krebs: Auch das wird sich durch die Krise ändern. Die private Bautätigkeit wird zurückgehen. Die Firmen haben weniger zu tun. Es gibt, ökonomisch gesprochen, wieder freie Kapazitäten, die mit staatlichem Geld nutzbar gemacht werden können. Aber man muss da grundsätzlicher herangehen. Ich habe dazu im Finanzministerium auch einen Vorschlag gemacht: Wir brauchen einen langfristigen also auf mehrere Jahre angelegten Investitionsplan für die sozial-ökologische Transformation der deutschen Wirtschaft. Die einzelnen Fachministerien sollten die nötigen Maßnahmen identifizieren, und das Finanzministerium sollte alles zusammenführen. ZEIT: Wie kam der Vorschlag bei Olaf Scholz an? Krebs: Er fand ihn interessant. Zeit: Können wir uns das alles überhaupt leisten? Der Staat nimmt so viele neue Schulden auf wie nie zuvor. Auf Kosten der kommenden Generationen, wie die Opposition argumentiert. Krebs: Das entspricht nicht meinem Verständnis von Generationengerechtigkeit. Es geht ja gerade darum, durch den Umbau der Wirtschaft unseren Kindern und Enkeln ein besseres Leben zu ermöglichen. Wenn der Planet kaputt ist, kann man sich von einem ausgeglichenen Staatshaushalt auch nichts kaufen. Schulden sind in diesem Zusammenhang eine Investition in die Zukunft. ZEIT: Wie viel Geld kann sich Deutschland sinnvollerweise leihen? Krebs: Der finanzielle Spielraum eines Staates wird im Wesentlichen durch das begrenzt, was die Finanzmärkte ihm zu leihen bereit sind. Das ist im Fall Deutschlands sehr, sehr viel und auch noch zu sehr niedrigen Zinsen. Wir sollten andersherum fragen: Wie viel Geld brauchen wir, damit das Land in Zukunft gut dasteht. ZEIT: Die Obergrenze für die Staatsverschuldung liegt in der EU bei 60 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die deutsche Schuldenquote wird in diesem Jahr bei rund 75 Prozent liegen, die französische bei 115 Prozent. Krebs: Ich halte es für richtig, dass es eine Schuldenregel gibt. Aber eine Zielmarke von 60 Prozent erscheint in Zeiten niedriger Zinsen nicht mehr zwingend. Aus meiner Sicht bieten sich 90 Prozent an, das wäre ein Wert, der auch für höher verschuldete Länder realistisch ist. Wenn man unter dieser Quote liegt, sollte man eine gewisse Freiheit ha ben, darüber muss es einen Plan geben, wie man das wieder zurückführt. Die Fragen stellten Petra Pinzler und Mark Schieritz Tom Krebs ist Wirtschaftsprofessor in Mannheim. Im September holte Olaf Scholz ihn als Berater ins Finanzministerium, wo er die Krisenpolitik der Regierung maßgeblich mitkonzipierte ANZEIGE Die Weltmeisterschaft des Denkens Großes 4-teiliges Sommerspiel mit wertvollen Preisen, ab 16. Juli in der ZEIT 1. Preis Goldbarren im Wert von
9 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 POLITIK 9 Russlands Präsident Wladimir Putin soll für die feindlichen Aktivitäten auf deutschem Boden verantwortlich sein Illustration: Adams Carvalho für DIE ZEIT Wie sagen wir s ihm bloß? Die Bundesregierung ist überzeugt: Russland schickte einen Auftragskiller nach Deutschland und ließ seine Hacker auf den Bundestag los. Jetzt verschärft sie den Konflikt mit Moskau VON HOLGER STARK Ein Auftragsmord im Herzen Berlins. Ein Hacker angriff auf den Deutschen Bundestag. Ein ausländischer Agent, der mit einem Sack voller Bargeld durch Deutschland reist, offenbar um einen weiteren Killer zu rekrutieren. Drei Geschichten, die aus einem Hollywood-Thriller stammen könnten und sich doch mitten in Deutschland zugetragen haben. Die Hauptrolle spielt dabei ein Staat: Russland. Die Bundesregierung und die deutsche Justiz sind überzeugt davon, dass es der Kreml ist, der hier hacken, schießen und sabotieren lässt. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat es eine solche Ballung feindlicher Aktivitäten zwischen Deutschland und Russland nicht mehr gegeben. Die Bundesregierung ist alarmiert, die russische Subversion Thema im Kabinett und bei vertraulichen Besprechungen der Sicherheitsbehörden. Die Angriffe, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), seien»nicht nur irgendwie ein Zufallsprodukt, sondern das ist durchaus eine Strategie«. Sie sagt auch:»ich nehme diese Dinge sehr ernst.«von einer»neuen Phase russischer Beeinflussungsaktivitäten«seit 2014 ist in einer geheimen Analyse der deutschen Nachrichtendienste die Rede. Aber woher kommt diese neue, aggressive Linie des Kreml? Und was ist die angemessene Reaktion darauf? Kurz: Wie halten wir s mit Russland? In diesen Tagen klingt der Satz so, als frage man nach dem klügsten Umgang mit einem Pausenhofschläger, den man gern zur Mäßigung rufen würde, aber man weiß nicht recht, wie. Moskau, das ist die Sicht in Berlin, hat in den vergangenen Jahren stillschweigend die Spielregeln verändert. Aus einer mal zugeneigten und mal kriselnden Beziehung zweier geschichtlich eng verbundener Länder droht ein Verhältnis zu werden, das durch die Ausweisung von Diplomaten und die Androhung von Sanktionen geprägt wird. Wie einst im Kalten Krieg. Die Bundesregierung hat sich lange vor schmerzhaften Konsequenzen gedrückt. Aber in den vergangenen Monaten sind in vertraulichen Regierungsrunden und geheimen Vermerken die Konturen einer neuen, schärferen Russland-Politik sichtbar geworden, die den Kreml zum Einlenken bewegen soll. Und diese Linie hat viel mit einem jungen Russen namens Dmitri Badin zu tun. Badin ist ein russischer Hacker, 29 Jahre alt, geboren in Kursk, ausgebildet an der Universität von St. Petersburg. Ein Fahndungsfoto, mit dem ihn das amerikanische FBI sucht, zeigt ein Milchgesicht mit nordisch blonden Haaren. Er soll zu jener Gruppe russischer Staatshacker zählen, die im April und Mai 2015 in das Computernetzwerk des Deutschen Bundestags eindrang; am Ende hatten die digitalen Einbrecher die Rechner von mindestens 16 Bundestagsabgeordneten geknackt, darunter das Abgeordneten-Postfach von Merkel. Mehr als 16 Giga byte an Daten flossen ab. Dmitri Badin soll dafür eine Art digitalen Dietrich codiert haben, ein Programm namens VSC.exe, das den Russen beim Einbruch in den Bundestag half. Doch das wussten die deutschen Ermittler damals noch nicht. In den Monaten nach dem Angriff berieten Merkel und ihre Leute im Kanzleramt, wie sie reagieren sollten. In der»präsidentenrunde«, in der jeden Dienstag die Chefs der Sicherheitsbehörden im Kanzleramt zusammentreffen, hatten die Topbeamten erläutert, dass hinter der Attacke vermutlich ein russischer Geheimdienst stecke. Peter Altmaier, damals Kanzleramtschef, beauftragte den Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst, einen Bericht zu erstellen. So entstand ein 49 Seiten dickes, vertrauliches»gemeinsames Lagebild«über»Russische Propaganda, Des infor ma tion und PsyOps«psychologische Kriegsführung. In der Vergangenheit habe Russland auf spektakuläre öffentlichkeitswirksame Aktionen gegen Deutschland verzichtet, heißt es in der Analyse, die der ZEIT vorliegt. Doch die»für Russland unerwartete Re ak tion der Bundesregierung und der westlichen Staatengemeinschaft auf die Ukraine- Krise«habe zu einem Wechsel der Strategie geführt. Russland sehe sich seitdem»in einem offenen Konflikt mit der westlichen Welt«. Auch einen Verantwortlichen machen die Dienste aus:»zentrale Drehscheibe«für die Koordination der feindlichen Aktivitäten sei die Präsidialadministration des Kreml. Putin also.»deutschland ist aus russischer Sicht das wichtigste Land in EuropaEs ist ausgeschlossen, dass eine so wichtige Ope ration wie der Angriff auf das deutsche Parlament ohne Wissen des Kreml abläuft«, glaubt ein langgedienter deutscher Geheimdienst-Beamter.»Wenn Putin nicht persönlich im Vorfeld davon wusste, dann hat er die Operation zumindest im Nachhinein abgesegnet.«seit seiner Rückkehr in den Kreml 2012 setze der russische Staatspräsident auf eine»neue Strategie der Konfrontation«, sagt auch Fiona Hill, die bis zur Ukraine-Affäre um Donald Trump im Weißen Haus für Ost euro pa zuständig war und als eine der besten Russland-Kennerinnen weltweit gilt.»und Deutschland ist aus russischer Sicht das wichtigste Land in Europa.«Das vertrauliche Lagebild der deutschen Nachrichtendienste liest sich wie eine Anklageschrift und so war es auch gemeint: Es sollte in einer abgespeckten Fassung veröffentlicht werden, um Putins Politik anzuprangern.»wir wollten damit ein Si gnal gen Moskau senden, dass wir das nicht hinnehmen«, erinnert sich ein damals Beteiligter. Doch den letzten Beweis dafür, dass der Bundestags-Hack im Kreml angeordnet worden war, konnten die Dienste Ende 2016 nicht erbringen. Altmaier hielt die Geheimdienst-Analyse für zu wenig belastbar, das Auswärtige Amt befürchtete bei einer Veröffentlichung eine schwere Belastung des deutsch-russischen Verhältnisses. Und die Russen, denen die Bundesregierung diskret über einen Emissär von der geplanten Publikation Kenntnis gegeben hatte, ließen ihre Verärgerung ausrichten. Also schluckte Merkel ihren Zorn herunter und einigte sich mit ihren Ministern darauf, die Analyse im Panzerschrank verschwinden zu lassen. Sie ist bis heute»vertraulich amtlich geheim gehalten«.»aktion Pranger«fiel aus. Stattdessen sandte das Kanzleramt einen hochrangigen deutschen Beamten nach Moskau, der sich bei den Chefs der drei Geheimdienste SWR, GRU und FSB beschwerte. Die Russen reagierten ebenso professionell wie kühl: Welche Beweise die Deutschen denn hätten? Keine. Damals jedenfalls. Denn mittlerweile hat sich die Lage geändert. Mithilfe des FBI konnte das Bundeskriminalamt (BKA) im vergangenen Jahr minutiös nachvollziehen, wann der junge russische Hacker den Einbruch in den Bundestag gesteuert hatte. Anfang Mai, fast auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Bundestags-Hack, erließ der Bundesgerichtshof Haftbefehl gegen Dmitri Badin. So begnadet Badin als Datendieb auch sein mag beim Schutz seiner eigenen Daten handelte er ausgesprochen schlampig. Einer russischen Daten bank zufolge registrierte er sein Auto unter der Adresse einer Einheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU in Moskau. Und in der Nähe der russischen Militärakademie erhielt er angeblich mehrere Strafzettel für Falschparken. Das BKA hält es heute für erwiesen, dass Badin ein Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU ist. Ein Haftbefehl gegen einen russischen Offizier, das ist ein seltenes, unmissverständliches Symbol.»Wir können jetzt nicht mehr so tun, als wäre unklar, wer dahintersteckt«, sagt ein hochrangiger deutscher Regierungsbeamter. Die wohltemperierte Strategie des offiziellen Nichtwissens, hinter der die Bundesregierung sich jahrelang verschanzte, ist durch die richterlich festgestellte Verantwortlichkeit Russlands abgelöst worden. Hinzu kommt eine ähnliche Entwicklung bei dem zweiten spektakulären Fall dem Mord an dem Exilgeorgier Selimchan Changoschwili im vergangenen August im Kleinen Tiergarten in Berlin. In der vergangenen Woche erhob Generalbundesanwalt Peter Frank Anklage und beschuldigte darin»staatliche russische Stellen«, den Auftrag erteilt zu haben. Ein mutmaßlicher russischer Auftragsmörder hatte Changoschwili am helllichten Tag mit mehreren Schüssen getötet. Die Berliner Polizei nahm einen Verdächtigen fest, der nicht nur einen gefälschten russischen Reisepass mit sich trug, sondern von dem auch vielfältige Verbindungen zu den russischen Geheimdiensten führen. Das Opfer hatte einst in Tsche tsche nien gegen die Russen gekämpft, in Moskau galt er als Terrorist. Ein Auftragsmörder des Kreml in Berlin,»das lässt nur einen Schluss zu: dass Deutschland von Russland mittlerweile als Operationsraum an gesehen wird, in dem man tun und lassen kann, was man will«, sagt ein hochrangiger deutscher Beamter. Aber was könnte die Russen davon abhalten? Die Deutschen merkten schnell, dass die alten Spielregeln nicht mehr gelten Der diplomatische Komment definiert eine Reihe von internationalen Spielregeln. Eine dieser Regeln besagt, dass ein ertappter Agent ausgewiesen wird, wenn er als Diplomat akkreditiert ist. Spioniert er als sogenannter Illegaler ohne diplomatischen Schutz, muss er damit rechnen, vor Gericht gestellt zu werden. So musste ein russischer Generalkonsul aus dem Hamburger Konsulat nach Moskau zurückkehren, als er 2004 dabei erwischt wurde, wie er einen Bundeswehrsoldaten als Spion anwarb. Und ein russisches Pärchen, das unter falschem Namen in Baden-Württemberg gelebt und von dort heimlich Agentenberichte gen Moskau gesendet hatte, wurde 2013 zu fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Bislang hat sich die Bundesregierung stets brav der internationalen Diplomatie unterworfen. Im Fall des Bundestags-Hacks und des Auftragsmords aber merkten die Deutschen schnell, dass die alten Spielregeln nicht mehr gelten. Ein paar Wochen nach dem Mord in Berlin wandten sich Merkels Leute per an Putins Berater und baten um Aufklärung vergeblich. Der Kreml hielt es nicht einmal für nötig, die Anfrage zu beantworten. Im nächsten Schritt erklärten die Deutschen zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin zu»unerwünschten Personen«, weil die Russen aus Sicht Berlins nicht angemessen kooperierten. Zeitgleich flog ein deutscher Sicherheitsbeamter nach Moskau und traf sich mit seinen russischen Counterparts. Die Russen versprachen diesmal Unterstützung und erklärten doch nur, dass es sich bei dem mutmaßlichen Auftragsmörder um eine personelle Verwechslung handeln müsse. Zugleich führten sie ungeniert ihre Operationen fort: In Hamburg beobachtete der Verfassungsschutz noch im Februar einen anderen mutmaßlichen russischen Agenten, der offenbar gerade dabei war, einen weiteren Auftragsmörder zu dingen, Euro sollte der Killer erhalten. Wie sehr der diplomatische Komment in den deutsch-russischen Beziehungen zu einem leeren Ritual verkommen ist, zeigt das Instrument des Botschaftergesprächs, mit dem ein Land normalerweise auf einen ernsten Vorgang hinweisen und sein Missfallen ausdrücken will. Nach einem ersten Gespräch im November folgte ein zweites Gespräch nach Erlass des Haftbefehls gegen den Hacker Badin im Mai und schließlich nur Tage später ein drittes Gespräch nach der Anklage gegen den Auftragsmörder. Der russische Botschafter ist im Auswärtigen Amt eine Art Dauergast geworden. Aber in einem asymmetrischen Konflikt, in dem eine Seite nach neuen Regeln spielt, zählen diplomatische Gepflogenheiten nicht mehr viel. Anders als die Briten, die nach dem Giftgas- Anschlag auf Sergej Skripal 2018 sämtliche Beziehungen zu Russland auf ein Minimum reduzierten, hat Berlin die verschiedenen außenpolitischen Themen bislang nicht mit ein an der vermengt. Wenn es Probleme im Ukraine-Konflikt gab, sollte das nicht auf die Syrien-Politik überschwappen, und Schwierigkeiten dort sollten nicht eine Lösung in Libyen verhindern oder die Nord-Stream-2-Gasleitung infrage stellen. Aber angesichts der Eskalation ist fraglich, ob diese fein kalibrierte Strategie noch aufgeht.»die Bun des regie rung kann es sich nicht mehr leisten, das hinzunehmen«, sagt der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter.»Wir sollten weitere Ausweisungen und die geplante Aufnahme Russlands in den Europarat überprüfen.«und Fiona Hill, die ehemalige Beraterin im Weißen Haus, glaubt, dass nur eine gemeinsame europäische Antwort etwas bewegt.»die einzige Re ak tion, die Putin wirklich wehtut, ist eine internationale Re ak tion.«wie die aussehen kann, hat der Mordanschlag auf Sergej Skripal gezeigt: Damals hatten 15 europäische Staaten sowie die USA und Kanada mehr als 30 russische Diplomaten außer Landes verwiesen. Sollte das Berliner Kammergericht, das über den Mord im Kleinen Tiergarten verhandeln wird, zu dem Urteil kommen, dass es sich tatsächlich um russischen Staatsterrorismus handelte, wird es wohl eine ähnlich breite Re ak tion geben. Den ersten Schritt in diese Richtung sind die Deutschen bereits gegangen. Dem russischen Botschafter erklärte der deutsche Staatssekretär Miguel Berger bei einem der Krisengespräche, man werde Sanktionen gegen den Hacker Badin und andere hochrangige russische Geheimdienstler beantragen. Winkt die EU den deutschen Antrag durch, dürfen Badin und seine Vorgesetzten nicht mehr in die EU einreisen, ihre Vermögen innerhalb Europas werden eingefroren. Zu den homöophatischen Mitteln der deutschen Außenpolitik gesellen sich jetzt auch härtere Methoden. Die Vorwürfe seien»haltlos«, teilt hingegen der russische Botschafter in Berlin mit, Strafmaßnahmen würden»nicht unerwidert bleiben«. Als die Kanzlerin Mitte Mai im Bundestag die Fragen der Abgeordneten beantwortete, ließ sie erstmals erahnen, wie sehr sie die Schlägerattitüde von Putins Leuten getroffen hat.»mich schmerzt es«, sagte Merkel, sie stecke in einem»spannungsfeld, in dem wir da arbeiten, das auch ich nicht ganz aus meinem Inneren streichen kann«. Merkels Leute hatten die Antworten der Kanzlerin sorgfältig vorbereitet, anders als 2015 sollte diesmal das Si gnal unmissverständlich ausfallen. Als sie nach dem Angriff auf den Bundestag gefragt wurde, entfuhr ihr spontan ein Wort, das nicht auf ihrem Sprechzettel stand und das für Merkel ungewöhnlich emotional ist: Die Attacke, sagte sie, sei»ungeheuerlich«.
10 STREIT JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Eine Landwirtschaft ganz ohne Tiere geht das? Fleischkonsum gilt als unökologisch, unethisch und jetzt, nach dem Tönnies-Skandal, auch noch als Gesundheitsgefahr. Schluss damit, wir brauchen überhaupt keine Tierhaltung, sagt ein Bauer. Eine Kollegin widerspricht: Das funktioniert niemals Daniel Hausmann, 29, hat Ökolandbau und Vermarktung studiert und 2012 den elterlichen Hof zwischen Leipzig und Chemnitz übernommen»tiere zu töten konnte ich nicht mit mir vereinbaren«die ZEIT: Frau Greggersen, Herr Hausmann, Sie beide betreiben Landwirtschaft, allerdings auf radikal unterschiedliche Weise. Was für einen Betrieb haben Sie, Frau Greggersen? Agnes Greggersen: Unser Hof in Schleswig- Holstein hat 120 Milchkühe und 130 Hektar Land. Darauf bauen wir Feldfrüchte und Futter für unsere Tiere an. Man kann auch Urlaub bei uns auf dem Bauernhof machen. Daniel Hausmann: Wir sind ein kleiner Betrieb in Sachsen mit 25 Hektar, hauptsächlich Ackerbau. Wir bauen Getreide, Kleegras und Kartoffeln an, die meiste Zeit beanspruchen aber zwei Hektar mit allerlei Sorten Gemüse. Und wir produzieren alles bio-vegan. ZEIT: Das heißt? Hausmann: Dass wir nicht nur auf Pestizide oder künstliche Dünger verzichten, sondern auch keine Tiere halten und ohne tierische Produkte düngen. Bei Frau Greggersen liefert die Kuh den Dung, bei uns tut dies das Kleegras im Komposthaufen. Damit geben wir dem Boden Stickstoff und weitere Nährstoffe zurück, die die Pflanzen zum Wachsen brauchen. ZEIT: Frau Greggersen, Landwirtschaft ohne Tiere, für eine gesündere Welt geht das? Greggersen: Ich lese häufig, dass bio-vegane Landwirtschaft die Lösung aller Probleme sei. Aber ich bezweifle, dass sie eine große Zukunft hat. Denn: ohne Tiere kein Ackerbau! Selbst Bioverbände schreiben ihren Landwirten vor, wie viele Tiere pro Hektar gehalten werden müssen. Denn zwei Drittel der weltweiten Agrarflächen sind Grünland. Wir Menschen essen kein Gras. Um es zu verwerten, brauchen wir die Kuh. Hausmann: Nein, es geht auch ohne sie. Was Tiere können, kann Kompost genauso gut. Das Ganze ist ein Kreislauf: Mit jeder Ernte holen wir Nährstoffe vom Acker, danach müssen wir wieder welche zufügen. Auch im bio-veganen Landbau funktioniert das. Greggersen: Aber dabei laufen Sie Gefahr, Raubbau an den Böden zu betreiben. Ohne die tierischen Nährstoffe, sprich Dung, mangelt es langfristig an Natrium, Phosphor und Kalium in den Böden. Hausmann: Die kann man zukaufen, dazu braucht es keine Gülle. Unser Betrieb besteht ja seit sechs Jahren, und Bodenanalysen beweisen: Die Qualität der Böden hat sich wenig verändert, weder zum Guten noch zum Schlechten. Andere Bauern wirtschaften seit den Siebzigerjahren bio-vegan. Das zeigt mir, dass es möglich ist. Greggersen: Was haben Sie eigentlich gegen die konventionelle Landwirtschaft? Hausmann: Dort entstehen viele Kosten, die sich nicht im Preis der Produkte widerspiegeln und die auf die Gesellschaft oder auf künftige Generationen abgewälzt werden. Zum Beispiel wird viel zu viel mit Nitrat gedüngt, das dann in unser Grundwasser gelangt. Die Reinigung müssen wir alle bezahlen. Greggersen: Mein Großvater hat viel mehr gedüngt als wir heute. Gerade erst ist die Düngeverordnung wieder verschärft worden. Und bei uns zwischen Flensburg und Kappeln ist nicht zu viel Nitrat im Grundwasser. Das sagen mir unsere Wasserwerke. Hausmann: Anderswo aber schon. Ein Problem sind vor allem Regionen mit viel Massentierhaltung, etwa der Raum um Cloppenburg in Niedersachsen. Mir geht es ums ganze Agrarsystem: Wir befinden uns damit in einer Sackgasse. Angefangen beim Thema Ethik da rede ich jetzt nicht von Betrieben wie dem von Ihnen, Frau Greggersen, da rede ich von Anlagen mit Tausenden von Masthähnchen in einem Betonstall, in dem sich antibiotikaresistente Keime bilden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Krankheiten nach draußen dringen oder über den Dung aufs Feld gelangen. Hinzu kommt ein immenser Ressourcenverbrauch und CO₂- Ausstoß, mit dem wir das Klima schädigen. Da müssen wir doch einen Weg finden, wie wir die Welt besser machen. Greggersen: Aber ist denn die bio-vegane Landwirtschaft der eine Weg? Hausmann: Es ist nicht der eine Weg, aber sie hat großes Potenzial für neue Lösungen. Viele Mastbetriebe beispielsweise füttern ihre Tiere mit Soja aus Südamerika. Das ist eine Verschwendung sondergleichen. Zudem werden die Böden vor Ort ausgelaugt. Das ist nicht nachhaltig. Greggersen: Ich lasse mir aber nicht unterstellen, dass meine Form des Wirtschaftens nicht nachhaltig sei. Unser Betrieb besteht seit 300 Jahren, ich bin die elfte Generation. Mehr Nachhaltigkeit geht kaum. Natürlich müssen wir mit den Ressourcen, die wir haben, ordentlich umgehen, damit ich dieses Erbe an die Generation nach uns weitergeben kann. Höfe wie meiner sichern die Versorgung der Bevölkerung. Sie haben dagegen viel weniger Erträge als ich, oder? Hausmann: Ich ernte etwa die halbe Menge im Vergleich zu konventionellen Betrieben. Dort landet aber die Hälfte des Getreides in der Tierfütterung. Bei uns wird alles für Lebensmittel verwertet, nichts geht an die Tiermast verloren sodass ich unterm Strich den gleichen Ertrag haben dürfte. Greggersen: Tierfutter wird zu rund 60 Prozent auf Flächen angebaut, auf denen nur Gras wächst. Solche Flächen gibt es, und sie sind wichtig für die Natur. Über Kühe, Schafe oder Ziegen können wir sie für uns nutzbar machen. Es wäre doch eine große Verschwendung, auf Milch, Fleisch oder Pflanzennahrung aus diesem Kreislauf zu verzichten. Hausmann: Prozentual gesehen kommen die wenigsten Lebensmittel, die wir essen, von solchen Flächen. Auch für Tierhaltung ist das Grasland nicht sonderlich effektiv. Deswegen können wir uns auf die guten Flächen konzentrieren und dort anbauen, was wir brauchen. Klar, bio-vegane Landwirtschaft ist nicht überall möglich und auch nicht von heute auf morgen. Aber wir können große Schritte in diese Richtung gehen, weniger Tiere zu halten, nicht länger massenweise Futter aus Südamerika zu beziehen und so das Klima zu schonen. Greggersen: Aber nicht nur für die Tiermast wird Nahrung importiert. Auch für die Veganer kommen jede Menge Kiwis, Avocados, Quinoa, Hirse oder Nüsse von weither. Hausmann: Sie meinen, die Leute sagen sich: Weil ich mir das Methan bei der Kuh einspare, darf ich viele Avocados aus Mexiko essen oder dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen? Ich bin vegan, und trotzdem verzichte ich auf übermäßiges Reisen und exotische Früchte. Greggersen: Wenn wir kein Tierfutter mehr hätten und so kein Fleisch mehr produzieren könnten, würde mir in meiner Nahrungsvielfalt etwas fehlen. Ich lebe nicht vegetarisch und schon gar nicht vegan. Hausmann: Das Vorurteil, Veganer hätten weniger Vielfalt beim Essen, kenne ich zur Genüge. Ich behaupte sogar, ich habe mehr Vielfalt als die meisten Fleischesser: weil ich sehr kreativ sein muss beim Ersetzen tierischer Produkte. Greggersen: Davon bin ich noch nicht überzeugt. ZEIT: Frau Greggersen, welches Verhältnis haben Sie zu Ihren Tieren? Greggersen: Ein sehr vertrautes. Jede Kuh hat bei uns einen Namen. Mit Nachzuchten und Kälbern sind wir ungefähr bei 200 Stück. Mir ist es wichtig, alle Namen zu kennen, weil wir jeden Tag mit ihnen arbeiten. Wer uns pauschal unterstellt, wir würden uns nicht ums Tierwohl sorgen, hat einfach keine Ahnung von der Landwirtschaft. Dieses Zerrbild, das über uns gerade in den sozialen Medien entsteht, schmerzt mich und meine Familie. Hausmann: Als ich 2012 den Hof von meinem Vater übernahm, hatten wir noch zwölf Mutterkühe. Wenn ich mit Tieren Geld verdienen möchte, läuft es darauf hinaus, dass ich sie irgendwann töte oder töten lasse. Und das konnte ich nicht mit mir vereinbaren, egal wie gut ich mich mit ihnen verstehe, weil ich damals Veganer geworden bin. Ich wollte Produkte anbauen, die ich auch esse. Aus dem Stall wurde unser Hofladen. Wir liefern unter anderem Gemüsekisten, jeden Donnerstag ins eine Stunde entfernte Leipzig. Greggersen: Darf ich fragen: Rentiert sich Ihr Betrieb überhaupt? Hausmann: Ja, sonst würde ich das nicht schon seit sechs Jahren machen. Für unsere Gemüsekisten haben wir aktuell sogar eine Warteliste. Greggersen: Aber bei Rewe oder Aldi werden täglich eben mehrheitlich andere Kaufentscheidungen getroffen. Auf dem Kassenband landen kaum Bioprodukte, obwohl es die dort mittlerweile auch immer öfter gibt. ZEIT: Würden künftig noch viel mehr Bauern auf bio-vegan umstellen, wäre dies das Ende der billigen Lebensmittel? Hausmann: Nicht unbedingt. Dass vieles so günstig ist, liegt ja zu einem großen Teil an den Subventionen, zum Beispiel für die Milchwirtschaft. Und noch einmal: Die geringeren Erträge machen wir bio-veganen Bauern dadurch wett, dass wir nichts von unserer Ernte als Tierfutter verschwenden. Greggersen: Mit kaum 20 Betrieben in Deutschland wird es aber schwierig, allein schon alle, die Bio-Veganismus toll finden, satt zu bekommen. Hausmann: Tatsächlich haben wir in Deutschland noch nicht viele bio-vegane Betriebe. Das liegt aber nicht daran, dass die Umstellung so schwer wäre, sondern daran, dass die wenigsten Landwirte selbst vegan leben. Für Frau Greggersen hätte es daher wohl kaum einen Sinn, ihre Kühe abzuschaffen. Greggersen: Nein, das hat einen anderen Grund. Das System der Direktvermarktung würde bei mir nicht funktionieren, denn ich habe Leipzig nicht nebenan, und die nächstgrößeren Städte wie Flensburg oder Kiel sind weiter entfernt. ZEIT: Die Vereinten Nationen schätzen, dass wir unsere Nahrungsmittelproduktion bis zum Jahr 2050 um 70 Prozent steigern müssen. Wäre das mit veganer Landwirtschaft möglich? Greggersen: Das würde voraussetzen, dass die Erdbevölkerung mitspielt und sich streng vegan ernährt. Aber momentan steigt der Fleischkonsum weltweit. Hausmann: Die Frage ist doch vor allem, was wir anpflanzen. Wir sollten uns nicht auf unser einseitiges europäisches Getreidemodell versteifen. Beispiel Weizen: Pro Quadratmeter komme ich auf etwa 400 Gramm Weizen, das sind zwei große Hände voll. Wenn ich stattdessen Gemüse anpflanze, schaffe ich mehrere Ernten im Jahr: im Frühling Radieschen, im Sommer Zucchini, im Herbst Spinat. Greggersen: Schön und gut. Aber was ist, wenn ich die vegane Ernährung nicht für das Nonplusultra halte? Ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, was ich essen darf und was nicht. Fotos: Henning Kretschmer für DIE ZEIT; Thomas Victor für DIE ZEIT (o.) Agnes Greggersen, 28, ist gelernte Landwirtin, studierte Agrarwirtschaft und arbeitet auf dem Familienhofunweit der Flensburger Förde Hausmann: Aber wenn Fleischkonsum offensichtlich klimaschädlich ist, müssen im Zweifel andere Regeln her. Ein erster Schritt wäre, die Mehrwertsteuer auf Fleisch zu erhöhen, sie beträgt im Moment nur sieben Prozent. Mit den Einnahmen daraus könnte der Staat womöglich ein paar innovative Projekte in der Landwirtschaft fördern. Greggersen: Gegen höhere Fleischpreise hätte ich grundsätzlich nichts. Auch im Interesse guter Betriebsstandards. Was das angeht, sind ja bei einigen Schlachtbetrieben in der Corona- Krise Zustände zutage getreten, die ich nicht in Ordnung finde. ZEIT: Einige Schlachthöfe sind derzeit in den Schlagzeilen wegen schlechter Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitern und mangelnder Hygiene, die zu Corona-Ausbrüchen führen. Die Debatte um Tiermast und mögliche Alternativen wird inzwischen teils sehr gereizt geführt. Wie erleben Sie das? Greggersen: Zunächst: Ich finde es schön, mit Herrn Hausmann so sachlich zu streiten. Leider hatte ich auch schon schlechte Erfahrungen mit vegan lebenden Menschen. Bis hin zu einem veganen Shitstorm vor zwei Jahren als ich Fotos von meinen Kindern mit unseren Kühen gepostet hatte, wurden wir aufs Übelste beschimpft. Es kann doch nicht sein, dass ich inzwischen Angst haben muss, mich als konventionell wirtschaftende Landwirtin zu outen. Hausmann: Es ist schlimm, dass es solche Leute gibt. Ähnlich ist es auch mir schon ergangen: Ich habe in den sozialen Medien Kartoffeln mit der Bezeichnung»bio-vegan«angeboten. Während ich den halben Tag auf dem Feld war, lieferten sich Antiveganer und Veganer im Netz eine Schlammschlacht. Ich wollte doch einfach nur Kartoffeln verkaufen. Moderation: Tobias Maydl und Stefan Schirmer Siehe auch Politik, S. 2: Unterwegs mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner»Darf ich fragen: Rentiert sich Ihr Betrieb überhaupt?«
11 »Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine.«helmut SCHMIDT 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 STREIT 11 Die falsche Anklage Es ist kein Privileg, ein Weißer zu sein. Eine dringend notwendige Begriffsklärung VON JÖRG SCHELLER Illustration: Karsten Petrat für DIE ZEIT; kl. Fotos: privat; Urban Zintel für DIE ZEIT (u.) er Gebrauch des Begriffs»Privileg«ist zu einem kommunikativen Ärgernis geworden. Vor allem in den sozialen Netzwerken und in journalistischen Meinungsbeiträgen hat sich die nobel tönende Vokabel zu einem Kampfbegriff entwickelt, der nicht mehr der Verständigung dient, sondern als Allzweckwaffe eingesetzt wird. Ähnlich wie kaum noch zwischen Rassismus, Xenophobie, Vorurteil, Ressentiment differenziert wird, kann»privileg!«allen an den Kopf geworfen werden, die aus Sicht der Werfer über Wettbewerbsvorteile verfügen. Will man eine Diskussion abwürgen, möchte man ein Gegenüber diskursiv plattmachen, fehlen einem schlicht Argumente, schleudert man ihm einfach ein check your privilege!,»überprüfe deine Privilegien!«, entgegen. Das soll heißen: Was du da sagst, ist nur eine verbrämte Rechtfertigung deiner privilegierten Position und deiner Machtinteressen! So macht sich ein vulgärer Schrumpfmarxismus breit, der erahnen lässt, warum schon Marx mit Marxisten haderte. Was ist ein Privileg? Ein Privileg, und das ist entscheidend, ist nicht einfach ein Vorteil. Sprachlich wie historisch ist es ein Vor-Recht, das von hierarchisch höherstehenden Einzelnen oder Institutionen an hierarchisch untergeordnete Menschen offiziell verliehen wird. So durften beispielsweise früher Männer wählen und Frauen nicht, in der Vormoderne waren bestimmte Kleidungsstücke bestimmten Personengruppen vorbehalten. Solche Rechtslagen mit Geburtslotteriegewinnen oder selbst erarbeiteten Vorteilen ja, die soll es geben! gleichzusetzen ist unredlich. Nimmt man den Gedanken ernst, dass Sprache unsere Realität miterzeugt, dann gilt: Achtung gerade bei solchen Begriffen, die das Zeug zur Spaltung haben! Wer möglichst viele Menschen für den Kampf gegen Diskriminierungen gewinnen will, der sollte besser nicht so tun, als sei dieses Ziel nur dadurch zu erreichen, dass man bestimmten Menschen etwas wegnimmt, weil sie»von oben«bevorzugt werden. Genau diese falsche Botschaft sendet aber das Reden von»privilegien«. Im Grundgesetz heißt es:»niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.«gemeint ist die Gleichheit vor dem Gesetz, nicht das Phantasma faktischer Gleichheit. Natürlich ist jemand in einer kompetitiven salesman culture benachteiligt, dessen Religion ein kontemplatives Leben verlangt. Natürlich bin ich bevorteilt, wenn ich mit vielen weißen Muskelfasern auf die Welt komme und deshalb, im Gegensatz zu meinem Nachbarn mit den vielen roten Muskelfasern, als Gewichtheber reüssieren kann. Natürlich bin ich bevorteilt, wenn ich von Tante Lotte ein Häuschen in der Südpfalz erbe. Alle diese Vorteile haben aber nichts mit einem Privileg zu tun, das mir von irgendeiner höheren Instanz als exklusives Vor-Recht gewährt worden wäre. Wer Privilegien mit Kontingenz und Ungleichheit in eins setzt, die kein System verhindern kann, neigt zum Verschwörungsideologischen. Insinuiert wird, die Vorteile würden von mächtigen, höheren Instanzen vergeben, die Möglichkeit des Zufalls oder schlichten Glücks wird taktisch ausgeblendet. Immer wieder ist zu lesen, Weiße seien per se privilegiert. Seltsam ist das nicht die grundlegende Funktionsweise des Rassismus: Einzelne mit Gruppen gleichzusetzen, den Kollektivsingular an die Stelle präziser Beobachtung und Empirie zu setzen? In Wahrheit ist die Sache ja vertrackter. Warum ist es ausgerechnet dem Afroamerikaner Jay-Z gelungen, zum ersten Rap- Milliardär zu avancieren? Ist der ausgebeutete Rumäne in einem Tönnies-Schlachthof privilegiert, weil seine Hautfarbe Weiß ist? Und wenn eine deutsche Maklerin die Wahl hat, eine Immobilie an einen gebildeten, eloquenten, vermögenden Nichtweißen zu vermieten oder aber an einen finanziell klammen, weißen Arbeiter aus Osteuropa, der gebrochen Deutsch spricht für wen würde sie sich wohl entscheiden? Überhaupt klammert die Privilegien- Diskussion meist den postkommunistischen osteuropäischen Bereich aus, wo die Erfahrungen sich deutlich von denjenigen unterscheiden, von denen manche Gesellschaftstheorien ausgehen, die an angloamerikanischen Universitäten gelehrt werden. Die gern bemühte»intersektionalität«, also die Kritik sich überschneidender Diskriminierungsformen, ist schließlich nur dann erhellend, wenn ihr gleichzeitig wirksame Bevorteilungsformen gegenübergestellt werden. Und schon verwandeln sich Schwarz-Weiß-Szenarios in ein Flimmern von Grautönen. Allein die Differenzierung gilt im Kontext der neuen Kulturkämpfe aber schon als verdächtig. Wer die Gleichsetzung von Vorrechten mit Vorteilen kritisiert, ist natürlich nur bestrebt, die eigenen Privilegien zu sichern. Wie schließlich können»privilegierte«beweisen, dass das, was sie in Diskussionen vorbringen, nicht eine raffinierte Sophisterei ist, um Reputation, Rente, Reihenhaus zu sichern? Dass die eben vertretene These nicht kausal darauf zurückzuführen ist, als Kind Tennisunterricht bekommen zu haben? Indem die Privilegienpolizei ein»privilege Profiling«unter ausgewählten Personengruppen vornimmt und sie unter einen Generalverdacht stellt, der sich nicht ausräumen lässt, bringt sie sich in eine letztlich unangreifbare Machtposition. Sie nimmt sich das Recht der Petitio Principii, der zufolge bestimmte Haltungen, Meinungen, Argumente stets Ausdruck von Privilegien sind, und: Privilegien können nur passiv empfangen, nicht aktiv erarbeitet werden. Undenkbar, dass sich jemand aus eigener Kraft etwas verdient hat. Das ist verdammenswerte neoliberale Rhetorik! Wenn Privilegien erarbeitet wurden, dann nur, weil sie aufgrund von nicht erarbeiteten Privilegien erarbeitet werden konnten! Dass es in liberalen Demokratien Privilegien gibt, ist unbestritten. Sie variieren je nach Rechtslage: Die einen dürfen Alkohol trinken, die anderen nicht. Die einen dürfen wählen, die anderen nicht. Diese Privilegien sind weder willkürlich noch per se schlecht oder gut, sondern mal gut und mal weniger gut begründet. Ein Weißen-Privileg aber existiert in liberalen Demokratien nicht, genauso wenig wie ein Liebende-Eltern-Privileg oder ein»ich profitiere von einem Garten während des Corona-Lockdowns«-Privileg. Mal ist der Garten hart erarbeitet, mal mühelos ererbt. Aber Menschen sind eben vergleichende Wesen. Sogar in annähernd paradiesischen Zuständen würden ihnen Mikrounterschiede wie Makrounterschiede vorkommen. All das ist natürlich keine Ausrede dafür, asymmetrische Machtverhältnisse einfach hinzunehmen. Mit Blick auf»racial Profiling«ist ebenfalls oft von Privilegien die Rede: Weiße würden deutlich weniger oft von der Polizei kontrolliert. Es trifft zu, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe vor allem in Grenzregionen häufiger gestoppt und durchsucht werden als Weiße. Aber ist das die einzige Form von Profiling? Jüngere Menschen werden häufiger auf Drogen kontrolliert als ältere und Punks misstrauischer beäugt als Geschäftsfrauen, Männer werden eher eines Gewaltverbrechens verdächtigt als Frauen und härter dafür bestraft. Racial Profiling ist nur eine Facette von etwas, das man»social Profiling«oder»Identity Profiling«nennen könnte. Selbst einer der schärfsten Kritiker des Rassismus und des Racial Profiling in den USA, der Erfinder des Gangsta-Rap, Ice-T, hat einen höheren Differenzierungsgrad erreicht als so manche der akademisch sozialisierten check your privilege!- Rufer. Als Reaktion auf die Bewegung Black Lives Matter, die er unterstützt, veröffentlichte er 2017 den Song No Lives Matter. Darin betont er die gemeinsamen Anliegen jener, die Ungerechtigkeit erfahren:»but honestly it ain t just black / It s yellow, it s brown, it s red / It s anyone who ain t got cash / Poor whites that they call trash.«der neue diskursive Winkelzug aus Akademikerkreisen, wonach»weiß«eigent lich nichts mit Hautfarbe zu tun habe und etwa die von den Nazis ermordeten Juden nicht wirklich weiß gewesen seien, vermag da nicht zu überzeugen. Wenn man diese Logik bedient, springen als Nächstes irgendwelche Alt-Right- Spinner auf den Zug auf und erklären, die Schwarzen in den USA seien gar nicht schwarz und könnten deshalb nicht aufgrund ihrer Hautfarbe benachteiligt sein. Last, but not least hat niemand etwas von weinerlichen, symbolpolitischen Selbstanklagen akademischer Weißer. So bekennt man auf Face book oder Twitter zerknirscht, aus einer zentral gelegenen Altbauwohnung zu senden, weit gereist zu sein und eine tolle Bildung genossen zu haben, selbstverständlich alles nur unverdient empfangen, nicht selbst erarbeitet. Diese Selbstgeißelungen erinnern stark an Augustinus, Bischof von Hippo, der in seinen Confessiones die eigene Sündhaftigkeit bejammerte und auf dem Fundament dieser Geständnisse seine Macht ausbaute. Eher selten hört man gut situierte Privilegienkritiker rufen:»schaut, ich habe mein ganzes Vermögen einer guten Sache gespendet und verbringe den Rest meines Lebens nun auf diesem Nagelbrett, auf dass es anderen besser gehe!«das größte»privileg«ist es, öffentlich die eigenen Privilegien bekennen und sich für sie kritisieren zu können, ohne den Verlust dieser Vorteile befürchten zu müssen. Jörg Scheller, 41, ist Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste, Autor und Metal-Musiker 60 ZEILEN LIEBE Christus kam nur bis Gütersloh: Was die Corona- und Tönnies-geschädigte Stadt so besonders macht VON PETER DAUSEND Zwölf Liter fasst der Pavenstädter Riesenbecher, ein 40 Zentimeter hohes Gefäß aus gelbem, grobgemagertem, brüchigmürbem Ton, das Menschen im Mündungsgebiet von Dalke und Wapel bereits im 17. Jahrhundert vor Christus erschufen. Vielleicht sollte man ihn in diesen Tagen mit»steinhäger Wacholderschnaps«oder»Verler Heimatwasser«füllen dann könnten die Einheimischen ihren Ärger und ihren Frust wenigstens mit Hochprozentigem aus der Region runterspülen. Und aus einem Gefäß, das in seinen Ausmaßen an Ärger und Frust wenigstens halbwegs heranreicht. Pavenstädt wurde 1088 in der Herzebrocker Heberolle erstmals urkundlich erwähnt und ist heute ein Stadtteil von Gütersloh. Und Gütersloh wurde 2020 in der globalen Corona-Krise erstmals in der New York Times erwähnt und ist nun die Heimstatt der Tönnies-Geschädigten. Wer aus Gütersloh kommt, bleibt den Sommer über am besten dort in My own pri vate Gütersloh, sonst wird er gemobbt. Und sie erst recht. Zwei Frauen, die es wagten, mit einem GT- Kennzeichen in Münster einzufallen, wurden beschimpft und bedrängt sie mussten von der Polizei aus der Stadt eskortiert werden. Frieden fanden sie nirgendwo außer in Gütersloh. Aus gutem Grund. Aramäisch, wer wüsste das nicht, ist die Sprache Jesu und in seiner klassischen Form leider ausgestorben. Aramäer aber gibt es noch, und von ihnen leben in Güters loh, ihrer Hochburg zwischen Alpen und Nordsee.»Christus kam nur bis Gütersloh«wäre ein sehr interessantes Buchprojekt für den ortsansässigen Stadtschreiber, hätte nicht Carlo Levi bereits 1945 in einem Roman pub likumswirksam behauptet:»christus kam nur bis Eboli«. Die Verfilmung durch Francesco Rosi hat das 1979 noch untermauert. Trotzdem ist Gütersloh ein Ort, an dem man seine Ruhe finden kann. Was sonst? Zumal die Einwohner der katholisch geprägten Nachbargemeinden die Stadt in ihrer Mitte bis heute»klein-nazareth«nennen. Die protestantisch geprägten Gütersloher galten schon immer als besonders fromm und arbeitsam. Als Menschen, die man andernorts gern hätte. Aber nicht gerade jetzt. Ob der»gütersloher Frühling«rund um Haus und Garten, das Kurzfilmfestival im Programmkino bambi oder das jährliche Wettschwimmen der Plas tik enten auf der Dalke: Alles an und Out of Gütersloh spiegelt Ruhe und Gelassenheit wider. Eine Ruhe, die den Gütersloher gelassen aussprechen lässt: Gott sei Dank bin ich kein Bielefelder. Peter Dausend ist Politischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der ZEIT Online mitdiskutieren: Mehr Streit finden Sie unter zeit.de/streit
12 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 IN DER ZEIT TITELTHEMA Die Macht der Angeber 12 Foto: privat Foto: Jewgeni Roppel für DIE ZEIT Foto: Jelka von Langen ZEITNAH Nach dem Essen, über den Wolken Die Teller waren gerade abgeräumt, die Schutzmasken noch abgelegt, als sich Julia Klöckner (re.) an Bord der Regierungsmaschine»Neustadt an der Weinstraße«den Fragen der ZEIT- Redakteurin Merlind Theile zum Thema Tierwohl stellte. Es hatte Schweinemedaillons gegeben,»alles bio!«, wie die Landwirtschaftsministerin betonte, die am Nachmittag in Zagreb mit ihrer kroatischen Amtskollegin die Staffelübergabe der EU-Ratspräsidentschaft zelebriert hatte. Theiles Reisekosten werden, wie es sich gehört, von der ZEIT beglichen POLITIK, SEITE 2 So schön leer hier! Die Prignitz ist die am dünnsten besiedelte Gegend des Landes ideal für Urlaub in der Unendlichkeit ENTDECKEN, S. 58 Wie die Corona-Pandemie Hans-Jörg Neuschäfer und seine Frau Mercedes nach 62 Jahren Ehe trennte Der Traum der Moderatorin Aminata Belli IN DEN REGIONALAUSGABEN ZEIT im Osten Greiz galt lange als Corona- Hotspot. Nun zeigt sich, welche Rolle das Klinikum der Kleinstadt dabei spielte VON MARTIN NEJEZCHLEBA UND DOREEN REINHARD 16 Vor dreißig Jahren wurde die DDR-Mark abgeschafft. Erinnerungen an den wahren Tag der deutschen Einheit VON CHRISTOPH DIECKMANN 17 ZEIT Alpen Schweiz und Österreich Die Corona-Krise hat den Menschen am Bodensee gezeigt, wie selbstverständlich offene Grenzen für sie sind und dass sie ohne Ein Jahrhundertleben Walter Arlen (li.) gehörte zur Exilgemeinde deutschsprachiger Künstler in Los Angeles. Kurz vor seinem 100. Geburtstag erzählt er von Thomas Mann und all den anderen. Und über seinen Lebensmenschen Howard Myers (re.) DOSSIER, SEITE 13 sie nicht mehr leben können VON FLORIAN GASSER UND LENZ JACOBSEN 16 Die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer musste 50 Jahre lang schreiben, bis ihr der erste Bestseller gelang. Wie gut, dass sie nie aufhörte VON CHRISTINA PAUSACKL 18 Die Schriftstellerin BIRGIT BIRNBACHER fühlt sich von den Bergen erschlagen 18 Der Tiroler Severin Schwan ist CEO des Basler Pharma-Riesen Roche. Einst als Abzocker beschimpft, wird er in der Corona-Krise weltweit gefeiert VON BARBARA ACHERMANN 26 A ZUM HÖREN Die so gekennzeichneten Artikel finden Sie als Audiodatei im»premiumbereich«unter ANZEIGEN IN DIESER AUSGABE Agenda Kultur: Museen, Kunstmarkt, Bühnen (Seite 51), Bildungsangebote und Stellenmarkt (ab Seite 35) FRÜHER INFORMIERT! Die aktuellen Themen der ZEIT schon am Mittwoch im ZEIT- Brief, dem kostenlosen Newsletter Die ZEIT inklusive aller Regional- und Wechselseiten finden Sie in der ZEIT-App und im E-Paper. Foto: Charles-Henry Bédué für DIE ZEIT INHALT POLITIK Tierwohl Kann sie nichts tun, oder will sie nicht? Ein Porträt der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner VON MERLIND THEILE A 2 Das Virus der anderen Während in Deutschland Entwarnung herrscht, erreicht die Pandemie weltweit einen neuen Höhepunkt VON ANDREA BÖHM, KARIN CEBALLOS BETANCUR, KERSTIN KOHLENBERG, JÖRG LAU UND JAN ROSS 3 Bundeswehr Was bedeutet es für Soldaten, wenn Drohnen jetzt bewaffnet werden? VON CATERINA LOBENSTEIN A 4 Frankreich Präsident Emmanuel Macron ergrünt VON GERO VON RANDOW 5 CSU Was muss passieren, damit ein Bayer Kanzler wird? VON MATTHIAS GEIS 6 Grüne Die Partei der Individualisten will nun den Zusammenhalt organisieren VON ROBERT PAUSCH 7 Konjunktur Wie die Regierung die Wirtschaft ankurbeln kann. Ein Interview mit dem Ökonomen Tom Krebs 8 Russland Die Bundesregierung wehrt sich gegen Geheimdienstaktivitäten auf deutschem Boden VON HOLGER STARK 9 STREIT Fleisch Lassen sich Lebensmittel auch ganz ohne Tierhaltung erzeugen? Ein Vegan-Bauer und eine Landwirtin im Streitgespräch 10 Diskriminierung Weiß zu sein ist kein Privileg VON JÖRG SCHELLER Zeilen Liebe VON PETER DAUSEND 11 DOSSIER Intellektuelles Leben In den Vierzigerjahren bauten sich Künstler wie Thomas Mann, Lion Feuchtwanger und Arnold Schönberg bei Los Angeles ein neues Leben auf. Der fast 100-jährige Walter Arlen war Teil dieser Exilgemeinde. Im Gespräch erinnert er sich an seine alten Weggefährten 13 GESCHICHTE Währungsunion Am 1. Juli 1990 wurde die DDR-Mark abgeschafft. Erinnerungen an den wahren Tag der deutschen Einheit VON CHRISTOPH DIECKMANN 17 RECHT & UNRECHT Der politische Fragebogen Diese Woche mit dem SPD-Politiker Karamba Diaby 18 WIRTSCHAFT Wirecard Der Skandalkonzern gab schon früh Rätsel auf. Doch niemand interessierte sich dafür VON INGO MALCHER A 19 BaFin Hat die Finanzaufsicht im Fall Wirecard versagt? Fragen an den BaFin-Präsidenten Felix Hufeld 20 USA Das Land schottet sich ab und sperrt begehrte ausländische Fachkräfte aus VON KATHARIN TAI 21 Medizin Gefährdet ein Gerät für Blutplasmaspenden die Sicherheit von Patienten und Spendern? VON EVA HOFFMANN, LUISA HOMMERICH, YASSIN MUSHARBASH, FLORIAN SCHUMANN UND SASCHA VENOHR 22 Metro Der Chef des Handelskonzerns über Gastronomen in der Krise 24 IT-Sicherheit Tausende Server in Deutschland lassen eine gefährliche Lücke für Hacker offen VON JENS TÖNNESMANN 25 Die Menschen von... der Polizeistation Leipzig-Connewitz, die bei vielen Bewohnern des Stadtviertels verhasst sind VON MARTIN MACHOWECZ A 26 WISSEN Titelthema: Die Macht der Angeber Warum sie uns nerven und wir sie trotzdem brauchen VON STEFANIE KARA, MARCUS ROHWETTER UND URS WILLMANN 27 Blender, Hochstapler, Maulhelden und andere Angeber eine Typologie 29 Ökologie Stammt Holz für Ikea-Stühle aus fragwürdigen Quellen in der Ukraine? VON FRITZ HABEKUSS UND YAROSLAVA KUTSAI A 30 Infografik Nächste Woche ist Weltkusstag. Wissenswertes über das Knutschen 32 Schule So meistert eine norddeutsche Grundschule ihren neuen Alltag VON JEANNETTE OTTO A 33 Schulpolitik Wie geht es nach den Sommerferien weiter? Fragen an vier Kultusministerinnen 34 LEO DIE SEITE FÜR KINDER Film ab! Seit die Kinos wegen Corona geschlossen sind, haben überall im Land Autokinos eröffnet. Die Brüder Valentin und Carl haben das Filmegucken von der Rückbank ausprobiert VON ANDREA BÖHNKE 44 Bestsellerliste Juni Die zehn meistverkauften Romane und Sachbücher für Leser zwischen 5 und 13 Jahren 44 FEUILLETON Polizei Warum ohne Kritik an ihr keine Demokratie möglich ist VON MARTIN EIMERMACHER 45 Theater Wie die Schauspielhäuser ihre Zuschauer vor dem Virus schützen wollen und was das mit dem Fall des drangsalierten russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow zu tun hat VON PETER KÜMMEL 45 Architektur In den Smart Citys können U-Bahnen Fieber messen. Aber die Stadt der Zukunft sollte viel mehr zum Verweilen anregen VON HANNO RAUTERBERG 46 Nachruf Zum Tod des früheren ZEIT-Feuilleton-Chefs und Nabokov-Heraus gebers Dieter E. Zimmer VON ULRICH GREINER 46 Literatur Ein Besuch bei der inzwischen reichlich umstrittenen Schriftstellerin Monika Maron VON MORITZ VON USLAR A 47 Kunst Die Ausstellung»Mapping the Collection«untersucht die blinden Flecke in der Sammlung des Kölner Museums Ludwig VON JÖRG SCHELLER 48 Kolumne Mein Leben als Frau VON ANTONIA BAUM A 48 Sachbuch Der Philosoph Omri Boehm reaktiviert in»israel eine Utopie«vergessene Ideen für ein Ende des Nahost-Dramas VON MICHA BRUMLIK 49 Roman Anna Katharina Hahns schwäbisches Frauen- und Familienepos»Aus und davon«von HUBERT WINKELS 49 Pop Ein Gespräch mit der britischen Sängerin und Songwriterin Laura Marling, die jetzt auf Instagram Gitarrenunterricht gibt 50 Kino»Undine«, Christian Petzolds fantastisch bebilderte moderne Version des Wasserfrauenmythos VON THOMAS ASSHEUER 51 Kuba Die deutsche Kulturprominenz fordert ein Ende des Embargos VON ALEXANDER CAMMANN 51 KINDER- & JUGENDBUCH LUCHS-Preis des Monats für Marianne Kaurins Kinderroman»Irgendwo ist immer Süden«VON KATRIN HÖRNLEIN 53 Die LUCHS-Jury empfiehlt... ein Sachbuch über Kanarienvögel, ein grellbuntes Bilderbuch übers Besonderssein und einen Jugendroman über einen schweren Abschied 53 Literarischer Protest Wie schwarze Jugendbuchautoren in den USA mit ihren Geschichten die Welt verändern wollen und ihre Leser auffordern, den Mund aufzumachen VON KATRIN HÖRNLEIN 53 GLAUBEN & ZWEIFELN Seelsorge Viele Alte und Kranke sind wegen Corona noch immer isoliert. Haben die Kirchen dagegen laut genug protestiert? Es debattieren Margot Käßmann, Christine Lieberknecht, Ulrich Lilie und andere 54 Z ZEIT ZUM ENTDECKEN Wutbürgerle Stuttgart 21, Hygiene- Demos: Die Schwaben sind beim Krawallmachen oft vorne mit dabei. Warum? VON CLAUDIA SCHUMACHER 55 Entdeckt Kokain und Schokotorte VON FRANCESCO GIAMMARCO 57 Reise Schön einsam hier! Corona-Urlaub in der Prignitz VON MORITZ HERRMANN 58 Wie wir reden Gesprächsnotizen aus dem Leben einer 22-Jährigen VON SWANTJE FURTAK 60 Ganz unten Unser Autor entdeckt seine Füße neu beim Barfußlaufen VON JULIUS SCHOPHOFF A 61 Wie es wirklich ist... ein halb leeres Freibad zu beaufsichtigen VON GREGOR GABRIEL 62 RUBRIKEN Leserbriefe 16 Der Zweifel A 27 Die Position 35 Worum geht s? 36 3 ½ Fragen 37 Impressum 62 Was mein Leben reicher macht 62 ANZEIGE 5x DIE ZEIT für nur 5, testen! Mit der ZEIT sind Sie immer bestens informiert. Testen Sie jetzt 5 Ausgaben für nur 5, statt 28,50 im Einzelkauf gedruckt oder digital. Wenn Sie danach weiterlesen, bedanken wir uns mit einem hochwertigen Geschenk Ihrer Wahl. Print oder digital + Geschenk zur Wahl Jetzt direkt bestellen unter: 040/ * *Bitte die jeweilige Bestellnummer angeben: Print Print Stud Digital Digital Stud. Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg
13 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 DOSSIER 13 DIE ZEIT: Herr Arlen, wie geht es Ihnen? Walter Arlen: Ich weiß nicht, ob Sie es wissen: Ich bin 99 Jahre alt. Es wäre etwas übertrieben, wenn ein Mann dieses Alters sagen würde: Mir geht es wunderbar. Lassen Sie es mich so sagen: Ich bin zufrieden. ZEIT: Ihren 100. Geburtstag feiern Sie Ende Juli. Wissen Sie schon, wie? Arlen: Wegen des Virus lassen wir gerade eigentlich niemanden rein. Ein großes Fest wird es also nicht werden. Aber wenn ein netter Mensch vor der Tür steht, werden wir ihm schon öffnen. ZEIT: Herr Arlen, ein hundertjähriges Leben: geboren in Wien, mit 18 Jahren in die USA ge flohen, dem Holocaust entkommen. Nach dem Krieg blieben Sie in den USA, wurden ein erfolgreicher Musikkritiker. Sie komponierten auch selbst. Als Sie über neunzig waren, wurden einige Ihrer Stücke erstmals von den Wiener Symphonikern aufgeführt. Was, würden Sie sagen, ist Ihre Heimat: Amerika oder doch Österreich? Arlen: Meine Heimat? Sagen wir es so: Ich werde nie vergessen können, was ich in Wien gesehen habe, was ich in Wien erlebt habe. ZEIT: Ihre Familie führte das»warenhaus Leopold Dichter«, eines der größten Kaufhäuser Wiens. Arlen: Mein Großvater hatte es 1890 gegründet.»howard!«, ruft Walter Arlen am Bildschirm vorbei. Weil wir aufgrund der Einreisesperre nicht in die USA können, telefonieren wir über FaceTime. Das Handy liegt vor ihm, es ist das iphone von Howard Myers, Jahrgang Er lebt seit über 60 Jahren an Walter Arlens Seite. Sie wohnen in einem Haus in Santa Monica, fünf Autominuten vom Meer entfernt. Hinten im Zimmer, das können wir sehen, steht ein Klavier, an den Wänden hängen Bilder. Insgesamt werden wir fünf Gespräche mit Walter Arlen führen, sie dauern jeweils zwei bis drei Stunden.»Howard, can you bring me the postcard, please?«arlen: (hält die Postkarte des Warenhauses in die Kamera) Das war unser Geschäft, direkt am Brunnenmarkt. Jeden Morgen um sechs Uhr bauten die Marktleute ihre Standl auf und verkauften Viktualien. Unser Geschäft war der Mittelpunkt der ganzen Nachbarschaft. Die Leute sagten:»wo treffen wir uns? Beim Dichter.«Das Warenhaus war von acht Uhr in der Früh bis um sechs Uhr abends geöffnet. 85 Angestellte arbeiteten bei uns, es gab 48 Schaufenster. Stellen Sie sich das mal vor! Zwei Auslagenarrangeure gestalteten die Schaufenster jede Woche neu. Sie kleideten die Puppen ein, veränderten die Landschaften. Ständig blieben Passanten stehen, um sich unsere Auslagen anzuschauen. Wir haben alles geführt: Parfüm, Geschirr, Damenkleider, Herrenkleider, Schuhe, Meterware, Spielzeug. ZEIT: Für einen kleinen Jungen wie Sie muss das ja ein Traum gewesen sein, oder? Arlen: Oh ja. Es gab oben im dritten Stock sogenannte Herrschaftswohnungen. Dort hatten meine Großeltern ihre Wohnung. Nebenan meine Eltern, meine kleine Schwester Edith und ich. Am Morgen, nach dem Aufstehen, bin ich hinunter ins Geschäft gelaufen und direkt in die Spielwarenabteilung. Wenn die Verkäuferinnen mich kommen sahen, riefen sie:»ach, der Walter!«Ich durfte dort machen, was ich wollte. ZEIT: Es waren die Zwanzigerjahre, in Wien lebten Geistesgrößen und Künstler wie Sigmund Freud, Karl Kraus, Arnold Schönberg, Trude Fleischmann und Joseph Roth. Arlen: Wien hatte damals fast zwei Millionen Einwohner, knapp davon waren Juden. Sie haben das intellektuelle Leben der Stadt geprägt. Es gab dort so viele wichtige jüdische Schriftsteller, Maler, Theaterregisseure. Und Musiker. Musiker! ZEIT: Wie kamen Sie zur Musik? Arlen: Mein Großvater hatte im Warenhaus ein für die damalige Zeit hochmodernes Tonsystem installieren lassen. In einem Hinterraum saß das Fräulein Mizzi und legte den ganzen Tag Platten auf ein Grammofon. Meistens liefen Schlager. Ich sang gerne mit. (Er beginnt zu singen:)»wenn die letzte Blaue fährt...«zeit: Sie können es noch? Arlen: Nur noch den Anfang. Die»letzte Blaue«, so nannte man die letzte Tram, die am Abend fuhr. Eines Tages, ich war vielleicht vier oder fünf, stellten mich die Angestellten auf eine Budel, eine Verkaufstheke, und forderten mich auf zu singen. Also sang ich. Die Kunden blieben stehen, sie waren ganz verzückt. Als mein Großvater das mitbekam, schickte er mich zu dem berühmten Schubert Forscher Otto Erich Deutsch. Der bescheinigte mir ein absolutes Gehör. ZEIT: Förderte Ihre Familie Ihr Talent? Arlen: Ich erhielt Klavierunterricht. Die Lehrerin war allerdings eine Katastrophe. Sie war eine alte Jungfer und sehr streng. Sie gab mir Hausaufgaben auf, und wenn ich nicht genug geübt hatte, schimpfte sie. Ich musste dann hundertmal schreiben: Ich muss mehr üben. Manchmal sollte ich auch auf einem Sack Erbsen knien. Es war ein schlechter Start für meine musikalische Karriere. ZEIT: Wie kam es schließlich, dass Sie anfingen, zu komponieren? Arlen: In der fünften Klasse ist der Paul Hamburger zu uns in die Klasse gekommen, der später in London ein gefeierter Pianist werden sollte und mit Künstlern wie der Sängerin Janet Baker und dem Cellisten Pierre Fournier zusammengearbeitet hat. Als er in unsere Klasse kam, hat sich mein Leben von Grund auf ge ändert. ZEIT: Wie das? Fotos: Charles-Henry Bédué für DIE ZEIT (o.); Walter Arlen u. Howard Myers/exil.arte Zentrum/Universität für Musik u. darstellende Kunst Wien Walter Arlen Ende Juni vor seinem Haus in Santa Monica»Ach, der Thomas Mann!«Der Komponist und Kritiker Walter Arlen ist einer der letzten lebenden Zeitzeugen einer großen Epoche. Die Manns, die Feuchtwangers, die Mahlers er kannte all die Exilanten in Los Angeles. Jetzt, mit fast hundert, blickt er zurück auf seine Jugend unter den Nazis und sein Leben im freien Amerika VON MORITZ AISSLINGER UND STEPHAN LEBERT 1951 Walter Arlen als junger Mann in Los Angeles Arlen: Wir sind ständig in die Oper gegangen, immer zu zweit, oben auf die billigen Stehplätze, wo wir zwar nichts sehen, aber alles hören konnten. Unten dirigierten so Kapazitäten wie der Bruno Walter, ein wunderbarer Dirigent, den ich später noch persönlich kennenlernen durfte. Jedes Mal, wenn wir aus der Oper rausgekommen sind, hat der Paul mir die Musik erklärt. Er hat geredet wie ein Wasserfall. Er hat mir alles beigebracht. Das war eine unglaubliche Bereicherung für mich. Er hat aus mir einen Komponisten gemacht. Denn zu dieser Zeit habe ich begonnen, zu komponieren. ZEIT: Interessierte sich Ihre Familie für Kunst? Arlen: Sehr! Mein Vater etwa, der ein sehr guter Vater gewesen ist, war selbst Maler. Wann immer wir in den Wald spazierten, nahm er Pinsel und Farben mit und malte Aquarelle, während wir herumtobten. Er hatte ja beim Schiele studiert. ZEIT: Egon Schiele? Arlen: Ja, klar. Der Schiele gab damals Zeichenkurse, und mein Vater hatte sich da eingeschrieben. Hätte er sich mal ein paar Bilder kaufen sollen... ZEIT: Dann wären Sie jetzt reich. Arlen: Das stimmt. Aber im 18er-Jahr zog diese Grippe durch Wien, die Spanische Grippe. Und dann war Schluss für den Schiele. Neben ihm starben Unzählige. Es war entsetzlich. So wie heute mit diesem Virus. Seit Wochen, erzählt Howard Myers später bei einem Gespräch, seien sie wegen Corona nicht mehr spazieren gewesen. Um Walter dennoch eine kleine Freude zu bereiten, fahre er ihn jetzt oft mit dem Auto durch Santa Monica. Sie halten dann vor den Häusern ihrer Freunde, und wenn jemand da ist, winken Walter und Howard ihnen aus dem Auto heraus zu. ZEIT: Welche Rolle spielte das Judentum in Ihrer Familie? Arlen: Jeden Freitag zündeten wir die Kerzen an, wir aßen koscher. Aber wir waren nicht orthodox. ZEIT: Wurden Sie in der Schule aufgrund Ihrer jüdischen Herkunft ausgeschlossen? Arlen: Wir waren drei Juden in der Klasse. Einige Schulkameraden beleidigten uns, es gab auch einen Professor, der ein Anti semit war. Uns wurde von manchen Leuten früh das Gefühl vermittelt, wir seien so etwas wie Untermenschen. ZEIT: Am 22. Februar 1938 drei Wochen vor dem Einmarsch der Nazis in Österreich schrieb Sigmund Freud, der in Wien seine Praxis hatte, an seinen Sohn:»Ich glaube nicht, daß Oesterreich, sich selbst überlassen, in den Nazismus verfallen würde.«hatten Sie schon vor dem Einmarsch der Deutschen eine Ahnung von dem Terror, der auch Österreich erfassen sollte? Arlen: Ja, und hundert Mal ja! In Wien waren die Hakenkreuze bis zum Einmarsch vom Hitler verboten. Doch die österreichischen Nazis versteckten sie einfach hinterm Revers. Im 37er-Jahr fuhr ich zu Weihnachten mit meiner Tante Gretl mit dem Zug zum Skifahren nach Tirol. Sobald der Zug losgefahren war, holten alle anderen Passagiere in unserem Waggon ihre Hakenkreuze hervor. Der ganze Zug war voller Nazis. Das war eine äußerst unangenehme Erfahrung. Zum Glück haben sie nicht erkannt, dass wir Juden waren. ZEIT: Am Freitag, dem 11. März 1938, erließ Adolf Hitler den Befehl zum Einmarsch in Österreich. Erinnern Sie sich an diesen Tag? Arlen: Am Morgen bin ich noch ganz normal zur Schule gegangen. Ich stand kurz vor der Matura. Abends saßen wir dann mit der Familie um den Tisch beim Großvater und aßen zusammen. Das Radio lief. Um kurz vor acht gab es auf einmal eine Ansprache vom Kurt Schusch nigg, dem Bundeskanzler. Er sagte, dass der Hitler ihm ein Ultimatum gestellt habe und dass er als Kanzler abtreten müsse. Am Ende verabschiedete er sich vom österreichischen Volk. Dieser Tag war mein letzter Schultag, und es war unser letztes gemeinsames Familien essen. ZEIT: In seinem Buch Der Hase mit den Bern steinaugen beschreibt der Autor Edmund de Waal die Stimmung in Wien am Abend nach der Radioanspra che Schuschniggs so:»es ist, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Geräuschrinnsale laufen unten auf der Straße zusammen, die Schottengasse hallt von Stimmen. Sie schreien: Ein Volk, ein Reich, ein Führer!, und: Heil Hitler! Sieg Heil! Und brüllen: Juda verrecke! «Arlen: Genau so war es. Die hatten eine Carte blanche, die Juden zu vernichten. Am nächsten Morgen, am Samstag, bin ich aufgewacht und zu meinem Vater ans Bett gegangen. Er sagte:»sorg dich nicht, es wird nicht so arg.«meine Mutter ging hinunter ins Geschäft. Samstags half sie regelmäßig in der Lederwarenabteilung aus, die von einer gewissen Frau Frank geleitet wurde. All die Jahre war sie zu meiner Mutter, der Tochter des Chefs, scheißfreundlich gewesen. An diesem Morgen sagte sie zu meiner Mutter:»Sie haben hier nichts mehr zu suchen.«meine Mutter kam wieder hoch in die Wohnung, setzte sich an den Tisch und weinte. An diesem Wochenende, mitten in der Nacht, haben sie auch meinen Vater geholt. ZEIT: Was passierte in dieser Nacht? Arlen: Diese Frau Frank aus der Lederwarenabteilung hatte ihren Nazi-Kumpanen die Schlüssel vom Kaufhaus gegeben, die sie vorher geklaut hatte. Um zwei Uhr in der Früh hat es plötzlich fürchterlich gegen unsere Tür gepumpert, wie man in Österreich sagt. Ich stand auf und öffnete. Da standen acht SA- Fortsetzung auf S. 14
14 14 DOSSIER 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28»Ach, der Thomas Mann!«Fortsetzung von S. 13 Leute. Sie hatten mit ihren Gewehrkolben gegen die Tür geschlagen. Sie stürmten ins Schlafzimmer meiner Eltern und zogen meinen Vater aus dem Bett. Sie durchwühlten die Kästen, die Schränke, schmissen alles auf den Boden. Das Geld und den Schmuck steckten sie ein, die riesige Briefmarkensammlung meines Vaters nahmen sie auch mit. Mich haben sie in mein Zimmer geworfen und abgewatscht. Als sie gegangen sind, haben sie sich noch mal umgedreht und gefragt:»soll ma den kleinen Jud auch mitnehmen?«sie haben mich dann dagelassen, aber meinen Vater haben sie mitgenommen. Ich weiß nicht, weshalb. In diesem Moment ist meine ganze Welt zusammengebrochen. ZEIT: Wohin brachten sie Ihren Vater? Arlen: In ein Sammellager in der Karajangasse. Dort war eine Schule, die man zum Gefängnis umfunktioniert hatte. ZEIT: Der Schriftsteller Carl Zuckmayer schrieb später in seiner Autobiografie über diese ersten Tage der nationalsozialistischen Herrschaft in Wien:»Was hier entfesselt wurde, war der Aufstand des Neids, der Mißgunst, der Verbitterung, der blinden, böswilligen Rachsucht und alle anderen Stimmen waren zum Schweigen verurteilt.«arlen: Es war, glaube ich, auch an diesem Wochenende, als ich die Josefstädter Straße hinunterlief. Alle paar Meter stand dort eine Traube von Menschen. Vor ihnen knieten Juden. Die Nazis hatten sie gezwungen, sich ihre Sonntagskleider an zu ziehen, und haben sie dann mit Zahnbürsten das Trottoir schrubben lassen. Als ich weiterlief, entdeckte ich meine Tante Gretl, auch sie auf den Knien und mit einer Zahnbürste in der Hand. ZEIT: Was passierte mit dem Warenhaus Ihrer Familie? Arlen: Am Montagmorgen stand eine Menschenmenge vor unserem Geschäft. Die Leute schrien:»ihr Dreckjuden!«Ich war oben in der Wohnung. Dann erschien ein Mann namens Edmund Topolansky. Der Topolansky besaß ein privates Bankhaus in Wien. Er sagte:»ich bin Ihr Ariseur.«Wissen Sie, was das ist, ein Ariseur? ZEIT: Sagen Sie. Arlen: Das waren diejenigen, die die Geschäfte der Juden enteigneten und übernahmen. Der Topolansky war ein Kumpan vom Adolf Eichmann, sie haben mit ein an der gepackelt. Geschäfte gemacht. Der Topolansky eignete sich unser Warenhaus an. Aber er nahm sich nicht nur unser Geschäft, sondern warf uns später auch aus unseren Wohnungen hinaus. Wir durften nur ein paar Sachen zusammenpacken, dann mussten wir raus. Wir siedelten über in eine Pension. Ich teilte mir ein Zimmer mit meinem Großvater, meine kleine Schwester wohnte mit unserer Mutter in einem anderen Zimmer. ZEIT: Was passierte mit dem Vermögen Ihrer Familie? Arlen: Alle jüdischen Konten wurden beschlagnahmt. Unser gesamtes Vermögen, Reichsmark, kam auf ein Sperrkonto, das der Topo lansky in seiner Bank verwaltete. Ich musste fortan zu ihm in die Bank, um etwas von unserem Geld zu erbetteln, damit wir uns Essen kaufen konnten. Wenn er mich kommen sah, rief er immer:»na, was will der kleine Jud schon wieder?«zeit: Am 15. März 1938 versammelten sich Hunderttausende Wiener auf dem Heldenplatz. Am Vormittag trat Hitler auf den Balkon der Neuen Hofburg und verkündete:»als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!«Die Menschen jubelten ihm zu. Arlen: Dieser Tag! So etwas haben Sie noch nicht gesehen. Hunderte Fokker-Aeroplane flogen über der Stadt. Der Himmel war den ganzen Tag dunkel. Da flogen so viele Aeroplane, dass man die Sonne nicht sehen konnte. Auf den Straßen marschierten Soldaten, überall hingen Hakenkreuze. Ich versteckte mich im Zimmer. Es war schrecklich. ZEIT: Am nächsten Tag sprang der Wiener Schriftsteller und Philosoph Egon Friedell aus dem Fenster seiner Wohnung im dritten Stock, nachdem er beobachtet hatte, wie SA-Leute unten an der Haustür Bewohner nach dem»jud Friedell«fragten. Vor dem Sprung rief er den Fußgängern unten noch zu, dass sie zur Seite treten sollen. Dann sprang er und starb. Weit über hundert Juden und Jüdinnen sollen sich in den Wochen nach dem Einmarsch der Nazis in Wien das Leben genommen haben. Arlen: Meine Mutter wollte auch Schluss machen. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch, nachdem die SA-Leute meinen Vater mitgenommen hatten. Sie saß nur noch am Tisch und reagierte auf nichts mehr. Das Einzige, was sie wollte, war, die Stiegen hinaufzusteigen, um sich vom Dach zu werfen. Ich musste ständig auf sie aufpassen. Irgendwann ging es nicht mehr, ich bin herumgeirrt durch Wien, auf der Suche nach Hilfe. Doch an allen Geschäften, Restaurants und Parks standen nun Schilder mit der Aufschrift:»Juden verboten«. Wie durch ein Wunder kam ich am Sanatorium Helia vorbei. Ich kannte es nicht. Dort gab es keine solche Aufschrift. Ich bin hineingegangen und habe dem Personal den Zustand meiner Mutter beschrieben. Die Leute waren sehr nett und sagten, ich solle die Mutter herbringen. Sie blieb fünf Wochen. Das war ein Glück. ZEIT: Wie erging es währenddessen Ihrem Vater? Arlen: Ich bin ihn eine Woche nach seiner Verhaftung in der Karajangasse besuchen gegangen. Die Häftlinge saßen da dicht gedrängt wie Sardinen, es gab keine Betten, die Leute mussten auf dem nackten Beton schlafen. Es stank bestialisch. Ich fand meinen Vater, er war unrasiert. Als er mich sah, fing er an zu weinen. ZEIT: Sie versuchten, ihn da herauszuholen? Arlen: Ja, aber anfangs vergebens. Nach ein paar Wochen zahlte eine meiner Tanten viel Geld, und sie ließen ihn laufen. Doch er blieb nicht lange auf freiem Fuß. Ihn erwischte es bei einer dieser Razzien, bei denen die Nazis wahllos Juden von der Straße aufgriffen und mit Last autos davonkarrten. ZEIT: Wo brachten sie ihn hin? Arlen: Nach Dachau. Das erfuhren wir aber erst einen Monat später, als wir einen Brief von ihm erhielten. Ich war dann jede Woche im Hotel Métro pole, wo die Ge sta po ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Ich versuchte, meinen Vater aus dem KZ zu bekommen. Doch statt ihn frei zulassen, deportierten sie ihn nach einigen Monaten nach Buchenwald. Da musste er im Steinbruch arbeiten. ZEIT: Währenddessen mussten Sie auch noch Ihre Flucht planen. Arlen: Mein Glück war, dass die Schwester meines Großvaters Ende des 19. Jahrhunderts nach Chicago ausgewandert war. Durch sie bekamen wir Affidavits, also Bürgschaften. Ohne Affidavit war keine Einreise in die USA möglich. ZEIT: Wie organisierten Sie die Flucht? Arlen: Es war mühsam. Ich hatte einen österreichischen Pass, doch der galt nicht mehr. Für die Ausreise brauchte man einen deutschen Pass. Man sagte mir, ich müsse dafür zum Palais Rothschild, das die Nazis beschlagnahmt hatten. Ich solle ganz früh dorthin, damit ich drankomme. Ich bin schon am Abend zuvor angestanden. Es war Januar, und ich trug meinen dicken Mantel, trotzdem war es eiskalt. Ich stellte mich in die Schlange, die sich bereits gebildet hatte. Die ganze Nacht schneite es. Am Morgen kam die Sonne heraus. Ein SA-Mann mit Gewehr spazierte vor dem Palais herum. Er besprach sich mit einem Mann aus dem Gebäude, und auf einmal brachten sie Schaufeln heraus. Der SA-Mann schrie:»jetzt tun ma Schnee schaufeln!«er verteilte die Schaufeln. Aber nur an die alten Juden. Die mit den Bärten und Locken. Einer dieser Männer konnte nach kurzer Zeit nicht mehr und lehnte sich mit seinem Kopf an die Schaufel. Der SA- Mann schrie:»du Saujud! Schaufel! Schaufel den Schnee!«Der Mann aber hatte keine Kraft mehr. Da nahm der SA-Mann sein Gewehr und schlug dem alten Juden mit dem Kolben auf den Kopf. Der Kopf platzte auf, der Mann fiel zu Boden. Der SA-Mann legte sein Gewehr an und erschoss ihn. Ich werde dieses Bild nie vergessen: der weiße Schnee und das rote Blut und der blaue Himmel. Und ich stand da und sah zu. ZEIT: Sie waren damals 18 Jahre alt. Ihr Vater war im Konzentrationslager, Ihre Mutter wollte Selbstmord begehen, Sie mussten für die Familie sorgen und die Flucht planen. Wie schafft man das als Achtzehnjähriger? Arlen: Schafft man es nicht, ist alles Schluss. Also muss man es schaffen. Wie? Das weiß ich nicht. ZEIT: Wann verließen Sie Wien? 1928 Der kleine Walter in Wien, verkleidet als Franz Schubert Arlen: Am 14. März 1939, ein Jahr nachdem der Hitler auf dem Heldenplatz gesprochen hatte, stieg ich nachmittags um vier im Wiener Südbahnhof in einen D-Zug. Am Bahnsteig standen meine Mutter, meine Großmutter und meine Schwester Edith. Sie kamen nicht mit, weil sie auf meinen Vater warten wollten. Als der Zug losfuhr, liefen mir die Tränen nur so hinunter. Mein Gesicht war ganz nass. Ich sah aus dem Fenster meine Familie immer kleiner werden. ZEIT: Wie lautete Ihr Ziel? Arlen: Triest. Dort ging ich an Bord der Vulcania. Ein paar Wochen später kamen wir in New York an. Ich bin dann mit dem Autobus weiter nach Chicago, wo unsere Verwandten lebten. Als ich ankam, hatte ich keine Worte, um meine Enttäuschung auszudrücken. In der Stadt standen lauter halb fertige Wolkenkratzer aus Metall herum, die einen angeschaut haben wie Wilde. Ich habe nur gedacht: Von dem schönen Wien kommst du hierher. Das also ist die Emi gra tion. ZEIT: Wo kamen Sie unter? Arlen: Bei meinen Verwandten. Wie gesagt: Die Schwester meines Großvaters war nach Chicago ausgewandert. Ihre Tochter Fanny hatte einen Herrn aus der Familie Pritzker geheiratet. Kennen Sie die Pritzkers? ZEIT: Wir haben schon mal von ihnen gehört. Arlen: Die Pritzkers wurden später eine der reichsten Familien Amerikas. Ein mir gegenüber ganz besonders freundlicher Cousin, der Jay, hat in den Fotos: Walter Arlen u. Howard Myers/exil.arte Zentrum/Universität für Musik u. darstellende Kunst Wien Walter Arlen (Mitte) in Beverly Hills zwischen seiner Freundin Anna Mahler und dem Musikverleger Irving Mills. Ganz links steht der Komponist Aaron Copland, rechts der Dirigent Lukas Foss Fünfzigerjahren zusammen mit seinen Brüdern die Hyatt-Hotelkette gegründet. Er war zwei Jahre jünger als ich, und wir hatten einen sehr guten Draht zu ein an der, denn er interessierte sich auch für Kunst. Er hat den Pritzker-Preis für Architektur ins Leben gerufen, den es ja bis heute gibt. Er nahm mich abends immer mit, wenn er ausging, und er stellte mich seinen Freunden vor, obwohl ich kaum Englisch sprach. ZEIT: Haben Sie noch Kontakt zu den Pritzkers? Arlen: Aber natürlich! Der eine Pritzker ist heute Gouverneur von Illinois, ein Demokrat. Seine Schwester war die Wirtschaftsministerin vom Barack Obama, und ihr Bruder, der Tony, lebt 15 Minuten von uns entfernt. Er wohnt allerdings etwas geräumiger als wir. Sein Haus ist das zweitgrößte von Los Angeles. Wir gehen ihn regelmäßig besuchen. Das Haus ist ultramodern. Wann immer wir hinkommen, sieht es anders aus. Er lässt das Haus andauernd ummodeln. ZEIT: Wie erging es Ihnen in Chicago? Arlen: Fanny hat mich gleich nach meiner Ankunft zu ihrem Pelzhändler gebracht, der mich für zwölf Dollar in der Woche angestellt hat. Ich musste dort Mäntel reinigen, aufhängen, ein packen. Als Amerika 1941 in den Krieg eintrat, steckten sie mich in eine Chemiefabrik zur sogenannten»kriegswichtigen Beschäftigung«. Aber ich konnte, nach allem, was geschehen war, nicht mehr. Ich stürzte in eine Depression. Auf einmal fielen mir die Haare aus, ganze Büschel. Der psychische Stress. Ich wusste ja nicht, was mit meiner Familie war. ZEIT: Was war mit ihr? Arlen: Meinem Vater war es nach meiner Flucht irgendwie gelungen, aus Buchenwald herauszukommen. Zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester floh er nach London. In London wurden sie dann drei Mal von den Deutschen ausgebombt. Sie überlebten in den U-Bahn- Schächten. Meine Großmutter hatte es nicht aus Wien geschafft. Sie kam nach Theresienstadt und wurde 1942 ermordet. All das wusste ich nicht, als ich in Chicago war. Ich hatte keine Ahnung, ob meine Familie noch lebte. Mein Herz war eingegraben wie mit eisern Hand. ZEIT: Was machten Sie gegen Ihre Depression? Arlen: Ich hatte in der Fabrik einen Kollegen, er hieß Bill. Ein Engel. Er kümmerte sich rührend um mich. Seine Schwester vermittelte mir einen Therapieplatz bei einem gewissen Doktor König, einem orthodoxen Freudianer. Er machte es genau wie der Freud. Und der Freud war ja kein Idiot, nicht mal ein halber Idiot. Sondern ein ziemliches Genie. In der Praxis stand ein Sofa, auf dem ich gelegen habe. Der Doktor König saß hinter mir, sodass ich ihn nicht sehen konnte. Er sagte, ich solle dreimal pro Woche kommen. Ich ging zweieinhalb Jahre zu ihm. Er hat mich geheilt. ZEIT: Wie? Arlen: Er wollte immerzu von meinen Träumen wissen. Am Anfang sagte ich zu ihm:»ich träume nicht.«er lachte und meinte nur:»machen Sie sich keine Sorgen. Die Träume werden kommen.«und sie kamen. Mit der Zeit konnte ich zu jeder Sitzung einen Traum mitbringen. ZEIT: Was träumten Sie? Arlen: Ganz Verschiedenes. Die Träume brachten alte, unterdrückte Begebenheiten und Gefühle zutage. Die ganzen Sachen, die mir in den Monaten der Nazi-Zeit in Wien passiert sind. Aber auch Sexuelles. Drohendes. Kindheitserinnerungen. Das hat mich innerlich auf eine neue Ebene gebracht. Wenn man sich erinnert, ist das nicht immer eine Erleichterung. Aber es bringt einen von A zu Z. Nach den zweieinhalb Jahren schrieb ich vier Lieder. Bis dahin hatte ich seit meiner Flucht nichts komponieren können. Als ich sie geschrieben hatte, entließ er mich. ZEIT: Sie gewannen mit den Liedern gleich einen Musikwettbewerb. Arlen: Das stimmt. So wurde der Komponist Roy Harris auf mich aufmerksam. Er wollte, dass ich für ihn arbeite. Nachdem meine Eltern 1965 und meine Schwester nach Kriegs ende auf der Gripsholm nach Amerika gekommen waren, wurde ich der Assistent vom Harris. Dann kam ich nach Santa Monica. Santa Monica ist ein Vorort von Los Angeles, direkt an der Pazifikküste. Während der Nazi- Herrschaft in Europa ließen sich dort und in der Umgebung einige der größten deutschsprachigen Künstler des 20. Jahrhunderts nieder : die Schriftsteller Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Vicki Baum, Lion Feucht wanger, Franz Werfel und seine Frau, die Musikerin Alma Mahler-Werfel. Die Theater intendanten Max Reinhardt und Leopold Jessner. Die Philosophen Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Ludwig Marcuse. Die Regisseure Fritz Lang und Max Ophüls. Die Komponisten Arnold Schönberg, Hanns Eisler und Bruno Walter. ZEIT: Wie war das Leben inmitten dieser großen Künstler und Künstlerinnen? Arlen: Es war ganz wunderbar. Wir waren eine richtige Gemeinde. Man hat sich gegenseitig angerufen und Neuigkeiten ausgetauscht, über die Heimat und über Kunst geredet. Man kann sich nicht vorstellen, welch ein Glück mir in den Schoß gefallen ist, dass ich dort gelandet bin. Vor den Nazis geflohen, in die Emi gra tion getrieben und dann nach Santa Monica gekommen, wo ich einige dieser Kapazitäten kennenlernen durfte. ZEIT: Wie lernten Sie sie kennen? Arlen: Ich hatte mich, nachdem ich beim Harris aufgehört hatte, in der Musikfakultät der University of California Los Angeles eingeschrieben. Es gab da einen Kurs über Musikkritik. Der Dozent war Kritiker bei der L.A. Times, einer der damals auflagenstärksten Zeitungen der Welt. Wir sollten Rezensionen schreiben. Ihm schien zu gefallen, was ich schrieb. Denn er fragte mich, ob ich nicht für ihn arbeiten wolle. So wurde ich Musikkritiker der L.A. Times. Das war meine Eintrittskarte in die Welt der Exilanten. ZEIT: Ludwig Marcuse schrieb:»ich dachte kaum daran, daß es hier auch Amerikaner gab, hier saß ich mitten in der Weimarer Republik.«Arlen: Ja, so war es. Sie waren alle vor dem Hitler- Regime hierher geflohen, weil die großen Filmstudios gleich um die Ecke waren. Für die konnten sie arbeiten. Die Schriftsteller wurden als Drehbuchschreiber engagiert, die Komponisten für die Filmmusik. ZEIT: Joseph Goebbels nannte die Exilanten»Kadaver auf Urlaub«. Arlen: Daran sieht man, wie dumm dieser Mensch war. ZEIT: Die Emigranten versuchten, sich rund um Los Angeles ein neues Leben aufzubauen. Den 2 km ZEIT-GRAFIK Lion u. Marta Feuchtwanger Hanns Eisler Kalifornisches Künstlerdorf Thomas Mann Franz Werfel Vicki Baum Arnold u. Alma Mahler-Werfel Schönberg Pacific Palisades Theodor W. Adorno Heinrich Mann Walter Arlen Bertolt Brecht Santa Monica einen gelang das besser, den anderen schlechter. Lion Feuchtwanger genoss das Exil, er schwamm jeden Tag eine Runde im Meer und machte danach Gymnastik auf seiner Terrasse. Bertolt Brecht dagegen maulte über die»nuttigen Kleinbürgervillen«. Heinrich Mann wurde von Geldsorgen geplagt, während sein Bruder Thomas der ungekrönte König unter den Exilanten war. Das Magazin New Yorker nannte ihn»goethe in Hollywood«. Arlen: Ach, der Thomas Mann! Wir haben hier eine Promenade am Meer, gesäumt mit Palmen, wie in Nizza oder Cannes. Früher gab es da ein Restaurant, in das alle gingen. Die machten den besten Salat, den ich je gegessen habe. Ich saß dort jeden Mittag. Und fast jeden Mittag ist hereinspaziert: der Thomas Mann. Seine Frau Katia immer an der Seite. Sie musste ihn ja chauffieren. Der Thomas Mann trug so einen Homburg-Hut. Wenn er mich sah, lüftete er ihn und sagte:»guten Tag.«Natürlich bestellte auch er immerzu den wunderbaren Salat. ZEIT: Woher kannte Thomas Mann Sie? Arlen: Er wusste, dass ich Kritiker war, und kannte meinen Namen aus der Zeitung. Manchmal sagte er, dass er wieder etwas von mir gelesen habe, und lobte mich dafür. Irgendwann fragte er, ob ich ihm mal die Ehre erweisen würde, ihn zu besuchen. Ich sagte:»die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Mann.«ZEIT: Wie war der Besuch bei den Manns? Arlen: Sehr nett. Er hat mir das Haus gezeigt, seinen Schreibort. Er stellte mir seine Tochter Erika vor. Es war ein ganz wunderbarer Ort, mit Orangen- und Zitronenhainen. Am Ende des Grundstückes hatte man eine Aussicht auf das Meer. Es kam später aber auch mal zu einer für mich unangenehmen Situation. ZEIT: Erzählen Sie! Arlen: Der Sohn vom Thomas Mann, der Michael, war ja ein Viola-Spieler. Eines Tages gab er ein Konzert, das ich rezensieren musste. ZEIT: Und wie war s? Arlen: Schlecht. Viola spielen konnte der Michael Mann jedenfalls nicht. Aber ich habe mich in der Rezension so freundlich ausgedrückt wie möglich. Ich habe nicht gesagt, was ich als Kritiker hätte sagen sollen. ZEIT: Unweit von den Manns wohnte Lion Feuchtwanger mit seiner Frau Marta in der Villa Aurora. Thomas Mann bezeichnete die Villa als»schloß am Meer«. Arlen: Bei meinem ersten Besuch in der Villa Aurora hatte mich der Chef der Musikfakultät mitgenommen. Der Feuchtwanger saß an seinem Schreibtisch, und ich wurde ihm vorgestellt. Er war nicht sonderlich interessiert an mir. Aber er hat mich gefragt, wer ich bin und wo ich herkomme. Später besuchten wir ihn noch ein paarmal. Nach- Bruno Walter LOS ANGELES Alfred Döblin Hier lebten die Exilanten: Lion Feuchtwanger mit seiner Frau Marta, Vicki Baum, Alfred Döblin, Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht und Franz Werfel mit seiner Frau Alma Mahler-Werfel, die Komponisten Arnold Schönberg, Hanns Eisler und Bruno Walter sowie der Philosoph Theodor W. Adorno
15 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 DOSSIER 15 dem er 1958 gestorben war, übernahm seine Frau Marta die Herrschaft über die Villa Aurora. Wir nannten sie nur»die Fürstin«. Sie war eine imposante Figur. Sie hat stets dieses eine Kleid angehabt hoffentlich war es nicht immer dasselbe. So ein dunkles hochgeschlossenes, das bis hinunter zu den Fußknöcheln ging. Meine Schwester Edith, die auch nach Kalifornien gezogen war und hier als Soziologin arbeitete, wurde eine gute Freundin von ihr. Aber sie musste die Frau Feuchtwanger ständig chauffieren. Wenn die Fürstin beispielsweise zu einem Konzert wollte, rief sie meine Schwester an und fragte, ob sie sie abholen könne. Arlens Schwester Edith starb 2012; auch die anderen Menschen, an die er sich hier erinnert, sind längst verstorben. Walter Arlen ist der vielleicht letzte noch lebende Zeitzeuge, der von den Jahren der deutschen Exilanten in Santa Monica erzählen kann. Zum Ende eines jeden Gesprächs mit ihm, wenn wir ihn fragen, ob wir ihn nächste Woche wieder anrufen dürfen, sagt er:»aber natürlich wenn ich dann noch lebe.«zeit: Nicht alle Exilanten kamen gut mit ein ander aus. Arnold Schönberg zum Beispiel hatte seine Probleme mit Thomas Mann. Arlen: Das war ein Skandal mit dem Schönberg! Und wer hat ihn ausgelöst? Die Alma Mahler. Wer sonst! ZEIT: Was war passiert? Arlen: Der Mann hatte ein Buch geschrieben, den Doktor Faustus. Darin gibt es eine Figur namens Leverkühn, ein genialer Komponist und ein Syphilitiker. Als das Buch herauskam, hat sich die Alma Mahler ein Exemplar gekauft und beim Lesen sofort gemerkt, dass der Mann in seinem Leverkühn den Arnold Schönberg porträtiert. Die Alma, die ein Biest sein konnte, griff sofort zum Telefonhörer und rief den Schönberg an:»weißt du eigentlich, dass der Mann dich in seinem neuen Buch porträtiert?«der Schönberg war natürlich sehr bös darüber. ZEIT: Schönberg war empfindlich? Arlen: Aber auch ein ganz lieber Mensch. Ich lernte ihn nach einem Konzert kennen. Er war sehr aufmerksam. Er wollte wissen, wer ich bin, wo ich wohne. Ich bin bis heute mit der Schönberg Familie befreundet. Sein Sohn Ronnie und dessen Frau Barbara, die Tochter des Komponisten Erich Zeisl, wohnen zehn Minuten von unserem Haus. Wir sind oft bei ihnen zu Besuch. Barbara bringt uns jedes Jahr zu Weihnachten eine selbst gemachte Sachertorte. ZEIT: Stimmt es, dass Arnold Schönberg mit Charlie Chaplin Tennis gespielt hat? Arlen: Stimmt. Mein Onkel, der auch hier wohnte, hat dort ebenfalls gespielt. Aber er war nicht interessiert an solchen Prominenzen. ZEIT: Arnold Schönberg starb Arlen: Ich war auf dem Begräbnis. Der Rabbiner, der es leitete, war leider ein Idiot. Er hielt eine Rede über den Schönberg: ein großer Komponist und so. Am Ende aber sagte er, der Schönberg komme jetzt in den Himmel, und die Pforten des Himmels würden sich öffnen zu seinen wunderbaren Klängen. Hätte der Schönberg das gehört, Foto: AP Photo/dpa 1941 Thomas und Katia Mann mit Enkeln vor ihrem Haus in Pacific Palisades hätte er sich im Grab umgedreht. Er war ja der Erfinder des Atonalen. Nicht der»wunderbaren Klänge«. ZEIT: Ups. Arlen: Ich erinnere mich, wie ich vor dem Begräbnis noch in die Leichenhalle ging. Der Schönberg lag da aufgebahrt. Als ich zu ihm hinunterschaute, habe ich einen solchen Schock bekommen. Ich habe mich umgedreht und bin hinausgelaufen. ZEIT: Warum? Arlen: Das Gesicht war ganz eingefallen. Dünn. Meine gute Freundin Anna Mahler hat Schönbergs Totenmaske angefertigt. Da sieht man es. ZEIT: Anna Mahler, die Tochter von Gustav und Alma Mahler? Arlen: Richtig. Sie war Bildhauerin. Jedes Mal, wenn hier jemand gestorben ist, hat man sie gerufen, damit sie die Totenmaske anfertigt. Sie hat nie Nein sagen können, es war ja ihr Job. Aber vor mir klagte sie ständig:»ich kann nie das machen, was ich machen will. Entweder muss ich Auftragsarbeiten machen. Oder Tote.«Die Totenmaske vom Feuchtwanger hat sie auch modelliert. ZEIT: Wie lernten Sie Anna Mahler kennen? Arlen: Ihr war eine Rezension von mir über irgendeine Sängerin aufgefallen. Sie rief mich an und sagte:»ich habe einen Text von Ihnen gelesen. Der war so bissig ich muss Sie kennenlernen!«sie wurde eine wunderbare Freundin. ZEIT: Sie waren ein strenger Kritiker? Arlen: Nun ja. Sagen wir es so: Wenn der Komponist Leonard Bernstein eine Rezension über eine seiner Aufführungen las, die ihm nicht gefiel, schrieb er dem verantwortlichen Kritiker gern einen bösen Brief. Und ich habe ziemlich viele Briefe von Bernstein bekommen. ZEIT: Anna Mahler mochte also die Schärfe Ihrer Texte. Was verband Sie beide noch mit ein an der? Arlen: Zwanzig Jahre lang hat sie mich jeden Samstag zum Essen eingeladen. Sie sagte:»du darfst dir samstags nie etwas vornehmen, denn da kommst du zu mir.«das war so rührend von ihr. Sie lud immer andere interessante Persönlichkeiten dazu ein. Dort habe ich auch den Bruno Walter kennengelernt, den ich als Junge in Wien mit meinem Freund Paul Hamburger bewundert habe. Er war ja der Nachbar vom Franz Werfel und der Alma. ZEIT: Alma Mahler-Werfel war berüchtigt. Arlen: Sie war eine beeindruckende Frau. Und eine glänzende Schönheit. Nicht umsonst haben sich so viele Männer in sie verliebt, der Gustav Klimt, der Oskar Ko kosch ka, der Mahler und der Werfel, der Walter Gropius. Einmal hat die Anna hier ein Fest für ihre Mutter organisiert. Sie hat einen richtigen Thron für sie aufgestellt, auf den die Alma sich wie selbstverständlich setzte. Es war eine riesige Party. Man konnte sich kaum bewegen. Die Anna hat mich irgendwann genommen und gesagt:»komm, ich stell dich der Mami vor«sie nannte sie Mami. Wir gingen hin, und die Anna sagte:»mami, das ist der Walter, von dem ich dir schon so viel erzählt habe.«alma sagte zu mir:»stell dich daher. Neben den Thron.«Dann packte sie mit ihren Fingern mein Ohrläppchen und ließ es eine Dreiviertelstunde nicht mehr los. Warum, weiß ich nicht. ZEIT: Alma Mahler-Werfel war Antisemitin. Wusste sie nicht, dass Sie Jude waren? Arlen: Sie hatte ja eine ganz komische Beziehung zum Judentum. Einerseits war sie eine furchtbare Antisemitin, andererseits waren zwei ihrer drei Ehemänner Juden: der Mahler und der Werfel. Nur der Gropius nicht. Ich habe sie einmal gefragt, wer von ihren Männern ihr Liebling war. ZEIT: Wer war s? Arlen: Sie sagte:»der Mahler und der Werfel.«Daraufhin fragte ich:»und der Gropius?«Da hat sie nur die Nase gerümpft. Obwohl er der einzige Nichtjude war! ZEIT: Eine besondere Beziehung hatten Sie zu Igor Strawinsky. Arlen: Ihn habe ich verehrt wie niemanden sonst. Ich bin zu jeder seiner Proben. Als Kritiker konnte ich das ja. Einmal, es war Anfang der Sechzigerjahre, fand abends eine Probe statt, und ich habe meinen Vater mitgenommen. In der Pause schaue ich neben mich. Der Vater ist weg. Ich blickte umher und entdeckte ihn in der Ecke mit dem Strawinsky! Sie sprachen aufgeregt und hielten ihre Hände so komisch vor sich. Ich habe mich hingeschlichen, um zu hören, was da los ist. Sie unterhielten sich über die Altersbeschwerden, die sie plagten. Der Strawinsky hatte seine Pillen herausgeholt und beschrieben, was wofür war. Dann forderte er meinen Vater auf, seine Pillen rauszuholen. Mein Vater erklärte ihm: Das ist gegen die Magensäure, die Pille für dieses, die Pille für jenes. Auf einmal fragte der Strawinsky erschrocken:»and where are your sleeping pills?«sagt mein Vater:»I don t take sleeping pills.«und der Strawinsky ungläubig:»you don t take sleeping pills? Only babies don t take sleeping pills.«zeit: Sie verfolgten Strawinskys Karriere bis zu seinem Tod Arlen: Wir kannten uns bestimmt 20 Jahre und er hat sich nie meinen Namen merken können. Aber wo immer er mich sah, kam er sofort auf mich zu und wollte mir zeigen, was er gerade komponierte. Einmal, nach einer Probe in der Hollywood Bowl, einer Freilichtbühne in den Hollywood Hills, fragte er mich, ob ich ihn mit meinem Auto mitnehmen und ihn zu Hause abliefern könne. Habe ich natürlich gemacht. ZEIT: Worüber haben Sie auf der Fahrt geredet? Arlen: Ich habe überhaupt nichts gesagt. Denn er hat geredet und geredet. Wie ein Wasserfall. Er war aufgeregt, weil er zum ersten Mal seit 1914 nach Russland fahren sollte. Der Chru schtschow wollte ihn empfangen. Unter Stalin ist er ja nie nach Russland, seine Musik war verboten. Der Chru schtschow hat das geändert. Der Strawinsky hat von nichts anderem gesprochen als von der bevorstehenden Reise. ZEIT: Sie haben über viele Jahrzehnte mit einigen der größten Komponisten der Welt zu tun gehabt. Was wurde eigentlich aus Ihren eigenen Kompositionen? Arlen: Während meiner ganzen Zeit als Kritiker, also bis in die Achtzigerjahre, lagen meine frühen Kompositionen in der Schublade. Für mich war das nicht zusammenzubringen, der Beruf des Kritikers und der des Komponisten. Ich hatte Angst davor, dass die Leute sagen: Der kritisiert alle und schreibt selbst so einen Mist. ZEIT: Wie kam es, dass Sie wieder anfingen, zu komponieren? Arlen: Am 11. Mai 1958 lernte ich auf einer Party Howard kennen. Es war der beste Tag in meinem Leben. Er zeigte mir viele, viele Jahre später, als ich nicht mehr als Kritiker arbeitete, Gedichte von Johannes vom Kreuz, einem spanischen Mystiker, die mich so sehr inspirierten, dass ich mich wieder an eigene Kompositionen wagte. Howard hat mir in all den Jahren unendlich viel geholfen. Jeden Morgen macht Howard Walter ein Müsli mit frischem Obst, dann frühstücken sie. Vor Corona gingen sie auch regelmäßig ins Fitnessstudio und besuchten Freunde. Die melden sich nun per Telefon, weshalb es nicht selten vorkommt, dass es besetzt ist, wenn wir anrufen. ZEIT: Es geht in Ihrer Musik um Sehnsucht, Verlust und Trauer. Als Sie Howard Myers kennenlernten, sagten Sie ihm, er müsse eines wissen: dass Sie nie ein glücklicher Mensch werden können. Arlen: Ich werde nie vergessen, was passiert ist. Seit 1938 konnte ich nie wieder wirklich lachen. Egal, wohin ich gehe, da ist immer eine gewisse Trauer, ein gewisser Verlust, der mich begleitet. Meine Mutter beging, als sie in Chicago war, Selbstmord. Sie konnte die Bilder und die Ereignisse einfach nicht mehr aus ihrem Kopf löschen. Auch einer meiner Onkel und ein Cousin begingen Selbstmord. Meine Großmutter wurde im KZ ermordet. Mein Vater starb glücklicher, hier bei uns vor der Tür, an einem Sonntag, als Howard und ich gerade mit ihm spazieren gingen. ZEIT: Wurden Sie für das, was Ihnen angetan wurde, je von Österreich entschädigt? Arlen: Ach. Der Ariseur Topolansky, der unser Warenhaus beschlagnahmt hatte, erschoss sich 1947, als er sich vor einem Volksgericht verantworten musste. Seine Witwe drohte, sie werde uns mit Klagen überziehen, sollten wir eine Entschädigung von ihr verlangen. Wir hätten dafür nach Wien gemusst. Doch die Reise wäre zu dieser Zeit sehr beschwerlich gewesen, ganz zu schweigen von all den Behördengängen. Die Österreicher haben es den Juden fast unmöglich gemacht, Wiedergutmachung zu erlangen. Wir sind erst 1965 das erste Mal wieder nach Wien gereist. ZEIT: Ihr Lebensgefährte zeigte Ihre Kompositionen 2007 heimlich einem Musikproduzenten. Der war begeistert erschien Ihre erste CD. Schließlich wurde Ihre Musik von den Wiener Symphonikern uraufgeführt. Da waren Sie weit über 90 Jahre alt. Verspürten Sie Stolz? Arlen: Ich war nie stolz auf irgendetwas, das ich getan habe. Aber ich habe mich gefreut. Denn ich habe nie eine Stadt mehr geliebt als Wien. ZEIT: Wollen Sie noch einmal dorthin zurück? Arlen: Nein. Mit hundert Jahren fährt man nicht mehr weg. Mit hundert Jahren bleibt man zu Hause. ANZEIGE 3. FORUM ANTHROPOZÄN Fotos: Gabriele Pichler Klimawandel durch CO₂-Anstieg: Die Meeresbiologin Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, machte klar, dass der CO₂-Gehalt der Atmosphäre trotz des Corona-Lockdowns weiter auf Rekordkurs ist. Das 3. Forum Anthropozän fand wegen Covid-19 erstmals als zweistündiges ONLINE ZEIT- GESPRÄCH statt. Zum Thema»KLIMA. DIE KRISE. Warum Wissenschaft und Macht im Dialog bleiben müssen«verwiesen sechs Vertreter aus Wissenschaft und Politik aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Kasachstan auf die Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Wissenschaft und Macht sowie die Dringlichkeit des Handelns.»Wir können mit dem Handeln nicht warten, bis wir alles wissen«, so die Meeresbiologin Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener- Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Moderiert wurde das Forum vom ZEIT-Wissenschaftsjournalisten Fritz Habekuß. Auch Marcus Wadsak, der Leiter der ORF-Wetterredaktion, unterstreicht den Faktor Zeit. Dass die globale Erwärmung menschengemacht sei, bedeute gleichzeitig, dass wir die erste Generation seien, die bereits die Folgen des Klimawandels spüre, und die letzte, die etwas dagegen tun könne:»es gibt derzeit keinen wissenschaftlichen Grund, warum wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen können. Es liegt nur an uns und unserem Handeln!«Daher fordert Peter Kaiser, der Landeshauptmann von Kärnten, dass Politik und Wissenschaft eine globale Verantwortung übernehmen müssen. Wissen und Handeln müssten kongruenter werden und auch der gesellschaftliche Gegenwartsegoismus müsse der Verantwortung für die Enkelgeneration weichen. Denn: Anders als gegen COVID-19 werde es gegen die dramatischen gesundheitlichen und ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels keine Impfung geben, so Kaiser. Auch der deutsche Ökologe und Geograf J. Daniel Dahm sieht in der großen Wissenslücke zwischen politischökonomischer Macht und wissenschaftlicher Erkenntnis ein Hindernis für eine zukunftsfähige Politik. Online ZEIT-Gespräch (von links): Landeshauptmann Peter Kaiser, Fritz Habekuß (Redakteur, DIE ZEIT) und Meeresbiologin Antje Boetius. Online zugeschaltet: Ökologe und Geograf Daniel J. Dahm, der Schweizer Ökonom und Präsident der Ethos-Stiftung, Rudolf Rechsteiner, der Kasachische Botschafter in Österreich und Slowenien, Kairat Sarybay und der Leiter der ORF-Wetterredaktion Marcus Wadsak. Klimaschutz:»Wir können mit dem Handeln nicht warten, bis wir alles wissen!«ist Corona ein Wendepunkt für den Klimaschutz? Rudolf Rechsteiner, Schweizer Ökonom und Präsident der Ethos-Stiftung, bewertet die Corona-Krise als historische Zäsur und damit als Wendepunkt in der Rolle der Wissenschaften:»Die Wissenschaften ermöglichten einen unglaublichen Aufschwung der Menschheit. Wollen wir unsere Zukunft sichern, müssen wir auch ihre Warnungen ernst nehmen«, fordert er. Anhand der Corona- Krise erläutert Antje Boetius die Bedeutung des Faktors Zeit. Zwar habe der Stillstand durch den Lockdown die größte Senkung von CO 2 - Emission gebracht größer als die Weltkriege, größer als die Ölkrise, größer als der Zusammenbruch der Sowjetunion»aber es reicht nicht!«der CO 2 -Gehalt in der Atmosphäre steige weiter an nur etwas langsamer.»denn der aktuelle CO 2 -Gehalt wird von vielen physikalischen und biologischen Faktoren bestimmt, und das über lange Zeiträume«, so Boetius. Auch Wadsak spricht von einem Denkfehler in der Corona-Krise:»CO 2 ist ein extrem langlebiges Gas, das wir nicht loswerden, auch wenn wir vorübergehend etwas weniger ausgestoßen haben. Darüber hinaus hat die Klimakrise nicht nur wirtschaftliche Folgen sie kostet auch Menschenleben.«J. Daniel Dahm ist überzeugt, dass diese Krise Alternativen im ökonomischen und politischen Handeln aufgezeigt habe. Durch die Pandemie und den Lockdown sei uns vor Augen geführt worden, dass wir in kürzester Zeit unsere Ökonomie grundlegend verändern könnten. Und dass vieles in unserer Infrastruktur, beispielsweise in der Wasser-, Energie- und der Nahrungsmittelversorgung, offenbar zu schlecht bezahlt und infrastrukturell zu wenig ausgebaut ist. Unsere Infrastrukturen und Institutionen seien nicht auf unsere tatsächlichen Bedarfe ausgerichtet und auch nicht auf die Bedarfe der kommenden Generation, so Dahm. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die globale Erwärmung menschengemacht ist und daher auch von Menschen beeinflusst werden könne, betonte Marcus Wadsak, Leiter der ORF-Wetterredaktion. Klimawandel als Top-Thema für Investments Für Rechsteiner ist die Wirtschaft sowohl Täter als auch Teil der Lösung und er ging der Frage nach, wie die Finanzmärkte zu einer ökologischen Transformation beitragen könnten. Dabei zeigte er auf, dass der Klimawandel bei immer mehr Unternehmen zum Top-Thema wird und große Vermögensverwalter bereits damit begonnen hätten, Klimawandel ernstzunehmen. Für den Ökonomen sei es ein sichtbares Zeichen des Wendepunktes, dass in den letzten Jahren viele Unternehmen mit fossilen Energien gescheitert sind. Damit steige das Potenzial erneuerbarer Energien als Investment. S.E. Kairat Sarybay, der Kasachische Botschafter in Österreich und Slowenien und Ständiger Vertreter der OSZE, verwies auf die erheblichen ökologischen Herausforderungen seines Landes, wie die Austrocknung des Aralsees. Er hob hervor, dass die globalen Herausforderungen nicht alleine gelöst werden könnten. Daher seien das Erkennen und Verstehen globaler Zusammenhänge, eine grenzübergreifende, nachhaltige Kooperation von Staaten und die Unterstützung neuer Technologien enorm wichtig. Sabine Seidler, Initiatorin des Forum Anthropozän, gab bekannt, dass sich das Forum per Vorstandsbeschluss dem Klimavolksbegehren in Österreich anschließt und hofft auf große Unterstützung seitens der Bevölkerung. Die OSZE bemühe sich deshalb in ihren Sicherheitsfragen in Wirtschaft und Umwelt intensiv um die Entwicklung internationaler Zusammenarbeit. Auf ein Zusammenrücken Europas hofft daher auch Peter Kaiser:»Wir beobachten in der Weltwirtschaft eine neue asiatisch-chinesische Dominanz neben der bisherigen US-Dominanz. Umso wichtiger ist es, jetzt die europäische Allianz zu stärken und geeint zu handeln.«er plädierte dafür, auf internationaler Ebene ein ökosoziales Steuersystem so rasch wie möglich einzuführen.»die Maxime, die man nun braucht, heißt globales Denken und regionales Handeln.«Einig ist sich die Gesprächsrunde, dass es keinen Grund gibt, Klimaschutz zu fürchten. Er kann dazu beitragen, soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen und zu mehr Lebensqualität führen. Wichtig sei dabei neben ökologischen und ökonomischen Fragen auch der Mut zur Erneuerung und zum Neubeginn. Ankündigung: Das 4. Forum Anthropozän findet vom in Heiligenblut am Großglockner, Nationalpark Hohe Tauern statt. Weiterführende Informationen finden Sie unter:
16 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 DAS LESERZITAT ZUM KAMPF GEGEN STRUKTURELLEN RASSISMUS:»Seien wir also überaus vorsichtig mit der Entscheidung, wem wir privat wie öffentlich ein Denkmal errichten. Und seien wir ebenso vorsichtig bei den zeitgenössischen Revisionen ebendieser.«von Matthias Bartsch LESERBRIEFE Zur Ausgabe N o 26 IM NETZ Weitere Leserbriefe finden Sie unter blog.zeit.de/leserbriefe 16 Freundschaft in der ZEIT-Blase Alard von Kittlitz:»Nie waren wir einander so nah«zeit NR. 26 Auch Weiße dürfen mitmachen Jens Jessen:»Der neue Bildersturm«ZEIT NR. 26 Maschinen im Dilemma Richard David Precht:»Roboter können keine Moral«ZEIT NR. 26 Ich möchte mich sehr für das gelungene Dossier zum Thema Freundschaft bedanken. Privat und in meiner Arbeit als Psychoanalytikerin erlebe ich, wie hilfreich gute Freundschaften sein können, aber auch, wie schwer der Verlust derselben einen trifft und wie einsam und unsicher das Fehlen von FreundInnen Menschen macht. Stefanie Kuhn, München Ich zähle es zu den herausragenden Privilegien meines Lebens, dass ich mit meinem besten Freund seit über 50 Jahren gemeinsam durch das Leben gehen darf. Rückblickend erfüllt unsere Freundschaft die Kriterien der»wahren Freundschaft«im aristotelischen Sinne. Gleichzeitig leben mein Freund und ich jeweils in dreißigjährigen Partnerschaften mit unseren Ehefrauen. Glücklicherweise zwingt uns niemand zu einem Ranking. Thomas Werner, Rieseby Gute Freunde sind für 85 Prozent der (erwachsenen) Deutschen wichtig. Haben sie auch tatsächlich alle gute Freunde? Und was ist mit den 15 Prozent, für die Freundschaft nicht wichtig ist? Einen möglichen Grund nennen Sie: sie haben keine Zeit,»nutzlos rumzuhängen«. Das gemeinsame Lernen von Schülern oder Studenten, das gemeinsame Werkeln im Garten, am Haus hat für Sie offenbar nichts mit Freundschaft zu tun, eher das Biertrinken in der Kneipe. Aber erweist sich wahre Freundschaft nicht in der Anspannung, wenn man anpacken muss,»in der Not«(wie ein Sprichwort sagt)? Oder gilt dies in der (weltweiten)»speers ort- Blase«nicht? Adolf Ronnenberg, Hannover Amazon sucht Liebe Ann-Kathrin Nezik:»Die unheimliche Maschine«ZEIT NR. 26 Das Gerede von»unersetzlich«und»unentbehrlich«stärkt die Marktmacht von Amazon eher noch, weil es auch die letzten Konsumenten zur»unheimlichen Maschine«treiben könnte. Dass Amazon ein Fall fürs Kartellamt ist, kann man auch anders sagen. Dr. Eberhard von Faber, Bornheim Eingebildete Menschheitsbeglücker wie Jeff Bezos versuchen alles Mögliche, um sich die Liebe der Weltbevölkerung zu erkaufen. Vielleicht probieren sie es mal ganz ohne Geschäftssinn und verzichten auf ihr gesamtes Vermögen außer einem»notgroschen«von 1 Mil liar de Dollar. Inzwischen würde das Vermögen der vier reichsten Männer der Erde reichen, um das Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung zu verdoppeln! Je nach Zählweise waren dazu vor zwei Jahren noch 26 bis 40 Mil liar dä re nötig. Markus Schilling, per BEILAGENHINWEIS Die heutige Ausgabe enthält folgende Publikationen in einer Teilauflage: ATB Arbeitsausschuss Tourismus, Braunschweig; Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik (GEP) ggmbh, Frankfurt am Main; Höffner Möbelgesellschaft, Schönefeld; Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.v., Neustadt/Wstr. (Memostick). Mal wieder ein Artikel eines»alten weißen Mannes«, der die Vorurteile gegenüber dieser»gruppe«bestätigt. Schade. Sichtlich nicht gelesen hat Herr Jessen Chimamanda Ngozi, Kübra Gümüşay, Noah Sow, Karim Fereidooni und andere schade. Klar, es gibt wie überall bei Versuchen, starre Strukturen zu lockern übertriebenes Handeln. Herr Jessen unternimmt aber den altbekannten Versuch, die Übertreibungen zum Anlass zu nehmen, gleich das gesamte Anliegen infrage zu stellen. Struktureller Rassismus ist aber keine»wahnidee«. Vielmehr liegt genau im strukturell und institutionell verankerten Rassismus die Ursache dafür, dass alle bisherigen Versuche, gegen den sichtbareren Rassismus vorzugehen, gescheitert sind. Dr. Sibylle Riffel, Darmstadt Endlich weist mal jemand deutlich darauf hin, dass die BekämpferInnen des»rassismus«selbst die besten VerteidigerInnen des Rassebegriffs sind. Denn auf subtile Weise brauchen sie ja die diskriminierende Vorstellung von einer»rasse«, um ihren Gegnern genau diese Diskriminierung vorwerfen zu können; sonst funktionierte der Vorwurf einfach nicht. Es ist Jens Jessen sehr zu danken, dass er den»rassismus«-begriff auf die Füße eines individuellen Verhaltens stellt, das dann auch individuell belangt werden kann. Und er macht schön deutlich, dass die ganze Aufregung um Symbole, Monumente und Benennungen vor allem eine akademische Schicht umtreibt, die sich gern im Raum von Symbolen, Monumenten und Benennungen aufhält, aber offenbar nicht gern woanders. Joachim Schieb, Bad Vilbel Struktureller Rassismus meint keineswegs, Rassismus sei bei hellhäutigen Menschen unvermeidlich, sondern, dass er tief in unserer Kul tur verwurzelt ist, wir deshalb alle zu rassistischen Affekten neigen und Weiße, weil sie mit Alltagsrassismus viel seltener konfrontiert sind, weniger darüber nachdenken, sprich diesen Affekten öfter nachgeben. Wir können die historischen Verdienste von Churchill, Kant, Jefferson, Gandhi et cetera also weiterhin rühmen, nur die kritiklose Heldenverehrung sollten wir angesichts ihres Menschenbildes lieber als überkommen entsorgen! Und hoffen, dass Polemik gegen Minderheiten sich nicht als unique selling point der ZEIT etabliert. Philipp Höck, per Es ist fürwahr schwer, einem Menschen aus guten Gründen ein beständiges Denkmal zu setzen, ob nun ideell oder gar plastisch. Wir leiden aus menschlicher Kurzsichtigkeit allzu oft an fehlerhafter Diagnostik, die fatalen historischen Ergebnisse daraus sind zwar oftmals bekannt, aber selten vollumfänglich aufgearbeitet. Seien wir also überaus vorsichtig bei der Entscheidung, wem wir privat wie öffentlich ein Denkmal errichten; und seien wir ebenso vorsichtig bei zeitgenössischen Revisionen ebendieser. Kein Mensch ist auch nur annähernd frei von Fehl und Tadel, Zwietracht und Bruchlinien stecken offenkundig in unser aller Genen. Aber lassen wir die Denkmale grundsätzlich als Zeitzeugen stehen, die achtenswert sind. Auf dass über das, was sie zu ihrer Zeit gegeben und genommen haben, gestritten, aufgeklärt, gelehrt und gelernt wird. Matthias Bartsch, Lichtenau Der weiße Autor findet, Nazis vertreibt man nicht, indem man allen die Schuld gibt, und tagtägliche rassistische Handlungen, die People of Color erlebt haben, müssen der Gefahr des nationalsozialistischen Gedankenguts erst mal untergeordnet werden. Denn davon gibt es ja viel mehr, und Schwarze sind halt einfach in der Minderheit in Deutschland. Wahnsinn. Ich bin schockiert und sprachlos. Ich hoffe, dem Autor blüht ein richtig schöner Shitstorm. Ich würde empfehlen, dass Ihre Redakteure sich zum Thema Rassismus weiterbilden. Denn: Überraschung! es ist kein Widerspruch, gegen strukturellen Rassismus vorzugehen und gleichzeitig gegen rechtsradikales Gedankengut. Diana Alemann, per Jens Jessen verkennt die Kontroverse um»all Lives Matter«als das Nichtzulassen von Empathie bekundungen Weißer. Dabei gibt es doch eine Bewegung, in der Weiße willkommen sind, die ebendas zum Ziel hat, nämlich»black Lives Matter«. Genauso wie beim Feminismus geht es hier nicht darum, einen Überlegenheitsanspruch von Frauen oder Schwarzen zu manifestieren, sondern die benachteiligte Gruppe zu benennen. Ebenso ist niemand, der sich gegen institutionellen Rassismus wendet, gegen individuelle Verantwortung oder Strafverfolgung. Man kann gerne eine Debatte über die historisch gewachsene deutsche Affinität zu überindividueller Schuld führen, ohne gleich jede systematische Erklärung zu entwerten. Tim Stadler, per Vor weniger als hundert Jahren wurden in Deutschland Bücher verbrannt und»entartete Kunst«entfernt. Egal welche Ideologie dahintersteckt wehret den Anfängen! Wir brauchen Handwerker und keine Horden von Geisteswissenschaftlern, die die Deutungshoheit für sich beanspruchen. Dr. Bernd Ahne, Altusried Nicht tragisch, sondern dumm Zu unserer Berichterstattung über Philipp Amthor, CDU, und die Firma Augustus Intelligence ZEIT NR. 26 Die Blauäugigkeit von Philipp Amthor ist angesichts seiner juristischen Ausbildung und seiner Einbindung in die Strukturen der CDU unverständlich. Aber die entscheidende Frage ist: Was wollen diese Männer mit der Firma Augustus Intelligence und ihrem konservativen Männerbund erreichen? Dies sollte im Rahmen der Aufarbeitung der Affäre geklärt werden. Denn es muss das»geschmäckle«der Käuflichkeit von Abgeordneten ausgeräumt werden, damit nicht neue populistische Aversionen gegen die demokratischen Organe unseres Staates provoziert werden. Klaus-Dieter Busche, Offenbach Einmal mehr eine Bestätigung, wie kümmerlich die Personaldecke bei allen Parteien ist. Als Kandidaten bleiben nur noch diese selbstgefälligen Opportunisten, Streber mit Überlegenheits-Dünkel übrig. Und wenn ich keine mir geeignet erscheinenden Kandidaten präsentiert bekomme, bleibt mir doch nichts anderes übrig als Wahl-Abstinenz. Genau hier liegen die Ursachen für die Politikverdrossenheit in weiten Kreisen unserer Bevölkerung. Es wird höchste Zeit, dieses mangelhafte System zu überdenken doch dann unter Ausschluss des aktuellen Parteiensystems. Hans von Schack, Konstanz Da kommt so ein naseweiser Besserwisser und Schlauberger daher, ein Politik erklärer ohne große Lebenserfahrung, hat aber zwei Nachteile: Er heißt nicht Kevin Kühnert, sondern Philipp Amthor und ist CDU-konservativ. Damit ist die Jagd eröffnet! Was als Journalismus getarnt ist, als Aufklärung und Information, ist wieder einmal faktisch und sprachlich eine Hetzjagd mit dem Ziel eines Schlachtfestes. Nee, Kinder, macht doch bitte die ZEIT nicht zur Bild. Die Würde des Menschen... Ihr wisst schon. Lutz Bauermeister, per Als fast regelmäßiger Leser Ihrer Zeitung schätze ich Ihre gut recherchierten, ausgewogenen und sehr stark vom Mainstream abweichenden Artikel sehr. Die Berichte über Herrn Amthor passen dazu aber leider gar nicht. Ganz sicher hat da jemand einen Fehler gemacht, der aber bereits mit reißerischer Begleitmusik in sehr vielen Medien ausgebreitet wurde. Allein das macht diesen Fall eher zu etwas für weniger anspruchsvolle, andere Blätter. Profis suchen sich Gegner und nicht Opfer aus. Lorenz Semper, Hannover Martin Machowecz hätte erwähnen müssen, dass alle CDU-Bundestagsabgeordneten seit einem Jahrzehnt ein öffentliches Lobbyregister verhindern, wie es fast alle fortschrittlichen europäischen Demokratien schon eingeführt haben. Er verharmlost die Verbandelung von Deutschlands Dauer-Regierungspartei mit den Wirtschaftsbossen, indem er Amthors Geschichte als Ausrutscher eines Emporkömmlings erzählt, über den dieser nur»öffentlich nachdenken«soll, anstatt sich dafür förmlich zu entschuldigen und sich für das Lobbyregister einzusetzen. Sebastian Koerner, Spreewitz Es geht nicht nur um Herrn Amthor, sondern um die Grundsatzfrage, was so ein Abgeordneter nebenbei anschaffen darf und deklarieren muss. Es ist ein Unding, dass etwa Aktienbezugsrechte, die seit Jahren bei vielen Unternehmen zu den ganz normalen Bestandteilen der Vergütung zählen, hierbei unter den Tisch fallen. Als Wähler fragt man sich, wie viele Berufe ein Bundestagsabgeordneter wohl zusätzlich ausüben kann und darf. Prof. Wolf-Rüdiger Heilmann, Berlin Was, bitte, ist an der Geschichte tragisch? Wenn Herrn Amthor offensichtlich das Gespür fehlt, was sich gehört und was nicht, dann ist das nicht tragisch, sondern dumm. Da hilft auch kein Prädikatsexamen. Volkes Diener ist kein Volks-Verdiener! Bruno Fey, Putzbrunn Es häufen sich in den Medien die Beispiele dafür, dass Umfang und Stil der kritischen Berichterstattung in keinem Verhältnis zum kritisierten Sachverhalt stehen. Amthors»Fall«vermutlich durchgestochen von der eigenen Partei füllt in Ihrer Ausgabe die prominentesten Seiten 1 und 2. Genügt nicht ein nüchterner Bericht im Mittelteil? Dort stehen üblicherweise die Nachrufe also die Rücktritte der wenigen charismatischen Politiker, die in unserem Land nicht mehr ihrer Berufung folgen können oder wollen. Aber nicht weil sie moralisch versagt haben, sondern weil manche Medien Bagatellen aufbauschen und dabei die Person samt Familie in Abgründe stürzen. Felix Evers, Hamburg Es würde mich brennend interessieren, wer in der»ki-branche«die von Herrn Precht beobachtete Fantasie von einer nahen Superintelli genz befeuert. Als Mitglied der Enquete-Kommission»Künstliche Intelligenz«des Bundestages habe ich davon noch nichts bemerkt. Wenn es sich nur auf PR-Leute wie Elon Musk bezieht, ist das ein sehr verkürzter Blick. Ich stimme zu, dass viele Ethik- Debatten weder von philosophischem noch von technischem Sachverstand geprägt sind. Dazu gehört leider auch das ständige Iterieren des Trolley-Dilemmas beim autonomen Fahren. Das ist genauso wirklichkeitsfremd wie seinerzeit die Frage beim Kreiswehrersatzamt:»Würden Sie als Pazifist auf den Vergewaltiger Ihrer Freundin schießen?«es gibt wahrlich interessantere Fragen rund um KI und die Zukunft, in der wir leben wollen. Dr. Aljoscha Burchardt, Berlin Es ist abwegig, von IT-Systemen zu erhoffen, sie würden eines Tages moralische Dilemmata lösen, die Menschen seit Jahrtausenden nicht lösen konnten. Als wäre es nur eine Frage der Rechnerleistung. Aber was ist der notwendige folgende Gedanke? Lösungen zu finden, wie wir, jeder Einzelne und wir als Gesellschaft, in den moralischen Entscheidungen dauerhaft und zuverlässig involviert bleiben. Klaus Eßer, Hannover Herr Precht ist einer der wenigen echten Häretiker der neuen Religion des Digitalismus. Sie dringt mit ihren Erlösungsversprechen in die sinnentleerten Wüsten des bisher vorherrschenden Merkantilismus und Konsumismus ein und findet weltweit immer mehr Anhänger. Die konfessionelle Vielfalt der neuen Glaubenslehre reicht von den infantil-verkitschten Paradiesbildern einer Digitalministerin über die liberalen Konvertiten, die ihren tradierten Wachstumsglauben retten wollen, bis hin zu den Allmachtsfantasien der Sicherheitspolitiker, denen Bilder aus China feuchte Träume bescheren. Dort ist der Digitalismus bereits zur Staatsreligion aufgestiegen. Es braucht mehr solcher Häretiker wie Herrn Precht, die ihre Thesen an die Türen der digitalen Kathedralen nageln. Till Buchmann, Lehrte Ich stimme in den meisten Punkten mit Precht überein, allerdings widerspreche ich der Aussage»Vernunft allein gebiert keine Moral«. Denn die Allgemeinen Menschenrechte und die daraus abgeleitete utilitaristische Ethik sind in der heutigen Form ein Ergebnis der europäischen Aufklärung und basieren somit hauptsächlich auf der Vernunft. Wolfgang Deimel, per IHRE POST erreicht uns am schnellsten unter der - Adresse leserbriefe@zeit.de Leserbriefe werden von uns nach eigenem Ermessen in der ZEIT und/oder auf ZEIT ONLINE veröffentlicht. Für den Inhalt der Leserbriefe sind die Einsender verantwortlich, die sich im Übrigen mit der Nennung ihres Namens und ihres Wohnorts einverstanden erklären. Zusätzlich können Sie die Texte der ZEIT auf Twitter (@DIEZEIT) diskutieren und uns auf Face book folgen. ANZEIGE ZEIT FUR NEUE ARZTE Kostenlos Jetzt online anmelden Teilnehmende Arbeitgeber und Beratungspartner: Uhrzeit: Uhr Programm und Anmeldung: Folgen Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg 9. JULI DIGITAL Eine Veranstaltung von: Partner: Exklusive Vorteile für Freunde der ZEIT
17 17 GESCHICHTE 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o Juli 1990: Die D-Mark ist da! Geldausgabe in einer Bank in Mecklenburg- Vorpommern Foto: Gerald Haenel/laif Endlich D-Mark-Deutsche! Vor dreißig Jahren wurde die DDR-Mark abgeschafft. Die Währungsunion machte den 1. Juli 1990 zum wahren Tag der deutschen Einheit und der Massenarbeitslosigkeit VON CHRISTOPH DIECKMANN Drei finanzielle Erinnerungen an die deutsche Teilung: Rumä nien, Constanţa am Schwarzen Meer, August Auf einer Hotelterrasse schwatzen, vom sozialistischen Ober missachtet, vier devisenfreie Leipziger Studenten. Ein Bundes bürger pflanzt sich an ihren Tisch. Na, Landsleit, schwäbelt er, wie geht s denn so in der Deutschen Demokratischen? Er sei auf Europatour, jüngst habe er in Spanien die Señoritas beglückt. Er zückt die pralle Börse: elf Währungen! Der Ober eilt herbei, ganz Untertan. Der Schwabe übernimmt die Zeche, wünscht Guds Nächtle und entschwindet auf sein Zimmer. Wir DDR-Bürger schlafen im Zelt. Polen, Oktober Kurz nach Aufhebung des Kriegsrechts erscheint beim Warschauer Jazz Jamboree der Gott Miles Davis. Das Festival ist längst ausverkauft, doch im Szene-Club Hybrydy fragt ein DDR-Mensch nach Karten. Gelächter, bis der naive Gast die Zauberformel raunt: I have the right money. 40 D-Mark, versenkt in ein Fleischsalat- Brötchen, sind illegal nach Polen eingereist. Jetzt kann der Barkeeper hexen und serviert mir Tickets für sämtliche Jamboree-Konzerte. Berlin, Hauptstadt der DDR, Frühjahr Das Bier am Friedrichshainer Märchenbrunnen kostet 63 Pfennig. Der Trinker aus Moabit findet den Osten dufte. Dank des Umtauschkurses 1 : 13 zahle er pro Glas fünf Pfennig West. Ich müsste drüben für ein Glas à 1,60 DM mehr als 20 Ostmark löhnen. So lustig leben die wiedervereinten Berliner zwischen Mauerfall und Wäh rungs union. Der 1. Juli 1990 ist der wahre Tag der deutschen Einheit. Geteilt wurde Deutschland am 20. Juni 1948, durch die westliche Währungsreform. Über Nacht ersetzte die neu geschaffene D-Mark in der Tri zone, am 24. Juni auch in West-Berlin, die bis dahin gesamtdeutsch gültige Reichs- beziehungsweise Rentenmark. Die Sowjetische Militäradministration gab sich überrumpelt. Ihrer Besatzungszone (SBZ) drohten Reichsmark-Überflutung und In flation. Am 24. Juni verriegelte die SMAD sämtliche Tran sit wege nach West-Berlin und begann ihre eigene Währungsreform. Am 24. Juli 1948 gab sie die»deutsche Mark der Deutschen Notenbank«aus. Beide deutsche Währungen spiegelten ihren Staat. Im Februar 1945 hatten die Führer der künftigen Siegermächte bei der Konferenz von Jalta Deutschland aufgeteilt. Kriegsreparationen sollte jeder aus seiner Zone realisieren. Westdeutschland wurde nichts genommen. Es bekam den Mar shall plan und die parlamentarische Demokratie. Auch wirtschaftlich wurde die Bundesrepublik in die Pax Americana integriert. Sehr anders erging es dem Osten. Die Sow jet union, vom deutschen Vernichtungskrieg grauenhaft zerstört, demontierte in der SBZ mehr als 2000 Industriebetriebe und installierte Stalins Sozialismus. Millionen Ostdeutsche türmten gen Westen, die akademischen Eliten vorneweg, ins Hochlohn-Land BRD bis die DDR am 13. August 1961 in diktatorischer Notwehr die letzte Grenzlücke schloss. Der Mauerbau lehrte dasselbe wie 1989 der Mauerfall: Die DDR konnte nur verriegelt überleben. Die Ostmark war eine Binnenwährung, tauglich zum sozialistischen Hausgebrauch. Das»machtvolle Bekenntnis zur Partei- und Staatsführung«, bei Massenaufmärschen rituell inszeniert, pries die soziale Sicherheit, auf Kosten individueller Freiheitsrechte. Es zählt zu den Paradoxien des materialistischen»arbeiter-und-bauern-staats«, dass er nichts nötiger brauchte als Idealisten: gläubige Parteigänger wider den kapitalistischen Mammon. Der DDR-Staat und seine Bürger sehnten sich gleichermaßen nach der Westmark Die Westmark war im Osten ein Fetisch. Fast metaphysisch symbolisierte sie die»freie Welt«jenseits der Mauer, selbstbestimmtes Leben, käufliches Glück. Seit 1962 gab es sogenannte In ter shops, die Westprodukte, teils in der DDR gefertigt, für Valuta boten. Der Volksmund nannte sie»uwubus«: Ulbrichts Wucherbuden. Als Honecker 1977 versicherte, die In ter shops seien»kein ständiger Begleiter des Sozialismus«, existierten republikweit 271 dieser Gemischtwarenläden, 1989 waren es 470. Sie ironisierten die Ideologie. Um Valuten abzuschöpfen, gebot die DDR 1979, DM-Bestände 1 : 1 gegen»forum- Schecks«zu tauschen, die zum Einkauf im In ter shop berechtigten. Die Mehrheit der Bürger empfing keinen devisenspendenden Westbesuch, trotzdem hatte die DM den Status einer Kryptowährung. Forum geht es?, fragte im Witz der Handwerker am Telefon. Westhalb rufen Sie an? Wenn Zeitungsinserenten»blaue Fliesen«suchten oder boten, so meinten sie Hundertmarkscheine nicht die mit Karl Marx, sondern jene mit dem Bun des adler. Die Westmark-Sehnsucht war Staat und Bürgern gemein. Die rohstoffarme Republik litt dramatische Devisennot. Die nichtsozialistische Handelsbilanz darbte, der technologische Rückstand wuchs wie die Verschuldung, obwohl die DDR als zehntstärkste Industrienation der Welt auftrat. Honeckers»Devisenbeschaffer«, der Stasi-Oberst Alexander Schalck- Golodkowski, regierte den Darkroom sozialistischer Valuta-Organisation: den geheimen Außenhandelsbereich Kommerzielle Koordinierung. Nach dessen Enttarnung im Revolutionsherbst 1989 schäumte die Volkswut ob der staatskriminellen Machenschaften. Schalck-Golodkowski floh nach West-Berlin, später an den Tegernsee, in die Hemisphäre seiner bundesdeutschen Geschäftspartner. Auch der Zwangsumtausch für einreisende Bundesbürger, der West-Ost-Geschenkdienst Genex und die partielle Westfinanzierung der Kirchen gehören zum Thema DDR-Devisenmangel, ebenso der bundesdeutsche Freikauf von Häftlingen. Seit dreißig Jahren streiten Moralisten und Ökonomen über die Krankheit zum Tode der DDR. Starb sie an Lüge, Stasi, Stacheldraht oder mangels wirtschaftlicher Effizienz? Sowohl als auch. Wer stürzte die SED-Diktatur die Flüchtlinge des Sommers 1989, die bürgerrechtlichen Reformer der DDR, die nationalistischen Demonstranten? Sie alle, in verschiedener Funktion. Den Bürgerrechtlern gebührt der Ruhm der Friedlichen Revolution. Doch niemand verlässt seine Heimat ohne Lebensnöte. Und auch jene, die nach dem Fall der Mauer DEUTSCH LAND, EINIG VATERLAND verlangten, sind als Konsumsklaven unzureichend beschrieben. Der Schlüssel zur deutschen Einheit lag immer in Moskau. Michail Gor ba tschow rückte ihn heraus. Am 30. Januar 1990 reiste DDR-Ministerpräsident Hans Modrow nach Moskau. Gor ba tschow sprach vom Selbstbestimmungsrecht der Deutschen. Modrow verstand und verkündete:»deutschland soll wieder einig Vaterland werden.«am 13. Februar bat er in Bonn Helmut Kohl um einen Sofortkredit von zehn bis 15 Mil liar den DM. Kohl bügelte ihn ab. Der Kanzler hatte seine gesamtdeutsche Offenbarung bereits am 19. Dezember 1989 in Dresden erlebt, als ihm Hausherr Modrow blieb Statist an der Frauenkirch-Ruine ergebene Massen zujauchzten: SCHWARZ-ROT-GOLD, WIR SIND EIN VOLK! Bis dahin hatten sich drei Viertel der DDRler gegen die rasche Einheit ausgesprochen. Fortan galt Kohls Kernsatz als Schwur:»Mein Ziel bleibt wenn die geschichtliche Stunde es zulässt die Einheit unserer Nation.«Im Rückblick wirkt die deutsche Vereinigung wie ein falsch synchronisierter Film. Das Bild passt nicht zum Ton. Eine gigantische Wirtschaftsoperation wurde unterlegt mit dem Klang eines Na tio nalgottes diens tes: Kohls Sound. Er überschallte den Wahlkampf vor dem ersten freien Plebiszit der DDR.»Das waren in die DDR exportierte Westwahlen«, stöhnte der Bürgerrechtler Jens Reich.»Das Bonner Nilpferd ist in einer Massivität gekommen, dass man einfach machtlos war.«bei der Volkskammerwahl am 18. März 1990 verdursteten die Bürgerrechtler vom Bündnis 90 bei 2,9 Stimmprozenten. Es siegte mit 48,1 Prozent die von Helmut Kohl ANZEIGE JETZT NEU AM KIOSK Hier testen: ODER GRATIS LESEN! getränkte christdemokratische Allianz für Deutschland. Von Stund an ging es vorwärts mit der freien DDR: bergab, ins Tal der Träume. Man erinnert sich mit Scham: Seit dem Mauerfall drückte sich die Freiheit geldlich aus. Das Ostvolk ergoss sich nach Westen und ergatterte, vom Neugeborenen bis zur Greisin, 100 DM»Begrüßungsgeld«. Am 21. Januar 1990 versammelten sich Eichsfelder mit Koffern am Grenzübergang Teistungen zur»symbolischen Massenflucht«und drohten: KOMMT DIE D-MARK, BLEIBEN WIR. KOMMT SIE NICHT, GEHN WIR ZU IHR. Auch die Leipziger Montagsdemonstrationen forderten nur noch das Ende der DDR. Die Bundesregierung wurde bereits als eigene Obrigkeit akklamiert. Kanzler Kohl galt als Generalissimus einer unbeschränkt potenten Westwirtschaft. Hatte er nicht versprochen, Tausende bundesdeutsche Unternehmen warteten nur auf sein Zeichen zur Investition im Osten? Wir nannten unsere Währung Indianergeld, weil sie nur in unserem Reservat galt In ruhigen Zeiten kann Politik gestalten, im Sturm wird sie getrieben. Die neu gewählte DDR-Regierung driftete verzweifelt gen Rettungshafen deutsche Einheit. Immer noch entlief das Volk. Da verhieß Helmut Kohl gegen alle wirtschaftliche Vernunft zum 1. Juli 1990 die Wäh rungs union zum Volksbeglückungskurs 1 : 1. Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl protestierte vergeblich gegen diesen»hüftschuss«. Ein Staatsvertrag, am 18. Mai von den Finanzministern Theo Waigel und Walter Romberg unterzeichnet, regelte die Modalitäten: Sparguthaben bis 4000 Mark wurden im Verhältnis 1 : 1 umgestellt, Beträge darüber zum Kurs 2 : 1. Bürger ab 60 Jahren durften 6000 DDR-Mark 1 : 1 tauschen, Kinder bis 14 Jahre 2000 Mark. Auch für Löhne, Gehälter, Stipendien, Renten, Mieten und Pachten galt der Kurs 1 : 1. Schulden wurden halbiert. Kurz vor der lichten Zukunft transferierte das Ostvolk innerfamiliär hektisch Geld, um den Tauschrahmen maximal auszunutzen. Selbst Säuglinge richteten Konten ein. So kam der 1. Juli, ein Sonntag. 25 Mil liar den DM 400 Millionen Banknoten, 600 Tonnen schwer waren aus dem Westen in die DDR gebracht worden. Schlangen vor den Sparkassen, landesweiter Jubel. Erlöste Ostler präsentierten die Wohl stands ikone. Freies Geld, freie Welt! Endlich DM-Deutscher, also Mensch! Und dann kam der 2. Juli. Zuvor war Westgeld heilig. Wer es besaß, weihte es erhabenen Gütern, nicht dem tagtäglichen Bedarf. Nun musste man Kartoffeln, Käse, Klopapier mit DM bezahlen, den Bäcker, den Schuster, den Sprit und den Bus, die unverändert marode Deutsche Reichsbahn und die beunruhigend steigende Miete. Wo DDR-Produkte nicht unverzüglich aus den Kaufhallen verschwanden, wurden sie verschmäht. Psychologisch war das verständlich, volkswirtschaftlich desaströs. Die schlagartig absatzlosen Betriebe machten Pleite, auch die mit Handelspartnern in den exsozialistischen»bruderländern«. In Rumänien oder Gor ba tschows Sow jet union hatte man kein Westgeld, um zu zahlen. Der 1. Juli 1990 war der Geburtstag der ostdeutschen Massenarbeitslosigkeit. Ließ sich das ahnen? Nein, wissen, ohne jeden Zweifel. Nur blieb dieses Wissen verachtet und verdrängt. Vielleicht war die Schocktherapie unvermeidlich. So wie man nicht allmählich, per»strukturanpassung«, von Links- auf Rechtsverkehr umstellen kann. Ein kleines bankrottes Gemeinwesen wurde einem großen intakten beigetreten, komplett zu den Bedingungen der übernehmenden Mehrheitsgesellschaft. Es folgte die Privatisierungsorgie der Treuhand, die Demontage der DDR-Industrie, die Verschleuderung ostdeutschen Volksvermögens als Konkursmasse in summa eine Labilisierung des Ostens, die bis heute währt. Die gesamte Sozialstruktur der DDR war an die Arbeitswelt gebunden, ebenso das Selbstbewusstsein ihrer Bewohner. Doch die benötigte der Übernahmestaat nicht als Produzenten, sondern als Konsumenten. Unverändert braucht der Osten den Westen als Sponsor, der Westen den Osten als Absatzmarkt. Das geht nun schon dreißig Jahre so: anderthalb Generationen. Immerhin lebt der Osten. Das Westgeld rettete seine morschen Städte. Seine Selbsterkenntnis wuchs, sein Kulturgedächtnis kehrte zurück. Uns Älteren, den Ostlern zweier Systeme, bedeutete die komplizierte Neuzeit zumeist eine Befreiung. Im Frühjahr 1990 hatte Helmut Kohl verkündet, die DDR-Bürger könnten bereits im kommenden Sommer mit dem neuen Geld verreisen. Das zog, das geschah. Die Welterfahrung bleibt das schönste Freiheitsgut, eingedenk des Brecht-Worts, ungereiste Völker lebten nahe der Barbarei. Bis heute schaudert mich der Gedanke, die Mauer wäre nicht gefallen. Kurz vor der Wäh rungs union erhielt ich ein unfassbares Westgeschenk. Das World Press In sti tute Saint Paul/Minnesota spendierte zehn jungen Reportern aus zehn Ländern die Entdeckung Amerikas. Unsere fünfmonatige US-Kreuzfahrt begann Mitte Juni Am 1. Juli besuchten wir in Wisconsin einen Radiosender im Siedlungsgebiet der Chippewa. Wir stellten uns vor. Der Moderator schrie begeistert: My first East German! Er wünschte ein Grußwort. Ich imaginierte Tipis auf einer Waldlichtung und edle Rothäute, die am Lagerfeuer ihrem Sender lauschen. Ich sprach: Liebe Chippewa, ich komme aus dem befreiten Ostdeutschland. Dort tauschen heute 16 Millionen Menschen ihr kommunistisches Geld in Dollars. Wir nannten unsere Währung Indianergeld, weil sie nur in unserem Reservat galt. Leider giert mein Volk jetzt nur nach Gold, doch einst wird es begreifen, was Häuptling Seattle sagte: Die Toten der Weißen vergessen das Land ihrer Geburt, wenn sie fortgehen, um unter den Sternen zu wandeln. Und die Weissagung eurer Geschwister, der Cree: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Der Moderator griente. Ich bat ihn, Money von Pink Floyd aufzulegen. Money, get away / Get a good job with good pay and you re okay. Er nickte und spielte Hotel California.
18 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 RECHT & UNRECHT DER POLITISCHE FRAGEBOGEN 18 1 Welches Tier ist das politischste? Das Chamäleon. Es ändert seine Farbe. Wir Politiker hören auch oft, dass wir unsere Meinung wechseln wie die Hemden. Und stimmt das? Nicht immer. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, und danach ändern sich die Verhältnisse, dann kannst du auch deine Meinung ändern. Politisches Handeln heißt immer, die Situation neu zu bewerten. 2 Welcher politische Moment hat Sie geprägt außer dem Kniefall von Willy Brandt? Der Mauerfall. Ich kam im Oktober 1985 als Chemie-Stipendiat aus dem Senegal in die DDR. Am Tag, als die Mauer fiel, habe ich mich gefragt: Behalte ich mein Stipendium? Darf ich hierbleiben und zu Ende studieren? Ich hatte gemischte Gefühle, einerseits freute ich mich über die Freiheit, andererseits dachte ich sofort an mein eigenes Schicksal. 3 Was ist Ihre erste Erinnerung an Politik? Als ich 13 war, kam der damalige senegalesische Präsident zu Besuch in unsere Sekundarschule, und wir Schüler sollten die Nationalhymne singen. Mir fiel auf, dass er von vielen Sicherheitsleuten umgeben war. Und ich dachte: Wie wichtig ist ein politischer Mensch, wenn sich so viele Leute um seine Sicherheit kümmern? 4 Wann und warum haben Sie wegen Politik geweint? Im Sommer 1989 sind die ersten DDR- Bürger über Ungarn nach Österreich und in die BRD geflohen. Unter ihnen war mein bester Freund. Da habe ich geweint, weil ich ihn nicht mehr sehen konnte. 5 Haben Sie eine Überzeugung, die sich mit den gesellschaftlichen Konventionen nicht verträgt? Eine schwierige Frage. Ich würde sagen: Nein. 6 Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, mächtig zu sein? Als ich meinen deutschen Pass bekam, das war Anfang Leider gab es damals keine Feierlichkeiten. Ich ging einfach zur Einbürgerungsbehörde und bekam das Dokument ausgehändigt. Für die Verwaltung war das unspektakulär, aber für mich ein entscheidender Tag, an dem ich sagen konnte, wow, ab jetzt habe ich nicht nur Pflichten in diesem Land, sondern endlich auch Rechte. Ich kann wählen und gewählt werden. Dass meine Stimme zählt, empfand ich als richtige Macht. 7 Und wann haben Sie sich besonders ohnmächtig gefühlt? An dem Tag, als Roland Koch 1999 in Hessen wiedergewählt wurde. Er hatte Erfolg mit einer Unterschriftensammlung gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe in Halle selbst erlebt, wie die Leute massenhaft Schlange standen und fragten: Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben? Als das Wahlergebnis feststand, war ich fassungslos. Im letzten Herbst gab es den Anschlag auf die Synagoge von Halle. Anfang dieses Jahres fielen Schüsse auf Ihr dortiges Büro, und immer wieder erhalten Sie Morddrohungen. Fühlen Sie sich dabei ohnmächtig? Nein, aber ich spüre Betroffenheit und manchmal Besorgnis darüber, dass Gewalt und menschenverachtende Tendenzen in den letzten drei, vier Jahren zugenommen haben. Gleichzeitig fühle ich mich stark und unterstützt durch die große Solidaritätswelle, die ich erlebe. 8 Wenn die Welt in einem Jahr untergeht was wäre bis dahin Ihre Aufgabe? Sie dürfen allerdings keinen Apfelbaum pflanzen. Ich würde so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen. 9 Welche politischen Überzeugungen haben Sie über Bord geworfen? Dass man mit allen Politikerinnen oder Politikern zusammenarbeiten kann. Wen genau meinen Sie? Es gibt Menschen, die es nicht schaffen, eine politische Auseinandersetzung zu führen, ohne andere zu beleidigen oder herabzuwürdigen. Diese Gruppe von Politikern gibt es im Deutschen Bundestag und in den Landtagen, und es ist fast unmöglich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. 10 Könnten Sie jemanden küssen, der aus Ihrer Sicht falsch wählt? Küssen sollte man Menschen, die einen»uns fehlt der Zusammenhalt«Sind Sie Teil eines politischen Problems? Haben Sie mal einen Freund wegen Politik verloren? Diese Woche stellen wir unsere Fragen dem SPD-Politiker Karamba Diaby besonderen Platz im Herzen haben. Für Menschen, die sich für eine Partei entscheiden, die Hass und Hetze verbreitet, kann ich nie einen Platz in meinem Herzen haben. 11 Haben Sie mal einen Freund oder eine Freundin wegen Politik verloren? Und wenn ja vermissen Sie ihn oder sie? Ja, aber ich vermisse ihn nicht. Es ging dabei um den Mindestlohn. Er meinte, die SPD sei schuld, dass er seine Arbeit verloren hatte, und ich persönlich auch, weil ich Teil der SPD bin. Ich wollte mit ihm reden, aber er sagte, mit einem Sozi rede man nicht. Ich sah keine Grundlage mehr, mit diesem Mann weiter in Kontakt zu bleiben. 12 Waren Sie in Ihrer Schulzeit beliebt oder unbeliebt, und was haben Sie daraus politisch gelernt? In Dakar war ich Schülersprecher und habe mich in der Schule immer für meine Mitschüler eingesetzt. Das kam bei den Leuten gut an. Politisch habe ich daraus gelernt, dass man dadurch Anerkennung und Respekt bekommt. Ich kümmere mich zum Beispiel um die Belange der Kleingärtner in Halle, unabhängig von der Herkunft und der Partei. Die Leute sehen mich als ihren Kleingartenfreund. 13 Welche politische Ansicht Ihrer Eltern war Ihnen als Kind peinlich? Keine. Meine Mutter starb, als ich drei Monate alt war, und mein Vater, als ich sieben Jahre alt war. Ich bin bei meinem Schwager aufgewachsen. 14 Nennen Sie eine gute Beleidigung für einen bestimmten politischen Gegner. Ich würde meinen politischen Gegner nicht beleidigen. Die Autorin Sharon Dodua Otoo fordert die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin (siehe Frage 25) Jede Woche stellen wir Politikern und Prominenten die stets selben Fragen, um zu erfahren, was sie als politische Menschen ausmacht und wie sie dazu wurden. Und wo sich neue Fragen ergeben, haken wir nach. Die Nachfragen setzen wir kursiv 15 Welche Politikerin, welcher Politiker hat Ihnen zuletzt leidgetan? Andrea Nahles hat mir sehr leidgetan. Trotz der Kritik an ihren öffentlichen Auftritten ist sie für wichtige Überzeugungen eingetreten. Sie war die erste Frau an der Spitze der SPD und der Fraktion. Das hat sie nicht verdient. Haben Sie ihr das auch gesagt? Nein, ich habe sie nicht wiedergesehen. Vielleicht hätte ich ihr eine schreiben können. Aber ich dachte: Wenn sie sich von der Politik verabschiedet hat, sollte man sie auch in Ruhe lassen. 16 Welche Politikerin, welcher Politiker müsste Sie um Verzeihung bitten? In einer Bundestagsrede berichtete ich, wie ich selbst am Bahnhof in Halle Opfer von Racial Profiling wurde. Ich wurde, zusammen mit einem anderen Schwarzen, von Polizisten vor Hunderten von Mitpendlern kontrolliert. Sie haben nur uns beide nach dem Ausweis gefragt. Ich fand das diskriminierend und verletzend. Ein CSU-Abgeordneter behauptete dann in seiner Gegenrede, die deutschen Beamten machten ihre Arbeit immer korrekt und ich müsse mir überlegen, was ich an diesem Tag falsch gemacht habe. Das hat mich tief verletzt, und ich hätte mir gewünscht, dass sich dieser Abgeordnete bei mir entschuldigt. Wer war das? Wenn ich den Namen nenne, mache ich ihn wichtig, und das möchte ich nicht. 17 Welche Politikerin, welcher Politiker sollte mehr zu sagen haben? Politikerinnen und Politiker mit Mi grations hin ter grund sollten mehr zu Wort kommen, damit sie die Verhältnisse in diesem Land häufiger aus ihrer Perspektive darstellen können. Ich bekomme regelmäßig ein Mikrofon vor die Nase gehalten, aber ich wünsche mir, dass es mehr gibt, die von ihren interkulturellen, Migrations- und Fluchterfahrungen berichten und Vorschläge unterbreiten. 18 Welche politische Phrase möchten Sie verbieten? Alle, die das Grundgesetz verbietet. Könnten Sie ein Beispiel nennen?»der Islam gehört nicht zu Deutschland.«Wer das behauptet, widerspricht Artikel 4 des Grundgesetzes, der die Religionsfreiheit betont. 19 Finden Sie es richtig, politische Entscheidungen zu treffen, auch wenn Sie wissen, dass die Mehrheit der Bürger dagegen ist? Parteien sollten das Interesse der Bürger vertreten. Daher hoffe ich, dass das nicht allzu oft vorkommt. 20 Was fehlt unserer Gesellschaft? Momentan der Zusammenhalt. Die Gesellschaft ist gespalten, und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir den Zusammenhalt stärken können. 21 Welches grundsätzliche Problem kann Politik nie lösen? Politik kann nicht alle Menschen glücklich machen. 22 Sind Sie Teil eines politischen Problems? Das ist Ansichtssache. Ich persönlich sehe mich natürlich als jemand, der angetreten ist, um Lösungen zu finden. 23 Nennen Sie ein politisches Buch, das man gelesen haben muss. Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen von Axel Hacke. Da wird deutlich gemacht, wie politische Auseinandersetzungen korrekt laufen können, ohne dass wir uns verletzen und die Würde des anderen mit Füßen treten. 24 Bitte auf einer Skala von eins bis zehn: Wie verrückt ist die Welt gerade? Und wie verrückt sind Sie? Acht für die Welt, denn was ich da international sehe, macht mir Sorgen, zum Beispiel, wenn ich die amerikanische Politik betrachte oder die des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Ich gebe mir eine Zwei. Ich bin überzeugt, dass die jetzigen Verhältnisse nicht von Dauer sind. Sie sind veränderbar, man darf nur nicht den Kopf in den Sand stecken. 25 Was sagt Ihnen dieses Bild (siehe Foto links)? Ich sehe eine berechtigte politische Forderung, die mit großem Selbstbewusstsein zum Ausdruck gebracht wird. Das Bild drückt keine Wut aus, sondern Hoffnung und Zuversicht. Und es ist absolut aktuell. Der schwarze Philosoph Anton Wilhelm Amo, der unter anderem an der Universität Halle lehrte, ist für mich eine Figur, die ich mit Vielfalt und Mut verbinde und die zur Erinnerungskultur Deutschlands gehört. Halten Sie die Forderungen nach Straßenumbenennungen oder dem Streichen des Wortes»Rasse«aus dem Grundgesetz generell für berechtigt? Ja. Denn das, was da laut und deutlich auf der Straße passiert, ist keine zu vernachlässigende Bewegung, und es sind auch nicht nur Schwarze Menschen, die protestieren, sondern es ist eine bunte Mischung. 26 Wovor haben Sie Angst außer dem Tod? Dass wir in einer verunsicherten Gesellschaft leben, in der jeder gegen jeden kämpft. Ich habe Angst davor, dass sich das verstärkt. 27 Was macht Ihnen Hoffnung? Die vielen Begegnungen mit Menschen, die für eine offene Gesellschaft stehen und kämpfen. Sie sind die Mehrheit in unserer Gesellschaft. Auch wenn eine rechte Partei in Teilen der Republik 20 Prozent der Wählerstimmen hat, denken immer noch 80 Prozent der Bevölkerung weltoffen und solidarisch. Wenn ich auf die letzten sechs Monate zurückschaue, war vieles schrecklich, auch für mich persönlich. Es gibt Dinge, die ich nicht einfach wegwischen kann. Aber ich spüre auch eine Welle der Solidarität sogar in den sozialen Medien. Kürzlich twitterte eine»paulapaulinchen«über mich:»sie sind hier nicht erwünscht.«sie bekam 2400 Likes, aber bei mir waren es Die Fragen stellte Jeannine Kantara Illustration: Oriana Fenwick für DIE ZEIT; kl. Foto: Tahir Della Karamba Diaby, 58, ist promovierter Chemiker und lebt in Halle (Saale). Seit 2013 ist er Abgeordneter im Deutschen Bundestag
19 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 WIRTSCHAFT 19 Das System Wirecard Zigfach überbewertete Firmen und kleine Zahlenwunder: Wirecard gab schon früh Rätsel auf. Es interessierte nur niemanden VON INGO MALCHER Collage: ZEIT-Grafik, verwendete Bilder: Getty Images (3) Wenn Geschäftsbeziehungen vor Gericht enden, dann ist es meistens schon zu spät. Am Londoner High Court wird unter der Verfahrens-Nummer CL gerade ein solcher Fall verhandelt. Wegen der Corona- Pandemie lud man zur ersten Anhörung am Dienstag vor zwei Wochen nicht in den gotischen Bau des Royal Court of Justice, sondern zu einer digitalen Skype-Konferenz. Vor Gericht geht es darum, wie aus 34 Millionen Euro beinahe über Nacht 300 Millionen werden konnten. Und die Antwort könnte dabei helfen, die Vorfälle um den wildesten Bilanzskandal der Bundesrepublik aufzuklären: den Absturz von Wirecard. Seit der Dax-Konzern in der vergangenen Woche Insolvenz anmelden musste, weil 1,9 Milliarden Euro in den Büchern fehlten, seit die Staatsanwaltschaft gegen den Vorstandschef ermittelt und sein Geschäftsführer abgetaucht ist, seitdem also ein ganzes Unternehmen in sich zusammenfiel, drängen sich Fragen auf: Wie konnte das System Wirecard, das scheinbar eine glänzende Erfolgsgeschichte hervorbrachte, über Jahre funktionieren? Und: Hätte es nicht schon viel früher auffliegen müssen? Diese Fragen müssen sich gerade viele gefallen lassen, nicht nur die Manager des Skandalunternehmens. Auch Wirtschaftsprüfer, Bankanalysten und die Finanzaufsicht stehen in der Kritik. Er habe einen solchen Fall hierzulande nicht für möglich gehalten, sagt Felix Hufeld, Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,»ich bin entsetzt«. (Siehe Interview S. 20) Seit wann also gab es Hinweise darauf, dass mit der sagenhaften Wirecard-Story etwas nicht stimmt? Zwei alte Fälle zeigen: schon sehr, sehr lange. Um einen der beiden geht es vor dem Londoner High Court. Geklagt haben Prashant Manek und Sanjay Chandi, die Minderheitsaktionäre eines indischen Unternehmens namens Hermes-i- Tickets. Sie verkauften im September 2015 ihre Aktien für 480 Euro pro Stück an eine Investmentgesellschaft auf Mauritius. Diese anonyme Gesellschaft reichte die Aktien im Oktober 2015 dann weiter, zum Preis von 4150 Euro. Und zwar an Wirecard. Aus einer Bewertung von 37 Millionen Euro für die Firma wurden so binnen wenigen Tagen rund 300 Millionen Euro. Man kann durchaus verstehen, dass Manek und Chandi sich irgendwie reingelegt fühlen. Sie behaupten: Bei Wirecard habe man davon gewusst, dass sie ausgebootet wurden. Deshalb klagen sie gegen den Konzern aus Aschheim bei München. Der Fall hat es in sich. Es geht dabei um mehr als die 26 Millionen Euro Schadensersatz, die Manek und Chandi von Wirecard maximal verlangen. Entscheidender als der Ausgang des Verfahrens ist der Einblick, den er ins System Wirecard bieten könnte. Es war ein System, in dem Umsätze in den Bilanzen standen, die Wirtschaftsprüfer nicht nachvollziehen konnten. Es war ein System, bei dem ein Vermögen ausgewiesen wurde, das es offenbar nicht gab, und Umsatzzahlen veröffentlicht wurden, die trotz Krisen stets nur einen Weg kannten: nach oben. Laut Gerichtsunterlagen, die der ZEIT vorliegen, war es der inzwischen verschwundene Wirecard-Geschäftsführer Jan Marsalek, der den Übernahmedeal in Indien damals mitausgehandelt hat. Wie das geschah, lässt sich mithilfe der Unterlagen nachzeichnen. Hermes-i-Tickets aus Chennai verkaufte an Kiosken in Indien Bahn- und Flugtickets und wickelte für Kunden innerhalb des Landes Geldtransfers ab. Es war nicht gerade ein boomendes Geschäft. Im Herbst 2014 beauftragten die Eigentümer eine Investmentbank damit, einen Käufer zu suchen. In einer Präsentation der Banker wird der Betriebsgewinn für das damals nächste Jahr auf gerade einmal 3,8 Millionen Euro geschätzt. Kein Wunder also, dass sich kein Käufer fand, um für einen solchen Laden die geforderten 46 Millionen Euro zu bezahlen. Aber dann war auf einmal eine anonyme Gesellschaft namens Emerging Markets Investment Fund 1A im Spiel. Diese bot umgerechnet 37 Millionen Euro für Hermes. Manek und Chandi schlugen ein. Was die Minderheitsaktionäre nicht wussten: Jan Marsalek hatte längst mit den Mehrheitsinhabern über die Übernahme von Hermes verhandelt. Aus s geht hervor, dass er im Dezember 2014 mit einem Vertreter dieser Gruppe im Hotel Sacher in Wien verabredet gewesen sein soll. Was dann geschah, ist mit betriebswirtschaftlicher Logik nicht mehr nachvollziehbar. Wirecard bezahlte fast das Zehnfache für Hermes an die anonyme Briefkastenfirma auf Mauritius, als diese zuvor für Hermes bezahlt hatte. So kam es zu dem irrwitzigen Sprung des Unternehmenswertes auf 300 Millionen Euro, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund gegeben hätte. Vermutungen, was dahinterstecken könnte, gibt es viele. Sie reichen von Geldwäsche bis zum Buchhaltungsbetrug. Vielleicht war es so, wie ein Investmentfonds-Analyst nahelegt, der nicht mit Namen genannt werden will:»wenn ich über 300 Millionen Euro in eine Gesellschaft fließen lasse, die ich letztendlich kontrolliere, dann kann ich das Geld über fiktive Umsätze wieder zurückfließen lassen.«um herauszufinden, ob diese Vermutung stimmt oder ob man sich bei Wirecard einfach nur über den Tisch ziehen ließ, müsste man jedoch wissen, wer die ominöse Gesellschaft auf Mauritius kontrolliert. In den Registerunterlagen finden sich dazu nur der Name einer weiteren Briefkastenfirma auf der Insel und die Adresse eines Offshore-Dienstleisters. Doch diese Frage ist so entscheidend, dass sie sich auch die Wirtschaftsprüfer von KPMG gestellt haben, die vergangenen Herbst vom Wirecard-Aufsichtsrat damit beauftragt wurden, bei dem Konzern nach dem Rechten zu sehen. Die Antwort ist in ihrem Abschlussbericht vom April nachzulesen.»der Wirecard AG ist der wirtschaftlich Berechtigte (...) nach Auskünften gegenüber KPMG nicht bekannt«, heißt es dort. Praktisch alles im Zusammenhang mit der Briefkastenfirma auf Mauritius ist geheim. Als in einem in Indien geführten Rechtsstreit über den Deal die früheren Gesellschafter in mehreren s darum bitten, dem Gericht mehr Einzelheiten dazu vorzulegen, lehnt Wirecard das ab. In einer an die früheren Gesellschafter vom 5. Dezember 2018 schreibt Wirecard-Finanzchef Alexander von Knoop, dass die Details zu dem Deal»vertraulicher Natur«seien und man sich»an diesen Vertraulichkeitsstatus gebunden fühle«. Bereits am 30. Juli 2018 hatte Jan Marsalek ebendarauf hingewiesen. Er schrieb:»wir bauen darauf, dass Sie unsere Verpflichtungen akzeptieren, dass wir die Information, die in den s verlangt wird, nicht offenlegen werden.«für Marsalek, 40, ist Diskretion Ehrensache. Er ist Österreicher, wie Wirecard-Chef Markus Braun, und gilt als dessen Gefolgsmann. Sein Name taucht überall dort auf, wo es dubios wird. Hält man hier einmal kurz inne und fasst den Fall zusammen, dann sieht man eine kleine indische Firma mit völlig überzogener Bewertung, die über dubiose Zwischenhändler gekauft wird, und einen Deal, über dessen Details geschwiegen wird. Hätte es noch eines deutlicheren Hinweises bedurft, dass da irgendetwas faul ist bei Wirecard? Auch im Jahr 2011 taucht Marsaleks Name im Zusammenhang mit einem seltsamen Vorgang auf das war also beinahe ein Jahrzehnt bevor die Wirecard-Bombe platzte. Da geht es um das Poker- Geschäft von Wirecard. Und um ein weiteres Bilanz-Rätsel. Am 15. April 2011 schlugen die amerikanischen Behörden zu. Auf den größten Poker- Websites für US-Spieler war es plötzlich nicht mehr bunt und flimmernd. Dafür hing über den Seiten ein Hinweis:»Diese Domain wurde beschlagnahmt.«darüber die Wappen des US- Justizministeriums und der Bundespolizei FBI. Der Tag ging als»black Friday«in die Geschichte des Online-Pokers ein. Damit machten die Vereinigten Staaten Ernst, um den Unlawful Internet Gambling Enforcement Act durchzusetzen, der 2006 beschlossen worden war. Damit wurde Online-Gambling in den USA praktisch verboten. Am Black Friday wurden Konten eingefroren und Online-Casino-Betreiber zur Fahndung ausgeschrieben. In einer Anklageschrift heißt es, die Betreiber hätten es US-Bürgern mit einem ausgeklügelten Betrugssystem ermöglicht, auf den Seiten zu zocken. Die seien dann zum Teil noch um ihre Gewinne gebracht worden. Für Wirecard war es eine Horror-Nachricht. Denn eines der Casinos hatte Konten bei der Wire card Bank. Zwar beteuerte das Unternehmen immerzu, man hätte keine Zahlungen für US- Poker-Spieler abgewickelt. Aber es gibt merkwürdige Details aus der Zeit davor. Im Februar 2010 wird der Deutsche Michael S. in Florida vom Secret Service verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, 70 Millionen Dollar Online-Poker- Gewinne an US-Bürger ausgezahlt zu haben. Überwiesen wurde ein Großteil der Summe von einem Konto der Wirecard Bank. Veranlasst wurden die Zahlungen von einer britischen Briefkastenfirma, die dieselben Aktionäre hatte wie Wire Card UK. Die Muttergesellschaft teilte zwar sofort mit, mit S. nichts zu tun zu haben. Doch bei Full Tilt Poker, einem der größten Online-Anbieter, fand sich 2008 ein interessanter Hinweis auf der Seite. Wer einen neuen Account bei dem Anbieter eröffnen wolle, könne das direkt auf der Seite über Click2Pay machen. Der Inhaber von Click2Pay war Wirecard. Einer der Direktoren dort war Jan Marsalek. Nachdem die Full-Tilt-Poker-Seite blockiert war, schloss der Betreiber einen Vergleich mit den Behörden. Dieser enthielt den Passus, dass für US- Bürger, die Opfer betrügerischer Handlungen auf der Poker-Seite wurden, von dem Unternehmen 547 Millionen Dollar als Entschädigung bereitstehen. Es ging also um richtig viel Geld. Die Folgen für Wirecard? Unsichtbar. Im April 2011 wurde das Casino geschlossen, auf dessen Seite Wirecard über Click2Pay Zahlungsdienstleistungen angeboten hatte. Eigentlich war das ein erheblicher Schlag. Doch im zweiten Quartal nahm der gemeldete Umsatz nicht etwa ab, sondern im Jahresvergleich um 19 Prozent zu. Wirecard, damals noch bedeutend kleiner als heute, hatte offenbar Kunden verloren, aber veröffentlichte fröhlich Rekorde. Was war geschehen? Möglich, dass der Verlust ganz schnell wie durch ein Wunder mit Neugeschäft im zweiten Quartal aufgefangen wurde. Wobei man an dieser Version aufgrund der jüngsten Ereignisse zweifeln kann. Wohlgemerkt, es geht um einen Dax-Konzern, der da gerade implodiert ist, weil ganz offensichtlich die Zahlen in den Büchern besser waren als in der Wirklichkeit. Wirecard war bis Montag vergangener Woche auch ein Konzern, bei dem schlechte Nachrichten tabu waren, auch wenn es um Kleinigkeiten ging. Nach außen hin hatte man immer alles im Griff. Etwa Ende Februar, als die Corona-Pandemie Deutschland längst erreicht hatte. Da meldete Wirecard:»Derzeit erwarten wir keine negativen Auswirkungen auf unser Konzernergebnis für das 1. Quartal 2020.«A A Was auch immer geschah, der Konzern meldete: Der Umsatz wächst!
20 20 WIRTSCHAFT DER WIRECARD-SKANDAL 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28»Ich würde mir wirksamere Möglichkeiten für uns wünschen«foto: Axel Griesch/laif DIE ZEIT: Herr Hufeld, sagt Ihnen die Vorwahl etwas? Felix Hufeld: nein. ZEIT: Das ist die Vorwahl von Manila. Hufeld: Aha. ZEIT: Denken Sie nicht heute manchmal, hätten wir da bloß bei der philippinischen Zentralbank angerufen und so erfahren, dass die angeblichen Milliarden von Wirecard gar nicht existierten? Hufeld: Ich bezweifle, dass es so einfach war. Große Wirtschaftsprüferteams, auch in Manila, haben die Wahrheit über Jahre nicht herausgefunden. Wir reden hier über eine gewaltige kriminelle Energie von wem genau, das wissen wir noch nicht. Jede Lebenserfahrung spricht dagegen, dass so etwas mit einem Anruf aufzudecken wäre. ZEIT: Sie waren schon Strategieberater, Vermögensmanager, Investor, jetzt sind Sie Deutschlands wichtigster Finanzaufseher. Hätten Sie so etwas für möglich gehalten? Hufeld: Jedenfalls nicht hierzulande. Ich bin entsetzt. ZEIT: Fühlen Sie sich persönlich getäuscht? Hufeld: Eher verärgert. Anfang 2019 haben wir erste Hinweise auf unkorrektes Verhalten bekommen und sofort Maßnahmen ergriffen, indem wir die zuständige Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, kurz DPR, mit einer Prüfung von Wirecard beauftragt haben. Es ist unbefriedigend, dass bis heute kein Ergebnis dieser Prüfung vorliegt. ZEIT: Nun lässt die EU durch die Europäische Marktaufsichtsbehörde die Rolle der Bafin im Fall Wirecard prüfen. Können Sie das nachvollziehen? Hufeld: Grundsätzlich haben wir nichts zu verbergen und werden selbstverständlich mit den Kollegen vorbehaltlos die Vorgänge rekapitulieren. Allerdings: Bei aller Bereitschaft, künftig Fälle wie Wirecard auszuschließen und meine Behörde noch effektiver aufzustellen, sehe ich nicht, wo die Bafin gegen EU-Recht verstoßen haben sollte. ZEIT: Reden wir über die Rolle der Bafin. Warum haben Sie Wirecard nicht früh prüfen lassen? Hufeld: Wirecard ist ein komplexes Konstrukt mit fast zwei Dutzend Tochterunternehmen und wir dürfen gesetzlich derzeit nur die Aufsicht über eine dieser Firmen, die Wirecard Bank AG, ausüben, über die das europäische Zahlungsverkehrsgeschäft abgewickelt wird. Die Holding Wirecard ist dagegen bislang als Technologieunternehmen eingestuft worden. Gegenüber solchen Firmen haben wir als Finanzaufsicht nur sehr eingeschränkte Befugnisse. Das ist grundsätzlich auch richtig so. Der Volkswagen-Konzern betreibt ebenfalls eine Bank, die unter unserer Aufsicht steht die Aufsicht erstreckt sich aber nicht über den gesamten VW- Konzern. Bei solchen Unternehmen intervenieren wir nur, wenn bestimmte Vorschriften des Kapitalmarktrechts verletzt sind oder etwas mit den Bilanzen nicht stimmt. Das haben wir im Frühjahr 2019 auch bei Wirecard getan und, wie erwähnt, die zuständige DPR beauftragt. Wir dürfen im sogenannten zweistufigen Verfahren ausdrücklich nicht selbst prüfen, bevor die DPR ihre Prüfung nicht vorgelegt hat. Die Bafin sollte künftig in die Lage versetzt werden, alle notwendigen Prüfungen möglichst kurzfristig, schnell und effizient durchführen zu können. ZEIT: Von außen gesehen ist schwer zu verstehen, warum Wirecard insgesamt keine Finanzfirma sein soll. Wirecard ist lizensiert von Visa und Mastercard und vermittelt im Auftrag der Anbieter die Zahlungen. Das ist sein Kerngeschäft. Wie kann das was anderes sein als ein Zahlungsdienstleister? Hufeld: Für Europa haben Sie ganz recht, denn dort ist eine Banklizenz zwingend vorgeschrieben. Allerdings ist das in vielen anderen Ländern dieser Erde, insbesondere in Asien, anders geregelt. An das Asiengeschäft des Unternehmens und an die Gruppe insgesamt kommt die Bafin nur dann heran, wenn sie über sehr präzise Kriterien das Gesamtkonstrukt als Finanzholding interpretieren kann. Im Jahr 2017 haben wir das gemeinsam mit der Bundesbank geprüft, das Ergebnis: Das war damals nicht möglich. Die EZB hat dies 2019 bestätigt. Danach hat sich Wirecard allerdings stürmisch weiterentwickelt und mittlerweile viele kleinere Firmen aufgekauft. Nach heutigem Stand spricht aus meiner Sicht vieles dafür, Wirecard als eine Finanzholding zu behandeln. Bedauerlicherweise haben wir das dafür nötige aufwendige Verwaltungsverfahren nicht vor der Insolvenz zu Ende gebracht. ZEIT: Noch einmal für den Laien: Sie sagen, ja, die waren früher schon ein Zahlungsabwickler, aber eben auch in Asien, wo ja angeblich der große Profit herkam, und weil da andere Regeln gelten, waren sie insgesamt kein Finanzdienstleister. Das muss man erst mal verdauen. Hufeld: Unser Ziel ist es wie gesagt, komplizierte internationale Firmen-Konstrukte wie Wirecard künftig effizienter und wirksamer zu kontrollieren. Das Asiengeschäft hat Wirecard aber nicht einmal selbst durchgeführt, sondern über andere Dienstleister abgewickelt, was es uns nach EU-Recht noch schwerer machte, da Einblick zu erhalten. Gerade in den vergangenen Wochen liefen aber Haben die Behörden im Fall Wirecard versagt? Der Präsident der Finanzaufsicht Bafin erklärt sich im Skandal um den Dax-Konzern Felix Hufeld Der 59-jährige Jurist war Unternehmensberater, Konzernstratege bei der Dresdner Bank, Regionalchef beim Versicherungsmakler Marsh und Chef einer Beteiligungsgesellschaft kam er zur Bafin und wurde dort 2015 schließlich Präsident. Die Bafin Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht steht unter Druck, weil sie beim Wirecard-Konzern erst spät aktiv wurde. Die Behörde in Frankfurt und Bonn beaufsichtigt mit ihren knapp 3000 Mitarbeitern das Finanzwesen einschließlich Versicherungen. Bei den großen Instituten kooperiert sie mit der EZB. hoffnungsvolle Gespräche mit dem Vorsitzenden des Wirecard-Aufsichtsrates, um tiefere Einblicke zu bekommen. ZEIT: Wie Sie sagen, ist die Bafin zweifelsfrei zuständig für die Wirecard Bank. Hätte der Bafin an deren Umtrieben nicht einiges auffallen müssen? Hufeld: Die Bafin hat die Bank selbstverständlich regelmäßig geprüft. Die Jahresabschlüsse der Bank waren vom Wirtschaftsprüfer vollständig testiert und standen auch nie im Zentrum der Vorwürfe wegen möglicher Bilanzfälschung. ZEIT: Im Jahr 2010 gab es den Fall des Michael S., der in Florida verhaftet wurde wegen Geldwäsche und illegalem Online-Gambling. In dem Verfahren gab es Indizien, dass die Millionen von ihm im Zusammenhang mit der Wirecard Bank standen stand in einer Anklage des US-Justizministeriums bezüglich einer illegalen Online-Pokerfirma, dass erhebliche Zahlungen über die Wirecard Bank abgewickelt wurden wurde in Großbritannien eine Poker- und Pornofirma geschlossen, die mit der Wirecard Bank agierte und in England nur als Briefkasten bestand. Hätte man diesen Fällen nachgehen müssen? Hufeld: Ich kenne die Details Ihrer Beispiele nicht, das war lange vor meiner Zeit. Ich weiß aber, dass meine Kollegen später auch eine geldwäscherechtliche Prüfung durchgeführt haben und zum Ergebnis kamen, dass die Wirecard Bank alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt hat. Eine Bank muss wirksame Präventionssysteme etablieren, kann aber illegales Handeln ihrer Kunden nicht gänzlich ausschließen. ZEIT: Ihre Zeit begann Hufeld: Als Präsident, ja. ZEIT: Und 2016 wird der Zatarra-Bericht veröffentlicht, geschrieben von damals anonymen Analysten, die viele der Wirecard-Probleme beschrieben. Doch was tut die Bafin? Leitet ein Verfahren gegen die Autoren ein, weil die mit dem Bericht auf einen Kurssturz der Wirecard-Aktie gewettet hatten. Können Sie diese Reaktion bitte erklären? Hufeld: Die Bafin sieht Spekulation und auch die sogenannten Leerverkäufe... ZEIT:... mit denen man auf den Verfall einer Aktie wettet... Hufeld:... als normale Bestandteile des Kapitalmarktgeschehens. Was wir aber von Gesetzes wegen zu schützen haben, ist die faire Preisfindung gegen manipulative Absicht oder Insiderhandel. Wenn wir Anhaltspunkte haben für solche Manipulationen, sind wir als Wertpapieraufseher verpflichtet einzuschreiten. Und diesen gesetzlichen Auftrag haben wir völlig unabhängig von der Frage, ob die zugrunde liegenden Behauptungen wahr oder falsch sind. Später hatten wir von einer deutschen Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte für solche Manipulationen vorliegen und haben Leerverkäufe bei Wirecard ausgesetzt. ZEIT: Jetzt sind wir schon drei Jahre weiter. Aber hätte man nicht den Inhalt des Zatarra-Berichtes ernster nehmen müssen, als man es damals tat? Da war unter anderem die Rede von einem kleinen indischen Unternehmen, das Wirecard für einen horrenden Preis von über 300 Millionen Euro gekauft habe, ohne dass ein auch nur entfernt entsprechender Gegenwert erzielt wurde. Das ging doch ans Eingemachte des Aktionärsschutzes. Hufeld: Wir haben es ernst genommen, aber man muss wissen: Die Firma Zatarra hat es vorher nicht gegeben und hinterher auch nie wieder. Die gab es nur, um durch vorgeblich analytische Aussagen die eigene Spekulation zu unterfüttern. Belastbare Informationen zu Wirecard, mit denen wir arbeiten konnten, haben wir erst Anfang 2019 erhalten. ZEIT: Aber trotzdem waren in dem Bericht nachprüfbare Informationen. Hufeld: Wir haben ihn als Bafin gewürdigt. Entscheidend aber war: Es ging in dem Bericht ausschließlich um die Korrektheit von Konten und Bilanzen. Sie zu überprüfen ist Aufgabe von Wirtschaftsprüfern. Von denen hatten wir uneingeschränkt testierte Jahresabschlüsse vorliegen. Um sich über solche Testierungen hinwegzusetzen, braucht man schon sehr konkrete Informationen. ZEIT: Damals gab es die erste Financial Times- Artikelserie namens House of Wirecards, und auch die Journalisten wurden verdächtigt, mit Aktienhändlern unter einer Decke zu stecken haben Sie dann ja sogar dieses Verbot von Leerverkäufen erwirkt. Hatte man in Deutschland den Eindruck, man müsste einen Angriff der angelsächsischen Spekulationswelt abwehren, und hat deswegen Wirecard geschützt und geschont? Hufeld: Für die Bafin spielten solche Motive nicht die geringste Rolle. Uns ging es um die»marktintegrität«, wie es im Gesetz heißt. Es gab konkrete Hinweise der Staatsanwaltschaft, hier bestehe zum dritten Mal innerhalb von einigen Jahren der Verdacht, dass mit manipulativer Absicht oder durch Insider-Trading Aktienpositionen gegen ein öffentlich gehandeltes Unternehmen aufgebaut wurden. Das mussten wir unterbinden. ZEIT: Anfang 2019 waren die Hinweise auf Bilanzmanipulation konkret, in Singapur durchsuchten Ermittler sogar die Wirecard-Büros. Hufeld: Und wir hatten konkrete Hinweise der Staatsanwaltschaft zu Insiderhandel und konnten feststellen, dass kurz vor entsprechenden Veröffentlichungen an der Börse rund um die Wirecard- Aktie die Aktivitäten zunahmen. Deshalb haben wir auf der Stelle gehandelt und einerseits innerhalb von Tagen den Prüfantrag bei der dafür zuständigen DPR gestellt. Andererseits haben wir auch mehrere Händler und zwei Financial-Times- Journalisten bei der Staatsanwaltschaft München angezeigt, damit deren Rolle geklärt werden konnte. Wir selbst sind ja keine Polizeibehörde. ZEIT: Angeblich ist die DPR nur mit einem Mitarbeiter da herangegangen. Wussten Sie, mit welchen Ressourcen diese Prüfung ausgestattet ist und wie sie vorankommt? Hufeld: Über den Personaleinsatz der Prüfstelle kann ich mich nicht äußern. Wir haben bei unseren Besprechungen mit der DPR mehrfach auf eine Beschleunigung der Prüfung gedrängt wir haben aber keine gesetzlichen Befugnisse, um eine Beschleunigung durchzusetzen. ZEIT: Hat die kleine Prüfstelle das nicht mit Ernst betrieben? Hufeld: Das vermag ich nicht zu beurteilen, solche Prüfungen können sich schon mal einige Zeit hinziehen. Das ist in einer so dynamischen Situation wie bei Wirecard aber nicht effektiv. Deshalb war es wichtig, dass gleichzeitig auch die sogenannte forensische Sonderprüfung durch die Firma KPMG lief, eine besonders intensive und harte Untersuchung. ZEIT: Unter dem Strich musste es 2019 für Anleger so aussehen, als würde die Bafin an Wirecard glauben. Die Anklagen und das Verbot waren öffentlichkeitswirksam, Ihr Prüfauftrag war es nicht. Hufeld: Gesetzlich sind wir verpflichtet, den Prüfauftrag an die DPR strikt vertraulich zu behandeln, deshalb durften wir darüber keine Auskunft geben. Das ist unbefriedigend für Anleger wie auch für die Bafin. ZEIT: Sie hätten eine harte Prüfung in Auftrag geben können, wenn Sie früher die Wirecard- Holding als Finanzinstitut eingestuft hätten. Bereuen Sie, das nicht früher noch mal versucht zu haben? Hufeld: Wir haben geprüft, ob diese Einstufung heute zu rechtfertigen ist. Dass es sich so lange hingezogen hat, ist nicht gut. Es handelt sich aber um einen komplexen Prüfprozess. Selbst wenn wir den mit Lichtgeschwindigkeit zu Ende geführt und früher Zugriff gehabt hätten, dann hätten wir genau eine solche Sonderprüfung veranlasst, wie sie durch KPMG schon lief. Ich glaube nicht, dass da schneller etwas herausgekommen wäre. ZEIT: Sie sprachen zuvor von den Wirtschaftsprüfern von EY, die jahrelang Wirecard prüften und alles bestätigten. Sind das aus Ihrer Sicht die eigentlich Schuldigen am Aufsichtsversagen? Hufeld: Diese Frage müssen andere beantworten. Alle Aufsichtsorgane auf dem Finanzmarkt und Börsenplatz Deutschland, einschließlich meiner Behörde, sind jetzt gefordert, potenzielle Fehlerquellen schnell zu identifizieren und auszuräumen. ZEIT: Kritisiert werden auch Banken. Es gab ja sehr viele Indizien für den Wahnsinn von Wirecard. Und doch empfahlen deutsche Kundenbanken diese Aktie Privatanlegern noch im Frühling Sind die nicht auch schuld, hätten die nicht auch die Financial Times lesen müssen? Hufeld: Vielleicht, und, um Ihre Liste zu verlängern: Die Deutsche Börse hat das Unternehmen in den Dax und den Prime Standard aufgenommen. Diese Debatte müssen wir alle führen. Ich fühle mich verantwortlich, für Verbesserungen in meiner eigenen Behörde zu sorgen, und denke, das sollten alle tun. ZEIT: Unter dem Strich: Wo haben Sie Fehler begangen? Hufeld: Meine Aussage war, dass wir effektiver sein müssen: Wir hätten die Einstufung als Finanzholding schneller zu Ende bringen müssen, auch wenn dies mit ziemlicher Sicherheit nichts gegen Bilanzbetrug und Täuschungen mit hoher krimineller Energie hätte ausrichten können. Wir müssen uns erneut mit der Bilanzkontrolle beschäftigen, wie von Bundesfinanzministerium und Bundesjustizministerium bereits veranlasst. Den zweistufigen Prozess, bei dem zunächst eine Stelle wie die DPR prüfen muss, gibt es sonst nur noch in Österreich und Schweden. Ich würde mir wirksamere Möglichkeiten für uns wünschen. ZEIT: Wirecard ist pleite, 20 Milliarden Euro Börsen wert sind vernichtet. Was bedeutet das für den Finanzstandort Deutschland? Hufeld: Das verlorene Vertrauen muss wiedererworben werden. Ein solcher Betrugsskandal darf sich nicht wiederholen. ZEIT: Aus der Politik kommen Rücktrittsforderungen an Sie. Ist es Ihre Verantwortung zu gehen oder zu bleiben und den Wandel einzuleiten? Hufeld: Wäre unser Verhalten bei fairer Betrachtung als wirkliche Verfehlung einzustufen, dann wäre ich der Erste, der die Konsequenz zieht. Das kann ich im Fall Wirecard aber nicht erkennen. Das Gespräch führte Uwe Jean Heuser
21 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 WIRTSCHAFT 21 Foto: Max Whittaker/NYT/Redux/laif Der Google-Manager Sundar Pichai stammt selbst aus Indien und kritisiert die Politik der US-Regierung Land ohne Talente Donald Trump lässt ausländische Forscher und Fachkräfte nicht mehr in die USA. Jetzt zeigt sich, wie abhängig Wissenschaft und Wohlstand von ihnen sind VON KATHARIN TAI Als Zhang, 25, zum Studium in die USA zog, glaubte er, alles richtig gemacht zu haben. In Amerika, so hoffte er, würde er jene akademische Freiheit und Exzellenz finden, die er in seiner chinesischen Heimat vermisste. Für ihn war Amerika ein Traumziel.»Ich dachte, die Wissenschaft in den USA sei diverser, weniger eingeschränkt durch die Regierung«, sagt Zhang, der an einer US-Eliteuniversität in einem Mint-Fach promoviert, aber in Wahrheit anders heißt. Seinen echten Namen will er nicht preisgeben aus Angst, seinen Aufenthaltsstatus in den USA zu gefährden. Denn von Zhangs amerikanischem Traum ist heute, fünf Jahre später, nicht mehr viel übrig geblieben. Eigentlich wollte er nach seiner Promotion in den USA bleiben. Als Naturwissenschaftler mit Doktortitel müsste er wahrscheinlich nicht lange nach einem Job suchen. Doch ob das noch möglich ist, weiß Zhang nicht. Wie Zehntausende andere ausländische Fachkräfte und Wissenschaftler droht er ein Opfer der Anti-Einwanderungs-Politik von US-Präsident Donald Trump zu werden. Seit Trump im Weißen Haus sitzt, müssen ausländische Staatsbürger, die in den USA arbeiten wollen, nicht nur deutlich länger auf ein Visum warten. Die Zahl der abgelehnten Visa-Anträge hat sich zudem vervielfacht, wie Zahlen der Einwanderungsbehörde belegen. Eine Anordnung Trumps aus der vergangenen Woche lässt die Lage weiter eskalieren: Ausländische Arbeitnehmer, die zum Stichtag 24. Juni kein gültiges Arbeitsvisum hatten, dürfen bis Januar nicht in die USA einreisen. Die Fachkräfte seien»eine Gefahr für Arbeit suchende Amerikaner«, heißt es in Trumps Verlautbarung. Für amerikanische Unternehmen ist es damit bis 2021 praktisch unmöglich, ausländische Staatsbürger neu anzustellen. Betroffen sind neben besonders qualifizierten Fachkräften unter anderem auch deren Angehörige und viele Saisonarbeiter. Trumps Erlass trifft vor allem die großen Technologiekonzerne hart, die Jahr für Jahr Tausende Mitarbeiter aus der ganzen Welt einstellen. Deren Chefs kritisierten die Entscheidung des US- Präsidenten scharf. Google-Chef Sundar Pichai twitterte, Einwanderung habe entscheidend zu ANZEIGE LESEN SIE IN UNSERER AKTUELLEN AUSGABE: DieRevolution derfleischindustrie AB FREITAGIMHANDEL Amerikas wirtschaftlichem Erfolg beigetragen; er stammt selbst aus Indien. Ein Sprecher des Online-Händler Amazon sagte laut Business Insider, Trumps Maßnahme gefährde»die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der USA«. Die Techkonzerne sind auf ausländische Programmierer und andere Experten angewiesen und umgekehrt. Einwanderer, die ein sogenanntes H1B-Visa für hoch qualifizierte Fachkräfte besitzen, riskieren ihre Aufenthaltsgenehmigung in den USA, wenn sie ihren Job verlieren und nicht innerhalb von zwei Monaten einen neuen finden. In der Vergangenheit warfen sowohl Arbeitsrechtsaktivisten als auch Einwanderungsgegner Techunternehmen wie Facebook wiederholt vor, diese Regelung auszunutzen, um ausländische Arbeitskräfte schlechter zu behandeln und zu bezahlen. Tatsächlich sind es Menschen wie der chinesische Doktorand Zhang, die entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes und zu seiner globalen Führungsrolle in der Forschung beitragen. Das gilt besonders für zukunftsweisende und symbolträchtige Bereiche wie die künstliche Intelligenz (KI). Mehr als jeder zweite Doktorand, der an einer amerikanischen Universität zu KI oder einem verwandten Feld forscht, ist ausländischer Staatsbürger. Jeder fünfte kommt aus China, schätzt ein Bericht des Center for Security and Emerging Technology der Georgetown University. Da nur ein Bruchteil der Doktoranden aus den USA kommt, ließen sich diese ausländischen Spezialisten nicht so einfach ersetzen, sollte Trump seinen Kurs gegen Einwanderer künftig noch weiter verschärfen. Eine Studie des Thinktanks MacroPolo aus Chicago, der Chinas wirtschaftlichen Aufstieg analysiert, zeigt, dass diese ausländischen Forscher auch qualitativ einen wichtigen Beitrag für Spitzenforschung in den USA leisten: Mehr als die Hälfte der Forscher, die im Namen amerikanischer Institutionen auf der wichtigsten Konferenz für KI-Forschung, der NeurIPS, neue Forschungsergebnisse präsentieren, stammt ursprünglich aus dem Ausland. Aus keinem Land kommen dabei so viele Forscher wie aus China.»Die USA haben gerade einen enormen Vorteil«, konstatierten die Studienautoren Ishan Banerjee und Matt Sheehan Anfang Juni. Dieser könnte aber leicht verschwinden, wenn politische Entscheidungen den internationalen Fluss der Talente unterbrechen. Zu keinem anderen Land haben sich die Beziehungen der USA unter Donald Trumps Präsidentschaft so sehr verschlechtert wie zu China. Und kaum eine Gruppe leidet darunter so unmittelbar wie chinesische Studierende, Wissenschaftler und Fachkräfte. Im Mai kündigte Trump an,»bestimmten chinesischen Forschern und Studierenden«die Einreise in die USA zu verbieten. Dies solle den Diebstahl»amerikanischer Technologie, geistigen Eigentums und von Informationen«unterbinden, so ein Sprecher des US- Außenministeriums. Wer genau von der neuen Regel betroffen ist, sagte er nicht. Ausländische Firmen werfen China seit Jahren Industriespionage im In- und Ausland vor. In einem prominenten Fall 2016 wurde ein Chinese in den USA dafür verurteilt, geistiges Eigentum der Firmen Monsanto und DuPont Pioneer in Form von Maiskörnern für eine Firma in Peking gestohlen zu haben. Belegte Fälle von chinesischen Studenten, die in den USA Industriespionage betrieben haben, sind der ZEIT nicht bekannt. Schon 2018 begann die US-Regierung, für manche chinesische Studierende in»sensiblen Bereichen«nur noch ein Jahr lang gültige Visa auszustellen, sodass sie jährlich bei einer Neubeantragung ihre Einreiseerlaubnis verlieren könnten. Im selben Jahr berichtete das US- Magazin Politico, Trump habe alle Studenten aus China als»spione«bezeichnet. Viele chinesische Doktoranden verzichten nach eigenen Angaben deshalb inzwischen auf Heimatbesuche während ihrer Promotion. Sie fürchten, bei der Rückkehr an der Grenze Probleme zu bekommen wie neun chinesische Studen- ten aus Arizona, denen im Sommer 2019 die Einreise in die USA verweigert wurde. Untereinander erzählen chinesische Doktoranden sich Anekdoten von Freunden, die von US-Grenzbeamten zu ihren Forschungsthemen verhört worden seien. Auch er fühle sich in den USA zunehmend unwohl, sagt Zhang, der Doktorand der US-Eliteuniversität.»Wir spüren am eigenen Leib, wie sich die ANZEIGE Beziehungen zwischen den USA und China verschlechtern«, beschreibt er die Stimmung unter chinesischen Studierenden. Viele seien zwar bislang nicht direkt von den neuen Maßnahmen betroffen, aber die Sorge sei groß, dass sich das bald ändern könnte:»es herrscht ein Gefühl das Unbehagens, und wir beobachten genau, wie sich die bilaterale Beziehung weiterentwickelt.«einzel-, Groß-, Onlineoder Außenhandel: Wir sind für Sie da. Zhang will so schnell wie möglich seinen Abschluss machen und sich danach in China einen Job in der Wirtschaft suchen. Auch in seinem Freundeskreis gebe es niemanden mehr, der ernsthaft eine Karriere in den USA plant.»wer weiß, was zwischen den beiden Ländern in fünf oder zehn Jahren passiert?«, sagt er.»ich hätte das Gefühl, hier eine Geisel zu sein, wenn sich das weiter verschlechtert.«mit unserer Genossenschaftlichen Beratung. vr.de Der Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät: ehrlich, kompetent, glaubwürdig und gerne auch zu Finanzthemen rund um Krisenbewältigung und Zukunftsstrategien. Probieren Sie es aus und nutzen auch Sie unsere Genossenschaftliche Beratung für Ihre unternehmerischen Ziele und Wünsche, Pläne und Vorhaben. Jetzt Termin vereinbaren und beraten lassen: vr.de/durchstarten
22 22 WIRTSCHAFT 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Die Maschine und das Blut Eine rätselhafte Krankheit Véronique Durand erinnert sich, dass das weiße Gerät bei der Plasmaspende nur leise rumorte, während es ihr Blut in zwei Teile schleuderte. Am 27. Januar 2018 lag die 55-jährige Sozialarbeiterin auf einer Liege im Blutspendezentrum in der Nähe ihres Hauses in Perpignan, Südfrankreich, und spendete zum sechsten und letzten Mal in ihrem Leben Plasma. Aus ihrem Arm floss das Blut durch einen Plastikschlauch in den Kasten. Eine kleine Zentrifuge darin trennte es in seine Bestandteile: in blassgelbes Plasma und den dunkelroten Rest, die Zellen, die zurück in Durands Adern flossen.»ich wollte Kranken helfen«, sagt sie heute. Doch nun ist Durand selbst krank, eine seltene Blutkrebsart. Und sie fragt sich, ob die Maschine daran schuld ist. Die Firma Haemonetics, die sie gebaut hat, erklärt auf Anfrage, ihre Maschinen seien sicher. Sieben Monate nach Durands Termin machte die französische Medizinproduktebehörde die Benutzung der Maschine unmöglich, indem sie den Betrieb mit dem einzigen in Frankreich zugelassenen Einweg-Set untersagte. Seither wird die Maschine in Frankreich nicht mehr benutzt. In vielen anderen Ländern der Welt, auch in Deutschland, ist sie bis heute in Betrieb. Véronique Durand kann ihr Wohnzimmer kaum mehr verlassen, erzählt sie, da sie sich mit ihrer Krankheit besonders vor einer Covid-19-Infektion schützen muss. Gemeinsam mit anderen klagt sie gegen Haemonetics.»Wenn die Vorwürfe stimmen, dann zählt in diesem System offenbar Profit mehr als Gesundheit«, sagt sie. Pharmaunternehmen und Patienten weltweit sind auf Spender wie Durand angewiesen. Die Unternehmen brauchen menschliches Blutplasma, um lebenswichtige Medikamente herzustellen. Denn Plasma, der flüssige Teil des Blutes, kann wie ein heilendes Elixier wirken: Es enthält wertvolle Eiweiße, die Immunkranken helfen können, Unfallopfern oder Menschen mit Blutgerinnungsstörungen. Auch bei Covid-19 gibt es die Hoffnung, dass eine Therapie mit dem Blutplasma Genesener helfen könnte. Der Rohstoff Plasma ist so wichtig, dass die Europäische Kommission ihn im April 2018 als»strategische Ressource«bezeichnete. Von US-Importen müsse man unabhängig werden: Europa solle mehr Spender gewinnen. Die müssen darauf vertrauen, selbst kein Risiko einzugehen. Doch dies ist eine Geschichte über die Frage, ob durch eine offenbar fehleranfällige Maschine und ein lückenhaftes Meldewesen für Störfälle eine große Zahl Menschen potenziell gefährdet wurden und werden. Haemonetics nennt solche Vermutungen»falsch und unbegründet«. Die ZEIT und sieben internationale Medienpartner haben auf der Suche nach Antworten Hunderte interne Dokumente der Firma Haemonetics ausgewertet, die sie durch Whistleblower erhalten haben. Die Dokumente zeigen, dass die Firma seit Jahren von einem Problem mit ihren Maschinen weiß, das nach Ansicht von Experten eventuell Gesundheitsschäden verursachen könnte. Ein Problem, von dem die deutschen Behörden offenbar kaum etwas mitbekommen haben. Dass Durand einen Verdacht gegen Haemonetics schöpfte, lag an mehreren Medienberichten, die sie Monate nach ihrer Krebs dia gno se gelesen hatte: Im Innern der Maschine, so berichteten darin zwei ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens, würden immer wieder seltsame schwarze Flocken produziert, allem Anschein nach Abrieb aus der Maschine. Die Teilchen könnten unter Umständen sogar in die Venen der Plasmaspender zurückfließen mit unklaren Folgen. Haemonetics sagt, die französische Medizinproduktebehörde sehe durch die Partikel kein Risiko für Spender oder Patienten gegeben. Tatsächlich gibt es bis heute keinen bekannten Fall, in dem sich eine Erkrankung unzweifelhaft auf eine Haemonetics- Maschine zurückführen lässt. Das wäre auch sehr schwierig, denn viele Erkrankungen können verschiedene Ursachen haben. Nur: Ausschließen, dass die abgelösten Teilchen die Gesundheit der Spender gefährden können, kann auch niemand.»fremdmaterial jeglicher Art darf durch eine Plasmaspende nicht in den Körper kommen«, sagt Rainer Blasczyk, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Transplantat Engineering an der Medizinischen Hochschule Hannover. Véronique Durand erzählt, sie habe die Firma Haemonetics vorher gar nicht gekannt. Dann aber schloss sie sich einer Strafanzeige gegen die Firma an:»gefährdung des Lebens anderer, schwere Täuschung und unterlassener Rückruf eines gesundheitsschädlichen Produkts«lauten die Vorwürfe. Angestoßen haben die Klage die zwei ehemaligen Unternehmensmitarbeiter, die auch die Partikel-Vorwürfe öffentlich gemacht hatten. Sieben weitere ehemalige Spender schlossen sich an. Sie sind derzeit nicht erkrankt, aber verunsichert.»ich will, dass die Klage mehr Licht in die Sache bringt«, sagt auch Durand. Ein globaler Markt Haemonetics-Aktien werden weltweit an den Börsen gehandelt, die Firma ist einer der drei Weltmarktführer in der blutverarbeitenden Industrie, sie exportiert in über 50 Länder, 2019 machte sie weltweit 968 Millionen Dollar Umsatz. Hat eine amerikanische Medizintechnikfirma fahrlässig die Gesundheit von Menschen gefährdet? Hunderte Dokumente offenbaren weltweite Probleme bei Blutplasmaspenden VON EVA HOFFMANN, LUISA HOMMERICH, YASSIN MUSHARBASH, FLORIAN SCHUMANN UND SASCHA VENOHR Bei einer Plasmaspende wird das Blut des Spenders in einer Maschine in seine Bestandteile zerlegt. Das flüssige Plasma gelangt in einen Behälter, die Blutzellen fließen zurück in die Vene des Spenders Eines der Bestseller-Produkte von Haemonetics sind Blutplasma-Maschinen vom Typ PCS2. Durch eine spezielle Zentrifuge sind sie schneller als Geräte der Konkurrenz. Zu den Kunden von Haemonetics gehören das Deutsche Rote Kreuz, Krankenhäuser und viele der über 70 privaten Spendezentren in Deutschland. In Deutschland waren nach internen Angaben der Firma 2018 mehr als 1600 der PCS2- Maschinen im Einsatz, sie ist eines der gängigsten Geräte auf dem Markt. Doch genau diese Maschine macht Probleme. Die Partikel, von denen die ehemaligen Mitarbeiter in ihrer Klage berichten, treten nach Informationen der ZEIT schon seit 2005 auf. Sie sind auch nicht auf Frankreich begrenzt es gibt sie weltweit. Das belegen interne Firmendokumente: Die Partikel-Fälle finden sich in einer Sammlung von insgesamt mehr als Unregelmäßigkeiten mit Haemonetics-Maschinen in 40 Ländern vor allem mit Geräten zum Gewinnen von Blutplasma und Blutplättchen. Spendezentren und Krankenhäuser haben sie der Firma gemeldet. Die Menge dieser Berichte sei nicht ungewöhnlich für ein Unternehmen dieser Größe, sagt Haemonetics. Bei der Mehrzahl handle es sich zudem um harmlose Vorfälle, etwa um fehlerhafte Verpackungen. Allerdings taucht in dem Datensatz über 600-mal das Problem auf, das bisher nur in Frankreich juristisch aktenkundig ist: Es erschienen die beschriebenen seltsamen Flocken. Sie setzen sich in der Maschine ab oder im Beutel mit dem gesammelten Plasma. Sie sind mit bloßem Auge sichtbar, Fotos zeigen klumpige, millimeterdicke Verunreinigungen in der blassgelben Flüssigkeit. Die jüngsten Vorfälle in den Daten sind von Das Problem: Wenn Menschen Plasma oder Blutplättchen spenden, fließen Teile des Blutes von der Maschine zurück in die Vene des Spenders. Eigentlich ist deshalb alles darauf ausgerichtet, Verunreinigungen zu vermeiden. Jedes medizinische Teil, das mit Blut in Kontakt kommt, darf nur einmal verwendet werden. Steril verpackte Einmal-Sets enthalten je eine Nadel, einen Beutel mit einer Lösung, die verhindert, dass das Blut gerinnt, einen Plasma-Sammelbeutel, Schläuche mit Filtern und einen kleinen Zentrifugeneinsatz, in dem das Blut geschleudert wird. Vor jeder Spende prüfen Fachkräfte, ob alles mit diesen Teilen in Ordnung ist. Eine Soft ware in der Maschine kann die Spende bei Unregelmäßigkeiten abbrechen, außerdem natürlich das Personal. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen flossen jedoch in einigen Fällen offenbar mit dem Blut auch Teilchen zurück in Richtung Arm. Darüber finden sich Be- Illustration: Daniel Stolle für DIE ZEIT; ZEIT-Grafik richte in den Dokumenten:»Der Mitarbeiter erkannte schwarze Partikel im Blutfilter des Schlauches, der zum Spender-Arm führt«, heißt es etwa über eine anscheinend missglückte Spende in Cottbus am 22. März Der Filter soll das zurückgeführte Blut von Fremdkörpern reinigen. Mikro- und Nanopartikel können jedoch hindurchschwimmen und ins Blut der Spender gelangen. Auf Anfrage sagt das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Probleme mit schwarzen Partikeln seien nur in Frankreich aufgetreten. Lediglich drei ähnliche Meldungen lägen für Deutschland seit 2005 vor, allerdings seien die Partikel nicht schwarz, sondern hell gewesen: Ein Fall habe sich am 1. April 2011 mit der Plasmaspende- Maschine PCS2 ereignet, einer 2019 mit der Maschine MCS+, die neben Plasma auch Blutplättchen und rote Blutkörperchen sammeln kann. Sie ist ebenfalls ein Haemonetics-Gerät. Ein weiterer Fall aus dem Jahr 2019 lässt sich nicht zuordnen. Doch laut internen Aufstellungen und s, die der ZEIT vorliegen, tauchten die Partikel seit 2005 mindestens 56-mal in deutschen Spendezentren auf etwa in Braunschweig, Rostock, Dessau, Plauen, Ingolstadt. Chargennummern in den Meldungen geben Hinweise, dass meist eine PCS2 oder die verwandte MCS+ Probleme gemacht haben muss. Die ZEIT hat alle 25 Zentren mit Partikel-Fällen kontaktiert. Die elf, die geantwortet haben, wollen sich weder konkret zu den Vorfällen äußern noch sie bestätigen oder dementieren. Hätten sich nicht in Frankreich ein unzufriedener Landesgeschäftsführer, ein Techniker und ein Gewerkschafter verbündet, wäre das Ausmaß des Problems womöglich noch immer nicht deutlich. Doch den Anfang nahm der Fall in den Niederlanden. Im Innern der Firma Mai 2011, Eindhoven, Niederlande: In einem Spendezentrum der Blutspendeorganisation Sanquin geschieht etwas, das Haemonetics-Mitarbeiter sehr nervös macht so jedenfalls lesen sich interne s, die sie anschließend schrieben. Eine PCS2-Maschine macht während der Plasmaspende seltsame Geräusche:»Die Zentrifuge schabte sehr stark und hörte für eine Weile auf, sich zu drehen«, heißt es in einer zwei Tage später verfassten Störfall-Meldung an Haemonetics. Ein Angestellter entdeckt schwarze Punkte im gesammelten Plasma. Rieb in der Maschine etwas aufein an der, lösten sich in ihrem Innern Stückchen ab? Es ist nicht das erste Mal, dass Sanquin sich mit Partikeln beschäftigen muss: Kurz zuvor haben sich zwei Krankenhäuser gemeldet. Sie haben Verunreinigungen in aufgetautem Plasma entdeckt es stammte aus derselben kratzenden Maschine, berichtet das Spendezentrum an Haemonetics. Und: Ein Teil des Plasmas scheine einem Patienten übertragen worden zu sein. Wurde also kontaminiertes Plasma verabreicht? Auf Nachfrage der ZEIT und ihrer Partner sagt die Organisation:»Soweit Sanquin in der Lage war, das festzustellen, ist keine Trans fusion von Plasma mit Partikeln geschehen.«haemonetics-mitarbeiter hatten jedoch offenbar große Sorge, dass genau das passiert sein könnte. Unter dem Betreff»Schwarze Partikel transfundiert«schreibt ein Vertriebsspezialist an eine Kollegin im Qualitätsmanagement:»Am Montag muss ich unseren Kunden eine Erklärung bieten, ich muss wissen, was ich kommunizieren kann, um Schaden zu minimieren, jetzt, da ein Patient betroffen ist.«mit s wie diesen konfrontiert, antwortet Haemonetics, diese zeichneten»kein richtiges oder vollständiges Bild«davon, wie stark die Firma sich bemühe,»das Risiko der Partikel zu bewerten«und ihre Produkte»dementsprechend sicher zu gestalten«. Teile der s seien»aus dem Kontext gerissen«, mit ihnen werde»etwas suggeriert, was so nicht ist«. Der Vertriebsspezialist, so die vorliegenden s, schreibt damals weiter:»sind wir 100 % sicher, was für ein Material das ist, das da in unserem Plasma schwimmt? Woraus besteht das Drehgelenk?«Das»Drehgelenk«ist so etwas wie das Alleinstellungsmerkmal der Haemonetics-Maschine und nach allem, was man weiß, ihr größter Schwachpunkt. Es verankert das Herzstück der PCS2: einen kleinen Zentrifugeneinsatz, genannt Glocke. Sie ist etwa so groß wie eine Orange und ist Teil des beschriebenen Einmal-Sets. Bei jeder Spende wird also eine neue Glocke eingesetzt. Sie schleudert das Blut mit bis zu 7500 Umdrehungen pro Minute so rasant, dass die Fliehkraft die schwereren Blutzellen nach außen drückt und sich das Plasma innen sammelt und anschließend abfließen kann. Das Gelenk muss die Glocke gleichzeitig in der Maschine festhalten und drehen. Es besteht deshalb aus einem festen und einem beweglichen Teil. Diese Technik macht die PCS2- Maschine so schnell. Doch der Zentrifugeneinsatz kann mitunter zu stark vibrieren und unrund laufen. Die rotierenden Teile des Drehgelenks schaben an ein an der, manchmal kratzt und quietscht es wie bei dem Fall in Eindhoven. Partikel können sich ablösen. Bei einer Fehlfunktion kann das Plasma in Kontakt mit dem Gelenk kommen und sich mit Partikeln mischen. Woraus das Drehgelenk genau besteht, wird Haemonetics erst Jahre später offenlegen.
23 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 WIRTSCHAFT 23»Wenn die Vorwürfe stimmen, dann zählt in diesem System Profit offenbar mehr als Gesundheit«, sagt Véronique Durand, die helfen wollte und nun Anzeige erstattet hat Zunächst aber schreibt die Qualitätsmanagerin ihrem hilflos klingenden Kollegen ungefähr 50 Minuten nach dessen Mail zurück:»danke für diese Informationen das ist ernst.«dann beruft die Qualitätsmanagerin eine Telefonkonferenz mit Technikern ein. Sanquin sperrt unterdessen 5500 Beutel gefrorenes Plasma für die Benutzung und fordert von Haemonetics Schadensersatz. Von da an baut Haemonetics den Zentrifugeneinsatz etwas anders, verändert seine Größe. Doch das löst das Problem offenbar nicht: 16 Monate später, im November 2012, schwimmen erneut schwarze Flocken in einem Plasmabeutel, schon wieder bei Sanquin, das vermerkt ein Spendezentrum in Tilburg nahe Eindhoven und das, obwohl diesmal ein»angepasstes Gerät«das Plasma gewonnen habe, so eine interne Mail. Haemonetics lässt die Flocken in die Firmenzentrale nach Massachusetts fliegen, wo der leitende Wissenschaftler der Firma sie untersucht. Längst gibt es zu diesem Zeitpunkt einen Deutungskampf um Ursprung und Gefährlichkeit der Partikel, der bis heute anhält. Zunächst gab Haemonetics gegenüber Sanquin an, die Partikel seien geklumptes Blut, dann, sie seien getrocknete Proteine. In einem Brief an US-Kunden räumte Haemonetics ein, die Partikel könnten Abrieb aus dem Gelenk enthalten, doch den baue der Körper schon ab. Schließlich findet der Haemonetics-Wissenschaftler in ihnen Spuren von Nickel, doch das sei im Drehgelenk gar nicht enthalten die Verunreinigung sei eventuell anders entstanden. Was stimmt? Die Antwort ist wichtig. Aber ohne Alexandre Berthelot, der sich 2015 entscheidet, seine alte Firma an die Behörden zu verraten, würde bis heute nicht einmal die Frage öffentlich diskutiert. Die Whistleblower Im Juni 2011 wurde Alexandre Berthelot in der Haemonetics-Filiale in Limonest, Südfrankreich, zum Frankreich-Geschäftsführer befördert ein studierter Biologe und Ökonom, heute 52 Jahre alt. Als Abteilungsleiter für die Beneluxstaaten hatte er in vielen der Mails über die niederländischen Partikel in Kopie gestanden. Berthelot ist kein einfacher Charakter. Ehemalige Weggefährten beschreiben ihn als nicht gerade konfliktscheu. Dass er Haemonetics angriff, behaupten sie, sei ein Rachefeldzug nach einer verpassten Beförderung gewesen. Berthelot selbst beschreibt sich als Kämpfer gegen das Unrecht:»Es ist schwer, psychologisch zu akzeptieren, dass wir potenziell gefährliche Maschinen verkauft haben.«am 15. Mai 2020 wurde sein Verhalten vor dem Arbeitsgericht Ver sailles offiziell nach dem französischen Whistleblower- Gesetz als rechtmäßig anerkannt. Es regelt, wie Mitarbeiter mit Missständen in Unternehmen umgehen dürfen. Laut den Gerichtsakten sprach Berthelot das Problem der Partikel zunächst intern an, wie es das Gesetz verlangt ohne Erfolg. Im August 2015 entließ Haemonetics ihn»wegen Illoyalität und schweren Fehlverhaltens«. Das sei unrechtmäßig gewesen, entschied das Gericht im selben Urteil Haemonetics muss ihm nun Schadensersatz zahlen. Nach seiner Entlassung verbündete sich Berthelot mit einem leitenden Techniker des Unternehmens, Jean-Philippe Urrecho, der ebenfalls zuvor intern angeeckt war. Dann, ab Dezember 2015, begannen beide, die französischen Behörden mit Briefen geradezu zu bombardieren: Sie schrieben der Blutbehörde, der einzigen Organisation, die in Frankreich Blut- und Plasmaspendezentren betreiben darf. Dann der Medizinproduktebehörde, dem Gesundheitsministerium, der Agentur für Arbeitsplatzgesundheit wandten sie sich an die Presse, das Online-Medium Mediapart berichtete. Es war einer dieser Artikel, die Véronique Durand, die kranke Sozialarbeiterin aus Perpignan, damals las. Und noch ein weiterer Unzufriedener meldete sich daraufhin, diesmal ein Gewerkschaftsfunktionär aus der Blutbehörde: Guylain Cabantous, 49 Jahre alt, in den Neunzigern arbeitete er in einem Blutspende-Truck, zuletzt am Empfang eines Spendezentrums in Montpellier.»Ich dachte an die Gesichter der Menschen dort«, sagt Cabantous bei einem Treffen in Paris.»Die Erinnerung daran, wie ein Student sagt, hallo, ich bin 18, ich will Gutes tun. Diese Leute vertrauen Ärzten und Technikern.«Cabantous durchforstete damals das Intranet der Blutbehörde, der Fall Haemonetics ließ ihn nicht los, er schickte lange Berichte an Verantwortliche. Fehler im System Schließlich, Anfang 2017, bewegten sich Blutund Medizinproduktebehörde, gaben Studien in Auftrag und bestellten ein Expertenkomitee. Deren Ergebnisse, veröffentlicht im Oktober 2017: Ja, das verdächtige Drehgelenk produziere Abrieb. Ein Teil des Gelenks bestehe laut Haemonetics aus Metallverbindungen, vor allem aus Aluminiumoxid, der andere aus gehärtetem Kunststoff. Doch weil Haemonetics unpräzise Angaben gemacht habe, konstatiert das Expertenkomitee, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass außer den erwähnten Materialien auch Reste von potenziell toxischen Stoffen enthalten seien etwa von Formaldehyd oder von sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, die als krebserregend gelten. Durchschnittlich zwei Milligramm Masse würden schon im Normalbetrieb pro Spende aus dem Drehgelenk herausgelöst. Unter den Partikeln, die sich im Falle einer Fehlfunktion lösen können, seien auch Mikropartikel, einige so klein, dass sie durch die Filter in das Blut gelangen könnten. Das Fazit des Expertenkomitees:»Die Gefahr der Partikelproduktion durch die Drehgelenke«sei»erwiesen«. Das Risiko für Spender festzustellen sei jedoch ohne weitere Stu dien und Angaben von Haemonetics unmöglich. Nach nur zwei Treffen wurde das Expertenkomitee aufgelöst. Seither hat keine Studie Klarheit bringen können, wie groß die Gefährdung ist. Haemonetics verweist auf Nachfrage auf ein späteres State ment der Medizinproduktebehörde: Es gebe kein erwiesenes Gesundheitsrisiko, heißt es darin. Berthelot, Urrecho und Cabantous zeigten die Firma nach Erscheinen des Expertenberichts an, die Blut- und die Medizinproduktebehörde gleich mit. Die Medizinproduktebehörde schrieb anderen europäischen Behörden, fragte, ob auch sie bei einer bestimmten Pro duk tions Charge von Zentrifugeneinsätzen Probleme mit Partikeln gehabt hätten. Doch in Deutschland wurde diese Charge nicht verwendet. Das BfArM antwortete, es gebe keine Probleme und beschäftigte sich nicht weiter mit den Ereignissen in Frankreich. Im August 2018 verbot die französische Medizinproduktebehörde den Einsatz des einzigen in Frankreich zugelassenen Einweg-Sets in den 300 PCS2-Geräten im Land, der Hälfte aller Plasmamaschinen Frankreichs. Die Ermittlungen in Frankreich dauern an. Haemonetics ist bislang außer der unrechtmäßigen Entlassung Berthelots kein Fehlverhalten nachgewiesen worden. Überall sonst auf der Welt laufen die Maschinen weiter. Die Partikel treten nach allem, was man weiß, selten auf: In den der ZEIT vorliegenden Daten finden sich mehr als 600 Partikel-Fälle aus 15 Jahren. Mit Haemonetics-Geräten wurde in dieser Zeit nach Angaben der Firma etwa 360 Millionen Mal gespendet. Bei 0,0006 Prozent aller Spenden seien Partikel gemeldet worden. Haemonetics sagt, die Bestandteile seiner Sets hätten keinerlei schädigende Wirkung für Menschen. Experten finden das dennoch beunruhigend.»natürlich dürfen sich keine Teilchen von der Maschine oder dem Set lösen«, sagt Rainer Blasczyk von der Medizinischen Hochschule Hannover. Auch wenn man nicht wisse, ob die Partikel schädlich seien. Der Partikelexperte Dirk Walter, Leiter der Gefahrstofflaboratorien für Chemie und Physik am Universitätsklinikum Gießen, beschäftigt sich in seiner Forschung mit der Frage, wie Stoffe auf den menschlichen Organismus wirken. Für die ZEIT hat er maßgebliche Studien zu den Partikeln gelesen. In einem Punkt gibt er Entwarnung: Die Teilchen aus dem Drehgelenk seien wohl vorwiegend biobeständig, also nicht löslich im Körper. Erhöhte Metallkonzentrationen im Blut oder Vergiftungen seien daher unwahrscheinlich. Aber:»Auch solche unlöslichen Partikel können Schaden anrichten«, sagt Walter. Setzten sie sich im Körper ab, sei nicht auszuschließen, dass die Partikel Blutgefäße verengen. Zudem betrachte der Organismus die Partikel als Fremdkörper. Als Folge der Immunreaktion könne Gewebe geschädigt werden, auf Dauer könnten Entzündungen entstehen. Aus Studien zu Feinstaub ist bekannt, dass kleinste Partikel, die in den Blutkreislauf gelangen, dazu führen können, dass Blut stärker zur Gerinnung neigt. Das kann das Risiko für Folgeschäden wie Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöhen. Ob und in welchem Umfang die Partikel aus den Plasmamaschinen solche Reaktionen im Körper auslösen könnten, sei unklar, sagt Walter.»Entscheidend ist, über welche Zeit und mit welcher Dosis die Belastung erfolgt.«ob Véronique Durands Krankheit mit den Partikeln zusammenhängen könnte? Walter hält das für nicht sehr wahrscheinlich, aber ausschließen lasse es sich nicht. Im Nachhinein sei es nahezu unmöglich, die Erkrankung einer Ursache zuzuordnen, weil es einfach zu viele Einflussfaktoren gebe. Das toxikologische Risiko für Spender und Patienten zu beurteilen sei mit den vorliegenden Daten nicht möglich. Keinesfalls aber könne man einfach argumentieren, dass der Körper sich schon um den Abrieb kümmern werde. Die zuständigen deutschen Behörden kennen das Partikel-Problem seit Jahren. Neben den Hinweisen aus Frankreich dokumentiert das der zuvor erwähnte Störfall aus dem Jahr Die Behörden nahmen diesen Fall auch ernst. Glaubt man ihren Aussagen, blieb ihnen die Dimension des Problems jedoch verborgen. Schon Wochen vor dem Eindhoven-Fall machte in Deutschland nämlich eine PCS2 Maschine Probleme. Nur mithilfe einer Klage ANZEIGE Die Plasma Files Dieser Artikel ist das Ergebnis einer internationalen Recherche des Signals-Netzwerks und seines Aufrufs an Hinweisgeber, Missstände öffentlich zu machen ( Die ZEIT kooperierte dabei mit El Mundo (Spanien), Mediapart, bastamag und Radio France (Frankreich), Miami Herald (USA), NRC (Niederlande) und Il Fatto Quotidiano (Italien). Auf ZEIT ONLINE finden Sie einen Beitrag zu der Frage, was Plasmaspender jetzt wissen müssen ( gegen das BfArM konnte die ZEIT in Erfahrung bringen, wo und wann genau dieser Fall auftrat: am 1. April 2011 im Spendezentrum des DRK- Blutspendedienstes Ost in Berlin.»Hier kam es zum Abrieb einer Gummidichtung an der Aphereseglocke während des Zentrifugationsprozesses«, erklärt das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auf Anfrage. Das PEI ist als Bundesoberbehörde für die Sicherheit von Blutprodukten zuständig.»fehler einzelner Chargen verschiedener Hersteller können immer mal vorkommen«, antwortet das Deutsche Rote Kreuz auf Nachfrage. Das Spendezentrum meldete den Vorfall seinerzeit an das BfArM. Laut den Daten, die der ZEIT vorliegen, teilten Dutzende weitere betroffene Zentren in Deutschland ihre Partikel-Fälle allerdings lediglich der Firma Haemonetics mit. Das Paul-Ehrlich-Institut reagierte damals prompt, sprach vorübergehend ein Verbot für die zwei betroffenen Glocken-Chargen aus. Deutsche Spendezentren mussten neue Glocken bestellen. Und doch meldeten sie später neue Partikel-Fälle an Haemonetics das zeigt der Datensatz. Wie kann es sein, dass die Ämter, die die Sicherheit der Geräte gewährleisten sollen, so viel schlechter über sie Bescheid wissen als deren Hersteller? Grund ist die sogenannte Medizinprodukte- Sicherheitsplanverordnung. Sie regelt, wie Störfälle gemeldet werden. Und sie regelt, was das BfArM dann tun kann: etwa eine Risikobewertung vornehmen, einige ihrer etwa 100 Experten auf das Produkt ansetzen, abklären, ob das Problem systematisch auftritt, Empfehlungen an die Landesbehörden abgeben diese können einen Rückruf anordnen, wenn nötig. Das Problem: Weder Krankenhäuser noch Spendezentren sind verpflichtet, Störfälle an das BfArM zu melden. Sie können sich entscheiden, einen Fall allein dem Hersteller zu berichten und genau das geschah offenbar bei den meisten Partikel-Fällen in Deutschland. Aus dem BfArM heißt es, es wäre wünschenswert, dass alle Störfälle gemeldet würden. Aber erzwingen könne das Amt das nicht. Die Hersteller wiederum müssen nur bei einem Verdacht auf eine Gesundheitsgefährdung ihre Meldungen an die Behörde weitergeben. Doch wo fängt eine Gesundheitsgefährdung an? Für Haemonetics waren die meisten Partikel- Fälle offenbar kein hinreichender Verdacht. Genau hier ist die Lücke im System. Ob und wie viele Plasmaspender oder -empfänger wegen dieser Lücke von einer potenziellen Gefährdung ihrer Gesundheit betroffen sind, weiß niemand. Mehr als Menschen spendeten 2018 laut Robert Koch-Institut allein in Deutschland Plasma. In den Ländern der Recherchepartner der ZEIT besteht das gleiche Problem. Nirgendwo haben die Behörden die Partikel wirklich auf dem Schirm. Der Transfusionsmediziner Rainer Blasczyk findet, dass deutsche Behörden die Frage der Haemonetics-Geräte thematisieren müssten. Auf die Frage der ZEIT, was das BfArM angesichts der Hinweise, dass es in Deutschland viel mehr Störfälle gab als bekannt, unternehmen werde, antwortete die Behörde ausweichend.
24 24 WIRTSCHAFT 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Effizienter werden: Ein Restaurant am Berliner Landwehrkanal Fotos: Laetitia Vancon/NYT/Redux/laif; dpa (u.)»ein leerer Tisch ist ein Desaster«Aus dem Riesenkonzern Metro hat Olaf Koch einen Großhändler für Gastronomen gemacht und will nun Wirten durch die Krise helfen DIE ZEIT: Herr Koch, seit acht Jahren schrumpfen Sie die Metro. Dazu gehörten mal Kaufhof, Saturn und Mediamarkt, nun haben Sie die Warenhauskette real verkauft. Sind Sie erleichtert oder betrübt? Olaf Koch: Natürlich war das ein emotionaler Moment. Real hat lange Zeit zur Metro-Familie gehört. Die Verkäufe der letzten Jahre dienten vor allem dem Ziel, uns auf den Großhandel zu konzentrieren und unsere Bilanz zu stärken. ZEIT: Als Großhändler haben Sie nun vor allem mit der Gastronomie zu tun. Wann wird die wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreichen? Koch: Anfang April brachen die Umsätze der Gastronomen um bis zu 80 Prozent ein. Wir konnten das recht gut durch Umsätze mit anderen Kundengruppen kompensieren, sodass unser Rückgang in der Spitze der Krise bei etwa 25 Prozent lag. Nach Ostern wurden die ersten Restaurants kreativ und begannen mit dem Abholgeschäft. Jetzt sehen die Kunden, dass Gastronomen sich an Abstands- und Hygieneregeln halten. Das Geschäft wird von Woche zu Woche besser. Das sehen wir an unseren Umsätzen in dem Bereich. ZEIT: Und wann ist bei Ihnen wieder alles normal? Koch: Unser Umsatz auf Gruppenebene wird sich schon in den nächsten Wochen wieder an das Vorjahresniveau annähern. Dafür haben wir während der Krise hart gearbeitet. ZEIT: Was denken Sie über die Hilfsprogramme der Bundesregierung? Koch: Die Geschwindigkeit und Entschlossenheit der Maßnahmen waren beeindruckend. Auch die Umsatzsteuer zu senken war aus Sicht der Gastronomie richtig. ZEIT: Werden die Gastronomen die Mehrwertsteuersenkung an ihre Kunden weitergeben? Koch: Die meisten werden wohl eher versuchen, ihre Kosten damit zu decken. Dafür haben die Gäste sicher Verständnis. Wegen der Abstandsregeln sind ja viel weniger Tische besetzt als sonst. ZEIT: Metro-Märkte sind bekannt für Großpackungen von Lebensmitteln. Was können Sie denn für Gastronomen tun? Preise senken? Koch: Produkte in Topqualität sind das A und O, aber unser Angebot geht weit über Lebensmittel hinaus. Schon seit Jahren schulen wir Köche in unseren Akademien, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Seit Beginn der Corona-Krise beraten wir die Betriebe zudem dabei, wie sie an Fördermittel kommen. Wir helfen Restaurants auch bei der Digitalisierung. Und das ist längst noch nicht alles. ZEIT: Sie richten auch Großküchen ein, richtig? Koch: Wir bieten mit unserem Partner Pentagast unter anderem moderne Küchengeräte an. Technik wie beispielsweise ein Dampfgarer hilft den Gastronomen, produktiver zu werden. ZEIT: Warum helfen denn Dampfgarer? Koch: Weil sie beispielsweise auf Lebensmittel der Metro abgestimmt sind. Unsere Linie Gourve nience umfasst circa 300 Artikel. Das sind von Topköchen entwickelte Produkte wie Suppen, Fleisch oder Pasta, die in den Geräten nahezu vollautomatisch verarbeitet werden können. Das steigert die Effizienz um die Hälfte. ZEIT: Den Gästen erzählen die Gastronomen von ihrer einzigartigen Küche, und hinten wärmt eine Maschine Metro-Fertiggerichte auf? Koch: Wir decken damit bewusst nie ein ganzes Sortiment ab! Kein Koch will austauschbar sein. Deshalb wird er seine Gerichte am Ende immer noch mit der eigenen Note versehen. Zudem sagen wir immer: Deine einzigartigen Gerichte, also deine so wunderbar gegrillte Dorade oder deine ganz spezielle Sauce die sind die Seele deines Restaurants! Die darfst du natürlich nicht ersetzen! So erhalten wir die Vielfalt der ganzen kleinen Restaurants im Land. Sonst hätten wir bald nur noch große Ketten. Aber auch die kleinen Betriebe müssen effizienter werden. Und da gibt es einige Möglichkeiten, von der Kommunikation mit den Kunden bis zur Optimierung der Speisekarte. ZEIT: Wie optimiert man denn eine Speisekarte? Koch: Alle Gerichte auf der Karte haben einen Deckungsbeitrag. Da geht es um Materialeinsatz und Arbeitsdauer. Jeder Koch lernt das in der Fachschule, in der Praxis geht das dann manchmal unter. Wenn wir ihnen das aufzeigen, erkennen etliche, dass sie gerade mit ihren Bestsellern nicht selten Geld verlieren. Anschließend überlegen wir gemeinsam, wie sich das ändern lässt. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, die Verarbeitung, die Kombination, die Produkte und nicht zuletzt der Preis. ZEIT: Was muss ich denn bestellen, wenn ich als Gast ein gutes Geschäft machen will? Koch: Ein gutes Geschäft machen Sie, wenn Ihnen das Gericht Genuss und Freude bereitet. Das sollte im Vordergrund stehen. Die Gerichte, die dem Gastronomen meist wirtschaftlich wehtun, sind die mit einem kleinen Preis und einem hohen Anteil an Handarbeit. Das ist weder clever noch notwendig. ZEIT: Ich dachte immer, das Geld in der Gastronomie wird mit Getränken verdient? Koch: Mit Speisen auch, wenn man es richtig macht. Durch Beratungen konnten wir Gastronomen zusätzliche Deckungsbeiträge mit Speisen von bis zu Euro pro Jahr ermöglichen. Und auch bei Getränken gibt es häufig Potenzial, wenn man erkennt, dass der Kunde sicherlich noch einmal nachgeschenkt bekommen möchte. ZEIT: Wie in schlechten amerikanischen Kettenrestaurants: Ständig nervt der Kellner, ob man noch etwas will und wenn man einmal»nein«sagt, knallt er einem die Rechnung auf den Tisch. Koch: Hierzulande kann ich mir so etwas nicht vorstellen. In Europa stellt die Gastronomie ein Kulturgut dar mit einem hohen Grad an Individualität. Die überwiegende Mehrheit der Gastronomen sind Gastgeber aus Leidenschaft, und die Kunden lieben sie dafür. Das wird sich auch nicht ändern, wenn sie hier und da systematischer arbeiten. Etwa, indem einige in Zeiten der Krise die wenigen Tische am Abend auch zweimal verkaufen müssen und dem Gast sozusagen ein Zeitfenster anbieten. ZEIT: Sie haben vorhin auch die Digitalisierung angesprochen. Warum? Koch: Noch vor drei Jahren war die Hälfte aller Gastronomen hierzulande noch nicht einmal online. Wie bieten ihnen eine kostenlose Internetpräsenz an, das nutzen rund Restaurants in Europa. Und etwa nutzen unser digitales Tisch-Reservierungssystem. Das hilft ihnen enorm. ZEIT: Inwiefern? Koch: Weil Gäste gerade der jüngeren Generation so etwas heute einfach erwarten. Und wir möchten, dass unsere Kunden erfolgreich sind und bleiben. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Gäste auch wirklich kommen, weil sie bei einer Online-Reservierung eine Telefonnummer und -Adresse hinterlassen. Für Gastronomen ist das entscheidend. Ein leerer Tisch ist ein Desaster! ZEIT: Können Sie sich noch mehr Digitalisierung in der Gaststube vorstellen? Koch: Der Bestellprozess etwa lässt sich vereinfachen, aber auch Kassensysteme kann man systematisch auswerten. Dann kann man die Produktivität pro Gericht, pro Tisch, pro Tag sehen und erkennen, wo man gerade wirtschaftlich steht. Aber damit hört die Digitalisierung nicht auf. Wir haben letztes Jahr den ersten Online-Marktplatz für alles gestartet, was Gastronomen außer Lebensmitteln sonst noch brauchen. Den wollen wir europaweit ausrollen. Da gibt es noch viel für uns zu tun. Das Gespräch führte Marcus Rohwetter Olaf Koch (50) ist Vorstandsvorsitzender des Handelskonzerns Metro mit Sitz in Düsseldorf ANZEIGE DIE BESONDERE IMMOBILIE IMMOBILIEN OLN EXCLUSIVE IMMOBILIE Gediegener Alterswohnsitz Österreich Vorarlberg zwischen Bodensee und Arlberg, in sonniger unverbauter Lage wird in einem exklusiven Villenneubau eine sehr schöne Wohnung, schlüsselfertig ausgestattet, mit allem Komfort, zur Miete angeboten. 130m² + Garagen und Gartenflächen nach Wunsch. Rundum durch einen HM betreut und gepflegt. Infos unter wohnen.goefis@gmail.com GELD UND ANLAGE Kapitalab ,- Investitions-/Mezzanine-Kapital, stimmrechtslosesbeteil.-kapital von50t 200Mio., Tel.:0551/ ,Fax:-217 dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de Kontakt für Anzeigenkunden 040 / Beratung und Verkauf Malte.Geers@zeit.de 040 / A DIE FASZINATION DES BÖSEN Der beste Platz am Wasser von Wien: D-City EIN BEITRAG DER S+B GRUPPE AG Am attraktivsten Standort Wiens direkt am Wasser, in unmittelbarer Nähe des historischen Zentrums, wird das größte städtebauliche Projekt finalisiert. Die S+B Gruppe AG hat mit Partnern die restlichen Flächen der DonauCity erworben und sich zur Aufgabe gemacht, Außergewöhnliches zu realisieren. Durch moderne, innovative und enkelgerechte Planung entstehen Wohn- und Büroflächen von mehr als m². Sieben Großprojekte bilden die neue Skyline Wiens neben dem bestehenden DC 1: der DC 2, der DC 3, die Danube Flats, DC Residential, der DC Innovations- und Bildungscampus, die DC Musicflats sowie Garagen- projekte. Weltweit gibt es keine Immobilie direkt am Ufer der Neuen Donau mit dem größten Naherholungsgebiet Donauinsel, europaweit größtem Musikfestival, Wasserski- und Wakeboardareal, Wildwasserkanal, Schwimmen, Rudern, Sandbeachbereich und direkt angrenzendem Nationalpark. Natürlich stehen Laufstrecken, Radwege, Skatebereiche zur Verfügung. Hinzu kommen optimale Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel (U1), kurze Fahrtzeiten zu Bahnhof, Flughafen, gute Erreichbarkeit durch Individualverkehr, direkte Anbindung an Autobahn, ausgezeichnete Nahversorgung, Gastronomie, Schulen, Kindergärten und Ärztezentren. Damit wird die neue D-City zum Wohn-, Arbeits- und Erholungsgebiet der besonderen Art in der lebenswertesten Stadt der Welt. Kontakt S+B Gruppe AG Löwengasse Wien Tel: +43 (0) Andrea.jarisch@sb-gruppe.at, office@sb-gruppe.at NEU AM KIOSK! Hier mit Rabatt bestellen:
25 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 WIRTSCHAFT 25 Durchs offene Fenster Tausende Server in Deutschland sind so eingerichtet, dass Angreifer sie ausspionieren können. Dabei ist die Gefahr seit Jahren bekannt VON JENS TÖNNESMANN Matthias Nehls braucht nur ein paar Klicks, um zu zeigen, wie gefährdet viele Computernetzwerke in Deutschland sind. Der IT-Experte startet ein Programm, das sich jeder im Internet herunterladen kann, und steuert damit den Server eines Touristikunternehmens an. Dann jagen lange Zeichenfolgen über Nehls Bildschirm; das Programm namens Dumper lädt Ordner voller Daten auf Nehls Rechner herunter. Ein paar Minuten später klickt Nehls sich durch die Ordnerstruktur, öffnet die ein oder andere Datei und entdeckt den Benutzernamen samt zugehörigem Passwort der Schlüssel zu einer Datenbank, in der Interna der Firma gespeichert sind.»auf all diese Dateien sollte niemand von außen Zugriff haben«, sagt Nehls,»aber aus Unachtsamkeit sind sie öffentlich einsehbar und ermöglichen es Angreifern, bis ins Innerste einer Organisation einzudringen.«es ist, als hätten die Wächter einer ansonsten gut geschützten Festung ein Kellerfenster offen gelassen leicht zu übersehen, aber groß genug, damit Plünderer einsteigen und bis zur Schatzkammer durchspazieren können. Nehls ist Unternehmer: Er hat die Deutsche Gesellschaft für Cybersicherheit in Flensburg gegründet; er verdient sein Geld damit, Kunden beim Schutz ihrer IT zu helfen. Die meisten Organisationen wissen zwar, wie gefährlich Attacken auf ihre Computer werden können nach Angaben des Digitalverbands Bitkom verursachen Angriffe einen wirtschaftlichen Schaden von mehr als 100 Mil liar den Euro pro Jahr. Doch viele kümmern sich zu wenig um den nötigen Schutz. Vor einigen Monaten etwa wies Nehls die ZEIT auf ein Datenleck beim Autovermieter Buchbinder hin, Millionen von Kundendaten waren betroffen (siehe Ausgabe Nr. 5/20). Jetzt hat Nehls sich erneut an die ZEIT, das Computermagazin c t und den NDR gewandt, um auf eine Schwachstelle hinzuweisen, die er etwa bei der Touristikfirma entdeckt hat. Die Schwachstelle ist weit verbreitet, obwohl sie seit Jahren bekannt ist. Laut Nehls Analysen sind etwa IT-Systeme betroffen. Viele davon sind einfache Webpräsenzen kleiner Firmen, doch es sind auch Server von Mittelständlern und Konzernen, Arztpraxen, Online-Shops und Stadtwerken darunter. Wie Recherchen der drei Medien zeigen, waren zum Beispiel ein Server der Allianz, des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines und der Handelskette Edeka betroffen; außerdem fand sich die Schwachstelle beispielsweise auf den Servern der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg oder des Studentenwerks Göttingen.»Die Sicherheitslücke ist besonders tückisch, weil Angreifer sie ohne großen Aufwand ausnutzen können und ohne dass es den betroffenen Organisationen auffällt«, sagt Nehls. Das Kellerfenster ist nicht nur offen, es liegt auch noch im toten Winkel der Burgwachen. Um zu verstehen, wie die Schwachstelle funktioniert, muss man sich in die Programmierer hineinversetzen, die einen Server mit Soft ware bestücken etwa mit Anwendungen, über die Kunden in einem Online-Shop einkaufen können. Die Programmierer entwickeln den Quelltext einer solchen Anwendung immer weiter, ergänzen neue Funktionen und schalten andere ab. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, speichern und verwalten sie die Versionen des Programms mit einer speziellen Versionsverwaltung. Eine beliebte Versionsverwaltung heißt»git«, benannt nach dem englischen Wort für Blödmann oder Depp. Tatsächlich machen viele Entwickler einen blöden Fehler: Sie verstecken und versperren den Inhalt ihres Git-Archivs nicht, sondern laden ihn mit dem fertigen Programm ins Internet hoch und versäumen es, den Zugriff darauf zu blockieren. So geben sie unabsichtlich den Quell code ihrer Soft ware und die Zugangsdaten ihrer Datenbanken preis.»für Hacker ist das ein gefundenes Fressen«, sagt der IT-Unternehmer Nehls. Nach eigenen Angaben hat er einem seiner Kunden schon demonstriert, wie sich über die Lücke dessen gesamtes Firmennetzwerk übernehmen ließe. Ein Risiko, das bei den Organisationen, die von der ZEIT, der c t und dem NDR mit der Sicherheitslücke konfrontiert wurden, wohl nicht bestand. Beim Göttinger Studentenwerk etwa war das Git eines Servers einsehbar, über den sich Studenten um Wohnungen bewerben können; dafür müssen sie ihre persönlichen Daten in ein Formular eingeben und ein Foto ihres Ausweises hochladen. Man bedanke sich für den Hinweis und habe alle Beteiligten informiert, antwortete das Studentenwerk der ZEIT, der c t und dem NDR.»Wir gehen davon aus, dass unsere Systeme beziehungsweise Daten von Studierenden zu keinem Zeitpunkt für nicht autorisierte Personen zugänglich waren.«ähnlich antworteten auch andere Betroffene:»Zu keiner Zeit waren Kundendaten gefährdet«, schreibt zum Beispiel die Lebensmittelkette Edeka, bei der ein Server zugänglich war, über den Kunden die Herkunft einzelner Lebensmittel nachverfolgen können.»die zwischenzeitlich erreichbaren Daten sind nur von einem geringen Wert für Dritte«, erklärte das Unternehmen. Beim Triebwerkhersteller MTU hieß es, der betroffene Server habe»generell keine sensiblen Informationen verarbeitet«und das Git habe»keine sensiblen Informationen enthalten«. Die Allianz wies darauf hin, dass ihr fraglicher Server nur dazu diene, Versicherungsmakler zu informieren:»es war und ist jedoch nicht möglich, dadurch Zugriff auf persönliche Daten zu erlangen.«und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg räumte zwar ein, dass sich über ihren betroffenen Server pro Jahr etwa 800 Bewerber registrierten, allerdings sei über das Git kein»durchgriff auf gespeicherte Daten«möglich gewesen. Das alles lässt sich von außen nicht überprüfen. Selbst wenn Passwörter öffentlich einsehbar sind: Sie auszuprobieren wäre genauso ein Rechtsbruch, wie durch ein offenes Kellerfenster in ein Haus einzusteigen. Weswegen auch Matthias Nehls Serverbetreiber zwar auf die Schwachstelle hinweist, sie aber nur dann genauer untersucht, wenn ihn die jeweiligen Organisationen damit beauftragen.»aber einem Hacker mit bösen Absichten wäre das egal«, sagt er. Dass es Angreifer gibt, die nach solchen Lücken suchen, ist wahrscheinlich. Zumal es im Netz die nötigen Tools gibt, die ihnen die Arbeit abnehmen. Einige davon haben Sebastian Neef und Tim Schäfers veröffentlicht. Die beiden Informatikstudenten haben die Plattform Internetwache.org ins Leben gerufen, auf der sie über Sicherheitslücken informieren. Ehrenamtlich, weil sie sich als»die Hüter der Sicherheit im Internet«verstehen, wie Schäfers sagt. Dass die Git-Verzeichnisse ein Einfallstor für Angreifer sein können, haben die beiden schon im Jahr 2015 öffentlich gemacht. Um das zu beweisen, programmierten sie Werkzeuge, die das Auslesen der Verzeichnisse erleichtern. Allein in den vergangenen beiden Wochen wurden diese Programme fast 500-mal heruntergeladen. Sie kursieren also im Netz. Eigentlich sollen sie Entwicklern dabei helfen, ihre eigenen Server zu testen und abzusichern.»aber natürlich kann man nicht ausschließen, dass sie auch von Kriminellen genutzt werden«, sagt Neef. Beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist man über die ungeschützten Gits nicht überrascht.»viele kleine und mittelgroße Organisationen machen sich um ihre IT-Sicherheit keinen Kopf, da muss es erst mal knallen, bevor sie die richtigen Schutzmaßnahmen einleiten«, heißt es bei der Behörde. Die unverschlossenen Git-Ordner sieht man dort nicht als Schwachstelle in der Software, sondern als einen jener typischen Anwenderfehler, die oft aus Unkenntnis oder Nachlässigkeit geschehen.»ähnlich gefährlich ist es, wenn Organisationen leichtfertig Back-ups von Konfigurationsdateien oder gar komplette Sicherungen auf ihren Webserver laden«, so ein Sprecher des BSI. Dabei genügen oft kleine Schritte, um die Server sicherer zu machen. Das BSI etwa hat ein ganzes Kompendium namens»grundschutz«mit Ratschlägen zusammengestellt. Die Gits sollte man gar nicht erst auf öffentliche Web-Server laden oder zumindest den Zugriff aus dem Netz verbieten, rät das BSI. Sowohl Matthias Nehls als auch Sebastian Neef und Tim Schäfers haben auf ihren Web sites cyber scan.io und internetwache.org Anleitungen veröffentlicht, worauf dabei genau zu achten ist. Wie schnell sich mit ein paar Klicks die offenen Türen wieder schließen lassen, zeigt auch die Recherche von ZEIT, c t und NDR: Kaum informiert, nahmen die Organisationen die offen stehenden Ordner vom Netz.»Vielen Dank für Ihren Hinweis, der für uns sehr hilfreich war«, antwortete eine Sprecherin der Allianz. ANZEIGE EINFACHKLEINE WAREN GÜNSTIG VERSENDEN. MIT DER WARENPOSTGEHT DAS. Beim Versand kleiner Waren ist jetzt mehr drin sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden. Denn mit der neuen Warenpost kommen Ihre Sendungen schnell und günstig und durch zusätzliche Empfängerservices auch ganz nach Kundenwunsch an. Mehr erfahren Sie unter dhl.de/warenpost Zustellung i.d.r. am nächsten Tag Empfängerservices auswählen Sendung verfolgen
26 26 WIRTSCHAFT DIE MENSCHEN VON DER POLIZEI LEIPZIG-CONNEWITZ 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Foto: Sebastian Wells/Ostkreuz für DIE ZEIT Lagebesprechung in der Connewitzer Polizeistation: Jörg Garbas, Karin Wöbbeking, Kerstin Kühn, Chefin Dorothea Benndorf und Heinz Tretbar (von links). Hinten am Fenster steht Jan Bergmann Revier der Wut Alle zwei Wochen stellen wir auf dieser Seite Menschen vor, die als Gruppe zusammenarbeiten. Diesmal: Die Polizisten von Leipzig-Connewitz, die in ihrem Stadtteil bei vielen verhasst sind VON MARTIN MACHOWECZ Läuft man mit Karin Wöbbeking und Jan Bergmann durch Leipzig- Connewitz, von der winzigen Polizeistation aus auf die Biedermannstraße, dann kann es passieren, dass ein junger Mann mit seinem Fahrrad anhält. Dass dieser junge Mann grimmig schaut. Und dass er sein Handy zückt, um Fotos zu machen von Frau Wöbbeking und Herrn Bergmann. Als wären sie gefährliche Tiere und als müsse man deren Ausbruch aus dem Zoo beweisen. Die Szene ereignet sich an einem sonnigen Nachmittag, aber Frau Wöbbeking lächelt, weil sie fast immer lächelt und weil sie es gewohnt ist, dass man ihr reserviert begegnet. Während Herr Bergmann so tut, als würde er das alles gar nicht bemerken. Später wird Frau Wöbbeking sagen:»tja, manche mögen uns eben nicht. Das nehm ich zur Kenntnis. Das beeinflusst meine Arbeit nicht.«und Herr Bergmann wird zugeben, dass er nicht immer so entspannt sei wie seine Kollegin. Dass ihn das aufwühle. Aber was solle man machen, da müsse man durch, wenn man in Connewitz arbeite. Und Uniform trage. Karin Wöbbeking, 51, und Jan Bergmann, 45, sind Polizisten. Sie sind in einer der umkämpftesten Polizeistationen der Republik eingesetzt, mitten im sogenannten Szeneviertel, das immer wieder Schlagzeilen macht, wenn hier die Gewalt eskaliert. Der Stadtteil ist ein deutscher Symbolort geworden für den Widerstand Autonomer gegen das System: Mal wurden Bagger angezündet und Baustellen attackiert. Mal wurde die Prokuristin eines Immobilienunternehmens, das in Connewitz Häuser errichtet, an ihrer eigenen Wohnungstür überfallen. Mitunter, wie in der jüngsten Silvesternacht, zetteln Linksextreme regelrechte Straßenschlachten an. Es war im Jahr 2014, als die Leipziger Polizeiführung beschloss: Wir setzen ein Revier mitten ins Herz dieses Viertels. An einen Straßenzug, in dem angeblich besonders viele Autonome leben. Dort, wo selbst der Kindergarten von unten bis oben mit Graffiti besprüht ist, prangt seither, wie ein Gegen-Statement, auch das kleine Schild mit der Schrift in Weiß auf Blau:»Polizei«. Ein Wort als Ansage: Jetzt reicht es mal, jetzt werdet ihr uns nicht mehr los! Aber wenn man es dann besucht, dieses Connewitzer Polizeirevier, stellt man fest, wie klein und karg es ist, wie wenige Menschen hier arbeiten nämlich, neben Wöbbeking und Bergmann, nur noch eine weitere Kollegin, Frau Kühn, die aber an diesem Tag nicht da ist. Und ein, zwei wechselnde Schreibkräfte. Und man stellt fest, wie defensiv die Beamten hier sind. Die Polizei hat diesmal nicht etwa eine Truppe breitschultriger Kämpfer nach Connewitz entsandt. Sondern sehr normale Leute, deren Job meist nichts anderes ist als: reden. Sie nennen sich»bürgerpolizisten«. Sie gehören, das soll der Name signalisieren, keiner Einsatz-Hundertschaft an, die sich auf Demos prügelt. Sie sind keine Mordermittler. Sie machen keine Razzien. Sie sind dafür da, auf der Straße zu sein, ansprechbar in kleinen Notlagen. Ein bisschen auch, um Marketing zu machen: als Freunde und Helfer. Sie tragen nicht immer die volle Uniform, stattdessen Polizei-Poloshirt und Dienst-Basecap. Die Waffe tragen sie schon, aber so unauffällig wie möglich. Herr Bergmann ist ein besonnener Typ von mittlerer Größe, eher schweigsam als laut. Frau Wöbbeking ist das Gegenteil, sie kommt gleich ins Plaudern, sie wirkt immer fröhlich. Trotzdem ziehen sie Wut auf sich, weil sie als Polizisten erkennbar sind. Das, was Beamte in ganz Deutschland seit der Ermordung George Floyds in den USA erleben dass sie im Mittelpunkt einer Debatte stehen, sich für ihre Arbeit rechtfertigen müssen, mitunter verbal attackiert werden, das kennen die beiden hier schon lange. Wer sie begleitet, erlebt ständig Blicke, die einen Moment zu lange auf ihnen haften bleiben. Gemurmel von Passanten, das klingt wie»was wollt ihr hier?«.»ganz Connewitz hasst die Polizei«war auf Demo-Plakaten zu lesen Von Anfang an gab es Demos gegen das Connewitzer Revier. Im Februar 2014 war es eine Landtagsabgeordnete der Linken, die die ersten Proteste anmeldete: Die Eröffnung der Polizeistation bedeute die Stigmatisierung des Stadtteils als Kriminalitätsschwerpunkt. Das Revier sei aus reiner Provokation nach Connewitz gekommen. Auf einem Schild war damals zu lesen:»ganz Connewitz hasst die Polizei«. Am 7. Januar 2015 zogen 50 Vermummte gegen die Station zu Felde, warfen Steine und Farbbeutel und Böller, zündeten einen Streifenwagen an und versetzten die beiden Beamten, die im Dienst waren, in Todesangst. Herr Bergmann war damals noch nicht dabei, Frau Wöbbeking hatte schon Feierabend, auch sie hat den Angriff nicht selbst erlebt.»trotzdem war es ein Schock, ganz schlimm«, sagt sie.»man beruhigt sich damit, dass es eine Ausnahmesituation war. Dass das hoffentlich nicht wieder passiert.«die beiden Beamten, die 2015 alles miterlebten, kehrten nie wieder an ihre alten Arbeitsplätze zurück. Das Revier wurde danach aufgerüstet, mit schusssicherem Glas. Aber Sicherheitsglas kann keine Wut beseitigen. Damals, nach dem Angriff von 2015, tauchte ein anonymes Bekennerschreiben auf.»auch wenn du deine Uniform ablegst«, stand darin,»so bleibst du immer noch das gleiche Schwein von Mensch und wirst weiterhin Ziel unserer Interventionen sein, wann immer wir es wollen.«da wird dir anders, sagen die Bürgerpolizisten. Sie sagen aber auch: Leute, die so denken, sind völlig in der Minderheit. Die schrecken uns nicht dauerhaft. Die sind nicht Connewitz Einwohner hat das Viertel. Einige Hundert, erklärt der Verfassungsschutz, gehören der radikal linken Szene an. Nur einige Dutzend gelten als gewaltbereit. Ein karger Konferenzraum, Lagebesprechung. Neben Frau Wöbbeking und Herrn Bergmann haben die Kollegen aus der Südvorstadt Platz genommen, dem nördlich angrenzenden Viertel, die die Connewitzer Kollegen von Zeit zu Zeit unterstützen: Jörg Garbas, 49, und Heinz Tretbar, 58, der auch schon mal in Connewitz eingesetzt war. Außerdem sitzt Dorothea Benndorf am Tisch, die 33-jährige Leiterin aller Bürgerpolizei-Einheiten der Stadt Leipzig. Einmal die Woche, immer am Donnerstag, trommelt Benndorf die Beamten zusammen, damit man sich austauscht: Wo gab es Probleme? Was ist los in den Vierteln? Polizisten sähen häufig nur die Schattenseiten des Lebens, sagt die Chefin. Das könne den Blick trüben. Da sei es wichtig, das, was man durchmacht, miteinander aufzuarbeiten. Sich gegenseitig daran zu erinnern, dass das Leben mehr ist als Kriminalität. So wie auch Connewitz mehr sei als sein Klischee, sagt Karin Wöbbeking.»Das ist ein Stadtteil«, sagt sie,»dessen größte Teile aus Auwald, Gartenanlagen und Parks bestehen. Es gibt viele Schulen. Es gibt altersgerechtes Wohnen und Pflegeheime. Und es gibt ganz normale Hausbesitzer. Die alle sagen: Schön, dass ihr da seid!«wenn die Beamten von ihrem Alltag sprechen, können sie richtig schwärmen. Von Grundschulen, die beraten werden wollen in der Frage, wie ihre Erstklässler sicher an einer Baustelle vorbeikommen. Von Ladenbetreibern, die gern ein paar Sicherheitstipps hätten. Sogar von Ecken mit Gerümpel. Denn das, was in einem anderen Viertel eine Müllecke wäre, sagt Frau Wöbbeking, nenne sich in Connewitz»Tauschbörse«. Leute stellten Dinge, die sie nicht mehr brauchen, an die Straßen.»Und andere Leute gehen gezielt hin, um sich was abzuholen.«wenn sie solche Ecken jedes Mal der Stadtreinigung melden würde, wäre das eine Provokation, findet sie.»das mache ich natürlich nicht.«da setzt die Polizei Beamte in den Stadtteil, um Präsenz zu zeigen und dann wollen die auf keinen Fall unangenehm auffallen. Im Gegenteil: Auf ihren Streifen entdecken Wöbbeking und Bergmann an fast jeder Straße Dinge, die sie mögen. Hier, sagt Karin Wöbbeking, hat gerade ein alternativer Imbiss aufgemacht! Hoffentlich wird da nicht ein Neubau hingesetzt, der ihn verdrängt. Und schauen Sie mal da, das Black Label! Eine Bar, die kennt jeder. Als man an einem Neubau vorbeiläuft, Studentenapartments, bald 20 Euro Warmmiete der Quadratmeter da erfährt man von den Polizisten, dass sie ein bisschen verstehen, dass manche das nicht gut finden. ACAB das lese er einfach als»automobilclub Annaberg-Buchholz«, sagt der Bürgerpolizist In Connewitz, sagt Jan Bergmann, werde an jeder Ecke gebaut. Überall werde Altes verdrängt, und Neues komme hinzu.»das ist natürlich ein Reizthema!«, sagt Wöbbeking. Den Bürgern werde sozialer Wohnungsbau versprochen, die Wiesen, auf denen sie sich früher zum Grillen getroffen haben, würden aber zugebaut klar sorge das für Zwist. Haben sie manchmal das Gefühl, von der Politik in einen Stadtteil, in einen Konflikt geschickt zu werden, in den sie gar nicht gehören? Da sagt Wöbbeking energisch: Sie gehöre doch nach Connewitz! Sie lebte hier schon vor dem Mauerfall, als man noch nicht vom»szeneviertel«sprach; als nichts saniert war. Sie, die in der DDR ein Ingenieurstudium angefangen hatte, die in den Wendewirren Polizistin wurde, weil das ein sicherer Job zu sein schien, sagt: Das hier sei auch ihr Zuhause. Deshalb sei es ja so absurd, wenn die Leute ihr»verpiss dich«hinterherriefen. Das rufen sie wirklich? Ja, sagt Wöbbeking. Das sei fast so eine Art Connewitzer Begrüßung.»Es folgt nichts daraus. Manchmal denke ich, es ist wie ein unhöfliches Guten Tag. Jemand teilt mir mit, dass er mich nicht mag, aber das hindert mich ja nicht an meiner Arbeit.ACAB«, was eigentlich»all cops are bastards«heißt das lese sie für sich schon lange einfach als»all cops are beautiful«, sagt Wöbbeking. Jan Bergmann, ihr Kollege, sagt: Für ihn heiße ACAB»Automobilclub Annaberg-Buchholz«. Als man mit Wöbbeking und Bergmann an einer Wand vorbeigeht, an die»fick die Polizei«gesprüht ist, Krakelschrift auf Kratzputz, sagt sie:»na ja. Die haben einen sehr aktiven Hausmeister, das ist morgen wieder weg.«aber kann man wirklich so leicht sagen: Mich stört das nicht? Vor zwei Wochen lief ein Protestzug gegen»repression«an Wöbbekings und Bergmanns Revier vorbei, Anlass war die Tötung des Afroamerikaners George Floyd in den USA durch einen Polizisten. Eine Rauchbombe flog direkt vors Fenster der Connewitzer Station. Die Bürgerpolizisten waren gerade nicht mehr im Dienst, getroffen hat es sie doch.»von uns«, sagt Jan Bergmann,»wird zu Recht verlangt, nicht zu verallgemeinern. Wir dürfen nicht von einem Kriminellen auf ganze Gruppen schließen.«warum, fragt er, werde dann vom Fehlverhalten einzelner Beamter auf die ganze Polizei geschlossen? Seit den Vorfällen in den USA wird auch in Deutschland über Polizeigewalt diskutiert, über Rassismus in Uniform. Den es ja gibt. Auch Bergmann findet, es gebe in der Polizei alle Probleme, die es in der Gesellschaft ebenfalls gebe. Aber ihm falle auf, dass der Blick auf ihn als Polizisten härter werde. Die Kolumne, die neulich in der taz erschien, in der es hieß, Polizisten gehörten auf die Müllhalde,»die hat mich als Mensch getroffen«, sagt Bergmann.»Ganz privat.«der Ton werde rauer, in der ganzen Gesellschaft, das beschreiben alle auf der Station. Es gehörten Berufserfahrung und Reife dazu, damit umzugehen, dass manche einen als Reizfigur sehen. Haben die Beamten Angst? Dorothea Benndorf, die Chefin, sagt:»manchmal habe ich Angst bei dem Gedanken, was da noch kommt, wie weit sich die Gewaltspirale noch drehen wird.«polizisten würden bei Demos im Leipziger Süden kaum mehr als Menschen wahrgenommen, nur als»hülle des Staates«und»Zielscheibe für Aggressionen«. Auch sie selbst habe das schon zu spüren bekommen: was das mit einem macht, wenn jemand»bullenschweine«ruft.»an sich rankommen lassen darf man das alles nicht«, sagt sie. Aber das sei nicht so einfach. Benndorf wird gerade befördert, sie wird demnächst wieder gefährlichere Einsätze mitmachen. Als in der Silvesternacht Feuerwerkskörper auf Beamte flogen, als Demonstranten sich mit Polizisten prügelten und als am Ende ein Polizist im Krankenhaus landete, mit einer Kopfverletzung da gab es im Anschluss eine Debatte, ob die Taktik der Polizei in dieser Nacht falsch war. Ob die jungen Bereitschaftspolizisten unverhältnismäßg hart aufgetreten waren, statt die Situation zu deeskalieren. Die Bürgerpolizisten wissen nicht, was genau in der Nacht passiert ist, sie waren nicht dabei. Frau Wöbbeking, Herr Bergmann und die anderen sind dafür zuständig, vor solchen Nächten das Viertel vorzubereiten. Sie streifen durch Connewitz, melden dem Bauhof lose Pflastersteine. Sie empfehlen Autobesitzern, umzuparken. Bitten Anwohner, Mülltonnen nicht rauszustellen, und Geschäftsinhaber, Aufsteller reinzubringen. Dann hoffen sie, dass nichts Schlimmes passiert. Nach Silvester meldeten sich viele Connewitzer bei ihnen, sprachen sie an auf der Straße. Nicht mit Kritik, sondern: Zuspruch. Danke, dass ihr da seid! Dass es euch gibt! Wir sind glücklich, euch zu haben! Das baut dich auf, sagt Jan Bergmann. A A Die Linksextremen und die Polizei 250 gewaltbereite Autonome zählt der Verfassungsschutz hier so viele wie in keiner anderen vergleichbar großen Stadt 357 linksextreme Straftaten wurden 2019 erfasst 3200 Beamte arbeiten in der Polizeidirektion Leipzig
27 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 WISSEN TITELTHEMA ÖKOLOGIE INFOGRAFIK: KÜSSEN 27 Der Zweifel Politische Immunität Foto (Ausschnitt): Paolo Woods & Gabriele Galiberti/INSTITUTE; Illustration: Timo Lenzen für DIE ZEIT Die wichtigste Regel für Angeber: Es muss wirklich Gold sein, was glänzt. Franck Ribéry hat also alles richtig gemacht: dickes Steak, dünne Goldschicht, 24 Karat, angeblich 1200 Euro teuer. Doch statt Beifall gab es Ärger. Die Welt ereiferte sich über das Protz-Steak und den Großkotz, der es verschlang. Der Fußballstar hatte ein Bild von seinem Angeberteller getwittert: Seht her, ich fresse Gold! Mittlerweile steht Ribérys Extrawurst ganz regulär auf der Karte des Edel-Steakhauses Nusr-Et in Dubai. Halb so dick, halb so teuer aber noch gülden genug, um sich damit wichtigzumachen. Die Posse um das Goldsteak illustriert den Kern jeder Angeberei: hier die Lust am Zurschaustellen, Angeber! Blender und Hochstapler richten viel Unheil an. Doch ehrliche Großmäuler nutzen der Gesellschaft ohne sie gäbe es weder Fortschritt noch Hochkultur VON STEFANIE KARA, MARCUS ROHWETTER UND URS WILLMANN dort der Neid und die Bewunderung des Publikums. Sich dicketun ist kein Privileg von Weltstars alle Menschen geben an. Fast jeden Tag. Und mit fast allem lässt sich prahlen. Der eine braust auf dem Motorboot in Sichtweite der Strandpromenade entlang. Der andere erzählt jedem, wie hochbegabt seine kleine Emilie sei. Doch was Mitmenschen mitunter gehörig auf den Wecker geht, hat auch sein Gutes: Stille Bescheidenheit mag sympathisch sein gesellschaftlich führt sie nicht weiter. Im Angeben hingegen steckt ein tieferer Sinn. Psychologinnen und Soziologen, Evolutionsbiologinnen und Ökonomen sind sich bei diesem Thema fast alle einig: ohne Prahlerei kein Wirtschaftswachstum, kein Fortschritt, keine Hochkultur. Angeber halten den Motor des»höher, schneller, besser«am Heulen und treiben damit die Zivilisation voran. Wer ein Angeber ist, gibt (im Wortsinne) an, was er hat, was er kann, was er will und damit die Richtung für andere vor. Man mag kapitalistische Länder und ihre Prunksucht für vieles kritisieren, doch am Ende waren sie erfolgreicher als all die sozialistischen Gegenentwürfe, die den Idealzustand im maximalen Gleichsein wähnen. Die Menschen streben nach mehr, nach Besserem, weil sie sehen, was möglich ist. Es stimmt: Angeber nerven kolossal aber viele von ihnen sind auch außerordentlich nützlich, tüchtig und erfolgreich. Mehr noch: Sie motivieren die Gesellschaft zu Höchstleistungen. Aber was, wenn doch nichts dahinter ist? Das gibt es auch. Dann gibt es im Laden nicht zu kaufen, was im Schaufenster funkelt. Dann hat man es nicht mit dem aufrichtigen Angeber zu tun, sondern mit dessen finsterem Zwilling, dem Blender und Schaumschläger, der anderen nicht nützt, sondern ihnen Schaden zufügt. Diese Scheinriesen stehen im geliehenen Cabrio vor dem Fünfsternehotel und überlassen der Freundin die Rechnung. Sie machen leere Versprechungen und lügen sich groß. Sie wissen als Vorgesetzte alles besser, halten Kompetentere klein und richten damit in Firmen Unheil an. Sie schwatzen als selbst ernannte Finanzgenies gutgläubigen Anlegern riskante Papiere auf und vernichten deren Altersvorsorge. Sie handeln mit dubiosen Wertpapieren und stürzen so geschehen 2008 die Welt in eine Finanzkrise. Ungezählte Existenzen werden durch Hochstapler vernichtet. Erst vergangene Woche stellte sich Markus Braun der Staatsanwaltschaft München. Es geht um sehr Fortsetzung auf Seite 28 Ein amtlicher Ausweis für etwas, das es gar nicht gibt? Klingt absurd, wird aber gerade diskutiert, und zwar nicht von irgendwem: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Deutschen Ethikrat beauftragt, über einen Immunitätsausweis für das Coronavirus Sars-CoV-2 zu beraten. Für alle, die bereits eine Infektion durchgemacht haben, hätte so ein Papier seinen Reiz es könnte wie ein Freifahrtschein wirken: Ich bin ungefährlich, und mir kann nichts mehr passieren! Beim Ethikrat heißt es, bis zu einer Stellungnahme dauere es noch, wegen der»komplexität der Lage«. Dabei ist die Lage gar nicht so komplex: Was der Ausweis bescheinigen soll die Immunität gegen Covid-19, existiert so nicht. Das fiel auch der SPD auf: Immunitätsausweise ergäben nur Sinn, falls es eine Immunität tatsächlich gebe und erst wenn sie durch Impfung erzeugt werden könne, twitterte die Bundesvorsitzende Saskia Esken. Eine Impfung ist jedoch noch in weiter Ferne. Und ob jemand nach einer überstandenen Infektion tatsächlich niemanden mehr anstecken kann, ist noch nicht klar. In Südkorea wurden Ende April Menschen, die als genesen galten, erneut positiv auf das Co ro na virus getestet. Die Forscher vermuten zwar, dass es sich um tote Virenreste handelte, aber es ist eben nicht sicher, dass Genesene nicht wieder ansteckend werden können. Ebenso wenig sicher ist, ob einmal Infizierte danach selbst gegen das Virus geschützt sind. Das Coronavirus könnte mutieren. Außerdem ist es möglich, dass Genesene ihre Antikörper wieder verlieren. Eine Studie in Nature Medicine zeigt, dass besonders bei Menschen, die symptomfrei blieben, die Antikörper nach zwei bis drei Monaten wieder verschwunden sein können. Ein Immunitätsausweis wäre also eine Phantom-Bescheinigung. Wenn Jens Spahn nun den Ethikrat erörtern lässt, ob so ein Papier ethisch vertretbar wäre, ist das pure Symbolpolitik. THERESA PALM AA Quellen Einen guten Überblick über die psychologische Forschung zur Angeberei bietet ein Aufsatz von Michael Dufner und Kollegen Erkenntnisse der Soziobiologie zur Prahlerei beschreiben Eckart Voland und Matthias Uhl in dem Buch»Angeber haben mehr vom Leben«Links zu diesen und weiteren Quellen finden Sie bei ZEIT ONLINE unter
28 28 WISSEN 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 TITELTHEMA Angeber! Fortsetzung von Seite 27 viel Geld. Der ehemalige Chef des Zahlungsabwicklers Wire card soll es nicht gestohlen haben, es wurde offenbar erfunden. Die neue Konzernleitung hatte in der Nacht zuvor mitgeteilt, 1,9 Milliarden Euro Betriebsvermögen, die man auf philippinischen Konten vermutet hatte, würden»mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen«. Ausgedachtes Geld also. Es sieht so aus, als habe Braun sein Unternehmen reich gerechnet. Die Staatsanwaltschaft München wirft dem Österreicher Bilanzmanipulation vor. Brauns Anwalt teilte auf Anfrage mit, sein Mandant kooperiere voll und ganz mit den Behörden. Über Jahre hinweg hat Braun die Geschichte vom erfolgreichen Digitalkonzern Wire card erzählt, der jedes Jahr zweistellig wuchs. Braun konnte nie recht erklären, wie Wire card es schafft, so erfolgreich zu sein, lieber pflegte er das Image des Tech-Nerds. Er trat gern in schwarzem Rollkragenpullover auf, wie Steve Jobs oder die Start-up- Hochstaplerin Elizabeth Holmes (siehe Seite 29). Als besondere Interessen gab Braun»Digitaltechnik«und»Quantentechnik«an.»Künstliche Intelligenz«war ein Schlagwort, mit dem er um sich warf. Klein- und Großanleger waren hingerissen, sie machten Braun reich, und er erzählte, dass er ja selbst sieben Prozent der Aktien des Konzerns hielt. Das schuf Vertrauen. Und Braun präsentierte Jahr für Jahr beeindruckende Gewinne. Im September 2018 lag der Aktienkurs von Wire card bei atemberaubenden 190 Euro, der Konzern war 24 Milliarden Euro wert und Braun mit seinem Anteil Milliardär. Eine irre Bewertung für eine Firma, die einst mit der Abwicklung von Zahlungen für Internet-Pornos und Glücksspiel angefangen hatte plötzlich hatte sie Filialen in Singapur, Hongkong und Dubai. Auch das gehörte zur Braun-Story. Er trank gern Pfefferminztee und ließ sich im Maybach ins Büro chauffieren. Inzwischen gehen viele davon aus, dass ein Großteil der Wirecard-Umsätze erfunden sind. Übrig bleiben werden andere Rekorde des angeblichen Finanzgenies: Wire card ist einer der wildesten Bilanzskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach der Insolvenz hinterlässt der Konzern an die vier Milliarden Euro Schulden, mehr als 20 Milliarden an Anlegerkapital wurden vernichtet. Doch ein Quäntchen von beiden dem redlichen Angeber und dem Schaumschläger schlummert in uns allen. Selbstdarstellung macht mehr als 70 Prozent aller Gesprächsinhalte aus, schätzen die Psychologen Constantine Sedikides, Vera Hoorens und Michael Dufner. Mathematisch exakt lässt sich so etwas natürlich nicht bestimmen, aber die Größenordnung wohl, und die bestätigt, was jeder erlebt: Prahlerei ist etwas zutiefst Menschliches. Der Persönlichkeitspsychologe Michael Dufner von der Universität Leipzig formuliert es so:»ohne Zweifel ist soziales Verhalten in hohem Maße Selbstdarstellung.«Mit Mut und Moral lässt sich genauso protzen wie mit Muskeln ja, sogar der Verzicht taugt zum Aufblasen des Egos. Der Veganer kann sich in diesen Tagen der Umweltsensibilität mit hohen moralischen Ansprüchen dicketun, manch Extra dünner mit demonstrativer Selbstkontrolle. Nie waren die Bedingungen für Selbstüberhöhung so ideal wie heute. Face book, You Tube und In sta gram bieten Milliarden von Angebern die perfekte Plattform. Die Marketing-Forscherin Irene Scopelliti von der City University London sagt:»die sozialen Medien haben zu einer regelrechten Explosion des Angebens geführt.«die Provokation des Angebers besteht darin, dass er demonstrativ hehre Ideale infrage stellt. Er pfeift auf die Gleichheit und will stattdessen besser sein. Beim Essen gelingt ihm dies mit exklusiven Zutaten. Einst fiel Fleisch in diese Kategorie. Seit Schweineschnitzel jedoch Billigware sind, muss das Großmaul einen draufsetzen. Bei Ribéry war es die exklusive Verkleidung mit Edelmetall. Und darin liegt eine Erklärung für den ökonomischen Nutzen von Angeberei. Knappheit ist die Voraussetzung, die einen Stoff für Angeber attraktiv macht. Wer es sich im 17. Jahrhundert leisten konnte, einem flämischen Meister den Auftrag für ein Stillleben zu geben, wollte nicht bloß Äpfel und Birnen auf dem Bild sehen. Daher finden sich in den Werken alter Meister viele Südfrüchte. Der Granatapfel war eine teure Exklusivität, wie heute Fugu vom Kugelfisch oder ein Steak vom Fotos (v. o.): Alexander Coggin; Anup Deodhar; hgm-press; Markus Burke Schau mich an! Ob Mensch oder Tier Auffallen um jeden Preis gehört zur Natur Blauflossen-Thunfisch. Selbst mit Kaffee und Tee lässt sich angeben die Bohnen sollten vor dem Mahlen aber mindestens den Verdauungstrakt von Elefanten oder Pandas durchquert haben. Auffallen um jeden Preis gehört zur Natur. Das Tierreich ist bevölkert von Tausenden Arten von Angebern. Das Paradebeispiel ist der»eitle«pfau. Zunächst überraschend, dass ein derartiges Geschöpf überhaupt existiert. Der schwere schleppenartige Schwanz behindert seinen Träger bei praktisch allem, was er tut, er macht ihn zur leichten Beute. Nach der Evolutionslehre Charles Darwins wäre eher erwartbar, dass jede Ressource im Überlebenskampf sinnvoll eingesetzt und Überflüssiges wegrationalisiert würde. Bloß: Was heißt sinnvoll? Und was überflüssig?»wer nicht schön ist, den bestraft die Liebe«, sagt der Soziobiologe Eckart Voland. Pfauenweibchen bevorzugen nun mal den Gutausseher. Denn er demonstriert die Fähigkeit zur Verschwendung und zeigt so, dass er in exzellenter Verfassung ist. Mehr noch, mit dem lebensgefährdenden Schweif beweist der männliche Pfau dem femininen Publikum: Ich kann mir das leisten! Als»Handicap-Prinzip«bezeichnete der israelische Biologe Amotz Zahavi diese Balztechnik. Das Handicap verwandelt sich in einen Farbenfächer, einen evolutionären Vorteil. Nicht weniger verschwenderisch agiert das Stichlingsmännchen. In der Paarungszeit legt sich der kleine Fisch mithilfe von Carotinoiden (die kolorieren auch Karotten) eine rote Brust zu. Für das Überleben des Einzelnen ist diese Farbenpracht eher kontraproduktiv, doch sie signalisiert genetische Gesundheit. Unnütze Äußerlichkeiten damit balzt auch der Mensch. Wie kein anderes Wesen hat der Homo sapiens uralte Angebersignale weiterentwickelt und kulturelle hinzuerschaffen. Bereits der Faustkeil, vor fast zwei Millionen Jahren vom Vormenschen Homo ergaster erfunden, dürfte weit mehr gewesen sein als ein Gebrauchsgegenstand frühester Heimwerker. Oft war er symmetrisch und schön geformt, was die geistige Potenz und die Fingerfertigkeit seines Schöpfers unter Beweis stellte. Das machte den Keil zu einem»gut sichtbaren Indikator für Fitness«und daher zum»kriterium bei der Partnerwahl«, davon ist der britische Archäologe Steven Mithen überzeugt. Viele der frühen Prachtexemplare aus Stein waren nämlich zu groß oder zu klein, als dass sie zum praktischen Einsatz getaugt hätten. In der Olduvai- Schlucht im Norden Tansanias schuf jemand ein beeindruckendes Monstrum von 28 Zentimetern Länge (etwa doppelt so groß wie ein normales Werkzeug) vermutlich war es ein Mann. Frauen fertigten zwar auch Faustkeile, doch Mithen glaubt, dass sie dabei deutlich praxisorientierter vorgingen. Die Tatsache, dass Frauen mehr in den Nachwuchs investieren, bewirke, dass sie den Sexualpartner sorgfältiger auswählten. Dies wiederum, vermutet Mithen, zwinge die Männer zur erweiterten Selbstdarstellung. So produzierten sie nutzlose, aber umso beeindruckendere Faustkeile. Es gibt Fundorte, an denen sie in Massen herumlagen, ohne eine einzige Gebrauchsspur. Für Mithen ein Zeichen, dass Jünglinge dort den Mädchen vorführten, was sie draufhatten. Zusammen mit dem Wissenschaftsautor Marek Kohn entwickelte der Archäologe die (in Forscherkreisen nicht unumstrittene)»sexy Hand axe Theory«: Da es in der Steinzeit noch keinen Porsche gab, wurde mit Faustkeilen herumrenommiert. Heute gibt es die Masters of LXRY, eine Luxusmesse in Amsterdam, die (außer an den Vokalen im Wort luxury) an nichts spart. Laut Selbstdarstellung handelt es sich um die»prestigeträchtigste Premium- Lifestyle-Messe der Welt«, um den»einzigen Ort, an dem das Beste aus den Bereichen Kunst, Innenarchitektur, Fotografie, Mode-Gadgets, Gastronomie, Schmuck, Uhren, Boote, Autos und Reisen unter einem Dach gezeigt wird«. Wenn es eine Chance gibt, Angebern zu begegnen, dann dort. Eröffnungsparty im Dezember Der Dresscode»strictly black tie«. Die Männer, leicht in der Überzahl, in Schwarz; die Frauen in größtmöglicher Varianz farbenfroher Abendgarderobe, besetzt mit Pailletten, die im Licht der Scheinwerfer funkeln. Echte Steine an Fingern, an Hälsen und Ohren. Wer keine hat Gassan Diamonds, ein Traditionsjuwelier, hat eine der größten Standflächen gemietet. Protzen ist nicht mehr nur Männersache. Drei Messehallen sind nicht zu viel für all die teuren Dinge. Erster Stopp beim britischen Jachtbauer Princess. Ob man sich die elf Meter lange knallrote Motorjacht näher anschauen dürfe? Der Angestellte reicht Überschuhe, über eine Treppe geht es hinauf. Wer seine Kunden seien?»geschäftsleute«, heißt es knapp. Fast entschuldigend fügt er hinzu, man baue größere Jachten, bloß kriege man die hier nicht in die Halle. Die in der Basisversion Euro teure R35 hier sei gewissermaßen das Einstiegsmodell. Entsprechend knapp daher der Platz unter Deck,»dafür brauchen Sie schon eine sehr verständnisvolle Freundin«. Nicht weit davon die teuren Autos. Ein orangefarbener McLaren im Gegenwert einer Eigentumswohnung parkt vor einem Schild:»Life is measured in achievement, not in years alone«. Ein Vater erläutert dem Sohn im Teenageralter die Vorzüge des Wagens. Auf der Luxusmesse offenbart sich das Grundgesetz der Angeberei: Ob Jacht, Sportwagen oder Schampus es muss echt sein und unvernünftig teuer. Sonst taugt das moderne Balz-Objekt nicht zur demonstrativen Verschwendung. Der wahre Angeber ist nämlich gerade kein Hochstapler, Blender oder Schaumschläger. Er ist ernsthaft und meint es wahrhaftig.»angeberei generiert Ehrlichkeit«, sagt der Soziobiologe Eckart Voland. Da eine aus der Balz resultierende Entscheidung folgenschwer sein kann, muss die Angeberei jeder Überprüfung standhalten. Zum Protzen taugen deshalb besonders jene Dinge, die sich nicht fälschen lassen. Beim Aufplustern geht es aber nicht nur um Materielles. Die allergrößten Angeber findet man deshalb nicht im Jetset sondern in der Kita.»Kleine Kinder geben hemmungslos an«, sagt Kristi Lockhart.»Die reden dauernd davon, dass sie die Größten und Besten sind.«die Psychologin von der amerikanischen Yale University erforscht, wie sich soziale Kognition entwickelt, also wie Kinder lernen, das Miteinander zu verstehen. Da spielt die Angeberei eine zentrale Rolle. Im Prahlen spiegelt sich die kindliche Entwicklung: das frühe Bedürfnis, Aufmerksamkeit zu erwecken, und das Ausprobieren, wie man es am besten anstellt. Das Kind muss es dabei schaffen, sich in andere hineinzuversetzen: Komme ich als Angeber an? Das geschieht mit kindlichem Optimismus, der dafür sorgt, dass die Kleinen die Welt und sich selbst positiver sehen, als sie sind. Die perfekte Mixtur für Angeberei. Wer jedoch im kindlichen Narzissmus stecken bleibt, wem es nicht gelingt, beim Erwachsenwerden eine rationale Distanz zu den eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen zu entwickeln, der kann sich zum Soziopathen auswachsen, mitunter mit katastrophalen Folgen entführte und tötete Magnus G., Jurastudent aus kleinen Verhältnissen, den elfjährigen Bankierssohn Jakob von Metzler aus Frankfurt am Main. Er wollte mit dem erpressten Lösegeld seinen wohlhabenden Freunden einen großspurigen Lebensstil demonstrieren. Männer geben deutlich häufiger an als Frauen, das räumen sie in Befragungen unumwunden ein. Erstaunlich wenig weiß die psychologische Forschung darüber, womit Männer und Frauen jenseits dicker Karren und Klunker prahlen. Die Psychologinnen Corinne Moss-Racusin und Laurie Rudman von der Rutgers University haben immerhin nachgewiesen, dass Frauen besser darin sind, die Leistungen anderer anzupreisen. Bei Werbung in eigener Sache fühlten sie sich eher unwohl. Bei Männern konnten die Forscherinnen einen solchen Unterschied nicht feststellen. Dazu passt eine Anekdote zweier Kolleginnen von der Montana State University: Sie hatten die Frauen an ihrer Uni aufgerufen, ihnen für ein Magazin von eigenen Erfolgen zu berichten. Keine einzige meldete sich. Allerdings schlugen mehrere Frauen andere Frauen vor. Zu dieser»fremd orien tie rung«, wie es die Wissenschaftlerinnen nennen, passt auch das Prahlen von Frauen mit den Leistungen von Mann und Kind. In ihrer Selbstwahrnehmung spielt der eigene Erfolg eine geringere Rolle als die Aneignung der Erfolge ihrer Bezugspersonen. Auf dem Feld der Angeberei ist die Emanzipation offenbar eine Schnecke. Ich habe mirdas Paradies immer alseineart Bibliothek vorgestellt. Jorge Luis Borges Wir nehmen Abschied von unserer lieben Cousine Prof. Dr. Karin Peschel *25. Oktober Juni 2020 Wir sind traurig. Gisela und Heinz Kronberg Marieanne und Volker Buckel Wolfgang und Ulrike Peschel Die Trauerfeier und die Beisetzung fanden aus aktuellemanlass im engsten Kreisstatt. Im Sinne der Verstorbenen bitten wir anstelle freundlich zugedachter Blumen um eine Spende an den Verein zur Förderung ausländischer Studierender in Kiel e.v., Förde Sparkasse, IBAN DE , Kennwort: Prof.Dr. Karin Peschel. Traueranschrift: Bestattungshaus Paulsen, Feldstraße47, 24105Kiel Kranken Kindern helfen Bitte helfen Sie kranken Kindern mit Ihrer Spende für den Neubau des Kinderzentrums Bethel. Spendenkonto (IBAN): DE Stichwort: KINDGESUND, 49 Was bleibt? Mein Erbe. Für unsere Natur. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber ein Sommer ohne Schwalben? Helfen Sie, bedrohte Tierarten und Lebensräume unserer Heimat auch für nachfolgende Generationen zu schützen und den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen. Mit einem Testament zu Gunsten der gemeinnützigen Heinz Sielmann Stiftung. Tun Sie mit Ihrem Nachlass nachhaltig Gutes. Kostenfreies Informationsmaterial rund um das Thema Erben und Vererben liegt für Sie bereit. Bestellung gerne unter: Telefon
29 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 WISSEN 29 TITELTHEMA Und selbst in Gesellschaften, die größten Wert auf Zurückhaltung legen, wird geprahlt, was das Zeug hält. In China etwa tarnen Angeber ihr Eigenlob als Gejammer (»als Chef hat man ja so schrecklich viele Pflichten«). Oder sie betonen zwar, dass sie etwas Großartiges zustande gebracht hätten fügen aber sofort hinzu, dass es nichts wirklich Außergewöhnliches sei. Das fand die Linguistin Ruey-Jiuan Regina Wu von der San Diego State University heraus, indem sie alltägliche Gespräche unter Chinesen analysierte. Und während im Westen oft mit individuellen Qualitäten (Führungsstärke, Einzigartigkeit) und renitenten Verhaltensweisen geprotzt wird (»Ich stelle mich gegen die ganze Gruppe, wenn die falschliegt«), geben Menschen in Asien eher mit kollektivistischen Eigenschaften an:»ich bin besonders loyal, verträglich, kompromissbereit, ich befolge die Regeln besonders gewissenhaft.«in anderen Kulturen wird also nicht unbedingt weniger angegeben bloß anders. Und überall facht eine neue Währung das Fegefeuer der Eitelkeiten an: die Beachtung durch andere.»die Aufmerksamkeit anderer Menschen ist die unwiderstehlichste aller Drogen. Ihr Bezug sticht jedes andere Einkommen aus. Darum steht der Ruhm über der Macht, darum verblasst der Reichtum neben der Prominenz«, schrieb schon 1998 der Softwareentwickler und Volkswirt Georg Franck in seinem Buch Ökonomie der Aufmerksamkeit. Zwei Jahrzehnte später sind weltweit 2,3 Milliarden Facebook-Nutzer, 1,9 Milliarden YouTube- Gucker und eine Milliarde Instagramer nicht nur Konsumenten von Inhalten, sondern selbst auf der Suche nach Aufmerksamkeit und Followern. Mein Traumurlaub, mein tolles Essen, mein großer Freundeskreis, mein neues Fahrrad, mein schöner Körper schauet her und liket! Dieser Angeberei einen Raum zu geben war die wohl genialste Geschäftsidee der jüngsten Vergangenheit. Apple, Samsung und Huawei liefern mit ihren Smartphones die Werkzeuge. Facebook, zu dem auch Instagram gehört, offeriert unendlich viele Standplätze auf dem Marktplatz der Gefallsucht und ist an der Börse um die 600 Milliarden Dollar wert. Der menschliche Drang, toll dazustehen, wird zu klingender Münze. Gleichzeitig: Angeber nerven. Und zwar schon immer. Der antike Dichter Sophokles lässt in Antigone den Chor sagen:»denn Gott hasst großer Zungen Geprahle über die Maßen.«Und weil der Chor im antiken Drama die öffentliche Meinung wiedergibt, kann man davon ausgehen, dass man bereits 500 v. Chr. von Protzerei abgestoßen war. Die moderne psychologische Forschung betrachtet das differenzierter. Ihr zufolge hat es der Angeber mit einem Trade off zu tun: Zwar gewinnt er an Ansehen, was seine Kompetenzen angeht, aber er verliert gleichzeitig an Sympathie. Letzteres trifft offenbar vor allem auf Frauen zu: Weibliche Angeberei wurde in einer Studie der Sozialpsychologin Laurie Rudman als besonders»sozial unattraktiv«gewertet, interessanterweise nur von Frauen. Die kulturelle Prägung spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung. So waren kanadische Personalchefs eher gewillt, aufgeblasene Bewerber einzustellen, als ihre Kollegen in der Schweiz. Allgemein wird Dicketun in Bewerbungsgesprächen eher toleriert als unter Freunden. In welchem Ausmaß ein Angeber irritiert, hängt also von der Situation ab. Nur kleine Kinder begeistern sich ohne Wenn und Aber. Auch das fand die Yale-Psychologin Kristi Lockhart in Experimenten heraus: Jüngeren und älteren Kindern wurden Geschichten über zwei Schüler vorgelesen, Erwachsene machten den Test online. Die beiden Protagonisten wurden als die jeweils Besten ihrer Klasse vorgestellt. Aber nur einer von ihnen erzählte, dass er der Tollste sei. Der an dere erwähnte es nicht einmal. Die älteren Kinder und die Erwachsenen mochten den Bescheidenen. Die unter Achtjährigen aber liebten den Angeber. Den Inbegriff des liebenswerten Prahlhanses erfand die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren mit ihrem verfressenen und von sich selbst berauschten Karlsson vom Dach, der sich selbst als»schönen, grundgescheiten, gerade richtig dicken Mann in seinen besten Jahren«vorstellt und bei jedem noch so leisen Zweifel an seiner Großartigkeit schwer beleidigt abschwirrt. Kein Wunder, dass dieser Protagonist seine kleinen Leser auch nach 65 Jahren noch fasziniert, irritiert und zum Lachen bringt.»kleine Kinder sehen Angeberei eher als Information über die Fähigkeiten einer Person«, erklärt Lockhart. Und mitunter verhielten sich Erwachsene ähnlich.»in gefährlichen oder komplizierten Situationen vertrauen auch sie eher den Angebern und erhoffen sich von ihnen Hilfe.«So könnte das Wahlergebnis des Donald Trump bei der letzten US-Präsidentschaftswahl erklärbar sein. Bei Politikern, sagt Lockhart, könne Angeberei als Zeichen von Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen und Kompetenz gewertet werden. Meistens jedoch, stellt die Marketingforscherin Irene Scopelliti von der City University London fest, geht das Protzen nach hinten los. Angeber überschätzten die positive Wirkung ihrer Prahlerei deutlich. In einer Befragung glaubten 66 Prozent der Befragten, die Wichtigmacherei zugegeben hatten, ihr Gegenüber sei beeindruckt gewesen. Tatsächlich waren es bloß 14 Prozent der Zuhörer. Gleichzeitig erwarteten nur 28 Prozent der Angeber, ihr Gegenüber könnte abgestoßen sein. Tatsächlich aber waren 77 Prozent angewidert.»empathie-lücke«nennt Scopelliti diese Unfähigkeit, sich die Gefühle anderer vorzustellen.»das ist eine plausible Erklärung dafür, dass wir alle angeben, obwohl niemand Angeberei mag.«dieses Urbedürfnis des Homo glorians wird also von der Norm der Bescheidenheit nur notdürftig im Zaum gehalten. Aus ökonomischer Sicht ist die Zurschaustellung von Erfolg geradezu essenziell. Wer weiß, wo er steht, versichert sich nach unten hin seiner Stellung und wird durch den Blick nach oben angespornt. Das gilt für den Einzelnen, der sich beim 20. Abiturtreffen bei Gehalt, Reisen, Lebenspartner und Immobilie mit seinen alten Klassenkameraden misst. Und für ganze Nationen, die bei Wettbewerbsfähigkeit, Steuersätzen oder Lebensqualität miteinander im Wettstreit liegen. Dafür, dass sich alle selbst verorten können, sorgen ungezählte Ranglisten, vom Global Competitiveness Report aller Länder, den das Weltwirtschaftsforum in Davos erstellt, bis hin zu den zehn schönsten Frauen Hessens. Wer an der Spitze steht, kann sich im Erfolg sonnen. Alle anderen sind entweder neidisch, oder sie lassen sich motivieren. So entsteht Wachstum. Imponiergehabe, hat der Soziobiologe Eckart Voland ergründet, leitete»den Abschied vom Affentum«ein.»Das Bewerben der eigenen verborgenen Qualitäten durch teure Signale wurde zum Motor für Innovationen und Kreativität.«Zur»Initialzündung unserer heutigen Kultur«sei es gekommen, als sich die Kreativität beim Angeben schrittweise erhöhte. Die Höhlenmalerei in den Grotten Chauvet oder Lascaux ist nackter Ausdruck von Prahlerei. Ebenso die Musik und später die Literatur denn auch Kunst fällt, laut Voland, unter das Handicap-Prinzip: Sie zeitigt keinen unmittelbaren Nutzen, sondern ist ein indirekter Beleg für Potenzial zur Verschwendung. Ich kann es mir leisten, also bin ich Künstler. Der Soziobiologe formuliert es so:»der Pfauenschwanz hat sich bei uns kulturell aufgefächert.«die Kelten, die Römer oder die Maya beweisen bis heute ihre Leistungsfähigkeit mit beeindruckenden Hinterlassenschaften. Und als Friedrich II. nach dem Siebenjährigen Krieg sein Neues Palais in Potsdam erbauen ließ, demonstrierte er der Welt, dass Preußen noch nicht am Boden lag (obwohl der Staat praktisch pleite war). Wer sich die Kulturdenkmäler aller Epochen und Regionen ansieht (bis hin zur Hamburger Elbphilharmonie), stellt fest, dass die wenigsten davon nach dem Nützlichkeitsprinzip errichtet worden sind. Im Weltkulturerbe der Unesco finden sich massenweise überdimensionierte Sakralbauten und Paläste die»hinterlassenschaften der größten Angeber der Weltgeschichte«, wie der Wissenschaftler Voland sagt:»streicht man alle angeberischen Objekte aus der Liste heraus, bleibt nur noch ein Viertel übrig.«nun also auch das noch: der Kölner Dom, die Pyramiden von Giseh, die Stadt Machu Picchu oder die Akropolis nichts als herrliche Prahlerei. Mitarbeit: Ingo Malcher Gute Angeber, schlechte Angeber Die Maulheldin Foto: Daniel Baldus/babiradpicture Die erste prägende Angeberin der deutschen Popgeschichte ist zweifellos Nina Hagen. Laut, schrill und konsequent eroberte sie sich Ende der Siebzigerjahre als erste Frau jene Freiräume, die künstlerische Autonomie braucht. In den derben Tönen des frühen Punk zeterte Hagen sich in eine Zukunft, in der Männer nicht mehr exklusiv bestimmen. Sie übertrieb klassische Rollenmodelle, ließ aber keinen Zweifel daran, dass sie sich eine Welt vorstellen kann, in der die Männer, die diese Modelle schufen, selbst keine Rolle mehr spielen. Als erste Sängerin propagierte sie das uneingeschränkte Verfügungsrecht über ihren eigenen Körper.»Ich war schwanger / ich wollt s nicht haben / musste gar nicht erst nach fragen«, singt sie in ihrem Lied Unbeschreiblich weiblich. In diesen Zeilen findet sich die Essenz der Hagenschen Angeberei: Sie prahlt damit, dass sie keinen Erwartungen folgt. Das bedeutete in den vergangenen Jahren allerdings seltener Punk auf der Bühne und häufiger Tragik in Talkshows. Immerhin, sie bleibt authentisch, eine Blenderin ist sie nicht. JENS BALZER Der Aufschneider Philipp Amthor bei der Gala»Kleider machen Leute«in Frankfurt Der Blender Der Junge aus reichem Hause präsentierte sich als Selfmade- Millionär, der es ganz allein zum großen Erfolg in der Immobilienbranche gebracht habe. Er behauptete, er habe eine Eliteuniversität als Bester seines Jahrgangs abgeschlossen. Alles erfunden. Lange überprüfte es keiner, in die gierige Stimmung der Achtzigerjahre passte die Protzerei nur allzu gut. Donald Trump ist der Blender in Reinform. Und er prahlte weiter: Er könne Frauen in den Schritt fassen, ohne dass ihm etwas passiere. Es schadete ihm tatsächlich kaum. Blender leben so lange, wie sie ein Publikum haben. Im Weißen Haus erzählte Trump dem russischen Außenminister von den vielen Geheiminformationen, die er täglich bekomme. Dem chinesischen Präsidenten sagte er beim Nachtisch, er habe gerade Syrien bombardiert. Jetzt erst nehmen ihm die Amerikaner sein Großmaul übel: Weil er seinem unter Covid-19 leidenden Land weismachen will, niemand habe Corona besser bekämpft als er. Wenn es um das eigene Leben geht, hört der Spaß auf. KERSTIN KOHLENBERG Der Möchtegern Wenn Prahlerei sich mit Unerfahrenheit paart, kann daraus sogar ein Politskandal entstehen. Der 27 Jahre alte CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat das gerade vorgemacht. Offenbar reichte es ihm nicht, einer der jüngsten Parlamentarier des Landes zu sein und den Wahlkreis von Angela Merkel zu übernehmen. Für Am thor durfte es noch etwas mehr Karriere sein: Und so ließ er sich von einem windigen New Yorker Cyber-Start-up mit Nähe zu diversen Unionspolitikern als Aufsichtsratsmitglied anheuern. Dass er für diese Firma ein Empfehlungsschreiben aufsetzte, bremste seinen Aufstieg allerdings. Es bleiben Selfies. Eines zeigt ihn mit seinen Unternehmer-Kumpels an der korsischen Küste, im Hintergrund ziehen Jachten durchs Wasser. Auf einem anderen steht er grinsend im gedimmten Licht eines Edel-Hotels in St. Moritz, umringt von seinen deutlich älteren Geschäftspartnern. Der junge Mann aus der ostdeutschen Provinz sieht auf den Bildern nicht so aus, als wäre ihm die Protzer-Pose angeboren. Ein echter Angeber ist er nicht. Eher ein Ehrgeizling, der mitspielen will. PAUL MIDDELHOFF Der Klassiker Hufeisen zerquetschte er mit bloßer Hand. Seinen Trompeter hielt er mit einem Arm aus dem Fenster. Er galt als Hercules Saxonicus und Lendengott. August»der Starke«unterhielt reichlich Mätressen, 354 Kinder wurden ihm unterstellt. Er verriet sein Luthertum für Polens katholische Krone. Er bekriegte Schweden und verlor. Erfolg hatte der Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen ( ) als Modernisierer der Wirtschaft und des sächsischen Adels, dem er Staatsdienst abverlangte. Er war ein absolutistischer Feudalfürst auf der Schwelle zur Moderne. Hofprunk, Künste, Feste dienten der politischen Demonstration wie seiner privaten Lust. Augusts Bild schwankt zwischen sächsischer und preußischer Färbung. Preußen schmähte August als amoralischen Verschwender. Die Sachsen glorifizierten den Schöpfer von»elbflorenz«, den Erbauer von Zwinger und Oper, den Begründer der Dresdner Gemäldegalerie, des Grünen Gewölbes, der Meißner Porzellan-Manufaktur. So prahlt und strahlt er noch heute. CHRISTOPH DIECKMANN Die Hochstaplerin Eine schöne Geschichte war das: Die 19-jährige Elizabeth Holmes bricht 2003 ihr Studium an der Eliteuniversität Stanford ab und entwickelt mit ihrem Biotech- Start-up eine Technik, die umfangreiche medizinische Analysen mit nur einem Tropfen Blut ermöglicht. Zehn Jahre nach der Gründung ist ihre Firma Theranos neun Mil liar den Dollar wert und Holmes, so scheint es, die jüngste Selfmade Milliardärin der Welt. Bis ein Journalist des Wall Street Journal die Geschichte infrage stellt und sich Behörden der Sache annehmen überführte die US-Börsenaufsicht SEC Holmes der Hochstapelei gegenüber Investoren. Ihr Test liefere nicht, was sie versprochen habe. Der Jahresumsatz ihrer Firma liege nicht bei 100 Millionen, sondern nur bei Dollar. Und anders als behauptet sei ihr Test auch nie vom US-Militär in Afghanistan eingesetzt worden. Holmes akzeptierte eine Geldbuße von Dollar. Ein davon unabhängiges Strafverfahren wegen Betrugs soll im Herbst beginnen. Holmes plädiert darauf, unschuldig zu sein. MARCUS ROHWETTER ANZEIGE Sie sparen 30 % Vom Loslassen & Festhalten Neue Zeiten bringen auch neue Fragen mit sich. Wir stellen sie an unsere Wünsche, unseren Verstand, unsere Lieben, unsere Süchte und Werte. Die neue Ausgabe von ZEIT WISSEN über die Suche nach dem Wesentlichen, das Comeback der Träume und die Liebe in Zeiten von Corona. Sichern Sie sich jetzt»was darf bleiben, was kann weg?«und zwei Folgeausgaben zum Vorzugspreis von nur 15,! Sie sparen 30 % und erhalten als Dankeschön ein hochwertiges Geschenk Ihrer Wahl. Schneidebrett»Bamboo«+ Asia-Messer 3x ZEIT WISSEN + Geschenk zur Wahl Geschenkset»The Ritual of Happy Buddha«Quizbox»Allgemeinwissen«Jetzt bestellen: 040/ * *Bitte Bestellnummer angeben: H3
30 30 WISSEN 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 ÖKOLOGIE Der Stuhl des Anstoßes Es gibt nicht mehr viele Orte, an denen man noch beobachten kann, wie Europa vor ein paar Tausend Jahren ausgesehen haben muss: endlose, zusammenhängende Buchenwälder, in denen Bären, Luchse und Wölfe auf der Suche nach Beute umherziehen. Jahrhundertealte Baumriesen, die Lebensraum für unzählige Arten Käfer, Pilze, Vögel und Flechten bieten. In West- und Mitteleuropa wurden solche urwüchsigen Wälder schon vor Jahrhunderten gefällt. Im Osten des Kontinents gibt es sie. Noch. Solche riesigen Wälder überziehen den Gebirgszug der Karpaten von der Slowakei über Ungarn und Rumänien bis in die Ukraine, wo Holz eines der wichtigsten Exportprodukte ist. Stetig wuchs in den vergangenen 25 Jahren die Ausfuhr von Rundholz, also ganzen Stämmen, sie wurde zu einer stabilen Einnahmequelle. Mindestens im gleichen Maße wucherte die Korruption, mit der die Ukraine in der Vergangenheit bis in die höchste Regierungsebene zu kämpfen hatte. Besonders während der Präsidentschaft des umstrittenen Viktor Janukowitsch bis zum Jahr 2014 wuchs sie enorm. Bis heute ist sie ein Problem, das Land steht auf Platz 106 im Korruptionsindex von Transparency International. In diesem Umfeld begann der schwedische Möbelkonzern Ikea Geschäfte zu machen. Spätestens seit 2010 nutzt er ukrainisches Holz. Nach eigenen Angaben bezieht das Unternehmen zwar nur ein Prozent seines Holzes aus dem Land. Doch es ist zugleich einer der größten Holzeinkäufer der Welt. Drei Fünftel seiner Produkte bestehen daraus. In den vergangenen Jahren ist der Bedarf stetig angewachsen: Seit den Nullerjahren hat sich Ikeas Umsatz fast vervierfacht und mit ihm der Holzverbrauch (siehe Grafik). Steigender Nachschub ist essenziell für den Konzern, der davon lebt, dass seine Kunden häufig neue Möbel kaufen. Dabei sieht sich Ikea selbst als Vorreiter der Umweltverträglichkeit.»Wir fördern die Nutzung nachhaltiger Forstwirtschaftsmethoden. Dies tun wir, um Abholzungen entgegenzuwirken und auch andere in dieser Hinsicht zu beeinflussen.«so klingt die Selbstdarstellung. Zweifel daran wecken Recherchen der in London ansässigen Nichtregierungsorganisation Earthsight, die sich auf Umweltkriminalität spezialisiert hat. Gerade veröffentlichte sie einen Bericht mit dem Titel Flatpacked Forests (eine Anspielung auf die flatpacks, die flachen Verpackungen der Ikea- Bausätze). Daraus geht hervor, dass in Produkten des Konzerns Holz aus fragwürdigen Quellen verbaut sein soll. Diese Produkte etwa der Stuhl Terje auf dem Foto sollen auch in deutschen Märkten gelandet sein. Die Recherchen von Earthsight konnte die ZEIT als einziges deutsches Medium vorab einsehen. Der zentrale Vorwurf lautet: Es wurde Holz verarbeitet, das gar nicht hätte geschlagen werden dürfen. Dennoch werden die Möbel daraus europäischen Käufern mit dem FSC-Zertifikat (Logo: ein Baum mit einem Häkchen) als nachhaltig, ökologisch und so zial verträglich angeboten. Die ZEIT konnte Teile der Recherchen nachvollziehen und hat ausführlich mit Vertretern von Firmen und Behörden, mit Wissenschaftlern und Umweltschützern in Deutschland und der Ukraine gesprochen. Konkret geht es darum, dass Zulieferer von Ikea die Regeln der sogenannten Ruhezeit systematisch umgangen haben: Von April bis Juni dürfen keine Bäume gefällt werden, damit seltene Arten wie Bären und Luchse ungestört ihre Jungen aufziehen können. Bei Schädlingsbefall oder Sturmschäden können die Forstbehörden jedoch Ausnahmegenehmigungen ausstellen für sogenannte Sanitärhiebe. Gedacht ist das für den Notfall, etwa um der Ausbreitung des Borkenkäfers zu begegnen. Tatsächlich stellt es ein Schlupfloch dar. Wie groß es ist, zeigte schon ein Earthsight-Report vor zwei Jahren: Demnach wurde 2017 mehr als doppelt so viel Holz mit solchen Ausnahmegenehmigungen geerntet wie durch reguläres Fällen. Ausnahme und Regel haben sich längst verkehrt, Fachleute kennen diese Masche: Ökologen der Universität Würzburg haben vor zwei Jahren beschrieben, wie Sanitärhiebe in vielen Ländern als Vorwand missbraucht werden, um eigentlich geschütztes Holz schlagen und verkaufen zu können. Und die Londoner Umweltermittler listen in ihrem aktuellen Ukraine-Bericht Indizien auf für Verstöße gegen die Ruhezeiten von 2018 bis in den Frühsommer 2020 hinein. Die Gegend um das Städtchen Welykyj Bytschkiw, auf die sich die britische NGO in ihrem Bericht konzentriert, liegt im Westen der Ukraine, nahe der rumänischen Grenze. Dort werden die Wälder vom gleichnamigen staatlichen Forstunternehmen verwaltet. Illegale Sanitärhiebe sind hier seit Jahren dokumentiert. Zugleich ist die Gegend eine der am dichtesten bewaldeten und artenreichsten Regionen des Landes. Zehn Millionen Hektar Wald wachsen in der Ukraine, weniger als ein Hundertstel davon sind tatsächlich noch Urwälder, die meisten davon liegen in den Karpaten.»Die Forstverwaltung von Welykyj Bytschkiw ist problematisch«, sagt Denis Kaplunow, der Vizedirektor des staatlichen Umweltinspektorats, der ZEIT. Ende Mai hätten seine Kollegen versucht, vor Ort eine Untersuchung durchzuführen, Dokumente zu überprüfen und die Orte geplanter Sanitärhiebe anzusehen. Daran habe sie die Forstverwaltung gehindert. Man habe die Polizei eingeschaltet, die zahlreiche Verstöße festgestellt habe. Jetzt laufen Ermittlungen. Stammt Holz für Ikea-Möbel aus fragwürdigen Quellen? Daten aus der Ukraine wecken Zweifel an dem Öko-Zertifikat, auf das sich der Konzern beruft VON FRITZ HABEKUSS UND YAROSLAVA KUTSAI»Terje«aus dem Sortiment des schwedischen Möbelhauses enthält Buchenholz aus der Ukraine Holzverbrauch in Mio. m Wie Ikea wächst Umsatz in Mrd. Euro ZEIT-GRAFIK/Quelle: Ikea-Nachhaltigkeitsberichte 41, Der mit Abstand größte Holzverarbeiter im Gebiet Welykyj Bytschkiw ist der Ikea-Zulieferer VGSM. Rund 90 Prozent der Produktion dieser Firma landen in Ikeas Möbelhäusern, entweder direkt (wie der Stuhl Börje) oder indirekt über den rumänischen Hersteller Plimob (wie der Stuhl Terje). Insgesamt produziert VGSM pro Monat Stühle, dazu Stuhlteile. Von der ZEIT mit den Earthsight-Recherchen konfrontiert, sagt Iryna Matsepura, die Direktorin des Ikea-Zulieferers VGSM:»Ich verstehe, dass diese Ruheperioden ein gut gemeinter, umweltbewusster Ansatz sind. An den Orten, wo Vögel nisten, wo Bären- und Luchshöhlen und so weiter sind, gibt es keine Nutzung.«Die Umweltschützer von Earth sight bemängeln hingegen, dass die ukrainischen Forstbehörden in vielen Fällen vor den Ausnahmegenehmigungen gar keine Umweltverträglichkeitsprüfung vornehmen, die eigentlich verhindern soll, dass besonders wertvolle Ökosysteme geschädigt werden.»alles, was wir getan haben, ist nach ukrainischer Gesetzgebung legal. Die Europäer halten alles für illegal, was Fehler aufweist: technologisch, juristisch, so zial oder ökologisch, wie in diesem Fall mit der Ruhezeit«, sagt Matsepura. Die Gesetze seien aber widersprüchlich. Der Chef des staatlichen Umweltinspektorats, Andrij Malowanyj, räumt gegenüber der ZEIT Probleme beim Waldschutz ein:»von 2018 bis ins erste Quartal 2020 wurden in 73 Prozent aller ukrainischen Wälder Verstöße gegen Umweltauflagen festgestellt. Der Schutz der Wälder durch den Staat ist ineffizient.«grund sei ein Interessenkonflikt zwischen Schutz und Nutzung. Der Waldexperte Andrij Plyha vom WWF Ukraine sieht das ähnlich:»der Ukraine fehlt eine grundsätzliche Strategie, die bei der Waldnutzung ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen ausbalanciert.«wie geht Ikea mit dieser Lage um? Auf Anfrage teilt der Konzern mit, sich mit seiner globalen Größe für positive Veränderungen einsetzen zu wollen,»insbesondere in herausfordernden Regionen«. Nach kritischen Berichten habe man 2018 und 2019 die eigene Lieferkette in der Ukraine prüfen lassen. Dabei sei kein illegal gefälltes Holz Foto: Jan A. Staiger für DIE ZEIT aufgefallen, teilt Ikea mit. Allerdings sind laut staatlichem Forst inspek to rat allein 2018 mehr als hundert Verstöße bei der Forstverwaltung von Welykyj Bytschkiw festgestellt worden. Ein Viertel davon, so Earth sight, soll VGSM begangen haben, das ganz überwiegend Ikea beliefert. Die Firma sagt, sie habe für jede Rodung Genehmigungen gehabt und somit legal gehandelt. Besondere Bedeutung kommt in solch einer unklaren Lage jener Organisation zu, welche die Quellen und die Verarbeitung des Holzes überprüfen soll dem Forest Stewardship Council (FSC). Es finanziert sich aus Beiträgen seiner Mitglieder für die Zertifizierung. Dazu gehören Firmen rund um die Welt, unter anderem eben Ikea. Sich auf diese Institution zu verlassen ist ebenso einfach wie einladend. So betont Ikea, man sei der Auffassung, dass dieses System»aufgrund seiner Transparenz und der Einbeziehung von vielen Interessenvertretern aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt im Rahmen einer demokratischen Entscheidungsfindung aktuell zu den stabilsten und vertrauenswürdigsten global verfügbaren Waldzertifizierungen gehört«. Tatsächlich sind mittlerweile weltweit rund ein Drittel aller Wälder FSC-zertifiziert. Der Markt für zertifiziertes Holz wächst rasant, das Logo findet sich auf Gartenmöbeln und Betten genauso wie auf Klopapier und Pappbechern. Der Eindruck beim Konsumenten: Solange das FSC-Siegel draufklebt, wird mit dem Produkt schon alles in Ordnung sein. Ikea strebt an, ab dem August 2020 all sein Holz aus FSC-zertifizierten Quellen zu beziehen. Für das eine Prozent seines Holzes, das aus der Ukraine stammt, hat Ikea dieses Ziel bereits erreicht jedenfalls auf dem Papier. Denn auch VGSM und andere Firmen aus Welykyj Bytschkiw tragen das Zertifikat. Und die Umweltermittler aus London betonen, dass wahrscheinlich weder VGSM noch die Forstverwaltung von Welykyj Bytschkiw ungewöhnliche Beispiele seien, sondern schlicht für die gängige Praxis im ukrainischen Forstsektor stehen. VGSM sei genauso Opfer wie Täter. Es stellt sich die Frage, was das FSC-Siegel wert ist. Earth sight wirft dem FSC vor, zu lax zu kontrollieren: Prüfer kündigten ihre Besuche an, weshalb sich die Holzfirmen vorbereiten könnten. Außerdem ließen sich die Kontrolleure von den Mitarbeitern der Firmen umherführen, statt sich selbstbestimmt umzusehen. Wirklich unabhängige Besuche gebe es kaum. In einer detaillierten Stellungnahme gegenüber der ZEIT bezeichnet der FSC die Lage im ukrainischen Forstsektor als»sehr schwierig«, sieht bei den aktuellen Fällen aber vor allem die unklare Gesetzeslage als Grund für die Vorwürfe:»Aus Sicht des FSC sind die Fälle in Bezug auf die Forstbetriebe in der Ukraine nicht so klar, wie es im Earthsight-Report dargestellt wurde.«der Generaldirektor des FSC, der Däne Kim Carstensen, hat gegenüber dem Guardian eingeräumt:»es ist wahrscheinlich, dass einiger Holzeinschlag illegal ist. Es ist wahrscheinlich, dass die Unsicherheiten in der Gesetzgebung von manchen Firmen ausgenutzt werden, um Holz zu fällen, wenn sie es nicht tun sollten.der FSC hat noch nie ein Land aus dem Portfolio genommen«, sagt Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz an der Hochschule Eberswalde, der selbst schon zu den ökologischen Wirkungen des FSC in Osteuropa geforscht hat.»ein Kernproblem bleibt: Die Anforderungen des Zertifikats gehen zwar zuweilen über die Gesetzgebung in den Herkunftsländern hinaus, sind dann aber in der Regel nicht hart formuliert. Das müssten sie aber sein, um wirklich sicherzustellen, dass das Holz nachhaltig geerntet wird«, sagt Ibisch.»Vor ein paar Wochen haben wir zwei Forstunternehmen in Transkarpatien besucht«, sagt Jehor Hrynyk, Experte für Wald- und Forstpolitik bei der ukrainischen Nature Conservation Group. Er berichtet von zwei Unternehmen, eines habe sein Zertifikat vor Jahren verloren, das andere trage noch das Siegel. Bei beiden hätten die Experten dieselben Tricksereien beobachtet.»in den öffentlichen FSC-Berichten steht aber nichts von diesen Verstößen.«Was bedeutet: Das Siegel garantiert noch nicht einmal die Einhaltung der Gesetze, die ohnehin schon als zu lasch kritisiert werden. Inzwischen hat der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal auf die Recherchen von Earth sight reagiert und versprochen, härter gegen illegale Holzernte vorzugehen:»den ersten Schritt, den wir unternehmen werden, um die Situation zu verändern, ist, eine Untersuchung einzuleiten (...) und die Chefs der Forstunternehmen auszutauschen, die schon Jahre in diesen Positionen sind.«das Beispiel aus den ukrainischen Karpaten ist deswegen so interessant, weil es auf vielen Ebenen kein Extremfall ist. So verfolgt Ikea immerhin eine der ambitioniertesten Nachhaltigkeitsstrategien. Und das FSC-Siegel gilt unter den verschiedenen Zertifizierungssystemen noch als das strengste. Manchmal genügt es einfach nicht, der Beste zu sein, solange man damit nicht gut ist. A A Quellen Die NGO Earthsight veröffentlichte jüngst den Bericht»Flatpacked Forests«und im Jahr 2018»Complicit in Corruption«Ikea gibt ausführliche Nachhaltigkeitsberichte heraus, in denen der Konzernumsatz und der Verbrauch von Holz dokumentiert sind 1571 Abweichungen von den FSC-Standards in der Ukraine zwischen 2015 und 2018 gehen aus der Datenbank info.fsc.org hervor Links zu diesen und weiteren Quellen finden Sie bei ZEIT ONLINE unter
31 Bei unserer Produktauswahl legen wir traditionell besonderen Wert darauf, Manufakturen aus der Region zu stärken. Entdecken Sie die neuen Sondereditionen exklusiv für die ZEIT gefertigt in regionalen Betrieben. Exklusiv für DIE ZEIT In drei neuen Farbvarianten HAMBURG ZEIT-Federzugleuchte von Midgard Dank der flexiblen und gleichzeitig stabilen Gelenke und dem frei positionierbaren Reflektor bringt die Leuchte das Licht genau dahin, wo es gebraucht wird. In exklusiven Farben für die ZEIT. Details: Länge Arme 500/400 mm, Schirm Ø 200 mm, Tischfuß Ø 300 mm Mehr unter shop.zeit.de/midgard 420, * Bestellnr. Orange: Dunkelrot: Dunkelblau: Exklusiv für DIE ZEIT In einer Fassung aus Edelstahl AACHEN ZEIT-Bügeltasche»Lola«von Volker Lang Exklusiv für DIE ZEIT In drei Farbkombinationen Eine edle Handtasche aus feinem Kalbsleder, die nur bei der ZEIT in den drei ausgewählten Farbkombinationen aus Außenleder und Innenfutter erhältlich ist. Details: Italienisches Kalbsleder, innen Nylon, verstellbarer Schulterriemen, Einsteckfach, Maße 21 x 24 x 7 cm (B x H x T), entwickelt in Deutschland, gefertigt in Tschechien Mehr unter shop.zeit.de/volkerlang 199, * Bestellnr. Vintage Blau/Bordeaux: Vintage Rot/Hellgrün: Schwarz/Lime: Exklusiv für DIE ZEIT Mit Sekundenzeiger in Roségoldton SCHRAMBERG ZEIT-Uhrenedition»Meister Handaufzug«von Junghans DREBACH Diese edle Armbanduhr, limitiert auf 100 Exemplare, ist eine Hommage an die Gestaltung der 1950er- und 1960er-Jahre und unterstreicht den individuellen Stil des Trägers. Details: Edelstahlgehäuse, Ø 37,7 mm, Höhe 7,3 mm, Sichtboden mit Mineralglas, individuell gravierte Nummerierung, braunes Pferdelederarmband Mehr unter shop.zeit.de/junghans 1.170, * Bestellnr.: ZEIT-Außenwetterstation von Fischer Feingeräte Nur bei der ZEIT erscheinen die präzisen Messgeräte Barometer, Haar-Hygrometer und Thermometer von Fischer in einer Edelstahlfassung und limitiert auf 500 Exemplare. Details: Maße 49 x 21,5 x 6,5 cm (H x B x T), Gewicht 1,5 kg Mehr unter shop.zeit.de/fischer 169,95 * Bestellnr.: zeitshop@zeit.de 040/ * Zzgl. Versandkosten. Da die Editionen teilweise limitiert sind, kann keine Gewähr für eine Berücksichtigung der Bestellung insgesamt bzw. der bestellten Menge übernommen werden. Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser
32 32 WISSEN 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 INFOGRAFIK: KÜSSEN NR 575 zum Raustrennen Mund zu Mund Am 6. Juli ist Weltkusstag. Wissenswertes über den romantischen Speichelaustausch VON NEELE JACOBI (INFOGRAFIK UND RECHERCHE) UND KATHARINA MENNE (RECHERCHE) 58:35 Knuuuuuutsch! Den Rekord für den längsten Kuss der Welt halten die Thailänder Ekkachai und Laksana Tiranarat. Volle 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden presste das Paar seine Lippen aufeinander. Küss die Hand! Der Handkuss gilt als Zeichen der Verehrung und des Respekts. Noch ehrerbietigere Formen sind der Kuss des Ringes, des Fußes oder des Kleidersaums der Dame. Bei einem Nasenkuss, auch Riechgruß genannt, werden Stirn und Nase sanft gegeneinandergedrückt, und der Atem wird ausgetauscht. Es ist ein traditionelles Begrüßungsritual der Maori in Neuseeland. Der sozialistische Bruderkuss auf den Mund entstammt der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Im Ostblock entwickelte er sich sogar zu einem offiziellen diplomatischen Ritual berühmtestes Beispiel ist der Kuss zwischen Erich Honecker (DDR) und Leonid Breschnew (Sow jet union), künstlerisch festgehalten an der Berliner East Side Gallery. Schnäbeln Auch Tiere zeigen einander ihre Zuneigung allerdings selten mit einem Kuss. Elefanten verwickeln ihre Rüssel, Hunde beschnüffeln einander, und Papageien schnäbeln. Nur von unseren nächsten Artverwandten, den Menschen affen, ist bekannt, dass sie ihre Nähe mit einem Kuss besiegeln Bonobos sogar mit Zunge. 76 % der Menschen neigen beim Küssen den Kopf nach rechts. Küssen verboten! Küsse in der Öffentlichkeit sind in vielen islamischen Ländern wie Saudi-Arabien oder Indonesien untersagt. Aber auch in Frankreich hat ein Gesetz aus dem Jahr 1910 noch Gültigkeit. Demnach darf auf Bahnsteigen und -übergängen nicht geknutscht werden der Sicherheit aller Beteiligten zuliebe. Im US-amerikanischen Eureka (Nevada) sollten sich Männer vorsorglich rasieren: Dort ist es Schnurrbart-Trägern laut einem alten, noch existierenden Gesetz verboten, eine Frau zu küssen. Und während des Corona-Lockdowns griff auch Österreich hart durch: Paaren, die in getrennten Haushalten leben, war das Küssen offiziell selbst im privaten Bereich nicht erlaubt. Wie alles anfing Der evolutionsgeschichtliche Ursprung des Kusses ist nicht geklärt. Eine Theorie besagt, dass er sich aus der Mund-zu-Mund-Fütterung zwischen Müttern und Kindern entwickelt habe. Eine andere sieht den Ursprung darin, dass sich die Vorfahren der Menschen bei Begegnungen gegenseitig am Hinterteil beschnüffelt und beleckt hätten. Mit der Entwicklung des aufrechten Ganges sei auch das Ritual nach oben gewandert. Universell ist der leidenschaftliche Kuss auf jeden Fall nicht. Eine Studie fand heraus, dass nur in 46 Prozent von 168 untersuchten Kulturen mit einem Kuss sexuelles Verlangen ausgedrückt wird. Reger Austausch Während des Küssens bildet der Körper mehr Hormone, der Herzschlag beschleunigt sich, und der Blutdruck steigt. Ein einziger leidenschaftlicher Kuss verbraucht rund 26 Kalorien pro Minute. Je nach Kussintensität sind bis zu 34 Gesichtsmuskeln beteiligt. Zudem wird das Immunsystem trainiert: Bei einem Zungenkuss werden etwa 80 Millionen Bakterien ausgetauscht. Allerdings können auch eine Reihe von krank machenden Organismen übertragen werden, darunter Viren der oberen Atemwege wie Sars- CoV-2, aber auch Herpes- und Epstein-Barr-Viren sowie Streptokokken und Tuberkulose-Bakterien. Quellen Einen Überblick über viele wissenschaftlich belegte Fakten rund um das Thema Küssen gibt ein Artikel im Magazin der UC Berkeley Wie intensives Knutschen die orale Mikroflora beeinflusst, lässt sich im Fachjournal Microbiome nachlesen Forscher von der University of Nevada haben sich mit der Frage beschäftigt, wie universell der romantische Kuss ist Links zu diesen und weiteren Quellen finden Sie bei ZEIT ONLINE unter
33 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 WISSEN SCHULE 33 Alles auf Abstand: Markierungen vor dem Schulbüro Die Freundinnen Donya (l.) und Tara-Lotte gehen in die 1b. Sie würden sich gerne wieder umarmen Ulrike Janßen leitet die Mühlenhofschule in Neumünster. Sie hat Lehrer und Schüler durch die Krise gelotst Fünf Jungs aus der 4a machen Pause im Klassenzimmer»Ich möchte keine Ferien«Kinder, die jetzt weiterlernen wollen, und erschöpfte Lehrer: Wie sich eine norddeutsche Grundschule in der Pandemie einen neuen Alltag erkämpft VON JEANNETTE OTTO (TEXT) UND ROMAN PAWLOWSKI (FOTOS) Ganz am Ende, an diesem letzten Freitag im Juni, als sich die Kinder der Mühlenhofschule mit einem»schöne Ferien, Frau Janßen!«verabschiedet haben, erzählt nur noch das rot-weiße Flatterband auf dem Hof vom Ausnahmezustand der vergangenen Monate. Erschöpft und erleichtert blickt die Schulleiterin Ulrike Janßen ihren Schülern hinterher, wie sie in der Mittagshitze von Neumünster davon laufen. Gerade stand sie noch mit der weißen Sprühflasche am Tor und desinfizierte Kinderhände. Was für eine seltsame Abschiedsgeste. Vor ein paar Wochen hätte Janßen nicht gedacht, dass sie das Schuljahr hier alle gemeinsam beenden, dass jedes Kind ein Zeugnis bekommt, obwohl der Unterricht so lange ausgefallen war.»kein anderes Jahr hat uns so viel Kraft abverlangt«, sagt Janßen ihrem Kollegium zum Schluss, alle nicken. Es ist gut, dass jetzt Ferien sind, und es ist schlecht, dass jetzt Ferien sind. Für jeden klafft da diese Lücke. Es fehlen Mathestunden, Deutschstunden, Sportstunden. Es fehlen Ausflüge ins Schwimmbad und gemeinsame Erlebnisse. Schule, das ist gerade hier für viele Kinder, die oft aus belasteten Elternhäusern kommen, Heimat und Familie.»Ich will noch bleiben«, hatte die Erstklässlerin Donya gesagt, als sie ihr Zeugnis bekam:»schule ist doch schön, da kann man schreiben und malen. Ich möchte keine Ferien, das ist langweilig, das ist wie Corona.«Corona! Die Grundschulkinder aus Neumünster werden dieses Wort nicht mehr vergessen, selbst die Erstklässler wissen schon, wie man es schreibt. Wie überall in Deutschland wurde vor dreieinhalb Monaten auch ihre Schule abgeriegelt. Wie haben sie und ihre Lehrer diese Zeit überstanden? Wie hat sich die Mühlenhofschule, eine gewöhnliche Grundschule in einer Einwohner-Stadt nahe Kiel, aus der Krise gekämpft? Und haben Schüler und Lehrer wieder zusammengefunden? Mittwoch, 13. Mai Kein Kinderlachen, kein Lehrergemecker. Als sei sie in einen tiefen Schlaf gesunken, liegt die Mühlenhofschule im Zentrum von Neumünster. Dabei sind immerhin die Viertklässler wieder im Haus. Das Kultusministerium von Schleswig-Holstein hat die»zweite Phase der Schulöffnungen«beschlossen,»für Schülergruppen, die die Unterstützung am nötigsten haben«. Einzeln sitzen die Kinder an ihren Tischen, weit auseinander. Es gilt der Mindestabstand, die Klassen wurden geteilt. Die Schüler dürfen sich nicht begegnen, keine Pause auf dem Hof machen. Ihre Freunde biegen in andere Räume ab, unerreichbar fern. Die Kinder kommen und gehen zu verschiedenen Zeiten. Immer entlang der rot-weißen Linien und Pfeile, die Verbote und Einbahnstraßen kennzeichnen. Tagelang hat Ulrike Janßen zusammen mit dem Hausmeister die geforderten Hygienerichtlinien umgesetzt, Abstände ausgemessen, Markierungen geklebt. Damit niemand die Klinken berührt, stehen alle Türen offen, in den Klassenzimmern, an den Eingängen, bei den Toiletten. Aber draußen sind es zwölf Grad, es zieht durch die Flure und Fenster, viele tragen Jacken und Masken.»Das ist nicht das, was die Kinder erwarten, wenn sie sich auf die Schule freuen«, sagt Ulrike Janßen. Aber es beschwere sich niemand.»es ist fast unheimlich, man merkt gar nicht, dass sie hier sind.«ernst und erwachsen sehen die Kindergesichter heute aus, auch ängstlich. Als seien sie Teil eines wichtigen Experiments, das nicht schiefgehen darf. Wenn sich hier das Virus einnistet, ist alles wieder vorbei, dann sitzen sie erneut isoliert zu Hause, füllen Arbeitsblätter aus, spielen zu viel am Computer und werden vom Rest der Welt einfach vergessen. Weil auch sie Teil dieses Experiments ist, bewegt sich die Klassenlehrerin der 4a nicht von der Tafel weg. Antje Isermann trägt Maske und hält sich streng an die Vorschrift, nicht zu den Plätzen der Kinder zu gehen. In der sterilen Schule wird alles Menschliche, Nahe und Warme der Infektionsgefahr untergeordnet.»normalerweise hätten wir uns nach so langer Zeit alle umarmt. Die Kinder sind traurig, das ist ein schlechtes Schuljahr und noch dazu ihr letztes an der Grundschule«, sagt Isermann. Sie muss die Zeit jetzt nutzen, um ihre Schüler für den Übergang auf Gymnasium oder Gemeinschaftsschule vorzubereiten. Schriftliche Division,»ein Riesenbrocken«, können sie noch gar nicht. Gut, dass sie jetzt zumindest wieder an der Tafel erklären kann.»isi ist die Beste«, sagen ihre Schüler.»Sie hat uns am meisten gefehlt!«. Eine so enge Beziehung zu den Kindern gebe es nur an der Grundschule, sagt Isermann.»Die vertrauen mir, die erzählen mir viel aus ihren Familien, und sie strengen sich an für mich.«aber mit jeder Woche Fernunterricht ist die Distanz größer geworden. Die Kinder ahnen, dass es nicht mehr so wird wie vorher. Nicht mal ein Abschiedsfoto ist erlaubt. Schnell ist der Vormittag in der Schule vorbei. Noch ein Sprüher Desinfektionsmittel an der Tür, dann marschieren die Kinder wie kleine Soldaten in 1,50 Meter Abstand durch das Treppenhaus, überholen und toben verboten. Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass durch die Schulschließungen ein Viertel der rund elf Millionen Schüler in Deutschland mit großen Lernrückständen kämpfen wird, vor allem Kinder an Förderschulen und jene, die schlecht Deutsch sprechen und keine Unterstützung von zu Hause bekommen. An der Mühlenhofschule haben rund 70 Prozent der knapp 200 Kinder einen Mi grations hin ter grund. Wie viel sie in all den Wochen zu Hause Deutsch gesprochen haben, ist ungewiss. Die Lehrer rechnen mit großen Lücken bei Sprachvermögen und beim Lesen. Weil die Kinder der ersten Klasse noch nicht zurück in die Schule dürfen, klappt Antje Isermann in einer Ecke ihres Klassenzimmers den Laptop auf und verbindet sich mit einem Mädchen, das gleich in die Kamera winkt. Im Hintergrund schreit ein Baby.»Nun lies mal vor!«, sagt Isermann schnell. Das Mädchen liest:»va ve vi vo vu vax vex vix vox vux lava lova liva vino.«die Silben kommen mit jeder neuen Zeile zögerlicher.»hast du Reihe vier auch schon geübt? Komm, das schaffst du!«ausgerechnet jetzt müssen die Erstklässler die schwierigen Buchstaben lernen, x und v, die nicht lautgetreuen. Kinder mit einer anderen Muttersprache sitzen vor den Silben und Wörtern wie vor Rätseln. Die beiden verabreden sich für das nächste Lesetraining: Donnerstag, 11 Uhr. Lehrer im ganzen Land mussten viel Kritik einstecken in den vergangenen Monaten. Ideenlos ließen sie sich durch die Krise treiben, hieß es, ohne Kontakt zu den Schülern, ohne Mut zum digitalen Unterricht, ohne Rückmeldung zu den Hausaufgaben. Und dann all die Forderungen nach Samstagsunterricht und verkürzten Sommerferien. Antje Isermann, 49 Jahre, und Ulrike Janßen, 48, macht das wütend. Die beiden Frauen sind norddeutsch genug, um keine großen Worte zu machen. Aber es könnte auch mal jemand sehen, wie sehr sie sich für ihre Kinder einsetzen. Isermann macht nicht nur Lesetraining per Video, sie gibt auch einem Jungen aus der vierten Klasse Einzelunterricht in Mathe, weil seine Eltern zur Risikogruppe gehören und er nicht in die Schule kommen soll. Janßen ist jeden Morgen um halb sieben im Büro, kopiert, schreibt Elternbriefe, telefoniert, hört sich an, was Ministerium und Schulamt entschieden haben, und kümmert sich um die Versorgung ihrer Erstklässler. Das Schultelefon hat sie auf ihr Handy umgeleitet. Kinder sprechen ihr kleine Texte auf die Mailbox, damit sie hört, wie gut sie lesen können, oder erzählen kleine Geschichten aus ihrem Alltag. Dass gerade die Kleinsten so lange ausgeschlossen bleiben, macht Janßen Sorgen. Lesen und Schreiben lernen im Fernunterricht? Sie muss aufpassen, dass kein Kind den Anschluss verliert. Im leeren Klassenzimmer der 1b, deren Klassenlehrerin sie ist, hängen noch Fotos vom Fasching im Februar, draußen im Flur reihenweise Eulen mit Wichtelmützen. Die Mühlenhofschule vermisst ihre Kinder. Montag, 25. Mai Ulrike Janßen war mal wieder die Erste in der Schule. Sie konnte nicht schlafen, so aufgeregt war sie. Kurz nach vier war die Nacht zu Ende. Heute kommen die Erstklässler zurück! Die Grundschulen in Schleswig-Holstein treten damit ein in Phase drei der Schulöffnungspläne. Schnell stellen die Kinder fest: Komisch hier! Das Gesicht ihrer Lehrerin ist hinter der Maske nur halb zu sehen, und statt einer Umarmung gibt es Desinfektionsmittel auf die Hände. Ulrike Janßen hat in den Nachrichten einen Bericht über Aerosole gesehen. Neueste Forschungen zeigen, dass häufiger als zunächst angenommen das Coronavirus über Kleinstpartikel übertragen wird, die minutenlang in der Luft schweben. Janßen fragt sich, ob die Aerosole nun in ihrem Klassenraum hängen, als unsichtbare Gefahr für alle. Und was eigentlich passiert, wenn ein Kind heftig niesen muss und die Armbeuge nicht trifft? Jeden Tag sind nun rund 80 Kinder im Haus. Montag und Mittwoch die ersten und dritten Klassen. Dienstag und Donnerstag die zweiten und vierten. Am Freitag die Schüler aus der internationalen Sprachvorbereitungsklasse. Janßen ist neben dem Unterrichten nur noch damit beschäftigt, für jede Lerngruppe Zeitpläne für Fortsetzung auf S. 34
34 34 WISSEN 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 SCHULE 3 Fragen an 4 Kultusminister Frage 1: War es die richtige Entscheidung, die Schulen zu schließen? Frage 2: Haben Sie an dieser Entscheidung gezweifelt? Frage 3: Wie geht es nach den Sommerferien weiter?»ich möchte keine Ferien«Fortsetzung von S. 33 Ankunft und Schulschluss zu schreiben, Räume aufzuteilen, Lehrer so einzusetzen, dass sie nicht auf zu viele Schüler treffen. Doch jetzt will sie von ihren Kindern wissen, was sie erlebt haben in den verrückten Corona-Zeiten. Es war langweilig, sagen sie. Sie durften nicht raus, haben sich mit den Geschwistern ums Handy gestritten.»ich hab das mit den verliebten Zahlen nicht verstanden«, sagt Tara-Lotte, die bald nach Berlin zieht,»und zu meiner Mutter gesagt: Du bist nicht meine Lehrerin!«Die muslimischen Kinder erzählen vom Zuckerfest, das gerade begonnen hat. Es habe neben Süßigkeiten Verwandtschaftsbesuche und küssende Tanten gegeben. Janßen lässt sich ihr Erstaunen kaum anmerken und sagt eher beiläufig: ANZEIGE In Lübeck den Alltag vergessen Hafen- und Kanalrundfahrt und Eintritt in das Europäische Hansemuseum sowie zwei Nächte für zwei Personen mit Verwöhnfrühstück, ab 229 Euro. Online-ID: 118 zeit.de/reiseauktion Heute bieten morgen reisen Bieten Sie mit: viele Reiseangebote bis zu 50 % unter Listenpreis. Die ZEIT-Reiseauktion startet am in der ZEIT und auf ZEIT ONLINE! Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg»Ihr wisst ja, wir sollten alle Abstand halten.«die Kinder nicken heftig. Und der Schulleiterin wird langsam klar, dass jetzt die Zeit kommt, in der die Widersprüche größer werden und die Hygienepläne der Schule schon bald lächerlich erscheinen könnten. Janßen will nichts falsch machen. Es ist auch ihre Verantwortung, zu verhindern, dass sich an der Schule ein Infektionsherd bildet.»ich möchte die Vorgaben gewissenhaft umsetzen, aber wenn die Kinder in der Schule etwas völlig anderes erleben als draußen, wird es unlogisch. Wem sollen sie dann glauben?«nach drei Stunden, ein bisschen Deutsch und Mathe, ist der Unterricht schon wieder vorbei.»leider ist morgen keine Schule«, ruft Janßen.»Erst Die Erstklässler dürfen Ende Mai endlich wieder in die Schule Einbahnstraßen: Rechts Treppe hoch, links Treppe runter Mittwoch wieder.«die Kinder bekommen Aufgaben für den Dienstag, die Lehrerin sammelt Hefte ein, die sie bis Mittwoch kontrollieren will. Verwirrte Gesichter. Als die Kinder auf dem Heimweg sind, setzt sich die Schulleiterin auf einen der viel zu kleinen Stühle und sagt:»so kann das doch nicht weitergehen bis zu den Sommerferien, es kostet so viel Logistik, alle Schüler jeden Tag zu erreichen.«auch konnte sie heute beobachten, was die vielen Wochen ohne Präsenzunterricht mit den Kindern gemacht haben. Einige haben viel geschafft und vorgelernt, bei anderen»fange ich wieder von vorne an«. Ein Mädchen, das plötzlich Kauderwelsch redet, wenn es auf Deutsch etwas erzählen soll. Ein Junge, der die Lehrerin nicht mehr versteht, weil zu Hause nur Türkisch gesprochen wird. Ein anderer, der müde und abwesend auf seinem Platz saß. Janßen erinnert sich an den 13. März, einen Freitag, den letzten richtigen Schultag vor dem großen Corona- Durcheinander. Zwanzig Minuten vor Unterrichtsschluss zeigt ihr ein Kollege eine Eilmeldung auf seinem Smartphone. Die Schulen werden dichtgemacht. Die Kinder fassungslos, untröstlich, verstört. Viele weinen. Sie verstehen nicht: Wer darf das, einfach ihre Schule schließen? Janßen weiß noch, wie sie in eine Art Schockzustand fiel, am Wochenende immer wieder dasaß und vor sich hinstarrte. All die Pläne für den Rest des Schuljahres zerplatzt. Alles, was sie und die Kollegen an Zeit und Ideen in Projekte, Ausflüge, Wettkämpfe und Klassenfahrten gesteckt hatten uninteressant. Schlimmer noch war die Ungewissheit, wie sie im Lockdown ihre Schüler erreichen konnte. 200 Kinder, von denen sie nicht wusste, wann sie sie wiedersehen würde. Die plötzlich zu Hause saßen, in engen Wohnungen und oft mit Eltern, die sie beim Lernen kaum unterstützen können. Janßen wusste, wie sehr die Familien auf die Verbindung zur Schule angewiesen waren. Schnell startete das Kollegium eine neue Internetseite, nach zwei Wochen stand eine Lernplattform. In jeder einzelnen Familie riefen die Lehrer an, redeten, erklärten, suchten für jeden Schüler eine passende Lösung fürs Lernen ohne Schule. Später, nach Ostern, hielten sie jede Woche Sprechstunden auf dem Schulhof ab. Zeit, um Kinder und Eltern für ihr Durchhalten zu loben, sie zu motivieren weiterzumachen, sich ihren Frust anzuhören. Janßen stand manchmal zwei Stunden im kalten Nieselregen. Mittwoch, 10. Juni Seit zwei Tagen ist die Schule wieder voll. Alle sind zurück, alle von der ersten bis zur vierten Klasse. Wie früher, vor der Corona-Angst, sitzen sie in ihren Klassenzimmern eng zusammen Mindestabstand aufgehoben. Aber draußen, da gilt er noch, im Treppenhaus und auf den Toiletten. Lehrer kontrollieren, dass immer nur ein Schüler aufs Klo geht. Auch die Pausen werden streng bewacht. Kein Huckepack, kein Raufen, keine Umarmung. Die 1b darf nicht der 1a begegnen und die 4a nicht der 4b. Durch Sportplatz und Pausenhof gehen lange rot-weiße Bänder. Der Alltag wird immer absurder.»corona ist jetzt zu Ende!«, ruft ein Erstklässler am Ende von Ulrike Janßens Unterricht. Die Schulleiterin lacht ein bisschen verzweifelt auf, schaut auf das abstandslose Gewusel in ihrer Klasse und ist immer noch überrascht:»jetzt sind wir also wirklich alle wieder da.«freitag, 26. Juni Es ist noch nicht einmal acht Uhr, da hat sich Ulrike Janßen schon eine Goldmedaille verdient. Viertklässler haben sie ihr überreicht, als Dankeschön kurz vor dem Abschied von der Grundschule. Lehrer und Kinder haben sich bunt angezogen, tragen Blumengirlanden um den Hals, farbige Strähnen im Haar. Ein Sommertag, der sich so leicht und frei anfühlt, als habe es die Corona-Krise nie gegeben. Doch Janßen wird auch in den Ferien viel Zeit in der Schule verbringen. Gerade heute hat das Bildungsministerium verkündet, weitere 74 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen und mehr Personal bereitzustellen. Nach den Ferien soll der Unterricht für alle Schularten und Jahrgänge normal stattfinden. Janßen braucht mehr Lehrer, 15 hat sie, viele in Teilzeit, drei Stellen sind schon lange unbesetzt. Sie beschäftigt Quereinsteiger und Studierende, zwei Assistenzkräfte gehören zur Risikogruppe, sie werden für unbestimmte Zeit ausfallen. Janßen wird Bewerbungsgespräche führen, Konzepte für das neue Schuljahr schreiben und hoffen, dass die Digitaloffensive des Landes ihrer analogen Schule endlich einen WLAN-Anschluss bringt, Tablets für die Kollegen, vielleicht sogar Smartboards für die Klassenzimmer. Alles, was die Lehrer im Fernunterricht angeboten haben, ging über ihre eigenen Geräte, über Datenverkehr, den sie selbst bezahlten. Die hybride Schule, wie sie sich Bildungs politiker wünschen, die jederzeit zwischen Präsenz- und Fernunterricht wechseln kann, ist für die Mühlenhofschule technisch noch lange nicht machbar. In der 4a gibt es jetzt Zeugnisse. Antje Isermann geht mit einem guten Gefühl aus ihrer Klasse, den wichtigsten Stoff hat sie im Endspurt noch geschafft. Einzeln kommen die Kinder und setzen sich zu ihr. Es ist dieser exklusive Moment, auf den sie so sehr gewartet haben. Zwei, drei Minuten, in denen Isermann ihnen ein letztes Mal Mut macht. Und Sätze sagt wie: Du kriegst das hin! Streng dich an, auf dem Gymnasium sind viele! Ruf mich an, wenn das Leben gemein zu dir ist. Jungs und Mädchen fangen an zu weinen. Auch die Lehrerin kann kaum noch sprechen. Isermann kennt das, am Ende der vierten Klasse schluchzen immer alle. Es ist der Abschied, den sie nicht ertragen, aber vielleicht ist es heute noch viel mehr, um das sie trauern. Das viel zu kurze Schuljahr, all das, was sie nicht mehr gemeinsam erleben durften, die Abschlussfahrt, die Ausflüge, das letzte Fest, alles, was ihnen verboten wurde, was man ihnen einfach zugemutet hat. Die Kinder gehen nach draußen, sehen durch die verheulten Augen ihre Eltern hinter dem Zaun. Sie laufen einzeln, hintereinander, sie rennen nicht, sie rangeln nicht, sie halten Abstand bis zum Schluss. Das haben sie gelernt. AA Stefanie Hubig (SPD), Rheinland-Pfalz; Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Frage 1: Wir hatten keine Wahl, unsere Verantwortung war groß. Die KMK wollte flächendeckende Schulschließungen vermeiden. Aber die Virologen sagten eindeutig: Schließt auch die Schulen, um die Zahl der Neuinfektionen zu senken. Eine harte Entscheidung, bei der es auch geknirscht hat. Wir haben sie dann aber einmütig getroffen. Frage 2: Die Krise trifft ausgerechnet diejenigen Schülerinnen und Schüler am härtesten, die ohnehin schlechtere Voraussetzungen haben. Das wird uns noch viel Kraft kosten. Frage 3: Um alle wieder auf einen Stand zu bringen, brauchen wir möglichst viele Lehrkräfte im Präsenzunterricht, gegebenenfalls auch die Unterstützung von pensionierten Lehrkräften und solchen mit dem ersten Staatsexamen. Und wir müssen die große Gewinnerin der Krise weiter nach vorn bringen: die digitale Bildung. Helmut Holter (Die Linke), Thüringen Frage 1: Am 12. März waren wir Kultusminister uns zunächst einig, die Schulen nicht zu schließen. Diese Entscheidung war aber abends nach der Beratung der Ministerpräsidenten schon obsolet. Die Situation war sehr emotional, man wollte eine dramatische Lage wie in Italien unbedingt verhindern. Heute wissen wir: Die Schulschließungen waren ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung. Frage 2: Wer nicht zweifelt, trifft keine guten Entscheidungen. In diesen Wochen lastete auf mir ein wahnsinniger Druck, die Schulschließungen vertreten zu müssen. Leistungsschwache Schüler wurden abgehängt, die Bildungsungerechtigkeit hat dramatisch zugenommen. Ich war froh, wenn ich mich auf neue Einschätzungen der Wissenschaft beziehen konnte. Aber eine eindeutige politische Empfehlung konnte sie uns nicht liefern das hat es für uns Politiker nicht leichter gemacht. Frage 3: Wir erarbeiten für Thüringen einen Plan mit drei Szenarien: Liegen keine Infektionen vor, haben wir Regelbetrieb, bei einzelnen Erkrankungen reagieren wir lokal und erst bei einer regionalen Ausbreitung des Virus müssen wieder Schulen regional schließen. Zuletzt stand der Schutz aller, auch der Lehrer, stark im Vordergrund, auch bei den Gewerkschaften. Für mich hat jetzt das Recht auf Bildung Priorität. In der ZEIT Nr. 27/20 enthielt der Artikel»Das größte Gerät der Welt«(S. 31) einen Fehler: Das Higgs-Boson existiere bloß eine Zweiundzwanzigstelsekunde. Erratum Yvonne Gebauer (FDP), Nordrhein-Westfalen Frage 1: Unter uns Kultusministern waren wir uns einig: Es ist nicht im Sinne der Kinder, die Schulen vorschnell zu schließen. Die Lage im März war aber sehr dynamisch. Fortlaufend gab es neue Erkenntnisse, jedes Land war in einer anderen Ausgangslage. Aus Vorsorge war die Entscheidung der Ministerpräsidenten auch im Rückblick richtig. Frage 2: Wir haben uns in NRW für einen Weg der kleinen Schritte entschieden, bei dem wir uns an der Infektionslage, an der Wissenschaft und vor allem am Recht der Kinder auf Bildung orientieren. Ich weiß aber, dass dies allen viel abverlangt hat. Zweifel daran hatte und habe ich nicht auch deshalb, weil es in solch einer nie dagewesenen Lage keinen Königsweg gibt. Was nicht sein darf: dass vor Ort reflexhaft als erste und einzige Maßnahme immer sofort Kitas und Schulen geschlossen werden. Frage 3: Wir wollen Präsenzunterricht in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen. Dem akuten Mehrbedarf an Lehrkräften begegnen wir so: Lehrer, die erst in kommenden Jahren hätten eingestellt werden müssen, können bereits ab diesem Sommer in allen Schulen eingesetzt werden. Christian Piwarz (CDU), Sachsen Frage 1: Ja, weil wir fürchteten, dass Schulen und Kitas die großen Treiber der Pandemie sein könnten. Wir wussten noch viel zu wenig über das Virus. In Sachsen haben wir den Schulen zwei Tage Übergangszeit gelassen. Der Druck war immens. Die Schulen für mehr als ein paar Tage zu schließen war bis dato unvorstellbar. Frage 2: Die Kinder sind anfangs zu sehr aus dem Blick geraten. Deshalb war mir wichtig, sie schnell wieder in Kitas und Grundschulen zu holen. Zum 18. Mai haben wir das in Sachsen dann umgesetzt. Eine positive Erkenntnis: Ohne Lehrerinnen und Lehrer geht es nicht. Schüler brauchen sie im Unterricht, aber auch den sozialen Austausch mit ihnen. Frage 3: An Schulen muss wieder Normalbetrieb einkehren, sodass alle Schülerinnen und Schüler ohne Abstandsregeln in voller Klassenstärke unterrichtet werden. Hygieneregeln und Infektionsschutz müssen dabei weiter gewährleistet werden. Schulschließungen dürfen in Zukunft nur noch die Ultima Ratio sein. Die Fragen stellten Thomas Kerstan und Anna-Lena Scholz Tatsächlich zerfällt dieses Elementarteilchen schon nach Sekunden. Das ist eine Zehntrilliardstelsekunde. Bitte entschuldigen Sie den Fehler! ANZEIGE Kapverden Segelvergnügen auf den Kapverden Entdecken Sie die Kapverden von See aus die Kulturhauptstadt der Kapverden, Mindelo auf São Vicente, mit alten Handelshäusern, Cafés, Gitarrenwerkstätten und Musikkneipen, sowie das touristisch noch weitgehend unentdeckte São Nicolau. Freuen Sie sich auf ein authentisches Segelerlebnis, Landausflüge und Erholung, und genießen Sie die Freiheit des Segelns und der Meere. Ihr Reisebegleiter Peter Korneffel bietet ergänzende Informationen zu der Region sowie ein ausgewähltes Landprogramm. Termine: Preis: ab / zeitreisen.zeit.de/kapverden-rhea Sailing Classics, Jo Crebbin/iStockphoto, duchy/shutterstock, Switzerland Tourism/Christof Sonderegger Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg Veranstalter: Reisen mit Sinnen, Erfurter Straße 23, Dortmund Sailing Classics, Kirchheimer Straße 60, Stuttgart Schweiz Tourismus, Mendelssohnstraße 87, Frankfurt a. M. Travel To Life GmbH & Co. KG, Schreiberstraße 32, Stuttgart In Kooperation mit: WANDERREISE Cinque Terre Wandern und genießen in romantischen Dörfern, verträumten Fischerhäfen und Weinbergen mit fantastischen Ausblicken. Erleben Sie die Schönheit der italienischen Riviera. 8 Tage ab WANDERREISE Liparische Inseln Erforschen Sie auf ausgiebigen Wanderungen (3 5 Stunden, leicht bis anspruchsvoll) die grenzenlosen Naturgewalten, und erfahren Sie Spannendes über Vulkanismus, Natur, Kultur, Land und Leute. 10 Tage ab SILVESTERREISE Glacier Express Vom wunderschönen Luzern aus werden Sie in die Gotthard-Region geführt und auf der Strecke des legendären Glacier-Express eine spektakuläre Bahnfahrt durch die Schweizer Berge unternehmen. 5 Tage ab Information und Buchung unter: 040/
35 2. J U L I DIE ZEIT DIE ZEIT No 28 STELLENMARKT Die Position Schaut über den Zaun! Fotos: Technische Universität München Die BWL ist der beliebteste Studiengang. Will sie das bleiben, muss sie sich mit Fächern wie der Medizin vernetzen Nimmt man die öffentliche Debatte um die aktuelle Krise zum Maßstab, ist es um die Relevanz der BWL nicht gut bestellt. Neben Politikern und Virologen prägen Volkswirte die Diskussion. Betriebswirte treten dagegen kaum in den Vordergrund, obwohl sie viele Auswirkungen auf Unternehmen und Wirtschaft sachgerechter beurteilen können. Das ließe sich als Moment aufnahme abtun, wären nicht auch an anderer Stelle Indizien für einen Bedeutungsverlust der BWL unübersehbar: am Arbeitsmarkt, wo sich zuverlässig zeigt, welche Qualifikationen wichtig sind. Dort erhalten Informatikerinnen und Datenwissenschaftler mittlerweile oft deutlich höhere Gehälter als BWLer. An dieser Entwicklung ist die Betriebswirtschaftslehre nicht ganz unschuldig. Der Unternehmensberater Burkhard Schwenker hat kürzlich in der ZEIT gefordert, das BWLStudium forschungsnäher, digitaler und interdisziplinärer zu machen. Das würden wohl die meisten Vertreter des Fachs unterschrei- ben. Wer aber die Probe aufs Exempel machen will, sollte vorschlagen, klimatologisches und medizinisches Wissen ins BWL-Studium zu inte grieren. Die Reaktionen dürften, vorsichtig formuliert, verhalten sein. Denn die Vorstellungen von»inter disziplinär«reichen oft nicht über die bestehenden Modelle der Wirtschaftsinformatik und des Wirtschaftsingenieurwesens hinaus. Dabei gibt es viele Gründe, das Studium für vermeintlich weit entfernte Fächer zu öffnen. Der wichtigste: Nur so geht der Anschluss an die großen Zukunftsthemen nicht verloren. Um etwa die Klimaziele in betriebs wirtschaftlichen Entscheidungen angemessen zu berücksichtigen, ist ein umfassendes Verständnis von Treibern und Technologien des Klimaschutzes nötig. Deshalb muss Klima- und Energie forschung im BWL-Studium Platz finden. Studierende müssen zudem befähigt werden, mit Zielkonflikten zwischen Ökonomie und Ökologie angemessen umzugehen. Kapazität an intensivmedizinischen Betten geschaffen werden kann, nicht zu hören. Auch innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird es wichtiger, nach links und rechts zu schauen. Immer mehr Firmen finden sich in der Plattformökonomie als Teil von Netzwerken wieder. Um die Absolventinnen und Absolventen darauf vorzubereiten, dürfen Fächer wie Strategie und Entrepreneurship nicht mehr nur Beiwerk sein. Diese Interdisziplinarität bedeutet nicht, dass die BWL ihren Wesenskern vernachlässigen sollte. Im Gegenteil: Sie muss ihn stärken. Hierzu zählen eine Beschäftigung mit Ethik, mit Informationswesen einschließlich des Finanz- und Rechnungswesens, mit den Wertschöpfungsprozessen sowie eine trag fähige und praxistaugliche Theorie des Unter nehmens. Letztere ist die Basis für die Integration all dieser Bestandteile. Die BWL ist das mit Abstand beliebteste Stu dien fach. Damit sie das bleibt, sollte sie sich erneuern.»grundlagen neuronaler Netze«könnte ein weiteres künftiges Seminarthema heißen. Denn in Dutzenden Branchen müssen Absolventen in der Lage sein, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Wenn die alten Modelle nicht rechtzeitig neu gestaltet werden, werden sie mit den daran hängenden Arbeitsplätzen von der Digitalisierung hinweggefegt. Das Themenfeld, dessen Bedeutung uns derzeit am stärksten vor Augen geführt wird, ist die Gesundheitswissenschaft. Obwohl die Gesundheitswirtschaft weltweit mit überdurchschnittlichen Raten wächst, gibt es in der BWL kaum ernsthafte Bemühungen, eine Schnittstelle zur Medizin an Universitäten zu eta blie ren. Dabei könnten die Wirtschaftswissenschaften wichtige Erkenntnisse für eine b essere Organisation des Gesundheitswesens bereitstellen. Während Wirtschaftswissenschaftler sich in der Corona-Krise zu weltweiten Lieferketten äußerten, waren sie bei der Frage, wie mit betriebswirtschaftlichen Methoden ausreichend Gunther Friedl ist Dekan der TUM School of Management und Professor für Controlling D N U R G N I E K N E G WO MONTAGMOR LAUNE IST. FÜR SCHLECHTE VON GUNTHER FRIEDL UND THOMAS HUTZSCHENREUTER Thomas Hutzschenreuter lehrt Strategic and International Management an der TU München Wir suchen für die Europäischen Schulen: Der Katholische Akademische Ausländer-Dienst (KAAD) e.v. ist das Stipendienwerk der deutschen katholischen Kirche für Studierende und Nachwuchswissenschaftler/innen aus Entwicklungsländern und Osteuropa mit jährlich etwa 500 Geförderten. Er arbeitet weltweit mit 50 kirchlichen und universitären Partnergremien und ca. 30 Alumnivereinen zusammen. Lehrer/innen Erzieher/innen INTENDANT (W/M/D) IM RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG Der KAAD sucht zum 1. März 2021 eine/n Generalsekretär/in. FÜR DIE ZEIT VOM 1. JULI 2021 BIS 30. JUNI 2026 Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg ist das Amt des Intendanten (w/m/d) für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2026 zu besetzen. Vor der Wahl durch den Rundfunkrat schreibt 22 Abs. 1 Satz 3 rbb-staatsvertrag die öffentliche Ausschreibung dieses Amtes vor. Kontakt: sekundarstufe-es@bmbf.bund.de kiga.primarstufe-es@bmbf.bund.de Wir erwarten ein mit Promotion abgeschlossenes Hochschulstudium, sehr gute Englischkenntnisse und gute Kenntnisse einer weiteren Sprache, vertiefte Erfahrung in der Arbeit mit Ländern des Globalen Südens bzw. Osteuropas, hohe interkulturelle Sensibilität und eine auf gläubiger Grundhaltung und kirchlicher Bindung basierende engagierte Mitwirkung bei der Kooperation der deutschen katholischen Kirche mit Partnern der Weltkirche. Die Intendantin/der Intendant leitet den Rundfunk Berlin-Brandenburg und ist verantwortlich für Programm und Betrieb des Senders. Ihre/seine Stellung und Aufgaben ergeben sich aus dem Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg. Sie/er wird vom Rundfunkrat für fünf Jahre gewählt. Die wiederholte Wahl ist zulässig. Der rbb ist eines der größten Medienunternehmen in Berlin und Brandenburg. Er bietet Radio, Fernsehen und Online aus einer Hand. Mit der Entwicklung der dafür erforderlichen multimedialen Strukturen und Angebote gehört der rbb zu den innovativsten und dynamischsten Sendern Deutschlands. Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird ausgeprägte Leitungserfahrung erwartet. Als öffentlich-rechtliches Unternehmen sieht sich der rbb darüber hinaus der Förderung von Frauen in Führungspositionen besonders verpflichtet. Daher sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht. Zudem möchten wir die kulturelle Vielfalt im rbb fördern und begrüßen daher Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten, ebenso wie die schwerbehinderter Bewerberinnen/Bewerber. Die gewählten Formulierungen zur Person schließen ausdrücklich alle Geschlechter ein. Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung per Post bis zum 17. Juli 2020 an den Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg An die Vorsitzende Friederike von Kirchbach Gremiengeschäftsstelle Masurenallee 8-14, Berlin Wir bieten ein sehr vielseitiges Aufgabengebiet, einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit (39 Wochenstunden), eine Vergütung nach TVöD (E 15) sowie eine betriebliche Altersversorgung. KONTAKT FÜR ANZEIGENKUNDEN Sie möchten Ihre Anzeige elektronisch übermitteln und haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben uns: Über unsere Arbeit informiert Sie näher unsere Homepage Ihre Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis zum 31. August 2020, gerichtet an den Präsidenten des KAAD, Herrn Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff persönlich (Mail: bewerbung@kaad.de) / zeit@anzeigeneingang.de Informationen zum Datenversand per Upload finden Sie unter: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine weitblickende Führungspersönlichkeit, die bereit ist für fortschrittliche Ideen, ein engagiertes Team und wertvolle Zusatzleistungen, als Die Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg (OVGU) ist eine forschungsstarke, regional vernetzte und international orientierte Profiluniversität. Mit ihren aktuell rund Studierenden aus dem In- und Ausland und durchschnittlich Beschäftigten ist sie die fünftgrößte Universität Mitteldeutschlands. Leiter*in des Kreisjugendamtes (E15/A15) Sie haben Erfahrung in der Sozialverwaltung oder Jugendhilfe, sehen gern das große Ganze und können Ziele strategisch umsetzen? Sie bringen Leitungserfahrung und starke Ideen mit, wie man ein kompetentes, engagiertes Team führt? zu repräsentieren und ihre Angebote weiterzuentwickeln? ZEIT STELLENMARKT Crossmedial gespielt: Ihre Ausschreibung zu besetzen. Auf GANZESACHEMACHEN.de erfahren Sie alles über die zu besetzende Stelle, über die Vorteile beim Landratsamt Reutlingen und wie Sie sich bewerben können. GANZE SACHE MACHEN UND JETZT BEWERBEN In der Rechtstelle der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Jurist (m/w/d) Sie haben Freude daran, die Kinder- und Jugendhilfe nach außen Jede Stellenanzeige im ZEIT STELLENMARKT finden Sie auch digital auf jobs.zeit.de und bei academics. Er/Sie wird auf Vorschlag des Präsidenten von der Mitgliederversammlung des KAAD e.v. berufen. Er/Sie leitet die Geschäftsstelle des Förderungswerks (derzeit ca. 20 Mitarbeiter/ innen) und führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Insbesondere gehören zum Aufgabenfeld die Koordination und strategische Weiterentwicklung von Länderförderungsprogrammen der fünf Regionalreferate sowie der Öffentlichkeitsarbeit, die Konzeption der umfangreichen Bildungsarbeit im In- und Ausland, zudem Aufstellung und Abwicklung des Haushalts (jeweils im Einvernehmen mit Präsident und Gremien). Gesucht wird demnach eine Persönlichkeit mit herausgehobener fachlich-akademischer und internationaler Qualifikation. Nähere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle erhalten Sie unter: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Dezernat Personalwesen Postfach 4120, Magdeburg bewerbung@ovgu.de REICHWEITENSIEGER Platz für Bewerber*innen Ihre Ausschreibung in Deutschlands reichweitenstärkster Qualitätszeitung erscheint parallel mit wöchentlich Visits auf jobs.zeit.de und academics. Quellen: AWA 2019 / Webtrekk, wöchentlicher Durchschnitt 2. Halbjahr 2019.
36 36 STELLENMARKT ZEIT Chancen REDAKTION 2. J U L I DIE ZEIT No 28 Worum geht s... in der Mediation? VON CHRISTINE PRUSSK Y STELLEN IN DIESER AUSGABE: 29 % Mint Das sagt die Professorin Das sagt die Studentin Gut zu wissen 24 % Geistes-, Sozialwissenschaften und Recht Immer noch verwechseln viele Leute Mediation mit Meditation. Das ist natürlich Unsinn: In Mediationen werden Konflikte an der Wurzel gepackt und außergericht lich so systematisch bearbeitet, dass am Ende kein fauler Kompromiss steht, sondern eine nachhaltige Verein barung. Das Verfahren ist sehr flexibel in beruflichen wie privaten Konflikten einsetzbar. Als Professorin konzen triere ich mich im Moment auf die Qualitätssicherung von Mediation und die Entwicklung von Konflikt management-systemen. Ich will dazu beitragen, dass Me diation als professionelle Dienstleistung breit genutzt wird. Im Hauptstudium studiere ich Jura. Mediation und Konflikt management belege ich zusätzlich als Master. Der Studiengang richtet sich primär an Berufstätige, die sich weiterbilden wollen. Viele Studierende bleiben ihren angestammten Fächern treu so wie ich Jura. Es war mir aber wichtig, auch das Handwerkszeug der Mediation und die kommunikativen Basistechniken zu beherrschen, die im Jurastudium kaum vermittelt werden. Zu Letzteren gehört zum Beispiel, Sachverhalte, Interessen- und Kon fliktkonstellationen mit den richtigen Fragen schnell und zielgerichtet zu erkunden. Ulla Gläßer, Juristin und Professorin für Mediation, Konfliktmanagement und Verfahrenslehre an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) Helene Bond, 3. Semester Masterstudiengang Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) Für das Studium: Mediationswissen wird in vielen Studiengängen vermittelt und gilt als Schlüssel kompetenz. Es ist auch in Psychologie oder Soziale Arbeit integriert. In Jura taucht Mediation als Wahlfach auf. Eigenständige Studiengänge bieten deutsche Hochschulen in aller Regel nur in berufsbegleitender Form an. Für den Beruf: Mediation ist für Freiberufler allenfalls eine Einkommensquelle von mehreren. Allein von der Dienstleistung wird man nicht satt. Freie Stellen in Konflikt management-abteilungen von Konzernen sind rar. Trotzdem lohnt sich eine Mediationsausbildung, weil sie den Blick für Konflikte schärft und einen professionel len Umgang mit ihnen ermöglicht. Diese Qualifikation ist in Führungspositionen besonders gefragt und kann indirekt Karrieren befördern. 10 % Medizin und Gesundheit 25 % Sonstiges Illustration: Doreen Borsutzki für DIE ZEIT 12 % Wirtschaftswissenschaften K. Fritze Jung, modern, forschungsorientiert: Hochschullehrer/in des Jahres Die UP ist die einzige lehrerbildende Hochschule in Brandenburg mit rund Lehramtsstudierenden (Bachelor und Master). Sie ist seit 2015 an der bundesweiten BMBF-geförderten Qualitätsoffensive Lehrerbildung beteiligt und wird auch in der zweiten Förderphase bis 2023 unterstützt. Die Digitalisierung im Lehr-Lern-Prozess ist hierbei ein wichtiger Bestandteil der Lehrkräftebildung und daher Querschnittsaufgabe aller Professuren der Lehrerbildung. Zudem erfolgt ein qualitativer und quantitativer Ausbau der Lehrerbildung. Unter anderem werden 22 neue Professuren eingerichtet und zukünftig jedes Jahr Studierende im Bachelor immatrikuliert. Im Jahr 1991 gegründet, hat sich die Universität Potsdam (UP) in der Wissenschaftslandschaft fest etabliert und sich zu einem herausragenden Wirtschaftsfaktor und Entwicklungsmotor für die Region entwickelt. Sie ist drittmittelstark, mehrfach prämiert in der Lehre und verfügt über eine serviceorientierte Verwaltung. Rund Studierende und Beschäftigte arbeiten an drei Standorten Am Neuen Palais, Griebnitzsee und Golm an einer der am schönsten gelegenen akademischen Einrichtungen Deutschlands. An der Humanwissenschaftlichen Fakultät der UP ist im Bereich Bildungswissenschaften/Lehramt eine künstlerische Professur zu besetzen. Die UP sieht eine besondere Herausforderung in der Vernetzung von künstlerischen Positionen und wissenschaftlicher Forschung und Lehre in der Lehrerbildung. Der/Die Stelleninhaber/-in1 muss in der Lage sein, die künstlerische Praxis in eine Auseinandersetzung mit Fragen der Vermittlung zu bringen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird eine künstlerische Professur besetzt: W2-Professur für Künstlerische Praxis mit dem Schwerpunkt Malerei/Grafik Der/Die Stelleninhaber/-in1 vertritt die künstlerische Praxis in der Lehrerbildung aller Schulstufen und organisiert die gesamte künstlerische Ausbildung. In der Lehre soll die für aktuelles Kunstgeschehen und den Schulunterricht wichtige Bandbreite unterschiedlicher künstlerischer Techniken und Konzeptionen (Malerei, Grafik, Plastik, neuere Verfahren) durch ein arbeitsteiliges Team vermittelt werden. P R E I S D E S D E U T S C H E N H O C H S C H U LV E R B A N D E S Gesucht wird eine im Bereich der Bildenden Kunst ausgewiesene Persönlichkeit mit einem starken Profil in der Malerei/ Grafik, sehr hoher didaktischer Eignung und Erfahrungen in der Lehrtätigkeit im Bereich Kunstpraxis. Auszeichnungskriterium Der Deutsche Hochschulverband zeichnet diejenige Hochschullehrerin/denjenigen Hochschullehrer aus, die/der durch außergewöhnliches Engagement in herausragender Weise das Ansehen ihres/seines Berufsstandes in der Öffentlichkeit gefördert hat. Es besteht keine Beschränkung, in welcher Art und Weise dies gelungen ist. Erwartet werden besondere künstlerische und pädagogische Befähigung, um die gesamte Breite der Kunst im Team künstlerischer Praxis leiten zu können, strategische Fähigkeiten für Aufbau und Weiterentwicklung der Kunstpraxis sowie fachbezogenes innovatives Engagement und Aufgeschlossenheit für Belange des Lehramtsstudiums. Es handelt sich um eine künstlerische Professur, deren Lehrverpflichtung 18 LVS nach 3 (3) der LehrVV für das Land Brandenburg beträgt. Preissumme , Euro. Die Preissumme wird nicht zweckgebunden vergeben. Wer kann Jede Professorin/jeder Professor, die/der korporationsrechtlich einer deutschen Hochschule anvorgeschlagen werden? gehört, sowie deutsche Professorinnen/Professoren im Ausland. Es kann eine Einzelperson oder eine Gruppe von Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern vorgeschlagen werden. Die wissenschaftliche Fachrichtung ist unerheblich. Ohne Belang ist ebenfalls, ob die/der Vorgeschlagene sich im aktiven Dienst oder im Ruhestand befindet. Selbstbewerbungen sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Hochschulverbandes können nicht vorgeschlagen werden. Vorschlagsfrist Die Frist zum Vorschlag endet am 30. September Unterlagen Vorschläge bedürfen der Schriftform. Zum Vorschlag gehören der Name der/des Vorgeschlagenen, die Hochschule, die/der sie/er angehört, eine Begründung des Vorschlags, die das Verdienst der/des Vorgeschlagenen skizziert, sowie ggf. aussagefähige Unterlagen über die Leistung der/des Vorgeschlagenen. Die Unterlagen sind an die Geschäftsstelle des Deutschen Hochschulverbandes zu richten: Deutscher Hochschulverband, Hochschullehrer/in des Jahres, Rheinallee 18 20, Bonn. Auswahl der Preisträger Die Preisträgerin/den Preisträger wählt das Präsidium des Deutschen Hochschulverbandes aus. Die Jury kann auch eine nicht vorgeschlagene Hochschullehrerin/einen nicht vorgeschlagenen Hochschullehrer auszeichnen. Die an der Realität von Schule und Unterricht, aber auch am aktuellen Forschungsstand orientierte Lehrerbildung mit einem hohen Anteil an Praxisphasen ist profilbildend für die UP. Gemeinsam mit den anderen lehramtsrelevanten Professuren an der UP und in Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung soll das Potsdamer Modell der Lehrerbildung engagiert weiterentwickelt werden. Erwartet wird eine Bereitschaft zur Mitwirkung an Lehrerfortbildungen und ein Interesse an der fakultätsübergreifenden Zusammenarbeit. Die gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen für Professor/-innen1 ergeben sich aus 41 Absatz 1 Nr. 1 4a Brandenburgisches Hochschulgesetz (BbgHG) wie folgt: abgeschlossenes Hochschulstudium in einem einschlägigen Fach, pädagogische Eignung, besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit, nachzuweisen durch ein Werk, das in einschlägigen Ausstellungen national wie international veröffentlicht ist, sowie zusätzliche künstlerische Leistungen. Das Berufungsverfahren wird nach 40 BbgHG durchgeführt. Bewerbungen mit schriftlichem Lehrkonzept für diese Professur sowie die üblichen Unterlagen (Darstellung des künstlerischen und pädagogischen Werdegangs, Lebenslauf, Zeugnisse, Tätigkeitsnachweise, Arbeitsbeispiele, Werk- und Publikationsverzeichnis) sind innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung per (in einer zusammengefassten PDF-Datei) an ausschreibungen@uni-potsdam.de zu richten. Ansprechpartner und Deutscher Hochschulverband / Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weitere Information Dr. Matthias Jaroch Rheinallee Bonn Telefon: presse@hochschulverband.de Die Universität Potsdam strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und fordert daher qualifizierte Bewerberinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Die Universität Potsdam schätzt die Vielfalt ihrer Mitglieder und verfolgt die Ziele der Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Bei gleicher Eignung werden Frauen im Sinne des BbgHG 7 Absatz 4 und schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen aus dem Ausland und von Personen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Die Universität Potsdam unterstützt neu berufene Professor/-innen1 durch einen Dual Career Service und Coachingangebote: 1 Diese Bezeichnung gilt für alle Geschlechterformen (w/m/d). Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter: Der Preis erhält die freundliche Unterstützung des Zeit-Verlages Gerd Bucerius GmbH & Co.KG. An der Pädagogischen Hochschule Weingarten sind folgende Stellen zu besetzen: Professur (W1) für Alltagskultur und Gesundheit mit dem Schwerpunkt Ernährung/Haushalt und ihre Didaktik mit Tenure Track auf W3 Kennziffer: AG436 Akademischer Mitarbeiter im Fach Deutsch Kennziffer: D437 (m/w/d) Akademischer Mitarbeiter für das Projekt Qualitätsoffensive Lehrerbildung (m/w/d) Kennziffer: R426/2 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter: (Die PH/Stellenausschreibungen) Die Universität Graz besetzt am Institut für Kunstgeschichte der Geisteswissenschaftlichen Fakultät eine STELLENAUSSCHREIBUNG FAKULTÄT SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN PROFESSUR (W 2) für Politikwissenschaft, insbesondere international vergleichende Politikfeldanalyse PROFESSUR (W 3) für Politikwissenschaft, insbesondere Politische Soziologie Bewerbungsende: jeweils am Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter: Otto-Friedrich-Universität Bamberg Bamberg Professur für Kunstgeschichte Pädagogische Hochschule Kirchplatz 2, Weingarten (40 Stunden/Woche; Verfahren gem. 98 Universitätsgesetz; unbefristetes Arbeitsverhältnis nach dem Angestelltengesetz; voraussichtlich zu besetzen ab 01. Oktober 2021) Die Professur vertritt das Fach Kunstgeschichte und Kunsttheorie mit einem Schwerpunkt in Bild- und Medienwissenschaften vom 18. bis zum Ende des langen 19. Jahrhunderts mit einer Spezialisierung auf Mittel- und Südosteuropa in Forschung und Lehre mit internationaler Wirksamkeit. Die Professur soll sich aktiv an Verbundforschungsprojekten beteiligen sowie an KUWI Graz (interuniversitärer Lehr- und Forschungsverbund zwischen Kunstuniversität, Technischer Universität und Universität Graz) und an den neuen Forschungs- und Lehrinitiativen des Instituts für Kunstgeschichte und der Fakultät mitwirken. Zudem erwarten wir Kompetenz im Bereich des Gender Mainstreaming. Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl BV/4/98 ex 2019/20 bis 26. August 2020 einzureichen. Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraussetzungen finden Sie unter jobs.uni-graz.at/bv/4/98. Voraussichtlicher Termin für das Hearing ( Berufungsvorträge ): 08. März bis 09. März 2021 Im Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen, Institut für Verkehrswesen, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende Stelle zu besetzen: W 3 - Professur (m/w/d) für Radverkehr und Nahmobilität Kennziffer Weitere Informationen zum Aufgaben- und Anforderungsprofil finden Sie im Internet unter: stellen.uni-kassel.de Bewerbungsfrist: Im Präsidialbüro, Campus Weihenstephan (Freising), ist folgende Vollzeitstelle befristet bis zu besetzen: REFERENTIN / REFERENT (M/W/D) FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT Kennziffer M465 Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf möchte ihre strategischen und operativen Risiken minimieren sowie ihre Chancen und Entwicklungspotenziale in vollem Maße nutzen und in Wert setzen. Hierfür wird ein strategisches Hochschulmanagementsystem entwickelt und eingeführt. Das Aufgabengebiet umfasst: Entwicklung, Aufbau und Einführung eines strategischen Hochschulmanagementsystems (Risiko- und Chancenmanagement) Konzeption und Umsetzung von Risikostrategien, Risikoanalysen und Risikobewertungen (qualitativ und quantitativ) Ableitung von risikoreduzierenden Maßnahmen in Abstimmung mit der Hochschulleitung, den Fakultäten, zentralen Einrichtungen und Instituten Risikoüberwachung (Monitoring) und Evaluierung, Anfertigen von Risikoberichten Pflege und Aktualisierung der Risiken und Kontrollen in einer Risikomanagement-Applikation, Entwicklung von Krisen- / Notfallplänen bedarfsorientierte Entwicklung von notwendigen Kompetenzen bei den Hochschulangehörigen Konzeption und Durchführung von Schulungen und internen Workshops Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen finden Sie bis unter
37 ZEIT DIE ZEIT No J U L I REDAKTION 3 ½ Fragen an: Annette Heuser Die Zahl Das sind doppelt so viele wie im Jahr Quelle: Stifterverband 1. Was brauchen Sie heute im Beruf, was Sie im Studium nicht gelernt haben? Ohne das Team ist alles nichts! Im Studium ist man als Einzelkämpfer unterwegs. Im Berufsleben stellt man fest, dass man in guten wie in schwierigen Zeiten ohne ein Team nicht vorankommt. Illustration: Doreen Borsutzki für DIE ZEIT Studierende sind an privaten Hochschulen eingeschrieben STELLENMARKT Welches wissenschaftspolitische Problem lässt sich ohne Geld lösen? Wir haben ein Abgrenzungsproblem zwischen Wissenschaft und Politik: Wissenschaft verdient nur dann den Namen, wenn sie immer und zu jeder Zeit unabhängig von der Politik forschen und ihre Ergebnisse präsentieren kann. Umgekehrt sollte die Wissenschaft sich nicht zu politischen Empfehlungen oder Entscheidungen hinreißen lassen. Dies sollten wir diskutieren, und das kostet keinen Cent. Die Europäische Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main hat eine Professur (W3) für Kognitive Sensorsysteme (Kennziffer W1720) Wirtschaftswissenschaftliche Dozentur für Lehre und Forschung (W2 HBesG, HE) und in Personalunion die Leitung des Fraunhofer-Instituts für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP besetzen. zu besetzen. Die Universität des Saarlandes (UdS) mit rund Studierenden im Südwesten Deutschlands ist eine Campus-Universität mit internationaler Ausrichtung und ausgeprägtem Forschungsprofil. Das Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP ist ein international anerkanntes FuE-Institut, das sich insbesondere der Entwicklung von zerstörungsfrei messenden kognitiven Systemen widmet. Das Lehrgebiet umfasst vor die Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Habilitation oder gleichwertige Leistungen sind erwünscht. Promotion und Erfahrung in Lehre und Forschung werden erwartet. Neben der Lehre erwarten wir die Akquise und Durchführung von Forschungsprojekten sowie die Mitarbeit bei der Studienorganisation und bei Projekten zur Weiterentwicklung der Akademie. Die Universität des Saarlandes (UdS) und das Fraunhofer IZFP kooperieren seit 1988 auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Prüfverfahren. Die Zusammenarbeit und die enge Vernetzung der Fachrichtung Systems Engineering mit dem Fraunhofer IZFP ist für die Stärkung der universitären Ingenieurwissenschaften im Saarland von großer Bedeutung. Die Anstellung erfolgt orientiert an die Entgeltgruppe W 2 im Angestelltenverhältnis zur Akademie (eine Stiftung des privaten Rechts, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Land Hessen getragen wird). Mit der Professur ist die Leitung des Fraunhofer IZFP verbunden, die die wissenschaftlichfachliche und unternehmerische Steuerung und Entwicklung des Institutes innerhalb des Fraunhofer-Modells und der Fraunhofer-Gesamtstrategie umfasst. Die Europäische Akademie der Arbeit will die berufliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern besonders fördern und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Die Stelle wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt. In Ihrer neuen Aufgabe leisten Sie wichtige Beiträge auf dem Gebiet der Entwicklung von intelligenten Sensorsystemen sowie des Technologietransfers in industrielle Anwendungen entlang der Material- und Produktwertschöpfungskette. Ziel ist die Entwicklung neuartiger autoadaptiver Messmethoden, z. B. auf den Gebieten der Ultraschall-, Thermographie-, Akustik- oder Mikrowellentechnologien. Sie vertreten kompetent die Schwerpunktthemen in Forschung und Lehre sowie im Forschungs- und Technologiemanagement gegenüber Forschungsförderern und Forschungspartnern und bauen die strategische Verbindung zwischen Universität und FraunhoferInstitut aus. Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind bis spätestens 30. Juli 2020 an den Leiter der Europäischen Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main, Prof. Dr. Martin Allespach, Eschersheimer Landstraße , Frankfurt am Main zu richten. Bitte reichen Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen ausschließlich in Kopie ein, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. Die UdS versteht Internationalisierung als Querschnittsaufgabe. Wir erwarten daher die Beteiligung an Aktivitäten zur weiteren Internationalisierung der Universität sowie die Bereitschaft zur Lehre in einer Fremdsprache. Die Zusammenarbeit mit Partnern innerhalb der grenzüberschreitenden Großregion SaarLorLux wird im Rahmen des Projekts Universität der Großregion besonders unterstützt ( Sie verfügen über vertiefte Erfahrungen in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: l Realisierung und Charakterisierung von (Mikro-)Sensoren, l Elektroniksysteme zum Betrieb und zur Auslesung von Sensoren und Sensorarrays, l Sensormodellierung und modellgestützte, ggf. adaptive Signalauswertung, l Sensorsignalauswertung basierend auf Maschinellem Lernen bzw. Methoden der künstlichen Intelligenz, l Stream Processing bzw. IoT Engines, l Sensorsystemintegration einschließlich Prüfung und Kalibrierung, l Vernetzung von Sensoren und Nutzung verteilter Auswertungsmethoden, l Umsetzung und Anwendung von Sensortechnologien in komplexen Systemen und Prozessen, l Systems Engineering von der Werkstoff- und Produktentwicklung bis zum Recycling. Die Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft ist mit rund Studierenden eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften Baden-Württembergs und hat neben der Lehre einen deutlichen Schwerpunkt in der angewandten Forschung. Die Hochschule verfügt über die Fakultäten Architektur und Bauwesen, Elektro- und Informationstechnik, Informatik und Wirtschaftsinformatik, Informationsmanagement und Medien, Maschinenbau und Mechatronik sowie Wirtschaftswissenschaften. Die Studienangebote zeichnen sich durch hohe praxisorientierte Lehrinhalte und herausragende Studienbedingungen aus. Die Hochschule weist sehr gute Rankingergebnisse auf und arbeitet eng mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft zusammen. An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium und Promotion in einem ingenieurwissenschaftlichen oder einem verwandten Fach, pädagogische Eignung, die i. d. R. durch Erfahrung in der Lehre nachzuweisen ist, sowie hervorragende Forschungsleistungen, die in der Regel durch eine Habilitation, im Rahmen einer Juniorprofessur oder der Leitung einer Nachwuchsgruppe an einer Universität oder an einer renommierten Forschungseinrichtung bzw. in der Industrie erbracht wurden. Auf Sie warten vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug und ein großer Gestaltungsfreiraum in der Forschung. Die Universität des Saarlandes und die Fraunhofer-Gesellschaft verfolgen eine familienfreundliche Personalpolitik und bieten ihren Mitarbeitenden flexible Arbeitszeiten und Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. W2-Professur für das Fachgebiet Human Resource Management und Arbeitswissenschaft Kennzahl 1406 Universitätsprofessur für Wissenschaftsgeschichte/Wissensgeschichte verbunden mit der Leitung einer Max-Planck-Forschungsgruppe (am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) BesGr. W 2 auf Zeit (5 Jahre) im Angestelltenverhältnis Aufg gabeng gebiet: Leitung g einer Max-Planck-Forschung gsg grup ppe am Max-PlanckInstitut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG) und Vertretung des o. g. Fachgebietes in Forschung und Lehre an der Freien Universität Berlin (Lehrverpflichtung 2 LVS) Einstellungsvoraussetzungen: gem. 100 BerlHG Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie ab dem unter beruf-karriere/jobs unter der angegebenen Kennung. Die Universität des Saarlandes und die Fraunhofer-Gesellschaft streben eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und fordern qualifizierte Wissenschaftlerinnen daher ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Bewerber*innen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % oder diesen Gleichgestellte haben bei gleicher fachlicher Qualifikation und Eignung Vorrang bei der Einstellung. Universität und Fraunhofer-Gesellschaft wertschätzen und fördern die Vielfalt der Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden und begrüßen daher alle Bewerbungen unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung sowie sexueller Orientierung und Identität. Die Max-Planck-Gesellschaft und die Freie Universität Berlin (Fachbereiche Geschichts- und Kulturwissenschaften und Philosophie und Geisteswissenschaften) besetzen gemeinsam folgende Professur: In der Fakultät Informatik der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten ist eine W2- Forschungsprofessur (m/w/d) in Vollzeit zum Wintersemester 2020/2021 ( ) oder später für einen Zeitraum von fünf Jahren für folgendes Lehrgebiet zu besetzen: Annette Heuser ist Geschäftsführerin der Beisheim Stiftung in München zu besetzen. Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin soll die Gebiete Human Resource Management und Arbeitswissenschaft in den Anwendungsfeldern Human Resource Management und Arbeitsgestaltung im internationalen Umfeld in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vertreten. Darüber hinaus soll die Forschung auf dem Gebiet der Arbeitswissenschaft ausgebaut werden. Der Bewerber/Die Bewerberin soll einen arbeitswissenschaftlichen Hintergrund mitbringen. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die ihre in der Forschung und in der beruflichen Praxis erworbene Kompetenz für unsere Studierenden nutzbar machen kann. Die Hochschule Karlsruhe ist eine der drittmittelstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Der weitere Ausbau der angewandten Forschung ist deshalb anerkanntes Ziel der Hochschule. Sie geht davon aus, dass der/die Stelleninhaber/-in sich aktiv an der angewandten Forschung beteiligt und Drittmittel einwirbt. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Beteiligung an der Grundlagenausbildung. Der/Die Stelleninhaber/-in muss bereit sein, auch Vorlesungen in fachlich benachbarten Gebieten zu übernehmen. Die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen, wird ebenso vorausgesetzt wie die Bereitschaft zur Online-Lehre. Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren sind geregelt in 47, 49, 50 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz LHG) in der Fassung ab Einzelheiten finden Sie in der ausführlichen Stellenausschreibung unter: > Hochschule > Stellenangebote Die Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Sie bittet daher qualifizierte Interessentinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entsprechender Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen werden bevorzugt elektronisch (PDF-Format, eine Datei) unter Angabe der Kennzahl bis erbeten an die Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft Personalabteilung Postfach 2440, Karlsruhe Telefon (0721) bewerbung.professoren@hs-karlsruhe.de Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der internen Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Durchführung des Bewerbungsprozesses gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz LDSG) zu. Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerberinnen und Bewerber nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzgerecht Online-Stellenvernichtet werden. Eine Rücksendung ist aus Verausschreibung waltungs- und Kostengründen nicht möglich. Rund junge Menschen studieren und forschen in attraktiven Studiengängen an der Hochschule Trier. Wir sind die drittmittelstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz und Mitglied der EUA European University Association. Damit bieten wir sehr gute Bedingungen für die Durchführung von Projekten mit regionalen und überregionalen Partnern. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Fachbereich Bauen + Leben am Standort Trier in der Fachrichtung Lebensmitteltechnik folgende Stelle zu besetzen: W2-Professur Toolchain für die digitale Produktion Zusammen mit einer Kollegin oder Kollegen aus der Fakultät Maschinenbau leiten Sie das neu einzurichtende Technologietransferzentrum (TTZ) für Produktion und Informatik mit Dienstort in Sonthofen. Sie übernehmen die Mitverantwortung für den Aufbau und Betrieb des Technologietransferzentrums. Mit Ihren Forschungsaktivitäten tragen Sie wesentlich zur Profilierung des TTZ bei und werben aktiv Drittmittel ein. In der digitalen Fabrik werden die notwendigen Fertigungsschritte vor dem Aufbau des Produktionssystems im Computer simuliert. Mit Hilfe eines digitalen Zwillings der gesamten Fertigung kann das System in der virtuellen Realität getestet und optimiert werden. Zur Realisierung kommen etablierte Standardsoftwarewerkzeuge aus den Bereichen PLM, ERP und MES zum Einsatz, die um neue Algorithmen und Methoden angereichert und in die digitale Fabrik integriert werden. Wir erwarten Bewerbungen von Wissenschaftlern/innen (m/w/d), die großes Interesse an der Entwicklung von Methoden und Algorithmen in folgenden Bereichen haben: l l l l l Industrie 4.0 und digitale Produktionsplanung Simulation und Optimierung von Produktionsprozessen Entwicklung von digitalen Zwillingen für Fertigungsprozesse Entwicklung von Tools zur Integration etablierter Softwarewerkzeuge Human-Machine-Interaction Vorausgesetzt werden tiefgehende Kenntnisse und Erfahrungen in mehreren der folgenden Gebiete: l l l l l l Aktuelle Standardtools und Trends in den Bereichen ERP, MES und PLM Agile Softwareentwicklung mit Python, R, C# und Java Kommunikations- und Integrationsplattformen wie z. B. OPC UA, MQtt und Kafke Algorithmen aus den Bereichen Simulation und Optimierung Methoden der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens Projekte im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0 Wir erwarten hohes Interesse und kreative Ideen für die Anbahnung und Durchführung von Forschungsprojekten und die Mitwirkung bei der Lehre in Grundlagen- und Vertiefungsfächern der Informatik. Idealerweise bringen Sie bereits einschlägige Erfahrung mit öffentlich geförderten und bilateralen Forschungsprojekten (Beantragung und Durchführung) mit und verfügen über gute Kontakte in der Industrie. Sie bieten Lehrveranstaltungen an und vertreten Ihr Lehrgebiet in der Weiterentwicklung unserer Präsenz- und Online-Studienangebote. Weiterhin wird eine Beteiligung an den Aktivitäten der Fakultät Informatik und an Grundlagenlehrveranstaltungen erwartet sowie die Durchführung von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache. Darüber hinaus erwarten wir eine Mitwirkung an der akademischen Selbstverantwortung der Hochschule sowie die Beteiligung am Technologie- und Wissenstransfer. Zusätzlich bringen Sie langjährige Führungserfahrung von großen, interdisziplinären Forschungsgruppen, Erfahrung bei der strategischen Planung, Akquisition und Durchführung von bedeutenden nationalen und internationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten in unterschiedlichen Feldern, Kompetenzen zur Effizienzsteigerung von Entwicklungsprozessen und in der Technologieverwertung sowie Lehrerfahrung idealerweise im Bereich der Messtechnik und Signalverarbeitung mit. Im Rahmen Ihrer Bewerbung um eine Stelle an der Universität des Saarlandes (UdS) und der Fraunhofer-Gesellschaft übermitteln Sie personenbezogene Daten. Beachten Sie bitte hierzu die jeweiligen Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten ( Durch die Übermittlung Ihrer Bewerbung bestätigen Sie, dass Sie die jeweiligen Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen haben. 3 ½. Und sonst so? Neugierig bleiben und Gelassenheit üben. Beides ist eine Lebensaufgabe, die ich durch die Kombination von Sport, Wein und Zigarillos zu bewältigen versuche Ausgang offen... Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter ZEIT WISSEN³ (ehemals CHANCEN Brief ) unter Die Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät der Universität des Saarlandes am Standort Saarbrücken und die Fraunhofer-Gesellschaft möchten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum im Online-Berufungsportal der Universität des Saarlandes ein: Bitte füllen Sie die Online-Synopse aus und laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als ein PDF-Dokument (bitte max. 10 MB) hoch. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung ein Motivationsschreiben (adressiert an den Dekan der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät, Herrn Univ.-Prof. Dr. Guido Kickelbick), Ihren Lebenslauf (inklusive Forschungs- und Lehrtätigkeiten), eine vollständige Publikationsliste sowie eine kurze Beschreibung Ihrer fünf wichtigsten Erfolge (Auszeichnungen, Publikationen/Patente, Projekte usw.) und elektronische Kopien der Urkunden bei. Parallel dazu schicken Sie Ihre Bewerbung bitte an den Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, Herrn Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer (praesident@fraunhofer.de). 3. Lektüre muss sein. Welche? Im Grunde gut von Rutger Bregman, denn: Gerade in Covid-19-Zeiten vermittelt das Buch Hoffnung, dass der Mensch gut ist und wir daher auch optimistisch in die Zukunft blicken können. Der Autor gehört zu einer jungen Garde Denker, die neue und spannende Impulse für unseren gesellschaftlichen Diskurs liefern auch das macht Mut! Die auf fünf Jahre befristete Professur ist eine Forschungsprofessur, deren Lehrdeputat von derzeit 18 Semesterwochenstunden auf die Hälfte festgelegt ist, um das Fachgebiet angemessen in der angewandten Forschung durch die Einwerbung von Drittmittelprojekten vertreten zu können. Eine Verlängerung der Lehrdeputatsermäßigung bei erfolgreicher Evaluierung nach 2,5 Jahren über die durchgeführte forschungs- und entwicklungsbezogene Tätigkeit ist beabsichtigt. Die Beschäftigung des/r Professors/in (m/w/d) erfolgt mit privatrechtlichem Dienstvertrag. Wir erwarten Wohnsitznahme am Dienstort oder in dessen Einzugsbereich. Hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen und weiterer Einzelheiten darf auf den Internetauftritt der Hochschule verwiesen werden: Wenn Sie sich für eine Professur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (taggenauer Lebenslauf nach Abschluss des Studiums als Nachweis für die berufliche Praxis erforderlich, Zeugnisse, Nachweise zu den beruflichen Stationen sowie den wissenschaftlichen Arbeiten) bis zum Bitte nutzen Sie hierfür unser Bewerbungsportal. Für evtl. telefonische Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Fakultät Informatik, Tel.-Nr Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die W1-Professur (mit Tenure Track nach W2) für Datenökonomie unter Beachtung des 64 Abs. 3 und 4 Hessisches Hochschulgesetz (HHG) für die Dauer von sechs Jahren zu besetzen. Gemäß 64 Abs. 3 HHG soll die Bewerberin oder der Bewerber an einer anderen Hochschule als der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) promoviert haben oder nach der Promotion mindestens zwei Jahre außerhalb der JLU wissenschaftlich tätig gewesen sein. Die Dauer der wissenschaftlichen Tätigkeit nach der Promotion soll vier Jahre, im Fall der erfolgreichen Absolvierung einer Weiterbildung nach 62 Abs. 6 HHG sieben Jahre, nicht übersteigen. Im Falle der Bewährung, die gem. 64 Abs. 2 HHG in einem Evaluationsverfahren festzustellen ist, wird die dauerhafte Übertragung einer W2-Professur zugesagt. Aufgaben: Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Arbeitsgebiet Datenökonomie in Forschung und Lehre vertreten. Dabei soll die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber sich aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht mit verschiedenen ökonomischen Funktionen und Herausforderungen von aufgrund der Digitalisierung anfallenden Daten auf individueller, unternehmensspezifischer, politischer und/oder gesamtwirtschaftlicher Ebene auseinandersetzen. Die Professur soll maßgeblich auch den im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften verorteten Schwerpunkt Datengetriebene Ökonomie weiterentwickeln, aufgrund der universitären Schwerpunktsetzung (Schwerpunkt Digitale Medizin, ehealth und Telemedizin im Fachbereich Medizin) insbesondere im Anwendungsfeld Gesundheit. Von der Professur wird die Beteiligung an der Ausbildung der Studierenden in den Bachelor- und Masterstudiengängen und an der Doktorandenausbildung, insbesondere im Rahmen des Gießener Graduiertenzentrums Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (GGS), erwartet. Dabei wird ein Lehrangebot im Bereich VWL erwartet und auch englischsprachige Veranstaltungen sind gewünscht. Eine aktive Beteiligung an der Profilbildung des Fachbereichs im Themenfeld Data Driven Economy wird ebenso vorausgesetzt wie die aktive Unterstützung bei der internationalen Profilierung des Fachbereichs. Eine Integration von Genderaspekten in Lehre und Forschung ist erwünscht. Während der Tätigkeit an der JLU werden Erfolge in der eigenständigen Einwerbung von Drittmitteln erwartet. Voraussetzungen: Wir suchen Bewerberinnen und Bewerber aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften mit einer sehr guten Promotion und einschlägigen Publikationen oder Manuskripten in fortgeschrittenen Überarbeitungsrunden in hochrangigen internationalen Fachzeitschriften (mit Peer-Review). Erste Erfahrungen in der eigenständigen Einwerbung von Drittmitteln sind erwünscht. Erwartet werden eine theoretisch fundierte empirischquantitative Forschungsausrichtung und eine hohe Methodenkompetenz sowie Bezüge zum Anwendungsfeld Gesundheit. Die JLU strebt einen höheren Anteil von Frauen im Wissenschaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich, sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Die JLU verfolgt auch das Ziel einer verstärkten Gewinnung von Führungskräften mit Gender- und Familienkompetenz. Die JLU versteht sich als familiengerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. Ihre Bewerbung (keine ) richten Sie bitte unter Angabe der Referenznummer 2-15/20 mit den erforderlichen Unterlagen einschließlich aussagefähiger Belege über Ihre pädagogische Eignung bis zum 31. August 2020 an den Präsidenten der JustusLiebig-Universität Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, Gießen. Zu den Einstellungsvoraussetzungen und erforderlichen Bewerbungsunterlagen wird empfohlen, unsere Hinweise unter: zu beachten. Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Wir bitten, Bewerbungen nur in Kopie und ohne Hefter/Hüllen vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden. für das Lehrgebiet Lebensmittelmikrobiologie, Lebensmittelhygiene und Gesundheit Im Schwerpunkt Gesunde und sichere Lebensmittelproduktion soll die/der zukünftige Stelleninhaber/-in in der Lehre und Forschung Themen zu verbraucherspezifischen Anforderungen einer sicheren und gesunden Lebensmittelproduktion vertreten. Wir suchen eine Persönlichkeit, die auf dem Gebiet der Lebensmittelmikrobiologie ausgewiesen ist. Die/Der zukünftige Inhaber/-in der Professur sollte neben einer mikrobiologischen Ausbildung und praktischen Erfahrungen auch umfassende Kenntnisse in Hygiene, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vorweisen und wissenschaftlich ausgewiesen sein, um diese Themen in Lehre und Forschung zu vertreten. Die Bewerber/-innen sollten ein sichtbares nationales/internationales Forschungsprofil aufweisen und in der Lage sein, englischsprachige Vorlesungen abzuhalten. Es wird erwartet, dass die/der zukünftige Stelleninhaber/-in maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung der Forschung in der Fachrichtung Lebensmitteltechnik beiträgt. Ein wesentlicher Teil der Tätigkeit soll die aktive Teilnahme an interdisziplinären Projekten der Hochschule zum Thema Gesundheit sein. Dazu gehört insbesondere die Mitarbeit bei der Konzeption und Implementierung neuer grundlegender Strategien mit regionalen, überregionalen und internationalen Partnern im Bereich der Hygiene, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll neben den ausgezeichneten beruflichen Erfahrungen über ausgewiesene didaktische Fähigkeiten verfügen. Ferner wird die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Gremien der Selbstverwaltung der Hochschule vorausgesetzt. Die Hochschule Trier bietet Ihnen innovative und zukunftsorientierte Forschungsmöglichkeiten sowie internationale und interdisziplinäre Kooperationsmöglichkeiten. Die praxisorientierte Ausbildung unserer Studierenden liegt uns ebenso am Herzen wie eine nachhaltige und teamorientierte Arbeitsumgebung. Allen Beschäftigten der Hochschule steht ein umfassendes Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Wir sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bieten vielfältige Kinderbetreuungsangebote sowie Unterstützung und Beratung durch unseren Familienservice und unseren Dual Career-Service. Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Trier vertreten ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. Weitere allgemeine Informationen sind im Internet abrufbar unter: Qualifizierte Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Für Rückfragen steht Ihnen gerne Prof. Dr.-Ing. Jens Voigt per unter voigt@hochschule-trier.de zur Verfügung. Ihre Bewerbung mit aufschlussreichem Portfolio, tabellarischem Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Nachweisen zur Berufstätigkeit und einer kurzen, aber aussagekräftigen Skizze zum Lehr- und Forschungsprofil senden Sie bitte bis zum an die Präsidentin der Hochschule Trier, Postfach 1826, D Trier sowie online auf die gesicherte Plattform Seafile des virtuellen Campus Rheinland-Pfalz: Am Department Mathematik/Informatik der Universität zu Köln ist in der Abteilung Mathematik eine Professur (W2) für Angewandte Mathematik (w/m/d) (Scientific Machine Learning) zu besetzen. Die Ausschreibung erfolgt im Rahmen der Förderung des Exzellenz Start-Up Centers GATEWAY durch das Land Nordrhein-Westfalen. Die Universität zu Köln hat sich dabei das Ziel gesetzt, unternehmerisches Denken und Handeln in forschungsstarken Fachgebieten zu fördern. Das Department Mathematik/Informatik möchte seine Kompetenzen auf dem Gebiet Scientific Machine Learning erweitern und verstärken, einem sich derzeit rapide entwickelnden Forschungsgebiet, in dem Techniken des Scientific Computing und des Machine Learning kombiniert und weiterentwickelt werden. Die ausgeschriebene Professur soll dabei insbesondere den Bereich datenintegrierte/datengetriebene numerische Simulation abdecken und eine Schnittstelle zwischen Numerik und Informatik bilden. Dabei ist die Entwicklung von Methoden und Algorithmen sowie deren Anwendung auf die Lösung industrieller Probleme in Forschung, Lehre und Transfer insbesondere Gründung erwünscht. Idealerweise liegen dazu schon Erfahrungen vor, ansonsten soll in der Bewerbung das Potential hierfür eingehend dargelegt werden. Wünschenswert wäre hier vorallem die gründungsbezogene Gestaltung von Forschung und Lehre wo es sinnvoll ist. Mögliche, aber nicht ausschließliche, Forschungsthemen sind Machine Learning-enhanced Modeling and Simulation, Physics-informed Machine Learning, Model Reduction with Machine Learning. Interdisziplinäre Anwendungen im Rahmen von Technologietransfer und insbesondere Gründungen, z. B. in Medizin, Natur- oder Ingenieurwissenschaften sowie Interaktionen mit bestehenden Forschungsthemen im Department Mathematik/Informatik sind erwünscht. Hochleistungs-Rechnerkapazitäten stehen am Regionalen Rechenzentrum Köln (RRZK) zur Verfügung. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die im Gebiet Scientific Machine Learning mit Schwerpunkt datenintegrierte/datengetriebene numerische Simulation in Forschung und Lehre hervorragend ausgewiesen ist. Zudem sollte sie außerordentliches Potenzial für die Weiterentwicklung des Bereichs Entrepreneurship und Transfer an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät haben. Erfahrung in der erfolgreichen Einwerbung kompetitiver Drittmittel ist von Vorteil. Der*Die zukünftige Stelleninhaber*in soll die Angewandte Mathematik in Forschung und Lehre vertreten und sich aktiv in den Mathematik- und Wirtschaftsmathematik-Studiengängen der Fachgruppe Mathematik/Informatik sowie in den künftigen Masterstudiengang Data Science and Scientific Computing unter anderem mit Lehrveranstaltungen im Grenzbereich von Numerik, Informatik, Technologietransfer und Gründung aus der Wissenschaft und Gründungskultur einbringen. Eine aktive Mitarbeit im Center for Data and Simulation Science (CDS) ist vorgesehen. Als aktives Mitglied des Exzellenz Start-up Centers GATEWAY soll er*sie eine engagierte Schnittstelle zwischen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und den bestehenden Strukturen des GATEWAY-Gründungsservice darstellen. Das schließt eine aktive Teilnahme an der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbereitung von Gründungen ein. Von den Bewerber*innen wird ein starkes Engagement bei der Umsetzung des von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät beschlossenen Konzepts Data Science erwartet, an dem die Abteilungen Mathematik und Informatik gleichermaßen beteiligt sind. Zu den weiteren Aufgaben der Professur gehört eine engagierte Beteiligung an den Serviceveranstaltungen des Departments Mathematik/Informatik sowie an der akademischen Selbstverwaltung. Einstellungsvoraussetzungen sind gemäß 36 HG NRW ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die insbesondere im Rahmen einer Habilitation oder z. B. im Rahmen einer Tätigkeit als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in oder Juniorprofessor*in erbracht wurden. Zudem sind eigene transfer- oder gründungsrelevante Erfahrungen und Qualifikationen wünschenswert und von Vorteil, z. B. durch die Begleitung von hochschulbasierten Start-up-Projekten als Mentor*in oder Coach oder durch die Durchführung von Lehr- und Forschungsformaten mit Transfer- und/oder Gründungspotenzial im Zusammenhang mit Industrie und Wirtschaft. Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Wissenschaftlerinnen sind besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaftler*innen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung über das Berufungsportal der Universität zu Köln ( berufungen.uni-koeln.de) mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriften- und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Urkunden über akademische Prüfungen und Ernennungen) bis an den Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen-Fakultät der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, Köln. Universität zu Köln
38 38 STELLENMARKT 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Die Europa-Universität Flensburg ist eine lebendige Universität in kontinuierlicher Entwicklung, in der die Disziplinengrenzen überschreitende Teamarbeit eine prominente Rolle spielt. Wir arbeiten, lehren und forschen für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Vielfalt in Bildungsprozessen und Schulsystemen, Wirtschaft und Gesellschaft, Kultur und Umwelt. Die Europa-Universität Flensburg bietet ein weltoffenes Arbeitsumfeld, das interkulturelles Verständnis fördert und Internationalität gemeinschaftlich lebt. Am Institut für Gesellschaftswissenschaften und Theologie der Europa-Universität Flensburg(EUF) ist im Seminar für Politikwissenschaft und Politikdidaktik zum Herbstsemester 2021 folgende Stelle zu besetzen: Professur (Bes.-Gr. W3) für Politikwissenschaft Partizipations- und Demokratieforschung (m/w/d) Kennziffer Wir suchen eine Person, die in Forschung und Lehre den Bereich der politikwissenschaftlichen Partizipations- und Demokratieforschung in ihrer theoretischen und empirischen Breite vertritt und über ein international anerkanntes wissenschaftliches Profil verfügt. Die Professur soll die Partizipations- und Demokratieforschung sowie die Parlamentarismus-, Parteien- und Föderalismusforschung an der EUF vertreten und komplementär zur Europa-Forschung an der Universität Wirkung entfalten. Vorausgesetzt werden international sichtbare wissenschaftliche Publikationen in einschlägigen Zeitschriften und bei führenden Wissenschaftsverlagen in Bezug auf das skizzierte Forschungsfeld. Erfahrungen in der erfolgreichen Einwerbung von Forschungsgeldern und dem Aufbau von Forschungskooperationen werden vorausgesetzt. Erwünscht ist eine international vergleichend angelegte Forschung, die vertiefte Kenntnisse sozialwissenschaftlicher Methoden in Forschung und Lehre erkennen lässt. In der Lehre trägt die Professur zu den Bachelor- und Masterstudiengängen des Seminars für Politikwissenschaft und Politikdidaktik, insbesondere der Lehrkräftebildung im Teilstudiengang Wirtschaft und Politik, bei. Dabei vertritt die Professur in der Lehre sowohl Binnen- als auch international vergleichende Perspektiven (politisches System der Bundesrepublik Deutschland und Ländervergleich) und repräsentiert auch die theoretischen und normativen Grundlagen der Partizipations- und Demokratieforschung. Die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen, wird ebenso erwartet wie die Bereitschaft, bei nicht vorhandenen hinreichenden Deutschkenntnissen, zügig die deutsche Sprache zu erlernen. Die Professur trägt zu den Forschungsschwerpunkten der EUF sowie zur interdisziplinären Arbeit in den universitätsübergreifenden Studiengängen und Forschungszentren bei. Vorausgesetzt werden eine qualifizierte, thematisch einschlägige Promotion in den Sozialwissenschaften und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen im Fachgebiet der Politikwissenschaft, die durch eine Habilitation, eine erfolgreich zwischenevaluierte Juniorprofessur oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen erbracht sein können. Im Übrigen gelten die des Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gern Herr Prof. Dr. Christof Roos, Juniorprofessor für European and Global Governance ( christof.roos@uni-flensburg.de). Am Institut für Gesundheits-, Ernährungs- und Sportwissenschaften der Europa-Universität Flensburg ist in der Abteilung Sportwissenschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen: Juniorprofessur (W1) mit Tenure-Track (W2) für Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Trainingswissenschaft (m/w/d) Kennziffer Wir suchen eine Persönlichkeit mit Forschungsschwerpunkten im Bereich des Gesundheitssports, der Leistungsdiagnostik oder des Trainings der körperlichen Leistungsfähigkeit. Vorausgesetzt werden eine qualifizierte Promotion und weitere qualifizierte, bevorzugt international sichtbare Publikationen auf dem Gebiet der Trainingswissenschaft. Erfahrungen in der Durchführung empirischer Forschungsprojekte und bei der Einwerbung von Drittmitteln sind erwünscht. Anschlussmöglichkeiten an Thematiken der schulischen und außerschulischen Kinder- und Jugendsportforschung sind wünschenswert. Der zukünftige Stelleninhaber (m/w/d) soll das Fachgebiet Trainingswissenschaft in Forschung und Lehre vertreten. Es wird die Bereitschaft vorausgesetzt, innerhalb und außerhalb der Europa-Universität Flensburg an Forschungsverbünden und -kooperationen, insbesondere dem Zentrum für Bildungs-, Unterrichts-, Schul- und Sozialisationsforschung (ZeBUSS), mitzuarbeiten sowie im Bereich der Forschung fachübergreifend zu kooperieren. Zu den Aufgaben der Juniorprofessur gehört die Lehre im Bachelorstudiengang Bildungswissenschaft und in den lehramtsbezogenen Masterstudiengängen, wobei Themen im Schnittfeld von Training, Sport und Gesundheit sowie Forschungsmethodik im Mittelpunkt stehen. Eine Bereitschaft zur interdisziplinären Lehre wird vorausgesetzt. Erwartet werden zudem die Bereitschaft zur Übernahme von englischsprachigen Lehrveranstaltungen und zur Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Universität. Die Juniorprofessur richtet sich an Nachwuchswissenschaftler (m/w/d) in der frühen Karrierephase. Zwingende Berufungsvoraussetzung ist eine wissenschaftliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren außerhalb der Europa- Universität Flensburg oder eine Promotion an einer anderen Universität. Im Übrigen gelten die des Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein. Bei positiver Endevaluation des Tenure-Track-Professors (m/w/d) ist der Tenure-Track verbindlich und steht nicht unter Stellenvorbehalt. Die Lehrverpflichtung beträgt entsprechend der gültigen Lehrverpflichtungsordnung in der ersten Phase der Juniorprofessur 4 LVS und nach erfolgreicher Evaluierung in der zweiten Phase 6 LVS. Weitere Informationen zu Regularien und Förderangeboten für Tenure-Track-Professuren an der EUF sind zu finden unter: Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gern der Sprecher der Abteilung Prof. Dr. Jürgen Schwier (juergen.schwier@uniflensburg.de). Die Europa-Universität Flensburg weist in der Statusgruppe der Hochschullehrenden eine ausgewogene Geschlechterrelation (m/w) auf und möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der Biographien und Kompetenzen weiter fördern. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Personen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen wie Zeugniskopien und Darstellung der bisherigen Forschungs- und Lehrtätigkeit richten Sie bitte unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum (Eingangsdatum) an den Präsidenten der Europa-Universität Flensburg, Herrn Prof. Dr. Werner Reinhart, persönlich/vertraulich, Auf dem Campus 1, Flensburg. Bei einer Bewerbung in elektronischer Form wird darum gebeten, diese in max. zwei PDF-Dateien an bewerbung@ uni-flensburg.de zu übersenden. Bei Bewerbungen in Papierform oder auf einem Speichermedium(CD-ROM oder USB-Stick) weisen wir darauf hin, dass diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden. Aufdie Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen. FacultyofSciences TheFacultyofScienceattheUniversityofZurichinvitesapplicationsforan Europa-Universität Flensburg Auf dem Campus Flensburg Assistant Professor non-tenuretrack in Quantitative Network Science Weareseekingcandidateswithapertinenttrackrecordinquantitativenetworksciencewiththegoal tobuildaninternationallyrecognizedresearchprogramwithinthebroadareaofstatistics/applied mathematics.fittingwithinfacultyanduniversityorientationwouldbeafocuson,forexample, interactionmodelingornetworksinthelifesciences,communicationnetworksincomputerscience, phylogeneticnetworksinlinguistics,phasetransitionsinrandomgraphtheoryetc.thisprofessorship issituatedwithintheuzhdigitalsocietyinitiativeandhenceitsresearchmusthavealinktoaspects ofdigitalization,e.g.bigdata,simulations,machinelearning,ordatamining.demonstratedactivities inopen-sourcescientificsoftwaredevelopmentorcommunityengagementrelatedtodigitalizationare aplus.theselectedcandidateisexpectedtoleadanindependentresearchgroupandtoparticipate inteachingatthelevelsofthebscandmscprogramsinstatistics.theuniversityofzurichhas anestablishedprogramforcareerprogressionhelpingthecandidatetoprepareforherorhisnext academicposition. TheUniversityofZurichprovidesgenerousresearchsupport,includingdedicatedfundsfor personnel,runningexpensesandcompetitivestart-uppackages.moreover,thesuccessfulapplicant isexpectedtoapplyforexternalresearchfunding.zurich sscientificenvironmentencompassesa richspectrumofdiverseactivitiesspanningpuremathematicstobiomedicalresearchthatprovides extensiveopportunitiesforcollaborationwithresearchgroupsattheuniversityofzurichandother leadingswissresearchinstitutions. TheemploymentconditionsforthispositionfollowthelegalregulationsoftheUniversityofZurich (pleaseseewww.prof.uzh.ch/en.html),includingpart-timeoptions.theuniversityofzurichisan equalopportunitiesemployerandinparticularstrivestoincreasethepercentageofwomeninleading positions(pleaseseehttps:// researchersareparticularlyencouragedtoapply.thecityofzurichcombinesastimulatingcultural sceneinamoderneuropeancitywitheasyaccesstobeautifulnaturalsurroundings. Academicswiththeappropriatequalificationsarekindlyinvitedtosubmittheirapplicationsincluding: -acurriculumvitae -aresearchplanincludingashortstatementonopenscienceandowncontribution -ashortstatementonteachingphilosophyandpotentialfuturecoursesatuzh -listofpublicationswithoutjournalimpactfactors -potentialresearchfunding, -namesandcontactdetailsofthreereferees For further information, pleasecontactprof.dr.reinhardfurrer( reinhard.furrer@math.uzh.ch). Pleaseuploadyourapplicationtohttp:// jobs.zeit.de Willkommen an der Hochschule Osnabrück, der größten Fachhochschule Niedersachsens! An drei Standorten bieten wirrund 100 Studiengänge mit Praxisbezug, eine beeindruckende Lehr- und Forschungsstärke sowie individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Unsere Studierenden profitieren von der wissenschaftlichen und beruflichen Expertise der Lehrenden,unserer internationalen Vernetzung und einem modernen Hochschulmanagement. Zur Unterstützung suchen wir Menschen, die innovativ handeln und ein Leben lang neugierig bleiben wollen. Die Hochschule Osnabrück möchte zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professuren der BesGr.W2besetzen: In der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik: PROFESSUR FÜR INTELLIGENTE AGRARSYSTEME Kennziffer IuI 161-P0720 Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in der beruflichen Praxis in der Industrie vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von intelligenten, mechatronischen Systemen, vorzugsweise im Bereich der Agrarsystemtechnik, gesammelt hat. Das erworbene Domänenwissen um die Semantik von Sensoren und deren Metadaten, vorzugsweise in der Agrartechnik,soll in Studium und Lehre vermittelt werden. Die denominierten Fachgebiete sind in der Lehre in den o.g. Bachelor-Studienprogrammen sowie in den Masterprogrammen Informatik, Elektrotechnik und Mechatronic Systems Engineering sowie in der angewandten Forschung und dem Technologietransfer zu vertreten. PROFESSUR FÜR TECHNISCHESMANAGEMENT Kennziffer IuI 163-P0720 Gesucht wirdeine Persönlichkeit, die in der langjährigen beruflichen Praxis tiefe Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des Technischen Managements gesammelt hat. Weiterhin sind tiefe Kenntnisse in der Planung, dem Betrieb und der Leitung von Produktionsanlagen mit ingenieurwissenschaftlichenmethoden sowieimqualitätsmanagement erforderlich.die Fachgebiete sind in der Lehre, insbesondere in den Bachelor-Studienprogrammen des Maschinenbaus und der Fahrzeugtechnik, im Masterprogramm Entwicklung und Produktion sowie in der angewandten Forschung und demtechnologietransfer zu vertreten. In der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur: PROFESSUR FÜR PRECISION LIVESTOCK FARMING Kennziffer AuL254-P0720 Die Professur Precision Livestock Farming ist als hauptberufliche Professur als zukünftig essentieller Bestandteil der Nutztierwissenschaften denominiert. Der/die zukünftige Stelleninhaber*in (m/w/d) soll den Bereich der verschiedenen technischen und datenanalytischen Komponenten der (Einzel-)Tiererkennung, der Sensorik, des Datenflusses und der Entscheidungsmodellierung abdecken. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium aus dem Bereich der Agrarwissenschaften oder Veterinärmedizin und fundierten praktischen Erfahrungen in den Nutztierwissenschaften. In der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: PROFESSUR FÜR ÖFFENTLICHES RECHT, INSBESONDERE VERWALTUNGSRECHT Kennziffer WiSo 384-P0720 Angesprochen werden sollen Volljuristen*innen(m/w/d),also Rechtswissenschaftler*innen (m/w/d), die eine abgeschlossene juristische Ausbildung (1. Staatsexamen mit mindestens vollbefriedigendem Ergebnis) oder ein i.s. von 112a DRiG vergleichbares Examen und 2. Staatsexamen mit mindestens vollbefriedigendemergebnisaufweisen. Es wird die Bereitschaft und Fähigkeit erwartet, das Öffentliche Recht in seinen verwaltungsrelevanten Bereichen in Lehre und angewandter Forschung zu vertreten. Neben dem allgemeinen Verwaltungsrechtsollen verschiedene Bereiche des besonderen Verwaltungsrechts abgedeckt werden. Die ausführlichen Stellenbeschreibungen und die Qualifikationsanforderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte in elektronischer Form möglichst als ein PDF unter Angabe der Kennziffer bis zum 31. Juli 2020 anfolgende Adresse: Präsident der Hochschule Osnabrück Postfach 1940 l Osnabrück berufungen@hs-osnabrueck.de DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM MIT ZUKUNFT. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg(DHBW) zählt mit ihren derzeit rund Studierenden(an 12 Standorten) Am Standort Heilbronn ist zum folgende Stelle zu besetzen: und ca kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen zu den größten Hochschulen des Landes. Professor*in als Rektor*in(m/w/d) Besoldungsgruppe W3 Die DHBW Heilbronn wurde 2010 gegründet und bietet in Kooperation mit 467 ausgewählten Unternehmen aktuell fünf national und international akkreditierte, praxisintegrierte Studiengänge und Studienrichtungen in dem Bereich Wirtschaft an. Diese führen die rund Studierenden zu den Abschlüssen Bachelor of Arts und Bachelor of Science. Ab Oktober 2020 wird das Studienangebot um den Studiengang Wirtschaftsinformatik mit drei Studienrichtungen sowie, vorbehaltlich der Akkreditierung, um die Studienrichtung BWL-Digital Commerce Management erweitert. Von dem*der zukünftigen Stelleninhaber*in wird ein besonderes Maß an Führungs- und Kooperationsqualitäten im Verhältnis zu den Studierenden, den beteiligten Unternehmen sowie dem haupt- und nebenberuflichen Lehrkörper und dem nichtwissenschaftlichen Personal erwartet. Die Motivation und Führungder derzeit 113 Mitarbeiter*innen, darunter aktuell 28 Professor*innen, gehört zu den Herausforderungen in diesem Amt. Der*Die Rektor*in trägt die Verantwortung für die wirtschaftliche Leitung der Studienakademie und die Qualität der Lehre und Forschung, pflegt die Kontakte zu den Repräsentant*innen der Region aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft und vertritt das Präsidium der DHBW vor Ort. Die Tätigkeit umfasst außerdem die Mitarbeit in zentralen GremienderDHBW. Hierfür suchen wir eine Persönlichkeit mit umfangreichen Erfahrungen in der Organisation und Durchführung von praxisintegrierten Studiengängen sowie Erfahrung in der Koordination und Zusammenarbeit mit Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs. Außerdem werden für die laufende Organisationsentwicklung sowie die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Ausrichtung der Studienakademie nachweisliche strategische Managementkompetenzen benötigt.die Übernahme der zu besetzenden Position erfordert mehrjährige Erfahrung in der Leitung von Organisationen und im Wissenschaftsmanagement. Zum*Zur Rektor*in kann bestellt werden, wer der Hochschule hauptberuflich als Professor*in angehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesonderein Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Technik, Verwaltung oder Rechtspflege erwarten lässt, den Aufgaben des Amts gewachsen zu sein. Die Einstellung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen im Beamtenverhältnis auf Zeit, andernfalls im befristeten Arbeitsverhältnis. Bisherige Beamtenverhältnisse zum Land Baden-Württemberg bleiben bestehen.die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die DHBW strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen an. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Bei gleicher fachlicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber*innen vorrangig berücksichtigt. Bitte bewerben Sie sich bis zum online über unser Bewerbungsportal auf der Homepage der DHBW Kennziffer 1642: Über anspruchsvolle Stellen auch online! Jetztaufjobs.zeit.de An deruniversität Bremen ist im Fachbereich 08 -Sozialwissenschaften im Fach Soziologie unter dem Vorbehalt der Stellenfreigabe zum Wintersemester 2021/2022 eine Professur (w/m/d) Besoldungsgruppe W3 für das Fachgebiet Soziologische Theorien Kennziffer: P637/20 zu besetzen. Bei Erfüllung der allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgt eine Verbeamtung auf Lebenszeit. Gesucht wird eine international ausgewiesene Persönlichkeit, die dieses Fachgebiet in Lehre und Forschung vertritt. Sie verfügt über breite Kenntnisse der Sozial- und Gesellschaftstheorie von den Klassikern/Klassikerinnen bis zu aktuellen Positionen und bringt insbesondere gesellschaftstheoretische Perspektiven auch in eigenen empirischen Forschungen zum Einsatz. Wünschenswert sind Forschungen, die sich mit dem sozialen Wandel und/oder der Integration von Gegenwartsgesellschaften befassen. Erwartet werden eine passfähige Forschungsausrichtung mit den inhaltlichen Schwerpunkten des SOCIUM Forschungszentrums Ungleichheit und Sozialpolitik und ein ausgeprägtes Kooperationsinteresse. Zu den Lehraufgaben gehört insbesondere die Mitwirkung an den Bachelor- und Master-Studiengängen der Soziologie und benachbarter Fächer des Fachbereichs. Erwünscht ist zudem die Beteiligung an der Graduiertenausbildung an der BIGSSS. Die Durchführung deutschsprachiger Lehre ist von Beginn an notwendig. Die Bereitschaft, Veranstaltungen in englischer Sprache anzubieten, sowie die Beteiligung an der Umsetzung des Konzepts des Forschenden Lernens werden erwartet. Wünschenswert ist der Einsatz mediengestützter Lehr- und Lernformen. Weiterhin sind Erfahrungen in der Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in Forschung und Lehre erwünscht. Die Universität Bremen bietet neben einem angenehmen kollegialen Arbeitsklima ein lebendiges, produktives und international sichtbares Umfeld in ihrem Wissenschaftsschwerpunkt Sozialer Wandel, Sozialpolitik und Staat, das vielfältige innerfachliche wie interdisziplinäre Kooperationen ermöglicht. Von der zu berufenden Persönlichkeit werden internationale wissenschaftliche Erfahrungen, die aktive Mitarbeit an der Internationalisierung und internationalen Vernetzung sowie Erfahrungen in der Einwerbung und Durchführung von Drittmittelprojekten erwartet. Erwartet wird die Beteiligung an laufenden sozialwissenschaftlichen Verbundforschungsinitiativen im Rahmen einer gut etablierten interdisziplinären Zusammenarbeit im Themenfeld soziale Ungleichheit und Wohlfahrtsstaatlichkeit. Einstellungsvoraussetzungen sind ein einschlägiger wissenschaftlicher Hochschulabschluss, eine fachlich einschlägige und herausragende Promotion sowie weitere wissenschaftliche (habilitationsadäquate) Leistungen, die auch außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein können. Die zusätzlichen Leistungen müssen durch eine Habilitation oder habilitationsadäquate Leistungen, wie sie beispielsweise im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht worden sind, nachgewiesen werden. Die Bereitschaft zur hochschuldidaktischen Fortbildung sowie pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der universitären Lehre nachzuweisen ist, werden ebenfalls vorausgesetzt. Die Berufung erfolgt unter Zugrundelegung von 18 BremHG und 116 BremBG. Die Universität bietet eine Vielzahl an Angeboten, die Neuberufene unterstützen, wie ein Welcome Center, Möglichkeiten zu Kinderbetreuung und Dual Careers und Angebote der Personalentwicklung und der Weiterbildung. Die Universität Bremen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im Wissenschaftsbereich an. Sie ist in unter anderem in Programmen zur Geschlechtergerechtigkeit mehrfach ausgezeichnet worden und fordert Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Ausdrücklich begrüßt werden Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Migrationshintergrund sowie internationale Bewerbungen. Schwerbehinderten Bewerberinnen/ Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Weitere Auskünfte erteilt: Prof. Dr. Susanne K. Schmidt, (Dekanin) dekaninfb8@uni-bremen.de Bewerbungen mit Lebenslauf (inklusive Zeugniskopien), Nachweisen der Forschungs- und Lehraktivitäten (u. a. Publikationsverzeichnis, Projekt(leitungs)erfahrungen, Lehrevaluationen) sowie ein Forschungs- und Lehrkonzept (in einer pdf-datei) sind zusammen mit drei Publikationen (in drei separaten pdf-dateien) und unter Angabe der Kennziffer bis zum zu richten an: Dekanin des Fachbereichs 08/ Sozialwissenschaften Universität Bremen Kennziffer: P637/20 Universitäts-Boulevard Bremen oder auf elektronischem Wege fb08.bewerbung@uni-bremen.de Weitere Informationen zu Berufungsverfahren an der Universität Bremen finden Sie unter uni-bremen.de/berufungsverfahren.de An der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Fachbereich Betriebswirtschaft, ist ab dem Sommersemester 2021 folgende Professur zu besetzen: Volkswirtschaftslehre Bes.Gr. W2; Kennziffer: BW 09 Der Bewerber/Die Bewerberin soll das Fach Volkswirtschaftslehre in seiner gesamtenbreite(mikro-, Makroökonomie, internationale Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsbeziehungen, empirische Methoden)inBachelor-und Masterstudiengängenvertreten. Notwendige Voraussetzungen: -Einabgeschlossenes Hochschulstudium der Volkswirtschaftslehre -EinequalifiziertePromotion aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre - Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, davon mindestens drei Jahre außerhalb einer Hochschule in einem Bereich der angewandten Volkswirtschaft -Lehrerfahrungen in den verschiedenen Gebieten der Volkswirtschaft Besonderer Wert wird auf die pädagogische Fähigkeit gelegt, volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Methoden im Rahmen betriebswirtschaftlicher Studiengänge zu vermitteln. Neben dieser Freude an der Lehre wird ein Engagement in der Forschung undeinwerbung vondrittmitteln erwartet. Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung sollten Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache durchgeführt werden können. Darüber hinaus ist die aktive Mitwirkung an der akademischen Selbstverwaltung erwünscht sowie an Kooperationen mit anderen (auch ausländischen) Hochschulen. Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen Sie bitte der Rubrik Karriere auf unserer Homepage unter Schriftliche Bewerbungen werden erbeten mitden üblichen aussagefähigen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer bis zum an den Rektor der Ernst-Abbe-Hochschule Jena Carl-Zeiss-Promenade 2, Jena (rektorat@eah-jena.de)
39 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 STELLENMARKT 39 BITTEBEACHTEN Anzeigen-/DruckunterlagenschlussPrint-Online-Stellenanzeigen: Montag der Erscheinungswoche, 14 Uhr eine eine eine eine Als Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft schafft und vermittelt das Karlsruher Institut für Technologie(KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Daran arbeiten am KIT rund Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studierende auf einer breiten disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen. Das KIT ist eine der deutschen Exzellenzuniversitäten. Wir suchen engagierte Köpfe, die gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten! Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sucht zum 1. Januar 2022 eine/einen 1. W3-Professur für Kulturtheorie Vizepräsidentin/Vizepräsidenten für Forschung (w/m/d) Die/Der Vizepräsidentin/Vizepräsident für Forschung bildet gemeinsam mit dem Präsidenten und den vier weiteren Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten die oberste Leitungsebene des KIT. Die Zuständigkeit des Präsidiums umfasst alle Angelegenheiten, für die nicht durch Gesetz oder die Gemeinsame Satzung des KIT eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Zur/Zum Vizepräsidentin/Vizepräsidenten des KIT kann bestellt werden, wer dem KIT hauptberuflich als Professor/-in oder leitende/-r Wissenschaftler/-in im Sinne des 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KIT-Gesetz angehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Forschung oder Wirtschaft, erwarten lässt, den Aufgaben des Amtes gewachsen zu sein. Die Größe und die besondere Aufgabenstellung des KIT sowie die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen,außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen auf nationaler und internationaler Ebene erfordern eine Persönlichkeit mit ausgewiesenen Fähigkeiten zur Organisation und Leitung komplexer Strukturen. Ausgeprägte Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten auch im internationalen Kontext sind selbstverständliche Voraussetzungen. Erfahrungen im Hochschulbereich und/oder in der außeruniversitären überregionalen Forschungsorganisation werden ebenso erwartet wie eine Ausbildung oder mehrjährige berufliche Schwerpunktsetzung in den Ingenieur-oder Naturwissenschaften. Nachgewiesene wissenschaftliche Exzellenz sowie Erfolge in der Einwerbung und Abwicklung sichtbarer Forschungsverbünde sind Voraussetzung. Affinität zu einem der wichtigen profilgebenden Schwerpunkte des KIT, die sich idealerweise auch in dem bisherigen beruflichen Werdegang widerspiegelt, ist von besonderem Vorteil. Die/Der Vizepräsidentin/Vizepräsident für Forschung trägt im engen Zusammenwirken mit dem KIT-Präsidenten die fachliche Verantwortung für die Forschungsaktivitäten des KIT,deren Exzellenz und Fortentwicklung sowie für das Qualitätsmanagement in der Forschung. Dies gilt insbesondere auch für alle Formen der koordinierten Forschung inklusive der Forschung im Rahmen von Helmholtz-Programmen. Die/Der Vizepräsidentin/Vizepräsident sorgt für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Forschungsstrategie als Teil der KIT-Gesamtstrategie sowie für eine angemessene und erfolgreiche Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Besonderer Wert wird auch auf die Unterstützung und das Vorantreiben der Verknüpfung von universitärer Forschung und Forschung im Rahmen nationaler und internationaler Großforschung gelegt. Die Bestellung erfolgt für die Dauer von sechs Jahren. Eine Wiederbestellung ist möglich. Es wird eine Vergütung entsprechend der Besoldungsgruppe W3 gewährt. Der gegenwärtige Amtsinhaber wird sich wieder bewerben. Das KIT hat sich die Förderung von Frauen und der Diversität in Führungspositionen zum Ziel gesetzt. Bewerbungen von Schwerbehinderten (m/w/d) werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wenn Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum in einer einzigartigen Wissenschaftsorganisation anspricht, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis an AR-Geschaeftsstelle@kit.edu (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Geschäftsstelle Aufsichtsrat, Kaiserstraße 12, Karlsruhe). Weitere Informationen zum KIT finden Sie im Internet unter: Die Datenschutzerklärung zum Verfahren sowie die Gesetzestexte (KIT-Gesetz und Gemeinsame Satzung des KIT) finden Sie unter folgendem Link: s.kit.edu/fiko-dse KIT Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft Die Universität der Bundeswehr München richtet unter dem Dach der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften einen kulturwissenschaftlichen Studiengang (B.A./M.A.) mit sechs Kernprofessuren ein. Dem Studiengang liegt ein interdisziplinäres Verständnis von Kultur zu Grunde. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betreiben theoretische und empirische Forschung. Sie vermitteln interkulturelle Kompetenzen und ein fundiertes Verständnis für kulturelle Lebensformen. Sie lehrenmit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa, Nordafrika und dem frankophonen subsaharischen Afrika. An der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst folgende Professuren zu besetzen: W3-Professur für Kulturtheorie W3-Professur für Nationales und Internationales Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Kulturgüterschutz W2-Professur für Neuere und Neueste Kulturgeschichte Nordafrikas W2-Professur für Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt Islam Die zukünftige Stelleninhaberin bzw. der zukünftige Stelleninhaber ist in der kulturwissenschaftlichen Forschung oder ggf. einer angrenzenden Sozialwissenschaft durch exzellente wissenschaftliche Arbeiten zur Kulturtheorie bzw. zum Kulturbegriff auch international sichtbar ausgewiesen. Sie bzw. er soll auch empirische Forschung vorweisen können. Der Professur obliegen Lehraufgaben in kulturtheoretischen Themenfeldern in dem im Aufbau befindlichen kulturwissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengang. Voraussetzung für eine Bewerbung sind exzellente wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen werden. 2. W3-Professur für Nationales und Internationales Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Kulturgüterschutz Die zukünftige Stelleninhaberin bzw. der zukünftige Stelleninhaber ist im Nationalen und im Internationalen Öffentlichen Recht sowie durch exzellente wissenschaftliche Arbeiten zum Kulturgüterschutz auch international sichtbar ausgewiesen. Der Professur obliegen Lehraufgaben in rechtswissenschaftlichen Themenfeldern in dem im Aufbau befindlichen kulturwissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengang. Voraussetzung für eine Bewerbung sind exzellente wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen werden. 3. W2-Professur für Neuere und Neueste Kulturgeschichte Nordafrikas Die zukünftige Stelleninhaberin bzw. der zukünftige Stelleninhaber vertritt das Gebiet der Neueren und Neuesten Kulturgeschichte Nordafrikas umfassend in Forschung und Lehre. Sie bzw. er soll durch exzellente wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der nordafrikanischen Geschichte bzw. des südlichen Mittelmeerraumes im 19. und 20. Jahrhundert auch international sichtbar ausgewiesen sein. Einschlägige Sprachkenntnisse insbesondere des Arabischen sind erwünscht. Der Professur obliegen Lehraufgaben in kulturgeschichtlichen Themenfeldern in dem im Aufbau befindlichen kulturwissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengang. Voraussetzung für eine Bewerbung sind exzellente wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen werden. 4. W2-Professur für Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt Islam Die zukünftige Stelleninhaberin bzw. der zukünftige Stelleninhaber vertritt das Gebiet der Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt Islam und seiner Kultur umfassend in Forschung und Lehre. In diesem Themenfeld soll sie bzw. er durch exzellente wissenschaftliche Arbeiten auch international ausgewiesen sein. Zusätzlich sollte sie bzw. er ein Forschungsprofil mit Blick auf grundlegende religionstheoretische bzw.-soziologische Fragen und den interreligiösen Dialog vorweisen können. Voraussetzung für eine Berufung sind neben einem einschlägigen abgeschlossenen Hochschulstudium in Religionswissenschaft, Islamwissenschaft oder in einem theologischen Studiengang exzellente wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen werden. Der Professur obliegen Lehraufgaben in religionswissenschaftlichen Themenfeldern in dem im Aufbau befindlichen Bachelor- und Masterstudiengang. Eine Bereitschaft der Professuren zur engen Kooperation innerhalb der Fakultät, insbesondere mit den im Rahmen des Studienganges neu einzurichtenden Professuren, wird vorausgesetzt. Es besteht die Möglichkeit zur Kooperation mit den Forschungszentren der Universität, z. B. dem Forschungszentrum Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt (RISK). Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber der jeweiligen Professur soll auch in der Lehre exzellent ausgewiesen sein. Hierzu zählt die Einbindung innovativer Lehr- und Lernmethoden. Die Bereitschaft zur Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung und in der Nachwuchsförderung wird ebenfalls vorausgesetzt. Ferner wird die Übernahme einer gleichstellungsorientierten Führungsverantwortung erwartet. Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber soll Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln aufweisen. An der Universität der Bundeswehr München sind W2- und W3-Professuren in personeller und sachlicher Ausstattung grundsätzlich gleichgestellt. Die Universität der Bundeswehr München bietet für Offizieranwärterinnen und -anwärter sowie Offiziere ein wissenschaftliches Studium an, das im Trimestersystem zu Bachelor- und Masterabschlüssen führt. Das Studium wird durch fächerübergreifende, berufsqualifizierende Anteile des integralen Begleitstudiums studium plus ergänzt. Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung von Professorinnen und Professoren richten sich nach dem Bundesbeamtengesetz. In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer am Tag der Ernennung das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen an und fordert deshalb ausdrücklich Wissenschaftlerinnen zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Bitte richten Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen bis zum als vertrauliche Personalsache in einer PDF-Datei elektronisch an die Dekanin der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr München unter dekanat.sowi@unibw.de. Mit der Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten von den mit dem Bewerbungsverfahren zuständigen Stellen verarbeitet werden. Nähere Angaben zum Datenschutz finden Sie auf der Homepage der UniBw München. Am Deutschen Krebsforschungszentrum(DKFZ) ist gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München(LMU) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Professur(W3) für Translationale Onkologie mit dem Schwerpunkt Reverse Translation (Lehrstuhl) am Standort München des DKTK (Kennziffer ) zu besetzen. Die Professur vertritt das Fach in Forschung und Lehre in seiner ganzen Breite. Die Professur wird im Rahmen des Deutschen KonsortiumsfürTranslationale Krebsforschung (DKTK) besetzt und ist räumlich an der LMU München angesiedelt.das Konsortium,ein Zusammenschluss des DKFZ als Kernzentrum und universitärer Partner,errichtet und nutzt translationale Forschungseinheiten für anwendungsnahe Krebsforschungansieben bundesweit vernetzten Partnerstandorten. Gesucht wird eine auf dem Gebiet dertranslation in der Onkologie international ausgewiesene Persönlichkeit.In besonderer Weise sind Clinician Scientists,in der Forschung tätige Ärztinnen und Ärzte(m/w/d)sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler(m/w/d)aus der Medizin angesprochen, die eine Translation klinischer Fragestellungen in die kliniknahe Krebsforschung zur Anwendung bringen. Darüber hinaus ist eine hohe Kooperationsbereitschaft mit den klinischen und wissenschaftlichen Institutionen in München, dem DKFZ( und den weiteren Partner-Standorten des DKTK( unabdingbar. Wir möchten eine hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit gewinnen, die ihre wissenschaftliche Qualifikation im Anschluss an ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie eine überdurchschnittliche Promotion oder eine vergleichbare besondere Befähigung durch international sichtbare, exzellente Leistungen in Forschung und Lehre nachgewiesen hat. DieBerufungerfolgt andie LMU bei gleichzeitiger Beurlaubung an das DKFZund dortiger Anstellung im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis. Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgt im Rahmen der Professur an der LMU eineverbeamtung auf Lebenszeit.Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr zum Zeitpunkt derernennung noch nicht vollendet sein. In dringenden Fällen können hiervonausnahmen zugelassen werden. Das DKFZ Heidelberg sowie die LMU streben eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung und Lehre an und bitten deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.die LMU und das DKFZ Heidelberg bieten Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an. Bewerbungenmit den üblichen Unterlagen(Lebenslauf,Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis) sowie einem Kurzbewerbungsbogen(siehe sind bis zum beim Dekan der Medizinischen Fakultät der LMU,Herrn Prof. Dr. R. Hickel, Bavariaring 19, München und zusätzlich an den Vorstandsvorsitzenden und Wissenschaftlichen Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums,Herrn Prof. Dr. M. Baumann, Im Neuenheimer Feld 280, Heidelberg über das Online-Bewerberportal des DKFZ( unter Angabe der Kennziffer einzureichen. Das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung ist eine gemeinsame Initiative des BMBF, der beteiligten Bundesländer und des DKFZ. Die Allianz zwischen dem DKFZ als Kernzentrum, dem Nationalen Centrum fürtumorerkrankungen(nct)heidelberg und den universitären PartnerstandorteninBerlin, Dresden, Essen/Düsseldorf, Frankfurt/Mainz, Freiburg, MünchenundTübingen baut gemeinsame Translationszentren auf.im Fokus stehen interdisziplinäre Forschungsansätze und innovative klinische Studien, die zur Verbesserung der Vorsorge und Diagnose sowie zu einer rascheren Anwendung personalisierter Therapien für Krebspatienten beitragen sollen. Bewerbungsschluss: WeitereInformationen: Prof. Dr. med. Michael Baumann, Telefon Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen per nicht angenommen werden können. Als Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft schafft und vermittelt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Daran arbeiten am KIT rund Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studierende auf einer breiten disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen. Das KIT ist eine der deutschen Exzellenzuniversitäten. Wir suchen engagierte Köpfe, die gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten! Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sucht zum 1. Januar 2022 eine/einen Vizepräsidentin/Vizepräsidenten für Innovation und Internationales (w/m/d) Die/Der Vizepräsidentin/Vizepräsident für Innovation und Internationales bildet gemeinsam mit dem Präsidenten und den vier weiteren Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten die oberste Leitungsebene des KIT. Die Zuständigkeit des Präsidiums umfasst alle Angelegenheiten, für die nicht durch Gesetz oder die Gemeinsame Satzung des KIT eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Zur/Zum Vizepräsidentin/Vizepräsidenten des KIT kann bestellt werden, wer dem KIT hauptberuflich als Professor/-in oder leitende/-r Wissenschaftler/-in im Sinne des 14 Abs.3 Satz 1 Nr. 1 KIT-Gesetz angehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Forschung oder Wirtschaft, erwarten lässt, den Aufgaben des Amtes gewachsen zu sein. Die Größe und die besondere Aufgabenstellung des KIT sowie die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen auf nationaler und internationaler Ebene erfordern eine Persönlichkeit mit ausgewiesenen Fähigkeiten zur Organisation und Leitung komplexer Strukturen. Ausgeprägte Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten auch im internationalen Kontext sind selbstverständliche Voraussetzungen. Von einem belastbaren Netzwerk an internationalen Kontakten, insbesondere zu Hochschuleinrichtungen und Forschungseinrichtungen im Ausland, wird ausgegangen. Erfahrungen im Hochschulbereich, in der außeruniversitären überregionalen Forschungsorganisation oder auch in der Wirtschaft werden ebenso erwartet wie eine Ausbildung oder mehrjährige berufliche Schwerpunktsetzung in den Ingenieur- oder Naturwissenschaften. Erfolge im Wissens- oder Technologietransfer oder in der Gründerszene müssen nachweisbar sein. Erfolge bei der Lancierung internationaler Kooperationsprojekte werden vorausgesetzt. Affinität zu einem der wichtigen profilgebenden Schwerpunkte des KIT,die sich idealerweise auch in dem bisherigen beruflichen Werdegang widerspiegelt, ist von besonderem Vorteil. Längere Auslandsaufenthalte an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen sowie weitereerfahrungen im internationalen Umfeld sind sehr begrüßenswert. Von der/dem Vizepräsidentin/Vizepräsidenten für Innovation und Internationales wird die zu Forschung und Lehre gleichgewichtige Positionierung des strategischen Handlungsfeldes Innovation mit fachlicher Fokussierung auf die Schwerpunktthemen des KIT erwartet. Der Fokus liegt insbesondere auf dem Innovationsmanagement, Kooperations- und Geschäftsmodellen mit der Wirtschaft auch im internationalen Kontext sowie dem Fundraising. Eingeschlossen ist die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Wissens- und Technologietransfers, für die Patentund Lizenzstrategie sowie für den Innovationsprozess ebenso wie das Beziehungsmanagement mit Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf nationaler und internationaler Ebene. Die/Der Vizepräsidentin/Vizepräsident für Innovation und Internationales ist gleichermaßen verantwortlich für die erfolgreiche internationale Positionierung und Vernetzung des KIT.Sie/Er entwickelt dazu die Internationalisierungsstrategie des KIT weiter und sorgt für deren zügige Umsetzung. Ziel dabei ist es, die internationale Sichtbarkeit des KIT zu erhöhen sowie internationale Aktivitäten des KIT zu bündeln und zu stärken. Die Bestellung erfolgt für die Dauer von sechs Jahren. Eine Wiederbestellung ist möglich. Es wird eine Vergütung entsprechend der Besoldungsgruppe W3 gewährt. Der gegenwärtige Amtsinhaber wird sich wieder bewerben. Das KIT hat sich die Förderung von Frauen und der Diversität in Führungspositionen zum Ziel gesetzt. Bewerbungen von Schwerbehinderten (m/w/d) werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wenn Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum in einer einzigartigen Wissenschaftsorganisation anspricht, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis an AR-Geschaeftsstelle@kit.edu (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Geschäftsstelle Aufsichtsrat, Kaiserstraße 12, Karlsruhe). Weitere Informationen zum KIT finden Sie im Internet unter: Die Datenschutzerklärung zum Verfahren sowie die Gesetzestexte(KIT-Gesetz und Gemeinsame Satzung des KIT) finden Sie unter folgendem Link: s.kit.edu/fiko-dse KIT Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg(OTH Regensburg) ist mit mehr als Studierenden, 221 Professorinnen und Professoren sowie 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern. An der OTH Regensburg sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Professuren derbes.-gr.w2 für folgende Lehrgebiete zu besetzen: An der Fakultät Betriebswirtschaft: Betriebswirtschaft, Controlling und Business Intelligence(BI) Wir suchen Persönlichkeiten mit fundierten theoretischen Kenntnissen und mehrjähriger praktischer Erfahrung in den genannten Lehrgebieten sowie in mehreren der im Folgenden genannten Vertiefungsgebiete. Erfahrungen im operativen Controlling, insbesondere Erlös-, Kostenund Finanzcontrolling, und strategisches Controlling(idealerweise in einem Handelsunternehmen). Erfahrungen in der Durchführung von Tätigkeiten im Umfeld des internen Rechnungswesens(z. B. Product Costing, Target Costing, DynamicPricing, Kostenmanagement). Erfahrungen in Einführung und Anwendung von Corporate Performance Management(CPM) bzw. Business Intelligence(BI) Software. der Verantwortung und eigenständigen Durchführung von Data Science Projekten im Controlling. der Gestaltung der digitalen Transformation(Digitalisierung) im Controlling. Darüber hinaus wäre wünschenswert: Außerordentliches Engagement in allen Studiengängen der Fakultät Betriebswirtschaft. Disziplin-, fakultäts- und hochschulübergreifende Kooperationen in Lehre und Forschung. Bereitschaft, Lehrveranstaltungen des Grundlagenbereichs der Betriebswirtschaftslehre(insbes. des Rechnungswesens) sowie Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten. Mitarbeit beim Aufbau einescorporate Performance Management (CPM)-Labors, verbunden mit der Einwerbung von Drittmitteln. Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, mit ihrer Bewerbung eine zweiseitige Ideenskizze hierfür abzugeben. Engagement in angewandter Forschung, Technologie- und Wissenstransfer und Weiterbildung sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung der Hochschule. Wir bieten Ihnen ein interessantes Wirkungsumfeld an der drittgrößten betriebswirtschaftlichen Fakultät in Bayern. Mitarbeitan Studiengängen, die im CHE Ranking deutschlandweit Spitzenplatzierungen erzielen. hervorragende Infrastruktur. ausgezeichnete Rahmenbedingungen für angewandte Forschung und Weiterbildung. ein praxisnahes und forschungsstarkesinterdisziplinäres Umfeld und regionale Netzwerke mit innovativen Industriepartnern. An der Fakultät Maschinenbau: Produktentwicklung mechatronischer Systeme Wir sucheneine engagierte Persönlichkeit mit hervorragender und praxiserprobter Kompetenz aus dem Bereich der Entwicklung mechatronischer Systeme. Der Schwerpunkt des ausgeschriebenen Lehrgebiets liegt im Bereich der mechanischen Konstruktion sowie der Aktor- und Sensorintegration unter Anwendung moderner methodischer Verfahren. Zusätzlich sind weitere Qualifikationen z. B. aus dem Bereich der Medizintechnik wünschenswert. Die Bewerberin/ Der Bewerber soll im Berufungsgebiet theoretischegrundlagen und aktuelle fachliche Anwendungen vertreten und diese praxisnah unter Einsatz adäquater Lehrmethoden an Studierende vermitteln. Die Bereitschaft zur Übernahme von Grundlagenveranstaltungen in den Studiengängen der Fakultät,z.B.Grundlagen der Konstruktion und die Durchführung industrienaher studentischer Projektarbeiten wird vorausgesetzt. Darüber hinaus freuen Sie sich als Lehrperson mit einschlägigen Berufserfahrungen in den genannten Bereichen darauf, Ihre Fachkompetenz und Ihre beruflichen Erfahrungen in die Forschung und in die Ausbildung von Studierenden einzubringen. Wir bieten ein aktives Forschungsumfeld, in dem Sie mit Ihrer Expertise eigene Forschungsprojekte durchführen und an der Konzeption und Beantragung interdisziplinärer Projekte mitwirken können. Administrativ werden Sie dabei von unserem Institut für angewandte Forschung und Wirtschaftskooperationen(IAFW) unterstützt. Die ausführlichen Stellenausschreibungen mit den jeweiligen Einstellungsvoraussetzungen finden Sie unter: Wir weisen darauf hin, dass in der aktuellen Situation möglicherweise die gesamten Verfahren(inklusive Probelehrveranstaltungen) virtuell durchgeführt werden. Die OTH Regensburg ist mit dem TOTAL E-QUALITY-Prädikat für vorbildlich an Chancengleichheit und Diversity orientierter Personalund Hochschulpolitik ausgezeichnet, Bewerbungen von Frauen sind demzufolge ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugteingestellt. Bewerbungen in elektronischer Form(PDF-Format) mit den üblichen Unterlagen(Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) werden bis erbeten an: Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg berufungen@oth-regensburg.de An der Fakultät Nachhaltige Agrar- und Energiesysteme, Campus Weihenstephan (Freising), ist zum Wintersemester 2020/2021 oder später folgende Professur zu besetzen: PROFESSUR FÜR AGRARSYSTEME UND KLIMAWANDEL (BESOLDUNGSGRUPPE W 2) Kennziffer PF671 Lehr- und Forschungsinhalte: Die zu besetzende Professur soll wesentlich in der Forschung aktiv sein. Damit verbunden ist eine Lehrentlastung von bis zu 50 % der Regellehrverpflichtung, zunächst befristet auf 5 Jahre. Die Professur soll in der Lehre die Auswirkungen des Klimawandels auf die Agrarproduktionssysteme darlegen. Dabei sind sowohl Anpassungs- als auch Vermeidungsstrategien zu vermitteln. Einschlägige Modellansätze zur Beschreibung, Analyse und Bewertung von Agrarproduktionssystemen sind einzuführen und an Praxisbeispielen anzuwenden. In der Forschung soll sich die Professur mit einer systemorientierten Analyse von Produktionssystemen der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Erneuerbaren Energien vor dem Hintergrund des Klimawandels befassen. Ihr Ziel ist dabei, die komplexen produktionstechnischen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Komponenten der betrachteten Systeme und deren Wechselwirkungen mit dem Klimawandel zu verstehen sowie Ansätze zur Optimierung aufzuzeigen. Profil: Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in den Agrar- bzw. den Gartenbauwissenschaften oder in der Erzeugung und Nutzung Erneuerbarer Energien und weisen Forschungskompetenz in der Modellierung und Bewertung der Wechselwirkungen des Klimawandels mit landwirtschaftlichen, gartenbaulichen oder Energieproduktionssystemen nach. Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter
40 40 STELLENMARKT 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 GENERALVERWALTUNG Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine der bedeutendsten Forschungsorganisationen. Die Leitung der Abteilung Wissenschaftspolitik und Strategieprozesse der Generalverwaltung wirdvakant und ist neu zu besetzen.zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine starkepersönlichkeit als Leiter*inWissenschaftspolitik und Strategieprozesse, zugleich Leitung der Repräsentanz der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin (Kennziffer 13/20) IhreAufgabe Monitoring und Analyse dernationalen und internationalen Trends der Forschungs- und Wissenschaftsentwicklung Beratung despräsidenten und Generalsekretärs zur Strategie und wissenschaftspolitischen Diskussion Positionierung derinteressen der MPG im wissenschaftspolitischen Dialog mit derbundesregierung, den Ländern und denforschungsorganisationen Definition, Implementierung und Begleitung derstrategischen Prozesse Durchführung strategischer Projekte Planung, Koordination und Teilnahme an Gremiensitzungen Führung eines Teams vonhochqualifiziertem Personal in München und Berlin Leitung der Repräsentanz Berlin Ihr Profil basierend auf Ihrem abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulstudium verfügen Sie über umfassende Erfahrung im Wissenschaftsumfeld, idealerweise in der Wissenschaftspolitik Sie besitzen Kenntnisse in der Strategiedefinition und -implementierung und verfügen über Erfahrung in der operativen Projektsteuerung und Gremienarbeit Sie kennen die momentanen Wissenschafts- und Forschungstrends und haben ein ausgewiesenes Interesse an wissenschaftspolitischen Diskussionen Sie verfügen über Erfahrungen in der aktiven Positionierung einer Organisation im politischen Raum weiterhin sind Ihnen die Herausforderungen der Mitarbeiterführung und Teamentwicklung aus der Praxis bekannt sehr gutekommunikationsfähigkeit im Deutschen und Englischen, Gestaltungswille,Treibermentalität, Überzeugungskraft sowie diplomatisches Geschick, Souveränität undoffenheit runden Ihr Profil ab UnserAngebot eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabemit großem Gestaltungsspielraum in einer weltweit angesehenen Forschungseinrichtung ein innovatives und fortschrittliches Umfeld, dessen Kultur und Arbeitsatmosphäregeprägt sind von Raum füreigenverantwortung, Mitarbeiterzufriedenheit und Wertschätzung Für die Wahrnehmung derfunktionkönnen wir Ihnen einen unbefristeten beamtenrechtsähnlichen Dienstvertrag mit einer Vergütung entsprechend derbesoldungsordnung B(Bund) anbieten. Die Pensionszusage ist abhängig vonden persönlichen Voraussetzungen grundsätzlich möglich. attraktivesozialleistungen bzw. -vergünstigungen Ihr Arbeitsplatz liegtäußerst attraktiv in der Stadtmitte München und Berlin. In der Nähe desdienstgebäudes in München sindbetreuungsmöglichkeitenfür Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren vorhanden. Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht. Wirfreuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Haben wirihr Interesse geweckt? Dann sind wir gespannt auf Ihrevollständige Online-Bewerbung (Kennziffer 13/20)unter: Bewerbungsfrist: 13.Juli 2020 MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT zur Förderungder Wissenschaften e. V. Generalverwaltung München Abteilung Personal und Personalrecht Das Leipzig Research Centre Global Dynamics untersucht aktuelle wiehistorische Globalisierungsprozesse in verschiedenenweltregionen in mehreren interdisziplinären Forschungsverbünden. In Teilprojekten des am Zentrum angesiedelte Forschungsinstituts GesellschaftlicherZusammenhaltsowie dessfb1199 Verräumlichungsprozesse unterglobalisierungsbedingungen sindzum nächstmöglichen Zeitpunkt folgendestellen zu besetzen: 5Wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d) (65% einer Vollbeschäftigung, befristet bis zum bzw ) Entgeltgruppe13TV-L Wir erwarten Bewerbungen von Nachwuchswissenschaftlern*innen mit Abschluss in regional-, kultur-, sozial-, politik- und geschichtswissenschaftlichen Fächern und mit derbereitschaft zur Zusammenarbeit in einem Forschungsverbund. Thematische und methodische Anforderungen zu den Teilprojekten sowie den jeweiligen Einstellungsvoraussetzungen und Aufgaben finden Sieauf: Die Universität Leipzig strebt die Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht. Gefördert durch As a University of Excellence, Universität Hamburg is one of the strongest research universities in Germany. As a flagship university in the greater Hamburg region, it nurtures innovative,cooperative contacts to partners within and outside academia. It also provides and promotes sustainable education, knowledge, and knowledge exchange locally,nationally,and internationally. The Center for Data and Computing in Natural Science(CDCS) is a new scientific institution formed as apartnership between the University of Hamburg,the Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY and the Hamburg University of Technology.The CDCS is dedicated to the development and application of modern information technologies(data Science, Artificial Intelligence, Scientific Computing) to complex scientific questions.with modern organisational concepts(so-called Cross-Disciplinary Labs)a flexible structure is created, which worksintegrativebetween the scientificgroups of computer scienceand natural science. The Center for Data and Computing in Natural Sciences(MIN Faculty) which is currently being formed invites applications forseveral RESEARCH ASSOCIATEs The positions in accordance with Section 28 subsection 3 of the Hamburg higher education act(hamburgisches Hochschulgesetz, HmbHG) commenceonseptember 1, A total of 11 postdoctoral positions will be filled in the CDCS,3 of which will be in the Informatics Core Unit and 2 in each of the four thematic Cross-Disciplinary Labs. The thematic priorities of the CDLs are Astro- and Particle Physics(1), Photon Science(2), Systems Biology(3) and Control of Accelerators(4). The detailed job descriptions can be found on our website: DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM MIT ZUKUNFT. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg(DHBW) zählt mit ihren derzeit rund Studierenden(an 12 Standorten)und AM STANDORT VILLINGEN-SCHWENNINGEN IST ZUM DIE STELLE EINER*EINES zu besetzen. Die DHBW Villingen-Schwenningen wurde 1975 gegründet und bietet in den Fakultäten Wirtschaft und Sozialwesen 16 akkreditiertestudienangebote an. Diese führen die rund 2500 Studierenden zu den Abschlüssen Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Science. Von dem*der zukünftigen Stelleninhaber*in wird ein besonderes Maß an Führungsqualifikation und sozialer Kompetenz im Verhältnis zu den Studierenden, den beteiligten Unternehmen und sozialen Einrichtungen, dem haupt- und nebenberuflichen Lehrkörper sowieden Beschäftigten im nichtwissenschaftlichen Bereich erwartet. Außerdem erfordern die laufende Organisationsentwicklung sowie die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Ausrichtung der Fakultät nachgewiesene strategische Managementkompetenzen. Wünschenswert sind darüber hinaus einschlägige Kenntnisse in der Konzipierung und Umsetzung von praxisintegrierenden Studiengängen sowie Erfahrungeninder Koordination undzusammenarbeit mit Einrichtungen des Bildungsbereichs. Der*Die Prorektor*in ist Teil des Rektoratsteams und übernimmt in Abstimmung bzw.kooperation mit diesem Geschäftsbereich des Rektorats. Wünschenswert aber nicht zwingend wäre hierbei ein Engagement in den Bereichen Internationales und Lehre und Studium. In der Funktion als Dekan*in gehören die Motivation und Führung der Mitarbeiter*innen und die Zusammenarbeit mit den Professor*innen in den Studiengängen der Fakultät Wirtschaft zu den Herausforderungen. Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Kontaktpflege zu den Repräsentant*innen der Region aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft Universität Hamburg has been certified. audit family-friendly university kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen zu dengrößten Hochschulen des Landes. Professor*in (W3) als Prorektor*in und Dekan*in (w/m/d) der FakultätWirtschaft bzw. Sozialen Einrichtungen und Wissenschaft. Die Tätigkeit beinhaltet außerdem die Mitarbeit in zentralen Gremien der DHBW.Zudem ist mit der Aufgabe eine Lehrverpflichtung verbunden. Gemäß LHG kann zum*zur Prorektor*in bestellt werden, wer der Hochschule hauptberuflich als Professor*in angehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere inwissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege erwarten lässt, den Aufgaben des Amts gewachsen zusein. Die Einstellung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen im Beamtenverhältnis auf Zeit, andernfalls im befristeten Arbeitsverhältnis. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Bisherige Beamtenverhältnisse zum Land Baden-Württemberg bleiben bestehen. Die DHBW strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen an.bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Beigleicher fachlicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber*innen vorrangig berücksichtigt. Bitte bewerben Sie sich bis zum online über unser Bewerbungsportal auf der Homepage der DHBW Kennziffer 1643: InderFakultätInformatikderHochschulefürangewandteWissenschaften Kemptenisteine W2-Forschungsprofessur(m/w/d) in Vollzeit zum Wintersemester 2020/2021( ) oder später für einen Zeitraum von fünf Jahren für folgendeslehrgebiet zu besetzen: Industrial Data Science Zusammen mit einer Kollegin oder Kollegen aus der Fakultät Maschinenbau leiten Sie das neu einzurichtendetechnologietransferzentrum(ttz) für Digitale Zerspanung mit Dienstort in Kaufbeuren. Sie übernehmen die Mitverantwortung für denaufbau und Betrieb des Technologietransferzentrums. Mit Ihren Forschungsaktivitäten tragen Sie wesentlich zur Profilierung des TTZ bei und werben aktiv Drittmittel ein. Durch die Digitalisierung und Vernetzung der Produktion,das Erfassen von vielfältigen Einflussparametern und Sensordaten können Produktionsprozesse besser überwacht und optimiert werden. Für die hier ausgeschriebene Professur suchen wir eine Persönlichkeit, die fundierte Kenntnisse im Fachgebiet Data Science und praktische Erfahrungen bei der Erfassung und Analyse großer Datenmengen aus dem Bereich der industriellen Fertigung hat. Wir erwarten Bewerbungen von herausragenden Wissenschaftlern/innen(m/w/d), die großes Interesse an der Entwicklung von Methoden und Algorithmen in folgenden Bereichen haben: l Predictive Maintenance und Predictive Quality Control l IOT-basierte Infrastrukturen zur Integration heterogener Sensorsignale l Cloudbasierte Infrastrukturen zur Datenbeschaffung und-speicherung l Data Science und Data Analytics Vorausgesetzt werden tiefgehende Kenntnisse und Erfahrungen in mehreren der folgenden Gebiete: Aktuelle Industriestandards und-trends im Umfeld von Smart Factory und Industrie 4.0 Agile Entwicklung im Umfeld von aktuellen IOT Plattformen und Programmiersprachen wie Python,R,C#und Java Datenbanken und Business-Intelligence-Werkzeuge Methoden der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens Projekte im Bereich Digitalisierung, Industrie 4.0 sowie Big Data Wir erwarten hohes Interesse und kreative Ideen für die Anbahnung und Durchführung von Forschungsprojekten und die Mitwirkung bei der Lehre in Grundlagenund Vertiefungsfächern der Informatik.Idealerweise bringen Sie bereits einschlägige Erfahrung mit öffentlich geförderten und bilateralen Forschungsprojekten (Beantragung und Durchführung) mit und verfügen über gute Kontakte in der Industrie. Sie bieten Lehrveranstaltungen an und vertreten Ihr Lehrgebiet in der Weiterentwicklung unserer Präsenz- und Online-Studienangebote. Weiterhin wird eine Beteiligung an den Aktivitäten der Fakultät Informatik und an Grundlagenlehrveranstaltungen erwartet sowie die Durchführung von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache.Darüber hinaus erwarten wir eine Mitwirkung an der akademischen Selbstverantwortung der Hochschule sowie die Beteiligung am Technologie-und Wissenstransfer. Die auf fünf Jahre befristete Professur ist eine Forschungsprofessur,deren Lehrdeputat von derzeit 18 Semesterwochenstunden auf die Hälfte festgelegt ist, um das Fachgebiet angemesseninderangewandten Forschung durch die Einwerbung von Drittmittelprojekten vertreten zu können. Eine Verlängerung der Lehrdeputatsermäßigung bei erfolgreicher Evaluierung nach 2,5 Jahren über die durchgeführte forschungs- und entwicklungsbezogene Tätigkeit ist beabsichtigt. Die Beschäftigung des/r Professors/in(m/w/d) erfolgt mit privatrechtlichem Dienstvertrag. Wir erwarten Wohnsitznahme am Dienstort oder in dessen Einzugsbereich. Hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen und weiterer Einzelheiten darf auf den Internetauftritt der Hochschule verwiesen werden: Wenn Sie sich für eine Professur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen(taggenauer Lebenslauf nach Abschluss des Studiums als Nachweis für die berufliche Praxis erforderlich, Zeugnisse, Nachweise zu den beruflichen Stationen sowie den wissenschaftlichen Arbeiten) bis zum Bitte nutzen Sie hierfür unser Bewerbungsportal. Für evtl.telefonische Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Fakultät Informatik, Tel.-Nr Die Hochschule für Musik und Tanz Köln gehört zu den weltweit führenden künstlerischen Ausbildungseinrichtungen und zählt mit ihren drei Standorten in Köln,Wuppertal und Aachen zu den größten Musikhochschulen Europas. Geprägt wird die Hochschule durch über 450 Lehrende, darunter eine Vielzahl renommierter Persönlichkeiten des internationalen Musiklebens, der Wissenschaft, der Pädagogik und des Tanzes.Sie betreuen die rund Studierenden aus über 60 Ländern. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung sorgen für breite Serviceleistungen für den Lehr-und Veranstaltungsbetrieb. An der Hochschule für Musik und Tanz Köln ist die Stelle der/des Kanzlerin/Kanzlers(m/w/d) im Beamtenverhältnis auf Zeit nach Besoldungsgruppe W 3 LBesO zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Entsprechend den Regelungen des Kunsthochschulgesetzes (KunstHG) vom in der aktuellen Fassung ist die Kanzlerin/der Kanzler Mitglied des Rektorates, leitet die Hochschulverwaltung, ist Beauftragte/Beauftragter für den Haushalt und Dienstvorgesetzte*r der weiteren Mitarbeiter*innen der Hochschule. Die Amtszeit beträgt gem. 19 KunstHG 6 Jahre; die Wiederernennung mit der Möglichkeit der Entfristung ist zulässig. Bewerber*innen müssen eine abgeschlossene Hochschulausbildung (unverzichtbar: exzellentekaufmännischeundjuristischekompetenzen insbesondere bezogen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen öffentlicher Hochschulen) und eine der Aufgabenstellung angemessene Berufserfahrung nachweisen.vorausgesetzt wird für diese Position eine mehrjährige Leitungserfahrung und -verantwortung, vorzugsweise im Personal-,Rechts-oder Finanzbereich. Die Universität Siegen ist mit knapp Studierenden, ca Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Technik und Verwaltung eine innovative und interdisziplinär ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und Sozialwissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Naturund Ingenieurwissenschaften ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietetvielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bietet einen Dual Career-Service an. In der Fakultät IV Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität Siegen ist im Department Mathematik eine Juniorprofessur (W 1LBesG NRW) für Algorithmische Algebra mit Tenure-Track auf eine unbefristete W2-Universitätsprofessur zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die künftige Stelleninhaberin/Der künftige Stelleninhaber ist auf einem Gebiet der Algorithmischen Algebra herausragend ausgewiesen. Bevorzugt werden Bewerberinnen und Bewerber mit einem Forschungsbezug zur Computeralgebra und zu den Forschungsaktivitäten im Rahmen des SFB/ Transregio 195 Symbolische Werkzeuge in der Mathematik und ihre Anwendung. Zu den Aufgaben der Professur gehören die Lehre in den Bachelor-/Master-Studiengängen Mathematik und eine angemessene Beteiligung an der mathematischen Ausbildung für Studiengänge anderer Departments der Fakultät. Einstellungsvoraussetzungen für die Juniorprofessur sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung und die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die durch die Qualität einer hervorragenden Promotion im Fach Mathematik und durch Forschungsarbeiten mit internationaler Sichtbarkeit belegt ist. Erfahrung mit der erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln ist erwünscht. Die Einstellung erfolgt zunächst für 3Jahre im Beamtenverhältnis auf Zeit (bei Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen, ansonsten in ein befristetes privatrechtliches Beschäftigungsverhältnis). Bei Bewährung als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer soll die Juniorprofessur im Laufe des dritten Jahres um weitere 3 Jahre verlängert werden. Die Lehrverpflichtung beträgt zunächst 4SWS und nach der Verlängerung 5SWS. Bei der Berufung auf die Juniorprofessur wird die Berufung auf eine unbefristete W2-Universitätsprofessur unter der Voraussetzung zugesagt, dass die Tenure-Evaluationskriterien, die bei der Berufung auf die Juniorprofessur festgelegt werden, während der Juniorprofessur erfüllt sind sowie die für die Universitätsprofessur notwendige fachliche und pädagogische Eignung zum Zeitpunkt der Tenure-Evaluation gegeben ist. Die Tenure-Evaluation wird als Berufungsverfahren für die W2- Universitätsprofessur im sechsten Jahr der Juniorprofessur durchgeführt. Auf die Ausschreibung der W2-Universitätsprofessur wird verzichtet. Das Lehrdeputat beträgt dann 9SWS. Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebeten. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. Für Auskünfte steht Ihnen Herr Prof. Dr. Mohamed Barakat ( mohamed.barakat@uni-siegen.de) gerne zur Verfügung. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Forschungskonzept, Liste der Lehrveranstaltungen, Zeugniskopien) richten Sie bitte bis zum an den Dekan der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät, Universität Siegen, Siegen. Bevorzugt wird die Zusendung der Bewerbung per als PDF-Datei an bewerbungen@nt.uni-siegen.de. Informationen über die Universität Siegen finden Sie auf unserer Homepage unter: Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programmzur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm) gefördert. Die Ausschreibung richtet sich daher insbesondere an den wissenschaftlichen Nachwuchs in einer frühen Karrierephase. Die Technische Hochschule Ulm ist eine Hochschule fürangewandte Wissenschaften mit rund Studierenden.Sie bietet zukunftsweisende und praxisnahe Studienprogramme mit ausgezeichneter Betreuung. Zum oder später sind folgende Professuren der Bes.Gr. W2 zu besetzen: Ingenieurmathematik Kenn-Nr Wir begrüßen insbesonderebewerbungen von Persönlichkeiten, dieüber Erfahrungen im Bereich der Anwendungmathematischer Methoden in der Industrie verfügen. Betriebswirtschaftslehre Kenn-Nr Wir suchen eine Persönlichkeit, die fundierte Kenntnisse und praktische Fertigkeiten in demfür die Professurvorgesehenen Fachgebiet mit Schwerpunkten im Rechnungswesen und/oder Quantitativen Marketing besitzt. Leistungselektronik Kenn-Nr.: Wir suchen eine Persönlichkeit mitfundierten Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten auf demgebiet der Leistungselektronik mit Schwerpunkt auf Energiewandlersystemen für Niederspannungsnetzanwendungenmit hohen Leistungen. NähereInformationen erhalten Sie auf unserer Webseite: The University of Siegen is an innovative university with an interdisciplinary orientation, with about 20,000 students, around 1,300 scientists and 700 administrative and technical staff. With a broad range of subjects, ranging from humanities and social sciences, through economic sciences, to natural and engineering sciences, it offers an excellent teaching and research environment with a large number of inter- and transdisciplinary research projects. The University of Siegen offers diverse possibilities to reconcile career and family. Therefore, it has been certified as a familyfriendly university since 2006 and offers adual Career Service. The Faculty IV Faculty of Science and Technology of the University of Siegen in the Department of Mathematics is seeking to appoint a Junior Professor (W1 LBesG NRW) in Algorithmic Algebra with tenure track for apermanent W2 university professorship The candidate is expected to have an outstanding research profile in one of the areas of algorithmic algebra. Preferred are candidates with an activity in computer algebra within a research area related to the DFG-funded Collaborative Research Center Symbolic Tools in Mathematics and their Application. The requirements for the junior professorship are a completed university degree in mathematics (content discipline or mathematics teaching qualification), pedagogical aptitude and the special qualification for scientific work (demonstrated by the quality of a relevant doctorate to one of the research fields mentioned above). Experience in the acquisition of third-party funds are desirable. The candidate will initially be employed as a fixed-term civil servant (if the statutory civil service conditions are fulfilled, otherwise as an employee under private law) for 3years. After asuccessful probationary period, the junior professorship will be extended for a further 3 years in the course of the third year. The teaching duties are initially 4 and after the extension 5 hours a week per semester. Upon the appointment to the junior professorship, the subsequent appointment to a permanent W2 university professorship is granted on the condition that the tenure evaluation criteria (defined upon the appointment to the junior professorship) are met during the junior professorship, and that the scientific and pedagogical aptitude required for the university professorship is given atthe time of the tenure evaluation. The tenure evaluation is carried out as an appointment procedure for the W2 university professorship in the sixth year of the junior professorship. The permanent W2 professorship will not be advertised. Teaching duties thenwill be9hoursaweek persemester. The University of Siegen aspires to increase the proportion of women in research and teaching. Female scientists with the relevant qualifications are encouraged to apply. Applications from suitable candidates with severe disabilities are encouraged. In addition to the usual documents (curriculum vitae, proof of academic and professional career,list ofpublications, certificates, overview of research, teaching or practical experience, list of academic courses provided, list of third-party funded projects), please submit a two-sided concept with your research projects related to the research fields at the University of Siegen mentioned above and another one in acomparable scope with regard to the teaching concept pursued. For questions please contact Prof. Dr. Mohamed Barakat ( mohamed.barakat@uni-siegen.de). Please send your application by (using the keyword Algorithmic Algebra ) to the Dean of Faculty IV, University of Siegen, Siegen. It is preferred to send the application via asapdf file to bewerbungen@nt.uni-siegen.de. You can find information about the University of Siegen on our homepage at This professorship is funded by the TenureTrack Programme of the German Federal Government and the Federal States. This call for applications is therefore particularly targeted at early-career researchers. Vielfältige Reformen in dem Bereich der Lehre und auch der Hochschulverwaltung erfordern eine ausgeprägtesoziale Kompetenz mit einer außerordentlichen Befähigung zur Personalführung, Kommunikations- wie auch Moderationsfähigkeit mit uneingeschränkter Bereitschaft zu einer Kooperation mit den verschiedenen Gremien der Hochschule. Anwendungssichere Englischkenntnisse sind selbstverständlich. DieHfMT Köln strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. BewerbungenvonqualifiziertenFrauensinddaherausdrücklich erwünscht. Frauen werden nach Maßgabe deslandesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungenvon Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte sind willkommen und werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt. Als Termine zur persönlichen Vorstellung sind die Zeiträume September sowie September 2020 vorgesehen. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung als PDF-Datei(bevorzugt gebündelt in einem Dokument) unter Angabe der Kennung Kanzler*in bis zum per an: patricia.hessel@hfmt-koeln.de Bewerbungen in Papierform werden nicht berücksichtigt. FürFragen vorabwenden Sie sich bitte an Frau Viedenz (Tel. 0221/ ). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Am Sprachenzentrum der Universität Erfurt ist zum folgende Stelle im Umfang von 30 Wochenstunden befristet fürdiedauervon2jahrenzubesetzen: Lehrkraft für besondere Aufgaben(LfbA)für den Bereich Deutsch als Fremdsprache(m/w/d) Entgeltgruppe 13 TV-L(75%) Kennziffer 47/2020 Weitere Informationen finden Sie unter: stellenausschreibungen
41 2. J U L I DIE ZEIT No 28 STELLENMARKT 41
42 42 STELLENMARKT 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Die Universität Siegen ist mit knapp Studierenden, ca Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Technik und Verwaltung eine innovative und interdisziplinär ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und Sozialwissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bietet einen Dual Career-Service an. In der Fakultät IV Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät der Universität Siegen ist im Department Mathematik eine Juniorprofessur (W1 LBesG NRW) für Mathematikdidaktik (mit Tenure Track auf eine unbefristete W2-Universitätsprofessur) zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Von der Bewerberin bzw. dem Bewerber wird ein Forschungsprofil an Schnittstellen der Primarstufe und Sekundarstufe im Bereich der Mathematikdidaktik erwartet, welches sich an die Forschungsfelder im Bereich der Mathematikdidaktik an der Universität Siegen anschließt: - Auffassungen (Überzeugungen, Beliefs etc.) von Mathematik, die Schülerinnen und Schüler aufgrund von im Mathematikunterricht verwendeten Anschauungs- und Arbeitsmitteln erwerben, - (Wissens-)Entwicklungsprozesse im Zusammenhang der Anwendung neuer Medien im Mathematikunterricht, - Individuelle Lernprozesse immathematikunterricht. Zudem ist eine Kooperation mit dem Forschungsverbund der MINT-Didaktiken (MINTUS) und dem Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung erwünscht. In der Lehre wird von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber erwartet, Lehrveranstaltungen für das Lehramt an Grundschulen sowie auch die Lehre für das Lehramt in der Sekundarstufe I, im Bereich der Elementarmathematik und der Mathematikdidaktik abdecken zu können. Einstellungsvoraussetzungen für die Juniorprofessur sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Mathematik (Fach oder Lehramt Mathematik), pädagogische Eignung (nachgewiesen durch selbstständige Lehrerfahrung) und die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die durch die Qualität einer Promotion zu einem der oben genannten Forschungsfelder nachgewiesen wird. Erwünscht sind darüber hinaus erste wissenschaftliche Leistungen, die einen über das Gebiet der Promotion hinausgehenden Forschungsschwerpunkt belegen. Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln, insbesondere im Rahmen von Verbundanträgen sowie ein Engagement in der Weiterentwicklung von (Drittmittel-)Projekten u. a. zur engen Verzahnung mit Bildungseinrichtungen und Partnern in der Regionsind erwünscht. Die Einstellung erfolgt zunächst für 3Jahre im Beamtenverhältnis auf Zeit (bei Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen, ansonsten in ein befristetes privatrechtliches Beschäftigungsverhältnis). Bei Bewährung als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer soll die Juniorprofessur im Laufe des dritten Jahres um weitere 3 Jahre verlängert werden. Die Lehrverpflichtung beträgt zunächst 4SWS und nach der Verlängerung 5SWS. Bei der Berufung auf die Juniorprofessur wird die Berufung auf eine unbefristete W2-Universitätsprofessur unter der Voraussetzung zugesagt, dass die Tenure-Evaluationskriterien, die bei der Berufung auf die Juniorprofessur festgelegt werden, während der Juniorprofessur erfüllt sind sowie die für die Universitätsprofessur notwendige fachliche und pädagogische Eignung zum Zeitpunkt der Tenure-Evaluation gegeben ist. Die Tenure-Evaluation wird als Berufungsverfahren für die W2- Universitätsprofessur im sechsten Jahr der Juniorprofessur durchgeführt. Auf die Ausschreibung der W2-Universitätsprofessur wird verzichtet. Das Lehrdeputat beträgt dann 9SWS. Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebeten. Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht. Für Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Ingo Witzke ( witzke@mathematik.uni-siegen.de) zur Verfügung. Neben den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Nachweis über den wissenschaftlichen und beruflichen Werdegang, Publikationsliste, Zeugnisse, Übersicht über Forschungs-, Unterrichts- oder Praxiserfahrungen, Liste der erbrachten akademischen Lehrveranstaltungen, Verzeichnis der Drittmittelprojekte) reichen Sie bitte mit Ihrer Bewerbung ein zweiseitiges Konzept zu beabsichtigten Forschungsprojekten mit Bezug zu den oben erwähnten Forschungsfeldern an der Universität Siegen sowie eines in vergleichbaremumfang, hinsichtlich des verfolgten Lehrkonzeptes, ein. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum (Stichwort: Mathematikdidaktik) an den Dekan der Fakultät IV, Universität Siegen, Siegen. Bevorzugt wird die Zusendung der Bewerbung per als PDF-Datei an bewerbungen@nt.uni-siegen.de. Informationen überdie Universität Siegen finden Sie auf unsererhomepage unter DieseTenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm) gefördert. Die Ausschreibung richtet sich daher insbesondere an den wissenschaftlichen Nachwuchs ineiner frühen Karrierephase. An der Fakultät für Physik und Astronomie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine PROFESSUR (W3) FÜR EXPERIMENTALPHYSIK zu besetzen. Gesucht wird eine international herausragend ausgewiesene Persönlichkeit, die auf einem aktuellen Gebiet des Molecular Systems Engineering forscht. Insbesondere soll die Physik der Wechselwirkung nano- und mikroskaliger Systeme mit ihrer Umgebung untersucht werden sowie ihre Herstellung und Charakterisierung mit Methoden der Physik und der Materialwissenschaften. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf Anwendungen liegen, z.b. für Sensorik und Aktuation. Die Entwicklung neuer experimenteller Techniken oder Instrumente wird als unumgänglich angesehen. Der Aufgabenbereich dieser Professur umfasst weiterhin die Vertretung der Fächer Experimentalphysik und Molecular Systems Engineering in ihrer vollen Breite in der Lehre sowie die Wahrnehmung von Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung. Die Mitarbeit an bestehenden und geplanten Lehr-und Forschungsverbünden wird erwartet. Ein Forschungsgebäude für das neue Institut für Molecular Systems Engineering befindet sich im Bau. Voraussetzung für die Bewerbung sind gemäß 47 Abs.1 Landeshochschulgesetz (LHG) insbesondere ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine Promotion sowie gem. 47 Abs. 2 LHG die Habilitation, die erfolgreich evaluierte Juniorprofessur oder habilitationsäquivalente Leistungen. Erfahrungen in der erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln sind erwünscht. Entsprechende Bewerbungen mit Lebenslauf, wissenschaftlichem Werdegang, Publikationsverzeichnis, Kopien von Hochschulzeugnissen, eine Kurzdarstellung der bisherigen und geplanten Forschungsaktivitäten (max. drei Seiten DIN A4), sowie eine Liste der bisherigen und geplanten Lehrveranstaltungen werden in elektronischer Form (in einem PDF) bis zum erbeten an den Dekan der Fakultät für Physik und Astronomie, Im Neuenheimer Feld 226, D Heidelberg, Germany, dekanat@physik.uni-heidelberg.de Die Universität Heidelberg strebt einen höheren Anteil von Frauen in den Bereichen, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind, an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden besonders um ihre Bewerbung gebeten. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt. Die Informationen bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 DS- GVO können unserer Homepage unter beschaeftigte/service/personal/datenschutz_personal.html entnommen werden. An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ist eine Universitätsprofessur (m/w/d) der BesGr. W3 NBesO für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Öffentliche Finanzen zum 1. April 2021 zu besetzen. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die hochrangige internationale Publikationen sowie exzellente Bewertungen in der Lehre vorweisen kann und Erfahrungen bei der Einwerbung von Drittmitteln hat. Eine Mitwirkung in einem der Forschungsschwerpunkte der Fakultät wird erwartet. Die bisherige Forschungstätigkeit sollte Steuern und institutionelle Arbeiten umfassen. Die Bereitschaft zur deutsch- und englischsprachigen Lehre im Bachelor- und Masterstudium sowie zur Mitwirkung in der Nachwuchsförderung werden vorausgesetzt. In der Lehre ist die Professur Bestandteil der Masterarea Accounting, Taxation and Public Finance. Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll ein entsprechendes Lehrprofil aufweisen. Die Aufgaben im Allgemeinen und die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG). Einzelheiten werden auf Anfrage erläutert. Den vollständigen Text der Ausschreibung und die Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter: Für Auskünfte steht Ihnen Herr Prof. Dr. Kay Blaufus (Tel.: , blaufus@steuern.uni-hannover.de) gern zur Verfügung. Bittebewerben Sie sich bis zum ausschließlich über das Berufungsportal der Leibniz Universität Hannover unter: An der KHSB ist zum Wintersemester 2021/2022 die folgende Stelle zu besetzen: Professur für Biblische Theologie (in Anlehnung an W2, Stellenumfang 100 %, Kennziffer 66) Die Professur ist in religionspädagogisch-pastoralen Kontexten verortet. Die Bewerber*innen sollen die Biblische Theologie im Bachelorstudiengang Religionspädagogik in Schule und pastoralen Räumen an der KHSB vertreten. Die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in allen anderen Studiengängen der Hochschule anzubieten und am Theorie-Praxis-Transfer mitzuwirken, wird vorausgesetzt. Erwartet wird die Bereitschaft zur Mitwirkung im Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Lehrkräftebildung. Fachbezogene Kenntnisse im Bereich Gender und Diversity sind erwünscht. Von den Bewerber*innen werden insbesondere vertiefte Kenntnisse in den folgenden Bereichen erwartet: Exegese des Alten und Neuen Testaments; geschichtliche Situation und Umwelt der biblischen Texte; biblisch ausgerichtete pastorale Handlungsmodelle bzw.bibelpastorale Arbeit; religionspädagogisch-pastorale Entwicklungen und Konzepte, u. a. im Bereich der frühkindlichen und schulischen Bildung und Erziehung; Sprachfähigkeit in religionspluralen Settings und Diskursfähigkeit mit agnostischen und atheistischen Positionen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist außerdem die folgende Stelle zu besetzen: Professur für Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkt gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit (in Anlehnung an W2, Stellenumfang 100 %, Kennziffer 67) Die Bewerber*innen sollen Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit mit Bezug auf Gesundheit vertreten. Die Bereitschaft, in interdisziplinärer Zusammenarbeit Lehrveranstaltungen in allen Studiengängen der Hochschule anzubieten und am Theorie-Praxis-Transfer mitzuwirken, wird vorausgesetzt. Fachbezogene Kenntnisse imbereich Gender und Diversity sind erwünscht. Von den Bewerber*innen werden insbesondere vertiefte Kenntnisse in den folgenden Bereichen erwartet: Theorie- und Methodendiskurse der Sozialen Arbeit; Soziale Arbeit als Profession und Disziplin; Professionalisierung Sozialer Arbeit in gesundheitsorientierten Handlungsfeldern; Handlungs- und Forschungskonzepte der gesundheitsorientierten Sozialen Arbeit; Klinische Sozialarbeit als Fachsozialarbeit. Die ausführlichen Ausschreibungstexte finden Sie unter: Die Universität Siegen ist mit knapp Studierenden, ca Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Technik und Verwaltung eine innovative und interdisziplinär ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und Sozialwissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Sie ist deswegenseit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bietet einen Dual Career Service an. In der Fakultät II (Bildung Architektur Künste) der Universität Siegen ist im Department Erziehungswissenschaft Psychologie eine Universitätsprofessur (Bes.-Gr.W2LBesG NRW) fürerziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Didaktik des Sachunterrichts zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Stelleninhaberin/DerStelleninhaber soll den Lernbereich Sachunterrichtund seine Didaktik in seiner ganzen Breite in Forschung und Lehre vertreten. In diesem Rahmen soll einer der folgenden Forschungsschwerpunkte nachgewiesen werden: Unterrichtsentwicklung im Sachunterricht, Nachhaltige Entwicklung, oder ein perspektivbezogener Themenbereich des Sachunterrichts. Die Aufgaben in der Lehre beziehen sich auf den Lernbereich Sachunterricht und seine Didaktik. Die federführende Kooperation mit den Bezugsdisziplinen in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften ist Bestandteil des Aufgabenprofils. Darüber hinaus soll die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber einschlägige Erfahrungen mit der interdisziplinären und curricularen Weiterentwicklung des Lernbereichs Sachunterricht und seine Didaktik mitbringen. Die Bereitschaft zur Kooperation in den Forschungsschwerpunkten der Fakultät II und der Bildungsforschung des ZLB wird vorausgesetzt. Schulpraxis und Erfahrungen mit der Einwerbung von Drittmitteln sind erwünscht. Die Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesenwird, zusätzliche wissenschaft liche Leistungen, die ausschließlich und umfassend im Berufungsverfahren bewertet werden sowie Lehrerfahrung und der Nachweis didaktischer Kompetenz. Zusätzliche wissenschaftliche Leistungen werden im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen einer sonstigen wissenschaftlichen Tätigkeit erbracht. Die Bereitschaft zur aktiven und konstruktiven Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien der Universität wird vorausgesetzt. Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten. Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht. Für Fragen steht Ihnen Frau Universitätsprofessorin Dr.Jutta Wiesemannzur Verfügung. wiesemann@erz-wiss.uni-siegen.de Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen(Lebenslauf, Publikationsliste, Zeugnisse,Übersicht über praktische und forschende Tätigkeiten) richten Sie bitte bis zum an den Dekan der Fakultät II, Universität Siegen, Siegen. Alternativ können Sie Ihre Bewerbung auch in einer PDF-Datei per an dekanat@bak.uni-siegen.de senden (eine PDF-Datei, max. 5MB) Informationen über die Universität Siegen finden Sie auf unserer Homepage Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften Institut für Philosophie Juniorprofessur für Praktische Philosophie Besoldungsgruppe: W1mit Tenure Track W3 Kennung: W1PraktPhil Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses(Tenure-Track-Programm) gefördert. Daher werden insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,die sich im Anschluss an die Promotion in einer frühen Karrierephase befinden, aufgefordert sich zu bewerben. Aufgabengebiet: Forschung und Lehre im Fach Praktische Philosophie mit Schwerpunkten in Moralphilosophie und politischer Philosopie Einstellungsvoraussetzungen: gem. 102 a BerlHG Den ausführlichenausschreibungstext finden Sie ab dem unter beruf-karriere/jobs unter der angegebenen Kennung. An der Katholischen Hochschule Mainz, Hochschule für Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften, Praktische Theologie sowie Gesundheit und Pflege, Catholic University of Applied Sciences Mainz, sind im Fachbereich Gesundheit und Pflege zum nächstmöglichen Zeitpunkt (voraussichtlich ab ) folgende Stellen zu besetzen: wissenschaftliche Mitarbeiter/innen(m/w/d) für die Umsetzungeines Innovationsfondsprojektes zum Einsatz von Advanced Practice Nurses in der hausarztnahen Versorgung (1,5 VK) wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) für Informatik, Datenmanagement und statistische Datenauswertung im o.g. Projekt (1,0 VK) (jeweils involl- oder Teilzeit, befristet bis ) Nähere Informationen unter: Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum an den Rektor der Katholischen Hochschule Mainz Herrn Prof. Dr. Martin Klose rektorat@kh-mz.de In der Fakultät I Bildungs- und Sozialwissenschaften ist am Institut für Sonderund Rehabilitationspädagogikzum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet die Stelleeiner Lehrkraft fürbesondereaufgaben (Entgeltgruppe 13 TV-L, Stichwort LfbA_KmE) in den FachgruppenPädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen der körperlich-motorischen Entwicklung sowie chronischen und progredienten Erkrankungen im Umfang von 50% der regelmäßigenarbeitszeit(zzt. 19,9 Std. wöchentlich) zu besetzen. Die Stelle soll Lehre inder Pädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen der körperlich-motorischen Entwicklung sowie chronischen und progredientenerkrankungen beinhalten. Zu den Aufgaben der Stelle gehören: die Durchführung von Lehrveranstaltungen in den von der Fachgruppe verantworteten Modulen im Umfang von8 LVS Mitwirkung bei der Planung und Anpassung von Curricula, Modulbeschreibungen und Prüfungsordnungen die Betreuung von Studierenden und Tutorien, Abnahme von Qualifikationsarbeiten, Planung und Weiterentwicklung des Studienangebotes Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung Einstellungsvoraussetzungen sind: ein überdurchschnittlich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Staatsexamen, Diplom, Master of Education oder Master of Arts bzw. Masterof Science) für das Lehramt für Sonderpädagogik oder in Sonder-und Rehabilitationspädagogik oder einem inhaltlich vergleichbaren Fach und eine dem Studium entsprechende Lehrerfahrung eine Promotion zu einem für die Sonder-und Rehabilitationspädagogik einschlägigen Themenbereich praktische Erfahrungen als Sonderpädagogische Lehrkraft, vorzugsweise im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklungen Erfahrungen in der Hochschullehre, vorzugsweise in Praktikumsmodulen und/ oder Lehrveranstaltungen mit dem Schwerpunkt Didaktik Erwartet werden zudem eine ergebnisorientierte Arbeitsweise,die Fähigkeit zur Arbeit in interdisziplinären Teams und zur Kooperation mit Forschungspartner*innen, eineausgeprägteorganisationskompetenz, die Fähigkeit zum wissenschaftlich-methodischen Handeln und ein sehr gutes schriftliches Ausdrucksvermögen. Geboten werden die Einbindung in ein dynamisches Hochschulteam, Möglichkeiten zur individuellen Weiterbildung und vielfältige Möglichkeiten zur Beteiligung an Lehr-und Forschungsprojekten. Die Carl von OssietzkyUniversitätOldenburg strebt an, den Frauenanteil im Wissenschaftsbereich zu erhöhen. Deshalb werden Frauen nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Gem. 21 Abs. 3 NHG sollen Bewerberinnen bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden. Schwerbehinderte Menschenwerden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Schriftliche Bewerbungen mit Ihrenvollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,Publikationen, Listemit Lehrveranstaltungenund Forschungsprojekten, Zeugniskopien) werden bevorzugt in elektronischer Form, alternativin postalischer Form unter Angabe desstichwortes bis zum erbeten an die Carl vonossietzky Universität Oldenburg, Fakultät I Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik, z. H. der Institutsdirektorin Frau Prof. Dr. Ute Koglin, Oldenburg, sonderpaedagogik@uni-oldenburg.de.per Post eingereichte Bewerbungsunterlagen können leider nicht zurückgesandt werden.bitte senden Sie daher keine Mappen oder Originale zu. The University of Siegen is an innovative university with an interdisciplinary orientation, with about 20,000 students, around 1,300 scientists and 700 administrative and technical staff. With a broad range of subjects, ranging from humanities and social sciences, through economic sciences, to natural and engineering sciences, it offers an excellent teaching and research environment with a large number of inter- and transdisciplinary research projects. The University of Siegen offers diverse possibilities to reconcile career and family. Therefore, it has been certified as a familyfriendly university since 2006 and offers adual Career Service. The Faculty IV Faculty of Science and Technology of the University of Siegen in the Department of Mathematics is seeking to appoint a Junior Professor (W1 LBesG NRW) in Mathematics Education with tenure track for apermanent W2university professorship as soon as possible. It is expected from the candidate to have aresearch profile focusingonintersections in the field of primary and lower secondary mathematics education. She or he is supposed to meet the research directions in the field of mathematics education at the University of Siegen: - Conceptual insights (beliefs, etc.) of mathematical contents that pupils acquire while dealing with different visual materials and manipulatives in mathematics classes, - Knowledge development processes in connection with the use of digital media in mathematics classes, - Individual learning processes in mathematics classes. Moreover, a cooperation with the research association of MINT didactics (MINTUS) and the center for teacher training and educational research (ZLB) is desired. Furthermore, the successful candidate is expected to be able to run university courses on elementary mathematics and didactics of mathematics for prospective primary school and lower secondary school teachers. The requirements for the junior professorship are a university degree in mathematics (content discipline or mathematics teaching qualification), pedagogical aptitude (proven by independent teaching experience) and the special qualification for scientific work, which is proven by the quality of a relevant doctorate to one of the research fields mentioned above. Initial academic achievements that demonstrate a research focus beyond the field of doctoral studies are also desired. Experience in the acquisition of third-party funds, especially in the context of joint applications, as well as a commitment in the further development of (third-party funded) projects, as well as the cooperation with educational institutions and partners in the region are desirable. The candidate will initially be employed as a fixed-term civil servant (if the statutory civil service conditions are fulfilled, otherwise as an employee under private law) for 3 years. After a successful probationary period, the junior professorship will be extended for a further 3 years in the course of the third year. The teaching duties are initially 4and after the extension 5hours aweek per semester. Upon the appointment to the junior professorship, the subsequent appointment to a permanent W2 university professorship is granted on the condition that the tenure evaluation criteria (defined upon the appointment to the junior professorship) are met during the junior professorship, and that the scientific and pedagogical aptitude required for the university professorship is given at the time of the tenure evaluation. The tenure evaluation is carried out as an appointment procedure for the W2 university professorship in the sixth year of the junior professorship. The permanent W2 professorship will not be advertised. Teaching duties then will be 9hours aweek per semester. The University of Siegen aspires to increase the proportion of women in research and teaching. Female scientists with the relevant qualificationsare encouraged to apply. Applications from suitable candidates with severe disabilities are encouraged. In addition to the usual documents (curriculum vitae, proof of academic and professional career, list of publications, certificates, overview of research, teaching or practical experience, list of academic courses provided, list of third-party funded projects), please submit a two-sided concept with your research projects related to the research fields at the University of Siegen mentioned above and another one in acomparable scope with regard to the teaching concept pursued. For questions please contactprof. Dr.Ingo Witzke ( witzke@mathematik.uni-siegen.de) Please send your application by (using the keyword Mathematics Education ) to the Dean of Faculty IV, University of Siegen, Siegen. It is preferred to send the application via as apdf file to bewerbungen@nt.uni-siegen.de. You can find information about the University of Siegen on our homepage at This professorship is funded by the Tenure Track Programme of the German Federal Government and the Federal States. This call for applications is therefore particularly targeted at early-career researchers. Das Institut für Chemie neuer Materialien der Universität Osnabrück sucht in der Abteilung Organische Materialchemie zum nächstmöglichenzeitpunkteine*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in(m/w/d) (Entgeltgruppe 14 TV-L, 100 %) zur unbefristeten Besetzung. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum an Herrn Prof. Dr. Uwe Beginn,Institut für Chemie neuer Materialien, Barbarastraße 7, D Osnabrück. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Weitere Informationen finden Sie unter: Forschen und Studieren mit Perspektive Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und forschungsorientierte Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profillinien in Forschung und Lehre. Gemeinsam stellen sich hier mehr als Forschende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie,Technik, Natur und Umwelt. In der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften ist in der Fachgruppe Musikpädagogik zum eine W 2-Universitätsprofessur für Musikwissenschaft zu besetzen. Bes.-Gruppe: W 2 LBesG NRW(gem. 36 HG NRW) Erwartungen: Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das Fach Musikwissenschaft mit historischen und systematischen Anteilen in Forschung und Lehre entsprechend der Grundausrichtung der Fachgruppe auf die Lehrer*innenbildung vertritt. Ein Schwerpunkt der Professur ist dabei auf den Bereich der Populären Musik und digitalen Medienkultur festgelegt, ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Musik des 20./21. Jahrhunderts oder einem Feld, welches die entsprechenden Forschungsaktivitäten der Fachgruppe in geeigneter Weise ergänzt. Erwünscht ist die Anschlussfähigkeit zu den Arbeitsfeldern anderer Professuren der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften. Ebenso wäre ein Engagement in den Forschungseinrichtungen des Zentrums für Erzählforschung (ZEF) oder auch des Interdisziplinären Zentrums für Editions- und Dokumentwissenschaft (IZED) begrüßenswert. Insbesondere: -ein abgeschlossenes Universitätsstudium (mindestens Magister*Magistra, Master of Art oder gleichwertig) in einem dem Lehr- und Forschungsgebiet entsprechenden Fach und -Promotion in Musikwissenschaft -einschlägige Forschungs-und Publikationstätigkeiten -Erfahrung in der Einwerbung von/mitwirkung an Forschungsprojekten -internationale Orientierung Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird als selbstverständlich erachtet. Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern als eine wichtige Aufgabe, an deren Umsetzung die Professur mitwirkt. Der vollständige Ausschreibungstext einschließlich der Einstellungsvoraussetzungen ist unter zu finden. Kennziffer: P20007 Forschen und Studieren mit Perspektive Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und forschungsorientierte Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profillinien in Forschung undlehre. Gemeinsam stellen sich hier mehr als Forschende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und Umwelt. In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft-Schumpeter School of Business and Economics ist zum eine Juniorprofessur mit Tenure Track nach W2 für Sustainability Management zu besetzen. Bes.-Gruppe: W1 LBesG NRW(gem. 36 HG NRW) DieseTenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses(Tenure-Track-Programm) gefördert. Die Professur dient dazu, Forschung und Lehre im Kompetenzfeld Sustainability Management der Schumpeter School of Business and Economics zu stärken und weiterzuentwickeln. Gesucht wird ein*e exzellente*r Wissenschaftler*in in einer frühen Phase der akademischen Karriere, der*die sich mit Fragestellungen derunternehmerischennachhaltigkeitauseinerquantitativenoderqualitativenbetriebswirtschaftlichen Perspektve beschäftigt. Erwartet werden einschlägige Forschungsund Publikationstätigkeiten, erste Erfahrungen bei der Einwerbung von und Mitwirkung an Forschungsprojekten sowie eine internationale Orientierung. Die Bereitschaft zur interdisziplinären Forschungskooperation, zum Aufbau und zur Pflege von Wissenschafts-Praxis-Netzwerken, zur Drittmitteleinwerbung und zur Beteiligung am Wissenschaftstransfer wird vorausgesetzt. Von dem*der zukünftigen Stelleninhaber*in wird erwartet, dass er*sie Lehrveranstaltungen insbesondere im Pflicht- und Wahlpflichtbereich des Master- Studiengangs Sustainability Management anbietet. Darüber hinaus sollen die Lehrveranstaltungen auch als ergänzende betriebswirtschaftliche Lehrinhalte für die übrigen Master-Studiengänge der Fakultät sowie für die in Kooperation mit den ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der Universität angebotenen Wirtschaftsingenieur-Masterstudiengängen geeignet sein. Erwartet werden weiterhin eine Offenheit gegenüber modernen Lehrmethoden unddiefähigkeit, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten. Weiterhin wird die Übernahme von Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung vorausgesetzt. DervollständigeAusschreibungstext einschließlich der Einstellungsvoraussetzungen ist unter zu finden. Kennziffer:P19014 Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und Verzeichnis der Lehrerfahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das Onlineportal der Bergischen Universität Wuppertal: Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden! Ansprechpartner für Ihr Anschreiben ist Herr Univ.-Prof. Dr. Nils Crasselt. Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRWbevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt. Bewerbungsfrist: Otto-Friedrich-Universität Bamberg Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und Verzeichnis der Lehrerfahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das Onlineportal der Bergischen Universität Wuppertal: uni-wuppertal.de. Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden! Ansprechpartnerin für Ihr Anschreiben ist die Dekanin der Fakultät für Geistesund Kulturwissenschaften, Frau Univ.-Prof. Dr. Ursula Kocher. Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt. Bewerbungsfrist: STELLENAUSSCHREIBUNG FAKULTÄT WIRTSCHAFTSINFORMATIK UND ANGEWANDTE INFORMATIK PROFESSUR (W 3) für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Entwicklung von Informationssystemen PROFESSUR (W 3) für Praktische Informatik, insbesondere Systemnahe Programmierung PROFESSUR (W 3) für Informationsvisualisierung Bewerbungsende: jeweils am Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter: Otto-Friedrich-Universität Bamberg Bamberg
43 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 STELLENMARKT 43 An der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Schmalkalden sind zum Wintersemester 2021/2022 folgende Professuren(Vollzeit) zu besetzen: W2-Professur für Wirtschaftspsychologie Kennziffer SW 69 Für die Professur werden qualifizierte Bewerber/innen mit vertieften Kenntnissen im Bereich der Wirtschaftspsychologie, idealerweise in den Teilgebieten der Marketing-, Arbeits- oder Organisationspsychologie gesucht. Weitere Informationen zur Professur,zu den Einstellungsvoraussetzungen gemäß 84ThürHG, zum Datenschutz, zur Gleichstellung sowie Hinweise für Schwerbehinderte finden Sie unter: W2-Professur für Corporate and Behavioural Finance Kennziffer SW 70 Für die Professur werden qualifizierte Bewerber/innen mit vertieften Kenntnissen im Bereich des Ausschreibungsgebietes gesucht. Weitere Informationen zur Professur,zu den Einstellungsvoraussetzungen gemäß 84ThürHG, zum Datenschutz, zur Gleichstellung sowie Hinweise für Schwerbehinderte finden Sie unter: IhreBewerbungrichtenSiebitteunterAngabederKennzifferbiszum 31. Juli 2020 per an personal@hs-schmalkalden.de oder schriftlich an folgendeadresse: Hochschule Schmalkalden University ofapplied Sciences Der Präsident Blechhammer Schmalkalden An der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Universität Weimar ist die Professur (W3)»Geschichte und Theorie der Visuellen Kommunikation«zu besetzen. Die Bauhaus-Universität Weimar ist eine international etablierte Universität, die auf eine 160-jährige Geschichte zurückblickt und sich in der Tradition des Bauhauses versteht. Die Professur»Geschichte und Theorie der Visuellen Kommunikation«ist den wissenschaftlichen Lehrgebieten der Fakultät Kunst und Gestaltung zugeordnet. Sie vermittelt geschichtliche und theoretische Grundlagen, methodische Kenntnisse und fachspezifisches Wissen der visuellen Kommunikation und darüber hinaus. Gleichzeitig nimmt sie Prozesse der Konzeption, Produktion und Vernetzung von Zeichen- und Wissenswelten in der globalen und zunehmend digitalen Medienkultur in den Blick. Die Professur erarbeitet hierzu einschlägige Beiträge zu einer kulturwissenschaftlichen Grundierung der visuellen Kommunikation, die sowohl übergeordnete Theoriekonzepte, methodische Zugänge, soziohistorische Verortungen als auch die jeweilige Empirie der Alltagspraktik berücksichtigt. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die neben einem abgeschlossenen einschlägigen Hochschulstudium durch eine qualifizierte Promotion sowie durch eine Habilitation, eine Juniorprofessur oder sonstige zusätzliche wissenschaftliche (habilitationsadäquate) Leistungen ausgewiesen ist, über entsprechende pädagogische Eignung und universitäre Lehrerfahrung im Fachgebiet verfügt sowie Erfolge in der Drittmittelakquise und der Leitung von Forschungsprojekten nachweisen kann. Die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache durchzuführen, wird genauso erwartet wie die Mitwirkung inder universitären Selbstverwaltung. Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen sind im 84Thüringer Hochschulgesetz geregelt. Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen und einer Besetzung der Stelle in Vollzeit erfolgt die Einstellung inein Beamtenverhältnis. Die Bauhaus-Universität Weimar verfolgt eine gleichstellungsfördernde, familienfreundliche Personalpolitik. Zu den strategischen Zielen der Universität gehört, den Frauenanteil in Lehre und Forschung zu erhöhen. Die Bauhaus-Universität Weimar bittet daher qualifizierte Wissenschaftlerinnenausdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Weitere Informationen zur Bauhaus-Universität Weimar sowie die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter: bzw. Bewerbungen werden unter Angabe der Kennziffer bis zum 31. August 2020 an die in der ausführlichen Ausschreibung im Internet genannte Adresse erbeten. Bei der Technischen Universität Berlin ist folgende Stelle zu besetzen: Studiendirektor*in(d/m/w) Leitung eines Studienkollegs für ausländische Studierende der TU Berlin BesGr.A15 bzw.entgeltgruppe E15 TV-L Berliner Hochschulen Teilzeitbeschäftigung ist ggf.möglich. Die Einstellung erfolgt abhängig von den persönlichen Voraussetzungen im Beamtenverhältnis oder als Tarifbeschäftigte*r. Internationales Studienkolleg Kennziffer: ZUV-90/20(besetzbarab /unbefristet/Bewerbungsfristende ) Aufgabenbeschreibung:Leitung des Referats INT SK Studienkolleg der TU Berlin Die*der Leiter*in des Studienkollegs ist verantwortlich für die dienstrechtliche Leitung des Studienkollegs und die konzeptionelle Weiterentwicklung im Kontext neuer Entwicklungen (Ausweitung derstudienvorbereitung im Ausland, Digitalisierung derlehre). Die Stelle umfasst Personalverantwortung für 9 hauptamtliche Mitarbeiter*innen und 25 Dozent*innen sowie eineverwaltungsfachkraft. ErwarteteQualifikationen: Erfüllung der beamten- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen, Laufbahnbefähigung für das Amt des Studienrates/der Studienrätin(2. Staatsexamen) erfolgreich abgeschlossenes Lehramtsstudium oder vergleichbare Qualifikation Derausführliche Ausschreibungstext ist im Internet abrufbar unter: REICHWEITENSIEGER Platz für Bewerber*innen Ihre Ausschreibung in Deutschlands reichweitenstärkster Qualitätszeitung erscheint parallel mit wöchentlich Visits auf jobs.zeit.de und academics. Quellen: AWA 2019 / Webtrekk, wöchentlicher Durchschnitt 2. Halbjahr Die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf genießt einen internationalen Ruf. Rund 850 Studierende aus mehr als 40 Nationen werden in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ausgebildet. 45 haupt- und nebenberufliche Professorinnen und Professoren und mehr als 200 Lehrbeauftragte sorgen für einen individuellen Unterricht auf höchstem Niveau. Zum Sommersemester 2021 ist an der Robert Schumann Hochschule eine Professur fürgesang (W2) unbefristetzubesetzen. Der Stelleninhaber(m/w/d) vertritt das Fach Gesang in der künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Ausbildung. In diesem Sinne suchen wir eine Persönlichkeit, die über reiche Erfahrungen auf dem Podium ebenso verfügt wie über pädagogische Erfahrungen aufgrund vorausgegangenerlehrtätigkeiten. Darüber hinaus erwartet die Hochschule die Bereitschaft, sich im Bereich der Selbstverwaltung der Hochschule zu engagieren. Auf dieeinstellungsvoraussetzungen aus 29 Abs.1Kunsthochschulgesetz wirdverwiesen.zur Feststellung der pädagogischen Eignung erfolgt die Einstellung zunächst in einem Beamtenverhältnis auf Probe bzw.in einem vorerst befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis, sollten die Voraussetzungen für eine Verbeamtung nicht gegeben sein. Die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf fördert Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und tritt für Geschlechtergerechtigkeit und personelle Vielfalt ein. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.sie versteht sich zudem als familienfreundliche Hochschule und fördert Maßnahmen zurbesseren Vereinbarkeitvon Berufund Familie. Die Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf,Darstellung des künstlerischen Werdegangs, Überblick über die bisherigen künstlerischen Leistungen, Verzeichnis der Lehrtätigkeit, Kopien der Zeugnisse sind bis zum zu richten an: Rektorat der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, Fischerstr.110,40476 Düsseldorf. Es wird gebeten, auf die Übersendung von Tonträgern, DVD o. ä. zu verzichten. Von Bewerbungen in elektronischer Form bitten wir abzusehen. Wir bitten um Vorlage von Kopien,weil aus Kostengründen die Unterlagen nicht zurückgesandt werden. Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung Ihrer Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO) und des Landesdatenschutzgesetzes zu. Otto-Friedrich-UniversitätBamberg STELLENAUSSCHREIBUNG FAKULTÄT GEISTES- UND KULTURWISSENSCHAFTEN JUNIORPROFESSUR(W 1) für Philosophie PROFESSUR (W 3) für Evangelische Theologie/Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts Bewerbungsende: jeweils am Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter: Otto-Friedrich-Universität Bamberg Bamberg An der Sportwissenschaftlichen Fakultät ist zum 1.März 2021 folgende Professur zu besetzen: W3-Professur Sportmedizin Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit international ausgewiesener Forschungsleistung, die das Fach Sportmedizin in seiner ganzen Breite sowohl in Forschung und Lehre als auch in der praktischen Umsetzung vertritt.die/der zu Berufende ist für die sportmedizinische Lehre im Studiengang Sportwissenschaft (Lehramt-,Bachelorund Masterabschlüsse) zuständig. Bewerber/-innen müssen habilitiert oder gleichwertig wissenschaftlich ausgewiesen sein.eine abgeschlossene Facharztausbildung wird vorausgesetzt,die Zusatzbezeichnung Sportmedizin (oder ein internationales Äquivalent) ist obligat. Ein besonderes Engagement in Forschung, Lehre und Weiterbildung wird vorausgesetzt. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Sportwissenschaftlichen Fakultät sowie außerhalb der Fakultät vor allem mit der Medizinischen Fakultät wird erwartet.ein Schwerpunkt in der internistisch-leistungsphysiologischen Sportmedizin sollte vorliegen. Der/Die Bewerber/-in sollte in der Lage sein, sich gewinnbringend in die Forschungsprofilbereiche der Universität Leipzig einzubringen. An der Juristenfakultät ist zum 1. April 2021 folgende Professur zu besetzen: W3-Professur Bürgerliches Recht und Internationales Privatrecht (Nachfolge: Prof. Dr. Thomas Rauscher) Der/Die Stelleninhaber/-in hat das Bürgerliche Recht in seiner ganzen Breite sowie das Internationale Privatrecht in Forschung und Lehre zu vertreten. Bewerber/-innen sollten möglichst einen Forschungsschwerpunkt im Bereich des Familienrechts und/ oder europäisches und internationales Zivilprozessrecht aufweisen. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die ihre Forschungstätigkeit in den genannten Rechtsgebieten durch entsprechende Veröffentlichungen nachweisen kann. Erwartet wird die Bereitschaft zur Einwerbung von Drittmitteln und zur Entwicklung weiterer lehrstuhlübergreifender auch interdisziplinärer Forschungsprojekte. In der Lehre sollten die Bewerber/-innen bereit sein,an der Entwicklung eines englischsprachigen LL.M.- Programmsmitzuwirken Dieausführlichen Stellenbeschreibungen mit weiteren Informationen zu den Erwartungen an den/die zukünftige/-n Stelleninhaber/-in, die persönlichen Voraussetzungen eines/einererfolgreichen Bewerbers/Bewerberin sowie rechtlichegrundlagen für die Berufung,einzureichende Unterlagen und Ausführungen zum Datenschutz finden Sie unter: In der Fakultät Business Science und Management am Standort Sigmaringen ist folgende Professorenstelle zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu besetzen: W2-Professur Digitalisierung und Smart Energy Wir suchen Persönlichkeiten mit berufspraktischen Erfahrungen in der digitalen Transformation von Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen, vorzugsweise in der Energiewirtschaft.Einschlägige berufspraktische Erfahrungen bei der Konzeption, dem Design oder der Anwendung moderner Informationstechnologien, wie z. B. Big Data, Internet of Things und Künstliche Intelligenz, oder im Bereich smarter Technologien sind erforderlich. Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage oder direkt unter: Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung in unserem Online- Bewerbungsportal unter der Kennziffer PEW 03 bis Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie Institut für Pharmazie Juniorprofessur für Immuntherapeutische Wirkstoffe Besoldungsgruppe:W1mit Tenure Track W2 Kennung: FU-BCP/W1-TT/ImmWS Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses(Tenure-Track-Programm) gefördert. Daher werden insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,die sich im Anschluss an die Promotion in einer frühen Karrierephase befinden, aufgefordert sich zu bewerben. Aufgabengebiet: Forschung und Lehre im o. g. Fach Einstellungsvoraussetzungen: gem. 102 a BerlHG Denausführlichen Ausschreibungstext finden Sie ab dem unter beruf-karriere/jobs unter der angegebenen Kennung. Am Zentrum für Islamische Theologie(ZITh) der Universität Tübingen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt(befristet auf zwei Jahre) die Stelle eines/r zu besetzen. Als innovative Hochschule bieten wir unseren Studierenden mehr als 35 Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft Technik Soziales Design. Mit 125 Professor*innen und über 400 Beschäftigten unterstützen wir die Region durch praxis- und zukunftsorientierte Lehre und Forschung sowie umfassende Transferaktivitäten. InderFakultätMaschinenbauundAutomobiltechniksindzumWintersemester2020/2021oderspätereine W2-Professur(m/w/d) für das Lehrgebiet Vehicle2X-Technologien zu besetzen. Lektors/in für Arabisch(50%, m/w/d) Zu den Aufgaben gehören die Sprachausbildung für AnfängerInnen und Fortgeschrittene im klassischen Arabisch mit Schwerpunkt auf theologischen Quellentexten sowie die Mitarbeit bei Prüfungen und sämtlichen anderenaufgaben des Bereichs der arabischen Sprachausbildung in der islamischen Theologie. Vorausgesetzt werden: l abgeschlosseneshochschulstudium(diplom,masterodereinvergleichbarerabschluss) ineinemphilologischausgerichtetenstudienfach,infremdsprachendidaktikodereinem vergleichbarenfach, l Arabischkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau, l universitäre Lehrerfahrung im Arabischen, l sehr gute Deutschkenntnisse sowie l Teamfähigkeit und interkulturelle Kommunikation. Je nach Qualifikation erfolgt die Eingruppierung bis E 13TV-L. Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. IhreBewerbungmitdenüblichenUnterlagen(Motivationsschreiben,Lebenslauf)undNachweisen über Studienabschlüsse und andere Qualifikationen, ggf. Publikationsliste, sowie den Kontaktdaten von zwei Referenzpersonen richten Sie bitte in einer PDF-Datei bis zum 23. Juli 2020 an die Geschäftsführerin des ZITh, Elisabeth Jurcic: elisabeth.jurcic@uni-tuebingen.de Bewerbungsende: Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie hier: Die Hochschule Kaiserslautern ist eine forschungsstarke Hochschule für Angewandte Wissenschaften mit fachlicher Fokussierung auf Technik, Wirtschaft, Gestaltung und Gesundheit sowie Informatik als integrierende Querschnittskompetenz. Wir bilden etwa 6200 Studierende in über 50 Studiengängen und Weiterbildungsangeboten an drei Studienorten in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken aus. Aktuell bestehen drei Forschungsschwerpunkte: Zuverlässige Software-intensiveSysteme (ZUSIS), IntegrierteMiniaturisierteSysteme (IMS) und Hocheffiziente technische Systeme (HTS). Im Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik ist am Studienort Zweibrücken die folgende Professur zum frühestmöglichen Termin unbefristet zu besetzen: W2-Professur ComputerVision und Künstliche Intelligenz Kennziffer: HS 2020/022 Wir erwarten Ihre Bewerbung einschließlich des ausgefüllten Bewerberprofils( unter Angabe der entsprechenden Kennziffer per an Für fachliche Fragen steht Ihnen der Dekan des Fachbereichs Informatik undmikrosystemtechnik, Herr Prof. Dr. Marko Baller(Marko. Baller@hs-kl.de), zur Verfügung. Weitere Informationen zu unserer Hochschule undder vakanten Stelle finden Sie unter Jetztneu! So gelingt Arbeiten zuhause Laptop aufklappenundlosgeht s Arbeitenim Homeoffice hatsich schnellzum Alltag entwickelt.dochwie siehtein Umfeld aus,das produktivesarbeitenermöglicht? Wiegelingt virtuellesteamworkund Leadership aufdistanz? SichernSiesichdenbrandaktuellenKursderZEITAkademie!Prof.Dr. NielsVanQuaquebeke erläutertalleaspekte erfolgreichervirtueller Zusammenarbeit, die durch Übungen,FallbeispieleundQuizze sofort umgesetztwerdenkönnen.»homeoffice«isteinervonüber40online-kursenderzeitakademie. Kurs»Homeoffice«mitProfessorDr.NielsVanQuaquebeke 3Lektionen 100Minuten Ab19,99 imabomonatlich Ab79 alseinzelseminar BestellenSiejetzt: 040/ JETZT GRATISLEKTION TESTEN zeitakademie.de Anbieter:ZEITAkademieGmbH,Buceriusstraße,Hamburg
44 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Ferien mit ZEIT LEO: Mit unserem Sommer-Newsletter kannst du täglich was erleben! Spiele, Rätsel, Comics und mehr kostenlos anmelden unter: 44 HIER AUSREISSEN! D I E S E I T E F Ü R K I N D E R Valentin und Carl kichern. Die Brüder sind elf und sechs Jahre alt und sitzen gerade eingekuschelt zwischen Kissen auf der Auto-Rückbank. Durch die Windschutzscheibe sehen sie auf eine Kinoleinwand.»Das ist so witzig«, sagt Valentin, während seine Hand wieder in die Tüte mit den Gummibärchen und Schokolinsen wandert. Den ganzen Tag hatten er und Carl darauf gewartet, dass der Film endlich anfängt. Denn dafür musste erst die Sonne untergehen. Doch der Reihe nach. Am Morgen erzählen wir den Brüdern, dass wir ins Autokino fahren. Ihr Vater und ich, seine Freundin, machen es uns freitag abends oft zu viert auf der Couch gemütlich. Ein Film abend im Auto ist für uns alle etwas Neues. Die Idee stammt aus den USA. Das erste Autokino hat dort vor mehr als 80 Jahren eröffnet, seit 1960 gibt es auch in Deutschland welche. Anfangs waren die Autokinos sehr beliebt, im Laufe der Zeit gingen die Menschen aber wieder lieber in die großen Kinopaläste konnte man nur noch an 18 Orten mit dem Auto ins Kino fahren. Dann kam Corona, und weil viele Kinos schließen mussten, eröffneten überall im Land vorübergehend Hunderte neue Autokinos. Valentin und Carl überlegen, mit welchem Wagen man dort wohl am meisten punktet.»wir können doch einen Pick-up leihen und ganz bequem von der Ladefläche aus gucken«, sagt der sechsjährige Carl. Er schließt die Augen und verschränkt die Arme hinter dem Kopf, als läge er schon hinten auf dem Geländewagen.»Ja, das wäre cool«, sagt Valentin.»Oder wir leihen eins mit Schiebedach, stapeln ganz viele Kissen über ein an der und gucken oben raus!«carl kichert.»aber jetzt mal ohne Spaß«, sagt Valentin und schaut zu seinem Papa und mir:»können wir in unserem 1er-BMW von hinten überhaupt was sehen und hören? Und welchen Film schauen wir eigentlich?ich hoffe, Star Wars«, quatscht Carl dazwischen,»oder den Joker-Film ab 18!«Leider nein, wir schauen den Animationsfilm Onward (ab 6 Jahren). Darin wollen zwei Elfenbrüder ihren toten Vater für einen Tag zum Leben erwecken mit Magie. Der Film startet erst, wenn es dunkel ist. Denn das Bild auf der Leinwand ist nur zu erkennen, wenn die Sonne nicht daraufscheint und die kann man ja nicht ausknipsen wie die Lampen im Kinosaal. An diesem Abend soll sie um Uhr untergehen, das heißt, der Film endet kurz vor Mitternacht!»Für mich kein Problem«, sagt Carl und winkt lässig ab.»silvester war ich auch bis zwei Uhr wach!«sein großer Bruder denkt längst über etwas anderes nach:»gibt s da eigentlich Popcorn?«Valentin weiß, dass Papas Auto normalerweise eine Warten, bis es dunkel ist: Erst dann können Valentin und Carl auf der Leinwand des Dortmunder Autokinos etwas sehen Sonne weg, Film ab! essensfreie Zone ist. Alles, was krümelt, schmiert oder tropft, muss draußen bleiben.»und wenn wir ein bisschen Schokolade mitnehmen?«, fragt Carl, neigt den Kopf und formt mit seinem Daumen und Zeigefinger einen winzig kleinen Kreis. Die beiden Jungs verhandeln hart und sichern sich Gummibärchen, Schokolinsen und Zitronenlimo. Papa muss das mit einem Handschlag besiegeln. Als wir am Abend das Auto gepackt haben, sieht es so aus, als würden wir in den Urlaub fahren. Wir haben viele Kissen dabei, Decken, lange Jacken Statt in einem Saal schauen in diesem Jahr wegen Corona viele Menschen woanders Filme: Im Autokino. Valentin und Carl haben das ausprobiert VON ANDREA BÖHNKE und Hosen, falls es abends kalt wird, Getränke, Süßigkeiten. Um kurz vor acht brechen wir auf, ab acht Uhr kann man auf den Platz. Pünktlich biegen wir in die Straße ein, in der in diesem Sommer das Autokino ist. Früher war hier eine große Eisenfabrik, und ein paar der alten Anlagen stehen noch. Vor einem großen Hoch ofen, einem rostbraunen Turm, in dem damals das Eisen geschmolzen wurde, steht die Leinwand. Aus dem Auto heraus zeigen wir unsere Tickets vor, eine Frau mit Warnweste und Leuchtstab winkt Foto (Ausschnitt): Sami Skalli für DIE ZEIT; Foto und Protokoll»Mein Buch dein Buch«: Jana Magdanz (u.) uns auf den Platz. 250 Autos können hier stehen, bisher sind erst wenige da.»guck mal, die sind mit einem Smart hier, da hat man doch null Platz drin«, sagt Carl. Unser Parkplatz ist in der Mitte vor der Leinwand, allerdings in der dritten Reihe. Valentin und Carl recken die Köpfe.»Der vor uns hat eine viel zu große Antenne!«, ruft Carl.»Und ich gucke genau auf den Rückspiegel«, sagt Valentin. Neben uns parkt das nächste Auto, so dicht, dass wir es durch die heruntergelassenen Fenster berühren könnten.»was?! Der hat eine Nintendo Switch dabei«, stöhnt Valentin und zeigt rüber. Während unser Nachbar spielt, liest die Frau neben ihm ein Buch.»Und die da vorne snacken schon«, sagt Valentin. Tatsächlich scheinen viele noch besser vorbereitet zu sein als wir. Sie essen in ihren Autos Pizza, Würstchen oder Salat, spielen Karten, lesen oder zocken auf tragbaren Videospielkonsolen. Manche schrubben auch ihre Windschutzscheiben, damit sie beim Film später klare Sicht haben. Dann schlüpfen sie wieder in ihre Autos. Wegen Corona soll man nicht so viel auf dem Platz herumlaufen. Wir bleiben auch an unserem Auto.»Wie viel Uhr ist es?«, fragt Carl um Uhr. Noch etwa eineinhalb Stunden, bis der Film beginnt. Wir drehen den Rückspiegel zur Seite, polstern die Rückbank mit Kissen aus und schieben Carls Kindersitz beiseite. Ihr Papa versucht, die Kopfstütze vom Fahrersitz zu lösen, und setzt sich aus Versehen auf die Hupe. Die Kinder giggeln.»wie viel Uhr ist es jetzt?«, fragt Carl Uhr, noch immer mehr als eine Stunde. Carl seufzt.»wollt ihr euch mal aufs Autodach setzen?«, fragt ihr Papa. Die Brüder schauen sich mit großen Augen an.»kann ich durchs Fenster klettern?«, fragt Carl. Schließlich geht es über die Stoßstange hoch. Von oben beobachten die Jungs, wie die Sonne langsam versinkt und der Schatten auf der Leinwand immer größer wird. Und plötzlich können sie erkennen, dass dort schon die ganze Zeit etwas steht: die Radiofrequenz, über die man den Film hören kann.»hundertsechs Komma null«, ruft Carl vom Dach herunter,»ich wiederhole, hundertsechs Komma null!«es rauscht nur.»wenn ihr mich alle verstanden habt, hupt jetzt«, sagt die Stimme einer Frau durch das Radio unserer Nachbarn. Alle außer uns hupen. Carl springt vom Dach und reißt die Autotür auf. Dann geht alles ganz schnell: Wir finden die Frequenz, lehnen uns zurück und haben nach kurzer Zeit vergessen, dass wir im Auto sitzen bis der Abspann des Films läuft.»wenn es euch gefallen hat, hupt jetzt!«, erklingt wieder die Frauenstimme vom Anfang. Carl schmeißt sich nach vorn und hupt und hupt und hupt. Um 0.13 Uhr sind wir wieder zu Hause, die Jungs rühren sich nicht.»puh! Ich freue mich schon aufs Bett«, flüstert Valentin. Die -Bestsellerliste Juli DIESE KINDERBÜCHER KAUFEN GERADE VIELE MEIN BUCH DEIN BUCH 1 6 Margit Auer/Nina Dulleck (Ill.): Die Schule der magischen Tiere. Endlich Ferien (5) Benni und Henrietta Carlsen 2020; 240 S., 12, ; ab 8 Jahren Neu in den Top Ten 2 7 Alice Pantermüller/Daniela Kohl (Ill.): Mein Lotta-Leben (16) Das letzte Eichhorn Arena 2020; 160 S., 12, ; ab 9 Jahren Vormonat: 4. Platz 3 8 Katja Brandis/Claudia Carls (Ill.): Seawalkers (3) Wilde Wellen Arena 2020; 328 S., 14, ; ab 10 Jahren Neu in den Top Ten 4 9 Rick Riordan: Die Abenteuer des Apollo (4) Die Gruft des Tyrannen Carlsen 2020; 480 S., 19,99 ; ab 12 Jahren Neu in den Top Ten 5 10 Ingo Siegner: Der kleine Drache Kokosnuss und der chinesische Drache cbj 2020; 80 S., 8,99 ; ab 6 Jahren Vormonat: 1. Platz Christelle Dabos: Die Spiegelreisende (4) Im Sturm der Echos Insel 2020; 613 S., 18, ; ab 12 Jahren Neu in den Top Ten Aimée Carter: Der Fluch des Phönix Oetinger 2020; 352 S., 15, ; ab 10 Jahren Vormonat: 6. Platz Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf Alle Abenteuer in einem Band Oetinger 2020; 400 S., 20, ; ab 6 Jahren Vormonat: 7. Platz Jeff Kinney: Gregs Tagebuch (14) Voll daneben! Baumhaus 2019; 224 S., 14,99 ; ab 10 Jahren Vormonat: 3. Platz Magnus Myst/Thomas Hussung (Ill.): Das kleine Böse Buch (1) Ueberreuter 2017; 128 S., 12,95 ; ab 8 Jahren Wiedereinstieg; 7. Platz im April 2020 Die monatliche ZEIT LEO-Bestsellerliste basiert auf Daten von media control. Über einen Zeitraum von jeweils vier Wochen werden deutschlandweit an mehr als 6500 Verkaufsstellen die abverkauften Titel ermittelt. Bezogen auf das Umsatzvolumen bilden diese Daten knapp 90 Prozent des deutschen Buchmarktes ab. Die Titel werden nach Warengruppen sortiert. Die ZEIT LEO-Bestsellerliste setzt sich zusammen aus den Warengruppen Erstlesealter/Vorschulalter, Kinderbücher, Jugendbücher, Biografien sowie Sachbücher/Sachbilderbücher. Berücksichtigt werden die Titel, die von den Verlagen für Leser zwischen 5 und 13 Jahren ausgewiesen sind. Bei Serien/Reihen wird nur der aktuell höchstplatzierte Band abgebildet. Die Bestsellerliste erhalten Sie monatlich per hier: Königreich gegen magische Düfte Das Lieblingsbuch in meiner Kindheit war Mio, mein Mio von Astrid Lindgren. Es ist schon fast 70 Jahre alt. Mio war ein Findelkind, das in der Geschichte seinen Vater aufspürte, der ein König war. Außerdem war Mio der ersehnte Retter für das Land, über das sein Vater herrschte. Der Junge musste deshalb viele Abenteuer bestehen und gegen einen grausamen Ritter kämpfen. Es ist ein spannendes Buch, aber auch ein trauriges. Das Schönste war für mich, dass Mio so gut über seine Gefühle sprechen konnte und über die Menschen um sich herum. Ich war auch so ein Gefühlskind, aber im echten Leben gab es nicht viele Menschen, die so über Gefühle oder Freundschaften sprechen wie Mio in der Geschichte. Das wünsche ich mir viel mehr in Kinderbüchern, dass auch Kinder, die anders sind, Helden sein können. Heute gibt es ja schon viele Geschichten, in denen Mädchen Jungssachen können. Das finde ich toll. Aber es könnten noch mehr ganz unterschiedliche Kinder Heldinnen und Helden sein. Oft sind es doch nur die gut aussehenden, die starken und sportlichen. Für mich dürften sie noch vielfältiger sein und auch mal eine andere Hautfarbe haben. Manjushas Mutter Prasanna, 48 Jahre Astrid Lindgren: Mio, mein Mio. Oetinger, Neuauflage 2008; 192 S., 14, ; ab 8 Jahren Anna Ruhe: Die Duftapotheke (1): Ein Geheimnis liegt in der Luft. Arena 2018; 264 S., 13, ; ab 10 Jahren Ich würde mir auch mal ein Kinderbuch wünschen, in dem die Hauptfigur eine Brille trägt so wie ich. Da fällt mir nur Harry Potter ein. An Mio, mein Mio gefällt mir, dass Mio selbst die Geschichte erzählt und dabei so ehrlich ist. Er sagt nicht nur, dass er zum Beispiel traurig ist, sondern er weint und steht dazu. An Büchern, die schon vor längerer Zeit geschrieben wurden, mag ich, dass ganz andere Ausdrücke benutzt werden als heute. Und die Leute haben auch ganz andere Klamotten an. Ich lese aber genauso gerne neue Bücher. Mein Lieblingsbuch ist eins von heute: Die Duftapotheke. Die Hauptfigur Luzie erzählt die Geschichte auch selbst, aber sie hat Jeans an. Die Duftapotheke ist geheim und liegt unter der Villa, in die Luzie einzieht. Mit den Düften kann man zaubern. Luzie findet heraus, dass sie eine Sentifleur ist, sie kann also neue Düfte kreieren. Der Duft der Ewigkeit kann einen 300 Jahre alt werden lassen, aber er ist dadurch auch sehr gefährlich. Böse Gestalten wollen ihn in die Hände bekommen und die Welt so erhalten, wie sie früher mal war. An der Duftapotheke gefällt mir so gut, dass mit Düften gezaubert wird, das hatte ich noch nie gehört. Manjusha, 9 Jahre
45 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 FEUILLETON 45 Das müssen sie aushalten Auf Kritik reagieren deutsche Polizeifunktionäre gerade recht dünnhäutig. Dabei ist es eine Frage der Demokratie, der Staatsgewalt zu misstrauen VON MARTIN EIMERMACHER Geheimnisvolle Spiele im Nebel Ein Zwischenbericht aus dem stillstehenden Theaterleben Auf den ersten Blick wirkte es wie ein Kunst-Happening, was Horst Seehofer da vergangene Woche in der Stuttgarter Innenstadt aufführte die er zu seiner Bühne machte wie weiland der Gummistiefel-Kanzler Schröder den überfluteten Osten. Im Mittelpunkt des Stuttgarter Szenarios: ein eilig herbeimanövriertes Polizeiautowrack, symbolbildstark vor den Kameras der versammelten Pressevertreter platziert und mit Klebefolien verhüllt wie ein kleines Christo-Kunstwerk. Nun handelte es sich bei Seehofers Performance nicht um Kunstquatsch mit Sekt und Stehtisch, sondern um eine Pressekonferenz, ein paar Dutzend Stunden nachdem Jugendliche die Scheiben jenes Polizeiautos ebenso wie die Scheiben zahlreicher Geschäfte der Schwabenmetropole eingeworfen hatten. Die Polizei hält für uns den Kopf hin, so Seehofers Botschaft, und das ist der Dank? Sie wird angefeindet, angespuckt, angegriffen immer öfter, immer brutaler. Und zu allem Überfluss lässt die Kuscheljustiz meist wieder laufen, wen die Beamten an der Gerichtspforte abladen. Das Problem dieser Erzählung, die man von Stammtischen, Spiegel TV-Reportagen und TKKG- Kinderkassetten her kennt: Sie stimmt nicht. Keine existierende Statistik liefert der Behauptung eine valide Grundlage, dass es zu»immer mehr«gewalt komme, wie man leider auch das gehört zur Wahrheit auch in Zeitungen lesen kann. Pressemitteilungen der Polizei gelten schließlich als sogenannte privilegierte Quellen, weshalb mancher Journalist glaubt, nicht mehr selbst recherchieren zu müssen. Der Soziologe Stuart Hall nennt Polizisten daher auch»primäre Definierer«. Weil sie eben zu den Informationen gleich deren Interpretation mitliefern. Wer hingegen darauf hinweist, dass in den Reihen der Polizei einiges im Argen liegt, wer also die von Polizeigewerkschaften, Boulevardpresse und Politikern eingeforderte Loyalität zu unseren Ordnungshütern vermissen lässt für den kann es ungemütlich werden. Lernen musste das etwa die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, nachdem sie im Juni davon gesprochen hatte, dass es einen»latenten«rassismus bei der Polizei gebe. Womit sie selbstverständlich irrte: Das Problem tritt schließlich keineswegs bloß latent, sondern ganz offen zutage. Zahlreiche rechtsradikale Zellen mit Polizisten wie die Prepper-Gruppe»Nordkreuz«sind in letzter Zeit aufgeflogen, die Europäische Kommission beklagt seit Jahren amtliche Ignoranz, und selbst ein Polizeiausbilder wie Rafael Behr weist auf den»subkulturellen Rassismus«einiger seiner Schützlinge hin. Doch Empirie nützt bekanntlich wenig gegen Moral (»Frau Esken schafft eine Kultur des Misstrauens gegen unsere Polizei«, urteilte die Deutsche Polizeigewerkschaft). Auf gehörigen Druck hin nahm Esken ihre Äußerungen zurück, die übrigens laut einer All colors are beautiful? So sieht es die Berliner Malerin Coco Bergholm in ihrem Werk»Color Bomb«(Acryl auf Leinwand, 2014) Insa-Umfrage bei 46 Prozent der Bevölkerung auf Zustimmung stoßen und nur bei 24 Prozent auf Ablehnung. Mit Eskens Einknicken war über die Debatte, ausgelöst durch die Black-Lives-Matter-Proteste, bereits nach kurzer Zeit ein Sargdeckel gewuchtet, den Seehofer sogleich als Sprungbrett für eine Gegenkampagne zu nutzen wusste. Die gipfelte dann bekanntlich in seiner Ankündigung, die Journalistin Hengameh Yaghoobifarah wegen einer Anti-Polizei- Kolumne in der taz anzuzeigen, und praktischerweise verdrängte diese ganze Aufregung auch gleich die Korruptionsvorwürfe gegen den Fraktionskollegen Philipp Amthor aus den Schlagzeilen. Nun sollte man die Behauptung, es gebe in Deutschland keine Meinungsfreiheit, dem rechten Rand überlassen. Aber was stellt es mit einer Debatte an, wenn der Bundesinnenminister zumindest erwogen hat, eine Journalistin wegen eines kontroversen Textes anzuzeigen? Als ob die Pressefreiheit nur für die Seite mit den Kreuzworträtseln gelte und für das, was eh Konsens ist. Vor wenigen Wochen demonstrierten in Deutschland bundesweit fast Menschen gegen rassistische Polizeigewalt es ist erstaunlich, wie selten man seitdem die Mahnung vernommen hat, deren Ängste und Sorgen doch bitte ernst zu nehmen. Als in Dresden Pegida- Anhänger monatelang um die Frauenkirche trotteten, war man sehr viel schneller bereit, ihnen zuzuhören. Seit einigen Tagen hört man öfter, von der CSU und auch von Journalisten wie Jörg Quoos (immerhin Chef der mächtigen Funke-Zentralredaktion): Medien, die in der Vergangenheit auf Missstände bei der Polizei hingewiesen haben, seien mit schuld daran, irgendwie zumindest, dass in Stuttgart die Scheiben barsten.»aus Worten werden Taten«, so ließ Seehofer wissen, und mit der gleichen Logik könnte man ihn, der einst davon sprach,»bis zur letzten Patrone«gegen zuwanderungsfreundliche Politik kämpfen zu wollen, der Beihilfe zur rechten Gewalt bezichtigen. Die NZZ sprach davon, die taz-kolumne klänge, als sei sie von»hitlers Mordbande«verfasst. Und um jeden Verdacht aus der Welt zu räumen, dass man es bei ihm mit einem Journalisten zu tun habe, beendete Chefredakteur Julian Reichelt sein Seehofer-Interview mit den Worten:»Auch im Namen von Bild an alle Polizistinnen und Polizisten da draußen: Vielen Dank für Ihren Dienst.«Jedenfalls: Die zaghafte Frage nach möglichen sozialen Ursachen von Stuttgart war so schnell vom Tisch, wie man»volle Härte des Gesetzes«sagen konnte. Der Weg wurde geebnet für Formulierungen wie»terror«und»zustände wie im Bürgerkrieg«, ganz so, als wären im Ländle Fassbomben geworfen worden. Der Welt-Autor Henryk M. Broder schrieb gar von einer»kleinen Reichskristallnacht«, worüber sich zumindest jene freuen können, die einen Schlussstrich unter den zwölfjährigen Vogelschiss ziehen wollen. Im Kölner Stadt-Anzeiger fand sich Stuttgart als»zivilisationsbruch«wieder, was als Begriff ja eigentlich Auschwitz meint, wie man selbst als nicht sonderlich aufmerksamer Schüler im Geschichtsunterricht hätte mitbekommen können. Durch Berufung auf Sprechpositionen und eine höhere Moral die inhaltliche Auseinandersetzung suspendieren: Ist das nicht genau das, was in den ungezählten Debatten der letzten Jahre der Identitätspolitik vorgeworfen wird? Wundersamerweise scheinen beim Sprechen über die Polizei die Rollenkarten vertauscht zu sein. Publizisten, die sonst oft zum Beispiel wenn es um Flüchtlinge geht den Kalenderspruch auf Tasche haben, wonach sich ein Journalist auch mit einer guten Sache nicht gemeinmachen dürfe, fordern plötzlich eine der Recherche vorgelagerte Parteilichkeit zugunsten der Ordnungskräfte. Bei Politikern versteht man ja wenigstens noch die Taktik hinter der identitätspolitischen»mach meinen Polizisten nicht an«-hypermoral. Als Opfergabe für die schwarze Null hat man auch auf der Wache den Gürtel enger schnallen müssen, und anders als bessere Arbeitszeiten und höhere Löhne kostet Innenpolitiker das Bauchpinseln und ständige Ankündigen höherer Strafmaße nicht viel. Bloß eben: die Zermalmung einer zentralen Idee des Rechtsstaats. Einen Generalverdacht gegenüber der Exekutive zu hegen ist schließlich keineswegs radikale Gesellschaftskritik, sondern entspricht im Kern erst einmal nichts anderem als dem Prinzip der Gewaltenteilung. Historisch entstanden als Misstrauensvotum des Bürgertums gegenüber staatlicher Allmacht und als Schutz des Einzelnen vor Willkür. Der Ethnologe David Graeber beschreibt die Polizei, in deren Aktionsradius sich Judikative, Legislative und Exekutive überschneiden, folgendermaßen:»der Einsatz des Polizeiknüppels ist jener Augenblick, in dem der bürokratische Imperativ des Staates, nämlich schlichte administrative Schemata festzulegen, mit seinem Monopol der Gewaltanwendung zusammenfällt.«eben weil das Recht also immer nur hinterher korrigierend eingreifen kann, braucht die Polizei Kritik von außen. Wissenschaftler beklagen allerdings seit Langem eine»negative Fehlerkultur«der überwiegend konservativen Funktionäre. Wie wenig Polizeigewalt aufgearbeitet wird (manche Forscher sprechen davon, dass bis zu 95 Prozent aller Verfahren mit Einstellung enden) und wie schnell Polizisten einen Korpsgeist ausbilden, um Fehler zu vertuschen, ist hinlänglich dokumentiert. Viele Anwälte raten ihren Klienten, auch das weiß man seit Jahren, Polizeigewalt bloß nicht zur Anzeige zu bringen. Zu groß die Gefahr, sich eine fingierte Gegenanzeige wegen»widerstand«einzuhandeln. Darunter kann schon fallen, sich bei einer Festnahme, egal wie unrechtmäßig sie passiert sein mag, zusammengekrümmt zu haben (und wer reagiert schon mit Muskelrelaxation, wenn hochgepanzerte Beamte auf einen zustürmen?). Die Vereinten Nationen fordern Deutschland seit Langem auf: Richtet endlich unabhängige Beschwerdestellen ein. Ohne Erfolg. Auch die Polizei steckt gewissermaßen in einem Dilemma. Je stärker die Gewaltkriminalität zurückgeht (und das tut sie: Aktuell leben wir in so sicheren Zeiten wie wohl noch nie), desto weniger kann sie ihre Forderung nach mehr Beamten und besserer Ausrüstung rechtfertigen, man kennt dieses Zu-Tode- Siegen von den Corona-Maßnahmen. Aber rechtfertigt das die Untergangsszenarien auf Polizei- Pressekonferenzen? Und das»wir stehen kurz vor dem Bürgerkrieg«-Geraune des Polizeigewerkschafts- Promis Rainer Wendt, der derart ressentimentgeladen über rechtsstaatliche Prinzipien hinwegmäht, dass man ihn fast schon durch den Verfassungsschutz beobachten lassen möchte. In den USA hat die Diskussion seit dem Mord an George Floyd einen Quantensprung erlebt. War Defund the Police lange Zeit eine Nischenparole, diskutiert man nun im Mainstream darüber, wie man Polizeibudgets am besten umverteilen könne. Gemessen an ihrem Jahreshaushalt sind amerikanische Städte nämlich, könnte man sagen, oft nichts anderes als gigantische Polizeiwachen mit einigen unterfinanzierten Nebenzweigen wie Bildungs- oder Gesundheitswesen. David Graeber nennt Polizisten»Bürokraten mit Knarre«, ihr Vordringen in immer mehr Lebensbereiche liege letztlich, unsichtbare Hand und eiserne Faust, auch an neoliberalen Reformen: Sollte man, statt Polizisten auf Obdachlose anzusetzen, nicht lieber gegen den überteuerten Wohnungsmarkt vorgehen? Könnte man medizinisches Personal besser schulen, statt Polizisten zu zwingen, sich mit Handschellen und Faustschlägen um psychisch Kranke zu kümmern? So oder so: Die US- Debatten seit Minneapolis zeigen, dass die Zeit des marktradikalen»there is no alternative«-mantras vorbei zu sein scheint. In Deutschland wirken obige talking points wie ein Bild aus der Zukunft, oder gar wie von einem anderen Stern; keine hiesige Institution kann sich ihres Vertrauens in der Bevölkerung so sicher sein wie die Polizei. Aber was spricht dagegen, die Diskussion, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, etwas ergebnisoffener zu führen? Mitte Juni erschoss die Bremer Polizei in einer mutmaßlichen Notwehrsituation den gebürtigen Marokkaner Mohamed Idrissi. Der psychisch kranke Mann war zuvor, nachdem man ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte, mit einem Messer in der Hand auf einen Beamten zugerannt. Seine Angehörigen haben sich nun an die Öffentlichkeit gewandt, sie fragen: Könnte er noch leben, hätte jemand Versiertes mit ihm geredet? Coco Bergholm,»Color Bomb«, 100 x 140 cm, Acryl auf Leinwand Theatergeschichte in aller Kürze: Das Ganze hat vor 2500 Jahren in Griechenland begonnen und seitdem nicht mehr aufgehört. Das Theater ist die robusteste aller Kunstformen. Doch was sich vor Kurzem auf einem nassen Markt in China ereignete, bewirkte Ungeheures: Zum ersten Mal kam das Bühnenleben weltweit zum Erliegen. Kein Wunder, dass nun die Theaterleute auf ihren leeren Bühnen stehen und wie Pioniere in die Zukunft blicken: Wie lassen sich die Häuser mit Volk füllen, ohne dass sie zu Hotspots, gleichsam zu Ischgl-Tourneebühnen, zu Tönnies- Buden werden? Wie kann man dem Publikum das Gefühl vermitteln, es sei hier vor dem Virus sicher? Am Berliner Ensemble experimentieren sie jetzt mit einer Art Schutz- und Heilnebel, den sie probeweise auf das Gestühl und die darin sitzenden Zuschauer niedergehen lassen. Dieser Nebel habe, so wird behauptet, die Gabe, im Sinken 99 Prozent aller im Raum schwebenden Viren und Übelpartikel mit sich zu Boden zu zwingen, wo sie keinen Schaden mehr anrichten. Mit dem Theaterbesuch wäre künftig also das diskrete Zischen des durch Düsen entfliehenden Dunstes verbunden der alles, was da geschähe, angenehm benetzte und beruhigte. Eine Gefahr der Methode bestünde darin, dass das Beste an dieser neuen Theaterwelt der Schöpfungsnebel selbst sein könnte, aus dem sie hervortritt. Ein anderes Problem ergäbe sich daraus, dass die Sache nicht ganz billig ist. Während in den letzten Jahren eine prachtvolle Drehbühne das oberste Zeichen des deutschen Theaterreichtums war, könnte es jetzt der Luxusnebel sein, der allen Beobachtern zeigen würde, wie großartig dieses Land seine Künste schützt. Der Berliner Nebeltest erinnert uns an eine Meldung, die wir kürzlich über Wladimir Putin lasen. Wer zum russischen Präsidenten in den Kreml vorgelassen werden will, der muss, so stand da, durch Desinfektionsschleusen hindurch, in denen er vermutlich ebensolche Erfahrungen macht wie demnächst das Publikum des Berliner Ensembles. Und auch in Putins Staat sorgt man sich um die Zukunft des Theaters, wenngleich es ein wenig andere Sorgen sind. Auch hier liegt die Zukunft im Nebel. Aber es ist ein giftiger Nebel. Es ist der Nebel der Herrschaft. Soeben ist in Moskau der Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikow zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er sei, so die Begründung, Kopf einer kriminellen Vereinigung, die sich der Unterschlagung von 1,6 Millionen Euro schuldig gemacht habe. Bis zur Wiedererstattung jener Summe habe Serebrennikow unter Hausarrest zu bleiben. Dem Ganzen gingen ein dreijähriger Prozess und Serebrennikows Hausarrest voraus. Hier wird ein Exempel statuiert, aber nicht, um einen Kritiker stracks zu vernichten, sondern, im Gegenteil, um sich den Mann frisch zu halten in einer Art Geiselhaft, ja eigentlich: um an ihm auf Jahre hin die mutmaßlich endlose Herrschaft Putins zu demonstrieren. Serebrennikow hat selbst einmal gesagt, die Reformkräfte Russlands unter dem damaligen Präsidenten Medwedew hielten sich ihn, Serebrennikow, wie ein Maskottchen,»a white bird«. Nun wird er zum Symbol der Restriktionspolitik Putins. Thomas Ostermeier, Intendant der Berliner Schaubühne, kennt die Sachlage gut und er kennt Serebrennikow. Am Telefon sagt er:»der Vorwurf der Veruntreuung ist absurd; von dem Geld, das Serebrennikow und seine Mitangeklagten angeblich unterschlagen haben, sind 340 Veranstaltungen gemacht worden.«die Bewährungsstrafe sei ein doppelt»schlaues«zeichen: Einerseits habe man den Anschein vermieden, eine Terrorjustiz zu sein, Serebrennikow wurde ja nicht in Haft genommen. Andererseits, so Ostermeier, hätten alle Künstler das Si gnal verstanden:»schnauze halten sonst schauen wir uns eure Geschäftsbücher an!«es sei ein gängiges Spiel in Russland: Man übe keine Zensur, sondern stelle, wenn man Künstler mundtot machen wolle, steuerrechtliche Verfehlungen fest, die könne man immer finden; so entstehe»ein Gogolsches System der Abhängigkeiten«. Warum Ostermeier, der in Russland als Regisseur arbeitete und dorthin gute Kontakte hat, so ungeschützt redet?»ich werde eh nicht mehr nach Russland reisen, ich habe die Schnauze voll, ich fühl mich dort nicht mehr wohl. Ich will s nicht drauf ankommen lassen.«das Theater steht still noch. Aber der Bühnennebel wabert gewaltig. Weh dem, der es nicht mit schützendem, sondern giftigem Nebel zu tun hat. PETER KÜMMEL
46 46 FEUILLETON 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Eine Architektur des Ankommens Smart Cities mit U-Bahnen, die Fieber messen und Mülleimern, die Viren scannen schön und gut. Aber worum es bei der Stadt der Zukunft eigentlich gehen wird, ist etwas ganz anderes VON HANNO RAUTERBERG Zu den erstaunlichsten Vorschriften des deutschen Baurechts gehört die Abstandsregel. Ohne sie wären die Städte so eng und finster, feucht und ungelüftet, wie es über Jahrhunderte ganz selbstverständlich war. Damals drängten sich die Menschen in den Gassen und Hinterhöfen, und Seuchen jeder Art gediehen prächtig. Beinahe wären die großen Städte an sich selbst erstickt, und nur weil schließlich die Hygiene zum Leitziel der Planer wurde, konnten London, Paris und Berlin unverdrossen weiterwachsen und zu dem werden, was sie heute sind. Die Enge wurde abgeschafft, es war ein Sieg über Cholera und Tuberkulose. Heute scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Erneut diskutieren die Planer, wie die Städte verwandelt, wie sie besser gegen Pandemien geschützt werden könnten. Braucht es größere Balkone? Breitere Fuß- und Radwege? Gebaute Abstandsregeln, damit sich die Menschen nicht immerzu über den Weg laufen? Ähnlich wie im 19. Jahrhundert soll die Stadt abermals umgerüstet werden. Damals verlegte man Stromleitungen und Abwassersiele, jetzt werden die urbanen Räume nach Kräften digitalisiert, um sie gegen den Virenfeind zu immunisieren. In dieser schönen neuen Stadtwelt, der Smart City, hätten die Straßenlaternen etwa plötzlich Augen und wachten darüber, ob die Bürger sich pandemiekonform verhalten. Fürsorgliche Fahrstühle, U-Bahnen und Bankautomaten würden jedem, der sich nähert, die Temperatur messen. Und selbst Papierkörbe könnten Bluetooth-schlau registrieren, wer gerade was in sie hineinwirft und wie ansteckend der Müll möglicherweise ist. Aus der Stadt würde eine Supermaschi ne, supersicher, superkontrolliert. Mag sein, dass sich das utopisch anhört. Doch unter den Planern und Architekten hat die Smart City erstaunlich viele Anhänger, und das schon deshalb, weil ihnen das Effizienz- und Optimierungsdenken, das dieser Stadtvision zugrunde liegt, überaus vertraut vorkommt. Es ist die patente Logik der Ingenieure, sie kennt keine Probleme, sie kennt nur Lösungen und immer sind sie technischer Natur. Allerdings hat diese Rationalität, der die moderne Großstadt vieles verdankt, auch ihre abgründigen Seiten. Nicht selten geraten die Lösungen sogar selbst zum Problem. Und die Technikeuphorie der Planer und Architekten, ihr Glaube an die Automatisierbarkeit des Daseins, trägt mit dazu bei, dass sich Pandemien rasch verbreiten können. Bis heute folgen viele Planungsbüros einem sehr traditionellen und eigentlich antiquierten In no vations be griff. Sie begeistern sich für raffinierte Konstruktionen, verwenden neue Materialien und setzen auf einen Fortschritt, der allein von Zahlen bestimmt ist, von den Kennziffern ökonomischer, ökologischer oder auch brand- und lärmschutztechnischer Absichten. Für eine andere Form von Innovation, eine, die ästhetisch oder sogar gesellschaftlich motiviert wäre, bleibt in der Regel kein Raum. Und so sehen die meisten Städte denn auch aus: herrlich funktional und auf normgerechte Weise steril. Natürlich stehen die Planer und Architekten nicht für sich. Ihr Fortschrittsbegriff wurzelt im Denken einer Moderne, die alles für machbar hielt und stets darauf aus war, Raum und Zeit zu überwinden. Sie verlangte nach Beschleunigung, nach Entgrenzung, sie wollte verfügbar machen, was als unverfügbar galt. Es war die Vision einer Hypermobilisierung, die dazu führte, dass die Städte auto gerecht umgestaltet und auch die Bauten aller Erdenschwere enthoben werden sollten. Es entstand eine Ästhetik des Vorbeirauschens, gläsern kalt, ortlos und von allen Traditionen gelöst. Die Häuser sähen»vielerorts wie reisefertig drein«, befand Ernst Bloch schon vor 80 Jahren.»Obwohl sie schmucklos sind oder eben deshalb, drückt sich in ihnen Abschied aus.«fotos: Paul Mayall/dpa; Hergen Schimpf (u.) In dieser Reisefertigkeit, in einer auf Beschleunigung und Wachstum getrimmten Planung, war die Globalisierung von heute bereits angelegt. Im Grunde haben die Architekten und Städtebauer in ihrer technophilen Begeisterung vorweggenommen, was unterdessen für viele Menschen zum Alltag geworden ist: Sie leben die Grenzenlosigkeit, flexibel und dauermobil. Die maschinisierte Stadt hat die Enge abgeschafft und die Weite gewonnen. Nur ging dieser Fortschritt, die große Entgrenzung, einher mit einem Verlust der Eingebundenheit. Viele Menschen klagen heute über Einsamkeit, Entfremdung, Heimatlosigkeit, in England wurde sogar ein Minister for Loneliness eingesetzt, um gegen die Vereinzelung vieler Menschen vorzugehen. Allen Vernetzungstechnologien zum Trotz scheint es den modernen Gesellschaften nicht zu gelingen, die verbreitete Sehnsucht nach Verbindlichkeit und Verbundenheit zu befriedigen. Im Gegenteil. Der mobilisierte Mensch wird noch mobiler, er verhält sich paradox. Er will die verlorene Nähe durch die Überwindung immer größerer Distanzen kompensieren. Eben zurück von der Dienstreise, pendelt er am Wochenende Statt ewiger Hypermobilität gibt es eine neue Vision: Das Fernweh in ein Nahweh wandeln zum neuen Lebenspartner, um von dort aus rasch die alte Restfamilie oder ein paar versprengte Freunde zu besuchen, nicht ohne nebenher den nächsten Kurztrip zu planen, eine Städtereise nach Barcelona oder Rom, warum nicht. In der Ferne sucht der mobilisierte Mensch das Hier und Jetzt, bereist hektisch den Planeten, getrieben vom Wunsch nach innerer Ruhe. Bricht ewig auf, um niemals anzukommen. Wenn aber alle immerzu unterwegs sind, sind auch die Viren unterwegs. Und spätestens damit fällt die schöne Hygienefantasie der modernen, technisch durchkontrollierten Stadt in sich zusammen. Für die Verbreitung der Pandemie ist ja nicht die Größe einer Metropolregion entscheidend; auch die Frage, ob dicht bebaute Quartiere besonders anfällig seien, erweist sich in der Corona- Debatte als nebensächlich. Manche Megacitys wie Tokio oder Singapur bekamen das Virus rasch in den Griff, hingegen erwiesen sich kleine Ortschaften wie Ischgl als Hochrisikogebiet. Denn was zählt, ist vor allem der Faktor Bewegung: Je mehr Bodenhaftung die Menschen haben, je verwurzelter sie sind in ihrem Heim, ihrem Viertel, ihrer Stadt, desto schwerer wird es für die Krankheit, sich rasch auszubreiten. Wer also die Städte umgestalten will, muss ebendort ansetzen: beim Bewegungsdrang. Er muss die Städte so umformen, dass sie die ohnehin mobile Gesellschaft nicht weiter mobilisieren. Er braucht ein neues Leitbild, eines, das vom Bleiben erzählt, vom Müßiggang, von der beglückenden Erfahrung, nicht länger gescheucht und gehetzt durchs Leben zu eilen. Sicher, die Klage über die Getriebenheit des Menschen ist so alt wie die Moderne (oder noch älter). Sie aber nun mit urbanen Strategien eindämmen zu wollen, die sich selbst dem Geist der totalen Machbarkeit verdanken, also weiterhin allein an die technische Innovation zu glauben, ist keineswegs so rational, wie viele Architekten und Städtebauer meinen. Egal, wie sehr die Smart City auch versucht, mit hocheffizienten Programmen gegenzusteuern, sie wird die Stadt weiter automatisieren und anonymisieren. Und das heißt, sie kann die ohnehin starken Fluchtreflexe vieler Zeitgenossen nur verstärken. Rational wäre es, mehr Irrationalität ins Spiel zu bringen. Es braucht Planer und Architekten, die Innovation neu denken und die endlich erkunden, welche soziale und auch ästhetische Kraft dabei helfen könnte, das Fernweh vieler Menschen in ein Nahweh zu verwandeln. Das neue Planer ziel hieße: den gesellschaftlichen Bindestoffen eine Gestalt verleihen mit einer Architektur des Ankommens. Eine solche Architektur lässt sich schwerlich per Bauordnung verfügen. Anders als die Smart Citys kann man das Ankommen nicht programmieren und technisch erzwingen. Wer es dennoch wagen will, eine andere Form von Stadt und also eine andere Form von Leben zu erproben, muss sich auf einen geistigen Wandel einlassen. Es geht schließlich nicht um wohlige Nostalgie, nicht darum, die Zukunft in heimattümelnde Vergangenheit zu verpacken. Vielmehr braucht es eine andere Denkungsart. Bislang neigen Planer und Architekten dazu, inhaltliche Fragen visuell zu beantworten und so ziemlich jede Kontroverse als Stil- und Formstreit aufzufassen. Ein neues Leitbild wird aber mehr sein müssen als eine glitzernde Power Point- Prä sen ta tion mit exaltierten Baukörpern. Es muss den standardisierten Zwecken und Methoden entkommen und sich die Freiheit nehmen, die alten Gewissheiten anders zu betrachten. Bislang geht es beim Bauen vor allem darum, wie teuer beispielsweise die Materialien sind, wie haltbar, wie effizient. Eine Architektur des Ankommens verlangt hingegen andere Fragen: Was ist von Glas zu halten, was von Holz oder Beton, wenn nicht allein die Quantitäten zählen, sondern die Qualität des Verweilens im Mittelpunkt steht? Wie entscheidend ist dafür die Glätte des Baukörpers, wie wichtig seine Größe? Sind eher organische oder technoide Strukturen geeignet, eher tradierte oder abstrakte Formen, um das zu evozieren, was im Englischen sense of place heißt, einen Sinn für das Sein und ein Gefühl von Herkunft? Und welche Rolle spielen die räumlichen Qualitäten, im Privaten wie im Öffentlichen? Wie müssen sich Straßen und Plätze anfühlen, damit ein Ministerium für Einsamkeit überflüssig wird? Wie wichtig ist Schönheit als sozialer Faktor? Es reicht eben nicht, die Stadt als Objekt zu behandeln, ausrechenbar und dem Willen der Planer unterworfen. Eine Stadt wird erst lebendig, wenn hier das Unbewusste, die Projektionen und Fantasien der Einzelnen ihren Raum haben. Und wenn sie die Paradoxien der Gegenwart, ihre Fernsucht und ihr Näheverlangen, für sich zu nutzen weiß: als Inspiration einer ebenfalls paradoxen Architektur und Stadtplanung, die zugleich wehmutsvoll und abwechslungsreich, befremdlich und überaus vertraut erscheint. Und so belebend, dass die Getriebenheit abflaut und ein Ankommen möglich wird, ohne dass Virologen es erst verordnen müssten. NACHRUF Immer mit der Kraft des Arguments Er schrieb über Romane und Wissenschaft, war Feuilletonchef und edierte Nabokov: Die staunenswerten Rollen des Dieter E. Zimmer VON ULRICH GREINER Es war 1975, als ich auf dem Literatursymposium in Graz dem Kollegen Dieter E. Zimmer zum ersten Mal begegnete. Als Kollegen auf Augenhöhe allerdings sah ich ihn nicht. Für mich, den namenlosen jungen Journalisten, war Zimmer der namhafte Literaturkritiker, der große Essayist, der Feuilletonchef der wunderbaren ZEIT, bei der er seit 1959 arbeitete. Kurz: Er war eine In sti tu tion. Als wir aber ins Gespräch kamen, staunte ich über die Bescheidenheit des Mannes. Er wirkte scheu. Lieber schien er zuzuhören, als selber zu reden, und seine sorgfältigen Repliken trug er mit leiser Stimme vor. Später, als wir uns besser kannten (eine Weile spielten wir wöchentlich Squash mit ein an der), lernte ich seinen Witz kennen, seinen freundlichen Sarkasmus. Das war zu der Zeit, als er sich von Feuilleton-Themen etwas zurückgezogen hatte und seine berühmten wissenschaftlichen Essays im ZEITmagazin veröffentlichte. Was bedeutet Intelligenz? Was passiert, wenn man schläft? Was ist gutes Deutsch? Wie sieht die Bibliothek der Zukunft aus? Was können Computer und was nicht? Was ist von der Psychoanalyse zu halten? (Nach Zimmers Ansicht: nicht viel.) Das waren einige der Fragen, die ihn beschäftigten und die er nach penibler Recherche zu beantworten suchte. Nicht immer fiel seine Antwort eindeutig aus, weil die Forschungslage dies nicht zuließ. War die Antwort aber klar, so widersprach sie oft dem Zeitgeist. Dass etwa Intelligenz zu einem nicht geringen Teil erblich ist, wollte man nicht hören. Zimmer jedoch hat immer auf die Kraft des Arguments gesetzt, was naturgemäß zur Folge hatte, dass er zuweilen den Kürzeren zog. Auch damals, auf dem Höhepunkt seines Schreibens, spielte die kraftvoll vorgetragene Meinung eine nicht minder große Rolle als das begründete Urteil. Und das Internet hat die Meinungsäußerungsorgien abermals beflügelt. Zimmer hat das Phänomen schon früh erkannt und Analysen über die dort übliche Sprache vorgelegt. Dieter E. Zimmer * DEZ, wie sein Kürzel lautete, hat einmal die journalistische Untugend, ein bloßes Dafürhalten nicht genauer herzuleiten, sondern mit Lautverstärkern zu orchestrieren,»impressionistisch«genannt. Das war ein höflicher Ausdruck. Er war ein von Grund auf höflicher Mensch. Wenn es darauf ankam, konnte er scharf werden. Scharf allerdings nie verletzend wurde er immer dann, wenn er die Prinzipien eines rationalen Umgangs mit Füßen getreten sah. Er war ein Rationalist, und alles Ideologische lag ihm fern. Was auch damit zusammenhing, dass er den Bombenkrieg leibhaftig miterlebt hatte. Das Drama der deutschen Geschichte war ihm stets gegenwärtig. Einmal hat er geschrieben:»fana ti scher Nationalismus und fanatischer Antinationalismus bedingen ein an der nicht nur in dem Sinne, dass der eine regelmäßig den anderen provoziert; sie sind darüber hinaus die beiden Seiten ein und derselben Medaille: eines gestörten Selbstwertgefühls.«Das sollte man sich merken. Zimmer, geboren 1934 in Berlin und mit 85 Jahren dort gestorben, liebte seine Stadt. Er hat dieser Liebe in vielen Texten Ausdruck verliehen, darunter seine Erzählung über die S-Bahn, in der er als Jugendlicher die abenteuerlichen Reize der gespaltenen Stadt erfahren hat. Er war auch ein Erzähler, und es ist schade, dass er sein beispielhaftes Leben nicht zu einer Autobiografie oder zu einem Roman zusammengefasst hat. Wahrscheinlich hat ihn seine Diskretion daran gehindert. Dieter E. Zimmer hat rund zwanzig, zum Teil sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht, darunter der Gedichtband Ich möchte lieber nicht, sagte Bartleby. Aber vor allem natürlich: Er ist der Mann, der in 28 Jahren, von 1989 bis 2017, die große Vladimir-Nabokov-Ausgabe im Rowohlt Verlag übersetzt und herausgegeben hat. Ein Meilenstein der Philologie, dem kein amerikanisches Pendant entspricht. Das wird von ihm bleiben. Und bleiben wird, dass er einer der seriösesten Journalisten war, die es je gab.
47 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 FEUILLETON 47 Foto: Jonas Ludwig Walter für DIE ZEIT Ihr Zigarettenrauch schwebt in den Himmel über der Uckermark: Monika Maron im Garten des Landhauses, das ihr seit über 40 Jahren gehört»ich brauche keinen Blumentopf mehr«ein Besuch bei der noch nicht ganz unmöglichen Schriftstellerin Monika Maron VON MORITZ VON USLAR Ihr Sommerhaus in der Uckermark: oben Holz, unten rosa. In dem weitläufigen, sich gen Osten in ein Feld öffnenden Garten dahinter liegen die Oder und die polnische Stadt Stettin gibt es drei Sitzgelegenheiten. Wir nehmen die im Halbschatten, unter einer Birke. Sie ist, wie so oft, schwarz gekleidet. Ihre langen Beine, ihr dunkler, nach 1970 aus sehen der Pagenkopf. Kettenraucherin Monika Maron und ihre auf Anhieb enttäuschte Frage:»Und Sie sind Nichtraucher?«In ihrem Gesicht zeigen sich Spiellust, Diskussionslust, Streitlust und, ja, auch Lust am Flirten. Der Reporter schöpft Mut in diesen ersten Minuten des Kennenlernens so vieles ist möglich, solange die Zigarette knistert. Das kann vorkommen, dass ein allseits geachtetes Mitglied des Literaturbetriebs ins Abseits gerät zuletzt hat sich der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp, unter anderem mit Äußerungen zur Meinungsfreiheit in der Demokratie, in eine Ecke begeben. Und Monika Maron? Im Juni nächsten Jahres wird sie 80 Jahre alt: 1941 im Berliner Arbeiterviertel Neukölln geboren, Tochter einer jüdischstämmigen Mutter und Stieftochter des damaligen DDR-Innenministers und Volkspolizei-Chefs Karl Maron von 1951 bis 1988 lebte sie in der DDR, ihr Debüt Flugasche (1981), in dem die gelernte Zeitungsreporterin die»ungeschönte, hässliche Wahrheit«über die DDR-Chemiestadt Bitterfeld offenlegte, konnte nur im Westen erscheinen. Maron, die feine Stilistin,»die großartige Schriftstellerin«(Iris Radisch). Über ihren Roman Animal Triste (1996) sagte Marcel Reich-Ranicki im Fernsehen:»Ich habe schon lange keinen Liebesroman mehr gelesen, der mich so berührt hätte wie dieser.«2010 äußerte sich die Schriftstellerin erstmals kritisch über den Islam, seit 2015 schreibt sie regelmäßig über die Flüchtlingskrise, mittlerweile lässt sie in öffentlichen Verlautbarungen, die oft in der Neuen Zürcher Zeitung erscheinen, kaum ein Reizthema aus: Sie schreibt gegen Globalisierung, Feministinnen, die Burka, Merkels Flüchtlingspolitik, gegen Windräder, eine hysterische Klimapolitik, die von ihr als solche beklagte»genderisierte Sprachverstümmelung«die neudeutsche Wortendung *innen treibt Maron erklärtermaßen fast in den Wahnsinn und einen immer schmaler werdenden Meinungskorridor, natürlich auch gegen einen»kollektiven Selbstmord der Deutschen«und für ein anderes, selbstbewusstes Nationalgefühl. Und die Altlinke, einst Inbegriff der schwierigen DDR-Autorin und Ost-Intellektuellen, gilt heute als Stimme der Neuen Rechten, sie ist eine»politisch auffällige Autorin«(SZ), noch keine Geächtete, aber eine beinahe unmögliche Person. Als 2018 ihr bisher letztes Buch Munin oder Chaos im Kopf erschien in dieser»erregungsschrift«denkt eine Schriftstellerin über den Dreißigjährigen Krieg nach und wähnt mit den Flüchtlingen der 2010er-Jahre den Krieg nach Deutschland zurückgekehrt, da konnte man die Kritiker, von der FAZ bis zur ZEIT, dabei erleben, wie sie in einigermaßen verzweifelten argumentativen Verrenkungen die schriftstellerische Kraft der Autorin noch einmal über ihre politisch prekären und ideologisch fragwürdigen Thesen stellten. Mitte August erscheint nun Marons zehnter Roman Artur Lanz, erneut ein politischer Thesenroman, in dem die Rebellin an der Schreibmaschine (Titel eines MDR-Porträtfilms) sich des Themas Heldentum in unserem angeblich postheroischen Zeitalter annimmt und abermals das Ich einer alternden Autorin allerlei Unwohlsein über die gesellschaftlichen Zustände empfinden lässt (dieses Mal beklagt die Erzählstimme Charlotte Winter das Verschwinden von Mut und Ritterlichkeit, der Feminismus habe das Geschlechterverhältnis degenerieren lassen, sie beschwört eine neue Männlichkeit, wobei natürlich kein kriegerisches Muskelspiel gemeint sei, sondern eine zivile Kraft, ein Mut des Geistes). Marons Verlag Fischer behauptet in seinem Vorschautext tapfer, der Roman entwerfe ein Stimmungsbild unserer Gesellschaft,»die sich dem Main stream unterwirft«. Die noch nicht ganz unmögliche Großschriftstellerin. Es ist oh Mann auch deshalb alles so furchtbar, weil einem als Monika-Maron-Kritiker kaum noch eine Wahl bleibt: entweder drauf auf die Störenfriedin, mit Gebrüll (wobei der Kritiker dabei wenig gewinnen kann und nicht sonderlich intelligent wirkt), oder sie ignorieren. Beim neuen Buch steht zu befürchten, dass die bisher nie schlechte Autorin in vielen großen Zeitungen kopfschüttelnd durchgewinkt werden wird. Immerhin, ihre alte Freundin, die Schriftstellerin Katja Lange-Müller die beiden lernten sich 1976 kennen, als Maron noch ihren Ton als Schriftstellerin suchte, hat sie als furchtlosen Menschen, als»extrem konfliktfähig, das Gegenteil von harmoniesüchtig«beschrieben. Zuletzt war Frau Maron mit einer im Rückblick doch ganz amüsanten Geschichte durch die Zeitungen gegeistert: Zum Höhepunkt der Corona- Krise hatte ihr das Landratsamt in Löcknitz-Penkun eine»ausreiseverfügung«zugestellt. Die Schriftstellerin sie unterhält ihren Erstwohnsitz in Berlin, ihr Landhaus hat sie 1978, noch zu DDR-Zeiten, erstanden habe ihren Zweitwohnsitz zu räumen. Großes Pathos im Corona-Theater in Vorpommern: Sie fühlte sich an ihre Ausreise aus der DDR erinnert. Mit einem Reporter der Bild-Zeitung erwartete die tapfere Autorin im Morgengrauen des Gründonnerstags ihren Abtransport. Allein, es geschah nichts, das Amt verzichtete auf den Vollzug. Wäre sie, die Widerstandskämpferin Monika Maron, bereit gewesen für noch größeres Theater?»Ich habe mir nicht gewünscht, dass sie mich hier aus dem Haus tragen. Aber freiwillig wäre ich nicht gegangen.«wie sollen wir jetzt über das neue Buch reden? Wirklich so, dass wir uns, wie von der Autorin intendiert, darüber unterhalten, ob Männer eine entmachtete Spezies sind? Bekanntes Phänomen: Viele Schreiberinnen und Schreiber wirken, wenn sie ihre Bücher erklären sollen, nicht unbedingt klüger als in ihren Büchern selbst, was ihr gutes Recht ist es gibt auch so etwas wie das Recht des Poeten auf seine eigene Beschränktheit (Schriftsteller sollten in ihren Büchern glänzen, nicht bei Interviews). Monika Maron besteht darauf kein ganz neuer und auch kein per se unvernünftiger Standpunkt, dass es zwischen den Geschlechtern biologische Unterschiede gebe, die von einem übertriebenen Feminismus und der aus Amerika importierten Kultur der Gender-Neutralität gleichgemacht würden:»männer können aber keine Kinder kriegen, und sie sollten auch nicht so tun.«interessanter Punkt im Folgenden fallen bei Monika Maron Sätze, die von einem sinnlichen Genervtsein, ja einer erotischen Enttäuschung über die neuen Männer zeugen:»wenn ich diese Männer sehe, die mit vor den Bauch geschnallten Babys rumlaufen...«ja, dann?»dann denke ich: Schöner war es, als sie ihre Babys auf den Schultern hatten. Oder auf dem Arm.«Sie macht sich jetzt über die Wochenendväter lustig, die sie beim Einkaufen beobachtet. Will Maron die Männer von früher, den Fünfzigerjahre- Familienvater, zurückhaben?»um Gottes willen. Was soll man denn mit denen anfangen? Nein, das meine ich überhaupt nicht.«in Artur Lanz spricht Lady, eine Freundin der Erzählerin, erstaunlich danebene Sätze, zum Beispiel:»Manche Männer seien nur schwul geworden, weil sie sich nur noch bei Männern wie Männer fühlen könnten.«freut sie sich auf das Gebrüll der Rezensenten, schon in dem Moment, in dem sie so einen Satz hintippt? Macht sie nicht, wenn nicht sich selbst, dann zumindest ihre Figuren lächerlich mit so einer Aussage?»Das macht doch nichts. Meine Figuren denken alles Mögliche. Es muss doch nicht stimmen.«die Schriftstellerin im Gartenstuhl erklärt jetzt:»ich habe nichts gegen schwule Männer. Aber Kinder adoptieren sollten sie nicht.«und den folgenden Satz möchte sie später, beim Zitate-Autorisieren, unbedingt noch dabeihaben: Frauen sollten ihr Privileg, Kinder zu kriegen, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Wir sind also in einem Buch, in dem, ähnlich wie bei seinem Vorgänger, in einem fort provokante Thesen formuliert werden: Der Verschwörungstheoretiker Gerald gefährdet seinen Arbeitsplatz mit einem auf Face book geposteten Mega-Unsinn (»Wir marschieren vorwärts ins Grüne Reich, aber nicht über Autobahnen, sondern über die Stromtrassen der Grünen«). Wobei sich beim Lesen schnell die Frage stellt, ob das Überschreiten der von der Autorin überall vermuteten Grenzen des Sagbaren allein schon gute Literatur produziert oder eher das Gegenteil der Fall ist. Für die Balance des Buches ist jedenfalls von Bedeutung, dass der Protagonist Artur Lanz eben kein Klimaleugner ist und seinem Freund widerspricht. Man wird der Autorin Maron also schwerlich vorhalten können, sich in ihrem neuen Roman zum Sprachrohr rechtspopulistischen Unsinns zu machen. Marons Argument, dass ihre Protagonisten nie allein ihre persönlichen Überzeugungen äußern, sondern stets, so auch in ihrem neuen Werk, das breite Spektrum deutscher Gereiztheiten zu Wort komme»es bleibt in diesem Buch ja nichts unwidersprochen«, überzeugt aber auch nicht. Wir nehmen die Autorin ins Kreuzverhör Versuch, einer professionellen Agentin der Provokation beizukommen: Will ihr Alter Ego, die Charlotte Winter, eigentlich recht haben, oder will sie, dass man ihr widerspricht?»sie will etwas verstehen.«würde sie sagen, dass ihre Charlotte Winter auch Plattitüden produziert?»weiß ich jetzt gar nicht so genau.«auch Ressentiments?»Die gibt es bei der Figur der Erzählerin sicher. Die gibt es auch bei anderen Figuren in diesem Buch.«Und bei ihr, Frau Monika Maron persönlich?»wahrscheinlich habe ich so was auch. Man hat es nicht gerne. Aber ich will nicht ausschließen, dass es das in meinem Denken gibt.«da sitzt sie in einer der bevölkerungsärmsten Regionen Deutschlands auf der grünen Wiese und beschreibt, wie die Gesellschaft kippt. Ist das nicht absurd? Es ist, mit Verlaub, nicht sonderlich produktiv, sich mit der Schriftstellerin über gesellschaftliche und politische Entwicklungen zu streiten. Gerne zitiert sie ihre Freundin, die Islamkritikerin Necla Kelek. Über Flüchtlinge hat sie betrüblich schlichte Dinge zu sagen. Windräder? Die 20 Prozent für die AfD in ihrer Region seien auch das Resultat des Missstands, dass sonst keine Partei mit dem Ärger der Menschen etwas anzufangen wisse:»es gibt in diesem Land keine legitime Opposition.«Und noch mal zugespitzt: In diesem Land werde jede oppositionelle Meinung sofort delegitimiert. Du liebes bisschen, natürlich ist es nicht egal, wenn 20 Prozent der Uckermärker sich wegen Windrädern im demokratischen Spektrum nicht mehr aufgehoben fühlen. Aber wer will diese Frau Maron denn nun sein, eine vorpommersche Bürgerrechtlerin oder eine Schriftstellerin, die im ganzen Land gelesen wird? Die große Frage, wie diese einst linke Autorin zu derjenigen wurde, die sie heute ist: Es muss eben auch für möglich gehalten werden, dass Monika Maron sich weniger verändert hat, als Kritiker und Leserschaft das wahrhaben wollen.»ich habe eine politische Biografie, seit Geburt«, heißt es bei ihr. Gleich mit ihrem ersten Roman Flugasche sei sie eine politische Schriftstellerin gewesen. Irritiert sie das gar nicht, dass sie der AfD nicht nur in einzelnen Punkten zustimmt, sondern praktisch die gesamte Programmatik dieser Partei ihren Zuspruch findet? Lässt sich ihr oft arg reflexhaftes Antoben gegen die Republik der großen Koa li tion noch unter einen aufklärerischen Widerspruchsgeist fassen?»dass ich rechtspopulistische Standpunkte vertrete, das ist doch schlicht nicht wahr.«viel von dem, was Monika Maron heute politisch äußert, lässt sich nur mit ihrer Prägung durch die DDR begreifen 37 Jahre lang hat sie in jenem Staat gelebt, in dem jede politische Äußerung, ganz gleich, ob sie von kritischer Seite oder den Trägern der Macht kam, ideologisch begründet zu sein hatte. Wenn sie heute klagt, sie fühle sich oft bösartig missverstanden, dann spricht daraus das Selbstverständnis vieler Alt-68er und ehemaliger Linker, die sich stets auf der guten Seite, bei den Unbequemen und den Außenseitern wähnten. Eine schöne Portion Selbstgerechtigkeit hat sich da mittlerweile eingeschlichen.»wer hat am Meinungskompass gedreht?«, fragte Maron in einem Essay. Und antwortet darauf in ihrem Garten:»Ich habe mich nicht verändert es sind dieselben Freiheitsideale, dieselbe Liberalität, dieselbe Offenheit für Themen. Aber ich reagiere allergisch, wenn Meinungen nicht mehr diskutiert, sondern diffamiert werden. Das habe ich im Osten so empfunden; und das empfinde ich jetzt zunehmend wieder.«ihr ist aber klar, dass sie mit ihren so demonstrativ unkorrekten Tiraden im Zeitalter von Trump keinen Blumentopf mehr gewinnen kann? Ihr fast mitleidiger Blick:»Ich brauche doch keinen Blumentopf mehr. Ich werde achtzig.«rauchen, lächeln, weiter Ungeheuerliches aussprechen: Merkwürdig achtzehnjährig wirkt die bald Achtzigjährige in ihrer Widerspruchslust und Renitenz. Letzte Frage im Maronschen Garten: Wer war der tollste Mann in ihrem Leben? Die viermal verheiratete Frau zögert:»das kann ich so nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es einen Mann gab, mit dem ich leben konnte und hätte weiter zusammenleben können, wäre er kein Alkoholiker gewesen.«pause. Er war wohl ein sehr männlicher Mann? Wir erleben jetzt, wie sie mit einem tiefen Zigarettenzug tief in der Vergangenheit verschwindet.»er konnte überhaupt nicht sehen, wenn ich die Küche aufwischte. Weil er fand, ich stelle mich zu blöd an. Dann sagte er (sie macht eine dunkle Stimme nach): Geh mal raus. «Abendglühen auf den vorpommerschen Feldern. Im Rückspiegel sieht der Reporter die Schriftstellerin einen wackligen Schritt zu einem Zaun hin machen sie streckt die rechte Hand nach einem Schaf aus. Und an diesem Anblick ist nun wirklich alles harmlos, alles okay. AA
48 48 FEUILLETON DIE ZEIT N o 28 MEIN LEBEN ALS FRAU Narzissmus, quo vadis? Über die Unterdrückung der Frau auf Kosten des Mannes und Instagram-Probleme Illustration: Rachel Levit für DIE ZEIT; Abb. (r.): T.C. Cannon (Kiowa/Caddo)/Sammlung Tia Zu Beginn der Sitzung sagte mein Therapeut Wolfgang G. zu meinem Kolumnen-Ich, dass er»stink sauer«sei, weil ich in der Zeitung dauernd über uns schreibe. Eigentlich wollte ich mit ihm über das Polizei-Problem meines jüngsten Sohnes sprechen, der, wenn ich mit ihm an der Polizei vorbeilaufe, jedes Mal in heimatfilmhafter Zeitlupe auf die Wache zurennt, während seine blonden Haare im Wind wehen und die Kirchglocken läuten, wobei der Polizist, der irgendwie immer den ganzen Tag rauchend vor der Tür steht, ihn sicher sofort durch die Luft wirbeln und verbeamten würde, wenn das möglich wäre, einfach weil das fast so süß wäre wie die Polizei- Tweets über gerettete Tiere. Pupsi, will ich meinem Sohn dann hinterherrufen, dass du die Polizei so mega findest, liegt ausschließlich daran, dass deine Bibliothek quasi systematisch mit Büchern ausgestattet wurde, die voller Polizisten sind, die Jungen wie dich über Deutschlands Straßen führen, und dass du ein Junge wie du bist, ja, das liegt daran, dass ich deine Mama bin und die Dinge liegen, wie sie liegen. Also, mein Sohn, hör auf mit dem Scheiß, ich fordere bedingungslose Solidarität was, wenn das auf Insta landet? Und das Instagram hätte direkt zu dem nächsten Tagesordnungspunkt geführt, den ich mit Herrn G. unbedingt hatte besprechen wollen, nämlich meiner Idee, Strafanzeige gegen In sta gram zu erstatten, weil ich einem Karl Marx nicht unähnlich kürzlich nachts diesen genialen Geistesblitz gehabt hatte, dass das Insta-Geschäftsmodell allein darauf basiert, dass Menschen süchtig danach sind, sich zu vergleichen, beziehungsweise von früh bis spät damit befasst sind, die Urszene ihrer Kindheit zu reinszenieren ( vom Umfeld kriegen), und dass all das zu einer brutalen Entsolidarisierung unter den Insta-Usern beziehungsweise der Menschheit an sich führt. Bei aller Liebe, hätte ich zu Herrn G. gesagt, aber es gibt Grenzen Menschheit, quo vadis? Aber Herr G. hatte ja ganz andere Dinge im Kopf, Herr G. war ja, wie angekündigt,»stink sauer«. Er fächerte sich mit einer alten taz-ausgabe etwas Luft zu, rutschte auf der Corbusier-Couch hin und her, und dann ging es los:»wie ich kürzlich in einem erfrischend unideologischen Artikel gelesen habe«, sagte Herr G. und wedelte mit seinem Smart phone,»leben wir im Zeitalter des KOLUMNISMUS, liebe Frau B., und die Währung, in der Ihr beträchtlicher Narzissmus gefüttert wird, ist das Generieren von Aufmerksamkeit, und dafür missbrauchen Sie MICH. Dafür ist Ihnen alles recht.«von ANTONIA BAUM Ich nickte. Herr G. hob den Zeigefinger und guckte noch mal auf sein Smart phone, um korrekt zu zitieren:»wie schon Ulrike Meinhof wusste, haben Kolumnistinnen regelmäßig eine Entlastungsfunktion für die jeweilige Zeitung, sie fungieren als renitente Feigenblätter«Herr G. malte an dieser Stelle Anführungszeichen in die Luft,»mit deren Hilfe die Zeitungen 1. den Eindruck erwecken können, die Kolumnistinnen dürften schreiben, was sie wollen, und 2. Profit, vulgo Aufmerksamkeit, generieren können. Ein abgekartetes Spiel.«Ich nickte ernst, ich wies Herrn G. vorsichtig darauf hin, dass ihm beim Gendern da eine kleine Übertreibung unterlaufen war, aber es ging direkt weiter:»frau B., ich will ganz offen zu Ihnen sein: Was Sie in Ihrer Funktion als Kolumnistin da perpetuieren, das ist die Knechtschaft der Frau, auf meine Kosten, wie gesagt. Sie sitzen zwischen lauter Männern und kriegen einen kleinen Vorgarten zugestanden, innerhalb dessen Sie ein wenig über die Stränge schlagen können.absolut richtig, Herr G., und insofern ist es doch nur folgerichtig, dass ich jede Woche zu IHNEN renne und dann darüber schreibe. Ich bin von meinen Chefs genauso abhängig wie von Ihnen. Außerdem: Was wollen Sie denn jetzt plötzlich mit den Frauen, ich dachte, Sie sind zumindest der Idee nach ein Roter und für das große Ganze? Und was kann ich dafür, dass Sie so einen schlechten Job gemacht haben und weiterhin machen?«es war ziemlich heiß. Herr G. tupfte sich mit einem Stofftaschentuch über die Stirn, ich beugte mich nach vorne, nahm die taz, die inzwischen auf dem Boden lag, und fächerte mir Luft zu.»sie«herr G. hob den Zeigefinger»rennen hier vor allem hin, weil Sie sich nicht ändern wollen.aber das ist doch Ihre Geschäftsgrundlage!«, rief ich und hätte ihn beinahe eine skru pel lose lahme Ente, eine machtbewusste Luftpumpe, einen Turbodeppen genannt, aber man konnte ja nie wissen, und deswegen sagte ich bloß, dass Leute mit seinem Beruf die narzisstischsten Persönlichkeiten überhaupt sind. Herr G.:»Ich bin kein Narzisst, ich komme von Adorno.«Und ich:»sie kommen von sich!«und er:»sie auch!«wir saßen einander etwa fünf Minuten schweigend nickend gegenüber, und die Situation war plötzlich von solcher Schönheit, dass ich sofort eine Insta-Story machen wollte, aber wir waren einfach zu verschwitzt. AA Im Feuilleton erscheinen im Wechsel vier Kolumnen. Lesen Sie nächstes Mal»Verhaltenslehren«von Andreas Bernard»All the Tired Horses in the Sun«heißt dieses Gemälde des indigenen US-Künstlers T. C. Cannon Eigensinnige Einzelne Das Kölner Museum Ludwig blickt zurück auf die amerikanische Kunst der Sechziger und Siebziger und fragt: Welche Künstlerinnen und Künstler fehlen hier? VON JÖRG SCHELLER Die Gesichtsmasken sind ein Segen für die Kunstkritik. Wer dieser Tage als Brillenträger Ausstellungen besucht, dem schiebt sich der eigene Atem als Filter zwischen Ich und Welt. Man tritt näher an die Exponate heran, versucht, sie überhaupt zu erkennen, und kommt so gar nicht erst auf die Idee, es gebe eine neutrale Perspektive, die alles überblickt. Und genau darum geht es in der Ausstellung Mapping the Collection. Die Kuratorin Janice Mitchell präsentiert USamerikanische Kunstwerke der 1960er- und 1970er- Jahre aus der Sammlung des Museums Ludwig in Köln. Bürgerrechtsbewegung, Black Panthers, Feminismus, Vietnamkrieg, Polizeigewalt und demokratische Teilhabe sind die zentralen Themen. Zumindest was Politik, Medien und Aktivismus betrifft, ist die Auswahl brandaktuell. Gleich am Eingang ist in Adam Pendletons Videoarbeit Gerade zurück aus Los Angeles (2016) der Satz»I can t breathe«aus dem Munde der Tänzerin Yvonne Rainer zu hören. Arbeiten von längst kanonisierten Künstlern wie Robert Rauschenberg und Carolee Schneemann kombiniert Mitchell mit»weiblichen, queeren, indigenen Künstler*innen sowie artists of color, die nicht in der Sammlung vertreten sind«. Sogleich vernimmt das innere Ohr den Aufschrei Tausender Twitter-Trolle, Neu- und Altrechter: Immer nur die angeblich Marginalisierten! Alles wird verqueert! Die Kunst der Diskurseliten hat den Kontakt zu den normalen Menschen verloren! Doch besteht das Anliegen solcher Ausstellungen nicht gerade darin, zu zeigen, dass die weniger Beachteten oder bis vor Kurzem gar Verfolgten auch»normale«menschen sind? Zwar balanciert der heutige Kunstbetrieb auf einem schmalen Grat zwischen Re-Ethnisierung und Re-Identitarisierung einerseits, Sichtbarmachen, Inklusion und Würdigen von Differenz andererseits. Aber grundsätzlich gilt: Je mehr wir kennen, je breiter die empirische Grundlage für unsere Urteile, desto besser. Wer kann schon aus dem Stand ein paar indigene Vertreter der amerikanischen Hard- Edge- Male rei aufzählen? Eben. Gefahr besteht derzeit eher darin, dass Sichtbarmachung zum tokenizing verkommt, zum Sich-Schmücken mit mutmaßlichen Unterprivilegierten, um auf karrieristische Weise die eigene Fortschrittlichkeit zu demonstrieren. Die Philosophin Nancy Fraser hat das als»progressiven Neoliberalismus«bezeichnet. Aber Mapping the Collection hat damit wenig zu tun. Zum einen besteht die Ausstellung überwiegend aus bekannten Positionen, die sich seit Langem in den Beständen des Museums befinden. Somit hat sie eher verstärkenden als Neues entdeckenden Charakter. Da ist etwa Martha Roslers legendäre Videoarbeit Semiotik der Küche (1975), in welcher die Künstlerin sich mittels der damals männlich konnotierten Semiotik über Klischees von Weiblichkeit lustig macht. Oder Claes Oldenburgs Fire Plug Souvenir (1968), ein zerknautschter Mini- Hydrant aus Gips, zeugt von leidvollen Demonstrationserfahrungen des Künstlers. Ein weiteres ikonisches Werk der Neo avant garde ist Ana Mendietas Fotoserie Ohne Titel (Facial Hair Transplants), in der die Künstlerin ihr Gesicht mit allerlei Bartvariationen beklebt (1972). Verbindendes Element der Exponate ist ihr Bezug zu den Umbrüchen der damaligen Zeit. Dass all das heute zum musealen Kanon gehört wie früher Reiterstandbilder, zeugt von einem gesellschaftlichen Wandel, der natürlich nicht abgeschlossen ist. Zum anderen handelt es sich bei den»queeren«,»indigenen«und»poc«mitnichten um eine Gruppe mit homogener Weltanschauung oder identischen Erfahrungen. Der kosmopolitische Lebenslauf der 1939 geborenen afroamerikanischen Künstlerin und Autorin Barbara Chase- Riboud liest sich wie eine lange Liste der»privilegien«, die man oft mit weißer Hautfarbe assoziiert: Elite-Uni, Reisen, Preise, Stipendien. Leon Polk Smith, der mit einem großformatigen abstrakten Gemälde vertreten ist, stammte zwar vom Stamm der Cherokee ab. Aber er wollte nicht als»indigener«wahrgenommen, sondern als Künstler ernst genommen werden. Nicht auf eine Identität festgezurrt zu werden dieses Privileg versagt gerade die gebildete, sich als progressiv verstehende Oberschicht der USA den»minderheiten«oft. Als»Last der Repräsentation«bezeichnete der Kunsthistoriker Kobena Mercer 1990 den Druck, in der Öffentlichkeit für die eigene»ethnie«stehen zu müssen, anstatt als eigensinnige Einzelne akzeptiert zu werden. Und an eigensinnigen Einzelnen besteht kein Mangel im Museum Ludwig. Corita Kent etwa war eine katholische Nonne, die pazifistisch-antirassistische Pop- Art produzierte. Es ist eine gute Entscheidung von Mitchell, nicht nur auf laute, plakative Protestarbeiten zu setzen, sondern auch auf subtile, fragende, ambivalente. Exemplarisch dafür stehen die Fotografien von Senga Nengudis Performances und Installationen. Die 1943 in Chicago geborene Künstlerin kombiniert die Ästhetik des Minimalismus mit westafrikanischen Ritualen und ließ sich von japanischer Avant garde inspirieren. Hier geht es nicht um diese oder jene»identität«. Es geht um das Dazwischen. So zeigt diese sehenswerte Ausstellung zuvorderst, dass unsere binären Kategorien wie»politisch oder unpolitisch«,»afroamerikanisch oder weiß«,»privilegiert oder unterprivilegiert«verlässlich an der Komplexität der Wirklichkeit scheitern. Museum Ludwig Köln, bis 23. August ANZEIGE KINO Paula Beer und Franz Rogowski SINDGRANDIOS. THE HOLLYWOOD REPORTER Kraftvoll und bezaubernd, EIN LIEBESMÄRCHEN. OUTNOW Paula BEER Franz ROGOWSKI Ein Film von CHRISTIANPETZOLD ENDLICH IM KINO AACHEN Apollo ASCHAFFENBURG Casino BAMBERG Lichtspiel BERLIN Capitol, Delphi Filmpalast, Kino International, Kant-Kino, fsk-kino, Hackesche Höfe Kino, Il Kino, Kino in der Kulturbrauerei, Kino Toni, Passage, Rollberg, Yorck, Kino im Kulturhaus Spandau, Union Friedrichshagen BIELEFELD Lichtwerk im Ravensberger Park BOCHUM Casablanca BONN Neue Filmbühne + Rex BRAUNSCHWEIG Universum BREMEN Schauburg + Gondel DARMSTADT Rex DRESDEN Programmkino Ost + Schauburg DÜSSELDORF Cinema ERLANGEN Lamm ESSEN Lichtburg FLENSBURG 51 Stufen FRANKFURT/MAIN Cinema, Mal Seh n, Astor Film Lounge FREIBURG Kandelhof GAUTING Breitwand GÖTTINGEN CinemaxX HALLE Puschkino HAMBURG Abaton, Holi, Elbe, Koralle, Studio, Zeise-Kinos HANNOVER Kino am Raschplatz HEIDELBERG Gloria + Kamera HEILBRONN Kinostar Arthaus KARLSRUHE Schauburg KASSEL Gloria KIEL Traum-Kino KÖLN Cinenova, Filmpalette, Odeon, Weißhaus KONSTANZ CineStar LEIPZIG Passage LEVERKUSEN Scala LUDWIGSBURG Caligari LÜNEBURG Scala MAINZ Capitol MANNHEIM Atlantis MARBURG Capitol MÜNCHEN ABC-Kino, City-Kinos, Kino Solln, Monopol, Neues Maxim, Studio Isabella, Rio-Filmpalast MÜNSTER Cinema NÜRNBERG Cinecitta, Metropolis OLDENBURG Casablanca OSNABRÜCK Filmtheater Hasetor PFORZHEIM Kommunales Kino POTSDAM Thalia REGENSBURG Kinos im Andreasstadel ROSTOCK Lichtspieltheater Wundervoll SAARBRÜCKEN Filmhaus SEEFELD Breitwand STARNBERG Breitwand STUTTGART Atelier am Bollwerk TÜBINGEN Atelier ULM Mephisto WEIMAR Lichthaus WIESBADEN Apollo WUPPERTAL Cinema WÜRZBURG Central im Bürgerbräu Gute Filme gibt s nicht nur im Kino: Fernsehserien Seichtodersuchterzeugend? DiebestenStaffelnder Saison im Überblick. Der besseredreh Wirschreiben jede Wocheden»Tatort«um. WarummachenSie das? Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren sprechen über ihre Projekte. Und obdrama oder Dokumentarfilm die wichtigsten Kinostarts der Woche: alles unter
49 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 LITERATUR FEUILLETON 49 In Haifa liegt die Lösung! Foto (Ausschnitt): Heike Steinweg/laif Der Philosoph Omri Boehm reaktiviert in»israel eine Utopie«vergessene Ideen für ein Ende des Nahostdramas VON MICHA BRUMLIK SACHBUCH Vor nunmehr 53 Jahren, im Juni 1967, eroberte der von mehreren arabischen Staaten bedrohte, gerade einmal 19 Jahre alte Staat Israel in einem militärisch brillanten Präventivschlag die Golanhöhen, den Sinai, das Westjordanland sowie den östlichen Teil Jerusalems. Während Israel später den Sinai räumte, Ostjerusalem und die Golanhöhen jedoch förmlich annektierte, blieb das Westjordanland offiziell unter Besatzungsherrschaft und in drei Verwaltungszonen israelischen, palästinensischen und gemischten Charakters aufgeteilt. Vor diesem historischen Hintergrund muss man das wohl bedeutendste Buch zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts lesen, das in den vergangenen Jahren erschienen ist. Omri Boehms Israel eine Utopie könnte die lähmende Resignation des immerwährenden Mantras von der Zweistaatenlösung überwinden. Der Autor des Buches, der 1979 in Israel geborene und in New York lehrende Philosoph Omri Boehm ein ausgewiesener Spezialist für die Philosophen Immanuel Kant, Baruch Spinoza und Leo Strauss, greift dazu auf die Gründerväter des Zionismus zurück. Sein Buch erscheint in einer denkbar brisanten Lage. Schon vor der jüngsten Debatte um den zu Unrecht des Anti semi tis mus geziehenen Theoretiker Achille Mbembe häufen sich die Vorwürfe, dass der Staat Israel im Westjordanland de facto eine Kolonialherrschaft mit einem Apartheidsystem errichtet habe. Ein Vorwurf, der von israelischer Seite stets mit dem Hinweis zurückgewiesen wird, dass es ja»nur«um eine Besatzungsherrschaft gehe. Die in dieser Frage ungewöhnlich aufmerksame Weltöffentlichkeit einschließlich der deutschen Regierung beharrt indes auf der Basis von UN-Beschlüssen noch immer auf einer künftigen»zweistaatenlösung«, obwohl doch alle Beteiligten und Interessierten seit Jahren genau wissen, dass es diese»lösung«wegen der faktischen Besiedlung des Westjordanlandes mit mehr als jüdischen Israelis niemals geben wird. Derzeit jedenfalls harrt diese internationale Öffentlichkeit mit gespannter Nervosität darauf, ob die gegenwärtige israelische Regierung unter Premier Netanjahu mit Unterstützung von Donald Trump wie angekündigt Teile des Westjordanlandes förmlich annektieren und damit eine internationale Krise sowie palästinensische Gewaltausbrüche provozieren wird. Omri Boehm geht angesichts dieser komplizierten Lage weit in die Geschichte des Zionismus zurück und zeigt, dass diese Bewegung ursprünglich unter politischen Vorzeichen entstanden ist, die es seit 1918 nicht mehr gibt: in einer»welt von gestern«(stefan Zweig), einer Welt vor der Herausbildung klassischer Nationalstaaten, in der Welt des Habsburgerreiches und des Osmanischen Reiches mit ihren diversen ethnischen Gruppen. Boehm schlägt nun eine begriffliche und damit institutionelle Trennung von ANZEIGE Unter Pfarrerstöchtern EIN PODCAST FÜR KIRCHENFERNE WAS DIE BIBEL ÜBER DIE MENSCHHEIT ERZÄHLT JETZT ANHÖREN: Selbstbestimmung«hier sowie»staatlicher Souveränität«dort vor. Also eine Art binationalen Staat, wie ihn schon in den 1920er-Jahren der Brit Schalom gefordert hatte, ein Friedensbund deutschsprachiger jüdischer Intellektueller, unter ihnen Martin Buber, Ernst Simon, Hugo Bergmann, der Max-Weber-Schüler Arthur Ruppin sowie Gershom Scholem. Omri Boehm: Israel eine Utopie. A. d. Englischen v. Michael Adrian; Ullstein Verlag, Berlin 2020; 220 S., 20,, als E-Book 16,99 Illustration: Lea Dohle Freilich: Wäre es nur die Erinnerung an diese großen Geister, so könnte man den Gedanken eines binationalen Staates sofort wieder vergessen ein weiterer Fall von naivem Gutmenschentum! Doch bietet Boehm, der sich selbst als entschieden liberalen Zionisten versteht, einen zusätzlichen Trumpf auf: Er kann nachweisen, dass diesen Gedanken mutatis mutandis nicht nur Theodor Herzl hatte, der Begründer des Zionismus, sondern auch andere wichtige Zionisten, vor allem der brillante Wladimir Jabotinsky ( ), Ahnherr des Rechtszionismus. Doch ließe sich auch dieser Hinweis mit dem realpolitischen Argument abwehren, dass sich seither nicht nur der industrielle Massenmord an sechs Millionen europäischen Juden ereignet hat, sondern auch siebzig Jahre israelischer Geschichte vergangen sind, mit, je nach Zählung, vier oder fünf israelisch-arabischen Kriegen. Was aber bisher hierzulande wirklich unbekannt war: Genau solch ein Plan wurde detailliert von dem ersten rechtszionistischen Likud-Premier Israels, dem späteren Friedensnobelpreisträger Menachem Begin, entworfen machte Begin auf Drängen des ägyptischen Staatschefs Anwar al-sadat und des amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter einen Vorschlag, der 21 Punkte umfasste, darunter die Abschaffung der Militärverwaltung in Judäa, Samaria und Gaza zugunsten eines Selbstverwaltungsgremiums der arabischen Einwohner. Dieses sollte eigenständige Behörden von der Erziehung über das Gesundheitswesen bis zur Justiz schaffen. Vor allem aber wurde den arabischen Einwohnern der eroberten Gebiete von Begin die Möglichkeit eingeräumt, zu israelischen Bürgern zu werden. So hieß es 1977 in Punkt 15:»Einwohnern Judäas, Samarias und des Gaza-Distrikts, die sich gemäß der ihnen gewährten Option für die israelische Staatsangehörigkeit entscheiden, wird in Übereinstimmung mit dem Wahlrecht die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts für die Knesset zustehen.«zudem wurde den arabischen Einwohnern und das war im Rahmen zionistischer Bodenpolitik wahrhaft revolutionär zugestanden,»in Israel Land zu erwerben und sich dort niederzulassen«. Tatsächlich legte Menachem Begin den nach internationalen Beratungen leicht veränderten Vorschlag 1977 der Knesset vor. Nach Aufhebung der Fraktionsdisziplin wurde er mit 64 Jastimmen, 8 Neinstimmen und 40 Enthaltungen angenommen er wurde also Gesetz. Damit wurde eine Utopie Wirklichkeit, die Wladimir Jabotinsky bereits 1906 (!) skizziert hatte. Diesem ging es staatstheoretisch um die Differenz von Autonomie und Föderation:»Autonomie und Föderation unterscheiden sich durch die Art ihres Zustandekommens scharf von ein ander: Im ersten Fall gibt der Staat einen Teil seiner Souveränitätsrechte auf und überträgt sie einem der Teile, aus denen er sich zusammensetzt. Das nennt man Autonomie.«Aus diesen Anregungen Jabotinskys und Begins entwickelt der Philosoph Boehm seine eigene Utopie: die binationale Vision einer»republik Haifa«. Anders als Jerusalem, das Symbol jüdischer Sehnsucht, anders auch als Tel Aviv, jene vibrierende und säkulare Strandstadt, ist Haifa eine kosmopolitische Stadt, in der»araber und Juden wie selbstverständlich die Liebe, das Gespräch und das Leben mit ein an der teilen«. Wenn Israel, so Boehm,»eine zivilisierte Zukunft haben soll, [...] wird es sich das Leben in Haifa zum Vorbild nehmen müssen«. Nun ist der liberale Zionist Omri Boehm weder Kenner noch Anhänger des Philosophen Ernst Bloch, der sich in seinem monumentalen Prinzip Hoffnung unter anderem auch mit dem Zionismus befasst hatte. Nein, Boehm ist Kantianer. Es war Immanuel Kant, der seine ganze Philosophie als Antwort auf vier Fragen verstand: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Und eben aus dieser Postulatenlehre Kants wiederum hat der erklärtermaßen areligiöse Philosoph Omri Boehm einmal gefolgert, dass das moralische Gesetz zur Annahme Gottes und diese Annahme wiederum geradezu eine Pflicht zur Hoffnung bedeute. So auch im Falle Israels und Palästinas, von Juden und Arabern in diesem Sinne kann man Omri Boehms hoffnungsvolle Vision verstehen. Micha Brumlik, geboren 1947, ist emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt/Main. Kürzlich erschien sein Buch»Antisemitismus«(Reclam) ROMAN Anna Katharina Hahn, Jahrgang 1970, ist seit ihrem Debüt-Roman»Kürzere Tage«Spezialistin für Bürgerlichkeitsgrusel Unheilsprosa voller Liebe Anna Katharina Hahns fabelhafter neuer Roman»Aus und davon«erzählt eine Familiengeschichte zwischen Pietismus und Abgrund VON HUBERT WINKELS Mit dem ersten Satz klebt ein Pfannkuchen an der Decke,»gleich neben der Hängelampe, die einen gelben Lichtschein auf den Küchentisch wirft«. Wie kommt er dahin? Der kleine, dicke Bruno hat ihn im Zorn aus der heißen Pfanne nach oben geschleudert. Zum Entsetzen seiner Oma Elisabeth, die auf ihn aufpassen muss, während die gestresste Mama sich zum ersten Mal eine Auszeit vom Familienleben gönnt, in New York und Pennsylvania. Diese kleine Genreszene ist so reich an Realismus und versteckter Bedeutung wie frühe niederländische Genrestücke aus dem 17. Jahrhundert. Sie erzählt von den Verwerfungen in einer modern-bürgerlichen schwäbischen Familie, von lebenspraktischer Überforderung, Leistungsdruck, normativem Stress und slap sticknaher Hysterie. Zugleich aber versammelt dieses Eingangsbild mit der runden Gestalt des Pfannkuchens, seiner prekären Lokalisierung, mit dem gelben Lichtkreis, der später auf den Mond bezogen wird und dieser wiederum auf den schwäbischen Monddichter Mörike, und mit dem Küchentisch als Ort der pietistischen Verinnerlichung und kulinarischer Vergemeinschaftung so viele starke Motive auf allerengstem Raum, dass es schon beinahe komisch ist. Im Poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts, den Anna Katharina Hahn zweifellos mag, ist solche symbolische Dichte nicht ungewöhnlich, aber heute? So viel mutwillig zusammengenähte Alltäglichkeit und Hochbedeutsamkeit in der pragmatisch-lässigen Gegenwart? Tatsächlich liegt die Kunst der geradezu bekenntnishaft schwäbischen Autorin darin, diese Spannung auszureizen, sie zu überreizen. Hahn steigert den Realismus bis ins Granulare der zum Backen benötigten Hefebröckchen, und die Symbolik bis in die Motivsprache des Alten Testaments, der pietistischen Gebete, der Märchen und spätromantischen Gedichte. Ein kleines Wunder, dass dieser Ba lance akt so leichthändig gelingt. Dazu gehört die Ba lance von Tragik und Humor. Man weiß oft nicht, ob man lachen oder weinen soll. So wenn der zu Hause mit Diäten gequälte und von seinen Schulkameraden mit den Worten»Bruno, Bruno, dicker fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dir eine reinhauen«gejagte Junge sich im Abfall eines Fast-Food- Ladens versteckt, in dessen Gerüchen vor Hunger fast vergeht und dann das einzig Essbare, eine Bifi-Wurst, an eine ängstlich streunende dicke Katze verfüttert; so wenn er sodann die raue Zunge der Katze spürt, ihr freudiges Schnurren, das nur ihm alleine gilt, und sie glücklich mit nach Hause nimmt. Das ist eine in die Unheilsprosa der Verhältnisse eingeschlossene Liebesgeschichte von Bedeutung, denn die Kirke getaufte Katze bildet zusammen mit der Rückkehr der Mutter den markanten Schlusspunkt des Romans. Kirke hat Junge geworfen, drei davon schließt ihr wie der Pfannkuchen warmer und kreisförmiger Körper völlig ein; ein so rührendes Bild, dass sich, wie im gesamten Roman, sofort auch der Abgrund im Glück, der Schrecken im Schönen zeigt: Zwei tot geborene Kätzchen liegen daneben, werden in ihrer traurigen, Abscheu erregenden Gestalt in einer Plastiktüte begraben, emblematisch verpackt. Von solchen Motiven körperlichen und seelischen Elends ist der scheinbar so munter weibliche und turbulente Familienroman durchsetzt. Anna Katharina Hahn erzählt den Alltag von vier schwäbischen Generationen, mit fleißigen, immer gewissensgeplagten starken Frauen im Mittelpunkt. Sie wechselt häufig die Erzählperspektive. Von der Großmutter lesen wir in der personalen Form, mit viel erlebter Rede. Die Kapitel zur Mutter Cornelia sind Ich-Erzählungen, als Tagebucheinträge präsentiert. Zwischendurch sehen wir die Welt durch Brunos Anna Katharina Hahn: Aus und davon. Roman; Suhrkamp Verlag, Berlin 2020; 308 S., 24,, als E-Book 20,99 hungrige Augen. Und doch ist jede Rede, jede Regung der Figuren beschwert durch die imaginäre Anwesenheit aller anderen. Das pietistische Über-Ich schläft nie. Nein, leicht ist so ein Leben nicht, aber man kann von seinen Zwängen erzählen, und wenn man Anna Katharina Hahn ist, sogar auf eine leichte Weise. Wie schon in Hahns vorigem Roman Das Kleid meiner Mutter wird ein weiterer, ein irrealer märchenhafter Erzählstrang immer dicker. Eine Stoffpuppe, genannt»der Linsenmaier«erzählt von einer vor hundert Jahren unternommenen Amerikareise mit der Urgroßmutter des schwäbischen Clans. Der mit Linsen gefüllte Leinenleib des Linsenmaier hat einiges auszuhalten bei diesem frühen Familienbesuch in Übersee. Er landet in einer Gastwirtschaft des Schreckens. Mehrere Familienmitglieder waren bei einem Brand auf einem Ausflugsboot schwer verletzt worden. Die einst stolze Wirtin, Brunos ferne Ururgroßtante, ist nur noch ein Bündel rohen Fleischs, mit Morphiumgaben am Leben gehalten. Das ist der historisch und symbolisch tiefste Punkt der familiengenealogischen Geschichte, eine Art Äquivalent für die»leiche im Keller«im klassischen Kriminalroman. Und dann wird auch noch das nahrhafte Innenleben Linsenmaiers verspeist: Kannibalismus im Kinderzimmer, denn diese zum Schauerstück ausartende Amerikageschichte erzählt Oma Eli ihrem Bruno zum Einschlafen. Eine märchenhafte Episode, die ein Drittel des Romans einnimmt und ihn auf gewollt groteske Weise in den Proportionen verzerrt. Ja, eine pietistisch und feministisch inspirierte Familiengeschichte ist Aus und davon auch, aber vor allem ist der Roman eine böse, satirische, schwarzromantische Fantasie in Callots oder eben hoffmannscher Manier. Zubereitet mit viel Mehl, Milch und Hefebrocken und größter Könnerschaft.
50 50 FEUILLETON 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Foto: Jason Richardson/Alamy/Mauritius Die 30-jährige Songwriterin Laura Marling lebt in London»Jetzt ist die Zeit für Musik«Ihr neues Album hat Laura Marling wegen der Pandemie vorgezogen und statt Konzerte gibt sie jetzt Gitarrenunterricht auf Instagram. Ein Gespräch über Pop und Corona Laura Marling telefoniert aus ihrer Londoner Wohnung, in der sie mit ihrem Lebensgefährten und einer ihrer Schwestern wohnt. Die Britin wurde 2008 als 18-Jährige mit ihrem Debüt»Alas, I Cannot Swim«berühmt. Seitdem folgten weitere Platten, die von der Kritik gefeiert wurden und Marling immer wieder Vergleiche mit Joni Mitchell einbrachten. Soeben ist ihr neues Album»Song for Our Daughter«erschienen. DIE ZEIT: Sie haben die Veröffentlichung von Song for Our Daughter mit der Begründung vorgezogen, dass sich dieser Tage die Rezeption von Musik grundlegend geändert habe. Wie meinen Sie das? Laura Marling: Meine neuen Songs sind bereits vor einiger Zeit fertig geworden, und es wäre unsinnig gewesen, die Musik nicht schnell zu veröffentlichen. Mir ist völlig klar, dass ein Album auch ein Produkt ist, das durchdacht vermarktet werden soll. Aber es war ein erfrischendes Gefühl, die Songs einfach so ins Netz zu stellen. Denn jetzt ist die Zeit für Musik, man kann sich endlich mal wieder ganz auf sie einlassen. ZEIT: Hat die Pandemie Ihre Hörgewohnheiten verändert? Marling: Klar, ich habe so viel Musik gehört wie schon seit Jahren nicht mehr. Hier in London war uns ein Spaziergang pro Tag erlaubt und ich wähle jeden Morgen ein Album aus, das ich dann unterwegs ungestört von Anfang bis Ende durchhöre. Das ist wirklich eine fantastische Erfahrung. Ich habe heute schon das großartige neue Fiona-Apple- Album gehört. ZEIT: Sie haben die Angewohnheit, zwischen Ihren Alben gern mal eine Auszeit zu nehmen, um dann etwas komplett anderes zu machen: Sie haben sich als Köchin und Yogalehrerin ausbilden lassen und den Motorradführerschein gemacht. Was treibt Sie? Marling: Das ist mein Trick, um mich zu motivieren, das Musikmachen frisch anzugehen. Letztlich frage ich mich nach jedem Album: Bist du dir wirklich sicher, dass Songwriter der richtige Job für dich ist? Ich glaube, dass es ganz gesund ist, die eigene Existenz in schöner Regelmäßigkeit infrage zu stellen. Dr.h.c.DieterE.Zimmer * WirtrauernumdenehemaligenFeuilletonchef, dengroßenessayistenundübersetzer, unserenliebenswürdigenkollegenundfreund. SeinerakribischenNeugierundseinemErzähltalent, dassichaufzahlreichenwissensgebietenentfaltete, hatdiezeitvielzuverdanken. ZEIT: Ist es so langweilig, Alben einzuspielen? Marling: Nein, ganz im Gegenteil. Ein Album zu schreiben und dann einzuspielen, das ist ein turbulenter Prozess, der mich jedes Mal an Grenzen führt. Es ist mir immer wieder vollkommen unklar, ob meine neue Musik nun brauchbar ist oder doch nicht. Ich empfinde diesen Prozess als sehr kräftezehrend, habe das jetzt achtmal mitgemacht, konnte mich noch immer nicht daran gewöhnen und bin immer so ausgelaugt danach, dass ich etwas anderes ausprobieren muss. ZEIT: Waren Sie mal versucht, ganz mit der Musik aufzuhören? Marling: Nein, bislang hat mich keine meiner anderen Tätigkeiten so sehr gepackt. Aber es sind diese Abwechslungen, die mir guttun. Manchmal ignoriere ich Musik auch einfach mal für zwei Monate und lese stattdessen jeden Tag. ZEIT: Sie sind der Albtraum Ihrer Plattenfirma, oder? Marling: Das kann man wohl so sagen, ja. ZEIT: Zuletzt haben Sie Psychologie studiert. Warum? Marling: Ich habe mit 16 die Schule verlassen und hatte immer das Gefühl, meine Ausbildung nachbessern zu müssen. Außerdem hat mich einfach das Thema interessiert. Der Blick der Psychoanalyse auf Kultur hat mich auch schon lange fasziniert. Damit einher gingen eine frische Perspektive auf Feminismus, Genderpolitik und solche Themen. ZEIT: Wie so viele Ihrer Kollegen haben Sie begonnen, das Internet verstärkt zur Kommunikation mit Fans zu nutzen. Zum Beispiel veröffentlichen Sie auf Instagram Gitarren-Tutorials. Marling: Mir bietet das eine gewisse Routine in Zeiten, in denen eigentlich alles auf den Kopf gestellt wird. Meine Tournee, auf die ich mich gefreut hatte und die natürlich auch ausfällt, hat ein Vakuum in meinem Leben hinterlassen, das ich nun füllen muss. Da sind meine Instagram- Gitarren-Tutorials ein dezenter Ersatz, weil ich dann eben so mit meinem Publikum kommuniziere, und den Zuschauern wiederum bieten sie vielleicht auch eine willkommene Abwechslung. Durch die erzwungene Zeit zu Hause versuchen sich auch viele Menschen an neuen Dingen, und Gitarre spielen zu lernen, das ist ja nicht so schlecht. ZEIT: Rauben die ganzen Online-Filmchen von unrasierten Musikern, die in Schlafanzughosen in ihrem Heimstudio vor sich hin musizieren, der Kunst nicht auch den Zauber? Marling: Diese Gefahr sehe ich definitiv. Genau deshalb habe ich mich dafür entschieden, mich auf kurze Gitarren-Tutorials zu beschränken, denn da bleibt dann doch eine gewisse Distanz erhalten, was ich wichtig finde. Ich möchte nicht zu viele Details meines Privatlebens öffentlich machen. Außerdem ist mein Alltag sowieso ziemlich trostlos. ZEIT: Auf Ihrem neuen Album machen Sie sich Gedanken über das Verhältnis zwischen Eltern und Töchtern. Sie haben mit 16 die Schule verlassen und sind nach London gezogen, um sich als Musikerin zu versuchen. Waren Ihre Eltern da nicht entsetzt? Marling: Sie haben das erstaunlich gefasst zur Kenntnis genommen, was wohl auch daran lag, dass mein Vater ebenfalls Songs geschrieben hat. Er hat also die Welt, zu der es mich hinzog, verstanden. Und ich war eher das Gegenteil eines wilden Kindes. Ich habe vor meinem 21. Geburtstag keinen Alkohol getrunken, und in London bin ich zu meinen beiden älteren Schwestern gezogen. Außerdem hatte ich auch relativ schnell einen Plattenvertrag. Die Schule zu verlassen war letztlich gar keine Kurzschlussentscheidung, was meinem Vater bewusst gewesen ist. Aber jetzt zurückblickend bin ich doch fassungslos, dass mir das damals erlaubt wurde. Ich war jung und brav, aber von jeglicher Reife weit entfernt. ZEIT: Ihr Vater betrieb eine Weile lang ein Aufnahmestudio. Wie sehr hat Sie das beeinflusst? Marling: Mein Vater ist ein großer Einfluss auf mich gewesen. Allein schon deshalb, weil er mir beigebracht hat, Gitarre zu spielen, und mir viel Musik nahebrachte, die ich bis heute liebe, Joni Mitchell oder Neil Young. Er hat mir vor allem das Gefühl dafür vermittelt, dass Musik aufregend und ständig in Bewegung ist. Allerdings wollte er nicht alles mitmachen, und weil er von Digitaltechnik nichts hielt, hat er sein analoges Studio damals dichtgemacht, als ich noch klein war. Ich wiederum habe dann erlebt, wie das Digitale aus der Mode gekommen ist und nun alle wieder mit analoger Technik einspielen. ZEIT: Wird das Songwriting mit den Jahren eher schwieriger oder einfacher? Marling: Puh, es wird eher schwieriger. Je länger man das macht, desto mehr grübelt man darüber nach. Als ich jung war, habe ich mir keine Sekunde lang den Kopf darüber zerbrochen, was ich da eigentlich gerade mache. Da habe ich mir alles zugetraut, weil es mir nicht in den Sinn kam, dass ich scheitern könnte. Andererseits bin ich heute eine sehr viel bessere Musikerin als früher, was die Arbeit an Musik sehr viel interessanter macht. Aber natürlich beschleicht einen mit den Jahren immer öfter das Gefühl, sich zu wiederholen. ZEIT: Sie sind 30 geworden. Wie sehr ändert das Älterwerden die Perspektive beim Schreiben? Marling: Ich werde gerne älter und genieße die Verantwortung, die damit einhergeht. Als ich jung war, träumte ich von Los Angeles. Vor einigen Jahren bin ich dann tatsächlich für eine Weile dort hingezogen und habe irgendwann realisiert, dass ich die USA zwar sehr genieße, aber da letztlich nicht hingehöre. Ich habe eine Schwäche für schöne Illusionen, aber bin dann doch nach London zurückgekehrt und habe mich wieder in die Community eingegliedert, die ich zurückgelassen hatte. Nur dass ich die jetzt sehr viel mehr zu schätzen weiß. Ich habe gelernt, Verantwortung für andere zu übernehmen, und kümmere mich beispielsweise um eine alte alleinstehende Tante von mir, für die ich nun immer einkaufen gehe. Früher habe ich die Bedürfnisse anderer nicht so klar gesehen. Ich war zehn Jahre lang fast ausschließlich mit mir und meiner Musik beschäftigt. In L.A. bin ich zur Besinnung gekommen. ZEIT: Sie verbringen nun notgedrungen sehr viel mehr Zeit als üblich zu Hause. Bedeutet das, dass Sie mehr Songs schreiben? Marling: Nein, ich habe zwar in jedem Raum eine Gitarre liegen, komme aber kaum noch zur Musik, denn auf einmal ist mein Tag voll von Dingen, die ich so noch nicht kannte: Videokonferenzen, Videointerviews und solches Zeug. Aber daran, nur noch zu Hause zu sein, könnte ich mich durchaus gewöhnen. Das Gespräch führte Christoph Dallach
51 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 FEUILLETON 51 Foto: Christian Schulz/Schramm Film Wie kann das sein? Soeben wurde ein Kind geboren, doch die Menschen wirken merkwürdig leblos. Wie eingefroren sind ihre Blicke, zwei ausgestreckte Arme hängen starr in der Luft. Von rechts betritt eine Nymphe die Szenerie, ihr Kleid weht, auf dem Kopf trägt sie eine Schale mit Früchten doch sobald der Blick auf sie fällt, scheint alles lebendig zu werden. Das Gemälde, auf dem die Nymphe ihren berühmten Auftritt hat, heißt Die Geburt Johan nes des Täufers und stammt von dem Renais sance- Maler Domenico Ghirlandaio. Johannes ist, rein zufällig, auch der Name des jungen Schnösels, der in Chris tian Petzolds neuem Film Undine seiner Freundin den Laufpass gibt, gleich in der ersten Szene. Mit ein paar abwaschbaren Standardphrasen erklärt er ihr, dass er eine andere Frau kennengelernt habe, vielleicht nur eine Liebelei, doch wer wisse das schon. Seine Freundin wirkt gefasst und antwortet ihrem treulosen Johannes (Jacob Matschenz) seelenruhig:»wenn du mich verlässt, muss ich dich töten, das weißt du doch.«undine Wibeau (Paula Beer) heißt die grausam drohende Frau, die das Wort Wasser schon im Namen trägt. Ihre Gesten und ihr Gesichtsausdruck sind streng kontrolliert, und das Business-Outfit ist ihr Schutzpanzer, doch in ihrem Büro versinkt sie schon einmal in einen jähen, weltentrückten Schlaf. Die promovierte Historikerin führt Touristen durch die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und zeigt ihnen Modelle, die von nichts anderem erzählen als von der rücksichtslosen Dynamik einer Metropole. Nichts bleibt. Nichts ist von Dauer. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Alles ist im Fluss. Und wo wurde Berlin einst gebaut? Am Wasser. Das Undine-Märchen ist der Prototyp einer Männerfantasie, vor allem das 19. Jahrhundert verehrte die Meerjungfrau abgöttisch. Doch die schaumgeborene Undine, die von Männern erlöst werden und im Fall von deren Untreue zurück in die Fluten gehen muss, provozierte auch feministischen Widerstand. Ingeborg Bachmann rechnet in ihrer Erzählung Undine geht mit dem seelischen Sadismus der Männerwelt ab; die amerikanische Filmregisseurin Jose phine Decker macht in Butter on the Latch aus Undine einen Rache-Engel, der einen widerwilligen Lover bei romantischem Vollmond lustvoll im Weiher ertränkt. Ob Traum oder Realität man weiß es nicht. Bei Petzold ist Undine eine Freelancerin, sie arbeitet frei, und das darf man wörtlich nehmen: Sie lebt auf der Schwelle zwischen Natur und Gesellschaft und sucht in der Menschenwelt ganz wie im Original die absolute Liebe, die Dauer und die Treue. Doch zugleich leidet sie unter ihrem Fluch, sie spürt ihre Unfreiheit, sie möchte lieben und nicht morden. Undine, die mythische Figur, will dem Mythos entrinnen und den Bann ihrer Naturverfallenheit brechen. Im Museums-Café wird sie von einem jungen Mann angesprochen, und schon im nächsten Moment finden sich Undine und ihr Bewunderer ausgelöst durch eine ungeschickte Bewegung durchnässt im Trümmerhaufen eines zerborstenen Aquariums wieder. Später sieht man, wie die beiden, versunken in ihre eigene Verliebtheit, Berlin durchstreifen, die kalte, babylonische Stadt. Undines neuer Freund ist Industrietaucher von Beruf, und auch sein Name hat mit Wasser zu tun: Er heißt Christoph (Franz Rogowski) trägt also der christlichen Legende nach Menschen ans rettende Ufer. Wenn er Unterwasserturbinen repariert, begegnet ihm schon einmal ein Wels von mythischer Größe. Das Riesentier mit Riesen- Wenn Mythen lügen Christian Petzold erzählt in seinem Film»Undine«das Märchen des Wasserwesens neu mit fantastischen Bildern VON THOMAS ASSHEUER Die Wasserfrau Undine (Paula Beer) und ihr sanftmütiger Industrietaucher Christoph (Franz Rogowski) schnurrbart hat einen waschechten Wagner- Namen er heißt Gun ther. Gunther, der Wels, kreuzt wieder auf, als Christoph mit Undine in seinen Arbeitsplatz abtaucht, in das Rückhaltebecken einer Talsperre. Petzold gelingen hier fantastische Bilder; im opak einfallenden Licht gleitet das Paar vorbei an einem versunkenen Torbogen, darauf steht»undine«geschrieben, sogar ein Herz ist zu sehen. Während die Kommunikation an Land eine Quelle von Zwietracht und Verfehlung ist, verstehen sich die Taucher im Naturfrieden des Wassers blind; in den Blasen und Sphären sind beide ganz in ihrem Element. Edelkitsch im Silbersee? Ja, aber genau kalkuliert. Traumverloren und von Gun ther durch die Fluten gezogen, streift Undine ihre Ausrüstung ab. Christoph muss die Ertrinkende ins Leben zurückholen der Tauchgang in den Ursprung hätte sie fast umgebracht. Nach dieser Schlüsselszene hat der Film zwei Möglichkeiten und entscheidet sich für eine dritte. Petzold könnte sagen: Zurück zur Natur, baden wir in den Wassern des Ursprungs. Oder, zweite Möglichkeit: Wie gut, dass die Zivilisation die mythische Natur fest im Griff hat; nur die naturbelassene Undine wird von jenem Fluch eingeholt, dem wir Modernen entkommen sind. Petzold hat eine andere Idee, und sie ist großartig. Warum ist Undine eine Historikerin? Warum wandert die Kamera (Hans Fromm) im Museum so ausdauernd über die Stadtmodelle? Weil die Modelle das Große im Kleinen sind, sie sind erstarrte Unruhe, gefrorene Vergänglichkeit, stillgestellte Zeit. Sie zeigen die Geschichte als mythischen Wiederholungszwang, als Aufbauen und Niederreißen, als Trennung und Teilung, als permanenten Verrat und organisierte Treulosigkeit und als Spekulation. Schon im Kaiserreich, erfährt man, wetteten Berliner Investoren auf steigende Grundstückpreise und trieben die Mieten in die Höhe. Gut hundert Jahre später, also heute, ist bei Petzold das ganze Leben Spekulation, selbst die Liebe muss sich amortisieren: Undines Ex- Freund Johannes, so scheint es, hat sich mit seinen erotischen Investments in das Luxusnest einer Karrierefrau (Julia Franz Richter) hinaufspekuliert nur um kurz darauf die Lust an der Neuen zu verlieren. Nun will er zurück zu Undine.»Du siehst sexy aus in deinen Ar beitssachen«, schmeichelt er ihr, doch das ist bloß der Kapitalismus des Herzens er will Undine erneut als sein Eigentum in Besitz nehmen.»die Nymphe ist eine heidnische Göttin im Exil«, hat der Kunsthistoriker Aby Warburg mit Blick auf Ghirlandaios Gemälde einmal gesagt. Mit diesem Bild beginne die moderne Imaginationsgeschichte der Wasserfrau, und ihre wichtigste Aufgabe sei es, unsere erstarrte Einbildungskraft wieder in Bewegung zu setzen. Mit verblüffenden Anspielungen macht Petzold aus dieser Tradition Kinostoff reinsten Wassers, aber er tut es viel radikaler, als es die zarte romantische Deckschicht seines Films vermuten lässt: Die Liebe zwischen Undine und Christoph verkörpert gleichsam das Gegenprinzip zur Welt der ökonomischen Menschen, sie ist jenseits von Tausch und Berechnung, von Kalkül und Habenwollen. Die beiden sind frei und spekulieren auf nichts, oder klassisch gesagt: Sie erotisieren den Intellekt und vergeistigen die Natur.»Du sagst so viele schlaue Sachen auf so schöne Weise«, sagt er zu ihr. Als Realist weiß Petzold, dass die Versöhnung von Natur und Vernunft zu schön ist, um wahr zu sein, doch als Romantiker rettet er das Märchenhafte in das freie Spiel von Kinobildern, die immer wieder neu in ihre Rätselhaftigkeit eintauchen. An der unbedingten Lebendigkeit der mythischen Undine sollen die falschen Mythen der Gegenwart zugrunde gehen. Mangelwirtschaft als Freiheitsversprechen? Wenn es um Kuba geht, geraten deutsche Intellektuelle ins Träumen Seit der Revolution von 1959 gibt es für Kuba drei Kontinuitäten: die Castros, das US- Embargo und die Rolle als Projektionsfläche für die Linke weltweit als bitterarme, aber sinnenfrohe Systemalternative mit Rum und Zigarren, ein morbider Sehnsuchtsort deutscher Intellektueller in Ost und West seit Hans Magnus Enzensbergers Kuba-Trip 1968/ Jahre ist Raúl Castro kürzlich geworden, Fidels kleiner Bruder und engster Weggefährte, seit 2011 Erster Sekretär des Zentralkomitees der immer noch allmächtigen Kommunistischen Partei Kubas. Und auch das US-Embargo lebt immer noch: Präsident Obama hatte die Strategie zwar geändert, besuchte Kuba 2016 und lockerte das erfolglose, von der EU, dem Papst und den meisten Staaten kritisierte Embargo doch Präsident Trump verschärfte es wieder. Und auch Künstler und Intellektuelle bleiben sich in Sachen Kuba treu: Eine lange schon nicht mehr in solcher Mannschaftsstärke erlebte Schar vorwiegend deutscher Kulturprominenz, darunter Jenny Erpenbeck, Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Fatih Akin, Nora Bossong, Jeanine Meerapfel, Margarethe von Trotta, Robert Menasse, Peter Schneider, hat jetzt eine Petition von sechs in Kuba arbeitenden Deutschen unterstützt, die in kubanischer Partei-Panegyrik (»Helfen wir der kubanischen Bevölkerung, so wie ihre Ärzte und Wissenschaftler der Welt helfen!«) die Bundesregierung auffordert, sich für ein Ende des US-Embargos einzusetzen und die Entwicklungszusammenarbeit mit Kuba fortzusetzen.»ich habe niemanden getroffen, der oppositionell war und Probleme hatte«, erklärte die Autorin und Mitunterzeichnerin Jenny Erpenbeck im Deutschlandfunk ihr Kuba-Engagement. Nun lässt der kubanische Staat anders als selbst die Pekinger Genossen kein Goethe-Institut im Land zu; dieses hätte womöglich entsprechende Kontakte zu Andersdenkenden vermitteln können. Stattdessen schwärmte sie von den Menschen,»die abends auf der Promenade im Lampenlicht sitzen und Bücher lesen«. Kein kritisches Wort über Kuba, die Mangelwirtschaft liege auch an der Insellage und am Embargo. Vor allem aber:»es gibt eine Gesellschaft, in der Konsum tatsächlich keine Rolle spielt, und das kann man natürlich auch als eine Art von Freiheit betrachten«, befand die Autorin, deren Bücher bei Penguin erscheinen, unter dem Dach der weltgrößten Buchkonzerngruppe Bertelsmann. Vergeblich war offenbar ANZEIGE Filmkritiken von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags Uhr. die Hoffnung, dass es mit solch privilegierter Blindheit gegenüber unfreien Gesellschaften nach 1989 endgültig vorbei sein würde. Dass das amerikanische Embargo aufhört, wäre menschlich und politisch sinnvoll. Menschlich und politisch sinnvoll wären aber auch andere Kuba-Petitionen prominenter deutscher Intellektueller gewesen: für die verfolgte Journalistin Mónica Baró, für die mehrfach verhaftete Künstlerin Tania Bruguera, für Erpenbecks Kollegen Ángel Santiesteban, der oft, zuletzt anderthalb Jahre, im Gefängnis saß, dessen Bücher in Deutschland, aber nicht in Kuba erscheinen dürfen und der einen klaren Begriff für seine sonnige Heimat hat: Diktatur. ALEXANDER CAMMANN bis ALBSTADT BERLIN BIELEFELD Kunstmuseum der Stadt Albstadt bis : KUNSTMUSEUM OFFSHORE. 150 Tage Kunst in allen Stadtteilen Tel o. 91, Di-Sa 10-17, So/Fei BACKNANG Galerie der Stadt Backnang bis : Anna Ingerfurth - Bewegungsmuster Tel / , Petrus-Jacobi-Weg 1, Di-Fr 17-19, Sa/So Uhr BADEN-BADEN Theater Baden-Baden Sa, Do, Fr 20:00, So 15:00 Der Vorname, Tel / BAYREUTH 12.Juli 11. Oktober 2020 RUPPRECHT FARBVERDICHTUNG Altes Barockrathaus und Ausstellungshalle im Neuen Rathaus Gefördertduch: Mit freundlicher Unterstützung: Berlinische Galerie Museum für Moderne Kunst bis : Umbo. Fotograf Werke bis : Bettina Pousttchi In Recent Years bis : Wide Open Seelenbilder Seelenräume bis : Mario Pfeifer Im IBB-Videoraum Dauerausstellung: Kunst in Berlin Alte Jakobstr , Berlin, Mo, Mi-So Bröhan-Museum Zu wenig Parfüm, zu viel Pfütze. Hans Baluschek zum 150. Geburtstag Tel , Schloßstr. 1a, Di-So Uhr C/O Berlin bis : Linda McCartney. The Polaroid Diaries bis : Francesca Woodman. On Being an Angel bis : Sophie Thun. Extension Tel , info@co-berlin.org, Hardenbergstraße 22-24, 10623, Berlin, Do-So, Feiertag Uhr Grisebach VORBESICHTIGUNG & SOMMERAUKTIONEN Vorbesichtigung: 17. Juni bis 8. Juli 2020, Mo-Sa Uhr (sowie nach Vereinbarung) / Sommerauktionen: 9. und 10. Juli Fasanenstraße 25, 27 und 73, Berlin, Tel , auktionen@grisebach.com PalaisPopulaire bis : Christo and Jeanne -Claude: Projects Ingrid & Thomas Jochheim Collection bis : Time Present Photography from the Deutsche Bank Collection Tel , palais.populaire@db.com, Unter den Linden 5, Berlin, Mi-Mo Uhr, Do Uhr Kunstforum Hermann Stenner bis : Johannes Itten: Kunst als Leben. Bauhausutopien und Dokumente der Wirklichkeit. (Eine Ausstellung vom Kunstmuseum Bern) Tel. 0521/ , Obernstraße 48, Bielefeld, Mi-Fr 14-20, Sa, So, Feiertag Uhr BIETIGHEIM-BISSINGEN Städtische Galerie bis : Farbe bekennen! Walter Ophey. Ein rheinischer Expressionist Di, Mi, Fr 14-18, Do-20, Sa/So/Feiert Uhr Tel , Hauptstr BOCHUM Kunstmuseum Bochum Dauerausstellung: sichtbar - Die Eigene Sammlung bis : Lebensgröße - Heinz Breloh bis : Abraham David Christian - Erde Tel. 0234/ , Kortumstr. 147 Situation Kunst Museum unter Tage Erich Reusch: grenzenlos. Werke 1951 bis Tel , info@situation-kunst.de, Schlossstraße 13, Bochum, Mi-Fr 14-18, Sa, So, Feiertag Uhr BONN Bundeskunsthalle bis : STATE OF THE ARTS Die Verschmelzung der Künste bis : WIR KAPITALISTEN Von Anfang bis Turbo bis : DOPPELLEBEN Bildende Künstler*innen machen Musik Tel , Friedrich-Ebert-Allee 4, Bonn, Öffnungszeiten: Dienstag u. Mittwoch 10 21, Donnerstag-Sonntag Uhr Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945 Willy-Brandt-Allee 14, Tel. 0228/91650, Di-So 9-19, Eintritt frei DIE VERSCHMELZUNG DER KÜNSTE Video Installation Performance bis 16. August 2020 in Bonn Kunst- undausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
52 52 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 KUNSTMUSEUM BONN bis : Candice Breitz Labour bis : Martin Noël paintprintpaint ab Juni: Nur nichts anbrennen lassen Neupräsentation der Sammlung Tel. 0228/776260, F.-E.-Allee 2, Di-So 11-18, Mi-21 BREMEN Gerhard Marcks Haus bis : Robert Schad - Bremen vierkant Tel. 0421/ , Am Wall 208, Di-So 10-18, Do-21 Uhr Kunsthalle Bremen ab : Remix Die Sammlung neu sehen bis : Norbert Schwontkowski. Some of My Secrets bis : Am Anfang war die Zeichnung Tel DARMSTADT Hessisches Landesmuseum Darmstadt bis : Kraftwerk Block Beuys Friedensplatz 1, Di, Do, Fr 10, Mi 10-20, Sa, So, Feiertag Uhr DELMENHORST Städtische Galerie Delmenhorst bis : F L Y. Arne Rautenberg betextet Werke der Sammlung Zhe Wang. Watch Me Di-So 11-17, Do-20 Tel , Fischstr. 30 DORTMUND Dortmunder U - Zentrum für Kunst und Kreativität bis : Body & Soul. Denken, Fühlen, Zähneputzen, Eintritt frei bis : Der kuratierte Kleiderschrank Zwischen Modelust und Modefrust, Eintritt frei bis : 25 von 78 Internationale Medienkunst aus der Reihe HMKV Video des Monats, Eintritt frei bis : 60 Jahre Freunde des Museums Ostwall, Eintritt frei Dauerausstellung: Kunstwelt/Konstrukt und Imagination/Illusion im U, Eintritt frei Tel. +49 (0) , info@dortmunder-u.de, Leonie-Reygers-Terrasse, Dortmund, Di, Mi 11-18, Do, Fr 11-20, Sa, So Uhr DRESDEN STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN Semperbau am Zwinger Dresden, Uhr, Mo geschl., Fr bis 20 Uhr bis : in der Gemäldegalerie Alte Meister: Raffael Macht der Bilder. Die Tapisserien und ihre Wirkung Residenzschloss Dresden, Sophienstr./Taschenberg/Schlossstr., Uhr, Di geschl., Fr. bis 20 Uhr bis : im Kupferstich-Kabinett: 300 Jahre sammeln in der Gegenwart Schloss Pillnitz, August-Böckstiegel-Str., Uhr, Mo. geschl. bis : im Kunstgewerbemuseum: Schönheit der Form. Die Designerin Christa Petroff-Bohne bis : im Kunstgewerbemuseum: Common Knowledge - Design in Zeiten der Informationskrise BIO26 Design Biennale Ljubljana zu Gast im Kunstgewerbemuseum Tel Jahre Sammeln in der Gegenwart Residenzschloss Dresden DÜSSELDORF Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof bis : Verrückt nach Angelika Kauffmann bis : Peter Lindbergh: Untold Stories bis : Sichtweisen. Die neue Sammlung Fotografie Tel. 0211/ , Ehrenhof 4-5, Di-So 11-18, Do-21 Uhr Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Präsentation der ständigen Sammlung bis : K20: Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945 bis : K20: Charlotte Posenenske. Work in Progress Tel , K20 Grabbeplatz 5 K21, Ständehausstr. 1, Düsseldorf, Mo-Fr 10-18, Sa, So, Feiertag EMDEN Kunsthalle Emden bis : SIGHT SEEING. Die Welt als Attraktion Tel , Di-Fr 10-17, Sa, So, Feiertag Uhr, Mo geschl. ESSEN Museum Folkwang ab : 100 Beste Plakate bis : 21.lettres.a.la.photographie bis : Dokumentarfotografie Förderpreise Tel , Museumsplatz 1, Essen, Di, Mi, Sa, So, feiertags 10-18, Do, Fr, Uhr. Eintritt frei in die Sammlung Ruhr Museum, Zollverein A 14 Dauerausstellung: Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets, Galerie bis 16.8.: Mensch und Tier im Revier 24., 25. und geschlossen Tel , Gelsenkirchener Str. 181, tgl FLENSBURG Museumsberg Flensburg und Flensburger Schifffahrtsmuseum bis : Perspektivwechsel Jahre Grenzgeschichten Uhr, Mo geschl. FRANKFURT AM MAIN Archäologisches Museum Frankfurt bis : Zwei Häuser eines Herrn. Kirchen und Synagogen um die Jahrtausendwende in der Slowakei. - Fotografien im Dialog zum Nachdenken. Karmelitergasse 1, Frankfurt am Main, Di, Do-So 10-18, Mi Uhr, Mo geschl. DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM bis : DIE NEUE HEIMAT ( ) - Eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten Tel. 069/ , Schaumainkai 43, Di-So 11-18, Mi-20 Uhr Liebieghaus Skulpturensammlung bis : BUNTE GÖTTER GOLDEN EDITION. Die Farben der Antike Tel , Schaumainkai 71, Di, Mi, Fr-So Uhr, Do Uhr MUSEUM MMK FÜR MODERNE KUNST bis : MUSEUM MMK: Frank Walter. Eine Retrospektive mmk.art, mmk@stadt-frankfurt.de, Domstraße 10, Frankfurt am Main, Di, Do-So 10-18, Mi Uhr Städel Museum bis : EN PASSANT. Impressionismus in Skulptur bis : Städels Erbe. Meisterzeichnungen aus der Sammlung des Stifters Zurück in die Gegenwart. Neue Perspektiven, neue Werke Die Sammlung von 1945 bis heute Tel , Schaumainkai 63, Di, Mi, Sa, So Uhr, Do, Fr Uhr GÖPPINGEN Kunsthalle Göppingen bis : zeitlos. Vom Wesen der Zeit bis : Stephanie Senge. Konsumbibliothek Tel / , Di-Fr 13-19, Sa, So Uhr HAGEN Kunstquartier Hagen bis : Emil Schumacher Der Reiz des Materials bis : Stephan Kaluza Unruhig wandern bis : Expressionisten aus der Sammlung des Osthaus Museums Museumsplatz 1, Hagen HALLE (SAALE) KUNSTHALLE Talstrasse bis : Guy Bourdin. Pariser Avantgarde der Nachkriegszeit. Tel , info@kunstverein-talstrasse.de, Talstraße 23, Halle (Saale), Di-Fr 14-19, Sa, So, Feiertag Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) bis : Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive, #lagerfeldfotografie, tgl. außer Mi HAMBURG BUCERIUS KUNST FORUM bis : David Hockney. Die Tate zu Gast Alter Wall 12, Hamburg, tägl , Do Uhr Deichtorhallen Hamburg Jetzt! Junge Malerei in Deutschland. Verlängert bis Quadro: Kerstin Brätsch / Kati Heck / Stefanie Heinze / Laura Link (Malerei). Verlängert bis Gute Aussichten. Junge deutsche Fotografie & recommended. Olympus Fellowship. Verlängert bis In der Sammlung Falckenberg (Harburg), geöffnet sonntags Uhr: Installationen aus 25 Jahren Sammlung Falckenberg. Verlängert bis Deichtorstr. 1-2, Hamburg, Di-So Uhr Ernst Barlach Haus bis : Kosmos Ost. Kunst in der DDR HAMBURGER KUNSTHALLE bis : Trauern. Von Verlust und Veränderung bis : Unfinished Stories. Geschichten aus der Sammlung Tel. 040/ , Glockengießerwall, Di-So 10 bis 18 Uhr / Do 10 bis 21 Uhr Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg bis : Das Plakat. 200 Jahre Kunst und Geschichte bis : Copy & Paste. Wiederholung im japanischen Bild bis : Syria Fossilien der Zukunft bis : Peter Lindbergh. Untold Stories Steintorplatz, Hamburg, Di-So 10-18, Do Uhr Stiftung Historische Museen Hamburg, Museum f. Hamburg. Geschichte: Von der Hammaburg bis zur HafenCity, ganzjährig bis : Altonaer Museum: Fide Struck fotografiert Hamburg bis : Jenisch Haus: Der Traum vom Süden HANNOVER Museum August Kestner bis : Die Freude der Etrusker. Ein Dialog HEIDELBERG Kurpfälzisches Museum bis : Herkules - Unsterblicher Held Tel , kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de, Hauptstr. 97, Di-So Uhr KARLSRUHE Städtische Galerie Karlsruhe bis : Kunstpreis der Werner-Stober-Stiftung 2019: Florian Köhler. Tschau Agip bis : (Un)endliche Ressourcen? Künstlerische Positionen seit 1980 bis : Peter Ackermann Verrätselte Architekturen Tel. 0721/ , Lorenzstr. 27, Mi-Fr 10-18/Sa/So ab 11 KASSEL Fridericianum bis : Forrest Bess Tel , info@fridericianum.org, Friedrichsplatz 18, Kassel, Di-So, Feiertag Uhr KIEL Kunsthalle zu Kiel bis : Rachel Maclean bis : Streifzüge durch die Sammlung von Expressionismus bis Liebe Tel. 0431/ , info@kunsthalle-kiel.de, Düsternbrooker Weg 1, Kiel, Di, Do-So 10-18, Mi Uhr KOBLENZ Ludwig Museum Koblenz im Deutschherrenhaus bis : Otto Fried Heaven Can Wait / Heaven Can t Wait bis : Unruhige Zeiten Werke aus der Sammlung Tel , Danziger Freiheit 1 KÖLN Käthe Kollwitz Museum Köln bis :»Liebe und Lassenmüssen...«Im 75. Todesjahr der Künstlerin Neumarkt Passage Köln, Di-So, Feiertag Uhr Köln Museen der Stadt Köln: Infos zu Ausstellungen und Veranstaltungen unter: Kölnisches Stadtmuseum bis : 50 Johr Bläck Fööss Zeughausstraße 1-3, Köln, Mi-So 10-17, Di 10-20, 1. Do im Monat Uhr Museum Ludwig Köln bis : Mapping the Collection bis : HIER UND JETZT im Museum Ludwig. Dynamische Räume Heinrich-Böll-Platz, Köln, Di-So Uhr, 1. Do im Monat Uhr Museum Schnütgen bis : Arnt der Bilderschneider. Meister der beseelten Skulpturen Cäcilienstr , Köln, Di-So 10-18, Do 10-20, 1. Do im Monat Uhr Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) bis : Künstlerblick. Clemens, Sigmund & Siecaup An der Rechtschule, Köln, Di-So Uhr, 1. Do im Monat Uhr Museum für Ostasiatische Kunst bis : Trunken an Nüchternheit. Wein und Tee in der chinesischen Kunst Universitätsstr. 100, Köln, Di-So Uhr, 1. Do im Monat Uhr NS-Dokumentationszentrum bis : Grigory Berstein Bilder gegen das Vergessen Appellhofplatz 23-25, Köln, Di-Fr 10-18, Sa, So 11-18, 1. Do im Monat Uhr Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud bis : Carlo Carlone. Ölskizzen aus der Zeit des Rokoko bis : Liebe am Abrund Trilogie II Obenmarspforten, Köln, Di-So 10-18, Do im Monat Uhr KONSTANZ Rosgartenmuseum bis : Schätze des Südens - Kunst aus 1000 Jahren. 150 Jahre Rosgartenmuseum Konstanz Tel / , Rosgartenstraße 3-5, Konstanz, Di-Fr 10-18, Sa, So, Feiertag Uhr KREFELD KUNSTMUSEEN KREFELD, Haus Esters Sharon Ya ari. The Romantic Trail and the Concrete House Bis 30.8., Di So Uhr, KÜNZELSAU MUSEUM WÜRTH Zwischen Pathos und Pastos. Christopher Lempfuhl in der Sammlung Würth bis , täglich.11-18, Eintr. frei, MUSEUM WÜRTH 2 Weitblick. Reinhold Würth und seine Kunst, täglich 11 bis 19 Uhr, Eintritt frei Tel , Am Forumsplatz 1 LEIPZIG Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, bis Purer Luxus Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Diktatur und Demokratie nach Tel. 0341/2220-0, Grimmaische Str. 6, Di-Fr 9-18, Sa, So, Fei MAINZ Gutenberg-Museum Große Dauerausstellung auf über qm mit stündlicher Druck- und Filmvorführung. Im Druckladen drucken unter fachlicher Anleitung. ab : Präsentation Von der Keilschrift zum Emoji MÖNCHENGLADBACH Museum Abteiberg bis : ANDREA BOWERS Grief and Hope Abteistr.27/Johannes-Cladders-Platz MÜNCHEN Bayerische Staatsgemäldesammlungen Alte Pinakothek, T 089/ , MI-SO 10-18, DI bis : Raffael Wenn du an die Neue denkst... Meisterwerke der Neuen Pinakothek jetzt in der Alten Pinakothek Von Goya bis Manet Neue Pinakothek, T 089/ , wegen Sanierung geschlossen Pinakothek der Moderne, T 089/ , DI-SO 10-18, DO Sammlung Moderne Kunst bis : A Brief Collection Display of John Baldessari bis : FEELINGS - Kunst und Emotion bis : August Sander. Sardinien 1927 Museum Brandhorst, T 089/ , DI-SO 10-18, DO bis : Forever Young - 10 Jahre Museum Brandhorst bis : Spot on: Bücher aus der Sammlung Brandhorst Sammlung Schack, Prinzregentenstr. 9, T 089/ , MI-SO Wenn du an die Neue denkst... Meisterwerke der Neuen Pinakothek jetzt in der Sammlung Schack Spitzentreffen Haus der Kunst bis : Theaster Gates: Black Chapel bis : Brainwashed. Sammlung Goetz im Haus der Kunst bis : Kapselausstellungen: Sung Tieu- Zugzwang Monira Al Qadira: Holy Quarter bis : Franz Erhard Walther. Shifting Perspectives Tel. 089/ , Prinzregentenstr. 1, tgl , Do-22 Uhr Jüdisches Museum München Dauerausstellung: Stimmen_Orte_Zeiten Juden in München bis : Von der Isar nach Jerusalem Gabriella Rosenthal ( ) Zeichnungen Tel , juedisches.museum@muenchen.de, St.-Jakobs-Platz 16, München, Di-So Uhr Kunsthalle München bis : Thierry Mugler: Couturissime tägl Uhr, Tel. 089/ , Theatinerstr. 8, München Museum Villa Stuck bis : She wants to go to her bedroom but she can t be bothered. 30 Jahre Schmuck von Lisa Walker bis : Margret Eicher. Lob der Malkunst bis : Beate Passow. Monkey Business bis : Schönheit Stärke Leidenschaft Die Plastiken Franz von Stucks in den Historischen Räumen neu präsentiert villa.stuck.de, Tel. 089/ , Prinzregentenstr. 60, Di-So Uhr, 1. Fr. im Monat Uhr, Dauerausstellung Historische Räume Franz von Stucks Münchner Stadtmuseum bis : Vorbilder/Nachbilder Die fotografische Lehrsammlung der Universität der Künste Berlin bis : Ready to go! Schuhe bewegen Tel. 089/ , St.-Jakob-Pl., Di-So AUKTIONEN 15 JULI ALTE KUNST SCHMUCK 16 JULI KLASSISCHE MODERNE POSTWAR CONTEMPORARYART Besichtigung 9 13 Juli NEUMEISTER Barer Straße München.T info@neumeister.com. NEUMARKT IN DER OBERPFALZ Museum Lothar Fischer, verlängert bis : INNEN-LEBEN. Shinichi Sawada, Keramik Alfred Kremer, Tusche, Mi-Fr 14-17, Sa/So Uhr Tel /510348, Weiherstr. 7a NÜRNBERG Kunstvilla im KunstKulturQuartier bis : Ernst Weil Abstraktion in Nürnberg kunstvilla.org, Blumenstraße 17, Di, Do-So 10-18, Mi Uhr GERMANISCHES NATIONALMUSEUM bis : Helden, Märtyrer, Heilige Wege ins Paradies bis : 150 Jahre Bayerisches Gewerbemuseum Tel , Fax -200, Kartäusergasse 1, Di-So 10-18, Mi-21 Uhr, Mo geschl. OBERHAUSEN LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen bis : RUDOLF HOLTAPPEL - Die Zukunft hat schon begonnen. Eine fotografische Werkschau von Konrad-Adenauer-Allee 46, Oberhausen ROSENHEIM Ausstellungszentrum Lokschuppen SAURIER-Giganten der Meere Rosenheim, Mo-Fr 09-18, Sa, So, Feiertag Uhr ROSTOCK KUNSTHALLE ROSTOCK bis : ### UTE & WERNER MAHLER - WERKSCHAU ### bis : ### GÜNTHER UECKER _ HAFIZ ### Tel , Hamburger Straße 40, Di-So SAARBRÜCKEN Saarlandmuseum, Alte Sammlung bis :...Lorenzetti, Perugino, Botticelli... Italienische Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg Schlossplatz 16, T. 0681/ , Di-So 10-18/Mi-20 Saarlandmuseum, Moderne Galerie bis : Künstlerbücher: aufgeblättert ausgebreitet bis Herbst 2020: Giuseppe Penone Tel , Bismarckstr , Saarbrücken, Di-So 10-18, Mi-20 SCHWÄBISCH HALL JOHANNITERKIRCHE Dauerausstellung: Alte Meister in der Sammlung Würth Tel. 0791/ , Di-So 11-17, Eintritt frei KUNSTHALLE WÜRTH Lust auf mehr. Neues aus der Sammlung Würth zur Kunst seit 1960 bis Lange Straße 35, tgl Uhr, Eintritt frei SIEGEN Museum für Gegenwartskunst Siegen bis : Unsere Gegenwart / MGKWalls: Nora Turato Tel. 0271/405770, Unteres Schloss 1, Di, Mi, Fr-So, Feiertag 11-18, Do Uhr STUTTGART Sommer-Auktionen Kunst, Antiquitäten &Schmuck Moderne &Zeitgenössische Kunst Asiatische Kunst Juli 2020 Besichtigung: 27. Juni -06. Juli 2020 Alexander Koester Schwüler Nachmittag im Entenwinkel, 1932 Online-Kataloge Neckarstr Stuttgart +49 (0) contact@auction.de Kunstmuseum Stuttgart bis : Vertigo. Op Art u. eine Geschichte des Schwindels bis : Museum Haus Dix ( Di-So 10-18, Fr Uhr, Mo geschl. Staatsgalerie Stuttgart bis : Drucksache Bauhaus bis : Ida Kerkovius. Die ganze Welt ist Farbe bis : Du lebst nur keinmal. Uwe Lausen und Heide Stolz. Ein Künstlerpaar der 1960er Jahre Tel , info@staatsgalerie.de, Di, Mi, Fr-So 10-17, Do Uhr, Mo geschl. ULM Museum Ulm bis : Schwarz auf Weiß - Das Rätsel der Steinzeitscheiben bis : Hans Gugelot - Die Architektur des Design (HfG-Archiv) Tel. +49(0) , info.museum@ulm.de, Marktplatz 9, Ulm, Di-Fr 11-17, Sa, So, Feiertag Uhr Stadthaus Ulm bis : Die Welt, ein Raum mit Flügeln Albrecht Ludwig Berblinger zum 250. Geburtstag. Eine Ausstellung v. Timo Dentler u. Okarina Peter, Eintritt frei Mo-Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So, Feiertag Uhr VÖLKLINGEN FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE Afrika Im Blick der Fotografen, bis 1. November 2020 Christian Boltanski Die Zwangsarbeiter Installation in der Völklinger Hütte, ganzjährig Ankündigung: Mon Trésor Europas Schatz im Saarland, ab 12. September Tel / , Meter Besucherwege WUPPERTAL Skulpturenpark Waldfrieden / Cragg Foundation Dauerausstellung Über 40 Skulpturen im 14 ha großen Gelände, mit Werken von TonyCragg und zahlreichen zeitgenössischen Bildhauer*innen bis : SEAN SCULLY Die Werkschau, die einige speziell für diesen Ort geschaffene Arbeiten umfasst, findet im Außenraum sowie in allen drei Ausstellungshallen statt. Tel (0) , mail@skulpturenpark-waldfrieden.de, Hirschstraße 12, Wuppertal, Di-So, Feiertag WÜRZBURG Museum im Kulturspeicher verlängert bis : Wolfgang Gurlitt. Zauberprinz museum.kulturspeicher@stadt.wuerzburg.de, Oskar-Laredo-Platz 1, Würzburg, Di 13-18, Mi, Sa, So 11-18, Do ZITTAU Städtische Museen Zittau bis : entkommen. Das Dreiländereck zwischen Vertreibung, Flucht und Ankunft Klosterstraße 3, Zittau, Di-So VADUZ WIEN Leopold Museum LIECHTENSTEIN Tribute to Ibrahim Kodra ÖSTERREICH bis Dauerausstellung: Wien Aufbruch in die Moderne Hundertwasser - Schiele. Imagine tomorrow bis : Deutscher Expressionismus. Die Sammlungen Braglia und Johenning Museumsplatz 1, 1070 Wien, Mi-So, Feiertag Uhr mumok Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien bis : Gelebt Ingeborg Strobl bis : Steve Reinke. Butter bis : Objects Recognized in Flashes bis : Im Raum die Zeit lesen. Moderne im mumok bis : MISFITTUNG TOGETHER. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art Tel. 43-1/52500, MuseumsQuartier Wien, Mi-So Uhr GESUCHE UHRMACHERMEISTER BUSE KAUFT ALTE ROLEX - MILITÄR - u. FLIEGERUHREN, Mainz - Heidelbergerfaßgasse 8, Tel UMFASSEND INFORMIERT Die Agenda/Kultur in der ZEIT hilft Ihnen beim Planen Ihres Kulturprogramms. Der Kultur-Newsletter der ZEIT ONLINE Redaktion hält Sie mit den spannendsten Neuigkeiten aus der Kulturszene auf dem Laufenden.
53 53 KINDER- & JUGENDBUCH 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 DIE LUCHS-JURY EMPFIEHLT AUSSERDEM: Paradies im Kopf Sachbuch: Die Reise eines kleinen gelben Kanarienvogels, der Nummer 189 im großen Käfig des Händlers, vom Schwarzwald über den Atlantik bis nach New York. Dieter Böge hat die Geschichte der Harzer Kanarienvögel recherchiert, die im 19. Jahrhundert in die ganze Welt verkauft wurden. Elsa Klever hat dazu ornamental-märchenhafte Bilder geschaffen. Entstanden ist ein in doppelter Hinsicht besonderes Sachbilderbuch. Dieter Böge/Elsa Klever (Ill.): 189. Aladin 2020; ab 5 Jahren Auch im Keller liegt ein Strand: Die norwegische Autorin Marianne Kaurin erzählt, wie zwei Kinder sich ein Sommerparadies in der Sozialsiedlung erschaffen VON KATRIN HÖRNLEIN Dass ihre Ferien in irgendeiner Weise spektakulär werden würden, hatte Ina gar nicht erwartet. Dass der Sommer aber dermaßen katastrophal beginnt, hätte die Elfjährige auch nicht gedacht. Tagelang klickt sie sich nun schon schwitzend durch Bildergalerien von Luxushotels und postet Fake- Fotos im Klassenchat, während sie kein einziges Mal die kleine Wohnung verlässt und trotz tropischer Hitze sogar Fenster und Vorhänge geschlossen hält. Ina fühlt sich wie eingesperrt. Das Gefängnis hat sie sich selbst gebaut. Hätte sie nur nicht am letzten Schultag herumgeprahlt, dass sie die gesamten Ferien mit ihrer Mutter im Süden verbringen würde, in einem Hotel direkt am Strand, mit Spa und Shoppingmall und all-inclusive. Aber was soll man tun, wenn man nach einem Schuljahr noch immer die Neue ist, das Mädchen ohne Freunde. Die Einzige, die nicht den winzigsten Reiseplan vorweisen kann, während alle anderen in ihre Sommerhäuser fahren oder die Koffer für Fernreisen packen. Auf Ina warten nur vierundfünfzig Tage in Tyllebakken, einer heruntergekommenen Betonsiedlung, die alle anderen Güllebakken nennen. Der norwegischen Autorin Marianne Kaurin gelingt mit ihrem Kinderroman Irgendwo ist immer Süden ein kleines Kunststück: Sie erzählt eine heitere und sonnige Sommergeschichte, deren Heldin ein Mädchen ist, das ziemlich viel Zeit im Schatten verbringt. Ein Kind, das zu bemitleiden ist allein deshalb, weil es weiß, dass es zu bemitleiden ist. Ina hat sehr feine Antennen. Sie schneidet jede Regung der coolen Mädchen mit, zu denen sie so gern gehören würde, obwohl sie ihr Angst machen. Ebenso sensibel reagiert sie auf die Stimmungen ihrer depressiven Mutter, die sich im Jogginganzug durch die Tage quält und schon gestresst ist, wenn die Tochter nach Geld für ein kleines Geburtstagsgeschenk fragt. Ina fragt deshalb erst gar nicht und geht eben zu keiner Geburtstagsfeier. Damit ihre Mutter nicht noch trauriger wird, weil Ina keinen Anschluss findet, denkt sie sich kurzerhand eine beste Freundin aus. Es ist erstaunlich und erschütternd, wie die Elfjährige sich in den eigenen Lügen verstrickt, um es allen recht zu machen, während sich umgekehrt niemand um sie kümmert. Bis Vilmer kommt. Der Junge mit den uncoolen Klamotten, dem schiefen Schneidezahn und den Strubbelhaaren ist neu in Tyllebakken. Er wohnt einmal quer über den Hof, Aufgang F. Auch Vilmer ist nicht verreist, weil sein Alkoholiker-Vater pleite ist. Die Mutter hat im Nachbarland LUCHS Nº 402 Jeden Monat vergeben die ZEIT und Radio Bremen den LUCHS-Preis für Kinder- und Jugendliteratur. Aus den zwölf Monatspreisträgern wird der Jahres-LUCHS gekürt. Mehr zum Gewinnerbuch des Monats bei Radio Bremen: Schweden eine neue Familie, Vilmer sieht sie dienstags und freitags über Face Time.»Ich brauche Freunde, die mich hochziehen, nicht runter«, denkt Ina. Aber da sie beide hier festsitzen, könnte sie ja ein bisschen mit Vilmer abhängen, im Hinterhof, wo sie keiner sieht, auch wenn der Sandkasten nach Pisse stinkt. Ein zweites Mal in diesem Sommer erlebt Ina, wie schnell sich die Dinge ändern können.»man kann selbst entscheiden, wo der Süden ist«, sagt Vilmer. Und so beginnen die beiden, sich in einer muffigen, verdreckten Kellerwohnung einen Ersatz-Süden zusammenzubasteln; ein altes Planschbecken, eine Fototapete, ein kaputter Sonnenschirm und eine Lichterkette fertig ist das schönste Luxus-Resort. Jeden Tag treffen die beiden sich hier, um»südendinge«zu tun: Spaß haben, chillen, Fast Food essen. Man könnte Ina und Vilmer auch jetzt bemitleiden, wie sie sich in dem siffigen Keller ein Paradies zurechtträumen. Kaurin aber zeichnet zwei starke und vor allem fröhliche Kinder, die sich inmitten des Scherbenhaufens, den die Erwachsenen hinterlassen, eine neue, bessere, schöne Welt bauen. Der Keller ist ihr geheimer, irgendwie verzauberter Ort, an dem sie glücklich sind, ein an der aber auch erzählen, was sie bisher tief in sich vergraben haben. Mit Vilmer, bemerkt Ina eines Tages, kann sie sogar das zwanghafte Zählen sein lassen. Er ist ein echter bester Freund, vielleicht sogar mehr? Bis zu dem Tag, an dem sich zum dritten Mal alles ändert, weil plötzlich die coolen Mädchen im Hinterhof stehen, Ina ihren Freund verrät und das Keller-Paradies in Stücke schlägt. Für Ina und Vilmer wird es ein gutes Ende geben. Aber erst nachdem Kaurin schonungslos erzählt, wie sehr ein Vertrauensbruch einen Menschen verletzen kann. Sie verschweigt auch nicht, dass es viel Mut braucht, sich gegen diejenigen zu behaupten, die auf dem Schulhof und im Klassenchat entscheiden, ob man dazugehört oder nicht. Und dass man zwar mit einem Freund an der Seite glücklich sein, aber trotzdem ein Außenseiter bleiben kann. Dass die Geschichte bei aller Härte ein echtes Kinderabenteuer ist und niemals moralisch wird, kann man nicht genug loben und will Kaurins Buch jederzeit empfehlen. In diesem Corona-Sommer aber passt es geradezu gespenstisch gut und das nicht nur, weil jeder, der gerade über ausgefallene Reisen jammert, lernen kann, wie man sich mit etwas Fantasie überall seinen eigenen Süden erschaffen kann. Marianne Kaurin: Irgendwo ist immer Süden. Aus dem Norwegischen von Franziska Hüther; WooW Books 2020; 240 S., 15, ab 11 Jahren Symbolfoto: Kanea/Shutterstock Bilderbuch: Eddie ist die Kleinste in der Familie, und im Gegensatz zu Mama, Papa, Schwester kann sie nichts. Bis sie sich auf die Suche nach einem Geschenk für ihre Mutter macht. Fluffig-puffelig-wuschelig soll es sein, und unbedingt: einzigartig. Das trifft auch auf diese lautmalerische kleine Erzählung zu, die mit verspielt leuchtenden Illustrationen und einer charmanten Heldin bezaubert. Beatrice Alemagna: Das wundervolle Fluffipuff. Beltz & Gelberg 2020; ab 4 Jahren Jugendbuch: Um bloß nicht wie ihre Mutter zu werden, hat die elfjährige Sasha eine Liste geschrieben. Letzter Punkt: Als Comedy Queen Menschen zum Lachen bringen. Sashas Mutter brachte andere zum Weinen und ist inzwischen tot. Der neue Roman der schwedischen Psychologin Jenny Jägerfeld über eine junge verletzte Seele: sensibel, vielschichtig und voller Zuversicht. Jenny Jägerfeld: Comedy Queen. Urachhaus 2020; ab 12 Jahren»Wir werden euch niemals das Mikro abdrehen!«die Proteste gegen Rassismus in den USA sind auch die Stunde der schwarzen Jugendbuchautoren: Sie fordern ihre Leser auf, mutig zu sein und den Mund aufzumachen In seinem Jugendroman Ghost schickt der afroamerikanische Autor Jason Reynolds seine Hauptfigur als Sprinter über die Aschenbahn. Ghost rennt erfolgreich allein und als Teammitglied im Staffellauf, was den Einzelgänger einiges an Training kostet. Solo mit seinen Leistungen zu glänzen und zugleich gemeinsam mit anderen etwas noch Größeres zu erreichen davon ließe sich auch anhand von Reynolds eigenem Leben erzählen. Der 36-Jährige ist in den USA derzeit einer der gefragtesten schwarzen Jugendbuchautoren, auch die ZEIT und Radio Bremen haben ihn für Ghost im vergangenen Jahr mit dem Jahres-LUCHS ausgezeichnet (ZEIT Nr. 13/19). Im Januar wurde Reynolds in seiner Heimat zum National Ambassador for Young People s Litera ture ernannt, zum Botschafter der Ju gendlite ra tur. Seine zweijährige Amtszeit hat er unter das Motto»Grab the mic tell your story«gestellt. Seit dem Tod George Floyds ist Reynolds Gast in zahlreichen Radio- und TV-Sendungen, spricht auf Podien und soll erklären, wie das nun ist mit den jungen Schwarzen in den USA: welche Fragen die Jugendlichen haben, was sie wütend macht und wie weiße Eltern mit ihren Kindern über Rassismus sprechen können. Mehrmals an Reynolds Seite war der weiße Autor Brendan Kiely, mit dem er vor fünf Jahren den Roman Nichts ist okay geschrieben hat eine Geschichte, die heute so aktuell ist wie damals: Der schwarze Jugendliche Rashad wird zum Opfer von Polizeigewalt. Kiely erzählt in dem Roman aus der Sicht des weißen Quinn, der eine enge Beziehung zu dem Polizisten hat. Reynolds bringt die Perspektive des schwer verletzten schwarzen Jungen ein. Die Stunde der großen Proteste in den USA, sie ist auch die Stunde der schwarzen Jugendbuchautorinnen und -autoren. Kindern, wie sie selbst einmal welche waren, eine Stimme zu geben, sie in und über die Literatur sichtbar zu machen, das ist eins von Reynolds wichtigen Zielen. Eins, das ihn mit vielen seiner schwarzen Autorenkollegen eint. Ob es Angie Thomas ist, die mit ihrem Bestseller The Hate U Give und der gleichnamigen Verfilmung weltweit bekannt wurde, Jacque line Woodson, die nicht nur in den USA, sondern international mit Preisen überhäuft wird, oder Kwame Alexander, dessen Basketball-Geschichte The Crossover 2015 das am häufigsten ausgezeichnete Jugendbuch in den USA war sie alle sagen, dass sie sich als Kinder in Büchern nicht wiedergefunden haben. Schwarze wie sie kamen in der Literatur so gut wie nicht vor, die Helden waren weiß. Für Reynolds und Alexander ein Grund, warum sie selbst nie gern gelesen haben. In den vergangenen Jahren sind sie und viele ihrer schwarzen Kollegen angetreten, um das zu ändern. Sie schreiben Bücher, die ganz selbstverständlich in black neighborhoods spielen, in denen sie auch, aber nicht nur von Polizeigewalt, Kriminalität und Rassismus erzählen. Bücher, die für schwarze Jugendliche Spiegel sind und für weiße ein Fenster in eine andere, ihnen oft unbekannte Welt, auch wenn diese nur ein paar Straßen entfernt liegt. Dass ihre Bücher von der Kritik positiv besprochen werden, dass Jason Reynolds so wie vor ihm Jacque line Woodson zum Jugendliteratur-Botschafter ernannt wird, dass People of Color bei den wichtigen Buchpreisen und Ehrungen die weißen Kollegen in den Schatten stellen, zeigt, dass ihnen bereits ein wenig change gelungen ist. Veränderung beginne nicht morgen und nicht nebenan, sagte Jacque line Woodson, bevor sie sich mit ihren Kindern in New York den Demonstranten anschloss. Deshalb haben sie, Jason Reynolds und Kwame Alexander gemeinsam Anfang Juni die KidLit4BlackLives Rally ins Leben gerufen, eine virtuelle Kundgebung der Kinderliteraturmacher im Geiste von Black Lives Matter. Man konnte sich live zuschalten, das Ganze wurde aber auch aufgezeichnet, um es später in unterschiedlichen Kontexten, in Schulen, Büchereien, zu Hause, über You Tube abzuspielen. Mehr als zwei Stunden lang reiht sich eine Rede an die andere, Autoren, Mitarbeiter von Verlagen und Aktivisten sprechen zu den Kindern und Jugendlichen, wenden sich aber auch an die Eltern, die Lehrer, die Bibliothekare. Sie lesen Gedichte vor, erzählen von eigenen Rassismus-Erfahrungen, von Verzweiflung und Wut, aber auch von Selbstzweifeln und dem Gefühl des Scheiterns. Die Hautfarbe war für die Teilnahme an der rally kein Kriterium. Neben vielen schwarzen Autoren sprechen zum Beispiel auch die irische Schriftstellerin Sarah Crossan oder die koreanisch-amerikanische Autorin Linda Sue Park. Entstanden ist ein bewegendes, nachdenklich stimmendes Dokument, nicht wenigen der mehr als 20 Redner zittert oder bricht die Stimme. Man spürt, dass es ihnen um mehr als Literatur geht. Dass sie, mit nichts als dem Bildschirm als Gegenüber, versuchen, jemanden da draußen in der Welt zu erreichen. Die New Yorker Autorin Elizabeth Acevedo, deren Eltern Einwanderer aus der Dominikanischen Republik sind und deren Romane in diesem Einwanderermilieu spielen, ruft den jungen Zuschauern voller Inbrunst zu:»i see you!«sie sagt, sie und ihre Kollegen wollten den Jugendlichen eine Bühne geben, damit sie gehört würden.»und wir werden euch niemals das Mikro abdrehen!«bestärkt werden alle: die schwarzen Kinder darin, durchzuhalten, friedlich zu bleiben, aber auch unbequeme Fragen zu stellen und vor allem! dem Unrecht Lebensfreude entgegenzusetzen. Die übrigen hören immer wieder: Nicht wegsehen, wenn andere sich rassistisch verhalten, sich einmischen und den Mund aufmachen, auch wenn es Mut kostet.»lest genauso viele Bücher über schwarze Leute, wie ihr schwarze Musik hört«, fordert Kwame Alexander zu Beginn der rally. Zum Abschluss sagt er:»wir alle schreiben Bücher, um die Welt zu verändern. Ihr lest sie, um euch eine andere Welt vorstellen zu können. Arbeitet mit uns daran, diese neue Welt zu erschaffen.«wie in Reynolds Leichtathletik-Geschichte Ghost hat jeder Sprecher den Staffelstab an den nächsten übergeben. Am Ende schaltet Alexander noch einmal den Großteil der Mitstreiter in kleinen Kacheln auf dem Bildschirm zusammen. 44 Augen blicken erwartungsvoll in die Kamera und hoffen, dass da draußen viele zuhören, den Stab entgegennehmen und sich in Bewegung setzen. KATRIN HÖRNLEIN
54 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 GLAUBEN & ZWEIFELN 54 Ja! Die Abschottung von Kliniken und Pflegeheimen sorgt seit Wochen für großes Leid. Der Vorwurf von Evelyn Finger in der ZEIT, die Bischöfe hätten zur Lage der Schwächsten geschwiegen, löste heftige Reaktionen aus Nein! Wir haben laut die unhaltbare Situation in der Pflege kritisiert, sagt der Präsident der Diakonie Deutschland ULRICH LILIE War die Kirche für die Alten da? Öffentlicher Einspruch gegen das einsame Sterben war nicht vernehmbar, sagt die Pastorin und einstige Ministerpräsidentin CHRISTINE LIEBERKNECHT Die Forderungen nach einem Bischofsmachtwort in der Corona-Krise erinnern mich an das jüdische Bonmot:»Die Synagoge, in die ich nicht gehe, muss orthodox sein.«ich finde diese merkwürdig schlecht recherchierte Debatte irritierend orthodox. Sie enthüllt einen erheblichen Nachholbedarf beim Kirchenbegriff der»gebildeten unter den Verächtern«und die dringende Notwendigkeit eines Faktenchecks. Dass es selbst unter Kircheninsidern cool ist, Kirche uncool zu finden geschenkt. Erschreckend finde ich die Borniertheit, mit der die Worte und Taten der Kirche ignoriert werden. Als Diakonie-Präsident zähle ich zum evangelischen Lager. Bei uns gilt die mobile Altenpflegerin auf dem platten Land, die seit Monaten ihre Enkelkinder in einem Akt freiwilliger Selbstverpflichtung nur noch digital trifft, weil sie ihre Patienten nicht gefährden will, genauso als Gesicht der Kirche wie der Leiter des Altenheims, der in seine Einrichtung umgezogen ist, weil er die ihm anvertrauten Menschen nicht allein lassen will. Es bräuchte viel Raum, um die anrührenden und mich stolz machenden Wundergeschichten von solch tagtäglichem Einsatz zu dokumentieren, der oft über die Erschöpfungsgrenze hinausgeht. Etwas Recherche etwa auf unserer Internetseite hätte genügt, um zu sehen, in wie vielen Feldern die angeblich verstummte Kirche sehr aktiv ist. Von Schweigen kann keine Rede sein. Mit den Partnern in der freien Wohlfahrt haben wir unsere Einrichtungen unter den Rettungsschirm verhandelt und das Sozialsystem vor dem Kollaps bewahrt. Wir haben laut auf die unhaltbare Situation in der Pflege aufmerksam gemacht. Und wir haben uns selbst um dringend benötigte Schutzkleidung bemüht, weil das vom Gesundheitsminister beauftragte Beschaffungsamt der Bundeswehr ein Totalausfall war. Wir haben die Lage der Ärmsten, der Wohnungslosen und der Geflüchteten thematisiert und früh eine breite Debatte über die richtige Balance von Infektionsschutz und Freiheitsrechten in Altenheimen eingefordert. Wir haben einen Rettungsschirm für Menschen im Hartz-IV-Bezug verlangt und gemeinsam mit der EKD darauf hingewiesen, dass die Situation für die Seelsorge in unseren Einrichtungen unerträglich ist. Dieser Facettenreichtum von Kirche blieb medial erstaunlich unterbelichtet. Ist das Relevanzverlust? Ohne die tagtäglichen und dem Gemeinwohl verpflichteten Beiträge zivilisierter öffentlicher Religion hätte Deutschland die Krise bisher nicht so gut bewältigt. Das hochwirksame Handeln der Kirchen bezieht sich auf Jesus Christus, der vorgelebt hat, dass Gottes- und Nächstenliebe allen Menschen gilt. Vom Altenpfleger bis zur Bischöfin arbeiten wir daran, diese Botschaft ins 21. Jahrhundert zu übersetzen. Wenn das frommes Schweigen ist, kann ich damit gut leben. Es gibt nämlich sehr viel zu tun. Die südkoreanische Fotokünstlerin KangHee Kim, die in New York lebt, schuf dieses Bild ohne Titel Abb.: aus der Serie»Street Errands«, 2016 KangHee Kim Wer wirklich wissen will, wieviel Einsamkeit, Verzweiflung und Ohnmacht seit Mitte März in deutschen Pflegeheimen und Kliniken herrschte, der muss sich nur den konkreten Fall vor Augen halten, er selbst oder seine Familie wäre betroffen. Deshalb sei hier zuerst ein solcher Fall benannt. Ende April stürzt in Baden-Württemberg ein Hochbetagter beim gewohnten Nachmittagsspaziergang auf den Gehweg. Nachbarn bemerken den Unfall, rufen einen Rettungswagen. Rasch wird der Gestürzte ins Krankenhaus gefahren. Zugleich werden die Angehörigen benachrichtigt. Der alte Herr hat das Glück, im Haus seiner Familie zu wohnen. Doch die Unfallnachricht kommt für sie zu spät. Es gibt keine Tür des Krankenhauses, die sich für Sohn, Tochter, Enkelkinder des nunmehr ans Bett gefesselten, nahezu tauben Patienten auch nur ein Spalt öffnete. Während draußen die Corona-Beschränkungen für Gesunde sich bereits lockern, bleibt er isoliert. Allein durch eine schmale Luke an der Pforte des Klinikums dürfen notwendigste Dinge für ihn abgegeben werden. Persönlicher Kontakt ist verboten. Sechs Tage und Nächte geht das so. Am siebten Tag verstirbt der Familienälteste, 95 Jahre alt. Niemand war bei ihm, auch kein Geistlicher, um einen Psalm mit ihm zu beten: Du bist nicht allein. Keines seiner Kinder hielt ihm die Hand, obwohl er eben noch das Leben mit seinen Lieben teilte. Ich frage: Wo war der deutlich vernehmbare Einspruch unserer Kirchen gegen solche Fälle von Infektionsschutz? Oder handelte es sich, wie jetzt behauptet wird, um Einzelfälle? Geschuldet der Unverhältnismäßigkeit staatlicher Anordnungen? Geschuldet dem Rat der Virologen? Und wo war die theologisch begründete Nachfrage? Seit Beginn der Corona- Krise starben in unseren Pflegeheimen und Krankenhäusern etwa Menschen. Ja, es gab das intensive Ringen von Seelsorgern, Ärzten und Heimleitungen um Beistand für Sterbende. Dafür meine höchste Wertschätzung und Anerkennung. Aber ein Einzelfall war der einsame Tod des 95-Jährigen nicht. Für Ostdeutschland kann ich sagen, dass die Mehrheit trotz allen kirchlichen Einsatzes vor Ort einsam aus dem Leben schied. Musste das sein? Nein. Es war kein leitender Geistlicher, sondern der Präsident des Deutschen Bundestages und Protestant Wolfgang Schäuble, der öffentlich eine Abwägung von Lebensschutz und Freiheitsrechten anmahnte. Als ich Mitte Mai kritisierte, die Kirchen hätten beim Schutz der Schwächsten versagt, erntete ich aus meiner eigenen evangelischen Kirche helle Empörung. Kein Anlass zu kirchlicher Selbstkritik? Das fand ich erstaunlich, da doch dieselben Kirchen bei anderen Themen die Politik oft kräftig kritisieren. So wünsche ich mir das kirchliche Wort zu Corona nicht frei von Irrtümern, aber bereit zur kritischen Selbstreflektion. Ich wünsche mir dieses Wort deutlich vernehmbar, öffentlich und getragen von der Botschaft Jesu:»Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.Der ZEIT war dies unwürdig«in einem Leitartikel der ZEIT vom 28. Mai warf Evelyn Finger den Bischöfen vor, sie hätten zur Isolation der Alten geschwiegen. Wir dokumentieren weitere Stimmen zur Debatte. Während andere Länder immer tiefer in der Pandemie versinken, holen wir Atem. Das wäre ein Moment, darüber nachzudenken, was wir erlebt, erlitten, getan und versäumt haben, eine Gelegenheit auch zur Selbstkritik. Was wir nicht brauchen, sind pauschale Entwertungen wie im Leitartikel zur Pfingstausgabe. Er hält den Kirchen vor, zur Lage der Alten und Sterbenden geschwiegen zu haben, und ist sich nicht zu schade, ihnen das hochproblematische Etikett»nicht systemrelevant«aufzukleben. Das ist unfair, weil die Corona-Maßnahmen die Kirchen ja von ihrem eigentlichen Lebenselement, der direkten Begegnung, abgeschnitten hatten. Es ist empirisch falsch, weil kirchliche Akteure sehr viel gesendet und sich intensiv engagiert haben. Vor allem aber offenbart dieser Vorwurf ein erschreckend autoritäres Kirchenbild: Als wäre der Inbegriff der Kirche eine heroische Proklamation ihres obersten Repräsentanten. Dieser Leitartikel war eine polemische Entgleisung, die besser in eine populistische Empörungspostille gepasst hätte. Der ZEIT, die liberale Nachdenklichkeit für sich beansprucht, war dies unwürdig. Johann Hinrich Claussen ist Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Der Vorwurf,»die Amtskirchen«hätten nicht ausreichend protestiert gegen die Isolation in den Pflegeheimen, greift zu kurz. Ja, die Situation war schwierig. Wer aber so tut, als wäre von Anfang an klar gewesen, was richtig ist, macht es sich zu einfach. Gerade die bedrückende Situation alter Menschen war komplex. Das erfordert Nachdenklichkeit, wie sie im Memorandum des badischen Landesbischofs Jochen Cornelius-Bundschuh und des Gerontologen Andreas Kruse Anfang April zu hören war. Sie warnten davor, Menschen aufgrund des Alters zur Risikogruppe zu erklären, und forderten, dass Besuche von Angehörigen möglich sein müssen, dass also Lebensqualität und der genaue Blick auf die individuelle Situation nötig sind. Die Kirchen haben in vielen Stimmen das Unplanbare geplant und das Unwägbare abgewogen, sie haben alles daran gesetzt, Menschen gut zu begleiten und Orientierung zu bieten. Sie haben Menschen getröstet und andere Menschen irritiert oder gar enttäuscht. Weil sie die Komplexität der Lage ernst genommen haben, waren sie eher tastend als vollmundig deklarierend unterwegs. Nur eines haben sie ganz sicher nicht: geschwiegen. Heike Springhart ist Privatdozentin für systematische Theologie in Heidelberg und Pfarrerin in Pforzheim Wo waren die Bischöfe, als Alte und Kranke sie brauchten? so fragten Sie rhetorisch in der ZEIT. Als Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe kann ich Ihnen versichern: Wir waren nach unseren Kräften da! Als in Niedersachsen Mitte März ein absolutes Besuchsverbot in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen erlassen wurde, haben wir alles dafür getan, um in jedem Heim Seelsorge zu ermöglichen. Das Ziel: Einsame und Sterbende zu begleiten. Nur ganz wenige Heime unserer Region erlaubten ja anfangs den Zugang von Seelsorgern. Die Angst war groß! So haben wir mit den politisch Verantwortlichen im Land und in den Kreisen verhandelt. Wir legten ein Konzept vor, wie unsere Seelsorger helfen könnten: durch Gottesdienst und Andacht; durch Sterbebegleitung für Heimbewohner und Trost für Angehörige; durch Stärkung des Pflegepersonals. Wir haben unser Angebot so formuliert, dass die Heime es nicht ablehnen konnten. Bei allen Heimleitungen galt es, Überzeugungsarbeit zu leisten: Lebensschutz und Begleitung von Einsamen und Sterbenden haben in einer zivilisierten Gesellschaft gleichen Rang. Wo war der Bischof? Gemeinsam mit seinen Seelsorgern an der Seite der Sterbenden, der Familien, der Pflegenden und übrigens auch bei den Polizisten. Karl-Hinrich Manzke ist Bischof der Evangelisch- Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe Allmählich hat sich das öffentliche Leben normalisiert. Doch wie sieht es in den Pflegeheimen aus? Viele Heimbewohner sind weiter isoliert. Denn jede einzelne Einrichtung musste ein Öffnungskonzept erarbeiten, das konkret auf das jeweilige Haus zugeschnitten ist. Immerhin: Ich darf als Seelsorgerin jetzt endlich»meine«pflegeheime wieder betreten! Ich konnte bereits kleine Gottesdienste feiern und darf nun auch Besuche machen. Darüber bin ich sehr froh. Es waren quälende Wochen, in denen ich keinen Zugang hatte. Mein Eindruck war, dass Seelsorge nicht als systemrelevant gilt. Sie fiel wochen-, ja monatelang aus. Unerträglich war mir die lange Einsamkeit der Heimbewohner, aber auch, dass Pflegekräfte ans Limit gerieten. War es genug, für sie zu beten und ihnen zu danken? Ich hätte mir die jetzt angelieferten Masken vor acht Wochen gewünscht, dazu Schutzkleidung und Unterstützung der Landeskirche. Warum hat die Kirchenleitung sich nicht dafür starkgemacht, dass ich meinen Dienst tun durfte? Mich hat es aufgewühlt, mir die Isolation vertrauter Heimbewohner vorzustellen. Auch der Hinweis von Kollegen, dass in Thüringen ein Pfarrer sich per Gerichtsurteil Einlass ins Heim verschaffte, war mir keine Hilfe. Ich will nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander helfen. Dorothee Schieber ist Pfarrerin und Altenseelsorgerin in Göppingen Eine Frau aus der Nachbarschaft klagt mir ihr Leid: Noch immer kann sie ihre Mutter im Pflegeheim nur von Ferne sehen. Die Mutter ist völlig verzagt, sie versteht die Tochter nicht. Ein Kollege ruft an: Ob ich wüsste, wie die rechtliche Lage aussieht. Ihm ist untersagt, ein Gemeindemitglied in der Alteneinrichtung zu besuchen. Eine Freundin wird gewarnt: Sollte sie mit ihrem dementen Mann, der im Heim lebt, draußen einen Spaziergang machen, könne sie ihn gleich mit nach Hause nehmen. Und eine Heimleiterin schreibt: Ob mir eigentlich klar sei, unter welchem Druck sie und ihre Mitarbeiterinnen stünden. Ich finde: Das geht so nicht weiter! Die Herausforderung durch Corona dauert an, und das Problem der Zwangsisolation alter Menschen ist ungelöst. Wir brauchen jetzt gelebte Nächstenliebe, die niemanden alleinlässt in den Heimen. Viele fühlen sich geradezu ihrer Freiheit beraubt. Der Berliner Bischof Christian Stäblein plant nun einen Seelsorgegipfel zum Thema. Das halte ich für dringend nötig. Wir brauchen christlich vertretbare Regeln, damit niemand in Einsamkeit und Isolation verzweifelt. Damit niemand vor Covid-19 geschützt, aber allein, abgeschottet, ohne seelsorgliche Begleitung sterben muss. Margot Käßmann ist Bischöfin i. R. Kranke und Alte zu besuchen gehört zu den sieben Werken der Barmherzigkeit. Das gilt erst recht in diesen Zeiten. Ich bin dankbar, dass in dem Seniorenheim, wo meine Eltern leben, die Leitung des Heimes das auch so gesehen hat! Dass es im Garten bei gutem Wetter für alle Heimbewohner möglich war, einmal pro Tag Besuch für eine Stunde zu empfangen. Ja: unter Einhaltung aller AHA-Regeln! Aber dass man auch Barmherzigkeit zulässt, ist eine Frage des Herzenstaktes. Das kann und muss jetzt in jedem Seniorenheim, jedem Krankenhaus möglich sein. Da darf man nicht den Totalabsicherern das Regiment überlassen. Denen, die Regeln erfinden, unter denen dann andere leiden. Die Kirchen sollten wie in den letzten 2000 Jahren auch heute dafür sorgen, dass der Dienst am Nächsten überall möglich ist. Und die Politik sollte auch an den Herzenstakt von uns allen appellieren. Er ist existenzrelevant. Wenn uns nicht die Liebe dazu treibt, barmherzig zu handeln, dann sollte uns wenigstens das Mitleid treiben. Von dem Schriftsteller Stefan Zweig haben wir das schöne Wort von der Ungeduld des Herzens. Auch die ist jetzt das Gebot der Stunde. Steffen Reiche ist Pfarrer in Berlin Mehr zum Thema lesen Sie im ZEIT-Magazin
55 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 ENTDECKEN Bilder: Felix Eckardt für DIE ZEIT Der Künstler Felix Eckardt malte diese Szene frei nach den Geschehnissen der Krawallnacht in Stuttgart, in der junge Männer die Innenstadt verwüsteten Warum sind viele Schwaben so wütend? Nicht erst seit Stuttgart 21 treibt es sie immer wieder auf die Barrikaden. CLAUDIA SCHUMACHER versucht ihre Landsleute zu verstehen
56 56 ENTDECKEN 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Schon der Briefkasten knurrt: Keine Werbung,»sonst viel Ärger«picture alliance/dpa Denke ich an Schwaben, meine Heimat, rede ich lauter, gröber und vergesse zu atmen. You can put lipstick on a Schwob, but it s still a Schwob. Das letzte Mal, als ich über meinen Stamm schrieb, wollte mich ein Mitschwabe wegen»volksverhetzung«verklagen. Meine Wut, seine Wut: der reinste Herkunftsnachweis.»Des isch doch Schwachsinn!«, poltert mir Boris Palmer entgegen. Skype-Anruf beim»wutbürgermeister«, der gegen die Corona-Maßnahmen mal wieder Kopf und Kragen riskierte, im Mai aber aus Vorsicht»nicht einmal die Bürger«traf. Zur verabredeten Zeit klingle ich mich ins Tübinger Rathaus, die Verbindung steht, aber am anderen Ende grüßt niemand. Palmer redet weiter, nur nicht mit mir. Es scheint um die Kita-Regelungen zu gehen.»hallo, Herr Palmer?«, wage ich mich vor.»huch, wer isch denn die fremde Frau?«, der grüne Oberbürgermeister lacht. Man könne sich auf Skype bei ihm einwählen, ohne dass er abhebe; habe er für seine Tochter eingerichtet. Mit Palmer möchte man klären, was da eigentlich los ist: Den Schwaben geht s gut, meist sogar besser als allen anderen trotzdem sind sie wütend. Ständig. Und schon wieder.»feiernde«randalieren in Stuttgarts Innenstadt. Im Mai fanden hier die größten Hygienedemos des Landes statt. Und vor zehn Jahren, bei Stuttgart 21, wurde der Wutbürger erfunden, den man heute irrtümlich für einen Ostdeutschen hält. Regt sich die schwäbische Wut, ist es nicht selten Palmer, der sie in Worte fasst.»wir retten möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären«, war sein letzter großer Aufreger zu Corona- Zeiten. Sprüche wie dieser haben ihn zum wahrscheinlich bekanntesten Bürgermeister Deutschlands gemacht. Natürlich war er auch gegen Stuttgart 21. In der Flüchtlingskrise schleuderte er der Kanzlerin ein»wir schaffen das nicht!«entgegen. Selbst Greta Thunberg, mit der er als leidenschaftlicher Öko eine Riesenschnittmenge hat, wollte er widersprechen:»nein, wir haben deine Jugend nicht zerstört.sind Sie oft wütend?«, taste ich mich heran.»nö, ich bin nicht wütend«, protestiert Palmer sofort. Es gebe mal kurze Situationen, da rege er sich auf,»auf Schwäbisch sagt mr: Da geht einem der Gaul durch, aber dann isch s au vorbei«. Es scheint Boris Palmer zweimal zu geben: Palmer, das erfolgreiche Schafferle, so nehmen sie ihn in der Musterstadt Tübingen wahr. Bundesweit sieht man vor allem den Polter-Palmer, der Shit storms losschimpft, zuverlässig gegen die grüne Parteilinie.»Ich gebe gerne Kontra«, sagt er. Und gegen die»harmoniesucht«im Land sei er»wirklich vehement«. Er sei übrigens»anhänger der Hegelschen Dialektik«und glaube,»dass zu jeder These eine Antithese gehört«. Friedrich Hegel, der schwäbelnde Philosoph aus Stuttgart: kein Wunder, dass die Dialektik im Ländle erfunden wurde. In Schwaben vereinten sich»die heftigsten Gegensätze«, schrieb schon der Mundartforscher Fritz Rahn Mitte des 20. Jahrhunderts, oft kämen»in ein und demselben Individuum äußerste Kühnheit mit befremdlicher Zaghaftigkeit, Rebellentum mit Philisterei, (...) Misstrauen mit Zutraulichkeit«und»Höhenflug mit Horizontlosigkeit«zusammen. Der Schwabe als wandelnder Widerspruch wie bei Palmer. Ist das pietistische Erbe an dieser Schizophrenie schuld? Der jüngst verstorbene Journalist Ulrich Kienzle, ein Rems ecker Urgestein, sprach von»schwäbischen Taliban«und»Piet congs«: Ab 1600 hätten die Pietisten die»umerziehung«der»fröhlichversoffenen Schwaben des Spätmittelalters«übernommen, schrieb er in seinem Buch Die Schwaben.»Bis zur Unkenntlichkeit«hätten die Pietisten und Pfarrer die lustigen Leutle damals verändert, aber vor allem: innerlich gespalten.»alles, was Spaß macht«, sei verboten worden, von der Völlerei bis zur Fastnacht. Stattdessen sollten sie sich für den Weltuntergang bereit machen. Es gab sogar eine Art Pietisten-Stasi: Nachbarn wurden zu informellen Mitarbeitern der Kirchenpolizei und bekamen für ihr Denunziantentum ein»anbringdrittel«. Eine historische Prägung, die sich vielleicht auch zu Beginn der Corona-Pandemie zeigte: Verwandte in der schwäbischen Provinz berichteten mir von Nachbarn, die andere bei der Polizei verpfiffen, sobald einer zu viel im Garten saß kurz bevor die Stimmung kippte und die Leute wütend gegen zu strikte Maßnahmen demonstrierten. Auch Boris Palmer glaubt, dass Wut und Rebellentum etwas sehr Schwäbisches seien. Das reiche zurück bis zum Tübinger Vertrag von 1514,»eine Art schwäbische Magna Charta«. Anders als in Bayern habe es in Württemberg keine Fürstenverehrung gegeben, sondern ein jahrhundertelanges Auflehnen gegen die Obrigkeit, sagt Palmer. Ich muss an meine Oma Anneliese denken, ein Musterbeispiel schwäbischer Renitenz. Ein Schrank von einer Frau, Bäuerin und Mutter von sechs Kindern. Bis ins hohe Alter lebte sie nahezu autark aus ihrem Gemüsegarten. Im Altersheim probte sie den Aufstand und stiftete Mitbewohnerinnen zum Ausbruch an. Mit»Wo kommsch denn du alds Arschloch her?«begrüßten die Älteren ein an der früher schon mal. Warum auch nicht? Ein heimisches Gericht entschied, dass»arschloch«in Schwaben keine Beleidigung sei. In einem Biergarten in Deizisau stellt sich Peter Främke als»rentner mit Demonstrationshintergrund«vor. Zur Begrüßung reicht er mir ein unverlangtes Manuskript: ein Best-of seiner Leserbriefe. 224 davon hat die Nürtinger Zeitung gedruckt. Zu Stuttgart 21, zum Klima, zu Corona.»Wirklich ganz hervorragend, diese Leserbriefabteilung!«, sagt er gut gelaunt, nur um in den folgenden zweieinhalb Stunden zunehmend in Rage zu geraten. Främke, pensionierter Industriekaufmann, Linken-Wähler und Fan von Fridays for Future, sagt, er habe sich viel mit den Dreißigerjahren befasst. Damit sich die Geschichte nicht wiederhole, dürften»die da oben«nicht zu viel Gewalt haben.»was wir jetzt bei Corona an Machtdemonstrationen erleben, dagegen war das bei Stuttgart 21...«Die Frau neben ihm hilft aus:»ein Vogelschiss«. Eigentlich wollte ich nur sie treffen: Walburga Bayer, Rentnerin und freiberufliche Lektorin, die Haare noch etwas röter als bei anderen Schwäbinnen ihres Alters. Främke hat sie mitgebracht, weil die ZEIT mal mit der Gates Foun da tion kooperierte ein rotes Tuch in ihren Kreisen. Stuttgart 21 war ihr Er we ckungs erleb nis. Aus Enttäuschung über»das System«gehe sie schon lange nicht mehr wählen. Sie betreibt einen meinungsstarken Newsletter, in dem sie zum Beispiel gegen die Corona- Auflagen für Schwimmbäder wettert: Sie werde sich»nicht am Nasenring durch die Manege führen bzw. durchs Becken ziehen, dressieren, überwachen und zum Affen machen lassen«. Warum sind Sie so wütend, Frau Bayer? Sie zögert.»wut hat immer so ein Gschmäckle«, sagt sie.»dabei ist sie doch was Gutes!«Ein Impuls, um aktiv zu werden.»mich machen die da oben wütend, die uns ständig ihren Willen aufdrücken und uns für dumm verkaufen«, sagt sie. Den Lockdown empfand sie als Gängelung:»Man hätte uns ruhig etwas Eigenverantwortung zutrauen können.«beruhigt es Sie nicht, dass die Einschränkungen zeitlich begrenzt sind?»überhaupt nicht«, sagt Bayer.»Wir haben ja beim Soli gesehen, wie s läuft.«ursprünglich für ein Jahr eingeführt, gebe es ihn bis heute. Lauter noch nicht vernarbte Wunden: so wie Stuttgart 21. Anfangs sah es da aus, als würden die Schwaben endlich mal was»geschenkt«bekommen. Ein preiswerter Superbahnhof fürs»imidsch«, größtenteils von Bund und Bahn finanziert. Viele allerdings hatten das Gefühl, er werde an ihnen vorbei geplant. Und als dann auch noch die In der Nacht des 20. Juni werden in der Stuttgarter Innenstadt 40 Läden beschädigt Kosten explodierten, wurden die damaligen Proteste zum Urknall. Eine neue Figur betrat die politische Bühne: der Wutbürger. Nicht das Prekariat stand auf, sondern die gebildete Mitte der Gesellschaft.»Der Wutbürger macht nicht mehr mit, er will nicht mehr. Er hat genug vom Streit der Parteien, von Entscheidungen, die er nicht versteht und die ihm unzureichend erklärt werden. Er will nicht mehr staatstragend sein, weil ihm der Staat fremd geworden ist«, schrieb der Spiegel- Redakteur Dirk Kurbjuweit damals. Mitten im stolzen Villenviertel, hoch über dem»kessel«der Stuttgarter Innenstadt, in dem immer wieder die Wut hochkocht, liegt das Holzhaus von Carola Eckstein und Matthias von Herrmann, am Gartentürchen ein Aufkleber: Stuttgart 21 rot durchgestrichen.»schuhe aus, bitte.«ich darf Filzpantoffeln aus dem Gast-Sortiment wählen schwäbischer kann der Tag kaum werden. Ein Klavier und Antiquitäten, viel Grünzeug in Töpfen. Wir nehmen Platz auf dem Balkon, Protestshirts trocknen in der Sonne.»Der Schwarze Donnerstag, an dem friedliche Demonstranten schwer verletzt wurden, hat natürlich alles verändert«, sagt Matthias von Herrmann, praktischer Haarschnitt, prüfender Blick. Wasserwerfer und Polizisten, die im September 2010 selbst Kinder mit Pfefferspray einnebelten:»was soll das für ein Staat sein?«, fragt seine Frau. Das war der Vertrauensbruch. Schnell ging es nicht mehr nur um den Bahnhof, sondern um einen Staat,»der offensichtlich den Respekt vor seinen Bürgern verloren hat«. Dazu gehörte auch die behäbige Stuttgarter Justiz, die bei Rechtsradikalen schon mal ein Auge zudrückte, die Bahnhofsproteste aber harsch verfolgte.»ganz zu schweigen von den Grünen, die der Widerstand an die Macht führte«: Frisch am Drücker, verrieten sie aus Sicht der Protestler erst mal die Wähler und zogen das Projekt durch, das man heute nur noch mit dem Berliner Flughafen vergleichen könne. Das Ehepaar, sie promovierte Mathematikerin, er Politologe, engagiert sich bis heute im Organisationsteam gegen Stuttgart 21, im Februar feierten sie ihre 500. Montagsdemo. Als ich wieder in den Kessel hinabsteige, denke ich darüber nach, wie wenig der Begriff»Wutbürger«doch zu diesen Widerständlern passt, die damals eine Debatte über direkte Demokratie anstießen. Würde die Wut solcher engagierten, klugen Bürger nicht verfliegen, wenn sie mehr Mitsprache hätten? Ist es im Kern nicht eine gute, eine produktive Wut? Im Gegensatz zur aktuellen. Niemand verkörpert den neuen Typ Wutbürger so wie Michael Ballweg. Der 46-jährige Unternehmer mit den»querdenken«-shirts, die gerade so viele Schwaben pfiffig finden: Keinem anderen Demo-Organisator gelang es zu Beginn der Corona-Krise, so viele Leute auf die Straße zu bringen. Bei Ballweg knurrt einen bereits der Briefkasten an: Keine Werbung,»sonst viel Ärger«. Er hat den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen nach Stuttgart eingeladen und den passenden Buchtitel im Regal stehen: Lügen mit Zahlen. Ich besuche ihn in seinem kühlen Unternehmensneubau in Bad Cannstatt, wo sie Soft ware für Kunden wie den Autozulieferer Bosch herstellen. Und was macht er als Erstes? Ballweg richtet eine Kamera auf mich. Journalisten filmen, das tun sonst eher Islamisten oder Rechtsextreme. Feindbeobachtung. Auch Ballweg ist ein Bürger, der sich engagiert, das verbindet ihn mit Eckstein und von Herrmann. Aber seine Wut ist anders, sie richtet sich nicht gegen so etwas Konkretes wie einen Bahnhofsneubau, sondern gleich gegen das ganze System. Es müsse dringend ein neues her,»mit neuen Parteien«. Er redet davon, dass»die Massenmedien«durch»alternative Medien«ersetzt werden würden. Das System, wie wir es kennen, sei am Ende. Bei den Demonstrationen, sagt er, sei es ihm ums Grundgesetz gegangen. Unterhält man sich allerdings eine Weile mit ihm, scheint sein naturheilkundliches Interesse durch. Ballweg ist Impfskeptiker und sieht sich in Zeiten von Corona als Freiheitskämpfer. Wer sich gesund ernähre, denke kritischer, sagte er einem Naturheilkundesender. Die Menschen würden gerade»in Massen«aufwachen, sich nicht mehr manipulieren lassen. Auf seinen Demos verschenkt er»energiesteine«. Mir kommt Ballweg wie ein Eso-Apokalyptiker vor, eine Art später Nachfahre der pietistischen Untergangsprediger. Er erzählt, dass er seine Lebensversicherungen gekündigt habe, denn er glaube nicht, dass das Geldsystem so noch lange funktioniert.»der Staat schürt Angst in der Bevölkerung, um sie besser beherrschen zu können«, sagt Ballweg. Dass auch seine Demos Angst schüren vor der Wirtschaftskrise, dem Staat, den Medien sieht er nicht. Wahrscheinlich ziehen Ballwegs dystopische Szenarien so viele an, weil die Angst bereits da ist. Er muss ihr nur Ausdruck verleihen. Neurologisch sind Wut und Angst Geschwisteremotionen, die von der gleichen Hirnregion, der Amygdala, gesteuert werden. Soziologen erklären die Wut der Bürger oft mit der Abstiegsangst der Mittelschicht. Doch woher kommt diese Angst in einer der reichsten Gegenden Deutschlands? Das schwäbische Wutbürgertum scheint zu großen Teilen aus Ingenieuren zu bestehen, aus Ärzten und Homöopathen. Von denen gibt es viele in der Region, dank der Tübinger Uni, der Gesundheitsindustrie und der anthroposophischen Bewegung, die hier starke Wurzeln hat. Es ging diesen Leuten schon besser: Die Homöopathen bangen dem Ende der Kassenunterstützung entgegen, die durchreformierte Ärzteschaft hat an Geld und Ansehen verloren. Wahrscheinlich kein Zufall, dass in Schwaben zwei Ärzte die Corona-Proteste anheizten: ein Sinsheimer, der die Bewegung»Widerstand 2020«mitgründete, und ein Cannstatter Onkologe, der sich als parteiloser Abgeordneter regelmäßig von der Polizei aus dem Landtag führen lässt. Ist die Angst vor dem Abstieg vielleicht so groß, weil der Aufstieg so schnell ging? Der Schwabe war praktisch Bauer, bis mit Mercedes, Porsche und ihren Zulieferern die Autoindustrie aufblühte und er plötzlich auf der Überholspur an Restdeutschland vorbeifuhr. Ein Wandel, der sich in meiner Familie in nur einem Menschenleben vollzog: Mein Onkel übernahm als junger Mann den Bauernhof vom Vater, arbeitete später als Ingenieur bei Daimler, entwickelte das Papamobil mit und traf zwei Päpste. Wahrscheinlich hat kein Unternehmen so viel dazu beigetragen, den Schwaben ein stabiles Selbstwertgefühl zu geben, wie»der Daimler«, der sie jahrzehntelang mit Arbeit und Wohlstand versorgte und endlich auch mit Ansehen. Wenn der Daimler wankt, wankt dieses Selbstwertgefühl. In der wirtschaftsgeografischen Fachliteratur gibt es ein Worst-Case-Szenario: Schwaben als»ruhrgebiet des 21. Jahrhunderts«. Landespolitiker erhalten Wutbriefe von Bürgern, die ihnen vorwerfen, mit ihrer Klimapolitik die heimische Wirtschaft mutwillig zu zerstören. Ein Besuch im Daimler-Stammsitz in Untertürkheim. Am Bahnhof werde ich von einer Limousine abgeholt, die mich zum vielleicht wütendsten deutschen Betriebsrat bringt. Es fühlt sich ein bisschen an, wie Der Pate auf Schwäbisch. Als ich meine Maske anziehen will, sagt der Fahrer:»Wege mir sicher ned« gründete Oliver Hilburger mit»zentrum Automobil«eine rechte Gewerkschaft bei Daimler, er selbst sagt: alternative Gewerkschaft. Er und seine Kollegen besetzen in Untertürkheim vier Büros. Hilburger agitiert gegen die Globalisierung, von der Daimler lebt. Corona habe gezeigt, wie zerbrechlich die Lieferketten seien. Auch Arbeitsmigration sieht er skeptisch. Die Wut seiner Anhänger richtet sich teils gegen die Kollegen mit Migrationshintergrund, die neben ihnen am Band stehen. Wegen rassistischer Vorfälle kam es schon zu zwei Kündigungen. Früher spielte Hilburger in der Rechtsrock-Band Noie Werte, deren Lieder im ersten Bekennervideo des NSU liefen. Heute distanziert er sich von Extremismus;»wenig überzeugend«, sagt ein Verfassungsschützer. Einer von Hilburgers Betriebsratskollegen wurde am Rande einer Corona- Demo in Stuttgart von»40 Vermummten«, mutmaßlich Linksextremen, ins Koma geprügelt. Hilburger fragt:»wo ist der Aufschrei der Medien?«Er freut sich auf den Ballweg-Demos über die Meditationen zur Beruhigung der Massen,»ganz meine Welt«. Der Gewerkschaftsgründer ist ein Familienvater, der nicht nur gegen Stuttgart 21 demonstrierte, sondern, auch er: gegen das Impfen. Eine erstaunliche Besonderheit der schwäbischen Wut: Nirgendwo sonst blenden die zwei Bedeutungen des Worts»alternativ«so in ein an der wie im konservativen Eso-Ländle. Die alte linke und die neue rechte Bedeutung: in Schwaben dialektisch vereint. Mir fällt Maxim Billers Begriff vom Linksrechtsdeutschen ein, worunter er so eine Art Bioladenkäufer mit reaktionärem Mindset versteht. Früher konnte die CDU die Linksrechtsdeutschen im Ländle containern und ruhigstellen. Heute ist die Wut allgegenwärtig, nur hat keine der Wutfraktionen eine Mehrheit. Die einen sind nach links, die anderen nach rechts gedriftet, wieder andere sind bloß verwirrt aber bei drei sind alle auf den Barrikaden. Ein»Völklein schwer zu begreifen. Gutes und Schlimmes verknäuelt wie kaum irgendwo«, schrieb der Philosoph Friedrich Theodor Vischer 1879 über die Schwaben würde ich heute noch unterschreiben. Kaum schließe ich einen Mitschwaben ins Herz, macht er mich wütend mit seiner dialektischen Kehrseite. Selbst meine Oma, die mich mit ihrer neurotischen Charakterstärke so beeindruckte, dass ich heute noch viel an sie denke, sagte während der Finanzkrise zu mir:»jetzt bräuchten wir wieder einen Hitler.«Ich war schockiert sie am Kichern. Ihr Ernst? Oder genoss sie nur meine wütende Reaktion? Wieder so ein Schwabenstreich.
57 ENTDECKEN 57 Wer sind Sie? FRANCESCO GIAMMARCO ENTDECKT Kokaino und Schokochino Widersprüche musst du aushalten, schon klar. Aber was macht dieser Hartrapper in meinem Mousse-au-Chocolat-Leben? Seit Tagen laufe ich mit diesen Songzeilen im Kopf herum: Gib mir eine Tonne weiße Ziegelsteine, und ich bau dir ein Iglu / Ich hab mehr Weiß gesehen als ein Eskimo / Wovon ich rede? Von Kilos Kokaino / Kolumbianische Ware direkt vom Latino. Ich singe sie bei jeder Gelegenheit vor mich hin. Wenn ich etwa mal wieder in der langen Schlange vorm Bäcker warten muss, weil jeder in der Nachbarschaft das gute Sylter Weißbrot haben will. Wenn ich morgens die Hortensien gieße und abends das alkoholfreie Weißbier kalt stelle. Oder wenn ich schnell noch im Café Liebes Bisschen um die Ecke ein Stück Mousse-au-Chocolat- Torte besorge. Lecker. In unserer komplexen Welt muss man lernen, Widersprüche auszuhalten. Das nennt man Ambiguitätstoleranz. Die Frage ist nur, ab wann es peinlich wird. Nehmen Sie meinen Fall: Die Zeilen, die ich rezitiere, stammen von Haftbefehl, einem Rapper aus Offenbach, der gerne von seiner Dealer-Vergangenheit erzählt und in Besitz eines sehr schönen grün-weiß gestreiften Hemdes von Ralph Lauren ist (vgl. ZEITmagazin Nr. 26/20). Haftbefehl und ich haben einfach sehr wenig gemeinsam. Wir haben beide einen Migrationshintergrund, okay, aber er kommt aus Offenbach und ich aus Schwabing. Er fährt»im Maybach durch Moskau«, ich fahre im Polo Terrakottatöpfe kaufen. Er rasiert sich die Haare hinten und an den Seiten ab, ich habe wunderschöne lange Locken. An einem idealen Tag veranstaltet Hafti ein BBQ mit seiner Familie. Ich will am Wochenende niemanden sehen und versuche, mehr Hülsenfrüchte zu essen. Was wir gemeinsam haben: Er und ich mögen seine Musik. Von uns beiden bin ich aber der Einzige, der meine Kolumne liest. Was jetzt nicht heißt, dass ich gar keine Ahnung von der Welt habe, die Haftbefehl in seinen Liedern beschreibt. Ich habe immerhin mal in Berlin gelebt. Da kann man auch als Bürgerkind einiges erleben. Ein Hier entdecken jede Woche im Wechsel: Francesco Giammarco, Alard von Kittlitz, Anna Mayr und Nina Pauer Freund von mir musste zum Beispiel immer die Junkies aus seinem Treppenhaus vertreiben, weil die Eingangstür seines Kreuzberger Wohnhauses kaputt war. Die Langzeitabhängigen leisteten keinen großen Widerstand. Aber die jungen Typen, die ihre Drogenkarriere gerade erst begannen und noch voll im Saft standen, konnten ziemlich unangenehm werden. Bei ihnen war mein Freund großzügiger. Außerdem erinnere ich mich noch an einen Studenten, mit dem ich auf einem Techno-Festival war. Der lief in einem Thawb herum, einem langen arabischen Gewand, das er sich in Neukölln gekauft hatte, weil ihm so heiß war. Der war mit Sicherheit auf Drogen. Er nannte sich selbst»kalif von Peenemünde«. Im Nachhinein betrachtet war das ein klarer Fall von cultural appropriation. Aber damals waren wir dafür einfach noch nicht sensibilisiert. Vielleicht hat dieses Problem der musikalischen Widersprüchlichkeit ja jede Generation betroffen. Leute im Alter meiner Eltern haben wahrscheinlich im Reformhaus gestanden und Brown Sugar von den Stones oder What s Going On von Marvin Gaye gesungen. Und wenn ich ehrlich bin, hat die Musik, die ich höre, noch nie besonders viel mit meinem Leben zu tun gehabt. Als Jugendlicher war ich Fan von Rage Against the Machine und tue heute trotzdem alles, was man mir sagt. Und wenn es in der Arbeit mal nicht läuft, lege ich Livin on a Prayer von Bon Jovi auf, damit mein working class struggle den richtigen Sound bekommt. Das ist allemal besser, als wenn ich selbst Kunst machen würde. Und jetzt sollte eigentlich ein von mir geschriebener Rap kommen, im Stil von Haftbefehl, aber mit Dingen, die in meinem Leben los sind: Bolia-Sofas, Zahnarzttermine, am Mittwoch der Demeter- Markt. Menschen, die es gut mit mir meinen, haben mich davon abgehalten. Schade eigentlich, ich glaube nämlich, dass so ein schönes Ralph-Lauren-Hemd auch sehr gut zu meinem Life style passt. Illustration: Oriana Fenwick für DIE ZEIT Victoria Jung porträtiert hier Menschen, die ihr im Alltag begegnen. Protokoll: Caroline Weigele PAARWEISE Nr. 2 Die Frage»Was machst du so?«habe ich gehasst. Ich schämte mich, weil ich nach dem Abi nichts fand, was mich begeisterte. Als ich 2017 eine Ausbildung zur Hotelfachfrau anfing, warnte man mich vor dem Stress. Zu Recht. Ich liebe die Arbeit trotzdem. Vor zwei Jahren entdeckte ich dann eine Beule an meinem Hals. Als man mir sagte, es sei Krebs, war ich sauer, ich fühlte mich gesund. Dann kam die Chemo. Wie paradox, dass die rettende Therapie einen so krank macht. Mir war kalt, Sonne ertrug ich nicht. Als mir die Haare ausfielen, drückte ich meiner besten Freundin den Rasierer in die Hand. Vor der Glatze probierten wir einen Iro. Jetzt arbeite ich wieder. Früher habe ich mich vor schweren Aufgaben gedrückt. Heute denke ich mir:»probier s halt.«charlotte Müller, 28, ist Hotelfachfrau im dritten Lehrjahr. Sie lebt in Stuttgart Eine Sex-Kolumne Zeichnungen von Mrzyk & Moriceau ANZEIGE REISEEMPFEHLUNG Sommerurlaub in Südtirol: Auszeit im 4-Sterne-Hotel INKLUSIVLEISTUNGEN DER REISE 7 x Übernachtung mit Halbpension Frühstücksbuffet & 4-Gang-Abendmenü mit Salatbar und Vorspeisenbuffet Galadinner mit Aperitif (immer sonntags) Kuchenbuffet am Nachmittag Themenabend im Hotel (z.b. Grillabend, Törgellenmenü) Spezielle Kindermenüs Kostenfreie Nutzung des Aussenschwimmbads Leihbademantel auf dem Zimmer Kostenfreie Nutzung der Sport- und Fitnesseinrichtungen (Hallenbad, Sauna, Tennisplatz, MTB-Verleih) Kostenfreie Stornierung bis 1 Tag vor Anreise DAS HOTEL LAMBRECHTSHOF Das Hotel befindet sich in wunderschön ruhiger, leichter Hanglage am Ortsrand von Eppan an der Südtiroler Weinstraße, ca. 10 km von Bozen entfernt. Das malerische Ortszentrum von Eppan erreicht man zu Fuß in ca. 10 Minuten. Das familiär geführte Haus bietet einen klimatisierten Speisesaal, Tiroler Stube, Fernsehraum, gemütlichen Aufenthaltsraum, zwei Panorama-Sonnenterrassen, mediterraner Garten mit Freibad, Liege- und Sitzmöglichkeiten, Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Tepidarium, Saunagarten, Erlebnisdusche, Tennisplatz, Fitnesspavillon, Lift und WLAN. Die geräumigen, individuell eingerichteten Zimmer, sind alle mit Du/WC, TV, Telefon und überwiegend mit Balkon, Loggia oder Terrasse ausgestattet. AUSFLUGSZIELE & UMGEBUNG Direkt vom Hotel aus wandern Sie zum beeindruckenden Naturphänomen Eislöcher. Für Familien bieten außerdem der Naturpark Schlern-Rosengarten und Seen wie der Kalterer See, die Montiggler Seen und der Karersee beliebte Ausflugsziele. Nicht weit entfernt liegen die Städte Meran und Bozen mit dem Ötzi-Museum und attraktiven Geschäften, Schloss Trauttmansdorf und seine fantastischen Gärten sowie Schloss Sigmundskron mit der Messner-Ausstellung. Im sehr ursprünglichen Sarntal hat sich manch alter Brauch bewahrt und spiegelt sich in den Festen der Gegend wider. Reisepreis: 599 pro Person im Doppelzimmer in der Kategorie Komfort, Kinderfestpreis im Zimmer der Eltern: 0 6 Jahre frei, 7 15 Jahre: 299 Reservierungsanfrage mit dem Kennwort ZEIT unter: Hotel Lambrechtshof****, Badlweg 22, Eppan, Südtirol, Tel / , info@lambrechtshof.com,
58 58 REISE 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Eindeutig mehr Kirschen in Seedorf als Menschen in Wittenberge Fotos: Jewgeni Roppel für DIE ZEIT Der Weg ist das Ziel, beziehungsweise ein Ziel wäre nur im Weg Warum macht die Prignitz nicht längst groß Werbung mit ihrer Leere? Wo doch gerade alle danach suchen. MORITZ HERRMANN jedenfalls findet den am dünnsten besiedelten Kreis der Republik ganz und gar sympathisch Voran, voran, dies ist mein Rückzug. Ich peitsche meinen Wagen ostwärts, dem entgegen, was ich vor Monaten wohl noch nicht als Fluchtort in Betracht gezogen hätte und was mir jetzt, in Anbetracht der Ungeheuerlichkeit der Welt, wie ein Idyll erscheint. In der Gegenrichtung stehen sie im Stau, auf ihrem Treck nach Norden. Fahrt fleißig an die Küste, ihr Menschen. Fahrt in die Berge. In den Schwarzwald und ins Allgäu. Ballt euch überall, aber lasst mir die Prignitz. Dort will ich mich, wie Kafka schrieb,»bis zur Besinnungslosigkeit von allen absperren, mit allen mich verfeinden, mit niemandem reden«. Und ich will Urlaub. Trotz Corona, von Corona, von mir selbst. Wo wollte das gelingen, wenn nicht hier, in diesem Gefilde, das schon etymologisch so viel bedeutet wie»ungangbares Waldgebiet«in diesem Bermudadreieck im Nordwesten Brandenburgs, dieser Leerstelle zwischen Elbe und A 24? Dem am dünnsten besiedelten Landkreis des Landes, 36 Einwohner je Quadratkilometer nur, weniger noch als in Salzwedel in der Altmark oder in der Uckermark. Wobei lange jeder dieser Kreise den Superlativ für sich beansprucht hatte, ehe der Bericht des Statistischen Amtes Berlin-Brandenburg Fakten schuf: Die Prignitz ist s! Dass ich ebendie bereits erreicht habe, werde ich schleichend gewahr, anhand einer diffusen Veränderung der Umgebung. Es sieht seit einigen Kilometern sozusagen mittelalterlich aus. Als durchführe man einen seit Jahrzehnten nicht mehr polierten Kupferstich. Endlich fühle ich mich visuell mal nicht überfordert. Was da vorbeizieht, scheint mir keine Landschaft im eigentlichen Sinne, jedenfalls wenn man Landschaft als Folge sich mischender Naturen und Topografien begreift. Alles sieht sich selbst ähnlich, geht in Schattierungen ineinander über, ohne dass man die Übergänge bemerken würde. Es ist generell eher wenig Landschaft, davon aber wiederum sehr viel. Man kann darin verschwinden, ohne Zweifel. Ich bremse vor dem Fachwerkferienhaus, auf dessen Reet ein Storch klappert. Wie es das Schicksal will, ploppt just im Moment der Ankunft die Eilmeldung auf, Scharbeutz schließe komplett für Tagesausflügler. Die Ostsee platzt aus allen Strandkörben, lese ich lächelnd. Campingplätze sind überbucht. Meine liebe Mutter, die gerade im Wohnwagen in der Lübecker Bucht weilt, schickt mir ein Foto: Es sieht nicht mittelalterlich aus. Es sieht aus wie Rimini in den Neunzigern. Später, stumme Nacht, ich starre in den Himmel, der über der Prignitz so klar ist, dass man sogar den lieben Gott sehen kann. Gestern hat Elon Musk seine SpaceX hinaufgeschickt. Ein Testlauf für den Weltraumtourismus, der mir tatsächlich wie die einzige Reisealternative zur Prignitz erscheint: auch viel Platz, auch wenig Leute. In dieser ersten Nacht schlafe ich tiefer, als es mir zu Hause in Hamburg jemals gelingen will. Am nächsten Morgen möchte ich zur Bäckerei fahren, kurz in die Altmark hinein, als deren Brötchenwagen vor Geestgottberg meinen Weg schneidet. Ich wende und tuckere zur Betonmischanlage hinterher, wo der Brötchenwagen klingelnd vorfährt. Das ist seine feste Tour. Und das ist natürlich ein bisschen unangenehm, wie ich nun dort also als Erster in der Reihe stehe und meine Bestellung dekliniere, noch vor den wackeren Arbeitern, die in Warnweste und Stahlkappenschuhen aus ihrem Quartier schlurfen und mein Vordrängeln johlend quittieren. Meine Erklärung, ich sei ein Investor aus Hamburg, der sich für die Übernahme des Kieswerkes interessiere, kriegt Lacher, die feindliche Stimmung ist besänftigt. Man klopft mir schwer auf die Schulter. Willkommen in der Prignitz! Ich vergesse kurz, dass ich eigentlich doch keinen Menschenkontakt wollte. Die Prignitz war ja immer schon leer, aber seit dem Ende der DDR und der Landflucht ist sie regelrecht entvölkert. Beispiel Wittenberge: Ende der Achtzigerjahre Einwohner, heute Verbliebene. Das mag in vielerlei Hinsicht betrüblich sein, für den Tourismus ist es eine Chance. Die Prignitz könnte groß für sich werben mit ihrer Leere, nach der doch alle gerade suchen, gerade In der Kirche kann man Dachziegel kaufen, was ich natürlich mache jetzt allein sie tut es nicht. Vielleicht trommelt man nicht gerne in eigener Sache, was ja in launigem Gegensatz zum Autokennzeichen der Gegend stünde, das da lautet: PR. In den Flyern, die den langen Schubern der Tourismusstellen entquellen, ist die verbriefte Minuszahl jedenfalls nicht mal erwähnt. Stattdessen nennt man sich»radlerparadies zwischen Elbe und Müritz«. Gewiss, die Wege sind weit und leer, und doch verstehe ich nicht, wieso man die Entspanntheit der Prignitz mit dem schweißtreibenden Gestrampel des Rades konterkarieren sollte. Ich sehe da einen Widerspruch. Ich fahre lieber Auto. Tagelang, einfach durch die Gegend, und man möge das nicht mit dem touristentypischen Getriebensein verwechseln. Denn ich steuere nichts an. Ich lasse mich treiben. Von hier nach dort, von dort nach hier. Von Perleberg nach Weisen, von Plattenburg nach Gülitz-Reetz, von Wahrenberg nach Quitzöbel. Der Weg ist das Ziel, beziehungsweise ein Ziel wäre nur im Weg, und manchmal sehe ich eine halbe Stunde kein anderes Auto. Und wenn doch wieder eins auftaucht, dann erst im Rückspiegel, alsbald größer werdend, aufschließend. Die Prignitzer fahren schnell, ich nicht. Beim Über holt werden auf der Unendlichkeit der Landstraße trotzdem das ewige Checkerritual, der nie lästig werdende Fuchsschwanz-Vergleich: Seitenblick, beide grinsen überlegen, der eine, weil er überholt, der andere, weil er sich einredet, dass der eine das mit dem Überholen nötig hat. Mancher fährt sich zwar auch an den Baum, Tabula Raser, das ist als brandenburgische Spezifität bekannt und besungen vom Kabarettisten Rainald Grebe, man kennt das. Schilder warnen davor (vor dem Überholen, nicht vor Rainald Grebe), was im Grunde unnötig ist, die blumengesäumten Kreuze am Straßenrand sind Warnung genug. Jetzt die Frequenz von Klassikradio einpegeln, wo sich Renate aus Halle soeben Beet hovens Quintett für Oboe, Horn und Fagott wünscht (Moderator:»Tolle Idee, danke, Renate!«), und das langsam hochdrehen und die Fenster runter und so ganz gediegen über die breite und einzige Straße Klein Lübens rollen. Ja, die Klein Lübener eilen an ihre Lattenzäune und beäugen den Eindringling, aber, bilde ich mir ein, mit einiger Anerkennung in den gefurchten Stirnen. Viele Männer tragen Trainingsblousons in den gedeckten Farben der Spätachtziger mit einer Selbstverständlichkeit, die ihnen die Eleganz von Zweireihern verleiht. Dabei ist die Kleidung nie nachlässig, sondern schlichtweg egal, man rechnet ja nicht damit, darin überhaupt ge sehen zu werden. Es gibt nicht diesen lästigen Originalitätszwang der Großstadt; man ist original dadurch, dass man von hier kommt, geblieben ist und bleiben wird. Vielleicht sollte man Linke-Spur-Fetischisten wie Ulf Poschardt die Prignitz empfehlen. Poschardt könnte aus seinem vollverglasten Newsroom bei der Welt in Berlin in den Porsche springen und wäre im Nu hier. Autofahrparadies zwischen Elbe und Müritz: Ich glaube, damit ließen sich Leute in die Prignitz locken. Mehr noch als für die leeren Landstraßen begeistere ich mich für die Kirchen der Gegend. Ihre Türme stehen erigiert aus den keuschen Ebenen ab, ein jedes Dorf hat einen. In den ewigen Himmel ragt die Wunderblutkirche von Bad Wilsnack. Tiefrot gemauert, seltsam kantig, mit kleinen, schartigen Fenstern. Ihr zu Füßen ein Markt, wo schweigsame, bärtige Hünen mit schaufelgroßen Händen die Salami hobeln und mächtige, beschürzte Gemüsefrauen in kargen Worten ihren Rettich feilbieten. In der Kirche kann man Dachziegel kaufen, was ich natürlich mache, denn von meiner Spende soll die Restaurierung des Daches finanziert werden. Ich stelle mir sogleich vor, wie Pfarrer, Presbyter und Diakon in geheimer Runde saßen, in einem Gewölbe unter der Sakristei, in ihre Roben gehüllt, ehe einer die Idee aufbrachte: Heureka, meine Brüder! Wir bauen unser Dach zurück, und mit dem Spendengeld bauen wir das Dach dann neu! Ich sei der Erste nach langer Zeit, der hier einen Ziegel ersteht, souffliert mir eine Kirchlerin, als ich den Stein an dem goldenen Retabel und der gewaltigen Tauffünte vorbeischleppe. Ich kaufe trotzdem nur einen, denn dies lehrt einen die Prignitz allemal: sich mit weniger zufriedengeben, vom Überschwang abrücken. Und das ist nicht das Einzige, was sie einen lehrt. Immer wieder fällt hier ein
59 2. J U L I REISE DIE ZEIT No 28 Landkreis Prignitz Satz, derart häufig, dass ich ihn mir bald als inoffizielle Hymne der Region notiere:»wir sind ja nicht auf der Flucht.«Ich höre den Satz auf der Löwenkopfbrücke in Karstädt, im Elbdeichhinterland bei Müggendorf und auf der Alpaka-Farm hinter Breese. Einst mag er zum verbalen Standardrepertoire der DreiländerecksOstler gehört haben, um sich reflexhaft gegen Verdächtigungen durch Stasi und Grenzer zu verwahren. Doch auch 30 Jahre später wird er ernst und ohne Lachen vorgetragen, aber das verstehe ich gern: Denn wo das Land weit und leer ist, muss eben alles gestreckt werden, auch die Gefühle. Jedes Lachen wird in sich drinnen rationiert, wer weiß, wann man es noch mal braucht! Es muss bis zum Ende der Woche reichen, vielleicht sogar bis zum Ende des Monats. Da ich grundlos und also immerzu lachende Menschen verdächtig finde, ist mir das ganz und gar sympathisch. Ich halte inne am Großsteingrab von Mellen, einer Megalithanlage der Trichterbecherkultur, die genauer auszuführen meine knappen Zeilen strapazieren würde nur so viel: entstanden etwa 3000 Jahre vor Christus. Als loser Halbkreis arrangiert, liegen die grauen Felsen im sonnenverbrannten Gras, und ich liege zwischen ihnen, über Stunden, und horche in mich: Bin ich im Urlaubsmodus? Fehlen mir die Menschen? Sie sind ja nicht ganz fort. Man muss sie nur gezielt aufsuchen, und das ist der Unterschied. Sie stören einen nicht von sich aus, mit Ausnahme eines Erlebnisses, das sich am Tag zuvor zugetragen hatte. In Havelberg saß ich, am Landbäcker, und horchte auf. Vom Nebentisch her Wortfetzen, die der Wind mir zuwehte. Attila. Kriegszug. Eigene Deutung. Mir stellte sich der Aluhut auf, ich musste nachfragen: Äh, hallo, Verzeihung: Attila? Gewiss, Attila, nickte der Rentner in der Mitte, er trug ein Erich-Honecker-Brillengestell. Allzu oft sei er als grausam geschildert worden, sich an Gewalt ergötzend. Lüge! Man müsse diesem Bild entgegentreten. Attila der Hunne war ein sanfter Herrscher, zumindest nach innen, und Priskos und auch der Gepidenfürst Ardarich hätten das der Nachwelt belegt. Er, pensionierter Historiker, lese gerade das phänomenale Essay von Jörg Fündling, das habe ihn nachgerade erleuchtet, und das teile er seinen Freunden gerade mit. Ob man selbst an Attila»übrigens im Mittelalter als König Etzel besungen«interessiert sei? Ich dachte, antwortete ich, es gehe hier um Hildmann, na, Sie wissen schon, den Koch mit den Verschwörungstheorien. Sie starrten mich an. Kannten sie nicht. Diese Begegnung hatte mich endgültig für die Prignitz eingenommen, also dass Attila hier der Hunnenkönig ist und kein veganer Schwurbler. Nun gehört Havelberg eigentlich zu Sachsen-Anhalt, wird aber»wiege der Prignitz«genannt, und die Havelberger fühlen sich selbst auch als Brandenburger. Die Zuschlagung zu Sachsen-Anhalt entsprang einer DDR-Gebietsreform und nicht ihren Herzen, glaube ich. In Havelberg trafen sich jedenfalls, noch früher, Zar Peter der Große und Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., um gegen Schweden zu paktieren, und bei der Gelegenheit übergaben die Preußen den Russen das Bernsteinzimmer. Dessentwegen war ich überhaupt gekommen. Als Kind hatte ich ein Buch, das die Geschichte des Bernsteinzimmers erzählte. Abendelang strich ich über die Malereien dieses achten Weltwunders, das mich mehr in seinen Bann zog als zum Beispiel die Hängenden Gärten von Babylon oder der Koloss von Rhodos. Und nun stand ich selbst endlich in Havelberg vor dem Dom, der auf einem Hügel über der kleinen Stadt gebaut ist, und hoffte, etwas von dem Mythoshaften, ja Ungeheuerlichen der verschollenen Intarsie möge meine Seele streifen. Wenige Meter entfernt standen zwei Bronzen der besagten Herrscher, ein an der fixierend, dabei allerdings gleichgültig dreinschauend. In ihrem Blick alles, was die Prignitz also zu kennzeichnen schien: bei sich und mit sich selbst zufrieden, seit Ewigkeiten im Sein, nicht mehr im Werden. Die Faszination der Prignitz speist sich aus so manchem historischen Ereignis, das sich hier zugetragen haben soll, im Kontrast zur absoluten Ereignislosigkeit heute, notiere ich ergriffen. Nach weiteren Nächten ohne Träume und Erwachen sitze ich im Garten von Horst Oppenhäuser, einem RheinlandExilanten, der in Breetz eine neue Heimat gefunden hat, jedenfalls wenn er nicht samt Gattin auf Mallorca urlaubt. Oppenhäuser ist einer der wenigen, die ich gezielt aufsuche. Er hat einige Fachwerkhäuser kundig restauriert, trägt Lederloafer in Hagebuttenrot und pinselt Aquarelle. Wenn man wissen möchte, was das Geheimnis der Prignitz ist, müsste man ihn fragen, dachte ich; ihn, der die Landschaft tagein und tagaus malt, immer nur die Landschaft und niemals Menschen. Oppenhäuser krault seine Minipli, er überlegt und sagt dann, aus der Perspektive des Malers:»Diese unendliche Weite habe ich im Oberbergischen ja nie gehabt, die gibt es dort gar nicht. Das Klima der Prignitz ist mit dem der Balearen vergleichbar, das Licht ebenso. Meine Güte, was für ein Licht! Beim Malen muss ich aufpassen, dass es nicht kitschig wird.«für diese Antwort kaufe ich ihm direkt ein Werk ab, zwar keines seiner Aquarelle, die ich ein bisschen kitschig finde, aber eine riesige Skulptur aus Strandgut. Im Radio auf dem Rückweg zum Fe rien haus wieder eine Waldbrandwarnung. Ich bleibe trotzdem volle sechs Tage in der Prignitz. Ich bin ja nicht auf der Flucht. Mellen Perleberg Bad Wilsnack Wittenberge Klein Lüben Havelberg PR IGNITZ Storchendorf Rühstädt Über Kilometer fliegen Weißstörche, wenn sie aus Afrika nach Norden ziehen und viele kommen in Rühstädt zur Ruhe, Deutschlands storchenreichstem Dorf. Die Bewohner kümmern sich um sie, erneuern Nisthilfen, beringen Jungstörche. Der Nabu bietet Führungen an. besucherzentrum-ruehstaedt.de Schloss Meyerburg Die größte Modesammlung des Landes wird auf Schloss Meyerburg kuratiert. Hier sieht man, wie sich die deutsche Garderobe gewandelt hat, entdeckt Modeströmungen und Vergessenes. Also: Latzhosen und Turbane, Petticoats und Hüte. modemuseum-schloss-meyenburg.de Radtouren Als Radlerparadies wird die Prignitz vermarktet: Flache Wege, mehr als 1000 Kilometer beschildert, abseits der Autostraßen. Der Elberadweg ist zu empfehlen, aber auch Tour Brandenburg und die Bischofstour. Oder: die Kleeblatt-Städte-Tour mit Start in Neustadt/Dosse und Halt in einer Gruft. dieprignitz.de Zur Attraktion gehören Störche und Kirchen wie der Dom St. Marien in Havelberg EIN SPEZIAL DES ZEITVERLAGS ANZEIGE FERIENDOMIZILE DEUTSCHLAND/ BENELUX DAS ROYAL HINTERHUBER IN SÜDTIROL direkt am 6 km feinen Sandstrand Luxemburg hat den schönsten Balkon Die Stadt lässt sich bequem zu Fuß erkunden. Luxemburg war und ist historisch, kulturell und wirtschaftlich eine bedeutende Region mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten: Palast, Kathedrale, Festungen, aber auch Museen, Philharmonie und dazu die bezaubernde Altstadt Barrio Grund. Einen fantastischen Ausblick bietet der berühmte Chemin de la Corniche, hoch oben auf den Felsen: Er gilt als der»schönste Balkon Europas«. Wer Luxemburg besucht, sollte sich auch kulinarisch etwas gönnen die Einflüsse aus vielen verschiedenen Nationalitäten sind ein Genuss! 850 m², 30 C Pool + SPA NORDEUROPAS TOURISTISCHES JUWEL Stärkung für Körper, Seele, Geist und Immunsystem Sicherer Urlaub auf Rügen mit unserem anspruchsvollen Hygiene- & Servicekonzeptes Frühlingssonne Kraft tanken BELGIENS MÄRCHENSTADT BRÜGGE 5 x Übern. / Langschläferfrühstück, Abendschlemmerbuffet, Begr.-Cocktail ab 490 p.p./dz ab 630 p.p./dz ab 490 p.p./dz Wie nur wenige Städte Europas besitzt Brügge eine Fülle prächtiger Plätze und Bauten, die bei den beliebten Bootsfahrten durch die Grachten auch aus einer ganz anderen Perspektive ihre Schönheit zeigen. Sie ist am besten außerhalb der Urlaubszeit zu genießen und in den Abendstunden, wenn die Tagesgäste Brügge verlassen haben und die Stadt golden leuchtet. Kinderbetreuung im eigenen Kinderhaus Hunde willkommen: / Nacht viele weitere ganzjährige Sonderarrangements nur direkt buchbar unter: Hotel Arkona Dr. Hutter e.k. Strandpromenade 59 Binz / Rügen reservierung@arkona-strandhotel.de Telefon: Provence SYLT 28-1 Z U J E D E R JA H R E S Z E I T Tel / RADREISEN SEN 202 RADREI EN 202 ADREIS 350 exklusive Feriendomizile! R Gratis Katalog Sommerknüller: 7 Tage buchen 20 % Rabatt (28. Juni-12. Juli) Natur pur! HOTEL ROTH am Strande INDIVIDUELLE RADREISEN mit Gepäckservice, Leihrad uvm zb. Bodensee, Mosel bereits ab 448,- pp Kostenfrei KATALOG bestellen! Touristik - mit der Sicherheit eines großen Namens Namens eines großennamens Touristik - mit der Sicherheit eines großen Sicherheit - mit der Touristik Donau Touristik GMBH Lederergasse 4-12, 4010 Linz/D gegenüber Freizeitbad Sylter Welle (*Eintritt inkl.) u. d. Syltness Center. Komfort-Zimmer und App. zum gr. Teil mit Loggia u. Seeblick, großer Tagungsbereich, Hotelrestaurant, umfangreiches Frühstücksbüffet, Bierstube, Bistro-Café, Tiefgarage, Sauna und Massagen. z. Zt. 7 Ü/F p. P , * oder 7 Ü/HP p. P , * (kein EZ-Zuschlag) 1 Zi. App. (1 2 P.) ab 137, / Tag, 2 Zi. App. (2 4 P.) ab 299, / Tag A ttraktiven eb en -u n da u ß ersaiso n p reise H o telr o th,in h.h ayof eikes,s tran d str.31,25980s ylt/w esterlan d, ax5095,i,n, w T el.04651/9230,f h o tel-ro th.d e,w w.h o tel-ro th.d e 1 katalogbestellung@zeit.de Sowie bequem und einfach online bestellen unter: Luxus Ferienhäuser/Sylt Ferienhaus in der Südpfalz Marokko Architektenhaus Garten, Auto, Sonne, Meer P O RTU GAL Idyllisches Landhaus, 2 km v. Strand Alleinlage, sehr ruhig, 2-6 Pers. Denken Sie bereits an eine Auszeit im Herbst? Wer sich mit Luxus verwöhnen möchte, der genießt ganz nach eigenem Gusto eines unserer großzügigen Domizile am Keitumer Wattenmeer. Luxuriös ausgestattet für bis zu 8 Pers., u.a. mit Sauna, Kamin. Großzügige, hist. Villa zw. Speyer u. Landau voller Unikate u. farbenfroher Zimmer, bis 14 Pers., 240 m², 8 SZ, WZ, EZ, 3 Bäder, 4 WC, Kamin, weitläufiger Garten, gr. Pool, abgeschlossenes Grundstück. Tel. 0174/ Ferienhaus zum Wohlfühlen, 2 Personen, ruhig, deutsche Gastgeber vor Ort, toller Blick, Dorf fußläufig. Tel. 0033/ Römerstadt Ladenburg/Kurpfalz Zwischen Pfalz und Odenwald, Rhein u. Neckar, Wald u. Weinbergen Geschichte und Natur erleben. Modernes, ruhiges, hochwertig und kompl. ausgest. App. mit Terr. und Garten in der Altstadt f. 1-2 Pers., ab Mai wochenweise für 395,-. hh-wahl@gmx.de 0171/ Hotel Royal Hinterhuber **** Royal Hinterhuber OHG Ried/Pfaffental 1A I Reischach Bruneck Tel. +39 (0) info@royal-hinterhuber.com Rügen das Haus am Meer 9 Appartements in zwei Häusern auf m² Grund mit Blick auf die Rügische Bucht, 200 m zum Ufer. Exklusive, natürliche Einrichtung, Kaminöfen, Schwimmhalle, Blockhaussauna, Infrarotkabine, Badeteich. Tel Wieder für Sie geöffnet! Romant. Gästehaus Augustenhöh Vergessen Sie Corona und entspannen Sie sich für ein paar Tage zur schönsten Jahreszeit an diesem schönen Ort für Wanderer, Träumer u. Ruhesuchende. Sauna im Hs. 1/2 Autostd. nach HH u. Lüneburg. augustenhoeh@gmx.de Tel. 0157/ Bretonisches Bauernhaus Ab sofort bis frei! Urgemütlich, bei Paimpol mit modernem Wintergarten, 2 Terrassen und großem Kamin, deutscher Standard, aller Komfort inkl. SAT-TV, 4 Schlafzimmer, ZH, m2 Grundstück, 2 km/strand. ITALI E N TOSK ANA-MEER FERIENHAUS mit/ohne Pool - privatissimo - freie Strände mit viel Abstand, 08662/9913 CILENTO SÜDITALIEN OS TS E E Forsthausidylle Bodensee Corona-Ferien ohne Maske, NR-FeWo, Tel /5511 Anzeigen: lachschulz.de BESTELLEN SIE DIE NEUEN REISEKATALOGE UNTER: Royal Wanderwochen Erleben Sie mit uns die herrliche Bergwelt Südtirols vom bis vom bis vom bis Übernachtungen ab 770 Euro p.p. FR AN K R E I CH FRANCIS BACON»Wenn ein Reisender heimkehrt, soll er die Länder, die er besucht hat, nicht ganz hinter sich lassen.«reisekataloge MARO K KO Ankommen. Eintreten. Wohlfühlen. Erleben Sie Südtiroler Herzlichkeit in einem der schönsten Gebiete der Dolomiten, eingebettet in 10 ha Grünfläche unweit der Stadt Bruneck. Das Royal ist der ideale Ort für einen Aktivurlaub in Verbindung mit purer Entspannung. Aktive Gäste zieht es in die Dolomiten, Erholungssuchende entspannen in der Wellnesswelt mit Massagen und Beautybehandlungen. Genießen Sie feine Alpine Küche, unsere Parkanlage mit beheiztem Freischwimmbad und Tennisplätzen. Haus Möwengarten am Haff 5-Sterne-Ferienhaus in Rerik-Roggow Urlaub an einem der schönsten Orte Holsteins: Ruhe finden, schwimmen, paddeln, angeln, radfahren, wandern, Ausflüge zur Ostund zur Nordsee. Weitere Informationen: / A' Cràpa Mangia - in idyllischer Natur liegt unsere historische Hofanlage mit 9 stilvollen Ferienwohnungen für 2 8 Personen. Alle mit großzügiger Terrasse, Blick über das Meer, auf die Amalfiküste und Capri. Tel. +49 (0) PIEMONT- NATUR PUR Großzügiges Bauernhaus in den Weinbergen der Alta Langhe, bis 9 Personen, Pool. nahe Ostseestrand und Salzhaff. Garten, Sauna, 2 6 Personen, Hunde erlaubt. Information und Vermietung: Tel. +49(0)38296/75930 oder Tel. +49(0)174/ ALLGÄU Genussmomente für Feinschmecker BODENSEE FEWO direkt am See seezeit20@ .de im Naturschutzgebiet/Schweizergenze 2 Personen ab 70 /Person/Tag 4x ÜN im Doppelzimmer Verwöhnpension mit Genussfrühstück, Kaffee & Kuchen, 3-Gang-Abend-Menü 1x 6-Gang-Degustationsmenü Benutzung des Wellnessbereichs mit Schwimmbad, Sauna, Ruheraum 419 p.p. ( ) inkl. Kurtaxe M&B Kiehne GbR Alpenhotel Dora Schweineberg Ofterschwang Tel /3509
60 60 ENTDECKEN 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 WIE WIR REDEN Mit 22»Da kommen zwei, na, wie sag ich noch gleich? Na hier, zwei...«in dieser Woche hört SWANTJE FURTAK in ihr Leben hinein. Gesprächsnotizen aus dem Alltag In der Bahn. Um mich herum eine Reisegruppe auf dem Weg an die Ostsee. Der Mann zu meiner Rechten packt seine Brotdose aus und lächelt mir zu. Vor mir an einem Vierertisch eine Frau in einem ausgewaschenen grünen Shirt. Frau im grünen Shirt: Nein, man kann es kaum fassen! Da wurden mir wirklich zwei meiner drei Schlösser geknackt. Ich spähe durch die beiden Sitze vor mir. Frau im grünen Shirt: Nur weil noch das letzte Schloss dran war, ist mein Fahrrad nicht geklaut worden. Am Ku damm! Mitten in Berlin! Sie gestikuliert, hat sich die Maske abgenommen. Das ist Berlin! Ich sag s euch. Das wird immer ge fährlicher. Stimmt s, Uwe? Uwe: Ja, ja, immer unsicherer. Hier, erzähl doch die Sache mit den, na du weißt schon, den... Frau im grünen Shirt, nickt aufgebracht: Mit den Spanierinnen, meinst du, oder? Oh ja, das war am Hauptbahnhof. Wir saßen in dem McDonald s vorne drin, ne, Uwe? Da kamen drei Spanierinnen. Zwei hübsche junge Mädchen. Ihre Mutter. Alle mit goldenen Handtaschen und Koffern. Wirklich schick gemacht. So, die beiden Mädels gehen etwas bestellen. Die Mutter bleibt allein zurück mit den Taschen. Da kommen zwei, na, wie sag ich noch gleich? Ich setze mich kerzengerade auf, lege den Laptop beiseite. Frau im grünen Shirt: Na hier, zwei stark Pigmentierte mit Migrationshintergrund. Sie zieht das Wort absichtlich in die Länge. Die kommen um die Ecke auf die ältere Dame zu. Ich atme tief ein. Müsste ich jetzt gleich etwas sagen? Frau im grünen Shirt: Nee, ich sag s dir. Berlin, da fühlst du dich nicht mehr sicher. Uwe: Und die Sache mit dem Floyd da drüben in den USA. Das ist gelogen, was die in unseren Nachrichten darüber erzählen. Der war vollgepumpt mit Amphetaminen. Der wär sowieso gestorben, auch ohne den Polizisten. Ich sehe George Floyd vor mir, wie er auf den Boden gedrückt wird. Wie er leise um Hilfe fleht. Uwe: Der war ein Drogenjunkie. Aber das sagen die hier in Deutschland natürlich nicht. Dafür müsst ihr schon die richtigen Nachrichten gucken. Auf Englisch gibt s da ein paar gute Sachen. Ich balle meine Hände zu Fäusten. Öffne sie wieder. Atme ein, aus, ein, aus. Die Landschaft fährt vorbei. Mecklenburg-Vorpommern. Weite Felder bis an den Horizont. Ich versuche mich auf die Strohballen zu konzentrieren. Ich könnte die Strohballen zählen. So kann ich nicht aufstehen, nichts sagen. Meine Hände zittern. Aber noch eine Sache, wenn sie noch eine Sache sagen... Frau im grünen Shirt: Eine Geschichte hab ich noch! Sie hat die Aufmerksamkeit der Gruppe. Frau im grünen Shirt: Als ich letztens am Bahnhof stand, da tänzelte wieder so einer, was war er denn? Na, doch schon! Doch, doch, wo ich mich jetzt recht entsinne: ein stark Pigmentierter mit Migrationshintergrund um meine Tasche... Ich stehe langsam auf und taste mich in die Mitte des Ganges vor. Halte mich links und rechts an den Sitzen fest. Als ich beginne zu sprechen, ist meine eigene Stimme mir fremd. Ich: Ich verstehe, dass Sie Angst haben. Ihnen scheinen wirklich Situationen passiert zu sein, die einem Angst machen können. Sie alle blicken mich groß an. Aber Wörter wie»schwarz«... Frau im grünen Shirt: Das habe ich nicht gesagt! Stark pigmentiert, habe ich gesagt. Ich, lauter jetzt, hastiger: Sie verallgemeinern hier Menschen zu einer Gruppe und schüren damit Hass. Die letzten Worte zittern. Der Wagen ist jetzt still, alle schauen neugierig über ihre Sitze. Uwe schnauzt mich an: Sagen Sie mal, das ist unser Gespräch. Wir können unsere freie Meinung äußern. Ich hole noch einmal tief Luft: Nein, das ist Rassismus, und dagegen möchte ich aufstehen. Uwe, nun aggressiver: Verschwinden Sie! Ich spüre meine Beine nicht mehr. Könnte mich übergeben. Rufe hinter mir werden lauter. Ich, noch lauter: Nein, ich werde nicht verschwinden. Was Sie sagen, verstößt gegen unser Grundgesetz. Dagegen muss ich aufstehen. Eine Stimme von der Seite: Mädchen, geh zurück zu deinen Fridays-for-Future- Demonstrationen und lass uns in Ruhe! Mir kommen die Tränen. Warum pflichtet mir niemand bei? Ich falle zurück auf meinen Sitz. Ich bin nicht links. Was ich sage, ist doch nicht links! Warum merkt das keiner? Das sind Worte der Mitte! Oder hat sich die Mitte verschoben? Uwe, schneidend: Jetzt geh! Eine Studentin geht vor mir in die Hocke: Entschuldige bitte, ich habe nichts mitbekommen. Ich habe Musik gehört. Sie streichelt über mein Knie. Ich schaue sie dankbar an. Ich: Es ist nur... Ich schluchze. Uwe beugt sich über den Sitz zu mir. Er erweist sich als ein alter Mann mit Anglerhut: Sie soll verschwinden. Ich, die Tränen laufen mir übers Gesicht: Nein, ich werde nicht verschwinden! Ich werde höchstens Musik hören, damit ich Sie nicht hören muss. Aber ich werde genau hier bleiben. Studentin, leise: Soll ich mich zu dir setzen? Ich schüttle den Kopf: Danke, geht schon, wirklich. Es war eine gute Erfahrung. Studentin, nickt: Das war sehr mutig. Ich: Nein, das war einfach, was jeder tun sollte. Das war normal. Nur wahrscheinlich mit zu vielen Tränen. Die Studentin geht. Auf den Sitzen vor mir murmelt es. Ich setze mir die Kopfhörer auf, höre aber keinen Ton. Als ich die Augen öffne, verlangsamt der Zug. Ein junger Mann kommt durch, auf dem Weg zum Ausstieg. Er klopft auf Uwes Sitz. Junger Mann: Na, hat se sich wieder beruhigt? Swantje Furtak lebt in Berlin und Greifswald, studiert Biochemie und träumt davon, Dokumentarfilme zu drehen Der Name des Mannes ist geändert ANZEIGE So findest du das passende Studium! Der ZEIT Studienführer ist die Nr. 1 für die Studienwahl und hilft dabei, die richtige Entscheidung zu treffen. Von der Wahl des passenden Fachs über die Bewerbungsphase bis hin zum Studienbeginn hier findet man alle Informationen für einen erfolgreichen Start in die Zukunft. + Extraheft»Welcher Job passt zu mir?«das Begleitheft erklärt, wie man Schritt für Schritt die richtige Berufswahl trifft und wie die Jobperspektiven auf dem Arbeitsmarkt sind. Neu am Kiosk oder online bestellen: studienfuehrer
61 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 ENTDECKEN 61 Wackeln Sie mal mit dem Mittelzeh Wer barfuß läuft, dem haben seine Fußsohlen eine Menge zu erzählen. Würdigung eines übersehenen Körperteils VON JULIUS SCHOPHOFF Illustration: Franz Lang für DIE ZEIT Ich weiß noch, wie ich mit meinem Bruder barfuß auf der Terrasse unseres Elternhauses saß. Wir hatten einen Joint geraucht, mein Bruder betrachtete seine blassen Füße und sagte:»diese komischen Dinger waren das mal Hände?«Wir spreizten unsere Zehen und erkannten in ihnen, durch unsere leicht verrutschte Wahrnehmung, degenerierte Finger. Es folgte, was wir damals einen Lachflash nannten. Wenn ich heute, zwanzig Jahre später, nüchtern, auf meine Zehen hinabblicke, empfinde ich so etwas wie Mitleid. Man muss damit ja nicht malen können oder Klavier spielen, aber: Ich kann die Dinger nicht mal einzeln bewegen. Der große und der kleine, das sind noch die unabhängigsten, die kann ich abspreizen und mehr oder weniger selbstständig krümmen und strecken; aber die drei mittleren, da geht nichts ohne den anderen, die sind wie durch ein unsichtbares Band zusammengeknotet, und das Erstaunlichste ist: Ich bin nicht nur unfähig, sie einzeln anzusteuern ich kann sie nicht einmal einzeln fühlen. Sie etwa? Spüren Sie Ihren Mittelzeh? Ich hatte mal einen Mitschüler, der hieß Max. Max sagte selten ein Wort und kritzelte unentwegt Miniaturcomics in seine Schulhefte. Seine Mathearbeiten gab er vor allen anderen ab und bekam trotzdem eine Eins; er fand Lösungswege, die nicht einmal die Lehrer kannten. In Sport war er eine Niete, aber als er in der Umkleide die Socken auszog, war das eine kleine Sensa tion: Max hatte zusammengewachsene Zehen. Der zweite und der dritte waren wie durch eine Schwimmhaut miteinander verbunden, an beiden Füßen. Damals haben wir ihn dafür gehänselt. Max, du Mutant! Heute frage ich mich: War Max seiner Zeit voraus? Auf der nächsten Stufe der Evolution? In hunderttausend Jahren, falls Greta Thunberg unsere Spezies rettet, werden beim Menschen wahrscheinlich alle Zehen verbunden sein, nicht nur der zweite und der dritte, alle fünf. Und in zweihunderttausend Jahren werden wir gar keine Zehen mehr haben. Ist echt so, googeln Sie mal: Körperteile, die verschwinden. Da finden Sie: Haare. Weisheitszähne. Blinddarm. Und immer wieder: die Zehen. Wäre es so schade drum? Was verlören wir denn? Wir könnten uns den kleinen Zeh nicht mehr am Tischbein stoßen. Wir müssten uns nicht mehr die Fußnägel schneiden, meine Kinder würden das sehr begrüßen. Wir hätten keine Zehenzwischen räume mehr. Bei Heidi Klum, in der Werbung, stecken da Joghurt-Gums; bei mir finde ich nur Fussel dunkler Socken. Wobei schon länger nicht mehr. Ich habe nämlich seit Wochen keine Socken mehr an, Schuhe auch nicht, sehr selten jedenfalls. Das liegt an einer Studie aus dem Magazin Nature, von der ich neulich gelesen habe. Da wurden 81 Kenianer und 22 Amerikaner untersucht, manche liefen immer barfuß, andere fast nie. Das Ergebnis, kurz gefasst: Schuhe sind ungesund. Je gepolsterter, desto mieser. Durch die künstliche Dämpfung trampeln wir achtlos herum, mit fatalen Folgen für Gelenke, Knochen und Sehnen im ganzen Körper. Die beste Schuhsohle, stand da, sei hart wie ein Brett, noch besser aber sei die Hornhaut selbst. Deren Dicke, diese Erkenntnis war das Neue an der Studie, habe keinerlei Einfluss auf die Empfindlichkeit des Fußes. Dämpfung als Gefahr? Hornhaut mit Gefühl? Mir war, als dringe ein Kitzeln durch die Luftpolstersohlen meiner Nike Air. Ich beschloss, dieses Jahr so oft wie möglich barfuß zu gehen. Ich wohne auf einer Insel in der Altstadt von Regensburg, zum Donaustrand sind es zwei Minuten. Mit Schuhen ist man da, ehe man sich s versieht; barfuß ist es eine Reise. Vom fußwarmen Parkett laufe ich über den borstigen Abtreter auf die Terrasse, sanfter Naturstein, aber manchmal trete ich auf eines dieser winzigen, scharfen Steinchen, mit denen die Fugen gefüllt wurden. Das Kopfsteinpflaster unserer Straße ist warm und glatt. Nach zwei Häuserecken folgt ein Stück Asphalt, grob und rissig; wenn er heiß ist, ist es die Hölle. Ein Sandweg führt den niedrigen Deich hinauf, die Steine darauf sind verschieden groß und allesamt piksig, auf der anderen Seite geht es noch steiniger bergab, aber dann, am Flussufer, erlöst mich der Rasen, feucht und weich. Die letzten Schritte, über rund geschliffene Kiesel, dann taucht der erste Fuß in den kühlenden Strom.»Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte«, so beginnt ein Gedicht, das der greise Jorge Luis Borges geschrieben haben soll, was nicht stimmt, wobei das niemanden juckt dann, jedenfalls, würde der Verfasser des Gedichts versuchen, mehr Fehler zu machen und weniger Dinge ernst zu nehmen, er würde mehr Sonnenuntergänge betrachten, mehr in Flüssen schwimmen, mehr Eis essen und weniger Bohnen, und, jetzt kommt s,»wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich barfuß laufen vom Beginn des Frühlings bis zum Ende des Herbstes«. Schön, oder? Eigentlich hatte ich nie ein besonderes Verhältnis zu Füßen. Sie beschäftigten mich nur, wenn sie Ärger machten. Als Kind hatte ich dauernd Stachelwarzen, aufgeschnappt im Hallenbad: Ich erinnere mich noch an das Gefühl, wenn man das Warzenpflaster samt Warze abzieht und nur dieses Loch bleibt. Weil ich einen patschenden Gang hatte, Dia gno se Knicksenk fuß, musste ich zur Krankengymnastik. Da waren dieser grüne Gymnastikball und dieser Therapeut, der mir mit feuchten Händen an den Knöchel fasste und sagte, ich solle auf den Außenkanten und Fußspitzen laufen und mit den Zehen Papierkügelchen greifen, während der Sommer vorm Fenster ohne mich stattfand. Ich kenne kaum jemanden, der ein besonderes Verhältnis zu Füßen hat. Einmal stöberte ein Freund von mir im Computer seines Mitbewohners, wir suchten einen Film und fanden diesen Ordner mit Fotos von Füßen. Unzählige Fotos von Füßen. Füße in roten Pumps, Füße in schwarzen Pumps, Füße in Leder stiefeln, nackte Füße, schlanke Füße, Füße mit lackierten Nägeln. Da waren auch Videos, ich will nicht näher darauf eingehen, aber wir saßen da mit großen Augen und offenen Mündern. Füße?! Was für ein Freak! Heute frage ich mich: Ist einer, der Füße liebt, wirklich seltsamer als einer, der sich, was ja recht verbreitet ist, davor ekelt? Füße sind hochsensibel, das weiß jeder. Unter unseren Sohlen enden so viele Nerven wie sonst nur, sagen wir, an un seren Lippen. Füße sind erogene Zonen, wer wollte das bestreiten? Kennen Sie die Szene in Pulp Fiction, in der Vincent Vega und Jules Winnfield über die Bedeutung einer Fußmassage diskutieren? Es geht im Wesentlichen darum, ob es gerechtfertigt war, einen Mann, der der Frau ihres Bosses die Füße massiert hat, aus dem vierten Stock zu werfen, in ein Gewächshaus aus Glas. Der Mann, darauf können die beiden sich schließlich einigen, hätte es wissen müssen. Für mich ist der Sommer eine einzige Fußmassage ziemlich ungefährlich übrigens, abgesehen von den Scherben, die auf dem Weg zum Festplatz in der Sonne glitzern, und den Wespen, die am Donauufer durchs Gras schwirren. Aber passiert ist mir noch nichts, barfuß wirst du wachsam für die kleinen Dinge. Ich verlasse nun wie selbstverständlich ohne Schuhe das Haus, laufe über Teer und Gras, Schotter und Matsch, Supermarktfliesen und Rolltreppenrillen. Abends, im Bett, wird mir ganz warm unter den Sohlen. Morgens, so scheint mir, erinnere ich mich intensiver an meine Träume. Ist es möglich, dass ich mit dem Barfußlaufen nicht nur meine Füße befreie? Dass da etwas in mir erwacht, das lange verborgen war? Vor einigen Jahren war ich bei einem Schreibworkshop mit Doris Dörrie in einem Zen-Kloster in der Schweiz. Der Schlüssel zur Kreativität, sagte sie, sei die Erinnerung: Denkt an eure frühe Kindheit, und dann schreibt drauflos, beginnend mit dem Satz:»Ich erinnere mich an den Boden unter meinen Füßen...«Ich lief in Gedanken um mein Elternhaus, über die dunkelrote, glatte Steinfläche vor der Haustür, die niedrige Stufe hinab auf das raue, graue Pflaster und weiter, am Holzstapel vorbei, über große, helle Steinplatten, auf denen Äste lagen. Eine dieser Platten, vor dem Schuppen, wackelte, wenn man drauftrat. Das Schreiben darüber machte Spaß, erstaunte mich aber nicht weiter. Ich lebte in dem Haus, bis ich 27 war. Dann passierte es. Nach der Übung gingen wir schweigend auf den Balkon, der rund um den Meditationsraum führte, in dem das Seminar stattfand. Barfuß, mit halb geschlossenen Augen, drehten wir unsere Runden, und plötzlich, ohne mein Zutun, hatte ich nicht mehr die Holzplanken des Balkons unter meinen Füßen, sondern die Steinplatten aus unserem Garten. Ich sah sie nicht, ich fühlte sie. Diese Erinnerung musste sehr lange zurückliegen, und sie war ganz anders als die Erinnerungen, die ich kannte. Nicht ich war es, der sich erinnerte. Meine Füße er inner ten sich. Wenn ich s mir recht überlege, glaube ich nicht, dass mein Mitschüler Max eine höhere Evolutionsstufe erreicht hat. Vielleicht sind zusammengewachsene Zehen eher ein Zeichen von Vernachlässigung als von Fortschritt. Ich bezweifle sowieso, dass Greta uns retten wird und wir die nächste Stufe überhaupt erreichen. Ich rede nicht vom ökologischen Fußabdruck, davon spüre ich nichts; ich rede davon, dass wir Wiesen asphaltieren. Irgendetwas ist schiefgelaufen, als wir mit unseren Greif füßen von den Bäumen geklettert und in luftgepolsterte Sneakers geschlüpft sind. Wir haben, vielleicht ist es so einfach, den Kontakt zum Boden unter unseren Füßen verloren. Ich werde jedenfalls weiter barfuß laufen, bis ans Ende des Herbstes, mindestens. Meine Füße fühlen sich so gut an wie nie, die Hornhaut ist dick und geschmeidig, ohne Risse, voller Gefühl. Meine Zehen sind kräftig und relativ beweglich. Neulich saß ich wieder mit meinem Bruder zusammen, barfuß in seinem Wohnzimmer. Wir tranken Rotwein und betrachteten unsere Zehen, das fanden wir immer noch ziemlich witzig. Dann sagte seine Frau etwas, das mir noch nie jemand gesagt hatte. Etwas, das mich wunderte und ein bisschen stolz machte, weil ich Ehrenwort! nichts anderes getan hatte, als hin und wieder meine Fußnägel zu schneiden. Sie sagte:»deine Füße sehen gepflegt aus.«vielleicht bilde ich es mir ein, aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist es, als spürte ich ein leichtes Kribbeln in meinem Mittelzeh. A A sind hochsensibel. Unter unseren Sohlen enden so viele Nerven wie sonst nur an unseren Lippen«
62 62 ENTDECKEN 2. JULI 2020 DIE ZEIT N o 28 Du siehst aus, wie ich mich fühle Was mein Leben reicher macht WIE ES WIRKLICH IST... ein halb leeres Freibad zu beaufsichtigen An heißen Sommertagen in Berlin haben wir normalerweise 5000 Gäste im Bad. Es waren auch schon Die Sonne knallt, das Becken ist so voll, dass niemand mehr schwimmen kann. Viele Familien und Jugendliche aus dem Wedding verbringen im Sommerbad Humboldthain die Ferien, auch Clan- Mitglieder. Da brauchst du Menschenkenntnis und Feingefühl am Beckenrand. Inzwischen sehe ich am Gang, ob jemand schwimmen kann. Dieser Sommer ist meine zweite Saison im Humboldthain und für mich bisher eine entspannte. Wegen Corona haben wir doppelt so viel Personal im Bad, und über den Tag verteilt dürfen maximal 1000 Leute rein, die Karten müssen sie online buchen. Nachmittags kommen ein paar Familien und Jugendliche. Aber die Kids verlieren schnell die Lust. Die Rutsche und der Sprungturm sind geschlossen, wir achten auf den Abstand im Wasser. Da haben die nicht so viel Spaß. Ansonsten sind 70, 80 Prozent der Gäste jetzt Schwimmer. Und durch die Beschränkungen haben wir eher die ruhige, intellektuelle Klientel. Da musst du diskutieren, ob die Maßnahmen zu streng sind oder nicht streng genug: Uns wurde schon gesagt, dass wir Kollegen zu eng zusammenstehen. Das kannst du nur weglächeln. Und dann hören wir wieder, dass wir genauer auf die Regeln achten als andere Bäder. Auf der Wiese haben wir Kreise ins Gras gemäht, in denen man sich aufhalten darf. Zwischen den Schwimmzeiten desinfizieren wir Bänke und Handläufe. Wir haben ein neues Sprühmittel dafür namens Rote Desiree, eine Mischung aus Desinfektions- und Reinigungsmittel. In der aktuellen Situation tun mir die Alten leid. Die wissen zum Teil gar nicht, wie man online Tickets kauft. Und ich frage mich oft, was die Kids diesen Sommer machen. Für manche haben wir eine richtige Aufsichts- und Erziehungsfunktion. Sie wissen, dass sie sich im Bad an Regeln halten müssen, sonst sind sie draußen. Die kennen das gar nicht von daheim. Für alle anderen sind die Bedingungen aber ge rade optimal. Das sagen uns auch die Gäste: Toll hier, schön, dass wieder geöffnet ist. Für mich ist die Aufsicht am Becken natürlich einfacher. Entspannen darfst du als Bademeister trotzdem nie, das ist wie bei der Feuerwehr: Meistens sitzt bloß eine Katze auf dem Baum, aber einmal im Jahr besteht Lebensgefahr. Gregor Gabriel, 37, arbeitet seit 20 Jahren für die Berliner Bäderbetriebe Aufgezeichnet von Florentin Schumacher Wenn Sie in unserer Rubrik»Wie es wirklich ist«berichten möchten, melden Sie sich bei uns: wirklich@zeit.de Illustration: Eva Revolver für DIE ZEIT; kl. Fotos: privat Folge 212 ZEITSPRUNG Der Schul-Baum Als ich als junge Lehrerin anfing, habe ich diese traurige Ecke auf dem Weg zur Turnhalle unserer Schule kaum wahrgenommen. Eines Tages hat jemand dort ein Bäumchen gepflanzt. Inzwischen muss es nicht mehr gestützt werden. Und jetzt, kurz vor meiner Pensionierung, erscheint es mir symbolhaft für meine Arbeit. Auf Wiedersehen, Kinder, es hat Spaß gemacht, euch wachsen zu sehen. Marlies Ebertshäuser, München MEIN WORTSCHATZ Milieu Beim Schrankaufräumen finde ich die Tischdecken meiner Großmutter wieder auch die kleinen Deckchen, die sie in die Mitte der gedeckten Tafel zu legen pflegte. Sie nannte sie Milieu. Ich weiß nicht, warum man im Odenwald diesen französischen Ausdruck benutzte, aber der Sinn dieser kleinen, oft besonders schön verzierten Deckchen war wohl, den Mittelpunkt des Tisches hervorzuheben. Annette Herrmann, Bad König, Hessen Die beiden Kröten haben sich im Odenwald kennen- und lieben gelernt. Für die Aufnahme wurden sie für eine Minute in eine Fotobox gesetzt. Fotografiert von Thomas Kuhn Die Müllmänner, die meine Stadt so sauber und lebenswert machen! Lisa Reck Burneo, Wien Wir wohnen in einer Straße, die vollständig vom zartgrünen Blätterdach großer Lindenbäume überwölbt ist. Wenn ich frühmorgens als Erstes das Fenster öffne und eine Woge von Lindenblütenduft hereinweht, erlebe ich einen Moment vollkommenen irdischen Glücks. Werner Wittersheim, Wuppertal Drei Kinder in der Ausbildung. Eines Tages kommt eine Nachricht von der Tochter, die gerade ihren Bachelor gemacht hat:»mami, Du kannst mir weniger überweisen, ich habe kleine Jobs, das reicht.«die Kinder werden groß! Christiane Kleinhempel, Chemnitz Im Garten leuchten jedes Jahr die schönsten Brombeeren, die man sich nur vorstellen kann: groß, saftig und tiefschwarz! Nur leider leuchten sie auf der anderen Seite des Zaunes also beim Nachbarn. Oh ja, Neid und Sehnsucht sind groß! Und es wäre geschwindelt, wenn ich sagen würde, dass ich niemals eine einzige probiert hätte... Ich bitte um Entschuldigung! Doch in diesem Jahr habe ich auf meiner eigenen Wiese Brombeerpflänzchen entdeckt sie sind unterm Zaun hindurchgewachsen. Daniela Berninger, Ebern, Bayern Der»Rapunzelservice«unserer Pfarrbücherei. Seit Kurzem hängt da aus dem ersten Stock ein Beutel herunter, ich lege einen Zettel mit Bücherwunsch hinein, läute eine Glocke, und wenn ich aus dem Gottesdienst zurückkomme, finde ich meine Wünsche erfüllt. Sibylle Korber, Odenthal, Nordrhein-Westfalen Meine beiden Mitbewohnerinnen. Wie gern würde ich sie mit in die neue Stadt nehmen. Pia Müller, Heidelberg Vier Wochen nach meinem Sturz (mit Wirbelsäulen-Verletzung und Not-OP) die Finger wieder auf der Tastatur bewegen zu können. Und an der Hand meiner neuen Liebe (etwas unsicher zwar, aber immerhin) durch den Klinikpark zu spazieren. In jeder Hinsicht: ein neu geschenktes Leben. Friederike Höhndorf, Biberach an der Riß Mit dem Rennrad unterwegs durch meine mittelsächsische Heimat, eine Region, die durch den mittlerweile eingestellten Erzbergbau bekannt wurde. Zu Hause angekommen, setze ich mich auf die Bank, um die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Plötzlich ertönt in einem der Nachbargärten eine Trompete. Jemand spielt das Bergmannslied. Die Tradition, sie lebt. Glückauf! Maxi Kanthack, Freiberg Als kleiner Bub sagte meine Mama öfter zu mir: Bub, wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, dann würdest du ihn auch vergessen. Jetzt bin ich 75 und habe ihn immer noch. Prof. em. Wolfgang Schumann, Bayreuth Machen Sie mit! Schreiben Sie uns, was Ihr Leben reicher macht, teilen Sie Ihre»Wortschätze«und»Zeitsprünge«mit uns. Beiträge bitte an leser@zeit.de oder an Redaktion DIE ZEIT,»Z-Leserseite«, Hamburg Gründungsverleger: Gerd Bucerius ( ) Herausgeberrat: Prof. Jutta Allmendinger, Dr. Nicola Leibinger- Kammüller, Zanny Minton Beddoes, Florian Illies, Dr. Josef Joffe Ehemalige Herausgeber: Dr. Marion Gräfin Dönhoff ( ) Helmut Schmidt ( ) Vorsitzender der Chefredaktionen des Zeitverlags und Chefredakteur: Giovanni di Lorenzo Stellvertretende Chefredakteure: Moritz Müller-Wirth (Managing Editor), Sabine Rückert, Holger Stark, Bernd Ulrich Mitglieder der Chefredaktion: Malin Schulz, Jochen Wegner, Dr. Stefan Willeke (Chefreporter) Chef vom Dienst: Iris Mainka (verantwortlich), Mark Spörrle Textchef: Dr. Christof Siemes Geschäftsführende Redakteure: Patrik Schwarz, Andreas Sentker Chefkorrespondentin: Tina Hildebrandt Internationaler Korrespondent: Matthias Naß Leitender Redakteur: Hanns-Bruno Kammertöns Redaktionsleiter Digitale Ausgaben: Götz Hamann Parlamentarischer Korrespondent: Matthias Geis Politik Hamburg/Berlin: Marc Brost/Elisabeth Raether/ Dr. Heinrich Wefing (verantwortlich), Mohamed Amjahid, Andrea Böhm, Peter Dausend, Christoph Dieckmann (Autor), Martin Klingst (Politischer Korrespondent), Matthias Krupa, Jörg Lau (Außen politik), Mariam Lau, Caterina Lobenstein, Anna Mayr, Paul Middelhoff, Robert Pausch, Petra Pinzler, Gero von Randow, Jan Roß, Mark Schieritz (Innennpolitik), Merlind Theile, Michael Thumann (Außenpolitischer Korrespondent), Özlem Topçu Hauptstadtredaktion: Dorotheenstraße 33, Berlin, Tel.: 030/ , Fax: 030/ Streit: Dr. Jochen Bittner/Charlotte Parnack (verantwortlich), Stefan Schirmer (Korrespondent) Dossier: Tanja Stelzer/Wolfgang Uchatius (verantwortlich), Malte Henk (stellv.), Nadine Ahr, Moritz Aisslinger, Bastian Berbner, Amrai Coen Leserbriefe: Dr. Christof Siemes (verantwortlich), Jutta Hoffritz Geschichte: Christian Staas (verantwortlich) Wirtschaft: Dr. Uwe J. Heuser (verantwortlich), Simon Kerbusk/ - Roman Pletter (stellv.), Laura Cwiertnia, Viola Diem, Thomas Fischermann, Hannah Knuth, Dr. Ingo Malcher, Ann-Kathrin Nezik, Marcus Rohwetter, Dr. Kolja Rudzio, Claas Tatje, Christian Tenbrock Wissen: Manuel J. Hartung/Andreas Sentker (verantwortlich), Rudi Novotny/Stefan Schmitt (stellv.), Anant Agarwala, Dr. Harro Albrecht, Dr. Ulrich Bahnsen, Fritz Habekuß, Stefanie Kara, Jeannette Otto, Maximilian Probst, Arnfrid Schenk, Ulrich Schnabel, Johanna Schoener, Dr. Anna-Lena Scholz, Jan Schweitzer, Martin Spiewak, Urs Willmann Bildungspolitischer Korrespondent: Thomas Kerstan Junge Leser: Katrin Hörnlein (verantwortlich), Maria Rossbauer Feuilleton: Dr. Adam Soboczynski (verantwortlich), Christine Lemke-Matwey/Dr. Hanno Rauterberg (stellv.), Dr. Thomas Ass heuer, Alexander Cammann, Jens Jessen, Peter Kümmel, Ijoma Mangold (Kulturpolitischer Korrespondent), Katja Nico de mus, Nina Pauer, Iris Radisch (Literatur; verantwortlich), Dr. Thomas E. Schmidt (Kulturkorrespondent Berlin), Dr. Elisabeth von Thadden (Sinn & Verstand), Lars Weisbrod Kulturreporter: Moritz von Uslar (Autor) Glauben & Zweifeln: Evelyn Finger (verantwortlich) Z Zeit zum Entdecken: Anita Blasberg/Dorothée Stöbener (verantwortlich), Johannes Gernert (stellv.), Michael Allmaier, Karin Ceballos Betancur, Stefanie Flamm, Francesco Giammarco, Elke Michel, Merten Worthmann; Besondere Aufgaben: Jutta Hoffritz Investigative Recherche/Recht & Unrecht: Karsten Polke- Majewski/Holger Stark (verantwortlich), Yassin Musharbash (stellv.), Anne Kunze, Stephan Lebert (Reporter), Daniel Müller, Fritz Zimmermann; Autor: Christian Fuchs ZEITmagazin: Christoph Amend (Chefredakteur), Tillmann Prüfer (Mitglied der Chefredaktion), Jörg Burger/Emilia Smechowski (Textchef/in), Anna Kemper (Stellv. Text chefin), Claire Beermann (Style Director), Sascha Chaimowicz, Heike Faller, Christine Meffert, Nicola Meier, Friederike Milbradt, Khuê Pham, Ilka Piepgras, Jürgen von Ruten berg, Matthias Stolz, Annabel Wahba Redaktionelle Koordination: Margit Stoffels Art-Direktorin: Jasmin Müller-Stoy; Gestaltung: Nina Bengtson, Mirko Merkel, Gianna Pfeifer; Fotoredaktion: Milena Carstens (verantwortlich), Michael Biedowicz Redaktion ZEITmagazin: Dorotheenstraße 33, Berlin, Tel.: 030/ , Fax: 030/ ; zeitmagazin@ zeit.de Die ZEIT-App: Götz Hamann (Redaktionsleitung), Jürgen von Rutenberg (ZEITmagazin); Art-Direktion: Haika Hinze, Jasmin Müller-Stoy (ZEITmagazin); Betreiber: ZEIT Online GmbH Verantwortlicher Redakteur Reportage: Wolfgang Ucha tius Reporter: Wolfgang Bauer, Cathrin Gilbert, Christiane Grefe, Ulrich Stock, Henning Sußebach Autoren: Antonia Baum, Klaus Brinkbäumer, Kerstin Bund, Dr. Christoph Drösser, Ronald Düker, Ulrich Greiner, Dr. Gunter Hofmann, Rüdiger Jungbluth, Sebastian Kempkens, Alard von Kittlitz, Angela Köckritz, Dr. Wolfgang Lechner, Ursula März, Dr. Susanne Mayer, Anna von Münchhausen, Roberto Saviano, Chris tian Schmidt- Häuer, Dr. Hans Schuh-Tschan, Jana Simon, Dr. Theo Sommer, Björn Stephan, Burkhard Straßmann, Tobias Timm, Jens Tönnesmann, Dr. Volker Ullrich Berater der Art-Direktion: Mirko Borsche Art-Direktion: Haika Hinze/Malin Schulz (verantwortlich), Jan Kny (stellv.) Gestaltung: Julika Altmann, Mirko Bosse, Martin Burgdorff, Mechthild Fortmann, Sina Giesecke, Katrin Guddat, Jan Lichte, Annett Osterwold, Lydia Sperber, Julia Steinbrecher, Jan-Peter Thiemann, Delia Wilms Infografik: Doreen Borsutzki, Nora Coenenberg, Anne Gerdes, Jelka Lerche, Matthias Schütte Bildredaktion: Amélie Schneider (verantwortlich), Jutta Schein (stellv.), Melanie Böge, Florian Fritzsche, Norman Hoppenheit, Lara Huck, Anja Martens, Navina Reus, Vera Tammen, Edith Wagner Dokumentation: Mirjam Zimmer (verantwortlich), Davina Domanski, Dorothee Schöndorf, Dr. Kerstin Wilhelms Korrektorat: Thomas Worthmann (verantwortlich), Oliver Voß (stellv.), Rüdiger Frank, Volker Hummel, Christoph Kirchner, Anke Latza, Irina Mamula, Ursula Nestler, Antje Poeschmann, Maren Preiß, Karen Schmidt, Matthias Sommer Schlussredaktion: Imke Kromer Frankfurter Redaktion: Lisa Nienhaus, Eschersheimer Landstraße 50, Frankfurt a. M., Tel.: 069/ , buero-frankfurt@zeit.de Christ&Welt/ZEIT:CREDO GmbH: Raoul Löbbert (verantwortlich), Merle Schmalenbach (stellv.), Andreas Öhler, Christina Rietz, Jonas Weyrosta; Konstanzer Straße 64, Berlin, redaktion@christundwelt.de Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser, Patrik Schwarz ZEIT:Hamburg: Kilian Trotier/Marc Widmann (verantwortl.), Frank Drieschner, Hanna Grabbe, Oliver Hollenstein, Annika Lasarzik (Newsletter Elbvertiefung), Oskar Piegsa, Florian Zinnecker ZEIT im Osten: Patrik Schwarz (Herausgeber); Martin Machowecz (Büroleitung), Anne Hähnig, Naumburger Straße 48, Leipzig, Tel.: 0341/ , martin.machowecz@zeit.de ZEIT:Österreich/ZEIT International GmbH: Patrik Schwarz (Herausgeber), Florian Gasser (stellv. Büroleitung), August Modersohn (bes. Aufgaben), Christina Pausackl; florian.gasser@zeit.de; Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser ZEIT:Schweiz: Matthias Daum (Büroleitung), Barbara Achermann, Sarah Jäggi, Dreikönigstraße 7, CH-8002 Zürich, Tel.: / , matthias.daum@zeit.de Europa-Redaktion: Ulrich Ladurner, Residence Palace, Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Tel.: / , Fax: / , ulrich.ladurner@zeit.de Pariser Redaktion: Blume News Group GmbH, 17, rue Bleue, Paris, Tel.: , blumegeorg@yahoo.de Mittelost-Redaktion: Lea Frehse, Rue Liban, Gemayzeh, Beirut, lea.frehse@zeit.de Washingtoner Redaktion: Kerstin Kohlenberg, 1930 Columbia Road, NW, Apt 212, Washington, DC 20009, kerstin.kohlenberg@zeit.de New Yorker Redaktion: Heike Buchter, 32 Broadway, Suite 1211, New York, NY 10004, Tel.: / , hbuchter@newyorkgermanpress.com Pekinger Redaktion: Xifan Yang, Jianguomenwai DRC , Chaoyang, Beijing, Tel.: / , xifan.yang@zeit.de Moskauer Redaktion: Alice Bota, Srednjaja Perejaslawskaja 14, Kw. 19, Moskau, alice.bota@zeit.de Weiterer Auslandskorrespondent: Dr. John F. Jungclaussen, Lon don, Tel.: / , zeit.de ZEIT Online GmbH: Chefredakteur: Jochen Wegner; Stellvertretende Chef red.: Maria Exner (Managing Editor), Markus Horeld, Sebastian Horn; Geschäftsf. Red.: Christoph Dowe (Mitglied der Chefred.); Leonie Seifert (Mitglied der Chefred.); Redakteur für besondere Aufgaben: Philip Faigle; Textchefin: Meike Dülffer; Chef/-in vom Dienst: Dr. Sasan Abdi-Herrle, Katharina Benninghoff, Rieke Havertz, Dr. Rita Lauter, Monika Pilath, Katrin Scheib, Till Schwarze, Michael Stürzenhofecker; Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Marcus Gatzke/Ileana Grabitz (Leitung), Lisa Caspari/Marlies Uken (stellv.), Dr. Andrea Backhaus, Christian Bangel, Andrea Buhtz, Steffen Dobbert, Alexandra Endres, Angelika Finkenwirth, Simone Gaul, Karin Geil, Sören Götz, Sarah Grahn, Tina Groll, Jurik Caspar Iser, Lenz Jacobsen, Sybille Klormann, Hannes Leitlein, Judith Luig, Carsten Luther, Ferdinand Otto, Steffen Richter, Parvin Sadigh, Dr. Michael Schlieben, Katharina Schuler, Tilman Steffen, Frida Thurm, Christian Vooren, Zacharias Zacharakis; Kultur: Rabea Weihser (Leitung), Dirk Peitz (stellv.), David Hugendick, Wenke Husmann, Johannes Schneider, Carolin Ströbele; Digital, Wissen: Dagny Lüdemann (Leitung), Sven Stock rahm (stellv.), Linda Fischer, Lisa Hegemann, Meike Laaff, Bente Lubahn, Maria Mast, Alisa Schröder, Dr. Florian Schumann, Dr. Jakob Simmank; Team Investigativ/ Daten: Karsten Polke- Majewski (Leitung), Kai Biermann, Astrid Geisler, Tom Sundermann, Sascha Venohr; Ressort X: Philip Faigle (Leitung), David Hugendick, Annabelle Seubert, Vanessa Vu; Magazine (ZEITmagazin Online, ZEIT Campus Online, Arbeit, Entdecken, Die Antwort): Leonie Seifert (Leitung), Carmen Böker (stellv.), Amna Franzke (verantwortl. Red. ZEIT Campus Online), Anne-Katrin Schade (verantwortl. Red. Arbeit), Silke Janovsky (Red. für besondere Aufgaben), Carla Baum, Juliane Frisse, Luisa Jacobs, Wlada Kolosowa, Alexander Krex, Jakob Pontius, Sara Tomsic; Sport: Christian Spiller (verantwortl. Red.), Oliver Fritsch, Fabian Scheler; Video: Thilo Kasper (Leitung), Claudia Bracholdt, Dilan Gropengiesser, Lydia Meyer, Adrian Pohr, Sven Wolters; Head of Visual: Julius Tröger; Team Interaktiv: Paul Blickle, Annick Ehmann, Julian Stahnke; Team Engagement: Janis Dietz, Tobias Dorfer, Carly Laurence, Jana Lavrov, Julia Meyer, Laura Oelker, Ulrike Rosina, Dennis Schmees, Marlon Schröder, Ann-Kristin Tlusty, Mona Wetzel; Bildredaktion: Michael Pfister/Andreas Prost (Leitung), Leonie Baumeister, Norbert Bayer, Sabine Bergmann, Felix Burchardt, Alexander Hoepfner, Reinhold Hügerich, Nina Lüth, Caroline Scharff, Jakob Weber; Entwicklungsredaktion: Holger Wiebe (Leitung), Thomas Stroth johann (stellv.), René Nicklas, Rosemary Tremlett, Leonie Wismeth Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser, Christian Röpke, Enrique Tarragona Verlag und Redaktion: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Helmut-Schmidt- Haus, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, Hamburg Telefon: 040/ , Fax: 040/ , DieZeit@zeit.de; ZEIT Online GmbH: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser Marketing und Vertrieb: Nils von der Kall Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen: Silvie Rundel Herstellung/Schlussgrafik: Torsten Bastian (verantwortlich), Patrick Baden, Helga Ernst, Stefanie Fricke, Jan Menssen, Oliver Nagel, Tim Paulsen, Frank Siemienski, Pascal Struckmann, Birgit Vester; Bildbearbeitung: Andrea Drewes, Hanno Hammacher, Martin Hinz Druck: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH & Co. KG, Kurhessenstr. 4 6, Mörfelden-Walldorf; Axel Springer Offsetdruckerei Ahrensburg GmbH & Co. KG, Kornkamp 11, Ahrensburg Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder übernimmt der Verlag keine Haftung. Anzeigenleitung: Áki Hardarson Anzeigenstruktur: Peggy Ludwig (verantwortlich), Laura Gilica Anzeigen-Preisliste Nr. 65 vom 1. Januar 2020 Magazine und Neue Geschäftsfelder: Sandra Kreft Projektreisen: Christopher Alexander Börsenpflichtblatt: An allen acht deutschen Wertpapierbörsen ZEIT-LESERSERVICE Leserbriefe Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg Fax: 040/ ; leserbriefe@zeit.de Artikelabfrage aus dem Archiv Fax: 040/ ; archiv@zeit.de Abonnement DIE ZEIT 280,80 (52 Ausgaben); für Studenten 176,80 (inkl. ZEIT Campus); Lieferung frei Haus; Digitales Abo 5,40 pro Ausgabe; Digitales Abo für ZEIT-Abonnenten 0,70 pro Ausgabe Schriftlicher Bestellservice: DIE ZEIT, Hamburg Abonnentenservice: Tel.: 040/ Fax: 040/ abo@zeit.de Abonnement für Österreich, Schweiz und restliches Ausland DIE ZEIT Leserservice Hamburg Deutschland Tel.: / Fax: / abo@zeit.de Abonnement USA DIE ZEIT (USPS No ) is published weekly by Zeitverlag; K.O.P.: Data Media (A division of Cover- All Computer Services Corp.), 2221 Kenmore Avenue, Suite 106, Buffalo, NY Periodicals postage is paid at Buffalo, NY Postmaster: Send address changes to: DIE ZEIT, Data Media, P.O. Box 155, Buffalo, NY Toll-free: service@roltek.com Abonnement Kanada Sunrise News, 47 Silver Shadow Path, Toronto ON M9C 4Y2 Tel.: sunriseorders@bell.net Einzelverkaufspreis Deutschland: 5,70 Ausland: Belgien 6,60; Dänemark DKR 60,95; Finnland 8,50; Frank reich 7,10; Griechenland 7,60; Großbritannien GBP 7,90; Italien 7,10; Luxemburg 6,60; Nieder lande 6,60; Österreich 5,90; Portugal 7,40; Schweiz CHF 8,20; Slowakei 7,20; Slowenien 7,10; Spanien 7,10; Kanarische Inseln 7,60; Ungarn HUF 2990,00 ISSN:
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
Nachricht von Martin Hagen
 Bitte beachten Sie! Damit Sie das Heft gut lesen können: Haben wir immer die männliche Form geschrieben. Zum Beispiel: der Bürger, der Polizist. Wir meinen damit aber genauso auch die Frauen: die Bürgerin,
Bitte beachten Sie! Damit Sie das Heft gut lesen können: Haben wir immer die männliche Form geschrieben. Zum Beispiel: der Bürger, der Polizist. Wir meinen damit aber genauso auch die Frauen: die Bürgerin,
Auf Lesbarkeit geprüft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Westfalenfleiß ggmbh, Münster
 Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm in Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm ist wirklich gültig. Herausgeberin: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesverband Baden-Württemberg Forststraße
Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm in Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm ist wirklich gültig. Herausgeberin: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesverband Baden-Württemberg Forststraße
Text zur Rede von Sabine Zimmermann über den Armuts- und Reichtums-Bericht
 Text zur Rede von Sabine Zimmermann über den Armuts- und Reichtums-Bericht Sabine Zimmermann ist von der Partei Die Linke. Sie hat eine Rede im Bundestag gehalten. Sie hat gesagt: Die Bundes-Regierung
Text zur Rede von Sabine Zimmermann über den Armuts- und Reichtums-Bericht Sabine Zimmermann ist von der Partei Die Linke. Sie hat eine Rede im Bundestag gehalten. Sie hat gesagt: Die Bundes-Regierung
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 119-1 vom 26. November 2009 Rede des Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Guido Westerwelle, zur Fortsetzung der Beteiligung der Bundeswehr am Einsatz der Internationalen
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 119-1 vom 26. November 2009 Rede des Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Guido Westerwelle, zur Fortsetzung der Beteiligung der Bundeswehr am Einsatz der Internationalen
Der Bayerische. Land-Tag. in leichter Sprache
 Der Bayerische Land-Tag in leichter Sprache Seite Inhalt 2 Begrüßung 1. 4 Der Bayerische Land-Tag 2. 6 Die Land-Tags-Wahl 3. 8 Parteien im Land-Tag 4. 10 Die Arbeit der Abgeordneten im Land-Tag 5. 12 Abgeordnete
Der Bayerische Land-Tag in leichter Sprache Seite Inhalt 2 Begrüßung 1. 4 Der Bayerische Land-Tag 2. 6 Die Land-Tags-Wahl 3. 8 Parteien im Land-Tag 4. 10 Die Arbeit der Abgeordneten im Land-Tag 5. 12 Abgeordnete
Kann sich Ebola explosionsartig ausbreiten?
 Kann sich Ebola explosionsartig ausbreiten? Aktualisiert am 19.08.2014 Eine wütende Menge hat die Quarantänestation eines liberianischen Spitals gestürmt, 30 Patienten sind geflohen. Was das für die Verbreitung
Kann sich Ebola explosionsartig ausbreiten? Aktualisiert am 19.08.2014 Eine wütende Menge hat die Quarantänestation eines liberianischen Spitals gestürmt, 30 Patienten sind geflohen. Was das für die Verbreitung
Rede. Volker Kauder MdB. 26. Parteitag der CDU Deutschlands. des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. 5. April 2014 Messe Berlin
 26. Parteitag der CDU Deutschlands 5. April 2014 Messe Berlin Rede des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Volker Kauder MdB Stenografische Mitschrift Gemeinsam erfolgreich in Europa.
26. Parteitag der CDU Deutschlands 5. April 2014 Messe Berlin Rede des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Volker Kauder MdB Stenografische Mitschrift Gemeinsam erfolgreich in Europa.
Wie Angela Merkel Wahl-Kampf macht
 Hier geht es zum Wörter-Buch: https://www.taz.de/!5417537/ Wie Angela Merkel Wahl-Kampf macht Angela Merkel muss endlich sagen, welche Themen ihr bei der Bundestags-Wahl wichtig sind! Dieser Text ist ein
Hier geht es zum Wörter-Buch: https://www.taz.de/!5417537/ Wie Angela Merkel Wahl-Kampf macht Angela Merkel muss endlich sagen, welche Themen ihr bei der Bundestags-Wahl wichtig sind! Dieser Text ist ein
Wir sind eine Partei. Sie können uns wählen bei der Wahl zum Landtag. Wir heißen ÖDP. Ö steht für ökologisch. Ökologisch heißt, Umwelt und Natur
 1 Wir sind eine Partei. Sie können uns wählen bei der Wahl zum Landtag. Wir heißen ÖDP. Ö steht für ökologisch. Ökologisch heißt, Umwelt und Natur auf der ganzen Welt sind uns wichtig. D steht für demokratisch:
1 Wir sind eine Partei. Sie können uns wählen bei der Wahl zum Landtag. Wir heißen ÖDP. Ö steht für ökologisch. Ökologisch heißt, Umwelt und Natur auf der ganzen Welt sind uns wichtig. D steht für demokratisch:
DOWNLOAD VORSCHAU. Kleines Politiklexikon. zur Vollversion. Politik ganz einfach und klar. Sebastian Barsch. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Sebastian Barsch Kleines Politiklexikon Politik ganz einfach und klar Bergedorfer Unterrichtsideen Sebastian Barsch Downloadauszug aus dem Originaltitel: Politik ganz einfach und klar: Wahlen
DOWNLOAD Sebastian Barsch Kleines Politiklexikon Politik ganz einfach und klar Bergedorfer Unterrichtsideen Sebastian Barsch Downloadauszug aus dem Originaltitel: Politik ganz einfach und klar: Wahlen
allensbacher berichte
 allensbacher berichte Institut für Demoskopie Allensbach 2001 / Nr. 21 TERROR IN AMERIKA Die Einschätzungen in Deutschland Allensbach am Bodensee, Mitte September 2001 - Zwei Tage nach dem Terroranschlag
allensbacher berichte Institut für Demoskopie Allensbach 2001 / Nr. 21 TERROR IN AMERIKA Die Einschätzungen in Deutschland Allensbach am Bodensee, Mitte September 2001 - Zwei Tage nach dem Terroranschlag
Gedanken zu den Terroranschlägen von Paris Hunteburg & Bohmte 2015
 Gedanken zu den Terroranschlägen von Paris Hunteburg & Bohmte 2015 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Was geschehen ist Die Ereignisse von Paris schockieren uns: 2 islamistische Terroristen dringen in die
Gedanken zu den Terroranschlägen von Paris Hunteburg & Bohmte 2015 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Was geschehen ist Die Ereignisse von Paris schockieren uns: 2 islamistische Terroristen dringen in die
Nur mit uns: Frieden, soziale Gerechtigkeit und Demokratie. Die Fraktion DIE LINKE im Bundestag stellt sich in leichter Sprache vor.
 Nur mit uns: Frieden, soziale Gerechtigkeit und Demokratie Die Fraktion DIE LINKE im Bundestag stellt sich in leichter Sprache vor. Fraktion DIE LINKE. im Bundestag Platz der Republik 1, 11011 Berlin Telefon:
Nur mit uns: Frieden, soziale Gerechtigkeit und Demokratie Die Fraktion DIE LINKE im Bundestag stellt sich in leichter Sprache vor. Fraktion DIE LINKE. im Bundestag Platz der Republik 1, 11011 Berlin Telefon:
Arbeit und Familie sollen besser zusammen funktionieren
 Manche Wörter in diesem Text sind schwer. Diese Wörter sind blau. Sie können am Ende vom Text eine Erklärung über das Wort in Leichter Sprache lesen. Wenn Sie das Wort nicht kennen. Oder wenn Sie mehr
Manche Wörter in diesem Text sind schwer. Diese Wörter sind blau. Sie können am Ende vom Text eine Erklärung über das Wort in Leichter Sprache lesen. Wenn Sie das Wort nicht kennen. Oder wenn Sie mehr
Entscheiden Sie: Bundes-Garten-Schau in der Stadt Mannheim. 22. September 2013! Leichte Sprache
 Entscheiden Sie: Bundes-Garten-Schau in der Stadt Mannheim 22. September 2013! Leichte Sprache Liebe Mannheimer und liebe Mannheimerinnen, Sie dürfen abstimmen. Das nennt man Bürger-Entscheid. Die Frage
Entscheiden Sie: Bundes-Garten-Schau in der Stadt Mannheim 22. September 2013! Leichte Sprache Liebe Mannheimer und liebe Mannheimerinnen, Sie dürfen abstimmen. Das nennt man Bürger-Entscheid. Die Frage
Das Kurzwahl-Programm von der Partei DIE LINKE in Leichter Sprache
 Das Kurzwahl-Programm von der Partei DIE LINKE in Leichter Sprache 1 Am 14. Mai 2017 ist Landtags-Wahl in NRW Zeigen Sie Stärke! Gehen Sie zur Wahl. Machen Sie sich stark für ein gerechtes NRW. Wählen
Das Kurzwahl-Programm von der Partei DIE LINKE in Leichter Sprache 1 Am 14. Mai 2017 ist Landtags-Wahl in NRW Zeigen Sie Stärke! Gehen Sie zur Wahl. Machen Sie sich stark für ein gerechtes NRW. Wählen
Steht die Eroberung Jerusalems bevor?
 Steht die Eroberung Jerusalems bevor? Quelle: http://realindianews.blogspot.com/2012/01/indian-asian-activists-planglobal.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=feed%3a+realnewsthatindian
Steht die Eroberung Jerusalems bevor? Quelle: http://realindianews.blogspot.com/2012/01/indian-asian-activists-planglobal.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=feed%3a+realnewsthatindian
Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren
 Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren Eine Studie zu einer neuen Versicherung für alle Bürger und Bürgerinnen Hier lesen Sie einen Beschluss von der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. Der Beschluss ist
Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren Eine Studie zu einer neuen Versicherung für alle Bürger und Bürgerinnen Hier lesen Sie einen Beschluss von der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. Der Beschluss ist
Wahl-Programm zur Europa-Wahl von der Partei CDU in Leichter Sprache
 Wahl-Programm zur Europa-Wahl von der Partei CDU in Leichter Sprache Das ist wichtig für diesen Text: Dieser Text ist nur in männlicher Sprache geschrieben. Zum Beispiel steht im Text nur: Politiker. Das
Wahl-Programm zur Europa-Wahl von der Partei CDU in Leichter Sprache Das ist wichtig für diesen Text: Dieser Text ist nur in männlicher Sprache geschrieben. Zum Beispiel steht im Text nur: Politiker. Das
Für einen linken Feminismus
 Die Leichte Sprache wurde geprüft von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten Für einen linken Feminismus Für eine gute Frauen-Politik Gleiche Rechte für alle Menschen Liebe Leser und Leserinnen, liebe Menschen,
Die Leichte Sprache wurde geprüft von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten Für einen linken Feminismus Für eine gute Frauen-Politik Gleiche Rechte für alle Menschen Liebe Leser und Leserinnen, liebe Menschen,
WAHLPROGRAMM IN LEICHTER SPRACHE
 WAHLPROGRAMM IN LEICHTER SPRACHE FÜ R D I E LANDTAG SWAH L 20 1 1 Gemeinsam für Baden-Württemberg. CHANCEN ERGREIFEN. WOHLSTAND SICHERN. Herausgeber: CDU Baden-Württemberg Landesgeschäftsstelle Hasenbergstraße
WAHLPROGRAMM IN LEICHTER SPRACHE FÜ R D I E LANDTAG SWAH L 20 1 1 Gemeinsam für Baden-Württemberg. CHANCEN ERGREIFEN. WOHLSTAND SICHERN. Herausgeber: CDU Baden-Württemberg Landesgeschäftsstelle Hasenbergstraße
Hashtags aus dem Bundestag
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Twitter 07.11.2016 Lesezeit 3 Min Hashtags aus dem Bundestag Barack Obama und Wladimir Putin tun es, ebenso François Hollande und Hillary Clinton:
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Twitter 07.11.2016 Lesezeit 3 Min Hashtags aus dem Bundestag Barack Obama und Wladimir Putin tun es, ebenso François Hollande und Hillary Clinton:
10 Vorurteile über Flüchtlinge
 10 Vorurteile über Flüchtlinge Ein Text in Leichter Sprache Flüchtlinge sind Menschen, die aus ihrem Land fliehen. Weil dort Krieg ist. Weil sie dort hungern und leiden. Weil sie dort bedroht sind. Weil
10 Vorurteile über Flüchtlinge Ein Text in Leichter Sprache Flüchtlinge sind Menschen, die aus ihrem Land fliehen. Weil dort Krieg ist. Weil sie dort hungern und leiden. Weil sie dort bedroht sind. Weil
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Positionen im Nahostkonflikt - Was genau wollen Israelis und Palästinenser?
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Positionen im Nahostkonflikt - Was genau wollen Israelis und Palästinenser? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Positionen im Nahostkonflikt - Was genau wollen Israelis und Palästinenser? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Gut für alle. Gerecht für alle. Frieden für alle.
 Die Leichte Sprache wurde geprüft von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten Für diese Zukunft kämpfen wir: Gut für alle. Gerecht für alle. Frieden für alle. Wahl-Programm von der Partei DIE LINKE zur Bundestags-Wahl
Die Leichte Sprache wurde geprüft von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten Für diese Zukunft kämpfen wir: Gut für alle. Gerecht für alle. Frieden für alle. Wahl-Programm von der Partei DIE LINKE zur Bundestags-Wahl
Hören wir doch mal einem Gespräch zwischen einem Joschka-Fan und einem Fischer- Gegner zu 1 :
 Wenn die Deutschen gefragt werden, welchen ihrer Politiker sie am sympathischsten finden, steht sein Name immer noch ganz weit oben: Joschka Fischer. Bundesbildstelle Es gibt aber auch viele Leute, die
Wenn die Deutschen gefragt werden, welchen ihrer Politiker sie am sympathischsten finden, steht sein Name immer noch ganz weit oben: Joschka Fischer. Bundesbildstelle Es gibt aber auch viele Leute, die
Aufbau einer Rede. 3. Zweite Rede eröffnende Regierung - (gegebenenfalls Erläuterung zum Antrag) - Rebuttal - Weitere Pro-Argumente erklären
 Aufbau einer Rede 1. Erste Rede eröffnende Regierung - Wofür steht unser Team? - Erklärung Status Quo (Ist-Zustand) - Erklärung des Ziels (Soll-Zustand) - Antrag erklären (Was möchten wir mit welchen Ausnahmen
Aufbau einer Rede 1. Erste Rede eröffnende Regierung - Wofür steht unser Team? - Erklärung Status Quo (Ist-Zustand) - Erklärung des Ziels (Soll-Zustand) - Antrag erklären (Was möchten wir mit welchen Ausnahmen
Große Aufregung um vier Buchstaben: TTIP bringt Streit Große Demonstration in Hannover am 23. April 2016 mit Menschen
 Große Aufregung um vier Buchstaben: TTIP bringt Streit Große Demonstration in Hannover am 23. April 2016 mit 10.000 Menschen Am 23. April 2016 gingen in Hannover viele Menschen auf die Straßen. Sie haben
Große Aufregung um vier Buchstaben: TTIP bringt Streit Große Demonstration in Hannover am 23. April 2016 mit 10.000 Menschen Am 23. April 2016 gingen in Hannover viele Menschen auf die Straßen. Sie haben
Die Teilhabe-Politik ist veraltet. Die Regierung hat zu wenig Fach-Wissen.
 Die Teilhabe-Politik ist veraltet Die Regierung hat zu wenig Fach-Wissen Dieser Text ist eine Rede von Sören Pellmann. Er ist Politiker im Deutschen Bundestag. Er gehört zu der Partei DIE LINKE. Er ist
Die Teilhabe-Politik ist veraltet Die Regierung hat zu wenig Fach-Wissen Dieser Text ist eine Rede von Sören Pellmann. Er ist Politiker im Deutschen Bundestag. Er gehört zu der Partei DIE LINKE. Er ist
Dreizehnter Kaufbeurer Dialog am
 Dreizehnter Kaufbeurer Dialog am 07.07.2014 General a.d. Klaus Dieter Naumann Im Sparkassenforum der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren stellte der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General
Dreizehnter Kaufbeurer Dialog am 07.07.2014 General a.d. Klaus Dieter Naumann Im Sparkassenforum der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren stellte der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General
Das politische Klima vor Und nach der Bundestagswahl
 Thomas Petersen Das politische Klima vor Und nach der Bundestagswahl Bezirksparteitag der CDU Südbaden Höchenschwand 28. Oktober 2017 1. Prognose und Wahlergebnis Die Allensbacher Wahlprognose und das
Thomas Petersen Das politische Klima vor Und nach der Bundestagswahl Bezirksparteitag der CDU Südbaden Höchenschwand 28. Oktober 2017 1. Prognose und Wahlergebnis Die Allensbacher Wahlprognose und das
Video-Thema Begleitmaterialien
 VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM IN FRAUENHAND Ursula von der Leyen von der CDU ist als erste Frau in Deutschland Verteidigungsministerin geworden. Es ist bereits das dritte Amt in der Bundesregierung, das die
VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM IN FRAUENHAND Ursula von der Leyen von der CDU ist als erste Frau in Deutschland Verteidigungsministerin geworden. Es ist bereits das dritte Amt in der Bundesregierung, das die
DOWNLOAD. Parteien, Wahlkampf und die Arbeit von Politikern. Politik ganz einfach und klar. Sebastian Barsch. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Sebastian Barsch Parteien, Wahlkampf und die Arbeit von Politikern Politik ganz einfach und klar Sebastian Barsch Bergedorfer Unterrichtsideen Downloadauszug aus dem Originaltitel: Politik ganz
DOWNLOAD Sebastian Barsch Parteien, Wahlkampf und die Arbeit von Politikern Politik ganz einfach und klar Sebastian Barsch Bergedorfer Unterrichtsideen Downloadauszug aus dem Originaltitel: Politik ganz
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 94-1 vom 11. September 2009 Ansprache von Bundespräsident Horst Köhler zur Einweihung des Ehrenmals der Bundeswehr am 8. September 2009 in Berlin: Was wir den Toten schuldig
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 94-1 vom 11. September 2009 Ansprache von Bundespräsident Horst Köhler zur Einweihung des Ehrenmals der Bundeswehr am 8. September 2009 in Berlin: Was wir den Toten schuldig
Armut und Behinderung: Menschen mit Behinderungen müssen vor Armut geschützt werden.
 Armut und Behinderung: Menschen mit Behinderungen müssen vor Armut geschützt werden. Der Monitoring-Ausschuss wollte einen Bericht zum Thema Armut schreiben. Dafür gibt es vor allem 3 Gründe: 2010 war
Armut und Behinderung: Menschen mit Behinderungen müssen vor Armut geschützt werden. Der Monitoring-Ausschuss wollte einen Bericht zum Thema Armut schreiben. Dafür gibt es vor allem 3 Gründe: 2010 war
*** Sehr geehrter Herr Kommandeur!
 Es gilt das gesprochene Wort *** Sehr geehrter Herr Kommandeur! Meine Damen und Herren! Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten vom Panzergrenadierbataillon 401, werden in den kommenden Monaten Zeugen des
Es gilt das gesprochene Wort *** Sehr geehrter Herr Kommandeur! Meine Damen und Herren! Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten vom Panzergrenadierbataillon 401, werden in den kommenden Monaten Zeugen des
Fleisch: Label hier, Label da
 Fleisch: Label hier, Label da Verbraucher wollen beim Fleischeinkauf mehr verlässliche Informationen zur Tierhaltung. Doch statt eines verpflichtenden staatlichen Tierwohllabels gibt es einen Dschungel
Fleisch: Label hier, Label da Verbraucher wollen beim Fleischeinkauf mehr verlässliche Informationen zur Tierhaltung. Doch statt eines verpflichtenden staatlichen Tierwohllabels gibt es einen Dschungel
Kirchentag Barrierefrei
 Kirchentag Barrierefrei Leichte Sprache Das ist der Kirchen-Tag Seite 1 Inhalt Lieber Leser, liebe Leserin! Seite 3 Was ist der Kirchen-Tag? Seite 4 Was gibt es beim Kirchen-Tag? Seite 5 Was ist beim Kirchen-Tag
Kirchentag Barrierefrei Leichte Sprache Das ist der Kirchen-Tag Seite 1 Inhalt Lieber Leser, liebe Leserin! Seite 3 Was ist der Kirchen-Tag? Seite 4 Was gibt es beim Kirchen-Tag? Seite 5 Was ist beim Kirchen-Tag
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit
 Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Video-Thema Begleitmaterialien
 VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM IN FRAUENHAND 1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Erklärung passt zu den Begriffen? Ordnet den Satzanfängen die richtigen Enden zu. 1. Die
VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM IN FRAUENHAND 1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Erklärung passt zu den Begriffen? Ordnet den Satzanfängen die richtigen Enden zu. 1. Die
Diese Sachen will DIE LINKE machen! Damit die Zukunft für alle Menschen besser wird
 Diese Sachen will DIE LINKE machen! Damit die Zukunft für alle Menschen besser wird In allen Betrieben wird heute mit Computern gearbeitet. Und es gibt viel neue Technik in den Betrieben. Maschinen, die
Diese Sachen will DIE LINKE machen! Damit die Zukunft für alle Menschen besser wird In allen Betrieben wird heute mit Computern gearbeitet. Und es gibt viel neue Technik in den Betrieben. Maschinen, die
auf stehen aus aus sehen backen bald beginnen bei beide bekannt bekommen benutzen besonders besser best bestellen besuchen
 der Abend auf stehen aber der August acht aus ähnlich das Ausland allein aus sehen alle das Auto als das Bad alt backen an der Bahnhof andere bald ändern der Baum der Anfang beginnen an fangen bei an kommen
der Abend auf stehen aber der August acht aus ähnlich das Ausland allein aus sehen alle das Auto als das Bad alt backen an der Bahnhof andere bald ändern der Baum der Anfang beginnen an fangen bei an kommen
Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes
 Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes (ausgestrahlt am 23. Mai 2009) 1. Deutschland feiert heute 60 Jahre Grundgesetz. Was bedeutet das
Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes (ausgestrahlt am 23. Mai 2009) 1. Deutschland feiert heute 60 Jahre Grundgesetz. Was bedeutet das
Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr
 Dr. Reinhard Brandl Mitglied des Deutschen Bundestages Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr Plenarprotokoll
Dr. Reinhard Brandl Mitglied des Deutschen Bundestages Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr Plenarprotokoll
Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN für die Europa-Wahl
 Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN für die Europa-Wahl In Leichter Sprache Anmerkung: Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm in Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm
Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN für die Europa-Wahl In Leichter Sprache Anmerkung: Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm in Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm
Krieger des Lichts. Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola
 Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola Krieger des Lichts Prolog Höre mich, Mensch. Was machst du mit der Erde? Wenn du dich darum nicht kümmerst, Wird alles bald
Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola Krieger des Lichts Prolog Höre mich, Mensch. Was machst du mit der Erde? Wenn du dich darum nicht kümmerst, Wird alles bald
Deutschland Das Politische System. Die Bundesrepublik ist ein freiheitlichdemokratischer
 Deutschland Das Politische System Die Bundesrepublik ist ein freiheitlichdemokratischer Rechtsstaat. 16 Bundesländer Die Bundesrepublik ist ein föderativer Staat, d.h. sie setzt sich aus Länder zusammen.
Deutschland Das Politische System Die Bundesrepublik ist ein freiheitlichdemokratischer Rechtsstaat. 16 Bundesländer Die Bundesrepublik ist ein föderativer Staat, d.h. sie setzt sich aus Länder zusammen.
Predigt: Jesaja 9,1-6 Ein Kind schreit. Es ist dunkel. Plötzlich geht die Tür auf. Sie schiebt sich sanft über den Teppich. Ein Licht scheint in den
 Predigt: Jesaja 9,1-6 Ein Kind schreit. Es ist dunkel. Plötzlich geht die Tür auf. Sie schiebt sich sanft über den Teppich. Ein Licht scheint in den Raum. Ein Leuchten von draußen -warm und hell-spaltet
Predigt: Jesaja 9,1-6 Ein Kind schreit. Es ist dunkel. Plötzlich geht die Tür auf. Sie schiebt sich sanft über den Teppich. Ein Licht scheint in den Raum. Ein Leuchten von draußen -warm und hell-spaltet
1 von , 16:34
 1 von 7 04.01.2019, 16:34 Auf dem Berliner Kurfürstendamm feiern Anhänger von Recep Tayyip Erdogan den Wahlsieg des türkischen Präsidenten. Sie schwenken türkische Fahnen und Banner der siegreichen Regierungspartei
1 von 7 04.01.2019, 16:34 Auf dem Berliner Kurfürstendamm feiern Anhänger von Recep Tayyip Erdogan den Wahlsieg des türkischen Präsidenten. Sie schwenken türkische Fahnen und Banner der siegreichen Regierungspartei
Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen. Wahlbroschüre Hessen. Einfach wählen
 Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Herausgeber Redaktion Fotos Gestaltung Druck Text Impressum Die Beauftragte der Hessischen Landesregierung
Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Herausgeber Redaktion Fotos Gestaltung Druck Text Impressum Die Beauftragte der Hessischen Landesregierung
Der Wal. Kanada Grönland
 Der Wal Ludek Pesek Die Eskimos leben in Gegenden, wo es meistens sehr kalt ist. In Kanada und in Grönland befinden sich Eskimos. Sie haben keinen Bürgermeister aber einen Häuptling. Kanada Grönland Europa
Der Wal Ludek Pesek Die Eskimos leben in Gegenden, wo es meistens sehr kalt ist. In Kanada und in Grönland befinden sich Eskimos. Sie haben keinen Bürgermeister aber einen Häuptling. Kanada Grönland Europa
Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016
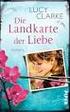 Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Das Bundes-Teilhabe-Gesetz: Mogel-Packung statt Meilen-Stein
 Das Bundes-Teilhabe-Gesetz: Mogel-Packung statt Meilen-Stein Rede von Katrin Werner Übersetzt in Leichte Sprache. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren. Wir sprechen heute über das
Das Bundes-Teilhabe-Gesetz: Mogel-Packung statt Meilen-Stein Rede von Katrin Werner Übersetzt in Leichte Sprache. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren. Wir sprechen heute über das
BAUSTEINE DER EU. Nr. 1174
 Nr. 1174 Dienstag, 03. November 2015 BAUSTEINE DER EU Gavrilo und Raphael (11) Hallo liebe Leserinnen & Leser! Wir kommen aus der Friesgasse und sind die 2B. In unserer Zeitung können Sie über die EU lesen.
Nr. 1174 Dienstag, 03. November 2015 BAUSTEINE DER EU Gavrilo und Raphael (11) Hallo liebe Leserinnen & Leser! Wir kommen aus der Friesgasse und sind die 2B. In unserer Zeitung können Sie über die EU lesen.
Regierung hält Versprechen zur Barriere-Freiheit nicht
 Regierung hält Versprechen zur Barriere-Freiheit nicht Dieser Text ist eine Rede von Sören Pellmann. Er ist Politiker für die Partei DIE LINKE im Deutschen Bundestag. Er hat im Deutschen Bundestag über
Regierung hält Versprechen zur Barriere-Freiheit nicht Dieser Text ist eine Rede von Sören Pellmann. Er ist Politiker für die Partei DIE LINKE im Deutschen Bundestag. Er hat im Deutschen Bundestag über
Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen. Wahlbroschüre Hessen. Einfach wählen
 Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Impressum Herausgeber Redaktion Fotos Gestaltung Druck Text Seite
Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Wahlbroschüre Hessen Einfach wählen Impressum Herausgeber Redaktion Fotos Gestaltung Druck Text Seite
Sehr geehrter General Marlow, sehr geehrter Herr Kommandeur, lieber OTL Bohnsack, sehr geehrter Herr Oberstleutnant Peterat,
 Rede anlässlich des Einsatzrückkehrerappells mit anschließender Übergabe der Führung des Panzergrenadierbataillons 411 von OTL Bohnsack an OTL Peterat am 17. September 2012 in der Kürrasier Kaserne in
Rede anlässlich des Einsatzrückkehrerappells mit anschließender Übergabe der Führung des Panzergrenadierbataillons 411 von OTL Bohnsack an OTL Peterat am 17. September 2012 in der Kürrasier Kaserne in
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
 1 Schwarz: UE Politisches System / Rikkyo University 2014 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lesen Sie den Text auf der folgenden Seite und ergänzen Sie das Diagramm! 2 Schwarz: UE Politisches
1 Schwarz: UE Politisches System / Rikkyo University 2014 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lesen Sie den Text auf der folgenden Seite und ergänzen Sie das Diagramm! 2 Schwarz: UE Politisches
Woher kommt der Hunger auf der Welt?
 Woher kommt der Hunger auf der Welt? Fakten und Erklärungen für Konfi-Gruppen von Pfrn. Andrea Knoche, RPI der EKHN Überall auf der Welt hungern Menschen etwa 842 Millionen Traurige Bilanz - Jährlich sterben
Woher kommt der Hunger auf der Welt? Fakten und Erklärungen für Konfi-Gruppen von Pfrn. Andrea Knoche, RPI der EKHN Überall auf der Welt hungern Menschen etwa 842 Millionen Traurige Bilanz - Jährlich sterben
Bedingungsloses Grundeinkommen
 Bedingungsloses Grundeinkommen Fast jeder hat heute davon gehört. Es geht in Deutschland um 1000 Euro, in der Schweiz, wo ich lebe, um das gut Doppelte, 2500 Franken, die der Staat seinen Bürger zahlen
Bedingungsloses Grundeinkommen Fast jeder hat heute davon gehört. Es geht in Deutschland um 1000 Euro, in der Schweiz, wo ich lebe, um das gut Doppelte, 2500 Franken, die der Staat seinen Bürger zahlen
Parteien wollen Europa reformieren
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Bundestagswahl 12.09.2017 Lesezeit 4 Min. Parteien wollen Europa reformieren Unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl steht eines schon jetzt
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Bundestagswahl 12.09.2017 Lesezeit 4 Min. Parteien wollen Europa reformieren Unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl steht eines schon jetzt
ARD-DeutschlandTREND: Mai 2010 Untersuchungsanlage
 Mai 2010 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Randomstichprobe Erhebungsverfahren: Computergestützte Telefoninterviews
Mai 2010 Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Randomstichprobe Erhebungsverfahren: Computergestützte Telefoninterviews
Unser Nordrhein-Westfalen. Das Wahl-Programm der SPD für die Landtags-Wahl in Leichter Sprache
 1 Unser Nordrhein-Westfalen Das Wahl-Programm der SPD für die Landtags-Wahl in Leichter Sprache 2 Achtung: Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm in Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm
1 Unser Nordrhein-Westfalen Das Wahl-Programm der SPD für die Landtags-Wahl in Leichter Sprache 2 Achtung: Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahl-Programm in Leichter Sprache. Aber nur das Original-Wahl-Programm
Schlusswort. (Beifall)
 Schlusswort Die Bundesvorsitzende Angela Merkel hat das Wort. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Vorsitzende der CDU: Liebe Freunde! Wir blicken auf einen, wie ich glaube, erfolgreichen Parteitag zurück.
Schlusswort Die Bundesvorsitzende Angela Merkel hat das Wort. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Vorsitzende der CDU: Liebe Freunde! Wir blicken auf einen, wie ich glaube, erfolgreichen Parteitag zurück.
Celler SchlossGespräche: Wirtschaftsstandort Niedersachsen
 Published on NiedersachsenMetall (https://niedersachsenmetall.de) Startseite > Celler Schloss-Gespräche: Wirtschaftsstandort Niedersachsen News Celle 14. März 2018 Netzwerk Celler SchlossGespräche: Wirtschaftsstandort
Published on NiedersachsenMetall (https://niedersachsenmetall.de) Startseite > Celler Schloss-Gespräche: Wirtschaftsstandort Niedersachsen News Celle 14. März 2018 Netzwerk Celler SchlossGespräche: Wirtschaftsstandort
Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis In Leichter Sprache
 Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis 2021 In Leichter Sprache Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis 2021 Was ist das Regierungs-Programm? Am 24. 9. 2017 ist die
Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis 2021 In Leichter Sprache Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis 2021 Was ist das Regierungs-Programm? Am 24. 9. 2017 ist die
Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,' '
 Janine Berg-Peer: Selbstständigkeit im Alter 1 Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,'28.11.2014' Manchmal habe ich Angst, was mit
Janine Berg-Peer: Selbstständigkeit im Alter 1 Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,'28.11.2014' Manchmal habe ich Angst, was mit
Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis In Leichter Sprache
 Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis 2021 In Leichter Sprache Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis 2021 Was ist das Regierungs-Programm? Am 24. 9. 2017 ist die
Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis 2021 In Leichter Sprache Regierungs-Programm von CDU und CSU für die Jahre 2017 bis 2021 Was ist das Regierungs-Programm? Am 24. 9. 2017 ist die
Bilanz der menschlichen Entwicklung
 Bilanz der menschlichen Entwicklung FORTSCHRITTE PROBLEME DEMOKRATIE UND PARTIZIPATION Seit 1980 unternahmen 81 Länder entscheidende Schritte in Richtung Demokratie, 33 Militärregime wurden durch zivile
Bilanz der menschlichen Entwicklung FORTSCHRITTE PROBLEME DEMOKRATIE UND PARTIZIPATION Seit 1980 unternahmen 81 Länder entscheidende Schritte in Richtung Demokratie, 33 Militärregime wurden durch zivile
Video-Thema Begleitmaterialien
 Saubere Energie aus Norddeutschland Deutschland will seine Energie in Zukunft nicht mehr so produzieren, dass es der Umwelt schadet. Strom, der aus Wind produziert wird, spielt dabei eine wichtige Rolle.
Saubere Energie aus Norddeutschland Deutschland will seine Energie in Zukunft nicht mehr so produzieren, dass es der Umwelt schadet. Strom, der aus Wind produziert wird, spielt dabei eine wichtige Rolle.
16. Sonntag nach Trinitatis, 11. September 2016
 16. Sonntag nach Trinitatis, 11. September 2016 Predigttext: 2. Timotheus 1:7-10 Predigtjahr: 2016 [ 7] (Denn) Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
16. Sonntag nach Trinitatis, 11. September 2016 Predigttext: 2. Timotheus 1:7-10 Predigtjahr: 2016 [ 7] (Denn) Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Gleiche Rechte und Hilfen für alle Menschen mit Kinder-Wunsch
 Gleiche Rechte und Hilfen für alle Menschen mit Kinder-Wunsch Dieser Text ist eine Rede von Katrin Werner. Katrin Werner ist Politikerin für die Partei DIE LINKE im Deutschen Bundestag. Sie hat am 1. Februar
Gleiche Rechte und Hilfen für alle Menschen mit Kinder-Wunsch Dieser Text ist eine Rede von Katrin Werner. Katrin Werner ist Politikerin für die Partei DIE LINKE im Deutschen Bundestag. Sie hat am 1. Februar
Video-Thema Manuskript & Glossar
 ZIELE FÜR EINE BESSERE WELT Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen (UN) die sogenannten Millenniumsziele formuliert. Damit haben die Staaten der UNO beschlossen, gegen Hunger, Armut und Krankheit in
ZIELE FÜR EINE BESSERE WELT Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen (UN) die sogenannten Millenniumsziele formuliert. Damit haben die Staaten der UNO beschlossen, gegen Hunger, Armut und Krankheit in
Chronologie des Arabischen Frühlings 2011
 -23. MÄRZ. /.-..-15. -29. BITTE WÄHLEN SIE EIN DATUM AUS, UM MEHR ZU ERFAHREN! MAI 29.-. /05 JUNI.-29. -23. MÄRZ..-. /.-15. -29. MAI 29.-. /05 JUNI.-29. 15.-21. FEBRUAR 2011 Anti-Regierungs-Proteste im
-23. MÄRZ. /.-..-15. -29. BITTE WÄHLEN SIE EIN DATUM AUS, UM MEHR ZU ERFAHREN! MAI 29.-. /05 JUNI.-29. -23. MÄRZ..-. /.-15. -29. MAI 29.-. /05 JUNI.-29. 15.-21. FEBRUAR 2011 Anti-Regierungs-Proteste im
Ohne Angriff keine Verteidigung
 VÖLKERRECHT Ohne Angriff keine Verteidigung Der Islamische Staat ist besiegt, doch die deutschen Militäreinsätze in Syrien dauern an. Damit verletzt die Regierung das völkerrechtliche Gewaltverbot. / Von
VÖLKERRECHT Ohne Angriff keine Verteidigung Der Islamische Staat ist besiegt, doch die deutschen Militäreinsätze in Syrien dauern an. Damit verletzt die Regierung das völkerrechtliche Gewaltverbot. / Von
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Stationenlernen Türkei - Land zwischen Europa und Nahost
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen Türkei - Land zwischen Europa und Nahost Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Stationenlernen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen Türkei - Land zwischen Europa und Nahost Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Stationenlernen
zur Bundestags-Wahl 2017 Wahl-Prüfsteine von der Lebenshilfe Übersetzung in Leichte Sprache
 zur Bundestags-Wahl 2017 Wahl-Prüfsteine von der Lebenshilfe Übersetzung in Leichte Sprache Wahl-Prüfsteine der Lebenshilfe Herausgeber: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.v. Raiffeisenstraße 18, 35043 Marburg
zur Bundestags-Wahl 2017 Wahl-Prüfsteine von der Lebenshilfe Übersetzung in Leichte Sprache Wahl-Prüfsteine der Lebenshilfe Herausgeber: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.v. Raiffeisenstraße 18, 35043 Marburg
O F F E N E R B R I E F
 Herr Dr. Franz Josef Jung Bundesministerium der Verteidigung Hardhöhe 53123 Bonn O F F E N E R B R I E F Sehr geehrter Herr Dr. Jung, wir als Partei die Linke im Kreis Rendsburg-Eckernförde beziehen Position
Herr Dr. Franz Josef Jung Bundesministerium der Verteidigung Hardhöhe 53123 Bonn O F F E N E R B R I E F Sehr geehrter Herr Dr. Jung, wir als Partei die Linke im Kreis Rendsburg-Eckernförde beziehen Position
Mehr Internet-Seiten sollen barriere-frei werden
 Manche Wörter in diesem Text sind schwer. Diese Wörter sind blau. Ganz am Ende vom Text: Sie können eine Erklärung über das Wort in Leichter Sprache lesen. Wenn Sie das Wort nicht kennen. Oder wenn Sie
Manche Wörter in diesem Text sind schwer. Diese Wörter sind blau. Ganz am Ende vom Text: Sie können eine Erklärung über das Wort in Leichter Sprache lesen. Wenn Sie das Wort nicht kennen. Oder wenn Sie
Predigt zu Jesaja 43,1-4a Themengottesdienst am Du bist Gold wert 2015 Wetzlar, Dom 1
 Predigt zu Jesaja 43,1-4a Themengottesdienst am 20.12.2015 Du bist Gold wert 2015 Wetzlar, Dom 1 Ihr Lieben, eine Menschen beschenken kann wunderbar sein oder auch echt Stress verursachen. Wir haben das
Predigt zu Jesaja 43,1-4a Themengottesdienst am 20.12.2015 Du bist Gold wert 2015 Wetzlar, Dom 1 Ihr Lieben, eine Menschen beschenken kann wunderbar sein oder auch echt Stress verursachen. Wir haben das
Das war die eine Seite in mir. So selbstbewusst konnte sie sprechen. Aber da gab es auch noch eine andere Seite. Erinnert ihr euch? Ich hatte Angst.
 Liebe Gemeinde! Eben hat Paulus ihn bekommen. Den Brief aus Korinth. Schon lange hatte er ihm entgegen gebangt, denn immer wieder waren ihm Nachrichten aus Korinth übermittelt worden, die alles andere
Liebe Gemeinde! Eben hat Paulus ihn bekommen. Den Brief aus Korinth. Schon lange hatte er ihm entgegen gebangt, denn immer wieder waren ihm Nachrichten aus Korinth übermittelt worden, die alles andere
Präsident Trump steht alleine da
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Interview 11.07.2017 Lesezeit 5 Min. Präsident Trump steht alleine da Was hat der G-20-Gipfel gebracht? Im Interview mit dem iwd ordnet Jürgen
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Interview 11.07.2017 Lesezeit 5 Min. Präsident Trump steht alleine da Was hat der G-20-Gipfel gebracht? Im Interview mit dem iwd ordnet Jürgen
Rede im Deutschen Bundestag Dr. Jan-Marco Luczak zur Ehe für alle. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen!
 Rede im Deutschen Bundestag Dr. Jan-Marco Luczak zur Ehe für alle Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauer auf den Tribünen! Mit dem heutigen Tag findet eine Debatte
Rede im Deutschen Bundestag Dr. Jan-Marco Luczak zur Ehe für alle Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauer auf den Tribünen! Mit dem heutigen Tag findet eine Debatte
Betreuungs-Vertrag. für das ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Erklärung in Leichter Sprache
 Betreuungs-Vertrag für das ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer geistigen Behinderung Erklärung in Leichter Sprache Was steht auf welcher Seite? Was steht auf welcher Seite?... 2 Was ist das
Betreuungs-Vertrag für das ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer geistigen Behinderung Erklärung in Leichter Sprache Was steht auf welcher Seite? Was steht auf welcher Seite?... 2 Was ist das
Video-Thema Manuskript & Glossar
 BIO IST IM TREND Immer mehr Menschen kaufen Bio-Produkte. Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist dies nichts Neues. Viele der Kunden, die Europas größten Bio-Supermarkt besuchen, kaufen hier seit Jahren
BIO IST IM TREND Immer mehr Menschen kaufen Bio-Produkte. Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist dies nichts Neues. Viele der Kunden, die Europas größten Bio-Supermarkt besuchen, kaufen hier seit Jahren
Barrieren müssen fallen überall!
 Barrieren müssen fallen überall! Eine Rede von Katrin Werner zum Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz vom 12. Mai 2016 Übersetzt in Leichte Sprache Sehr geehrte Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren.
Barrieren müssen fallen überall! Eine Rede von Katrin Werner zum Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz vom 12. Mai 2016 Übersetzt in Leichte Sprache Sehr geehrte Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren.
Barack? Telefon für dich studiert Barack Obama in New York. Er ist gerade 21 Jahre alt geworden. Er erhält einen Anruf.
 BARACK OBAMA 3 Barack Obama ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat an vielen verschiedenen Orten gewohnt. Und er hat viele verschiedene Menschen getroffen. Er hat es aber nicht immer
BARACK OBAMA 3 Barack Obama ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat an vielen verschiedenen Orten gewohnt. Und er hat viele verschiedene Menschen getroffen. Er hat es aber nicht immer
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klausur: Jean-Claude Juncker: "Rede zur Lage der EU: Hin zu einem besseren Europa - Einem Europa, das schützt, stärkt und verteidigt"
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klausur: Jean-Claude Juncker: "Rede zur Lage der EU: Hin zu einem besseren Europa - Einem Europa, das schützt, stärkt und verteidigt"
Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte: Vater, gib mir mein. Der Vater teilte seinen ganzen Besitz unter den Söhnen auf.
 Der verlorene Sohn Jesus erzählte oft Geschichten. Eine ging so: Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte: Vater, gib mir mein Erbe! Der Vater teilte seinen ganzen Besitz unter den Söhnen auf. Der
Der verlorene Sohn Jesus erzählte oft Geschichten. Eine ging so: Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte: Vater, gib mir mein Erbe! Der Vater teilte seinen ganzen Besitz unter den Söhnen auf. Der
Ergebnisse des Latinobarómetro 2003
 Diskussionspapier Forschungsgruppe Amerika Stiftung Wissenschaft und Politik Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit Ilona Laschütza Ergebnisse des Latinobarómetro 2003 Ludwigkirchplatz
Diskussionspapier Forschungsgruppe Amerika Stiftung Wissenschaft und Politik Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit Ilona Laschütza Ergebnisse des Latinobarómetro 2003 Ludwigkirchplatz
1.1 Glauben Sie, dass Deutschland alleine etwas 1.2 Sorgen Sie sich, dass Klimawandel zu mehr
 Internetumfrage auf DIE WELT Klima 1.1 Glauben Sie, dass Deutschland alleine etwas 1.2 Sorgen Sie sich, dass Klimawandel zu mehr gegen den Klimawandel ausrichten kann? extremen Wetterlagen in Deutschland
Internetumfrage auf DIE WELT Klima 1.1 Glauben Sie, dass Deutschland alleine etwas 1.2 Sorgen Sie sich, dass Klimawandel zu mehr gegen den Klimawandel ausrichten kann? extremen Wetterlagen in Deutschland
!!! Mein Gespräch mit dem Arzt
 Ist es Ihnen schon einmal so ergangen, dass Sie nach einem Arzttermin enttäuscht waren, weil Sie einiges nicht richtig verstanden haben? Oder hatten Sie eine besondere Frage auf dem Herzen, die Sie nicht
Ist es Ihnen schon einmal so ergangen, dass Sie nach einem Arzttermin enttäuscht waren, weil Sie einiges nicht richtig verstanden haben? Oder hatten Sie eine besondere Frage auf dem Herzen, die Sie nicht
