Arbeiten mit einem Bestimmungsschlüssel
|
|
|
- Innozenz Richter
- vor 2 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Arbeiten mit einem Bestimmungsschlüssel Die Abbildung zeigt Mitglieder verschiedener Familien. Mithilfe eines Bestimmungsschlüssels lassen sich die einzelnen Personen schnell ihren jeweiligen Familien zuordnen. Annika Tom Rudolf Lena Nils Kati Ralf Greta Lisa Tina Janosch Sven a Nase dick und rund... b Nase dünn... a Ohren groß... Familie Schmitt b Ohren klein... Familie Korn a lockige Haare... Familie Happel b glatte Haare... Familie Lenz 0 Ordne alle Comicfiguren einer der vier Familien zu. Familie Schmitt: Familie Korn: Familie Happel: Familie Lenz: 0 Für Familie Korn gibt es einen eigenen Bestimmungsschlüssel: Bestimme die Namen der Figuren: a männlich... b weiblich... a Lippen dick... b Lippen dünn... Erstelle nun selbst jeweils einen Bestimmungsschlüssel für die drei übrigen Familien. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustratorin: Ingrid Schobel, Hannover
2 Vielfalt bei Wirbeltieren ARBEITSBLATT Arbeiten mit einem Bestimmungsschlüssel Lösungen Familie Schmitt: Kati, Lena, Ralf, Tom Familie Korn: Annika, Greta, Rudolf Familie Happel: Janosch, Lisa Familie Lenz: Nils, Sven, Tina Bestimmungsschlüssel für Familie Korn a männlich Rudolf Korn b weiblich a Lippen dick Annika Korn b Lippen dünn Greta Korn Bestimmungsschlüssel für Familie Lenz a männlich b weiblich Tina Lenz a Schnurrbart Sven Lenz b kein Schnurrbart Nils Lenz Bestimmungsschlüssel für Familie Happel a männlich Janosch Happel b weiblich Lisa Happel Bestimmungsschlüssel für Familie Schmitt a männlich b weiblich a Muttermal Ralf Schmitt b kein Muttermal Tom Schmitt a Augen klein Kati Schmitt b Augen groß Lena Schmitt Differenzierende Aufgabe Erstelle einen Bestimmungsschlüssel für alle Comicfiguren. (Beispiel, andere Lösungen sind möglich) Bestimmungsschlüssel a männlich b weiblich 7 a Nase dünn b Nase dick 5 a Haare glatt 4 b Haare lockig Janosch 4a Schnurrbart Sven 4b kein Schnurrbart Nils 5a Ohren groß 6 5b Ohren klein Rudolf 6a Augen groß Tom 6b Augen klein Ralf Bestimmungsschlüssel 7a Nase dünn 8 7b Nase dick 9 8a Haare glatt Tina 8b Haare lockig Lisa 9a Augen groß 0 9b Augen klein 0a Ohren groß Lena 0b Ohren klein Annika a Lippen dick Kati b Lippen dünn Greta
3 Die Evolution der Wale Auf den ersten Blick ähnelt ein Wal zunächst den Fischen, mit denen er sich den großen Lebensraum Meer teilt. Er ist jedoch ein Säugetier, bei dem im Verlauf der Evolution Angepasstheiten an den Lebensraum Wasser entstanden sind. Mithilfe mehrerer Zwischenstufen kannst du die Evolution der Wale gut nachvollziehen: Ein entfernter Verwandter war wahrscheinlich Pakicetus, der ungefähr,75 Meter lang war und vor 50 Millionen Jahren lebte. Er hatte, wie die heutigen Flusspferde, verdickte Knochen. Diese deuten darauf hin, dass er sich häufig im Wasser aufgehalten hat, da sie der Verringerung des Auftriebs beim Waten auf dem Gewässergrund gedient haben könnten. Der nächste Vorfahr könnte der Ambulocetus gewesen sein. Er lebte ungefähr vor 47 Millionen Jahren, war 4,5 Meter lang und hatte einen ähnlichen Körperbau wie ein Krokodil. Hals und Schwanz waren kräftiger. Dies gab dem Körper im Wasser mehr Stabilität. Seine Beine waren kürzer und dienten dem Paddeln. Der nächste Verwandte Dorudon lebte vor etwa 40 Millionen Jahren. Seine Vorderextremitäten waren flossenartig und auch seine kräftige Wirbelsäule war ganz an das Leben im freien Wasser angepasst. Dorudon hatte einen stromlinienförmigen Körper. Er war 4,5 Meter lang und die Reste der Hinterbeine hatten keine Verbindung zum Becken mehr. Aus ihm entwickelten sich wahrscheinlich im Verlauf der vergangenen Millionen von Jahren die heutigen Wale: ein stromlinienförmiger Körper, verkümmerte Hinterextremitäten ohne eine Verbindung zum Becken, Vorderextremitäten als Flossen, eine kräftige Wirbelsäule und eine Länge von über 0 Metern. Name Hat vor Millionen Jahren gelebt Länge (m) Angepasstheiten an den Lebensraum Wasser Pakicetus (,75 m), vor etwa 50 Mio. Jahren 0 Erstelle in der Tabelle oben die erforderlichen Angaben zu den verschiedenen Tieren: Name, wann sie gelebt haben, wie lang sie waren und welche Angepasstheiten sie an ein Leben im Wasser besaßen. Informiere dich und beschreibe in deinem Heft, wie Lamarck und wie Darwin die Entwicklung der Wale begründet hätten. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustratoren: Otto Nehren, Achern Nora Wirth, Frankfurt
4 Belege für die Evolution ARBEITSBLATT Die Evolution der Wale Lösungen Pakicetus: vor 50 Mio. Jahren,,75 m Ambulocetus: vor 47 Mio. Jahren, 4,5 m Dorudon: vor 40 Mio. Jahren, 4,5 m Blauwal: heute lebend, über 0 m Pakicetus: Er hatte, wie die heutigen Flusspferde, verdickte Knochen. Diese können ein Hinweis darauf sein, dass er sich häufig im Wasser aufgehalten hat, da sie der Verringerung des Auftriebs beim Waten auf dem Gewässergrund gedient haben könnten. Ambulocetus: Ähnlicher Körperbau wie ein Krokodil. Sein Körper war stromlinienförmiger als der des Pakicetus. Sein Hals und sein Schwanz wurden kräftiger. Dies gab dem Körper im Wasser mehr Stabilität. Seine Beine wurden kürzer und kräftiger und dienten dem Paddeln im Wasser. Dorudon: Seine Vorderextremitäten waren flossenartig ausgebildet und auch seine kräftige Wirbelsäule war ganz an das Leben im freien Wasser angepasst. Er hatte einen stromlinienförmigen Körper. Er war 4,5 Meter lang und die Reste der Hinterbeine hatten keine Verbindung zum Becken mehr. Blauwal: Der stromlinienförmige Körper des Blauwals ähnelt sehr dem des Dorudon; er hat ebenfalls verkümmerte Hinterextremitäten ohne eine Verbindung zum Becken, seine Vorderextremitäten sind Flossen und seine Wirbelsäule ist sehr kräftig gebaut. Dies verleiht ihm im Wasser Stabilität. Er ist über 0 Meter lang. Lamarck: Durch ein vermehrtes Leben im Wasser werden die entsprechenden Organe (z. B. die Körperform) anders benutzt, sodass diese veränderte Fähigkeiten erhielten, die weitervererbt wurden. Andere Organe verkümmerten durch Nichtgebrauch (z. B. die Extremitäten). Darwin: Da Nachkommen natürlicherweise variabel sind, werden die Nachkommen überleben, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind. So verändern sich die Tiere im Verlauf der Evolution.
5 Wie gelangt die Nahrung aus dem Dünndarm in alle Körperregionen? Damit die Nahrungsbestandteile vom Dünndarm aufgenommen und über die Blutgefäße in alle Bereiche des Körpers gelangen können, müssen sie in kleinste Bausteine zerlegt werden. Die Innenwand des Dünndarms besitzt viele Falten, die mit winzigen Darmzotten besetzt sind. Jede Darmzotte wird von feinen Blutgefäßen, den Kapillaren, sowie Lymphgefäßen umgeben, sodass die Bausteine der Nahrung durch die Darmzotten in die verschiedenen Gefäße gelangen.. Fette - Fettsäuren - Glycerin Blutgefäß Lymphgefäß. Proteine - Proteine - kurze Aminosäurekette - Aminosäuren Dünndarm. Kohlenhydrate - Stärke - Maltose - Glucose Lymphgefäß Blutgefäß Vorgänge bei der Verdauung a b c Darmzelle d Bau des Dünndarms Erläutere mithilfe der Abb. und des Infotextes in deinem Heft die Vorgänge bei der Verdauung im Dünndarm. Beschrifte Abb.. Verwende dazu folgende Begriffe: Lymphgefäß, Mikrovilli, Darmzotte, Blutgefäß. Erläutere mithilfe der Abb. in deinem Heft, welche Bedeutung der Aufbau der Darmzotten im Dünndarm für den Verdauungsvorgang hat. Gehe hier besonders auf das Prinzip der Oberflächenvergrößerung ein. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustratoren: Matthias Balonier, Lützelbach Stefan Leuchtenberg, Augsburg Ingrid Schobel, Hannover
6 Ernährung und Verdauung ARBEITSBLATT Wie gelangt die Nahrung aus dem Dünndarm in alle Körperregionen? Lösungen Im Dünndarm werden alle Nährstoffe verdaut. Enzyme zerlegen dort Fette, Proteine und Kohlenhydrate in ihre Bausteine. Diese werden von den Zellen der Darmschleimhäute aufgenommen und über die Blut- und Lymphgefäße in den Körper transportiert. a Darmzotte b Mikrovilli c Blutgefäß d Lymphgefäß Durch die Auffaltung der Dünndarmwand in Darmzotten und Mikrovilli vergrößert sich die Oberfläche des Dünndarms extrem. Über diese große Kontaktfläche können die Bausteine der Nährstoffe schnell und effektiv in den Körper gelangen. Zusatzinformation Die Resorption im Dünndarm Vitamine, Mineralstoffe und die zerlegten Nährstoffe werden über den Dünndarm in das Blut aufgenommen. Dazu besitzt die Dünndarmschleimhaut eine fast 00 m große Oberfläche (ca. die Größe eines Tennisplatzes). In jeder Darmzotte verlaufen Blutgefäße, Lymphbahnen und Nervenfasern. Bei einigen Substanzen, z. B. beim Fruchtzucker (ein Einfachzucker), erfolgt der Transport passiv, also ohne Energieverbrauch durch Diffusion entlang einem Konzentrationsgefälle. Der weitaus größere Teil der Nährstoffe wird jedoch gegen das Konzentrationsgefälle befördert. Damit aber eine Substanz durch die Membran auf die Seite transportiert wird, auf der sie bereits höher konzentriert vorliegt, muss die Zelle Energie aus ihrem Stoffwechsel aufwenden. Deshalb wird dieser Vorgang auch als aktiver Transport bezeichnet. Beim aktiven Transport wird das zu transportierende Molekül zusammen mit einem Ion an bestimmten Poren durch die Zellwand transportiert. Ein Beispiel für einen aktiven Transport ist die Aufnahme von Glucose. Die Konzentration der Glucose im Darmlumen ist geringer als in den Darmwandzellen. Die Natrium-Ionen- Konzentration verhält sich genau gegenteilig. Bei dem freiwilligen Konzentrationsausgleich der Natrium-Ionen werden die Glucosemoleküle huckepack mit transportiert. Damit der Prozess nicht zum Erliegen kommt, muss die Natrium-Ionen-Konzentration in Darmwandzellen gering gehalten werden. So werden unter Energieverbrauch Natrium-Ionen wieder in das Darmlumen gepumpt, wobei gleichzeitig Kalium-Ionen in entgegengesetzter Richtung aus dem Darmlumen heraus transportiert werden. Während die Aminosäuren und die Zucker direkt vom Cytoplasma der Darmwandzellen in die Blutkapillaren übertreten, werden die Bestandteile der Fette (Glycerin und Fettsäuren) wieder zu vollständigen Fettmolekülen zusammengebaut, in Transportbläschen verpackt und in das Lymphsystem abgegeben. Da die Lymphbahnen sich später mit der oberen Hohlvene verbinden, gelangen auch die Fette in das Blut.
7 Der weibliche Zyklus Der weibliche Zyklus ist ein komplexer Kreislauf, der in der Hirnanhangdrüse (Hypophyse) beginnt, wenn dort die Hormone LH (Luteinisierendes Hormon) und FSH (Follikel stimulierendes Hormon) freigesetzt werden. FSH bewirkt das Heranreifen einer Eizelle in einer Hülle (Follikel). Im reifenden Follikel wird Östrogen gebildet. Die FSH-Bildung wird mit zunehmender Östrogen-Bildung gehemmt. Östrogen sorgt für die Verdickung der Gebärmutterschleimhaut. LH und FSH bewirken das Platzen des Follikels beim Eisprung. Nach dem Eisprung wird der Follikel zum Gelbkörper und produziert Progesteron. Wenn die Progesteron- Konzentration im Blut stark ansteigt, wird die Gebärmutterschleimhaut in ein sehr gut durchblutetes Gewebe mit Nährstoffeinlagerungen umgebaut und eine LH-Freisetzung gehemmt, sodass kein neuer Follikel heranreifen kann. Wenn keine Eizelle befruchtet wird, sinken die Östrogen- und Progesteron-Werte im Blut wieder, die Gebärmutterschleimhaut wird ausgestoßen und eine Menstruation findet statt. Hirnanhangsdrüse Auf den Eierstock wirkende Hormone Konzentration FSH LH Eierstock Entwicklung des Follikels Eisprung Auf die Gebärmutter wirkende Hormone von Follikel und Gelbkörper Konzentration Östrogen Progesteron Gebärmutter Menstruation Menstruation Gebärmutterschleimhaut Zyklustag Nenne den Bildungsort und die Wirkung des Hormons FSH. Bildungsort: Wirkung:. FSH und LH bewirken unter anderem die Ausschüttung von Östrogen im Eierstock. Erläutere, welche Auswirkungen es auf die Gebärmutterschleimhaut hätte, wenn FSH und LH nicht ausgeschüttet würden.. Erläutere, welche Auswirkungen es hätte, wenn LH nicht durch Progesteron gehemmt würde. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustrator: Prof. Jürgen Wirth, Dreieich
8 Sexualität und Schwangerschaft ARBEITSBLATT Der weibliche Zyklus Lösungen Bildungsort: Hirnanhangdrüse Wirkung: Reifung der Eizelle Es würde kein Progesteron gebildet und so würde die Gebärmutterschleimhaut nicht auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Eine befruchtete Eizelle könnte sich dort nicht einnisten und entwickeln. Dann würde zu früh ein weiterer Follikel mit einer Eizelle heranreifen und der Gelbkörper würde zu früh zurückgebildet. Praktische Tipps Zusatzinformation Zum Arbeitsblatt Das Arbeitsblatt sollte in einer Partnerarbeit bearbeitet werden, da es sich um komplizierte Sachverhalte und eine vielschichtige Abbildung handelt. So können die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Vorgänge bei befruchteter und unbefruchteter Eizelle Eizelle nicht befruchtet Eizelle befruchtet Gelbkörper verkümmert bildet Progesteron Gebärmutter Menstruationszyklus Follikel stimulierendes Hormon (FSH) Luteinisierendes Hormon (LH) Schleimhaut wird abgestoßen: Menstruation regelmäßig wiederkehrender Ablauf wird von der Hypophyse ausgeschüttet: Follikelreifung wird von der Hypophyse ausgeschüttet: Eisprung Schleimhaut wird weiter aufgebaut während der Schwangerschaft unterbrochen Progesteron und Östrogen hemmen die Ausschüttung von FSH Progesteron und Östrogen hemmen die Ausschüttung von LH Menstruationsstörungen und -beschwerden Menstruationsstörungen: Dazu zählt man: Die Periode kommt zu früh, zu spät oder bleibt aus. Die Blutung ist zu stark, sehr schwach oder es kommt zu Schmierblutungen. Als Ursachen können hierbei hormonelle oder organische Veränderungen infrage kommen. Doch besonders in der Pubertät sind diese Störungen meistens auf hormonelle Schwankungen zurückzuführen, solange bis sich der Zyklus eingespielt hat. Menstruationsbeschwerden: Bei vielen Frauen bringt die Menstruation einmal im Monat Unterleibskrämpfe, Schmerzen im Kopf oder Rücken, Schwindel oder Übelkeit mit sich. Während der Periode werden vermehrt Prostaglandin und Arachidonsäure produziert. Diese Hormone führen zu einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit und zu Kontraktionen der Gebärmutter. Das Zusammenziehen der Muskeln sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Aber auch Entzündungen der Eileiter, der Gebärmutter oder Myome können Regelschmerzen hervorrufen. Bei ständigen, sehr schmerzhaften Menstruationen sowie starken Blutungen sollte daher ein Arzt konsultiert werden. Zur Linderung nicht krankhafter Menstruationsbeschwerden können Stressabbau, Entspannungsübungen oder eine Ernährungsumstellung neben dem Einsatz von homöopathischen Mitteln wie z. B. Tees oder Medikamente helfen.
9 Der Stoffkreislauf des Waldes Du hast bereits gelernt, dass es in einem Ökosystem Produzenten, Konsumenten und Destruenten gibt. Wenn zum Beispiel eine Maus von einem Waldkauz gefressen wird, dann gehört das zum Kreislauf des Lebens. In so einem Kreislauf gibt es keine Abfallprodukte. Produzenten, Konsumenten und Destruenten sorgen gemeinsam dafür, dass die Biomasse ständig wieder verwertet wird. Damit diese Zusammenhänge im Ökosystem Wald deutlich werden, sollte Andreas als Hausaufgabe einen Text über den Stoffkreislauf im Wald schreiben. Leider hat er in diesem Text 0 Fehler gemacht. Der Stoffkreislauf des Waldes Alle Pflanzen im Wald, wie Bäume, Sträucher oder Kräuter, erzeugen mithilfe der Sonnenenergie aus Glucose, Wasser und Mineralstoffen große Mengen an organischen Stoffen. Das sind Holz, Blätter, Nadeln oder Früchte. Dadurch wird der größte Teil des Kohlenstoffdioxids durch die Zellatmung als Biomasse gebunden. Durch die Fotosynthese wird ein kleiner Teil an Sauerstoff nachts von den Pflanzen wieder ausgeatmet und so der Luft wieder zugeführt. Von den Pflanzen ernähren sich die Konsumenten. Ordnung, wie z. B. Mäuse oder Buntspechte. Pflanzenfresser dienen den Konsumenten. Ordnung (z. B. Waldkauz, Fuchs) als Nahrungsquelle. So nehmen sie das organische Material auf, das sie zum Überleben brauchen. Die organischen Reste, wie z. B. Kot oder tote Tiere/Pflanzen, werden von den Produzenten zersetzt. Kohlenstoffdioxid Sauerstoff Weg der Stoffe pflanzliche Biomasse (Nähr- und Mineralstoffe) Einige organische Substanzen werden von Bakterien und Pilzen zu anorganischen Verbindungen wie Mineralstoffe und Stärke abgebaut, die für die Produzenten zur Fotosynthese wichtig sind. Sowohl Destruenten als auch Produzenten atmen Kohlenstoffdioxid wieder aus. Damit schließt sich der Stoffkreislauf. In einem funktionierenden Ökosystem geht manchmal ein Stoff verloren. Produzenten Zellatmung Mineralstoffe und Wasser tote Biomasse (Nähr- und Mineralstoffe) Luft Zellatmung Destruenten Boden Mineralstoffe und Wasser Fotosynthese Zellatmung tote Biomasse (Nähr- und Mineralstoffe) Konsumenten Urin (Mineralstofffe und Wasser) Andreas' Hausaufgabe zum Kreislauf der Stoffe Lies dir Andreas' Text gut durch und markiere alle Fehler, die du findest. Korrigiere die Fehler mithilfe der Abbildung und schreibe den korrigierten Text in dein Heft. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustrator: Otto Nehren, Achern
10 Lebensgemeinschaft Wald ARBEITSBLATT Der Stoffkreislauf des Waldes Lösungen und Alle Pflanzen im Wald, wie Bäume, Sträucher oder Kräuter, erzeugen mithilfe der Sonnenenergie aus Kohlenstoffdioxid, Wasser und Nährstoffen große Mengen an organischen Stoffen. Das sind Holz, Blätter, Nadeln oder Früchte. Dadurch wird der größte Teil des Kohlenstoffdioxids durch die Fotosynthese als Biomasse gebunden. Durch die Zellatmung wird ein kleiner Teil an Kohlenstoffdioxid nachts von den Pflanzen wieder ausgeatmet und so der Luft wieder zugeführt. Von den Pflanzen ernähren sich die Konsumenten. Ordnung, wie z. B. Mäuse oder Insekten. Pflanzenfresser dienen den Konsumenten. Ordnung (z. B. Waldkauz, Fuchs) als Nahrungsquelle. So nehmen sie das organische Material auf, das sie zum Überleben brauchen. Die organischen Reste, wie z. B. Kot oder tote Tiere/Pflanzen, werden von den Destruenten zersetzt. Einige organische Substanzen werden von Bakterien und Pilzen zu anorganischen Verbindungen wie Mineralstoffe und Wasser abgebaut, die für die Produzenten zur Fotosynthese wichtig sind. Sowohl Destruenten als auch Konsumenten atmen Kohlenstoffdioxid wieder aus. Damit schließt sich der Stoffkreislauf. In einem funktionierenden Ökosystem geht kein Stoff verloren. Praktische Tipps Zum Arbeitsblatt Das Arbeitsblatt Der Stoffkreislauf des Waldes kann gut in Partnerarbeit bearbeitet werden. So können die Partner die gefundenen Fehler vergleichen. Zur Sicherung der Lösungsergebnisse sollten Sie das Arbeitsblatt auf Folie ziehen und die Fehler markieren. Zusatzinformation Stoffkreisläufe Kohlenstoff-Sauerstoffkreislauf und Energiefluss sind gekoppelt über die Fotosynthese und Zellatmung; beide Kreisläufe gehen über Atmosphäre, Gewässer und Festland. Der Stickstoffkreislauf beginnt mit der Fixierung des atmosphärischen Stickstoffs; daran ist eine Vielzahl von Bodenbakterien beteiligt. Durch intensive Bewirtschaftung wird der Stickstoffkreislauf in zweierlei Weise beeinflusst: Bestimmte Bereiche werden stickstoffarm durch die Abfuhr großer Biomassebeträge bei der Ernte und ihre Remineralisierung durch die Destruenten an anderen Orten. Damit wird dann eine intensive N-Düngung der Agrarflächen erforderlich wodurch wieder z. B. über den Wasserkreislauf viel Stickstoff in Bereiche gelangt, wo er eigentlich nicht benötigt wird (Kunstdünger führt zur Nährstoffübersättigung in Gewässern). Der Phosphorkreislauf hat kein Reservoir in der Atmosphäre, sondern folgt vom Festland ins Meer dem Wasserkreislauf. Wichtige Reservoire sind Gesteine und natürliche Phosphatvorkommen. Ein Teil wird im Nährstoffkreislauf weitergegeben. Hieraus ergibt sich auch ein geringer Teil der Phosphatgewinnung durch Guano-Abbau. Phosphor gelangt nach Erosion, Auswaschung oder Sedimentation schnell in biologisch nicht weiter zu nutzende Meeressedimente. Ein lokaler Vorrat kann rasch erschöpft sein. Das unlösliche Phosphat muss dann über die marinen Nahrungsketten (zuletzt durch Fisch fressende Vögel) wieder emporgebracht werden. Die Eingriffsmöglichkeiten des Menschen sind in einem Ablagerungskreislauf vielfältig (Guanogewinnung, Phosphatanreicherung in Gewässern über Düngung und Waschmittel). Ablagerungskreisläufe gibt es auch für Eisen, Calcium, Kalium und Magnesium. Der Schwefelkreislauf ist ein kombinierter Kreislauf mit einer Sediment- und einer Gasphase. An ihm sind in großem Umfang Mikroorganismen beteiligt. Erhebliche menschliche Eingriffe erfolgen über die Verbrennung fossiler Energieträger und über den Eintrag schwefelhaltiger, gasförmiger und flüssiger Substanzen aus den Kohlebergwerken. Zusatzaufgabe Die Schülerinnen und Schüler können sich eigene Darstellungsformen des Stoffkreislaufs in einer Gruppenarbeitsphase überlegen und, mit Abbildungsbeispielen aus der Tier- und Pflanzenwelt versehen, auf Plakaten darstellen.
11 Einfluss des Kohlenstoffdioxids Mit dem folgenden Versuch kannst du den Einfluss des Kohlenstoffdioxids auf die Fotosyntheseaktivität der Wasserpest untersuchen. Da sich die fotosynthetische Aktivität über die Produkte der Fotosynthese (Sauerstoff, Glucose bzw. Stärke) nachweisen lässt, kannst du bei der Wasserpest die Fotosyntheseaktivität einfach mithilfe der Anzahl der aus dem Spross tretenden Sauerstoffbläschen bestimmen. Du brauchst dazu Ein großes Reagenzglas (Ø 0mm), Schere, Uhr, Leitungswasser, Mineralwasser (medium), abgekochtes Wasser, Trieb der Wasserpest (in Wasser aufbewahrt), Lampe Durchführung. Ein Reagenzglas wird mit Leitungswasser gefüllt.. Das Ende eines Triebes der Wasserpest wird noch im Aufbewahrungsbecken unter Wasser mit einer Schere schräg angeschnitten. Erst anschließend wird der Trieb vorsichtig (mit der Schnittstelle nach oben) in das Reagenzglas überführt.. Die Lampe wird eingeschaltet, ca. 0 cm vor das Reagenzglas gestellt und der Versuchsaufbau wird für 5 min beleuchtet. 4. Die Anzahl der Bläschen, die aus dem angeschnittenen Sprossende entweichen, werden jeweils dreimal eine Minute lang gezählt. Wasser Wasserblasen Stiel nach oben mit schräg angeschnittener Fläche Wasserpest 5. Anschließend wird das Wasser weggeschüttet und der Versuch mit abgekochtem Wasser bzw. Mineralwasser und demselben Trieb wiederholt. Warte jeweils eine Minute, bevor du mit dem Zählen beginnst! Gruppe Versuch mit Leitungswasser (Bläschenzahl pro min) Versuch mit abgekochtem Wasser (Bläschenzahl pro min) Versuch mit Mineralwasser (Bläschenzahl pro min) Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Notiere deine Beobachtungen in der Tabelle und ergänze anschließend die Ergebnisse deiner Mitschüler oder Mitschülerinnen. Vergleiche die durchschnittlichen Werte der drei verschiedenen Versuchsansätze miteinander und deute die Beobachtungen. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustrator: Wolfgang Herzig, Essen
12 Pflanzen betreiben Fotosynthese ARBEITSBLATT Einfluss des Kohlenstoffdioxids Lösungen Gruppe Versuch mit Leitungswasser (Bläschenzahl pro min) Versuch mit abgekochtem Wasser (Bläschenzahl pro min) Versuch mit Mineralwasser (Bläschenzahl pro min),, 0, 0, 0 00, 0, 00,, 0, 0, 0 45, 45, 8 4, 4, 0, 0, 0 4,, 5 4,, 5 0, 0, 0, 4, 5 5 8, 8, 5 0, 0, 0, 6, 9 6 5, 4, 0, 0, 0 86, 95, 7 5, 5, 4 0, 0, 0 4, 5, 8 8 7, 6, 5 0, 0, 0 5, 90, 0 (Anmerkung: Die Zahlen stammen aus selbst durchgeführten Schülerversuchen.) Vergleich: In den Versuchen mit Mineralwasser ist die Bläschenzahl deutlich höher als in den Versuchen mit Leitungswasser. In den Versuchen mit abgekochtem Wasser bilden sich gar keine Bläschen. Deutung: Die Sauerstoffproduktion ist abhängig vom Kohlenstoffdioxidangebot/ gehalt des Wassers. Je mehr Kohlenstoffdioxid vorhanden ist, desto höher ist die Sauerstoffproduktion bzw. die Fotosyntheserate. (Anmerkung: Leitungswasser enthält nur wenig Kohlenstoffdioxid, abgekochtes Wasser gar keines. Mineralwasser wird mit Kohlenstoffdioxid versetzt). Differenzierende Aufgabe Sollte es nicht möglich sein, den Versuch durchführen zu lassen, können Sie auch obige Ergebnistabelle vorgeben und auswerten lassen. Praktische Tipps Nachweis von Kohlenstoffdioxid (CO ) und Sauerstoff (O ) Sie können vor der Durchführung des Versuchs mithilfe von Kalkwasser zeigen, dass in den bei den Versuchen verwendeten Wasserproben unterschiedlich viel CO vorhanden ist. Sauerstoff Wasser Sprosse von Wasserpest Sollte den Schülerinnen und Schülern nicht klar sein, dass es sich bei den Bläschen, die aus den Trieben der Wasserpest entweichen, um Sauerstoff handelt, können Sie dies mit einem Zusatzversuch zeigen: Nehmen Sie ein großes mit Wasser gefülltes Becherglas und stellen Sie einen Trichter hinein, unter dem sich einige Triebe der Wasserpest befinden (eventuell müssen Sie die Triebe mit einer Büroklammer beschweren, damit sie auf dem Boden des Glases stehen bleiben). Stülpen Sie über den Stiel des Trichters ein Reagenzglas (es darf keine Restluft im Glas sein) und lassen Sie den Versuchsaufbau einige Tage bei guter Beleuchtung stehen. Sie können Ihren Schülerinnen und Schülern z. B. den Versuchsaufbau demonstrieren und dann einen zweiten Versuchsaufbau, der schon einige Tage stand, zeigen. Nehmen Sie nun das Reagenzglas ab (da Sauerstoff schwerer als Luft ist, drehen Sie es schnell um), und halten Sie einen Glimmspan hinein. Die deutlich positive Glimmspanprobe zeigt, dass sich in dem Reagenzglas Sauerstoff angereichert hat. Zusatzinformation Kohlenstoffdioxid und Fotosyntheserate Der Kohlenstoffdioxid Anteil am Gesamtvolumen der Luft liegt bei 0,04 %. Dieser Wert liegt meist deutlich unter dem Optimum der Fotosyntheserate der Pflanzen. Daher wird z. B. in manchen Gewächshäusern der Kohlenstoffdioxidgehalt durch Begasung auf 0, % erhöht, was ungefähr zu einer Verdreifachung der Fotosyntheserate der Pflanzen führt (s. Abb.). Fotosyntheserate (%) ,04 0, CO -Konzentration (%) Illustrator: Wolfgang Herzig, Essen
13 Sehfehler können behoben werden Viele Menschen müssen eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, um scharf sehen zu können. Wenn du allerdings durch die Brille eines Freundes schaust, siehst du vermutlich alles verschwommen, selbst dann, wenn du ebenfalls eine Fehlsichtigkeit hast. Erst ein Augenarzt kann die bei dir vorliegende Art und Stärke der Fehlsichtigkeit herausfinden, um dann eine genau für dich passende Sehhilfe auswählen zu können. entfernter Gegenstand Bild unscharf naher Gegenstand Bild unscharf Streulinse Sammellinse Bild scharf Bild scharf Kurz- und Weitsichtigkeit Gegenstandsweite Bildweite Weitsichtigkeit Weitsichtigkeit mit Brillenglas korrigiert Kurzsichtigkeit Kurzsichtigkeit mit Brillenglas korrigiert Bildweite bei starrer Linse Akkommodation zur Regulation der Bildweite 4 Augapfel bei Sehfehler 5 Korrektur der Sehfehler Scharfes Sehen wie funktioniert das? Abbildung : Wenn sich eine optische Linse nicht verformen kann, werden Gegenstände weiter scharf abgebildet, Gegenstände weiter. Die Bildweite je nach Gegenstandsweite. Die Netzhaut ist im Auge aber immer an der gleichen Stelle im Augapfel, sprich in gleichem Abstand von der Linse entfernt. Damit der Mensch einen Gegenstand scharf wahrnehmen kann, muss ein Gegenstand aber genau auf der abgebildet werden. Wie können wir aber trotzdem sowohl nahe als auch ferne Gegenstände scharf sehen? Abbildung : Durch den Vorgang der wird die Linse, und damit die Brechung (Brennweite) je nach Situation verändert. Ist die Linse gekrümmt, verkürzt sich die Bildweite, Gegenstände können auf der Netzhaut abgebildet und scharf gesehen werden. Ist die Linse, können Gegenstände scharf auf der Netzhaut abgebildet werden. Betrachte die Abbildungen und. Informiere dich und ergänze dann den Informationstext zum scharfen Sehen.. Beschreibe die Besonderheiten des Augapfels bei Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit (Abb. 4) und erkläre den Zusammenhang zum jeweiligen Seheindruck (Abb. ) in deinem Heft. Gib an, wie die jeweiligen Sehfehler mithilfe von speziellen Linsen korrigiert werden können. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustratoren: Matthias Balonier, Lützelbach Wolfgang Herzig, Essen
14 Das Auge und das Ohr des Menschen ARBEITSBLATT Sehfehler können behoben werden Lösungen Abbildung : Wenn sich eine optische Linse nicht verformen kann, werden nahe Gegenstände weiter hinten scharf abgebildet, entfernte Gegenstände weiter vorne. Die Bildweite variiert je nach Gegenstandsweite. Die Netzhaut ist im Auge aber immer an der gleichen Stelle im Augapfel, sprich in gleichem Abstand von der Linse entfernt. Damit der Mensch einen Gegenstand scharf wahrnehmen kann, muss ein Gegenstand aber genau auf der Netzhaut abgebildet werden. Wie können wir aber trotzdem sowohl nahe als auch ferne Gegenstände scharf sehen? Abbildung : Durch den Vorgang der Akkommodation wird die Linse unterschiedlich stark gekrümmt (bzw. verändert) und damit die Brechung (Brennweite) je nach Situation verändert. Ist die Linse stärker gekrümmt, verkürzt sich die Bildweite, sehr nahe Gegenstände können auf der Netzhaut abgebildet und scharf gesehen werden. Ist die Linse abgeflacht, können weit entfernte Gegenstände scharf auf der Netzhaut abgebildet werden. Bei Weitsichtigkeit ist der Augapfel zu kurz (die Netzhaut zu weit vorne), d. h. nahe Gegenstände, die normalerweise durch Akkommodation noch auf der Netzhaut scharf gestellt werden könnten, erscheinen unscharf, da das Bild hinter der Netzhaut entstehen würde. Die Krümmung der Linse reicht bei nahen Gegenständen nicht aus. Weit entfernte Gegenstände können scharf gesehen werden, da bei diesen das scharfe Bild weiter vorne, also noch auf der Netzhaut, erzeugt werden kann (die Bildweite ist bei weit entfernten Gegenständen kürzer). Bei Kurzsichtigkeit ist der Augapfel zu lang (die Netzhaut zu weit hinten, d. h. entfernte Gegenstände, die normalerweise durch Akkommodation noch auf der Netzhaut scharf gestellt werden könnten, erscheinen unscharf. Nahe Gegenstände können scharf gesehen werden, da bei diesen das scharfe Bild weiter hinten, also noch auf der Netzhaut, erzeugt werden kann (die Bildweite ist bei nahen Gegenständen länger). Korrektur der Weitsichtigkeit: Es werden Sammellinsen eingesetzt. Diese bündeln die Lichtstrahlen stärker, d. h. sie erhöhen die Brechkraft der Linse. Durch die stärkere Krümmung können auch nahe Gegenstände auf der Netzhaut abgebildet werden. Korrektur der Kurzsichtigkeit: Es werden Zerstreuungslinsen eingesetzt. Die Lichtstrahlen werden weniger stark gebündelt und erzeugen bei weit entfernten Gegenständen weiter hinten ein scharfes Bild, d. h. bei dem zu langen Augapfel nun korrekt auf der Netzhaut. Zusatzinformation Fehlsichtigkeiten Altersweitsichtigkeit (Presbyopie): Mit steigendem Alter nimmt die Eigenelastizität der Augenlinse ab. Sie verliert dadurch nach und nach ihre Fähigkeit, sich beim Zusammenziehen des Ziliarmuskels, wodurch auch die Zonulafasern entspannt werden, zu krümmen. Astigmatismus (Stabsichtigkeit): Aufgrund einer Hornhautverkrümmung (oder Linsenverkrümmung) kommt es zu einer Verzerrung des Bildes: Punkte werden als Striche wahrgenommen. Makuladegeneration: Kommt es vor allem altersbedingt zu Veränderungen in der Makula (Gelber Fleck, Stelle des schärfsten Sehens) der Netzhaut, kann dies bis zum Erblinden führen. Auch genetische Disposition und Rauchen kann einen Einfluss auf das Entstehen einer Makuladegeneration haben. Verschiedene Zellen der Netzhaut sterben ab, und es entstehen z. B. Vernarbungen oder es kommt zu Einblutungen. Grauer Star (Katarakt, griech. Wasserfall: Altersweitsichtigkeit unscharfes Netzhautbild Normalsichtigkeit Aufgrund des wasserfallartigen Seheindrucks des Erkrankten wird alles wie durch einen Schleier gesehen.) Vorwiegend altersbedingt kann die Linse eintrüben und erscheint dann weißlich hinter der Pupille. Aber auch andere Ursachen sind möglich (z. B. eine Rötelninfektion in der Schwangerschaft kann zu einem Katarakt beim Baby führen). Durch die Einpflanzung einer künstlichen Linse kann dieser Sehfehler gut behoben werden. Grüner Star (Glaukom, von griech. glaukos: graubläulich verfärbte Regenbogenhaut): Hierbei handelt es sich um eine gefährliche Erkrankung, die oft spät bemerkt wird und zur vollständigen und akut auftretenden Erblindung führen kann. Grüner Star entsteht durch eine Schädigung des Sehnervs, meistens aufgrund eines erhöhten Augeninnendrucks infolge von schlecht abfließendem Kammerwasser. Erst bei Fortschreiten der Krankheit werden Gesichtsfeldausfälle bemerkt. Ab dem 40. Lebensjahr sollte man deshalb regelmäßig den Augeninnendruck von einem Augenarzt kontrollieren lassen. M scharfes Netzhautbild Illustrator: Jörg, Mair, München
15 Das Sarkomer Grundbaustein der Skelettmuskulatur Betrachtet man das Präparat eines Skelettmuskels unter dem Lichtmikroskop, so kann man Muskelfasern erkennen, die eine auffällige Querstreifung zeigen. Bei noch stärkerer Vergrößerung unter dem Elektronenmikroskop erkennt man die Grundbausteine der Muskelfasern, die Muskelfibrillen, die aus Sarkomeren bestehen. Sarkomer Bei den Sarkomeren handelt es sich um etwa,5 µm ( mm = / 000 mm) große Eiweißzylinder. Ein Sarkomer besteht hauptsächlich aus den Eiweißen Actin und Myosin. Das Myosin besitzt an seiner Oberfläche unzählige gelenkige Köpfchen. Wird ein Muskel vom Nervensystem erregt, zieht er sich zusammen. Diese Arbeit verrichten die Myosinköpfchen, indem sie eine Nickbewegung ausführen und die Actinfilamente dabei verschieben. Z-Scheibe Actin Myosin 0 Die Abbildung links zeigt den Ausschnitt aus einer Muskelfibrille in Ruhe und nachdem die Myosinköpfchen die Nickbewegung durchgeführt haben. Zeichne die beiden Abbildungen auf einem Blatt nach rechts weiter. Man stellt sich vor, dass die Verschiebung der Actinfilamente nach dem Tauzieh-Prinzip (Abbildung rechts) zustande kommt. Erläutere. Wenn du deinen Arm anwinkelst, wird der Armbeuger nicht nur härter, sondern auch dicker. Betrachte die Form der Sarkomere in Ruhelage und nach der Verkürzung genau. Erkläre die Verformung des Armbeugers. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustrator: Jörg Mair, München
16 Bewegung durch Muskeln ARBEITSBLATT Das Sarkomer Grundbaustein der Skelettmuskulatur Lösungen Die Myosinköpfchen ziehen an den Actinstäbchen und da die Enden der Myosinfilamente gegensinnig orientiert sind, bewegen sich die Actinstäbchen aufeinander zu. Ein Sarkomer wird bei der Verkürzung dicker. Die Summe der Einzelverkürzungen führt zu einer Verdickung des Muskels. Zusatzinformation Wissenswertes zu Muskeln Muskulatur: Die Hälfte der Körpermasse eines Menschen besteht aus Muskeln. Insgesamt gibt es mehr als 600 verschiedene Muskeln, die in zwei Gruppen unterteilt werden: Die Skelettmuskulatur oder auch willkürliche Muskulatur, die Eingeweidemuskulatur oder auch unwillkürliche Muskulatur, da sie sich nicht willentlich beeinflussen lässt. Sie findet man z. B. in der Magen- und Darmwand oder als Herz und in den Blutgefäßen. Muskelkater: Nach ungewohnten größeren Anstrengungen können Muskelschmerzen und -versteifungen auftreten. Sie treten nach ca. Stunden auf und gehen nach bis 5 Tagen zurück. Schmerzen spürt man nur dann, wenn der betroffene Muskel bewegt wird. Muskelkater entsteht nach heutiger Lehrmeinung nicht durch Milchsäureansammlung im Gewebe bei anaerober Muskelarbeit, denn nach Belastungsende müsste der Muskelkater vorüber sein, wenn die Milchsäure abgebaut ist. Man nimmt deswegen auch an, dass seine Ursachen in kleinsten Verletzungen auf Zellebene zu suchen sind. Muskelzerrung: Überdehnung einzelner Muskelfasern; durch Kapillarrisse dringt Blut in das Gewebe. Symptome: plötzlich einschießender Schmerz, eingeschränkte Funktionsfähigkeit. Therapie: Entlastung des Muskels eine Woche lang. Muskelanriss: Riss mehrerer Muskelfasern. Symptome: plötzlicher, messerartiger einschießender Schmerz mit sofortigem Funktionsausfall, Druckschmerz. Therapie: gegebenenfalls operatives Annähen der Fasern. Muskelriss: Alle Fasern eines Muskels sind durchtrennt, zu den oben genannten Symptomen kann man zuweilen über der Rissstelle eine Eindellung tasten. Therapie: Operatives Annähen der Fasern. Sportfähigkeit erst nach drei Monaten. Geräusche erzeugende Muskeln: Tiere erzeugen Geräusche oft mit Muskeln und anatomischen Strukturen der Atmungsorgane ( Muh der Kühe oder Miau der Katzen). Viele Tiere besitzen aber auch eigene Geräuschorgane mit Muskeln, die auf besonders hochfrequente Kontraktionen spezialisiert sind: Das Klapperorgan im Schwanz einer Klapperschlange besitzt Muskeln, die hundertmal pro Sekunde (also mit 00 Hz) kontrahieren, Zikaden biegen einen Teil ihres Außenskeletts mit mehr als 00 Hz. Die beteiligten Muskeln arbeiten dabei zehnmal schneller als die schnellsten Muskeln aus dem Fortbewegungssystem. Der molekulare Mechanismus in diesen spezialisierten Muskeln ist vergleichbar dem der Skelettmuskeln.
17 Nachweis der Elternschaft Da sich Neugeborene häufig sehr ähnlich sehen, kommt es leider hin und wieder einmal vor, dass sie vertauscht werden oder die Zugehörigkeit zu den Eltern nicht mehr sicher ist. In solchen Fällen hat man früher einen Blutgruppenvergleich bei den Eltern und Kindern durchgeführt. Dieser war aber nicht immer eindeutig, da mit der Blutgruppe und dem Rhesusfaktor Merkmale bestimmt werden, die nur wenige Kombinationsmöglichkeiten zulassen. Heute kann man in einem solchen Fall einen genetischen Fingerabdruck von den Eltern und dem Neugeborenen anfertigen, bei dem verschiedene Marker der DNA verglichen werden. M M M K K K V V V Genetische Fingerabdrücke (dargestellt sind verschiedene DNA-Marker in Form von Bandenmuster auf einem Agarose-Gel) In der Abbildung oben siehst du die genetischen Fingerabdrücke von jeweils drei Müttern (M M ), drei Kindern (K K ) und drei Vätern (V V ). Informiere dich und erkläre, wie man herausfinden kann, welche Eltern zu welchem Kind gehören. Ordne nun in der Abbildung oben den Kindern ihre Eltern zu. Dabei bilden jeweils Mutter und Vater mit der gleichen Nummer ein Ehepaar (z. B. M und V ). Gehe dabei folgendermaßen vor: Schreibe links neben die Banden des Kindes die Zahl der Mutter, mit der die jeweilige Bande übereinstimmt, und rechts die Zahl des Vaters. K K K Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustrator: Wolfgang Herzig, Essen
18 Verfahren in der Anwendung ARBEITSBLATT Nachweis der Elternschaft Lösungen Bei dem genetischen Fingerabdruck des Kindes muss jeweils ein Marker von der Mutter und einer von dem Vater stammen. Zunächst markiert man im genetischen Fingerabdruck des Kindes alle Marker, die von der Mutter stammen könnten. Die restlichen Marker müssen dann von seinem Vater stammen, man muss also einen Vater finden, der diese Marker alle besitzt. K : M =, M =, M = Übereinstimmungen Mutter ist also M, eine Überprüfung mit V bestätigt dies. K : M =, M = 0, M = Übereinstimmungen Mutter M ist also am wahrscheinlichsten, eine Überprüfung mit V bestätigt dies. K : M = 0, M =, M = Übereinstimmungen Mutter ist also M, V kann allerdings nicht der leibliche Vater sein. M M M K K K V V V Praktische Tipps Zusatzinformation Erstellen eines genetischen Fingerabdrucks Sie können mit Ihren Schülerinnen und Schüler selbst genetische Fingerabdrücke erstellen. Viele Lehrmittelfirmen bieten hierzu fertige Experimentier-Kits an, mit denen man genetische Fingerabdrücke in Form von Bandenmustern auf einem Agarose-Gel erzeugen kann. (Leider sind diese Kits nicht ganz billig, besonders wenn Sie auch noch eine Gelelektrophoresekammer benötigen.) Interessante oder aus der Presse bekannte Anwendungen des genetischen Fingerabdrucks Forensik ( Gerichtsverfahren ) Der Fall Moshammer. Die Identifikation der Kinderleichen von Levke und Felix. Die Identifikation der Leichen bei Flugzeugabstürzen oder beim Zusammensturz des World Trade Centers bzw. in den Massengräbern bei Screbrenica. Der Fall von O. J. Simpson. Der Spermafleck von Bill Clinton auf dem Kleid seiner Praktikantin Monica Lewinsky. Vaterschaftstest bei vermeintlichen Kindern von Prominenten (z. B. Boris Becker). Ancient DNA (a-dna) Die Identifikation der Skelette der Romanovs, insbesondere Anastasias. Die Verwandtschaft der ca. 000 Jahre alten Skelette der Lichtensteinhöhle mit alteingesessenen Einwohnern von Osterode. Die Untersuchung der angeblichen Gebeine und des Schädels von Friedrich Schiller. Die Skelett-Protese des linken Arms von Herzog Christian dem II von Braunschweig- Wolfenbüttel. Zusatzaufgabe Stelle eine Hypothese auf, warum der genetische Finderabdruck von Vater nicht zu dem des Kindes K passt. Vater kann nicht der leibliche Vater seines Kindes sein. Lösung: Vielleicht ist die Mutter ohne des Wissens des Vaters fremdgegangen, vielleicht hat die Mutter aber auch eine Samenspende erhalten (z. B. weil der Vater Träger einer genetischen Krankheit oder unfruchtbar ist). Illustrator: Wolfgang Herzig, Essen
19 Klima im Wandel Sicher weißt du, dass seit der Entstehung der Erde sich ihr Klima ständig ändert, Warmzeiten und Eiszeiten wechseln sich ab. Eine Veränderung des Klimas über einen langen Zeitraum wird als Klimawandel bezeichnet. Sehr viele verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle. Zu den natürlichen Ursachen eines Klimawandels gehören beispielsweise Änderungen der Erdumlaufbahn um die Sonne und damit verbundene Änderungen bei der Sonneneinstrahlung, Vulkanismus, Veränderungen der Meeresströmungen und der natürliche Treibhauseffekt. Der sogenannte natürliche Treibhauseffekt ermöglicht das Leben auf der Erde, indem er ein Auskühlen unseres Planeten verhindert. In der Atmosphäre befinden sich unter anderem Wasserdampf (auch in Form von Wolken) und Kohlenstoffdioxid sowie Methan. Diese Gase verhindern zum Teil die Rückstrahlung der von der Sonne auf die Erde ein- Sonnenlicht Wärmestrahlung 8 C ohne Atmosphäre Strahlungsbilanz der Erde natürlicher Treibhauseffekt Absorbtion durch Treibhausgase +4 C wirkenden Energie ins Weltall. Je höher die Konzentration an solchen Gasen ist, umso stärker wirkt der Treibhauseffekt. Zu den natürlichen Einflüssen kommen durch den Menschen verursachte Einflüsse (zusätzlicher Treibhauseffekt), die einen Klimawandel beschleunigen oder in ihrer Summe sogar hervorrufen können. Eine starke Erwärmung der Erde hat für Mensch und Umwelt viele negative Folgen. Wärmestrahlung (kurzwellig) Wärmestrahlung (langwellig) Erwärmung der Erdoberfläche und Abgabe langwelliger Wärmestrahlung Rückhaltung eines Teils der Wärmestrahlung durch Treibhausgase Auswirkungen Schmelzen von Gletschern und Polkappen Anstieg des Meeresspiegels und Überflutung der Küstenregionen Verstärkung des Treibhauseffekts durch zunehmende Wasserverdunstung Zunahme von Stürmen und Unwettern Abtragung fruchtbaren Bodens durch Erosion Ausbreitung von Dürregebieten CO CH 4 CO CH 4 CO N O FCKW CH 4 N O Viehzucht Verbrennungsprozesse Gewinnung von Erdöl, Gas, Kohle Ursachen Chemische und Elektroindustrie Anbau von Reis, Stickstoffdüngung Zusätzlicher Treibhauseffekt Ursachen und Folgen Erkläre anhand der Abb. und des Textes die Entstehung und Auswirkung des natürlichen Treibhauseffekts. In Abb. sind die Einflüsse des Menschen auf den Treibhauseffekt und die möglichen Folgen einer Erwärmung der Erde dargestellt. Erläutere in deinem Heft die Abbildung mit den zu erwartenden Auswirkungen für den Menschen. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustratoren: Ingrid Schobel, Hannover Wolfgang Herzig, Essen
20 Evolution des Menschen ARBEITSBLATT Klima im Wandel Lösungen Natürlicher Treibhauseffekt: Die Erdoberfläche wird durch Sonnenstrahlen erwärmt. Ein Großteil der Lichtenergie wird als Wärmeenergie von der Erde (bzw. von der erwärmten Erdoberfläche und der erwärmten Luft) wieder in den Weltraum zurückgestrahlt. Die Atmosphäre lässt die Sonnenstrahlen gut durch, die von der Erde wieder abgegebene Wärmeenergie wird jedoch zum Teil von den Gasen in der Atmosphäre absorbiert. Daher wird die Erde warm gehalten. Der natürliche Treibhauseffekt ermöglicht überhaupt erst das Leben auf der Erde, wie wir es kennen. Der Mensch produziert durch Heizungen, Autoabgase, Industrieabgase und Ähnliches verstärkt Treibhausgase, wie Kohlenstoffdioxid und Methan. Die Zunahme an Treibhausgasen verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt, und die Erde erwärmt sich stärker. Es gibt zunehmend heftige Wetterlagen. Die Erwärmung der Erde zieht ein Abschmelzen von Gletschern und Polkappen nach sich. Direkte Folgen können Überschwemmungen, Erdrutsche oder Gerölllawinen in den betroffenen Gegenden sein. Zudem hat das Schmelzen der Eismassen eine zunehmende Erhöhung der Meeresspiegel zur Folge. Dadurch werden Küsten oder Inseln überschwemmt, bewohnte Gebiete werden unbewohnbar, ehemals fruchtbarer Boden wird weggeschwemmt. (Auch sind die Gletscher und Polkappen ein wichtiges Süßwasserreservoir auf der Erde. Durch ihr Abschmelzen kann langfristig die Trinkwasserversorgung gefährdet werden.) Zusatzaufgabe Mache Vorschläge, was du selbst zu einem Verhindern des Klimawandels beitragen kannst. Lösung: Mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Nicht unnötig Licht brennen lassen. Elektrische Geräte nicht auf Standby lassen, um Strom zu sparen. Nicht unnötig Heizen. Ernährung umstellen (z. B. Fleischkonsum reduzieren). Engagement in politischen Gruppen oder Umweltorganisationen.
21 Von der DNA zum Protein Damit aus der DNA ein Protein entsteht, das dann als Enzym- oder Strukturprotein für die Ausbildung der Merkmale eines Lebewesens sorgt, sind zwei aufeinanderfolgende Vorgänge nötig: Die Transkription, die im Zellkern stattfindet und die Translation an den Ribosomen im Zellplasma UGA CGC AC UGCG Vorgänge bei der Transkription und Translation Informiere dich und ordne den Zahlen aus der Abbildung ( bis ) die entsprechenden Fachbegriffe zu: Aminosäuren, Aminosäurekette, Anticodon, Basentriplett auf der DNA (Codogen), Basentriplett auf der m-rna (Codon), DNA, Kernpore, m-rna, Ribosom, t-rna, Zellkern, Zellplasma.. Erläutere mithilfe der Abbildung in deinem Heft die Entstehung einer Aminosäurekette (eines Proteins) aus der Basensequenz der DNA. Erkläre in deinem Heft die Begriffe Transkription und Translation. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 0 Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Illustrator: Prof. Jürgen Wirth, Dreieich
22 Vom Gen zum Merkmal ARBEITSBLATT Von der DNA zum Protein Lösungen Zellkern DNA Basentriplett auf der DNA (Codogen) 4 Basentriplett auf der m-rna (Codon) 5 Kernpore 6 m-rna 7 Ribosom 8 Codon 9 t-rna 0 Anticodon Aminosäure Aminosäurekette Zellplasma Zunächst werden die beiden DNA-Stränge voneinander getrennt. Nun lagern sich m-rna-nucleotide an den Einzelstrang an, und es entsteht eine fertige m-rna (Boten- RNA). Die m-rna verlässt den Zellkern durch eine der Kernporen. Im Zellplasma lagert sich die m-rna an ein Ribosom an. Im Zellplasma befinden sich t-rna-moleküle, die unterschiedliche Aminosäuren tragen und ein bestimmtes Basentriplett, das Anticodon, besitzen. Nacheinander lagert sich jeweils ein t-rna-molekül mit einem passenden Anticodon an das Codon der m-rna an. Die Aminosäure der t-rna wird gelöst und an die nachfolgende t-rna gebunden. So entsteht eine lange Aminosäurekette (ein Protein). Bei der Transkription wird ein DNA-Abschnitt in einen m-rna-abschnitt umgeschrieben. Bei der Translation wird die Information aus der Sequenz bzw. der Basentripletts des m-rna-abschnittes mithilfe der t-rna in eine Proteinsequenz übersetzt. Zusatzaufgabe Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler Transkription und Translation tabellarisch vergleichen. Eventuell können Sie die Aufgabe auch auf die Replikation ausdehnen. Transkription Translation Replikation RNA-Einzelstrang eines begrenzten Bereiches (m-rna), enthält Ribose und Uracil Polypeptidkette (Aminosäuren mit Peptidbindung) Ort Zellkern Ribosom im Zellplasma Zellkern Ziel Bau und Eigenschaften der Syntheseprodukte Syntheserichtung Erstellen einer Genkopie zur Proteinbiosynthese Erstellen eines Polypeptids 5 5 Ableserichtung beteiligte Enzyme und deren Funktion RNA-Polymerase (kein Primer nötig) DNA-Doppelstrang (komplett) enthält Desoxyribose und Thymin identische Verdopplung des Erbmaterials DNA-Polymerase III+ I Helicase Ligase Primase Topoisomerase Praktische Tipps Eine Eselsbrücke zur Syntheserichtung von DNA und RNA: Von fünf nach drei wächst neue DNA und RNA herbei.
Aufnahme der Nährstoffbausteine vom Darm in die Blutbahn durch Diffusion und aktiven Transport
 Nährstoffe 10 1 10 1 Organische Stoffe, die von heterotrophen Organismen zur Energiegewinnung bzw. zum Aufbau des Organismus aufgenommen werden müssen. Kohlenhydrate (Zucker und Stärke) Fette (ein Fettmolekül
Nährstoffe 10 1 10 1 Organische Stoffe, die von heterotrophen Organismen zur Energiegewinnung bzw. zum Aufbau des Organismus aufgenommen werden müssen. Kohlenhydrate (Zucker und Stärke) Fette (ein Fettmolekül
Das Blut fließt nicht wie beim geschlossenen Blutkreislauf in Gefäßen (Adern) zu den Organen, sondern umspült diese frei.
 Grundwissen Biologie 8. Klasse 6 Eucyte Zelle: kleinste lebensfähige Einheit der Lebewesen abgeschlossene spezialisierte Reaktionsräume Procyte Vakuole Zellwand pflanzliche Zelle Zellkern tierische Zelle
Grundwissen Biologie 8. Klasse 6 Eucyte Zelle: kleinste lebensfähige Einheit der Lebewesen abgeschlossene spezialisierte Reaktionsräume Procyte Vakuole Zellwand pflanzliche Zelle Zellkern tierische Zelle
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Kennzeichen des Lebens. Zelle. Stoffebene und Teilchenebene. Teilchenmodell. Allen Lebewesen sind folgende Merkmale gemeinsam:
 Allen Lebewesen sind folgende Merkmale gemeinsam: Kennzeichen des Lebens Zelle Grundbaustein der Lebewesen. Ist aus verschiedenen Zellorganellen, die spezielle Aufgaben besitzen, aufgebaut. Pflanzenzelle
Allen Lebewesen sind folgende Merkmale gemeinsam: Kennzeichen des Lebens Zelle Grundbaustein der Lebewesen. Ist aus verschiedenen Zellorganellen, die spezielle Aufgaben besitzen, aufgebaut. Pflanzenzelle
Kennzeichen des Lebens. Zelle. Evolution. Skelett (5B1) (5B2) (5B3) (5B4)
 Kennzeichen des Lebens (5B1) 1. Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion 2. aktive Bewegung 3. Stoffwechsel 4. Energieumwandlung 5. Fortpflanzung 6. Wachstum 7. Aufbau aus Zellen Zelle
Kennzeichen des Lebens (5B1) 1. Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion 2. aktive Bewegung 3. Stoffwechsel 4. Energieumwandlung 5. Fortpflanzung 6. Wachstum 7. Aufbau aus Zellen Zelle
DOWNLOAD. Vertretungsstunde Biologie 9. 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren. Corinna Grün/Cathrin Spellner
 DOWNLOAD Corinna Grün/Cathrin Spellner Vertretungsstunde Biologie 9 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren auszug aus dem Originaltitel: Die Pflanzen Lebensgrundlage aller Organismen
DOWNLOAD Corinna Grün/Cathrin Spellner Vertretungsstunde Biologie 9 7./8. Klasse: Wechselbeziehungen von Pflanzen und Tieren auszug aus dem Originaltitel: Die Pflanzen Lebensgrundlage aller Organismen
Zellen. Biologie. Kennzeichen des Lebens. Das Skelett des Menschen. Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen.
 1. 3. Biologie Zellen Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen. Ist die Naturwissenschaft, die sich mit dem Bau und Funktion der Lebewesen beschäftigt. Dazu zählen Bakterien, Pflanzen, Pilze und
1. 3. Biologie Zellen Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen. Ist die Naturwissenschaft, die sich mit dem Bau und Funktion der Lebewesen beschäftigt. Dazu zählen Bakterien, Pflanzen, Pilze und
Procyte Eucyte Organell Aufgabe Zellorganell Autotrophe Stellen Nährstoffe selbst her Organismen Pflanzen Fotosynthese Bakterien Chemosynthese
 Procyte (die) Eucyte (die) Zellorganell (das; -organellen) Organell Zellkern Ribosomen Mitochondrien Chloroplasten Endoplasmatisches Retikulum (ER) Golgiapparat (Dictyosom) Membran Zellwand Vakuole Aufgabe
Procyte (die) Eucyte (die) Zellorganell (das; -organellen) Organell Zellkern Ribosomen Mitochondrien Chloroplasten Endoplasmatisches Retikulum (ER) Golgiapparat (Dictyosom) Membran Zellwand Vakuole Aufgabe
Schulcurriculum Fachbereich Biologie Jg. 7/8
 1. Unterrichtseinheit: Lebewesen bestehen aus Zellen Themen Wovon ernähren sich Pflanzen? Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung bei der Fotosynthese Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät
1. Unterrichtseinheit: Lebewesen bestehen aus Zellen Themen Wovon ernähren sich Pflanzen? Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung bei der Fotosynthese Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät
Natürliche ökologische Energie- und Stoffkreisläufe
 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau für den Unterricht an allgemein bildenden Schulen. Initiiert durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen
Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau für den Unterricht an allgemein bildenden Schulen. Initiiert durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem
 Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem 1. Der Regenwurm in seinem Lebensraum Im Biologiebuch findest du Informationen über den Regenwurm. Lies den Text durch und betrachte die Abbildung. Regenwürmer
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem 1. Der Regenwurm in seinem Lebensraum Im Biologiebuch findest du Informationen über den Regenwurm. Lies den Text durch und betrachte die Abbildung. Regenwürmer
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem
 Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung B2.1 Stoffkreislauf, Energieumwandlung und Wechselwirkungen in Modellökosystemen W2 Ich kann aus unterschiedlichen
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung B2.1 Stoffkreislauf, Energieumwandlung und Wechselwirkungen in Modellökosystemen W2 Ich kann aus unterschiedlichen
5.1. Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? 5.2. Wie sind pflanzliche und tierische Zellen aufgebaut? 5.3
 Lebewesen... (1) (2) (3) 5.1 (4) (5) Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? (6) aktive Bewegung Wachstum Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen) Fortpflanzung Reizbarkeit
Lebewesen... (1) (2) (3) 5.1 (4) (5) Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? (6) aktive Bewegung Wachstum Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen) Fortpflanzung Reizbarkeit
Nährstoffe. Enzyme. Essentiell bedeutet, dass der Körper diese Stoffe nicht selbst herstellen kann.
 2 Kohlenhydrate (z.b. Nudeln, Brot) sind Makromoleküle aus verschiedenen Einfachzuckern (Monosacchariden). Sie dienen als Energieträger. 2 Nährstoffe Fette (z.b. Butter, Olivenöl) sind Verbindungen aus
2 Kohlenhydrate (z.b. Nudeln, Brot) sind Makromoleküle aus verschiedenen Einfachzuckern (Monosacchariden). Sie dienen als Energieträger. 2 Nährstoffe Fette (z.b. Butter, Olivenöl) sind Verbindungen aus
5.1. Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? 5.2. Wie sind pflanzliche und tierische Zellen aufgebaut? 5.3
 5.1 Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? (1) Informationsaufnahme (2) Informationsverarbeitung und Reaktion (3) aktive Bewegung (4) Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen)
5.1 Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? (1) Informationsaufnahme (2) Informationsverarbeitung und Reaktion (3) aktive Bewegung (4) Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen)
1. Biologie die Wissenschaft von den Lebewesen. 2. Der Mensch als Lebewesen. Grundwissen NuT 5. Klasse (LehrplanPlus) Kennzeichen des Lebens
 (zusammengestellt von E. Fischer, A. Grenzinger, A. Hutschenreuther, B. Müller, G. Stadler) 1. Biologie die Wissenschaft von den Lebewesen Kennzeichen des Lebens Stoffwechsel Bewegung aus eigener Kraft
(zusammengestellt von E. Fischer, A. Grenzinger, A. Hutschenreuther, B. Müller, G. Stadler) 1. Biologie die Wissenschaft von den Lebewesen Kennzeichen des Lebens Stoffwechsel Bewegung aus eigener Kraft
In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
 In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte mikroskopisch
In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte mikroskopisch
Basiswissen Ernährungslehre
 Basiswissen Ernährungslehre Hauptnährstoffgruppen und bioaktive Substanzen Ergänze folgende Übersicht zu den natürlichen Bestandteilen der Nahrung Natürliche Bestandteile der Nahrung Nährstoffe Funktionsgruppen
Basiswissen Ernährungslehre Hauptnährstoffgruppen und bioaktive Substanzen Ergänze folgende Übersicht zu den natürlichen Bestandteilen der Nahrung Natürliche Bestandteile der Nahrung Nährstoffe Funktionsgruppen
TH emeneft. Klima und Klimawandel. Kohlendioxid das besondere Gas. Aufgaben:
 Kohlendioxid das besondere Gas Das Klima auf der Erde wird durch viele verschiedene Dinge bestimmt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Luft. Sie besteht aus einem Gemisch von unsichtbaren Gasen. Dazu
Kohlendioxid das besondere Gas Das Klima auf der Erde wird durch viele verschiedene Dinge bestimmt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Luft. Sie besteht aus einem Gemisch von unsichtbaren Gasen. Dazu
Allgemeines - Die biologischen Kennzeichen der Lebewesen: 1.) Stoffwechsel und Energiewandlung. 5.) Aufbau aus Zellen 2.) Information + Reizbarkeit
 Allgemeines - Die biologischen Kennzeichen der Lebewesen: 1.) Stoffwechsel und Energiewandlung 5.) Aufbau aus Zellen 2.) Information + Reizbarkeit 3.) Aktive Bewegung 4.) Fortpflanzung und Entwicklung
Allgemeines - Die biologischen Kennzeichen der Lebewesen: 1.) Stoffwechsel und Energiewandlung 5.) Aufbau aus Zellen 2.) Information + Reizbarkeit 3.) Aktive Bewegung 4.) Fortpflanzung und Entwicklung
Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie Seiten
 Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Inhaltsverzeichnis. Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16
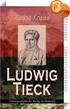 Inhaltsverzeichnis Was sind Naturwissenschaften?... 8 Rundgang durch den Nawi-Raum... 10 Kennzeichen des Lebendigen................................. 12 Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16 Die Pflanzenzelle...
Inhaltsverzeichnis Was sind Naturwissenschaften?... 8 Rundgang durch den Nawi-Raum... 10 Kennzeichen des Lebendigen................................. 12 Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16 Die Pflanzenzelle...
Lernkontrolle Arbeitsblatt
 Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Evaluation und Ergebnissicherung Ziel Die SuS lösen den Test. Material Testblätter Lösungen Sozialform EA Zeit 45 Zusätzliche Informationen: Die Punktezahl zur Bewertung
Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Evaluation und Ergebnissicherung Ziel Die SuS lösen den Test. Material Testblätter Lösungen Sozialform EA Zeit 45 Zusätzliche Informationen: Die Punktezahl zur Bewertung
Aufgabenwörter (Operatoren) in der Unterstufe
 Aufgabenwörter (Operatoren) in der Unterstufe Die Aufgabenstellung in schriftlichen Prüfungen wird mit dem Übertritt auf das Gymnasium konkreter, bisweilen weniger intuitiv erfassbar und insgesamt komplexer.
Aufgabenwörter (Operatoren) in der Unterstufe Die Aufgabenstellung in schriftlichen Prüfungen wird mit dem Übertritt auf das Gymnasium konkreter, bisweilen weniger intuitiv erfassbar und insgesamt komplexer.
Stunde 6: Bau des Auges und Funktion der Bestandteile
 Informationssysteme Bildungsplanbezug: 3.2.2.4 Informationssysteme Die Schülerinnen und Schüler kennen Sinnesorgane des Menschen und ihre Bedeutung für die Informationsaufnahme aus Umwelt und eigenem Körper.
Informationssysteme Bildungsplanbezug: 3.2.2.4 Informationssysteme Die Schülerinnen und Schüler kennen Sinnesorgane des Menschen und ihre Bedeutung für die Informationsaufnahme aus Umwelt und eigenem Körper.
Verdauung. Oberflächenvergrößerung. Enzym. Atmung
 Verdauung Mechanische Zerkleinerung, enzymatische Zersetzung sowie Weiterleitung von Nahrung und Aufnahme von Nahrungsbestandteilen ins Körperinnere (Blut) Unverwertbare Teile werden ausgeschieden. Oberflächenvergrößerung
Verdauung Mechanische Zerkleinerung, enzymatische Zersetzung sowie Weiterleitung von Nahrung und Aufnahme von Nahrungsbestandteilen ins Körperinnere (Blut) Unverwertbare Teile werden ausgeschieden. Oberflächenvergrößerung
Schulcurriculum Biologie 7/8 Goldberg-Gymnasium Sindelfingen
 Schulcurriculum Biologie 7/8 Goldberg-Gymnasium Sindelfingen Hinweis: Dieses Curriculum gibt die Inhalte und die zugeordneten Kompetenzen wieder. Klasse 7 (einstündig): Inhalt Zelle und Stoffwechsel Zelle
Schulcurriculum Biologie 7/8 Goldberg-Gymnasium Sindelfingen Hinweis: Dieses Curriculum gibt die Inhalte und die zugeordneten Kompetenzen wieder. Klasse 7 (einstündig): Inhalt Zelle und Stoffwechsel Zelle
Weniger CO 2 dem Klima zuliebe Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Der CO 2- Kreislauf wird behandelt und die Beeinflussung des Menschen erarbeitet. Die Schülerberichte (Aufgabe 3) dienen als Grundlage zur Diskussion im Plenum. Ziel
Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Der CO 2- Kreislauf wird behandelt und die Beeinflussung des Menschen erarbeitet. Die Schülerberichte (Aufgabe 3) dienen als Grundlage zur Diskussion im Plenum. Ziel
Ursachen des Klimawandels Info für Lehrpersonen
 Info für Lehrpersonen Arbeitsauftrag Die SuS sehen sich ein Film an und die LP erklärt verschiedene Begriffe. Anschliessend lösen die SuS unterschiedliche Aufgabentypen (Lückentext, interpretieren Karikatur
Info für Lehrpersonen Arbeitsauftrag Die SuS sehen sich ein Film an und die LP erklärt verschiedene Begriffe. Anschliessend lösen die SuS unterschiedliche Aufgabentypen (Lückentext, interpretieren Karikatur
C Der Kreislauf des Kohlenstoffs
 C Der Kreislauf des Kohlenstoffs Inhalt der DVD, beschreibungen und Menüplan wfw-film.de Inhalt der DVD Hauptfilm 1: Der Kreislauf des Kohlenstoffs (21.35 Min.) : Kap.- (1.37 Min.) Verteilung: (2 S.) Produzenten
C Der Kreislauf des Kohlenstoffs Inhalt der DVD, beschreibungen und Menüplan wfw-film.de Inhalt der DVD Hauptfilm 1: Der Kreislauf des Kohlenstoffs (21.35 Min.) : Kap.- (1.37 Min.) Verteilung: (2 S.) Produzenten
Grundwissen Natur und Technik 5
 Grundwissen Natur und Technik 5 Die roten Fäden durch die Biologie: Basiskonzepte 1 Kennzeichen des Lebens: Bewegung Stoffwechsel Aufbau aus Zellen Wachstum Fortpflanzung Information (Aufnahme, Verarbeitung,
Grundwissen Natur und Technik 5 Die roten Fäden durch die Biologie: Basiskonzepte 1 Kennzeichen des Lebens: Bewegung Stoffwechsel Aufbau aus Zellen Wachstum Fortpflanzung Information (Aufnahme, Verarbeitung,
Zellen brauchen Sauerstoff Information
 Zellen brauchen Sauerstoff Information Tauchregel: Suche mit deiner schweren Tauchausrüstung einen direkten Weg zum Einstieg ins Wasser. Tauchen ist wie jede andere Sportart geprägt von körperlicher Anstrengung.
Zellen brauchen Sauerstoff Information Tauchregel: Suche mit deiner schweren Tauchausrüstung einen direkten Weg zum Einstieg ins Wasser. Tauchen ist wie jede andere Sportart geprägt von körperlicher Anstrengung.
Themen im Jahrgang 5 Oberschule.
 B B I O L O G I E Themen im Jahrgang 5 Oberschule. PRISMA Biologie 5/6 Niedersachsen Differenzierende Ausgabe, Klett Verlag Unterrichtserteilung: 2 Stunden pro Woche / ganzjährig Womit beschäftigt sich
B B I O L O G I E Themen im Jahrgang 5 Oberschule. PRISMA Biologie 5/6 Niedersachsen Differenzierende Ausgabe, Klett Verlag Unterrichtserteilung: 2 Stunden pro Woche / ganzjährig Womit beschäftigt sich
Skelett = Gesamtheit aller Knochen. Bewegung erfordert folglich zwei Muskeln, die als Gegenspieler wirken. Sinnesorgane bestehen aus Sinneszellen.
 5.1 Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? Lebewesen... (1) aktive Bewegung (2) Wachstum (3) Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen) (4) Fortpflanzung (5) Reizbarkeit (=
5.1 Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? Lebewesen... (1) aktive Bewegung (2) Wachstum (3) Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen) (4) Fortpflanzung (5) Reizbarkeit (=
HTW Chur Photonics, Optik 1, T. Borer Aufgaben /19
 Aufgaben Optische Instrumente Auge Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können. - einen bekannten oder neuen Sachverhalt analysieren
Aufgaben Optische Instrumente Auge Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können. - einen bekannten oder neuen Sachverhalt analysieren
Die roten Fäden durch die Biologie
 Die roten Fäden durch die Biologie LPG-Grundwissen: 5. Klasse Energie ebene Energie Oberfläche Oberfläche...... Organisations- Fortpflanzung Fortpflanzung Stoffwechsel Stoffwechsel 5. Jgst. 1 5. Jgst.
Die roten Fäden durch die Biologie LPG-Grundwissen: 5. Klasse Energie ebene Energie Oberfläche Oberfläche...... Organisations- Fortpflanzung Fortpflanzung Stoffwechsel Stoffwechsel 5. Jgst. 1 5. Jgst.
5.1 Merkmale der Lebewesen. 5.2 Bau der Zelle. 5.3 Reiz-Reaktions-Schema
 5.1 Merkmale der Lebewesen GW 5.Klasse NuT Wachstum und Individualentwicklung Fortpflanzung Stoffwechsel (Stoff- und Energieumwandlung) Aufbau aus Zellen Aktive Bewegung Reizbarkeit : Informationsaufnahme,
5.1 Merkmale der Lebewesen GW 5.Klasse NuT Wachstum und Individualentwicklung Fortpflanzung Stoffwechsel (Stoff- und Energieumwandlung) Aufbau aus Zellen Aktive Bewegung Reizbarkeit : Informationsaufnahme,
Geografie, D. Langhamer. Klimarisiken. Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes. Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf.
 Klimarisiken Klimaelemente Klimafaktoren Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf Definitionen Wetter Witterung Klima 1 Abb. 1 Temperaturprofil der
Klimarisiken Klimaelemente Klimafaktoren Beschreibung des Klimas eines bestimmten Ortes Räumliche Voraussetzungen erklären Klimaverlauf Definitionen Wetter Witterung Klima 1 Abb. 1 Temperaturprofil der
Wie funktionieren unsere Muskeln?
 Wie funktionieren unsere Muskeln? Prof. Hermann Schwameder Institut für Sport und Sportwissenschaft Übersicht Wozu benötigen wir Muskeln? Gibt es verschieden Arten von Muskeln? Wie kommt es zu Bewegungen?
Wie funktionieren unsere Muskeln? Prof. Hermann Schwameder Institut für Sport und Sportwissenschaft Übersicht Wozu benötigen wir Muskeln? Gibt es verschieden Arten von Muskeln? Wie kommt es zu Bewegungen?
Schulinterner Arbeitsplan für den Doppeljahrgang 7./8. im Fach Biologie Verwendetes Lehrwerk: BIOSKOP 7/8
 Thema Inhaltskompetenzen Prozesskompetenzen Bezug zum Methodencurriculum (in Zukunft) Vorschlag Stunden - zahl Lebewesen bestehen aus Zellen 6 Die Schülerinnen und Schüler Das Mikroskop Pflanzen- und Tierzellen
Thema Inhaltskompetenzen Prozesskompetenzen Bezug zum Methodencurriculum (in Zukunft) Vorschlag Stunden - zahl Lebewesen bestehen aus Zellen 6 Die Schülerinnen und Schüler Das Mikroskop Pflanzen- und Tierzellen
In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit
 In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit in der Nucleotidsequenz der DNA verschlüsselt (codiert)
In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit in der Nucleotidsequenz der DNA verschlüsselt (codiert)
Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse
 Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse Biologie Lehre der Lebewesen Kennzeichen der Lebewesen Aufbau aus Zellen Bewegung aus eigener Kraft Fortpflanzung Aufbau aus Zellen Zellkern Chef der Zelle Zellmembran
Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse Biologie Lehre der Lebewesen Kennzeichen der Lebewesen Aufbau aus Zellen Bewegung aus eigener Kraft Fortpflanzung Aufbau aus Zellen Zellkern Chef der Zelle Zellmembran
1 Was ist Leben? Kennzeichen der Lebewesen
 1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
Lernerfolg(e) erzielen
 Lernerfolg(e) erzielen Kurz-Lernkontrolle Realien, Donnerstag, 5. November Inhalte Ziele Verweise Wirbeltiere Einleitung Kategorien Typische Vertreter und ihr Körperbau / Verhalten /... Organe von Säugetieren
Lernerfolg(e) erzielen Kurz-Lernkontrolle Realien, Donnerstag, 5. November Inhalte Ziele Verweise Wirbeltiere Einleitung Kategorien Typische Vertreter und ihr Körperbau / Verhalten /... Organe von Säugetieren
Auge. Aufgaben 11.1 Studieren Sie im Lehrbuch Tipler/Mosca den folgenden Abschnitt: Optische Instrumente (Teil Das Auge, Seiten 1067 bis 1070)
 Aufgaben 11 Optische Instrumente Auge Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können. - einen bekannten oder neuen Sachverhalt analysieren
Aufgaben 11 Optische Instrumente Auge Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können. - einen bekannten oder neuen Sachverhalt analysieren
22 DIE KÖRPERHÜLLE SEITE ZELLSTOFFWECHSEL DNA ZELLTEILUNG GEWEBE UND ORGANE HAUT, HAARE UND NÄGEL
 SEITE Unser Körper besteht aus Millionen spezialisierter Einheiten - den Zellen die fast ebenso viele Funktionen erfüllen. Zwar ist jede Zelle anders, doch enthalten alle Zellkerne den identischen Code
SEITE Unser Körper besteht aus Millionen spezialisierter Einheiten - den Zellen die fast ebenso viele Funktionen erfüllen. Zwar ist jede Zelle anders, doch enthalten alle Zellkerne den identischen Code
Zelldifferenzierung Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A)
 Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A) Abb. 1: Querschnitt durch ein Laubblatt (Rasterelektronenmikroskop) Betrachtet man den Querschnitt eines Laubblattes unter dem Mikroskop (Abb. 1), so sieht
Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A) Abb. 1: Querschnitt durch ein Laubblatt (Rasterelektronenmikroskop) Betrachtet man den Querschnitt eines Laubblattes unter dem Mikroskop (Abb. 1), so sieht
Protokoll für die Gewässergütebestimmung mit Zeigerarten. Bestimme alle gefangenen Arten. Zähle sie aus und trage sie in das Protokoll ein.
 Protokoll Protokoll für die Gewässergütebestimmung mit Zeigerarten Bestimme alle gefangenen Arten. Zähle sie aus und trage sie in das Protokoll ein. Bioindikator Anzahl Index Produkt Steinfliegenlarve
Protokoll Protokoll für die Gewässergütebestimmung mit Zeigerarten Bestimme alle gefangenen Arten. Zähle sie aus und trage sie in das Protokoll ein. Bioindikator Anzahl Index Produkt Steinfliegenlarve
Vorfahrt fürs Klima Schulprojekt für Jugendliche der 7./8. Klasse
 Vorfahrt fürs Klima Schulprojekt für Jugendliche der 7./8. Klasse EINSTIEG Experiment Treibhauseffekt Zeit 10-15 Minuten Aufbau und Erklärung, Laufzeit etwa 1 Schultag Material Tisch Stellwand Treibhauseffekt-Experiment
Vorfahrt fürs Klima Schulprojekt für Jugendliche der 7./8. Klasse EINSTIEG Experiment Treibhauseffekt Zeit 10-15 Minuten Aufbau und Erklärung, Laufzeit etwa 1 Schultag Material Tisch Stellwand Treibhauseffekt-Experiment
HTW Chur Photonics, Optik 1, T. Borer Aufgaben /18
 Aufgaben 11 Optische Instrumente Auge Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können. - einen bekannten oder neuen Sachverhalt analysieren
Aufgaben 11 Optische Instrumente Auge Lernziele - sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können. - einen bekannten oder neuen Sachverhalt analysieren
Teilchenmodell. Reinstoffe. Stoffgemische. Luft ist ein Gasgemisch. Gasnachweise. Naturwissenschaftliches Arbeiten. Reinstoffe.
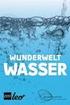 1 1 Teilchenmodell Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen, die sich in Größe und Masse unterscheiden. Sie sind selbst unter dem Mikroskop noch nicht sichtbar. Zwischen den kleinsten Teilchen ist nichts.
1 1 Teilchenmodell Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen, die sich in Größe und Masse unterscheiden. Sie sind selbst unter dem Mikroskop noch nicht sichtbar. Zwischen den kleinsten Teilchen ist nichts.
Wie funktioniert Muskelaufbau? Eine Reise in die Welt des Muskels.
 Wie funktioniert Muskelaufbau? Eine Reise in die Welt des Muskels. Wie funktioniert Muskelaufbau? Wie funktioniert Muskelaufbau also wirklich. Immer wieder hört man Märchen wie zum Beispiel, dass Muskeln
Wie funktioniert Muskelaufbau? Eine Reise in die Welt des Muskels. Wie funktioniert Muskelaufbau? Wie funktioniert Muskelaufbau also wirklich. Immer wieder hört man Märchen wie zum Beispiel, dass Muskeln
Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten
 Inhaltsverzeichnis Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten 1 Reise in die Welt des Winzigen... 8 Zelle Grundbaustein der Lebewesen... 10 Hilfsmittel zum Betrachten winzig kleiner Dinge... 12 Das
Inhaltsverzeichnis Lebewesen bestehen aus Zellen kleinste Einheiten 1 Reise in die Welt des Winzigen... 8 Zelle Grundbaustein der Lebewesen... 10 Hilfsmittel zum Betrachten winzig kleiner Dinge... 12 Das
Aufgabe 6: Nahrungsbeziehungen und Kreisläufe in einem Ökosystem
 Schüler/in Aufgabe 6: Nahrungsbeziehungen und Kreisläufe in einem Ökosystem LERNZIELE: Nahrungsbeziehungen und biologisches Gleichgewicht in Ökosystemen erklären Stoffkreislauf in einem Lebensraum ergänzen
Schüler/in Aufgabe 6: Nahrungsbeziehungen und Kreisläufe in einem Ökosystem LERNZIELE: Nahrungsbeziehungen und biologisches Gleichgewicht in Ökosystemen erklären Stoffkreislauf in einem Lebensraum ergänzen
Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 7-8
 ASG Schulcurriculum für Jg 7/8-1- Stand: Aug 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 7-8 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94) sind sowohl
ASG Schulcurriculum für Jg 7/8-1- Stand: Aug 2016 Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg - Schulinternes Curriculum Biologie Jg. 7-8 Anmerkungen: Gemäß den Vorgaben (KC Biologie 2015 Sek I S. 94) sind sowohl
Verlauf der Blutzuckerkonzentration nach der Mahlzeit. Thinkstock /istockphoto. Konzentration. Thinkstock /istockphoto VORANSICHT.
 S 6 Art der Mahlzeit Verlauf der Blutzuckerkonzentration nach der Mahlzeit Abbildung 1 Graph 1 Abbildung 2 Graph 2 Abbildung 3 www.colourbox.de Graph 3 Die verschiedenen Mahlzeiten lassen den Blutzuckerspiegel
S 6 Art der Mahlzeit Verlauf der Blutzuckerkonzentration nach der Mahlzeit Abbildung 1 Graph 1 Abbildung 2 Graph 2 Abbildung 3 www.colourbox.de Graph 3 Die verschiedenen Mahlzeiten lassen den Blutzuckerspiegel
Laurentius-Siemer-Gymnasium Ramsloh Schuleigener Arbeitsplan für das Fach Biologie (gültig ab dem Schuljahr 2007/08)
 Jahrgangsstufe: 7/8 Lehrwerke / Hilfsmittel: Bioskop 7/8, Westermann, ISBN 978-3-14-150501-6 Inhalte / Themen: Kompetenzen: Die Reihenfolge ist nicht verbindlich, Seitenangaben in Kompetenzen gemäß Kerncurriculum
Jahrgangsstufe: 7/8 Lehrwerke / Hilfsmittel: Bioskop 7/8, Westermann, ISBN 978-3-14-150501-6 Inhalte / Themen: Kompetenzen: Die Reihenfolge ist nicht verbindlich, Seitenangaben in Kompetenzen gemäß Kerncurriculum
Inhalt. So arbeitest du mit dem Biobuch 10. Was ist Biologie? 12. Biologie eine Naturwissenschaft 14
 Inhalt So arbeitest du mit dem Biobuch 10 Was ist Biologie? 12 Biologie eine Naturwissenschaft 14 Kennzeichen des Lebens 16 Pflanzen sind Lebewesen 18 MMP: Lebendig oder nicht? 19 Zusammenfassung 20 Teste
Inhalt So arbeitest du mit dem Biobuch 10 Was ist Biologie? 12 Biologie eine Naturwissenschaft 14 Kennzeichen des Lebens 16 Pflanzen sind Lebewesen 18 MMP: Lebendig oder nicht? 19 Zusammenfassung 20 Teste
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Chemie um uns herum. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Chemie um uns herum Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 5.-10. Schuljahr Wolfgang Wertenbroch Lernwerkstatt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Chemie um uns herum Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 5.-10. Schuljahr Wolfgang Wertenbroch Lernwerkstatt
Variation und Selektion
 2.1 Variation und Selektion: Tiere in ihrer Umwelt (Basiskurs) Variation und Selektion Variation und Selektion 1234 Huhu, hier bin ich wieder euer Urmel Auf unserer spannenden Reise durch das "Abenteuer
2.1 Variation und Selektion: Tiere in ihrer Umwelt (Basiskurs) Variation und Selektion Variation und Selektion 1234 Huhu, hier bin ich wieder euer Urmel Auf unserer spannenden Reise durch das "Abenteuer
Schulinterner Lehrplan. für das Fach. Biologie. (Sekundarstufe I Kurzversion)
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Biologie (Sekundarstufe I ) Jahrgangsstufe: 5 Schulinterner Lehrplan Biologie I. Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen I.I Was lebt in meiner Nachbarschaft? Artenkenntnis
Schulinterner Lehrplan für das Fach Biologie (Sekundarstufe I ) Jahrgangsstufe: 5 Schulinterner Lehrplan Biologie I. Inhaltsfeld: Vielfalt von Lebewesen I.I Was lebt in meiner Nachbarschaft? Artenkenntnis
Das Wichtigste auf einen Blick... 66
 Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 5. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 5. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 5. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
10% des Volumens Membran Poren Nucleoplasma Chromatin Proteinen DNS (DNA) Nucleoli (Einzahl: Nucleolus). Endoplasmatische Reticulum
 Zellkern (Nucleus) Der Zellkern ist die Firmenzentrale der Zelle. Er nimmt ca. 10% des Volumens der Zelle ein. Der Zellkern: - Ist von einer Membran umgeben. - Enthält Poren für den Austausch mit dem Cytosol
Zellkern (Nucleus) Der Zellkern ist die Firmenzentrale der Zelle. Er nimmt ca. 10% des Volumens der Zelle ein. Der Zellkern: - Ist von einer Membran umgeben. - Enthält Poren für den Austausch mit dem Cytosol
Die hier im pdf-format dargestellten Musterblätter sind geschützt und können weder bearbeitet noch kopiert werden.
 Die hier im pdf-ormat dargestellten Musterblätter sind geschützt und können weder bearbeitet noch kopiert werden. Inhalt Themengebiet Beschreibung Arbeitsblatt zur Schattengröße Arbeitsblatt zum Schattenraum
Die hier im pdf-ormat dargestellten Musterblätter sind geschützt und können weder bearbeitet noch kopiert werden. Inhalt Themengebiet Beschreibung Arbeitsblatt zur Schattengröße Arbeitsblatt zum Schattenraum
Pauls Müsli geht auf die Reise
 Pauls Müsli geht auf die Reise Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung W1 Ich kann Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik beschreiben und benennen. 1 W1 Ich kann Vorgänge
Pauls Müsli geht auf die Reise Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung W1 Ich kann Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik beschreiben und benennen. 1 W1 Ich kann Vorgänge
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Linsen und optische Geräte
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Linsen und optische Geräte Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Lernwerkstatt Linsen und optische
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Linsen und optische Geräte Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Lernwerkstatt Linsen und optische
Lernkontrolle Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Evaluation und Ergebnissicherung Ziel Die SuS lösen den Test. Material Testblätter Lösungen Sozialform EA Zeit 30 Testblatt 2/5 Aufgabe: Löse die Aufgaben. 1. Beschrifte
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Evaluation und Ergebnissicherung Ziel Die SuS lösen den Test. Material Testblätter Lösungen Sozialform EA Zeit 30 Testblatt 2/5 Aufgabe: Löse die Aufgaben. 1. Beschrifte
10.1 Was bedeutet Stoffwechsel? 10.2 Was sind Enzyme? 10.3 Welche Aufgabe erfüllen die Organe des Verdauungsapparats?
 10.1 Was bedeutet Stoffwechsel? Stoffwechsel Gesamtheit der Vorgänge der Stoffaufnahme, Stoffumwandlung und Stoffabgabe in lebenden Zellen (immer auch mit Energiewechsel verbunden) Energiestoffwechsel:
10.1 Was bedeutet Stoffwechsel? Stoffwechsel Gesamtheit der Vorgänge der Stoffaufnahme, Stoffumwandlung und Stoffabgabe in lebenden Zellen (immer auch mit Energiewechsel verbunden) Energiestoffwechsel:
Die roten Fäden durch die Biologie Grundwissen: 5. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Grundwissen: 5. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und umwandlung Steuerung und Regelung ebene Struktur und Funktion
Die roten Fäden durch die Biologie Grundwissen: 5. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und umwandlung Steuerung und Regelung ebene Struktur und Funktion
Partnerpuzzle zum Thema MENSTRUATIONSZYKLUS. Didaktische Hinweise zur Durchführung des Partnerpuzzles (SOL)
 Partnerpuzzle zum Thema MENSTRUATIONSZYKLUS Didaktische Hinweise zur Durchführung des Partnerpuzzles (SOL) Das Verständnis der hormonellen und körperlichen Vorgänge während des Menstruationszyklus überfordert
Partnerpuzzle zum Thema MENSTRUATIONSZYKLUS Didaktische Hinweise zur Durchführung des Partnerpuzzles (SOL) Das Verständnis der hormonellen und körperlichen Vorgänge während des Menstruationszyklus überfordert
NuT 5.1. Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? NuT 5.2. Welche Aufgaben erfüllt das menschliche Skelett? NuT 5.3
 NuT 5.1 Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? Lebewesen zeigen... (1) aktive Bewegung (2) Wachstum (3) Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen) (4) Fortpflanzung (5) Reizbarkeit
NuT 5.1 Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? Lebewesen zeigen... (1) aktive Bewegung (2) Wachstum (3) Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen) (4) Fortpflanzung (5) Reizbarkeit
Euglena - Pflanze oder Tier? Was für ein Lebewesen findest Du hier, und was hat es mit Fotosynthese zu tun?
 Euglena - Pflanze oder Tier? Was für ein Lebewesen findest Du hier, und was hat es mit Fotosynthese zu tun? Hypothese: : Erkenntnis: Zeichnung : 1 Euglena goes Disco! Reagiert Euglena auf Licht? Mag sie
Euglena - Pflanze oder Tier? Was für ein Lebewesen findest Du hier, und was hat es mit Fotosynthese zu tun? Hypothese: : Erkenntnis: Zeichnung : 1 Euglena goes Disco! Reagiert Euglena auf Licht? Mag sie
Procyte. Eucyte. Zellorganell. Autotrophe Organismen. (die) (die) (das; -organellen) Reservestoffe. Bakterienzellwand (Murein) Zellmembran.
 45 Ribosomen Schleimkapsel Reservestoffe Bakterienzellwand (Murein) Procyte (die) Zellplasma Bakterienchromosom Zellmembran Bakteriengeißel keine membranumgrenzten Organellen 46 Pflanzliche Zelle Dictyosom
45 Ribosomen Schleimkapsel Reservestoffe Bakterienzellwand (Murein) Procyte (die) Zellplasma Bakterienchromosom Zellmembran Bakteriengeißel keine membranumgrenzten Organellen 46 Pflanzliche Zelle Dictyosom
Die kosmische Evolution - Lösung
 Die kosmische Evolution - Lösung Nr. Aussage Der Urknall muss sehr laut gewesen sein. 2 Vor dem Urknall gab es nichts. Am Anfang war es sehr, sehr heiß. 4 Der Urknall ereignete sich vor ca.,77 Millionen
Die kosmische Evolution - Lösung Nr. Aussage Der Urknall muss sehr laut gewesen sein. 2 Vor dem Urknall gab es nichts. Am Anfang war es sehr, sehr heiß. 4 Der Urknall ereignete sich vor ca.,77 Millionen
5.1. Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? 5.2. Welche Aufgaben erfüllt das menschliche Skelett? 5.3
 5.1 Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? Lebewesen... (1) aktive Bewegung (2) Wachstum (3) Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen) (4) Fortpflanzung (5) Reizbarkeit (=
5.1 Welche Kennzeichen besitzen alle Lebewesen? Lebewesen... (1) aktive Bewegung (2) Wachstum (3) Stoffwechsel (= Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung von Stoffen) (4) Fortpflanzung (5) Reizbarkeit (=
Umweltwissenschaften: Ökologie
 Umweltwissenschaften: Ökologie Atmung und Gärung Quelle der Graphik: http://de.wikipedia.org/wiki/zellatmung Atmung C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 >>> 6 CO 2 + 6 H 2 O [30 ATP] G = - 2870 kj /mol Milchsäure G. C
Umweltwissenschaften: Ökologie Atmung und Gärung Quelle der Graphik: http://de.wikipedia.org/wiki/zellatmung Atmung C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 >>> 6 CO 2 + 6 H 2 O [30 ATP] G = - 2870 kj /mol Milchsäure G. C
Musterprüfung Welche Winkel werden beim Reflexions- und Brechungsgesetz verwendet?
 1 Musterprüfung Module: Linsen Optische Geräte 1. Teil: Linsen 1.1. Was besagt das Reflexionsgesetz? 1.2. Welche Winkel werden beim Reflexions- und Brechungsgesetz verwendet? 1.3. Eine Fläche bei einer
1 Musterprüfung Module: Linsen Optische Geräte 1. Teil: Linsen 1.1. Was besagt das Reflexionsgesetz? 1.2. Welche Winkel werden beim Reflexions- und Brechungsgesetz verwendet? 1.3. Eine Fläche bei einer
Das Auge Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Ziel Die SuS setzen sich zu zweit gegenüber, betrachten die Augen des Nachbarn und erstellen eine Skizze. Sie beschriften diejenigen Teile des Auges, die sie kennen.
Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Ziel Die SuS setzen sich zu zweit gegenüber, betrachten die Augen des Nachbarn und erstellen eine Skizze. Sie beschriften diejenigen Teile des Auges, die sie kennen.
Hauptaufgabe Gastransport
 Gastransport Einstiegsfragen: - Sind Verbrennungen exotherm oder endotherm? - Welches Gas wird dafür benötigt? - Wo kommt es vor? - Wo wird es benötigt? - Wie kann es dorthin gelangen? - Was braucht es
Gastransport Einstiegsfragen: - Sind Verbrennungen exotherm oder endotherm? - Welches Gas wird dafür benötigt? - Wo kommt es vor? - Wo wird es benötigt? - Wie kann es dorthin gelangen? - Was braucht es
8_ Die Zusammensetzung der Nahrung
 Gruppe 1: Kohlenhydrate benötigen, hängt davon ab, wie viel wir uns bewegen, wie alt, wie gross, wie schwer wir sind Kohlenhydrate stammen bevorzugt aus pflanzlicher Kost, zum Beispiel aus Kartoffeln und
Gruppe 1: Kohlenhydrate benötigen, hängt davon ab, wie viel wir uns bewegen, wie alt, wie gross, wie schwer wir sind Kohlenhydrate stammen bevorzugt aus pflanzlicher Kost, zum Beispiel aus Kartoffeln und
Das Auge (ein natürliches optisches System)
 Das Auge (ein natürliches optisches System) Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung 1 N1 Ausgehend von stark angeleitetem, geführtem Arbeiten Sachverhalte aus Natur, Umwelt und Technik
Das Auge (ein natürliches optisches System) Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung 1 N1 Ausgehend von stark angeleitetem, geführtem Arbeiten Sachverhalte aus Natur, Umwelt und Technik
Biologischer Abbau (Physiologie)
 Ö K O L O G I E Biologischer Abbau (Physiologie) Der biologische Abbau organischer Substrate (u.a. Kohlenhydrate) durch Enzyme oder Mikroorganismen dient zu folgendem: --- zelleigenes Material (u.a. Proteine)
Ö K O L O G I E Biologischer Abbau (Physiologie) Der biologische Abbau organischer Substrate (u.a. Kohlenhydrate) durch Enzyme oder Mikroorganismen dient zu folgendem: --- zelleigenes Material (u.a. Proteine)
Der Treibhauseffekt. Tabelle 1: Übersicht der wichtigsten Charakteristika der "Treibhausgase"
 Der Treibhauseffekt Ein wichtiger Begriff, der immer wieder im Zusammenhang mit den Klimaänderungen auftaucht, ist der Treibhauseffekt. Durch diesen Vorgang wird die Erdatmosphäre ähnlich wie die Luft
Der Treibhauseffekt Ein wichtiger Begriff, der immer wieder im Zusammenhang mit den Klimaänderungen auftaucht, ist der Treibhauseffekt. Durch diesen Vorgang wird die Erdatmosphäre ähnlich wie die Luft
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lehrerhandreichungen zu: "Der Kohlenstoffkreislauf"
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lehrerhandreichungen zu: "Der Kohlenstoffkreislauf" Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Schlagwörter Assimilation;
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lehrerhandreichungen zu: "Der Kohlenstoffkreislauf" Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Schlagwörter Assimilation;
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klassenarbeit: Klimawandel, Klimaschutz, ökologisches Wirtschaften (erhöhtes Niveau) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klassenarbeit: Klimawandel, Klimaschutz, ökologisches Wirtschaften (erhöhtes Niveau) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Aufbau & Funktion. Das Sinnesorgan Auge. Nr Halten in der Augenhöhle Verformung der Aufhängung der Linse
 Aufbau & Funktion Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teil Bindehaut Ziliarmuskel Iris (Regenbogenhaut) Linse Hornhaut Vordere Augenkammer Lederhaut Adlerhaut Pigmentschicht mit Netzhaut Glaskörper Gelber Fleck
Aufbau & Funktion Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teil Bindehaut Ziliarmuskel Iris (Regenbogenhaut) Linse Hornhaut Vordere Augenkammer Lederhaut Adlerhaut Pigmentschicht mit Netzhaut Glaskörper Gelber Fleck
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
7a. Ernährung und Verdauung
 7a. Ernährung und Verdauung Der Metabolismus Anabole Reaktionen: aufbauend (Wachstum, Erneuerung, Speicher, ->benötigt Energie Katabole Reaktionen: abbauend, Energie gewinnend (ATP und Wärme) Essentielle
7a. Ernährung und Verdauung Der Metabolismus Anabole Reaktionen: aufbauend (Wachstum, Erneuerung, Speicher, ->benötigt Energie Katabole Reaktionen: abbauend, Energie gewinnend (ATP und Wärme) Essentielle
AMD kann das scharfe Sehen zerstören, das notwendig ist für Aktivitäten wie Lesen, Autofahren und für das Erkennen von Gesichtern.
 Was ist AMD? AMD (Altersbedingte Makuladegeneration) ist eine Erkrankung des Auges, bei der im Alter zu einer Schädigung der Stelle des schärfsten Sehens (Makula) kommt. AMD kann zum Verlust der Sehkraft
Was ist AMD? AMD (Altersbedingte Makuladegeneration) ist eine Erkrankung des Auges, bei der im Alter zu einer Schädigung der Stelle des schärfsten Sehens (Makula) kommt. AMD kann zum Verlust der Sehkraft
Aufgaben: 1. Beschrifte die folgende Abbildung mit den entsprechenden Begriffen, die unter der Abbildung stehen!
 Pflanzenzelle Kapitel 1 1. Beschrifte die folgende Abbildung mit den entsprechenden Begriffen, die unter der Abbildung stehen! Zellkern Vakuole Cytoplasma Zellwand Zellmembran Chloroplasten 2. Welcher
Pflanzenzelle Kapitel 1 1. Beschrifte die folgende Abbildung mit den entsprechenden Begriffen, die unter der Abbildung stehen! Zellkern Vakuole Cytoplasma Zellwand Zellmembran Chloroplasten 2. Welcher
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
GYMNASIUM ISERNHAGEN. Was essen eigentlich Pflanzen? Inhaltsbezogene Kompetenzen. Prozessbezogene. Medien/ Hinweise. fächerverbindende.
 Fachbereich Biologie GYMNASIUM ISERNHAGEN Schulinternes Curriculum 8. Jg. Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen (FW) Was essen eigentlich Pflanzen? Prozessbezogene Kompetenzen (EG, KK, BW) Medien/ Hinweise
Fachbereich Biologie GYMNASIUM ISERNHAGEN Schulinternes Curriculum 8. Jg. Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen (FW) Was essen eigentlich Pflanzen? Prozessbezogene Kompetenzen (EG, KK, BW) Medien/ Hinweise
Internet-Akademie. Streifzüge durch die Naturwissenschaften. Serie. Ökologie, Teil 3. Folge 11. Autor: Hans Stobinsky
 Serie Streifzüge durch die Naturwissenschaften Autor: Hans Stobinsky Ökologie, Teil 3 - 1 - Die Grundelemente einer Lebensgemeinschaft 1. Pflanzliche Solaranlagen als Energieversorger Da, wie in der letzten
Serie Streifzüge durch die Naturwissenschaften Autor: Hans Stobinsky Ökologie, Teil 3 - 1 - Die Grundelemente einer Lebensgemeinschaft 1. Pflanzliche Solaranlagen als Energieversorger Da, wie in der letzten
Dossier Klimawandel. Nachdem ihr nun zu zweit (oder alleine) die gegebenen Fragen diskutiert habt, sollt ihr eure Antworten
 Klasse: Datum: AB1 Nachdem ihr nun zu zweit (oder alleine) die gegebenen Fragen diskutiert habt, sollt ihr eure Antworten aufschreiben. Frage 1: Wo nimmt der Film seine Wende? Hast du damit gerechnet?
Klasse: Datum: AB1 Nachdem ihr nun zu zweit (oder alleine) die gegebenen Fragen diskutiert habt, sollt ihr eure Antworten aufschreiben. Frage 1: Wo nimmt der Film seine Wende? Hast du damit gerechnet?
- beschreiben Aufbau und beschreiben Aufbau und Funktion des menschlichen Skeletts und vergleichen es mit dem eines anderen Wirbeltiers.
 Stadtgymnasium Detmold Schulinternes Curriculum für das Fach Biologie Jahrgangsstufe 5 Stand: 20.06.2016 Klasse / Halbjahr 5.1 Inhaltsfelder Angepasstheit von Tieren an verschiedene Lebensräume (Aspekt
Stadtgymnasium Detmold Schulinternes Curriculum für das Fach Biologie Jahrgangsstufe 5 Stand: 20.06.2016 Klasse / Halbjahr 5.1 Inhaltsfelder Angepasstheit von Tieren an verschiedene Lebensräume (Aspekt
DOWNLOAD. Lineare Texte verstehen: Die Verdauung. Ulrike Neumann-Riedel. Downloadauszug aus dem Originaltitel: Sachtexte verstehen kein Problem!
 DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Lineare Texte verstehen: Die Verdauung Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich differenziert Was geschieht
DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Lineare Texte verstehen: Die Verdauung Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich differenziert Was geschieht
EG 1.4 zeichnen lichtmikroskopische. Präparate )
 Zellen, Fotosynthese und Zellatmung: 1. Lebewesen bestehen aus Zellen; 1.1 Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät FW 2.2 beschreiben Zellen als Grundeinheiten; beschreiben einzelne Zellbestandteile
Zellen, Fotosynthese und Zellatmung: 1. Lebewesen bestehen aus Zellen; 1.1 Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät FW 2.2 beschreiben Zellen als Grundeinheiten; beschreiben einzelne Zellbestandteile
Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn
 Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn 1 für die Sekundarstufe I Klassenstufe 5 Optional: Hund oder Katze; Rind oder 10 F 1.4, F2.4, Pferd F2.6, F3.2 -Tierhaltung und Tierpflege
Schulinternes Fachcurriculum Biologie Elsensee-Gymnasium Quickborn 1 für die Sekundarstufe I Klassenstufe 5 Optional: Hund oder Katze; Rind oder 10 F 1.4, F2.4, Pferd F2.6, F3.2 -Tierhaltung und Tierpflege
Sicher experimentieren
 Sicher experimentieren A1 Das Experimentieren im Labor kann gefährlich sein. Deswegen muss man sich an Regeln im Labor halten. Lies dir die 6 wichtigsten Regeln im Labor durch. 1. Kein Essen und Trinken
Sicher experimentieren A1 Das Experimentieren im Labor kann gefährlich sein. Deswegen muss man sich an Regeln im Labor halten. Lies dir die 6 wichtigsten Regeln im Labor durch. 1. Kein Essen und Trinken
