und Humanitäres Völkerrecht
|
|
|
- Ulrich Peters
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 19. Jahrgang 1/2006 Volume 19 1/2006 ISSN G10364 Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften Journal of International Law of Peace and Armed Conflict Special: Die Demokratische Republik Kongo Deutsches Rotes Kreuz Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht
2 Herausgeber: Deutsches Rotes Kreuz e.v., Generalsekretariat, Carstennstraße 58, Berlin-Steglitz, Tel. (0 30) , Fax (0 30) , Internet: Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV), Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Tel. (02 34) , Fax (02 34) , Internet: ISSN Manuskripte: Herausgeber und Redaktion haften nicht für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben werden, wenn Rückporto beigefügt ist. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor den Herausgebern alle Rechte für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts, insbesondere auch die Befugnis zur Einspeicherung in eine Datenbank sowie das Recht der weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege eines fotomechanischen oder eines anderen Verfahrens. Dem Autor verbleibt das Recht, nach Ablauf eines Jahres anderen Verlagen eine einfache Abdruckgenehmigung zu erteilen. Urheber- und Verlagsrechte: Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, bleiben vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung der Herausgeber in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- oder Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten. Fotokopien für den persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch dürfen nur von einzelnen Beiträgen oder Teilen daraus als Einzelkopien hergestellt werden. Bezug: Erscheinungsweise vierteljährlich; Inlands-Abonnementpreis jährlich EUR 33,00 (inkl. MwSt. 7% und Porto und Versand); Auslands- Abonnementpreis jährlich EUR 42,50 (inkl. Porto und Versand); Einzelheftpreis Inland: EUR 7,90 (inkl. MwSt. 7%, zzgl. Porto und Versand EUR 1,28); Einzelheftpreis Ausland: EUR 18,20 (inkl. Porto, Versand und Bankgebühren). Bestellungen unter DRK-Service GmbH, Geschäftsbereich Verlag, Berliner Straße 83, Berlin, Tel. (0 30) , Fax (0 30) , verlag@drkservice.de Das Abonnement kann nur schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende beim Verlag gekündigt werden. Verlag: DRK-Service GmbH, Geschäftsbereich Verlag, Berliner Straße 83, Berlin, Tel. (0 30) , Fax (0 30) , verlag@drkservice.de Druck: Mediengruppe UNIVERSAL, Kirschstraße 16, München, Tel. (0 89) , Fax (0 89) , Internet: Redaktion: Prof. Dr. Horst Fischer, Bochum; verantwortlicher Redakteur dieser Ausgabe: Dozent Dr. Hans-Joachim Heintze, Bochum; Redaktionsassistentin: Dr. Noëlle Quénivet LL.M., Bochum Ständige Mitarbeiter: Georg Bock, Bochum; Dr. Cristina Churruca Muguruza, Bochum; Prof. Dr. Dennis T. G. Dijkzeul, Bochum; Prof. Dr. Wolff Heintschel v. Heinegg, Frankfurt (Oder); Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Knut Ipsen, Bochum; Prof. Dr. Claus Kreß LL.M., Köln; Prof. Dr. Thilo Marauhn, Gießen; Michaela Schneider, Bochum; Gregor Schotten, Berlin; Dr. Heike Spieker, Berlin; Prof. Dr. Joachim Wolf, Bochum; Dr. Messeletch Worku LL.M., Bochum Korrespondierende Mitarbeiter: Dr. Andreas v. Block-Schlesier, Brüssel; Ralph Czarnecki LL.M., Berlin; Dr. Knut Dörmann, Genf; Dr. Robert Heinsch LL.M., Den Haag; Dr. Avril J.M. McDonald M.A., LL.M., Den Haag; Dr. Sascha Rolf Lüder, Bochum
3 Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften (HuV-I) Journal of International Law of Peace and Armed Conflict (JILPAC) 19. Jahrgang 1/2006 Volume 19 1/2006 Editorial 3 Special: Die Demokratische Republik Kongo Der Transitionsprozess in der Demokratischen Republik Kongo: eine Zwischenbilanz vor den Wahlen Denis Tull 5 Lage der Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo Kalala Ilunga Matthiesen 11 Kostenbeteiligung bei der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in 17 Gesundheitszonen in einer Provinz im Osten der Demokratischen Republik Kongo Erfahrungen von Malteser International Alfred Kinzelbach und Peter Schmitz 20 Weakening and Building Capacities in the Eastern Democratic Republic of the Congo Dennis Dijkzeul 28 Beiträge / Notes and Comments Artikel / Articles The Rome Statute s Sexual Related Crimes: An Appraisal under the light of International Humanitarian Law Tathiana Flores Acuña 39 Operieren private Sicherheits- und Militärfirmen in einer humanitär-völkerrechtlichen Grauzone? Christian Schaller 51 Verbreitung / Dissemination Genozid Eine Zwischenbilanz der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien Andreas Bummel und Frank Selbmann 58 Fallstudien / Case Studies Der Primat der Politik im Spannungsfeld von Krieg und Frieden Ulf Häußler 67 Panorama / Panorama Konferenzen / Conferences Jubiläumskonferenz des Internationalen Instituts für Humanitäres Völkerrecht (IIHL) in San Remo (Italien), September 2005 Alexander Wallau 78 Buchbesprechungen / Book Reviews Werner Link, Die Neuordnung der Weltpolitik. Grundprobleme globaler Politik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert Sergej Sajapin 80 Mashood A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law Phillip Tahmindjis 81 Hans Blix, Disarming Iraq Noelle Higgins 83 Emmanuel Mourlon-Druol, La stratégie nord-américaine après le 11 Septembre un réel renouveau? Christian Lentföhr 84 Tom Gallagher, The Balkans in the New Millennium: In the Shadow of War and Peace Emilian Kavalski 85 Susan Marks and Andrew Clapham, International Human Rights Lexicon Wolf-Dieter Eberwein 86 Antonio Donini, Larry Minear, Ian Smilie, T. van Baarda, und Anthony C. Welch, Mapping the Security Environment: Understanding the Perceptions of Local Communities, Peace Support Operations and Assistance Agencies Sven Peterke 86 Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften / Journal of International Law of Peace and Armed Conflict 1
4 ABC springer.de Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Hrsg.: A. von Bogdandy, R. Wolfrum Die Vereinbarkeit von Militärgerichten mit dem Recht auf ein faires Verfahren gemäß Art. 6 Abs. 1 EMRK, Art. 8 Abs. 1 AMRK und Art. 14 Abs. 1 des UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte J. Bucherer, Düsseldorf Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen militärgerichtliche Strafverfahren gegen Zivilpersonen. Die Frage, inwiefern solche Verfahren mit dem Recht auf ein faires Verfahren vereinbar sind, beschäftigt internationale Spruchkörper und Gremien seit längerem. Prüfungsmaßstab sind drei Konventionen: die EMRK, die AMRK und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Die Arbeit systematisiert zunächst die vorhandene Spruchpraxis. Sie geht dann der Frage nach, ob es ein Recht auf ein zuständiges Gericht gibt bzw. wie sich ein solches Recht konstruieren lässt. Ausführungen zu besonderen Problemen im Kontext von Ausnahmezuständen und eine Betrachtung der U.S.-amerikanischen Militärkommissionen im Nachtrag runden die Analyse ab XVII, 307 S. (Bd. 180) Geb. ISBN ,95 sfr 124,00 Bei Fragen oder Bestellung wenden Sie sich bitte an Springer Distribution Center GmbH, Haberstr. 7, Heidelberg Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) SDC-bookorder@springer.com Die -Preise für Bücher sind gültig in Deutschland und enthalten 7% MwSt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Springer-Verlag GmbH, Handelsregistersitz: Berlin-Charlottenburg, HR B Geschäftsführer: Haank, Mos, Gebauer, Hendriks a
5 Editorial Die Demokratische Republik Kongo kann als ein bedauerliches Beispiel eines zerfallenden Staatswesens angesehen werden. Ihre Geschichte markiert einen ständigen Niedergang. Nach der jahrzehntelangen Herrschaft Präsident Mobutus ( ), die durch eine maßlose Korruption gekennzeichnet war, brach 1996 ein bewaffneter Konflikt aus, da sich die Nachbarstaaten von den Rebellen im Kongo bedroht fühlten. Auch die Machtergreifung des Rebellenführers Kabila 1997 brachte dem geschundenen Land keinen Frieden, denn schon 1998 kam es zu einem neuen Krieg in der gesamten Region der Großen Seen. Viele Staaten sind seither mehr oder weniger militärisch involviert. Ruanda und Uganda unterstützten die kongolesischen Aufständischen, die Kabila stürzen wollten, während Angola, Zimbabwe und Namibia dessen Macht zu erhalten versuchten. Praktisch brachte das die Teilung des Landes mit sich. Von 1998 bis 2002 kamen rund 3,8 Millionen Menschen zu Tode, so dass sich nun mit allem Nachdruck die Frage auftut, welchen Beitrag die internationale Gemeinschaft geleistet hat und leisten kann, um diesen Konflikt wirksam und dauerhaft zu beenden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die sorgfältige wissenschaftliche Analyse der Ursachen und Ausformungen des Konflikts sowie die Einschätzung und Bewertung der Möglichkeiten und der unternommenen Aktivitäten. Die Redaktion freut sich, dass Dr. Dennis Dijkzeul, Juniorprofessor am Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht, der seit Jahren Forschungen zum Kongo-Konflikt betreibt, ein HuVI-Special zusammengestellt hat. In diesem Rahmen äußern sich Denis M. Tull (Berlin) zum Transitionsprozess, Kalala Ilunga Matthiesen (Lubumbashi) zur Menschenrechtssituation, Alfred Kinzelbach/Peter Schmitz von den Maltesern International zur Gesundheitsversorgung im Osten Kongos. Dennis Dijkzeul untersucht, wie internationale humanitäre Organisationen im Ostkongo, die verschiedentlich unwillentlich die lokalen Kapazitäten geschwächt haben, nunmehr Alternativen für den Kapazitätsaufbau entwickeln. Alle Beiträge machen deutlich, dass der Kongo sich in einer höchst schwierigen Phase seiner Entwicklung befindet. Die Artikel in der Rubrik Beiträge wenden sich wiederum Fragen des humanitären Völkerrechts zu. Im Zentrum steht die internationale Strafgerichtsbarkeit, und zwar einerseits hinsichtlich der Abstrafung völkerrechtlicher Verbrechen mit sexuellem Hintergrund und andererseits in Bezug auf Auseinandersetzung des Jugoslawientribunals mit dem Genozid-Verbrechen. Ein weiterer Beitrag von Christian Schaller setzt sich mit dem humanitärvölkerrechtlich komplizierten Status privater Sicherheits- und Militärfirmen auseinander. Wie gewohnt schließen sich am Ende des Heftes Konferenzberichte und Rezensionen an. Last but not least erlaubt sich die Redaktion wiederum den Hinweis, dass alle Beiträge in den Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften die Meinungen der Autoren reflektieren. Die Redaktion identifiziert sich nicht notwendigerweise mit deren Positionen. Die Redaktion Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften / Journal of International Law of Peace and Armed Conflict 3
6 12. DRK-Kurs im Humanitären Völkerrecht Berlin, August 2006 Der Kurs richtet sich vorrangig an Jurastudenten höherer Semester, an Rechtsreferendare und andere junge Juristen, die ihre Kenntnisse im humanitären Völkerrecht vertiefen möchten. Unter entsprechenden Voraussetzungen sind auch Studierende und junge Absolventen anderer Fachbereiche herzlich willkommen. Da einzelne Kursteile in englischer Sprache stattfinden, sind gute Englischkenntnisse die Bedingung für eine Teilnahme. Im Anschluss an den Kurs besteht die Möglichkeit, aufgrund einer schriftlichen Arbeit ein von den Kursveranstaltern ausgestelltes Diplom zu erwerben. Der Kurs beinhaltet Vorlesungen und Gruppenarbeiten zu den grundsätzlichen und aktuellen Themenstellungen des humanitären Völkerrechts. Einführung in das Humanitäre Völkerrecht Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Knut Ipsen, eh. Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Berlin - angefragt Anwendungsbereiche des Humanitären Völkerrechts Die Konflikttypen Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg, Europa Universität Viadrina, Frankfurt. a.d.o. Internationale Hilfsaktionen des Deutschen Roten Kreuzes Aktuelle Herausforderungen und Beispiele Dr. Johannes Richert, Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat, Berlin Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und das Humanitäre Völkerrecht Grundlagen und Einsatzfelder Dr. Toni Pfanner, Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf Kombattanten und Nichtkombattanten Der Kriegsgefangenenstatus Dr. Noelle Quénivet, LL.M., Ruhr-Universität Bochum Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte Prof. Dr. Horst Fischer, Ruhr-Universität Bochum Die UN-Charta und das Humanitäre Völkerecht Prof. Dr. Manfred Mohr, Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat, Berlin Mittel und Methoden der Kampfführung Waffenverbote und Abrüstung Dr. Thomas Desch, Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien Durchsetzung des Humanitären Völkerrechts Dr. Heike Spieker, Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat, Berlin Der Internationale Strafgerichtshof und das Völkerstrafrecht: Entwicklung, Stand, Perspektiven Dr. Robert Heinsch, LL.M., Internationaler Strafgerichtshof, Den Haag Kriegsverbrecherprozesse Fallbeispiele / Moot Court Dr. Robert Heinsch, LL.M., Internationaler Strafgerichtshof, Den Haag Das Humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte Dr. Hans-Joachim Heintze, Ruhr-Universität Bochum Die Arbeit des Deutschen Instituts für Menschenrechte Frauke Seidensticker, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin Der Kurs wird vom Deutschen Roten Kreuz, Generalsekretariat unter Mitwirkung des Instituts für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum veranstaltet und findet in Berlin statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Die Teilnehmergebühr für den Kurs beinhaltet Dokumentationsmaterial, Unterbringung in Doppelzimmern sowie Verpflegung und beträgt 300,00. Bewerbungen mit Lichtbild, die Angaben zur Person insbesondere Nachweise über erbrachte Studien- bzw. Examensleistungen enthalten, richten Sie bitte bis 30. Mai 2006 an: Ruhr-Universität Bochum, IFHV, Prof. Dr. Horst Fischer, Geb. NA 02/33, Bochum (Tel / ) Stand:
7 Special: Die Demokratische Republik Kongo Der Transitionsprozess in der Demokratischen Republik Kongo: eine Zwischenbilanz vor den Wahlen Denis M. Tull* After four years of warfare in the DR Congo, Congo s warring factions signed a peace deal in late 2002, which formally ended the conflict. The peace agreement stipulated a power-sharing agreement and the formation of an all-inclusive government of national unity, which is supposed to lead the war-torn country to the first free elections since independence. Due to the stagnation of the transition process, elections are only likely to take place after a one-year delay (in spring 2006). This article takes stock of the achievements and failures of the transition process in the DRC after two years of transitional government. The limited successes of the process contrast sharply with a vast number of problems. These include massive corruption and a lack of political will within the government to move the transition process forward, stagnation of security sector reform and the overall failure of the coalition partners to extend state authority throughout Congo s territory. Left unresolved, these challenges may derail the electoral process as they provide spoilers with opportunities to re-initiate violence. Moreover, and provided elections will take place, there is a real danger that the international community will equate the transition process with a peace process. However, even under the best of circumstances, elections will not be sufficient to bring about lasting peace in the DRC as many deep-rooted sources of conflict remain (such as impunity and lawlessness, corruption, contested citizenship of minorities, and security concerns of neighbouring countries). 1. Einleitung Die Demokratische Republik Kongo gilt heute als paradigmatischer Fall eines gescheiterten Staates. 1 Der drei Jahrzehnte dauernden repressiven und korrupten Herrschaft Präsident Mobutus ( ) folgte der erste Kongo-Krieg. Ausgelöst wurde er durch die sicherheitspolitischen Bedrohungen, für die Nachbarstaaten (Angola, Burundi, Ruanda, Uganda), die von Rebellengruppen innerhalb des Kongos ausgingen. Der Krieg endete mit der Machtergreifung des von den Nachbarländern unterstützten Rebellenführers Laurent Desiré Kabila. Kaum ein Jahr später brach der zweite Kongo-Krieg aus, der die gesamte Region der Großen Seen erneut in eine Gewaltspirale riss. Ruanda und Uganda unterstützten kongolesische Rebellengruppen, die zum Sturz Kabilas aufriefen, dem Angola, Zimbabwe und Namibia zu Hilfe eilten. Infolgedessen kam es zur effektiven Teilung des Landes in drei konkurrierende Gebiete, die von Kabila und diversen Rebellen und ihren ausländischen Mentoren kontrolliert wurden. Zwischen 1998 und 2002 starben ca. 3,8 Millionen Menschen an den direkten und indirekten Folgen des Konflikts. Damit stellt der Kongo den Schauplatz des tödlichsten Krieges seit dem 2. Weltkrieg dar. Vor etwa drei Jahren, am 16. Dezember 2002, wurde der Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo unterzeichnet, mit dem der im August 1998 ausgebrochene Krieg in der DR Kongo formell beendet wurde. Die Konfliktparteien die ehemalige Regierung unter Präsident Joseph Kabila, der Nachfolger von Laurent Kabila und die diversen Rebellengruppen (im Wesentlichen RCD und MLC) 2 sowie Vertreter der politischen Opposition und der Zivilgesellschaft einigten sich darin auf einen Fahrplan, der den Frieden konsolidieren und zur Herstellung einer neuen verfassungsmäßigen Ordnung führen sollte. Zentraler Baustein dieses Plans war die Bildung einer parteiübergreifenden Regierung für eine zwei-, höchstens aber dreijährige Übergangsphase. Unter ihrer Ägide sollten die notwendigen Voraussetzungen für einen politischen Neuanfang in der Nachkriegszeit geschaffen werden. Den Abschluss der Übergangsphase sollen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen bilden, in deren Folge eine neue, demokratisch gewählte Regierung die Amtsgeschäfte übernehmen soll. Ungeachtet des Transitionsprozesses bleibt die humanitäre Lage dramatisch. Bis zur Jahresmitte 2005 blieben mehr als 2,3 Millionen Kongolesen Flüchtlinge in ihrem eigenen Land (2003: 3,4 Millionen.). 3 Alleine im Distrikt Ituri hielten sich Binnenvertriebene auf. 4 Der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zufolge muss die Mehrheit der kongolesischen Bevölkerung mit etwa $ 0,3 pro Tag auskommen. Zwischen 45 und 67% der Bevölkerung haben keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten. 5 Schätzungsweise Menschen sterben täglich an den indirekten wie direkten Folgen des Konflikts. Damit hatte sich die humanitäre Situation für die Mehrzahl der Kongolesen trotz des Friedensabkommens von 2002 keineswegs verbessert. Bemerkenswerterweise wirkte sich die extrem schwierige Situation im Kongo auch auf die mittlerweile Mann starke UN-Mission im Kongo (MONUC) aus, die nach Angaben der UN unter einem sehr hohen Personalverschleiß leidet. Im Durchschnitt kamen seit Januar 2004 auf drei neu eingestellte Mitarbeiter der MONUC zwei, die die Mission verließen. 6 Nach einem einleitenden Überblick über den gegenwärtigen Stand der Transition wird der Artikel die zentralen Problem- * Dr. phil. Denis M. Tull ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten und Afrika der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin (Deutschland). 1 Das ehemalige Zaire wurde 1997 in DR Kongo umbenannt. 2 Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD); Mouvement pour la Libération du Congo (MLC). Die RCD besetzte während des Krieges weite Teile Ostkongos und wurde von Rwanda unterstützt. Die MLC kontrollierte den Norden und war mit Uganda verbündet. 3 Global IDP Project, DR Congo: Renewed Fighting, Killing, Rapes Slows down IDP Return and Cause New Displacements, 29. Juli 2005, unter: ,000 still Displaced in Volatile DR Congo Region, Say Aid Groups, in: AFP v. 5. August Access to Health Care no Better now than During the War, in: IRIN News v. 15. November UN Doc. S/2005/506 v. 2. August 2005, Ziff. 79. Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften / Journal of International Law of Peace and Armed Conflict 5
8 Special: Die Demokratische Republik Kongo felder skizzieren, die einen erfolgreichen Abschluss des Übergangsprozesses verhindern könnten. Dabei handelt es sich um 1. Korruption und Missmanagement innerhalb der Übergangsregierung, 2. die mangelnden Fortschritte im Bereich der Reform des Sicherheitssektors, 3. die anhaltenden sicherheitspolitischen Risiken in den Randgebieten des Landes. Der Artikel argumentiert, dass ohne die rasche Lösung dieser Probleme die Perspektiven für die Durchführung fairer und freier Wahlen düster sind. Aber selbst unter günstigeren Bedingungen wird die Herstellung und Konsolidierung von Frieden im Land viele Jahre in Anspruch nehmen. 2. Der Stand der Dinge Als die kongolesische Übergangsregierung im Juni 2003 ihr Amt antrat war allen Beteiligten klar, dass das Überleben der Regierung, geschweige denn ihre effektive Handlungsfähigkeit, keineswegs vorausgesetzt werden konnte. Denn die Regierung war das Produkt eines Kompromisses, der den ehemaligen Kriegsgegnern unter erheblichem internationalem Druck abgerungen worden war. Erwartungsgemäß fällt die Bilanz des Transitionsprozesses nach knapp zweieinhalb Jahren dürftig aus. Zwar ist die Allparteienregierung nicht kollabiert, sie ist aber bei der Umsetzung der verabredeten Schritte vieles schuldig geblieben, und die substantiellen Probleme des Landes sind weit von einer Lösung entfernt. Dazu zählen die Erarbeitung notwendiger Gesetzesvorhaben und Verfassungsbestimmungen, die Reform des Sicherheitssektors, die Demobilisierung und Reintegration der Kombattanten sowie der Aufbau einer einheitlichen nationalen Armee und Polizei. Auch die Problematik der Präsenz ruandischer Hutu-Milizen im Osten des Kongo bleibt ungelöst. Die internationale Gemeinschaft (UN, Geber, MONUC) zog erst im Frühjahr 2005 die Konsequenzen aus der politischen Stagnation und erhöhte ihren Druck auf die teils handlungsunfähige, teils handlungsunwillige Regierung in Kinshasa, um den holprigen Übergangsprozess doch noch zum Erfolg zu führen. Diese verspätete Reaktion konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die ursprünglich für Juni angesetzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen auf 2006 verschoben werden mussten. 7 Tabelle 1: Zeitplan für die Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo Juni: Das Parlament stimmt einer Verlängerung der Übergangsfrist um sechs Monate zu. 20. Juni: Registrierung der 28 Millionen wahlberechtigten Kongolesen beginnt 18. Dez.: Volksabstimmung über die Verfassung Dez.?: Benötigte Abstimmung des Parlaments für die Verlängerung der Übergangsfrist um weitere sechs Monate Jan.: Stichtag für die Kandidatenregistrierung März: Parlaments-, Präsidentschafts-, Provinz- und Kommunalwahlen 30. Apr.: Zweite Runde der Präsidentschaftswahl (falls nötig) und Wahlen der Senatoren durch die Regionalversammlungen Während die Regierung die Notwendigkeit dieses Schrittes bis zuletzt leugnete, hatte die Unabhängige Wahlkommission (Commission électorale indépendante/cei) bereits im Januar 2005 darauf aufmerksam gemacht, dass der Wahltermin aufgrund zahlreicher Probleme (u. a. fehlende gesetzliche Grundlagen, Logistik) nicht eingehalten werden könne. Diese Ankündigung wurde von der Bevölkerung zunächst als Versuch der Regierung interpretiert, ohne Wahlen im Amt bleiben zu können. Bei den anschließenden Demonstrationen in Kinshasa wurden drei Menschen von der Polizei erschossen. Zu weiteren Vorfällen kam es im Mai 2005 in den Kasai-Provinzen. Nachdem schließlich von Regierungsseite bestätigt wurde, dass die Wahlen nicht wie ursprünglich vorgesehen spätestens am 30. Juni (dem 45. Jahrestag der Unabhängigkeit Kongos) stattfinden könnten, nahmen die Spannungen in der Hauptstadt Kinshasa zu. Die größte Oppositionspartei des Landes, die von Etienne Tshisekedi geführte Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), rief die Bürger zu Streiks und Demonstrationen auf, um eine Verschiebung der Wahlen zu verhindern. Der Aufruf fand unter der kriegsmüden Bevölkerung jedoch wenig Resonanz, obgleich die Unzufriedenheit über die Regierung und das Ausbleiben greifbarer sozialer und wirtschaftlicher Fortschritte beträchtlich waren. Aus Sicht vieler Kongolesen scheinen die Wahlen und die Regierungsübernahme einer demokratisch legitimierten Regierung die einzige Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Situation zu sein. Gefördert wurde dies im Jahresverlauf 2005 durch den vergleichsweise überraschend effizienten Verlauf der Wählerregistrierung im Land. Sie begann nach etlichen Verzögerungen am 20. Juni in Kinshasa und wurde danach auf die Provinzen ausgedehnt. Bis Anfang Oktober hatte die CIE an Registrierstellen ca. 15 Millionen der geschätzten 25 Millionen stimmberechtigten Wähler in Listen eingetragen. 10 Dieser Teilerfolg war vor allem der massiven logistischen Unterstützung der MONUC zu verdanken. In Anbetracht des nahezu vollständigen Fehlens von Infrastrukturen im Kongo stellte sie fast ihre gesamte Flotte (Helikopter, Flugzeuge) zur Verfügung, um Computer und Ausstattung in die Provinzen zu fliegen. Trotz erwarteter Sicherheitsprobleme verlief auch in der volatilen Provinz Nord-Kivu der Registrierprozess erfolgreich und mehr als 90% der Wahlberechtigten trugen sich in das Wählerregister ein. Die CEI geht davon 7 Die Möglichkeit einer Verschiebung der Wahlen um bis zu zwölf Monate war im Transitionsabkommen vorgesehen. 8 The Economist Intelligence Unit, DR Congo Country Report, September 2005, S Die Datumsangaben sind davon abhängig, ob die Verfassung angenommen wird und nach der Volksabstimmung ein Wahlgesetz erlassen wird. 10 UN Pressekonferenz, New York, 6. Oktober /2006
9 Special: Die Demokratische Republik Kongo aus, dass für die Durchführung der Wahlen Wahlbüros und Wahlhelfer nötig sein werden. Die Kosten für die Wahlen belaufen sich auf etwa $ 430 Millionen und werden von internationalen Gebern getragen, insbesondere der EU. 3. Korruption und Missmanagement Seit dem Beginn der Transition stand für die internationale Gemeinschaft vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob die Regierung die für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen notwendigen Schritte unternimmt. Im Zuge dessen wurde jedoch fast vergessen, dass der Riege unter Präsident Kabila auch die Aufgabe zukam, die DR Kongo zu regieren, d.h. den Wiederaufbau des kriegszerrütteten Landes einzuleiten und elementare staatliche Dienstleistungsfunktionen zu erfüllen. Wie der Blick auf die humanitäre Situation bereits angedeutet hat, erwies sich diese Hoffnung für die breite Bevölkerung jedoch als weitgehend illusorisch. Deren Frustration wurde unter anderem durch die Tatsache genährt, dass die Regierungsmitglieder vor allem eigene (materielle) Interessen verfolgten. Dies war bereits in der Konstruktion der aufgeblähten Übergangsinstitutionen angelegt, in der alle Parteien ihren Platz finden mussten. Bereits die Gehälter und Zuwendungen für die Regierung (der Präsident, vier Vize- Präsidenten und 36 Minister) und das Parlament (500 Abgeordnete, 120 Senatoren) sind erheblich. Noch schwerwiegender sind jedoch die illegalen Bereicherungschancen, die sich aus der Größe und Art des Machtapparates ergeben. Die im November 2004 erfolgte Suspendierung und spätere Entlassung von sechs Ministern und Direktoren von zwölf Staatsunternehmen bleibt bis heute der einzige Fall, in dem gegen korrupte Amtsträger vorgegangen wurde. 11 Es liegen zahlreiche Hinweise darauf vor, dass Korruption und Veruntreuung den gesamten Regierungsapparat durchziehen. Dass dies keine Sanktionsmaßnahmen nach sich zieht, liegt unter anderem daran, dass die Mitglieder aller Regierungsparteien an dieser Schattenwirtschaft beteiligt sind. Sie sehen einer ungewissen politischen Zukunft entgegen und sind offenbar darum bemüht, ihre kurze Amtsperiode zur größtmöglichen Selbstbereicherung zu nutzen. 12 Exemplarisch kann auf den im Mai 2005 vorgelegten Bericht einer parlamentarischen Untersuchungskommission unter Leitung von Christophe Lutundula verwiesen werden, deren Aufgabe es war, die Legalität aller Verträge (vor allem im Bergbausektor) zu untersuchen, die der kongolesische Staat in den Kriegsjahren zwischen und abgeschlossen hatte. Der Bericht wurde bis heute nicht veröffentlicht, und es gilt als sicher, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass darin hochrangige Regierungsmitglieder der Korruption und illegalen Veräußerung staatlicher Vermögenswerte überführt werden. 13 Darüber hinaus sollen mehr als 50% der staatlichen Ausgaben außerhalb des regulären Budgets abfließen. Allein der Präsident und seine vier Vize- Präsidenten sollen ihren Finanzrahmen um 300% überschritten haben, während öffentliche Angestellte keine oder nur sehr niedrige Löhne beziehen. Streikende Gewerkschaftler, die gegen diese Missstände demonstrierten, wurden verhaftet. 14 Diese Situation führt die Forderungen der Geber nach dem Aufbau effektiver staatlicher Institutionen ad absurdum. Besonders gravierend wirkt sich dies auf die im Aufbau befindliche nationale Armee und die Reform des Sicherheitssektors aus (siehe unten). Die Geber, die mehr als 50% des staatlichen Budgets finanzieren, haben bislang wenig Bereitschaft gezeigt, der Korruption innerhalb der Transitionsregierung Einhalt zu gebieten. Hinter dieser Zurückhaltung steht die Furcht, Sanktionen oder das Einfrieren von Zuwendungen könnten den fragilen Transitionsprozess destabilisieren. Ende August übermittelte das internationale Komitee zur Unterstützung der Transition (CIAT), in dem die wichtigsten Geber und die MONUC vertreten sind, an Präsident Kabila den Entwurf eines Konzepts zur Gründung einer gemeinsamen Kommission aus Regierung und Gebern, die Good Governance und finanzielle Kontrollmechanismen stärken sollte. Ähnliche Gremien bestehen bereits zur Förderung wichtiger Gesetzgebungsverfahren, der Sicherheitssektorreform und der Vorbereitung der Wahlen. Sie sind ein Beleg dafür, dass Regierung und internationale Gemeinschaft nicht dieselben Interessen verfolgen und der Erfolg der Transition wesentlich vom Engagement der internationalen Gemeinschaft abhängt. Dass dies dem vielzitierten Prinzip der kongolesischen Ownership zuwiderläuft mag zu bedauern sein, aber es ist ohnehin mehr als fraglich, ob die Übergangsregierung, deren Mitglieder das Land während des Krieges systematisch zugrunde gerichtet haben, von der breiten Bevölkerung als Repräsentant ihrer Interessen betrachtet werden. Im Folgenden werden einige der zentralen Probleme skizziert, deren Lösung für den erfolgreichen Abschluss des Transitionsprozesses im Kongo von entscheidender Bedeutung ist. 4. Der Aufbau einer nationalen Armee Der Aufbau einer nationalen Armee (Forces Armées de la République Démocratique du Congo/FARDC), in die die Kombattanten der verschiedenen kongolesischen Konfliktparteien integriert werden sollen, stellt die vielleicht wichtigste Herausforderung auf Kongos langem Weg zur Herstellung von Frieden und Staatlichkeit dar. 15 Im Idealfall liefe dieser Prozess erstens auf die Reduzierung irregulärer autonomer Verbände hinaus (Milizen, Rebellengruppen), die gerade im Hinblick auf die Wahlen und deren Ausgang eine potentiell große Gefahr darstellen. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass Wahlverlierer in die gewaltsame Opposition gehen werden. Der Aufbau einer Armee ist zweitens notwendig, um das staatliche Gewaltmonopol herzustellen, das auch 11 D.M. Tull, in: A. Mehler et al. (Hsg.), Africa Yearbook 2004: Politics, Economy and Society South of the Sahara, Leiden 2005, S Follow the Money, in: Africa Confidential v. 4. November Politicians on Notice, in: Africa Confidential v. 4. November Congo: Unpublished Report on War Contracts May Rock President, in: SouthScan v. 1. November Vgl. H. Boshoff, Update on the Status of Army Integration in the DRC, Pretoria, Institute for Security Studies, Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften / Journal of International Law of Peace and Armed Conflict 7
10 Special: Die Demokratische Republik Kongo drei Jahre nach dem offiziellen Kriegsende nicht in Sicht ist. Drittens sind effektive Armeeeinheiten notwendig, um gegen die ruandischen Hutu-Milizen im Ostkongo vorzugehen. Sie können jederzeit eine erneute militärische Intervention Ruandas provozieren, die vermutlich das Ende des Friedensprozesses im Kongo bedeuten würde. Die MONUC verfügt nach wie vor nicht über ein Mandat des UN-Sicherheitsrates, das eine gewaltsame Entwaffnung der Milizen legitimieren würde. 16 Ob die Überlegungen der Afrikanischen Union, afrikanische Truppen in den Kongo zu entsenden, umgesetzt werden können, bleibt mehr als zweifelhaft. Obwohl in Kinshasa ein integrierter Militärstab gebildet wurde, bleiben die meisten Kombattanten von dieser Maßnahme unberührt. Die früheren Kriegsgegner sind zurückhaltend, ihre Truppen einem gemeinsamen Kommando zu unterstellen. In Anbetracht des ungewissen Ausgangs des Übergangsprozesses neigen sie dazu, die Verfügbarkeit über ihre eigenen Kontingente als letzte und einzige Trumpfkarte zu betrachten. Parallele und rivalisierende Militär- und Kommandostrukturen bestehen daher weiterhin fort und die nationale Armee existiert im Wesentlichen nur auf dem Papier. 17 Die Übergangsregierung legte erst im Mai 2005 ihren Plan zum Aufbau einheitlicher nationaler Streitkräfte vor. Dank der Unterstützung diverser Geber konnten bis Oktober 2005 immerhin sechs integrierte Brigaden (à Soldaten) formiert werden. Allerdings vermitteln die Probleme, mit denen die bereits bestehenden Einheiten konfrontiert sind, einen Eindruck von der mangelnden Durchschlagskraft dieser Verbände. Maßgebliche Verantwortung für diese Missstände trägt vor allem die korrupte Transitionsregierung. 18 Die Folgen sind niedrige und unregelmäßige Soldauszahlungen an die bestehenden Einheiten, die mit rudimentärer militärischer und logistischer Ausrüstung auskommen müssen. In der Regel erhalten die Einheiten nicht einmal Nahrung, Medikamente, Uniformen oder Benzin. 19 Die Soldaten sind daher dazu gezwungen, auf dem Rücken der Bevölkerung zu leben, zu deren Schutz sie eigentlich entsandt werden. 20 Unter diesen Umständen kann von operativen Armeetruppen kaum die Rede sein, die in- wie ausländischen nicht-staatlichen Gewaltakteuren etwas entgegenzusetzen hätten. Das Ausmaß, in dem die systematische Veruntreuung von öffentlichen Mitteln den Aufbau des Staates im Allgemeinen und der Armee im Besonderen verhindert, zeigt sich in den Ergebnissen eines Zensus, den südafrikanische Experten durchgeführt haben. Während die Regierung bislang angab, die Zahl der Soldaten aus den unterschiedlichen Kriegsparteien, die die Sicherheitsreform durchlaufen müssten, beliefe sich auf Mann, kam der Zensus zu dem Ergebnis, dass lediglich zwischen und dieser Soldaten tatsächlich existierten. Da das staatliche Budget Soldaten zugrunde legt, für deren Soldzahlungen jeden Monat $ 8 Millionen an die Militärführung fließen, ist davon auszugehen, dass monatlich zwischen $ 2 3 Millionen von Generälen und anderen Staatseliten privatisiert, d.h. illegal entwendet werden. 21 MONUC und die Europäische Union haben Maßnahmen zur Eindämmung dieser Praxis angekün- digt. Sollten sie nicht zum Erfolg führen, dürfte auch die bis zu den Wahlen geplante Aufstellung weiterer 12 integrierter kongolesischer Armeebrigaden wirkungslos bleiben. In diesem Fall wird die MONUC auf absehbare Zeit der einzige Akteur sein, der die Sicherheitslage im Land zumindest teilweise garantieren kann. Nur unwesentlich effizienter gestalten sich bislang Reform und Aufbau der nationalen Polizeieinheiten. Neben der Regierung tragen auch die internationalen Geber einen Teil der Verantwortung für die mäßigen Fortschritte. Belgien, Südafrika, Angola und die EU führen zwar unabhängig voneinander einzelne Projekte im Bereich der Sicherheitssektorreform durch, die mangelnde Koordinierung dieser bilateralen Maßnahmen hat aber greifbare und breitenwirksame Resultate bislang verhindert. 22 Problematisch bleibt weiterhin auch das Schicksal jener Kombattanten, die nicht in die Armee integriert werden wollen oder können. Ein erheblicher Teil der demobilisierten Kämpfer hat bislang noch keinerlei Unterstützung zur Reintegration in das zivile Leben erhalten. Ähnlich wie in anderen Postkonfliktländern könnte das Ausbleiben versprochener Hilfsmaßnahmen diese Kombattanten dazu veranlassen, sich erneut bewaffneten Gruppen anzuschließen. 5. Brennpunkte und Konfliktpotentiale In Anbetracht der begrenzten Fortschritte bei der Sicherheitssektorreform und dem Aufbau einer nationalen Armee ist es wenig verwunderlich, dass sich die Sicherheitslage im Land seit dem Amtsantritt der Übergangsregierung kaum verbessert hat. Dies betrifft in besonderem Maße die im Osten des Langes gelegenen Provinzen Nord-Kivu, Süd-Kivu, Katanga und den Distrikt Ituri. Während der unmittelbare Grund hierfür offensichtlich mit der Stagnation der Reform des Sicherheitssektors (Armeeaufbau, Demobilisierung) verbunden ist, liegen die Kernursachen für diese bedenkliche Situation tiefer. Denn die scheinbare Inklusivität des Transitionsprozesses verdeckt die Tatsache, dass das Übergangsarrangement im Kongo nur scheinbar die Interessen aller in der Regierung vertretenen Konfliktparteien reflektiert. Zum einen darf nicht übersehen werden, dass die Regierung eine zusammengewürfelte Koalition ehemaliger Kriegsgegner darstellt, deren Beziehungen nach wie vor durch ein tief sitzendes wechselseitiges Misstrauen gekennzeichnet sind. Der Fortbestand paralleler administrativer und militärischer Strukturen, die eigentlich unter dem Dach der Zentralregierung fusioniert werden sollten, macht dies offenkundig; zum anderen dürfen die Koalitionsmitglieder nicht als homogene 16 Allerdings wäre ein gewaltsames Vorgehen gegen die Milizen unter Verweis auf den Schutz der Zivilbevölkerung berechtigt. Dies wird jedoch von der MONUC nicht getan. 17 Crisis Group, Congo Action Plan, Brüssel/Nairobi 2005, S Politicians On Notice, a.a.o. (Fn. 10). 19 UN Doc. S/2005/603 v. 26. September 2005, Ziff J. Sterns, Ces invisibles assassins du Congo, in: Le Soir v. 17. November F. Misser, Fiktive Soldaten halten Kongos Generäle reich, in: Die Tageszeitung v. 15. November 2005, S Crisis Group, a.a.o. (Fn. 13), S /2006
11 Special: Die Demokratische Republik Kongo Akteure betrachtet werden. Insbesondere die Partei Kabilas und die RCD verfügen nicht über eine solide Hierarchie. In beiden Lagern befinden sich Individuen und Gruppen, die dem Transitionsprozess skeptisch oder gar ablehnend gegenüber stehen. Am bislang deutlichsten traten diese Interessengegensätze im Frühjahr 2004 hervor, als Rivalitäten um die politische und militärische Kontrolle von Süd-Kivus Provinzhauptstadt (Bukavu) zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Kabila-Loyalisten und Hardlinern aus dem Lager der RCD führten. Die Krise und ihre Folgen brachten den Transitionsprozess an den Rand des Zusammenbruchs. 23 Zwar befindet sich die Provinz seither unter der Kontrolle des Kabila-Lagers, die Nachbarprovinz Nord-Kivu bleibt jedoch weiterhin die Hochburg der ehemaligen, von Ruanda unterstützten, RCD-Rebellion bzw. von Hardlinern, die sich trotz der Beteiligung der RCD an der Übergangsregierung nicht an den Transitionsprozess gebunden fühlen. Unterstützung erhält diese Gruppe zumindest konkludent von Teilen der ruandophonen Bevölkerungsgruppen in der Provinz (Banyarwanda), die für den Fall, dass Kabila seine Macht auf Nord-Kivu ausdehnen würde, mit teilweiser Berechtigung ihre politische und wirtschaftliche Marginalisierung befürchten müssten. 24 Schon während der misslungenen Demokratisierungsversuche zu Beginn der 90er Jahre waren gewaltförmige ethnische Konflikte in der Provinz ausgebrochen, als die so genannten autochthonen ethnischen Gruppen die Staatsbürgerschaft der Banyarwanda in Frage stellten. Ähnliche Konstellationen der Instrumentalisierung ethnischer Identitäten zugunsten politischen Machterwerbs waren und sind in Katanga und den Kasai-Provinzen zu beobachten. Anders ist die Situation in dem nordöstlichen Distrikt Ituri, der seit Jahren von dem nationalen Friedensprozess abgeschnitten ist. Im Gegensatz zu den von RCD und MLC kontrollierten Gebieten im Osten und Norden des Landes hatte sich in Ituri während des Krieges keine dominante Rebellengruppe herauskristallisiert. Der Distrikt wurde vielmehr von zahlreichen rivalisierenden ethnischen Milizen beherrscht, von denen keine in die nationale Übergangsregierung integriert wurde. Damit bleibt Ituri vom nationalen Transitionsprozess politisch weitgehend abgekoppelt und die Kinshasa- Regierung übt dort faktisch keinerlei Autorität aus. Auf Drängen der internationalen Gemeinschaft wurden indes die ersten integrierten FARDC-Einheiten nach Ituri verlegt, die gemeinsam mit der MONUC gegen die lokalen Milizen vorzugehen versuchen. Nachdem im Januar 2005 neun UN- Blauhelme bei einem Angriff von Milizen ums Leben kamen, ging die MONUC robuster gegen die bewaffneten Gruppen vor, um deren Entwaffnung zu forcieren. In der Folge konnten etwa Milizen entwaffnet werden. 25 Scheinbar trug zu diesem Erfolg auch die Verhaftung einiger Milizenführer in Kinshasa bei, denen die Verantwortung für die Ermordung der neun Blauhelme angelastet wurde. Wiederum andere Milizenführer aus Ituri wurden von Kabila zu FARDC-Generälen ernannt. Dennoch bleibt die Situation in Ituri äußerst prekär. Ein harter Kern von etwa Milizionären aus unterschiedlichen Gruppen verweigert weiterhin die Entwaffnung und alimentiert sich durch die Kontrolle von Diamantminen und Grenzübergängen. Zudem liegen deutliche Hinweise vor, dass diese Gruppen von Uganda unterstützt werden. Derzeit bleibt fraglich, ob die Zentralregierung in absehbarer Zeit dazu in der Lage sein wird, ihre schwache Autorität auf Ituri auszudehnen. Ermutigend ist immerhin der Umstand, dass trotz der prekären Sicherheitslage nach UN-Angaben rund 1,2 Millionen der geschätzten 1,6 Mio. Wahlberechtigten in Ituri in das Wählerregister aufgenommen werden konnten. 26 Ein weiteres Sicherheitsrisiko bilden die ruandischen Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR), deren Entwaffnung und Repatriierung weiterhin einer Lösung harrt. Bei ihnen handelt es sich um Hutu-Milizen, die seit 1994 ihren bewaffneten Konflikt gegen die Regierung in Kigali vom ostkongolesischen Territorium (insbesondere Süd-Kivu) aus führen. Aufgrund der regelmäßigen Drohungen von Ruandas Präsident Paul Kagame, ein erneutes Mal im Kongo einzumarschieren, um die FDLR zu zerschlagen, bleibt diese Gruppe eine Bedrohung für den Frieden in der Region. Die anhaltende Virulenz des Problems und die Tatsache, dass das Mandat der MONUC lediglich eine nicht-militärische Unterstützung rückkehrwilliger FDLR-Kämpfer vorsieht, hat die UN-Mission 2005 zu einem Strategiewechsel veranlasst. Ähnlich wie in Ituri basiert der neue Ansatz auf gemeinsamen Operationen mit FARDC-Einheiten. Damit sollen die Hutu-Milizen auch ohne direkte militärische Auseinandersetzungen unter Druck gesetzt und von der Zivilbevölkerung isoliert werden, die regelmäßig Opfer von FDLR- Angriffen ist. Gleichzeitig hat die MONUC ihre Bemühungen verstärkt, Verhandlungen zwischen FDLR-Kommandeuren, Ruanda und dem Kongo zu initiieren, um gemäßigten Elementen die Rückkehr nach Ruanda zu erleichtern. Dieser Gruppe steht jedoch ein harter Kern von Kommandeuren gegenüber, die wenig Kompromissbereitschaft erkennen lassen. Diese Bruchlinie wurde im Anschluss an die Deklaration von Rom (März 2005) deutlich, in der die FDLR ankündigte, ihren bewaffneten Kampf aufzugeben. Diese Politik wurde von Teilen der FDLR nicht mitgetragen und konkrete Schritte zur ihrer Umsetzung blieben aus. In der Folge brach ein Machtkampf innerhalb der FDLR zwischen moderaten rückkehrwilligen Kommandeuren und Hardlinern aus, der zur Spaltung der Gruppe führte Fazit Die Perspektiven für eine baldige Friedenskonsolidierung und den Aufbau funktionierender staatlicher Strukturen im 23 D.M. Tull, Die DR Kongo vor dem dritten Krieg?: die möglichen Folgen des Gatumba Massakers, Berlin, Stiftung Wissenschaft und Politik, Zur Situation in der Provinz siehe Amnesty International, DR Congo: Civilians Pay the Price for Political and Military Rivalry, Allerdings wurden nur Waffen eingereicht, von denen aber 70% defekt waren. Über den Verbleib der Waffen kann nur spekuliert werden. Auch die mangelnden Reintegrationsmaßnahmen zugunsten der Kombattanten ( Friedensdividenden ) geben Anlass zur Sorge. Vgl. UN Doc., a.a.o. (Fn. 5), Ziff UN Doc., a.a.o. (Fn. 15), Ziff Vgl. DRC-RWANDA: Interview with Anastase Munyandekwe, Spokesman for the Hutu-Dominated FDLR, in: IRIN News v. 13. September Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften / Journal of International Law of Peace and Armed Conflict 9
12 Special: Die Demokratische Republik Kongo Kongo müssen skeptisch beurteilt werden. Zwar ist es zutreffend, dass innerhalb der letzten zwölf Monate deutliche Fortschritte erzielt worden sind, gleichwohl steht der Friedensprozess in dem kriegszerrütteten Land auf tönernen Füßen. Wie der kursorische Problemaufriss gezeigt hat, steht das Land nach wie vor und auf viele Jahre hinaus vor gewaltigen Herausforderungen, die von kongolesischen wie internationalen Akteuren bislang nur ansatzweise in Angriff genommen wurden. Auch ist keineswegs sicher, dass die jüngsten Fortschritte konsolidiert werden können. Dies gilt auch für den Fall, dass die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vor Juli 2006 stattfinden werden. Damit würde zwar was die Wahlen anbelangt der Fahrplan der Transition eingehalten werden, aber die substantiellen Probleme, deren effektive Bearbeitung eine Minimalvoraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss der Transition durch Wahlen darstellt, bleiben nach wie vor ungelöst. Dass die Wahlen in einem Fiasko enden werden, ist zwar nicht zwangläufig, aber nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand wäre es mehr als leichtsinnig davon auszugehen, dass erstens die Wahlen frei und fair sein werden und zweitens Gewalteskalationen vor, während und nach dem Urnengang ausbleiben werden. Auf das Eintreten dieses Best Case-Szenarios muss jedoch gehofft werden, denn weder der kongolesische Staat noch die MONUC wären dazu in der Lage, schwerwiegenden Zwischenfällen und Störungen wirksam entgegenzutreten: die Regierung nicht aus den oben dargelegten Gründen und ihrer mangelnden Handlungsfähigkeit; die MONUC nicht, weil ihre logistischen und militärischen Fähigkeiten für den Ernstfall nicht ausreichen. Die Bitte von Generalsekretär Annan, zusätzliche Blauhelme während der Wahlen zu entsenden, wurde vom UN-Sicherheitsrat mehrfach abgelehnt. Aus diesem Grund bergen die Wahlen erhebliche Risiken in sich. Als Ernstfälle kommen unter anderen folgende Szenarien in Betracht: 1) Im Vorfeld und/oder während der Wahlen brechen Gewaltkonflikte aus, die von Politikern aus dem Kabila- und/oder RCD-Lager initiiert und instrumentalisiert werden. Als wahrscheinliche Brennpunkte kommen vor allem die beiden Kivu-Provinzen, Kasai und Katanga in Betracht, wo von lokalen und nationalen Politikern geschürte xenophobe Hetzkampagnen gegen Zugewanderte und Minderheiten eine Vorgeschichte haben. Umgekehrt ist bereits erkennbar, dass politische Unternehmer aus diesen Gruppen bestehende Ängste schüren und Gewaltbereitschaft mobilisieren. 2) Jede der jetzigen Regierungsparteien wird ihre Zugriffsmöglichkeiten auf staatliche Ressourcen zur Manipulierung der Wahlen und Wahlergebnisse nutzen und gleichzeitig ähnlichen Manövern ihrer politischen Gegner entschieden entgegen treten. Letzteres gilt auch für die Oppositionsparteien, insbesondere die UDPS. In Anbetracht der ungezügelten Repressionsbereitschaft der Ordnungskräfte könnte dies in den Großstädten zu massiven Gewalteskalationen führen, insbesondere im wahrscheinlichen Fall von Demonstrationen der UDPS. 28 3) Unabhängig von der Frage, ob freie und faire Wahlen im gegenwärtigen politischen Kontext durchführbar sind, wird es Wahlverlierer geben, die ihre Niederlage vermutlich nicht akzeptieren werden. Eine große Gefahr besteht hier insbesondere in Nord-Kivu, der Hochburg der RCD-Dissidenten um Gouverneur Eugène Serufuli. Da die RCD aller Voraussicht nach nur einen geringen Stimmanteil erhalten wird, ist es durchaus denkbar, dass die Hardliner mit Unterstützung Ruandas erneut zu den Waffen greifen, um ihre Macht zu verteidigen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Destabilisierung auf Nord-Kivu begrenzt bleiben wird. Obwohl diese Problematik allgemein bekannt ist, wurde seit Beginn der Transition kein ernsthafter politischer Versuch zu ihrer Beilegung unternommen. Aber selbst im Falle eines weitgehend friedlichen Verlaufs der Wahlen sind schwere Rückschläge zu erwarten. Die Konzentration der internationalen Staatengemeinschaft auf die Wahlen ist nachvollziehbar, aber gefährlich. Die wiederholte Weigerung des UN-Sicherheitsrates, die Mission personell für alle Eventualitäten auszustatten, zeigt, dass die internationale Gemeinschaft ihre Belastungsgrenze im Kongo schon erreicht hat und ihr Engagement sobald wie möglich reduzieren wird. Ein weitgehend zufriedenstellender Verlauf der Wahlen dürfte das Startsignal sein, das den Rückzug einläuten wird, denn mittlerweile hat sich innerhalb der internationalen Gemeinschaft der Glaube verfestigt, ein gelungener Transitionsprozess sei ein gelungener Friedensprozess. Eine rasche Rückführung des militärischen und politischen Engagements der externen Akteure wäre jedoch selbst unter der (unrealistischen) Annahme eines Best Case-Szenario nicht verantwortbar. Nicht nur kommt es in nahezu der Hälfte aller Nachkriegsgesellschaften innerhalb von nur fünf Jahren erneut zu einem Ausbruch kriegerischer Konflikte, auch gibt es gegenwärtig wenig Grund zu der Annahme, dass der Kongo nicht zu dieser Gruppe von Risikoländern gehören wird, zumal keine der strukturellen Problemursachen im Land gelöst ist (z.b. Korruption, Rechtlosigkeit). Nicht zuletzt muss daran erinnert werden, dass die Kriegsparteien um die Macht und Ressourcen des Staates gekämpft haben. Wie auch der bisherige Verlauf der Übergangsphase nahe legt, haben sie diese Ansprüche mit der Unterzeichnung des Transitionsabkommens keineswegs aufgegeben. Unabhängig vom Wahlergebnis gibt es zudem keine Veranlassung zu glauben, die Funktionsweise des politischen Systems werde sich nach den Wahlen fundamental verbessern. Es wäre kaum eine Überraschung, wenn Kongo jenen Weg ginge, den Liberia nach der Beendigung des ersten Krieges ( ) und den Wahlen von 1997 genommen hat. Die auf die Wahlen folgende Herrschaft einer korrupten und kriminellen Regierung führte Liberia direkt in den zweiten Krieg und machte im Jahr 2003 die Entsendung einer erneuten UN-Friedensmission notwendig. 28 H. Boshoff/S. Wolters. 10 1/2006
EUFOR RD Congo (2006)
 Ismail Küpeli EUFOR RD Congo (2006) Wie agiert die EU in Räumen begrenzter Staatlichkeit? DR Kongo: Machtwechsel und Kriege - 1. Kongokrieg (1997): Präsident Mobutu (seit 1965 an der Macht) wird von der
Ismail Küpeli EUFOR RD Congo (2006) Wie agiert die EU in Räumen begrenzter Staatlichkeit? DR Kongo: Machtwechsel und Kriege - 1. Kongokrieg (1997): Präsident Mobutu (seit 1965 an der Macht) wird von der
B. Kolonialzeit ( ): Menschenverachtende Politik der belgischen Kolonialherren, Ausplünderung der Rohstoffe
 Einige Aspekte zur politischen Entwicklung des Kongo A. Erste Kontakte zu Europa (16.-19.Jh): Kongo Reservoir für Sklaven B. Kolonialzeit (1885-1960): Menschenverachtende Politik der belgischen Kolonialherren,
Einige Aspekte zur politischen Entwicklung des Kongo A. Erste Kontakte zu Europa (16.-19.Jh): Kongo Reservoir für Sklaven B. Kolonialzeit (1885-1960): Menschenverachtende Politik der belgischen Kolonialherren,
Analyse des Falbeispiels MONUSCO
 Analyse des Falbeispiels MONUSCO Der größte Einsatz der Vereinten Nationen Katharina Biel 2015 Hintergrundinformationen zum Krisenherd Kongo Schon kurz nach der Machtergreifung Laurent-Désiré Kabilas im
Analyse des Falbeispiels MONUSCO Der größte Einsatz der Vereinten Nationen Katharina Biel 2015 Hintergrundinformationen zum Krisenherd Kongo Schon kurz nach der Machtergreifung Laurent-Désiré Kabilas im
Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften
 26. Jahrgang Volume 26 ISSN 0937-5414 G10364 Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften Journal of International Law of Peace and Armed Conflict Deutsches Rotes Kreuz Institut für Friedenssicherungsrecht
26. Jahrgang Volume 26 ISSN 0937-5414 G10364 Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften Journal of International Law of Peace and Armed Conflict Deutsches Rotes Kreuz Institut für Friedenssicherungsrecht
STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK
 STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Hamburg, Heft 2/2005 Steffen Handrick Das Kosovo und die internationale Gemeinschaft: Nation-building versus peace-building? IMPRESSUM Studien zur Internationalen Politik
STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Hamburg, Heft 2/2005 Steffen Handrick Das Kosovo und die internationale Gemeinschaft: Nation-building versus peace-building? IMPRESSUM Studien zur Internationalen Politik
Übung: Konfliktforschung 2
 Übung: Konfliktforschung 2 Thema: Peace-Enforcement & Peace-Keeping Woche 7 Simon Pressler simonpr@student.ethz.ch 10.04.2018 1 Fragen? 10.04.2018 2 Übungsaufgabe Erklären sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Übung: Konfliktforschung 2 Thema: Peace-Enforcement & Peace-Keeping Woche 7 Simon Pressler simonpr@student.ethz.ch 10.04.2018 1 Fragen? 10.04.2018 2 Übungsaufgabe Erklären sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
Humanitäres Völkerrecht
 Hans-Peter Gasser Humanitäres Völkerrecht Eine Einführung mit einer Einleitung von Daniel Thürer Nomos Schulthess 2007 Einleitende Bemerkungen von Daniel Thürer: Kriegerische Gewalt und rule of law 1 Kapitel
Hans-Peter Gasser Humanitäres Völkerrecht Eine Einführung mit einer Einleitung von Daniel Thürer Nomos Schulthess 2007 Einleitende Bemerkungen von Daniel Thürer: Kriegerische Gewalt und rule of law 1 Kapitel
Adenauers Außenpolitik
 Haidar Mahmoud Abdelhadi Adenauers Außenpolitik Diplomica Verlag Haidar Mahmoud Abdelhadi Adenauers Außenpolitik ISBN: 978-3-8428-1980-1 Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2012 Dieses Werk ist
Haidar Mahmoud Abdelhadi Adenauers Außenpolitik Diplomica Verlag Haidar Mahmoud Abdelhadi Adenauers Außenpolitik ISBN: 978-3-8428-1980-1 Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2012 Dieses Werk ist
Konfliktforschung II
 Konfliktforschung II Herausforderungen Herausforderungen und und Lösungen Lösungen gegenwärtiger gegenwärtiger Konflikte Konflikte Die Die Region Region der der Grossen Grossen Seen Seen Judith Vorrath
Konfliktforschung II Herausforderungen Herausforderungen und und Lösungen Lösungen gegenwärtiger gegenwärtiger Konflikte Konflikte Die Die Region Region der der Grossen Grossen Seen Seen Judith Vorrath
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Die Region der Grossen Seen Judith Vorrath Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Security Studies (CSS) & NCCR
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Die Region der Grossen Seen Judith Vorrath Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Security Studies (CSS) & NCCR
Vereinigung Berner Division. Entwicklung von Sicherheit: Erfahrungen und künftige Herausforderungen
 Vereinigung Berner Division Entwicklung von Sicherheit: Erfahrungen und künftige Herausforderungen Walter Fust Direktor Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 1 Sicherheit und Entwicklung Die Ziele
Vereinigung Berner Division Entwicklung von Sicherheit: Erfahrungen und künftige Herausforderungen Walter Fust Direktor Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 1 Sicherheit und Entwicklung Die Ziele
Internationalisierung und Privatisierung von Krieg und Frieden
 A 2006/ 4000 Prof. Herbert Wulf Internationalisierung und Privatisierung von Krieg und Frieden Nomos Inhalt Danksagung 9 Vorwort 11 Einleitung Neue Kriege und die Gefahr für das staatliche Gewaltmonopol
A 2006/ 4000 Prof. Herbert Wulf Internationalisierung und Privatisierung von Krieg und Frieden Nomos Inhalt Danksagung 9 Vorwort 11 Einleitung Neue Kriege und die Gefahr für das staatliche Gewaltmonopol
Dawisha, Adeed (2005): The New Iraq. Democratic Institutions and Performance. Journal of Democracy. Vol 16. No. 3:
 Dawisha, Adeed (2005): The New Iraq. Democratic Institutions and Performance. Journal of Democracy. Vol 16. No. 3: 35-49. Thema Dynamik des politischen Klimas und das Kräfteverhältnis im Nachwahl/Vorkonstitutions-
Dawisha, Adeed (2005): The New Iraq. Democratic Institutions and Performance. Journal of Democracy. Vol 16. No. 3: 35-49. Thema Dynamik des politischen Klimas und das Kräfteverhältnis im Nachwahl/Vorkonstitutions-
Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit failed und failing States
 Hinrieb Schröder Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit failed und failing States Nomos Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 13 Einleitung 17 A. Analyse einzelner Fälle von Staatszerfall
Hinrieb Schröder Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit failed und failing States Nomos Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 13 Einleitung 17 A. Analyse einzelner Fälle von Staatszerfall
Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes
 Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes (ausgestrahlt am 23. Mai 2009) 1. Deutschland feiert heute 60 Jahre Grundgesetz. Was bedeutet das
Interview der Botschafterin für A1 TV aus Anlass des 60. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes (ausgestrahlt am 23. Mai 2009) 1. Deutschland feiert heute 60 Jahre Grundgesetz. Was bedeutet das
14098/15 cha/pg 1 DG C 1
 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 17. November 2015 (OR. fr) 14098/15 BERATUNGSERGEBNISSE Absender: Generalsekretariat des Rates vom 17. November 2015 Empfänger: Delegationen COAFR 334 CFSP/PESC
Rat der Europäischen Union Brüssel, den 17. November 2015 (OR. fr) 14098/15 BERATUNGSERGEBNISSE Absender: Generalsekretariat des Rates vom 17. November 2015 Empfänger: Delegationen COAFR 334 CFSP/PESC
Zwischen Krieg und Hoffnung
 Geschichte - Erinnerung - Politik 15 Zwischen Krieg und Hoffnung Internierung der 2. polnischen Infanterieschützen-Division in der Schweiz 1940 45 Bearbeitet von Miroslaw Matyja 1. Auflage 2016. Buch.
Geschichte - Erinnerung - Politik 15 Zwischen Krieg und Hoffnung Internierung der 2. polnischen Infanterieschützen-Division in der Schweiz 1940 45 Bearbeitet von Miroslaw Matyja 1. Auflage 2016. Buch.
Deutscher Bundestag Drucksache 18/1095. Beschlussempfehlung und Bericht. 18. Wahlperiode des Auswärtigen Ausschusses (3.
 Deutscher Bundestag Drucksache 18/1095 18. Wahlperiode 08.04.2014 Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Drucksache 18/1081 Entsendung
Deutscher Bundestag Drucksache 18/1095 18. Wahlperiode 08.04.2014 Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Drucksache 18/1081 Entsendung
Das Kriegsgeschehen im Kongo seit 1994
 Ein Soldat der Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) sticht am 20. Mai 1997 in Mobutu Sese Sekos Residenz in Kinshasa mit seinem Bajonett in ein Bild des gestürzten Präsidenten,
Ein Soldat der Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) sticht am 20. Mai 1997 in Mobutu Sese Sekos Residenz in Kinshasa mit seinem Bajonett in ein Bild des gestürzten Präsidenten,
Bilanz der menschlichen Entwicklung
 Bilanz der menschlichen Entwicklung FORTSCHRITTE PROBLEME DEMOKRATIE UND PARTIZIPATION Seit 1980 unternahmen 81 Länder entscheidende Schritte in Richtung Demokratie, 33 Militärregime wurden durch zivile
Bilanz der menschlichen Entwicklung FORTSCHRITTE PROBLEME DEMOKRATIE UND PARTIZIPATION Seit 1980 unternahmen 81 Länder entscheidende Schritte in Richtung Demokratie, 33 Militärregime wurden durch zivile
Rechtstaatlichkeit das erste Gebot einer EU- Sanktionspolitik
 Rechtstaatlichkeit das erste Gebot einer EU- Sanktionspolitik Pressegespräch zur Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union zu den EU-Sanktionen gegen Mykola Azarov 29. Jänner 2016 Das Urteil des
Rechtstaatlichkeit das erste Gebot einer EU- Sanktionspolitik Pressegespräch zur Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union zu den EU-Sanktionen gegen Mykola Azarov 29. Jänner 2016 Das Urteil des
Politische Ökonomie der Gewalt
 Politische Ökonomie der Gewalt Friedens- und Konfliktforschung Band7 Werner Ruf (Hrsg.) Politische Ökonomie der Gewalt Staatszerfall und die Privatisierung von Gewalt und Krieg Springer Fachmedien Wiesbaden
Politische Ökonomie der Gewalt Friedens- und Konfliktforschung Band7 Werner Ruf (Hrsg.) Politische Ökonomie der Gewalt Staatszerfall und die Privatisierung von Gewalt und Krieg Springer Fachmedien Wiesbaden
B) Was ist ein schwacher, ein zerfallener, ein zerfallender Staat?
 A) Was ist ein Staat? B) Was ist ein schwacher, ein zerfallener, ein zerfallender Staat? C) Zur quantitativen Messung von failed states : Wie kann ich Staatenschwäche/Staatszerfall messen? D) Was sind
A) Was ist ein Staat? B) Was ist ein schwacher, ein zerfallener, ein zerfallender Staat? C) Zur quantitativen Messung von failed states : Wie kann ich Staatenschwäche/Staatszerfall messen? D) Was sind
Afrika. Die Region der Grossen Seen
 Afrika. Die Region der Grossen Seen Nils Weidmann International Conflict Research Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) weidmann@icr.gess.ethz.ch Gliederung Geographische Situation Nationaler
Afrika. Die Region der Grossen Seen Nils Weidmann International Conflict Research Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) weidmann@icr.gess.ethz.ch Gliederung Geographische Situation Nationaler
der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 Deutscher Bundestag Drucksache 17/6448 17. Wahlperiode 06. 07. 2011 Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Die Demokratische Republik Kongo stabilisieren Der Bundestag wolle
Deutscher Bundestag Drucksache 17/6448 17. Wahlperiode 06. 07. 2011 Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Die Demokratische Republik Kongo stabilisieren Der Bundestag wolle
Ergebnisse des Latinobarómetro 2003
 Diskussionspapier Forschungsgruppe Amerika Stiftung Wissenschaft und Politik Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit Ilona Laschütza Ergebnisse des Latinobarómetro 2003 Ludwigkirchplatz
Diskussionspapier Forschungsgruppe Amerika Stiftung Wissenschaft und Politik Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit Ilona Laschütza Ergebnisse des Latinobarómetro 2003 Ludwigkirchplatz
Teil nicht mehr benötigte oder unbrauchbare Waffen ab, während die wesentlichen Bestände unangetastet blieben.
 pa/dpa/db Koltermann Ein Soldat der kongolesischen Armee registriert Gewehre, die in einem Entwaffnungslager der UN-Mission MONUC gesammelt wurden (25. April 2005 in Bunia). Einem auch auf dem Balkan und
pa/dpa/db Koltermann Ein Soldat der kongolesischen Armee registriert Gewehre, die in einem Entwaffnungslager der UN-Mission MONUC gesammelt wurden (25. April 2005 in Bunia). Einem auch auf dem Balkan und
Zivile Konfliktbearbeitung
 Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile
Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile
Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan und das Völkerrecht. Vorbemerkungen
 Vorbemerkungen 1. Das geltende Völkerrecht kennt nicht den "gerechten Krieg" 2. Die UN-Charta trifft folgende grundlegenden Regelungen zur Anwendung von Waffengewalt: a) Sie verbietet den Staaten die Erstanwendung
Vorbemerkungen 1. Das geltende Völkerrecht kennt nicht den "gerechten Krieg" 2. Die UN-Charta trifft folgende grundlegenden Regelungen zur Anwendung von Waffengewalt: a) Sie verbietet den Staaten die Erstanwendung
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 8: Peacekeeping & Peace Enforcement Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 8: Peacekeeping & Peace Enforcement Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Bundeswehr und deutsche NGOs in Afghanistan
 Bundeswehr und deutsche NGOs in Afghanistan Referentinnen: Annika Krempel, Stefanie Jenner Forschungsseminar: Clausewitz und Analysen Internationaler Politik - Die Bundeswehr in Afghanistan Dozenten: Prof.
Bundeswehr und deutsche NGOs in Afghanistan Referentinnen: Annika Krempel, Stefanie Jenner Forschungsseminar: Clausewitz und Analysen Internationaler Politik - Die Bundeswehr in Afghanistan Dozenten: Prof.
Die aktuelle Lage in der DR Kongo:
 Die aktuelle Lage in der DR Kongo: Ein Update zur Verlängerung der Übergangsperiode und zur anhaltenden Gewalt im Osten Von Pamphile Sebahara In den vergangenen Monaten haben zwei wesentliche Ereignisse
Die aktuelle Lage in der DR Kongo: Ein Update zur Verlängerung der Übergangsperiode und zur anhaltenden Gewalt im Osten Von Pamphile Sebahara In den vergangenen Monaten haben zwei wesentliche Ereignisse
Schutz der Menschenwürde
 Schutz der Menschenwürde 30.11.2018 14.00 Uhr Stadtwerk Strubergasse 18 Foto: privat Workshop 6 Stefan Kieber, Robert Krammer Moderation: Birgit Bahtic Kunrath Foto: privat Tagung Zukunft: International
Schutz der Menschenwürde 30.11.2018 14.00 Uhr Stadtwerk Strubergasse 18 Foto: privat Workshop 6 Stefan Kieber, Robert Krammer Moderation: Birgit Bahtic Kunrath Foto: privat Tagung Zukunft: International
Zivilgesellschaft in Europa Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in den europäischen Politikprozess
 Denise Fritsch Zivilgesellschaft in Europa Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in den europäischen Politikprozess Diplom.de Denise Fritsch Zivilgesellschaft in Europa Einbindung zivilgesellschaftlicher
Denise Fritsch Zivilgesellschaft in Europa Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in den europäischen Politikprozess Diplom.de Denise Fritsch Zivilgesellschaft in Europa Einbindung zivilgesellschaftlicher
Konfliktforschung II
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 9: Peace Building & Nation-Building Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 9: Peace Building & Nation-Building Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Sanktionen der Vereinten Nationen in Afrika, 1990 bis 2004: Übersicht / Aufteilung nach Ländern (alphabetisch)
 Sanktionen der Vereinten Nationen in Afrika, 1990 bis : Übersicht / Aufteilung nach Ländern (alphabetisch) Land Sanktionsziel Sanktionstyp Zielsetzung 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Sicherheitspolitischer Kontext
Sanktionen der Vereinten Nationen in Afrika, 1990 bis : Übersicht / Aufteilung nach Ländern (alphabetisch) Land Sanktionsziel Sanktionstyp Zielsetzung 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Sicherheitspolitischer Kontext
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS. ATHEORIETEIL 5 I Parteien und Parteiensystem in Westeuropa 5
 Inhaltsverzeichnis ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS XIII EINLEITUNG 1 ATHEORIETEIL 5 I Parteien und Parteiensystem in Westeuropa 5 L P É i Begriff 5 2. P tien-e ntstehung 7 3. P iien -T y p en 11 4. Parteiorganisation
Inhaltsverzeichnis ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS XIII EINLEITUNG 1 ATHEORIETEIL 5 I Parteien und Parteiensystem in Westeuropa 5 L P É i Begriff 5 2. P tien-e ntstehung 7 3. P iien -T y p en 11 4. Parteiorganisation
Post-Conflict: Wiederherstellung von Staatlichkeit
 A 2009/13002 Post-Conflict: Wiederherstellung von Staatlichkeit Völkerrechtliche Aspekte der Friedenssicherung im Irak Von Dr. Brigitte Reschke l Carl Heymanns Verlag Einleitung 1 I. Kapitel: Geschichtliche
A 2009/13002 Post-Conflict: Wiederherstellung von Staatlichkeit Völkerrechtliche Aspekte der Friedenssicherung im Irak Von Dr. Brigitte Reschke l Carl Heymanns Verlag Einleitung 1 I. Kapitel: Geschichtliche
VERURTEILEN SIE DIE GEWALT IN BENI, DR KONGO!
 KUDRA MALIRO/AFP/Getty Images VERURTEILEN SIE DIE GEWALT IN BENI, DR KONGO! TROTZ DER PRÄSENZ DER STREITKRÄFTE DER DEMOKRATISCHEN REPUBLIK KONGO (DRK) UND DER UN WERDEN ZIVILISTEN NACH WIE VOR OPFER VON
KUDRA MALIRO/AFP/Getty Images VERURTEILEN SIE DIE GEWALT IN BENI, DR KONGO! TROTZ DER PRÄSENZ DER STREITKRÄFTE DER DEMOKRATISCHEN REPUBLIK KONGO (DRK) UND DER UN WERDEN ZIVILISTEN NACH WIE VOR OPFER VON
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 8: Peace-Building & Nation-Building Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 8: Peace-Building & Nation-Building Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 13: Die Region der Grossen Seen Judith Vorrath Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Security Studies
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 13: Die Region der Grossen Seen Judith Vorrath Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Security Studies
PROTOKOLL ZUR DURCHFÜHRUNG DER ALPENKONVENTION VON 1991 ÜBER DIE BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
 PROTOKOLL ZUR DURCHFÜHRUNG DER ALPENKONVENTION VON 1991 ÜBER DIE BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN Die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Italienische Republik, das Fürstentum Liechtenstein,
PROTOKOLL ZUR DURCHFÜHRUNG DER ALPENKONVENTION VON 1991 ÜBER DIE BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN Die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Italienische Republik, das Fürstentum Liechtenstein,
Die Streitkräfte der DDR - Die NVA als Parteiarmee unter Kontrolle ziviler Kräfte
 Politik Sven Lippmann Die Streitkräfte der DDR - Die NVA als Parteiarmee unter Kontrolle ziviler Kräfte Studienarbeit Ruprecht- Karls- Universität Heidelberg Institut für Politische Wissenschaft Oberseminar:
Politik Sven Lippmann Die Streitkräfte der DDR - Die NVA als Parteiarmee unter Kontrolle ziviler Kräfte Studienarbeit Ruprecht- Karls- Universität Heidelberg Institut für Politische Wissenschaft Oberseminar:
Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften
 27. Jahrgang Volume 27 ISSN 0937-5414 G10364 Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften Journal of International Law of Peace and Armed Conflict Themenheft Der Schutz von Wasser im Völkerrecht Deutsches
27. Jahrgang Volume 27 ISSN 0937-5414 G10364 Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften Journal of International Law of Peace and Armed Conflict Themenheft Der Schutz von Wasser im Völkerrecht Deutsches
Manche Menschen meinen, dass man zwischen guten und schlechten Kriegen unterscheiden soll.
 Themenwelt Krieg Was ist Krieg? Im Krieg kämpfen Soldaten oder bewaffnete Gruppen gegeneinander. Sie wollen andere Länder erobern oder ihre Macht im eigenen Land vergrößern. Die Gegner sprechen nicht mehr
Themenwelt Krieg Was ist Krieg? Im Krieg kämpfen Soldaten oder bewaffnete Gruppen gegeneinander. Sie wollen andere Länder erobern oder ihre Macht im eigenen Land vergrößern. Die Gegner sprechen nicht mehr
Deutscher Bundestag Drucksache 19/1304. Beschlussempfehlung und Bericht. 19. Wahlperiode des Auswärtigen Ausschusses (3.
 Deutscher Bundestag Drucksache 19/1304 19. Wahlperiode 20.03.2018 Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Drucksache 19/1096 Fortsetzung
Deutscher Bundestag Drucksache 19/1304 19. Wahlperiode 20.03.2018 Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Drucksache 19/1096 Fortsetzung
Einführung ins Humanitäre. Völkerrecht I. Prof. Dr. Christine Kaufmann Vorlesung vom 23. November 2010 Herbstsemester 2010 Seite 1 von 5.
 Einführung ins Humanitäre Völkerrecht Vorlesung vom 23. November 2010 Prof. Christine Kaufmann Herbstsemester 2010 Ziele Unterscheidung ius ad bellum/ius in bello verstehen Genfer Recht/Haager Recht kennen
Einführung ins Humanitäre Völkerrecht Vorlesung vom 23. November 2010 Prof. Christine Kaufmann Herbstsemester 2010 Ziele Unterscheidung ius ad bellum/ius in bello verstehen Genfer Recht/Haager Recht kennen
Unterstützung der kongolesischen Sicherheitskräfte im Vorfeld der Wahlen
 Deutscher Bundestag Drucksache 17/6213 17. Wahlperiode 14. 06. 2011 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dag delen, Christine Buchholz, Dr. Diether Dehm, weiterer Abgeordneter
Deutscher Bundestag Drucksache 17/6213 17. Wahlperiode 14. 06. 2011 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dag delen, Christine Buchholz, Dr. Diether Dehm, weiterer Abgeordneter
C l a u s e w i t z u n d d i e A n a l y s e i n t e r n a t i o n a l e r P o l i t i k : D i e B u n d e s w e h r i n A f g h a n i s t a n
 C l a u s e w i t z u n d d i e A n a l y s e i n t e r n a t i o n a l e r P o l i t i k : D i e B u n d e s w e h r i n A f g h a n i s t a n D a s K o n z e p t d e r P r o v i n c i a l R e c o n s
C l a u s e w i t z u n d d i e A n a l y s e i n t e r n a t i o n a l e r P o l i t i k : D i e B u n d e s w e h r i n A f g h a n i s t a n D a s K o n z e p t d e r P r o v i n c i a l R e c o n s
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 12: Peace Building & Nation-Building Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 12: Peace Building & Nation-Building Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten
 Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten Dr. Andreas Schockenhoff MdB Stellvertretender Vorsitzender 12. Ausgabe Seite 1 von 6 leere Seite Seite 2 von 6 Warum können wir mit ISAF jetzt aus Afghanistan
Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten Dr. Andreas Schockenhoff MdB Stellvertretender Vorsitzender 12. Ausgabe Seite 1 von 6 leere Seite Seite 2 von 6 Warum können wir mit ISAF jetzt aus Afghanistan
Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003
 Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 3 2. Feststellungen
Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 3 2. Feststellungen
Gemeinsam gegen HIV/AIDS in Entwicklungsländern kämpfen
 Gemeinsam gegen HIV/AIDS in Entwicklungsländern kämpfen Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union Deutschlands vom 16. März 2002 Die HIV Epidemie hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einer humanitären
Gemeinsam gegen HIV/AIDS in Entwicklungsländern kämpfen Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union Deutschlands vom 16. März 2002 Die HIV Epidemie hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einer humanitären
Deutscher Bundestag Drucksache 18/ Wahlperiode Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem An
 Deutscher Bundestag Drucksache 18/5250 18. Wahlperiode 17.06.2015 Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Drucksache 18/5053 Fortsetzung
Deutscher Bundestag Drucksache 18/5250 18. Wahlperiode 17.06.2015 Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Drucksache 18/5053 Fortsetzung
Der Begriff der Bedrohung des Friedens" in Artikel 39 der Charta der Vereinten Nationen
 Andreas Schäfer Der Begriff der Bedrohung des Friedens" in Artikel 39 der Charta der Vereinten Nationen Die Praxis des Sicherheitsrates PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis
Andreas Schäfer Der Begriff der Bedrohung des Friedens" in Artikel 39 der Charta der Vereinten Nationen Die Praxis des Sicherheitsrates PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis
Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.) Demokratie, Recht und Legitimität im 21. Jahrhundert
 Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.) Demokratie, Recht und Legitimität im 21. Jahrhundert Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.)
Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.) Demokratie, Recht und Legitimität im 21. Jahrhundert Mandana Biegi Jürgen Förster Henrique Ricardo Otten Thomas Philipp (Hrsg.)
Handbuch des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten
 Handbuch des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten In Zusammenarbeit mit Michael Bothe, Horst Fischer, Hans-Peter Gasser, Christopher Greenwood, Wolff Heintschel von Heinegg, Knut Ipsen, Stefan
Handbuch des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten In Zusammenarbeit mit Michael Bothe, Horst Fischer, Hans-Peter Gasser, Christopher Greenwood, Wolff Heintschel von Heinegg, Knut Ipsen, Stefan
NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik?
 Politik Sandra Markert NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik? Studienarbeit Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung
Politik Sandra Markert NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik? Studienarbeit Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung
Einführung in die Argumente der Konfliktökonomie
 Einführung in die Argumente der Konfliktökonomie Uni im Dorf 2018: Konflikt Forschung - Frieden Andreas Exenberger Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte Leopold-Franzens-Universität
Einführung in die Argumente der Konfliktökonomie Uni im Dorf 2018: Konflikt Forschung - Frieden Andreas Exenberger Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte Leopold-Franzens-Universität
Niedergang des Staates?
 Friedens- und Konfliktforschung Niedergang des Staates? 3. Vorlesung Inhalt Die These vom Niedergang des Staates Denationalisierung und Entstaatlichung Die neuen Kriege Gegenthese 1: Die neuen Kriege sind
Friedens- und Konfliktforschung Niedergang des Staates? 3. Vorlesung Inhalt Die These vom Niedergang des Staates Denationalisierung und Entstaatlichung Die neuen Kriege Gegenthese 1: Die neuen Kriege sind
SICHERHEITSPOLITISCHES FORUM NIEDERSACHSEN Prävention und Stabilisierung in Krisenregionen in Hannover
 SICHERHEITSPOLITISCHES FORUM NIEDERSACHSEN Prävention und Stabilisierung in Krisenregionen 03.04.2017 in Hannover Zum wiederholten Mal folgten Vertreter_innen aus Politik, NGOs und Bundeswehr der Einladung
SICHERHEITSPOLITISCHES FORUM NIEDERSACHSEN Prävention und Stabilisierung in Krisenregionen 03.04.2017 in Hannover Zum wiederholten Mal folgten Vertreter_innen aus Politik, NGOs und Bundeswehr der Einladung
Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges
 Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Afrika und externe Akteure Partner auf Augenhöhe? Nomos
 Franziska Stehnken Antje Daniel Helmut Asche Rainer Öhlschläger (Hrsg.) Afrika und externe Akteure Partner auf Augenhöhe? Nomos Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Franziska Stehnken Antje Daniel Helmut Asche Rainer Öhlschläger (Hrsg.) Afrika und externe Akteure Partner auf Augenhöhe? Nomos Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Chronologie des Arabischen Frühlings 2011
 -23. MÄRZ. /.-..-15. -29. BITTE WÄHLEN SIE EIN DATUM AUS, UM MEHR ZU ERFAHREN! MAI 29.-. /05 JUNI.-29. -23. MÄRZ..-. /.-15. -29. MAI 29.-. /05 JUNI.-29. 15.-21. FEBRUAR 2011 Anti-Regierungs-Proteste im
-23. MÄRZ. /.-..-15. -29. BITTE WÄHLEN SIE EIN DATUM AUS, UM MEHR ZU ERFAHREN! MAI 29.-. /05 JUNI.-29. -23. MÄRZ..-. /.-15. -29. MAI 29.-. /05 JUNI.-29. 15.-21. FEBRUAR 2011 Anti-Regierungs-Proteste im
Bachelorarbeit. Die Wehrhafte Demokratie und der Rechtsextremismus. Wie sich der Staat gegen seine Verfassungsfeinde wehrt. Christoph Dressler
 Bachelorarbeit Christoph Dressler Die Wehrhafte Demokratie und der Rechtsextremismus Wie sich der Staat gegen seine Verfassungsfeinde wehrt Bachelor + Master Publishing Christoph Dressler Die Wehrhafte
Bachelorarbeit Christoph Dressler Die Wehrhafte Demokratie und der Rechtsextremismus Wie sich der Staat gegen seine Verfassungsfeinde wehrt Bachelor + Master Publishing Christoph Dressler Die Wehrhafte
HIPHOP PARTEI KICK OFF
 KICK OFF Dezember 2016 WIR! In Zeiten der Globalisierung ist unsere Gesellschaft einem stetigen Wandel von kultureller Identität unterworfen. Die HipHop Kultur hat seit den 70er Jahren eine Vielzahl von
KICK OFF Dezember 2016 WIR! In Zeiten der Globalisierung ist unsere Gesellschaft einem stetigen Wandel von kultureller Identität unterworfen. Die HipHop Kultur hat seit den 70er Jahren eine Vielzahl von
BESCHLUSS DER KOMMISSION. vom
 EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 21.5.2014 C(2014) 3291 final BESCHLUSS DER KOMMISSION vom 21.5.2014 über die Finanzierung humanitärer Maßnahmen aus der Überbrückungsfazilität für die Flüchtlinge und
EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 21.5.2014 C(2014) 3291 final BESCHLUSS DER KOMMISSION vom 21.5.2014 über die Finanzierung humanitärer Maßnahmen aus der Überbrückungsfazilität für die Flüchtlinge und
Doppelte Solidarität im Nahost-Konflikt
 Doppelte Solidarität im Nahost-Konflikt Im Wortlaut von Gregor Gysi, 14. Juni 2008 Perspektiven - unter diesem Titel veröffentlicht die Sächsische Zeitung kontroverse Kommentare, Essays und Analysen zu
Doppelte Solidarität im Nahost-Konflikt Im Wortlaut von Gregor Gysi, 14. Juni 2008 Perspektiven - unter diesem Titel veröffentlicht die Sächsische Zeitung kontroverse Kommentare, Essays und Analysen zu
Die UNIFIL ( ) als Beispiel für mangelhafte Effizienz friedenssichernder Operationen der Vereinten Nationen
 Frank Wullkopf Die UNIFIL (1978-1998) als Beispiel für mangelhafte Effizienz friedenssichernder Operationen der Vereinten Nationen LIT VI Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung 1 1.1. Zum Hintergrund des
Frank Wullkopf Die UNIFIL (1978-1998) als Beispiel für mangelhafte Effizienz friedenssichernder Operationen der Vereinten Nationen LIT VI Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung 1 1.1. Zum Hintergrund des
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 8: Peace-Building & Nation-Building Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 8: Peace-Building & Nation-Building Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Militär und Entwicklung in der Türkei, Ein Beitrag zur Untersuchung der Rolle des Militärs in der Entwicklung der Dritten Welt
 Gerhard Weiher Militär und Entwicklung in der Türkei, 1945-1973 Ein Beitrag zur Untersuchung der Rolle des Militärs in der Entwicklung der Dritten Welt Leske Verlag + Budrich GmbH, Opladen 1978 INHALT
Gerhard Weiher Militär und Entwicklung in der Türkei, 1945-1973 Ein Beitrag zur Untersuchung der Rolle des Militärs in der Entwicklung der Dritten Welt Leske Verlag + Budrich GmbH, Opladen 1978 INHALT
Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003
 Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 15. Oktober 2002 (S/2002/1146)". Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen vereinbart,
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 15. Oktober 2002 (S/2002/1146)". Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen vereinbart,
Den Gegner schützen?
 Studien zur Friedensethik Studies on Peace Ethics 47 Bernhard Koch [Hrsg.] Den Gegner schützen? Zu einer aktuellen Kontroverse in der Ethik des bewaffneten Konflikts Nomos Das Institut für Theologie und
Studien zur Friedensethik Studies on Peace Ethics 47 Bernhard Koch [Hrsg.] Den Gegner schützen? Zu einer aktuellen Kontroverse in der Ethik des bewaffneten Konflikts Nomos Das Institut für Theologie und
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 119-1 vom 26. November 2009 Rede des Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Guido Westerwelle, zur Fortsetzung der Beteiligung der Bundeswehr am Einsatz der Internationalen
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 119-1 vom 26. November 2009 Rede des Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Guido Westerwelle, zur Fortsetzung der Beteiligung der Bundeswehr am Einsatz der Internationalen
Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten
 Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten Dr. Andreas Schockenhoff MdB Stellvertretender Vorsitzender 13. Ausgabe Seite 1 von 6 leere Seite Seite 2 von 6 Warum engagieren wir uns nach 2014 weiter in
Einsatz in Afghanistan Fragen und Antworten Dr. Andreas Schockenhoff MdB Stellvertretender Vorsitzender 13. Ausgabe Seite 1 von 6 leere Seite Seite 2 von 6 Warum engagieren wir uns nach 2014 weiter in
Deutscher Bundestag Drucksache 19/175. Beschlussempfehlung und Bericht. 19. Wahlperiode des Hauptausschusses
 Deutscher Bundestag Drucksache 19/175 19. Wahlperiode 06.12.2017 Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung Drucksache 19/20 Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter
Deutscher Bundestag Drucksache 19/175 19. Wahlperiode 06.12.2017 Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung Drucksache 19/20 Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter
P7_TA-PROV(2009)0118 Unruhen in der Demokratischen Republik Kongo
 P7_TA-PROV(2009)0118 Unruhen in der Demokratischen Republik Kongo Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2009 zur Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo Das Europäische Parlament,
P7_TA-PROV(2009)0118 Unruhen in der Demokratischen Republik Kongo Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2009 zur Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo Das Europäische Parlament,
Margret Johannsen. Der Nahost-Konflikt
 Margret Johannsen Der Nahost-Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart Bernhard Frevel Klaus Schubert Suzanne S. Schüttemeyer Die ELEMENTE DER POLITIK sind eine politikwissenschaftliche
Margret Johannsen Der Nahost-Konflikt Elemente der Politik Herausgeber: Hans-Georg Ehrhart Bernhard Frevel Klaus Schubert Suzanne S. Schüttemeyer Die ELEMENTE DER POLITIK sind eine politikwissenschaftliche
Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr
 Dr. Reinhard Brandl Mitglied des Deutschen Bundestages Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr Plenarprotokoll
Dr. Reinhard Brandl Mitglied des Deutschen Bundestages Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr Plenarprotokoll
Die völkerrechtliche Definition von Krieg
 Die völkerrechtliche Definition von Krieg - Sachstand - 2007 Deutscher Bundestag WD 2 3000-175/07 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages Verfasserinnen: Die völkerrechtliche Definition von
Die völkerrechtliche Definition von Krieg - Sachstand - 2007 Deutscher Bundestag WD 2 3000-175/07 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages Verfasserinnen: Die völkerrechtliche Definition von
Gustav Stresemann und die Problematik der deutschen Ostgrenzen
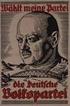 Georg Arnold Arn Gustav Stresemann und die Problematik der deutschen Ostgrenzen PETER LANG Europaischer Verlag der Wissenschaften 11 Inhaltsverzeichnis Einleitung 15 I. Biographischer Werdegang und politische
Georg Arnold Arn Gustav Stresemann und die Problematik der deutschen Ostgrenzen PETER LANG Europaischer Verlag der Wissenschaften 11 Inhaltsverzeichnis Einleitung 15 I. Biographischer Werdegang und politische
Inhaltsverzeichnis. A. Einleitung B. Europäische Ebene... 5
 Inhaltsverzeichnis A. Einleitung... 1 B. Europäische Ebene... 5 I. Schaffung der ESVP... 5 1. Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)... 6 2. Westeuropäische Union (WEU)... 8 3. Bilaterale Verteidigungspolitik...
Inhaltsverzeichnis A. Einleitung... 1 B. Europäische Ebene... 5 I. Schaffung der ESVP... 5 1. Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)... 6 2. Westeuropäische Union (WEU)... 8 3. Bilaterale Verteidigungspolitik...
2862/J XX. GP - Anfrage 1 von /J XX.GP
 2862/J XX. GP - Anfrage 1 von 5 2862/J XX.GP der Abgeordneten Kier, Stoisits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten betreffend Umsetzung der Menschenrechte im Rahmen
2862/J XX. GP - Anfrage 1 von 5 2862/J XX.GP der Abgeordneten Kier, Stoisits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten betreffend Umsetzung der Menschenrechte im Rahmen
Gewalt und politische Transformation im Globalen Süden. Dr. Sabine Kurtenbach Ringvorlesung Friedensbildung WiSe 2013/14 7.
 Gewalt und politische Transformation im Globalen Süden Dr. Sabine Kurtenbach Ringvorlesung Friedensbildung WiSe 2013/14 7. November 2013 Problemlagen Politische Transformationsprozesse wohin? Die Rolle
Gewalt und politische Transformation im Globalen Süden Dr. Sabine Kurtenbach Ringvorlesung Friedensbildung WiSe 2013/14 7. November 2013 Problemlagen Politische Transformationsprozesse wohin? Die Rolle
Die Geltung der Grundrechte für ein Handeln deutscher Organe im Ausland Jonas Eckert, Johannes Pogoda Europa-Universität Viadrina
 Die Geltung der Grundrechte für ein Handeln deutscher Organe im Ausland I. Grundrechte und extraterritoriale Hoheitsakte Grundrechte und extraterritoriale Hoheitsakte Art. 1 III maßgeblich: Die nachfolgenden
Die Geltung der Grundrechte für ein Handeln deutscher Organe im Ausland I. Grundrechte und extraterritoriale Hoheitsakte Grundrechte und extraterritoriale Hoheitsakte Art. 1 III maßgeblich: Die nachfolgenden
Assad gewinnt Kontrolle über ein völlig zerstörtes Land 170 Milliarden Euro für Wiederaufbau nötig
 Assad gewinnt Kontrolle über ein völlig zerstörtes Land 170 Milliarden Euro für Wiederaufbau nötig Epoch Times14. September 2017 Aktualisiert: 14. September 2017 10:00 Die Syrische Armee erobert ihr Land
Assad gewinnt Kontrolle über ein völlig zerstörtes Land 170 Milliarden Euro für Wiederaufbau nötig Epoch Times14. September 2017 Aktualisiert: 14. September 2017 10:00 Die Syrische Armee erobert ihr Land
EUROPÄISCHER RAT KOPENHAGEN JUNI 1993 SCHLUSSFOLGERUNGEN DES VORSITZES
 EUROPÄISCHER RAT KOPENHAGEN 21.-22. JUNI 1993 SCHLUSSFOLGERUNGEN ES VORSITZES 6. Beziehungen zur Türkei Hinsichtlich der Türkei ersuchte der Europäische Rat den Rat, dafür zu sorgen, daß die vom Europäischen
EUROPÄISCHER RAT KOPENHAGEN 21.-22. JUNI 1993 SCHLUSSFOLGERUNGEN ES VORSITZES 6. Beziehungen zur Türkei Hinsichtlich der Türkei ersuchte der Europäische Rat den Rat, dafür zu sorgen, daß die vom Europäischen
Politik im Klimawandel
 Mit Beiträgen von: Silke Beck, Thomas Bernauer, Katharina Böhm, Ulrich Brand, Thomas Bräuninger, Claudia von Braunmühl, Andreas Busch, Hans-Joachim Busch, Marc Debus, Simon Franzmann, Bernhard Kittel,
Mit Beiträgen von: Silke Beck, Thomas Bernauer, Katharina Böhm, Ulrich Brand, Thomas Bräuninger, Claudia von Braunmühl, Andreas Busch, Hans-Joachim Busch, Marc Debus, Simon Franzmann, Bernhard Kittel,
Vergleich der Rechtsprechung der USA und Deutschlands zur Staatsinsolvenz
 Jura Rouven Wohlbrück Vergleich der Rechtsprechung der USA und Deutschlands zur Staatsinsolvenz Das Beispiel Argentinien Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Jura Rouven Wohlbrück Vergleich der Rechtsprechung der USA und Deutschlands zur Staatsinsolvenz Das Beispiel Argentinien Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Entwicklungsminister Niebel spielt den Türöffner für deutsche Interessen
 Entwicklungsminister Niebel spielt den Türöffner für deutsche Interessen Im Wortlaut von Niema Movassat, 26. Januar 2010 Niema Movassat über die erste Dienstreise des Nachfolgers von Heidemarie Wieczorek-Zeul
Entwicklungsminister Niebel spielt den Türöffner für deutsche Interessen Im Wortlaut von Niema Movassat, 26. Januar 2010 Niema Movassat über die erste Dienstreise des Nachfolgers von Heidemarie Wieczorek-Zeul
Fachübergreifende Modulprüfung Europäische und internationale Grundlagen des Rechts 20. November Name Vorname Matrikelnummer
 Europäische und internationale Grundlagen des Rechts 20. November 2012 Name Vorname Matrikelnummer Teil: Einführung in die internationalen Grundlagen des Rechts: Einführung in das Völkerrecht Punkte: 1.
Europäische und internationale Grundlagen des Rechts 20. November 2012 Name Vorname Matrikelnummer Teil: Einführung in die internationalen Grundlagen des Rechts: Einführung in das Völkerrecht Punkte: 1.
Geschätzte Kosten von Maßnahmen der EU zur Terrorismusbekämpfung
 xxx GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE FACHABTEILUNG C: BÜRGERRECHTE UND VERFASSUNGSFRAGEN BÜRGERLICHE FREIHEITEN, JUSTIZ UND INNERES Geschätzte Kosten von Maßnahmen der EU zur Terrorismusbekämpfung
xxx GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE FACHABTEILUNG C: BÜRGERRECHTE UND VERFASSUNGSFRAGEN BÜRGERLICHE FREIHEITEN, JUSTIZ UND INNERES Geschätzte Kosten von Maßnahmen der EU zur Terrorismusbekämpfung
Polizeiprogramm Afrika. Stärkung der Funktionsfähigkeit von Polizeistrukturen in Afrika. Im Auftrag
 Polizeiprogramm Afrika Stärkung der Funktionsfähigkeit von Polizeistrukturen in Afrika Im Auftrag Polizeiprogramm Afrika Die GIZ führt im Auftrag des Auswärtigen Amtes (AA) seit Anfang 2008 ein Programm
Polizeiprogramm Afrika Stärkung der Funktionsfähigkeit von Polizeistrukturen in Afrika Im Auftrag Polizeiprogramm Afrika Die GIZ führt im Auftrag des Auswärtigen Amtes (AA) seit Anfang 2008 ein Programm
Grundlagenwissen über Herkunftsländer und Folgerungen für die pädagogische Praxis Afghanistan
 Grundlagenwissen über Herkunftsländer und Folgerungen für die pädagogische Praxis Afghanistan Bonner Institut für Migrationsforschung und interkulturelles Lernen (BIM) e.v. - www.bimev.de Geographische
Grundlagenwissen über Herkunftsländer und Folgerungen für die pädagogische Praxis Afghanistan Bonner Institut für Migrationsforschung und interkulturelles Lernen (BIM) e.v. - www.bimev.de Geographische
Wolfgang Schweiger. Der (des)informierte Bürger im Netz. Wie soziale Medien die Meinungsbildung verändern
 Der (des)informierte Bürger im Netz Wie soziale Medien die Meinungsbildung verändern Der (des)informierte Bürger im Netz Der (des)informierte Bürger im Netz Wie soziale Medien die Meinungsbildung verändern
Der (des)informierte Bürger im Netz Wie soziale Medien die Meinungsbildung verändern Der (des)informierte Bürger im Netz Der (des)informierte Bürger im Netz Wie soziale Medien die Meinungsbildung verändern
Grundprinzipien der zwischenstaatlichen Beziehungen
 Grundprinzipien der zwischenstaatlichen Beziehungen Vorlesung vom 20. November 2013 Prof. Christine Kaufmann Modul Transnationales Recht Bachelor of Law LVB HS 2013 an der RWF und der WWF Wir laden Sie
Grundprinzipien der zwischenstaatlichen Beziehungen Vorlesung vom 20. November 2013 Prof. Christine Kaufmann Modul Transnationales Recht Bachelor of Law LVB HS 2013 an der RWF und der WWF Wir laden Sie
