Diagnostik und Therapie der weiblichen Harninkontinenz revisited
|
|
|
- Käthe Schulz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Harninkontinenz der Frau Diagnostik und Therapie der weiblichen Harninkontinenz revisited Harninkontinenz (unwillkürlicher Harnverlust) liegt vor, wenn unkontrolliert Urin aus der Blase abgeht was für die Betroffenen meist sehr belastend ist. Harninkontinenz ist eine der häufigsten Erkrankungen der Frau. So liegt die Prävalenz der Urininkontinenz bei Frauen zwischen 30 und 49 Jahren bei 17%, zwischen 60 und 79 Jahren bei 23% und kann bei den über 80-jährigen über 50% betragen (1). Frauen mit Harninkontinenz leiden meist sehr unter der fehlenden Blasenkontrolle und fühlen sich häufig sozial ausgegrenzt und in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt. Prof. Dr. med. Volker Viereck Dr. med. Irena Zivanovic Marlies von Siebenthal Formen der Harninkontinenz Die beiden häufigsten Inkontinenzformen der Frau sind: llbelastungsinkontinenz (bis 50%) und llhyperaktive Blase/Dranginkontinenz (20 30%) wobei llmischformen häufig vorkommen (20%). Seltenere Inkontinenzformen sind: llüberlaufinkontinenz < 10%, die Betroffenen haben z.b. durch eine urethrale Obstruktion (Prolaps, postoperativ) oder periphere Blasendenervierung Schwierigkeiten, ihre Harnblase willkürlich zu leeren. Es verbleibt nach dem Wasserlassen Restharn in der Blase, der unwillkürlich abgeht. llreflexinkontinenz < 10%, der Harnverlust tritt aufgrund unwillkürlicher Kontraktionen der Blasenwandmuskulatur auf z.b. bei Multipler Sklerose, Alzheimer, Demenz, Parkinson. Ein Harndrang besteht vorher nicht. llextraurethrale Inkontinenz z.b. bei vesikovaginalen Fisteln, konnatalen Fehlbildungen. Im weiteren wird der Fokus auf die beiden häufigsten Inkontinenzformen, die Belastungs- und Dranginkontinenz sowie deren Mischformen gelegt. Belastungsinkontinenz Ein Urinverlust ohne vorherigen Harndrang bei körperlichen Anstrengungen beim Husten, Niesen, Lachen, Heben von Lasten, Sport wird als Belastungsinkontinenz (früher Stressinkontinenz) bezeichnet. Bei dieser Form der Urininkontinenz besteht eine Beckenbodenschwäche resp. ein zu tiefer Harnröhrenverschlussdruck gegenüber dem intravesikalen Druck. Je nach Schweregrad der Inkontinenz geht dann Urin in Form von Tropfen, Spritzer oder im Schwall verloren. Die Ursachen der Muskel- und Bindegewebeschwäche sind vielfältig. Schwangerschaft, Geburt, Adipositas, starke intraabdominale Druckanstiege durch chronischen Husten oder Obstipation führen zu einer Überbelastung der Beckenbodenmuskultur. Fehlendes Beckenbodentraining, Gewebeatrophie in Folge eines Hormonmangels sowie altersbedingte, degenerative Veränderungen können ebenfalls dazu beitragen. Hyperaktive Blase (OAB, Dranginkontinenz, Reizblase) Bei der Dranginkontinenz dagegen handelt es sich um einen unkontrollierten Urinverlust begleitet von einem starken Harndrang. Die Dranginkontinenz kann im Rahmen des Syndroms der hyperaktiven Blase (OAB = Overactive Bladder) vorkommen. Diese wird gemäss International Continence Society (ICS) als typischer Symptomkomplex aus imperativem Harndrang, Pollakisurie und Nykturie, der mit Harnverlust (OAB wet) oder ohne Harnverlust (OAB dry) auftreten kann, definiert (2). Idiopathische Detrusorüberaktivität steht bei den Ursachen an erster Stelle. Weitere Ursachen sind falsches Ess- und Trinkverhalten, rezidivierende Harnwegs- und Genitalinfektionen, ein genitaler Hormonmangel und Senkungszustände (Zystozele). Blasentumore, Fremdkörper, Interstitielle Zystitis (Persistenz typischer Schmerzsymptomatik bei keimfreiem Urin) und Stoffwechselkrankheiten sollten ausgeschlossen werden. Die Dranginkontinenz kann auch Abb.1: Urogyna kologische Untersuchungseinheit: Gyna kologischer Untersuchungsstuhl, Videoturm zur Zystourethroskopie, Ultraschallgera t zur Pelvic-Floor-Sonografie, Mikroskop zur Nativbeurteilung des Vaginalsekrets der informierte arzt _ 08 _
2 Abb. 2: PF-Sonografie: Trichterbildung der proximalen Urethra beim Pressen als sonomorphologisches Korrelat bei Patientin mit Belastungsinkontinenz, 2a: mit vertikalem Descensus und schmalem Trichter, 2b: mit gemischt-rotatorischem Descensus und breitem Trichter und urethraler Hypermobilita t (B = Blase, S = Symphyse, T = Trichter, U = Urethra) Abb. 3: Zystoskopie. 3a: Zystitis zystica, 3b: ulzeröse (Hunner sche La sion), 3c: ha morrhagische Interstitielle Zystitis und 3d: Blasentumor Erstsymptom einer neurologischen Erkrankung wie Multiple Sklerose und Parkinson oder Folge einer Strahlentherapie sein. Ungenügendes Trinken, Reizgetränke, Medikamente, übermässiger Alkohol- und Nikotinkonsum können die hyperaktive Blase fördern. Diagnostik der Harninkontinenz Mit der Anamnese lässt sich bereits in ca. 70% der Fälle die richtige Diagnose stellen und der Stellenwert der Erkrankung auf die Beeinträchtigung der Lebensqualität erfassen. Auch können standardisierte Fragebögen zur Objektivierung und Verlaufskontrolle hilfreich sein. Ein einfaches aber wichtiges Diagnostikum stellt der Trink- und Miktionskalender (s.a. unter dar. Dieser gibt uns rasch Anhaltspunkte über die tägliche Trinkmenge, Miktionsvolumina und Häufigkeit der Nykturie. Mittels Urin-Stix und -kultur des Mittelstrahlurins kann ein Harnwegsinfekt ausgeschlossen werden. Des Weiteren kann mittels einer Abdomensonografie der Restharn bestimmt werden oder eine Nierenektasie und ggf. ein Fremdkörper in der Blase erkannt werden. Weitere diagnostische Schritte erfolgen im Rahmen einer urogynäkologischen Untersuchung (Abb. 1). Dabei werden die Genitalatrophie, die Beckenbodenanatomie und die Frage nach einer Senkung eruiert. Des Weiteren werden mit Beckenboden-Testing die Beckenbodenkontraktion und mit Hustentest bei voller Blase der Harnröhrenverschluss und das Ausmass einer Belastungsinkontinenz beurteilt. Mittels Pelvic-Floor-Sonografie wird das gesamte kleine Becken mit dem vorderen, mittleren und hinteren Kompartiment untersucht (3). Somit wird beurteilt, ob z.b. der Blasenhals beim Pressen eine Trichterbildung (Abb. 2) aufweist, ob und in welchem Kompartiment ein Descensus genitalis vorliegt und wie hoch die Restharnmenge ist. Zur genauen Planung einer Inkontinenzoperation sind die Urethralänge, die Urethramobilität und die Höhe der paraurethralen Sulci von Relevanz. Mit Abstrichen aus der Vagina und Urethra können Infekte ausgeschlossen werden. Die Urethrozystoskopie ermöglicht Aussagen über Restharn, Blasenkapazität, aber auch über Blasenwandveränderungen wie Entzündungen, chronische Blasenwandinfekte (Zystitis zystica) und Balkenblasenzeichnung, Pseudodivertikel, urotheliale Schutzschichtdefekte, Interstitielle Zystitis mit Hunner schen Läsionen, Tumore und Blasensteine (Abb. 3) (4). Mit dieser Stufendiagnostik wird die Diagnose gestellt und initial eine konservative Therapie eingeleitet. Ist der damit erreichte Therapieerfolg nicht zufriedenstellend, wird eine operative Therapie erwogen oder handelt es sich um eine Rezidivsituation folgt als nächster diagnostischer Schritt eine Urodynamik mit Messung der Druck- und Flussverhältnisse in den ableitenden Harnwegen. Therapie der Belastungsinkontinenz Sowohl in den deutschen als auch den englischen Leitlinien werden zunächst konservative Massnahmen empfohlen (5). Dies sind je nach BMI Gewichtsreduktion und lokale Anwendung von Hor- der informierte arzt _ 08 _
3 Tab. 1 Lokale Östrogenpräparate Crèmes und Gels Ovestin 1 mg E3 in 1 g Creme Oestro-Gynaedron 0.5 mg E3 in 1 g Creme Blissel 0.05 mg E3 in 1 g Gel Ovula, Tabletten und Kapseln Ovestin Tbl. 1 mg E3/Tbl. Ovestin Ovulum 0.5 mg E3/Ovulum Gynoflor Vag. Tbl mg E3/Vag. Tbl. Vagifem Vag. Tbl mg E2/Vag. Tbl. Vagifem Vag. Tbl mg E2/Vag, Tbl. Colpotrophine Vag. Kps. 10 mg Promestrien/Kapsel ABB. 4 Retropubisches Band (TVT Exact, Gynecare) monpräparaten zur Epithelproliferation (Tab. 1). Präparate mit Estriol (E3) sind denen mit Estradiol (E2) für die lokale Anwendung zu bevorzugen. Die Physiotherapie wird ggf. mit Elektrostimulation, Biofeedback oder Ganzkörper-Vibrationstherapie ergänzt (6). Damit soll die Beckenbodenmuskulatur gestärkt und die muskuläre Koordination optimiert werden. Pessare (Ring/ Schale aus Silikon, Wegwerfpessare) dienen als Urethrawiderlager, werden zusammen mit einer Östrogencrème (E3 = Estriol) eingeführt und sind zum täglichen, eigenständigen Wechsel durch die Patientin geeignet. Wenn diese Massnahmen nach drei Monaten keine befriedigende Besserung oder Heilung bewirken und das Gewebe mit lokalen Östrogenen gut aufgebaut ist, wird in der Regel eine Operation empfohlen. Das Ziel einer Inkontinenzoperation ist durch einen minimal invasiven Eingriff die Harnröhre trotz erschlafften Aufhängebändern und Beckenbodenschwäche zu restabilisieren. Dies erreicht man mittels Schlingenoperation (z.b. TVT-Band-Operation). Das Polypropylene-Band (Abb. 4) wird in örtlicher Betäubung und Analgosedation retropubisch (Abb. 5), eingelegt. TVT steht für Tension Free Vaginal Tape ein spannungsfreies, synthetisches Band, das die Harnröhre im funktionell relevanten, mittleren Bereich unterstützt. Die TVT-Schlingenoperation wurde durch Professor Ulf Ulmsten aus Schweden Mitte der 90er Jahre entwickelt (7). Weitere Bänder mit anderen Einlage- und Fixierungstechniken kamen in den letzten Jahren auf den Markt. Sonografische Befunde erlauben auch sehr präzise Empfehlungen zu Operationsindikationen bis hin zu operationstechnischen Details. Die Einlage eines Bandes unterliegt strengen Kriterien. Liegt das Band nicht korrekt (dystop), so ist es wichtig, dass der Fehler früh erkannt und behoben wird (8). Die PF-Sonografie erweist sich dabei vor allem bei den sogenannten Versagern der Methode oder bei den postoperativen Komplikationen als essentiell. Zu den häufigsten postoperativen Komplikationen zählen nebst der per- ABB. 5 Belastungsinkontinenz 5a: belastungsinkontinenz: Beim Husten oder Springen öffnet sich der obere Anteil der Harnröhre und Urin geht ab. Schlaffe Aufhängebänder sind der Grund. 5b: Scheiden-Pessar (Recafem): Wiedererlangte Kontinenz durch eingelegtes Pessar. 5c: operation: In örtlicher Betäubung wird das TVT-Band von vaginal her um die Harnröhre eingelegt und hinter dem Schambein retropubisch hinaufgeführt. Nur bei exakter Positionierung unterstützt es die Harnröhre optimal _ 2015 _ der informierte arzt
4 sistierenden Belastungsinkontinenz (OP-Versager), obstruktive Miktionsbeschwerden, Restharnbildung mit/ohne rezidivierende Harnwegsinfekte und De-novo-Dranginkontinenz. Die Genesungszeit nach dieser Operation ist kurz und die Operationsnarben sind minimal. Die Langzeitdaten zeigen, dass die objektive Heilungsrate bei 83 Prozent und die subjektive Zufriedenheit bei hohen 95 Prozent liegen (9). Eine operative Therapiealternative für die Belastungsinkontinenz stellt die periurethrale Injektion mit Bulking Agents (z. B. Bulkamid) dar. Sie kommt bei Therapieversagern nach Kolposuspension, Bandeinlagen mit immobiler Harnröhre und bei der hochbetagten Frau zum Einsatz. Die Umspritzung der Harnröhre wird in der Regel nur unter Lokalanästhesie durchgeführt und ist damit die am wenigsten invasive Inkontinenztechnik. Dabei wird an drei ABB. 6 An drei Stellen wird eine kleine Menge des Bulkamid- Hydrogels in die Harnröhrenwand gespritzt, um deren Schliessmechanismus zu verbessern (Koaptation) Tab. 2 In der Schweiz erhältliche Medikamente zur Behandlung der hyperaktiven Blase (OAB) Medikamentengruppe Wirkstoff Markenname Dosierung Packung à Tageskosten Beta-3- Adrenozeptoragonist Mirabegron Betmiga 25 mg ret. Tbl. 1 x 25 mg/tag 30, 90 Fr. 2.32; 1.93 Betmiga 50 mg ret. Tbl. 1 x 50 mg/tag 30, 90 Fr. 2.32; 1.93 Anticholinergika Solifenacin Vesicare 5 mg Tbl. 1 x 5 mg/tag 30, 90 Fr. 2.25; 1.77 Vesicare 10 mg Tbl. 1 x 10 mg/tag 30, 90 Fr. 2.58; 2.07 Fesoterodin Toviaz 4 mg ret. Tbl. 1 x 4 mg/tag 14, 84 Fr. 3.12; 2.09 Toviaz 8 mg ret. Tbl. 1 x 8 mg/tag 14, 84 Fr. 3.21; 2.19 Darifenacin Emselex 7.5 mg ret. Tbl. 1 x 7.5 mg/tag 14, 56 Fr. 3.04; 2.16 Emselex 15 mg ret. Tbl. 1 x 15 mg/tag 14, 56 Fr. 3.04; 2.16 Tolterodin Detrusitol SR 2 mg ret. Kps. 1 x 2 mg/tag abends 28 Fr Detrusitol SR 4 mg ret. Kps. 1 x 4 mg/tag abends 14, 56 Fr. 3.04; 2.16 Tolterodin Pfizer 2 mg ret. Kps. 1 x 2 mg/tag abends 28 Fr Tolterodin Pfizer 4 mg ret. Kps. 1 x 4 mg/tag abends 14, 56 Fr. 2.61; 1.73 Oxybutynin Ditropan 5 mg Tbl. 3 x 5 mg/tag 60 Fr Lyrinel OROS 5 mg Tbl. 1 x 5 mg/tag 30, 90 Fr. 1.51; 1.10 Lyrinel OROS 10 mg Tbl. 1 x 10 mg/tag 30, 90 Fr. 2.12; 1.68 Lyrinel OROS 15 mg Tbl. 1 x 15 mg/tag 30, 90 Fr. 2.74; 2.27 Kentera Hautpflaster 2 x /Woche 8 Fr Trospiumchlorid Spasmo Urgenin Neo 20 mg Drg. 2 x 20 mg/tag 20, 60 Fr. 1.88; 1.46 Spasmex 20 mg Tbl. 2 x 20 mg/tag 30, 100 Fr. 1.81; 1.24 Spasmolytikum Flavoxat Urispas 200 mg Drg. 3 x 200 mg/tag 30, 100 Fr. 1.62; 1.18 Neurotoxin Botulinumneurotoxin Typ A Botox Amp. à 100 E* 100 E 100 E Fr Xeomin Amp. à 50 E** 50 E 50 E Fr Xeomin Amp. à 100 E** 100 E 100 E Fr *Seit 01/2015 für die idiopathische Blase zugelassen _ 2015 _ der informierte arzt
5 Stellen ein kleines Depot des Bulkamid-Hydrogels in die Harnröhrenwand gespritzt (Abb. 6). Hierdurch wird die Urethra eingeengt (Koaptation). Therapie der Dranginkontinenz Die konservativen Massnahmen bei der Dranginkontinenz sind gute Trinkmengen, wenig Reizgetränke wie z.b. Kaffee, Blasentraining (indem die Drangepisoden unterdrückt und die Miktionsintervalle schrittweise verlängert werden), Phytotherapie mit Preiselbeersaft, schonende Intimpflege, umfassende Infektprophylaxe und -sanierung. Die Begleitmedikation sollte überprüft werden, da eine Vielzahl von Medikamenten eine hyperakive Blase auslösen können. Des Weiteren sollte eine Obstipation behandelt und die Patientin z.b. beim Rauchstopp unterstützt werden. Die Physiotherapie kombiniert mit Elektrostimulation und/ oder Galileo-Vibrationstherapie gehört zu wesentlichen Therapiebausteinen. Die medikamentöse Blasenrelaxation (Tab. 2) unterstützt die Primärtherapie. Die Medikamente wirken anticholinerg und dadurch detrusorrelaxierend. Sie reduzieren die Inkontinenz- und Drangepisoden sowie die Miktionsfrequenz und steigern das Miktionsvolumen. Mögliche Nebenwirkungen sind Mundtrockenheit, Obstipation oder Sehstörungen. Bei älteren Menschen kann die kognitive Leistung beeinträchtig werden. Kontraindikationen für Anticholinergika sind das Engwinkelglaukom und die Tachyarrhythmie. Seit kurzem gibt es auch einen anderen medikamentösen Therapieansatz. Der Wirkstoff Mirabegron (Betmiga) ist ein Beta- 3-Adrenozeptoragonist und seit dem 15. August 2014 auch in der Schweiz erhältlich. Er ist nach 30 Jahren der erste Vertreter einer neuen Substanzklasse mit einem neuartigen Wirkmechanismus. Bisherige Daten zeigen eine sehr gute Wirksamkeit und nur wenige, vor allem keine anti-cholinergen Nebenwirkungen (10). Bleibt der gewünschte Effekt aus, wird eine Instillationstherapie mit intravesikaler Anwendung von entzündungshemmenden und blasenrelaxierenden Medikamenten durchgeführt. Als letzter Schritt bei therapieresistenter, invalidisierender Dranginkontinenz ohne Restharnbildung kann Botulinumtoxin A in die Blasentrabekel injiziert werden. Die Nebenwirkungen sind in der Regel gering, gelegentlich kann es aber zu einer temporären Restharnbildung bis hin zum Harnverhalt kommen. Therapie der Mischharninkontinenz Bei Frauen mit gemischter Belastungs- und Dranginkontinenz gilt es die dominanten Symptome herauszufiltern und diese dann primär konservativ oder operativ anzugehen. Insgesamt muss gesagt werden, dass man mit einem multimodalen Therapie-Prophylaxe-Konzept am besten zum Ziel gelangt (11, 12). Bei gut koordinierter individuellen Behandlung und Begleitung der Patientin lassen sich Inkontinenzbeschwerden meist heilen oder zumindest erheblich lindern. Viel Leid und Scham bleiben den Betroffenen dadurch erspart. Die Lebensqualität und die soziale Integration werden verbessert, die Pflege erleichtert und nicht zuletzt auch die Gesundheitskosten deutlich gesenkt. Prof. Dr. med. Volker Viereck Co- Chefarzt Frauenklinik, Chefarzt Urogynäkologie Leitung Blasen- und Beckenbodenzentrum, Kantonsspital Pfaffenholzstrasse 4, 8501 info@blasenzentrum-frauenfeld.ch Dr. med. Irena Zivanovic, Marlies von Siebenthal Blasen- und Beckenbodenzentrum, Frauenklinik, Kantonsspital B Interessenkonflikt: Die Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert. Take-Home Message Harninkontinenz, Blasen- und Intimbeschwerden gehören zu den häufigsten Frauenleiden. Sie können in jedem Alter auftreten und haben fast immer mehrere Ursachen Eine Basisdiagnostik besteht aus einer gezielten Anamnese, einem Infektausschluss, einer Resturinbestimmung und dem Führen eines Trink-Miktionskalenders Erfolgreiche Therapien urogynäkologischer Krankheiten bauen auf multimodalen Stufen-Konzepten auf, welche individuell auf die Patientinnen zugeschnitten sind Bei Versagen der Basistherapie, komplexen Beschwerden im Rahmen der Harninkontinenz und vor einer operativen Therapie ist die Überweisung der Patientinnen an ein urogynäkologisches Zentrum erforderlich Der Operationserfolg wird günstig beeinflusst durch eine adäquate Gewebevorbereitung, sorgfältige Diagnostik, optimale Auswahl der Operationsmethode sowie guter postoperativer Nachbetreuung. Anhaltende, konservative Massnahmen wie Trinktraining und lokale Hormon anwendung dienen der Langzeitprophylaxe Literatur: 1. Nygaard I et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. Pelvic Floor Disorders Network, JAMA. 2008;300(11): Haylen et al. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Neurourology and Urodynamics 2010;29: Kociszewski J, Viereck V. Belastungsinkontinenz Individuell behandeln dank optimaler Diagnose. Urol Urogynäkol 2010;17(3) Viereck V, Kociszewski J, Eberhard J. Präoperative urogynäkologische Diagnostik. Urol Urogynäkol 2010;17(4). 5. Reisenauer C et al. Interdisziplinäre S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau. Geburtsh Frauenheilk 2013; Von der Heide S, Viereck V 2012 Vibrationstherapie in Carrière, B / Brown C (Hrsg.): Beckenboden, Physiotherapie und Training Thieme Verlag, Stuttgart. 2., aktual. u. erw. Aufl. 7. Ulmsten U, Henriksson L, Johnson P, Varhos G. An ambulatory surgical procedure under local anesthesia for treatment of female urinary incontinence. Int Urogynecol J 1996;7: Viereck V, Eberhard J. Inkontinenzoperationen - Indikationen, Auswahl der Operationsmethode, Operationstechnik, Umgang mit Früh- und Spätkomplikationen. J Urol Urogynäkol 2008;15(3). 9. Kociszewski J, Rautenberg O, Perucchini D, Eberhard J, Geissbuehler V, Hilgers R, Viereck V. Tape functionality: Sonographic tape characteristics and outcome after TVT incontinence surgery. Neurourol Urodyn 2008;27: Khullar V et al. Efficacy and tolerability of mirabegron, a β(3)-adrenoceptor agonist, in patients with overactive bladder: results from a randomised European- Australian phase 3 trial. Eur Urol Feb;63(2): Viereck V. Urogynäkologische Probleme bei der Seniorin bis zur Hochbetagten. info@gynäkologie _ 02 _ Eberhard J, Viereck V. Einfache Diagnostik multimodale konservative Therapie. Hausarzt Praxis 2008;7:9-14. der informierte arzt _ 08 _
Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel
 Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
UMFRAGEERGEBNISSE DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN
 UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz
 Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz Prim. Univ. Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Gynäkologie KH Barmherzige Brüder Wien Wien, am 25.06.2013 Harninkontinenz Definition Prävalenz
Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz Prim. Univ. Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Gynäkologie KH Barmherzige Brüder Wien Wien, am 25.06.2013 Harninkontinenz Definition Prävalenz
Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll
 Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Überaktive Blase State of the Art
 Überaktive Blase State of the Art Livio Mordasini, Oberarzt Klinik für Urologie, KSSG 2 Definition International Continence Society The overactive bladder syndrome (OAB) is defined as Urinary urgency,
Überaktive Blase State of the Art Livio Mordasini, Oberarzt Klinik für Urologie, KSSG 2 Definition International Continence Society The overactive bladder syndrome (OAB) is defined as Urinary urgency,
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz
 Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Belastungsinkontinenz. Reizblase (Overactive Bladder) Senkungsbeschwerden
 Belastungsinkontinenz Reizblase (Overactive Bladder) Senkungsbeschwerden Was versteht man unter Harninkontinenz, Reizblase oder Senkungsbeschwerden? 2 Das Verlieren von Urin (Harninkontinenz) ist ein weitverbreitetes
Belastungsinkontinenz Reizblase (Overactive Bladder) Senkungsbeschwerden Was versteht man unter Harninkontinenz, Reizblase oder Senkungsbeschwerden? 2 Das Verlieren von Urin (Harninkontinenz) ist ein weitverbreitetes
PATIENTENINFORMATION. über. Harninkontinenz
 PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
sreferentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau
 Aroserkongress 2013 Workshops sreferentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau Moderation: Claudia Zuber, Hausärztin, Othmarsingen Einführung
Aroserkongress 2013 Workshops sreferentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau Moderation: Claudia Zuber, Hausärztin, Othmarsingen Einführung
Differenzialdiagnostik und therapeutisches Management
 Die überaktive Blase Differenzialdiagnostik und therapeutisches Management Die über- oder hyperaktive Blase kann die Befindlichkeit der Betroffenen erheblich stören. Abklärung und Therapie sollen patientinnenorientiert
Die überaktive Blase Differenzialdiagnostik und therapeutisches Management Die über- oder hyperaktive Blase kann die Befindlichkeit der Betroffenen erheblich stören. Abklärung und Therapie sollen patientinnenorientiert
Patienteninformation. Nehmen Sie sich Zeit...
 Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Die überaktive Blase. Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier
 Die überaktive Blase Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier Überaktive Blase 1. Definition und Ursachen Definition International Continence Society ICS 2002: Überaktive Blase ÜAB Overactive Bladder OAB
Die überaktive Blase Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier Überaktive Blase 1. Definition und Ursachen Definition International Continence Society ICS 2002: Überaktive Blase ÜAB Overactive Bladder OAB
Wasser löse Wasser häbe
 Wasser löse Wasser häbe Individuelle Lösungen bei Miktionsproblemen im Alter Dr. med. Michael Thoms Oberarzt Urologie LUKS Luzern Wolhusen, 29.09.2016 Kein Tabuthema!!! Miktionsprobleme Ungewollter Urinverlust
Wasser löse Wasser häbe Individuelle Lösungen bei Miktionsproblemen im Alter Dr. med. Michael Thoms Oberarzt Urologie LUKS Luzern Wolhusen, 29.09.2016 Kein Tabuthema!!! Miktionsprobleme Ungewollter Urinverlust
BECKENBODEN- ZENTRUM
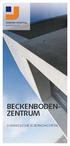 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
 Zu dieser Folie: Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3
Zu dieser Folie: Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k
 Mein Beckenboden Beckenbodenschwäche & Inkontinenz Ursachen, Diagnostik und Therapien 3D Animation Beckenboden Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k Ursachen Beckenbodenschwäche Geburten Alter
Mein Beckenboden Beckenbodenschwäche & Inkontinenz Ursachen, Diagnostik und Therapien 3D Animation Beckenboden Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k Ursachen Beckenbodenschwäche Geburten Alter
Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz
 12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
Die Harninkontinenz bei der Frau. Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien
 Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Blasenschwäche. Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen
 Blasenschwäche Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen 2 TW_WH_137_Patientenb_Blasenschw_10_D_RZ_3.indd 3 02.12.13 17:54 Inhalt Blasenschwäche ist behandelbar... 4/5 Die verschiedenen
Blasenschwäche Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen 2 TW_WH_137_Patientenb_Blasenschw_10_D_RZ_3.indd 3 02.12.13 17:54 Inhalt Blasenschwäche ist behandelbar... 4/5 Die verschiedenen
Diagnostik & Therapie von Senkungszuständen des weiblichen Genitale. Leiterin Urogynäkologie Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum
 Diagnostik & Therapie von Senkungszuständen des weiblichen Genitale Prof. Dr. med. René Hornung Dr. med. Tanja Hülder Chefarzt Frauenklinik Oberärztin mbf Frauenklinik Leiterin Urogynäkologie Interdisziplinäres
Diagnostik & Therapie von Senkungszuständen des weiblichen Genitale Prof. Dr. med. René Hornung Dr. med. Tanja Hülder Chefarzt Frauenklinik Oberärztin mbf Frauenklinik Leiterin Urogynäkologie Interdisziplinäres
corina.christmann@luks.ch sabine.groeger@luks.ch Frühjahrsfortbildung Inkontinenz
 Frühjahrsfortbildung Inkontinenz Welche Inkontinenzformen gibt es? Andere Inkontinenzformen (stress 14% urinary incontinence, SUI) - Dranginkontinenz (überaktive Blase, urge UUI, OAB wet/dry) (Inkontinenz
Frühjahrsfortbildung Inkontinenz Welche Inkontinenzformen gibt es? Andere Inkontinenzformen (stress 14% urinary incontinence, SUI) - Dranginkontinenz (überaktive Blase, urge UUI, OAB wet/dry) (Inkontinenz
Anticholinerge Therapie der hyperaktiven Blase Wie wird optimiert?
 Anticholinerge Therapie der hyperaktiven Blase Wie wird optimiert? Die Therapie der hyperaktiven Blase mit Anticholinergika kann durch verschiedene Strategien optimiert werden. Zur Verbesserung der Wirksamkeit
Anticholinerge Therapie der hyperaktiven Blase Wie wird optimiert? Die Therapie der hyperaktiven Blase mit Anticholinergika kann durch verschiedene Strategien optimiert werden. Zur Verbesserung der Wirksamkeit
Lage-und Haltungsveraenderungen der Beckenorgane. Brubel Réka
 Lage-und Haltungsveraenderungen der Beckenorgane Brubel Réka Descensus uteri Insuffiziens des Halteapperates der Gaebaermutter (Lig. Sacrouterinum, parametrium, Beckenboden) Tiefetreten des uterus in der
Lage-und Haltungsveraenderungen der Beckenorgane Brubel Réka Descensus uteri Insuffiziens des Halteapperates der Gaebaermutter (Lig. Sacrouterinum, parametrium, Beckenboden) Tiefetreten des uterus in der
Inkontinenz stoppt mich nicht mehr
 Inkontinenz stoppt mich nicht mehr Ist Inkontinenz eine eher seltene Erkrankung? Zurück ins Leben Ganz und gar nicht! Nahezu 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Inkontinenz, Junge wie Alte,
Inkontinenz stoppt mich nicht mehr Ist Inkontinenz eine eher seltene Erkrankung? Zurück ins Leben Ganz und gar nicht! Nahezu 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Inkontinenz, Junge wie Alte,
Beckenboden- und Kontinenzzentrum Urogynäkologie. Sana Klinikum Borna. Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig
 Beckenboden- und Kontinenzzentrum Urogynäkologie Sana Klinikum Borna Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig Sehr geehrte Patientin, Inkontinenz ist eine Erkrankung, die auch als Blasen-,
Beckenboden- und Kontinenzzentrum Urogynäkologie Sana Klinikum Borna Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig Sehr geehrte Patientin, Inkontinenz ist eine Erkrankung, die auch als Blasen-,
BECKENBODEN- ZENTRUM
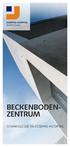 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE IM JOSEPHS-HOSPITAL KONTAKT JOSEPHS-HOSPITAL WARENDORF GYNÄKOLOGIE AGUB II-Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE IM JOSEPHS-HOSPITAL KONTAKT JOSEPHS-HOSPITAL WARENDORF GYNÄKOLOGIE AGUB II-Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
University of Zurich. Anticholinerge Therapie der hyperaktiven Blase. Zurich Open Repository and Archive
 University of Zurich Zurich Open Repository and Archive Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich http://www.zora.uzh.ch Year: 2009 Anticholinerge Therapie der hyperaktiven Blase Perucchini, D; Scheiner, D;
University of Zurich Zurich Open Repository and Archive Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich http://www.zora.uzh.ch Year: 2009 Anticholinerge Therapie der hyperaktiven Blase Perucchini, D; Scheiner, D;
Beratung Vorsorge Behandlung. Beckenboden- Zentrum. im RKK Klinikum Freiburg. Ihr Vertrauen wert
 Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Harninkontinenz und Sexualität - Was ist an Diagnostik wichtig aus gynäkologischer Sicht?
 13. Bamberger Gespräche 2009 Harninkontinenz und Sexualität - Was ist an Diagnostik wichtig aus gynäkologischer Sicht? Von Dr. med. Bettina Wildt Bamberg (5. September 2009) - Epidemiologisch wird die
13. Bamberger Gespräche 2009 Harninkontinenz und Sexualität - Was ist an Diagnostik wichtig aus gynäkologischer Sicht? Von Dr. med. Bettina Wildt Bamberg (5. September 2009) - Epidemiologisch wird die
Raus aus der sozialen Isolation Harninkontinenz ist heilbar
 Raus aus der sozialen Isolation Harninkontinenz ist heilbar Dr. med. Tanja Hülder Leitende Ärztin Frauenklinik Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum Kantonsspital St. Gallen 2 Themen Einleitung Welche
Raus aus der sozialen Isolation Harninkontinenz ist heilbar Dr. med. Tanja Hülder Leitende Ärztin Frauenklinik Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum Kantonsspital St. Gallen 2 Themen Einleitung Welche
BECKENBODENZENTRUM TÜV WIR SORGEN FÜR SIE. Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf. geprüft
 BECKENBODENZENTRUM Behandlungspfad Zertifizierter TÜV geprüft Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf WIR SORGEN FÜR SIE Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf
BECKENBODENZENTRUM Behandlungspfad Zertifizierter TÜV geprüft Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf WIR SORGEN FÜR SIE Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf
Frau Prof. Burkhard, wie lässt sich das Problem der Inkontinenz zuordnen? Wer ist davon betroffen?
 Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Harnkontinenz. Definitionen. Formen nicht kompensierter Inkontinenz. Pflegediagnosen: Risikofaktoren
 Definitionen Harninkontinenz ist jeglicher unfreiwilliger Urinverlust. ist die Fähigkeit, willkürlich zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase zu entleeren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit,
Definitionen Harninkontinenz ist jeglicher unfreiwilliger Urinverlust. ist die Fähigkeit, willkürlich zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase zu entleeren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit,
Gynäkologische Aspekte
 Gynäkologische Aspekte C. Kissel 1 Scheidentrockenheit Die Befeuchtung der Scheide kommt aus den Bartholin'schen und Skene'schen Drüsen am Scheideneingang. 2 Scheidentrockenheit Die natürliche Feuchtigkeit
Gynäkologische Aspekte C. Kissel 1 Scheidentrockenheit Die Befeuchtung der Scheide kommt aus den Bartholin'schen und Skene'schen Drüsen am Scheideneingang. 2 Scheidentrockenheit Die natürliche Feuchtigkeit
Birgit Bair Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
 Birgit Bair Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Prävalenz der Harninkontinenz knapp jede 4. Frau im Verlauf ihres Lebens betroffen Frauen ca. 9x häufiger als Männer im mittleren und höheren Alter
Birgit Bair Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Prävalenz der Harninkontinenz knapp jede 4. Frau im Verlauf ihres Lebens betroffen Frauen ca. 9x häufiger als Männer im mittleren und höheren Alter
Referentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau
 Referentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau Moderation: Claudia Zuber, Hausärztin, Othmarsingen Einführung Anatomische Grundlagen Descensus
Referentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau Moderation: Claudia Zuber, Hausärztin, Othmarsingen Einführung Anatomische Grundlagen Descensus
Inhalt. Geschichtliche Anmerkungen... 1
 Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Frau und Probleme mit der Blase... Alexandra Röllin Annette Kuhn Bern
 Frau und Probleme mit der Blase... Alexandra Röllin Annette Kuhn Bern Inkontinenz Reizblase Harnwegsinfekte Hormone Operationen Spezielle Probleme bei der älteren Patientin Inkontinenz 50% postmenopausaler
Frau und Probleme mit der Blase... Alexandra Röllin Annette Kuhn Bern Inkontinenz Reizblase Harnwegsinfekte Hormone Operationen Spezielle Probleme bei der älteren Patientin Inkontinenz 50% postmenopausaler
Harninkontinenz: Volkskrankheit und Tabu
 HARNINKONTINENZ 7 Harninkontinenz: Volkskrankheit und Tabu Miriam Deniz Die Belastungsinkontinenz und die Überaktive Blase gehören zu den häufigsten Krankheitsbildern unserer Zeit. Die Prävalenz scheint
HARNINKONTINENZ 7 Harninkontinenz: Volkskrankheit und Tabu Miriam Deniz Die Belastungsinkontinenz und die Überaktive Blase gehören zu den häufigsten Krankheitsbildern unserer Zeit. Die Prävalenz scheint
Fragebogen des Beckenboden- und Kontinenzzentrums Pfalz
 Fragebogen des Beckenboden- und Kontinenzzentrums Pfalz Wir bitten Sie den Fragenbogen möglichst vollständig auszufüllen. Er hilft uns, schneller die Ursachen ihrer Beschwerden zu erkennen. Wenn Fragen
Fragebogen des Beckenboden- und Kontinenzzentrums Pfalz Wir bitten Sie den Fragenbogen möglichst vollständig auszufüllen. Er hilft uns, schneller die Ursachen ihrer Beschwerden zu erkennen. Wenn Fragen
Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz
 Harninkontinenz: Definition Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz Unter Harninkontinenz verstehen wir, wenn ungewollt Urin verloren geht. Internationale Kontinenzgesellschaft (ICS) Zustand mit jeglichem
Harninkontinenz: Definition Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz Unter Harninkontinenz verstehen wir, wenn ungewollt Urin verloren geht. Internationale Kontinenzgesellschaft (ICS) Zustand mit jeglichem
Reden wir über Harninkontinenz!
 PRESSEINFORMATION Wels, Juni 2018 Auch Männer betroffen Reden wir über Harninkontinenz! Knapp eine Million Österreicher quer durch alle Altersgruppen ist von unfreiwilligem Harnverlust betroffen: Neben
PRESSEINFORMATION Wels, Juni 2018 Auch Männer betroffen Reden wir über Harninkontinenz! Knapp eine Million Österreicher quer durch alle Altersgruppen ist von unfreiwilligem Harnverlust betroffen: Neben
Harnblasenentleerungs- und speicherstörung : Wie können wir Urologen helfen?
 Jahresseminar der HSP-Selbsthilfegruppe Deutschland e.v. Braunlage 20. April 2012 Harnblasenentleerungs- und speicherstörung : Wie können wir Urologen helfen? Dr. W. Wucherpfennig, Urologische Klinik Salzgitter
Jahresseminar der HSP-Selbsthilfegruppe Deutschland e.v. Braunlage 20. April 2012 Harnblasenentleerungs- und speicherstörung : Wie können wir Urologen helfen? Dr. W. Wucherpfennig, Urologische Klinik Salzgitter
Leben Sie Ihr Leben!
 Toilette Toilette Leben Sie Ihr Leben! Ergreifen Sie die Initiative und erfahren Sie in dieser Broschüre mehr über die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten der überaktiven Blase. Weitere Informationen
Toilette Toilette Leben Sie Ihr Leben! Ergreifen Sie die Initiative und erfahren Sie in dieser Broschüre mehr über die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten der überaktiven Blase. Weitere Informationen
urivesc : Neue Option bei der 1x1-Behandlung der überaktiven Blase
 Effektive Inkontinenztherapie mit Trospiumchlorid urivesc : Neue Option bei der 1x1-Behandlung der überaktiven Blase Mannheim (14.11.2009) Das Anticholinergikum urivesc mit dem Wirkstoff Trospiumchlorid
Effektive Inkontinenztherapie mit Trospiumchlorid urivesc : Neue Option bei der 1x1-Behandlung der überaktiven Blase Mannheim (14.11.2009) Das Anticholinergikum urivesc mit dem Wirkstoff Trospiumchlorid
Fragebogen des Beckenboden- und Kontinenzzentrums Pfalz
 Fragebogen des Beckenboden- und Kontinenzzentrums Pfalz Wir bitten Sie den Fragenbogen möglichst vollständig auszufüllen. Er hilft uns, schneller die Ursachen ihrer Beschwerden zu erkennen. Wenn Fragen
Fragebogen des Beckenboden- und Kontinenzzentrums Pfalz Wir bitten Sie den Fragenbogen möglichst vollständig auszufüllen. Er hilft uns, schneller die Ursachen ihrer Beschwerden zu erkennen. Wenn Fragen
BECKENBODEN- KONTINENZ- & ZENTRUM ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR
 ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR KONTINENZ- & BECKENBODEN- ZENTRUM WILLKOMMEN Über uns Der Beckenboden ist für die Funktion von Blase und Darm von entscheidender Bedeutung. Geburten, Bindegewebsschwäche,
ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR KONTINENZ- & BECKENBODEN- ZENTRUM WILLKOMMEN Über uns Der Beckenboden ist für die Funktion von Blase und Darm von entscheidender Bedeutung. Geburten, Bindegewebsschwäche,
Workshop 18: «Zuviel im Fluss»- Urininkontinenz
 Workshop 18: «Zuviel im Fluss»- Urininkontinenz Dr. med. Corina Christmann, Leitende Ärztin, Leitung Urogynäkologie Frauenklinik Luzerner Kantonsspital Agenda Welche Inkontinenz-Formen gibt es? - Inkl.
Workshop 18: «Zuviel im Fluss»- Urininkontinenz Dr. med. Corina Christmann, Leitende Ärztin, Leitung Urogynäkologie Frauenklinik Luzerner Kantonsspital Agenda Welche Inkontinenz-Formen gibt es? - Inkl.
Urininkontinenz der Frau: Was ist sinnvoll in der hausärztlichen Praxis?
 Urininkontinenz der Frau: Was ist sinnvoll in der hausärztlichen Praxis? Jörg Humburg Frauenklinik, Kantonsspital Bruderholz Quintessenz P Die Urininkontinenz der Frau ist eine häufige Erkrankung, die
Urininkontinenz der Frau: Was ist sinnvoll in der hausärztlichen Praxis? Jörg Humburg Frauenklinik, Kantonsspital Bruderholz Quintessenz P Die Urininkontinenz der Frau ist eine häufige Erkrankung, die
Kontinenzfördernde Pflege im spitalexternen Umfeld. Martha Vögeli Dipl. Pflegefachfrau HF/ Stomatherapeutin Kontinenz- & Stomaberatung Spitex Uster
 Kontinenzfördernde Pflege im spitalexternen Umfeld Martha Vögeli Dipl. Pflegefachfrau HF/ Stomatherapeutin Kontinenz- & Stomaberatung Spitex Uster Möglichkeiten der kontinenzfördenden Pflege in der Spitex
Kontinenzfördernde Pflege im spitalexternen Umfeld Martha Vögeli Dipl. Pflegefachfrau HF/ Stomatherapeutin Kontinenz- & Stomaberatung Spitex Uster Möglichkeiten der kontinenzfördenden Pflege in der Spitex
Belastungsharninkontinenz
 Behandlung von Belastungsharninkontinenz Die Kontrolle zurückgewinnen. Lebensqualität wiederherstellen. Ihre Fragen - unsere Antworten Wissenswertes über die Harninkontinenz Harninkontinenz ist ein weit
Behandlung von Belastungsharninkontinenz Die Kontrolle zurückgewinnen. Lebensqualität wiederherstellen. Ihre Fragen - unsere Antworten Wissenswertes über die Harninkontinenz Harninkontinenz ist ein weit
BAnz AT B3. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die utzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die utzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren. Dr. Nicole Lövin
 Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren Dr. Nicole Lövin Quellenangaben Guidelines der European Association of Urology (EAU, 2013) Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren Dr. Nicole Lövin Quellenangaben Guidelines der European Association of Urology (EAU, 2013) Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt
 Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Miktionsanamnese Begleiterkrankungen Miktionsanamnese Trink- und Essgewohnheiten
Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Miktionsanamnese Begleiterkrankungen Miktionsanamnese Trink- und Essgewohnheiten
Harninkontinenz. Stefan Corvin Fachzentrum für Urologie Eggenfelden. Harninkontinenz. Tabu-Thema auch von Ärzten vernachlässigt
 Harninkontinenz Stefan Corvin Fachzentrum für Urologie Eggenfelden Harninkontinenz Tabu-Thema auch von Ärzten vernachlässigt 1 Häufigkeit -ca 6-8 Millionen Betroffene in Deutschland -insbesondere Frauen
Harninkontinenz Stefan Corvin Fachzentrum für Urologie Eggenfelden Harninkontinenz Tabu-Thema auch von Ärzten vernachlässigt 1 Häufigkeit -ca 6-8 Millionen Betroffene in Deutschland -insbesondere Frauen
Tiefer Beckenboden. Ursachen/Risiken POP
 Tiefer Beckenboden 11.Fortbildungstag des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM) KKL Luzern, 25. Juni 2009 B. Köhler O. Hutter Ursachen/Risiken POP SS/Geburt: 1. Kind Hohes Geburtsgewicht Lange AP/Forzeps,
Tiefer Beckenboden 11.Fortbildungstag des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM) KKL Luzern, 25. Juni 2009 B. Köhler O. Hutter Ursachen/Risiken POP SS/Geburt: 1. Kind Hohes Geburtsgewicht Lange AP/Forzeps,
Pessartherapie in der Praxis
 Pessartherapie in der Praxis Katharina Putora Oberärztin Frauenklinik, KSSG 1000 v. Chr Pessartherapie in der Praxis 1000 v. Chr c 1000 v. Chr c Indikationen Prolaps Belastungsinkontinenz überaktive Blase
Pessartherapie in der Praxis Katharina Putora Oberärztin Frauenklinik, KSSG 1000 v. Chr Pessartherapie in der Praxis 1000 v. Chr c 1000 v. Chr c Indikationen Prolaps Belastungsinkontinenz überaktive Blase
BLASENBESCHWERDEN BEI DER FRAU
 1 Praxisadresse: Urologie am Rheinfall, Heinrich Moser-Platz 5, 8212 Neuhausen Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, bitte nehmen Sie Platz Dr. med. Isabelle S. Keller Fachärztin für Urologie, speziell operative
1 Praxisadresse: Urologie am Rheinfall, Heinrich Moser-Platz 5, 8212 Neuhausen Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, bitte nehmen Sie Platz Dr. med. Isabelle S. Keller Fachärztin für Urologie, speziell operative
Harninkontinenz bei Frauen ein häufiges und oft schweres Lebensqualitätsproblem
 CURRICULUM Schweiz Med Forum 2006;6:442 447 442 Harninkontinenz bei Frauen ein häufiges und oft schweres Lebensqualitätsproblem Gabriel Schär Frauenklinik, Kantonsspital Aarau Quintessenz Die Belastungsinkontinenz
CURRICULUM Schweiz Med Forum 2006;6:442 447 442 Harninkontinenz bei Frauen ein häufiges und oft schweres Lebensqualitätsproblem Gabriel Schär Frauenklinik, Kantonsspital Aarau Quintessenz Die Belastungsinkontinenz
Anhang. Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-Operation
 53 Anhang Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) Name, Vorname: geboren am: Größe cm Gewicht:
53 Anhang Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) Name, Vorname: geboren am: Größe cm Gewicht:
Zu dieser Folie: Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz
 Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3 Relevante Kapitel:
Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3 Relevante Kapitel:
Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis. AGUB GK Freiburg,
 Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis AGUB GK Freiburg, 28.10.2016 Überblick Harninkontinenz Belastungsinkontinenz Dranginkontinenz Nykturie Mischformen Überblick
Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis AGUB GK Freiburg, 28.10.2016 Überblick Harninkontinenz Belastungsinkontinenz Dranginkontinenz Nykturie Mischformen Überblick
Urogynäkologiekurse. Grundkurse Aufbaukurse. Refresherkurse. MFA-Kurse. Erfurt Worms - Dresden
 Urogynäkologiekurse Grundkurse Aufbaukurse Refresherkurse MFA-Kurse Erfurt Worms - Dresden offizielle Fortbildungsveranstaltungen der AGUB Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und Beckenbodenrekonstruktion
Urogynäkologiekurse Grundkurse Aufbaukurse Refresherkurse MFA-Kurse Erfurt Worms - Dresden offizielle Fortbildungsveranstaltungen der AGUB Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und Beckenbodenrekonstruktion
BLASENBESCHWERDEN BEI DER FRAU - MÖGLICHKEITEN DER BECKEN-PHYSIOTHERAPIE
 1 Adresse: Physiotherapie am Rheinfall, Heinrich Moser-Platz 5, 8212 Neuhausen - MÖGLICHKEITEN DER BECKEN-PHYSIOTHERAPIE Gabriela Meier Soltic Physiotherapeutin FH, Beckenphysiotherapeutin MSc PRAXIS UROLOGIE
1 Adresse: Physiotherapie am Rheinfall, Heinrich Moser-Platz 5, 8212 Neuhausen - MÖGLICHKEITEN DER BECKEN-PHYSIOTHERAPIE Gabriela Meier Soltic Physiotherapeutin FH, Beckenphysiotherapeutin MSc PRAXIS UROLOGIE
UKD Universitätsklinikum
 UKD Universitätsklinikum Düsseldorf Urinverlust und Senkungsbeschwerden Wir helfen Ihnen Informationen für Patentinnen Beckenbodenzentrum Liebe Patientin, Sie sind auf der Suche nach Hilfe auf Grund von
UKD Universitätsklinikum Düsseldorf Urinverlust und Senkungsbeschwerden Wir helfen Ihnen Informationen für Patentinnen Beckenbodenzentrum Liebe Patientin, Sie sind auf der Suche nach Hilfe auf Grund von
Inkontinenz/Deszensus
 Inkontinenz/Deszensus Universitätsfrauenklinik Dresden A. Kolterer Epidemiologie der Beckebodenfunktionsstörungen Prävalenz für Genitalsenkung beträgt im Mittel 19.7% für Harninkontininenz 28.7% für Stuhlinkontinenz
Inkontinenz/Deszensus Universitätsfrauenklinik Dresden A. Kolterer Epidemiologie der Beckebodenfunktionsstörungen Prävalenz für Genitalsenkung beträgt im Mittel 19.7% für Harninkontininenz 28.7% für Stuhlinkontinenz
Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm. Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr
 Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr Liebe Patienten, in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an ständigem Harndrang,
Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr Liebe Patienten, in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an ständigem Harndrang,
Dossierbewertung A14-19 Version 1.0 Mirabegron Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V
 2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Mirabegron gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung erfolgte auf Basis eines
2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Mirabegron gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung erfolgte auf Basis eines
Vorwort 11. Der Harntrakt und seine Funktion 15
 Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Überaktive Blase erkennen. Unterdiagnostiziert Unterbehandelt
 Überaktive Blase erkennen Unterdiagnostiziert Unterbehandelt Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege Eine überaktive Blase (OAB) ist ein behandelbares Krankheitsbild, das nach wie vor unterdiagnostiziert
Überaktive Blase erkennen Unterdiagnostiziert Unterbehandelt Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege Eine überaktive Blase (OAB) ist ein behandelbares Krankheitsbild, das nach wie vor unterdiagnostiziert
Senkungen und Harninkontinenz
 Gerlinde Debus Senkungen und Harninkontinenz Eine medizinische Entscheidungshilfe für betroffene Frauen DC D IAMETRI VERLAG C gender f orschung rauengesundheit Anschrift der Autorin Professor Dr. med.
Gerlinde Debus Senkungen und Harninkontinenz Eine medizinische Entscheidungshilfe für betroffene Frauen DC D IAMETRI VERLAG C gender f orschung rauengesundheit Anschrift der Autorin Professor Dr. med.
Medikamentöse Therapie bei überaktiver Blase und Belastungsinkontinenz
 Medikamentöse Therapie bei überaktiver Blase und Belastungsinkontinenz Update 2006: Umsetzung im Praxisalltag Für den Praktiker wird es immer zeitaufwendiger, sich eine Übersicht über die verschiedenen
Medikamentöse Therapie bei überaktiver Blase und Belastungsinkontinenz Update 2006: Umsetzung im Praxisalltag Für den Praktiker wird es immer zeitaufwendiger, sich eine Übersicht über die verschiedenen
Die überaktive Blase Update
 An JEDEM Baum! Die überaktive Blase Update Wolfgang Umek Universitätsklinik für Frauenheilkunde Wien Obergurgl 2012 wolfgang.umek@meduniwien.ac.at Begriffsdefinition Harndrang überaktive Blase (OAB) Häufige
An JEDEM Baum! Die überaktive Blase Update Wolfgang Umek Universitätsklinik für Frauenheilkunde Wien Obergurgl 2012 wolfgang.umek@meduniwien.ac.at Begriffsdefinition Harndrang überaktive Blase (OAB) Häufige
Inkontinenz. Was versteht man unter Harninkontinenz? Welche Untersuchungen sind notwendig?
 Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
ICS-Definition der Harninkontinenz: Die Entwicklung. Alter und Urininkontinenz
 52-jährige Patientin mit Verlust von grösseren Mengen Urin beim Spielen mit dem Enkel. Schon länger tropfenweise Urinverlust beim Husten und Niesen. Früher oft eckenbodengymnastik mit gutem Erfolg, ohne
52-jährige Patientin mit Verlust von grösseren Mengen Urin beim Spielen mit dem Enkel. Schon länger tropfenweise Urinverlust beim Husten und Niesen. Früher oft eckenbodengymnastik mit gutem Erfolg, ohne
Konservative Therapie der überaktiven Blase
 Konservative Therapie der überaktiven Blase Urogynäkologie Grundkurs 2017 Dr. Monika Gerber Evangelisches Diakoniekrankenhaus 1) M. detrusor vesicae 2) Nn. pelvici splanchnici (parasympathisch: M2/M3 Rezeptoren)
Konservative Therapie der überaktiven Blase Urogynäkologie Grundkurs 2017 Dr. Monika Gerber Evangelisches Diakoniekrankenhaus 1) M. detrusor vesicae 2) Nn. pelvici splanchnici (parasympathisch: M2/M3 Rezeptoren)
WAID- FORUM. Blasenschwäche - ein Tabu Thema -????????????????
 WAID- FORUM Blasenschwäche - ein Tabu Thema -???????????????? Daniel Passweg, Chefarzt-Stellvertreter Frauenklinik Stadtspital Triemli Belastungsinkontinenz und Vorfall Gesundheitswesen häufig erste Anlaufsstelle
WAID- FORUM Blasenschwäche - ein Tabu Thema -???????????????? Daniel Passweg, Chefarzt-Stellvertreter Frauenklinik Stadtspital Triemli Belastungsinkontinenz und Vorfall Gesundheitswesen häufig erste Anlaufsstelle
Parkinson und die Blase
 encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt Behandlung von Blasenproblemen ISK kann helfen Die Krankheit Parkinson Parkinson ist eine fortschreitende neurologische
encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt Behandlung von Blasenproblemen ISK kann helfen Die Krankheit Parkinson Parkinson ist eine fortschreitende neurologische
Wirkungsvolle Hilfe für Frauen bei Blasenschwäche
 Wirkungsvolle Hilfe für Frauen bei Blasenschwäche Sehr geehrte Patientinnen, über Blasenschwäche oder Harninkontinenz wird nicht viel gesprochen obwohl in Deutschland etwa fünf Millionen Frauen darunter
Wirkungsvolle Hilfe für Frauen bei Blasenschwäche Sehr geehrte Patientinnen, über Blasenschwäche oder Harninkontinenz wird nicht viel gesprochen obwohl in Deutschland etwa fünf Millionen Frauen darunter
Inkontinenz: Rezidivierende HWI. LSA und LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms)
 Frauenklinik Geburtshilfe Die Probleme der Vulva beim Urogynäkologen J. Ries Urogynäkologische Erkrankungen Inkontinenz Rez. HWI Miktionsstörungen LSA Vulvaerkrankungen 2 Vulva und Urogynäkologie Belastungsinkontinenz
Frauenklinik Geburtshilfe Die Probleme der Vulva beim Urogynäkologen J. Ries Urogynäkologische Erkrankungen Inkontinenz Rez. HWI Miktionsstörungen LSA Vulvaerkrankungen 2 Vulva und Urogynäkologie Belastungsinkontinenz
Prophylaxen. P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz
 Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
LoFric encathopedia. Behandlung von Blasenproblemen. Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt. ISK kann helfen
 LoFric encathopedia encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wellspect HealthCare ist ein führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Urologie und Chirurgie. Wir
LoFric encathopedia encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wellspect HealthCare ist ein führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Urologie und Chirurgie. Wir
Fragebogen zum unwillkürlichen Urinverlust: Inkontinenz
 Fragebogen zum unwillkürlichen Urinverlust: Inkontinenz Patienten-Name oder Initialen: Geburtsdatum: Aktuelles Datum: Liebe Patientin, lieber Patient Ihre Blasenfunktion ist uns ein Anliegen. Vor allem
Fragebogen zum unwillkürlichen Urinverlust: Inkontinenz Patienten-Name oder Initialen: Geburtsdatum: Aktuelles Datum: Liebe Patientin, lieber Patient Ihre Blasenfunktion ist uns ein Anliegen. Vor allem
Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau
 Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Gültig bis: 07/2018 Evidenzlevel: S2e Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau http://www.dggg.de/leitlinien DGGG 2013 Diagnostik
Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Gültig bis: 07/2018 Evidenzlevel: S2e Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau http://www.dggg.de/leitlinien DGGG 2013 Diagnostik
Management der Mischinkontinenz Die Mischinkontinenz steigt mit zunehmendem Lebens - alter und ist ab dem 55. Altersjahr die häufigste Inkonti-
 Management der Mischinkontinenz Schritt für Schritt zum Erfolg Diagnostik, Therapie, Beratung Die Mischinkontinenz steigt mit zunehmendem Lebens - alter und ist ab dem 55. Altersjahr die häufigste Inkontinenzform.
Management der Mischinkontinenz Schritt für Schritt zum Erfolg Diagnostik, Therapie, Beratung Die Mischinkontinenz steigt mit zunehmendem Lebens - alter und ist ab dem 55. Altersjahr die häufigste Inkontinenzform.
Interdisziplinäre S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Kurzfassung AWMF-Register-Nummer:015 005,Juli2013
 Interdisziplinäre S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Kurzfassung AWMF-Register-Nummer:015 005,Juli2013 Interdisciplinary S2e Guideline for the Diagnosis and Treatment
Interdisziplinäre S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Kurzfassung AWMF-Register-Nummer:015 005,Juli2013 Interdisciplinary S2e Guideline for the Diagnosis and Treatment
Interstitielle & Chronische Cystitis. Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand?
 Interstitielle & Chronische Cystitis Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand? Was ist das Besondere an Instillamed? 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand
Interstitielle & Chronische Cystitis Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand? Was ist das Besondere an Instillamed? 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand
DR. ARZT MUSTER Facharzt für Urologie und Andrologie
 1 DR. ARZT MUSTER Facharzt für Urologie und Andrologie 2 Herzlich willkommen in meiner Ordination! 3 MEIN TEAM 4 Dr. Arzt Muster MEIN TEAM Medizinstudium und Ausbildung zum Facharzt für Urologie und Andrologie
1 DR. ARZT MUSTER Facharzt für Urologie und Andrologie 2 Herzlich willkommen in meiner Ordination! 3 MEIN TEAM 4 Dr. Arzt Muster MEIN TEAM Medizinstudium und Ausbildung zum Facharzt für Urologie und Andrologie
Ich kann nicht Wasser lösen!
 Ich kann nicht Wasser lösen! Swiss Family Docs, Basel 26.08.2011 Christoph Cina / Stephan Holliger Eine häufige und banale Männergeschichte? Eine häufige und banale Männergeschichte? Arten der Prostata
Ich kann nicht Wasser lösen! Swiss Family Docs, Basel 26.08.2011 Christoph Cina / Stephan Holliger Eine häufige und banale Männergeschichte? Eine häufige und banale Männergeschichte? Arten der Prostata
Interstitielle & Chronische Cystitis. Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand?
 Interstitielle & Chronische Cystitis Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand? Was ist das Besondere an Instillamed? 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand
Interstitielle & Chronische Cystitis Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand? Was ist das Besondere an Instillamed? 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten. Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie
 Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Unentspannt? Besser bestens entspannt. Fragen Sie Ihren Arzt! Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase
 Unentspannt? Fragen Sie Ihren Arzt! Besser bestens entspannt. Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase Die überaktive Blase Liebe Leserinnen, liebe Leser, Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit
Unentspannt? Fragen Sie Ihren Arzt! Besser bestens entspannt. Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase Die überaktive Blase Liebe Leserinnen, liebe Leser, Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit
Gynäkologie am EVKK EIN KOMPETENTES TEAM AN IHRER SEITE INFORMATION FÜR PATIENTEN UND ÄRZTE UNSERE ANGEBOTE
 Gynäkologie am EVKK EIN KOMPETENTES TEAM AN IHRER SEITE INFORMATION FÜR PATIENTEN UND ÄRZTE UNSERE ANGEBOTE Gynäkologie DAS TEAM DER Dr. Dirk M. Forner Chefarzt Dr. Friedrich Strecker Oberarzt Angela Jörissen
Gynäkologie am EVKK EIN KOMPETENTES TEAM AN IHRER SEITE INFORMATION FÜR PATIENTEN UND ÄRZTE UNSERE ANGEBOTE Gynäkologie DAS TEAM DER Dr. Dirk M. Forner Chefarzt Dr. Friedrich Strecker Oberarzt Angela Jörissen
Blasenschwäche? Überaktive Blase? Werden Sie jetzt aktiv! Was Sie gezielt gegen häufigen Harndrang und eine überaktive Blase tun können.
 Blasenschwäche? Überaktive Blase? Werden Sie jetzt aktiv! Was Sie gezielt gegen häufigen Harndrang und eine überaktive Blase tun können. Blasenbeschwerden bei Frauen weit verbreitet, oft verschwiegen Typische
Blasenschwäche? Überaktive Blase? Werden Sie jetzt aktiv! Was Sie gezielt gegen häufigen Harndrang und eine überaktive Blase tun können. Blasenbeschwerden bei Frauen weit verbreitet, oft verschwiegen Typische
Management der Mischinkontinenz Schritt für Schritt zum Erfolg Diagnostik, Therapie, Beratung
 Management der Mischinkontinenz Schritt für Schritt zum Erfolg Diagnostik, Therapie, Beratung Die Mischinkontinenz steigt mit zunehmendem Lebensalter und ist ab dem 55. Altersjahr die häufigste Inkontinenzform.
Management der Mischinkontinenz Schritt für Schritt zum Erfolg Diagnostik, Therapie, Beratung Die Mischinkontinenz steigt mit zunehmendem Lebensalter und ist ab dem 55. Altersjahr die häufigste Inkontinenzform.
