Literalität und Stigma. Ulrich Steuten
|
|
|
- Kilian Vogt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Literalität und Stigma Ulrich Steuten Der Blick auf Menschen mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen hat sich seit der Veröffentlichung der leo. Level.One-Studie im Februar 2011 erheblich verändert. Dies lässt sich zumindest für die fachwissenschaftliche Sichtweise so konstatieren. Eingebettet in den Förderschwerpunkt Forschung und Entwicklung zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener des BMBF, gelang es dem Forschungsteam um Anke Grotlüschen erstmals belastbare Zahlen zur Größenordnung des funktionalen Analphabetismus zu ermitteln. In nachfolgenden Veröffentlichungen haben differenziertere Analysen aus dem Forschungsschwerpunkt weitere, zum Teil überraschende Zusammenhänge sichtbar gemacht: Befunde zum Zusammenhang von funktionalem Analphabetismus und Erwerbstätigkeit, Schulabschluss, regionaler Verteilung brachten einige unerwartete Fakten hervor. Wie nie zuvor in der Geschichte der deutschen Erwachsenenalphabetisierung entwickelten sich in der Folge des Bekanntwerdens der leo-forschungsergebnisse auf verschiedenen Ebenen Diskurse über angemessene und wirksame Reaktionen auf die Problematik eines postschulischen Analphabetismus. Zu diesen Diskursen gehört - vornehmlich in fachwissenschaftlichen Kreisen - zum einen die Auseinandersetzung über eine adäquate Bezeichnung der Problematik und der von ihr betroffenen Menschen. Zum anderen nimmt die - auch zunehmend öffentlich geführte - Diskussion über ein angemessenes Verständnis der Lebenssituation nicht hinreichend alphabetisierter Menschen seit Veröffentlichung der leo-studie größeren Raum ein. Die Erkenntnis, dass die allseits gängige Vorstellung des von gesellschaftlicher Teilhabeoptionen nahezu ausgeschossenen, weitgehend hilflosen leseund schriftunkundigen Menschen sich als nicht zutreffend erwiesen hat, hat geradezu einen Boom an Beiträgen zur Teilhabediskussion ausgelöst (vgl. Hessische Blätter 3/2010; Kastner 2011; Report 3/2011, 1/2012; EB 2/2012; Alfa-Forum 84/2014). Wenngleich die Revision des Teilhabe-Trugbildes in der fachlichen Diskussion mittlerweile intensiver nachvollzogen wurde, so gilt dies trotz verschiedenster Alphabetisierungs- und Grundbildungskampagnen (z.
2 B. Mein Schlüssel zur Welt ) und Förderschwerpunkte längst nicht für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Der vorliegende Beitrag richtet den Blick hauptsächlich auf die beiden oben skizzierten Diskurse um damit einige Entwicklungen in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsforschung der letzten zwei Jahre zu verdeutlichen. Er zielt darauf ab Fortschritte wie auch Desiderate sichtbar zu machen. 1 Begriff und Stigma Die Tatsache, dass in hoch entwickelten Gegenwartsgesellschaften Menschen leben, deren Schriftkenntnisse unter den für das alltägliche Leben in diesen Gesellschaften als notwendig angesehene Maß liegt, löst bis heute vielfach Erstaunen und Befremdung aus. Sie als funktionale Analphabeten zu bezeichnen, hat sich als gängiger und weitgehend akzeptierter Terminus technicus durchgesetzt. Noch 2010 befassten sich eine Expertenkommission aus Theorie und Praxis der Erwachsenenalphabetisierung in der Fachgruppe Zielgruppenanalyse im Kontext des BMBF-Förderschwerpunktes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Alphabetisierung/Grundbildung für Erwachsene mit einer Überprüfung und Neujustierung dieses Begriffs. Ihrer später als Alphabund-Definition bekannt gewordenen Definition zufolge liegt Funktionaler Analphabetismus vor, wenn die schriftsprachlichen Kompetenzen von Erwachsenen niedriger sind als diejenigen, die minimal erforderlich sind und als selbstverständlich vorausgesetzt werden, um den jeweiligen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. (vgl. von Rosenbladt/Bilger 2011, S. 9). Zu den gemeinten Anforderungen werden in diesem Kontext die gesellschaftliche Teilhabe und die Realisierung individueller Verwirklichungschancen gerechnet. In den weiteren Ausführungen zur Definition werden prekäre Lebensumstände, permanente Abhängigkeit von sozialstaatlicher und /oder privater Hilfe sowie eingeschränkte(n) Kompetenzen in anderen Bildungsbereichen als Begleiterscheinungen funktionalen Analphabetismus genannt. Wenngleich eine so gefasste Definition eine fraglos bestehende Problematik und ihre Folgen zunächst schlüssig erscheinen lässt macht, haftet ihr doch ein entscheidender Nachteil an: Die gewählte
3 Bezeichnung für Menschen mit diesem speziellen Problem diskreditiert die Betroffenen. Allein das Wort Analphabetismus - so konstatiert von Rosenbladt (2012, S. 10) zu Recht - hat einen dramatisierenden Charakter. Menschen mit Schriftproblemen als Analphabeten zu bezeichnen, kann von diesen daher im 21. Jahrhundert kaum anders als diffamierend empfunden werden. Mehr noch, die Rede von Analphabeten verschärft die Stigmatisierung (von Rosenbladt 2012, S. 10). Sie lässt das Problem Norm abweichender literaler Praxis als pathologische(n) Zustand (Linde 2004, S. 28) erscheinen, marginalisiert die Betroffenen und erschwert es ihnen damit, sich anderen Menschen, aber auch Weiterbildungseinrichtungen mit ihrem Problem anzuvertrauen. Die Dramatisierung der Abweichung von einer Norm-Literalität produziert und verstetigt ein in den Massenmedien gern aufgegriffenes Klischee des sprach- und hilflosen Außenseiters (vgl. Egloff 2000). Folgt man der Klassifizierung des kanadischen Soziologen Erving Goffman (1980, S. 56ff), so lassen sich funktionale Analphabeten sehr wohl der Gruppe der Diskreditierbaren zuzuordnen. Sie sind anders als Menschen mit sichtbaren Behinderungen oder auffälligem Sozialverhalten, die Goffman zu den Diskreditierten rechnet, als solche nicht zu erkennen. Dennoch führen sie einen Makel mit sich. Viele von ihnen leben auf Grund dessen in beständiger Angst, dass ihr Handikap offenbar wird. Aus diesem Grund haben sie Techniken des Umgangs mit dem ihnen zugeschrieben und mitunter auch selbst empfundenen Stigmata entwickelt. Laut Goffman umfasst ihr Stigma-Management unterschiedliche Techniken der Informationskontrolle (Goffman 1980, S. 116) und steht im Dienst der Aufrechterhaltung ihrer Identität. Dazu gehört unter anderem, dass sie in bestimmten, antizipierten Situationen die Hilfe vertrauter Menschen (oder anderer, um ihre besondere Situation Wissende, bei Goffman: Weise ) in Anspruch nehmen oder auf selbsterdachte Bewältigungsstrategien zurückgreifen um Begegnungen mit der Schrift in ihren Alltag zu meistern und so einer Stigmatisierung zu entgehen. Unter Bezug auf die Studie von H. Freeman und G. Kasenbaum The Illiterate in America von 1956 verweist Goffman (1980, S. 31) darauf, dass Analphabeten sehr wohl über eigene normative Begriffe zur Bewertung von Situationen verfügen, sich ein differenziertes Wertesystem schaffen und dieses anerkennen sowie
4 eigene Symbole und Idiome kreieren, die für ihre Lebenswelt sinnvoll und tauglich sind. Die durch Vertraute und Weise vermittelte moralische Unterstützung führt die Diskreditierbaren dazu, sich akzeptiert zu fühlen, als eine Person, die wirklich wie jede andere normale Person ist. Unter Ihresgleichen und Vertrauten fühlen sie sich sicher und vor der Bedrohung ihres Images weitgehend geschützt. Die selbstgeschaffene Lebenswelt zu verlassen kann für die Betroffenen dagegen einen potentiellen Kontrollverlust bedeuten. Die Vergegenwärtigung dieser besonderen Problematik trägt auch zur Erklärung der Frage bei, warum sich nur ein minimaler Bruchteil nicht hinreichend alphabetisierter Menschen zur Teilnahme an Kursen zum Lesen- und Schreibenlernen entschließt. Auf die von Goffman beschriebene latente Gefahr der Stigmatisierung funktionaler Analphabeten und deren Einfluss auf ihre Identität wie auch auf ihre (zum Teil kontraproduktiven) Problemlösungsstrategien wurde bereits in den Anfängen der Alphabetisierungsbewegung in Deutschland hingewiesen (vgl. Oswald/Müller 1982, S. 98ff). Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Funktionalen Analphabetismus, an der sich auch Wissenschaftler des Literacy Research Centers der Universität Lancaster beteiligten, vermochte Mitte der 2000er Jahre im deutschsprachigem Raum weder eine begriffliche Modifizierung noch eine theoretische Neuausrichtung herbeizuführen (vgl. hierzu die Beiträge von Ivancic/Baron/Hamilton, Linde, Korfkamp/Steuten in Alfa-Forum 54-55). In jüngster Zeit hat von Rosenblatt erneut einen Versuch unternommen, stigmatisierende Effekte bei der Benennung der Thematik durch eine sensiblere Sprachverwendung zu vermeiden. Alternativ zum Begriff des (funktionalen) Analphabetismus, der ihm zufolge in der Öffentlichkeit jedoch falsche Vorstellungen (weckt) und auch nicht dazu geeignet (ist), die Zielgruppe möglicher Bildungsangebote anzusprechen (von Rosenblatt, 2012, S. 75), schlägt er ein Konzept vor, in dem die Grade der Schriftbeherrschung unterschieden werden (von Rosenbladt/Lehmann 2013, S. 56). Die besonderen Schwierigkeiten mancher Menschen mit geschriebener Sprache wären ihm zufolge analog zu den etablierten Begriffen der Rechenschwäche oder der Lese-Rechtschreibschwäche dann als Schriftschwäche zu beschreiben. Die Betroffenen wären
5 entsprechend als Menschen mit Schriftschwäche oder als Schriftschwache zu bezeichnen. Freilich signalisiert auch dieser Vorschlag eine Problemlage. Ob mit ihm aber eine Diskreditierung vermieden wird und Betroffene diese Bezeichnung akzeptieren können, ist damit noch nicht gesagt. Die Problematik der begrifflichen Schwierigkeiten zeigt sich sehr deutlich auch in den Vorüberlegungen und Darstellungen zur leo.- Studie. Die dazu eingeführte Unterscheidung von unterschiedlichen Alpha-Levels hat sich für den wissenschaftlichen Bereich als trennscharf und aussagekräftig erwiesen. Die Verwendung des Begriffes der Literalität und der Charakterisierung unterschiedlicher Stufen (levels) eröffnet und signalisiert prinzipiell aber auch die Chance einer Abkehr von der Konzeption des Funktionalen Analphabetismus. Gleichwohl operiert die Studie durchgängig sowohl mit dem Begriff des Funktionalen Analphabetismus auf der Basis der Alphabund-Definition, der Definition der UNESCO von 1978, die auf eine wortgleiche, seinerzeit freilich nur zu statistischen Zwecken empfohlenen Formulierung des Analphabetismus von 1958 zurückgeht als auch dem Begriff der Literalität. Letztere stellt laut den Autorinnen ein Merkmal dar, dass in unterschiedlichen Abstufungen auftritt (Grotlüschen/Riekmann 2011, S. 26). Der International Adult Literacy Survey (IALS) hatte 1995 die Literacy- Konzeption bewusst gewählt, um - wie auch Grotlüschen und Riekmann (ebd., S. 26) erwähnen - von der dichotomen Teilung in Personen, die als literalisiert und nicht literalisiert gelten, Abstand nehmen zu können. Obwohl Grotlüschen u.a. bereits 2009 in ihrem Aufsatz über Die unterschätzte Macht legitimer Literalität die Tragfähigkeit einer Konzeption anerkennen, der zufolge im Wege multipler Literalitäten Raum für Anerkennung und Ressourcenorientierung geschaffen würde, entscheiden sie sich nun dafür den Begriff des funktionalen Analphabetismus beizubehalten. Diese als konservativ (im Sinne von vorsichtig) und begründungswürdig bezeichnete Entscheidung wird von den Autorinnen als notwendig erachtet, um präzise angeben zu können, wo funktionaler Analphabetismus beginnt.
6 Die Auswertung der ermittelten Daten zeigt wie erwartet eine deutliche Korrespondenz der Ergebnisse mit den Definitionen des Analphabetismus beziehungsweise des funktionalen Analphabetismus. Das gewählte Forschungsdesign macht es nachweislich möglich die präzisierte Definition des funktionalen Analphabetismus mit Hilfe von Alpha-Levels zu operationalisieren (ebd., S. 27). Die Gefahr, das Phänomen in seinem Ausmaß zu überschätzen, wurde durch die konservative Entscheidung ausgeschaltet. Damit scheint auch ein hinreichender Beleg für die Angemessenheit der begrifflichen Festlegungen des leo-forschungsansatzes gegeben. Quasi als unerwünschten, aber in Kauf genommenen, Nebeneffekt hat der gewählte Forschungsansatz aber die problematischen, dichotomisiernden und stigmatisierenden Begriffe des (funktionalen) Analphabetismus verstetigt. Nahezu unmerklich gewinnt damit eine zu einem bestimmten Zweck (statistischer Vergleichbarkeit) gefasste Definition eine neue Dimension. Sie setzt sich in Diskursen fest und generiert Bedeutungswandel. Sicherlich hat eine Beutungsverlagerung und -verstetigung des Begriffs Funktionaler Analphabetismus auch in der Zeit vor der leo.-studie stattgefunden; durch den leo-schock hat sie in der Öffentlichkeit aber eine andere Dimension erlangt. Dass Begriffe Diskurse prägen und Diskursen neue Realitäten erschaffen, wird sehr wohl auch von den Wissenschaftlern der leo- Forschung gesehen. So geht Grotlüschen (2011, S.24) im Kontext ihrer Überlegungen zur Modellierung von Literalität auch auf das Problem der Benennung und seiner Tragweite ein und stellt klar: Es scheint uns also sinnvoller, die Hierachie zu benennen und zum Streitgegenstand zu erklären, statt sie in einer diffusen Unterschiedlichkeit aufgehen zu lassen. Eine derart deutlich artikulierte programmatische Intention klärt auf den ersten Blick die Sachlage. Sie scheint bei genauerer Betrachtung aber nicht als zwingend notwendig und daher nicht als die beste Lösung des Problems. Denn gerade die leo.-studie hat Befunde geliefert, die zum einen mit einer diffusen Unterschiedlichkeit aufräumen, zum anderen aber nicht zwangsläufig in hierachischen Kategorien interpretiert werden müssen. Die folgenden Überlegungen zu Literalität (2) und Teilhabe (3) sollen dies erläutern.
7 2 Literalität Die Wirkmächtigkeit des Konzeptes Funktionaler Analphabetismus und eine über Jahrzehnte fehlende Grundlagenforschung zum postschulischen Analphabetismus haben im deutschen Sprachraum eine intensive Beschäftigung mit alternativen Konzepten zur Literalität weitgehend verhindert. So hat in der Geschichte der hiesigen Erwachsenenalphabetisierung bis auf wenige Ausnahmen (z.b. Kamper 1994; Linde 2004; Hussain 2010) über lange Zeit keine genauere Auseinandersetzung mit Konzepten der New Literacy Studies und der Multiliteracies, wie sie beispielsweise in Nordamerika und in England entwickelt wurden, stattgefunden. In diesen wird von einer monolithischen Perspektive auf Literalität zunehmend Abstand genommen (Hussain 2010, S. 187). Vielmehr gehen diese Konzeptionen von einer Pluralität unterschiedlich sozial konstruierter Literalitäten ( multiliteracies ) aus und erkennen diese prinzipiell als gleichberechtigt an. Theoriegeschichtlich können sie als eine Ausdifferenzierung innerhalb der britischen Tradition der Cultural Studies angesehen werden, einer sozial- und sprachwissenschaftlichen Forschungsausrichtung, die sich hegemoniekritisch mit kulturellen Praktiken des Alltags auseinandersetzt. Sie thematisiert insbesondere Prozesse der Marginalisierung und Exklusion vermeintlich nicht legitimer politischer, sozialer und kultureller Artikulation. Das im deutschen Sprachraum ansatzweise unter dem Begriff Literalität als soziale Praxis aufgegriffene Konzept geht auf ethnographische und sprachwissenschaftliche Forschungen von David Barton und Mary Hamilton sowie Brian Street zurück. Im deutschen Sprachraum erlangen diese Konzeptionen in Fachkreisen erst seit Kurzem mehr Aufmerksamkeit. Entscheidend für die Grundannahmen beider Forschungsansätze ist ein weites Verständnis von Literalität. Anders als der hierzulande diskutierte Funktionale Analphabetismus bezieht sich der Literacy- Begriff in der englischsprachigen Diskussion zum einen auf lesekundige wie nicht lesekundige Menschen und geht zum anderen über die Fokussierung auf die Techniken des Lesens und Schreibens zum Erwerb einer Norm-Orthographie hinaus (Street 2008, S.3). So
8 unterscheidet Street ein autonomes Modell der Literalität, das kognitiv-technische Lernprozesse unabhängig von einem sozialen Umfeld beschreibt, von einem ideologischen Literalitätsmodell, das den Schriftspracherwerb eingebettet in spezifische soziale Kontexte begreift sowie dessen subjektiven Begründungen Beachtung schenkt. Vertreter der New Literary Studies verstehen Spracherwerb grundsätzlich in Abhängigkeit von vorherrschenden Macht- und Abhängigkeitsstrukturen, die in den dominierenden Formen sozialer, kultureller und ökonomischer Praxis zum Ausdruck kommen. Aus letzteren erwachsen unreflektiert dominante Literalitäten, die zum gesellschaftlichen Maßstab werden, an dem sich auch allgemeine Zuschreibungen und Zielsetzungen ausrichten. Alltagsweltliche Literalitäten werden somit vom Standpunkt der dominanten Literalität aus gewöhnlich als Formen der Norm-Abweichung betrachtet und negativ sanktioniert. In diesem Verständnis erscheinen sie folglich als weniger berechtigte literale Praxen. In vielen institutionalisierten Kontexten wird solch illegitimen Literalitäten die Geltung abgesprochen, ihren Sprechern droht der soziale Ausschluss aus der etablierten Schriftsprachkultur. So gesehen ist es lediglich die als richtig determinierte Art der Literalität, die soziale Teilhabe an und Partizipation in der Gesellschaft ermöglicht (Hussain 2010, S.191). Das zentrale Problem, dass Hussain und andere mit ihrer Kritik an einem eindimensionalen Verständnis von Literalität offenlegen, besteht jedoch darin, zu zeigen, dass ein Diskurs über normierte (autonome) Literalität eben auch ein die Normalität definierender Diskurs ist. Dieser generiert soziale Konstruktionen von Zugehörigkeit und erschafft damit Inkludierte und Exkludierte. Letztlich gilt dies auch für einen Diskurs, der weiterhin wenngleich oft unbedacht und nicht mit ausgrenzender Absicht mit dem Begriff des Funktionalen Analphabetismus arbeitet. Allein die Perpetuierung dieser Begrifflichkeiten unterstützt ungewollt die Vormachtstellung eines bestimmten Literalitätsverständnisses. Es führt dazu, Lese- und Schreibfähigkeit als Voraussetzung für gesellschaftlichen Teilhabe und Inklusion zu sehen (vgl. Zeuner/Pabst 2011, S. 218f) und dadurch Stigmatisierungen Raum zu geben. Für Bremer (2010, S. 102) bedeutet die Doxa des Beherrschens der legitimen Schriftkultur - im Sinne einer unhinterfragten Selbstverständlichkeit - ein Wirken
9 symbolischer Gewalt. Es exkludiert Menschen, die daran nicht teilhaben können oder drängt sie in die Selbstexklusion. 3 Teilhabe Wie viele andere aktuelle Arbeiten zur Erwachsenenalphabetisierung stützen sich auch Grotlüschen/Riekmann (2011) bei ihrer Unterscheidung zwischen Analphabetismus und funktionalem Analphabetismus auf den Begriff der Teilhabe. Funktionale Analphabeten sind ihnen zufolge dadurch gekennzeichnet, dass nicht in der Lage sind, in angemessener Weise am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben (Grotlüschen/Riekmann 2011, S. 6). Diese Vorstellung lässt sich bis in die Anfänge der Erwachsenenalphabetisierung in Deutschland zurückverfolgen. Schon Anfang der achtziger Jahre behaupten Müller/Oswald in ihrer These zur Selbstisolierung und politische(r) Enthaltsamkeit funktionaler Analphabeten: Analphabeten können sich kaum bei gesellschaftlichen Aktivitäten engagieren und beschränken ihre Kontakte meist auf den engsten Familienkreis (Oswald/ Müller 1982, S. 76). Das Motiv der verminderten oder gänzlich ausgeschlossenen Teilhabe ist bis heute eine konstante Bezugs- und Orientierungsgröße in der Grundbildung geblieben. Dies gilt sowohl für die theoretischkonzeptionelle Ausrichtung der Erwachsenenalphabetisierung im Sinne einer Neuen Sozialen Bewegung (vergl. Steuten 2008, Korfkamp/Steuten 2010) wie für die konkrete Unterrichtspraxis. Menschen mit gering ausgebildeten literalen Kompetenzen durch Grundbildung Teilhabeoptionen zu verschaffen, ihre gesellschaftliche Inklusion zu ermöglichen oder zu verbessern, ist von den Anfängen der Erwachsenenalphabetisierung bis heute nicht nur Ziel der Alphabetisierungsbewegung sondern auch gleichzeitig deren Legitimationsgrundlage. Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe auch dies ist weitgehend einhellige Einschätzung zeigt sich dabei hauptsächlich in folgender Weise: Funktionale Analphabeten sind häufiger von Arbeitslosigkeit bedroht, sie haben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt, können sich weder politisch hinreichend artikulieren noch mit technischem Fortschritt mithalten sowie bestimmte Anforderungen im Alltagsleben nur mit Hilfe anderer bewältigen. Ihre Teilhabeoptionen am Konsum
10 sind stark eingeschränkt, sie tragen zu weiterer Marginalisierung bei, weil aktivem Konsumverhalten eine entscheidende Bedeutung für die individuelle Verortung und Selbstvergewisserung innerhalb der Gesellschaft zukomme. Ihre Grundbildungskenntnisse, zu denen neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen häufig auch soziale und ökonomische Kompetenzen, Medien- und Gesundheitskenntnisse, Kenntnisse des politischen Systems sowie allgemein Problem lösende Strategien gezählt werden (vergl. Rothe/Ramsteck 2010, S.274f), werden als nicht ausreichend erachtet, um in einer modernen Gesellschaft ein autonomes Leben führen zu können. Der leo.-studie ist es zu verdanken, dass diese Sichtweise nach langer Zeit gravierende Korrekturen erfahren hat. Von Rosenbladt (2012) hat die repräsentativen und zum großen Teil überraschenden Ergebnisse aus der leo.-studie in einer übersichtlichen Weise zusammengefasst: - Zum Aspekt des Erwerbslebens resümiert er, dass der Anteil von erwerbstätigen unter den Personen mit Schriftschwäche relativ hoch und vom Grad der Schriftschwäche kaum berührt ist (S. 79). Bereits in den ersten Publikationen der leo- Ergebnisse hatte das Grotlüschen-Team festgestellt: Funktionale Analphabet/inn/en sind mitnichten auf breiter Front vom Erwerbsleben ausgeschlossen. (leo. News Nr. 02/2012). Probleme mit der Schrift schließen auch eine berufliche Existenz als Selbständige/r nicht aus. Dass sie faktisch oft in einfachen Arbeitsverhältnissen mit vergleichbar geringer Bezahlung arbeiten, ist kein Indiz für ihren Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe. - Schriftschwache Menschen haben teil an der Welt des Konsums. Allerdings machen sie seltener alleine Einkäufe und führen auch deutlich seltener ohne Hilfe im Versandshandel oder per Internet ihre Einkäufe durch. - Auch in ihrer Mobilität sind sie generell nicht eingeschränkt. Sie nutzen häufiger als Menschen mit höherer literaler Kompetenz öffentliche Verkehrsmittel, steuern aber seltener selbst ein Auto. - Die Nutzung von technischen Geräten stellt schriftkundige Menschen jedes Grades punktuell vor Probleme. Bei gängigen Geräten wie Fernseher, DVD, Waschmaschine, sowie
11 Computerspielen ist zwischen mehr oder weniger literalisierten Menschen kein Unterschied zu erkennen. Die Kommunikation mit s oder SMS nutzen aber immerhin auch 44 Prozent hochgradig schriftschwache Personen (von Rosenbladt, ebd. S. 81). - Ein immer noch erstaunlich hoher Anteil funktionaler Analphabeten erledigt eigenständig Geldgeschäfte mit Banken (78%). Mehr als zwei von dreien (68%) regeln selbständig ihre persönlichen Belange mit Ämtern, Versicherungen und Behörden. Für die verschwindend geringe Teilgruppe der nicht Norm- Literalisierten, die in Alphabetisierungskursen lernen, haben von Rosenbladt und Bilger (2011) weitere Teilhabebereiche untersucht. Aus ihren Untersuchungen geht hervor, dass die überwiegende Mehrzahl der befragten Kursteilnehmer/innen in einem normalen Privathaushalt lebt (ebd. S. 42). Sie können dort, aber auch über andere Wege, Hilfe bei ihren Lese- und Schreibproblemen finden. 80% der in einer Partnerschaft lebenden Befragten nutzen den Partner als Hilfeperson, andere lassen sich von ihren Kindern oder anderen Familienmitgliedern helfen, 42% haben Freunde, die sie unterstützen. Von Rosenbladt/Bilger (S. 43) attestieren ihnen aufgrund ihrer Antworten und in Anbetracht der Schwierigkeiten und Belastungen, mit denen diese Menschen zu kämpfen haben... ein bewundernswertes Maß an Lebensmut und Lebenszufriedenheit. Letztendlich spricht auch die Tatsache, dass weniger als 1% der funktionalen Analphabeten einen Kurs zum Lesen- und Schreibenlernen besucht, dafür, dass die weit überwiegende Mehrheit der Menschen mit Schriftproblemen es offensichtlich vorzieht ihr Leben ohne einen solchen zu bewältigen. Bei dieser Entscheidung mögen auch Scheu und Scham vor der mit einer Kursanmeldung verbundenen Offenlegung ihres Handicaps eine Rolle spielen. Eine in einzelnen Bereichen mehr oder weniger eingeschränkte Teilhabeoption scheint ihnen aber offensichtlich weniger auszumachen, als dafür ein schwer kalkulierbares Risiko zwischen Lernerfolg und Stigmatisierungsbedrohung einzugehen. The stigma of,illiteracy is often a greater burdon than the actual literacy difficulties. (Street, 1991, S. 163).
12 4 Fazit Die referierten Befunde zeigen, dass Menschen, die nicht normgerecht literalisiert sind, sehr wohl am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Sie tun dies in vielen Bereichen in einer Weise, die sich nicht wesentlich von der der normgerecht-literalisierten unterscheidet. In bestimmten Situationen, in denen ihre Fähigkeiten aufgrund fehlender Schriftkenntnisse nicht zur direkten Teilhabe ausreichen, bedienen sie sich der Hilfe anderer. Wo diese nicht verfügbar sind, oder sie scheuen, diese um Hilfe zu bitten, verzichten sie auch auf einzelne Teilhabeoptionen. Allein in diesen einzelnen Fällen lässt sich vertretbar davon sprechen, dass ihre Lese- und Schreibprobleme zu einem Rückzug (Rosenbladt 2011, S. 96) führen. Man kann aber anders als von Rosenbladt fortfährt gerade nicht sagen, dass sie somit zu einer sozialen Exklusion (ebd., S. 96) führen. Denn dies hieße, dass sie vollständig von sozialen Interaktionen abgekoppelt wären. Wie die leo.-studie und von Rosenbladts eigene Untersuchungen sehr deutlich zeigen, ist dies genau nicht der Fall. Die Problematik, auf die es im Kontext der aktuellen Forschungen zum funktionalen Analphabetismus im deutschsprachigen Raum immer wieder hinzuweisen gilt, besteht somit nicht in der vermeintlichen Exklusionsbedrohung funktionaler Analphabeten. Sie besteht vielmehr darin, dass sie sich weitgehend in Normalität definierenden und generierenden Diskursen bewegt und artikuliert. In der Folge verrechnet sie gesellschaftliche und bildungspolitische Versäumnisse als individuelle Schwächen. Wie die Literacy- Konzeptionen in den anglophonen Ländern seit etwa zwei Jahrzehnten deutlich machen, sind es diese Diskurse, die zur Stigmatisierung und Marginalisierung der Betroffenen beitragen. Sie tun dies zum einen, indem sie ohne zwingende Begründungen in der Wissenschaft und der Öffentlichkeit an einem heute fragwürdigen Begriff des funktionalen Analphabetismus festhalten, der dem sozialwissenschaften Funktionalismus der späten 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entstammt. Zum anderen tun sie dies indem sie die Zugangswege zur gesellschaftlichen Teilhabe der nicht Norm-Literalisierten nicht als gleichwertig und ihre Art der Literalität nicht als gleichberechtigt anerkennen.
13 Genau dies aber exkludiert Menschen, die Probleme mit der dominanten Form von Literalität haben. So wenig wie man Menschen, die sich nicht an Bundestagswahlen beteiligen gerechtfertigter Weise als unpolitisch bezeichnen kann, so wenig sollte man, Menschen, die sich nicht an der dominierenden Form der Literalität beteiligen, als (funktionale) Analphabeten bezeichnen. Es ist also längst an der Zeit sich im deutschsprachigen Raum vom Begriff des Funktionalen Analphabetismus zu verabschieden und stattdessen wie in der englischsprachigen Forschung mit dem besser geeigneten Begriff der Literatität beziehungsweise dem der Literalitäten (multiliteracies) zu arbeiten. Allein um der Vermeidung der folgenreichen Stigmatisierung willen, erscheint ein solcher Paradigmenwechsel geboten. Literatur Bremer, H. (2010): Literalität, Bildung und die Alltagskultur sozialer Milieus. In: Bothe, J. / BV Alphabetisierung und Grundbildung e.v. (Hg.): Das ist doch keine Kunst. Kulturelle Grundlagen und künstlerische Ansätze von Alphabetisierung und Grundbildung. Münster, New York, München, Berlin, S Egloff, B. (1997): Biographische Muster funktionaler Analphabeten. Frankfurt am Main Egloff, B.(2000): Blind, taub und sprachlos: der Analphabet. Zur Konstruktion eines Phänomens. In: Barz, Heiner (Hg.): Pädagogische Dramatisierungsgewinne, S Egloff, B./A. Grotlüschen (Hg.) (2011):Forschen im Feld der Alphabetisierung. Ein Werkstattbuch. Münster, New York, Berlin Goffman, E. (1980), Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main (erstmals 1963) Grotlüschen, A.; Heinemann, A.M.B.; Nienkämper, B. (2009): Die unterschätzte Macht legitimer Literalität. In: Report 4, S Grotlüschen, A.; Riekmann, W. (2011): leo. Level-One Studie. Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Grotlüschen, A.; Riekmann, W. (2011): Konservative Entscheidungen Größenordnung des funktionalen Analphabetismus in Deutschland. In: Report 3, S
14 zkonferenz/2011_mar_leo_v3_bilanzkonferenz_berlin.pdf (Abruf ). Grotlüschen, A. (2011): Akzeptanz von Diagnostik in Grundbildungskursen der Volkshochschulen. Erfahrungen zwischen theoretischen Klärungen und forschender Zusammenarbeit.In: Egloff, B. Grotlüschen, A. (Hg.): Forschen im Feld der Alphabetisierung und Grundbildung. Ein Werkstattbuch, S Hussain, S. (2010): Literalität und Inklusion. In: Kronauer, M. (Hg.): Inklusion und Weiterbildung. Reflexionen zur gesellschaftlichen Teilhabe in der Gegenwart. Bielefeld, S Ivanic, R.; Barton, D.; Hamilton, M. (2004): Wie viel Literacy braucht ein Mensch? In: Alfa-Forum 54-55, S Kastner, M. (2011): Vitale Teilhabe. Bildungsbenachteiligte Erwachsene und das Potenzial von Basisbildung. Wien Korfkamp, J.; Steuten, U. (2004): Abschied vom funktionalen Analphabetismus? In: Alfa-Forum 54-55, S Korfkamp, J.; Steuten, U. (2010): Grundbildung und soziale Teilhabe Erwachsenenalphabetisierung als bürgerschaftliches Engagement in der literalen Gesellschaft. In: Praxis Politische Bildung, Heft 4, S Kronauer, M. (2010): Inklusion Exklusion. Eine historische und begriffliche Annäherung an die soziale Frage der Gegenwart. In: Ders. (Hg.): Inklusion und Weiterbildung. Reflexionen zur gesellschaftlichen Teilhabe in der Gegenwart. Bielefeld, S Linde, A. (2004): Sind Sie funktional alphabetisiert? Auf der Suche nach geeigneten Begriffen und Konzepten. In: Alfa-Forum 54-55, S Oswald, M.-L.; Müller, H.-M. (1982): Deutschsprachige Analphabeten. Lebensgeschichten und Lerninteressen von erwachsenen Analphabeten. Stuttgart Rosenbladt, B. von/bilger, F. (2011): Erwachsene in Alphabetisierungskursen der Volkshochschulen, Bonn Rosenbladt, B. von (2011): Lernende Analphabetinnen und Analphabeten. Wen erreicht das Kursangebot der Volkshochschulen? In: Egloff/Grotlüschen, a.a.o., S
15 Rosenbladt, B. von (2012): Schriftschwäche als Handicap Zur sozialen Verortung des funktionalen Analphabetismus in Deutschland. In: Report 2, S Rosenbladt, B. von (2012): Der sogenannte funktionale Analphabetismus eine sprachkritische Bestandsaufnahme. In : Alfa-Forum 79, S Rosenbladt, B. von; Lehmann, R.H. (2013): Grade der Schriftbeherrschung und subjektiver Lernerfolg bei Teilnehmenden an Alphabetisierungskursen. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaften, Heft 1, S Rothe, K.; C. Ramsteck (2010): ABC zum Berufserfolg Förderung der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit unzureichenden Schriftsprachkompetenzen. In: Hessische Blätter für Volksbildung, Heft 3, S Steuten, U. (2008): Demokratisches Kapital und Problemindikator Erwachsenenalphabetisierung in der Zivilgesellschaft. In: Schneider, J.; Gintzel, U.; Wagner, H. (Hg.) (2008): Sozialintegrative Alphabetisierungsarbeit. Bildungs- und sozialpolitische sowie fachliche Herausforderung. Münster, S Steuten, U./Korfkamp, J. (2004): Abschied von funktionalen Analphabetismus? Gesellschaftstheoretischen Überlegungen zu einem fragwürdigen Begriff. In: Alfa-Forum 54-55, S Street, B. (1991): International Literacy Year. Rhetoric and Reality. In: Adult Education and Development 36, S Street, B. (2008): New Literacies, New Times: Developments in Literacy Studies. In: Street, B. / N.H. Hornberger (Ed.): Encyclopedia of Language and Education. Volume 2. New York, S Zeuner, Chr./A. Pabst (2011): Lesen und Schreiben eröffnen eine neue Welt. Literalität als soziale Praxis eine ethnographische Studie. Bielefeld
16
URSACHENFORSCHUNG FRÜHER & HEUTE
 Prof. Dr. Sven Nickel Einführung in die Sprachdidaktik der Grundschule Impuls FORSCHUNG URSACHENFORSCHUNG FRÜHER & HEUTE 1 1. Frühe Ursachenforschung (1980-2000) Biographieanalytische Studien mit Lernenden
Prof. Dr. Sven Nickel Einführung in die Sprachdidaktik der Grundschule Impuls FORSCHUNG URSACHENFORSCHUNG FRÜHER & HEUTE 1 1. Frühe Ursachenforschung (1980-2000) Biographieanalytische Studien mit Lernenden
LEO & PIAAC Welche Lehren ziehen wir daraus?
 Auftaktveranstaltung des neuen Regionalen Grundbildungszentrums der EEB in Stade 18.12.2013 LEO & PIAAC Welche Lehren ziehen wir daraus? Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich in unerwarteter Weise
Auftaktveranstaltung des neuen Regionalen Grundbildungszentrums der EEB in Stade 18.12.2013 LEO & PIAAC Welche Lehren ziehen wir daraus? Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich in unerwarteter Weise
Spaß am Lesen Verlag Ralf Beekveldt. Einfache Sprache
 Spaß am Lesen Verlag Ralf Beekveldt Einfache Sprache Wie liest Deutschland? Vor 2011: keine exakten Zahlen für Analphabetismus und Menschen mit Leseschwäche in Deutschland. Schätzung des Bundesverbandes
Spaß am Lesen Verlag Ralf Beekveldt Einfache Sprache Wie liest Deutschland? Vor 2011: keine exakten Zahlen für Analphabetismus und Menschen mit Leseschwäche in Deutschland. Schätzung des Bundesverbandes
Wer kennt wen? Funktionaler Analphabetismus und das mitwissende Umfeld
 Wer kennt wen? Funktionaler Analphabetismus und das mitwissende Umfeld Prof. Dr. Anke Grotlüschen,, Klaus Buddeberg Universität Hamburg heute-journal 08.09.2015 Von der Alphabetisierung zur Grundbildung
Wer kennt wen? Funktionaler Analphabetismus und das mitwissende Umfeld Prof. Dr. Anke Grotlüschen,, Klaus Buddeberg Universität Hamburg heute-journal 08.09.2015 Von der Alphabetisierung zur Grundbildung
Perspektiven aus dem Projektverbund Alpha-Wissen : Erfahrungen und Anknüpfungspunkte
 Transfer-Workshop»Literalität als soziale Praxis«Perspektiven aus dem Projektverbund Alpha-Wissen : Erfahrungen und Anknüpfungspunkte Monika Tröster Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Hamburg, 17.-18.
Transfer-Workshop»Literalität als soziale Praxis«Perspektiven aus dem Projektverbund Alpha-Wissen : Erfahrungen und Anknüpfungspunkte Monika Tröster Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Hamburg, 17.-18.
Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung. Unterrichtsform Punkte I II III IV
 Seite 1 von 5 Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen Bezeichnung des Moduls/ der Lehrveranstaltung Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung Unterrichtsform ECTS-
Seite 1 von 5 Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen Bezeichnung des Moduls/ der Lehrveranstaltung Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung Unterrichtsform ECTS-
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Dekade-Tagung Alphabetisierung und Grundbildung
 Dekade-Tagung Alphabetisierung und Grundbildung Zusammenfassung der Konferenz aus Sicht eines Sprechers des Wissenschaftlichen Beirats der Alpha-Dekade Donnerstag, 26. April 2018 Vorbemerkungen Welche
Dekade-Tagung Alphabetisierung und Grundbildung Zusammenfassung der Konferenz aus Sicht eines Sprechers des Wissenschaftlichen Beirats der Alpha-Dekade Donnerstag, 26. April 2018 Vorbemerkungen Welche
Bei mir waren die Kinder nie gefährdet, nie!
 Bei mir waren die Kinder nie gefährdet, nie! Erleben und Bewältigen von Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung aus Sicht betroffener Eltern Dipl.-Päd. Michaela Berghaus, M.A. Wissenschaftliche
Bei mir waren die Kinder nie gefährdet, nie! Erleben und Bewältigen von Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung aus Sicht betroffener Eltern Dipl.-Päd. Michaela Berghaus, M.A. Wissenschaftliche
DIGITALES LERNEN IN DER ALPHABETISIERUNG UND GRUNDBILDUNG
 FACHTAGUNG DIGITALES LERNEN IN GRUNDBILDUNG UND INTEGRATION DIGITALES LERNEN IN DER ALPHABETISIERUNG UND GRUNDBILDUNG KOMED, Media Park 7, Köln Dienstag, 20. November 2018 9:15-10:00 Uhr Dr. Alexis Feldmeier
FACHTAGUNG DIGITALES LERNEN IN GRUNDBILDUNG UND INTEGRATION DIGITALES LERNEN IN DER ALPHABETISIERUNG UND GRUNDBILDUNG KOMED, Media Park 7, Köln Dienstag, 20. November 2018 9:15-10:00 Uhr Dr. Alexis Feldmeier
Vortrag im Rahmen der 2. Hessische vhs-messe 19. März 2015 in Gelnhausen
 26.09. 2014 Rieckmann / VHS / HESSENCAMPUS Frankfurt 1 Dr. Carola Rieckmann: Lernerfolg in der Alphabetisierung und Grundbildung Ergebnisse des HC Leitprojekts Alphabetisierung der Volkshochschule Frankfurt
26.09. 2014 Rieckmann / VHS / HESSENCAMPUS Frankfurt 1 Dr. Carola Rieckmann: Lernerfolg in der Alphabetisierung und Grundbildung Ergebnisse des HC Leitprojekts Alphabetisierung der Volkshochschule Frankfurt
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Grundbildung fördern Chancen eröffnen. Die Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung
 Grundbildung fördern Chancen eröffnen Die Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung Was ist das Ziel der AlphaDekade und wie soll es erreicht werden? Ziel der AlphaDekade ist es, die Lese-
Grundbildung fördern Chancen eröffnen Die Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung Was ist das Ziel der AlphaDekade und wie soll es erreicht werden? Ziel der AlphaDekade ist es, die Lese-
Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland
 Medien Andrea Harings Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Analphabetismus... 2 2.1 Begriffsbestimmung... 2 2.2 Ausmaß...
Medien Andrea Harings Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Analphabetismus... 2 2.1 Begriffsbestimmung... 2 2.2 Ausmaß...
Probe-Reihungstest Jahr: 2014
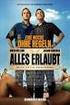 Berufsmaturitätsschule Liechtenstein Probe-Reihungstest Jahr: 2014 Fach: Deutsch Dauer: 45 Minuten Name: Vorname: Prüfungsnummer: Textverständnis (1 6) /12 Punkte Sprachbetrachtung (7 13) /13 Punkte Punkte
Berufsmaturitätsschule Liechtenstein Probe-Reihungstest Jahr: 2014 Fach: Deutsch Dauer: 45 Minuten Name: Vorname: Prüfungsnummer: Textverständnis (1 6) /12 Punkte Sprachbetrachtung (7 13) /13 Punkte Punkte
Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung
 Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Selbstbestimmung und Partizipation
 Pädagogik Christel Rittmeyer Selbstbestimmung und Partizipation Ihre Bedeutung im fachwissenschaftlichen Diskurs und der Gesetzgebung und Aspekte der Umsetzung Unterrichtsentwurf Selbstbestimmung und
Pädagogik Christel Rittmeyer Selbstbestimmung und Partizipation Ihre Bedeutung im fachwissenschaftlichen Diskurs und der Gesetzgebung und Aspekte der Umsetzung Unterrichtsentwurf Selbstbestimmung und
Eine Pädagogik der Inklusion
 Dr. Gabriele Knapp Eine Pädagogik der Inklusion die Prämisse der Vielfalt als pädagogischer Ansatz in der Jugendsozialarbeit Impulsreferat in FORUM 4 auf der Fachtagung Thüringen braucht dich 20 Jahre
Dr. Gabriele Knapp Eine Pädagogik der Inklusion die Prämisse der Vielfalt als pädagogischer Ansatz in der Jugendsozialarbeit Impulsreferat in FORUM 4 auf der Fachtagung Thüringen braucht dich 20 Jahre
Fachtagung Das steht doch da! Ohne richtig Lesen und Schreiben bist du arm dran
 Fachtagung Das steht doch da! Ohne richtig Lesen und Schreiben bist du arm dran Claire Zynga, Projektkoordinatorin, Grund-Bildungs-Zentrum Berlin Ehrenamt: Vorstandsmitglied, ATD Vierte Welt e.v. Deutschland
Fachtagung Das steht doch da! Ohne richtig Lesen und Schreiben bist du arm dran Claire Zynga, Projektkoordinatorin, Grund-Bildungs-Zentrum Berlin Ehrenamt: Vorstandsmitglied, ATD Vierte Welt e.v. Deutschland
kultur- und sozialwissenschaften
 Christiane Hof Kurseinheit 1: Lebenslanges Lernen Modul 3D: Betriebliches Lernen und berufliche Kompetenzentwicklung kultur- und sozialwissenschaften Redaktionelle Überarbeitung und Mitarbeit Renate Schramek
Christiane Hof Kurseinheit 1: Lebenslanges Lernen Modul 3D: Betriebliches Lernen und berufliche Kompetenzentwicklung kultur- und sozialwissenschaften Redaktionelle Überarbeitung und Mitarbeit Renate Schramek
Schleswig-Holsteins Alphabetisierungskampagne 4. Schleswig-Holsteinischer Bibliothekstag, in Kiel
 Lesen macht Leben leichter! Schleswig-Holsteins Alphabetisierungskampagne 4. Schleswig-Holsteinischer Bibliothekstag, 14.10.2015 in Kiel 1. Funktionaler Analphabetismus in Deutschland 2. Praxisbericht
Lesen macht Leben leichter! Schleswig-Holsteins Alphabetisierungskampagne 4. Schleswig-Holsteinischer Bibliothekstag, 14.10.2015 in Kiel 1. Funktionaler Analphabetismus in Deutschland 2. Praxisbericht
Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft"
 Geisteswissenschaft Eva Kostakis Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung:... 2 2. Die Kabylei:... 3 3. Die gesellschaftliche Konstruktion der Körper:...
Geisteswissenschaft Eva Kostakis Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung:... 2 2. Die Kabylei:... 3 3. Die gesellschaftliche Konstruktion der Körper:...
Die Beziehung von Entwicklung und Kultur
 I Die Beziehung von Entwicklung und Kultur Kapitel Einführung: die Wissenschaft vom Alltagsleben 3 Kapitel 2 Kultur und Kontext eine untrennbare Allianz 7 Kapitel 3 Kultur definiert die menschliche Natur
I Die Beziehung von Entwicklung und Kultur Kapitel Einführung: die Wissenschaft vom Alltagsleben 3 Kapitel 2 Kultur und Kontext eine untrennbare Allianz 7 Kapitel 3 Kultur definiert die menschliche Natur
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/ Wahlperiode
 SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/1385 17. Wahlperiode 2011-03-23 Kleine Anfrage der Abgeordneten Hans Müller (SPD) und Antwort der Landesregierung - Minister für Bildung und Kultur Analphabetismus
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 17/1385 17. Wahlperiode 2011-03-23 Kleine Anfrage der Abgeordneten Hans Müller (SPD) und Antwort der Landesregierung - Minister für Bildung und Kultur Analphabetismus
Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft
 Cathleen Grunert Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Cathleen Grunert Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Wahlprüfsteine Was tun für die Alphabetisierung?
 Wahlprüfsteine 2013 Was tun für die Alphabetisierung? Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung bringt sich auch im Wahljahr 2013 ein und fragte bei den Parteien ihre politische Positionen ab.
Wahlprüfsteine 2013 Was tun für die Alphabetisierung? Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung bringt sich auch im Wahljahr 2013 ein und fragte bei den Parteien ihre politische Positionen ab.
Zentrale Fragen dieser Einheit
 Zentrale Fragen dieser Einheit Sollte in allgemeinbildenden Schulen thematisiert werden? Sollten sthemen in einem eigenen Fach oder in Kombinations- /Integrationsfächern wie Arbeit-- Technik, und Politik
Zentrale Fragen dieser Einheit Sollte in allgemeinbildenden Schulen thematisiert werden? Sollten sthemen in einem eigenen Fach oder in Kombinations- /Integrationsfächern wie Arbeit-- Technik, und Politik
Einführung in die Allgemeine Bildungswissenschaft
 Cathleen Grunert Einführung in die Allgemeine Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
Cathleen Grunert Einführung in die Allgemeine Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
Dr. Friedrun Erben. Gestaltungsprinzipien, Erfahrungen und Herausforderungen. Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung
 Bündnis für Beteiligung. Vitalisierung der Demokratie und der Zivilgesellschaft Salzburg, 13.-14. Juni 2013 Dr. Friedrun Erben Gestaltungsprinzipien, Erfahrungen und Herausforderungen Immer eine Arbeit
Bündnis für Beteiligung. Vitalisierung der Demokratie und der Zivilgesellschaft Salzburg, 13.-14. Juni 2013 Dr. Friedrun Erben Gestaltungsprinzipien, Erfahrungen und Herausforderungen Immer eine Arbeit
Hochwertige und chancengerechte Bildung für alle. Katja Römer Pressesprecherin Deutsche UNESCO-Kommission
 Hochwertige und chancengerechte Bildung für alle Katja Römer Pressesprecherin Deutsche UNESCO-Kommission Bildung o Bildung befähigt Menschen dazu, ein erfülltes Leben zu führen und ihre Persönlichkeit
Hochwertige und chancengerechte Bildung für alle Katja Römer Pressesprecherin Deutsche UNESCO-Kommission Bildung o Bildung befähigt Menschen dazu, ein erfülltes Leben zu führen und ihre Persönlichkeit
Informationen zur Alphabetisierung
 Informationen zur Alphabetisierung Liebe Bürgerinnen und Bürger, Lesen & Schreiben Mein Schlüssel zur Welt : Für mehr als sieben Millionen Erwachsene in Deutschland ist dieser Satz nur eine Ansammlung
Informationen zur Alphabetisierung Liebe Bürgerinnen und Bürger, Lesen & Schreiben Mein Schlüssel zur Welt : Für mehr als sieben Millionen Erwachsene in Deutschland ist dieser Satz nur eine Ansammlung
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Was brauchen schlecht rechtschreibende Haupt- und Förderschüler/innen?
 Gefördert vom Handlungs- und Bildungskompetenzen funktionaler Analphabeten Forschung und Entwicklung zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener Lust am Lernen, Teilhabechancen, Anerkennung Was brauchen
Gefördert vom Handlungs- und Bildungskompetenzen funktionaler Analphabeten Forschung und Entwicklung zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener Lust am Lernen, Teilhabechancen, Anerkennung Was brauchen
INKLUSION ALS FRAGE GESELLSCHAFTLICHER ANERKENNUNG KONSEQUENZEN FÜR PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN UND IHR UMFELD? Sigrid Graumann
 INKLUSION ALS FRAGE GESELLSCHAFTLICHER ANERKENNUNG KONSEQUENZEN FÜR PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN UND IHR UMFELD? Sigrid Graumann Vorgehen 1. Das Leitbild Inklusion in der UN-BRK 2. Erfahrungen von Verkennung
INKLUSION ALS FRAGE GESELLSCHAFTLICHER ANERKENNUNG KONSEQUENZEN FÜR PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN UND IHR UMFELD? Sigrid Graumann Vorgehen 1. Das Leitbild Inklusion in der UN-BRK 2. Erfahrungen von Verkennung
Vielfalt gehört dazu Demografische Entwicklung, Inklusion und Diversität: Herausforderungen für die Selbsthilfe
 Vielfalt gehört dazu Demografische Entwicklung, Inklusion und Diversität: Herausforderungen für die Selbsthilfe 34. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.v. in Goslar vom
Vielfalt gehört dazu Demografische Entwicklung, Inklusion und Diversität: Herausforderungen für die Selbsthilfe 34. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.v. in Goslar vom
Das Fach Praktische Philosophie wird im Umfang von zwei Unterrichtsstunden in der 8./9. Klasse unterrichtet. 1
 Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Landesverband Nordrhein-Westfalen
 Landesverband Nordrhein-Westfalen Grundbildung für alle! Thesen und Konkretionen für die Alphabetisierung Regionalkonferenz Weiterbildung im Regierungsbezirk Arnsberg 29. Oktober 2014 in Hamm 27.06.2014
Landesverband Nordrhein-Westfalen Grundbildung für alle! Thesen und Konkretionen für die Alphabetisierung Regionalkonferenz Weiterbildung im Regierungsbezirk Arnsberg 29. Oktober 2014 in Hamm 27.06.2014
Sozialraumorientierung + Freiwilliges Engagement = Inklusion
 Zentrum für kooperative Forschung an der DHBW Stuttgart Treffpunkt Soziale Arbeit Stuttgart Stuttgart, 27. März 2014 Sozialraumorientierung + Freiwilliges Engagement = Inklusion!? Eine Erfolgsformel zwischen
Zentrum für kooperative Forschung an der DHBW Stuttgart Treffpunkt Soziale Arbeit Stuttgart Stuttgart, 27. März 2014 Sozialraumorientierung + Freiwilliges Engagement = Inklusion!? Eine Erfolgsformel zwischen
Verlinkungsstudie. Ergebnisse und Konsequenzen für Bildungspolitik und Praxis
 Verlinkungsstudie Ergebnisse und Konsequenzen für Bildungspolitik und Praxis Workshop A, 19. November 2014, Fachtagung Grundbildung und Alphabetisierung in München Lebenslanges Lernen, Universität Hamburg
Verlinkungsstudie Ergebnisse und Konsequenzen für Bildungspolitik und Praxis Workshop A, 19. November 2014, Fachtagung Grundbildung und Alphabetisierung in München Lebenslanges Lernen, Universität Hamburg
Forum Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW. LAAW-Projekt Nachhaltigkeit entdecken - Zugänge & Formate entwickeln
 04. November 2014 (Düsseldorf) Forum Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW Workshop 3 LAAW-Projekt Nachhaltigkeit entdecken - Zugänge & Formate entwickeln 1 Einfach ANDERS? BNE und bildungsferne
04. November 2014 (Düsseldorf) Forum Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW Workshop 3 LAAW-Projekt Nachhaltigkeit entdecken - Zugänge & Formate entwickeln 1 Einfach ANDERS? BNE und bildungsferne
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Die erneuerte europäische Agenda für Erwachsenenbildung. NA beim BIBB
 Die erneuerte europäische Agenda für Erwachsenenbildung Was erwartet Sie? Herausforderungen für die Erwachsenenbildung in Europa Wie Europa auf diese Herausforderungen reagiert - Übergeordnete bildungspolitische
Die erneuerte europäische Agenda für Erwachsenenbildung Was erwartet Sie? Herausforderungen für die Erwachsenenbildung in Europa Wie Europa auf diese Herausforderungen reagiert - Übergeordnete bildungspolitische
Das Wissen über die Anderen.
 Das Wissen über die Anderen. Islam und Muslime als Thema von Bildungsarbeit Wiebke Scharathow wiebke.scharathow@ph-freiburg.de Bildungsangebote zu Islam Nicht-muslimische Adressierte Motivation/Ziel: den
Das Wissen über die Anderen. Islam und Muslime als Thema von Bildungsarbeit Wiebke Scharathow wiebke.scharathow@ph-freiburg.de Bildungsangebote zu Islam Nicht-muslimische Adressierte Motivation/Ziel: den
Inhalt. Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13
 Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13 1. Einleitung 15 1.1 Hauptschüler und ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit I 18 1.2 Leitende Thesen der Untersuchung
Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13 1. Einleitung 15 1.1 Hauptschüler und ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit I 18 1.2 Leitende Thesen der Untersuchung
These 1 Die gegenwärtigen Präventionsprogramme sind weitgehend gescheitert; ihre Ziele sind unklar, ihre Evaluation versagt 41
 Inhaltsverzeichnis Vorwort zur zweiten Auflage 13 Vorwort: Jugendhilfe oder Drogenarbeit? 29 Vorbemerkung zur Schwierigkeit eines kritischen Diskurses 37 These 1 Die gegenwärtigen Präventionsprogramme
Inhaltsverzeichnis Vorwort zur zweiten Auflage 13 Vorwort: Jugendhilfe oder Drogenarbeit? 29 Vorbemerkung zur Schwierigkeit eines kritischen Diskurses 37 These 1 Die gegenwärtigen Präventionsprogramme
Analphabetismus im Erwachsenenalter Ausmaß, Entstehungszusammenhänge und Gegensteuerung
 Analphabetismus im Erwachsenenalter Ausmaß, Entstehungszusammenhänge und Gegensteuerung Impulsvortrag am 09. Dezember 2015 Bildungszugänge schaffen Thementagung Alphabetisierung und Grundbildung in Trier
Analphabetismus im Erwachsenenalter Ausmaß, Entstehungszusammenhänge und Gegensteuerung Impulsvortrag am 09. Dezember 2015 Bildungszugänge schaffen Thementagung Alphabetisierung und Grundbildung in Trier
Zivilgesellschaftliche Bedeutung von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM)
 Zivilgesellschaftliche Bedeutung von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) Kirsten Bruhns Tagung Potenziale nutzen Teilhabe stärken von BMFSFJ, BAMF, DBJR, 10./11.05.2012 1 Gliederung
Zivilgesellschaftliche Bedeutung von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) Kirsten Bruhns Tagung Potenziale nutzen Teilhabe stärken von BMFSFJ, BAMF, DBJR, 10./11.05.2012 1 Gliederung
Bildungsferne. Ein Definitionsversuch. Auf Basis der Arbeiten von:
 Bildungsferne Ein Definitionsversuch Auf Basis der Arbeiten von: Allmendinger und Leibfried (2003) Bremer und Kleemann-Göhring (2011) Bremer (2010) Brüning und Kuwan (2002) Erler (2010) Holzer (2010) Kastner
Bildungsferne Ein Definitionsversuch Auf Basis der Arbeiten von: Allmendinger und Leibfried (2003) Bremer und Kleemann-Göhring (2011) Bremer (2010) Brüning und Kuwan (2002) Erler (2010) Holzer (2010) Kastner
Parallelgesellschaft, Ghettoisierung und Segregation Norbert Gestring
 Zum Verhältnis von Politik und Islam Zwischen symbolischer Inszenierung und materieller Neuerung, Münster, 10.02.2010 Parallelgesellschaft, Ghettoisierung und Segregation Norbert Gestring Gliederung 1)
Zum Verhältnis von Politik und Islam Zwischen symbolischer Inszenierung und materieller Neuerung, Münster, 10.02.2010 Parallelgesellschaft, Ghettoisierung und Segregation Norbert Gestring Gliederung 1)
Begrenzte Lernerfolge in Alphabetisierungskursen
 Bernhard von Rosenbladt Rainer H. Lehmann Begrenzte Lernerfolge in Alphabetisierungskursen Befunde aus der Forschung Konsequenzen für die Praxis Bernhard von Rosenbladt Rainer H. Lehmann Begrenzte Lernerfolge
Bernhard von Rosenbladt Rainer H. Lehmann Begrenzte Lernerfolge in Alphabetisierungskursen Befunde aus der Forschung Konsequenzen für die Praxis Bernhard von Rosenbladt Rainer H. Lehmann Begrenzte Lernerfolge
Mögliche Bewertungskriterien für Prüfungsleistungen in schriftlichen Abiturprüfungen Geschichte
 QUELLENINTERPRETATION Bereich A Die Prüflinge geben aufgabenbezogen Quelleninhalte in notwendigem Umfang sowie korrekt Quelleninhalte sehr präzise und in vollem Umfang Quelleninhalte richtig und in vollem
QUELLENINTERPRETATION Bereich A Die Prüflinge geben aufgabenbezogen Quelleninhalte in notwendigem Umfang sowie korrekt Quelleninhalte sehr präzise und in vollem Umfang Quelleninhalte richtig und in vollem
Universalitätsanspruch am Beispiel der deutschen Gender Studies von Kathleen Heft, Frankfurt/Oder, Juni 2006
 Wissenschaftliche Theoriebildung von und für Weiße Universalitätsanspruch am Beispiel der deutschen Gender Studies von Kathleen Heft, Frankfurt/Oder, 9. -11. Juni 2006 Motivation Arnold Farr,, 51: Die
Wissenschaftliche Theoriebildung von und für Weiße Universalitätsanspruch am Beispiel der deutschen Gender Studies von Kathleen Heft, Frankfurt/Oder, 9. -11. Juni 2006 Motivation Arnold Farr,, 51: Die
Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung
 Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung Die Folgen der Finanzkrise verunsichern viele Menschen. Vor allem Berufseinsteiger sind bei möglichen Entlassungen als erste betroffen.
Zwischenergebnisse 5 Berufseinstieg und subjektive Verunsicherung Die Folgen der Finanzkrise verunsichern viele Menschen. Vor allem Berufseinsteiger sind bei möglichen Entlassungen als erste betroffen.
S T A T E M E N T S. Der Weltalphabetisierungstag Statements. Fürsprecher im O-Ton
 S T A T E M E N T S Statements Der Weltalphabetisierungstag 2014 Fürsprecher im O-Ton Prof. Dr. Johanna Wanka Bundesministerin für Bildung und Forschung Lesen und schreiben zu können, ist elementar für
S T A T E M E N T S Statements Der Weltalphabetisierungstag 2014 Fürsprecher im O-Ton Prof. Dr. Johanna Wanka Bundesministerin für Bildung und Forschung Lesen und schreiben zu können, ist elementar für
I N F O R M A T I O N
 I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit LR Mag. a Doris HUMMER, Landesrätin für Bildung Dr. Christoph JUNGWIRTH, Vorsitzender EB-Forum Mag. Leander M. DUSCHL, Grundbildungszentrum VHS Linz Dr. Wilhelm
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit LR Mag. a Doris HUMMER, Landesrätin für Bildung Dr. Christoph JUNGWIRTH, Vorsitzender EB-Forum Mag. Leander M. DUSCHL, Grundbildungszentrum VHS Linz Dr. Wilhelm
WAS BEINHALTET GRUNDBILDUNG IM BEREICH FINANZIELLE GRUNDBILDUNG?
 Monika Tröster WAS BEINHALTET GRUNDBILDUNG IM BEREICH FINANZIELLE GRUNDBILDUNG? FACHTAGUNG GRUNDBILDUNG: DEFINITION THEMENFELDER ZIELGRUPPEN? DER VERSUCH EINER BEGRIFFSBESTIMMUNG Berlin, 20. April 2016
Monika Tröster WAS BEINHALTET GRUNDBILDUNG IM BEREICH FINANZIELLE GRUNDBILDUNG? FACHTAGUNG GRUNDBILDUNG: DEFINITION THEMENFELDER ZIELGRUPPEN? DER VERSUCH EINER BEGRIFFSBESTIMMUNG Berlin, 20. April 2016
Fördert oder beeinträchtigt die Globalisierung die Entwicklungschancen der Entwicklungsländer?
 Politik Christian Blume Fördert oder beeinträchtigt die Globalisierung die Entwicklungschancen der Entwicklungsländer? Essay Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S.03 2. Definition der Begriffe Globalisierung
Politik Christian Blume Fördert oder beeinträchtigt die Globalisierung die Entwicklungschancen der Entwicklungsländer? Essay Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S.03 2. Definition der Begriffe Globalisierung
Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie
 Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung
 Geisteswissenschaft Stefanie Backes Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 1. Einleitung... 2 2. Qualitative Sozialforschung...
Geisteswissenschaft Stefanie Backes Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 1. Einleitung... 2 2. Qualitative Sozialforschung...
6. NIC-Konferenz: Interkulturalität und Soziale Arbeit
 6. NIC-Konferenz: Interkulturalität und Soziale Arbeit Professionelles und politisiertes Handeln in der Sozialen Arbeit: der Blick auf Social Justice und das diskriminierungskritische Diversity Leah Carola
6. NIC-Konferenz: Interkulturalität und Soziale Arbeit Professionelles und politisiertes Handeln in der Sozialen Arbeit: der Blick auf Social Justice und das diskriminierungskritische Diversity Leah Carola
Unterrichtsvorhaben I
 Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
SEKTION F3 Alphabetisierung in der Zielsprache Deutsch
 Seite 20 SEKTION F3 Alphabetisierung in der Zielsprache Deutsch Die Schriftsprache ist für viele Menschen die erste und oft auch die einzige zusätzliche Sprache, die sie nach bzw. parallel zu ihrer Muttersprache
Seite 20 SEKTION F3 Alphabetisierung in der Zielsprache Deutsch Die Schriftsprache ist für viele Menschen die erste und oft auch die einzige zusätzliche Sprache, die sie nach bzw. parallel zu ihrer Muttersprache
Prof. Dr. Jürgen Neyer. Einführung in die Politikwissenschaft. - Was ist Wissenschaft? Di
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
leo. Level-One Studie Funktionaler Analphabetismus in Deutschland
 leo. Level-One Studie Funktionaler Analphabetismus in Deutschland Verantwortlich: Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Dr. Wibke Riekmann Universität Hamburg Durchführung: Dr. Robert Jaeckle, Frauke Bilger, Bernhard
leo. Level-One Studie Funktionaler Analphabetismus in Deutschland Verantwortlich: Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Dr. Wibke Riekmann Universität Hamburg Durchführung: Dr. Robert Jaeckle, Frauke Bilger, Bernhard
Ganzheitliche berufsorientierte Förderung einer heterogenen Zielgruppe
 AG BFN-Forum 2010 Umgehen mit heterogenen Lerngruppen: Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildungspraxis Ganzheitliche berufsorientierte Förderung einer heterogenen Zielgruppe Bonn 28.04.2010 Dr. Kathleen
AG BFN-Forum 2010 Umgehen mit heterogenen Lerngruppen: Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildungspraxis Ganzheitliche berufsorientierte Förderung einer heterogenen Zielgruppe Bonn 28.04.2010 Dr. Kathleen
MIGRATION & QUALIFIZIERUNG. Teams. Dienstleistungsmanagement.
 Führung Interkultureller Teams Fachtagung Dienstleistungsmanagement 1.10.201310 Kassel MIGRATION & QUALIFIZIERUNG Hauptprojekt: Verwaltungen interkulturell stärken Vielfalt lt nutzen (VERIS) www.arbeiteninvielfalt.de
Führung Interkultureller Teams Fachtagung Dienstleistungsmanagement 1.10.201310 Kassel MIGRATION & QUALIFIZIERUNG Hauptprojekt: Verwaltungen interkulturell stärken Vielfalt lt nutzen (VERIS) www.arbeiteninvielfalt.de
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Das MdM ein Museum für alle?
 Susanne Zauner Das MdM ein Museum für alle? Das Projekt unserer Gruppe bezieht sich nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Werk von Andrea Fraser, sondern greift vielmehr verschiedene Stränge ihres künstlerischen
Susanne Zauner Das MdM ein Museum für alle? Das Projekt unserer Gruppe bezieht sich nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Werk von Andrea Fraser, sondern greift vielmehr verschiedene Stränge ihres künstlerischen
PUBLIKATIONEN CHRONOLOGISCH
 PUBLIKATIONEN CHRONOLOGISCH Monographien und Herausgeberschaften Riekmann, Wibke; Buddeberg, Klaus; Grotlüschen, Anke (2016) (Hg.): Das mitwissende Umfeld von Erwachsenen mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen.
PUBLIKATIONEN CHRONOLOGISCH Monographien und Herausgeberschaften Riekmann, Wibke; Buddeberg, Klaus; Grotlüschen, Anke (2016) (Hg.): Das mitwissende Umfeld von Erwachsenen mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen.
Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen.
 Institut für Philosophie Stand 21.08.2014 Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen. Modulhandbuch M.A. (2-Fach) Philosophie Das Studienziel des MA-Studiengangs
Institut für Philosophie Stand 21.08.2014 Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen. Modulhandbuch M.A. (2-Fach) Philosophie Das Studienziel des MA-Studiengangs
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Kurzbericht zur FOM-Umfrage Arbeitspensum von Fach- und Führungskräften im Jahr 2007
 Kurzbericht zur FOM-Umfrage Arbeitspensum von Fach- und Führungskräften im Jahr 2007 Die vorliegende Studie basiert auf einer schriftlichen Befragung im Zeitraum 4. 18. Dezember 2007 im Rahmen von Seminarveranstaltungen
Kurzbericht zur FOM-Umfrage Arbeitspensum von Fach- und Führungskräften im Jahr 2007 Die vorliegende Studie basiert auf einer schriftlichen Befragung im Zeitraum 4. 18. Dezember 2007 im Rahmen von Seminarveranstaltungen
Regionale Differenzierung der Industrialisierung in Deutschland
 Geschichte Frank Bodenschatz Regionale Differenzierung der Industrialisierung in Deutschland Eine vergleichende Betrachtung von Sachsen und Rheinland-Westfalen Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Geschichte Frank Bodenschatz Regionale Differenzierung der Industrialisierung in Deutschland Eine vergleichende Betrachtung von Sachsen und Rheinland-Westfalen Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Willkommen zur Informationsveranstaltung. Schlüsselkompetenzen. Informationsveranstaltung Schlüsselkompetenzen Claudia Richter, MA
 Willkommen zur Schlüsselkompetenzen 19.02.2012 1 Ablauf Schlüsselkompetenzen Schlüsselkompetenzen und Bildungsstandards Kompetenzentwickelnde Jahresplanung Erfahrungsaustausch und Diskussion 19.02.2012
Willkommen zur Schlüsselkompetenzen 19.02.2012 1 Ablauf Schlüsselkompetenzen Schlüsselkompetenzen und Bildungsstandards Kompetenzentwickelnde Jahresplanung Erfahrungsaustausch und Diskussion 19.02.2012
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden)
 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden) Voraussetzungen für Zeugnis Regelmäßige Teilnahme (80%) (11,2 Montage) schreiben von kleinen Texten (1 ECTS) kleine
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Proseminar 2 ECTS (entspricht 50 Zeitstunden) Voraussetzungen für Zeugnis Regelmäßige Teilnahme (80%) (11,2 Montage) schreiben von kleinen Texten (1 ECTS) kleine
Gibt es eine Literatur der Migration?
 TU Dresden, Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte, Prof. Dr. Walter Schmitz Gibt es eine Literatur der Migration? Zur Konzeption eines Handbuchs zur Literatur der Migration in den deutschsprachigen
TU Dresden, Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte, Prof. Dr. Walter Schmitz Gibt es eine Literatur der Migration? Zur Konzeption eines Handbuchs zur Literatur der Migration in den deutschsprachigen
Über das Altern einer Generation
 12. Fachtagung der Deutschen Alterswissenschaftlichen Gesellschaft (DAWG) e.v. 15./ 16. September 2006 Ludwig-Windthorst Windthorst-Haus Haus,, Lingen Vorstellung der Diplomarbeit Die 68er Über das Altern
12. Fachtagung der Deutschen Alterswissenschaftlichen Gesellschaft (DAWG) e.v. 15./ 16. September 2006 Ludwig-Windthorst Windthorst-Haus Haus,, Lingen Vorstellung der Diplomarbeit Die 68er Über das Altern
Inklusive Erwachsenenbildung in Deutschland
 Inklusive Erwachsenenbildung in Deutschland Wege zur Teilhabe auf Augenhöhe 1 Inklusion Darunter wird in Deutschland vor allem die gemeinsame Beschulung von nichtbehinderten und behinderten Kindern verstanden.
Inklusive Erwachsenenbildung in Deutschland Wege zur Teilhabe auf Augenhöhe 1 Inklusion Darunter wird in Deutschland vor allem die gemeinsame Beschulung von nichtbehinderten und behinderten Kindern verstanden.
Forschendes Lernen mit digitalen Medien:
 Forschendes Lernen mit digitalen Medien: Gedanken aus einer Perspektive der Lebensspanne Gabi Reinmann Augsburg, 17.06.2010 Einführung und Überblick Verschiedene Metaphern für das Lernen Lernen nach dem
Forschendes Lernen mit digitalen Medien: Gedanken aus einer Perspektive der Lebensspanne Gabi Reinmann Augsburg, 17.06.2010 Einführung und Überblick Verschiedene Metaphern für das Lernen Lernen nach dem
Alphabetisierung deutschsprachiger Erwachsener
 Alphabetisierung deutschsprachiger Erwachsener Petra Mundt, Programmbereichsleiterin, Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.v., Sabine Karwath, Regionalstelle Alphabetisierung, VHS Oldenburg
Alphabetisierung deutschsprachiger Erwachsener Petra Mundt, Programmbereichsleiterin, Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.v., Sabine Karwath, Regionalstelle Alphabetisierung, VHS Oldenburg
Bachelor of Arts Sozialwissenschaften und Philosophie (Kernfach Philosophie)
 06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration
 Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration Engagement für alle! Kooperation zwischen Engagementförderung und Integrationsarbeit Fachtagung des Hessischen Ministeriums
Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration Engagement für alle! Kooperation zwischen Engagementförderung und Integrationsarbeit Fachtagung des Hessischen Ministeriums
Thomas S. Kuhn. Ein Referat von Michael Wallrad 1
 Thomas S. Kuhn Ein Referat von Michael Wallrad 1 Erstinformationen Paradigmata Protowissenschaft Normalwissenschaft Das Wesen der Normalwissenschaft Rätsel/Problem Analogie Paradigmavorzüge Krisen, Anomalien
Thomas S. Kuhn Ein Referat von Michael Wallrad 1 Erstinformationen Paradigmata Protowissenschaft Normalwissenschaft Das Wesen der Normalwissenschaft Rätsel/Problem Analogie Paradigmavorzüge Krisen, Anomalien
Eine erste Beschreibung der Situation. verbunden mit dem Wunsch nach Veränderung
 Eine erste Beschreibung der Situation verbunden mit dem Wunsch nach Veränderung Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Menschen jeden Alters gehen ihrem angeborenen Bedürfnis nach, Neues zu erkunden, ihr
Eine erste Beschreibung der Situation verbunden mit dem Wunsch nach Veränderung Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Menschen jeden Alters gehen ihrem angeborenen Bedürfnis nach, Neues zu erkunden, ihr
Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren?
 Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren? SZH-Kongress Pierre Margot-Cattin Seite 1 SZH 1 2013 - P. Margot-Cattin Lebensqualität Gutes Leben? Wohlbefinden? Lebensqualität:
Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren? SZH-Kongress Pierre Margot-Cattin Seite 1 SZH 1 2013 - P. Margot-Cattin Lebensqualität Gutes Leben? Wohlbefinden? Lebensqualität:
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis
 0. Einleitung... 11 0.1 E-Learning Der Beginn eines neuen Lernzeitalters?... 11 0.2 Stand der Nutzung und Evaluation des E-Learning... 14 0.3 Zielsetzung und Forschungsfragen der Arbeit... 24 0.4 Aufbau
0. Einleitung... 11 0.1 E-Learning Der Beginn eines neuen Lernzeitalters?... 11 0.2 Stand der Nutzung und Evaluation des E-Learning... 14 0.3 Zielsetzung und Forschungsfragen der Arbeit... 24 0.4 Aufbau
Warum C1 keine Lösung ist
 Warum C1 keine Lösung ist Nachweis von Deutschkenntnissen für den Hochschulzugang, der GER, und warum sie nicht zusammenpassen. TestDaF-Institut H.-J. Althaus Inhalt Der Diskurs Die Rahmenordnung Der GER
Warum C1 keine Lösung ist Nachweis von Deutschkenntnissen für den Hochschulzugang, der GER, und warum sie nicht zusammenpassen. TestDaF-Institut H.-J. Althaus Inhalt Der Diskurs Die Rahmenordnung Der GER
Intersektionale fallbezogene Pädagogik. Eine Stunde (wiederholbar)
 IGIV Anleitung Name Zeit Intersektionale fallbezogene Pädagogik Eine Stunde (wiederholbar) Analyse und Reflexion-Tool Zielgruppe Pädagog_innen Material, Raum, Anzahl der Räume etc. Arbeitsblatt Intersektionale
IGIV Anleitung Name Zeit Intersektionale fallbezogene Pädagogik Eine Stunde (wiederholbar) Analyse und Reflexion-Tool Zielgruppe Pädagog_innen Material, Raum, Anzahl der Räume etc. Arbeitsblatt Intersektionale
Wenn Erwachsene Lesen lernen..
 Ausgangssituation Nicht alle Stellen können kurzfristig besetzt werden Bestehendes Missmatch aufgrund qualifikatorischer Lücken kurzfristig nicht zu schließen Weiter steigende Anforderungen durch technologische
Ausgangssituation Nicht alle Stellen können kurzfristig besetzt werden Bestehendes Missmatch aufgrund qualifikatorischer Lücken kurzfristig nicht zu schließen Weiter steigende Anforderungen durch technologische
Allesamt Faschisten? Die 68er und die NS-Vergangenheit
 Geschichte Tatjana Schäfer Allesamt Faschisten? Die 68er und die NS-Vergangenheit Studienarbeit FU Berlin Krieg und Kriegserinnerung in Europa im 19. und 20. Jahrhundert Sommersemester 2007 Allesamt Faschisten?
Geschichte Tatjana Schäfer Allesamt Faschisten? Die 68er und die NS-Vergangenheit Studienarbeit FU Berlin Krieg und Kriegserinnerung in Europa im 19. und 20. Jahrhundert Sommersemester 2007 Allesamt Faschisten?
Wer integriert hier wen?
 Prof. Dr. Tina Spies Ev. Hochschule Darmstadt Wer integriert hier wen? Ehrenamtliches Engagement als Integration in die Gesellschaft? Fachtag Engagiert integrieren! Unsere Gesellschaft vor Ort gestalten
Prof. Dr. Tina Spies Ev. Hochschule Darmstadt Wer integriert hier wen? Ehrenamtliches Engagement als Integration in die Gesellschaft? Fachtag Engagiert integrieren! Unsere Gesellschaft vor Ort gestalten
Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und Integration in Europa
 Theologische Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät VORTRAG UND BUCHVERNISSAGE Prof. em. Dr. Dr. h.c. Karl Gabriel (Universität Münster) Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und
Theologische Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät VORTRAG UND BUCHVERNISSAGE Prof. em. Dr. Dr. h.c. Karl Gabriel (Universität Münster) Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und
Polyvalenter Bachelor Lehramt Ethik/ Philosophie
 06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
leo. Level-One Studie Funktionaler Analphabetismus in Deutschland
 leo. Level-One Studie Funktionaler Analphabetismus in Deutschland Verantwortlich: Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Dr. Wibke Riekmann Universität Hamburg Durchführung: Dr. Robert Jaeckle, Frauke Bilger, Bernhard
leo. Level-One Studie Funktionaler Analphabetismus in Deutschland Verantwortlich: Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Dr. Wibke Riekmann Universität Hamburg Durchführung: Dr. Robert Jaeckle, Frauke Bilger, Bernhard
Grundbildung im Spannungsfeld von Ein- und Abgrenzungsinteressen Salon für Erwachsenenbildung Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung
 Grundbildung im Spannungsfeld von Ein- und Abgrenzungsinteressen Salon für Erwachsenenbildung Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 16. November 2017, Hannover Dr. Caroline Duncker-Euringer Grundbildung
Grundbildung im Spannungsfeld von Ein- und Abgrenzungsinteressen Salon für Erwachsenenbildung Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 16. November 2017, Hannover Dr. Caroline Duncker-Euringer Grundbildung
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Grundbildung und Alltagsbildung. Perspektiven und Herausforderungen für die Weiterbildung
 Prof. Dr. Helmut Bremer (Universität Duisburg-Essen) Grundbildung und Alltagsbildung. Perspektiven und Herausforderungen für die Weiterbildung Vortrag auf dem 15. Weiterbildungstag Ruhr GRUND.BILDUNG.FÜR
Prof. Dr. Helmut Bremer (Universität Duisburg-Essen) Grundbildung und Alltagsbildung. Perspektiven und Herausforderungen für die Weiterbildung Vortrag auf dem 15. Weiterbildungstag Ruhr GRUND.BILDUNG.FÜR
