Beachtenswerte Renaissance
|
|
|
- Lennart Schmidt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2
3 E D I T O R I A L Beachtenswerte Renaissance Der Oberflächenersatz an der Hüfte erfährt weltweit eine beachtenswerte Renaissance, nachdem dieses Verfahren erstmals in den 70er Jahren in größerem Umfang zur Anwendung kam. Der geringe Knochenverlust am Femur sowie die einfachere Revisionsmöglichkeit galten als Vorteile gegenüber den gängigen Methoden. Federführend in Entwicklung und klinischer Anwendung waren derzeit Amstutz in den Vereinigten Staaten, Freeman in England und Wagner in Deutschland. Die Pfanne aus hochvernetztem Polyethylen wurde ebenso wie die Femurkomponente, bestehend aus Metall, mit Knochenzement verankert. Die anfänglich viel versprechenden Resultate wichen ernüchternden mittelfristigen Ergebnissen. Die hohe Versagensquote wurde primär dem im Vergleich zu konventionellen Implantaten deutlich stärkeren Polyethylenabrieb zugeschrieben. Die Lockerung entstand demnach durch Osteolysen an der Zement-Knochengrenze, also einer Gewebereaktion auf diese Abriebpartikel. Schenkelhalsfrakturen und Osteonekrosen spielten in der Interpretation des Versagensmechanismus keine entscheidende Rolle. Dieses bedeutete zunächst das Ende des Oberflächenersatzes. Lediglich Amstutz in Los Angeles nutzte das Implantat in einer modifizierten Form für ein hoch selektiertes junges Patientengut weiter. Er entwickelte in der Folge eine zementfreie Variante sowie das sog. Hemiresurfacing, bei dem nur die Femurkomponente ersetzt wird. Die Wiederentdeckung der Metall-Metall Gleitpaarung Ende der 80er Jahre beeinflusste die Entwicklung einer neuen Generation des Oberflächenersatzes entscheidend. Neue Fertigungstechniken ermöglichten es, das Polyethylen der Pfanne durch Metall zu ersetzten und somit den angeschuldeten Versagensmechanismus auszuschalten. Wiederum war es Amstutz, der neben McMinn in England eine Hybridvariante mit zementfreier Pfanne und zementierter Femurkomponente konzipierte. Mittlerweile befinden sich beide Implantate seit ca. 10 Jahren in der klinischen Anwendung. Die vorliegenden Ergebnisse belegen, dass die neuen Komponenten denen der ersten Generation deutlich überlegen sind. Als Vorteile gelten neben dem geringen Knochenverlust vor allem der geringe Abrieb, das große Bewegungsausmaß und die Gelenkstabilität. Diese will man vor allem bei jungen und aktiven Patienten nutzen. Der über moderne Medien informierte Patient ist es, der dieses Implantat immer häufiger beim Arzt einfordert. Dabei stößt er vor allem in Deutschland auf die Skepsis derer, die das Versagen der Wagner-Kappe in den 70er Jahren noch erlebt haben oder ähnliches auch bei der neuen Generation befürchten. Fokussiert werden jetzt vor allem die Gefahr von Schenkelhalsfraktur, Osteonekrose und die Folgen des Metallabriebs in Form von Partikeln und Metallionen sowie deren lokale und systemische Wirkung. Unklar sind die Bedeutung der Durchblutung des Schenkelhalses sowie die der Zementiertechnik und des Zementes überhaupt. Der Versagensmechanismus ist nach bisherigen Erkenntnissen am ehesten multifaktoriell, eine definitive Gewichtung der Risikofaktoren aufgrund der mit konventionellen Methoden verglichenen geringen Stückzahlen noch schwer. Dennoch erscheint es sinnvoll, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Die Daten, die bisher vorliegen, müssen zusammenfassend betrachtet und möglichst objektiv bewertet werden. Das vorliegende Heft soll vor allem dieser Intention dienen. Ich danke dem GIT-VERLAG, der diese zweite Sonderpublikation im Bereich Orthopädie ermöglichte, vor allem Herrn Mateblowski für seine professionelle redaktionelle Unterstützung und Geduld. Mein besonderer Dank gilt allen Autoren und Unternehmen, ohne deren substantielle Beiträge alles nur eine Idee geblieben wäre. Priv.-Doz. Dr. Georg Köster ist Chefarzt der Chirurgisch-Orthopädischen Fachklinik Lorsch (Südhessen) und lehrt Orthopädie an der Georg-August-Universität Göttingen Kontakt: Priv.-Doz. Dr. Georg Köster Chirurgisch-Orthopädische Fachklinik D-Lorsch Tel.: 06251/ Fax: 06251/ koester@fachklinik-lorsch.de Orthopädie im Profil 1/2006 1
4 N A C H R U F In memoriam Am 25. September 2006 verstarb Prof. Dr. Hans-Georg Willert. Die Orthopädie verliert damit eine herausragende Persönlichkeit und einen ihrer bedeutsamsten Wissenschaftler, der weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt war. Prof. Dr. Hans-Georg Willert, bedeutsamer Wissenschaftler und herausragende Persönlichkeit der Orthopädie. Prof. H.-G. Willert wurde am 24. September 1934 in Greiz/Thüringen geboren. Nach dem Medizinstudium an der Universität Leipzig führte ihn seine Ausbildung zwischen 1960 und 1969 in die Heidelberger Chirurgie (Prof. Linder), Orthopädie (Prof. Lindemann) und Pathologie (Prof. Lennert) sowie in die Pathologie (Prof. Uehlinger) und Orthopädie (Prof. Francillon) nach Zürich wurde er Oberarzt an der Orthopädischen Universitätsklinik in Frankfurt am Main (Prof. Heipertz), wo er 1972 mit der Arbeit Klinik und Pathologie der Dysmelie habilitierte. In Frankfurt wurde er dann zum Professor ernannt und leitete die Abteilung für Knochenpathologie wurde Prof. H.-G. Willert auf den Lehrstuhl für Orthopädie an der Georg-August-Universität in Göttingen berufen und leitete als Direktor die Orthopädische Universitätsklinik über 20 Jahre bis zu seiner Emeritierung im Jahre Schon in frühen Jahren war Prof. H.-G. Willert wissenschaftlich aktiv. Diese Aktivität prägte ihn bis wenige Tage vor seinem Tod. Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit waren neben Knochensystemerkrankungen und Knochentumoren vor allem Biomaterialien. Weltweit bekannt wurde er vor allem mit seinen Arbeiten über Gewebereaktionen auf Implantate und deren Verschleiß- und Abriebpartikel. Prof. H.-G. Willert gilt als Erstbeschreiber des Phänomens der Lockerung künstlicher Gelenke durch Gewebereaktionen auf Partikel, die durch den Verschleiß der Implantatkomponenten entstehen. Diese Partikel initiieren eine Kaskade zellulärer Reaktionen, die schließlich zu Osteolysen und damit zum Implantatversagen führen. Seine Theorie des Lockerungsmechanismus ist gegenwärtig allgemein anerkannt und führte zu unzähligen Forschungsinitiativen. Diese hatten das Ziel, die Implantatkomponenten tribologisch so verschleiß- und abriebarm wie möglich zu gestalten und die zellulären und molekularen Mechanismen der Entstehung von Osteolysen aufzuklären. Prof. Willert beschrieb darüber hinaus den Mechanismus der Spaltkorrosion bei zementierten Hüftschaften aus Titanlegierungen und klärte damit das Frühversagen dieser Implantate auf. Erst kürzlich beschrieb er als erster eine neue Form der Gewebereaktion auf Implantate mit einer Metall-Metall- Gleitpaarung. Prof. H.-G. Willert war Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler wissenschaftlicher Gesellschaften u.a. der International Society for Biomaterials, der International Skeletal Society und der International Hip Society. In Anerkennung seines wissenschaftlichen Lebenswerkes wurde ihm noch im März diesen Jahres in Chicago als erstem Deutschen der Arthur Steindler Award der Orthopaedic Research Society verliehen. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war Prof. H.-G. Willert ein exzellenter akademischer Lehrer und Kliniker. Alle, die mir ihm arbeiteten, kannten seinen unermüdlichen Arbeitseinsatz, seine methodologische Genauigkeit, seine intuitiven Fähigkeiten und seine intellektuelle Brillianz. Vermissen werden die, die ihm nahe standen, aber vor allem jene Eigenschaften, die er sich bis zum Schluss bewahrte: Humor und Witz, Optimismus, menschliche Wärme und seine Liebe zum Leben. Priv.-Doz. Dr. Georg Köster, Lorsch 2 Orthopädie im Profil 1/2006
5 I N H A L T Editorial 1 Beachtenswerte Renaissance Priv.-Doz. Dr. G. Köster Implantationstechnik 16 Wunsch und Wirklichkeit Tribologie und Implantationstechnik des Oberflächenersatzes Prof. Dr. M. M. Morlock Nachruf 2 In memoriam Priv.-Doz. Dr. G. Köster Klinische Anwendung 4 Bedeutender Schritt Oberflächenersatz beim endoprothetischen Gelenkersatz PhD H. C. Amstutz 6 Fester Platz unter den Hüftgelenkendoprothesen Birmingham Hip Resurfacing Prof. Dr. M. Faensen 9 Gezielte Nachfrage Oberflächenersatz des Hüftgelenkes mit der ReCap Prof. Dr. J. Schmidt 12 Knochensparende Behandlung der Coxarthrose bei jungen aktiven Patienten Dr. M. Guinard Tribologie 18 Große Köpfe bei Hüft TEP? Eine individuell patientenbezogene Entscheidung G. H. Buchhorn 21 Non plus ultra? Keramik-Keramik-Gleitpaarung Prof. Dr. J. Scholz Wechselwirkungen 22 Diagnostisches Dilemma Implantatallergie bei Metall-Metall-Endoprothesen Prof. Dr. C. H. Lohmann Ökonomie 24 Integrierte Versorgung in der orthopädischen Praxis K. Klitza, Prof. Dr. J. Schmid, V. Latz, Prof. Dr. R. Riedel Navigation 14 Präzision made in Germany Navigation beim Oberflächenersatz Priv.-Doz. Dr. T. Hess 26 Optimierungspotential nutzen Therapiekonzept ideal für integrierte Versorgung B. Wesselow 28 Integra neue Wege Spezialstation für Hüft- und Knieendoprothetik eröffnet 30 Schonende Instrumentenaufbereitung für orthopädische Chirurgie Biologics 31 Angestrebt Regeneration ganzer Gelenkflächen Veranstaltungen 32 Gipfeltreffen der Wintersportmedizin Orthopädie im Profil 1/2006 3
6 K L I N I S C H E A N W E N D U N G Bedeutender Schritt Oberflächenersatz beim endoprothetischen Gelenkersatz Der Oberflächenersatz an der Hüfte repräsentiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklungsgeschichte des endoprothetischen Gelenkersatzes. Er ist eine Knochensubstanz erhaltende Alternative zur konventionellen Versorgung und ermöglicht die Rekonstruktion der normalen Biomechanik des Gelenkes. Die unverändert herausfordernde Problematik der Behandlung einer Coxarthrose bei jungen und aktiven Patienten sowie das immer noch aktuelle Ziel, die Haltbarkeit des endoprothetischen Gelenkersatzes zu verbessern, führten weltweit zu einem erneuten Interesse an Metall-Metall Gleitpaarungen. Zahlreiche Untersuchungen und Erfahrungen sprechen dafür, dass gerade bei jungen Patienten, bei denen aufgrund ihrer Lebenserwartung ein Implantatsystem mit einer Polyethylenkomponente nicht lebenslang funktioniert, die endoprothetische Versorgung mit einer abriebarmen Gleitpaarung eine bedenkenswerte Alternative darstellt. Es ist wahrscheinlich, dass eine Reduktion des volumetrischen Abriebs die lokale Gewebereaktion auf ein Maß reduziert und somit eine relevante Zerstörung der Grenzschicht zwischen Implantat und Knochen ebenso wenig zustande kommt wie die konsekutive Lockerung. In den 60er Jahren wurden verschiedene Typen von Endoprothesen mit Metall-Metall Gleitpaarungen entwickelt, die aber Mitte der 70er Jahre vollständig durch Implantatsysteme mit Polyethylen-Gleitpaarungen verdrängt worden waren. Man nimmt an, dass ein Teil dieser Metall-Metall-Gelenke aufgrund von Designfehlern oder wegen mangelhafter Herstellungstechnik der Oberflächen frühzeitig versagten. Andere Gründe waren das ungenügend abgestimmte Kopf-Hals-Verhältnis, das zum Impingement führte, sowie ein ungünstiges Schaftdesign und eine schlechte Zementiertechnik. Trotz dieser Mängel konnte eine erhebliche Anzahl dieser Gelenke aufgrund des geringen Abriebs und minimaler Osteolysen eine Lebensdauer zwischen 25 und 30 Jahren aufweisen. Dieses waren in der Regel Implantate mit einem nachweisbaren Polkontakt der Gleitpartner, mit einer richtigen Komponentenpositionierung, so dass es zu keinem Impingement kam, und einer guten Zementiertechnik. Die Vermutung liegt also nahe, dass diese Systeme sehr gut und dauerhaft funktionieren können. Tab. 1: Operationsindikationen Ätiologie Primäre Arthrose 65,6% Osteonekrose (14% ON Ficat III und 86% ON Ficat IV) 9,0% Dysplasie (77% Crowe I, 23% Crowe II) 10,8% Posttraumatische Arthrose 7,8% Perthes 2,5% Epiphyseolysis capitis femoris 1,8% Spondylitis ancylosans 1,0% Juvenile rheumatoide Arthritis 0,8% Rheumatoide Arthritis 0,8% Melorheostose 0,3% Vorangegangene Operation 6,3 % Osteotomie 6 Anbohrung 10 Hemiresurfacing 2 Spickung 5 Judet Knochenplastik 1 Azetabuloplastik 1 Harlan C. Amstutz, M.D., Gründungsdirektor des Joint Replacement Institute, Professor Emeritus und ehemaliger Chef des Department für Orthopädische Chirurgie an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Betrachtet man die Literatur so finden sich nach 1967, wo die meisten Designfehler der Metall-Metallpaarung beseitigt waren, keine Hinweise mehr für einen signifikanten Metallabrieb oder eine Metallose. Forschungsergebnisse belegen, dass der volumetrische Abrieb von Gleitpaarungen aus gegossenen Kobalt-Chrom Legierungen mal geringer ist als der von Metall gegen Polyethylen. Untersuchungen von McKee-Farrar Prothesen nach mehr als 20 Jahren Funktionszeit zeigen einen mindestens 25 mal geringeren volumetrischen Abrieb und deutlich weniger periprothetische Gewebereaktionen als bei Polyethylen. Alle Typen von Metall-Metall Totalendoprothesen (McKee-Farrar, Ring, Müller und Huggler), die in der Vergangenheit in größeren Mengen zum Einsatz kamen, hatten große Köpfe, die mit denen des Oberflächenersatzes vergleichbar sind begannen wir mit der Implantation eines optimierten Designs des Oberflächenersatzes. Zwischen November 1996 und November 2000 wurden die ersten 400 Implantationen mit dem Conserve Plus Oberflächenersatz (Wright Medical Technology, Arlington, Tennessee) bei 355 Patienten durchgeführt. 4 Orthopädie im Profil 1/2006
7 K L I N I S C H E A N W E N D U N G Die Conserve Plus Pfanne ist nahezu hemisspärisch (170o). An ihrer Außenseite befinden sich gesinterte Kugeln in einem Durchmesser zwischen 50 μm und 150 μm für eine zementfreie Verankerung. Die Monoblock-Pfanne ist 5 mm dick und wird durch Pressfit verankert. Die Femurkomponente hat das gleiche Design wie die Conserve Hemiresurfacing Prothese (Wright Medical Technology, Arlington, Tennessee). Die Komponente hat einen kurzen Schaft, um sie exakt platzieren zu können. Die Oberfläche hat eine Rauhigkeit von μm. 10 femorale und 10 azetabuläre Komponenten stehen zur Verfügung. Die Pfannengrößen liegen in 2 mm Schritten zwischen 46 und 64 mm, die Femurkomponente entsprechend zwischen 36 und 54 mm. Alle Komponenten sind aus einer gegossenen F-75 Kobalt-Chrom-Molybdän Legierung. Die häufigste Indikation zur Implantation diese Oberflächenersatzes ergab sich bei jungen Patienten mit einem hohen Aktivitätslevel (s. Tab. 1). Das Durchschnittsalter betrug 48,2 Jahre (15 77 Jahre). 32 Patienten wurden beidseitig in einer Sitzung operiert, 13 wurden innerhalb von 2,5 und 34 Monaten auf der Gegenseite operiert. Die durchschnittliche Nachuntersuchungszeit betrug 3,5 Jahre. Die klinischen Ergebnisse (Harris-Hip Score, UCLA Aktivitäts Score und SF 12) sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 78 Patienten hatten präoperativ Beinlängendifferenzen (15 x < 1 cm, 16 x 1 2 cm, 8 x 2 3 cm, 1 x > 3 cm). Lediglich 25 Patienten wiesen auch postoperativ Beinlängendifferenzen auf (22 x < 1 cm, 3 x 1 2 cm). 261 Patienten (67%) hatten im Bereich der Pfanne keinerlei Lysesäume, 122 (32 %) einen Saum in ein oder zwei Zonen. Lysesäume in Zone I oder II nach Delee und Charnley waren nicht progredient. 16 Hüften (4,2%), die nicht revidiert werden mussten, wiesen im Bereich des Schaftes der Femurkomponente umschriebene Lysesäume auf. Diese Patienten waren klinisch nicht symptomatisch. 12 x (3%) erfolgte der Wechsel auf eine Totalendoprothese, sieben mal wegen der Lockerung der femoralen Komponente, drei mal wegen einer Schenkelhalsfraktur. Zwei Schenkelhalsfrakturen traten innerhalb der ersten sechs Wochen postoperativ auf, die dritte ereignete sich mit 20 Monaten. In fünf der Fälle, in denen wegen einer Lockerung der femoralen Komponente gewechselt wurde, bestanden initial ausgedehnte Zysten im Kopfbereich, was zu einer deutlichen Reduktion der Verankerungsfläche führte. Drei mal hatte die Femurkomponente nicht ihre Solltiefe erreicht. Zwischen Verankerungsfläche und Implantat fand sich eine dicke Zementschicht. In allen bis auf einen Fall erfolgte der Wechsel auf Tab. 2: Klinische Resultate: UCLA Aktivitäts-Score, SF-12, und Harris-Hip-Score (HHS). Präoperativer Wert Follow-up Wert P Werte UCLA Schmerz 3.5 (1 8) 9.5 (2 10) p < Gang 6.0 (2 10) 9.6 (3 10) p < Funktion 5.7 (1 10) 9.4 (3 10) p < Aktivität 4.5 (1 10) 7.7 (2 10) p < SF-12 physisch 31.2 ( ) 50.0 ( ) p < mental 46.8 ( ) 53.1 ( ) p < HHS (41 100) N/A eine Schaftprothese mit großem Kopf entsprechend der fest verankerten und belassenen Pfanne. Die klinischen Resultate sind viel versprechend. Nach unserer Risikoanalyse ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Lysesäumen an der Femurkomponente größer bei Frauen, größeren Kopfzysten und kleineren Komponentengrößen. Dieses lässt darauf schließen, dass die Verankerungsfläche, die für die Zementverankerung zur Verfügung steht, eine entscheidende Rolle spielt. Im Wesentlichen sind beim Oberflächenersatz der Hüfte zwei Versagensmechanismen entscheidend: die Schenkelhalsfraktur und die aseptische Lockerung. Nach unseren Ergebnissen ist die Ursache der aseptischen Lockerung multifaktoriell. Die Schenkelhalsfraktur war in der vorliegenden Serie mit 0,75% vergleichsweise selten. Mit zunehmender Erfahrung und einer verbesserten Operationstechnik konnte sie nahezu vermieden werden. Ein sog. notching d. h. ein Einkerben des Schenkelhalses sollte ebenso vermieden werden wie eine inkomplette Überdeckung des gefrästen Knochens mit der Femurkomponente. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn man beim zylindrischen Fräsen in dem empfohlenen Winkel von 140 in die Nähe des lateralen Kortex gelangt. Ein anteriorer Osteophyt, der prinzipiell stabilisierende Wirkung hat, sollte nur reduziert werden, wenn er in 90 Flexion und Innenrotation anstößt. Gemäß einer umfangreichen Literaturrecherche liegt die Inzidenz der Schenkelhalsfrakturen beim Oberflächenersatz weltweit > 1,25%. Diese Untersuchung schließt etwa Fälle ein, von denen allein aus dem Australischen Hüftregister stammen. Trotz der fehlenden Evidenz, dass Metall- Metall Paarungen im Langzeitverlauf spezifische Probleme verursachen, gibt es Bedenken bezüglich lokaler und möglicherweise auch systemischer Effekte der metallischen Abriebpartikel einschließlich der Metallionen. Untersuchungsberichte über atypische lymphozytäre Infiltrationen in dem Gewebe um revidierte konventionelle Endoprothesensysteme mit Metall-Metall Gleitpaarungen haben uns veranlasst, das eigene Material durchzusehen. Wir fanden in etwa einem Drittel solche Gewebereaktionen. Hinweise für einen Zusammenhang zwischen dieser Gewebereaktion und dem klinischen Resultat gibt es bisher nicht. Das Phänomen wird jedoch weiter beforscht. Gegenwärtig gibt es keine Methode, die Patienten identifizieren kann, die solche Gewebereaktionen zeigen. In den wenigen Fällen, die uns aus Australien und Europa geschickt wurden, war ein Austausch der Gleitpaarung erforderlich. In unserem eigenen Patientengut von mehr als Metall-Metall Gleitpaarungen konnten wir keinen Fall mit klinischen Konsequenzen identifizieren. Gegenwärtig werden in unserem Labor bei mehr als 100 Patienten mit einem Conserve Plus Oberflächenersatz regelmäßig Metallionenkonzentrationen im Blut gemessen. Die Werte sind vergleichbar oder geringer als die bei Patienten mit konventionellen Implantaten und Metall-Metall-Gleitpaarungen. Unerwünschte Effekte wurden bisher nicht registriert. Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die bisherigen klinischen Resultate mit dem Oberflächenersatz Conserve Plus exzellent sind und weiter optimiert werden durch eine kritische Analyse der Ergebnisse und angemessene technische Änderungen. Bei der Überlebenswahrscheinlichkeit mit dem vorgestellten Implantat muss der hohe Aktivitätsgrad (Ø 7,7 UCLA Aktivitäts-Score) der Patienten berücksichtigt werden. 54% haben einen UCLA Aktivitäts-Score von acht, dem höchsten, der bisher bei Hüftendoprothesenträgern verzeichnet wurde. Engmaschige Nachuntersuchungen unserer Patienten sind erforderlich, um die Ergebnisse besser interpretieren und Indikationen optimaler definieren zu können. Die klinischen Ergebnisse und radiologischen Resultate der aktuellsten Serie von 200 Fällen, bei denen keine potentiell negativen radiologischen Phänomene beobachtet wurden, ermutigen uns sehr. Kontakt: The Joint Replacement Institute at Orthopaedic Hospital, Los Angeles, California Orthopädie im Profil 1/2006 5
8 K L I N I S C H E A N W E N D U N G Die grundsätzlichen Vorteile des Oberflächenersatzes am Hüftgelenk gegenüber den Standardprothesen mit Stiel im Markraum des Femur bestehen in der weitgehenden Erhaltung der Anatomie, der Propriozeption und der Biomechanik, der Vermeidung des Stress-shielding, der hohen Luxationssicherheit und der guten Revisionsmöglichkeit bei Komplikationen. Diese Vorteile hatten schon Anfang der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts John Charnley veranlasst, derartige Implantate zu entwickeln und anzuwenden. Fester Platz unter Chefarzt Prof. Michael Faensen, Zentrum für Oberflächenersatz am Hüftgelenk, DRK-Kliniken- Berlin den Hüftgelenkendoprothesen Birmingham Hip Resurfacing (BHR) Seine ersten Prothesen aus Teflon scheiterten ebenso wie die in den 70er bis in die 80er Jahre verwendeten Prothesen aus Polyäthylen und Kobalt/Chrom bzw. Keramik von Freeman, Wagner und anderen Autoren. Als wesentliche Gründe für die enttäuschenden Ergebnisse wurden die unterbrochene Durchblutung des Hüftkopfes durch den operativen Zugang und das Implantat angesehen sowie der starke Abrieb der dünnen Kunststoffimplantate durch die Größe der Gleitpartner aus Metall oder Keramik. Die Beobachtung, dass einige Prothesen mit Metall-Metall Gleitpaarung (M-M G) 30 Jahre und mehr ohne Lockerung und Osteolysen blie- ben, führte dazu nach den Kriterien zu suchen, die eine erfolgreiche M-M G kennzeichnen. Eine optimale Sphärizität, eine Spaltweite von μm, eine geringe Oberflächenrauhigkeit und ein hoher Kohlenstoffanteil der CoCrMo-Legierung waren für die erfolgreichen Implantate charakteristisch. Die überwiegend schlechten Ergebnisse der M-M G waren durch Mängel in der Herstellung aufgetreten, die heute zuverlässig vermeidbar sind. Diese Erkenntnis führte dazu, dass Weber 1988 die M-M G für Standardprothesen wieder einführte, die bis heute klinisch erfolgreich angewendet wird. Die zweite Voraussetzung für die Renaissance des Oberflächenersatzes war die Erkenntnis, dass weder der Zugang zum Hüftgelenk mit Durchtrennung der Gelenkkapsel noch das Implantat selbst zu einer Hüftkopfnekrose führen. Freeman (1978) und Bradley (1987) wiesen histologisch an Explantaten nach, dass Kopfnekrosen nur vereinzelt nach Oberflächenersatz auftreten. Die Kombination von M-M G und Oberflächenersatz durch McMinn 1989 sollte die Vorteile des Oberflächenersatzes mit einer hohen Abriebfestigkeit verbinden und so ein Implantat für die jüngeren und aktiven Patienten sein, deren langfristige Versorgung mit Hüftprothesen 6 Orthopädie im Profil 1/2006
9
10 K L I N I S C H E A N W E N D U N G Patienten beträgt 54 Jahre (16 78 Jahre); 65 % sind männlich, 35% weiblich. 80% sind primäre Coxarthrosen. Sekundäre Coxarthrosen bei Dysplasie, bei avaskulärer Hüftkopfnekrose, nach Traumen, bei Epiphyseolysen und M. Perthes sind in dieser Reihenfolge seltener. Die klinischen Ergebnisse sind bezüglich der Schmerzbeseitigung und der verschiedenen Funktionsscores vergleichbar mit Standardprothesen. Der Unterschied besteht in den Möglichkeiten der stärkeren körperlichen Belastbarkeit im Beruf und im Sport. Von schwerer körperlicher Arbeit, Arbeiten auf Leitern und Gerüsten muss wegen der hohen Luxationssicherheit und dem geringen Abrieb nicht mehr abgeraten werden. Dieser Vorteil ist von großer sozioökonomischer Bedeutung, da ein Verlust des Arbeitsplatzes wegen eingeschränkter Leistungsfähigkeit kaum zu befürchten ist. Sportlich aktive Patienten können ihre gewohnten Sportarten weiterhin ausüben bzw. wieder aufnehmen. Die Bedenken, die gegen dieses Verfahren vorgebracht werden, beziehen sich auf die langfristigen Folgen der erhöhten Metallionenspiegel bei Patienten mit M-M G. Immunologische Überempfindlichkeitsreaktionen, Kanzerogenität und Mutagenität können als Gefahren nicht völlig ausgeschlossen werden. Bei eingeschränkter Nierenfunktion kann es durch Schwermetalle zu einer weiteren Nierenschädigung kommen. Durch Hauttest nachgewiesene Metallallergien bestehen bei 10 20% der Bevölkerung. Nach Implantation einer M-M G steigt der Prozentsatz geringfügig an. Ob Wechsel-OPs aus diesem Grund erwegen früher eintretender Lockerung unbefriedigend ist. Die ersten Ergebnisse wurden von McMinn 1996 veröffentlicht. Es zeigte sich, dass die Patienten mit einer zementfrei implantierten Pfanne mit einer gegossenen porösen, hydroxylapatitbeschichteten Oberfläche und einer zementierten Femurkomponente die geringste Komplikationsrate hatten. Bei der Herstellung werden die durch den hohen Kohlenstoffgehalt entstehenden harten Karbide (Metall-Kohlenstoff Verbindungen) in der Oberfläche nicht verändert oder vermindert, so dass die hohe Abriebfestigkeit erhalten bleibt. Bis jetzt liegen nur für dieses Implantat Röntgenanalysen (RSA) über fünf Jahre vor, die die Zuverlässigkeit der Verankerung beweisen. Diese Prothese (Birmingham Hip Resurfacing, BHR) mit ihrem seit 10 Jahren unveränderten Design ist inzwischen weltweit über mal implantiert und im Mai 2006 als einziger Oberflächenersatz in den USA durch die FDA zugelassen worden. Andere Hersteller, die dieses Verfahren später ebenfalls aufgegriffen haben, modifizierten das Implantat und die OP-Technik. Die Erfahrungen mit diesen Implantaten sind daher noch sehr begrenzt. Im Australischen Hüftprothesen Register weist die BHR mit 2% Komplikationen bei Prothesen verglichen mit anderen Modellen deutlich die geringste Komplikationsrate auf. Eine prospektive Studie aus Birmingham mit 446 Prothesen bei 384 Patienten, die jünger als 55 Jahre waren, zeigt nach bis zu 8,3 Jahren (Durchschnitt 3,3 Jahre) nur eine Revision, d.h. 0,02% Komplikationen. Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, da diese Altersgruppe als besonders aktiv gilt, und deshalb bei Standardprothesen eine frühzeitige Lockerung eher zu erwarten ist. Die veröffentlichten klinischen Ergebnisse zeigen, dass Frühkomplikationen in etwa 2 4% der Fälle auftreten. Die häufigste Komplikation stellt die Schenkelhalsfraktur dar. Ursache können technische Probleme während der OP oder eine zu weit gestellte Indikation sein. Andere Komplikationen sind weniger spezifisch für den Oberflächenersatz. Unsere eigenen Erfahrungen mit über Implantationen in fast sechs Jahren bestätigen, dass die Frühkomplikationen von der Lernkurve abhängen. Sie nehmen mit wachsender Erfahrung deutlich ab und sind bei korrekter Indikationsstellung bis auf Ausnahmen vermeidbar. Bei den ersten 120 Patienten traten acht Schenkelhalsfrakturen auf, die man der Lernkurve von zwei Operateuren zuschreiben muss. Bei 366 OPs im Jahr 2005 traten bei erweiterter Indikationsstellung mit erhöhtem Risiko nur noch zwei Frakturen auf. Das Durchschnittsalter unserer Abb. 1: 64-jährige Patientin mit Dysplasiecoxarthrose beiderseits, rechts mit Kranialisierung des Hüftkopfes und Substanzverlust am Azetabulum. Röntgenbefund vier Jahre postoperativ. Abb. 2: 57-jähriger Patient mit primärer Coxarthrose beiderseits; Verlauf nach drei, fünf Jahren. forderlich wurden, scheint nicht sicher. Eine Kanzerogenität konnte für die verschiedenen Malignome statistisch nicht nachgewiesen werden. Metallspezifische Schäden der DNA konnten mit Co- und Cr Abriebpartikeln in vitro erzeugt werden, ohne dass klinische Folgen festgestellt wurden. Diese unbestätigten Befürchtungen müssen jedoch auch im Vergleich zu den bekannten und gefürchteten Folgen des Polyäthylenabriebs bewertet werden. Eine Niereninsuffizienz ist allerdings als Kontraindikation anzusehen. Obwohl nach jahrzehntelanger Anwendung von M-M G mit erhöhten Metallionenspiegeln keine der befürchteten klinischen Folgen beobachtet wurde, wird an einer weiteren Verminderung des Abriebs durch spezielle Verfahren der Oberflächenhärtung gearbeitet. Die BHR mit der M-M G hat nach zehnjähriger Erfahrung ihren festen Platz unter den Endoprothesen des Hüftgelenks gefunden. Sie bietet dem jungen wie auch dem aktiven älteren Patienten die Möglichkeit, sich eine hohe Lebensqualität in Beruf und Freizeit zu erhalten. Kontakt: Prof. Dr. Michael Faensen Zentrum für Oberflächenersatz am Hüftgelenk an den DRK-Kliniken-Berlin D-Berlin Tel.: 030/ oder Fax: 030/ oberflaechenersatz@drk-kliniken-berlin.de 8 Orthopädie im Profil 1/2006
11 ? Gezielte Nachfrage Oberflächenersatz des Hüftgelenkes mit der ReCap Prof. Dr. Joachim Schmidt, Ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie und Sporttraumatologie am Dreifaltigkeits- Krankenhaus Köln Braunsfeld Oberflächenersatzprothesen erleben seit 1991 eine Renaissance durch die Einführung der Metall-Metall-Paarung für diesen Implantat-Typ. Es hat sich bei den verschiedenen Arbeitsgruppen bisher die zementfreie Press-fit-Verankerung der Pfanne und die zementierte Verankerung der Hüftkopfkappe durchgesetzt. K L I N I S C H E A N W E N D U N G Die Oberflächenersatzprothese des Hüftgelenkes ermöglicht Patienten mit einem biologischen Alter unter 60 Jahren eine nahezu uneingeschränkte Aktivität und Sportausübung. In Deutschland werden pro Jahr bei insgesamt Hüftprothesen ca Oberflächenersatzprothesen zurzeit implantiert und 10 verschiedene Anbieter für Oberflächenersatzprothesen sind auf dem Markt. Durch Medien und Internet werden diese Prothesen gerade von den gut informierten jüngeren Patienten gezielt bei den Operateuren nachgefragt, so dass in den nächsten Jahren die Implantationszahlen deutlich steigen werden. In der Literatur werden hervorragende kurzbis mittelfristige Ergebnisse (bisher maximal acht Jahre) mit revisionsfreien Standzeiten von % angegeben. Entscheidendes Erfolgskriterium ist neben der korrekten Indikation die exakt positionierte Prothese. Die Hüftkopfkappe muss einen CCD-Winkel von über 130 Grad aufweisen, und eine Schwächung der kranialen Schenkelhalsbegrenzung muss strikt vermieden werden. Die korrekte Positionierung der Pfanne (45 Grad Inklination, 20 Grad Anteversion) ist die Voraussetzung für einen geringen Abrieb und Abb. 1: ReCap Oberflächenersatzprothese des Hüftgelenkes bei Coxa valga. ein gutes Langzeitergebnis. Ein schmerzhaftes Impingement zwischen Schenkelhals und Azetabulumrand lässt sich durch die korrekte Positionierung der Prothese erreichen und die Verwendung der größtmöglichen Prothese. Die Prothesengröße wird in der Regel durch das Azetabulum bestimmt. Ein ideales Implantat sollte daher eine möglichst geringe Wanddicke der Pfanne und der Hüftkopfkappe bei ausreichender Stabilität aufweisen und ein OP-Instrumentarium, welches ein sicheres Zielen und Positionieren von Pfanne und Hüftkopfkappe ermöglicht (s. Abb. 1). Uneinigkeit besteht darüber, ob Oberflächenersatzprothesen am Hüftgelenk auch bei Hüftkopfnekrose oder bei fortgeschrittenen Hüftkopfverformungen implantiert werden sollten. Da gerade diese Patienten in der Regel sehr jung sind und ein hohes Aktivitätsniveau haben, implantiere ich auch bei dieser anspruchsvollen Klientel eine ReCap, sofern keine Begleiterkrankungen vorliegen (s. Abb. 2). Auch aus den USA werden gute mittelfristige Ergebnisse für Patienten mit Hüftkopfnekrose mitgeteilt, insbesondere aus der Arbeitsgruppe Orthopädie im Profil 1/2006 9
12 K L I N I S C H E A N W E N D U N G Abb. 2: Grenzindikation einer ReCap bei einem 35jährigen Patienten mitposttraumatischer Coxarthrose. von Amstutz. Das entscheidende Argument bei diesen Patienten ist, dass ein Rückzug auf eine Schaftprothese jederzeit ohne wesentliche Nachteile (außer einer erneuten Operation) möglich ist. Es besteht aber die Notwendigkeit einer umfassenden Aufklärung des Patienten. Grundsätzlich muss bei der Aufklärung aller Patienten auf die fehlenden Langzeitergebnisse hingewiesen werden und den im Blut nachweisbaren Metallabrieb, dessen klinische Relevanz letztlich noch nicht geklärt ist. Auch sollte die Erwartungshaltung der Patienten angesprochen werden, da häufig Ansprüche an die Operation gestellt werden, die zwar möglich aber medizinisch bedenklich sind (z. B. Freeclimbing, Volleyball-Leistungssport, Fußball, etc). Ich implantiere die Prothese über den dorsalen Zugang in Seitenlage. Um eine ausreichende Übersicht zu haben und eine korrekte Protheseimplantation zu gewährleisten, verwende ich keinen sog. minimalinvasiven Zugang, sondern eine Schnittlänge von etwa 15 cm. Ich positioniere und bearbeite zuerst den Hüftkopf mindestens eine Fräse größer als geplant, setze dann die definitive Pfanne und passe abschließend den entsprechenden Hüftkopf an. Die abgetrennten Außenrotatoren werden refixiert. Postoperativ ist grundsätzlich eine sofortige Vollbelastung erlaubt, die Patienten verwenden aus Sicherheitsgründen für 14 Tage Unterarmgehstützen. Mit den Oberflächenersatzprothesen des Hüftgelenkes stehen sehr gute Alternativen zu den konventionellen Stilprothesen zur Verfügung, die die Indikationsstellung zur Prothese bei jüngeren Patienten erweitern und ggf. auch früher stellen lassen. Auch müssen die als Alternative zu aufwändigen und belastenden Umstellungsosteotomien des Azetabulum oder proximalen Femur berücksichtigt werden. Kontakt: Prof. Dr. Joachim Schmidt Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln Braunsfeld, D-Köln Tel.: 0221/ Fax: 0221/ joachim.schmidt@dfk-koeln.de Herausgeber: GIT VERLAG GmbH & Co. KG Bereichsleitung Dr. Heiko Baumgartner Tel.: 06151/ h.baumgartner@gitverlag.com Objektleitung Ralf Mateblowski Tel.: 06151/ r.mateblowski@gitverlag.com Redaktion/Verkauf Michael Reiter Tel.: 06151/ m.reiter@gitverlag.com Dr. Albert Sachs Tel.: 06151/ a.sachs@gitverlag.com Schriftführer Priv.-Doz. Dr. Georg Köster Redaktionsassistenz Christiane Rothermel Tel.: 06151/ c.rothermel@gitverlag.com IMPRESSUM Herstellung GIT VERLAG GmbH & Co. KG Dietmar Edhofer (Leitung) Nicole Schramm (Anzeigen) Elke Palzer (Litho) Sandra Rauch (Layout) Sonderdrucke Christine Mühl Tel.: 06151/ c.muehl@gitverlag.com GIT VERLAG GmbH & Co. KG Rösslerstraße Darmstadt Tel.: 06151/ Fax: 06151/ info@gitverlag.com Bankkonten Dresdner Bank Darmstadt Konto Nr.: /00, BLZ: Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2 vom 1. Oktober 2006 Druckauflage: Abonnement Einzelheft 13 zzgl. MwSt. und Porto Schüler und Studenten erhalten unter Vorlage einer gültigen Bescheinigung 50% Rabatt. Abonnementbestellungen gelten bis auf Widerruf; Kündigungen 6 Wochen vor Jahresende. Abonnementbestellungen können innerhalb einer Woche schriftlich widerrufen werden, Versandreklamationen sind nur innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen möglich. Originalarbeiten: Die namentlich gekennzeichneten Beiträge stehen in der Verantwortung des Autors. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion und mit Quellenangabe gestattet. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Abbildungen übernimmt der Verlag keine Haftung. Dem Verlag ist das ausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich eingeschränkte Recht eingeräumt, das Werk/den redaktionellen Beitrag in unveränderter Form oder bearbeiteter Form für alle Zwecke beliebig oft selbst zu nutzen oder Unternehmen, zu denen gesellschaftsrechtliche Beteiligungen bestehen, so wie Dritten zur Nutzung übertragen. Dieses Nutzungsrecht bezieht dich sowohl auf Print- wie elektronische Medien unter Einschluss des Internets wie auch auf Datenbanken/Datenträgern aller Art. Alle etwaig in dieser Ausgabe genannten und/oder gezeigten Namen, Bezeichnungen oder Zeichen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Druck Frotscher Druck GmbH Riedstr. 8, Darmstadt Printed in Germany 10 Orthopädie im Profil 1/2006
13
14 K L I N I S C H E A N W E N D U N G Knochensparende Behandlung der Coxarthrose bei jungen aktiven Patienten Vielen Kollegen sind die teilweise katastrophalen Ergebnisse und Standzeiten aus der Wagner-Cup Ära noch im Gedächtnis. Dies führte zu einem Verlassen der Methode für viele Jahre. Erst Derek Mc.Minn aus Birmingham hat zu Beginn der 90er Jahre diese Philosophie wieder entdeckt und verfeinert. Seine sehr guten Ergebnisse bei hoher Fallzahl ließen auch den deutschen Operateuren keine andere Wahl, als sich mit der OP-Methode zu beschäftigen. Nicht zuletzt auch aufgrund der ständig steigenden Nachfragen von Seiten der Patienten. Abb. 1: Joystickähnliches Zielgerät zur Positionierung der Durom Kappe Dr. Markus Guinard, Oberarzt der Orthopädischen Abteilung im Bethlehem Krankenhaus, Stolberg. In unserer Klinik implantieren wir mit gutem Erfolg seit vier Jahren Kappenprothesen. Begonnen haben wir mit der klassischen BHR/Corin, später benutzten wir die ASR Kappe von DePuy. Die Operationen erfolgten jeweils über den dorsalen Zugang. Als 2003 die Durom-Kappe der Firma Zimmer auf den Markt kam, überzeugte uns neben den tribologischen Vorteilen des Produkts, insbesondere die Möglichkeit über ein spezielles Zielinstrumentarium (maßgeblich entwickelt von Prof. Wirtz,Bonn) über den anterolateralen Zugang zu operieren. Dies ist für Operateure, die konventionelle Endoprothesen ausschließlich über den anterolateralen Zugang implantieren, von nicht zu unterschätzendem Vorteil. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist meines Erachtens ein exzellenter Support durch die Industrie, welcher bei dieser Methode bis zur Überwindung der nicht unerheblichen Learning curve, von entscheidender Bedeutung ist. Dieser war und ist bei uns durch den Außendienst der Firma Zimmer (Dipl-.Ing. Stefan Peters) jederzeit gegeben. Seit 2002 haben wir 45 Patienten mit einem Hip-Resurfacing versorgt. Davon 34 mit der Durom-Cup. Die Altersspanne lag zwischen 22 und 57 Jahren, davon 16 Frauen und 29 Männer. Ausschlusskriterien waren und sind neben bekannter Metallallergie und Osteoporose, insbesondere die Coxa vara sowie eine ausgeprägte Coxa valga. Desweiteren hochgradige Dysplasiecoxarthrosen, sowie mehrfach voroperierte Hüftgelenke. Eine gewisse Problematik stellen Hüftgelenke dar, bei denen ein starkes Missverhältnis zwischen Kopfgröße und Acetabulumdurchmesser besteht, welches zu einem Überfräsen des Acetabulums mit unnötigem Knochenverlust führen würde. Auch Hüftkopfnekrosen mit einem nekrotischen Areal von größer als 2 cm² wurden ausgeschlossen. Diese Patienten haben wir dann alternativ mit einer Kurzschaftprothese (Mayo/ Firma Zimmer) in Kombination mit einer Durom-Schale und Grosskopfmodul versorgt. An Komplikationen traten eine Schenkelhalsfraktur, sechs Wochen postoperativ, sowie eine Luxation, zwei Wochen postoperativ auf. Die Schenkelhalsfraktur entstand durch intraoperativ unbemerktes Notching des Schenkelhalses auf, die Luxation durch Fehlpositionierung der Pfanne. Beides ist sicher unter der Rubrik Learning curve zu verbuchen. Ansonsten war das postoperative Ergebnis gut. Alle Patienten konnten nachuntersucht werden. Danach waren 43 Patienten mit dem Ergebnis sehr zufrieden und würden den Eingriff wiederholen lassen. Durchgehend berichteten die Patienten über ein sehr stabiles Gefühl in der Hüfte mit sehr guter Range of Motion. Ein Patient klagte über Schmerzen über dem Trochanter mayor, die sich aber durch gezielte Stosswellenbehandlung deutlich lindern ließen. Die meisten Patienten konnten auch ihrer gewohnten sportlichen Betätigung wieder nachgehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Hip-Resurfacing bei gewisser Patientenselektion ein gutes Verfahren zur Behandlung der Coxarthrose bei jüngeren und aktiven Patienten darstellt, wobei natürlich Langzeitergebnisse abzuwarten sind. Kontakt: Dr. Markus Guinard Bethlehem Krankenhaus D-Stolberg Tel.: 02402/ Fax: 02402/ guinard@bethlehem.de 12 Orthopädie im Profil 1/2006
15 * Metal-on-Metal Bearings in Cementless Primary Total Hip Arthroplasty, Ch. P. Delaunay, MD, The Journal of Arthroplasty, Vol. 19, No. 8, Suppl. 3, 2004, pp ; The Argument for the Use of Metasul as an Articulation Surface in Total Hip Replacement, L. D. Dorr, MD; W. T. Long, MD; L. Sirianni, O-PAC; M. Campana, PAC; and Z. Wan, MD; Clinical Orthopaedics and Related Research, No. 429, pp Weitere Referenzen zum Thema «Metasul Technologie» finden Sie unter
16 N A V I G A T I O N Präzision made in Germany Navigation beim Oberflächenersatz Der Oberflächenersatz am Hüftgelenk hat in den letzten Jahren einen festen Platz zur Versorgung insbesondere jüngerer und aktiver Patienten gewonnen. Dabei überzeugt dieses Verfahren durch außerordentlich günstige funktionelle Ergebnisse und zumindest für das BHR System und Patienten unter 55 Jahren bessere mittelfristige Abb. 1 Intraoperative Navigation beim Oberflächenersatz Überlebensraten als beim konventionellen totalen Hüftgelenkersatz. Priv.-Doz. Dr. Thomas Hess, Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Gelenkchirurgie am Dreifaltigkeitshospital in Lippstadt Mittlerweile haben sich aber auch spezielle Komplikationen und Probleme dieser Versorgungsform gezeigt. Dabei stellt sich mehr und mehr heraus, dass für die meisten dieser Komplikationen die Komponentenpositionierung eine Rolle spielt. Bisher konnten folgende Zusammenhänge nachgewiesen werden: Für die Positionierung der Femurkappe: Begünstigung von Schenkelhalsfrakturen sowohl bei zu varischer als auch bei zu valgischer Positionierung. Auftreten eines ventralen Impingement bei zu weit dorsaler Positionierung der Kappe, insbesondere wenn bereits von Natur aus kein ausreichendes ventrales Offset bestand. ( Pistolengriffdeformität ) Für die Position der Pfanne: Vermehrter Implantatverschleiß bei fehlerhafter Inklination der Pfanne. Vorderer Leistenschmerz durch Psoassehnenreizung oder Impingement bei Vorstehen des scharfen Pfannenrandes durch ungenügende Anteversion. Dorsale Luxation oder Subluxation durch ungenügende Anteversion. Für beide Komponenten zusammen: Vermehrter Metallabrieb bei ungünstiger Position der beiden Komponenten zueinander. Angesichts dieser Fakten erschienen uns die bisher angebotenen mechanischen Zielhilfen für die femoralen Komponenten oder gar die freihändige Positionierung der Pfanne zu ungenau. Die Anwendung eines hochpräzisen Mess- und Orientierungs-Systems wie der Navigation ist dagegen gerade beim Oberflächenersatz besonders sinnvoll. Die Entwicklung ein eigenes Navigationsmodul für das BHR wurde von der Orthopädie Lipp- Abb. 2 a) Navigation der Femurkomponente, b) Navigation der Pfanne, c) Planung, intraoperative Anzeige und postoperatives Ergebnis eines navigierten Oberflächenersatzes 14 Orthopädie im Profil 1/2006
17 N A V I G A T I O N Abb. 3 a) und b) Navigation beim minimalinvasiven Oberflächenersatz stadt begleitet und klinisch erprobt. Bei diesem röntgenfreien System können intraoperativ sowohl die Kappe als auch die Pfanne virtuell auf einem computersimulierten Modell des Knochen positioniert werden, wobei die erforderlichen Winkel (Prothesen Schenkelhalswinkel, Anteversion- und Inklination) angezeigt werden. Ist der Operateur mit der gewählten Position zufrieden, zeigt das Gerät einen Zielstrahl an, der ihm die korrekte Positionierung des Implantates in der gewünschten Ausrichtung ermöglicht. Das System hat sich bei seiner Erprobung in der Orthopädie-Lippstadt als außerordentlich hilfreich und zuverlässig erwiesen. In nahezu 100 Fällen konnte für die femorale Komponente eine sehr gute Genauigkeit des Modells sowie eine leicht valgische Positionierung der Implantate ohne Verletzung der Kortikalis erreicht werden. Die Inzidenz von Schenkelhalsfrakturen konnte hierdurch deutlich gesenkt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, durch eine Erhöhung des ventralen Offset die Innenrotationsfähigkeit zu erhöhen und die Gefahr eines Impingement zu verringern. An der Pfanne konnte die gerade beim dorsalen Zugang gefährliche Fehlpositionierung durch zu geringe Inklination und Anteversion vermieden werden. Im Zusammenhang mit speziellen Instrumenten ermöglicht die Navigation vor allem den sicheren Einstieg in den minimalinvasiven Oberflächenersatz mit kleinen Zugängen. Die Verringerung der Schnittlänge als auch der Muskeldiszisionen sind speziell bei diesem Verfahren ein häufiger Wunsch von Operateuren und Patienten. Hierbei entstehen oftmals erhebliche Probleme durch die weiter dorsal gelegene Incision, was die Übersicht gerade am vorderen Pfannenrand herabsetzt und die Orientierung über die Pfannenposition stark beeinträchtigt. Die Navigation gibt hier zuverlässige Angaben über den vorderen Pfannenrand und die Pfannenposition. Somit können Incision und Ablösung von Muskulatur verringert werden, ohne dass hierunter die Genauigkeit der Komponentenpositionierung leidet. Kontakt: Priv.-Doz. Dr. Thomas Hess Dreifaltigkeitshospital, D Lippstadt Tel.: 02941/ Fax: 02941/ thomas.hess@dreifaltigkeits-hospital.de gmbh Orthopädie im Profil 1/
18 I M P L A N T A T I O N S T E C H N I K Wunsch und Wirklichkeit Tribologie und Implantationstechnik des Oberflächenersatzes Prof. Dr. Michael M. Morlock, Leiter des Instituts für Biomechanik, TU Hamburg-Harburg. Der Oberflächenersatz pathologisch veränderter Femurköpfe kommt seit mehreren Jahrzehnten in unterschiedlichen Varianten zur Anwendung. Die erste sog. Kappenprothese basierte auf Überlegungen von Smith-Petersen (1939). Sie wurde in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in größerem Umfang implantiert. Die Grundidee dieser Implantate, nur die defekte Gleitfläche des Femurkopfes zu ersetzen und dabei eine die Biomechanik verändernde Knochenresektion weitgehend zu vermeiden, wurde dann 20 Jahre später wieder aufgegriffen und entsprechend den inzwischen gesammelten Erfahrungen und Fortschritten in der Endoprothetik umgesetzt. obachtungszeiträumen Meldungen von höheren Lockerungsraten der Kappen im Vergleich zu totalen Endoprothesen (Wagner, 1979; Lapp et. al., 1981; Freeman und Bradley, 1983; Bell, 1985; Ferdini et. al., 1986). Nach ersten Vermutungen, dass diese Versagensfälle auf avaskuläre Nekrose zurückzuführen seien, häuften sich die Argumente für die Auffassung, dass aseptische Osteolyse das Hauptproblem derartiger Prothesendesigns darstellt (Howie 1990 & 1993). Polyäthylenabrieb kann durch die Verwendung von Hart- Hart Gelenkpaarungen (Metall oder Keramik) vermieden werden. Die Metall-Metall Artikulation im künstlichen Hüftgelenk wurde erstmals 1938 von Philip Wiles verwandt, also gut 20 Jahre bevor Sir John Charnley die Metall-Polyäthylenpaarung. McKee, Farrar, Ring, Sivash und Wagner waren weitere Pioniere im Bereich der Metall-Metall Paarungen, denen jedoch nicht sofort der endgültige Durchbruch gelang. Dies geschah für modulare Prothesen am Ende der 80er Jahre mit der Metasul- Paarung. Der letzte Meilenstein in der Wiederbelebung der Metall-Metall Paarung gelang Derek McMinn, dem die Neuentdeckung des Oberflächenersatzes zu verdanken ist. In den letzten Jahren ist ein starker Anstieg des Interesses am Oberflächenersatz zu beobachten, welcher durch die guten Langzeitergebnisse (Beaule et al., 2004, Daniel et al., 2004) sowie die Verwendung verbesserter Metall-Me- tall Implantate (4. Generation) erklärt werden kann. Tribologisch haben Großkopf Hart-Hart Paarungen mit optimierter Passung (Größe des Spalts zwischen Kopf und Pfanne) Vorteile da der Abrieb mit zunehmender Kopfgröße auf Grund der höheren Geschwindigkeit an der Grenzfläche abnimmt, was in mehreren Simulatorenstudien unter Beweis gestellt wurde (Smith et al., 2001). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass Metallpartikel wie jegliche Art von Partikel Körperreaktionen verursachen kann. Die Mehrzahl der entstehenden Metallpartikel wird zwar ausgeschieden, die im Körper verbleibenden Partikel können jedoch bereits nach kurzer Zeit in nahezu sämtlichen Organen nachgewiesen werden. Lokale Entzündungen, verzögerte Hypersensitivität sowie lymphozytäre Reaktionen können die Konsequenz sein. Diese Nebenwirkungen werden in verschiedenen Arbeiten von Willert und Mitarbeitern ausführlich dargestellt (2005). Derartige Nebenwirkungen wurden bei 0,05 0,5% der Patienten in unterschiedlichem Ausmaße berichtet. Da größere Probleme mit Abriebpartikeln der Metall-Metallpaarungen der zweiten Generation bis dato (noch?) nicht erkennbar sind und zu erwarten ist, dass mit den Prothesen der vierten Generation der Verschleiß (bei korrektem Einbau) noch einmal reduziert sein wird, so kann damit gerechnet werden, dass sich Metall-Metall Großkopfpaarungen auf Dauer und in zunehmendem Maße etablieren werden. Zwischen 1970 und 1980 wurden verschiedene Kappenendoprothesen entwickelt und implantiert (Freeman, 1978; Gerad, 1978; Tretani und Vaccarino, 1978; Rusdea und Struck, 1980). In Deutschland setzte sich hauptsächlich die sog. Wagner-Kappe durch (Wagner, 1975). Diese Prothese besteht aus einer Metallkappe für den Femurkopf und einer Pfanne aus Polyethylen. Konnten Wagner und andere Autoren nach kurzer Verlaufskontrolle noch über gute Ergebnisse berichten, mehrten sich nach längeren Be- Abb. 1: Schenkelhalsfraktur nach Oberflächenersatz mit Pseudarthrose an der Frakturzone im Femurkopf innerhalb des Implantates. 16 Orthopädie im Profil 1/2006
19 I M P L A N T A T I O N S T E C H N I K Abb. 2: Radiale Abweichung einer Oberflächenersatzprothese (links) und der dazu gehörigen Pfanne (rechts) von einer perfekten Kugel verursacht durch Randbelastung nach 350 Tagen im Patienten. Der Abrieb an Kopf und Pfanne entspricht den negativen Abweichungen. Oberflächenimplantate der dritten und vierten Generation werden hauptsächlich hybrid (pressfit Pfanne, zementierte Kappe) eingesetzt. Die Zementiertechnik am Femurkopf stellt hierbei (neben der Ausrichtung) eine Herausforderung für den Operateur dar, da die Art der Zementierung ungewohnt ist und das Erreichen des gewünschten Resultates post-operativ nicht erkennbar bzw. überprüfbar ist. Derzeit steht kein bildgebendes Verfahren zur Verfügung um die Grenzflächensituation innerhalb der Kappenprothese darzustellen. Eine optimale Einbausituation ist jedoch notwendige Voraussetzung für den Erfolg des Implantates. Schenkelhals- oder Kopffrakturenfrakturen innerhalb der ersten 3 8 Monate können zu einem großen Prozentsatz auf Einbaufaktoren (oder Patientenselektion) zurückgeführt werden. Um einen Überblick über die Versagensursachen speziell bei Frühversagern zu bekommen, wurde in Hamburg eine Studie zur Analyse versagter Oberflächenersatzprothesen initiiert. Im Rahmen dieser Studie wurden 179 Explantate erhalten, und die ersten Ergebnisse liegen vor, auch wenn die Analyse nicht abgeschlossen ist: Der Zementmantel und die Zementpenetration entsprachen in der Mehrzahl der Fälle nicht dem gewünschten Ergebnis. Mehr als 50% der Fälle zeigten keine ausgeprägte avaskuläre Nekrose sondern Zeichen einer zwei-zeitigen Fraktur (in mehreren Fällen wurden sogar Pseudarthrosen im Femurkopf innerhalb der Kappenprothesen gefunden; Abb. 1). Allgemein werden die folgenden Mechanismen für das Versagen von Oberflächenersatzprothesen aufgeführt (z. B. Goldberg, 2005 AAOS): unbedeckter befräster Knochen, ungenügende Setzung des Implantates, Verletzung des Schenkelhalses, Osteopenie und Zysten, Impingement des Kopfes, und Unfallgeschehen. Nach den vorläufigen Ergebnissen dieser Studie sollte ein weiterer Mechanismus berücksichtigt werden und zwar Mikrofrakturen im Kopf- oder Schenkelhalsbereich. Verursacht werden können diese Mikrofrakturen durch zu hohe bzw. falsch gerichtete Kräfte während der Implantation. Ein erhöhter Kraftaufwand kann nötig werden, wenn die Zementierungstechnik suboptimal ist, z.b. durch zu hohe Viskosität des Zementes. Mikrofrakturen können zum einen zu einer initialen Schwächung des Knochens führen und somit bei hohen Belastungen zur vollständigen Fraktur führen können. Zum anderen könnte dadurch in den Arealen proximal zu diesen Frakturzonen die Durchblutung gestört und avaskuläre Nekrosen begünstigt werden (Morlock et al., 2006). Die große Anzahl von Explantaten im Rahmen der bereits aufgeführten Studie ermöglicht auch eine Überprüfung der tribologischen Simulatorenergebnisse. Erste Ergebnisse dieser Analyse deuten an, dass die hohen Erwartungen zu Recht bestehen. Allerdings musste bei der Analyse der in-vivo Ergebnisse festgestellt werden, dass Grosskopf Metall-Metall Paarungen sehr empfindlich hinsichtlich der Ausrichtung der Komponenten sind: Gerät der Gelenkkopf während einer Aktivität in die Nähe des Pfannenrandes (wie z. B. bei einer zu steilen Pfanne) bricht der Schmierfilm zusammen und die Abriebsraten steigen je nach Ausmaß der Randbe- lastung teilweise dramatisch an (Faktor 15 bis 500; Abb. 2). Für die analysierten Pfannen konnte die Randbelastung eindeutig bei Pfanneninklinationen über 55 festgestellt werden (Abb. 2). Die Antetorsion spielt ebenfalls eine äußerst wichtige Rolle, konnte jedoch auf Grund der unstandardisierten Röntgenbilder nicht genau bestimmt werden. Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass moderne Metall-Metall Hüftoberflächenersatzprothesen auf Grund des großen Kopfdurchmessers äußerst gute Verschleißeigenschaften aufweisen wenn sie korrekt implantiert werden. Frühversager sind in vielen Fällen auf mangelnde Implantationstechnik zurückzuführen. Hierbei scheinen besonders die Zementiertechnik und die Größe der Implantationskräfte eine wichtige Rolle zu spielen. Die aufgeführte Studie wird von BioMet, Corin, DePuy, Smith&Nephew und Zimmer finanziell unterstützt. Eine Literaturliste ist auf Anfrage von den Autoren erhältlich. Co-Autoren: W. Rüther, M. Hahn, G. Delling, Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg Kontakt: Prof. Dr. Michael M. Morlock TU Hamburg-Harburg D-Hamburg Tel.: 040/ (3253) Fax: 040/ morlock@tuhh.de Orthopädie im Profil 1/
Entwicklung des Hüftoberflächenersatzes.
 Entwicklung des Hüftoberflächenersatzes. Erstmals griff McMinn nach Wagner und Amstutz die Idee des modernen Oberflächenersatzes im Jahre 1989 wieder auf. McMinn nahm sich die Erfahrungswerte, die seine
Entwicklung des Hüftoberflächenersatzes. Erstmals griff McMinn nach Wagner und Amstutz die Idee des modernen Oberflächenersatzes im Jahre 1989 wieder auf. McMinn nahm sich die Erfahrungswerte, die seine
Warum einen Zahn ziehen, wenn man ihn auch überkronen kann
 Patienteninformation Oberflächenersatz am Hüftgelenk n. McMinn Der Oberflächenersatz am Hüftgelenk ist eine knochenschonende Alternative zur konventionellen Versorgung ihres Hüftleidens. Oberflächenersatz
Patienteninformation Oberflächenersatz am Hüftgelenk n. McMinn Der Oberflächenersatz am Hüftgelenk ist eine knochenschonende Alternative zur konventionellen Versorgung ihres Hüftleidens. Oberflächenersatz
Standards in der Knieendoprothetik
 Standards in der Knieendoprothetik Dr. Lukas Niggemann Ltd. Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum Ruhr-Universität Bochum Gonarthrose
Standards in der Knieendoprothetik Dr. Lukas Niggemann Ltd. Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum Ruhr-Universität Bochum Gonarthrose
Einsatz von Hüft-Totalendoprothesen. Patienteninformation
 Einsatz von Hüft-Totalendoprothesen Patienteninformation Liebe Patientin, lieber Patient, seit Monaten, teilweise seit Jahren, klagen Sie über immer wiederkehrende Schmerzen im Hüftgelenk, wobei diese
Einsatz von Hüft-Totalendoprothesen Patienteninformation Liebe Patientin, lieber Patient, seit Monaten, teilweise seit Jahren, klagen Sie über immer wiederkehrende Schmerzen im Hüftgelenk, wobei diese
Endoprothetik, Arthroskopische Operationen, Minimal-invasive Wirbelsäulenchirurgie, Fußchirurgie
 Endoprothetik, Arthroskopische Operationen, Minimal-invasive Wirbelsäulenchirurgie, Fußchirurgie Patienteninformation Das künstliche Hüftgelenk Allgemeines Das Hüftgelenk wird weltweit am häufigsten künstlich
Endoprothetik, Arthroskopische Operationen, Minimal-invasive Wirbelsäulenchirurgie, Fußchirurgie Patienteninformation Das künstliche Hüftgelenk Allgemeines Das Hüftgelenk wird weltweit am häufigsten künstlich
z STANDARDENDOPROTHESE
 Hüftendoprothesen z 47 z STANDARDENDOPROTHESE Eine 67-jährige Patientin berichtet... Als ich zum ersten Mal Schmerzen in meinen Hüftgelenken hatte, war ich ungefähr 57 Jahre alt. Im Verlauf der dann folgenden
Hüftendoprothesen z 47 z STANDARDENDOPROTHESE Eine 67-jährige Patientin berichtet... Als ich zum ersten Mal Schmerzen in meinen Hüftgelenken hatte, war ich ungefähr 57 Jahre alt. Im Verlauf der dann folgenden
Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3
![Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3 Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3](/thumbs/98/135702962.jpg) 21 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Ergebnisse 4.1.1 Untersuchungsgruppen In einer prospektiven Studie wurden die Patienten erfasst, die im Zeitraum von 1990 bis 1994 mit ABG I- und Zweymüller SL-Hüftendoprothesen
21 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Ergebnisse 4.1.1 Untersuchungsgruppen In einer prospektiven Studie wurden die Patienten erfasst, die im Zeitraum von 1990 bis 1994 mit ABG I- und Zweymüller SL-Hüftendoprothesen
Endoprothetik / Gelenkersatz
 Endoprothetik / Gelenkersatz Die Anzahl der orthopädischen Erkrankungen wird in den kommenden Jahrzehnten aufgrund des demographischen Wandels mit steigender Lebenserwartung aber auch infolge zivilisationsbedingter
Endoprothetik / Gelenkersatz Die Anzahl der orthopädischen Erkrankungen wird in den kommenden Jahrzehnten aufgrund des demographischen Wandels mit steigender Lebenserwartung aber auch infolge zivilisationsbedingter
5 Nachuntersuchung und Ergebnisse
 Therapie bei ipsilateraler Hüft- u. Knie-TEP Anzahl n HTEP-Wechsel Femurtotalersatz konservative Therapie Diagramm 4: Verteilung der Therapieverfahren bei ipsilateraler HTEP und KTEP 4.7. Komplikationen
Therapie bei ipsilateraler Hüft- u. Knie-TEP Anzahl n HTEP-Wechsel Femurtotalersatz konservative Therapie Diagramm 4: Verteilung der Therapieverfahren bei ipsilateraler HTEP und KTEP 4.7. Komplikationen
.. Muller Geradschaft. Hüftschaft zementiert Operationstechnik
 .. Hüftschaft zementiert Operationstechnik .. Inhalt Einleitung und Produktbeschreibung 4 Indikationen für den Einsatz des Müller Geradschaftes 4 Kontraindikationen für den Einsatz des Müller Geradschaftes
.. Hüftschaft zementiert Operationstechnik .. Inhalt Einleitung und Produktbeschreibung 4 Indikationen für den Einsatz des Müller Geradschaftes 4 Kontraindikationen für den Einsatz des Müller Geradschaftes
ist auch immer sinnvoll Die Indikation zur Endoprothese
 Das Mögliche M ist auch immer sinnvoll Die Indikation zur Endoprothese Matthias Zurstegge Orthopädische Klinik - Zentrum für f r Gelenkersatz Asklepios Stadtklinik Bad TölzT Das Mögliche M ist auch immer
Das Mögliche M ist auch immer sinnvoll Die Indikation zur Endoprothese Matthias Zurstegge Orthopädische Klinik - Zentrum für f r Gelenkersatz Asklepios Stadtklinik Bad TölzT Das Mögliche M ist auch immer
Update: Hüft-Totalendoprothesen-Chirurgie. PD Dr Hannes A Rüdiger Leitender Arzt - Hüftchirurgie
 Update: Hüft-Totalendoprothesen-Chirurgie PD Dr Hannes A Rüdiger Leitender Arzt - Hüftchirurgie Girdlestone 1945: Behandlung der Hüftarthrose 1924-1940 22 Patienten mit Resektions-Arthroplastien Resultate
Update: Hüft-Totalendoprothesen-Chirurgie PD Dr Hannes A Rüdiger Leitender Arzt - Hüftchirurgie Girdlestone 1945: Behandlung der Hüftarthrose 1924-1940 22 Patienten mit Resektions-Arthroplastien Resultate
Information zu Ihrer Hüft-Operation. Kurzschaft
 Information zu Ihrer Hüft-Operation Kurzschaft Wie funktioniert unsere Hüfte? Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und das zweitgrößte Gelenk im menschlichen Körper. Der Oberschenkel - knochen und das Becken
Information zu Ihrer Hüft-Operation Kurzschaft Wie funktioniert unsere Hüfte? Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und das zweitgrößte Gelenk im menschlichen Körper. Der Oberschenkel - knochen und das Becken
Dr. med. Dirk Rose. Das neue Hüftgelenk. Die Qual der Wahl: das Prothesenmodell
 Das neue Hüftgelenk Wenn die Knorpelschicht im Bereich der Hüfte verletzt oder nicht mehr vorhanden ist, kann nach heutigem Stand der Wissenschaft nur noch eine Hüftprothese die Beweglichkeit wiederherstellen.
Das neue Hüftgelenk Wenn die Knorpelschicht im Bereich der Hüfte verletzt oder nicht mehr vorhanden ist, kann nach heutigem Stand der Wissenschaft nur noch eine Hüftprothese die Beweglichkeit wiederherstellen.
Rund um das künstliche Hüftgelenk
 Rund um das künstliche Hüftgelenk Praxis für Orthopädie Dr. med. Karl Biedermann Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie Central Horgen Seestrasse 126 CH 8810 Horgen Tel. 044 728 80 70 info@gelenkchirurgie.ch
Rund um das künstliche Hüftgelenk Praxis für Orthopädie Dr. med. Karl Biedermann Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie Central Horgen Seestrasse 126 CH 8810 Horgen Tel. 044 728 80 70 info@gelenkchirurgie.ch
Standards moderner Hüftendoprothetik
 Standards moderner Hüftendoprothetik Stephanie Verhoeven Oberärztin in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum Ruhr-Universität Bochum Coxarthrose
Standards moderner Hüftendoprothetik Stephanie Verhoeven Oberärztin in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum Ruhr-Universität Bochum Coxarthrose
SP-CL Anatomisch angepasstes Hüft-System, zementfrei
 SP-CL Anatomisch angepasstes Hüft-System, zementfrei +++ Verkaufsstart Februar 2015 +++ Verkaufsstart Februar 2015 +++ The most important advancement in total hip arthroplasty in the last 50 years has
SP-CL Anatomisch angepasstes Hüft-System, zementfrei +++ Verkaufsstart Februar 2015 +++ Verkaufsstart Februar 2015 +++ The most important advancement in total hip arthroplasty in the last 50 years has
Rückruf des ASR XL Acetabulumsystems und ASR Hüftoberflächenersatzsystems von DePuy Patienteninformation
 Rückruf des ASR XL Acetabulumsystems und ASR Hüftoberflächenersatzsystems von DePuy Patienteninformation Bei DePuy haben die Sicherheit und Gesundheit unserer Patienten oberste Priorität. Daher evaluieren
Rückruf des ASR XL Acetabulumsystems und ASR Hüftoberflächenersatzsystems von DePuy Patienteninformation Bei DePuy haben die Sicherheit und Gesundheit unserer Patienten oberste Priorität. Daher evaluieren
Wenn die Hüfte schmerzt..
 Wenn die Hüfte schmerzt.. von der Spreizhose bis zur Hüftprothese Dr. W. Cordier Chefarzt der Orthopädischen Klinik St. Josef - Wuppertal - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Spreizhose Hüftprothese
Wenn die Hüfte schmerzt.. von der Spreizhose bis zur Hüftprothese Dr. W. Cordier Chefarzt der Orthopädischen Klinik St. Josef - Wuppertal - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Spreizhose Hüftprothese
.. Muller II. Pfanne zementiert Operationstechnik
 Pfanne zementiert Operationstechnik Inhalt Einleitung und Produktbeschreibung 4 Biomechanisches Konzept 4 Indikationen für den Einsatz der Müller II Pfanne 4 Kontraindikation für den Einsatz der Müller
Pfanne zementiert Operationstechnik Inhalt Einleitung und Produktbeschreibung 4 Biomechanisches Konzept 4 Indikationen für den Einsatz der Müller II Pfanne 4 Kontraindikation für den Einsatz der Müller
Hüft-TP zu oft? zu teuer? Hausarztfortbildung
 Hüft-TP zu oft? zu teuer? Hausarztfortbildung 15.11.2018 Google.ch Zu oft zu teuer Operation 42 500 000 in 0.45 Sek!!! Presse: unnötige Eingriffe Aargauer Zeitung 10.7.2017 2015 19451 Hüft TP in der Schweiz
Hüft-TP zu oft? zu teuer? Hausarztfortbildung 15.11.2018 Google.ch Zu oft zu teuer Operation 42 500 000 in 0.45 Sek!!! Presse: unnötige Eingriffe Aargauer Zeitung 10.7.2017 2015 19451 Hüft TP in der Schweiz
Hüfttotalprothesen. Prof. Dr. med. K. A. Siebenrock. Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie & Traumatologie Inselspital Bern
 Hüfttotalprothesen! Prof. Dr. med. K. A. Siebenrock Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie & Traumatologie Inselspital Bern Kontakt: klaus.siebenrock@insel.ch Zukunft Demographie in Europa Anteil
Hüfttotalprothesen! Prof. Dr. med. K. A. Siebenrock Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie & Traumatologie Inselspital Bern Kontakt: klaus.siebenrock@insel.ch Zukunft Demographie in Europa Anteil
Femoroacetabuläres Impingement
 Femoroacetabuläres Impingement Femoroacetabuläres Impingement Einklemmung zwischen den beiden Gelenkpartnern des Hüftgelenks Femur Acetabulum Ausgelöst entweder durch zu viel Knochen am Femur oder Acetabulum
Femoroacetabuläres Impingement Femoroacetabuläres Impingement Einklemmung zwischen den beiden Gelenkpartnern des Hüftgelenks Femur Acetabulum Ausgelöst entweder durch zu viel Knochen am Femur oder Acetabulum
*smith&nephew. Patienteninformation. NANOS Kurzschaftendoprothese für die Hüfte
 *smith&nephew Patienteninformation NANOS Kurzschaftendoprothese für die Hüfte Was ist Arthrose? Arthrose bezeichnet den allmählichen Verschleiß der Gelenkoberflächen, d.h. die schützende Knorpelschicht
*smith&nephew Patienteninformation NANOS Kurzschaftendoprothese für die Hüfte Was ist Arthrose? Arthrose bezeichnet den allmählichen Verschleiß der Gelenkoberflächen, d.h. die schützende Knorpelschicht
Es beginnt in der Leiste: Verschleiß des Hüftgelenks
 Es beginnt in der Leiste: Verschleiß des Hüftgelenks WAZ-Nachtforum Medizin, Bochum, 13. Oktober 2011 Prof. Dr. Rüdiger Smektala Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum ität ik
Es beginnt in der Leiste: Verschleiß des Hüftgelenks WAZ-Nachtforum Medizin, Bochum, 13. Oktober 2011 Prof. Dr. Rüdiger Smektala Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum ität ik
Was ist ein Kniegelenkersatz? Abb.: Gesundes Kniegelenk
 Was ist ein Kniegelenkersatz? Aufbau des Kniegelenks. Abb.: Gesundes Kniegelenk Wenn wir gehen, uns strecken oder beugen, ist unser größtes Gelenk aktiv das Kniegelenk. Es stellt die bewegliche Verbindung
Was ist ein Kniegelenkersatz? Aufbau des Kniegelenks. Abb.: Gesundes Kniegelenk Wenn wir gehen, uns strecken oder beugen, ist unser größtes Gelenk aktiv das Kniegelenk. Es stellt die bewegliche Verbindung
Aesculap Orthopaedics Patienteninformation
 Aesculap Orthopaedics Patienteninformation Hüftoperation mit dem OrthoPilot Das Navigationssystem OrthoPilot ermöglicht eine optimierte Implantation des künstlichen Hüftgelenks Patienteninformation Hüftoperation
Aesculap Orthopaedics Patienteninformation Hüftoperation mit dem OrthoPilot Das Navigationssystem OrthoPilot ermöglicht eine optimierte Implantation des künstlichen Hüftgelenks Patienteninformation Hüftoperation
Das künstliche Hüftgelenk
 Traumatologisch- Orthopädisches Zentrum West des St. Elisabeth Krankenhauses Geilenkirchen Das künstliche Hüftgelenk Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Dr. med. Achim Dohmen, Chefarzt der Klinik
Traumatologisch- Orthopädisches Zentrum West des St. Elisabeth Krankenhauses Geilenkirchen Das künstliche Hüftgelenk Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Dr. med. Achim Dohmen, Chefarzt der Klinik
Die gesunde Hüfte. Hüftgelenkverschleiß - Individuelle Hüftgelenkprothese - Kurzschaftprothese - Prothese im höheren Lebensalter
 In der Chirurgischen Klinik des St. Martinus Hospitals wird der Schwerpunkt Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie angeboten. Dazu zählt ein umfassendes Spektrum an endoprothetischen Eingriffen. Hierbei
In der Chirurgischen Klinik des St. Martinus Hospitals wird der Schwerpunkt Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie angeboten. Dazu zählt ein umfassendes Spektrum an endoprothetischen Eingriffen. Hierbei
KNIE & HÜFTZENTRUM FÜR ENDOPROTHETIK MARIA-HILF. Klinik für Orthopädie & Unfallchirurgie
 KOMPETENZ ZENTRUM FÜR ENDOPROTHETIK Klinik für Orthopädie & Unfallchirurgie KOMPETENZ ZENTRUM FÜR ENDOPROTHETIK Liebe Patienten, Das Knie und Hüft Zentrum Maria-Hilf ist ein KompetenzZentrum für Computer
KOMPETENZ ZENTRUM FÜR ENDOPROTHETIK Klinik für Orthopädie & Unfallchirurgie KOMPETENZ ZENTRUM FÜR ENDOPROTHETIK Liebe Patienten, Das Knie und Hüft Zentrum Maria-Hilf ist ein KompetenzZentrum für Computer
Case-Report K. Perner
 421 Case-Report K. Perner Fall 1: Als Folge einer OS-Fraktur in der Jugend kam es beim Patienten zu einer bajonettförmigen Deformierung des rechten Femurs im proximalen Drittel. Die daraus resultierende
421 Case-Report K. Perner Fall 1: Als Folge einer OS-Fraktur in der Jugend kam es beim Patienten zu einer bajonettförmigen Deformierung des rechten Femurs im proximalen Drittel. Die daraus resultierende
Degenerative Gelenkerkrankungen und Endoprothetik
 Arthrose Degenerative Gelenkerkrankungen und Endoprothetik häufigste Erkrankung des älteren Menschen mit erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung Univ.-Prof. Dr. med. H. R. Merk 250.000 Hüftprothesen/Jahr
Arthrose Degenerative Gelenkerkrankungen und Endoprothetik häufigste Erkrankung des älteren Menschen mit erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung Univ.-Prof. Dr. med. H. R. Merk 250.000 Hüftprothesen/Jahr
Vorgehen bei Infektion oder Versagen eines künstlichen Kniegelenks. Mögliche Komplikationen
 Vorgehen bei Infektion oder Versagen eines künstlichen Kniegelenks Mögliche Komplikationen Komplikationsursachen Was sind die Gründe für ein Versagen eines künstlichen Kniegelenks? Die häufigsten Ursachen
Vorgehen bei Infektion oder Versagen eines künstlichen Kniegelenks Mögliche Komplikationen Komplikationsursachen Was sind die Gründe für ein Versagen eines künstlichen Kniegelenks? Die häufigsten Ursachen
Primäre Hüftgelenkendoprothese. Wechseloperationen. HELIOS Klinikum Berlin-Buch. Patienteninformation zu Krankheitsbild, Diagnose und Therapie
 HELIOS Klinikum Berlin-Buch Primäre Hüftgelenkendoprothese und Wechseloperationen Patienteninformation zu Krankheitsbild, Diagnose und Therapie (030) 94 01-123 45 Endoprothetik- Hotline HELIOS Klinikum
HELIOS Klinikum Berlin-Buch Primäre Hüftgelenkendoprothese und Wechseloperationen Patienteninformation zu Krankheitsbild, Diagnose und Therapie (030) 94 01-123 45 Endoprothetik- Hotline HELIOS Klinikum
Zukunft Hüft- und Knieendoprothetik - zementlose Technik
 Zukunft Hüft- und Knieendoprothetik - zementlose Technik Abteilung für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Asklepios Klinik Wandsbek Dr. Bogislav Herzfeldt 1 Endoprothetik des Kniegelenkes Deutliche
Zukunft Hüft- und Knieendoprothetik - zementlose Technik Abteilung für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Asklepios Klinik Wandsbek Dr. Bogislav Herzfeldt 1 Endoprothetik des Kniegelenkes Deutliche
Gesicherte Indikation, Aufklärung, Vorbereitung, Dokumentation
 Gesicherte Indikation, Aufklärung, Vorbereitung, Dokumentation Dietmar Pierre König IQN 63. Fortbildungsveranstaltung - Hüftendoprothetik Primärendoprothetik - Anamnese - Klinische Untersuchung - Labordiagnostik
Gesicherte Indikation, Aufklärung, Vorbereitung, Dokumentation Dietmar Pierre König IQN 63. Fortbildungsveranstaltung - Hüftendoprothetik Primärendoprothetik - Anamnese - Klinische Untersuchung - Labordiagnostik
Das künstliche Kniegelenk
 Das künstliche Kniegelenk M. Vonderschmitt 17. Juni 2009 Das künstliche Kniegelenk Erstoperation Wechseloperation Umwandlungsoperation Komplikationsmanagement Fragen? Das künstliche Kniegelenk Angesichts
Das künstliche Kniegelenk M. Vonderschmitt 17. Juni 2009 Das künstliche Kniegelenk Erstoperation Wechseloperation Umwandlungsoperation Komplikationsmanagement Fragen? Das künstliche Kniegelenk Angesichts
Lukas Niggemann. Arthrosetag Lebensqualität im Zentrum ärztlicher Überlegungen Moderne Endoprothetik des Kniegelenkes
 Knie-Totalendoprothese Lebensqualität im Zentrum ärztlicher Überlegungen Moderne Endoprothetik des Kniegelenkes Arthrosetag 2011 Lukas Niggemann Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum
Knie-Totalendoprothese Lebensqualität im Zentrum ärztlicher Überlegungen Moderne Endoprothetik des Kniegelenkes Arthrosetag 2011 Lukas Niggemann Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum
Das künstliche Kniegelenk: Schlitten- oder Totalendoprothese
 Das künstliche Kniegelenk: Schlitten- oder Totalendoprothese PD Dr. med. Lutz Arne Müller Zeitlicher Ablauf Knieprothese 4-6 Wochen vor Operation: Aufklärung Orthopäde / Terminfestlegung 2 Wochen vor Operation:
Das künstliche Kniegelenk: Schlitten- oder Totalendoprothese PD Dr. med. Lutz Arne Müller Zeitlicher Ablauf Knieprothese 4-6 Wochen vor Operation: Aufklärung Orthopäde / Terminfestlegung 2 Wochen vor Operation:
Der interessante Fall: Standardchaos?
 AWMF-Arbeitskreis Ärzte und Juristen Tagung 15./16.11.2013 in Bremen Der interessante Fall: Standardchaos? Dr. iur. Volker Hertwig 1 Patientin: 67 Jahre alt Diagnose: Coxathrose rechts Therapie: Hüft-TEP
AWMF-Arbeitskreis Ärzte und Juristen Tagung 15./16.11.2013 in Bremen Der interessante Fall: Standardchaos? Dr. iur. Volker Hertwig 1 Patientin: 67 Jahre alt Diagnose: Coxathrose rechts Therapie: Hüft-TEP
Das neue Hüftgelenk. Hinweise und Tipps für Patienten KLINIKUM WESTFALEN
 KLINIKUM WESTFALEN Das neue Hüftgelenk Hinweise und Tipps für Patienten Klinikum Westfalen GmbH Knappschaftskrankenhaus Dortmund www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
KLINIKUM WESTFALEN Das neue Hüftgelenk Hinweise und Tipps für Patienten Klinikum Westfalen GmbH Knappschaftskrankenhaus Dortmund www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels
 Qualitätspartner der PKV PARTNER Privaten der Verband Krankenversicherung e.v. I L A TÄT U & EIGENDARSTELLUNG DES HAUSES: MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels Fachklinik für Orthopädie und Orthopädische
Qualitätspartner der PKV PARTNER Privaten der Verband Krankenversicherung e.v. I L A TÄT U & EIGENDARSTELLUNG DES HAUSES: MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels Fachklinik für Orthopädie und Orthopädische
Aesculap. Patienteninformation Hüftoperation mit dem OrthoPilot Navigationssystem
 Aesculap Patienteninformation Hüftoperation mit dem OrthoPilot Navigationssystem Der künstliche Hüftgelenkersatz zählt zu einem der erfolgreichsten operativen Verfahren in der Medizin. Jährlich werden
Aesculap Patienteninformation Hüftoperation mit dem OrthoPilot Navigationssystem Der künstliche Hüftgelenkersatz zählt zu einem der erfolgreichsten operativen Verfahren in der Medizin. Jährlich werden
Navigation - Klinische Ergebnisse
 AE-Kurs Knie Ofterschwang Pleser M, Wörsdörfer O. Klinikum Fulda gag A. Gesamtergebnisse Fulda B. Navitrack TM -Multicenterstudie (Teilergebnisse Fulda) C. Ergebnisse: randomisierte Studie zum Einfluss
AE-Kurs Knie Ofterschwang Pleser M, Wörsdörfer O. Klinikum Fulda gag A. Gesamtergebnisse Fulda B. Navitrack TM -Multicenterstudie (Teilergebnisse Fulda) C. Ergebnisse: randomisierte Studie zum Einfluss
Der richtige Zeitpunkt für die Operation ist in der Regel dann gekommen, wenn alle anderen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind.
 Die Schulterprothese Das Kunstgelenk der Schulter hat in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung erlebt. Während es in den Anfangszeiten vor allem ein Platzhalter war zur Schmerzreduktion, ist es
Die Schulterprothese Das Kunstgelenk der Schulter hat in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung erlebt. Während es in den Anfangszeiten vor allem ein Platzhalter war zur Schmerzreduktion, ist es
Zimmer Sidus Schaftfreie Schulterprothese Knochenerhaltend mit stabiler Verankerung
 Zimmer Sidus Schaftfreie Schulterprothese Knochenerhaltend mit stabiler Verankerung Sidus Schaftfreie Schulterprothese Mit der neuen Sidus Schaftfreien Schulterprothese spielt Zimmer auch weiterhin die
Zimmer Sidus Schaftfreie Schulterprothese Knochenerhaltend mit stabiler Verankerung Sidus Schaftfreie Schulterprothese Mit der neuen Sidus Schaftfreien Schulterprothese spielt Zimmer auch weiterhin die
Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel (Modul 17/3) Hüft-Endoprothesen. Jahresauswertung 2014 BASISAUSWERTUNG
 Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung Hüft-Endoprothesen Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel (Modul 17/3) Jahresauswertung 2014 BASISAUSWERTUNG 0 Geschäftsstelle Qualitätssicherung
Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung Hüft-Endoprothesen Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel (Modul 17/3) Jahresauswertung 2014 BASISAUSWERTUNG 0 Geschäftsstelle Qualitätssicherung
Orthopädengemeinschaft Amberg-Sulzbach
 Hüft-TEP Hüft-Total-Endo-Prothese Ersatz des abgenützten oder funktionsgestörten Hüftgelenkes Hüftgelenkarthrose Künstliches Hüftgelenk Lieber Patient/in, sie leiden an einer Hüftgelenkarthrose. Hierbei
Hüft-TEP Hüft-Total-Endo-Prothese Ersatz des abgenützten oder funktionsgestörten Hüftgelenkes Hüftgelenkarthrose Künstliches Hüftgelenk Lieber Patient/in, sie leiden an einer Hüftgelenkarthrose. Hierbei
Die Hemiarthroplastik des Knies
 Die Hemiarthroplastik des Knies Ersatz des inneren oder äusseren Anteils des Kniegelenks Praxis für Orthopädie Dr. med. Karl Biedermann Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie Central Horgen Seestrasse
Die Hemiarthroplastik des Knies Ersatz des inneren oder äusseren Anteils des Kniegelenks Praxis für Orthopädie Dr. med. Karl Biedermann Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie Central Horgen Seestrasse
Tribologie Forum Gleitflächen der Hüftendoprothetik Programm
 DRK Kliniken Berlin Westend Tribologie Forum Gleitflächen der Hüftendoprothetik Programm Freitag, 24. Juni 2011, Großer Hörsaal DRK Kliniken Berlin Westend, Spandauer Damm 130 E i n l a d u n g Vorwort
DRK Kliniken Berlin Westend Tribologie Forum Gleitflächen der Hüftendoprothetik Programm Freitag, 24. Juni 2011, Großer Hörsaal DRK Kliniken Berlin Westend, Spandauer Damm 130 E i n l a d u n g Vorwort
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
3. Ergebnisse Geschlechts- und Altersverteilung
 23 3. Ergebnisse 3.1. Geschlechts- und Altersverteilung In der vorliegenden Studie wurden 100 übergewichtige Patienten mittels Gastric Banding behandelt, wobei es sich um 22 männliche und 78 weibliche
23 3. Ergebnisse 3.1. Geschlechts- und Altersverteilung In der vorliegenden Studie wurden 100 übergewichtige Patienten mittels Gastric Banding behandelt, wobei es sich um 22 männliche und 78 weibliche
Der Oberschenkelhalsbruch
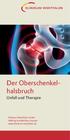 KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
Aesculap Orthopaedics Patienteninformation. Knieoperation mit dem OrthoPilot
 Aesculap Orthopaedics Patienteninformation Knieoperation mit dem OrthoPilot Patienteninformation Knieoperation mit dem OrthoPilot Was ist der OrthoPilot OrthoPilot ist ein computergestütztes Navigationssystem,
Aesculap Orthopaedics Patienteninformation Knieoperation mit dem OrthoPilot Patienteninformation Knieoperation mit dem OrthoPilot Was ist der OrthoPilot OrthoPilot ist ein computergestütztes Navigationssystem,
Sport nach großen Gelenkeingriffen Rehabilitation und Prävention von Kreuzbandrissen. 20. Pauwels-Symposium
 20. Pauwels-Symposium Sport nach großen Gelenkeingriffen Rehabilitation und Prävention von Kreuzbandrissen Freitag, 6. November 2015 Konferenzzentrum der AGIT, Aachen Liebe Kolleginnen und Kollegen, verbesserte
20. Pauwels-Symposium Sport nach großen Gelenkeingriffen Rehabilitation und Prävention von Kreuzbandrissen Freitag, 6. November 2015 Konferenzzentrum der AGIT, Aachen Liebe Kolleginnen und Kollegen, verbesserte
Die Hüftprothese Warum? Wann? Wie? Und danach?
 Die Hüftprothese Warum? Wann? Wie? Und danach? Wann wird die Indikation zur Hüftprothese gestellt? Die Implantation einer Hüftprothese ist heute ein Routineeingriff. Ihnen wurde geraten, sich ein künstliches
Die Hüftprothese Warum? Wann? Wie? Und danach? Wann wird die Indikation zur Hüftprothese gestellt? Die Implantation einer Hüftprothese ist heute ein Routineeingriff. Ihnen wurde geraten, sich ein künstliches
E x c e e d A B T P f a n n e n s y s t e m. P r o d u k t i n f o r m a t i o n
 E x c e e d A B T P f a n n e n s y s t e m P r o d u k t i n f o r m a t i o n Exceed ABT Pfannensystem In Anlehnung an unseren Ansatz der Komplettversorgung vereint das höchst vielseitige Exceed ABT
E x c e e d A B T P f a n n e n s y s t e m P r o d u k t i n f o r m a t i o n Exceed ABT Pfannensystem In Anlehnung an unseren Ansatz der Komplettversorgung vereint das höchst vielseitige Exceed ABT
Teilbelastung nach hüftgelenksnaher Fraktur- Sinn oder Unsinn?
 Teilbelastung nach hüftgelenksnaher Fraktur- Sinn oder Unsinn? Dr. med. Alexander Eickhoff Assistenzarzt Bevölkerungsentwicklung 60 % Stürze ca. 6 Mio. p. a. > 30% der über 65 Jährigen betroffen 10 % behandlungsbedürftige
Teilbelastung nach hüftgelenksnaher Fraktur- Sinn oder Unsinn? Dr. med. Alexander Eickhoff Assistenzarzt Bevölkerungsentwicklung 60 % Stürze ca. 6 Mio. p. a. > 30% der über 65 Jährigen betroffen 10 % behandlungsbedürftige
Kontroversen in der Hüftprothetik
 Kontroversen in der Hüftprothetik Bei der Hüft-Totalprothese sind nach wie vor viele Fragen offen und werden teilweise sehr kontrovers diskutiert. Der folgende Abschnitt zeigt Ihnen einige der heutigen
Kontroversen in der Hüftprothetik Bei der Hüft-Totalprothese sind nach wie vor viele Fragen offen und werden teilweise sehr kontrovers diskutiert. Der folgende Abschnitt zeigt Ihnen einige der heutigen
Das bionische Hüftendoprothesensystem J. Scholz, W. Thomas
 177 Das bionische Hüftendoprothesensystem J. Scholz, W. Thomas Bionische Systeme versuchen, Beobachtungen aus der Natur in technische Lösungen umzusetzen. Dieser Grundgedanke war auch bei der Konzeption
177 Das bionische Hüftendoprothesensystem J. Scholz, W. Thomas Bionische Systeme versuchen, Beobachtungen aus der Natur in technische Lösungen umzusetzen. Dieser Grundgedanke war auch bei der Konzeption
Oberflächenersatz der Hüfte - Zehn Jahre Erfahrungen
 Oberflächenersatz der Hüfte - Zehn Jahre Erfahrungen M. Menge (Ludwigshafen) Für junge Patienten mit Coxarthrose ist das Ergebnis der herkömmlichen Endoprothetik immer noch nicht ausreichend. Das schwedische
Oberflächenersatz der Hüfte - Zehn Jahre Erfahrungen M. Menge (Ludwigshafen) Für junge Patienten mit Coxarthrose ist das Ergebnis der herkömmlichen Endoprothetik immer noch nicht ausreichend. Das schwedische
Osteotomien um das Hüftgelenk. Martin Beck, Prof. Dr.med.. Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Luzerner Kantonsspital Luzern
 Osteotomien um das Hüftgelenk Martin Beck, Prof. Dr.med.. Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Luzerner Kantonsspital Luzern > Beckenosteotomien Hüftdysplasie Acetabuläre Retroversion > Osteotomien
Osteotomien um das Hüftgelenk Martin Beck, Prof. Dr.med.. Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Luzerner Kantonsspital Luzern > Beckenosteotomien Hüftdysplasie Acetabuläre Retroversion > Osteotomien
ligamentären Balance, so dass das Wissen um die zugrunde liegende Pathologie der Gonarthrose Schlüssel zur Vermeidung von Fehlpositionierungen ist.
 3 Operation Die Operation beginnt mit der Planung. Sowohl in der Hüft- als auch in der Knieendoprothetik gibt es keinen Konsens darüber, welche Implantatposition optimal ist. In Zusammenfassung der Literatur
3 Operation Die Operation beginnt mit der Planung. Sowohl in der Hüft- als auch in der Knieendoprothetik gibt es keinen Konsens darüber, welche Implantatposition optimal ist. In Zusammenfassung der Literatur
Mittelfristige und langfristige Ergebnisse mit dem PPF Schaft R. Legenstein, A. Ungersböck, P. Bösch
 Mittelfristige und langfristige Ergebnisse mit dem PPF Schaft R. Legenstein, A. Ungersböck, P. Bösch 319 Im April 1990 wurde der PPF Schaft (Proximal-Press- Fit) erstmals in Wr. Neustadt, Niederösterreich,
Mittelfristige und langfristige Ergebnisse mit dem PPF Schaft R. Legenstein, A. Ungersböck, P. Bösch 319 Im April 1990 wurde der PPF Schaft (Proximal-Press- Fit) erstmals in Wr. Neustadt, Niederösterreich,
Hüftgelenkersatz bei Coxarthrose des Hochbetagten: Was ist heute möglich und was ist vertretbar?
 Hüftgelenkersatz bei Coxarthrose des Hochbetagten: Was ist heute möglich und was ist vertretbar? B. Schweigert Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Spezielle Orthopädische Chirurgie Orthopädische
Hüftgelenkersatz bei Coxarthrose des Hochbetagten: Was ist heute möglich und was ist vertretbar? B. Schweigert Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Spezielle Orthopädische Chirurgie Orthopädische
Patienteninformation. Ihr neues Hüftgelenk
 Patienteninformation Ihr neues Hüftgelenk Inhalt dieser Broschüre Der Aufbau des Hüftgelenke s 4 Gründe für den Hüftgelenke rsatz 5 Das künstliche Hüftgelenk 7 Die Operation 9 Nachbehandlung und mögli
Patienteninformation Ihr neues Hüftgelenk Inhalt dieser Broschüre Der Aufbau des Hüftgelenke s 4 Gründe für den Hüftgelenke rsatz 5 Das künstliche Hüftgelenk 7 Die Operation 9 Nachbehandlung und mögli
Navigierte Endoprothetik an Hüfte und Kniegelenk
 Was gibt es Neues: Navigiertes Operieren in der Unfallchirurgie Trauma Berufskrankh 2009 11[Suppl 1]:44 48 DOI 10.1007/s10039-008-1426-5 Online publiziert: 25. Februar 2009 Springer Medizin Verlag 2009
Was gibt es Neues: Navigiertes Operieren in der Unfallchirurgie Trauma Berufskrankh 2009 11[Suppl 1]:44 48 DOI 10.1007/s10039-008-1426-5 Online publiziert: 25. Februar 2009 Springer Medizin Verlag 2009
Information zu Ihrer Knie-Operation. Kniegelenk
 Information zu Ihrer Knie-Operation Kniegelenk Liebe Patientin, lieber Patient, Sie haben sich für eine Operation Ihres Kniegelenks entschieden. Eine Arthrose ist für die Schmerzen in Ihrem Knie verantwortlich.
Information zu Ihrer Knie-Operation Kniegelenk Liebe Patientin, lieber Patient, Sie haben sich für eine Operation Ihres Kniegelenks entschieden. Eine Arthrose ist für die Schmerzen in Ihrem Knie verantwortlich.
CeramTec Medizintechnik. BIOLOX DUO Keramisches Bipolarsystem. Knochensparende Gelenkrekonstruktion mit maximaler Beweglichkeit
 CeramTec Medizintechnik BIOLOX DUO Keramisches Bipolarsystem Knochensparende Gelenkrekonstruktion mit maximaler Beweglichkeit 2 BIOLOX DUO Keramisches Bipolarsystem Weniger ist mehr BIOLOX DUO ist die
CeramTec Medizintechnik BIOLOX DUO Keramisches Bipolarsystem Knochensparende Gelenkrekonstruktion mit maximaler Beweglichkeit 2 BIOLOX DUO Keramisches Bipolarsystem Weniger ist mehr BIOLOX DUO ist die
Studie nimmt Patientennutzen neuer Operationstechniken unter die Lupe
 Linz, 21.09.2011 Studie nimmt Patientennutzen neuer Operationstechniken unter die Lupe Die Entfernung einer Gallenblase mittels Einlochchirurgie hinterlässt beim Patienten keine sichtbaren Operationsnarben
Linz, 21.09.2011 Studie nimmt Patientennutzen neuer Operationstechniken unter die Lupe Die Entfernung einer Gallenblase mittels Einlochchirurgie hinterlässt beim Patienten keine sichtbaren Operationsnarben
Definition. Zeichnung: Hella Maren Thun, Grafik-Designerin Typische Ursachen
 Definition Der Oberschenkelknochen besteht aus vier Anteilen: dem Kniegelenk, dem Schaft, dem Hals und dem Kopf, der zusammen mit dem Beckenknochen das Hüftgelenk bildet. Bei einem Oberschenkelhalsbruch
Definition Der Oberschenkelknochen besteht aus vier Anteilen: dem Kniegelenk, dem Schaft, dem Hals und dem Kopf, der zusammen mit dem Beckenknochen das Hüftgelenk bildet. Bei einem Oberschenkelhalsbruch
Definition. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann der Bruch folgende vier Knochenanteile betreffen: = Schultergelenkanteil des Oberarms
 Definition Die proximale Humerusfraktur ist ein Bruch des schulternahen Oberarmknochens, der häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose diagnostiziert wird. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann
Definition Die proximale Humerusfraktur ist ein Bruch des schulternahen Oberarmknochens, der häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose diagnostiziert wird. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann
Gesundheit aus der Natur Die Forschung der letzten Jahre hat ganz klar gezeigt, dass sich viele Symptome dank des erheblichen medizinischen
 Gesundheit aus der Natur Die Forschung der letzten Jahre hat ganz klar gezeigt, dass sich viele Symptome dank des erheblichen medizinischen Fortschritts zwar sehr gut behandeln, die eigentlich zugrunde
Gesundheit aus der Natur Die Forschung der letzten Jahre hat ganz klar gezeigt, dass sich viele Symptome dank des erheblichen medizinischen Fortschritts zwar sehr gut behandeln, die eigentlich zugrunde
Das künstliche. Hüftgelenk. Patienten-Informations-Broschüre.
 Das künstliche Hüftgelenk Patienten-Informations-Broschüre www.mein-gelenkersatz.com www.orthopaedie-leitner.at www.kh-herzjesu.at Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Diese Broschüre wurde für Patienten,
Das künstliche Hüftgelenk Patienten-Informations-Broschüre www.mein-gelenkersatz.com www.orthopaedie-leitner.at www.kh-herzjesu.at Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Diese Broschüre wurde für Patienten,
Patientenspezifische Instrumente in der Orthopädie:
 Patientenspezifische Instrumente in der Orthopädie: Wie funktioniert es und wie können sie die Art und Weise orthopädischer Operationen verbessern? Johan Hermans Associate Director Personalized Solutions
Patientenspezifische Instrumente in der Orthopädie: Wie funktioniert es und wie können sie die Art und Weise orthopädischer Operationen verbessern? Johan Hermans Associate Director Personalized Solutions
Hüftgelenkersatz (Hüft-TEP) Individuelle Versorgung durch die richtige Implantatwahl
 Orthopädische Universitätsklinik Essen Klinik und Poliklinik für Orthopädie u. Evangelisches Krankenhaus Werden Direktor Prof. Dr. med. F. A. Löer Fachinformation: Hüftgelenkersatz (Hüft-TEP) Individuelle
Orthopädische Universitätsklinik Essen Klinik und Poliklinik für Orthopädie u. Evangelisches Krankenhaus Werden Direktor Prof. Dr. med. F. A. Löer Fachinformation: Hüftgelenkersatz (Hüft-TEP) Individuelle
Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart. Notwendigkeit von abgefragten Parametern
 Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart Notwendigkeit von abgefragten Parametern Prof. Dr. Hanns-Peter-Scharf Orthopädische Universitätsklinik
Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart Notwendigkeit von abgefragten Parametern Prof. Dr. Hanns-Peter-Scharf Orthopädische Universitätsklinik
Die navigierte Knieprothese!! AkadeMI 25. Mai 2016! Dr. md. Lukas G. LOREZ!
 Die navigierte Knieprothese!! AkadeMI 25. Mai 2016! Dr. md. Lukas G. LOREZ! Knieprothese! Knie, Arthrose, Alternativen zur Prothese! Was ist eine Knieprothese! Was für Prothesen gibt es! Geschichte der
Die navigierte Knieprothese!! AkadeMI 25. Mai 2016! Dr. md. Lukas G. LOREZ! Knieprothese! Knie, Arthrose, Alternativen zur Prothese! Was ist eine Knieprothese! Was für Prothesen gibt es! Geschichte der
Nr. Anforderung n.a. Status Bemerkung
 Version vom 26.09.2016 Seite 1 von 5 1 Stage 0: Definition des Umfangs der klinischen Bewertung - Ziel der klinischen Bewerbung definieren - allgemeine Beschreibung des Produkts inkl. Hersteller, Zweckbestimmung
Version vom 26.09.2016 Seite 1 von 5 1 Stage 0: Definition des Umfangs der klinischen Bewertung - Ziel der klinischen Bewerbung definieren - allgemeine Beschreibung des Produkts inkl. Hersteller, Zweckbestimmung
Qualitätsbericht EndoProthetikZentrum Lauterbach. Berichtsjahr 2014
 Qualitätsbericht EndoProthetikZentrum Lauterbach Berichtsjahr 2014 1 Vorwort Die Abteilung Unfall- und Orthopädische Chirurgie am Krankenhaus Eichhof in Lauterbach ist das erste zertifizierte EndoProthetikZentrum
Qualitätsbericht EndoProthetikZentrum Lauterbach Berichtsjahr 2014 1 Vorwort Die Abteilung Unfall- und Orthopädische Chirurgie am Krankenhaus Eichhof in Lauterbach ist das erste zertifizierte EndoProthetikZentrum
Hüftschmerzen bei jüngeren sportlich aktiven Patienten werden oft durch das Hüftimpingementsyndrom hervorgerufen
 Hüftschmerzen beim sogenannten Hüftimpingement - Syndrom die Hüftgelenkspiegelung kann in vielen Fällen helfen Abbildung 1) Hüftschmerzen beim sogenannten Impingementsyndrom (Einklemmungsschmerz) Hüft-
Hüftschmerzen beim sogenannten Hüftimpingement - Syndrom die Hüftgelenkspiegelung kann in vielen Fällen helfen Abbildung 1) Hüftschmerzen beim sogenannten Impingementsyndrom (Einklemmungsschmerz) Hüft-
Die Analyse der Nachbarsegmente ergab lediglich eine Tendenz zur Abnahme der Bandscheibenhöhe. Vorhandene Osteophyten nahmen im Grad ihrer Ausprägung
 21 Diskussion Die vorliegende prospektive Studie der ventralen zervikalen Diskektomie mit anschließender Fusion zeigte im 7-Jahres-Verlauf gute klinische Ergebnisse. Die Schmerzen waren postoperativ signifikant
21 Diskussion Die vorliegende prospektive Studie der ventralen zervikalen Diskektomie mit anschließender Fusion zeigte im 7-Jahres-Verlauf gute klinische Ergebnisse. Die Schmerzen waren postoperativ signifikant
Dank FITBONE fit für das Leben
 intens Dank FITBONE fit für das Leben Smarte Beinverlängerung Das würde ich jederzeit wieder machen, sagt sie rückblickend. Der operative Eingriff war minimal, der Aufenthalt im Krankenhaus kurz, die Verlängerungsprozedur
intens Dank FITBONE fit für das Leben Smarte Beinverlängerung Das würde ich jederzeit wieder machen, sagt sie rückblickend. Der operative Eingriff war minimal, der Aufenthalt im Krankenhaus kurz, die Verlängerungsprozedur
Arthrose Ursache, Prävention und Diagnostik
 Arthrose Ursache, Prävention und Diagnostik Wolfgang Schlickewei, Klaus Nowack Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die auf einem Missverhältnis von Belastbarkeit und Belastung des Gelenkknorpels
Arthrose Ursache, Prävention und Diagnostik Wolfgang Schlickewei, Klaus Nowack Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, die auf einem Missverhältnis von Belastbarkeit und Belastung des Gelenkknorpels
Behandlung der Hüftgelenkdysplasie beim wachsenden Hund
 Behandlung der Hüftgelenkdysplasie beim wachsenden Hund C.v.Werthern Fachtierarzt für Chirurgie und Kleintiere, Dipl. ECVS, 6210 Sursee Hüftgelenkdysplasie (HD) ist die am häufigsten beobachtete orthopädische
Behandlung der Hüftgelenkdysplasie beim wachsenden Hund C.v.Werthern Fachtierarzt für Chirurgie und Kleintiere, Dipl. ECVS, 6210 Sursee Hüftgelenkdysplasie (HD) ist die am häufigsten beobachtete orthopädische
Stadtklinik Baden-Baden Unfallchirurgisch-Orthopädische Klinik Rheumaorthopädie-Hand-und Fußchirurgie
 Leitender Arzt Orthopädie: Prof.Dr.L.Rabenseifner Stadtklinik Baden-Baden Unfallchirurgisch-Orthopädische Klinik Rheumaorthopädie-Hand-und Fußchirurgie Orthopädie bewegt Reasons for revisions design related
Leitender Arzt Orthopädie: Prof.Dr.L.Rabenseifner Stadtklinik Baden-Baden Unfallchirurgisch-Orthopädische Klinik Rheumaorthopädie-Hand-und Fußchirurgie Orthopädie bewegt Reasons for revisions design related
"7. Berliner Arthrose-Informationstag"
 "7. Berliner Arthrose-Informationstag" Hüftprothese Wann und Welche für Wen? Dr. med. Johannes Michels Montag, 29. März 2010 von 18:00 bis ca. 20:00 Uhr im Ludwig Erhard Haus Fasanenstr. 85, 10623 Berlin
"7. Berliner Arthrose-Informationstag" Hüftprothese Wann und Welche für Wen? Dr. med. Johannes Michels Montag, 29. März 2010 von 18:00 bis ca. 20:00 Uhr im Ludwig Erhard Haus Fasanenstr. 85, 10623 Berlin
Komplikationen und deren sinnvolle Erfassung
 Komplikationen und deren sinnvolle Erfassung Univ. Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz M.Sc. Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Universitätsklinik für Chirurgie,
Komplikationen und deren sinnvolle Erfassung Univ. Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz M.Sc. Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Universitätsklinik für Chirurgie,
Operation Wann ist eine Operation angezeigt? Welche Optionen hat der Patient? b) Das künstliche Hüft-Gelenk
 Operation Wann ist eine Operation angezeigt? Welche Optionen hat der Patient? b) Das künstliche Hüft-Gelenk Dr. med. Frank Klufmöller Breitenbachplatz 21 Rüdesheimer Str. 43 14195 Berlin 14197 Berlin 030
Operation Wann ist eine Operation angezeigt? Welche Optionen hat der Patient? b) Das künstliche Hüft-Gelenk Dr. med. Frank Klufmöller Breitenbachplatz 21 Rüdesheimer Str. 43 14195 Berlin 14197 Berlin 030
Fortschritte in der zementierten Endoprothetik Heraeus steht für Sicherheit und lange Standzeiten
 Fortschritte in der zementierten Endoprothetik Heraeus steht für Sicherheit und lange Standzeiten Berlin (3. Oktober 2006) - Der Operationserfolg in der Endoprothetik wird an der Standzeit der Prothese
Fortschritte in der zementierten Endoprothetik Heraeus steht für Sicherheit und lange Standzeiten Berlin (3. Oktober 2006) - Der Operationserfolg in der Endoprothetik wird an der Standzeit der Prothese
Stellungnahme von Prof. Winter zur BHR = "McMinn-Prothese - Stand Mai 2016 EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung Friedrichshafen-Bodensee
 1 Herzlich Willkommen auf unserer Homepage und vielen Dank für Ihr Interesse! Die Einführung neuer orthopädisch-chirurgischer Techniken ist immer eine Herausforderung für die Gemeinschaft der orthopädischen
1 Herzlich Willkommen auf unserer Homepage und vielen Dank für Ihr Interesse! Die Einführung neuer orthopädisch-chirurgischer Techniken ist immer eine Herausforderung für die Gemeinschaft der orthopädischen
Welche Erkrankungen können durch Hüftarthroskopie behandelt werden?
 Die Hüftarthroskopie Was ist eine Hüftarthroskopie? Die Hüftarthroskopie wird auch Gelenkspiegelung genannt. Die Operation erfolgt in Vollnarkose. Für eine Arthroskopie der Hüfte ist die Lagerung auf einem
Die Hüftarthroskopie Was ist eine Hüftarthroskopie? Die Hüftarthroskopie wird auch Gelenkspiegelung genannt. Die Operation erfolgt in Vollnarkose. Für eine Arthroskopie der Hüfte ist die Lagerung auf einem
ENDOPROTHETIK- ZENTRUM DER MAXIMAL- VERSORGUNG ZERTIFIZIERT UND INTERPROFESSIONELL
 ZERTIFIZIERT UND INTERPROFESSIONELL ENDOPROTHETIK- ZENTRUM DER MAXIMAL- VERSORGUNG WILLKOMMEN Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie im Endoprothetikzentrum
ZERTIFIZIERT UND INTERPROFESSIONELL ENDOPROTHETIK- ZENTRUM DER MAXIMAL- VERSORGUNG WILLKOMMEN Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie im Endoprothetikzentrum
EndoProthetikZentrum Lorsch. Endoprothetik auf höchstem Niveau. Chirurgisch-Orthopädische Fachklinik Lorsch
 Chirurgisch-Orthopädische Fachklinik Lorsch Endoprothetik auf höchstem Niveau EndoProthetikZentrum Lorsch zertifiziert nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
Chirurgisch-Orthopädische Fachklinik Lorsch Endoprothetik auf höchstem Niveau EndoProthetikZentrum Lorsch zertifiziert nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
Verschleiß des Schulterhauptgelenkes (Omarthrose / Osteonekrose)
 Ursache : veränderte Altersstruktur der Bevölkerung zunehmende Anzahl von Verschleißerkrankungen des Schulterhauptgelenkes Normale funktionelle Anatomie Schulterhauptgelenk Komplex Normale Biomechanik
Ursache : veränderte Altersstruktur der Bevölkerung zunehmende Anzahl von Verschleißerkrankungen des Schulterhauptgelenkes Normale funktionelle Anatomie Schulterhauptgelenk Komplex Normale Biomechanik
2 Warum ein künstliches Hüftgelenk
 2 Warum ein künstliches Hüftgelenk nötig wird Anatomie 7 Wie ein gesundes Hüftgelenk funktioniert Gehen, hüpfen und springen, rennen und Treppen steigen, bergauf und bergab laufen, in die Hocke gehen und
2 Warum ein künstliches Hüftgelenk nötig wird Anatomie 7 Wie ein gesundes Hüftgelenk funktioniert Gehen, hüpfen und springen, rennen und Treppen steigen, bergauf und bergab laufen, in die Hocke gehen und
ENDOPROTHETIK- ZENTRUM DER MAXIMAL- VERSORGUNG ZERTIFIZIERT UND INTERPROFESSIONELL
 ZERTIFIZIERT UND INTERPROFESSIONELL ENDOPROTHETIK- ZENTRUM DER MAXIMAL- VERSORGUNG WILLKOMMEN Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie im Endoprothetikzentrum
ZERTIFIZIERT UND INTERPROFESSIONELL ENDOPROTHETIK- ZENTRUM DER MAXIMAL- VERSORGUNG WILLKOMMEN Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie im Endoprothetikzentrum
