Fundgeschichte. Jürgen Weiner, Pulheim Mit Beiträgen von Erich Claßen, München und Karl Heinz Rieder, Kipfenberg
|
|
|
- Hilko Graf
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bayerische Vorgeschichtsblätter 78, 2013, S Technologische und ergologische Erkenntnisse zu den Stein-, Knochen-, Zahn- und Geweihartefakten aus dem schnurkeramischen Doppelgrab von Gaimersheim, Lkr. Eichstätt Jürgen Weiner, Pulheim Mit Beiträgen von Erich Claßen, München und Karl Heinz Rieder, Kipfenberg Fundgeschichte Im Jahr 1981 wurde eine Dienststelle des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) in Ingolstadt eingerichtet, die es ermöglichte, den stark expandierenden Flächenverbrauch in der Region denkmalpflegerisch angemessen zu betreuen 1. Eine erste mehrjährige Ausgrabung in Gaimersheim fand am Brunnbuck nördlich des Ortes statt, wo bei einer Straßenbegradigung Siedlungsbefunde mehrerer Perioden um einen Quellbereich festgestellt wurden, darunter eine römische villa rustica sowie alt-, mittel- und jungneolithische Siedlungsareale 2. Der verstärkte Einsatz der Luftbildarchäologie, und insbesondere die konsequente archäologische Begleitung von Oberbodenabträgen in neu ausgewiesenen Baugebieten, führte zu einer Vielzahl neuer Erkenntnisse zur prähistorischen Besiedlung des mittleren Donauraumes. So konnte 1998 im Baugebiet Kreppenäcker im Nordosten von Gaimersheim (Abb. 1) ein besonderer Befund dokumentiert werden: eine schnurkeramische Doppelbestattung. Regionale Forschungsgeschichte und Fundplätze der Schnurkeramik Schon im Jahr 1790 lieferte der Eichstätter Professor Ignatz Pickel ( ) den ersten Beleg für ein Grab der Schnurkeramik. Er berichtete über die Ausgrabung eines Grabhügels in der Waldabteilung Flüssel, heute in der Gemarkung Pietenfeld (Lkr. Eichstätt) 3. Seine Funde, unter anderem drei Steinäxte und zwei Silexdolche, sind leider nicht erhalten geblieben. Weitere bemerkenswerte Funde waren 1841 ein Silexdolch aus einem Grabhügel bei Biding (Lkr. Eichstätt) 4 sowie im Jahr 1867 wiederum ein ebenmäßiger Silexdolch vom Osterberg bei Pfünz (Lkr. Eichstätt). Ebenfalls im späten 19. Jahrhundert fanden sich ein Silexdolch und ein Steinbeil, angeblich in einem Grabhügel bei Eitensheim (Lkr. Eichstätt), welcher möglicherweise bei Erdarbeiten anlässlich des Bahnbaus ab 1867 zum Vorschein kam. Nicht weit entfernt davon fand sich 1882 bei Tauberfeld (Lkr. Eichstätt) eine prächtige facettierte Axt 5. Immer wieder waren es Beile, Äxte oder Dolche, die in der Folge bekannt wurden, wohl häufig als Belege angepflügter Gräber 6. Mit der konsequenten denkmalpflegerischen Betreuung ab Anfang der 1980er Jahre konnten, neben dem generellen Zuwachs dokumentierter Ausgrabungen, 1991 in der Neubautrasse der Bundesstraße 16 südlich von Weichering (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) auch erstmals drei Ost-West ausgerichtete Gräber der Schnurkeramik fachgerecht dokumentiert werden 7. Danach wurden in fast jährlichen Abständen zum Teil sehr reich ausgestattete Gräber entdeckt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind in der Region Ingolstadt mindestens 26 schnurkeramische Gräber mit mindestens 31 Bestattungen ans Licht gekommen (s. Katalog Liste 1 8 ). Siedlungsspuren sind hingegen kaum bekannt geworden. Bei der Domgrabung in Eichstätt und auf der ICE-Trasse bei Kinding konnten nur wenige Keramikreste festgestellt werden. Einige Neufunde des letzten Jahrzehnts aus Grabungen und Aufsammlungen belegen in der Gemeinde Egweil 9 eine schnurkeramische Siedlungstätigkeit. Zur Fundgeschichte der Doppelbestattung von Gaimersheim Aus der Ortsflur von Gaimersheim lag als Beleg für die Schnurkeramik eine durchlochte Axt vor, die von 1 Rieder Rieder u. a Rieder Birkner 1932; Birkner Winkelmann 1926, 92; Naber 1974, 7 ff., sowie Abb Reichart Weinig Übersicht der Grabungen und Fundplätze des Jahres Arch. Jahr Bayern 1991, 12 und BVbl. Beih. 7, Fundchronik für das Jahr 1991 (München 1994) 74. Angezeigt auch in: Jahrb. Bayer. Denkmalpfl. 45/46, 1991/1992 (Berlin, München 1999). Berichtsteil, Abt. Bodendenkmalpfl., Berichtszeitraum 1991 (Ausgrabungen) Aus den Vorberichten und teils unvollständigen Grabungsdokumentationen, bzw. den Inkonsistenzen zwischen diesen, lassen sich keine verlässlichen Zahlen ermitteln, vgl. z. B. Anmerkungen zu Katalog Liste 1 Nr Rieder 2008 u. frdl. Mitteil. H. Strobel, BLfD Ingolstadt, Projektsteuerung. 23
2 Jürgen Weiner Abb. 1. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. 1 Lage der Fundstelle Kreppenäcker östlich des Ortes Gaimersheim, im nördlichen Oberbayern. o. M. einem Landwirt südlich des Augrabens gefunden und 1989 dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zur Kenntnis gebracht worden war 10. Mit hoher Wahrscheinlichkeit entstammt das aus fremdem Felsgestein (Serpentinit) hergestellte Werkzeug einem Grab der frühen Schnurkeramik. Bei Erdeingriffen jeder Art konnte also stets auch mit der Aufdeckung einzeln gelegener Gräber der Schnurkeramik gerechnet werden. So auch im zukünftigen Baugebiet Kreppenäcker in Gaimersheim, als am in den bis dahin weitgehend unauffälligen Trassenabschnitten die hier zu beschreibende Doppelbestattung aufgedeckt wurde. Nach dem maschinellen Oberbodenabtrag musste festgestellt werden, dass der Pflug die Skelette bereits tangiert hatte. Ebenso waren bereits zwei den jeweiligen Individuen zuzuordnende Gefäßbeigaben, in einem Fall zu zwei Dritteln, im anderen zu drei Vierteln zerstört. Die äußeren Bedingungen der Bergung waren durch anhaltenden Starkregen ausgesprochen ungünstig. Neben den obligatorischen Zeichnungen der Bestattung, erfolgte die Fotodokumentation entgegen der üblichen Verfahrensweise (Schwarzweiß-Negativfilm und Diapositiv) erstmals ausschließlich in Digitaltechnik, da das Grabungszelt für eine konventionelle Praxis zu niedrig war und wegen der herrschenden Wetterbedingungen auch nicht entfernt werden konnte. Die Grablege wurde in Quadranten fotografiert, die später fotogrammetrisch kombiniert wurden. Zusätzlich wurden zahlreiche Detailaufnahmen angefertigt, insbesondere von der Lage der Beigaben. Aufgrund der außergewöhnlichen Beigaben war bereits unmittelbar nach der Bergung eine wissenschaftliche Bearbeitung durch verschiedene Fach kollegen vorgesehen, die sich aber leider deutlich zeitlich verzögerte. Auch das Skelettmaterial konnte bislang nicht bearbeitet werden, da die Knochen seit geraumer Zeit nicht auffindbar sind. Dennoch erfolgte mittlerweile eine öffentliche Präsentation des Grabinventars im 2008 eröffneten Marktmuseum Gaimersheim. Der vorliegende Artikel schließt nun auch die wissenschaftliche Vorlage der archäologischen Funde ab. Karl Heinz Rieder Befund Lage der Fundstelle Der Marktort Gaimersheim (Lkr. Eichstätt) liegt ca. 6 km nordwestlich von Ingolstadt, am Südrand der südlichen Frankenalb. Die Fundstelle Kreppenäcker befindet sich am nordöstlichen Ortsrand auf einem flachen, 24
3 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim süd exponierten Hang, der zur holozänen Aue des Retzgrabens abfällt. Den geologischen Untergrund bildet die im Miozän abgelagerte obere Süßwassermolasse, die in weiten Teilen mit pleistozänem Löss überdeckt ist. Molassematerial und Lösslehm sind das Substrat der hier vorhandenen Braunerden. Die Befunde, die in den Erschließungstrassen und den einzelnen Baugrundstücken des Baugebietes Kreppenäcker ab 1998 untersucht wurden, konzentrieren sich im Süden des Baugebietes, in Höhen lagen um 390 m NN. Neben der näher vorzustellenden schnurkeramischen Doppelbestattung, die im Westteil der südlichsten Erschließungsstraße aufgedeckt wurde, konnten im Baugebiet Kreppenäcker urgeschichtliche Siedlungsbefunde der Linienbandkeramik, der Münchshöfener Kultur, der Urnenfelderzeit sowie der späten Hallstatt- oder frühen Latènezeit dokumentiert werden. Das Grab Die Bestattung der Schnurkeramik gab sich im ersten Planum als langrechteckige, Ost-West orientierte Verfärbung von ca. 2,6 1 m zu erkennen (Abb. 2). Erste Knochen und Gefäßbruchstücke wurden bereits bei Anlage des Baggerplanums freigelegt. Im Zuge der Ausgrabung konnte dann die Grablege zweier Individuen in einer nur noch maximal 8 cm tiefen Grabgrube dokumentiert werden 11. Individuum 1, bei dem es sich vermutlich um eine Frau handelte 12, befand sich im Westteil der Grube. Die Frau lag, den Kopf im Westen mit Blick nach Süden auf dem Rücken, die Beine lagen leicht angehockt auf der rechten Seite, somit wiesen die Knie nach Süden. Beide Arme lagen angewinkelt am Körper, sodass es wahrscheinlich ist, dass die Hände auf dem Bauchbereich ruhten. Individuum 2, ein Mann, war im Ostteil der Grabgrube niedergelegt worden. Sein Kopf lag im Osten und blickte nach Süden. Während der Oberkörper flach auf dem Rücken lag, waren die Beine ebenfalls leicht nach links angewinkelt, womit die Knie wiederum nach Süden wiesen. Bei der männlichen Bestattung war der rechte Unterarm leicht zur Hüfte hin abgeknickt, während der linke ausgestreckt neben dem Körper lag. Beide Skelette waren nach Ausweis der Grabungsdokumentation verschränkt niedergelegt worden. Das heißt: Das linke Bein von Individuum 2 war zwischen den Beinen von Individuum 1 hindurchgeschoben und nach links geneigt worden, wohingegen das rechte Bein auf der linken Körperseite von Individuum 1 abgelegt worden war. Die Füße von Individuum 2 kamen damit auf Höhe des Brustkorbes von Individuum 1 bei den Armbeugen zu liegen. Erich Claßen Funde Verteilung des Fundmaterials im Grab Die Beigaben der Frau umfassen neben einem Becher oberhalb des Kopfes lediglich zwei Artefakte, einen kleinen Dolch und eine Silexklinge (Abb. 2,2). Sie wurden neben der linken Schulter auf einer Fläche von ca cm nebeneinanderliegend gefunden (Ensemble 1). Die Männerbestattung enthielt ebenfalls einen Becher links oberhalb des Kopfes und insgesamt 23 weitere Artefakte sowie über 100 Retuschierreste. Mit Ausnahme des Gürtelhakens parallel an der Außenseite des rechten Oberarms (Einzelfund 1) und der Dolchklinge in der linken Armbeuge (Einzelfund 2), verteilen sich die restlichen Objekte auf zwei Fundensembles. Es handelt sich einmal um drei Beilklingen, die auf einer Fläche von ca. 20 ca. 30 cm rechts neben dem Becken vor, am und unterhalb des rechten Unterarmes angetroffen wurden (Ensemble 2). Die restlichen 18 Artefakte und alle Retuschierreste wurden auf einer Fläche von ca cm dicht neben- und übereinanderliegend rechts oberhalb des Kopfes freigelegt (Ensemble 3). Legt die Fundposition des Ensembles 3 nachgerade zwangsläufig die Deponierung des Ensembles in einem Beutel nahe, so ist dies für Ensemble 1 nur wahrscheinlich. Es gibt keinerlei Hinweise, dass das Grab durch Wühltiere oder Grabraub nachhaltig gestört wurde. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich alle Beigaben von verwesungsbedingten, geringfügigen Lageveränderungen abgesehen an ihren zum Zeitpunkt der Bestattung gewählten Niederlagestellen befanden. Lässt man die beiden Toten gleichermaßen mitgegebenen Becher außer Acht, so fällt das krasse Missverhältnis zwischen der Beigabenanzahl der Frau und derjenigen des Mannes auf. Von den verbleibenden insgesamt 25 Objekten sind nur zwei (8 %) der Frau zuzuordnen, 23 (92 %) dagegen dem Mann, weshalb er zu Recht als überaus reich ausgestattet beschrieben wurde 13. Jürgen Weiner 10 Tillmann 1990, 85 90; Tillmann 1995, Abb Die Grabungsleitung und die Dokumentationen vor Ort lag für die Firma ProArch, Ingolstadt, in den Händen von G. Malcher M. A. und A. Liebhardt, die ebenfalls den Grabungsbericht verfassten. 12 Eine erste anthropologische Ansprache der Skelette lieferte nach Auskunft von K. H. Rieder zeitnah zur Grabung P. Schröter (ehem. Anthropolog. Staatsslg. München). Eine abschließende anthropologische Untersuchung konnte bislang jedoch nicht erfolgen, da die Skelettreste derzeit nicht auffindbar sind. 13 Rieder 1999a, 3. 25
4 Jürgen Weiner Abb. 2. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. 1 Die schnurkeramische Doppelbestattung im Planum; 2 Umzeichnung. 1 o. M.; 2 M. 1 : 20. Gefäßbeigaben Die beiden jeweils oberhalb der Köpfe der bestatteten Individuen geborgenen Gefäßreste wurden bereits kurz nach ihrer Bergung ergänzt und konserviert. Heute können sie daher zwar als vollständige Gefäße im Museum betrachtet werden, Aussagen zum Gefäßaufbau, der Magerung oder Oberflächenbehandlung sind aber nicht mehr möglich. Daher sollen die beiden als Becher anzusprechenden Gefäße hier nur formal und in Bezug auf die Verzierungen kurz beschrieben werden. Bei der Frau fanden sich die Scherben eines in rekonstruierter Form 13 cm hohen Gefäßes (Obj. 1 1; Abb. 3,1) mit einem Mündungsdurchmesser von 10,5 cm. Die größte Weite am Bauch beträgt 11,7 cm. Das Gefäß weist eine flach S förmig geschwungene Wandung auf, die Randlippe ist gleichmäßig gerundet, die Bodenform nicht rekonstruierbar. An Verzierungselementen finden sich am Bauchumbruch und am Gefäßhals jeweils zwei horizontale parallele Reihen aus kleinen, einzeln gesetzten ovalen Einstichen. Von dem bei dem männlichen Toten gefunden Gefäß (Obj. 1 28; Abb. 3,2) ist lediglich das untere Gefäßdrittel bis zu einer Höhe von 7,5 cm erhalten. Der Durchmesser des flachen, leicht abgesetzten Bodens beträgt 6 cm. Die gleichmäßig geschwungene, vom Boden 26
5 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Abb. 3. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. 1 Gefäßbeigabe der vermutlichen Frauenbestattung (Obj. 1 1); 2 Gefäßbeigabe der vermutlichen Männerbestattung (Obj. 1 28). M. 1 : 2. aus ansteigende Wandung erreicht eine maximale Weite von 16 cm. Die Verzierung dieses Gefäßes besteht ebenfalls aus zwei horizontalen, parallelen Einzelstichreihen, die hier jedoch knapp unterhalb des Bauchumbruchs bzw. der größten nachgewiesenen Gefäßweite liegen. Die beiden Gefäße sind typologisch in die Nähe der Becher vom Typ Geiselgasteig zu stellen. Somit weisen diese, wie auch die weiter unten zu besprechenden Dolchklingen, auf eine jüngere Zeitstellung des Grabes von Gaimersheim innerhalb der Schnurkeramik hin. Erich Claßen 2.66 Plattenhornstein, grau-braun, stumpf, homogen, opak, auf beiden Seiten noch harte, dicke, weiße Rinde Hornstein(?), mittelgrau bis gelbbraun, hellgraue Einschlüsse und zonige Schlieren, glasig, opak Hornstein, mittelgrau, homogen, opak Hornstein(?), hellgrau bis grauweiß, in Rindennähe gelbliche Tüpfel und gelblich ausgefüllte Risse, opak Hornstein, hellgrau, homogen, opak. Die Stein-, Knochen-, Zahn- und Geweihartefakte 14 Die Artefakte aus Stein, Knochen, Zahn und Geweih wurden entsprechend der oben gegebenen Beschreibung ihrer Anordnung im Grab nach Frauen- und Männerbeigaben getrennt behandelt. Allgemeine Beobachtungen zum Silex-Rohmaterial Es lassen sich auf makroskopischer Basis (mit bloßem Auge und Lupe) sechs verschiedene Materialgruppen bilden: 1.66 Hornstein/Feuerstein, braun-grau, homogen, stumpf, opak. 14 Mein besonderer Dank gilt K. H. Rieder für die Möglichkeit der Bearbeitung des Inventars. Gleichermaßen Dank geht an A. Tillmann (Bayer. Landesamt f. Denkmalpfl., Außenstelle Bamberg) für Diskussionsbeiträge und Literaturhinweise. Ein herzlicher Dank gilt Prof. Dr. M. Dambach (Zoologisches Institut, Universität zu Köln) für Hinweise zu Eber- und Keilerhauern. Ferner danke ich J. Schibler (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Basel), für freundliche Informationen zu Hauermessern. Großer Dank gebührt K. Drechsel (Rheinisches Amt für Bodendenkmalpfl. Bonn, Außenstelle Nideggen), die mit Langmut zahlreiche Beobachtungen des Verf. am Material kritisch überprüfte und ausgiebig diskutierte. Dank geht zuletzt auch an S. Haendschke M. A. (Rheinisches Landesmuseum Bonn) und U. Wohnhaas M. A. (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln). 27
6 Jürgen Weiner Diesen Gruppen lassen sich folgende Artefakte zuordnen: 1. Dolchklinge Obj. 1 8 und Pfeilspitze Obj Dolch Obj Feuerschlagstein Obj und drei Absplisse der Gruppe Silexklinge Obj Abschlag Obj und Pfeilspitzen Obj. 1 1; 1 3; Pfeilspitzen Obj. 1 2; 1 10; Beigaben der Frau Ensemble 1 Ensemble 1 besteht aus einer Silexklinge (Obj. 1 22; Abb. 4,1) und einem Dolch aus Silex (Obj. 1 33; Abb. 4,2). Die Länge der Klinge beträgt 72 mm, die Breite 18 mm und die Dicke 6 mm bei einem Gewicht von 6 g. Die Klinge besitzt einen glatten Schlagflächenrest und deutliche Dorsalflächenreduktion. Unbeschadet letzteren Merkmales wurde sie vermutlich in Punchtechnik hergestellt. Das Stück ist beidseitig randlich bis flächig ausschließlich dorsal druckretuschiert. An der rechten Längsseite befindet sich ein eventuell moderner Ausbruch, das Spitzenende ist gebrochen. Auf der Dorsalund der Ventralfläche ist seidiger Glanz vorhanden, der an den Längskanten und über die ganze Länge des Dorsalgrates am stärksten ausgeprägt ist und als Gebrauchsspur interpretiert wird 15. Die Länge des Dolches beträgt 86 mm, die Breite 31 mm und die Dicke 11 mm bei einem Gewicht von 25 g. Die annähernd im rechten Winkel zu beiden Breitseiten orientierte Basis besteht vermutlich aus einer natürlichen, unpatinierten Sprungfläche, wie sie für Plattensilex bekannt ist. Die Breitseiten weisen jeweils in der proximalen Hälfte deutliche weiße und harte Rindenreste auf. Sie sind nicht überschliffen und können deshalb bei der Benutzung nicht gestört haben. Distalabschnitte großer Negative auf beiden Breitseiten legen eine erste Zurichtung in Schlagtechnik nahe. An den Rindenpartien enden diese Distalabschnitte in step fractures. Die endgültige Formgebung geschah durch Drucktechnik. Offensichtlich wurde zuerst die Ventralfläche durch Druck randlich retuschiert; später wurden diese Negative durch die Druckretuschierung auf der Dorsalfläche weitgehend gekappt 16. Eine kleine Verrundungszone an der Ventralkante der natürlichen Sprungfläche wird als diagnostisch für eine Verwendung zum Feuerschlagen gewertet. Voraussetzung für die Entstehung von Feuerschlagspuren ist ein ungehinderter Kontakt zwischen der Artefaktkante und einer Schwefelkiesknolle. Hieraus folgt konsequent, dass das Artefakt nicht mit einem Handgriff als Schäftung versehen war. Somit stellt es nicht den erhaltenen Teil eines ehemaligen Kompositgerätes dar. Deshalb kann dieser Fund nicht als Dolchklinge angesprochen, sondern muss konventionell-terminologisch als Dolch bezeichnet werden. Interpretation Ohne dies besonders betonen zu müssen, unterliegen die im Folgenden gelieferten Interpretationen zu allen Objekten aus dem Grab der Annahme, dass sich in der Beigabensitte ein Glauben an ein Leben nach dem Tode manifestiert und die Artefakte zum Gebrauch in jenem Leben dienen sollten 17. Als Frauenbeigabe völlig ungewöhnlich ist das technologisch und formal eindeutig als Dolch zu bezeichnende Artefakt. Vergleichbare Objekte gelten als klassische Beigabe männlicher Schnurkeramiker 18 Abb. 4. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble 1. 1 Silexklinge (Obj. 1 22); 2 Dolch aus Silex (Obj. 1 33). M. 2 : 3. 28
7 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim bzw. als männliche Komponenten der Glockenbecherkultur 19. Dieser Charakter als männliches Statussymbol war auch dem Ausgräber bekannt, weshalb er in einem Vorbericht das Stück zwar als beidseitig bearbeiteten Steindolch benannte, im Folgenden aber intuitiv die Bezeichnung zweischneidiges Messer bzw. beidseitig bearbeitete Spitze (Messer) favorisierte 20. Die Bezeichnung schnurkeramischer Silexdolche als Nahkampfwaffe 21 ist eine Hypothese. Zwar ist nicht auszuschließen, dass solche Artefakte bei Bedarf als durchaus wirkungsvolle Waffen benutzt werden konnten, aber Spuren von Nachschärfung und Gebrauchsspurenanalysen belegen in erster Linie deren Verwendung als Allzweckmesser 22. Deshalb bietet sich die Bezeichnung Dolchmesser als sinnvolle Verständigungshilfe an. Das Dolchmesser stand aufrecht auf einer Schneide oberhalb und im rechten Winkel zum Distalende der Silexklinge (Abb. 2,1 2). Diese Artefaktkonfiguration macht eine Aufbewahrung beider Stücke in einem jetzt vergangenen Beutel sehr wahrscheinlich; insbesondere, da das Dolchmesser ungeschäftet war. Das Vorkommen eines a priori männlichen Statussymboles im Beigabenensemble einer weiblichen Bestattung erfordert selbstverständlich eine Erklärung. Hier bieten sich zwei Beobachtungen an: die Fundlage der Artefakte und deren ehemalige Funktion. Im Vergleich zur Dolchklinge des Mannes besaß das Dolchmesser der Frau keine prominente Fundlage. Im Gegenteil: Es wurde mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Beutel und somit nicht sichtbar deponiert. Dies verbietet es, dem Artefakt eine symbolische Funktion beizumessen. Billigt man dem Artefakt eine Funktion als Allzweckmesser zu, dann ergibt sich die Frage, warum ein zweites Gerät mit vergleichbarer Schneidefunk tion mitgegeben wurde. Tatsächlich besitzt die druck retuschierte Silexklinge zwei wesentlich regelmäßigere scharfe Längskanten als das Dolchmesser. Jeder moderne Mensch würde sich intuitiv für die Silexklinge bei einer schneidenden Tätigkeit entscheiden. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Schneiden des Dolchmessers keinesfalls verstumpft sind und damit unbrauchbar wären. Unter der Voraussetzung, dass die Silexklinge letztlich das eigentliche Allzweckmesser der Frau war, muss das Dolchmesser zumindest fallweise, vielleicht auch überwiegend, eine andere Funktion besessen haben. Als entscheidender Hinweis dazu bieten sich die Spuren vom Feuerschlagen an. Die Interpretation des Dolchmessers als Feuerschlagstein wird durch zwei zusätzliche Fakten gestützt: Zum einen sind solche Spuren z. B. an Griffteilen endneolithisch-frühbronzezeitlicher Flintdolchklingen des Nordens sehr geläufig. Zum anderen fehlt im Beigabenensemble der Frau ein Silexartefakt, das unbeschadet charakteristischer Gebrauchsspuren allein durch eine kissen- oder spindelartige Form eine Ansprache als klassischer Feuerschlagstein erlaubte. Hieraus folgt, dass ein originär männliches Silexgerät der Frau zum Feuerschlagen überlassen wurde. Vielleicht wäre es deshalb möglich, dass es sich bei dem Dolchmesser um den Rest einer ehemals erheblich größeren Dolchklinge des Mannes handelt, die durch dauernden Gebrauch und durch häufige Nachschärfung zu kurz wurde. Dergestalt zwar seiner ursprünglich eindrucksvollen Wirkung beraubt, war das Stück dagegen wegen seiner gedrungenen, robusten Form als Feuerschlagstein noch willkommen. Diese Hypothese setzt allerdings eine ehemalige Schäftung voraus, bei der mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit Birkenpech als Klebstoff benutzt wurde. Deshalb wäre zu erwarten, dass zumindest auf den beidseitigen porösen Kreidepartien noch schwache Verfärbungen auf Klebestellen hinweisen sollten. Da aber keinerlei Schäftungsspuren vorliegen, sind diese entweder vollständig den Erhaltungsbedingungen zum Opfer gefallen, oder die Hypothese ist falsch, und das Dolchmesser gehörte zu Lebzeiten von vornherein und in dieser Form zum Geräteensemble der Frau. Aus der Tatsache, dass die Gebrauchsspuren nur auf kleiner Fläche und nicht sehr intensiv ausgeprägt sind, ließe sich schließen, dass das Artefakt nicht lange zum Feuerschlagen benutzt wurde. Unter der Voraussetzung, dass es doch ehemals dem Mann gehörte und unter Berücksichtigung des nahezu fabrikneuen Zustandes der Dolchklinge des Mannes, könnte dies eventuell darauf hindeuten, dass der Mann erst kurz vor seinem Tod eine neue Dolchklinge für sich anfertigte und die Frau das übernommene Vorgängerstück deshalb nur kurze Zeit bis zu ihrem Tod benutzen konnte. Zwar sind Schwefelkiesfeuerzeuge u. a. auch in der Schnurkeramik ebenfalls als typisch männliche Grabbeigaben nachgewiesen 23. Der Feuerschlagstein der Frau zeigt aber, dass Frauen zumindest in der Lage waren, bei Bedarf Feuer zu erzeugen. Fest steht indes, dass die Frau kein Schwefelkiesstück oder eine -knolle mit sich führte. Denn man darf (analog zu dem Befund auf der Brust des Mannes), sollte es sich dabei tatsächlich um vergangenen Schwefelkies handeln (s. u.), davon ausgehen, dass den Ausgräbern vergleichbare Verwitterungsreste am Skelett der Frau oder nahe der Silexartefakte ebenfalls aufgefallen wären. 15 Das Rohmaterial des Stücks wurde von A. Tillmann als Eitensheimer Material bestimmt. 16 Das Rohmaterial des Stücks wurde von A. Tillmann als Schernfelder Plattensilex bestimmt. 17 z. B. Behrens 1973, 235; Fischer 1956, z. B Tillmann 1995, Schmotz 1989, Rieder 1999a, 3; z. B. Tillmann 1995, Weiner 1999b Anm z. B. Tillmann/Rieder
8 Jürgen Weiner Abb. 5. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble 2. Große Beilklinge, Parallelbeilklinge (Obj. 1 5). M. 2 : 3. Beigaben des Mannes Ensemble 2 Das Rohmaterial der drei als Ensemble 2 zusammengefassten Beilklingen aus Felsgestein (Obj ; Abb. 5 6) lässt sich der sog. AHS-Gruppe (Aktinolith- Hornblende-Schiefer) zuordnen und wird landläufig als Amphibolit bezeichnet 24. Makroskopisch besteht jede Beilklinge aus einer eigenen AHS-Variante. Das Material des größten Stückes erscheint makroskopisch am rauesten, das der kleinsten Klinge etwas weniger rau. Den feinsten Eindruck vermittelt das Material des mittelgroßen Exemplars. Dieser Gesamteindruck ist mit der Erkennbarkeit der Schieferung hoch korreliert. Am größten Exemplar ist die Schieferung sowohl auf geschliffenen Partien als auch auf alten Bruchflächen am deutlichsten zu erkennen und verläuft hier diagonal zur Schneide. Beim kleinsten Stück scheint sie quer zur Schneide zu stehen. An dem mittelgroßen Exemplar ist die Schieferung makroskopisch am besten auf alten Bruchflächen zu erkennen und verläuft erwartungsgemäß (s. u.) annähernd parallel zur Schneide. Die Berücksichtigung der Schieferung bei der Orientierung der Schneide von Beilklingen aus Gesteinen der AHS-Gruppe ist eine technologische Notwendigkeit und wird durch die mechanische Beanspruchung des Gesteines bei der Arbeit bedingt. Sie stellt bereits bei alt- und mittelneolithischen Dechselklingen ein regelhaft auftauchendes Merkmal dar 25. Die Länge der größten Beilklinge (Obj. 1 5; Abb. 5) beträgt 159 mm, die maximale Breite 39 mm, die Schneidenbreite 37 mm und die Dicke 24 mm bei einem 30
9 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Abb. 6. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble 2. 1 Kleine Beilklinge, Behaubeilchen (Obj. 1 6); 2 Mittelgroße Beilklinge, Dechselklinge (Obj. 1 7). M. 2 : 3. Gewicht von 250 g. Das Stück weist keinerlei moderne Beschädigungen auf. Es besitzt einen keilförmigen Umriss, der sich von der Schneide kontinuierlich zum Nacken verjüngt. Die Dorsalfläche ist gleichmäßig in Längs- und Querrichtung gewölbt und bis auf wenige Reste antiker Zurichtungsnegative vollständig überschliffen. Der Schliff ist sehr fein und erstreckt sich auf dem schneidenwärtigen Drittel gleichmäßig in Längsund Querrichtung ohne jegliche Facetten. Die Ventralfläche ist nur auf der schneidenwärtigen Hälfte sowie 24 Weiner Weiner 1996,
10 Jürgen Weiner zirka über ein Viertel des Nackenabschnittes flächendeckend fein überschliffen, wobei hier jedoch deutlich langgestreckte parallele Schlifffacetten erkennbar sind. Der dazwischenliegende Abschnitt wird von einer randlichen antiken Bruchzone und der nur partiell überschliffenen, naturrauen Oberfläche eines großen alten Zurichtungsnegatives gebildet. Das Negativ verläuft deutlich konkav, sodass die Beilklinge in der Seitenansicht schwach gebogen erscheint. Seitlich ist das Stück von zwei rechtwinklig zu den Breitseiten stehenden, über die gesamte Länge verlaufenden, ebenfalls weitestgehend fein überschliffenen Schmalseiten begrenzt. Sie stoßen auf der zur Schneide gewandten Hälfte an drei Seiten scharfkantig an die Dorsal- und Ventralfläche. Nur die linke Kante an der Ventralseite wird durch zwei hintereinanderliegende, nicht geschliffene Zurichtungsnegative gebrochen. Nahezu ausschließlich auf die nackenwärtigen Hälften beider Schmalseiten begrenzt sind kurze, querverlaufende Riefen. Im Querschnitt ist das Stück prinzipiell rechteckig. Der sehr geradlinige Verlauf des schneidenwärtigen Abschnittes der linken Schmalseite könnte auf die Verwendung der Sägetechnik zur Gewinnung des Beilklingenrohlings hinweisen. Der Nacken wird durch eine im rechten Winkel zur Längsachse verlaufende, schmale überschliffene Fläche und eine angrenzende, unregelmäßig gestufte raue Bruchfläche gebildet. Ein Blick auf den Schneidensaum in Längsrichtung der Beilklinge lässt erkennen, dass er unbeschadet eines schwach S förmigen Verlaufes eine zentrische Stellung zum Beilklingenkörper besitzt. Dies bedeutet, dass das Stück ehemals parallel geschäftet war. Im Umriss verläuft die Schneide nicht symmetrisch, sondern fällt zum rechten Ende (Blick in Arbeitsrichtung) deutlich und gleichmäßig ab. Im Vergleich zum Kontaktpunkt der Schneide mit der linken Schmalseite ist der rechte Kontaktpunkt um 4,5 mm in Nackenrichtung versetzt, so dass die rechte Schmalseite kürzer ist. Asymmetrien dieser Form sind von Parallel- und Querbeilklingen bekannt und werden als Abnutzung, d. h. als Gebrauchsspuren interpretiert 26. Sie entstehen, wenn die Beilklinge bei der Arbeit überwiegend und zuerst mit diesem Schneidenabschnitt in das zu bearbeitende Holz eindringt. Deshalb erlaubt die Lage solcher Gebrauchsspuren eine Aussage über die ehemalige Position von Beilklingen im Beilholm, und zwar unabhängig von der Schäftung in einem Gerad- (Stangen-) oder einem Knieholm. Freilich fällt die Vorstellung schwer, ein so hartes, vor allem aber zähes Gestein wie Amphibolit sei lediglich durch den Kontakt mit Holz derart intensiv abradiert worden. Eine gleichermaßen nachvollziehbare wie zwanglose Erklärung der Asymmetrie ergibt sich aus dem S förmigen Verlauf des Schneidensaumes und des angrenzenden ventralseitigen Schneidenabschnittes. Bei frontaler Schneidenansicht erkennt man, dass der ventralseitige Schneidenabschnitt über zwei Drittel seiner Breite stärker zur Schneide abfällt als am restlichen Drittel. Dieser Abschnitt korrespondiert mit dem längeren Abschnitt des S förmigen Schneidensaumes. Interessanterweise sind wenig oberhalb des Schneidensaums mehrere kleinere ungeschliffene Bruchzonen erkennbar. Diese Beobachtungen legen die Annahme nahe, dass die Schneide, vermutlich bei der Arbeit, an dieser Stelle ausgebrochen ist, wobei sich das Negativ auf den schneidennahen Abschnitt der Ventralfläche erstreckte. Das Bruchnegativ wurde bei der Reparatur durch Schliff nahezu vollständig überprägt und so die Ventralfläche und der Schneidensaum modifiziert. Deshalb kann für diese Beilklinge die Asym metrie nicht zur Bestimmung ihrer ehemaligen Position im Schaft herangezogen werden. Lässt sich die Asymmetrie der Schneide höchstens als indirekte Gebrauchsspur bezeichnen, so weist das Artefakt auch direkte Gebrauchsspuren auf. Fährt man etwa mit einer Fingerspitze von der linken Schneidenecke zur asymmetrischen rechten über den Schneidensaum, dann spürt man, dass die linke Ecke winkelig und schärfer, die rechte dagegen eindeutig verrundet und stumpfer ist. Zusätzlich ist am dorsalseitigen Schneidensaum eine Folge paralleler, kurzer Riefen erkennbar. Sie verlaufen nicht rechtwinkelig zur Schneide, sondern diagonal in Richtung der rechten Schmalseite. Solche Riefen treten auch am ventralen Schneidensaum auf. Eine kleine Gruppe am Ende des Schneidensaumes besitzt eine Länge von ca. 4 mm. Erstaunlicherweise zeigen sie hier nicht einen erwartungsgemäß gleichgerichteten, sondern einen diagonal zur linken Schmalseite gegengerichteten Verlauf. Projiziert man die Riefen in eine Ebene, dann würden sie sich kreuzen. Während die kurzen Riefen nicht vom Schneidenschliff stammen, sondern Gebrauchsspuren sind, ist dies für die kleine Gruppe der längeren nicht zu entscheiden. Natürlich wurden sie nicht vom viel zu weichen Holz, sondern von winzigen Sandkörnchen o. ä. hervorgerufen, die z. B. in der Baumrinde eingebettet waren oder an der Beilklinge selbst hafteten. Ihr diagonaler Verlauf entsteht durch die bogenförmige Schlagrichtung seitlich zum Körper und gilt als diagnostisches Merkmal für eine Parallelschäftung 27. Allerdings weisen nach S. A. Semenov Riefen bei Parallelbeilklingen auf beiden Breitseiten auch regelhaft gleichgerichteten Verlauf auf. Dies widerspricht den hier beobachteten Merkmalsausprägungen. Eine versuchsweise Erklärung des gegengerichteten Verlaufes der Riefen könnte darin bestehen, dies als Hinweis auf eine zeitlich versetzte Entstehung zu interpretieren. Wichtigste Voraussetzung hierfür ist jedoch die Annahme, dass sich Riefen analog zum Gebrauchsglanz letztlich auf derjenigen Breitseite der Beilklinge stärker entwickeln, die den intensivsten Kontakt mit dem Holz hat. Die Frage nach der ursprünglichen Positionierung des Artefaktes im Beilschaft kann jedenfalls durch die 32
11 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Riefen allein nicht erklärt werden. Diese zeigen einen gegengerichteten Verlauf. Andererseits erlaubt gerade dieses Merkmal die verbindliche Aussage, dass der Benutzer dieser Beilklinge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Rechtshänder gewesen sein muss. Denn nur unter dieser Voraussetzung konnten sich Riefen des beschriebenen Verlaufes auf beiden Breitseiten bilden. Bei einer Benutzung durch einen Linkshänder müssten sich dagegen gleichartige Riefen, aber mit jeweils umgekehrter Verlaufsrichtung gebildet haben. Dies hängt mit der Handhabung von Parallelbeilen durch Rechts- oder Linkshänder zusammen. Ein Rechtshänder steht vor einem zu fällenden Baum und führt das Beil gegen die aus seiner Sicht rechte Baumseite, wobei er es mit der linken Hand am Schaftende und mit der rechten Hand als Führhand davor hält. Bei einem Linkshänder ist es genau umgekehrt: Das Beil wird mit der rechten Hand am Schaftende gehalten, und die davorliegende linke Hand ist die Führhand. Eine verbindliche Antwort zur Originalkonfiguration von Beilklinge und Schaft liefert ausschließlich die Fundlage der Klinge, denn sie repräsentiert deren letzte Position zum Zeitpunkt der Bestattung. Das Stück lag mit der Ventralfläche nach oben und der Schneide nach außen in unmittelbarer Nähe der Grabgrubenwand. Außerdem lag es schräg zu dieser, d. h. zwischen der geradlinigen linken Schmalseite und der Grabgrubenwand bestand ein stumpfer Winkel. Unabhängig von seiner ehemaligen Schäftung in einem Kolbenkopf- oder einem Knieholm dürfte der Schaftstiel parallel zum rechten Arm des Mannes und nicht in Richtung der Frau orientiert gewesen sein. Es ist also möglich, dass die Fundlage der Originaldeponierung entspricht. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass das Stück ehemals auf seiner Schneide stand und mit dem Holm parallel gegen die Grabgrubenwand gelehnt war. Diese Interpretationen sind seit langem für die Fundlage einiger Dechselklingen aus bandkeramischen Gräbern bekannt 28. Letztlich ergibt sich zwingend eine Schäftung der Klinge mit der rechten, stärker gewölbten Schmalseite in Schlagrichtung und der Dorsalfläche an der linken Schaftseite. Die Riefen auf der stärker exponierten Dorsalfläche korrespondieren mit dieser Rekonstruktion. In dieser Form wurde das Beil über einen längeren Zeitraum benutzt. Eine vorläufige Interpretation der gegengerichteten Riefen als Indikatoren zeitlich unterschiedlicher Entstehung würde zu folgendem Ergebnis führen: Die Beilklinge war ursprünglich (erstmals nach Herstellung?) exakt um 180 in Querrichtung gedreht mit der linken, geradlinigen Schmalseite in Schlagrichtung und der Ventralfläche an der linken Schaftseite positioniert. Damit korrespondiert der Verlauf der Riefen mit der in diesem Falle stärker exponierten Ventralfläche. Das Beil wurde in dieser Form benutzt, wobei vermutlich die Schneide der Beilklinge beschädigt wurde. Sie wurde durch Schliff repariert, wozu eventuell die Klinge aus dem Schaft entfernt werden musste. Ob sich der Besitzer unmittelbar nach der Reparatur dazu entschied, die Klinge in einer exakt entgegengesetzten Position neu zu schäften oder erst später, entzieht sich unserer Kenntnis. Dass irgendwann jedoch eine Neuschäftung vorgenommen wurde, ist durch die Fundlage und den Riefenverlauf zu vermuten. Eine endgültige Klärung könnte eventuell eine Gebrauchsspurenanalyse liefern. Die Frage nach der ehemaligen Holmform ist abschließend nicht zu klären. In der Schweiz gelten Keulenkopfholme als schnurkeramische Normalform des Parallelbeils 29. Man könnte also diese Geradholmform als Schäftung für die vorliegende Beilklinge annehmen. Dabei spricht allein die Größe des Stückes bereits für eine direkte Schäftung, vermutlich in einem durchgehenden Schaftloch und gegen eine indirekte mittels eines Zwischenfutters aus Geweih. Überdies hätte sich ein solches erhalten müssen, wie die im Grab gefundenen Geweihartefakte zeigen. Auch eine direkte Schäftung in einem gegabelten Knieholm ist nicht auszuschließen. Dies ist eventuell sogar wegen der Größe des Stückes und der schlanken, spitznackigen Form zu favorisieren. Derartige Formen sind aus der Ostschweiz bekannt, wo sie sich bereits In der 2. Hälfte des 4. Jahrtausend v. Chr. als einzige Lösung auch für massivere Steinbeilklingen durchsetzen 30. Für diese Schäftungsart spricht auch die deutliche Schräglage der Klinge, bezogen auf die Grabgrubenwand. Das Artefakt ist auf allen vier Seiten über die gesamte Länge mit teilweise spiegelnden großflächigen Glanzzonen bedeckt. Wegen dieser Verteilung ist eine Interpretation dieses Merkmales als Schäftungsspuren problematisch, da man solche doch auf die nackenwärtige Hälfte begrenzt und dann wiederum besonders stark auf dort exponierten Partien erwarten würde. Sonstige Schäftungsspuren, wie z. B. zentral gelegene, querverlaufende Schnittspuren 31, sind makroskopisch nicht erkennbar. Die Abnutzungsspuren sprechen jedoch für eine intensive Verwendung des Stückes, natürlich in geschäfteter Form. Deshalb und nach aller Erfahrung ist davon auszugehen, dass sich Schäftungsspuren hätten entwickeln müssen. Auf dieser Basis könnte man annehmen, dass es sich bei den nackenwärtigen Glanzzonen doch um Schäftungsspuren (sog. Holzpolitur) handelt. Die normalerweise sichtbare Grenze dieser Schäftungszone wäre dann durch andersartige, nach der Schäftung entstandene Glanzzonen auf der schneidenwärtigen Hälfte überprägt worden und deshalb nicht erkennbar. Fragt man sich nach der möglichen Entstehung jener Glanzzonen, dann drängt sich eine Interpretation als klassischer Gebrauchsglanz auf. Dies umso mehr, als bei 26 Semenov 1976, Semenov 1976, Modderman 1970, Winiger 1981, Gross-Klee/Schibler 1995, Weiner 1998a. 33
12 Jürgen Weiner einer anzunehmenden Holzbearbeitung weit überwiegend ein Glanz entsteht, der von Spezialisten, die mit Gebrauchsspuren vertraut sind, ebenfalls als Holzpolitur bezeichnet wird. Beilklingen, vor allem aus Feuerstein mit teilweise intensivstem Spiegelglanz, hauptsächlich auf den Breitseiten, sind nicht selten. Wurde solcher Glanz früher als intentionelle Politur, d. h. als Ergebnis eines vermeintlich letzten Herstellungsschrittes von Beilklingen gedeutet, so steht mittlerweile fest, dass sich darin lediglich eine intensive und langjährige Arbeit mit solchen Artefakten reflektiert 32. Eine Überprüfung der Hypothese zur Entstehung der Glanzzonen kann nur durch eine Gebrauchsspurenanalyse gewährleistet werden. Das Stück besitzt eine insgesamt noch scharfe Schneide und macht einen jederzeit einsatzbereiten Eindruck. Die Länge der kleinsten Beilklinge (Obj. 1 6; Abb. 6,1) beträgt 48 mm, die maximale Breite entspricht der Schneidenbreite und beträgt 19 mm, die Dicke 13 mm bei einem Gewicht von 17 g. Das Stück trägt keine modernen Beschädigungen. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine stark verkleinerte Version der großen Beilklinge. Die Dorsal- und Ventralflächen sind vollständig fein überschliffen. Auf der Dorsalfläche gliedert sich der Schliff in eine kurze, deutlich halbrund abgesetzte Schneidenfacette und eine daran anschließende große Facette, die am Nackenende und der rechten Längskante von je einer weiteren Facette begleitet wird. Auf der Ventralfläche gliedert sich der Schliff dagegen in eine weit auf die Fläche verlaufende Schneidenfacette, die linksseitig von einer kleineren begleitet wird. Der restliche Abschnitt wird von drei schwach gegeneinander abgesetzten Schlifffacetten bedeckt. Tatsächlich gewinnt man den Eindruck, dass die Facette auf der Dorsalfläche stärker zur Schneide abfällt und balliger ausfällt als diejenige der Ventralfläche, die insgesamt flacher und keinesfalls ballig erscheint. Die rechte Schmalseite (Blick in Arbeitsrichtung) steht im rechten Winkel zu den Breitseiten und ist mit Ausnahme dreier antiker Bruchzonen flächendeckend geschliffen. Die linke Schmalseite neigt sich fast über ihre gesamte Länge von ventral nach dorsal. Sie ist nur parallel zur Ventralkante über einen schmalen Streifen durchgehend geschliffen und besteht sonst aus einer natürlich verrundeten Sprungfläche. Der Querschnitt des Stückes ist gebrochen rechteckig. Das Nackenende steht im rechten Winkel zu den Breitseiten und wird von einer kleinen überschliffenen Fläche gebildet. Links und rechts der Nackenpartie verlaufen zu beiden Schmalseiten alte bruchraue Flächen, von denen diejenige am Beginn der linken Schmalseite eindeutig als Reaktionsbruch von Kräften aus der Nackenrichtung interpretiert werden kann. Dies wäre zugleich ein Hinweis auf die Befestigung dieser Beilklinge in einer Schäftung mit Widerlager. Ein Blick auf den Schneidensaum zeigt, dass er geradlinig und überdies zentrisch verläuft. Somit wäre das Artefakt als Parallelbeilklinge anzusprechen. Zwar ist die rechte Schneidenecke im Vergleich mit der linken um knapp 1 mm zurückversetzt, aber insgesamt verläuft die Schneide im Umriss symmetrisch. Deshalb handelt es sich bei der geringfügigen Unregelmäßigkeit nicht um eine Abnutzung und damit um eine Gebrauchsspur, sondern um eine zufällige Abweichung von einer angestrebten symmetrischen Form als Folge des in Handarbeit vorgenommenen Schneidenschliffs. Auf den nackenwärtigen Abschnitten, vor allem der Dorsal- und Ventralflächen, ist ein deutlicher Schäftungsglanz erkennbar. Von diesem Schäftungsglanz gut zu unterscheiden sind weitere Glanzzonen, die sich ausschließlich auf den schneidenwärtigen Hälften der Dorsal- und Ventralfläche befinden. Sie vermitteln einen metallischen Eindruck, und sind auf der Dorsalfläche unter einer Lupe erkennbar an zwei Stellen mit winzigsten, goldglänzenden Partikeln vergesellschaftet. Analog zu vergleichbaren Beobachtungen an einigen Absplissen (s. u.), dürfte es sich um Flitter aus Schwefelkies handeln. Der Grund für das Vorkommen dieser Residuen an dem Stück entzieht sich momentan unserer Kenntnis. Eine eventuell entscheidende Erkenntnis im Hinblick auf die Schäftung, vor allem aber auf eine typologisch-ergologische Ansprache des Artefaktes, ergab sich auf der Suche nach Gebrauchsspuren bei genauerer Betrachtung der Schneidenfacetten und des Schneidensaumes. Auf der Ventralfläche befinden sich jeweils unmittelbar am Schneidenende zwei Zonen intensiven Glanzes von je ca. 2 mm Länge und vielleicht einem halben Millimeter Breite. Der dazwischen liegende Abschnitt weist nur in unmittelbarer Nähe zum Schneidensaum diffusen Glanz auf. Im Gegensatz dazu erstreckt sich auf der Dorsalfläche vom zentralen, am stärksten gewölbten Abschnitt des Schneidensaumes eine geschlossene Zone seidigen Glanzes auf einer annähernd D förmigen Fläche zum Ende der dortigen Schneidenfacette. Alles spricht dafür, dass es sich bei diesen Glanzzonen um asymmetrisch auf beiden Schneidenpartien ausgeprägte Gebrauchsspuren handelt. Asymmetrische Verteilung von Glanzzonen und besonders deren D förmige Konzentration am dorsalen Schneidenabschnitt wurden von bandkeramischen Dechselklingen beschrieben 33. Unabhängig davon gelten sie als typische Indikatoren für eine Querschäftung von Beilklingen unterschiedlicher Zeitstellung und diverser Gesteinsarten 34. Erst eine Gebrauchsspurenanalyse wird eine endgültige Klarheit zur Schäftungsart dieser Beilklinge liefern. Es würde freilich nicht wundern, wenn das Stück als Dechselklinge eines sog. Behaubeilchens identifiziert und damit ein bezeichnendes Licht auf die konventionell-typologische Ansprache mancher sog. Rechteckbeil chen werfen würde. Dass das Dechselprinzip in der Schnurkeramik bekannt war, lehren z. B. eigenwillig geformte Querbeilklingen aus Flint und als solche interpretierte sog. Rechteckbeile aus Felsgestein 35. Unabhängig davon, ob das Stück parallel oder quer geschäftet war, sind schnurkeramische Beilklingen 34
13 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim derart geringer Größe indirekt mit Zwischenfuttern unterschiedlicher Typen aus Geweih am eigentlichen Holm geschäftet worden 36. Ein gerade in diesem Falle zu erwartendes Zwischenfutter, das sich hätte erhalten müssen, ist aber nicht gefunden worden. Somit ist entweder davon auszugehen, dass das Artefakt direkt geschäftet war oder dass es ungeschäftet deponiert wurde. Im Vergleich zu der großen Beilklinge besitzt das kleine Stück einen noch spitzeren Schneidenwinkel. Die Schneide ist sehr scharf, und auch dieses Stück wäre jederzeit einsatzbereit. Die dritte Beilklinge (Obj. 1 7; Abb. 6,2) ist 114 mm lang, die maximale Breite beträgt 34 mm, die Schneidenbreite 20 mm, die Dicke 15 mm bei einem Gewicht von 91 g. Das Stück weist keinerlei moderne Beschädigungen auf und besitzt einen tropfenförmigen Umriss. Die Dorsalfläche ist mit Ausnahme zweier antiker bruchrauer Zonen (gekappte Zurichtungsnegative?) rechts und links der Schneide sowie einer längs zur rechten Schmalseite verlaufenden, nur im schneidennahen Abschnitt flüchtig überschliffenen, gleichartigen Zone vollständig überschliffen. Der Schliff lässt sich in zwei Großzonen aufteilen, die sich wiederum in Einzelfacetten gliedern. Zone 1 wird von einem größeren gedrungenen, längs und quer gewölbten Abschnitt der Schneidenfacette gebildet, die an ihrer rechten Seite (Blick in Arbeitsrichtung) durch einen abgewinkelten schmalen, kleineren Abschnitt ergänzt wird. Diese Zone endet an der höchsten Stelle der Dorsalfläche. Dort beginnt die weitaus größere Zone 2, die von drei parallelen und dachartig gegeneinander abgewinkelten Facetten bis zum Nacken bedeckt wird. Die Schneidenfacette weist ausschließlich in Längsrichtung verlaufende feinste Schleifspuren auf. Im Gegensatz dazu sind die drei Facetten auf Zone 2 von einem Muster deutlich erkennbarer, querverlaufender Riefen wie ein feiner Schleier zusätzlich überzogen. Die dachartigen Facetten lassen im übrigen die Dorsalfläche, unbeschadet des Verlaufes der dorsalseitigen linken Längskante, zumindest in ihrer schneidenwärtigen Hälfte, insgesamt deutlich quergewölbt erscheinen. Die Ventralfläche ist mit Ausnahme einer bruchrauen Fläche (gekapptes Zurichtungsnegativ oder Teil der Ventralfläche eines ehemaligen Abschlages) auf der linken Seite kurz vor der Schneide ebenfalls vollständig überschliffen. Hier verteilt sich der Schliff auf drei längsgerichtet-parallele Facetten. Die zentrale und größte Facette erstreckt sich vom Schneidensaum ohne erkennbare Unterbrechung bis zum Nacken. Sie wird auf der rechten Seite von einer langschmalen Einzelfacette flankiert, die mit schwacher Neigung in Richtung der scharfen Ventralkante der linken Schmalseite abfällt. Als Pendant findet sich eine wenn auch wesentlich kürzere Facette auf der linken Seite, die gleichermaßen schwach geneigt zur hier bruchrauen Oberfläche der rechten Schmalseite abfällt. Auf dem weitaus größten Teil der Ventralfläche wiederholt sich das von der Dorsalfläche bekannte Muster querverlaufender Riefen. Diese Riefen fehlen dagegen auf dem vordersten, schneidenwärtigen Abschnitt der Ventralfläche über eine Länge von rund 20 mm. Die Oberfläche entspricht derjenigen der gegenüberliegenden Schneidenfacette. Bei dieser riefenfreien Zone kann es sich jedoch nicht um eine ventrale Schneidenfacette handeln. Denn ihr schneidenwärtiger Abschnitt ist nicht winkelig vom Rest der Zone abgesetzt, sondern wölbt sich bruchlos auf den höheren Abschnitt der Ventralfläche. Erst in der Seitenansicht wird deutlich, dass sich eine eigenständige Schneidenfacette doch festlegen lässt. Es handelt sich um einen ca. 6 mm breiten ballig geformten Streifen, der einheitlich längs- und quergewölbt vom Schneidensaum bis zum Beginn des bruchrauen Zurichtungsnegatives und in derselben Höhe über dieses hinaus bis kurz unterhalb der linken Schneidenecke verläuft. Obwohl auch auf der Ventralfläche die beiden Seitenfacetten winkelig nach außen gegen die Zentralfacette gestellt sind, vermittelt sie keinesfalls den Eindruck einer Wölbung. Sie erscheint vielmehr auf den ersten Blick weitestgehend eben. Legt man das Stück indes auf eine glatte Unterlage und betrachtet es von der Seite, so wird deutlich, dass es nicht flächig, sondern nur punktuell aufliegt, und zwar an einem zentralen Punkt ca. 60 mm vom Nacken entfernt. Von dort ist in Richtung Nacken eine schwächere, in Richtung Schneide eine stärkere Längswölbung der somit längskonvexen Ventralfläche erkennbar. Auf der linken Seite wird die Beilklinge von einer senkrecht zur Dorsal- und Ventralfläche stehenden Schmalseite begrenzt. Sie besteht aus einer bruchrauen Fläche, die lediglich am schneidenwärtigen Ende und beiden Längskanten stärker überschliffen ist. Die rechte Schmalseite ist sehr unregelmäßig gearbeitet und nur an ihren prominentesten Stellen stärker überschliffen. Hier lässt die Schlifffacette querverlaufende Riefen erkennen. Diese Schmalseite verläuft nur über einen kurzen Abschnitt rechtwinkelig zu beiden Breitseiten, kippt dann bis zum Nacken im stumpfen Winkel zur Ventralfläche ab und ist bruchrau. Der dadurch bedingte Querschnitt des Stückes ist sehr unregelmäßig; im nackenwärtigen und mittleren Drittel ist er grob rechteckig, im schneidenwärtigen dagegen eher D förmig. Der Nacken verläuft spitz und wird von mehreren, winkelig geneigt zueinanderstehenden kurzen Facetten begrenzt. Im Umriss ist die Schneide gleichmäßig gewölbt. Der Schneidensaum verläuft in der Aufsicht geradlinig, fällt aber von der rechten Schneidenecke zur linken leicht ab. Die Position der Schneide ist zentrisch, und es dürfte nicht wundern, wenn das Artefakt konventionell als Parallelbeilklinge angesprochen würde. 32 Weiner 1996, Dohrn Semenov 1976, 130; 135 Abb. 65,1. 35 Weiner 1999a. 36 Gross-Klee/Schibler 1995, ; Winiger 1981,
14 Jürgen Weiner Sehr deutliche, zum Teil spiegelnde Glanzzonen auf den nackenwärtigen Hälften der Dorsal- und Ventralfläche werden als Schäftungsglanz interpretiert. Dorsal finden sie sich flächig verteilt an den höchsten Partien der Oberfläche und am linken Nackenende. Ventral erstrecken sie sich hauptsächlich parallel zu beiden Längskanten. Vergleichbare Spuren erstrecken sich an den dorsal- und ventralseitigen scharfen Kanten der linken Schmalseite sowie auf korrespondierenden Kantenabschnitten der rechten Schmalseite. Vorbehaltlich einer Gebrauchsspurenanalyse dürfte es sich um eine sog. Holzpolitur handeln. Auf der dorsalen Schneidenfacette erstreckt sich direkt hinter dem Schneidensaum über eine Breite von ca. 6 mm auf ganzer Länge der Schneide ein diffuser Seidenglanz. Am Schneidensaum selbst ist im Schräglicht eine Folge zahlreicher, ca. 1,5 mm langer, mit überwältigender Mehrheit parallel zur Längsrichtung und im rechten Winkel zum Schneidensaum verlaufender Riefen zu erkennen. Die ventrale Schneidenfacette ist mit einem vergleichbaren Seidenglanz bedeckt. Auch hier verlaufen vom Schneidensaum parallel aufgereihte Riefen, die jedoch nur Bruchteile von Millimetern lang sind; zusätzlich finden sich zwei winzige Ausbrüche. Alle beschriebenen Merkmale werden als Gebrauchsspuren interpretiert. Die zentrische Schneidenstellung des Artefaktes könnte eventuell eine Ansprache als Parallelbeilklinge nahelegen. Zwei Merkmale, Form und Gebrauchsspuren, sprechen jedoch gegen diese Überlegungen. Die diagnostisch wichtigsten Ausprägungen der Form bestehen darin, dass die Ventralfläche unbeschadet einer deutlichen Längs- und einer minimalen Querwölbung insgesamt einen flacheren Verlauf als die demgegenüber stark gewölbte Dorsalfläche besitzt. Tatsächlich würde dieses Artefakt, schon allein wegen der Gesteinsart, etwa in bandkeramischem Fundkontext a priori keine Irritation hervorrufen. Zwar würden bei genauerer Betrachtung die unregelmäßige Form und vor allem die ballige ventrale Schneidenfacette auffallen. Letztlich würde sie aber mit der vorgegebenen Form des verwendeten Rohstückes erklärt und als Dechselklinge vom Typ 1 bestimmt werden 37. Bandkeramische Dechselklingen untypischer Form sind nicht selten. Eine diagnostisch noch bedeutendere Merkmalausprägung stellt das Vorkommen und die Position der Riefen am Schneidensaum dar. Gebrauchsspuren dieser Art können nur entstehen, wenn das ehemalige Beil beim Schlag parallel zur Körperachse und nicht im spitzen Winkel dazu geführt wird 38. Völlig vergleichbare Riefen treten an altneolithischen Dechselklingen auf, und es steht fest, dass es sich nicht um Schleifspuren von der Zurichtung der Schneide, sondern um typische Gebrauchsspuren handelt, die charakteristisch für eine Querschäftung sind 39. Damit steht fest, dass das Artefakt eine Querbeilklinge ist und als Dechselklinge angesprochen werden muss. In diesem Sinne bestätigt das Stück eine Feststellung von U. Fischer, wonach Die schnurkeramische Kultur es anscheinend auf Überraschungseffekte abgesehen hat 40. Da auch für diese Klinge ein Zwischenfutter fehlt, war sie ehemals, wie ihre beiden Schwesterstücke, direkt in einem (Knie-)Holm geschäftet. Interessanterweise kennen wir zwar aus bandkeramischen Gräbern hunderte von Dechselklingen, aber nach wie vor fehlt jeder Hinweis auf ein Zwischenfutter. Obwohl die Form der schnurkeramischen Dechselklinge gewiss nicht als besonders symmetrisch zu bezeichnen ist, weist das Stück deutliche Schäftungs- und Abnutzungsspuren auf. Dies führt zu dem Schluss, dass die ehemalige Dechsel offensichtlich längere Zeit und überdies intensiv verwendet wurde. Wegen des charakteristischen Formschemas bandkeramischer Dechselklingen darf man für diese grundsätzlich voraussetzen, dass für beide Haupttypen aller Größen möglichst symmetrische Formen angestrebt wurden. Wenn aber eine unsymmetrische und deshalb nicht einfach zu schäftende schnurkeramische Dechselklinge allem Anschein nach direkt in einem Knieholm befestigt und das Gerät anschließend offensichtlich erfolgreich benutzt wurde, dann erscheint es bei aller gebotenen Vorsicht zulässig, dies zumindest als weitere Stützung der Hypothese einer direkten Schäftung auch bandkeramischer Dechselklingen zu betrachten, zumal deren symmetrische Form eine ebenfalls direkte Schäftung zweifellos erleichtert haben sollte. Auch dieses Artefakt besitzt noch eine scharfe Schneide und ist funktionsfähig. Interpretation und Rekonstruktionsversuch zur Niederlegung der ehemaligen Beile Der Tote wurde mit einem funktionsfähigen Parallelbeil, sicher mit einer gleichermaßen funktionsfähigen mittelgroßen Dechsel und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einer zweiten in Form eines sog. Behaubeilchens ohne Zwischenfutter ausgestattet. Die Fundlage der Beilklingen gestattet mit hinreichender Genauigkeit die Rekonstruktion der Positionen der ursprünglich niedergelegten Kompositgeräte (Abb. 7). Als Orientierungshilfen für mögliche Holmformen dienen schnurkeramische und Horgener Parallelund Knieholme 41, der schnurkeramische Dechselschaft von Stedten, Kr. Eisleben und der endneolithische aus Nieuw-Dordrecht (Niederlande) 42, das Beil des Mannes vom Hauslabjoch 43, sowie das möglicherweise endneolithische Exemplar vom Dümmer Weiner 1996, Semenov 1976, 130; 131, Abb. 63; 132, Abb Weiner/Pawlik Fischer 1958, Winiger 1981, 201,1; 1991, Weiner 1999a. 43 Egg/Spindler 1992, Schirnig
15 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Abb. 7. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble 2. Hypothesen zur Deponierung. 1 Grabzeichnung mit Schäftung der Parallelbeilklinge in einem Parallelholm, sog. Keulenkopf, in liegender Position; 2 Wie 1, aber in stehender Position; 3 Schäftung der Parallelbeilklinge in einem Knieholm in liegender Position; 4 Wie 3, aber in stehender Position. M. 1 :
16 Jürgen Weiner Die Fundlage des kleinsten Stückes auf seiner rechten Schmalseite ist ein weiteres Indiz für die Interpretation als Dechselklinge und die Schäftung in einem Knieholm. Die mittelgroße Dechselklinge lag bei der Bergung auf ihrer Dorsalseite. Ihre ursprüngliche Schäftung in einem Knieholm und eine auf die rechte Schmalseite gestellte Position nach der Deponierung der Dechsel macht die Fundlage verständlich. Sie ist als Ergebnis des Zersetzungsprozesses einer mutmaßlichen Bindung und des Holms zu verstehen. Die Fundlage der Parallelbeilklinge kann, muss aber nicht die originäre Position bei der Niederlegung widerspiegeln. Unabhängig von der Holmform erlaubt sie sowohl die Rekonstruktion in liegender als auch in an die Längswand der Grabgrube angelehnter, auf der Schneide stehender Form. Hieraus und aus den beiden Holmalternativen für die Parallelbeilklinge ergeben sich vier hypothetische Möglichkeiten der Deponierung (Abb. 7,1 4). Ensemble 3 Das dritte Fundensemble besteht insgesamt aus 18 Artefakten, sieben Pfeilspitzen 45, einem Abschlag, einem Feuerschlagstein, einem Schleifsteinbruchstück, einem Knochenbeitel, zwei vollständigen Druckstäben, einem Druckstabfragment, einem Pfriem und drei Hauern sowie allen Retuschierresten, die eng beieinanderliegend gefunden wurden. Bei allen sieben zum Ensemble gehörenden Pfeilspitzen ist nicht mit letzter Sicherheit zu entscheiden, ob es sich bei den hier als gekappte Reste von Dorsalflächennegativen bzw. Ventralflächen angesprochenen Merkmalen tatsächlich um die korrespondierenden Flächen der ehemaligen Abschläge handelt. Die hier gewählte Festlegung von Dorsal- und Ventralansichten muss also nicht die Originalpositionen an den zur Herstellung verwendeten Abschlägen widerspiegeln. Sie folgt durchaus subjektiven Eindrücken des Verlaufes und Gesamteindruckes dieser größeren Restflächen auf den Stücken. Obj. 1 1: Die Länge beträgt 17 mm, die Breite 17 mm, die Dicke 3,1 mm bei einem Gewicht von 0,8 g. Das Stück ist dorsal vollständig flächenretuschiert; ventral sind in der Mitte und der linken Ecke noch geringe Reste einer Ventral(?)fläche erhalten. Ansonsten ist das Stück flächendeckend retuschiert und weist eine starke Zähnung auf (Abb. 8,1). Obj. 1 2: Die Länge beträgt 20,5 mm, die Breite 17,6 mm, die Dicke 2,3 mm bei einem Gewicht von 0,8 g. Das Stück ist dorsal an der Spitze flächig, sonst nur randlich retuschiert und trägt Reste eines Dorsalnegatives. Ventral ist es an der Spitze flächig, sonst randlich retuschiert mit Resten einer Ventralfläche (Abb. 8,2). Obj. 1 3: Die Länge beträgt 20 mm, die Breite 18,5 mm, die Dicke 2,8 mm bei einem Gewicht von 1,0 g. Das Stück ist dorsal an der Basis und beiden Längskanten bis zur Mitte flächig, dann randlich und an der Spitze wieder flächig retuschiert. Im Zentrum liegen Reste eines Dorsalnegatives. Ventral überwiegt die randliche Retuschierung, so dass sich ein großer Rest einer Ventralfläche erhalten hat. Bemerkenswert ist ein beidseitiger starker Glanz auf den Graten (Abb. 8,3). Obj. 1 4: Die Länge beträgt 20,1 mm, die Breite 17,7 mm, die Dicke 3,3 mm bei einem Gewicht von 0,8 g. Das Stück ist dorsal vollständig und ventral bis auf einen kleinen Rest einer Ventral(?)fläche flächenretuschiert (Abb. 8,4). Obj. 1 5: Es ist das einzige Stück, bei dem die Länge mit 19,2 mm kleiner ist als die Breite mit 19,6 mm. Die Dicke liegt bei 2,6 mm, und das Gewicht beträgt 0,8 g. Dorsal ist das Stück an der Basis und der linken Seite randlich, an der rechten Seite flächig retuschiert und weist zentral zwei gleichgerichtete Negative auf, bei denen es sich um Reste von Dorsal(?)flächennegativen handeln könnte. Ventral ist es an der Spitze flächig, sonst randlich retuschiert und trägt im Zentrum einen großen Rest einer Ventral(?)fläche (Abb. 8,5). Obj. 1 10: Die Länge beträgt 19 mm, die Breite 18,3 mm, die Dicke 2,7 mm bei einem Gewicht von 0,8g. Die Dorsalfläche ist an der Basis und der linken Ecke flächig, sonst randlich retuschiert und zeigt den Rest eines Dorsalnegatives. Ventral ist es an der linken Kante flächig, sonst randlich retuschiert, im Zentrum befindet sich ein großer Rest einer Ventralfläche (Abb. 8,6). Obj. 1 11: Die Länge beträgt 19,1 mm, die Breite 18,4 mm, die Dicke 3 mm bei einem Gewicht von 0,8 g. Das Stück ist dorsal vollständig flächenretuschiert. Ventral ist es an der linken Ecke flächig, sonst randlich retuschiert und trägt noch einen großen Rest einer Ventralfläche. Dies ist das einzige Exemplar, dessen Spitze um Bruchteile eines Millimeters abgebrochen ist. Letzteres beeinträchtigt jedoch die Funktion nicht (Abb. 8,7). Auffallend ist eine feine und gleichmäßige Randzähnung (z. B. Obj. 1 2; 1 3; 1 4; 1 5). Das beste Beispiel dafür liefert die Spitze Obj. 1 1: Hier sind auf der linken Längskante insgesamt vier nebeneinanderliegende, von kleinen Vorsprüngen getrennte, halbrunde Bruchstellen erkennbar, die mit vier auf die Fläche greifenden Negativen korrespondieren. Die Breite der Bruchstellen ist einheitlich und beträgt 1,0 mm, die Länge der Negative 3,5 4 mm. Die Bruchstellen liegen am Beginn der Negative und markieren die ehemaligen Ansatzstellen des Funktionsendes eines Druckgerätes. Ihre winzige Größe führt zu dem Schluss, dass das zur Retuschierung verwendete Druckgerät ein Funktionsende mit einer sehr schlanken Spitze besessen haben muss. Dies schließt a priori die Verwendung des massiven Druckstabes wegen der beide Male breiten Funktionsenden aus. Der zweite Druckstab besitzt zwar deutlich spitzere Funktionsenden, aber das Material ist letztlich viel zu weich, um halbrunde Trennbrüche der beschriebenen Dimensionen produzieren zu können. Als einziges auch experimentell vielfach bewährtes Material, das eine erfolgreiche Kraftübertragung auf solch winzigen Flächen erlaubt, ohne nennenswert komprimiert zu werden, verbleibt Kupfer. 38
17 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Dies führt zu der Überlegung ob für die Herstellung einer Randzähnung die Verwendung eines Druckstabes mit einem Funktionsende aus Kupfer verwendet wurde. Als geeignete, nachgewiesene Werkzeugform des schnurkeramischen Geräteensembles bieten sich dafür die sog. Kupferpfrieme an 46, wie sie auch aus bayerischen Gräbern der Glockenbecherkultur geläufig sind 47. Der Herstellungsablauf könnte demnach wie folgt rekonstruiert werden: Das Ausgangsstück (Abschlag) wurde in Drucktechnik unter Verwendung der Geweihdruckstäbe in der Dicke reduziert. Zugleich wurde die Form festgelegt 48. In einem abschließenden Arbeitsschritt wurde die Randzähnung mittels eines geschäfteten Kupferpfriemes als Druckstab vorgenommen und dabei eventuell der Randverlauf begradigt. In einem Grab der Glockenbecherkultur traten ebenfalls außerordentlich fein gezähnte Pfeilspitzen auf 49. Die Pfeilspitzen sind in jeder Beziehung als qualitativ herausragend zu bezeichnen. Ihre metrischen und qualitativen Merkmale legen die Annahme nahe, dass alle Stücke aus der Hand eines Steinbearbeiters stammen. In sechs von sieben Fällen stimmt das Gewicht absolut überein, eine wünschenswert deutliche Rechtfertigung dafür, die Stücke als genormt zu bezeichnen. Eine vergleichbar strenge Normung bei den metrischen Maßen findet sich auch bei den Pfeilspitzen aus dem Grab von Kösching 50. Damit wird eindrücklich die Fähigkeit ihres Herstellers unterstrichen, aus diversen Silexvarianten und gewiss unterschiedlich dimensionierten Ausgangsstücken (Abschlägen) unter Anwendung standardisierter Techniken und Methoden eine reine Zweckform anzufertigen, die sich einer lediglich in der Vorstellung existierenden Idealform ( mental template ) optimal annäherte. In Ensemble 3 liegen insgesamt 115 vollständige und fragmentarische Absplisse vor; das größte vollständige Exemplar ist 13 mm lang, das kleinste 3 mm. Fragmente treten bis zu einer Länge von ca. 0,5 mm auf. Die Absplisse lassen sich makroskopisch in drei Mate rialgruppen einteilen: 1. Weiß/hellgrau, 2. Dunkelbraun/ dunkelgrau und 3. Gelb/gelbgrau. Gruppe 1 ist bei weitem am stärksten vertreten und enthält auch die größten Exemplare, Gruppe 2 umfasst acht, Gruppe 3 drei Stücke. Trotz mehrfacher Versuche gelang es nicht, irgendeinen Abspliss an eines der mit gefundenen Silexwerkzeuge anzupassen. Die Pfeilspitze Obj. 1 5 wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus einem Präparationsabschlag von der Dolchklinge des Mannes hergestellt. Aufgrund der ungewöhnlichen Abb. 8. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble 3. Sieben Pfeilspitzen. 1 Obj. 1 1; 2 Obj. 1 2; 3 Obj. 1 3; 4 Obj. 1 4; 5 Obj. 1 5; 6 Obj. 1 10; 7 Obj M. 1 : Bei den Pfeilspitzen wurden von A. Tillmann Buxheimer und Attenfelder Hornstein bestimmt. 46 Ottaway z. B. Kreiner 1992; Schmotz Weiner 1987, Schmotz Tillmann 1996,
18 Jürgen Weiner Farbe der Exemplare aus Gruppe 3 ist davon auszugehen, dass sie vom gelbgrauen Ende des Feuerschlagsteines stammen. Ein Abschlag (Obj. 1 17; Abb. 9,1) hat eine Länge von 14 mm, die Breite beträgt 14 mm, die Dicke 4 mm bei einem Gewicht von 4 g. Es handelt sich um einen deutlich in Längsrichtung gekrümmten, unmodifizierten Abschlag aus weißlich-hellgrauem, mit zonierten Schlieren durchsetztem, am Rand durchscheinenden Hornstein 51, der in direkter harter oder weicher Schlagtechnik hergestellt worden ist. Allem Anschein nach bestehen die Pfeilspitzen Obj. 1 1; 1 3 und 1 4 aus dem gleichen oder einem ähnlichen Material. Die Dimensionen des Abschlages würden die Herstellung einer Pfeilspitze des mit gefundenen Typs erlauben, die wegen der Krümmung freilich vollständig flächenretuschiert ausfallen müsste. Somit ließe sich der Abschlag als Reservestück ( blank ) für die Pfeilspitzenherstellung interpretieren. Der Feuerschlagstein (Obj. 1 32; Abb. 9,2) ist 69 mm lang, 26 mm breit und wiegt bei einer Dicke von 11 mm 21 g. Das Stück weist dorsal und ventral Flächen auf, die wegen eindeutig erkennbarer Wallnerlinien als Reste gekappter Negative anzusprechen sind. Allerdings besitzen jene Flächen eine raue Oberfläche, und in einem Falle zeichnet ein solches Negativ an der linken Kante der Dorsalfläche am Distalende einen teilweise in den Objektkörper verlaufenden Haarriss nach. Große, auf beiden Breitseiten verlaufende gekappte Negative deuten darauf hin, dass das Stück zuerst grob in Form gebracht und später zumindest auf der Dorsalseite randlich in Drucktechnik überarbeitet wurde. Als Gebrauchsspuren sind Verrundungen und Zerrüttung beider Längskanten sowie besonders deutliche Verrundungen beider Enden zu erkennen. Die untere Hälfte besitzt eine gelbgraue Farbe, die völlig derjenigen der drei Absplisse von Gruppe 3 entspricht. Die Dorsalfläche eines der Absplisse ist in Längsrichtung auf einer Hälfte gelb, auf der anderen dagegen eher grau gefärbt. Diese Farbgebung läuft offensichtlich durch das Material hindurch, da sie auch auf der Ventralfläche zu erkennen ist. Aufgrund dieser Beobachtung dürfte es sich auch bei der farblich korrespondierenden Zone des Feuerschlagsteines um die natürliche Gesteinsfarbe und nicht um eine chemische Veränderung etwa durch Schwefelkies handeln. Die Negative und Grate auf diesem Abschnitt tragen alle einen metallischen Glanz, der auch an experimentellen Feuerschlagsteinen zu beobachten ist 52. Die Länge des Schleifsteinbruchstücks (Obj Abb. 9,3) beträgt 67 mm, die Breite 53 mm, die Dicke 47 mm bei einem Gewicht von 100 g. Das pyramidenförmige Stück besteht aus äußerst feinkörnigem, homogenem Sandstein. Es besitzt zwei stark gewölbte Schliffbahnen; die restlichen drei Flächen sind durch Bruch entstanden. Eine Schliffbahn ist nahezu unfacettiert mit konkavem Quer- und Längsschnitt; nur am Rand der dicken Basis weist sie eine kleine separate Schlifffacette auf. Die andere Schliffbahn lässt zusätzlich zwei Abb. 9. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble 3. 1 Abschlag Obj. 1 17; 2 Schlagstein Obj. 1 32; 3 Schleifstein Obj M. 1 : 1; 2 3 M. 2 : 3. 40
19 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim schwache, von der Basis bis etwa zur Mitte verlaufende, längliche Schlifffacetten erkennen. Wegen der charakteristischen Form und Lage der Schliffbahnen dürfte es sich um das Bruchstück einer ehemals größeren Schleifwanne zum Schleifen von Beilklingen handeln. Schleifsteine sind eine nicht ungewöhnliche Beigabe in schnurkeramischen Gräbern 53. Ein formal gut vergleichbares, größeres Stück stammt aus dem Grab von Bergheim 54. Die Länge des Knochenbeitels (Obj. 1 12, Abb. 10) beträgt 153 mm, die maximale Breite am Gelenkende 41 mm, die Schneidenbreite 13 mm und die maximale Dicke am Gelenkende 38 mm. Traditionell werden solche Artefakte als Meißel bezeichnet. Der Rohstoff Knochen erlaubt jedoch nur einen sinnvollen Einsatz solcher Stücke bei der Holzbearbeitung, z. B. beim Ausstemmen von Schaftlöchern an Beilholmen. In Anlehnung an eine moderne Werkzeugform für derartige Holzarbeiten sollte man deren Bezeichnung Beitel auch für ihre prähistorischen Pendants verwenden. Der Beitel besteht aus einem längsgespaltenen Röhrenknochen eines Großsäugers (wahrscheinlich Radius vom Rind) 55 mit teilweise erhaltener Gelenkpfanne. Das Funktionsende wurde aus der Kompakta des Diaphysenabschnittes gearbeitet und ist beidseitig zu einer schwach konvex geschwungenen Schneide mit balligem Längsschnitt zugeschliffen. Die Schneide wird rechts und links von zwei im rechten Winkel zu ihr stehenden Seitenfacetten begrenzt. Der Körper verbreitert sich kontinuierlich bis zum erhaltenen Teil der ehemaligen schwach konkaven Gelenkpfanne (Epiphyse); deren höher stehende Randpartie verschliffen ist. Die Dorsalfläche wird von der halbrunden Außenseite des Knochens gebildet und trägt Verwitterungsspuren. Die Ventralfläche lässt nur im Abschnitt unterhalb der Gelenkpfanne Spongiosareste erkennen. Die Kompakta ist sehr massiv und auf der Ventralfläche von deren Mittelabschnitt bis zur Schneide überschliffen. Nicht verwitterte Oberflächenpartien der Dorsalfläche tragen deutlichen Glanz, der als Handhabungsglanz anzusprechen ist. Dagegen handelt es sich bei dem gleichermaßen deutlichen Glanz auf beiden Schneidenbreitseiten und einer Seitenfacette um Gebrauchsglanz. Auf der Dorsalfläche ist hart unterhalb der Gelenkpfanne eine annähernd runde, mehrere Millimeter tief in die Kompakta eingreifende Zone erkennbar, deren Oberfläche durch zahlreiche lineare, teilweise radial verlaufende kurze, fallweise scharfkantige Hiebspuren bedeckt ist. Offensichtlich wurde der Beitel auch als Schlaggerät benutzt, wodurch diese Gebrauchsspuren entstanden. Die Intensität der Abnutzung und die Ausprägung der Hiebmarken legen die Annahme nahe, dass ein hartes, scharfkantiges Material, z. B. Hornstein, bearbeitet wurde. Wegen der auf den Werkzeugkörper nach innen und überdies auf die konkave Außenseite des Gelenkendes versetzten Lage der Abnutzungszone, ist die Verwendung des Artefaktes als Schlaggerät bei der Silexbearbeitung in direkter Schlagtechnik eindeutig auszuschließen. Wesentlich eher könnten solche Abb. 10. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble 3. Knochenbeitel Obj M. 1 : 2. Spuren z. B. durch die Arbeit mit ausgesplitterten Stücken erklärt werden. Der Beitel wäre dann als Schlägel benutzt worden. Es handelt sich also um ein bifunktional eingesetztes Werkzeug. Ein vollständiger massiver Druckstab (Obj. 2 24; Abb. 11,1) ist 118 mm lang, die Breite liegt bei 19 mm und die Dicke beträgt 13 mm. Als Rohstück diente ein Span, der aus einem stark gebogenen Abschnitt einer Geweihstange vom Rothirschgeweih abgetrennt wurde. Die natürliche Biegung favorisiert die ehemalige Lage des Spanes z. B. am unteren Ansatz einer Mittel sprosse oder an entsprechend gebogenen Abschnitten einer starken Krone. Spuren der Trennflächen sind auf beiden Längskanten über eine kurze Strecke noch erhalten. Der zentrale Spongiosaabschnitt ist weitgehend ausgebrochen und dürfte ehemals überschliffen gewesen sein. Ursprünglich besaß das Stück einen unregelmäßig ovalen Querschnitt. An einem Ende ist es verrundet, am anderen facettiert. Auf der Dorsalfläche ist die Kompakta an einem Ende durch nicht unerhebliche longitudinale Krafteinwirkung aus Richtung der Spitze in Form eines Negativs ausgebrochen. Ähnliches kennt man von jungpaläolithischen und neolithischen Geweihschlägeln. Der ursprünglich symmetrisch-ovale Umriss wurde durch drei Abnutzungszonen auf den Längskanten modifiziert, von denen zwei deutlich konkav in den Gerätekörper greifen. Diese Zonen erstrecken sich über einige Zentimeter Länge und liegen einmal einseitig 51 Das Rohmaterial des Stücks wurde von A. Tillmann als Attenfelder Material bestimmt. 52 Pawlik 1995, Buchvaldek 1992; Wetzel Tillmann/Schröter Clason 1969; Schibler 1981, 61; Schmid
20 Jürgen Weiner Abb. 11. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble Druckstäbe Obj. 2 24; Obj. 2 25; Obj. 1 16; 4 Pfriem Obj M. 1 : 2. und einmal gegenständig jeweils vor beiden Enden. An diesen Stellen ist die Oberfläche der hier zusammentreffenden Kompakta und Spongiosa von quer und diagonal verlaufenden Schlagspuren bedeckt. Interessanterweise liegen die Zonen intensivster Abnutzung nicht unmittelbar am Ende, sondern ca. 23 mm und 26 mm unterhalb beider Enden. Die Intensität dieser Gebrauchsspuren ist ein Indiz für die zusätzliche Verwendung des Druckstabes als Schlaggerät. Aus technologischer Sicht wäre es nicht richtig, die Zonen als Merkmal einer sekundären Verwendung anzusprechen. Es ist eher davon auszugehen, dass das Gerät während seiner Verwendung im Wechsel für die Druck- und die Schlagtechnik eingesetzt wurde. Die diagonale Lage der beiden stärker ausgeprägten Abnutzungszonen erinnert an vergleichbar positionierte Arbeitsspuren auf paläolithisch-neolithischen sogenannten Retuscheuren aus Felsgesteingeröllen 56. Der Druckstab wurde also bifunktional benutzt. Der zweite vollständige Druckstab (Obj. 2 25, Abb. 11,2) ist deutlich schlanker, seine Länge beträgt 93 mm, die Breite 15 mm und die Dicke 9 mm. Das Stück wurde aus einem Geweihspan eines stark geperlten Hirschgeweihs angefertigt und besitzt den langdreieckigen Umriss eines flachen Walmdaches. Der Querschnitt in der Mitte ist unregelmäßig gebrochen, an beiden Enden rundlich. Die teilweise langrechteckig facettierten Trennflächen an der Kompakta sind nicht überschliffen und auf einer Längskante vollständig, auf der anderen zu mehr als einem Drittel erhalten. Die restlichen zwei Drittel sind anscheinend bei der Bergung beschädigt worden. Beide Enden sind durch Schliff zugespitzt und teilweise facettiert. Ein Teil der Spongiosa ist wahrscheinlich beim Bergen ausgebrochen. Das Objekt 1 16 (Abb. 11,3) stellt den Rest eines Druckstabes oder Pfriemes dar, dessen Länge noch 72 mm beträgt, die Breite liegt bei 12 mm und die Dicke bei 8 mm. Das Stück besteht aus einem Geweihspan und trägt an beiden Längsseiten noch schwache Spuren der Spangewinnung. Beide Enden sind durch Korrosion vollständig überprägt. Der Querschnitt ist rechteckig. Der Pfriem (Obj. 2 26, Abb. 11,4) ist 164 mm lang, 10 mm breit und 8 mm dick. Das in Längsrichtung gebogene Stück besteht aus einem dünneren Geweihspan. Teilweise sind an den Längsseiten noch Schnittspuren der Spangewinnung zu erkennen. Ein Ende läuft gleichmäßig zu einer im Querschnitt facettierten Spitze aus. Nur das äußerste Spitzenende ist minimal beschädigt. Eine vergleichbare Spitze dürfte auch am anderen Ende vorhanden gewesen sein. Sie ist jedoch durch Verwitterung und vermutlich bei der Bergung ausgebrochen. Der Querschnitt ist rechteckig, an den Enden rundlich. Bei einem bearbeiteten linken Hauer eines Ebers (Hausschwein) oder Keilers (Wildschwein) (Obj. 1 15; Abb. 12,1) ist eine Bestimmung des Lebensalters über den Zahnindex nicht möglich, da der Querschnitt intentionell verändert wurde 57. Die Modifikationszone erstreckt sich über die gesamte Länge der hier ehemals durchlaufend vorhandenen linken Innenkante, wodurch auch die linke Hälfte der sog. Angriffsfläche (natürliche Ab- 42
21 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Abb. 12. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Ensemble Zwei bearbeitete Eberhauer Obj. 1 15; Obj. 1 13; 3 Großer Eberhauer Obj M. 1 : 2. nutzungsfacette an der Zahnspitze) betroffen ist. Die Kante wurde vollständig entfernt, wobei der Schmelz durchtrennt und das sog. Bein 58 freigelegt wurde. Zahlreiche, auf dieser Zone erkennbare feinste, überwiegend quer- und nur an der Zahnspitze schrägverlaufende Riefen legen nahe, dass die Modifikation in Schleiftechnik mittels eines körnigen Schleifsteines z. B. aus Sandstein geschah. Der mit gefundene Schleifstein dürfte hierfür nicht in Frage gekommen sein. Er erscheint zu feinkörnig. Vor allem aber müssten an seinen für diese Arbeit einzig geeigneten Kanten entsprechende Abnutzungsspuren erkennbar sein. Zum Schärfen der Schneide hätte er aber sicher dienen können. Wie intensiv die Schleifarbeit war, zeigt ein kleiner, in Querrichtung tief eingeschliffener, wenige Millimeter breiter stufenförmiger Absatz unterhalb der Angriffsfläche. Auch die Spitze ist künstlich verrundet. Im Gegensatz zu dem zweiten bearbeiteten Exemplar (s. u.) ist das vorliegende deutlich kleiner. Ausgehend von den Dimensionen der noch erhaltenen Reste der Angriffsfläche dürfte das Stück noch etwa ein Drittel seiner ursprünglichen Länge besitzen. Der wichtigste Unterschied zu dem zweiten bearbeiteten Stück besteht jedoch darin, dass hier die Modifikationszone bis zur Außenkante des Zahnbogens reicht, wodurch sich an der Schmelzschicht eine scharfe durchgehende Schneide gebildet hat. Der Querschnitt ist hier flach-spitzoval. Bei dem zweiten bearbeiteten Hauer (Obj. 1 13; Abb. 12,2) handelt es sich ebenfalls um den linken Hauer eines Ebers oder Keilers. Das Alter des Tieres ist nicht mehr zu bestimmen. Die Modifikation setzt kurz unterhalb der Angriffsfläche an und verläuft bis zur Alveole. In Querrichtung erstreckt sie sich von der rechten Innenkante nahezu vollständig über die linke Zahnseite. Dadurch wurde der ehemals typische dreieckige Querschnitt zu einem unregelmäßig-ovalen verändert. Allerdings erreicht die Schliffzone nirgendwo die Vorderkante auf der Außenseite des Zahnbogens, sondern endet 5 mm bis 10 mm davor. Auch hier sind zahlreiche querverlaufende Riefen erkennbar. Die Zahnspitze ist noch natürlich scharf und nicht verrundet, das Alveolenende ist modern ausgebrochen. Eventuell endete es spitz. Vergleicht man dieses Stück mit dem anderen bearbeiteten Exemplar, dann wird klar, dass es sich hier um ein Halbfabrikat handelt, dessen Schneide noch nicht vollständig ausgebildet ist. Der dritte Hauer (Obj. 1 14; Abb. 12,3) ist ein unbearbeitetes, vollständiges linkes Exemplar eines kapitalen Ebers oder Keilers; aufgrund des Zahnindexes betrug das Alter des Tieres mindestens acht oder mehr Jahre 59. Interpretation Die kleinräumige, dicht neben- und übereinander gepackte bzw. ineinander gestaffelte (Hauer) Fundlage dieses Artefaktensembles deutet zwingend auf ein mittlerweile vergangenes Behältnis aus organischem Material, d. h. einen Beutel oder eine Tasche aus Leder oder Textilien. Vergleichbare Grabbefunde sind aus dem Neolithikum bestens bekannt 60 und sprechen für eine einfache 56 Weiner Herre Schmid Herre z. B. Kórek 1986; Nieszery 1995, ; Matthias 1964; Patay 1974, 12; Tillmann 1996, 365; Schmotz 1989; 1992; Seitz
22 Jürgen Weiner und sinnvolle Lösung eines speziellen Aufbewahrungsund darüber hinaus auch Transportproblems. Herkunft der Absplisse: Sowohl die Form als auch die Größe der Absplisse erlaubt es, sie als Retuschierreste anzusprechen. Dabei dürften die besonders dünnen vollständigen und fragmentarischen Exemplare von der Druckretuschierung z. B. bei der Pfeilspitzenherstellung stammen. Da alle Absplisse viel zu klein sind, um irgendeinem praktischen Zweck zu dienen, fragt man sich, warum sie in dem Behältnis angetroffen wurden. Eine mögliche Antwort liefern Beobachtungen bei der modernen Herstellung steinzeitlicher Steingeräte. Im Besitz des Verf. befindet sich eine kleine Stofftasche, in der seit gut 20 Jahren seine Geräte für die Druckretuschierung aufbewahrt werden. Während der Arbeit befindet sich die geöffnete Tasche links oder rechts in unmittelbarer Nähe des Sitzplatzes, so dass die erforderlichen Geräte bei Bedarf entnommen werden können. Vor einiger Zeit wurde die Tasche vollständig entleert, wobei einige Absplisse und Abschläge gefunden wurden, die offensichtlich irgendwann bei der Arbeit zufällig in das Behältnis gelangt sind. Auf diese Weise könnte die Fundlage der Absplisse aus dem Gaimersheimer Beutel erklärt werden. Alternativ könnte man sie als Hinweis auf eine Vorsichtsmaßnahme interpretieren. Dies würde die Annahme voraussetzen, dass der Mann in einem Raum arbeitete, dessen Boden durch die scharfkantigen Stücke nicht verunreinigt werden sollte. So hätte er seine Werkstücke über dem geöffneten Beutel retuschieren und die Absplisse auffangen können. Diese Annahme erscheint jedoch aus ergonomischen Gründen wenig wahrscheinlich, zumal der gewünschte Effekt durch ein auf dem Boden ausgebreitetes Tuch oder größeres Lederstück einfacher und wirksamer erreicht worden wäre. Die Absplisse sind letztlich als unerwünschte Verunreinigung des Beutels zu werten. Herkunft mutmaßlicher Residuen von Schwefelkies: Mehrere Absplisse weisen auf ihren Breitseiten anhaftende, winzige goldglänzende Flitter auf, bei denen es sich vorbehaltlich einer naturwissenschaftlichen Analyse um Schwefelkiespartikel handeln dürfte, vermutlich von der Markasit-/Pyritknolle eines Schlagfeuerzeuges 61. Vergleichbare Schwefelkiesflitter wurden im Inneren zweier als Lampen interpretierter Keramikgefäße aus Twann 62 sowie in der Zundermasse aus der Gürteltasche des Mannes vom Hauslabjoch 63 identifiziert. In beiden Fällen ist die Interpretation der Flitter als Hinweis auf die Erzeugung von Feuer naheliegend. Dies gilt ebenfalls für die Flitter aus dem Gaimersheimer Beutel, zumal dort auch ein spezieller Feuerschlagstein gefunden wurde. In der schnurkeramischen Mehrfachbestattung von Kösching hat sich ein Feuerzeug bestehend aus Feuerschlagstein und zugehöriger stark abgearbeiteter Markasitknolle erhalten 64. Es stellt sich die Frage, wie die Flitter in den Gaimersheimer Beutel gelangen konnten. Im Falle von Twann nimmt die Autorin an, dass Beim Feuerschlagen, das ja beim Docht, also über der Lampe geschehen musste, [ ] vom Pyrit sehr wohl kleine Schüppchen abspringen konnten 65. Die noch so intensiv bemühte Selbstverständlichkeit, mit der diese Behauptung vorgetragen wird, verschleiert indes nicht eine gewisse Unkenntnis zum Vorgang der Erzeugung von Feuer mit Hilfe eines neolithischen Schlagfeuerzeuges. Ungezählte erfolgreiche Versuche von Experimentalarchäologen zeigen, dass die Funken über Baumpilzzunder geschlagen werden, um diesen zum Glimmen zu bringen. Daraus entsteht erst offenes Feuer, wenn durch Sauerstoffzufuhr am Glutherd zugegebenes, leicht brennbares Material entflammt wird. Dagegen kann ein Docht aus fettgetränkten Pflanzenfasern nicht mit glimmenden Schwefelkiespartikeln, sondern nur mit einer Flamme entzündet werden. Folgerichtig war ein von der Autorin vorgenommener praktischer Zündversuch a priori zum Scheitern verurteilt. Deshalb musste sie schließlich ein Streichholz zum Entzünden eines aus Leinenfasern dicht gedrehten Dochtes verwenden 66. Nun liegt es in der Natur der Sache, dass beim Funkenschlagen von einer Schwefelkiesknolle bzw. einem Feuerschlagstein Partikel abgetrennt werden. Die Autorin bestätigt dies mit der Feststellung, dass sich solche Partikel als die Lampe ausgebrannt war an der Wand und auf dem Boden der benutzten Keramikschale gesammelt hatten 67. Es ist jedoch keinesfalls zulässig, diese Beobachtung als Bestätigung der Ausgangshypothese zu verwenden, da deren Grundbedingung, das Entzünden des Dochtes mit glimmenden Schwefelkiespartikeln, nicht erfüllt wurde. Die Schwefelkiespartikel in den Lampen aus Twann können somit nicht als Reste des mutmaßlichen Feuerschlagens über den Lampen interpretiert werden. Geht man davon aus, dass die Lampen zur Beleuchtung der Häuser gedient haben, dann fragt man sich, warum man sie nicht mit einem am Hausfeuer leicht zu entflammenden Kienspan angezündet hat. Zu dieser Überlegung gelangte auch die Autorin und schließt daraus, dass die Lampen auf die vermutete Weise nur außerhalb der Häuser entzündet wurden 68. Freilich wäre es ein Leichtes, die Lampen im Haus anzuzünden und nach draußen zu bringen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen fehlt nach wie vor eine schlüssige Erklärung für die Existenz der Schwefelkiesflitter in den Lampen aus Twann. Anders verhält es sich im Falle des Fundes vom Hauslabjoch. Bei der Beschreibung des Inhaltes des Gürteltäschchens wird darauf hingewiesen, dass eine Schwefelkiesknolle fehlt 69. Da sich Schwefelkies durch Kontakt mit Sauerstoff und Wasser leicht zersetzt, könnte man annehmen, dass es sich bei den Flittern um ein Verwitterungsprodukt der ehemaligen Schwefelkiesknolle handeln könnte. In diesem Falle würde man allerdings eine deutlich größere Menge an Partikeln in der Zundermasse erwarten, es sei denn, das Schwefelkiesstück wäre z. B. stark abgenutzt und deshalb sehr klein gewesen. Diese Hypothese ließe sich leicht dadurch überprüfen, indem man die gesamte Zundermas- 44
23 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim se auswaschen und das Gewicht der gewonnenen Flitter ermittelt würde 70. Alle Bestandteile bandkeramischer 71, schnurkeramischer 72 und sonstiger prähistorischer und frühgeschichtlicher 73 Schwefelkiesfeuerzeuge, d. h. Feuerschlagstein, Schwefelkiesknolle und mit großer Wahrscheinlichkeit auch Zunder, finden sich in aller Regel zusammen und waren vermutlich in einem Behältnis aufbewahrt. Vom Mann vom Hauslabjoch wird behauptet 74, er habe ein komplettes Feuerzeug mitgeführt, was nicht stimmt, denn ein Feuerschlagstein fehlt ebenfalls im Ensemble des Täschchens. Der Bearbeiter vermutet, dass der Schwefelkies und der Feuerschlagstein durch den Riß auf der Vorderseite des Gürteltäschchens verloren gingen 75. Eine andere Erklärung für die Flitter in der Zunder masse beruht auf der Tatsache, dass die aktive Schlagfläche einer Schwefelkiesknolle kontinuierlich zu einer dünnen grauen Schicht verwittert, die leicht auf mechanischem Wege entfernt werden kann. Die Schlagfläche einer Knolle wird beim Transport in einem Beutel oder einer Tasche immer wieder Kontakt mit dem Feuerschlagstein haben, so dass Flitter auf diese Weise von der Knolle gelöst werden konnten. Eine letzte Möglichkeit der Deutung von Schwefelkiesflittern in einem Feuerzeugbehältnis ergibt sich aus modernen Beobachtungen beim Feuerschlagen. Sie lehren, dass sich bereits nach wenigen Schlägen gegen die Schwefelkiesknolle ein staubartiger Belag aus Schwefelkiespartikeln auf der Zunderoberfläche sammelt, der die Entstehung eines Glutherdes beeinträchtigt und durch Schütteln des Zunders entfernt werden muss. Die Zunderoberfläche ist jedoch recht porös, und so bleiben kleinste Schwefelkiesflitter im Zunder eingebettet. Da der Zunder in der Tasche aufbewahrt wurde, könnten sich die Flitter im Laufe der Zeit auch auf diese Weise im Täschchen vom Hauslabjoch angereichert haben. Das Fundensemble des Beutels aus dem Gaimersheimer Grab enthielt keine Schwefelkiesknolle. Dies könnte die Interpretation des Feuerschlagsteines als pars pro toto-beigabe nahelegen. Allerdings wurde rostig verfärbtes Erdreich in der Herzgegend des Männerskelettes 76 beobachtet (vgl. Abb. 2,1 2), das als Rest von verwittertem Schwefelkies gedeutet wird. Da die Bestattung abgesehen von Beeinträchtigungen durch die moderne Nutzung ungestört ist (s. u.), ist davon auszugehen, dass ein hypothetisches Schwefelkiesstück bewusst an dieser Stelle deponiert worden sein muss. Im Gaimersheimer Beutel befand sich jedoch ein Feuerschlagstein. Deshalb darf man in Übereinstimmung mit anderen neolithischen Grabbefunden erwarten, dass die ehemalige Schwefelkiesknolle ebenfalls in diesem Beutel aufbewahrt wurde. Eine chemische Analyse des rostig verfärbten Erdreichs liegt nicht vor und ist nicht mehr möglich, da keine Erdprobe geborgen wurde 77. Als alternative Erklärung für diesen Befund bietet sich z. B. die Annahme an, dass es sich dabei nicht um vergangenen Schwefelkies, sondern um ein vergangenes Stück aus Roteisenstein (Hämatit) handeln könnte, das durchbohrt als Anhänger an einer Schnur um den Hals getragen wurde. Allem Anschein nach sind verwitterte Schwefelkies- und Farbsteinstücke leicht miteinander zu verwechseln. Dies legt jedenfalls eine verwitterte Schwefelkiesknolle aus einem Grab der Glockenbecherkultur von Altenmarkt nahe, die trotz des mit gefundenen typischen Feuerschlagsteines als Roteisenstein angesprochen wurde 78. Wenn es sich bei den Flittern aus dem Beutel tatsächlich um Schwefelkies handelte, wären sie analog zu dem Befund vom Hauslabjoch entweder als im vergangenen Zunder eingebettete Residuen zu deuten oder als Abriebprodukte von der Oberfläche des Schwefelkieses während der Aufbewahrung im Beutel. Zur Funktion der Artefakte aus Schweinehauern: Der kleine bearbeitete Hauer ist ein intensiv verwendetes und deshalb stark abgenutztes Gerät, dessen schneidenartige Arbeitskante eine Messerfunktion nahelegt. Zwar sind Hauer mit derartigen Merkmalen aus dem Endneolithikum nicht selten; sie werden aber in aller Regel als Schmuckstücke gedeutet 79. Dies gilt gewiss für an beiden Enden gelochte Eberhauerlamellen, ist für nur an einem Ende gelochte Exemplare aber fraglich 80 und für ungelochte kaum wahrscheinlich. Auf dieses Problem hat bereits J. Schibler 81 hingewiesen und solche Stücke später als Messer bezeichnet 82. Ein anderer Autor ist der Ansicht, dass derartige Artefakte zum Abkratzen von Fellen gedient haben könnten 83. Aufgrund der Form und Gebrauchsspuren sehen I. Matuschik und H. J. Werner in den Stücken Geräte zum Stechen, Schaben-Kratzen und Schnitzen 84. Eine vom Verf. angefertigte Nachbildung besitzt eine durchlaufende scharfe Kante, die aber zum Schneiden oder Schnitzen selbst relativ weicher Materialien, wie z. B. Holz fraglos zu stumpf ist. Ohne weitere Experimente durchgeführt 61 Weiner 1998b. 62 Schmid Sauter/Stachelberger Tillmann/Rieder 1992, Schmid 1977, Schmid 1977, Schmid 1977, Schmid 1977, 22 f. 69 Egg/Spindler 1992, Sauter/Stachelberger Nieszery Tillmann/Rieder Nieszery Nieszery 1992, Spindler 1995, Frdl. Mitt. K. H. Rieder. 77 Frdl. Mitt. K. H. Rieder. 78 Schmotz 1989, Abb. 29; weiteres Beispiel einer vergleichbaren Verwechslung bei Spatz Clason 1969; Ramseyer Clason 1969, Abb Schibler 1981, Schibler 1995b. 83 Pavlu 1999, Matuschik/Werner 1981/82,
24 Jürgen Weiner zu haben, festigte sich allerdings der Eindruck, dass die Geräte kratzend-schabend benutzt werden können. Die Bezeichnung Hauer messer folgt somit ausschließlich formalen und nicht funktionalen Kriterien. Eine zusätzliche Durchbohrung an diesen Geräten kann als Hilfe zur Befestigung einer Aufhängeschlaufe interpretiert werden, analog z. B. zu ebenfalls gelegentlich durchbohrten Geweihhandhaben für Schwefelkiesstücke neolithischer Schlagfeuerzeuge 85. Die schaberartige Verwendung von Hauern zur Holzbearbeitung ist aus der Völkerkunde bekannt. Allem Anschein nach werden hier aber nur die natürlich scharfkantigen Spitzen- bzw. Alveolenenden als Funktionsenden benutzt 86. Artefaktgruppen und erschließbare Tätigkeiten: Allen Artefakten ist gemeinsam, dass sie mit verschiedenen Tätigkeitsfeldern in Verbindung gebracht werden können. Aus technologisch-ergologischer Sicht lässt sich das Ensemble in vier Artefaktgruppen unterteilen: 1. Werkzeuge/Geräte, 2. Halbfabrikate/Rohmaterial, 3. Fertigprodukte und 4. Abfälle/Residuen. Die gewichtsmäßig größte Gruppe 1 besteht aus den beiden Druckstäben, dem Pfriem bzw. dem Pfriemoder Druckstabrest, dem Beitel, dem kleinen Hauermesser, dem Schleifsteinbruchstück und dem Feuerschlagstein. Gruppe 2 beinhaltet den unbearbeiteten Hauer, ein Hauermesser-Halbfabrikat und den Silexabschlag. Gruppe 3 umfasst die Pfeilspitzen, Gruppe 4 wird von den Absplissen und den mutmaßlichen Schwefelkiesflittern gebildet. Aus den Artefakten erschließbare Tätigkeitsfelder lassen sich in folgende Gruppen einteilen: A. Silexbearbeitung, B. Bearbeitung von Felsgestein, Knochen, Geweih und Zähnen, C. Holzbearbeitung, D. Feuermachen und E. Sonstige Tätigkeiten bei der Bearbeitung organischen Materiales. Zu A: Hiervon zeugen die beiden Druckstäbe, die Pfeilspitzen, der unbearbeitete Abschlag und die Absplisse (sowie natürlich der nicht zu diesem Ensemble gehörende Dolch). Zu B: Das Schleifsteinfragment konnte zum Schärfen stumpf gewordener Schneiden der Beil- und Dechselklingen dienen, eventuell zum Abziehen der Beitelschneide und zum fallweisen Überarbeiten beschädigter Druckstabspitzen, wahrscheinlich aber nicht zur Zurichtung der Hauer. Zu C: Hierzu diente der Beitel (und natürlich die ein eigenes Ensemble bildenden Beile). Zu D: Vom Feuerschlagen zeugen der Schlagstein, drei wahrscheinlich von ihm stammende Absplisse und die Schwefelkiesresiduen. Zu E: Eventuell wurden Pfrieme und Hauermesser hierzu benutzt (dann ließen sich auch das Halbfabrikat und der vollständige Hauer dieser Gruppe zuordnen). Artefaktkonfiguration Grundausstattung und/ oder spezifische Grabbeigaben: Der Beutelinhalt reflektiert in erster Linie bestimmte handwerkliche und sonstige technische Fähigkeiten des Mannes. Dies muss jedoch keinesfalls bedeuten, dass das nachgewiesene Ensemble zu Lebzeiten ebenfalls in dieser Konfiguration im Beutel aufbewahrt wurde. Manches spricht dafür, dass der Beutel, am Gürtel befestigt, den Mann ständig begleitete, wie dies aus der Volks- und Völkerkunde bestens für Taschen und andere Behältnisse von Sammlern, Jägern, Hirten und wehrhaften Männern belegt ist 87. Fragt man sich nach einer möglichen Grundausstattung, die für den Even tual fall immer zur Hand sein musste, dann gehörte dazu gewiss ein ehemals vollständiges Feuerzeug, was durch die möglichen Schwefelkiesresiduen in Verbindung mit dem Feuerschlagstein nahegelegt wird. Die Absplisse favorisieren dieselbe Interpretation für die Retuschiergeräte und den Silexabschlag. Eine diesbezügliche Beurteilung des kleinen Hauermessers ist nicht einfach. Die vermutete Schaberfunktion könnte mit Fellbearbeitung 88 oder allgemein Lederherstellung/-verarbeitung in Verbindung gebracht werden. Da es sich bei dem Objekt aber um das Gerät eines Mannes handelt und Fellbearbeitung nicht zwingend Männerarbeit gewesen sein muss, fällt es schwer, sich diesem Vorschlag anzuschließen. Einleuchtender erschien dagegen eine Verwendung im Zusammenhang mit der Behandlung von Jagdbeute, etwa in Form eines Spezialgerätes zum Abhäuten, um besonders die wertvollen Felle ( Rauchwaren ) vor Beschädigung zu schützen. Da der Mann mit ziemlicher Sicherheit Bogenschütze (s. u.) und somit wahrscheinlich auch Jäger war, würde das kleine Hauermesser als Bestandteil der Grundausstattung des Beutels nicht wundern. Auch die Interpretation des Pfriemes ist nicht unproblematisch. Das Stück erinnert an die Ahle bzw. den Geweihdorn aus dem Köcher des Mannes vom Hauslabjoch. Dieser wird mit sog. Haut niggln verglichen, volkskundlich nachgewiesenen Objekten, die beim Häuten von Tieren benutzt wurden 89. Diese Funktion entspräche aber derjenigen, die für das Hauer messer vermutet wird, so dass für jenes eine andere Funktion gesucht werden müsste. Nicht auszuschließen ist schließlich, dass der Pfriem die Stelle eines Knochenpendants für vielfältigen Gebrauch eingenommen hat. In beiden Fällen würde er sich zwanglos in das En semble der Grundausstattung einfügen. Dagegen erscheint eine Interpretation des Schleifsteines, des Hauermesser-Halbfabrikates und des unbearbeiteten Hauers, des Beitels sowie der Pfeilspitzen als Bestandteile einer Grundausstattung aus mehreren Gründen fraglich. So trägt der Schleifstein keinerlei makroskopisch erkennbare Schwefelkiesresiduen, was bei einer Aufbewahrung zusammen mit einer Schwefelkiesknolle nicht der Fall sein dürfte. Schweinehauer sind im Endneolithikum häufig als Männerschmuck nachgewiesen 90. In der Schnurkeramik spielt Tierzahnschmuck eine außerordentlich große Rolle 91. Wahrscheinlich handelt es sich bei den dazu verarbeiteten Stücken um Wildschweinhauer, die wegen der nicht ungefährlichen Jagd, begehrte Trophäen 46
25 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim darstellten 92. Zur Herstellung der Hauermesser dürfte man dagegen in erster Linie die wesentlich leichter zu beschaffenden Hauer vom Hausschwein verwendet haben. Der Schleifstein war wahrscheinlich nicht zur Zurichtung der Hauer geeignet. Diese Arbeiten dürften dort vorgenommen worden sein, wo geeignete Werkzeuge zur Verfügung standen und überdies verschiedene Rohstoffe (Geweih, Knochen, Zähne u. ä.) aufbewahrt wurden, d. h. im und beim Haus. Es ist also nicht einsichtig, dass Hauer als Halbfabrikat oder Rohstücke ständig im Beutel mitgeführt wurden. Der Beitel ist zwar nicht das größte, aber das sperrigste Objekt des gesamten Ensembles. Alleine aus diesem Grund wird man ihn kaum als Teil einer Grundausstattung im Beutel erwarten. Vor allem handelt es sich aber um ein hochspezialisiertes Werkzeug, ohne das Schäftungshilfen an Beilholmen in Form von Löchern, Schlitzen oder Vertiefungen jeder Art nicht oder nur unter ungleich größerem Aufwand herzustellen wären. Solche Arbeiten fallen gewiss nicht täglich an. Deshalb ist auch für dieses Gerät davon auszugehen, dass es im Werkzeugensemble einer Werkstatt sinnvoller aufgehoben ist als im Beutel. Die Pfeilspitzen sind alle fertiggestellt und zudem äußerst qualitätsvoll. Durch einen häufigen Kontakt mit den harten Oberflächen des Knochenbeitels, der beiden Hauer, des Schleifsteines oder der Schwefelkiesknolle sowie untereinander hätten sie Schaden nehmen können. Da dies nicht im Interesse des Mannes liegen konnte, ist es unwahrscheinlich, dass die Pfeilspitzen zur Grundausstattung des Beutels gehörten. Wie bereits dargelegt, hat der Mann die Pfeilspitzen vermutlich selbst angefertigt. Dies lässt darauf schließen, dass er Bogenschütze war und somit zu Lebzeiten auch ein Bogen zu seiner persönlichen Ausstattung zählte. Interessanterweise fehlt diese Waffe unter den Grabbeigaben. Dies ist nicht durch die schlechten Erhaltungsbedingungen zu erklären, denn wenn ein Bogen mitgegeben worden wäre, dann spricht alles dafür, dass auch ein Köcher mit Pfeilen dazugelegt worden wäre. Wegen der Erhaltungsbedingungen wäre zwar das gesamte Ensemble vergangen, aber die Silexspitzen wären auf dem Boden der Grabgrube in entsprechender Fundlage überliefert worden. Man könnte eventuell annehmen, dass es sich bei den gefundenen Spitzen um solche von vergangenen Pfeilen handelt. Dagegen spricht jedoch eindeutig ihre dokumentierte unregelmäßige Fundlage an der Basis des Beutelinhaltes. Deshalb ist die Frage nach dem Verbleib des Bogens, des zugehörigen Köchers und der Pfeile naheliegend. Als nachvollziehbare Erklärung würde sich die Annahme anbieten, dass dieses ausgesprochen wertvolle Ensemble durch Vererbung in die Hände eines Nachkommen gelangte. Vor diesem Hintergrund wird die Deponierung der funktionsfähigen Pfeilspitzen im Beutel verständlich. Als Jäger ohne Bogenwaffe musste der Mann im Jenseits einen neuen Bogen und neue Pfeile anfertigen. Einen Bogenstabrohling konnte er sich mit seinem Beil und den beiden Dechseln jederzeit beschaffen und gebrauchsfertig zurichten. Die Pfeilspitzen waren für die Bewehrung neuer Pfeile gedacht. Die zur Anfertigung dieser Pfeile notwendigen Materialien, Federn, Sehnen und Birkenpech sowie eine Schnursehne für einen zukünftigen Bogenstab, dürften ursprünglich auch im Beutel gewesen sein. Sie scheinen aber den Erhaltungsbedingungen vollständig zum Opfer gefallen zu sein. Zusammenfassend ergibt sich für Ensemble 3 folgendes Bild: Der Beutel enthielt zu Lebzeiten eine Grundausstattung bestimmter Artefakttypen. Die sicher oder vermutlich nicht dazu zählenden anderen Artefakte wurden aus rein praktischen Gründen ebenfalls im Beutel untergebracht. Dieser war das einzige Behältnis, das dem Mann mitgegeben wurde und das für eine geschlossene Aufbewahrung kleinerer Grabbeigaben geeignet war. Gürtelhaken Der Gürtelhaken Obj. 1 9 (Abb. 13) hat eine Länge von 146 mm, die maximale Breite beträgt am Hakenfuß 18 mm und die maximale Dicke am Hakenfuß 20 mm. Bereits die Form des Stückes mit einem breiten flachen Ende und einem ursprünglich runden, dünneren Ende deutet darauf hin, dass es aus einer Sprosse eines Hirschgeweihs hergestellt wurde, wobei der Haken zum ehemaligen Spitzenende der Sprosse orientiert ist. Im Vergleich zu anderen schnurkeramischen Gürtelhaken besitzt das Stück aber kaum eine Längsbiegung, so dass es weder aus einer Aug-, Eis-, Mittel- oder Wolfssprosse hergestellt worden sein kann. Als Ursprungsposition kommt deshalb am ehesten der Kronenabschnitt eines kapitalen Geweihs in Frage. Das Ausgangsstück war vermutlich ein Kronenspross 93. Die Spitze der Sprosse wurde abgetrennt, verschliffen und dabei die Spongiosa an der Oberseite freigelegt. Während an anderen schnurkeramischen Vergleichsstücken, von einem Stück abgesehen, der Haken immer aus dem konvex verlaufenden Oberflächenabschnitt der Sprosse herausgearbeitet wurde, befindet er sich hier im Mittelabschnitt zwischen der konvexen und der konkaven Seite. Die Außenseite des Hakens besteht aus Kompakta, die in den Hakenfuß aus Spongiosa übergeht. Die Hakenoberseite ist überschliffen und beidseitig mit kurzen und längeren, unterschiedlich tiefen, wie es scheint, flüchtig angebrachten diagonalen Schnittkerben in Fischgrätart verziert. Das Stück verbreitert sich kontinuierlich zu seinem annähernd halbrunden zun- 85 Schibler 1995b. 86 Pétrequin/Pétrequin 1988, 104; z. B. Weiner 1999c. 88 Pavlu 1999, Egg/Spindler 1992, Clason 1969; Schibler 1981, 67; 1995b. 91 Fischer 1956, Clason Drechsler Lederende nach Kilian-Dirlmeier 1974, 24, Anm
26 Jürgen Weiner Abb. 13. Gaimersheim, Lkr. Eichstätt. Gürtelhaken Obj M. 1 : 1. genförmigen Ende, im Folgenden Schaft genannt 94. Dort befinden sich quer zur Längsrichtung symmetrisch angebracht zwei Löcher in einem Abstand von ca. 8 mm. Der Lochdurchmesser ist einheitlich und beträgt ca. 4 mm. Unterhalb des Hakens und auf dem gesamten Schaft wurde die Spongiosa bis auf die Kompakta vollständig entfernt. Im Querschnitt ist das Stück vom breiten Schaftende bis zur Mitte schwächer gewölbt. Von dort an nimmt die Breite in Richtung Hakenfuß ab, und folgt auf Höhe des Hakens der natürlich starken Oberflächenwölbung der Sprosse. Wegen der auf den Haken wirkenden Zugkräfte ist es eigentlich merkwürdig, dass am Hakenfuß beidseitig die Kompakta bis zur Spongiosa abgearbeitet und zusätzlich auch am hinteren Hakenende in Richtung Sprossenspitze durchtrennt und vollständig entfernt worden ist. Auf dieses Problem haben bereits andere Autoren bei der Behandlung ähnlicher Gürtelhaken mehr oder weniger deutlich hingewiesen 95. Allerdings ist die Spongiosa am Spitzenende einer Geweihsprosse besonders dicht und entsprechend zäh, wodurch die Bruchgefahr vermindert wurde. Neben der Form unterstützt diese Überlegung die Annahme, dass das Stück aus einer Geweihsprosse angefertigt wurde. Die Hakenoberseite, die linke Seite des Hakenfußes und die Außenseite der Sprosse auf Hakenhöhe weisen starken Glanz auf. Die ursprüngliche Perlung ist nirgendwo zu erkennen. Offensichtlich wurde das Stück auf seiner gesamten Oberfläche überschliffen. An der linken Seite des Hakenfußes bildet die Kompakta einen stufenförmigen Absatz, der Glanzspuren trägt. Man gewinnt den Eindruck, dass an dieser Stelle ein Teil der vorauszusetzenden Befestigungsschlaufe verlief und im Laufe der Zeit den Glanz (d. h. die Tra- 48
27 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim ge- bzw. Gebrauchsspuren) erzeugte 96. Auf der rechten Seite ist die Spongiosa ausgebrochen und die Kompakta ist stark verwittert, so dass hier keine Glanzspuren erkennbar sind. Das hintere Ende des Hakens überragt dachartig den Hakenfuß; hier ist offenbar die Spongiosa ausgebrochen. Dieses Ende ist so zu rekonstruieren, dass der Hakenfuß aus Spongiosa hier halbrund und steil nach unten abfiel. Denn an der linken Kante der Kompakta des Sprossenkörpers, ist kurz vor dem Ende eine quer zur Längsachse verlaufende, halbrunde Vertiefung zu erkennen. Sie trägt deutlichen Glanz und ist als Absatz zu interpretieren, von dem die Spongiosa des Objektkörpers bis zu dessen Ende gleichmäßig abfiel. Dieser Endabschnitt der Spongiosa weist teilweise noch Schliffspuren auf. Die halbrunde Vertiefung ist nicht als ausgebrochenes Bohrloch zu interpretieren, da es an einer Entsprechung auf der gegenüberliegenden Kompaktakante fehlt. Außerdem ist die angrenzende Spongiosa überschliffen. Wäre hier ehemals eine Durchbohrung gewesen, dann hätte die Spongiosa eine ausreichende Dicke besessen haben müssen und dürfte nur Bruchspuren, aber keine Schliffspuren zeigen. Am Spitzenende befindet sich auf der Rückseite ein Ausbruch auf der Spongiosa. Die hier ehemals einwirkende Kraft ließ ein Stück Spongiosa abplatzen, wobei ein Negativ zurückblieb. Interpretation Mit dem Fund aus Gaimersheim vergleichbare Objekte werden als Gürtelhaken interpretiert. Dies geschieht in Anlehnung an früheste Interpretationen von Knochenplatten als zum Gürtel gehörig aus Ausgrabungen des späten 19. Jahrhunderts 97. Im Hinblick auf diese funktionale Deutung ist festzuhalten, dass für die hier interessierende Fundgattung bis zum heutigen Tag keine einschlägigen Hinweise [für diese Interpretation] vorliegen 98. Die Artefakte sind unter der Bezeichnung Stabhaken vom Typ Ig bekannt 99. Mit dem Fund aus Gaimersheim sind mindestens 26 vollständige, fragmentarische oder als Halbfabrikat anzusprechende Stabhaken dieses Typs bekannt (vgl. Katalog Liste 2 Nr. 1 20). Bei der überwältigenden Mehrzahl handelt es sich um Siedlungsfunde 100. Nur dreimal sind sie aus schnurkeramischen Gräbern belegt, aus Gródek Nadbużny in Polen (Abb. 14,5) 101 sowie Bergheim (Abb. 14,6) 102 und Gaimersheim in Bayern (Abb. 14,1) 103. Ein doppelt gelochtes Bein artefakt aus dem schnurkeramischen Grab 1301 von Franzhausen II im Unteren Traisental (A) wird als Knochenglätter aus einem massiven Röhrenknochen angesprochen 104. Eventuell könnte es sich um einen Gürtelhaken mit abgebrochenem Haken handeln; die Größe spricht nicht dagegen. Die Außenseiten der Stücke lassen keine Reste einer Perlung oder sonstigen Struktur des Geweihs erkennen. Daraus ist zu schließen, dass ihre gesamte Oberfläche weitestgehend überschliffen worden ist und ihre ursprüngliche Farbe Weiß war. Dies ist vermutlich der Grund dafür, warum das Rohmaterial in vielen Fällen mit Knochen 105 bzw. Tierrippen 106 angegeben wird. Die Feststellung: Die knöchernen Gürtelhaken aus Barca sind aus Geweih gefertigt 107 spricht für sich und mahnt im Hinblick auf Materialangaben anderer Exemplare zu gesunder Skepsis. Mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit dürfte es sich in allen Fällen um Hirschgeweih handeln 108. Als Befestigungshilfen sind zwei technische Lösungen nachgewiesen: Lochung bzw. Kerbung des Schaftes. In aller Regel entschied man sich für eine exklusive Lösung, nur zweimal ist eine Kombination belegt (Bergheim, Abb. 14,6; Brno-Starý Lískovec, Abb. 14,4). Es finden sich entweder ein, zwei, drei, vier oder sechs Löcher. Aus naheliegenden Gründen sind die Löcher immer symmetrisch zur Längsachse angebracht. Das Loch des Bergheimer Stabhakens und die Doppellochung an einem Stück aus Řivnáč (Abb. 14,18) befinden sich auf dieser Linie, wie auch das mittlere Loch am Exemplar aus Gródek Nadbużny (Abb. 14,5). Bei den restlichen doppelten Lochungen liegen die gegenständigen Löcher beidseitig der Längsachse, bei vierfacher oder sechsfacher Lochung bilden sie zwei oder drei Paare dieser Ausrichtung. Die Randkerbung fällt durchaus unterschiedlich aus: sie schwankt zwischen flachen, weitmundig-geschwungenen Eintiefungen (Riekofen-Kellnerfeld, Abb. 14,3), kurzen V förmigen Kerben (Mezölak-Szelmezömajor, Abb. 14,9; Řivnáč, Abb. 14,19), breiteren Kerben mit U-, V- oder offenem-trapezförmigem Umriss (Bergheim, Abb. 14,6; Ripač, Abb. 14,17), halbrunden, die an seitlich offene Löcher erinnern (Brno-Starý Lískovec, Abb. 14,4), sehr schmalen, tiefen mit V förmiger oder gerader Basis (Ig, Abb. 14,13) und schließlich sehr breiten mit offen-trapezförmigem Umriss (Barca, Abb. 14,15). Einmal entsteht der Eindruck, als sei die Schaftinnenseite durch zusätzlich querverlaufende Kerben wellenartig strukturiert (Mezölak-Szelmezömajor, Abb. 14,9). Die Bearbeiterin erwähnt jedoch nur acht dreieckige in die Ränder eingeschnittene Kerben 109. Das große 95 Hájek 1959, 297; Kilian-Dirlmeier 1975, Vergleichbare Spuren bei einem Riekofener Exemplar beschreiben Matuschik/Werner 1981/82, 53 Anm Kilian-Dirlmeier 1975, Bill 1981, Kilian-Dirlmeier 1975, Kilian-Dirlmeier 1975, Głosik Tillmann/Schröter Rieder 1999a. 104 Neugebauer 1994, 31, Abb. 10, 5; z. B. Medunová-Benešová/Vitula 1994, z. B. Kilian-Dirlmeier 1975, Hájek 1959, In diesem Sinne auch Matuschik/Werner 1981/82, 52, Anm Kilian-Dirlmeier 1975,
28 Jürgen Weiner 50
29 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Abb. 14. Gürtelhaken vomtyp Ig. 1 Gaimersheim-Kreppenäcker; 2 Bylany Okrouhlik; 3 Riekofen-Kellnerfeld; 4 Brno-Starý Lískovec; 5 Gródek Nadbużny; 6 Bergheim; 7 8, Ig; 9 Mezölak-Szelmezőmajor; 10 Lac de Chalain; 15 Barca; 17 Ripač; Řivnáč. M. 1 : 2. 51
30 Jürgen Weiner Formenspektrum der Kerben spiegelt nichts anderes wider, als morphologisch unterschiedliche Ausprägungen letztlich eines einzigen Lösungsschemas und lässt sich nach Ansicht des Verf. nicht als chronologisches Merkmal nutzen. Durch die Kerben wird der Längskantenverlauf des Schaftes gebrochen. Sie bieten dadurch ein Widerlager für eine Schnurbindung. Sie sind immer zum Schaftende orientiert und erstrecken sich je nach Breite oder Anzahl maximal über zwei Drittel der Schaftlänge. Die sehr breiten Kerben am Exemplar von Barca (Abb. 14,15) werden beidseitig durch eine Folge von kurzen V förmigen Kerben in Richtung Haken verlängert. Da sich völlig vergleichbare Kerben hinter dem Haken umlaufend am Ende des Stückes befinden, kann es sich dabei nicht um Befestigungshilfen handeln. Sie sind vielmehr als Verzierung zu interpretieren. Die Kerben an zwei kürzeren Exemplaren (Ig, Abb. 14,13; Ripač, Abb. 14,16) sollen sekundär angebracht worden sein, nachdem die Schaftlochung ausgebrochen war, wie dies an einem anderen Exemplar aus Ig (Abb. 14,12) deutlich wird 110. Hervorzuheben sind zwei Stabhaken aus Ig (Abb. 14,11 12), bei denen die ehemalige Sprossenspitze zu einem halbkugeligen oder zwiebelförmigen Absatz als Zierelement ausgearbeitet wurde. Abgesehen von den Exemplaren aus Gaimersheim und Barca (Abb. 14,1; 14,15), ist allen Stabhaken vom Typ Ig die Orientierung ihres Hakens zur konvex gebogenen Seite der ehemaligen Geweihsprosse gemeinsam. Dies wird als günstig für die Trageweise interpretiert 111. In krassem Gegensatz dazu stehen breitschäftige Geweihobjekte aus der Schweiz, deren Haken an der konkav gebogenen Seite aus der Kompakta gearbeitet ist (hier konkave Gürtelhaken ). Ein Halbfabrikat lässt erkennen, dass als Rohstück der mittlere Stangenabschnitt mit dem Ansatz der Mittelsprosse diente 112. Hinsichtlich der Form und der Hakenposition vergleichbare Stücke aus Knochen sind aus Oberitalien bekannt 113. Der Bearbeiter der schweizerischen Stücke erwägt nicht nur für diese und die italienischen, sondern auch für die Exemplare vom Typ Ig eine Funktion als Speerschleuder. Dies ist auf jeden Fall methodisch fragwürdig, da Stabhaken vom Typ Ig u. a. eine diametral entgegengesetzte Orientierung des Hakens aufweisen 114. In seiner Monographie über Speerschleudern widerspricht U. Stodiek erwartungsgemäß dieser Hypothese vor allem wegen der lang ausgezogene[n] Haken, [die] für Speerschleuder-Widerlager untypisch sind 115. Im Übrigen besteht für die Funde vom Lago di Ledro keine Veranlassung, deren Funktion als Gürtelhaken mit der Begründung zu bezweifeln, die Haken [würden] für den Träger unbequem gegen seinen Körper drücken 116. Alle Stücke besitzen eine nur schwache Längswölbung und zwei der drei erhaltenen Haken verlaufen sehr flach und parallel zur gegenüberliegenden Außenseite. Dass sie tatsächlich mit dem Haken nach innen befestigt wurden, wird durch ein Stück zwingend nahegelegt: Dort ist die der Hakenseite gegenüberliegende konvexe Seite mit drei Zickzacklinien verziert und somit als Schauseite gearbeitet. Eine verzierte Schauseite findet sich auch an dem endneolithischen oder frühbronzezeitlichen Stück aus Meilen Rohrenhaab 117. Alles spricht dafür, dass es sich auch bei den Exemplaren aus der Schweiz um Gürtelhaken handelt. Die italienischen und schweizerischen konkaven Exemplare wurden offensichtlich nicht aus Geweihsprossen angefertigt. Sie können deshalb nicht zum Typ Ig gerechnet werden und finden hier keine weitere Berücksichtigung. Das Stück aus Okrouhlík bei Bylany wurde als Angelhaken interpretiert 118. Der Bearbeiter des Grabes von Gródek Nadbużny sieht in dem dortigen Gürtelhaken Parallelen zu Knüpfnadeln für Netze aus ethnographischem Zusammenhang 119. Eine einfache Nachbildung hätte ihn schnell vom Gegenteil überzeugt. Das Bruchstück eines Stabhakens vom Lac de Chalain (Abb. 14,10) wurde als Harpunenfragment angesprochen 120. Der in mancherlei Beziehung eigenwillige verzierte Gürtelhaken aus dem Geweih eines Fahnenhirsches oder Elches vom Altheimer Fundplatz Ergolding Fischergasse 121 repräsentiert einen völlig anderen Typ. Er findet Parallelen in einem aus Elchgehörn gefertigten Flussfund aus Kava in der Slowakei 122 und einem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus einer vergleichbaren Geweihart bestehenden Stück aus Schneckenberg in Rumänien 123. In die Reihe dieser Gürtelhaken mit seitlich weit ausladendem und umgeschlagenem Hakenende würde sich auch das Halbfabrikat aus Meilen Schellen (CH) problemlos einfügen 124. Datierung und Verbreitung der Stabhaken vom Typ Ig Alle Exemplare stammen sicher oder wahrscheinlich aus endneolithischen bis frühbronzezeitlichen Fundstellen 125. Sie bilden ein typologisch-technologisch eigenständiges Ensemble im größeren Rahmen des sog. Gürtelplattenkreises der schnurkeramischen Kultur 126. Die Gürtelhaken sind über ein großes Gebiet verbreitet. Zwischen dem westlichsten Fundort am Lac de Chalain und dem nordöstlichsten in Polen liegen ca km (Luftlinie), zwischen dem südlichsten in Bosnien und dem polnischen ca. 870 km. Ein Schwerpunkt deutet sich offensichtlich im Herzen Mitteleuropas in einer Region mit ca km Seitenlänge an. Von dort stammen 80 % (20 Exemplare) aller Gürtelhaken. In diesem Kerngebiet war allem Anschein nach das Tragen solcher Gürtelhaken geläufig. Dadurch wurden Überlegungen zum Import über teilweise große Entfernungen relativiert (s. u.). Nach dieser Verbreitung darf man besonders in der Tschechischen Republik, in der Westslowakei, in Westungarn und in Ostbayern mit weiteren Funden rechnen. Zugleich fragt man sich, warum bislang kein einziges Exemplar aus Ost- und Zentralösterreich bekannt wurde. 52
31 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Rekonstruktionsversuch der Befestigung Einzelheiten zu Form, Material und Machart schnurkeramischer Gürtel sind leider unbekannt. Für die Gürtelhaken dürfte aber feststehen, dass sie an einem bandartigen Gürtelkörper aus organischem Material an einem Ende dauerhaft befestigt waren und am anderen Ende in eine dort vorhandene Schlaufe oder Öse, einen Schlitz oder ein Loch mit dem Haken eingehängt wurden. Vom Lago di Ledro ist ein 190 cm langer und 3 cm breiter Textilstreifen aus Leinen bekannt, bei dem es sich eventuell um einen Gürtel handelt könnte. Die wichtigsten Details sind einmal die aus einem Ende herausreichenden mindestens etwa zehn, ca. 12 cm langen Fransen oder Kordeln, die jeweils aus mehreren Fäden gezwirnt sind sowie eine am anderen Ende, das herumgeschlagen und festgenäht zu sein scheint, ebenfalls ösenartig festgenähte Kordel 127. Wenn das Band als Gürtel verwendet worden ist, dann hätte es wegen seiner Länge mehrfach um die Hüften geschlungen werden müssen. Gewisse konstruktive Details der Gürtelhaken erlauben Aussagen zu deren Befestigung und führen damit eventuell zu weiteren Erkenntnissen über damalige Gürtel. So lässt sich z. B. für die gekerbten Stabhaken postulieren, dass aus Gründen der Haltbarkeit deren Schaftenden gewiss nicht in querverlaufende, schmale Schlitze am zugehörigen Gürtelende lediglich eingeschoben wurden. Grundsätzlich könnten alle Exemplare entweder flexibel oder unbeweglich am Gürtel befestigt worden sein. Während eine flexible Befestigung nur vor dem Gürtelende erreicht wird, setzt eine unbewegliche voraus, dass der Gürtelhaken entweder auf oder im Gürtelende fixiert wird. Eine Befestigung darauf ist entweder auf der Vorder- oder auf der Rückseite des Gür telendes möglich. Nur ein Gürtel mit einem zungenförmig doppelten Ende erlaubt eine Befestigung im Ende, d. h. zwischen den Zungen. Selbstverständlich konnten die Gürtelhaken vom Typ Ig nur mit nach außen weisendem Haken ihre Funktion erfolgreich ausüben, d. h. sie mussten eine aufrechte Position besessen haben. Dies wird jedoch durch die konvex gewölbte Außenseite der ehemaligen Sprosse, die Längswölbung und den ungünstigen Schwerpunkt infolge des nach außen gerichteten Hakens beeinträchtigt. Offensichtlich versuchten die Hersteller diese Nachteile dadurch auszugleichen, dass sie die Stabhaken mit zum Ende kontinuierlich breiter werdenden Schäften versahen. Diese charakteristische Schaftform hat somit weder herstellungstechnische Gründe noch hängt sie mit der Belastbarkeit der Stücke zusammen, sondern diente ausschließlich dazu, durch eine möglichst breite Auflagefläche die Objekte gegen seitliches Verkippen zu bewahren. Dabei liegt es auf der Hand, dass die angestrebte aufrechte Position durch die Wahl eines zwar biegsamen, zusätzlich aber recht festen, eventuell sogar schwach steifen Gürtelmateriales, begünstigt wird. Als Gürtelmaterialien bieten sich in erster Linie Leder oder Textilien an. Der große Vorteil von entsprechend gegerbtem, festerem Leder besteht u. a. darin, dass es sich in Querrichtung weniger einrollt, als dies bei Textilien der Fall ist. Berücksichtigt man diese Eigenschaft von Leder und zugleich dessen große Zähigkeit, dann liegt die Verwendung von Lederstreifen als schnurkeramischem Gürtelmaterial sehr nahe. Aus der Stützfunktion der breiten Schaftenden ergibt sich somit eine Befestigungsart, bei der die Objekte nicht flexibel vor dem Gürtelende mit daran separat befestigten Schnüren oder mit aus dem Gürtelmaterial bestehenden, über das Gürtelende reichenden schnurartigen Streifen aus Leder oder mit aus den Gürtelenden reichenden Litzen aus Textilien (möglicher Gürtel vom Lago di Ledro) befestigt waren. Vielmehr waren sie auf oder im Gürtelende weitgehend unbeweglich fixiert. Da eine Befestigung auf dem Gürtelende technisch einfacher und durchaus sicher ist, wird diejenige im Gürtelende nicht weiter berücksichtigt. Die Frage, ob die Gürtelhaken auf der Vorder- oder der Rückseite des Gürtelendes angebracht waren, ist nicht endgültig zu entscheiden. Gegen eine Anbringung auf der Rückseite spricht die Überlegung, dass die Objekte mit ihrer Schnurbindung über die Oberseite des Gürtels hervorstehen und dadurch den Tragekomfort eventuell beeinträchtigen könnten. Eine solche Beeinträchtigung wäre auf der Gürtelvorderseite nicht gegeben. Deshalb wird diese Befestigungsart im Folgenden favorisiert. Über die Gürtelbreite lässt sich allgemein keine Aussage treffen. Nicht auszuschließen ist, dass die Gürtel erheblich breiter als die Gürtelhaken waren, zumal deren Befestigung in der Mitte des Gürtelendes von der Gürtelbreite prinzipiell unabhängig ist. Freilich hätten die dann nach oben und unten vorstehenden Ecken des Gürtelendes beim Tragen eventuell stören können. Die Befestigung der gelochten Exemplare ist wie folgt denkbar: Sie wurden mit dem Ende des Schaftes auf das Gürtelende gelegt, und zwar so, dass dieses das 110 Kilian-Dirlmeier 1975, 17, Nr z. B. Matuschik/Werner 1981/82, Anm Bill Rageth 1974, Bill Stodiek 1993, Matuschik/Werner 1981/82, 53 Anm Bill 1981, 240, Abb Dvořák Głosik 1958 (zit. nach Matuschik/Werner 1981/82, 53 Anm. 46). 120 Billamboz Aitchison u. a. 1988, Pichlerová z. B. Werner Bill 1981, 242, Abb Nähere Ausführungen bei Kilian-Dirlmeier 1975; Matuschik/ Werner 1981/82; Medunová-Benešová/Vitula Brendow 1977; vgl. jedoch Kilian-Dirlmeier 1975, 13 ff. zu Gürtelplatten aus glockenbecherzeitlichen bzw. Aunjetitzer Gräbern. 127 Rageth 1974, 202; Taf. 121,
32 Jürgen Weiner am weitesten in Richtung Haken orientierte Loch oder Lochpaar mit einem gewissen Überstand überragte. An der so fixierten Position wurde das Gürtelende entsprechend der Lochzahl am Gürtelhaken durchbohrt. Die Objekte konnten dann mit einer durch die Löcher geschlungenen und verknoteten Textilschnur oder einem Lederriemen befestigt werden. Alternativ könnte man annehmen, dass seitlich auf Höhe der Durchlochungen am Objekt zusätzliche Löcher im Gürtelende angebracht wurden. Aus befestigungstechnischen Gründen ist dies jedoch nicht erforderlich. Einen Hinweis auf die Dicke der verwendeten Bindeschnüre liefern die in der Literatur angegebenen oder aus den Zeichnungen ermittelten Lochdurchmesser der Stücke. Sie schwanken zwischen 5,5 mm (Brno-Starý Lískovec, Abb. 14,4) bzw. ca. 5 mm (Bergheim, Abb. 14,6) und ca. 2 mm (Ig, Abb. 14,11; 14,14). Durch die Verschnürung konnte sich bei Stücken mit vier oder mehr Löchern ein dekoratives Kreuzmuster ergeben. Bei dickeren Schnüren aus Textilmaterial oder Leder ist es denkbar, dass die Verknotung auf der Gürtelrückseite lag, um den ästhetischen Eindruck nicht zu stören. In diesen Fällen hätten die recht massiven Knoten jedoch den Tragekomfort beeinträchtigen können. Vielleicht wurden sie deshalb als dekoratives Element auf der Vorderseite in die Verschnürung einbezogen. Analog zur Befestigung der gelochten Stabhaken muss man sich diejenige der nur gekerbten Exemplare vorstellen, wobei hier Löcher oder kurze Schlitze im Gürtelende auf Höhe der Kerben entsprechend deren Anzahl angebracht wurden. Die beiden besonders breiten Kerben am Exemplar aus Barca (Abb. 14,15) legen allerdings nahe, dass dort das Gürtelende auf Höhe der beiden Kerben jeweils mit mehreren Löchern oder kurzen Schlitzen versehen wurde. Eine Kerbung ist gegenüber einer Lochung natürlich die einfachere Lösung, offensichtlich aber keinesfalls die schlechtere, hätte doch eine Lochung jederzeit mühelos angebracht werden können. Vor diesem Hintergrund fragt man sich, warum zwei Exemplare eine Lochung und zusätzliche Kerben aufweisen. Das Schaftende des Bergheimer Stückes besitzt mit 14 mm die geringste Breite aller Exemplare, was auf eine sehr dünne Sprosse als Rohstück schließen lässt. Notgedrungen konnte nur eine Lochung, allerdings mit auffallend großem Durchmesser, angebracht werden. Ein Loch am Gürtelende hätte durchaus die Befestigung des Stückes erlaubt: Nämlich indem die Schnur durch das Loch im Schaft und das darunterliegende im Leder geschlungen wurde. Vermutlich wurde sie dann mehrfach diagonal gleichgerichtet, sowohl rechts und links des Schaftes vorbeigeführt und jedes Mal durch das Loch geschlungen. Schließlich wäre die Schnur auf der Vorder- oder Rückseite verknotet worden. Wegen der geringen Breite hätte aber bei selbst noch so fester Verknotung das Stück eventuell seitlich verschoben werden können. Die zusätzliche Anbringung der Kerben an der breitesten Stelle des Schaftes zwischen dem Loch und dem Gürtelende erforderte lediglich zwei weitere Löcher an korrespondierenden seitlichen Positionen im Gürtelende. Nun war durch einfache, eher aber durch Kreuzwicklung, eine ergänzende Sicherung der aufrechten Position des Objektes möglich. Die o. g. Begründung kann für das Stück aus Brno- Starý Lískovec (Abb. 14,4) nicht gelten. Sein breites Schaftende und das Lochpaar hätten eine aufrechte Position und dauerhafte Befestigung gewährleistet. Diese wird durch die beiden ungekerbten Exemplare mit nur einem Lochpaar und gleichbreitem (Ig, Abb. 14,16) bzw. erheblich breiterem Schaft (Gaimersheim, Abb. 14,1) gestützt. Überlegungen und Beobachtungen bei der Anfertigung einer Gürtelnachbildung (s. u.) legen es nahe, dass die beiden halbrunden Kerben des Stückes von Brno-Starý Lískovec gewiss nicht lediglich als Hilfen für die Anbringung einer dekorativen Kreuzwicklung gedacht waren. Vielmehr erlauben sie die Rekonstruktion der Länge des ehemaligen Gürtelendes, das etwas über beide Kerben hinausreichte und dort zusätzlich durch eine Schnurbindung gesichert wurde. I. Kilian-Dirlmeier stellte seinerzeit zwei Befestigungsvarianten auf, eine gelochte und eine gekerbte 128. Die beiden vorstehend beschriebenen Exemplare wären danach als dritte Variante zu betrachten. Nachbildung eines Gürtels Um einen Eindruck von Gürteln mit Gürtelschließe vom Typ Ig zu erhalten, fertigte Verf. eine naturgetreue Nachbildung eines Gürtelhakens nach dem Vorbild von Gródek Nadbużny (Abb. 14,5) an. Das Exemplar aus Gaimersheim konnte noch nicht nachgebildet werden, da kein geeignetes Rohstück zur Verfügung stand. Der Gürtelkörper besteht aus einem handels üblichen, chromgegerbten, 35 mm breiten und 3 mm dicken, recht steifen Lederstreifen. Aus befestigungstechnischen Gründen steht fest, dass das Gürtelende über die Lochungen am Schaft hinausstehen muss. Die Länge des Überstandes ist jedoch unbekannt. Die drei Befestigungslöcher wurden versuchsweise 14 cm vor dem Ende angebracht, so dass der Haken über eine Länge von 8 cm auf dem Lederstreifen liegt und das Gürtelende zusätzlich 6 cm über das Hakenende frei hinaussteht. Dadurch besteht die Möglichkeit, das zweite Gürtelende mit der Einhängeschlaufe auf das freie Ende vor dem Gürtelhaken zu legen, wodurch optisch der Eindruck eines nicht unterbrochenen Gürtels entsteht. Zur Befestigung wurde eine dünne Flachsschnur (Linum usitatissimum L.) dreimal doppelt und einmal einfach durch die Löcher geschlungen und die beiden Enden auf der Rückseite mehrfach verknotet. Der Knoten überragt die Rückseite um ca. 10 mm. Wegen der konkaven Schaftform des Stückes ist der Lederstreifen auf Höhe der beiden äußeren Löcher nach außen und oben gewölbt und liegt eng am Schaft an (Abb. 15,1). Die Bindung macht einen sehr soliden Eindruck, der Schaft ist 54
33 Erkenntnisse zum Doppelgrab von Gaimersheim Abb. 15: Nachbildung eines Gürtels mit Gürtelhaken vomtyp Ig. 1 Seitenansicht des Hakenendes; 2 Seitenansicht der Einhängschlaufe; 3 Seitenansicht des geschlossenen Gürtels; 4 Aufsicht auf den geschlossen, auf seiner Breitseite niedergelegten Gürtel. o. M. fest auf dem Leder fixiert, und das Artefakt lässt sich nur minimal in Querrichtung bewegen. Vor dem anderen Gürtelende wurden in einem Abstand von 40 mm in Querrichtung zwei Löcher angebracht, durch die eine Einhängeschlaufe in Form eines schmalen Bandes aus sehr weichem, aber äußerst zähem fettgegerbtem Leder führt. Ihre Enden sind auf der Rückseite mit einem Doppelknoten gesichert, der die Oberfläche um ca. 5 mm überragt (Abb. 15,2). Das Hakenende wird durch die Schlaufe geführt, wobei sich das schlaufenseitige Gürtelende zwischen den Gürtelhaken und das dort überstehende hakenseitige Gürtelende schiebt (Abb. 15,3). Das Stück liegt mittig horizontal auf dem Lederstreifen und bildet einen aparten Kontrast zur schwarzbraunen Lederfarbe (Abb. 15,4). 128 Kilian-Dirlmeier 1975,
Zusammenfassung der archäologischen Ausgrabung und Datierung des Körpergräberfeldes Unterhausen an der B 16
 Zusammenfassung der archäologischen Ausgrabung und Datierung des Körpergräberfeldes Unterhausen an der B 16 Georg Habermayr Im Zuge des Neubaus der Bundesstraße 16 als Ortsumfahrung von Oberund Unterhausen
Zusammenfassung der archäologischen Ausgrabung und Datierung des Körpergräberfeldes Unterhausen an der B 16 Georg Habermayr Im Zuge des Neubaus der Bundesstraße 16 als Ortsumfahrung von Oberund Unterhausen
Ein prähistorischer Salzbarren aus dem Salzbergwerk Hallstatt
 Ann. Naturhistor. Mus. Wien 80 819-821 Wien, November 1976 Ein prähistorischer Salzbarren aus dem Salzbergwerk Hallstatt Von F. E. BARTH *) (Mit 1 Tafel und 1 Textabbildung) Manuskript eingelangt am 19.
Ann. Naturhistor. Mus. Wien 80 819-821 Wien, November 1976 Ein prähistorischer Salzbarren aus dem Salzbergwerk Hallstatt Von F. E. BARTH *) (Mit 1 Tafel und 1 Textabbildung) Manuskript eingelangt am 19.
Südholländer. DKB Deutscher Kanarien- und Vogelzüchter-Bund e.v. Seite 1 von 11 Ulrich Völker DKB Foto: Paul Pütz.
 Südholländer Seite 1 von 11 Südholländer Diese Rasse kleinerer, gebogener Frisierter stammt wahrscheinlich aus dem Süden Frankreichs. Hollandais du Sud, übersetzt als Südlicher Frisierter, könnte aus dem
Südholländer Seite 1 von 11 Südholländer Diese Rasse kleinerer, gebogener Frisierter stammt wahrscheinlich aus dem Süden Frankreichs. Hollandais du Sud, übersetzt als Südlicher Frisierter, könnte aus dem
Die Steinzeit ins Klassenzimmer holen? Das können Sie mit unserem Jungsteinzeitkoffer!
 JUNGSTEINZEITKOFFER Die Steinzeit ins Klassenzimmer holen? Das können Sie mit unserem Jungsteinzeitkoffer! Der Koffer beinhaltet Repliken, Rohmaterialien und Originalfunde rund ums Thema Jungsteinzeit.
JUNGSTEINZEITKOFFER Die Steinzeit ins Klassenzimmer holen? Das können Sie mit unserem Jungsteinzeitkoffer! Der Koffer beinhaltet Repliken, Rohmaterialien und Originalfunde rund ums Thema Jungsteinzeit.
Funde nach erfolgter Bearbeitung und Restaurierung im Museum Mödling.
 K a r l s t e t t e n, Gem. Karlstetten, BH St. Polten. 1979 wurde auf der Ackerparz. 1719, an der Straße von Karlstetten nach Doppel, der Nackenteil eines Werkzeuges (?) aus dem nördlich von Karlstetten
K a r l s t e t t e n, Gem. Karlstetten, BH St. Polten. 1979 wurde auf der Ackerparz. 1719, an der Straße von Karlstetten nach Doppel, der Nackenteil eines Werkzeuges (?) aus dem nördlich von Karlstetten
BERICHT. Troisdorf-Eschmar, Rhein-Sieg-Kreis Bebauungsplan E 65, Blatt 3
 BERICHT zur Anlage von archäologischen Sondagen, Rhein-Sieg-Kreis Bebauungsplan E 65, Blatt 3 im Auftrag der Stadt Troisdorf, Stadtplanungsamt Aktivitätsnummer PR 2015/ 0520 Alexandra Gatzen M.A. Januar
BERICHT zur Anlage von archäologischen Sondagen, Rhein-Sieg-Kreis Bebauungsplan E 65, Blatt 3 im Auftrag der Stadt Troisdorf, Stadtplanungsamt Aktivitätsnummer PR 2015/ 0520 Alexandra Gatzen M.A. Januar
Auflage RU/PU Rollenmerkmale Bemerkungen. B 47-1 I (1) PU- (a) Unten schmaler Schnitt mit offenem Mittelzähnungsloch
 Auflage RU/PU Rollenmerkmale Bemerkungen B 47-1 I (1) PU- (a) Unten schmaler Schnitt mit offenem Mittelzähnungsloch mittlere PK-Werte Nachweis durch Doppel-KN kein weiterer PU nachgewiesen PU- Unten breiter
Auflage RU/PU Rollenmerkmale Bemerkungen B 47-1 I (1) PU- (a) Unten schmaler Schnitt mit offenem Mittelzähnungsloch mittlere PK-Werte Nachweis durch Doppel-KN kein weiterer PU nachgewiesen PU- Unten breiter
Sezieren eines Schweinefußes
 Anleitungen zu Modul 1 / NAWI-LAB Biologie am 13.10.2015 Sezieren eines Schweinefußes Materialien: Schweinefuß, Handschuhe, Küchenrolle, ( Skalpell+Klingen, Pinzette :wenn vorhanden), Fotoapparat; Ihr
Anleitungen zu Modul 1 / NAWI-LAB Biologie am 13.10.2015 Sezieren eines Schweinefußes Materialien: Schweinefuß, Handschuhe, Küchenrolle, ( Skalpell+Klingen, Pinzette :wenn vorhanden), Fotoapparat; Ihr
Die Firma Otto Klein in Hanau ist wegen der Herstellung
 OTTO KLEIN & CO. Die Firma Otto Klein in Hanau ist wegen der Herstellung der offiziellen Version des Eichenlaubs mit Schwerter und Diamanten und des extrem seltenen Goldenen Eichenlaubs mit Schwertern
OTTO KLEIN & CO. Die Firma Otto Klein in Hanau ist wegen der Herstellung der offiziellen Version des Eichenlaubs mit Schwerter und Diamanten und des extrem seltenen Goldenen Eichenlaubs mit Schwertern
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein
 Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Scydameniden (Coleoptera) aus dem baltischen Bernstein von H. Franz In Bernstein eingeschlossene fossile Scydmaeniden wurden bisher meines Wissens nur von Schaufuss (Nunquam otiosus III/7, 1870, 561 586)
Grundschraffur Metalle feste Stoffe Gase. Kunststoffe Naturstoffe Flüssigkeiten
 Anleitung für Schraffuren beim Zeichnen Die Bezeichnung Schraffur leitet sich von dem italienischen Verb sgraffiare ab, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie kratzen und eine Vielzahl feiner, paralleler
Anleitung für Schraffuren beim Zeichnen Die Bezeichnung Schraffur leitet sich von dem italienischen Verb sgraffiare ab, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie kratzen und eine Vielzahl feiner, paralleler
a) Bestimmen Sie rechnerisch die Koordinaten und die Art der Extrempunkte von G. Betrachtet wird die Gleichung
 Analysis Aufgabe 1.1 Gegeben ist die Funktion f mit 1 3 2 f x x 4 3x 9x 5 und G f Definitionsmenge IR. Die Abbildung zeigt den Graphen von f. a) Bestimmen Sie rechnerisch die Koordinaten und die Art der
Analysis Aufgabe 1.1 Gegeben ist die Funktion f mit 1 3 2 f x x 4 3x 9x 5 und G f Definitionsmenge IR. Die Abbildung zeigt den Graphen von f. a) Bestimmen Sie rechnerisch die Koordinaten und die Art der
Archäologische Erschließung Freiham-Nord 1. Realisierungsabschnitt
 Archäologische Erschließung Freiham-Nord 1. Realisierungsabschnitt Seit Herbst 2013 f inden im Auftrag des Kommunalreferats in Freiham archäologische Ausgrabungen statt. Mehrere private Grabungsf irmen
Archäologische Erschließung Freiham-Nord 1. Realisierungsabschnitt Seit Herbst 2013 f inden im Auftrag des Kommunalreferats in Freiham archäologische Ausgrabungen statt. Mehrere private Grabungsf irmen
Beiträge zur urgeschichtlichen Landschaftsnutzung im Braunkohlenrevier (LANU)
 Universität zu Köln und RWTH Aachen (Antrag Nr. 182.7) Beiträge zur urgeschichtlichen Landschaftsnutzung im Braunkohlenrevier (LANU) Das Projekt " Beiträge zur urgeschichtlichen Landschaftsnutzung im Braunkohlenrevier"
Universität zu Köln und RWTH Aachen (Antrag Nr. 182.7) Beiträge zur urgeschichtlichen Landschaftsnutzung im Braunkohlenrevier (LANU) Das Projekt " Beiträge zur urgeschichtlichen Landschaftsnutzung im Braunkohlenrevier"
Der Sudoku-Knacker. Vorwort 3. Allgemeine Sudoku-Regeln. 4. Das Duplex-Verfahren Das Zwillings-Duplexpaar... 15
 Helmut Igl Der Sudoku-Knacker Inhaltsverzeichnis: Vorwort 3 Allgemeine Sudoku-Regeln. 4 Das Duplex-Verfahren..... Das Zwillings-Duplexpaar... 1 Das versteckte Zwillings-Duplexpaar.. 18 Der Drilling.. 33
Helmut Igl Der Sudoku-Knacker Inhaltsverzeichnis: Vorwort 3 Allgemeine Sudoku-Regeln. 4 Das Duplex-Verfahren..... Das Zwillings-Duplexpaar... 1 Das versteckte Zwillings-Duplexpaar.. 18 Der Drilling.. 33
Herausgeber: Bund deutscher Chiropraktiker e.v. Fuggerstr Berlin Model: Viola Jacob Idee/Realisation: K.J.
 Chiropraktik Patienten-Trainingsbuch Herausgeber: Bund deutscher Chiropraktiker e.v. Fuggerstr. 33-10777 Berlin www.chiropraktik-bund.de 1996-2007 Fotografien: kmk-artdesign.de Model: Viola Jacob Idee/Realisation:
Chiropraktik Patienten-Trainingsbuch Herausgeber: Bund deutscher Chiropraktiker e.v. Fuggerstr. 33-10777 Berlin www.chiropraktik-bund.de 1996-2007 Fotografien: kmk-artdesign.de Model: Viola Jacob Idee/Realisation:
Die mittelkaiserzeitlichen und spätantiken Gräber der römischen Villa WW 132
 Jessica Greven (Antrag Nr. 257) Die mittelkaiserzeitlichen und spätantiken Gräber der römischen Villa WW 132 In Inden-Altdorf wurde in den Jahren 2010/11 eine römische Villenanlage mit zwei Grabarealen
Jessica Greven (Antrag Nr. 257) Die mittelkaiserzeitlichen und spätantiken Gräber der römischen Villa WW 132 In Inden-Altdorf wurde in den Jahren 2010/11 eine römische Villenanlage mit zwei Grabarealen
Mauerinventar Vorarlberg Aufnahmen Marktgemeinde Rankweil 64M026/1
 Mauerinventar Vorarlberg Aufnahmen Marktgemeinde Rankweil 64M026/1 Aufnahmenummer 64M026/1 Datum der Ersterfassung 16.04.2010 Gartenmauer Gewerbepark, Abschnitt 1 Parzellennummer 21/4, 6443/3, 6443/6 Adresse/Flurname
Mauerinventar Vorarlberg Aufnahmen Marktgemeinde Rankweil 64M026/1 Aufnahmenummer 64M026/1 Datum der Ersterfassung 16.04.2010 Gartenmauer Gewerbepark, Abschnitt 1 Parzellennummer 21/4, 6443/3, 6443/6 Adresse/Flurname
Siedlungskeramik der frührömischen Kaiserzeit von Kremmin, Kreis Ludwigslust Jürgen Brandt, Schwerin
 Siedlungskeramik der frührömischen Kaiserzeit von Kremmin, Kreis Ludwigslust Jürgen Brandt, Schwerin [erschienen in: Informationen des Bezirksarbeitskreises für Ur- und Frühgeschichte Schwerin 24 (1984),
Siedlungskeramik der frührömischen Kaiserzeit von Kremmin, Kreis Ludwigslust Jürgen Brandt, Schwerin [erschienen in: Informationen des Bezirksarbeitskreises für Ur- und Frühgeschichte Schwerin 24 (1984),
Oberstufe (11, 12, 13)
 Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
DER STEINZEITMENSCH DAS GROSSSTEINGRAB VON TANNENHAUSEN
 DER STEINZEITMENSCH Die Menschen in der Steinzeit waren Menschen wie wir. Sie unterschieden sich in ihrem Äußern nicht von uns heute. Sie trugen andere Kleidung, sie machten andere Dinge und sie sprachen
DER STEINZEITMENSCH Die Menschen in der Steinzeit waren Menschen wie wir. Sie unterschieden sich in ihrem Äußern nicht von uns heute. Sie trugen andere Kleidung, sie machten andere Dinge und sie sprachen
07 Grundübung Oberkörper
 07 Grundübung Oberkörper Stützen in der Mitte, nahe zusammen, Gesäß senkrecht freihängend Handgelenke gerade, Arme gestreckt, Schulter stark nach unten ziehen Arme, Brust, Rücken Beine gestreckt in der
07 Grundübung Oberkörper Stützen in der Mitte, nahe zusammen, Gesäß senkrecht freihängend Handgelenke gerade, Arme gestreckt, Schulter stark nach unten ziehen Arme, Brust, Rücken Beine gestreckt in der
Kräftigungsprogramm CCJL-B
 Kräftigungsprogramm CCJL-B Saison 2016/17 Mit gezielten Präventionsmaßnahmen und Athletik-Training lassen sich Risiken von Verletzungen und die damit verbundenen Ausfälle in der Mannschaft verringern.
Kräftigungsprogramm CCJL-B Saison 2016/17 Mit gezielten Präventionsmaßnahmen und Athletik-Training lassen sich Risiken von Verletzungen und die damit verbundenen Ausfälle in der Mannschaft verringern.
Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20
 Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20 (1) Jedes der 24 Teilquadrate grenzt an genau eine der acht Ecken. Da nach unserer Vorschrift die drei Teilquadrate an jeder Ecke unterschiedlich gefärbt sein
Lösung zur Aufgabe Würfel färben von Heft 20 (1) Jedes der 24 Teilquadrate grenzt an genau eine der acht Ecken. Da nach unserer Vorschrift die drei Teilquadrate an jeder Ecke unterschiedlich gefärbt sein
Von 21 Fraktursystemen in diesem Bereich gehen 23 Berstungsfrakturen aus. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
 6 6 Ergebnisse 6. Ergebnisse aus den Kumulativskizzen 6.. Frakturen mit Zentrum occipipital Occipital sind 4 Fraktursysteme mit 6 Berstungsfrakturen aufgetreten. Bis auf zwei Ausnahmen verlaufen alle durch
6 6 Ergebnisse 6. Ergebnisse aus den Kumulativskizzen 6.. Frakturen mit Zentrum occipipital Occipital sind 4 Fraktursysteme mit 6 Berstungsfrakturen aufgetreten. Bis auf zwei Ausnahmen verlaufen alle durch
8.Perspektive (oder Zentralprojektion)
 8.Perspektive (oder Zentralprojektion) In unseren bisherigen Vorlesungen haben wir uns einfachheitshalber mit Parallelprojektionen beschäftigt. Das menschliche Sehen (damit meinen wir immer das Sehen mit
8.Perspektive (oder Zentralprojektion) In unseren bisherigen Vorlesungen haben wir uns einfachheitshalber mit Parallelprojektionen beschäftigt. Das menschliche Sehen (damit meinen wir immer das Sehen mit
BWS Mob. 5/12. Erstellt über das PhysioWorkout-System am 13. Mai 2012 Seite 1 / 2
 BWS Mob. 5/12 Mob. obere BWS SITZ auf einem Stuhl mit Rückenlehne: Der Oberkörper wird nach hinten bewegt, dabei entsteht eine Streckung der BWS. Wenn Sie die Sitzposition änderen, können verschiedene
BWS Mob. 5/12 Mob. obere BWS SITZ auf einem Stuhl mit Rückenlehne: Der Oberkörper wird nach hinten bewegt, dabei entsteht eine Streckung der BWS. Wenn Sie die Sitzposition änderen, können verschiedene
10 Übungen zur Kräftigung Ihrer Muskulatur
 1 Für einen starken Rücken 1. Sie stehen in Schrittstellung, das rechte Bein steht vorn. Ihr Oberkörper ist so weit vorgebeugt, dass Ihr linkes Bein, Rücken und Kopf eine Linie bilden. Die Hände erfassen
1 Für einen starken Rücken 1. Sie stehen in Schrittstellung, das rechte Bein steht vorn. Ihr Oberkörper ist so weit vorgebeugt, dass Ihr linkes Bein, Rücken und Kopf eine Linie bilden. Die Hände erfassen
Wie wählen wir eine Sprossenwand?
 Wie wählen wir eine Sprossenwand? Wenn Sie eine Sprossenwand wählen, müssen Sie folgendes beachten: 1. Welche Höhe und Breite ist richtig? Wenn Sie 180 cm gross sind sollten Sie keine 200 cm hohe Sprossenwand
Wie wählen wir eine Sprossenwand? Wenn Sie eine Sprossenwand wählen, müssen Sie folgendes beachten: 1. Welche Höhe und Breite ist richtig? Wenn Sie 180 cm gross sind sollten Sie keine 200 cm hohe Sprossenwand
Die richtige Messerpflege
 Die richtige Messerpflege Skanaffär GbR Inh. Sven und Martina Crößmann SKANAFFÄR 7 August 2013 Verfasst von: Sven Crößmann Die richtige Messerpflege Skanaffär GbR Inh. Sven und Martina Crößmann Die richtige
Die richtige Messerpflege Skanaffär GbR Inh. Sven und Martina Crößmann SKANAFFÄR 7 August 2013 Verfasst von: Sven Crößmann Die richtige Messerpflege Skanaffär GbR Inh. Sven und Martina Crößmann Die richtige
Laboratorio Scientifico del MUSEO D ARTE E SCIENZA di Gottfried Matthaes
 Laboratorio Scientifico del MUSEO D ARTE E SCIENZA di Gottfried Matthaes Milano, 23/02/2011 Nr. 2AN-7754 Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen an dem vorliegenden Gemälde, Öl auf Leinwand (123
Laboratorio Scientifico del MUSEO D ARTE E SCIENZA di Gottfried Matthaes Milano, 23/02/2011 Nr. 2AN-7754 Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen an dem vorliegenden Gemälde, Öl auf Leinwand (123
Leitern für den Ausstieg von Tieren aus einem Schwimmbecken
 Leitern für den Ausstieg von Tieren aus einem Schwimmbecken Konstruktion und Bau aus sehr traurigem Anlass. Es ist stark zu vermuten, dass diese Leitern KEIN Mittel gegen den Tod von Tieren in Schwimmbecken
Leitern für den Ausstieg von Tieren aus einem Schwimmbecken Konstruktion und Bau aus sehr traurigem Anlass. Es ist stark zu vermuten, dass diese Leitern KEIN Mittel gegen den Tod von Tieren in Schwimmbecken
Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres
 Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres Historisches und Grundlagen: Generell wird zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Fernrohren unterschieden. Auf der einen Seite gibt es das
Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres Historisches und Grundlagen: Generell wird zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Fernrohren unterschieden. Auf der einen Seite gibt es das
Zugereiste oder Einheimische?
 Beiträge aus der Statistik 561 Zugereiste oder Einheimische? Die Herkunft von Erstsemestern an bayerischen Hochschulen Dr. Raimund Rödel Das Abitur am Gymnasium stellt den klassischen Weg dar, um ein Studium
Beiträge aus der Statistik 561 Zugereiste oder Einheimische? Die Herkunft von Erstsemestern an bayerischen Hochschulen Dr. Raimund Rödel Das Abitur am Gymnasium stellt den klassischen Weg dar, um ein Studium
Die besten Rückenübungen für zu Hause. Der Trainingsplan passend zum Artikel auf Daytraining.de
 Die besten Rückenübungen für zu Hause Der Trainingsplan passend zum Artikel auf Daytraining.de Rückentrainingsplan Das Training für einen starken Rücken und eine stabile Körpermitte muss nicht kompliziert
Die besten Rückenübungen für zu Hause Der Trainingsplan passend zum Artikel auf Daytraining.de Rückentrainingsplan Das Training für einen starken Rücken und eine stabile Körpermitte muss nicht kompliziert
Level TRAININGSZIRKEL GELANDER & CO
 Level 2 TRANNGSZRKEL GELANDER & CO 1W5EDXER HÄNGENDE DPS Kräftigt die Arm- und Schultermuskulatur 1. Für diese Übung benötigen Sie etwas Ähnliches wie einen Barren. Stellen Sie sich aufrecht zwischen die
Level 2 TRANNGSZRKEL GELANDER & CO 1W5EDXER HÄNGENDE DPS Kräftigt die Arm- und Schultermuskulatur 1. Für diese Übung benötigen Sie etwas Ähnliches wie einen Barren. Stellen Sie sich aufrecht zwischen die
Karnak - Hypostyl. Abbildung aus Refai, koloriert von Iufaa nach Kontrolle vor Ort 2007
 Karnak - Hypostyl Das Hypostyl in Karnak gilt als der größte Säulensaal der Welt. Ehemals befanden sich in ihm 134 Papyrussäulen, heute fehlen lediglich eine Hand voll. Die Säulen tragen Verzierung, Inschriftenbänder
Karnak - Hypostyl Das Hypostyl in Karnak gilt als der größte Säulensaal der Welt. Ehemals befanden sich in ihm 134 Papyrussäulen, heute fehlen lediglich eine Hand voll. Die Säulen tragen Verzierung, Inschriftenbänder
c) Zeigen Sie, dass dieses Parallelogramm AOBC kein Rhombus und auch kein Rechteck ist.
 Fach Klassen Mathematik alle 5. Klassen Dauer der Prüfung: Erlaubte Hilfsmittel: 4 Std. Fundamentum Mathematik und Physik Taschenrechner TI-83 Plus inkl. Applikation CtlgHelp Vorbemerkungen: 1. Ergebnisse
Fach Klassen Mathematik alle 5. Klassen Dauer der Prüfung: Erlaubte Hilfsmittel: 4 Std. Fundamentum Mathematik und Physik Taschenrechner TI-83 Plus inkl. Applikation CtlgHelp Vorbemerkungen: 1. Ergebnisse
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Hochhausen Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg von Frank Buchali und Marco
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Hochhausen Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg von Frank Buchali und Marco
Fehlgeschlagene Versuche zur Erklärung von Expansion des Universums und Urknall. Zchg. (a) Zchg. (b) Zchg. (c) Zchg. (d)
 Fehlgeschlagene Versuche zur Erklärung von Expansion des Universums und Urknall Grundlage : Simon Singh in "Big Bang" Abb. 67 / S.265 siehe Anhang Hubbles Beobachtungen ließen den Schluss zu, dass das
Fehlgeschlagene Versuche zur Erklärung von Expansion des Universums und Urknall Grundlage : Simon Singh in "Big Bang" Abb. 67 / S.265 siehe Anhang Hubbles Beobachtungen ließen den Schluss zu, dass das
Andreas Schardt Personal Training Business Fitness
 Andreas Schardt Personal Training www.andreasschardt.com Business Fitness Lockere Schultern (Entspannungsübung) Stellen Sie sich gerade hin, die Arme hängen locker am Körper herab. Atmen Sie ein und ziehen
Andreas Schardt Personal Training www.andreasschardt.com Business Fitness Lockere Schultern (Entspannungsübung) Stellen Sie sich gerade hin, die Arme hängen locker am Körper herab. Atmen Sie ein und ziehen
1. Rückenbeweglichkeit. 2. Verkürzung der Hüftaussenrotatoren
 1. Rückenbeweglichkeit Mit gestreckten Knien versuchen den Fingerspitzen den Boden zu erreichen. 2. Verkürzung der Hüftaussenrotatoren Im Sitzen den Fuss auf das Knie der Gegenseite legen. Den Unterschenkel
1. Rückenbeweglichkeit Mit gestreckten Knien versuchen den Fingerspitzen den Boden zu erreichen. 2. Verkürzung der Hüftaussenrotatoren Im Sitzen den Fuss auf das Knie der Gegenseite legen. Den Unterschenkel
Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material
 Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material Zusammenfassung 2 2 2 Abstract Gruppierungen nach Eigenschaftspaaren Wirkung der Materialien Auswertung 3 4 5 6 7 8 9 10 Gelb Orange Rot Braun
Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material Zusammenfassung 2 2 2 Abstract Gruppierungen nach Eigenschaftspaaren Wirkung der Materialien Auswertung 3 4 5 6 7 8 9 10 Gelb Orange Rot Braun
RHYTHMIK - DIE 5 SCHLAFLOSEN STUDENTEN
 RHYTHMIK - DIE 5 SCHLAFLOSEN STUDENTEN Autoren: Marius Schäfer, Jannik Venter, Yannic Sommer; Michael Soffner; Philipp Kämpf 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Geschichte der schlaflosen Studenten Instrumente
RHYTHMIK - DIE 5 SCHLAFLOSEN STUDENTEN Autoren: Marius Schäfer, Jannik Venter, Yannic Sommer; Michael Soffner; Philipp Kämpf 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Geschichte der schlaflosen Studenten Instrumente
Makige. DKB Deutscher Kanarien- und Vogelzüchter-Bund e.v. Seite 1 von 9 Ulrich Völker DKB 2006
 Makige Seite 1 von 9 Makige Die Rasse Makige wird vielfach auch als Japan-Frisé wegen ihres Herkunftslandes bezeichnet. Im Standard wird von diesen Figuren-Kanarien eine Haltung verlangt, bei der Rücken-
Makige Seite 1 von 9 Makige Die Rasse Makige wird vielfach auch als Japan-Frisé wegen ihres Herkunftslandes bezeichnet. Im Standard wird von diesen Figuren-Kanarien eine Haltung verlangt, bei der Rücken-
Bericht zur Grabung Zellerstraße, Wels 2015 Michaela Greisinger
 Bericht zur Grabung Zellerstraße, Wels 2015 Michaela Greisinger 1 Bericht Teil B Mnr.: 51218.15.01 Mbez.: Römische Gräber Bl.: Oberösterreich PB: Wels Gemeinde: Wels KG: Obereisenfeld Gst.Nr.: 321/2 Anlass
Bericht zur Grabung Zellerstraße, Wels 2015 Michaela Greisinger 1 Bericht Teil B Mnr.: 51218.15.01 Mbez.: Römische Gräber Bl.: Oberösterreich PB: Wels Gemeinde: Wels KG: Obereisenfeld Gst.Nr.: 321/2 Anlass
TECHNIKEN PITCHING TECHNIK. 1. Gewichtsverlagerung und kurzer Schritt nach hinten, um das Standbein in Ausgangsposition zu bringen (Windup).
 TECHNIKEN PITCHING TECHNIK 1. Gewichtsverlagerung und kurzer Schritt nach hinten, um das Standbein in Ausgangsposition zu bringen (Windup). 2. Gewichtsverlagerung auf das Standbein. Das andere Bein schwingt
TECHNIKEN PITCHING TECHNIK 1. Gewichtsverlagerung und kurzer Schritt nach hinten, um das Standbein in Ausgangsposition zu bringen (Windup). 2. Gewichtsverlagerung auf das Standbein. Das andere Bein schwingt
In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0),
 IQB-Aufgabe Analytische Geometrie I In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0), B(28 10 0), C(0 10 0), D(0 0 0) und P(20 0 6) gegeben. Der Körper ist ein schiefes Prisma,
IQB-Aufgabe Analytische Geometrie I In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0), B(28 10 0), C(0 10 0), D(0 0 0) und P(20 0 6) gegeben. Der Körper ist ein schiefes Prisma,
Das Tiroler Schloss. 1. Inhaltsverzeichnis. 1. Inhaltsverzeichnis 1 2. Anwendung 2 3. Beispiele Ändern des Tiroler Schlosses 7
 Das Tiroler Schloss 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis 1 2. Anwendung 2 3. Beispiele 3 3.1. Beispiel rechtwinklige Ecke 4 3.2. Beispiel rechtwinklige T-Ecke 6 4. Ändern des Tiroler Schlosses 7
Das Tiroler Schloss 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis 1 2. Anwendung 2 3. Beispiele 3 3.1. Beispiel rechtwinklige Ecke 4 3.2. Beispiel rechtwinklige T-Ecke 6 4. Ändern des Tiroler Schlosses 7
Ein Vergleich zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen
 Die Bedeutung der Grundschulempfehlung für die Wahl der weiterführenden Schule Ein Vergleich zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen In NRW gibt es unverbindliche Empfehlungen der Grundschulen, denen die
Die Bedeutung der Grundschulempfehlung für die Wahl der weiterführenden Schule Ein Vergleich zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen In NRW gibt es unverbindliche Empfehlungen der Grundschulen, denen die
Mathematik. Oktober 2017 AHS. Kompensationsprüfung 1 Angabe für Kandidatinnen/Kandidaten
 Name: Datum: Klasse: Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Oktober 2017 Mathematik Kompensationsprüfung 1 Angabe für Kandidatinnen/Kandidaten Hinweise
Name: Datum: Klasse: Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Oktober 2017 Mathematik Kompensationsprüfung 1 Angabe für Kandidatinnen/Kandidaten Hinweise
KERSTIN KRUSCHINSKI PETRA WALDMINGHAUS. Lebensgefühl BRILLE. Verkaufen mit Stylingkompetenz
 KERSTIN KRUSCHINSKI PETRA WALDMINGHAUS Lebensgefühl BRILLE Verkaufen mit Stylingkompetenz Anatomie des Gesichtes ABFALLENDE AUGENBRAUEN Merkmale: Die Brauen sind vom mittigen Ansatz bis zum Ende Richtung
KERSTIN KRUSCHINSKI PETRA WALDMINGHAUS Lebensgefühl BRILLE Verkaufen mit Stylingkompetenz Anatomie des Gesichtes ABFALLENDE AUGENBRAUEN Merkmale: Die Brauen sind vom mittigen Ansatz bis zum Ende Richtung
Einführung in die Hallstattzeit. Der Westen Die Gräber (HaC + HaD)
 Der Westen Die Gräber (HaC + HaD) Westhallstattkreis Westhallstattgräber allgemein Grabhügel ein oder mehrere Gräber darin Größe und Menge der Gräber pro Hügel regional unterschiedlich Kammergräber (Holzbohlen)
Der Westen Die Gräber (HaC + HaD) Westhallstattkreis Westhallstattgräber allgemein Grabhügel ein oder mehrere Gräber darin Größe und Menge der Gräber pro Hügel regional unterschiedlich Kammergräber (Holzbohlen)
Reflexion des Lichts (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Reflexion des Lichts (Artikelnr.: P063600) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Reflexion und Brechung Experiment:
Lehrer-/Dozentenblatt Reflexion des Lichts (Artikelnr.: P063600) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Physik Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Optik Unterthema: Reflexion und Brechung Experiment:
Scheranleitung für Rechtshänder
 Scheranleitung für Rechtshänder 1. Bauch: Das Entfernen der Bauchwolle ist einer der wichtigsten Aufgaben des Scherens, da man damit gleichzeitig den Anfang für den Hals, Rücken und die rechte Seite schafft.
Scheranleitung für Rechtshänder 1. Bauch: Das Entfernen der Bauchwolle ist einer der wichtigsten Aufgaben des Scherens, da man damit gleichzeitig den Anfang für den Hals, Rücken und die rechte Seite schafft.
Sonnenstand abschätzen
 Sonnenstand abschätzen 1. Himmelsrichtung der Sonne 2. Uhrzeit bestimmen 3. Höhenwinkel- und Zenitbestimmung 4. Zeitraum einschränken 5. Fehlerbetrachtung 6. Gesamtergebnis 1. Himmelsrichtung der Sonne
Sonnenstand abschätzen 1. Himmelsrichtung der Sonne 2. Uhrzeit bestimmen 3. Höhenwinkel- und Zenitbestimmung 4. Zeitraum einschränken 5. Fehlerbetrachtung 6. Gesamtergebnis 1. Himmelsrichtung der Sonne
Ausgrabung Live für Interessierte Öffentliche Führung auf der Grabung Kleinfischlingen am
 Ausgrabung Live für Interessierte Öffentliche Führung auf der Grabung Kleinfischlingen am 17.07.2012 Am 17.07. war eine öffentliche Führung für die Grundbesitzer im Neubaugebiet Auf dem Weinhübel und für
Ausgrabung Live für Interessierte Öffentliche Führung auf der Grabung Kleinfischlingen am 17.07.2012 Am 17.07. war eine öffentliche Führung für die Grundbesitzer im Neubaugebiet Auf dem Weinhübel und für
Schleifstütze SVD-110
 Schleifstütze SVD-110 SCHABER Mit runder Schneide Mit gerader Schneide Mit abgerundete Seitenschneide FASSSCHABER UND ZUGMESSER ZIEHKLINGEN KLINGEN FÜR HOHLDREHWERKZEUGE SCHRAUBENDREHER Aufstellen der
Schleifstütze SVD-110 SCHABER Mit runder Schneide Mit gerader Schneide Mit abgerundete Seitenschneide FASSSCHABER UND ZUGMESSER ZIEHKLINGEN KLINGEN FÜR HOHLDREHWERKZEUGE SCHRAUBENDREHER Aufstellen der
Abb. 1: Magnetikplan des Kultbezirkes 2 mit Objekt 40 ( NHM Keltenforschung Roseldorf 2014)
 GRABUNG 2014 Im Jahre 2011 wurden im Rahmen einer weiterführenden geomagnetischen Prospektion am Plateau des Sandberges neben den bereits ausgegrabenen Heiligtümern Objekt 30 und Objekt 41 ein weiteres
GRABUNG 2014 Im Jahre 2011 wurden im Rahmen einer weiterführenden geomagnetischen Prospektion am Plateau des Sandberges neben den bereits ausgegrabenen Heiligtümern Objekt 30 und Objekt 41 ein weiteres
Das Landratten Stabilitätsprogramm für Surfer
 Das Landratten Stabilitätsprogramm für Surfer Jede Übung wird einmal durchgeführt. Es gibt 6 Übungen, 2 davon mit links/ rechts Variante. Das entspricht 8 Sätzen. Die letzte (Handstand) ist optional. Die
Das Landratten Stabilitätsprogramm für Surfer Jede Übung wird einmal durchgeführt. Es gibt 6 Übungen, 2 davon mit links/ rechts Variante. Das entspricht 8 Sätzen. Die letzte (Handstand) ist optional. Die
Plattenfundament bauen Anleitung der HORNBACH Meisterschmiede
 Seite 1 von 5 Plattenfundament bauen Anleitung der HORNBACH Meisterschmiede Das brauchen Sie für Ihr Projekt Material Werkzeug Markierungsspray Trockenbeton Schotter Betonkies Pflastersplitt Randsteine
Seite 1 von 5 Plattenfundament bauen Anleitung der HORNBACH Meisterschmiede Das brauchen Sie für Ihr Projekt Material Werkzeug Markierungsspray Trockenbeton Schotter Betonkies Pflastersplitt Randsteine
Feilenarten: Einhieb, Kreuzhieb, Raspelhieb Was ist das?
 Feilenarten: Einhieb, Kreuzhieb, Raspelhieb Was ist das? Inhaltsverzeichnis Hiebfertigung Gehauene Hiebe Gefräste Hiebe Hiebformen Einhieb Kreuzhieb Raspelhieb Hiebzahl und Hiebnummer Hiebzahl Hiebnummer
Feilenarten: Einhieb, Kreuzhieb, Raspelhieb Was ist das? Inhaltsverzeichnis Hiebfertigung Gehauene Hiebe Gefräste Hiebe Hiebformen Einhieb Kreuzhieb Raspelhieb Hiebzahl und Hiebnummer Hiebzahl Hiebnummer
Vorrichtung für Messer SVM-45
 Vorrichtung für Messer SVM-45 DIE MEISTEN MESSER Schneidenlänge mindestens 60 mm. ZUGMESSER Aufstellen der Maschine Schleifrichtung: Gegen oder weg von der Schneide. Anm Die Werkbank sollte beim Messerschleifen
Vorrichtung für Messer SVM-45 DIE MEISTEN MESSER Schneidenlänge mindestens 60 mm. ZUGMESSER Aufstellen der Maschine Schleifrichtung: Gegen oder weg von der Schneide. Anm Die Werkbank sollte beim Messerschleifen
Bauchmuskulatur. Position 1: In Rückenlage die Knie anziehen und die Unterschenkel von außen umfassen.
 Double-Leg-Stretch Untere gerade und schräge Bauchmuskulatur Position 1: In Rückenlage die Knie anziehen und die Unterschenkel von außen umfassen. Position 2: Den Bauchnabel einziehen. Kopf und Schultern
Double-Leg-Stretch Untere gerade und schräge Bauchmuskulatur Position 1: In Rückenlage die Knie anziehen und die Unterschenkel von außen umfassen. Position 2: Den Bauchnabel einziehen. Kopf und Schultern
Körper erkennen und beschreiben
 Vertiefen 1 Körper erkennen und beschreiben zu Aufgabe 6 Schulbuch, Seite 47 6 Passt, passt nicht Nenne zu jeder Aussage alle Formen, auf die die Aussage zutrifft. a) Die Form hat keine Ecken. b) Die Form
Vertiefen 1 Körper erkennen und beschreiben zu Aufgabe 6 Schulbuch, Seite 47 6 Passt, passt nicht Nenne zu jeder Aussage alle Formen, auf die die Aussage zutrifft. a) Die Form hat keine Ecken. b) Die Form
Sicheres Arbeiten. Aufarbeiten von Bäumen
 Sicheres Arbeiten Aufarbeiten von Bäumen Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger und für die Richtigkeit des Inhaltes: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Abteilung für Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung
Sicheres Arbeiten Aufarbeiten von Bäumen Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger und für die Richtigkeit des Inhaltes: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Abteilung für Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt.
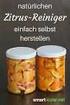 ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
Jutta Leskovar OÖ. Landesmuseum Abt. Ur- und Frühgeschichte Welser Strasse Linz/Leonding 0676/
 Jutta Leskovar OÖ. Landesmuseum Abt. Ur- und Frühgeschichte Welser Strasse 20 4060 Linz/Leonding 0676/5502438 j.leskovar@landesmuseum.at Einführung Einführungin indiediehallstattkultur Hallstattzeit Prüfungsmodalitäten
Jutta Leskovar OÖ. Landesmuseum Abt. Ur- und Frühgeschichte Welser Strasse 20 4060 Linz/Leonding 0676/5502438 j.leskovar@landesmuseum.at Einführung Einführungin indiediehallstattkultur Hallstattzeit Prüfungsmodalitäten
Beiträge zur Naturgeschichte des Krefelder Raums Festschrift zum 125jährigen Bestehen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Krefeld
 Herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Krefeld e. V. in Verbindung mit dem Verein Linker Niederrhein e. V., Krefeld ISBN Nr. 3-923140-07-X Beiträge zur Naturgeschichte des Krefelder Raums
Herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Krefeld e. V. in Verbindung mit dem Verein Linker Niederrhein e. V., Krefeld ISBN Nr. 3-923140-07-X Beiträge zur Naturgeschichte des Krefelder Raums
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Die grau unterlegten Begriffe beziehen sich auf die Frage- und Antwortkarten.
 Die grau unterlegten Begriffe beziehen sich auf die Frage- und Antwortkarten. Amphore Großes Vorrats- und Transportgefäß mit zwei Henkeln. Anorganisches Material Von keinem Lebewesen stammend (zum Beispiel
Die grau unterlegten Begriffe beziehen sich auf die Frage- und Antwortkarten. Amphore Großes Vorrats- und Transportgefäß mit zwei Henkeln. Anorganisches Material Von keinem Lebewesen stammend (zum Beispiel
D I E E A berls M MORGEN 1
 DIE A M Eberls M O R G E N 1 HÄNDE ÜBERSTRECKEN Ausgleichsübung für die Hände Die normale Handhaltung ist gekrümmt und verkürzt. Wir machen aus dem Überstrecken eine einfache Fitnessübung zur Kräftigung.
DIE A M Eberls M O R G E N 1 HÄNDE ÜBERSTRECKEN Ausgleichsübung für die Hände Die normale Handhaltung ist gekrümmt und verkürzt. Wir machen aus dem Überstrecken eine einfache Fitnessübung zur Kräftigung.
Tipsheet. Glas schneiden und brechen
 Tipsheet Glas schneiden und brechen Obwohl mache Leute es zwar glauben, ist das schneiden und brechen von Glas nicht schwer. Wir beschreiben hier die meist verbreiteteste und einfachste Art und Weise Glas
Tipsheet Glas schneiden und brechen Obwohl mache Leute es zwar glauben, ist das schneiden und brechen von Glas nicht schwer. Wir beschreiben hier die meist verbreiteteste und einfachste Art und Weise Glas
7.7 Auflösungsvermögen optischer Geräte und des Auges
 7.7 Auflösungsvermögen optischer Geräte und des Auges Beim morgendlichen Zeitung lesen kann ein gesundes menschliche Auge die Buchstaben des Textes einer Zeitung in 50cm Entfernung klar und deutlich wahrnehmen
7.7 Auflösungsvermögen optischer Geräte und des Auges Beim morgendlichen Zeitung lesen kann ein gesundes menschliche Auge die Buchstaben des Textes einer Zeitung in 50cm Entfernung klar und deutlich wahrnehmen
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica
 Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Mit dem Helikopter in die Römerzeit Luftbildprospektion in Augusta Raurica Der heisse Sommer 2015 mit seiner langanhaltenden Trockenheit hinterliess auch auf den Wiesen und Ackerflächen in und um Augusta
Nähanleitung Landsknecht Wams
 Nähanleitung Landsknecht Wams Vorbild für das Wams in dieser Anleitung sind die Wämser der Landsknechte im Zeitraum 1505 bis 1525. Charakteristisch hierfür sind der Sitz auf Taille, der weite Kragenausschnitt
Nähanleitung Landsknecht Wams Vorbild für das Wams in dieser Anleitung sind die Wämser der Landsknechte im Zeitraum 1505 bis 1525. Charakteristisch hierfür sind der Sitz auf Taille, der weite Kragenausschnitt
Richtlinien für die Durchführung von Fahnenschwenkerwettbewerben - Niederrheinische Art -
 D03 Richtlinien Niederrheinische Art 14.03.2009 Seite 1 Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.v. Richtlinien für die Durchführung von Fahnenschwenkerwettbewerben - Niederrheinische Art
D03 Richtlinien Niederrheinische Art 14.03.2009 Seite 1 Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.v. Richtlinien für die Durchführung von Fahnenschwenkerwettbewerben - Niederrheinische Art
13 Shapes Kibbe-Quiz
 13 Shapes Kibbe-Quiz Entdecke dein wahres Potential Allgemeine Ausfüllhinweise Das Quiz ist relativ lang, nimm dir bitte etwa 30 Minuten Zeit Wenn du nicht sicher bist, welche die richtige Antwort ist,
13 Shapes Kibbe-Quiz Entdecke dein wahres Potential Allgemeine Ausfüllhinweise Das Quiz ist relativ lang, nimm dir bitte etwa 30 Minuten Zeit Wenn du nicht sicher bist, welche die richtige Antwort ist,
Schärfen von Werkzeugen
 Seite 1 von 7 Informationen zu diesem Dokument Dieses Dokument wurde erstellt von: Heiko Rech Internet: http://heio-rech.de E-Mail: info@heiko-rech.de Technische Informationen: Größere Version der Bilder
Seite 1 von 7 Informationen zu diesem Dokument Dieses Dokument wurde erstellt von: Heiko Rech Internet: http://heio-rech.de E-Mail: info@heiko-rech.de Technische Informationen: Größere Version der Bilder
Circuitblätter Rumpf-Kräftigung
 Circuitblätter Rumpf-Kräftigung Inhalt Schwerpunkt Nr Rumpfbeugen Bauch gerade 1 Rumpfbeugen schräg Bauch schräg 2 Toter Käfer Bauch gerade Pü 3 Einrollen Bauch/ Brust/ Hüftbeuger 4 Rocky-Rumpfbeugen Bauch/
Circuitblätter Rumpf-Kräftigung Inhalt Schwerpunkt Nr Rumpfbeugen Bauch gerade 1 Rumpfbeugen schräg Bauch schräg 2 Toter Käfer Bauch gerade Pü 3 Einrollen Bauch/ Brust/ Hüftbeuger 4 Rocky-Rumpfbeugen Bauch/
MBSR-Übungen: Körperübungen (Yoga)
 MBSR-Übungen: Körperübungen (Yoga) Michael Seibt Anleitung nach: Cornelia Löhmer, Rüdiger Standhardt: MBSR die Kunst, das ganze Leben zu umarmen. Klett- Cotta-Verlag Übung 1: In der Rückenlage eine bequeme
MBSR-Übungen: Körperübungen (Yoga) Michael Seibt Anleitung nach: Cornelia Löhmer, Rüdiger Standhardt: MBSR die Kunst, das ganze Leben zu umarmen. Klett- Cotta-Verlag Übung 1: In der Rückenlage eine bequeme
Stammköpfe. Situation. Wissen. Baum-Check Arbeitsblatt zur einfachen und schnellen Baumkontrolle nach VTA. Zwiesel erkennen und kontrollieren
 Situation Zwiesel erkennen und kontrollieren In Vergabelungen und n sind Holzanatomie und Kraftflussverlauf anders als im Stamm. Sie sind im Vergleich zu Baumteilen mit durchgehend längsgerichteter Holzfaser
Situation Zwiesel erkennen und kontrollieren In Vergabelungen und n sind Holzanatomie und Kraftflussverlauf anders als im Stamm. Sie sind im Vergleich zu Baumteilen mit durchgehend längsgerichteter Holzfaser
Grosse Statue des Zascha sitzend. 2 Mus. von Cairo.
 Grosse Statue des Zascha sitzend. 2 Mus. von Cairo. H. 70 cm. Der Mann sitzt auf einem grossen Würfel, der weiss, schwarz u. rot-fleckig bemalt ist, in Nachahmung von Holz. Die Plinthe vorn vor dem Würfel
Grosse Statue des Zascha sitzend. 2 Mus. von Cairo. H. 70 cm. Der Mann sitzt auf einem grossen Würfel, der weiss, schwarz u. rot-fleckig bemalt ist, in Nachahmung von Holz. Die Plinthe vorn vor dem Würfel
Sport-Thieme Balance-Pad Premium
 Übungsanleitung Sport-Thieme Balance-Pad Premium Art.-Nr. 11 132 0002 Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben! Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit
Übungsanleitung Sport-Thieme Balance-Pad Premium Art.-Nr. 11 132 0002 Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben! Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit
Auswahlverfahren. Verfahren, welche die prinzipiellen Regeln zur Konstruktion von Stichproben angeben
 Auswahlverfahren Verfahren, welche die prinzipiellen Regeln zur Konstruktion von Stichproben angeben Definition der Grundgesamtheit Untersuchungseinheit: Objekt an dem Messungen vorgenommen werden Grundgesamtheit
Auswahlverfahren Verfahren, welche die prinzipiellen Regeln zur Konstruktion von Stichproben angeben Definition der Grundgesamtheit Untersuchungseinheit: Objekt an dem Messungen vorgenommen werden Grundgesamtheit
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) / DE
 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 03. 03. 1997 / DE FCI - Standard Nr. 290 BEAGLE-HARRIER 2 ÜBERSETZUNG Originalsprache (FR).
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 03. 03. 1997 / DE FCI - Standard Nr. 290 BEAGLE-HARRIER 2 ÜBERSETZUNG Originalsprache (FR).
Holz für Garn und Stricksachen
 Holz für Garn und Stricksachen Während auch heute noch Knöpfe und Stricknadeln aus Holz hergestellt werden, gehören Strickgabeln und Wickelhölzer schon zu den fast vergessenen Handarbeitsgeräten. Die Strickgabel
Holz für Garn und Stricksachen Während auch heute noch Knöpfe und Stricknadeln aus Holz hergestellt werden, gehören Strickgabeln und Wickelhölzer schon zu den fast vergessenen Handarbeitsgeräten. Die Strickgabel
Stiftsschule Engelberg Physik Schuljahr 2017/2018
 2 Reflexionen 2.1 Reflexion und Reflexionsgesetz Wir unterscheiden zwei Arten der Spiegelung: regelmässige und unregelmässige Reflexion (= Streuung). Auf rauen Oberflächen eines Körpers wird das Licht
2 Reflexionen 2.1 Reflexion und Reflexionsgesetz Wir unterscheiden zwei Arten der Spiegelung: regelmässige und unregelmässige Reflexion (= Streuung). Auf rauen Oberflächen eines Körpers wird das Licht
Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und
 Ent. Arb. Mus. Frey 25, 1974 131 Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und Bolivien (Col. Melolonthidae Sericinae) Von G. Frey Astaena iridescens n. sp. (Abb. 1) Ober- und Unterseite braun bis
Ent. Arb. Mus. Frey 25, 1974 131 Neue Astaena-Arten aus Argentinien, Brasilien und Bolivien (Col. Melolonthidae Sericinae) Von G. Frey Astaena iridescens n. sp. (Abb. 1) Ober- und Unterseite braun bis
Englische Schecke (ESch) Kleine Rasse mit Tupfenzeichnung
 Englische Schecke (ESch) Kleine Rasse mit Tupfenzeichnung Mindestgewicht 2,5 kg Idealgewicht 2,7 3,1 kg Höchstgewicht 3,3 kg Spalterbig Ursprungsland England Entstanden aus Scheckenkaninchen In der Schweiz
Englische Schecke (ESch) Kleine Rasse mit Tupfenzeichnung Mindestgewicht 2,5 kg Idealgewicht 2,7 3,1 kg Höchstgewicht 3,3 kg Spalterbig Ursprungsland England Entstanden aus Scheckenkaninchen In der Schweiz
Landersdorf. lebendiges. Geschichtsdorf. Landersdorf Gemeinde Thalmässing
 Geschichtsdorf Landersdorf lebendiges Geschichtsdorf Landersdorf Gemeinde Thalmässing Jungsteinzeitliches Haus Rekonstruktion eines jungsteinzeitlichen Hauses Die ältesten Hinweise auf eine Besiedlung
Geschichtsdorf Landersdorf lebendiges Geschichtsdorf Landersdorf Gemeinde Thalmässing Jungsteinzeitliches Haus Rekonstruktion eines jungsteinzeitlichen Hauses Die ältesten Hinweise auf eine Besiedlung
New Balance Krafttraining
 New Balance Krafttraining 12 Übungen für das Training abseits der Laufstrecke Übung 1: Rückenstrecker unterer Teil, großer Gesäßmuskel, Kapuzenmuskel unterer Anteil Lege Dich auf den Bauch, winkele ein
New Balance Krafttraining 12 Übungen für das Training abseits der Laufstrecke Übung 1: Rückenstrecker unterer Teil, großer Gesäßmuskel, Kapuzenmuskel unterer Anteil Lege Dich auf den Bauch, winkele ein
Statistik Testverfahren. Heinz Holling Günther Gediga. Bachelorstudium Psychologie. hogrefe.de
 rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
Randsteine. Pollet Pool Group RANDSTEINE SRBA SAHARA ARDOISE NATURRANDSTEINE DER POLLET POOL GROUP PEPPERINO DARK TWILIGHT...
 9 9 SAHARA... 122 ARDOISE... 124 NATURRANDSTEINE DER POLLET POOL GROUP PEPPERINO DARK... 126 TWILIGHT... 127 Pollet Pool Group 121 SAHARA LINE 330MM 500 mm 330 mm 330 mm 25 mm 55 mm 310 mm Die Steine der
9 9 SAHARA... 122 ARDOISE... 124 NATURRANDSTEINE DER POLLET POOL GROUP PEPPERINO DARK... 126 TWILIGHT... 127 Pollet Pool Group 121 SAHARA LINE 330MM 500 mm 330 mm 330 mm 25 mm 55 mm 310 mm Die Steine der
Durchführung eines Muskelfunktionstests in Partnerarbeit
 Durchführung eines Muskelfunktionstests in Partnerarbeit 1. Bitte geht zu zweit zusammen und schaut euch die Übungen zur Dehn- bzw. Kraftkontrolle an. 2. Nehmt euch als Paar zwei Matten und führt die Übungen
Durchführung eines Muskelfunktionstests in Partnerarbeit 1. Bitte geht zu zweit zusammen und schaut euch die Übungen zur Dehn- bzw. Kraftkontrolle an. 2. Nehmt euch als Paar zwei Matten und führt die Übungen
Stabilisationsprogramm
 Stabilisationsprogramm Nachwuchs-Nationalteams Frauen 2006 Alle Rechte vorbehalten. Markus Foerster Eidg. dipl. Trainer Leistungssport CH-3053 Münchenbuchsee In Zusammenarbeit mit Swiss Volley und der
Stabilisationsprogramm Nachwuchs-Nationalteams Frauen 2006 Alle Rechte vorbehalten. Markus Foerster Eidg. dipl. Trainer Leistungssport CH-3053 Münchenbuchsee In Zusammenarbeit mit Swiss Volley und der
Der Höhenschnittpunkt im Dreieck
 Der Höhenschnittpunkt im Dreieck 1. Beobachte die Lage des Höhenschnittpunktes H. Wo befindet sich H? a) bei einem spitzwinkligen Dreieck, b) bei einem rechtwinkligen Dreieck, c) bei einem stumpfwinkligen
Der Höhenschnittpunkt im Dreieck 1. Beobachte die Lage des Höhenschnittpunktes H. Wo befindet sich H? a) bei einem spitzwinkligen Dreieck, b) bei einem rechtwinkligen Dreieck, c) bei einem stumpfwinkligen
Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts
 Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
Spieltheorie Sommersemester 007 Verfeinerungen des Bayesianischen Nash Gleichgewichts Das Bayesianische Nash Gleichgewicht für Spiele mit unvollständiger Information ist das Analogon zum Nash Gleichgewicht
