DIN EN NuK Consulting UG Geschäftsführung: Dr. Heinrich Kehl, Internet:
|
|
|
- Hanna Siegel
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 DIN EN Erläuterungen zur Deutschen Industrie Norm für Fertigungsmanagementfunktionen und zur Interoperabilität bzw. zu den Interdependenzen von Fertigungsprozessen mit Unternehmensführungs und -adminstrationsprozessen Einleitung Die optimale Integration von Fertigungsmanagementsystemen, heute leider meist Manufacturing Execution Systeme (MES) genannt, und administrativen Transaktionssystemen, meist ERP-System genannt, ist eine wichtige Unternehmensaufgabe, um die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen am Markt zu verbessern - und zwar unabhängig von ihrer Größe oder Branche. Worum geht es dabei? Vereinfacht ausgedrückt muss der durchgängige Austausch von Informationen zwischen den Unternehmensfunktionen wie Vertrieb, Produktentwicklung, Fertigung, Planung, Materialwirtschaft, Personal, den Leitsystemen und den ERP-Systemen inhaltlich richtig, komplett, und zeitnah ohne Verzögerung erfolgen, damit alle Prozesse des Unternehmens ökonomisch und effizient auf den oder die Kunden ausgerichtet werden können. Die Normenreihe DIN EN hat das Ziel, diesen durchgängigen Austausch von Informationen im Unternehmen zu definieren und die Integration unabhängig vom Grad der Automatisierung zu beschreiben. Die Norm beschreibt zudem die Aufgaben, Funktionen bzw. Prozesse der fertigungsnahen Unternehmensbereiche. Sie ist die einzige (!) gültige Norm zu diesem Themenkomplex. Unternehmen haben oder besser sollten deshalb ein starkes Interesse an einer solchen Norm haben, weil damit unabhängig und ohne Marketinghintergrund einzelner Systemhersteller unterschiedliche IT-Verfahren vereinheitlicht und Unternehmensaufgaben, die gegenseitig Informationen austauschen müssen, zusammengeführt werden und es möglich wird, nachhaltig zu robusten, pflegeleichten und bezahlbaren Integrationslösungen zu kommen. Die wesentlichen Vorteile für die Unternehmen sind: Ø kürzere Anlaufzeiten bei der Einführung neuer Systeme, Ø verbesserte Werkzeuge zur Integration, Ø niedrigere Automatisierungskosten, Ø bessere Möglichkeiten für die Definition von Benutzeranforderungen Ø und insbesondere eine unabhängige Leitlinie für die Optimierung der Supply Chain auf den Kunden. Daher ist eine solche Norm, wenn sie umfassend und inhaltlich richtig ist, für Anwender und Systemhersteller und -integratoren gleichermaßen wichtig.
2 Historie Die amerikanische ISA arbeitet seit 1995 gemeinsam mit Anbietern von Fertigungssystemen, Herstellern von ERP-Software, Beratern und Benutzern an der Entwicklung des Multi Parts Standards ISA SP 95 "Enterprise / Control System Integration". Diese Arbeiten schienen notwendig geworden zu sein, da der CIM Computer Integrated Manufacturing-Ansatz, aufgrund von prominienten Implementationskatastrophen scheinbar gescheitert war und niemand mehr mit dem Wort CIM in Verbindung gebracht werden wollte. Um die Norm außerhalb der USA bekannt zu machen und diese in IEC und ISO durchzusetzen, wurde ISA SP 95 innerhalb der IEC SC 65A "System Aspects" von der IEC/ISO JWG 15 (Joint Working Group) unter der Bezeichnung IEC "Enterprise / Control System Integration" bearbeitet - ein wichtiger Schritt für die weltweite Akzeptanz der Norm. Aufgrund der Dringlichkeit wurde ein beschleunigter Ablauf für die Entwicklung und Freigabe der einzelnen Entwicklungsphasen der Norm, die sogenannte Fast Track Procedure gewählt. Bemerkenswert ist, dass die Arbeiten der JWG15 seit dem ersten Meeting unter aktiver Beteiligung von Großunternehmen (Hersteller integrierter Fertigungssysteme) aber auch von Endnutzern und Beratern stattfinden - in der Regel in einem Team von 30 Experten aus vielen Ländern. Hinsichtlich der Entwicklung der Norm spielte die USA eine Vorreiterrolle. Der Standard ISA S95 ist als 5-teiliger Standard konzipiert, wobei die Teile 4 und 5 sich auch heute noch in der Entwurfsphase befinden. Die Normenreihe DIN EN 62264, identisch zu den IEC Normen, enthält gegenwärtig drei Teile: DIN EN , Integration von Unternehmens-EDV und Leitsystemen - Teil 1: Modelle und Terminologie (Englisch und Deutsch mit einem Wörterbuch Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch), DIN EN , Integration von Unternehmens-EDV und Leitsystemen - Teil 2 Attribute des Objektmodells (Englisch), DIN EN , Integration von Unternehmens-EDV und Leitsystemen - Teil 3 Aktivitätenmodelle des Fertigungsmanagements (Englisch). Teil 1 der Norm DIN EN IT Systeme im industriellen Umfeld können in verschiedene funktionale Kategorien eingeteilt werden. Die Normenreihe DIN EN verwendet im Ansatz ein hierarchisches Unternehmensmodell mit vier Ebenen, die ursprünglich in der Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA) definiert wurden.
3 Abb. 1 Hierarchisches Unternehmensmodell Ebene 4 entspricht der strategischen und taktischen Unternehmensführung mit Aktivitäten im Bereich Rechnungswesen, Einkauf, Verkauf, Langzeit-Planung, Management von Produktionsstandorten, externer Logistik, Personalwesen etc. Ebene 3 enthält Aktivitäten aus den Bereichen Produktionsmanagement, Qualitätsmanagement, Instandhaltung, Intralogistik und mengenorientierte Materialbestandsführung. Ebene 2 umfasst Automatisierungs- und Kontrollsysteme für verschiedene Industrien: chargenorientierte oder kontinuierliche Produktion sowie diskrete Fertigung. Ebene 1 umfasst die Automatisierungsobjekte, also die zu automatisierenden Geräte und Maschinen. Die Normenreihe DIN EN behandelt weiterhin den Informationsfluss von Unternehmensführung (Ebene 4) mit der Kontrollsystemebene (Ebene 2). Ziel dieser Aktivität ist die möglichst vollständige und in allen Industriezweigen anwendbare Definitionen und Beschreibungen der zwischen Leitsystem und Unternehmens-EDV angesiedelten Funktionen sowie der auszutauschenden Informationen (Abb. 2). Damit soll eine klare Definition von Systemgrenzen [ERP(Ebene 4) FMS(Ebene 3) - DCS/SCADA(Ebene 2)] und Verantwortlichkeiten zur Verfügung stehen. Unterhalb der Ebene 4 sind dabei alle Aufgaben angesiedelt, die sich auf folgende Funktionen beziehen bzw. diese beeinflussen: Betrieb der Produktionsanlagen sowie die in diesem Rahmen auszuführenden Tätigkeiten Sicherheit der Fertigung bzw. der Prozesse Sicherheit und Qualität der hergestellten Produkte Einhaltung von Industriestandards bzgl. Produktion und Qualität (z.b. FDA, IFS, GAMP) Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Produktion.
4 Abb. 2 Funktionales Modell der Unternehmenssteuerung Die Definition der Schnittstellen im Teil 1 der Norm DIN EN Nach der Festlegung der Systemgrenzen zu Kontrollsystemen und zur Unternehmensführung wird für die auf Ebene 3 angesiedelten Aufgaben eines Fertigungsleit- bzw. managementsystems (FMS) eine einheitliche Terminologie entwickelt und durch Objektmodelle funktional strukturiert. Ziel ist die Kategorisierung und Strukturierung der über die Schnittstellen zwischen Ebene 3 und Ebene 4 auszutauschenden Informationen nach den folgenden Kategorien: Product Definition - Definition der Produkte mittels, Spezifikation bestimmter Ressourceneigenschaften, insbesondere die hierarchische Einsatzstoffliste und Produkt- / Prozessparameter Production Capability - Verfügbarkeit, Eigenschaften, Einschränkungen von Ressourcen Production Schedule - Produktionsaufträge mit Anforderungen an die zu verwendenden Ressourcen Production Performance - Rückmeldung über tatsächlich verwendete Ressourcen, insbesondere produzierte und verbrauchte Materialien jeweils bezogen auf die Ressourcenmodelle für:
5 Equipment Personnel Material Process Segment Anlagenstruktur Mitarbeiterstruktur und rollen, Materialnamen, Materialtypen und -klassen für Roh-, Zwischen und Fertigprodukte, Materiallose etc. Prozessbeschreibung Der Vorteil in der Einführung dieser Modelle liegt darin, dass unterschiedliche Aspekte der Produktion im Wesentlichen unabhängig voneinander modelliert werden können und nur lose über Schnittstellen gekoppelt sind, sodass z.b.: für verschiedene Produktvarianten (unterschiedliche Spezifikationen, d.h. Product Definitions) dasselbe Prozessmodell (Process Segment) verwendet werden kann. Für verschiedene Produktionsaufträge (Production Schedule) dieselben Spezifikationen (Product Definition) verwendet werden können. Einschränkungen bzgl. Equipment (Production Capability) unabhängig von dem jeweils zu produzierenden Produkt und dem zugehörigen Plan (Production Schedule) formuliert werden können. Teil 2 der Norm DIN EN Hier werden die konkreten Attribute, d.h. Dateninhalte, der in Teil 1 identifizierten Objekte beschrieben. Ziel ist es, die Basis für konkrete Implementierungen des Objekt- und Datenmodells der zwischen Ebene 3 und Ebene 4 auszutauschenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Implementierung selbst (z.b. in XML) ist nicht Aufgabe dieser Norm, sondern kann unabhängig davon erfolgen (z.b. B2MML durch das WBF). Die Datenmodelle beschreiben dabei die folgenden Aspekte der in Teil 1 identifizierten Modelle:den konkreten Dateninhalt mittels eindeutiger IDs, Namen, textlicher Beschreibungen, konkret vorgegebener Eigenschaften wie z.b. Zustände (aus einer fest definierten Liste von möglichen Zuständen), Mengen / Werten (jeweils mit Maßeinheit)frei definierbare Eigenschafts- oder Parameterlisten (teilweise mit Maßeinheit), beispielsweise für Rezeptparameter Verwaltungsaspekte, z.b. Versionsnummern Zeitmodelle: z.b. Gültigkeitszeitraum für die Verfügbarkeit einer bestimmten Ressource oder Start- und Endzeit für einen ProduktionsauftragZugehörigkeit von Objekten zu bestimmten Klassen, z.b. Materialien zu Materialklassen wie "Farbstoffe", "Reinigungsmittel", "Katalysatoren" etc.hierarchien, d.h. Referenzen innerhalb eines Objektmodells, z.b. für die oben aufgeführte Anlagenstruktur (Equipment) oder für die hierarchische Strukturierung einer Einsatzstoffliste (Bill of Material), d.h. Einsatzstoffe je Prozessabschnitt (Process Segment)Externe Referenzen auf (zu anderen Modellen gehörige) Objekte, z.b. die Verwendung einer bestimmten Ressource (Equipment, Material,...) im Produktionsplan (Production Schedule) oder die Anwendung einer bestimmten Prozessbeschreibung (Process Segment) zur Herstellung eines Zwischenproduktes (Product Segment)Logische, funktionale oder zeitliche Abhängigkeiten, z.b. von Prozessabschnitten (Process Segments) zur Beschreibung einer zeitlichen Abfolge oder der Wegeführung von Material durch die Produktionsanlagec)
6 Teil 3 der Norm IEC Definition der Aktivitäten im Detail: Ziel dieses Teils ist die durchgängige funktionale Strukturierung der Aktivitäten innerhalb der Ebene 3 sowie der zwischen den Funktionen auszutauschenden Informationen. Dieser Teil der Norm ist der wichtigste und auch eingängiste Teil der Norm für Endbenutzer! Die Norm entwickelt zunächst ein generisches Modell (Abb. 3) für die Bereichsaktivitäten (Operations). Dies sind Definition Management (Spezifikations-Management) Resource Management (Ressourcen-Management) Detailed Scheduling (Feinplanung) Dispatching (Auftragsauslösung) Execution Management (Durchführung) Data Collection (Datenakquisition) Tracking (Verfolgen) Analysis (Analyse, Prüfungen) welches dann auf die vier Fertigungskategorien 1. Production (Produktionsaufträge, Produktionsdatenerfassung etc.), 2. Quality (Qualitätsmanagement, Probendefinition, Analyse, Freigabe etc.), 3. Maintenance (Wartungsplanung, Wartungsdaten etc.) und 4. Inventory (Intralogistik, Bestandsführung) angewandt und im Detail beschrieben wird. Abb. 3 Generisches Funktionsmodell
7 Dies ist der Gesamtumfang eines kompletten Fertigungsmanagementsystems (FMS/MOS)! Die funktionale Untergliederung aus Teil 1 der Norm kann damit als ein Spezialfall von Teil 3 für die Kategorie Production gesehen werden. Die Struktur der identifizierten Aktivitäten und Informationen ist dabei als rein funktionale, nicht als systemtechnische Gliederung (z.b. als Applikationen) zu verstehen. Durch die Einführung der weiteren Kategorien Quality, Maintenance und Inventory wird die in Teil 1 der Norm definierte Schnittstelle zwischen Ebene 3 und Ebene 4 entsprechend erweitert. Teil 4 der Norm ISA 95 Part 4 Hier beschreibt die Norm die konkreten Attribute der in Teil 3 identifizierten Aktivitäten (analog zur Vorgehensweise in Teil 2 ausgehend von Teil 1). Korrespondierend zu dem in Teil 3 entwickelten generischen Aktivitätenmodell, wird zunächst ein ebenfalls allgemein gehaltenes Objekt- und Datenmodell eingeführt. Dieses Common Work Model (Allgemeines Arbeitsmodell) ist für die in Teil 3 definierten Kategorien (Production, Quality, Maintenance, Inventory) anwendbar ist. Das in Teil 2 entwickelte Modell erscheint wiederum als Spezialfall für die Kategorie Production. Ziel von Teil 4 ist es zum einen, die Basis für die konkrete Implementierung für die zwischen den Ebenen 3 und 4 auszutauschenden Informationen auf die in Teil 3 der Norm neu definierten Kategorien zu erweitern, und zum anderen, in gleicher Weise die zwischen den einzelnen Kategorien und Aktivitäten auszutauschenden Informationen innerhalb der Ebene 3 zur Verfügung zu stellen. Die internen Modelle der einzelnen Aktivitäten sind nicht Gegenstand der Norm. Mithilfe des Common Work Models lässt sich z.b. die Feinplanung von Arbeitsabläufen (Detailed Work Schedule) darstellen, d.h. Unterteilung von Work Requests (Arbeitsanforderungen) in Work Orders (Arbeitsaufträge) während der Planung anhand der Work Segments (Arbeitsabschnitte)entsprechende Unterteilung von Work Tasks (Arbeitsinhalte) in Work Task Segments (Arbeitsabschnitte)Zuordnung von Ressourcen (hier: Work Centers) aus den vier genannten Kategorien zu den einzelnen Work Orders und umgekehrt die Verteilung der Work Orders auf die einzelnen Work CentersZusammenfassung einzelner Ressourcen und deren Verwendung zu einem Work Task Datentechnische Implementierung. Die konkrete Umsetzung der UMLbasierten Modelle wird vom World Batch Forum (WBF) in Abstimmung mit ISA und IEC/ISO durchgeführt. Das Ergebnis für die Teile 1 und 2 sind die (frei verfügbaren) XML- Schemata der Business to Manufacturing Markup Language (= B2MML, Version 3.0); die Umsetzung von Teil 5 wird ebenfalls durch das WBF bearbeitet.dabei werden die in Teil 1 und 2 der Norm definierten Modelle in XML-Schemata umgesetzt (Entsprechung Modell : Schema = 1 : 1); außerdem werden die logischen Gruppierungen aus Teil 5 berücksichtigt. Ziel ist eine einheitliche und vollständige Spezifikation eines (offenen, erweiterbaren) Datenformates, das in Standard-IT-Systemen direkt verwendet werden kann.die Systemarchitektur unter Verwendung von B2MML wird i. A. wie folgt aussehen: Messageorientierte Middleware Asynchrone, Kommunikation zwischen ERP und FMS; Message- Routing (zu unterschiedlichen Applikationen), verteilte Transaktionen zur gesicherten KommunikationConnectoren zur Umsetzung von B2MML nach nicht-b2mml, z. B. unter Verwendung von Standardmechanismen wie XSLT, XQuery, XPathUnterstützung von Standard-Protokollen (http, WebServices...). Die Einführung von B2MML für den Datenaustausch zwischen Ebene 3 und Ebene 4 bietet dabei folgende Vorteile: Durch die Einführung eines einheitlichen Datenformates wird die Schnittstellenvielfalt reduziert und
8 dadurch der finanzielle Aufwand für Implementierung und Instandhaltung beträchtlich gesenkt. Im Gegensatz zu vielen bisher verwendeten Mechanismen (z.b. OPC, ODBC) umfasst B2MML auch semantische und kontextuelle Informationen über die Bedeutung der Daten, die Rollen der beteiligten Systeme und deren Verantwortlichkeiten. Diese Festlegungen müssen so nicht mehr in den Applikationen implementiert und gepflegt werden. Applikationen bzw. Schnittstellen müssen nicht mehr direkt auf die aller anderen Kommunikationspartner (FMS, ERP) abgestimmt werden, sondern können über eine Middleware entkoppelt werden, die dann die Aufgaben des Datenmappings (nicht-b2mml nach B2MML und zurück, Routing = welche Requests gehen an welche Systeme bzw. Applikationen?) vornimmt. Insgesamt werden die einzelnen Systeme von der Aufgabe der Daten- und Protokollumsetzung entlastet, die Einführung neuer oder der Ersatz existierender Applikationen wird deutlich erleichtert. Dies ist insbesondere dann entscheidend, wenn eine Vielzahl verschiedener Systeme (häufig von unterschiedlichen Herstellern), verteilt über mehrere Produktionsstandorte zu pflegen ist. B2MML ist nur eine mögliche Implementierung. Gegenwärtig wird ebenfalls an einer datenbankorientierten Implementierung B2MQL gearbeitet, die SQL anstelle von XML zur Darstellung der auszutauschenden Daten verwendet. Teil 5 der Norm ISA 95 Part 5 Dieser Abschnitt behandelt weitere Aspekte der Interoperabilität zwischen Ebene 3 und 4, die in Teil 1 und 2 nicht berücksichtigt wurden. Dazu werden Transaktionstypen eingeführt, die den Kontext der über die Schnittstelle von Ebene 3 zu Ebene 4 auszutauschenden Informationen spezifizieren und die Rollen und Verantwortlichkeiten der beteiligten Systeme bzgl. Datenhaushalt und -austausch näher spezifizieren:push: der Eigner der Daten sendet diese zusammen mit einer Bearbeitungsanforderung (PROCESS, CHANGE, CANCEL) an einen Empfänger, der die Anforderung zu bestätigen hat (ACKNOWLEDGE, CONFIRM)PULL: ein System sendet eine Anforderung zur Datenübermittlung (GET) an den Dateneigner, der diese dann zur Verfügung stellt (SHOW)PUBLISH: in diesem Falle stellt (nach einer Registrierung - nicht Teil des Modells) eine Datenquelle verschiedene Daten an die Empfänger zur Verfügung (SYNC ADD, SYNC CHANGE, SYNC DELETE), ohne von den Empfängern eine konkrete Verarbeitung der Daten zu anzufordern; die Empfänger aktualisieren "ihre" jeweilige "lokale Kopie" der Daten. Die Dateninhalte selbst entsprechen den in Teil 1 und 2 definierten Modellen. Teil 5 spezifiziert zudem, für welche Datenmodelle aus Teil 1 welche der o. g. Transaktionsmodelle gelten bzw. welchen Einschränkungen diese unterliegen. Außerdem werden die in Teil 1 definierten Modelle in kleinere Einheiten unterteilt, die eine bzgl. einer Transaktion (PROCESS, CHANGE,...) logisch zusammengehörige Gruppe von Daten umfassen; somit können z.b. je nach Änderungshäufigkeit unterschiedliche Teile der Objektmodelle ausgetauscht werden ("Stammdaten" vs. "Laufzeitinformation"). Ziel von Teil 5 ist, diese Festlegungen aus der Verantwortung einzelner Applikationen in die Norm zu überführen und so eine bessere Interoperabilität sowie Reduzierung der Komplexität der Applikationen zu erreichen. Auch Teil 5 verfolgt nicht das Ziel, eine Implementierung (z.b. in XML) vorzunehmen bzw. die Technologie oder das Protokoll (z.b. HTTP, WebServices,...) für den Datenaustausches selbst festzulegen.
9 Fazit - die Vorteile der Normenreihe Ein offensichtlicher Nutzen ist die allgemeingültige, einheitliche Definition von Begriffen und Terminologien. Mitarbeiter, die im kommerziellen Bereich eines Unternehmens arbeiten, sind nun in der Lage, mit den Mitarbeitern aus der Produktion und Automatisierungstechnik zu kommunizieren. Bisher benützen diese Personengruppen häufig unterschiedliche Begriffe für dieselben Sachverhalte oder belegen die gleichen Dinge mit unterschiedlichen Namen. Durch die Norm wird die Gefahr verringert, dass es in der Kommunikation zu Missverständnissen kommt, die unnötige Zeitverluste und Fehler nach sich ziehen. Die Norm wurde von einer großen Expertengruppe entwickelt, deren Mitglieder unterschiedliche berufliche Erfahrungen haben. Das kollektive Wissen dieser Gruppe ist außerordentlich mächtig und es gibt keinen Grund, das "Rad neu zu erfinden". Der Standard, auf den sich diese Gruppe geeinigt hat, ist wahrscheinlich die derzeit beste Lösung hinsichtlich von Modellen und Terminologien. ANSI/ISA-Standards haben nur Gültigkeit in den USA. Der ISA-S95-Standard wurde jedoch in die Hände der International Electrotechnical Commission (IEC) und der International Standardization Organisation (ISO) gegeben, um als internationale Normen der Reihe IEC veröffentlicht zu werden. Schließlich wird in Kürze die Übernahme als europäische Normen unter EN und deutsche Normen unter DIN EN erfolgen. Davon profitieren Hersteller und LieferantenHersteller von ERPsowie von FMS/MOS-Systemen können unmittelbar von der neuen Norm profitieren - von der Produktentwicklung bis hin zu Vermarktung und Vertrieb: DIN EN vermittelt ein gutes Verständnis für die Thematik der Integration von Unternehmensplanungs- und - steuerungssystemen sowie dem Gebiet der Produktionssteuerungs- und Überwachungssysteme. Diese Norm stellt somit eine gute Wissensbasis für jeden Entwickler, Systemarchitekten und Produktmanager dar und bietet eine gute Basis für eventuell notwendige Produktgespräche. Durch die klare Terminologie der Norm verwenden alle an der Entwicklung beteiligten Personen die gleichen Begriffe. Innerhalb eines Produktes - und darüber hinaus - sorgt DIN EN so für maximale Transparenz und Konsistenz. Im Teil 1 der Norm ist ein Geräte- und Anlagenmodell definiert, das es gestattet, sämtliche Objekte einer Fabrik zu beschreiben. Falls objektorientierte Programmiertechniken zu Anwendung kommen, lassen sich die Anlagenobjekte in der Anlagenhierarchie direkt als Klassen implementieren, von denen Unterklassen (sub-classes) abgeleitet werden können. Teil 2 beschreibt die Objektmodelle und die damit verbundenen Attribute. Diese Modelle können z.b. in der Datenbank eines Produktes verwendet werden. Dies erleichtert es, eine DIN EN kompatible Schnittstelle bereitzustellen, und/oder die B2MML-Schemata zu unterstützen. Zudem gibt es im Teil 2 der internationalen Version (IEC 62264, Part 2) einen Abschnitt, der der Definition hinsichtlich Vollständigkeit, Entsprechung (in Bezug auf die Norm) und Kompatibilität gewidmet ist. Teil 3 der Norm stellt eine exzellente Referenz dar, wenn es in einer Diskussion um die Festlegung geht, welche Funktionen durch ein FMS/MOS-Produkt abgedeckt werden sollen. Sind z.b. die Aktivitäten, wie z.b. Reihenfolgeplanung oder Datenakquisition von einem FMS/MOS-Produkt nicht enthalten, so können diese jedoch in einem anderen Produkt des gleichen Unternehmens abgedeckt werden. Davon profitieren Endnutzer von Produktionsplanungssystemen oder FMS/MOS-Produkten können ebenfalls von der DIN EN profitieren. In Verbindung mit der Norm gibt es eine Reihe von Aspekten, die ein Endbenutzer sowohl beim Kauf als auch bei der Bewertung und dem Einsatz eines Produktes in Betracht ziehen sollte.
10 Hat ein Automatisierungsprojekt die Integration einer Organisations-Software mit einem System der Produktionsführung zum Gegenstand, so sind Identifikation und Definition der Ziele, welche Aufgaben/Abläufe zwischen Unternehmens- und Produktionsebene automatisiert werden sollen wichtige Aufgaben in einem solchen Projekt. Die Abläufe, Aktivitäten und Aufgaben müssen identifiziert, definiert und verstanden sein. Das funktionale Unternehmensmodell (Abb. 2) aus Teil 1 kombiniert mit dem generischen Modell (Abb. 3) aus Teil 3 der DIN EN kann und sollte als Ausgangspunkt gewählt werden, um die vom Fertigungsmanagementprojekt betroffenen Funktionen und Datenflüsse zu identifizieren. Hat ein Endbenutzer die Aufgabe, Produkte unterschiedlicher Hersteller zu vergleichen, so steht er häufig vor dem Problem, dass Hersteller die Funktionen und Eigenschaften ihrer Produkte auf unterschiedliche Art und Weise darstellen. Um eine gute Vergleichs- und Bewertungsbasis für unterschiedliche Produkte zu erhalten, ist es vorteilhaft, die DIN EN als "Universalsprache" zu verwenden. D.h., die Darstellung des Herstellers in die Terminologie der Norm zu übertragen und dann auf dieser Basis zu vergleichen. Für jede im funktionalen Unternehmensmodell dargestellte Funktion gibt es eine Liste von Unterfunktionen. Ein Endnutzer kann insofern direkt davon profitieren, als er seine potenziellen Lieferanten auffordern kann, genau aufzuführen, welche der Unterfunktionen abgedeckt werden und in welchen Produkten diese enthalten sind. Die DIN EN bietet dafür einen universellen Sprachstandard. Davon profitieren Systemintegratoren. Systemintegratoren sind gefragt, wenn es um die Auswahl und Implementierung von komplexen Lösungen geht. Um die richtige Auswahl zu treffen, ist ein gutes Verständnis notwendig, welche Funktionen benötigt werden und was von diesen Funktionen erwartet wird. Systemintegratoren müssen daher die Spezifikationen ihrer Kunden genau analysieren. DIN EN kann dazu beitragen, die Aufgabenstellung klar zu strukturieren, um so zur erfolgreichen Auswahl eines MES/MOS-Produktes beizutragen. Eine der Aufgaben ist die Festlegung, ob eine bestimmte Funktion zur Produktions-, Unternehmens- oder zu beiden Ebenen gehört. Das funktionale Unternehmensmodell kann als Richtlinie verwendet werden, wo welche Funktionen angesiedelt sind. Falls ein Systemintegrator mit Anforderungen aus der Produktionsführungsebene konfrontiert sein sollte, hilft Teil 3 der Norm: Die Anforderungen können anhand der dort definierten Aktivitäten beispielsweise der Produktion, der Instandhaltung, dem Qualitätswesen oder der Intralogistik zugeordnet werden. Häufig sind Systemintegratoren auch von Anforderungen betroffen, die Eigenschaften der Produktions-, Instandhaltungs-, Qualitäts- oder Bestandsvorgänge beschreiben. Anforderungen, die zu diesen Gruppen gehören, können anhand der Aktivitäten des Betriebsmodells klassifiziert und behandelt werden, wie z.b. Feinplanung, Auftragsauslösung, Datenerfassung, etc. Sind die Anforderungen (Lasten- oder Pflichtenheft) vollständig nach DIN EN klassifiziert und verstanden, fällt dem Systemintegrator die Entscheidung wesentlich leichter, ob Anforderungen zusammengeführt und so von nur einem Produkt abgedeckt werden müssen, oder ob die Implementierung besser mit unterschiedlichen Produkten erfolgt. Auch die Diskussion mit unterschiedlichen Lieferanten vereinfacht sich, wenn aufgrund der guten Strukturierung alle Beteiligten genau verstehen, was gebraucht wird.
intelligent control of production processes
 intelligent control of production processes Konzept zur intelligenten Produktionssteuerung Verwaltung der Ressourcen Material bzw. Energie Equipment Personal Modellierung des Prozesses Physikalische Beziehungen
intelligent control of production processes Konzept zur intelligenten Produktionssteuerung Verwaltung der Ressourcen Material bzw. Energie Equipment Personal Modellierung des Prozesses Physikalische Beziehungen
VDMA 66412-10. Manufacturing Execution Systems Daten für Fertigungskennzahlen. Manufacturing Execution Systems Data for Production Indicators
 VDMA-Einheitsblatt April 2015 VDMA 66412-10 ICS 03.100.50; 35.240.50 Manufacturing Execution Systems Daten für Fertigungskennzahlen Manufacturing Execution Systems Data for Production Indicators Verband
VDMA-Einheitsblatt April 2015 VDMA 66412-10 ICS 03.100.50; 35.240.50 Manufacturing Execution Systems Daten für Fertigungskennzahlen Manufacturing Execution Systems Data for Production Indicators Verband
Blitzlicht: MES Produktionsplanung und Unternehmensmodelle IEC 62264 Integration von Unternehmensführungs und Leitsystemen
 Blitzlicht: MES Produktionsplanung und Unternehmensmodelle IEC 62264 Integration von Unternehmensführungs und Leitsystemen Tagung: Normen für Industrie 4.0 BMWi, Berlin 19.02.2015 Max Weinmann, Emerson
Blitzlicht: MES Produktionsplanung und Unternehmensmodelle IEC 62264 Integration von Unternehmensführungs und Leitsystemen Tagung: Normen für Industrie 4.0 BMWi, Berlin 19.02.2015 Max Weinmann, Emerson
1 Mathematische Grundlagen
 Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Klaus Schild, XML Clearinghouse 2003. Namensräume
 Namensräume Lernziele Namenskonflikte Warum lösen im World Wide Web einfache Präfixe dieses Problem nicht? Wie lösen globale Namensräume das Problem? Wie werden sie in XML-Dokumenten benutzt? Was sind
Namensräume Lernziele Namenskonflikte Warum lösen im World Wide Web einfache Präfixe dieses Problem nicht? Wie lösen globale Namensräume das Problem? Wie werden sie in XML-Dokumenten benutzt? Was sind
Java Enterprise Architekturen Willkommen in der Realität
 Java Enterprise Architekturen Willkommen in der Realität Ralf Degner (Ralf.Degner@tk-online.de), Dr. Frank Griffel (Dr.Frank.Griffel@tk-online.de) Techniker Krankenkasse Häufig werden Mehrschichtarchitekturen
Java Enterprise Architekturen Willkommen in der Realität Ralf Degner (Ralf.Degner@tk-online.de), Dr. Frank Griffel (Dr.Frank.Griffel@tk-online.de) Techniker Krankenkasse Häufig werden Mehrschichtarchitekturen
Projektmanagement in der Spieleentwicklung
 Projektmanagement in der Spieleentwicklung Inhalt 1. Warum brauche ich ein Projekt-Management? 2. Die Charaktere des Projektmanagement - Mastermind - Producer - Projektleiter 3. Schnittstellen definieren
Projektmanagement in der Spieleentwicklung Inhalt 1. Warum brauche ich ein Projekt-Management? 2. Die Charaktere des Projektmanagement - Mastermind - Producer - Projektleiter 3. Schnittstellen definieren
Skript Pilotphase em@w für Arbeitsgelegenheiten
 Die Pilotphase erstreckte sich über sechs Meilensteine im Zeitraum August 2011 bis zur EMAW- Folgeversion 2.06 im August 2013. Zunächst einmal musste ein grundsätzliches Verständnis für das Verfahren geschaffen
Die Pilotphase erstreckte sich über sechs Meilensteine im Zeitraum August 2011 bis zur EMAW- Folgeversion 2.06 im August 2013. Zunächst einmal musste ein grundsätzliches Verständnis für das Verfahren geschaffen
Fassade. Objektbasiertes Strukturmuster. C. Restorff & M. Rohlfing
 Fassade Objektbasiertes Strukturmuster C. Restorff & M. Rohlfing Übersicht Motivation Anwendbarkeit Struktur Teilnehmer Interaktion Konsequenz Implementierung Beispiel Bekannte Verwendung Verwandte Muster
Fassade Objektbasiertes Strukturmuster C. Restorff & M. Rohlfing Übersicht Motivation Anwendbarkeit Struktur Teilnehmer Interaktion Konsequenz Implementierung Beispiel Bekannte Verwendung Verwandte Muster
Integration mit. Wie AristaFlow Sie in Ihrem Unternehmen unterstützen kann, zeigen wir Ihnen am nachfolgenden Beispiel einer Support-Anfrage.
 Integration mit Die Integration der AristaFlow Business Process Management Suite (BPM) mit dem Enterprise Information Management System FILERO (EIMS) bildet die optimale Basis für flexible Optimierung
Integration mit Die Integration der AristaFlow Business Process Management Suite (BPM) mit dem Enterprise Information Management System FILERO (EIMS) bildet die optimale Basis für flexible Optimierung
Qualitätsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen
 Qualitätsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen M. Haemisch Qualitätsmanagement Von der Qualitätssicherung zum Qualitätsmanagement (ISO 9001) Qualitätsmanagement als ein universelles Organisationsmodell
Qualitätsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen M. Haemisch Qualitätsmanagement Von der Qualitätssicherung zum Qualitätsmanagement (ISO 9001) Qualitätsmanagement als ein universelles Organisationsmodell
Systemen im Wandel. Autor: Dr. Gerd Frenzen Coromell GmbH Seite 1 von 5
 Das Management von Informations- Systemen im Wandel Die Informations-Technologie (IT) war lange Zeit ausschließlich ein Hilfsmittel, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Personal einzusparen. Sie hat
Das Management von Informations- Systemen im Wandel Die Informations-Technologie (IT) war lange Zeit ausschließlich ein Hilfsmittel, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Personal einzusparen. Sie hat
Workflow, Business Process Management, 4.Teil
 Workflow, Business Process Management, 4.Teil 24. Januar 2004 Der vorliegende Text darf für Zwecke der Vorlesung Workflow, Business Process Management des Autors vervielfältigt werden. Eine weitere Nutzung
Workflow, Business Process Management, 4.Teil 24. Januar 2004 Der vorliegende Text darf für Zwecke der Vorlesung Workflow, Business Process Management des Autors vervielfältigt werden. Eine weitere Nutzung
Requirements Engineering für IT Systeme
 Requirements Engineering für IT Systeme Warum Systemanforderungen mit Unternehmenszielen anfangen Holger Dexel Webinar, 24.06.2013 Agenda Anforderungsdefinitionen Von der Herausforderung zur Lösung - ein
Requirements Engineering für IT Systeme Warum Systemanforderungen mit Unternehmenszielen anfangen Holger Dexel Webinar, 24.06.2013 Agenda Anforderungsdefinitionen Von der Herausforderung zur Lösung - ein
Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem
 Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem von André Franken 1 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1 2 Einführung 2 2.1 Gründe für den Einsatz von DB-Systemen 2 2.2 Definition: Datenbank
Fachbericht zum Thema: Anforderungen an ein Datenbanksystem von André Franken 1 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1 2 Einführung 2 2.1 Gründe für den Einsatz von DB-Systemen 2 2.2 Definition: Datenbank
Ishikawa-Diagramm. 1 Fallbeispiel 2. 2 Was ist ein Ishikawa-Diagramm 2. 3 Vorgehen bei der Erstellung eines Ishikawa-Diagramms 2.
 Ishikawa-Diagramm 1 Fallbeispiel 2 2 Was ist ein Ishikawa-Diagramm 2 3 Vorgehen bei der Erstellung eines Ishikawa-Diagramms 2 4 Vorteile 5 5 Nachteile 5 6 Fazit 5 7 Literaturverzeichnis 6 1 Fallbeispiel
Ishikawa-Diagramm 1 Fallbeispiel 2 2 Was ist ein Ishikawa-Diagramm 2 3 Vorgehen bei der Erstellung eines Ishikawa-Diagramms 2 4 Vorteile 5 5 Nachteile 5 6 Fazit 5 7 Literaturverzeichnis 6 1 Fallbeispiel
360 - Der Weg zum gläsernen Unternehmen mit QlikView am Beispiel Einkauf
 360 - Der Weg zum gläsernen Unternehmen mit QlikView am Beispiel Einkauf Von der Entstehung bis heute 1996 als EDV Beratung Saller gegründet, seit 2010 BI4U GmbH Firmensitz ist Unterschleißheim (bei München)
360 - Der Weg zum gläsernen Unternehmen mit QlikView am Beispiel Einkauf Von der Entstehung bis heute 1996 als EDV Beratung Saller gegründet, seit 2010 BI4U GmbH Firmensitz ist Unterschleißheim (bei München)
Content Management System mit INTREXX 2002.
 Content Management System mit INTREXX 2002. Welche Vorteile hat ein CM-System mit INTREXX? Sie haben bereits INTREXX im Einsatz? Dann liegt es auf der Hand, dass Sie ein CM-System zur Pflege Ihrer Webseite,
Content Management System mit INTREXX 2002. Welche Vorteile hat ein CM-System mit INTREXX? Sie haben bereits INTREXX im Einsatz? Dann liegt es auf der Hand, dass Sie ein CM-System zur Pflege Ihrer Webseite,
Was macht Layer2 eigentlich? Erfahren Sie hier ein wenig mehr über uns.
 Was macht Layer2 eigentlich? Erfahren Sie hier ein wenig mehr über uns. Seit über 24 Jahren... unterstützen und beraten wir unsere Kunden und Partner erfolgreich bei ihren IT-Projekten. Unsere Kernkompetenz
Was macht Layer2 eigentlich? Erfahren Sie hier ein wenig mehr über uns. Seit über 24 Jahren... unterstützen und beraten wir unsere Kunden und Partner erfolgreich bei ihren IT-Projekten. Unsere Kernkompetenz
Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1. Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse:
 Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1 Problemstellung Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse: große Software-Systeme werden im Schnitt ein Jahr zu spät
Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1 Problemstellung Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse: große Software-Systeme werden im Schnitt ein Jahr zu spät
Zeichen bei Zahlen entschlüsseln
 Zeichen bei Zahlen entschlüsseln In diesem Kapitel... Verwendung des Zahlenstrahls Absolut richtige Bestimmung von absoluten Werten Operationen bei Zahlen mit Vorzeichen: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren
Zeichen bei Zahlen entschlüsseln In diesem Kapitel... Verwendung des Zahlenstrahls Absolut richtige Bestimmung von absoluten Werten Operationen bei Zahlen mit Vorzeichen: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren
1. Was sind Aufgaben?... 1 2. Aufgaben einrichten... 2 3. Ansicht für die Teilnehmer/innen... 3
 AG elearning Service und Beratung für E-Learning und Mediendidaktik ZEIK Zentrale Einrichtung für Informationsverarbeitung und Kommunikation Moodle an der Universität-Potsdam How-To: Aufgaben Inhalt: 1.
AG elearning Service und Beratung für E-Learning und Mediendidaktik ZEIK Zentrale Einrichtung für Informationsverarbeitung und Kommunikation Moodle an der Universität-Potsdam How-To: Aufgaben Inhalt: 1.
Professionelle Seminare im Bereich MS-Office
 Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Der Name BEREICH.VERSCHIEBEN() ist etwas unglücklich gewählt. Man kann mit der Funktion Bereiche zwar verschieben, man kann Bereiche aber auch verkleinern oder vergrößern. Besser wäre es, die Funktion
Interoperabilität von Produktion und Unternehmensführung
 Quelle: Siemens AG Interoperabilität von Produktion und Unternehmensführung Einheitliche Terminologien, Daten- und Betriebsmodelle für das Produktionsmanagement auf Basis der Normenreihe DIN EN 62264 "Integration
Quelle: Siemens AG Interoperabilität von Produktion und Unternehmensführung Einheitliche Terminologien, Daten- und Betriebsmodelle für das Produktionsmanagement auf Basis der Normenreihe DIN EN 62264 "Integration
Software-Validierung im Testsystem
 Software-Validierung im Testsystem Version 1.3 Einleitung Produktionsabläufe sind in einem Fertigungsbetrieb ohne IT unvorstellbar geworden. Um eine hundertprozentige Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten
Software-Validierung im Testsystem Version 1.3 Einleitung Produktionsabläufe sind in einem Fertigungsbetrieb ohne IT unvorstellbar geworden. Um eine hundertprozentige Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten
Fachdidaktik der Informatik 18.12.08 Jörg Depner, Kathrin Gaißer
 Fachdidaktik der Informatik 18.12.08 Jörg Depner, Kathrin Gaißer Klassendiagramme Ein Klassendiagramm dient in der objektorientierten Softwareentwicklung zur Darstellung von Klassen und den Beziehungen,
Fachdidaktik der Informatik 18.12.08 Jörg Depner, Kathrin Gaißer Klassendiagramme Ein Klassendiagramm dient in der objektorientierten Softwareentwicklung zur Darstellung von Klassen und den Beziehungen,
Unsere vier hilfreichsten Tipps für szenarienbasierte Nachfrageplanung
 Management Briefing Unsere vier hilfreichsten Tipps für szenarienbasierte Nachfrageplanung Erhalten Sie die Einblicke, die Sie brauchen, um schnell auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können Sales and
Management Briefing Unsere vier hilfreichsten Tipps für szenarienbasierte Nachfrageplanung Erhalten Sie die Einblicke, die Sie brauchen, um schnell auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können Sales and
Das große ElterngeldPlus 1x1. Alles über das ElterngeldPlus. Wer kann ElterngeldPlus beantragen? ElterngeldPlus verstehen ein paar einleitende Fakten
 Das große x -4 Alles über das Wer kann beantragen? Generell kann jeder beantragen! Eltern (Mütter UND Väter), die schon während ihrer Elternzeit wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Eltern, die während
Das große x -4 Alles über das Wer kann beantragen? Generell kann jeder beantragen! Eltern (Mütter UND Väter), die schon während ihrer Elternzeit wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Eltern, die während
Barrierefreie Webseiten erstellen mit TYPO3
 Barrierefreie Webseiten erstellen mit TYPO3 Alternativtexte Für jedes Nicht-Text-Element ist ein äquivalenter Text bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für Bilder. In der Liste der HTML 4-Attribute
Barrierefreie Webseiten erstellen mit TYPO3 Alternativtexte Für jedes Nicht-Text-Element ist ein äquivalenter Text bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für Bilder. In der Liste der HTML 4-Attribute
Outsourcing und Offshoring. Comelio und Offshoring/Outsourcing
 Outsourcing und Offshoring Comelio und Offshoring/Outsourcing INHALT Outsourcing und Offshoring... 3 Comelio und Offshoring/Outsourcing... 4 Beauftragungsmodelle... 4 Projektleitung vor Ort und Software-Entwicklung
Outsourcing und Offshoring Comelio und Offshoring/Outsourcing INHALT Outsourcing und Offshoring... 3 Comelio und Offshoring/Outsourcing... 4 Beauftragungsmodelle... 4 Projektleitung vor Ort und Software-Entwicklung
Web Services stellen eine Integrationsarchitektur dar, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen
 9 3 Web Services 3.1 Überblick Web Services stellen eine Integrationsarchitektur dar, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen mit Hilfe von XML über das Internet ermöglicht (siehe Abb.
9 3 Web Services 3.1 Überblick Web Services stellen eine Integrationsarchitektur dar, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen mit Hilfe von XML über das Internet ermöglicht (siehe Abb.
Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1
 Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1 4 Die Datenbank Kuchenbestellung In diesem Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 2 Die Datenbank Buchausleihe an Hand einer weiteren Datenbank Kuchenbestellung
Kapitel 4 Die Datenbank Kuchenbestellung Seite 1 4 Die Datenbank Kuchenbestellung In diesem Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 2 Die Datenbank Buchausleihe an Hand einer weiteren Datenbank Kuchenbestellung
«Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen
 18 «Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.» 3Das Konzept der Funktionalen
18 «Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.» 3Das Konzept der Funktionalen
Studie über Umfassendes Qualitätsmanagement ( TQM ) und Verbindung zum EFQM Excellence Modell
 Studie über Umfassendes Qualitätsmanagement ( TQM ) und Verbindung zum EFQM Excellence Modell (Auszug) Im Rahmen des EU-Projekts AnaFact wurde diese Umfrage von Frauenhofer IAO im Frühjahr 1999 ausgewählten
Studie über Umfassendes Qualitätsmanagement ( TQM ) und Verbindung zum EFQM Excellence Modell (Auszug) Im Rahmen des EU-Projekts AnaFact wurde diese Umfrage von Frauenhofer IAO im Frühjahr 1999 ausgewählten
WSO de. <work-system-organisation im Internet> Allgemeine Information
 WSO de Allgemeine Information Inhaltsverzeichnis Seite 1. Vorwort 3 2. Mein Geschäftsfeld 4 3. Kompetent aus Erfahrung 5 4. Dienstleistung 5 5. Schulungsthemen 6
WSO de Allgemeine Information Inhaltsverzeichnis Seite 1. Vorwort 3 2. Mein Geschäftsfeld 4 3. Kompetent aus Erfahrung 5 4. Dienstleistung 5 5. Schulungsthemen 6
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016
 L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
mysql - Clients MySQL - Abfragen eine serverbasierenden Datenbank
 mysql - Clients MySQL - Abfragen eine serverbasierenden Datenbank In den ersten beiden Abschnitten (rbanken1.pdf und rbanken2.pdf) haben wir uns mit am Ende mysql beschäftigt und kennengelernt, wie man
mysql - Clients MySQL - Abfragen eine serverbasierenden Datenbank In den ersten beiden Abschnitten (rbanken1.pdf und rbanken2.pdf) haben wir uns mit am Ende mysql beschäftigt und kennengelernt, wie man
Change Management. Hilda Tellioğlu, hilda.tellioglu@tuwien.ac.at 12.12.2011. Hilda Tellioğlu
 Change Management, hilda.tellioglu@tuwien.ac.at 12.12.2011 Methoden für den 7 Stufenplan (CKAM:CM2009, S.29) Prozessmanagement (CKAM:CM2009, S.87-89) eine Methode, mit deren Hilfe die Prozesse im Unternehmen
Change Management, hilda.tellioglu@tuwien.ac.at 12.12.2011 Methoden für den 7 Stufenplan (CKAM:CM2009, S.29) Prozessmanagement (CKAM:CM2009, S.87-89) eine Methode, mit deren Hilfe die Prozesse im Unternehmen
Zulassung nach MID (Measurement Instruments Directive)
 Anwender - I n f o MID-Zulassung H 00.01 / 12.08 Zulassung nach MID (Measurement Instruments Directive) Inhaltsverzeichnis 1. Hinweis 2. Gesetzesgrundlage 3. Inhalte 4. Zählerkennzeichnung/Zulassungszeichen
Anwender - I n f o MID-Zulassung H 00.01 / 12.08 Zulassung nach MID (Measurement Instruments Directive) Inhaltsverzeichnis 1. Hinweis 2. Gesetzesgrundlage 3. Inhalte 4. Zählerkennzeichnung/Zulassungszeichen
Objektorientierter Software-Entwurf Grundlagen 1 1. Analyse Design Implementierung. Frühe Phasen durch Informationssystemanalyse abgedeckt
 Objektorientierter Software-Entwurf Grundlagen 1 1 Einordnung der Veranstaltung Analyse Design Implementierung Slide 1 Informationssystemanalyse Objektorientierter Software-Entwurf Frühe Phasen durch Informationssystemanalyse
Objektorientierter Software-Entwurf Grundlagen 1 1 Einordnung der Veranstaltung Analyse Design Implementierung Slide 1 Informationssystemanalyse Objektorientierter Software-Entwurf Frühe Phasen durch Informationssystemanalyse
Anleitung über den Umgang mit Schildern
 Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Verpasst der Mittelstand den Zug?
 Industrie 4.0: Verpasst der Mittelstand den Zug? SCHÜTTGUT Dortmund 2015 5.11.2015 Ergebnisse einer aktuellen Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen 1 Industrie 4.0 im Mittelstand Ergebnisse einer
Industrie 4.0: Verpasst der Mittelstand den Zug? SCHÜTTGUT Dortmund 2015 5.11.2015 Ergebnisse einer aktuellen Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen 1 Industrie 4.0 im Mittelstand Ergebnisse einer
Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements. von Stephanie Wilke am 14.08.08
 Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements von Stephanie Wilke am 14.08.08 Überblick Einleitung Was ist ITIL? Gegenüberstellung der Prozesse Neuer
Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements von Stephanie Wilke am 14.08.08 Überblick Einleitung Was ist ITIL? Gegenüberstellung der Prozesse Neuer
Agile Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung: Scrum
 C A R L V O N O S S I E T Z K Y Agile Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung: Scrum Johannes Diemke Vortrag im Rahmen der Projektgruppe Oldenburger Robot Soccer Team im Wintersemester 2009/2010 Was
C A R L V O N O S S I E T Z K Y Agile Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung: Scrum Johannes Diemke Vortrag im Rahmen der Projektgruppe Oldenburger Robot Soccer Team im Wintersemester 2009/2010 Was
Integrierte IT Portfolioplanung
 Integrierte Portfolioplanung -en und _e als zwei Seiten einer Medaille Guido Bacharach 1.04.010 Ausgangssituation: Komplexe Umgebungen sportfolio Ausgangssituation: Komplexe Umgebungen portfolio Definition:
Integrierte Portfolioplanung -en und _e als zwei Seiten einer Medaille Guido Bacharach 1.04.010 Ausgangssituation: Komplexe Umgebungen sportfolio Ausgangssituation: Komplexe Umgebungen portfolio Definition:
Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche?
 6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
1. Man schreibe die folgenden Aussagen jeweils in einen normalen Satz um. Zum Beispiel kann man die Aussage:
 Zählen und Zahlbereiche Übungsblatt 1 1. Man schreibe die folgenden Aussagen jeweils in einen normalen Satz um. Zum Beispiel kann man die Aussage: Für alle m, n N gilt m + n = n + m. in den Satz umschreiben:
Zählen und Zahlbereiche Übungsblatt 1 1. Man schreibe die folgenden Aussagen jeweils in einen normalen Satz um. Zum Beispiel kann man die Aussage: Für alle m, n N gilt m + n = n + m. in den Satz umschreiben:
.. für Ihre Business-Lösung
 .. für Ihre Business-Lösung Ist Ihre Informatik fit für die Zukunft? Flexibilität Das wirtschaftliche Umfeld ist stärker den je im Umbruch (z.b. Stichwort: Globalisierung). Daraus resultierenden Anforderungen,
.. für Ihre Business-Lösung Ist Ihre Informatik fit für die Zukunft? Flexibilität Das wirtschaftliche Umfeld ist stärker den je im Umbruch (z.b. Stichwort: Globalisierung). Daraus resultierenden Anforderungen,
Würfelt man dabei je genau 10 - mal eine 1, 2, 3, 4, 5 und 6, so beträgt die Anzahl. der verschiedenen Reihenfolgen, in denen man dies tun kann, 60!.
 040304 Übung 9a Analysis, Abschnitt 4, Folie 8 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei n - maliger Durchführung eines Zufallexperiments ein Ereignis A ( mit Wahrscheinlichkeit p p ( A ) ) für eine beliebige Anzahl
040304 Übung 9a Analysis, Abschnitt 4, Folie 8 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei n - maliger Durchführung eines Zufallexperiments ein Ereignis A ( mit Wahrscheinlichkeit p p ( A ) ) für eine beliebige Anzahl
FAQ 04/2015. Auswirkung der ISO 14119 auf 3SE53/3SF13 Positionsschalter. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475921
 FAQ 04/2015 Auswirkung der ISO 14119 auf 3SE53/3SF13 Positionsschalter mit https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475921 Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support. Es
FAQ 04/2015 Auswirkung der ISO 14119 auf 3SE53/3SF13 Positionsschalter mit https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475921 Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support. Es
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
How to do? Projekte - Zeiterfassung
 How to do? Projekte - Zeiterfassung Stand: Version 4.0.1, 18.03.2009 1. EINLEITUNG...3 2. PROJEKTE UND STAMMDATEN...4 2.1 Projekte... 4 2.2 Projektmitarbeiter... 5 2.3 Tätigkeiten... 6 2.4 Unterprojekte...
How to do? Projekte - Zeiterfassung Stand: Version 4.0.1, 18.03.2009 1. EINLEITUNG...3 2. PROJEKTE UND STAMMDATEN...4 2.1 Projekte... 4 2.2 Projektmitarbeiter... 5 2.3 Tätigkeiten... 6 2.4 Unterprojekte...
Anforderungen an die HIS
 Anforderungen an die HIS Zusammengefasst aus den auf IBM Software basierenden Identity Management Projekten in NRW Michael Uebel uebel@de.ibm.com Anforderung 1 IBM Software Group / Tivoli Ein Feld zum
Anforderungen an die HIS Zusammengefasst aus den auf IBM Software basierenden Identity Management Projekten in NRW Michael Uebel uebel@de.ibm.com Anforderung 1 IBM Software Group / Tivoli Ein Feld zum
Konzentration auf das. Wesentliche.
 Konzentration auf das Wesentliche. Machen Sie Ihre Kanzleiarbeit effizienter. 2 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, die Grundlagen Ihres Erfolges als Rechtsanwalt sind Ihre Expertise und Ihre Mandantenorientierung.
Konzentration auf das Wesentliche. Machen Sie Ihre Kanzleiarbeit effizienter. 2 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, die Grundlagen Ihres Erfolges als Rechtsanwalt sind Ihre Expertise und Ihre Mandantenorientierung.
etutor Benutzerhandbuch XQuery Benutzerhandbuch Georg Nitsche
 etutor Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch XQuery Georg Nitsche Version 1.0 Stand März 2006 Versionsverlauf: Version Autor Datum Änderungen 1.0 gn 06.03.2006 Fertigstellung der ersten Version Inhaltsverzeichnis:
etutor Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch XQuery Georg Nitsche Version 1.0 Stand März 2006 Versionsverlauf: Version Autor Datum Änderungen 1.0 gn 06.03.2006 Fertigstellung der ersten Version Inhaltsverzeichnis:
Integration verteilter Datenquellen in GIS-Datenbanken
 Integration verteilter Datenquellen in GIS-Datenbanken Seminar Verteilung und Integration von Verkehrsdaten Am IPD Lehrstuhl für Systeme der Informationsverwaltung Sommersemester 2004 Christian Hennings
Integration verteilter Datenquellen in GIS-Datenbanken Seminar Verteilung und Integration von Verkehrsdaten Am IPD Lehrstuhl für Systeme der Informationsverwaltung Sommersemester 2004 Christian Hennings
SSI WHITE PAPER Design einer mobilen App in wenigen Stunden
 Moderne Apps für Smartphones und Tablets lassen sich ohne großen Aufwand innerhalb von wenigen Stunden designen Kunde Branche Zur Firma Produkte Übersicht LFoundry S.r.l Herrngasse 379-381 84028 Landshut
Moderne Apps für Smartphones und Tablets lassen sich ohne großen Aufwand innerhalb von wenigen Stunden designen Kunde Branche Zur Firma Produkte Übersicht LFoundry S.r.l Herrngasse 379-381 84028 Landshut
ISO 20022 im Überblick
 Inhaltsverzeichnis Was ist ISO 20022? 2 Wo sind die ISO-20022-Nachrichten veröffentlicht? 2 Welche Bereiche umfasst ISO 20022? 2 Welche Bedeutung hat ISO 20022 für die Standardisierung? 3 Welche Bedeutung
Inhaltsverzeichnis Was ist ISO 20022? 2 Wo sind die ISO-20022-Nachrichten veröffentlicht? 2 Welche Bereiche umfasst ISO 20022? 2 Welche Bedeutung hat ISO 20022 für die Standardisierung? 3 Welche Bedeutung
Kapitalerhöhung - Verbuchung
 Kapitalerhöhung - Verbuchung Beschreibung Eine Kapitalerhöhung ist eine Erhöhung des Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft durch Emission von en Aktien. Es gibt unterschiedliche Formen von Kapitalerhöhung.
Kapitalerhöhung - Verbuchung Beschreibung Eine Kapitalerhöhung ist eine Erhöhung des Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft durch Emission von en Aktien. Es gibt unterschiedliche Formen von Kapitalerhöhung.
Um ein solches Dokument zu erzeugen, muss eine Serienbriefvorlage in Word erstellt werden, das auf die von BüroWARE erstellte Datei zugreift.
 Briefe Schreiben - Arbeiten mit Word-Steuerformaten Ab der Version 5.1 stellt die BüroWARE über die Word-Steuerformate eine einfache Methode dar, Briefe sowie Serienbriefe mit Hilfe der Korrespondenzverwaltung
Briefe Schreiben - Arbeiten mit Word-Steuerformaten Ab der Version 5.1 stellt die BüroWARE über die Word-Steuerformate eine einfache Methode dar, Briefe sowie Serienbriefe mit Hilfe der Korrespondenzverwaltung
AGROPLUS Buchhaltung. Daten-Server und Sicherheitskopie. Version vom 21.10.2013b
 AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
Tech-Clarity Perspective: Best Practices für die Konstruktionsdatenverwaltung
 Tech-Clarity Perspective: Best Practices für die Konstruktionsdatenverwaltung Wie effektive Datenmanagement- Grundlagen die Entwicklung erstklassiger Produkte ermöglichen Tech-Clarity, Inc. 2012 Inhalt
Tech-Clarity Perspective: Best Practices für die Konstruktionsdatenverwaltung Wie effektive Datenmanagement- Grundlagen die Entwicklung erstklassiger Produkte ermöglichen Tech-Clarity, Inc. 2012 Inhalt
FlowFact Alle Versionen
 Training FlowFact Alle Versionen Stand: 29.09.2005 Rechnung schreiben Einführung Wie Sie inzwischen wissen, können die unterschiedlichsten Daten über verknüpfte Fenster miteinander verbunden werden. Für
Training FlowFact Alle Versionen Stand: 29.09.2005 Rechnung schreiben Einführung Wie Sie inzwischen wissen, können die unterschiedlichsten Daten über verknüpfte Fenster miteinander verbunden werden. Für
Presseinformation. Ihre Maschine spricht! Mai 2015. GLAESS Software & Automation Wir machen industrielle Optimierung möglich.
 Presseinformation Mai 2015 GLAESS Software & Ihre Maschine spricht! Wäre es nicht hilfreich, wenn Maschinen zu uns sprechen könnten? Natürlich nicht immer aber immer dann, wenn etwas Entscheidendes passiert.
Presseinformation Mai 2015 GLAESS Software & Ihre Maschine spricht! Wäre es nicht hilfreich, wenn Maschinen zu uns sprechen könnten? Natürlich nicht immer aber immer dann, wenn etwas Entscheidendes passiert.
Fragebogen ISONORM 9241/110-S
 Fragebogen ISONORM 9241/110-S Beurteilung von Software auf Grundlage der Internationalen Ergonomie-Norm DIN EN ISO 9241-110 von Prof. Dr. Jochen Prümper www.seikumu.de Fragebogen ISONORM 9241/110-S Seite
Fragebogen ISONORM 9241/110-S Beurteilung von Software auf Grundlage der Internationalen Ergonomie-Norm DIN EN ISO 9241-110 von Prof. Dr. Jochen Prümper www.seikumu.de Fragebogen ISONORM 9241/110-S Seite
Kurzanleitung zur Bereitstellung von Sachverhalten und Lösungen zum Universitätsrepetitorium auf dem Server unirep.rewi.hu-berlin.
 Humboldt-Universität zu Berlin Juristische Fakultät Kurzanleitung zur Bereitstellung von Sachverhalten und Lösungen zum Universitätsrepetitorium auf dem Server unirep.rewi.hu-berlin.de Stand: 1. Juni 2010
Humboldt-Universität zu Berlin Juristische Fakultät Kurzanleitung zur Bereitstellung von Sachverhalten und Lösungen zum Universitätsrepetitorium auf dem Server unirep.rewi.hu-berlin.de Stand: 1. Juni 2010
SWOT-Analyse. Der BABOK V2.0 (Business Analysis Body Of Knowledge) definiert die SWOT-Analyse wie folgt:
 SWOT-Analyse Die SWOT-Analyse stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich und wurde in den 1960er-Jahren von der Harvard Business School zur Anwendung in Unternehmen vorgeschlagen. Die SWOT-Analyse
SWOT-Analyse Die SWOT-Analyse stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich und wurde in den 1960er-Jahren von der Harvard Business School zur Anwendung in Unternehmen vorgeschlagen. Die SWOT-Analyse
pro4controlling - Whitepaper [DEU] Whitepaper zur CfMD-Lösung pro4controlling Seite 1 von 9
![pro4controlling - Whitepaper [DEU] Whitepaper zur CfMD-Lösung pro4controlling Seite 1 von 9 pro4controlling - Whitepaper [DEU] Whitepaper zur CfMD-Lösung pro4controlling Seite 1 von 9](/thumbs/27/11531484.jpg) Whitepaper zur CfMD-Lösung pro4controlling Seite 1 von 9 1 Allgemeine Beschreibung "Was war geplant, wo stehen Sie jetzt und wie könnte es noch werden?" Das sind die typischen Fragen, mit denen viele Unternehmer
Whitepaper zur CfMD-Lösung pro4controlling Seite 1 von 9 1 Allgemeine Beschreibung "Was war geplant, wo stehen Sie jetzt und wie könnte es noch werden?" Das sind die typischen Fragen, mit denen viele Unternehmer
DIN EN ISO 9000 ff. Qualitätsmanagement. David Prochnow 10.12.2010
 DIN EN ISO 9000 ff. Qualitätsmanagement David Prochnow 10.12.2010 Inhalt 1. Was bedeutet DIN 2. DIN EN ISO 9000 ff. und Qualitätsmanagement 3. DIN EN ISO 9000 ff. 3.1 DIN EN ISO 9000 3.2 DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9000 ff. Qualitätsmanagement David Prochnow 10.12.2010 Inhalt 1. Was bedeutet DIN 2. DIN EN ISO 9000 ff. und Qualitätsmanagement 3. DIN EN ISO 9000 ff. 3.1 DIN EN ISO 9000 3.2 DIN EN ISO 9001
Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI)
 Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI) RECHTLICHE BESTIMMUNGEN Die Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI) wird getroffen von und zwischen: Stadtwerke Mengen Mittlere
Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI) RECHTLICHE BESTIMMUNGEN Die Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI) wird getroffen von und zwischen: Stadtwerke Mengen Mittlere
Prozessoptimierung. und. Prozessmanagement
 Prozessoptimierung und Prozessmanagement Prozessmanagement & Prozessoptimierung Die Prozesslandschaft eines Unternehmens orientiert sich genau wie die Aufbauorganisation an den vorhandenen Aufgaben. Mit
Prozessoptimierung und Prozessmanagement Prozessmanagement & Prozessoptimierung Die Prozesslandschaft eines Unternehmens orientiert sich genau wie die Aufbauorganisation an den vorhandenen Aufgaben. Mit
! APS Advisor for Automic
 APS Advisor for Automic Business Service Monitoring für Fachanwender, IT- Manager and IT- Experten www.apsware.com Überblick for Automic ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse von Fachanwendern, IT-
APS Advisor for Automic Business Service Monitoring für Fachanwender, IT- Manager and IT- Experten www.apsware.com Überblick for Automic ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse von Fachanwendern, IT-
D i e n s t e D r i t t e r a u f We b s i t e s
 M erkblatt D i e n s t e D r i t t e r a u f We b s i t e s 1 Einleitung Öffentliche Organe integrieren oftmals im Internet angebotene Dienste und Anwendungen in ihre eigenen Websites. Beispiele: Eine
M erkblatt D i e n s t e D r i t t e r a u f We b s i t e s 1 Einleitung Öffentliche Organe integrieren oftmals im Internet angebotene Dienste und Anwendungen in ihre eigenen Websites. Beispiele: Eine
WIE WIRKLICH IST DIE WIRKLICHKEIT WIE SCHNELL WERDEN SMART GRIDS WIRKLICH BENÖTIGT? DI Dr.techn. Thomas Karl Schuster Wien Energie Stromnetz GmbH
 WIE WIRKLICH IST DIE WIRKLICHKEIT WIE SCHNELL WERDEN SMART GRIDS WIRKLICH BENÖTIGT? DI Dr.techn. Thomas Karl Schuster Wien Energie Stromnetz GmbH Agenda Einleitung Historisches zum Thema Smart Definitionen
WIE WIRKLICH IST DIE WIRKLICHKEIT WIE SCHNELL WERDEN SMART GRIDS WIRKLICH BENÖTIGT? DI Dr.techn. Thomas Karl Schuster Wien Energie Stromnetz GmbH Agenda Einleitung Historisches zum Thema Smart Definitionen
Kay Bömer. Prozess- und Wertanalyse im Einkauf - Identifizierung von Verbesserungspotentialen
 Kay Bömer Prozess- und Wertanalyse im Einkauf - Identifizierung von Verbesserungspotentialen Gliederung - Value Management & Co. Kostenoptimierung als ganzheitlicher Ansatz - Prozessanalyse und Prozessintegration
Kay Bömer Prozess- und Wertanalyse im Einkauf - Identifizierung von Verbesserungspotentialen Gliederung - Value Management & Co. Kostenoptimierung als ganzheitlicher Ansatz - Prozessanalyse und Prozessintegration
BASIS Karten, WEA-Katalog, Projektierung, Objekte etc.
 Das Basismodul enthält diese Elemente: 1. Projektsteuerung / -management 3. Kartenhandling-System 2. Windenergieanlagen-Katalog 4. Projektierung und objektorientierte Dateneingabe Die Projektsteuerung
Das Basismodul enthält diese Elemente: 1. Projektsteuerung / -management 3. Kartenhandling-System 2. Windenergieanlagen-Katalog 4. Projektierung und objektorientierte Dateneingabe Die Projektsteuerung
Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky
 #upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
#upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
GRS SIGNUM Product-Lifecycle-Management
 GRS SIGNUM Product-Lifecycle-Management Das optionale Modul Product-Lifecycle-Management stellt eine mächtige Ergänzung zum Modul Forschung & Entwicklung dar. Folgende Punkte werden dabei abgedeckt: Definition
GRS SIGNUM Product-Lifecycle-Management Das optionale Modul Product-Lifecycle-Management stellt eine mächtige Ergänzung zum Modul Forschung & Entwicklung dar. Folgende Punkte werden dabei abgedeckt: Definition
PQ Explorer. Netzübergreifende Power Quality Analyse. Copyright by Enetech 2000-2010 www.enetech.de Alle Rechte vorbehalten. ros@enetech.
 1 PQ Explorer Netzübergreifende Power Quality Analyse 2 Ortsunabhängige Analyse: so einfach, wie noch nie PQ-Explorer ist ein Instrument, das die Kontrolle und Überwachung von Energieversorgungsnetzen
1 PQ Explorer Netzübergreifende Power Quality Analyse 2 Ortsunabhängige Analyse: so einfach, wie noch nie PQ-Explorer ist ein Instrument, das die Kontrolle und Überwachung von Energieversorgungsnetzen
ISA Server 2004 Erstellen eines neuen Netzwerkes - Von Marc Grote
 Seite 1 von 10 ISA Server 2004 Erstellen eines neuen Netzwerkes - Von Marc Grote Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf: Microsoft ISA Server 2004 Einleitung Microsoft ISA Server 2004 bietet
Seite 1 von 10 ISA Server 2004 Erstellen eines neuen Netzwerkes - Von Marc Grote Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf: Microsoft ISA Server 2004 Einleitung Microsoft ISA Server 2004 bietet
Kommunikations-Management
 Tutorial: Wie importiere und exportiere ich Daten zwischen myfactory und Outlook? Im vorliegenden Tutorial lernen Sie, wie Sie in myfactory Daten aus Outlook importieren Daten aus myfactory nach Outlook
Tutorial: Wie importiere und exportiere ich Daten zwischen myfactory und Outlook? Im vorliegenden Tutorial lernen Sie, wie Sie in myfactory Daten aus Outlook importieren Daten aus myfactory nach Outlook
Die Gesellschaftsformen
 Jede Firma - auch eure Schülerfirma - muss sich an bestimmte Spielregeln halten. Dazu gehört auch, dass eine bestimmte Rechtsform für das Unternehmen gewählt wird. Für eure Schülerfirma könnt ihr zwischen
Jede Firma - auch eure Schülerfirma - muss sich an bestimmte Spielregeln halten. Dazu gehört auch, dass eine bestimmte Rechtsform für das Unternehmen gewählt wird. Für eure Schülerfirma könnt ihr zwischen
Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen
 Zentrale Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 445/2011 umfasst das Instandhaltungssystem der ECM die a) Managementfunktion b) Instandhaltungsentwicklungsfunktion
Zentrale Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 445/2011 umfasst das Instandhaltungssystem der ECM die a) Managementfunktion b) Instandhaltungsentwicklungsfunktion
Projekt- Management. Landesverband der Mütterzentren NRW. oder warum Horst bei uns Helga heißt
 Projekt- Management oder warum Horst bei uns Helga heißt Landesverband der Projektplanung Projektplanung gibt es, seit Menschen größere Vorhaben gemeinschaftlich durchführen. militärische Feldzüge die
Projekt- Management oder warum Horst bei uns Helga heißt Landesverband der Projektplanung Projektplanung gibt es, seit Menschen größere Vorhaben gemeinschaftlich durchführen. militärische Feldzüge die
Agile Enterprise Development. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
 Agile Enterprise Development Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Steigern Sie noch immer die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens alleine durch Kostensenkung? Im Projektportfolio steckt das Potenzial
Agile Enterprise Development Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Steigern Sie noch immer die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens alleine durch Kostensenkung? Im Projektportfolio steckt das Potenzial
Klausur Informationsmanagement 15.01.2010
 Klausur Informationsmanagement 15.01.2010 Sie haben 90 Minuten Zeit zum Bearbeiten. Sie können maximal 90 Punkte erreichen. Nehmen Sie die für eine Aufgabe vergebenen Punkte auch als Hinweis für die Bearbeitungszeit.
Klausur Informationsmanagement 15.01.2010 Sie haben 90 Minuten Zeit zum Bearbeiten. Sie können maximal 90 Punkte erreichen. Nehmen Sie die für eine Aufgabe vergebenen Punkte auch als Hinweis für die Bearbeitungszeit.
Risikomanagement in der Praxis Alles Compliance oder was?! 1. IT-Grundschutz-Tag 2014 13.02.2014
 Risikomanagement in der Praxis Alles Compliance oder was?! 1. IT-Grundschutz-Tag 2014 13.02.2014 Risikomanagement Eine Einführung Risikomanagement ist nach der Norm ISO 31000 eine identifiziert, analysiert
Risikomanagement in der Praxis Alles Compliance oder was?! 1. IT-Grundschutz-Tag 2014 13.02.2014 Risikomanagement Eine Einführung Risikomanagement ist nach der Norm ISO 31000 eine identifiziert, analysiert
Design Pattern - Strukturmuster. CAS SWE - OOAD Marco Hunziker Klaus Imfeld Frédéric Bächler Marcel Lüthi
 Design Pattern - Strukturmuster CAS SWE - OOAD Marco Hunziker Klaus Imfeld Frédéric Bächler Marcel Lüthi Agenda Einleitung Strukturmuster Fassade Model View Controller Vergleich 2 Einleitung Strukturmuster
Design Pattern - Strukturmuster CAS SWE - OOAD Marco Hunziker Klaus Imfeld Frédéric Bächler Marcel Lüthi Agenda Einleitung Strukturmuster Fassade Model View Controller Vergleich 2 Einleitung Strukturmuster
Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz
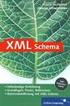 Anwendungshandbuch Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz Version: 1.0 Herausgabedatum: 31.07.2015 Ausgabedatum: 01.11.2015 Autor: DB Energie http://www.dbenergie.de Seite: 1 1.
Anwendungshandbuch Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz Version: 1.0 Herausgabedatum: 31.07.2015 Ausgabedatum: 01.11.2015 Autor: DB Energie http://www.dbenergie.de Seite: 1 1.
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit
 Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Diplomarbeit. Konzeption und Implementierung einer automatisierten Testumgebung. Thomas Wehrspann. 10. Dezember 2008
 Konzeption und Implementierung einer automatisierten Testumgebung, 10. Dezember 2008 1 Gliederung Einleitung Softwaretests Beispiel Konzeption Zusammenfassung 2 Einleitung Komplexität von Softwaresystemen
Konzeption und Implementierung einer automatisierten Testumgebung, 10. Dezember 2008 1 Gliederung Einleitung Softwaretests Beispiel Konzeption Zusammenfassung 2 Einleitung Komplexität von Softwaresystemen
Stellen Sie bitte den Cursor in die Spalte B2 und rufen die Funktion Sverweis auf. Es öffnet sich folgendes Dialogfenster
 Es gibt in Excel unter anderem die so genannten Suchfunktionen / Matrixfunktionen Damit können Sie Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs suchen. Als Beispiel möchte ich die Funktion Sverweis zeigen.
Es gibt in Excel unter anderem die so genannten Suchfunktionen / Matrixfunktionen Damit können Sie Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs suchen. Als Beispiel möchte ich die Funktion Sverweis zeigen.
Vermeiden Sie es sich bei einer deutlich erfahreneren Person "dranzuhängen", Sie sind persönlich verantwortlich für Ihren Lernerfolg.
 1 2 3 4 Vermeiden Sie es sich bei einer deutlich erfahreneren Person "dranzuhängen", Sie sind persönlich verantwortlich für Ihren Lernerfolg. Gerade beim Einstig in der Programmierung muss kontinuierlich
1 2 3 4 Vermeiden Sie es sich bei einer deutlich erfahreneren Person "dranzuhängen", Sie sind persönlich verantwortlich für Ihren Lernerfolg. Gerade beim Einstig in der Programmierung muss kontinuierlich
Erfolgreiche ITIL Assessments mit CMMI bei führender internationaler Bank
 Turning visions into business Oktober 2010 Erfolgreiche ITIL Assessments mit CMMI bei führender internationaler Bank David Croome Warum Assessments? Ein strategisches Ziel des IT-Bereichs der Großbank
Turning visions into business Oktober 2010 Erfolgreiche ITIL Assessments mit CMMI bei führender internationaler Bank David Croome Warum Assessments? Ein strategisches Ziel des IT-Bereichs der Großbank
WARENWIRT- SCHAFT UND ERP BERATUNG Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung
 WARENWIRT- SCHAFT UND ERP BERATUNG Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung IT-SERVICE Warenwirtschaft (WaWi) und Enterprise Resource Planning (ERP) WaWi und ERP Beratung Kunden erfolgreich beraten und während
WARENWIRT- SCHAFT UND ERP BERATUNG Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung IT-SERVICE Warenwirtschaft (WaWi) und Enterprise Resource Planning (ERP) WaWi und ERP Beratung Kunden erfolgreich beraten und während
Dipl.-Ing. Herbert Schmolke, VdS Schadenverhütung
 1. Problembeschreibung a) Ein Elektromonteur versetzt in einer überwachungsbedürftigen Anlage eine Leuchte von A nach B. b) Ein Elektromonteur verlegt eine zusätzliche Steckdose in einer überwachungsbedürftigen
1. Problembeschreibung a) Ein Elektromonteur versetzt in einer überwachungsbedürftigen Anlage eine Leuchte von A nach B. b) Ein Elektromonteur verlegt eine zusätzliche Steckdose in einer überwachungsbedürftigen
Test zur Bereitschaft für die Cloud
 Bericht zum EMC Test zur Bereitschaft für die Cloud Test zur Bereitschaft für die Cloud EMC VERTRAULICH NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG Testen Sie, ob Sie bereit sind für die Cloud Vielen Dank, dass Sie sich
Bericht zum EMC Test zur Bereitschaft für die Cloud Test zur Bereitschaft für die Cloud EMC VERTRAULICH NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG Testen Sie, ob Sie bereit sind für die Cloud Vielen Dank, dass Sie sich
Abschnitt 2 Vier Fragen, jeweils 5 Punkte pro Frage erreichbar (Maximal 20 Punkte)
 Abschnitt 1 2. Listen Sie zwei Abschnitte von ISO 9001 (Nummer und Titel) auf. die das Qualitätsmanagementprinzip Systemorientierter Ansatz unterstützen. (2 Punkte) Abschnitt 2 Vier Fragen, jeweils 5 Punkte
Abschnitt 1 2. Listen Sie zwei Abschnitte von ISO 9001 (Nummer und Titel) auf. die das Qualitätsmanagementprinzip Systemorientierter Ansatz unterstützen. (2 Punkte) Abschnitt 2 Vier Fragen, jeweils 5 Punkte
INDIVIDUELLE SOFTWARELÖSUNGEN CUSTOMSOFT CS GMBH
 01 INDIVIDUELLE SOFTWARELÖSUNGEN 02 05 02 GUMMERSBACH MEHRWERT DURCH KOMPETENZ ERIC BARTELS Softwarearchitekt/ Anwendungsentwickler M_+49 (0) 173-30 54 146 F _+49 (0) 22 61-96 96 91 E _eric.bartels@customsoft.de
01 INDIVIDUELLE SOFTWARELÖSUNGEN 02 05 02 GUMMERSBACH MEHRWERT DURCH KOMPETENZ ERIC BARTELS Softwarearchitekt/ Anwendungsentwickler M_+49 (0) 173-30 54 146 F _+49 (0) 22 61-96 96 91 E _eric.bartels@customsoft.de
