Funkkommunikationstechnik. Systembetrachtungen: Reichweiten, Modulationsverfahren...
|
|
|
- Claus Küchler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Funkkommunikationstechnik Systembetrachtungen: Reichweiten, Modulationsverfahren... Lösungen
2 Netzstruktur: Prinzip
3 Systembetrachtungen Einleitung 1 Am Beispiel der verschollenen MH370 hat sich gezeigt, dass ein globales Positionserfassungssystem für Flugzeuge auch über Meeresflächen notwendig wäre. Ein Lösungsansatz ist im Schaubild auf der vorangegangenen Seite dargestellt. Dabei senden Flugzeuge ihre Positionsdaten mit ADS-B oder evtl. in Zukunft mit LDACS1 aus (Beide Systeme nutzen das L-Band). Von Schiffen werden diese Daten empfangen und an Satelliten weitergeleitet. Mit LDACS1 könnten auch weitere Datendienste auf dieses System aufbauen. Am Schiffsverkehr beteiligte Objekte (Schiffe, Häfen, Bojen) tauschen Positionsdaten über das AIS-Funksystem aus. Für die Schiffs-Satelliten-Kommunikation müsste dieser Standard mit einem neuen Verfahren AIS+ erweitert werden. Um eine möglichst lückenlose Verfügbarkeit des Positionserfassungssystem zu erreichen, müssten genügend Schiffe mit ADS-B/LDACS1 und AIS+ aufgerüstet werden. Aufgabe 1 (1 Punkt) (1 Punkt). Was könnte einen Reeder dazu bewegen, ein zusätzliches Funksystem an Board zu installieren? Geld Team Punkte R&S Fallstudienwettbewerb
4 Systembetrachtungen Einleitung 2 Betrachten Sie dazu zunächst mal den als AIS+ bezeichneten Kommunikationsstrang aus dem Schaubild. Die benötigten Satelliten können entweder als: (A) Geostationäre oder (B) Low Earth Orbit Satelliten realisiert sein Für beide Fälle gilt dann: (A) Konstante Umlaufbahnhöhe über der Erdoberfläche beträgt ca km (B) Typische Umlaufbahnhöhe beträgt ca. 800 km. Der Satellit bewegt sich dabei mit einer Geschwindigkeit, die um Faktor 20 höher ist als die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Dabei sollen Frequenzen im VHF-Band (~ 160 MHz) verwendet werden. ıaufgabe 2 (3 Punkte) (2 Punkte) Welche Art von Antennen sind für beide Fälle sinnvoll? Betrachten Sie sowohl den möglichen Gewinn wie auch die Richtcharakteristik der Antennen. (A) Antenne mit einer ausgeprägten Richtwirkung, da der Abstand zum Satelliten sehr groß ist und der Strahlungswinkel weitgehend konstant bleibt. (B) Antenne mit einer flachen Strahlungscharakteristik, da der Satellit ständig seine Position ändert. (1 Punkt) Wie ist die Verfügbarkeit eines jeweiligen Satelliten am bestimmten Ort der Erde in 24 Stunden? Hinweis: Eine qualitative Aussage genügt (A) ständig verfügbar, zumindest wenn er sich auf der richtigen Seite der Erde und nicht gerade über den Polen befindet (B) Je nach Umlaufgeschwindigkeit taucht er nur einige wenige Male innerhalb von 24 Stunden auf, für eine Dauer von typisch 10 min Team Punkte R&S Fallstudienwettbewerb
5 Funkkommunikationstechnik Elektromagnetische Wellenausbreitung 1 Die Sende-/Empfangsantenne sowohl am Schiff wie am Satellit wird als λ/4-stab über leitender Fläche ausgeführt. Die verfügbare Sendeleistung betrage jeweils 10 W effektiv. Aufgabe 3 (6 Punkte) (4 Punkte). Für den Fall (B) auf der Vorgängerseite berechnen Sie die Signalstärke des ankommenden Signals. Dabei wird für die gesamte Strecke Freifelddämpfung angenommen und zwar für die Entfernung zwischen Satellit und Schiff bei der der Satellit gerade am Horizont auftaucht. Der Erdradius sei 6400 km und der Gewinn beider Antennen sei Die effektive Antennenhöhe beträgt λ/(2π). Hinweis: Die Feldstärke wird üblicherweise in dbµv/m angegeben. Abstand zum Satelliten: d = h {(1+2 R / h)} = [km] Freifelddämpfung: att = 20 log10(4 p d f / c) = [db] Effektive Antennenhöhe: heff = 0.3 [m] Rx_power = 10 log10(10000) att + 10 log10(3.28) + 10 log10(3.28) = 96.6 [dbm] = [3.3 µv] Feldstärke: E_rx = 20 log10(rx_power/heff) = 20.9 [dbµv] (2 Punkte) Wodurch könnte die tatsächliche Streckendämpfung wesentlich höher ausfallen als die oben berechnete Freifelddämpfung? Streckendämpfung kann durch den langen Weg durch die Atmosphäre erheblich höher sein. Richtwerte für z.b. dichten Nebel (Sichtweite ~100m) : exp. Attenuation Coefficient = 50[1/km] Auch Mehrwegeausbreitung, durch geringen Einfallswinkel begünstigt, kann die effektive Dämpfung erhöhen. Team Punkte R&S Fallstudienwettbewerb
6 Funkkommunikationstechnik Elektromagnetische Wellenausbreitung 2 Ein LEO-Satellit bewegt sich auf einer Umlaufbahn, die senkrecht zur Rotationsbewegung der Erde liegt, mit einer Geschwindigkeit von typischerweise 8 km/s. Damit taucht er für einen stationären Beobachter auf der Erde 4 Mal am Tag am Horizont auf und verschwindet wieder nach ca. 5 bis 15 Minuten, je nach Standort des Betrachters. Aufgabe 4 (4 Punkte) (2 Punkte) Skizzieren Sie den prinzipiellen Verlauf der Doppler- Verschiebung während der Satellit für den Betrachter sichtbar ist. Siehe Bild rechts (1 Punkt) Wie groß ist die maximale Frequenzverschiebung im VHF-Band 160 MHz? Wie ändert sich dieser Wert für L-Band (~ 1GHz)? Doppler-Verschiebung VHF: fd = f / (1 v/c) = 4267 [Hz] Im L-Band vergrößert sich die Frequenzverschiebung um mehr als Faktor 6. (1 Punkt) Was bedeutet dies für ein Mehrträgerverfahren? Der Trägerabstand muss deutlich geringer sein als die max. mögliche Dopplerverschiebung Team Punkte R&S Fallstudienwettbewerb
7 Funkkommunikationstechnik Linkbudget: Flugzeug zu Basisstation Nun soll die Funkstrecke: Flugzeug zu den möglichen Basisstationen betrachtet werden. Die Modulationsart ist 2-fach FSK unter Verwendung eines kohärenten Demodulators, die äquivalente Rauschbandbreite beträgt 25 khz. Ein Codierungsgewinn wird außer Acht gelassen. Sowohl die Empfangs- als auch die Sendeantenne können als λ/4-monopole über einer unendlichen, leitenden Fläche angenähert werden. Die Bitfehlerhäufigkeit ist durch die nachstehende Formel gegeben: Aufgabe 5 (5 Punkte) (5 Punkte) Der Satellit, dessen Umlaufbahn 800 km beträgt ist gerade sichtbar am Horizont. Wie ist die maximale Rauschleistung des Empfängers zu dimensionieren, damit eine Bitfehlerhäufigkeit von 10^-6 erreicht werden kann. Die Sendeleistung sei 10 Watt. Berücksichtigen Sie dabei eine Systemreserve von 10 db. Empfangsleistung: Rx = [dbm] (siehe Aufgabe 3. Teil 1) Rauschzahl: F = log10 (kt0) 10 log10 (BW/Hz) 10 log10 (E b /N0 BER=10^-6 ) 10 db = 9.9 [db] Anmerkung: Die geforderte Bitfehlerhäufigkeit wird bei einem Störabstand von Eb/N0=13.5 db erreicht. Team Punkte R&S Fallstudienwettbewerb
8 Funkkommunikationstechnik Systemische Störfestigkeit (Co-site) ı Am Schiff, das als See-Basisstation fungieren soll, müssen verschiedene Funksysteme koexistieren, ohne sich gegenseitig negativ zu beeinflussen. ı In unserem Fall wird im selben Frequenzband (VHF ~ 160 MHz) gleichzeitig ein Signal über AIS gesendet und über AIS+ empfangen. Die Sende- und Empfangsfrequenz liegen mindestens 1% auseinander. (Zur Erinnerung: Sendeleistung = 10 W) ı Als Faustregel für die Entkopplungsdämpfung zwischen zwei Antennen gilt: Ein Abstand von 10 Wellenlängen entspricht 40 db Dämpfung. Hinweis: Als Vereinfachung nehmen Sie an, dass die Entkopplungsdämpfung mit dem Quadrat der Entfernung zwischen den Antennen steigt R&S Fallstudienwettbewerb
9 Funkkommunikationstechnik Alternativlösung 1 Störfestigkeit im System(Co-site) Antennengewinn +5.2 dbi Aufgabe 6 (7 Punkte) (5 Punkte) Wie ist die minimale Entfernung in Metern zwischen den beiden VHF Antennen zu wählen, damit ein Störabstand von mindestens 13.5 db gewährleitet werden kann? Der installierte Sender weise ein Störabstand von 150 dbc/hz in einer Frequenzablage zum Träger von 1 % auf. Die Nutzbandbreite sei 25 khz. Das Nutzsignal muss noch mit einem minimalen Pegel von dbm empfangen werden können. Das Rauschmaß, das der Empfänger selbst hat, ist hier ausnahmsweise zu vernachlässigen. Senderauschleistungsdichte in % Abstand: +40 [dbm] [dbi] 150 [dbc/hz] = [dbm/hz] Erlaubte Rauschleistungsdichte am Empfänger: 92.5 [dbm] [db] + 10 log10 (BW/Hz) 5.2[dBi] = [dbm/hz] Mindestentkopplung Rx-Tx: = [dbm/hz] ( [dbm/hz]) = 50.4 [db] 40 db ~ 10 Wellenlängen, für die zusätzlichen 10.4 db muss der Abstand um Faktor: /20 = 3.3 vergrößert werden Damit ergibt sich ein Abstand von [m] = 62 [m] (2 Punkte) Der Reeder hat nur einen begrenzten Raum für die Unterbringung von Antennenmasten verfügbar, so dass ein Abstand von nur ca. 6 m möglich ist. Um wieviel verringert sich die Entkopplungsdämpfung in diesem Fall? Dämpfungsverringerung: 20 log10 (d1/d2) = 19.5 [db], (d1 = 56.6 m, d2 = 6 m) Welche Maßnahmen könnte er ergreifen, um die Anforderung an den Störabstand zu erfüllen? Welche Kosten sind damit verbunden? Einen Sender mit -170dBc/Hz in 1% gibt s nicht zum Kaufen, daher Sendefilter installieren. Teuer! Team Punkte R&S Fallstudienwettbewerb
10 Funkkommunikationstechnik Alternativlösung 2 Störfestigkeit im System(Co-site) Antennengewinn 0dBi Aufgabe 6 (7 Punkte) (5 Punkte) Wie ist die minimale Entfernung in Metern zwischen den beiden VHF Antennen zu wählen, damit ein Störabstand von mindestens 13.5 db gewährleitet werden kann? Der installierte Sender weise ein Störabstand von 150 dbc/hz in einer Frequenzablage zum Träger von 1 % auf. Die Nutzbandbreite sei 25 khz. Das Nutzsignal muss noch mit einem minimalen Pegel von dbm empfangen werden können. Das Rauschmaß, das der Empfänger selbst hat, ist hier ausnahmsweise zu vernachlässigen. Senderauschleistungsdichte in % Abstand: +40 [dbm] + 0 [dbi] 150 [dbc/hz] = [dbm/hz] Erlaubte Rauschleistungsdichte am Empfänger: 92.5 [dbm] [db] + 10 log10 (BW/Hz) 0 [dbi] = [dbm/hz] Mindestentkopplung Rx-Tx: = [dbm/hz] ( [dbm/hz]) = 40.0 [db] Entkopplung von 40 db entspricht einem Abstand von ~ 10 Wellenlängen. Damit ergibt sich ein notwendiger Abstand von [m] = 18.8 [m] (2 Punkte) Der Reeder hat nur einen begrenzten Raum für die Unterbringung von Antennenmasten verfügbar, so dass ein Abstand von nur ca. 6 m möglich ist. Um wieviel verringert sich die Entkopplungsdämpfung in diesem Fall? Dämpfungsverringerung: 20 log10 (d1/d2) = 10.0 [db]. Welche Maßnahmen könnte er ergreifen, um die Anforderung an den Störabstand zu erfüllen? Welche Kosten sind damit verbunden? Einen Sender mit -160dBc/Hz in 1% oder Sendefilter installieren. Teuer! R&S Fallstudienwettbewerb
11 Netzstrukturen Betrachtung von selbstorganisierenden Netzwerken, Datenaufbereitung und kompression und CDMA.
12 Netzstrukturen Selbstorganisierende Netzwerke ı Problemstellung ı Die von Flugzeugen ausgesandten Positionsdaten sollen auf See von speziellausgestatteten Schiffen empfangen und an ein Satellitennetzwerk weitergeleitet werden. ı Um die Datenlast zu reduzieren, sollen nur Schiffe Positionsdaten weiterleiten, die die Netzabdeckung für Flugzeuge maximieren R&S Fallstudienwettbewerb
13 Netzstrukturen Selbstorganisierende Netzwerke ı Vorgaben Für Schiff-zu-Schiff Verbindungen beträgt die Reichweite etwa 20nm (37km). Für Flugzeug-zu-Schiff Verbindungen beträgt die Reichweite etwa 200nm (370km). Schiffe sind nicht homogen auf der Wasseroberfläche verteilt sondern bilden Cluster (Häfen) oder folgen in der Regel Seestraßen. Schiffe die zu einer Satellitenkommunikation fähig sind, senden diese Information zusammen mit den Positionsdaten aus. Diese besitzen Up-Link- Fähigkeiten. Die Netzstruktur organisiert sich selbstständig ohne Einfluss zentraler Stellen (Satellit oder Bodenstationen) R&S Fallstudienwettbewerb
14 Netzstrukturen Selbstorganisierende Netzwerke ı Algorithmus Der folgende Algorithmus bestimmt für jedes Schiff mit Up-Link-Fähigkeit, ob es Flugzeugdaten an den Satellit weiterleiten soll oder nicht. Dabei werden im folgenden nur empfangene Schiffspositionen berücksichtigt, die eine Up-Link- Fähigkeit besitzen. 1. Wenn kein weiteres Schiff sichtbar ist, ist dieses Schiff eine Vermittlungsstation, sonst 2. Bestimme anhand aller Schiffspositionen das Gravizentrum (Center of Gravity) 3. Bestimme den Abstandsvektor aller Schiffspositionen zum Gravizentrum. 4. Bestimme die Entfernung aller Schiffspositionen bezogen auf die Richtung vom Gravizentrum zur eigenen Position. 5. Falls eigene Position größte Entfernung zum Gravizentrum aufweist, dann ist dieses Schiff eine Vermittlungsstation R&S Fallstudienwettbewerb
15 Netzstrukturen Selbstorganisierende Netzwerke Mit dem vorgestellten Algorithmus sollen folgende Zielvorgaben erreicht werden. ı Zielvorgaben Positionsdaten von Flugzeugen sollen lückenlos an das Satellitensystem weitergeleitet werden. Die Anzahl der Schiffe, die Informationsdaten von Flugzeugen weiterleiten, soll minimal sein. Das Netzwerk organisiert sich selbstständig R&S Fallstudienwettbewerb
16 Netzstrukturen Selbstorganisierende Netzwerke ı Aufgabe 7 (6 Punkte) Bestimmen Sie das Gravizentrum für Schiff E für das Beispielszenarios. Ist Schiff E eine Vermittlungsstation? Schiffskennung X-Position [km] Y-Position [km] ı Kartesisches A Koordinartensystem B C D E F G H I J K L M N ı Darstellung auf nächster Seite R&S Fallstudienwettbewerb
17 Netzstrukturen Selbstorganisierende Netzwerke ı Aufgabe 7 (6 Punkte) Bestimmen Sie das Gravizentrum für Schiff E für das Beispielszenarios. Ist Schiff E eine Vermittlungsstation? ı Lösung 7 (6 Punkte) Zentrum befindet sich bei (116, 172) Nein. Aus Sicht von E ist D eine geeignetere Vermittlungsstation. Team Punkte Footer: >Insert >Header & Footer 17
18 Netzstrukturen Selbstorganisierende Netzwerke ı Kartenansicht des Beispielszenarios: ı Bezugspunkt ist die untere linke Ecke (0, 0) R&S Fallstudienwettbewerb
19 Network structures Self-organizing networks ı Aufgabe 8 (6 Punkte) Leider hat der vorgestellte Algorithmus Schwächen. Welche Probleme können bei diesem Algorithmus auftreten? Können alle Zielvorgaben erreicht werden? Lösung Folgende Schwächen des Algorithmus können zu Tage treten (bitte hierzu auch die Grafik betrachten): 1. Zuständigkeiten werden wechselseitig zugeordnet (Aus Sicht von E wäre D, aus D wiederum E besser geeignet. Dadurch entstehen Lücken in der Abdeckung, obwohl Schiffe vorhanden wären (hier zwischen H, E und D) 2. Zuständigkeiten werden nicht delegiert (G und I sehen den Cluster mit 5 Schiffen (Graviszentrum ist identisch), beide nehmen an, dass sie geeignet sind, liegen jedoch eng beieinander. Wäre E weiter entfernt, würden sich alle Schiffe des Clusters als zuständig betrachten. Fortsetzung auf nächster Folie R&S Fallstudienwettbewerb
20 Network structures Self-organizing networks Lösung 8 (Fortsetzung): 1. Der Bezugsradius ist zu klein. Aus Sicht des Flugzeuges würde ein einzelnes Schiff bereits als Vermittlungsstation ausreichen, da sich alle Schiffe in Empfangsreichweite befinden. Team Punkte Footer: >Insert >Header & Footer 20
21 Network structures Self-organizing networks ı Aufgabe 9 (6 Punkte) Welchen Algorithmus würden Sie stattdessen verwenden? ı Lösung 9 (6 Punkte) Hier ist der Kreativität freien Lauf gelassen. Eine Möglichkeit: Schiffe unterteilen die Fläche in Zuständigkeitsbereiche, in dem sie zwischen sich und anderen Grenzlinien ziehen. Überfliegt ein Flugzeug das eigene Zuständigkeitsgebiet, so muss das Schiff die Positionsdaten weiterleiten, sonst nicht. Team Punkte Footer: >Insert >Header & Footer 21
22 Netzstrukturen Datenaufbereitung und -kompression ı In der folgenden Tabelle sind durch das Schiff E empfangene Flugzeugpositionen exemplarisch angegeben. (Siehe Verlauf auf Kartenansicht) ı Aufgabe 10 (3 Punkte) Wie würden Sie die Daten aufbereiten, so dass die zu sendende Datenmenge weiter reduziert wird? Welche Probleme treten hierbei in der Praxis auf? Zeit [min] X-Position [km] Y-Position [km] R&S Fallstudienwettbewerb
23 Netzstrukturen Datenaufbereitung und -kompression Team Punkte ı Aufgabe 10 (3 Punkte) Wie würden Sie die Daten aufbereiten, so dass die zu sendende Datenmenge weiter reduziert wird? Welche Probleme treten hierbei in der Praxis auf? ı Lösung 10 (3 Punkte) Die Daten sind absolute Positionsangaben. Diese können in einen Bewegungsvektor umgerechnet werden. Da die Daten mit Rauschen belegt sind, sollten nur Änderungen übertragen werden, die einen Schwellwert überschreiten. Dabei dürfen leichte Kursänderungen nicht unterdrückt werden, d.h. Ableitung des V-Vektors ist ungeeignet für den Schwellwert. Stattdessen kann der Fehler des Prädiktorschätzwertes als Schwellwert verwendet werden. Fortsetzung nächste Seite R&S Fallstudienwettbewerb
24 Netzstrukturen Datenaufbereitung und -kompression ı Lösung 10 (3 Punkte): Folgende Daten wären sinnvoll: Zeit [min] Tatsächliche Position AC Geschätzte Position Abweichung Aktueller Bewegungsvektor , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.6 ı (Die Daten weichen geringfügig von der Aufgabenstellung ab, da die Daten im Script zufällig erzeugt wurden) R&S Fallstudienwettbewerb
25 Netzstrukturen CDMA Kommunikation ı Für die Schiffs-Satelliten Kommunikation soll CDMA eingesetzt werden. Damit der Satellit in der Lage ist, die Daten jedes Schiffes, das als Vermittlungsstation fungiert, zu decodieren, muss jedes Schiff einen einzigartigen Spreizcode verwenden. Die Satellitenkommunikation muss auf 8000 Schiffe ausgelegt sein. ı Aufgabe 11 (6 Punkte) Wie würden Sie einen Spreizcode aus der Menge der verfügbaren Codes ohne eine zentrale Management Station den Schiffen zuordnen? Wodurch ist die Mächtigkeit der Menge der Spreizcodes beeinflusst? Kann der Satellit durch Ihr Verfahren die Anzahl der zu dekodierenden Verbindungen reduzieren? R&S Fallstudienwettbewerb
26 Netzstrukturen Punkte CDMA Kommunikation Team Aufgabe 11 (6 Punkte) Wie würden Sie einen Spreizcode aus der Menge der verfügbaren Codes ohne eine zentrale Management Station den Schiffen zuordnen? Wodurch ist die Mächtigkeit der Menge der Spreizcodes beeinflusst? Kann der Satellit durch ihr Verfahren die Anzahl der zu dekodierenden Verbindungen reduzieren? Lösung 11 (6 Punkte): Jedes Bit wird auf Chips (Symbole mit Informationsgehalt < 1bit) gespreizt; dabei ist die Anzahl der Chips fix (z.b.: 32). Dadurch verbreitert sich die Bandbreite um Faktor 32. Bei einem RM-Code (32, 6, 16) können lediglich 64 Chipfolgen (Codewörter entspr. Anzahl Teilnehmer) verwendet werden (64 aus 4 Mrd. Kombinationen). Mächtigkeit ist beeinflusst von der Anzahl gültiger Codewörter und verfügbaren Bandbreite. Ein CDMA mit 8000 Teilnehmern ist daher nicht machbar?! Fortsetzung nächste Seite R&S Fallstudienwettbewerb
27 Netzstrukturen CDMA Kommunikation Aufgabe 11 (6 Punkte) Wie würden Sie einen Spreizcode aus der Menge der verfügbaren Codes ohne eine zentrale Management Station den Schiffen zuordnen? Wodurch ist die Mächtigkeit der Menge der Spreizcodes beeinflusst? Kann der Satellit durch ihr Verfahren die Anzahl der zu dekodierenden Verbindungen reduzieren? Lösung 11 (6 Punkte): Zuordnung der Spreizcodes über eine Funktion, die aus der Schiffsposition den Index für die Spreizcodetabelle errechnet. Problem: Zwei Schiffe dürfen nicht den selben Code verwenden, wenn sie nahe beieinander liegen. Bewegt sich ein Schiff von einer Zelle in eine andere, muss der Spreizcode geändert werden. Zuordnung über Schiffskennung ist nicht möglich, da es wesentlich mehr Schiffe als Speizcodes gibt, und der Satellit nicht wissen kann, welches Schiff sich gerade wo befindet R&S Fallstudienwettbewerb
28 Security und Nachrichteninhalte Betrachtung von Verschlüsselung und Integrität
29 Security Verschlüsselung ı Bei der Übermittlung von Positionsdaten durch Flugzeuge und Schiffe ist immer ein gewisses Vertrauen gefragt. Stellen Sie sich vor, ein Flugzeug übermittelt Daten an ein Schiff. Das Schiff dient als Repeater und soll die Daten weiter an einen Satelliten senden. Wenn die Besatzung des Schiffes feindselig gegenüber ziviler Luftfahrt ist, kann mit der Manipulation der Positionsdaten bzw. des Positionsvektors sensibel in die Flugruten eingegriffen werden. Der veränderte Positionsvektor gelangt zu einer Bodenstation (ATC) wo die Daten ausgewertet werden. Kommt es nun aufgrund des veränderten Positionsvektors zu vermeintlichen Zusammenstößen, kann dies zu drastischen Konsequenzen führen (Ausweichmanöver werden bspw. angeordnet). Um solche Szenarien zu verhindern, sollte die Positionsübertragung zwischen Bodenstation und Flugzeug verschlüsselt sein R&S Fallstudienwettbewerb
30 Security Verschlüsselung Team Punkte ı Da es sich bei verschlüsselten Verbindungen um digitale Verfahren handelt, müssen sich am Anfang jeder Verbindung der Empfänger und der Sender synchronisieren. ı Aufgabe 1 (2 Punkte) Wie könnte eine Synchronisation des Datenstromes in einem solchen Szenario funktionieren? ı Lösung 1 Die Synchronisation muss unverschlüsselt übertragen werden (bspw. Eine Folge aus ). In diesem Fall geht kein Bit des Datenstromes verloren. Mit einer PLL die Frequenz anhand eines zufälligen Datenstromes zu synchronisieren dauert ggf. zu lange es gehen Daten verloren R&S Fallstudienwettbewerb
31 Security Verschlüsselung Team Punkte ı Neben der Synchronisation am Anfang sollte der Empfänger auch wissen, wann ein verschlüsseltes Signal endet. ı Aufgabe 2 (2 Punkte) Was findet man am Ende eine verschlüsselten Datenstroms und wofür könnte es Verwendung finden? ı Lösung 2 Ein sogenanntes EOM (End Of Message) wird benötigt. Dieses dient dazu, dem Empfangendem Radio zu signalisieren, dass der Datenstrom zu ende ist (Squelch schließt sich, Radio ist bereit für neue Secure Übertragung) R&S Fallstudienwettbewerb
32 Security Verschlüsselung Team Punkte ı Bei Funkübertragungen kommt es vor, dass periodische Signale übertragen werden. Stellen Sie sich vor ein reines Sinus Signal soll verschlüsselt übertragen werden. ı Aufgabe 3 (4 Punkte) Wie wird sichergestellt, dass der Sinus nicht in dem verschlüsselten Signal erkennbar ist und was für eine Art Verschlüsselung würden Sie bevorzugen? Erklären Sie das vorgehen (warum ein Sinus Signal nicht aus dem verschlüsseltem Signal extrahiert werden kann) und zeichnen Sie ein Blockschaltbild die eine solche Vorrichtung exemplarisch Umsetzt. ı Lösung 3 Es kommen Linear Feedback Shift Register (LFSR) zum Einsatz (i.d.r. 3 oder mehr). Mit diesem wird eine Pseudozufallsfolge generiert, die keinerlei Rückschluss auf den Klartext zulässt, auch wenn dieser sich wiederholt R&S Fallstudienwettbewerb
33 Security Verschlüsselung ı Mögliche Antworten sind: ı Output Feedback Mode oder Cipher Feedback Mode, Blockchiffre. ı Linear Feedback Shift Register, Stromchiffre. ı OFB Mode (Blockschaltbild kann stark variieren)*: ı Der Bitstrom ist pseudozufällig, weil er von der Blockchiffre, dem Schlüssel und dem Initialisierungsvektor abhängig ist *. ı *: Quelle Wikipedia, R&S Fallstudienwettbewerb
34 Security Verschlüsselung Team Punkte ı Es gibt immer wieder Situationen in denen dritte Personen an dem Inhalt der Nachricht Interessiert sind. ı Aufgabe 4 (2 Punkte) Welche Methoden sind Ihnen bekannt um das Abhören (Gewinnung von lesbaren Informationen) des Datenstroms zu erschweren? ı Lösung 4 COMSEC: Verschlüsselung des Datensignals. TRANSEC: Hopping-Verfahren mit großen Frequenzsprüngen erschwert das Aufzeichnen R&S Fallstudienwettbewerb
35 Security Verschlüsselung Team Punkte ı Am Flughafen wird versehentlich eine Frequenz dauerhaft gestört. Die Ortung des Störers läuft bereits im vollem Gange. Bis dahin müssen die Flugzeuge dennoch mit der Bodenstation in Kontakt bleiben. ı Aufgabe 5 (2 Punkte) Wie könnte man dieses Problem auf Radio-Ebene lösen? ı Lösung 5 TRANSEC Modul: Frequenzsprünge oder sehr breitbandige Kanäle benutzen R&S Fallstudienwettbewerb
36 Security Verschlüsselung ı In ein Flugfunkgerät soll ein Verschlüsselungsmodul integriert werden. Hierbei sollten einige Dinge beachtet werden, da es um die Sicherheit auf der Kommunikationsebene geht. ı Aufgabe 6 (5 Punkte) Wie würden Sie ein Verschlüsselungsmodul in ein Funkgerät integrieren? Zeichnen Sie ein Blockschaltbild auf Modul-Ebene (Transmitter, Receiver, Verstärker ). Markieren Sie anschließend die Bereiche in denen der Datenfluss unverschlüsselt ist mit roter Farbe, Bereiche in denen die Daten verschlüsselt vorliegen sollen Schwarz markiert sein R&S Fallstudienwettbewerb
37 Security Verschlüsselung ı Lösung 6 Team Punkte R&S Fallstudienwettbewerb
38 Security Verschlüsselung ı Ein Verschlüsselungsmodul benötigt eine Schnittstelle zum Rest des Funkgerätes. ı Aufgabe 7 (5 Punkte) Erstellen Sie eine Schnittstellenbeschreibung. Beachten Sie, dass neben Sprache auch Daten verschlüsselt werden sollen. Es soll ebenfalls möglich sein Einstellungen wie Schlüssel oder Datenrate verstellen zu können. ı Lösung 7 Bezeichnung I/O Team Punkte Data In (black) (Receiver) Data Out (black) (Transmitter) Audio In (red) Audio Out (red) Data In (red) Data Out (red) Fill In (Keys) I O I O I O I/O Control Bus (Data / Adr. / Ctrl.) I/O R&S Fallstudienwettbewerb
39 Security Verschlüsselung Team Punkte ı Damit der Schlüssel im Funkgerät nicht an unberechtigte Personen gelangt ist es wichtig das Verschlüsselungsmodul vor Manipulation zu schützen. Aber auch das Schlüsselladegerät muss sicher sein. ı Aufgabe 8 (2 Punkte) Was für Mechanismen würden Sie wählen, damit unberechtigte Personen weder Zugang zu den Schlüsseln im Funkgerät noch zu denen am Schlüsselladegerät erhält? Beschreiben Sie wie der Schlüsselladevorgang mit den Mechanismen funktioniert R&S Fallstudienwettbewerb
40 Security Verschlüsselung ı Lösung 8 Team Punkte Schlüsselladegerät: Schlüssel sollten nur verschlüssel gespeichert werden. Zusätzlich gibt es an Schlüsselladegeräten sogenannte Cipher Ignition Keys mit denen das Gerät Freigeschaltet werden muss. Im COMSEC werden die Schlüssel entschlüsselt mit Hilfe eines Key Encryption Keys. Die Schlüssel werden unverschlüsselt abgelegt. Sollte jemand das COMSEC Modul ausbauen oder manipulieren wollen, sorgen Schutzschalter dafür, dass die Schlüssel gelöscht werden, bspw. Eine Schutzschaltung die sich durch das komplette Funkgerät zieht: wird ein Modul oder Deckel entfernt, werden sofort die Schlüssel gelöscht R&S Fallstudienwettbewerb
41 Security Verschlüsselung Team Punkte ı Teils gibt es sensible Anforderungen bzgl. Funkgerätezertifizierung. Beispielsweise können ohne direkten Kontakt zum Funkgerät Informationen gewonnen werden obwohl eine Verschlüsselung im Funkgerät stattfindet. Dazu werden hochsensible Geräte benötigt. ı Aufgabe 9 (2 Punkte) Auf was wird hier angespielt? Wie kann man ein Funkgerät gegenüber solchen Angriffen robuster machen? ı Lösung 9 Es wird auf TEMPEST oder offizielle Van-Eck-Phreaking angespielt. Dabei werden elektromagnetische Wellen, die das beobachtete Objekt abstrahlt aufgenommen und ausgewertet. Um ein Funkgerät gegen diese Attacke robust zu machen kommt eine Stromkompensation zum Einsatz. Dadurch wird das Phänomen der Abstrahlung stark gemildert R&S Fallstudienwettbewerb
42 Messplatz Teilaspekte des Systementwurfs Senderarchitektur und Verstärkerauswahl MUSTERLÖSUNG
43 Messplatz Aufgabe 1 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Überprüfen Sie die Einsatzmöglichkeit des Vorverstärkers im Sender! Messen Sie hierfür den Frequenzgang (Betrag) und den Verstärkungsfaktor: Stellen Sie die Signalleistung am Ausgang des Generators zunächst auf -20dBm. Der Messaufbau hat eine frequenzunabhängige Einfügedämpfung von 13dB. ı Welchen Betrag hat der maximale Verstärkungsfaktor? (2 Punkte) 24.3dB +/- 10% (22 26dB) ı Wie groß ist die Variation der Verstärkung über Frequenz maximal. (Im Frequenzbereich 100MHz 1GHz) (3 Punkte) 1.7dB +/- 15% (1.5 2dB) ı Ermitteln Sie den 1dB-Kompressionspunkt (P1dB) bei 160 MHz**! (6 Punkte) 18.5 dbm +/- 10% ( dbm) Für die Auswertung/Erfassung obiger Messungen nutzen Sie die Hilfsblätter auf den nächsten Folien R&S Fallstudienwettbewerb
44 1dB Kompression Hilfsblatt 30 OIP3 P1dB Pout /dbm Achtung! Die Leistung am Eingang des DUT darf -5dBm nicht überschreiten! Bis -5dBm (entspricht +1,5dBm am Generator) kann gefahrlos gearbeitet werden Pin /dbm R&S Fallstudienwettbewerb
45 Pegelplan Hilfsblatt VSWR 3 = 6dB return loss = 25% d. Leistung reflektiert, 75% d. Leistung abgestrahlt -10*log(0.75)= 1.25dB 1dB+1.25dB+0.75dB=3dB Digital + IF Block Upconverter Variable Attenuator Pre- Amp. (DUT) RF Switch Driver Amp. Power Amp. Harm. Filter. Directional Coupler UHF Ant MHz 54dBm radiated < VSWR 3 DAC LO Var. Att. >16 db db 38dB - 40dB NF=12dB 21dB - 23dB NF=6dB 17dB - 19dB NF=10dB 15dB - 18dB NF=10dB max. 1dB max. 1dB < VSWR 3 VHF Ant. 43dBm radiated -10 dbm nom. -12 dbm -2 dbm dbm Filter loss, Antenna mismatch + margin 0.75dB = -26 dbm 10 dbm dbm 3dB db dbm dbm R&S Fallstudienwettbewerb
46 Messplatz Aufgabe 2 (keine eigene Messung notwendig) Wie groß ist die nach Ihrem Pegelplan geforderte Leistung am Ausgang des Vorverstärkers (DUT) ı Minimal und -2dBm (+/-1dB wg. Rundungsfehlern) ı Maximal +10dBm (+/-1dB wg. Rundungsfehlern) Befindet sich diese auch unterhalb des P1dB? (5 Punkte) Ja (+10dBm vs. 18.5dBm), somit verwendbar Der sich aus der gemessenen Verstärkungsfaktoren (min./max.) und der notwendigen Ausgangsleistung ermittelte Dynamikbereich am Eingang des Vorverstärkers beträgt wie viel db? ı Wie groß muss daher das variable Dämpfungsglied davor mindestens gewählt >16dB Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 werden? (1 Punkt) ı Reicht bei gegebener Ausgangsleistung des Mischers die Verstärkung des Vorverstärkers in jedem Fall aus? (1 Punkte) Ja, (10dBm-22dB=-12dBm) R&S Fallstudienwettbewerb
47 Messplatz Aufgabe 3 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Eine wesentliche Verstärkereigenschaft ist dessen Verzerrungsverhalten. ı Ermitteln Sie den OIP3**** mit einem 2-Ton Testsignal***** bei 160MHz mit Tonabstand 10kHz. (4 Punkte) OIP3 = 25dBm Ergebnisse zwischen 20dBm und 28dBm sind okay, da sich je nach Messgenauigkeit große Streuungen ergeben können. Verifizieren Sie den Intermodulationsabstand 3. Ordnung (hier: Schulterabstand) mit dem FSW_WF1 Testsignal das sie bereits aus der Vorstudie kennen. ı Könnte ein Abstand von 50dB bei einer Ausgangsleistung von +10dBm eingehalten werden? Wie groß ist dieser? (2 Punkte) Nein, 44dB (Werte zwischen 40dB bis 49.5dB sind Okay) ı Deckt sich das Ergebnis mit Ihrer Erwartung aus dem Resultat der 2-Ton Messung? Falls dem nicht so ist: Worin sehen Sie die Ursache begründet? (2 Punkte) Nein, bei 2-Ton 51dB Ursache: Crest-Faktor, ggf. Bandbreite R&S Fallstudienwettbewerb
48 Messplatz Aufgabe 4 (keine eigene Messung notwendig) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 ı Wie groß darf das Rauschmaß des Vorverstärkers maximal sein, wenn das Rauschmaß des Senders im schlechtesten Fall 3dB nicht überschreiten soll? (3 Punkte) mit F1=? F2= 12dB -> lin 15,8 F3= 10dB -> lin 10 G1= 22dB -> lin 158,5 G2= 38dB -> lin 6310 vernachlässigbar F1= 1,99 0,09 = 1,9 NF1= 2,78dB R&S Fallstudienwettbewerb
ZHW, NTM, 2005/06, Rur 1. Übung 6: Funkkanal
 ZHW, NTM, 2005/06, Rur 1 Aufgabe 1: Strahlungsdiagramme. Übung 6: Funkkanal Gegeben sind die Strahlungsdiagramme des (λ/2-) Dipols und des (λ/4-) Monopols (Stabantenne auf einer Grundfläche). Welche Antenne
ZHW, NTM, 2005/06, Rur 1 Aufgabe 1: Strahlungsdiagramme. Übung 6: Funkkanal Gegeben sind die Strahlungsdiagramme des (λ/2-) Dipols und des (λ/4-) Monopols (Stabantenne auf einer Grundfläche). Welche Antenne
NTM1-Modul Zwischenprüfung
 ZHAW, ASV, HS2008, 1 NTM1-Modul Zwischenprüfung Name: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 Punkte Vorname: 1: 2: 3: 4: 5: 6. Punkte: Note: Teilaufgaben sind möglichst unabhängig gehalten. Benutzen sie immer die
ZHAW, ASV, HS2008, 1 NTM1-Modul Zwischenprüfung Name: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 Punkte Vorname: 1: 2: 3: 4: 5: 6. Punkte: Note: Teilaufgaben sind möglichst unabhängig gehalten. Benutzen sie immer die
NTM1-Modul Schlussprüfung
 ZHAW, NTM1, HS, 1 NTM1-Modul Schlussprüfung Name: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 Punkte Vorname: 1: 2: 3: 4: 5: 6. Punkte: Note: Teilaufgaben sind möglichst unabhängig gehalten. Benutzen sie immer die Vorgaben!
ZHAW, NTM1, HS, 1 NTM1-Modul Schlussprüfung Name: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 Punkte Vorname: 1: 2: 3: 4: 5: 6. Punkte: Note: Teilaufgaben sind möglichst unabhängig gehalten. Benutzen sie immer die Vorgaben!
Übung zu Drahtlose Kommunikation. 3. Übung
 Übung zu Drahtlose Kommunikation 3. Übung 05.11.2012 Einführung Aufgabe 1 2. Übungsblatt Abgabe: Sonntag, 12 Uhr https://svn.uni-koblenz.de/vnuml/drako/wise2012/exercises http://svn.uni-koblenz.de/~vnuml/drako/uebung/
Übung zu Drahtlose Kommunikation 3. Übung 05.11.2012 Einführung Aufgabe 1 2. Übungsblatt Abgabe: Sonntag, 12 Uhr https://svn.uni-koblenz.de/vnuml/drako/wise2012/exercises http://svn.uni-koblenz.de/~vnuml/drako/uebung/
Übung zu Drahtlose Kommunikation. 4. Übung
 Übung zu Drahtlose Kommunikation 4. Übung 12.11.2012 Aufgabe 1 Erläutern Sie die Begriffe Nah- und Fernfeld! Nahfeld und Fernfeld beschreiben die elektrischen und magnetischen Felder und deren Wechselwirkungen
Übung zu Drahtlose Kommunikation 4. Übung 12.11.2012 Aufgabe 1 Erläutern Sie die Begriffe Nah- und Fernfeld! Nahfeld und Fernfeld beschreiben die elektrischen und magnetischen Felder und deren Wechselwirkungen
Klirrfaktor Einstellung des NF Doppeltongenerators
 Klirrfaktor Einstellung des NF Doppeltongenerators Die im Bericht "NF Doppeltongenerator für IM 3 Messungen an SSB Sendern" (1) eingesetzten NF Generatoren müssen beide auf sehr geringen Klirrfaktor (Oberwellengehalt)
Klirrfaktor Einstellung des NF Doppeltongenerators Die im Bericht "NF Doppeltongenerator für IM 3 Messungen an SSB Sendern" (1) eingesetzten NF Generatoren müssen beide auf sehr geringen Klirrfaktor (Oberwellengehalt)
Messprotokoll / MEASUREMENT REPORT
 A n t e n n e n / A N T E N N A Messprotokoll / MEASUREMENT REPORT MEASURED PRODUCT Entkopplung zwischen zwei GSM-R-Antennen in Abhängigkeit des Abstandes zueinander Seite 1 von 7 Inhaltsverzeichnis 1.
A n t e n n e n / A N T E N N A Messprotokoll / MEASUREMENT REPORT MEASURED PRODUCT Entkopplung zwischen zwei GSM-R-Antennen in Abhängigkeit des Abstandes zueinander Seite 1 von 7 Inhaltsverzeichnis 1.
Aufbau und Betrieb einer kostengünstigen vollautomatischen S-Band Satelliten- Erdefunkstelle in urbaner Umgebung
 Aufbau und Betrieb einer kostengünstigen vollautomatischen S-Band Satelliten- Erdefunkstelle in urbaner Umgebung Dr. Werner Keim Prof. Dr. Arpad L. Scholtz EEEfCOM - 29. Juni 2006 Inhalt Erforderliche
Aufbau und Betrieb einer kostengünstigen vollautomatischen S-Band Satelliten- Erdefunkstelle in urbaner Umgebung Dr. Werner Keim Prof. Dr. Arpad L. Scholtz EEEfCOM - 29. Juni 2006 Inhalt Erforderliche
Diplomprüfungsklausur. Hochfrequenztechnik. 06. März 2003
 Diplomprüfungsklausur Hochfrequenztechnik 6. März 3 Erreichbare Punktzahl: Name: Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Platznummer: Aufgabe Punkte 3 4 5 6 7 8 9 Aufgabe (8 Punkte) Gegeben sei eine mit
Diplomprüfungsklausur Hochfrequenztechnik 6. März 3 Erreichbare Punktzahl: Name: Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Platznummer: Aufgabe Punkte 3 4 5 6 7 8 9 Aufgabe (8 Punkte) Gegeben sei eine mit
Ein (7,4)-Code-Beispiel
 Ein (7,4)-Code-Beispiel Generator-Polynom: P(X) = X 3 + X 2 + 1 Bemerkung: Es ist 7 = 2^3-1, also nach voriger Überlegung sind alle 1-Bit-Fehler korrigierbar Beachte auch d min der Codewörter ist 3, also
Ein (7,4)-Code-Beispiel Generator-Polynom: P(X) = X 3 + X 2 + 1 Bemerkung: Es ist 7 = 2^3-1, also nach voriger Überlegung sind alle 1-Bit-Fehler korrigierbar Beachte auch d min der Codewörter ist 3, also
Übung 5: MIMO und Diversity
 ZHAW WCOM2, Rumc, 1/6 Übung 5: MIMO und Diversity Aufgabe 1: SIMO-System bzw. Empfangsdiversität. In einem Empfänger mit 3 Antennen wird Selection Diversity eingesetzt. a) Bestimmen Sie die Verbesserung
ZHAW WCOM2, Rumc, 1/6 Übung 5: MIMO und Diversity Aufgabe 1: SIMO-System bzw. Empfangsdiversität. In einem Empfänger mit 3 Antennen wird Selection Diversity eingesetzt. a) Bestimmen Sie die Verbesserung
Pegelverhältnisse im Nahbereich von 2m-Contest-Stationen
 Pegelverhältnisse im Nahbereich von 2m-Contest-Stationen (Vortrag von DL1DQW anlässlich der Weihnachtsfeier 2010 des OV S04) Im Zusammenhang mit unseren 2m-Contest-Aktivitäten kam es in der Vergangenheit
Pegelverhältnisse im Nahbereich von 2m-Contest-Stationen (Vortrag von DL1DQW anlässlich der Weihnachtsfeier 2010 des OV S04) Im Zusammenhang mit unseren 2m-Contest-Aktivitäten kam es in der Vergangenheit
Abschlussprüfung Nachrichtentechnik 03. August 2015
 Abschlussprüfung Nachrichtentechnik 03. August 2015 Name:... Vorname:... Matrikelnr.:... Studiengang:... Aufgabe 1 2 3 4 Summe Note Punkte Hinweis: Die Teilaufgaben (a), (b) und (c) können unabhängig voneinander
Abschlussprüfung Nachrichtentechnik 03. August 2015 Name:... Vorname:... Matrikelnr.:... Studiengang:... Aufgabe 1 2 3 4 Summe Note Punkte Hinweis: Die Teilaufgaben (a), (b) und (c) können unabhängig voneinander
Optischer Rückkanalsender SSO 125. Systembeschreibung
 SSO 125 Systembeschreibung INHALTSVERZEICHNIS 1 DOKUMENT UND ÄNDERUNGSSTÄNDE 3 2 EINLEITUNG 4 3 TECHNISCHE BESCHREIBUNG 4 4 TECHNISCHE DATEN 6 4.1 Systemdaten 6 4.2 Elektrische Eingangsschnittstelle 6
SSO 125 Systembeschreibung INHALTSVERZEICHNIS 1 DOKUMENT UND ÄNDERUNGSSTÄNDE 3 2 EINLEITUNG 4 3 TECHNISCHE BESCHREIBUNG 4 4 TECHNISCHE DATEN 6 4.1 Systemdaten 6 4.2 Elektrische Eingangsschnittstelle 6
Dual-Mode-Kommunikationssysteme für Anwendungen im Auto?
 Dual-Mode-Kommunikationssysteme für Anwendungen im Auto? Von Prof. H. Heuermann 13.05.2010 Fachhochschule Aachen Prof. Heuermann Eupener Str. 70, 52066 Aachen Telefon +49 241 6009 52108, Telefax +49 241
Dual-Mode-Kommunikationssysteme für Anwendungen im Auto? Von Prof. H. Heuermann 13.05.2010 Fachhochschule Aachen Prof. Heuermann Eupener Str. 70, 52066 Aachen Telefon +49 241 6009 52108, Telefax +49 241
Anlage 2. BGBl. II - Ausgegeben am 11. Jänner Nr von 6
 BGBl. II - Ausgegeben am 11. Jänner 2012 - Nr. 12 1 von 6 Anlage 2 Ermittlung der Systemdämpfung 1. Allgemeines Die Systemdämpfung ist die Dämpfung des Funksignals bei Punkt - zu Punkt -Verbindungen zwischen
BGBl. II - Ausgegeben am 11. Jänner 2012 - Nr. 12 1 von 6 Anlage 2 Ermittlung der Systemdämpfung 1. Allgemeines Die Systemdämpfung ist die Dämpfung des Funksignals bei Punkt - zu Punkt -Verbindungen zwischen
Entwicklung des Hochfrequenzteils eines universellen Mobilfunk-Messsystems. Robert Langwieser, Gerhard Humer und Prof. Dr. Arpad L.
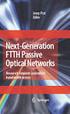 Entwicklung des Hochfrequenzteils eines universellen Mobilfunk-Messsystems Messsystems Robert Langwieser, Gerhard Humer und Prof. Dr. Arpad L. Scholtz EEEfCOM 2006, ULM Übersicht Anwendungs Szenarien Konzept
Entwicklung des Hochfrequenzteils eines universellen Mobilfunk-Messsystems Messsystems Robert Langwieser, Gerhard Humer und Prof. Dr. Arpad L. Scholtz EEEfCOM 2006, ULM Übersicht Anwendungs Szenarien Konzept
Dipl.-Ing. Kurt Graefe Hochfrequenztechnik Darmstädter Straße 230, Bensheim Tel /939817
 Echo-Detektor für Repeater in Gleichwellennetzen 1 Hintergrund 1.1 Gleichwellennetze (Single Frequency Networks, SFN) Die Ausstrahlung terrestrischer digitaler Rundfunk- und Fernsehsignale (DAB, DVB-T,
Echo-Detektor für Repeater in Gleichwellennetzen 1 Hintergrund 1.1 Gleichwellennetze (Single Frequency Networks, SFN) Die Ausstrahlung terrestrischer digitaler Rundfunk- und Fernsehsignale (DAB, DVB-T,
Nebenwellen Konverter a) gemessen mit Signal 50 MHz; 0 dbm am Eingang. Mischprodukt MHz. Frequenz. Pegel
 Selbstbauwettbewerb 2004 Großsignalfester 50 MHz/28 MHz Konverter/Transverter Dipl. Ing. Entwurfsziele: Konverter besteht aus zwei Baugruppen: Outdoor unit (Vorverstärker) indoor unit (Konverter) Erweiterung
Selbstbauwettbewerb 2004 Großsignalfester 50 MHz/28 MHz Konverter/Transverter Dipl. Ing. Entwurfsziele: Konverter besteht aus zwei Baugruppen: Outdoor unit (Vorverstärker) indoor unit (Konverter) Erweiterung
Raumwellen-Ausbreitungsprognosen des digital 11-Senders
 Raumwellen-Ausbreitungsprognosen des digital 11-Senders Friederike Maier, IKT, Leibniz Universität Hannover 9. September 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Sonnenecken 2 3 Raumwellenausbreitung 2
Raumwellen-Ausbreitungsprognosen des digital 11-Senders Friederike Maier, IKT, Leibniz Universität Hannover 9. September 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Sonnenecken 2 3 Raumwellenausbreitung 2
Tutorübung zur Vorlesung Grundlagen Rechnernetze und Verteilte Systeme Übungsblatt 3 (6. Mai 10. Mai 2013)
 Technische Universität München Lehrstuhl Informatik VIII Prof. Dr.-Ing. Georg Carle Dipl.-Ing. Stephan Günther, M.Sc. Nadine Herold, M.Sc. Dipl.-Inf. Stephan Posselt Tutorübung zur Vorlesung Grundlagen
Technische Universität München Lehrstuhl Informatik VIII Prof. Dr.-Ing. Georg Carle Dipl.-Ing. Stephan Günther, M.Sc. Nadine Herold, M.Sc. Dipl.-Inf. Stephan Posselt Tutorübung zur Vorlesung Grundlagen
Diplomprüfungsklausur. Hochfrequenztechnik. 04. August 2003
 Diplomprüfungsklausur Hochfrequenztechnik 4. August 23 Erreichbare Punktzahl: 1 Name: Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Platznummer: Aufgabe Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Aufgabe 1 Gegeben sei
Diplomprüfungsklausur Hochfrequenztechnik 4. August 23 Erreichbare Punktzahl: 1 Name: Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Platznummer: Aufgabe Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Aufgabe 1 Gegeben sei
Funknetzplanung. - Theorie und Praxis -
 - Theorie und Praxis - Wir bieten unseren Kunden im Vorfeld der Planung eines Datenfunknetzes an, Berechnungen der Funkstecken unter Berücksichtigung der topografischen Verhältnisse an. Als Grundlage für
- Theorie und Praxis - Wir bieten unseren Kunden im Vorfeld der Planung eines Datenfunknetzes an, Berechnungen der Funkstecken unter Berücksichtigung der topografischen Verhältnisse an. Als Grundlage für
NPR Rauschmessplatz von DC4KU
 NPR Rauschmessplatz von DC4KU Blockschaltbild White Generator P 1MHz HP-Filter 6MHz TP-Filter Notchfilter Level adjust 0...30dB Receiver under test ColibriNANO USB PC/Display P N =-80dBm/Hz B RF = 1...6MHz
NPR Rauschmessplatz von DC4KU Blockschaltbild White Generator P 1MHz HP-Filter 6MHz TP-Filter Notchfilter Level adjust 0...30dB Receiver under test ColibriNANO USB PC/Display P N =-80dBm/Hz B RF = 1...6MHz
Antennenrauschen im Kurzwellenbereich
 Antennenrauschen im Kurzwellenbereich Unter Funkamateuren wird häufig und auch kontrovers über das Thema "Rauschen von Antennen" diskutiert. Dabei lautet die Frage im Vordergrund meist: "Wie groß darf
Antennenrauschen im Kurzwellenbereich Unter Funkamateuren wird häufig und auch kontrovers über das Thema "Rauschen von Antennen" diskutiert. Dabei lautet die Frage im Vordergrund meist: "Wie groß darf
Inhaltsverzeichnis Einleitung Darstellung von Signalen und Spektren Aufbau und Signale eines Software Defined Radio -Systems
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung.................................. 1 1.1 Software Defined Radio-Systeme.................... 1 1.1.1 Verarbeitung imdigitalteil................... 2 1.1.2 Hardware und Software
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung.................................. 1 1.1 Software Defined Radio-Systeme.................... 1 1.1.1 Verarbeitung imdigitalteil................... 2 1.1.2 Hardware und Software
2.4 Hash-Prüfsummen Hash-Funktion message digest Fingerprint kollisionsfrei Einweg-Funktion
 2.4 Hash-Prüfsummen Mit einer Hash-Funktion wird von einer Nachricht eine Prüfsumme (Hash-Wert oder message digest) erstellt. Diese Prüfsumme besitzt immer die gleiche Länge unabhängig von der Länge der
2.4 Hash-Prüfsummen Mit einer Hash-Funktion wird von einer Nachricht eine Prüfsumme (Hash-Wert oder message digest) erstellt. Diese Prüfsumme besitzt immer die gleiche Länge unabhängig von der Länge der
Antennenrauschen im Kurzwellenbereich
 Antennenrauschen im Kurzwellenbereich Unter Funkamateuren wird häufig und auch kontrovers über das Thema "Rauschen von Antennen" diskutiert. Dabei lautet die Frage im Vordergrund meist: "Wie groß darf
Antennenrauschen im Kurzwellenbereich Unter Funkamateuren wird häufig und auch kontrovers über das Thema "Rauschen von Antennen" diskutiert. Dabei lautet die Frage im Vordergrund meist: "Wie groß darf
Aufgabe 1 - Pegelrechnung und LTI-Systeme
 KLAUSUR Nachrichtentechnik 06.08.0 Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. G. Fettweis Dauer: 0 min. Aufgabe 3 4 Punkte 5 0 4 50 Aufgabe - Pegelrechnung und LTI-Systeme Hinweis: Die Teilaufgaben (a), (b) und (c) können
KLAUSUR Nachrichtentechnik 06.08.0 Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. G. Fettweis Dauer: 0 min. Aufgabe 3 4 Punkte 5 0 4 50 Aufgabe - Pegelrechnung und LTI-Systeme Hinweis: Die Teilaufgaben (a), (b) und (c) können
Übung 4: Physical layer and limits
 Wintersemester 217/218 Rechnernetze Universität Paderborn Fachgebiet Rechnernetze Übung 4: Physical layer and limits 217-11-3 1. Basisband/Breitband Diese Aufgabe soll den Unterschied zwischen Basisband-
Wintersemester 217/218 Rechnernetze Universität Paderborn Fachgebiet Rechnernetze Übung 4: Physical layer and limits 217-11-3 1. Basisband/Breitband Diese Aufgabe soll den Unterschied zwischen Basisband-
Aufgaben für den Messplatz. Charakterisierung zweier Wellenform-Kandidaten für einen zukünftigen Flugsicherungsstandard
 Aufgaben für den Messplatz Charakterisierung zweier Wellenform-Kandidaten für einen zukünftigen Flugsicherungsstandard Messplatz Einrichtung Geräte: SMU 200 A 10 N-Kabel Vektorieller Signalgenerator SMU
Aufgaben für den Messplatz Charakterisierung zweier Wellenform-Kandidaten für einen zukünftigen Flugsicherungsstandard Messplatz Einrichtung Geräte: SMU 200 A 10 N-Kabel Vektorieller Signalgenerator SMU
0 bis. 62,5MHz 1. NQZ 2. NQZ 3. NQZ
 Red Pitaya als SHF Nachsetzer oder als m Transceiver Bedingt durch die Abtastfrequenz des RP vonn 5MHz ergeben sich folgende f Nyquistzonen:. NQZ. NQZ. NQZ bis 6,5MHz 6,5 bis 5MHzz 5 bis 87,5MHz Der Frequenzbereich
Red Pitaya als SHF Nachsetzer oder als m Transceiver Bedingt durch die Abtastfrequenz des RP vonn 5MHz ergeben sich folgende f Nyquistzonen:. NQZ. NQZ. NQZ bis 6,5MHz 6,5 bis 5MHzz 5 bis 87,5MHz Der Frequenzbereich
Fachprüfung. Mobile Communication
 Fachprüfung Mobile Communication 5. September 005 Prüfer: Prof. Dr. P. Pogatzki Bearbeitungszeit: Stunden Hilfsmittel: Nichtprogrammierbarer Taschenrechner Name:... Matr.-Nr.:... Unterschrift:... Punkte
Fachprüfung Mobile Communication 5. September 005 Prüfer: Prof. Dr. P. Pogatzki Bearbeitungszeit: Stunden Hilfsmittel: Nichtprogrammierbarer Taschenrechner Name:... Matr.-Nr.:... Unterschrift:... Punkte
FM Funksystem TSQ - HB9W
 FM Funksystem TSQ - HB9W 1 TSQ Einführung FM Simplex/Relais Funk System Einführung in die TSQ-Technik, Geräte und Anwendungen Vortrag HB9W 01. April 2015 Version 1.04 HB9SJE, Axel 2 TSQ Grundzüge Was ist
FM Funksystem TSQ - HB9W 1 TSQ Einführung FM Simplex/Relais Funk System Einführung in die TSQ-Technik, Geräte und Anwendungen Vortrag HB9W 01. April 2015 Version 1.04 HB9SJE, Axel 2 TSQ Grundzüge Was ist
MSW-4/2 MKII QUAD VOCAL SYSTEM DRAHTLOSES VOCAL SYSTEM MIT 4 HANDSENDERN/ EMPFÄNGERN UND LCD DISPLAY
 MSW-4/2 MKII QUAD VOCAL SYSTEM DRAHTLOSES VOCAL SYSTEM MIT 4 HANDSENDERN/ EMPFÄNGERN UND LCD DISPLAY Bedienungsanleitung Inhaltsangabe 1. Features 2. Empfänger 3. Sender 4. Bedienung des Empfängers 5.
MSW-4/2 MKII QUAD VOCAL SYSTEM DRAHTLOSES VOCAL SYSTEM MIT 4 HANDSENDERN/ EMPFÄNGERN UND LCD DISPLAY Bedienungsanleitung Inhaltsangabe 1. Features 2. Empfänger 3. Sender 4. Bedienung des Empfängers 5.
Wie groß sind die Pegelunterschiede an einer Mobilfunk Basisstation durch gleiche Mobilteile in 20 m und 2000 m Freiraum Entfernung?
 Komponenten für die drahtlose Kommunikation /Teil Solbach 1. Übungsaufgabe Vergleichen Sie die Übertragungsdämpfung D einer Koaxial Leitung mit der einer dielektrischen Leitung und mit einer Funkübertragung,
Komponenten für die drahtlose Kommunikation /Teil Solbach 1. Übungsaufgabe Vergleichen Sie die Übertragungsdämpfung D einer Koaxial Leitung mit der einer dielektrischen Leitung und mit einer Funkübertragung,
Übung 4. Tutorübung zu Grundlagen: Rechnernetze und Verteilte Systeme (Gruppen Mo-T1 / Di-T11 SS 2016) Dennis Fischer
 Übung 4 Tutorübung zu Grundlagen: Rechnernetze und Verteilte Systeme (Gruppen Mo-T1 / Di-T11 SS 2016) Dennis Fischer Technische Universität München Fakultät für Informatik 09.05.2016 / 10.05.2016 1/12
Übung 4 Tutorübung zu Grundlagen: Rechnernetze und Verteilte Systeme (Gruppen Mo-T1 / Di-T11 SS 2016) Dennis Fischer Technische Universität München Fakultät für Informatik 09.05.2016 / 10.05.2016 1/12
GPS (Global Positioning System)
 GPS (Global Positioning System) HF-Praktikum Referat von : Sabine Sories Thomas Schmitz Tobias Weling Inhalt: - Geschichte - Prinzip - Fehlerquellen - Zukünftige Systeme 1 GPS (Global Positioning System)
GPS (Global Positioning System) HF-Praktikum Referat von : Sabine Sories Thomas Schmitz Tobias Weling Inhalt: - Geschichte - Prinzip - Fehlerquellen - Zukünftige Systeme 1 GPS (Global Positioning System)
Amateur Fernsehen. im Bereich
 Amateur Fernsehen im Bereich 6cm, 5.65-5.85 GHz Projekt 6cm FM-ATV Beim Stöbern im Internet stieß ich auf Komponenten aus dem Modellbaubereich, welche in mir den Drang weckten, diese in irgend einer Form
Amateur Fernsehen im Bereich 6cm, 5.65-5.85 GHz Projekt 6cm FM-ATV Beim Stöbern im Internet stieß ich auf Komponenten aus dem Modellbaubereich, welche in mir den Drang weckten, diese in irgend einer Form
Diplomprüfungsklausur. Hochfrequenztechnik I/II. 29. September 2003
 Diplomprüfungsklausur Hochfrequenztechnik I/II 29. September 2003 Erreichbare Punktzahl: 100 Name: Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Platznummer: Aufgabe Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aufgabe
Diplomprüfungsklausur Hochfrequenztechnik I/II 29. September 2003 Erreichbare Punktzahl: 100 Name: Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Platznummer: Aufgabe Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aufgabe
Messung des Seitenbandrauschen (SBN) eines SSB-Empfängers
 Messung des Seitenbandrauschen (SBN) eines SSB-Empfängers 1. Phasen- und Amplitudenrauschen Kein elektronisches Bauteil ist frei von stochastischem Rauschen. Auch jeder Oszillator endlicher Güte und Bandbreite
Messung des Seitenbandrauschen (SBN) eines SSB-Empfängers 1. Phasen- und Amplitudenrauschen Kein elektronisches Bauteil ist frei von stochastischem Rauschen. Auch jeder Oszillator endlicher Güte und Bandbreite
Modulation. Demodulation. N-ary modulation scheme: number of different symbols! i.e., this can convey log(n) Bits per symbol
 Terminology Modulation 1011 Demodulation Bit(s) Symbol Data rate: Number of Bits per seconds Symbol rate: Number of Symbols per second N-ary modulation scheme: number of different symbols! i.e., this can
Terminology Modulation 1011 Demodulation Bit(s) Symbol Data rate: Number of Bits per seconds Symbol rate: Number of Symbols per second N-ary modulation scheme: number of different symbols! i.e., this can
Übungen zur Einführung in die Astrophysik I. Musterlösung Blatt 2
 Übungen zur Einführung in die Astrophysik I Musterlösung Blatt 2 Aufgabe 1(a) Das Gravitationspotential der Erde ist ein Zentralpotential. Es gilt somit: γ Mm r 2 = m v2 r wobei γ die Gravitationskonstante,
Übungen zur Einführung in die Astrophysik I Musterlösung Blatt 2 Aufgabe 1(a) Das Gravitationspotential der Erde ist ein Zentralpotential. Es gilt somit: γ Mm r 2 = m v2 r wobei γ die Gravitationskonstante,
UMTS Planung u. Optimierung Festnetz u. Funknetz
 UMTS Planung u. Optimierung Festnetz u. Funknetz Teil 1 Funknetzplanung u. optimierung Dipl.-Ing. Wolfgang Thöing Vodafone D2 GmbH Niederlassung Nord-West Grundlagen UMTS Globaler Standard UMTS ist ein
UMTS Planung u. Optimierung Festnetz u. Funknetz Teil 1 Funknetzplanung u. optimierung Dipl.-Ing. Wolfgang Thöing Vodafone D2 GmbH Niederlassung Nord-West Grundlagen UMTS Globaler Standard UMTS ist ein
Vorlage für Expertinnen und Experten
 2010 Qualifikationsverfahren Multimediaelektroniker / Multimediaelektronikerin Berufskenntnisse schriftlich Basiswissen EMPFANG / ÜBERTRAGUNG Vorlage für Expertinnen und Experten Zeit 120 Minuten für alle
2010 Qualifikationsverfahren Multimediaelektroniker / Multimediaelektronikerin Berufskenntnisse schriftlich Basiswissen EMPFANG / ÜBERTRAGUNG Vorlage für Expertinnen und Experten Zeit 120 Minuten für alle
Workshop BDBOS Technische Punkte
 Workshop BDBOS Technische Punkte Berlin, 06.10.2015 BDBOS, Referat Objektversorgung TII4 Berechnung des Rauscheintrages (Grundlagen) Empfindlichkeit der TBS./. TMO-Repeater Simple Formel mit vorhandenen
Workshop BDBOS Technische Punkte Berlin, 06.10.2015 BDBOS, Referat Objektversorgung TII4 Berechnung des Rauscheintrages (Grundlagen) Empfindlichkeit der TBS./. TMO-Repeater Simple Formel mit vorhandenen
Wireless LAN Meßverfahren
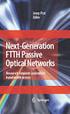 Wireless LAN 802.11 Meßverfahren Ad-hoc-Netzwerke für mobile Anlagen und Systeme 199. PTB-Seminar und Diskussionssitzung FA 9.1 Meßverfahren der Informationstechnik Berlin, 3. - 4.11.2004 Martin Weiß Rohde
Wireless LAN 802.11 Meßverfahren Ad-hoc-Netzwerke für mobile Anlagen und Systeme 199. PTB-Seminar und Diskussionssitzung FA 9.1 Meßverfahren der Informationstechnik Berlin, 3. - 4.11.2004 Martin Weiß Rohde
Systeme II 2. Die physikalische Schicht
 Systeme II 2. Die physikalische Schicht Christian Schindelhauer Technische Fakultät Rechnernetze und Telematik Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Version 14.05.2014 1 Raum Raumaufteilung (Space- Multiplexing)
Systeme II 2. Die physikalische Schicht Christian Schindelhauer Technische Fakultät Rechnernetze und Telematik Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Version 14.05.2014 1 Raum Raumaufteilung (Space- Multiplexing)
Technischer Anhang. Optische Komponenten
 Allgemeines Bei den optischen Abzweigern (BOC xxx) und optischen Verteilern (BOV xxx) wird die gleiche Terminologie verwendet, wie bei den elektrischen CATV-Abzweigern und Verteilern. Die Begriffe beziehen
Allgemeines Bei den optischen Abzweigern (BOC xxx) und optischen Verteilern (BOV xxx) wird die gleiche Terminologie verwendet, wie bei den elektrischen CATV-Abzweigern und Verteilern. Die Begriffe beziehen
Infoblatt der Firma Lixnet AG
 Infoblatt der Firma Lixnet AG 2018 Allgemeine Informationen zur Funktechnik Die Hochfrequenzfunktechnik überträgt das Signal über ein Trägersignal (elektromagnetisch). Bei der Kanalbandbreite wird in den
Infoblatt der Firma Lixnet AG 2018 Allgemeine Informationen zur Funktechnik Die Hochfrequenzfunktechnik überträgt das Signal über ein Trägersignal (elektromagnetisch). Bei der Kanalbandbreite wird in den
Großsignalfestigkeit eines SDR Receivers
 Großsignalfestigkeit eines SDR Receivers Messung kritischer Spezifikationen eines SDR Receivers HF Eingang DX Patrol 100kHz 2GHz Blockschaltbild Nachfolgend soll die Großsignalfestigkeit eines SDR Receiver
Großsignalfestigkeit eines SDR Receivers Messung kritischer Spezifikationen eines SDR Receivers HF Eingang DX Patrol 100kHz 2GHz Blockschaltbild Nachfolgend soll die Großsignalfestigkeit eines SDR Receiver
Der Baken-Empfänger HB9AW
 Der Baken-Empfänger HB9AW Entwicklungsbericht und Spezifikationen Stand: 20.11.2015 Hans Zahnd, HB9CBU Hardware Für den Empfang mit automatischer Feldstärkeregistrierung der Bake HB9AW im 60m-Band ist
Der Baken-Empfänger HB9AW Entwicklungsbericht und Spezifikationen Stand: 20.11.2015 Hans Zahnd, HB9CBU Hardware Für den Empfang mit automatischer Feldstärkeregistrierung der Bake HB9AW im 60m-Band ist
2 Grundlagen e lektromagnetischer Felder
 2 Grundlagen elektromagnetischer Felder 9 2 Grundlagen e lektromagnetischer Felder Seit mehr als 100 Jahren nutzt der Mensch nun schon elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder für sehr viele
2 Grundlagen elektromagnetischer Felder 9 2 Grundlagen e lektromagnetischer Felder Seit mehr als 100 Jahren nutzt der Mensch nun schon elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder für sehr viele
AM-Mod-Begrenzer Oberwellen wie bei der FM-Hubbegrenzung erhöhten NF-Pegel einspeisen und Modulationsgrad messen. Albrecht Funkgeräte sollten dabei mi
 AM-Mod-Begrenzer Oberwellen wie bei der FM-Hubbegrenzung erhöhten NF-Pegel einspeisen und Modulationsgrad messen. Albrecht Funkgeräte sollten dabei mindestens 80 % Modulationsgrad erreichen, aber nicht
AM-Mod-Begrenzer Oberwellen wie bei der FM-Hubbegrenzung erhöhten NF-Pegel einspeisen und Modulationsgrad messen. Albrecht Funkgeräte sollten dabei mindestens 80 % Modulationsgrad erreichen, aber nicht
GPS System. NAVSTAR-System besteht aus 3 Komponenten. Geschichte Grundfunktion Wie funktioniert GPS?
 GPS System Gliederung Die Position der Satelliten Die Zeit ist das Wesentliche Die eigentliche Positionenbestimmung Was ist GPS? Geschichte Grundfunktion Wie funktioniert GPS? Eingeschränkte Signale Mögliche
GPS System Gliederung Die Position der Satelliten Die Zeit ist das Wesentliche Die eigentliche Positionenbestimmung Was ist GPS? Geschichte Grundfunktion Wie funktioniert GPS? Eingeschränkte Signale Mögliche
Diplomprüfungsklausur. Hochfrequenztechnik I/II. 19. Juli 1999
 Diplomprüfungsklausur Hochfrequenztechnik I/II 19. Juli 1999 Erreichbare Punktzahl: 100 Name: Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Platznummer: Aufgabe Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aufgabe 1 (8
Diplomprüfungsklausur Hochfrequenztechnik I/II 19. Juli 1999 Erreichbare Punktzahl: 100 Name: Vorname: Matrikelnummer: Fachrichtung: Platznummer: Aufgabe Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aufgabe 1 (8
Systeme II. Christian Schindelhauer Sommersemester Vorlesung
 Systeme II Christian Schindelhauer Sommersemester 2006 6. Vorlesung 11.04.2006 schindel@informatik.uni-freiburg.de 1 Das elektromagnetische Spektrum leitungsgebundene Übertragungstechniken verdrillte DrähteKoaxialkabel
Systeme II Christian Schindelhauer Sommersemester 2006 6. Vorlesung 11.04.2006 schindel@informatik.uni-freiburg.de 1 Das elektromagnetische Spektrum leitungsgebundene Übertragungstechniken verdrillte DrähteKoaxialkabel
WLAN & Sicherheit IEEE
 WLAN & Sicherheit IEEE 802.11 Präsentation von Petar Knežić & Rafael Rutkowski Verbundstudium TBW Informations- und Kommunikationssysteme Sommersemester 2007 Inhalt Grundlagen IEEE 802.11 Betriebsarten
WLAN & Sicherheit IEEE 802.11 Präsentation von Petar Knežić & Rafael Rutkowski Verbundstudium TBW Informations- und Kommunikationssysteme Sommersemester 2007 Inhalt Grundlagen IEEE 802.11 Betriebsarten
GPS Global Positioning System
 GPS Global Positioning System Fast jeder kennt es, viele benutzen es bereits. 12.05.2011 Radtouren in Zeiten des Internets 1 Was ist GPS? GPS (Global Positioning System) 3D Positionsbestimmung durch Laufzeitmessung
GPS Global Positioning System Fast jeder kennt es, viele benutzen es bereits. 12.05.2011 Radtouren in Zeiten des Internets 1 Was ist GPS? GPS (Global Positioning System) 3D Positionsbestimmung durch Laufzeitmessung
Klausur zur Digitalen Kommunikationstechnik
 Klausur zur Digitalen Kommunikationstechnik Prof. Dr. Henrik Schulze, Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede 17. Januar 014 Die Klausur dauert 10 Minuten. Insgesamt sind 48 Punkte erreichbar. Erlaubte
Klausur zur Digitalen Kommunikationstechnik Prof. Dr. Henrik Schulze, Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede 17. Januar 014 Die Klausur dauert 10 Minuten. Insgesamt sind 48 Punkte erreichbar. Erlaubte
HAMNET- Highspeed Amateurradio Mutimedia Network
 HAMNET- Highspeed Amateurradio Mutimedia Network Funkfeldbetrachtung für Links: DB0FOR DB0UB DB0ADB DB0ABC- DO0ET- DB0BGK. Version 7.0 vom 15. Juli 2010 DC1NF mit Korr. von DB2FB (Standortdaten DB0ADS).
HAMNET- Highspeed Amateurradio Mutimedia Network Funkfeldbetrachtung für Links: DB0FOR DB0UB DB0ADB DB0ABC- DO0ET- DB0BGK. Version 7.0 vom 15. Juli 2010 DC1NF mit Korr. von DB2FB (Standortdaten DB0ADS).
MHz sind verglichen mit der Wellenlänge von m die Welche der aufgelisteten Frequenzen liegt im 15m Amateurfunkband?
 1. Was versteht man unter Spannungsabfall? Restspannung einer entladenen Batterie. Ein mehr oder weniger grosser Spannungsverlust, der nicht mit dem ohmschen Gesetz erklärt werden kann. c) Man bezeichnet
1. Was versteht man unter Spannungsabfall? Restspannung einer entladenen Batterie. Ein mehr oder weniger grosser Spannungsverlust, der nicht mit dem ohmschen Gesetz erklärt werden kann. c) Man bezeichnet
*DE A *
 (19) *DE102017203993A120180913* (10) (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2017 203 993.0 (22) Anmeldetag: 10.03.2017 (43) Offenlegungstag: 13.09.2018 (71) Anmelder: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
(19) *DE102017203993A120180913* (10) (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2017 203 993.0 (22) Anmeldetag: 10.03.2017 (43) Offenlegungstag: 13.09.2018 (71) Anmelder: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
WCOM2-Zwischenprüfung
 ZHAW, Rumc, 1 WCOM2-Zwischenprüfung 24 Punkte Name: Vorname: 1: 2: 3: 4: 5: Punkte: Note: Achtung: Bitte begründen Sie jede Antwort kurz, es gibt sonst keine Punkte. Aufgabe 1: Zellularfunk. 5 Punkte Ein
ZHAW, Rumc, 1 WCOM2-Zwischenprüfung 24 Punkte Name: Vorname: 1: 2: 3: 4: 5: Punkte: Note: Achtung: Bitte begründen Sie jede Antwort kurz, es gibt sonst keine Punkte. Aufgabe 1: Zellularfunk. 5 Punkte Ein
9. Einführung in die Kryptographie
 9. Einführung in die Kryptographie Grundidee: A sendet Nachricht nach B über unsicheren Kanal. Es soll verhindert werden, dass ein Unbefugter Kenntnis von der übermittelten Nachricht erhält. Grundbegriffe:
9. Einführung in die Kryptographie Grundidee: A sendet Nachricht nach B über unsicheren Kanal. Es soll verhindert werden, dass ein Unbefugter Kenntnis von der übermittelten Nachricht erhält. Grundbegriffe:
Welcome to PHOENIX CONTACT
 Welcome to PHOENIX CONTACT Wireless in der Praxis Die Antenne - eine oft unterschätzte Baugruppe Wireless in der Automation Automatische Sicherungsmechanismen gewährleisten bei Funkverbindungen, dass keine
Welcome to PHOENIX CONTACT Wireless in der Praxis Die Antenne - eine oft unterschätzte Baugruppe Wireless in der Automation Automatische Sicherungsmechanismen gewährleisten bei Funkverbindungen, dass keine
Übung zu Drahtlose Kommunikation. 6. Übung
 Übung zu Drahtlose Kommunikation 6. Übung 26.11.2012 Aufgabe 1 (Multiplexverfahren) Erläutern Sie mit wenigen Worten die einzelnen Multiplexverfahren und nennen Sie jeweils ein Einsatzgebiet/-möglichkeit,
Übung zu Drahtlose Kommunikation 6. Übung 26.11.2012 Aufgabe 1 (Multiplexverfahren) Erläutern Sie mit wenigen Worten die einzelnen Multiplexverfahren und nennen Sie jeweils ein Einsatzgebiet/-möglichkeit,
Der ideale Op-Amp 2. Roland Küng, 2009
 Der ideale Op-Amp 2 Roland Küng, 2009 Reiew Reiew o f(, 2 ) L: o /2 + 2 Strom-Spannungswandler Photodiode liefert Strom proportional zur Lichtmenge Einfachstes Ersatzbild: Stromquelle V out -R 2 i in Anwendung:
Der ideale Op-Amp 2 Roland Küng, 2009 Reiew Reiew o f(, 2 ) L: o /2 + 2 Strom-Spannungswandler Photodiode liefert Strom proportional zur Lichtmenge Einfachstes Ersatzbild: Stromquelle V out -R 2 i in Anwendung:
3 Interpretation wichtiger Messergebnisse von Empfängern, Sendern und Transceivern
 3 wichtiger Messergebnisse von Empfängern, Sendern und Transceivern 3.1 Vorbemerkung Das beste Messergebnis nützt nichts, wenn man es nicht bewerten kann. Welches Ergebnis ist schlecht, welches gut? Die
3 wichtiger Messergebnisse von Empfängern, Sendern und Transceivern 3.1 Vorbemerkung Das beste Messergebnis nützt nichts, wenn man es nicht bewerten kann. Welches Ergebnis ist schlecht, welches gut? Die
Funkauslesung bedenkenlos einsetzen. Qivalo Know-How
 Funkauslesung bedenkenlos einsetzen Qivalo Know-How 2 FUNKAULESUNG BEDENKENLOS EINSETZEN Seit Jahren befassen sich diverse Wissenschaftler mit den möglichen Gefahren von Funkwellen und Strahlungen. Tests
Funkauslesung bedenkenlos einsetzen Qivalo Know-How 2 FUNKAULESUNG BEDENKENLOS EINSETZEN Seit Jahren befassen sich diverse Wissenschaftler mit den möglichen Gefahren von Funkwellen und Strahlungen. Tests
ImmersionRC HF-Leistungsmesser Bedienungsanleitung. Oktober 2013 Ausgabe, (vorläufig) ImmersionRC ImmersionRC HF- Leistungsmesser
 ImmersionRC HF- Bedienungsanleitung Oktober 2013 Ausgabe, (vorläufig) Überblick Der ImmersionRC HF- ist ein Handgerät, unabhängiges HF Leistungsmessgerät für Signale im 1MHz-8GHz Bereich, mit einer Leistungsstufe
ImmersionRC HF- Bedienungsanleitung Oktober 2013 Ausgabe, (vorläufig) Überblick Der ImmersionRC HF- ist ein Handgerät, unabhängiges HF Leistungsmessgerät für Signale im 1MHz-8GHz Bereich, mit einer Leistungsstufe
Übung zu Drahtlose Kommunikation. 2. Übung
 Übung zu Drahtlose Kommunikation 2. Übung 29.10.2012 Termine Übungen wöchentlich, Montags 15 Uhr (s.t.), Raum B 016 Jede Woche 1 Übungsblatt http://userpages.uni-koblenz.de/~vnuml/drako/uebung/ Bearbeitung
Übung zu Drahtlose Kommunikation 2. Übung 29.10.2012 Termine Übungen wöchentlich, Montags 15 Uhr (s.t.), Raum B 016 Jede Woche 1 Übungsblatt http://userpages.uni-koblenz.de/~vnuml/drako/uebung/ Bearbeitung
Zentralabitur 2008 Physik Schülermaterial Aufgabe II ea Bearbeitungszeit: 300 min
 Thema: Experimente mit Interferometern Im Mittelpunkt der in den Aufgaben 1 und 2 angesprochenen Fragestellungen steht das Michelson-Interferometer. Es werden verschiedene Interferenzversuche mit Mikrowellen
Thema: Experimente mit Interferometern Im Mittelpunkt der in den Aufgaben 1 und 2 angesprochenen Fragestellungen steht das Michelson-Interferometer. Es werden verschiedene Interferenzversuche mit Mikrowellen
Richtfunk. als Ergänzung zur Glasfaser im Breitbandausbau
 Richtfunk als Ergänzung zur Glasfaser im Breitbandausbau Hochschule RheinMain Oliver Meffert 08.05. 2015 Agenda Die Herausforderung Lösungsansatz Systemtechnik 2 Die Herausforderung 4 5 Wozu Breitband
Richtfunk als Ergänzung zur Glasfaser im Breitbandausbau Hochschule RheinMain Oliver Meffert 08.05. 2015 Agenda Die Herausforderung Lösungsansatz Systemtechnik 2 Die Herausforderung 4 5 Wozu Breitband
NWT2.0 zur PC-Software, Kalibrierung. Andreas Lindenau DL4JAL
 NWT2.0 zur PC-Software, Kalibrierung Andreas Lindenau DL4JAL 11. November 2018 Inhaltsverzeichnis 1 Kalibrierung des NWT2 2 1.1 PowerON............................... 2 1.2 Starten der SW............................
NWT2.0 zur PC-Software, Kalibrierung Andreas Lindenau DL4JAL 11. November 2018 Inhaltsverzeichnis 1 Kalibrierung des NWT2 2 1.1 PowerON............................... 2 1.2 Starten der SW............................
Rechenübung HFT I. Antennen
 Rechenübung HFT I Antennen Allgemeines zu Antennen Antennen ermöglichen den Übergang zwischen der leitungsgebundenen Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und der Wellenausbreitung im freien Raum Allgemeines
Rechenübung HFT I Antennen Allgemeines zu Antennen Antennen ermöglichen den Übergang zwischen der leitungsgebundenen Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und der Wellenausbreitung im freien Raum Allgemeines
Funktechniken. Aktuelle Funktechniken
 Funktechniken Ein Überblick Walter Berner Landesanstalt für Kommunikation Rottenburg-Baisingen 14. Mai 2009 Aktuelle Funktechniken Satellit WiMAX Mobilfunk GSM UMTS LTE Digitale Dividende Warum so viele?
Funktechniken Ein Überblick Walter Berner Landesanstalt für Kommunikation Rottenburg-Baisingen 14. Mai 2009 Aktuelle Funktechniken Satellit WiMAX Mobilfunk GSM UMTS LTE Digitale Dividende Warum so viele?
1.1. Netzwerkstatus insgesamt
 Es handelt sich hier um ein Beispiel einer Funkvermessung, daher wurde als Firma die Funkwerk Enterprise Communications GmbH eingesetzt. Echte Berichte über eine Funkvermessung sind sehr viel umfangreicher
Es handelt sich hier um ein Beispiel einer Funkvermessung, daher wurde als Firma die Funkwerk Enterprise Communications GmbH eingesetzt. Echte Berichte über eine Funkvermessung sind sehr viel umfangreicher
Grundlagen der Nachrichtentechnik
 Universität Bremen Arbeitsbereich Nachrichtentechnik Prof. Dr.-Ing. A. Dekorsy Schriftliche Prüfung im Fach Grundlagen der Nachrichtentechnik Name: Vorname: Mat.-Nr.: BSc./Dipl.: Zeit: Ort: Umfang: 07.
Universität Bremen Arbeitsbereich Nachrichtentechnik Prof. Dr.-Ing. A. Dekorsy Schriftliche Prüfung im Fach Grundlagen der Nachrichtentechnik Name: Vorname: Mat.-Nr.: BSc./Dipl.: Zeit: Ort: Umfang: 07.
ANHANG. Fragen und Antworten zu den Themen LPD (Low Power Device) FreeNet PMR 446
 Relaiskarte DL 2-m-Band Relaiskarte DL 70-cm-Band Relaiskarte DL 23-cm-Band Relaiskarte EU 10-m-Band Locatorkarte EU Bandplan DL Tabelle S-Wert, Leistungen und Spannungen an 50 Ohm Koaxkabel-Übersicht
Relaiskarte DL 2-m-Band Relaiskarte DL 70-cm-Band Relaiskarte DL 23-cm-Band Relaiskarte EU 10-m-Band Locatorkarte EU Bandplan DL Tabelle S-Wert, Leistungen und Spannungen an 50 Ohm Koaxkabel-Übersicht
NPR Rauschmessplatz von DC4KU
 NPR Rauschmessplatz von DC4KU Blockschaltbild White Generator P 1MHz HP-Filter 6MHz TP-Filter Notchfilter Level adjust 0...30dB Receiver under test ColibriNANO USB PC/Display P N =-80dBm/Hz B RF = 1...6MHz
NPR Rauschmessplatz von DC4KU Blockschaltbild White Generator P 1MHz HP-Filter 6MHz TP-Filter Notchfilter Level adjust 0...30dB Receiver under test ColibriNANO USB PC/Display P N =-80dBm/Hz B RF = 1...6MHz
Ansätze zur Reduzierung der Schallemission bei der akustischen Unterwasserkommunikation
 Ansätze zur Reduzierung der Schallemission bei der akustischen Unterwasserkommunikation Peter A. Höher Christian-Albrechts- ph@tf.uni-kiel.de www-ict.tf.uni-kiel.de 2. Kieler Marktplatz: Lärm im Meer IHK
Ansätze zur Reduzierung der Schallemission bei der akustischen Unterwasserkommunikation Peter A. Höher Christian-Albrechts- ph@tf.uni-kiel.de www-ict.tf.uni-kiel.de 2. Kieler Marktplatz: Lärm im Meer IHK
Immersionflug 2.4Ghz Video System. Mini A/V Sender:
 Immersionflug 2.4Ghz Video System Inhaltsverzeichnis 1. Spezifikation... 1 2. Kanal Einstellung für TX... 3 2.1 PIN Belegung des Steckers... 3 3. Troubleshooting / Fehlerbehandlung... 3 4. Häufig gestellte
Immersionflug 2.4Ghz Video System Inhaltsverzeichnis 1. Spezifikation... 1 2. Kanal Einstellung für TX... 3 2.1 PIN Belegung des Steckers... 3 3. Troubleshooting / Fehlerbehandlung... 3 4. Häufig gestellte
SCS-Verzeichnis Akkreditierungsnummer: SCS 0086
 Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2005 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2005 Electrosuisse Montena EMC Route de Montena 75 1728 Rossens FR Leiter: Christophe Perrenoud MS-Verantwortlicher: Jacques
Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2005 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2005 Electrosuisse Montena EMC Route de Montena 75 1728 Rossens FR Leiter: Christophe Perrenoud MS-Verantwortlicher: Jacques
Anforderungen an Empfangsantennen für DVB-T
 A r b e i t s g r u p p e Empfang digitaler Rundfunksignale EDR 098 R4 14. August 2006 Positionspapier Anforderungen an Empfangsantennen für DVB-T 1. Ausgangslage Der Übergang auf DVB-T führt zu einer
A r b e i t s g r u p p e Empfang digitaler Rundfunksignale EDR 098 R4 14. August 2006 Positionspapier Anforderungen an Empfangsantennen für DVB-T 1. Ausgangslage Der Übergang auf DVB-T führt zu einer
Mikrocomputertechnik. Thema: Serielle Schnittstelle / UART
 Mikrocomputertechnik Thema: Serielle Schnittstelle / UART Parallele vs. serielle Datenübertragung Parallele Datenübertragung Mehrere Bits eines Datums werden zeitgleich mittels mehrerer Datenleitungen
Mikrocomputertechnik Thema: Serielle Schnittstelle / UART Parallele vs. serielle Datenübertragung Parallele Datenübertragung Mehrere Bits eines Datums werden zeitgleich mittels mehrerer Datenleitungen
Rauschzahlmessungen auf den Amateurbändern GHz
 Rauschzahlmessungen auf den Amateurbändern 122-134 GHz DB6NT 12.2016 Die Rauschzahlmessungen auf den Millimeterwellenbändern scheitern meistens an den dafür benötigten Rauschquellen. Es ist sehr schwierig
Rauschzahlmessungen auf den Amateurbändern 122-134 GHz DB6NT 12.2016 Die Rauschzahlmessungen auf den Millimeterwellenbändern scheitern meistens an den dafür benötigten Rauschquellen. Es ist sehr schwierig
Funk Ausbreitungseigenschaften und Antennencharakteristiken
 Funk Ausbreitungseigenschaften und Antennencharakteristiken In diesem Praktikum werden alle wichtigen Grundgegebenheiten der Funkübertragung erlebt. 1 Ziele Die wichtigsten Eigenschaften der Funkübertragung
Funk Ausbreitungseigenschaften und Antennencharakteristiken In diesem Praktikum werden alle wichtigen Grundgegebenheiten der Funkübertragung erlebt. 1 Ziele Die wichtigsten Eigenschaften der Funkübertragung
SCS-Verzeichnis Akkreditierungsnummer: SCS 0086
 Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2005 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2005 Eurofins Electrosuisse Product Testing AG Route de Montena 75 1728 Rossens FR Leiter: Christophe Perrenoud MS-Verantwortlicher:
Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2005 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2005 Eurofins Electrosuisse Product Testing AG Route de Montena 75 1728 Rossens FR Leiter: Christophe Perrenoud MS-Verantwortlicher:
Das Logarithmische Maß Dezibel
 Das Logarithmische Maß Dezibel W. Kippels 28. Februar 2013 Inhaltsverzeichnis 1 Definitionen 2 1.1 Leistungs- und Spannungsverhältnisse.................... 2 1.2 Pegelwerte mit bezogenen Dezibel......................
Das Logarithmische Maß Dezibel W. Kippels 28. Februar 2013 Inhaltsverzeichnis 1 Definitionen 2 1.1 Leistungs- und Spannungsverhältnisse.................... 2 1.2 Pegelwerte mit bezogenen Dezibel......................
Messen mit dem Spektrumanalysator
 ZHAW, EASP1 FS2012, 1 Messen mit dem Spektrumanalysator Einleitung Jedes periodische Signal lässt sich als Fourier-Reihe darstellen. Mit dem Spektrumanalyzer kann man die entsprechenden, einseitigen Amplitudenspektren
ZHAW, EASP1 FS2012, 1 Messen mit dem Spektrumanalysator Einleitung Jedes periodische Signal lässt sich als Fourier-Reihe darstellen. Mit dem Spektrumanalyzer kann man die entsprechenden, einseitigen Amplitudenspektren
Spektrumanalyse. Inhalt. I. Einleitung 2. II. Hauptteil 2-8
 Fachhochschule Aachen Campus Aachen Hochfrequenztechnik Hauptstudium Wintersemester 2007/2008 Dozent: Prof. Dr. Heuermann Spektrumanalyse Erstellt von: Name: Mario Schnetger Inhalt I. Einleitung 2 II.
Fachhochschule Aachen Campus Aachen Hochfrequenztechnik Hauptstudium Wintersemester 2007/2008 Dozent: Prof. Dr. Heuermann Spektrumanalyse Erstellt von: Name: Mario Schnetger Inhalt I. Einleitung 2 II.
Der neue PNA der einzigartige Multi-Analyzer für den anspruchsvollen Systemfunkerrichter
 Der neue PRO-TECS PNA 4500 ist ein universell verwendbarer Network-Analyzer für verschiedenste Anwendungen. Durch seinen eingebauten Windows PC ist er in Verbindung mit dem großen 7 Touch Screen sehr bedienerfreundlich
Der neue PRO-TECS PNA 4500 ist ein universell verwendbarer Network-Analyzer für verschiedenste Anwendungen. Durch seinen eingebauten Windows PC ist er in Verbindung mit dem großen 7 Touch Screen sehr bedienerfreundlich
3. Fourieranalyse und Amplitudenspektren
 3.1 Fourieranalyse 3.1.1 Einleitung Laut dem französischen Mathematiker Fourier (1768-1830) kann jedes periodische Signal in eine Summe von sinusförmigen Signalen mit unterschiedlichen Amplituden, Frequenzen
3.1 Fourieranalyse 3.1.1 Einleitung Laut dem französischen Mathematiker Fourier (1768-1830) kann jedes periodische Signal in eine Summe von sinusförmigen Signalen mit unterschiedlichen Amplituden, Frequenzen
Signalübertragung und -verarbeitung
 ILehrstuhl für Informationsübertragung Schriftliche Prüfung im Fach Signalübertragung und -verarbeitung 6. Oktober 008 5Aufgaben 90 Punkte Hinweise: Beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Teilaufgaben.
ILehrstuhl für Informationsübertragung Schriftliche Prüfung im Fach Signalübertragung und -verarbeitung 6. Oktober 008 5Aufgaben 90 Punkte Hinweise: Beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Teilaufgaben.
Empfindlichkeit und Rauschmaß eines DVB T Sticks
 Empfindlichkeit und Rauschmaß eines DVB T Sticks Messung kritischer Spezifikationen eines Salcar Stick DVB T RTL 2832U&R820T SDR Salcar Stick, oder ähnlich Blockschaltbild des R820T Tuners Aufbau für Empfindlichkeitsmessung:
Empfindlichkeit und Rauschmaß eines DVB T Sticks Messung kritischer Spezifikationen eines Salcar Stick DVB T RTL 2832U&R820T SDR Salcar Stick, oder ähnlich Blockschaltbild des R820T Tuners Aufbau für Empfindlichkeitsmessung:
Global Positioning System (GPS)
 Global Positioning System (GPS) - Beispiel für Anwendungen präziser Zeitmessung Genaue Orts- Geschwindigkeits- und Zeitinformation Unbegrenzte Zahl von Nutzern Weltweite Verfügbarkeit GPS - Segmente GPS
Global Positioning System (GPS) - Beispiel für Anwendungen präziser Zeitmessung Genaue Orts- Geschwindigkeits- und Zeitinformation Unbegrenzte Zahl von Nutzern Weltweite Verfügbarkeit GPS - Segmente GPS
