Übersicht I. 1799: Napoleon reißt die Macht an sich und wird Erster Konsul 1804: Napoleon wird Kaiser der Franzosen
|
|
|
- Ralf Schulze
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Übersicht I 1.Napoleonische Zeit (bis 1815) 1.1 Napoleon Bonaparte 1799: Napoleon reißt die Macht an sich und wird Erster Konsul 1804: Napoleon wird Kaiser der Franzosen 1.2. Napoleonische Kriege Bis 1815 kommt es zu einer ganzen Reihe von Kriegen, in deren Folge Napoleon seine Macht auf große Teile von Europa ausdehnt. Immer wieder treten Koalitionen verschiedener Staaten (vor allem Preußen, Österreich, Großbritannien und Russland) gegen Napoleon an und werden besiegt. Napoleon nutzt seine Siege aus und erlegt den besiegten Gegnern harte Friedensbedingungen auf. Die harten Friedensbedingungen tragen allerdings dazu bei, dass die Kriege weiter gehen, da die besiegten Mächte ihre verlorenen Gebiete zurückerlangen wollen. Zudem bildeten Napoleons Siege eine erhebliche Störung des Gleichgewichts der Großmächte in Europa, die vor allem Großbritannien zu einem Feind Frankreichs machte. 1801/02: Ende des zweiten Koalitionskrieges durch die Friedensverträge von Luneville (1801 mit Österreich) und Amiens (1802 mit Großbritannien). Der römisch-deutsche Kaiser (und Oberhaupt von Österreich) muss das linksrheinische Deutschland an Frankreich abtreten. 1803: Reichsdeputationshauptschluss. Die Fürsten, die linksrheinisch Gebiete verloren haben, werden rechtsrheinisch entschädigt. Dies geschieht durch Säkularisation (Ende der geistlichen Fürstentümer) und Mediatisierung (Ende der kleinen weltlichen Herrschaften, vor allem fast aller freien Reichsstädte). Das Ergebnis ist eine Reduzierung der Zahl der deutschen Fürstentümer von über 350 auf etwa 40. Napoleon hat sich massiv in die Verhandlungen eingemischt. Er wollte eine Reihe von mittelgroßen Staaten schaffen, die mit ihm verbündet waren (da sie ihm ihre Vergrößerung verdankten) und die stark genug waren dem römisch-deutschen Kaiser Probleme zu bereiten. (Bitte beachten: Säkularisierung und Säkularisation sind keine Synonyme! Säkularisation meint die Auflösung geistlichen Besitzes und Säkularisierung den Rückgang des kirchlichen Einflusses auf den Lebenswandel und die Moralvorstellungen der Menschen bzw. der Gesellschaft) 1805: Dritter Koalitionskrieg (Frankreich gegen Österreich, Großbritannien und Russland), Sieg Napoleons bei Austerlitz über ÖS und RUS, bei Trafalgar vernichten die Briten die französische Flotte. Nach seinem Sieg in Kontinentaleuropa kann Napoleon Deutschland grundlegend umgestalten. Juli 1806: Gründung des Rheinbundes. Eine Reihe von deutschen Fürsten tritt aus dem römisch-deutschen Reich aus und gründet den unter französischer Protektion stehenden Rheinbund. Der Rheinbund befand sich in einem Militärbündnis mit Frankreich. Im Laufe
2 der Jahre treten alle deutschen Fürsten außer Preußen und Österreich dem Rheinbund bei. 06. August 1806: Auf französischen Druck hin tritt Franz II. als römisch-deutscher Kaiser zurück. Er erklärt das römisch-deutsche Reich für aufgelöst. Damit endet das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Es gibt keinen vereinten deutschen Staat mehr. Franz II. hatte vorher schon vorsorglich (um nicht auf den ehrwürdigen Titel eines Kaisers verzichten zu müssen) Österreich zum Kaiserreich erklärt und ist ab jetzt Kaiser Franz I. von Österreich. 1806/07: Vierter Koalitionskrieg (Preußen und Russland gegen Frankreich) Preußen wartete die Ankunft der russischen Kräfte nicht ab und versuchte allein gegen Napoleon loszuschlagen. Das Ergebnis war am eine verheerende Niederlage Preußens in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt. Preußen brach militärisch zusammen und konnte nur durch das Eingreifen Russlands vor einer vollständigen Vernichtung gerettet werden. Im Frieden von Tilsit (Juli 1807) verlor Preußen etwa die Hälfte seines Gebiets (Elbe als neue Westgrenze), musste hohe Kriegskontributionen zahlen und sein Heer wurde auf Mann begrenzt. Ab November 1806: Kontinentalblockade. Napoleon versucht GB in die Knie zu zwingen, indem er alle von ihm kontrollierten oder beeinflussten Teile Europas für den britischen Handel verschloss. 1809: Fünfter Koalitionskrieg (Österreich und Großbritannien gegen Frankreich) Österreich verliert und muss noch mehr Gebiete an Frankreich abtreten. 1812: Russlandfeldzug Napoleons. Napoleon dringt mit der bis dahin größten Armee der Weltgeschichte in Russland ein. Die russischen Truppen ziehen sich immer weiter zurück und locken die Angreifer damit immer weiter ins Land hinein. Die immer länger werdenden Nachschubwege sorgen für eine immer schlechtere Versorgung der Angreifer, bei denen sich Seuchen ausbreiten. Angesichts des einbrechenden Winters (auf den Napoleons Truppen nicht vorbereitet waren) müssen sich die Angreifer unter hohen Verlusten zurückziehen. Im Dezember erreichen die russischen Truppen die preußische Grenze : Konvention von Tauroggen. Preußen war mit Napoleon verbündet und hatte ein Hilfskorps für den Russlandfeldzug zur Verfügung gestellt, das die Hauptmacht Napoleons nach Norden hin Rückendeckung geben sollte. Dieses Korps unter der Führung von Johann David von Yorcks stand den russischen Truppen nun in Ostpreußen gegenüber. Ohne Zustimmung des preußischen Königs wurde General Yorck eigenmächtig aktiv und wechselte mehr oder weniger die Seite: Mit der Konvention von Tauroggen wurden die preußischen Truppen in Ostpreußen für neutral erklärt. Der preußische König zögerte. Er war sich nicht sicher, ob Preußen stark genug sei, um eine weitere Konfrontation mit Frankreich zu suchen : Kriegserklärung Preußens an Frankreich Unter dem Druck seiner Berater und der massiv antifranzösischen Stimmung der Bevölkerung wechselt auch der preußische König die Seite. Am selben Tag veröffentlicht der preußische König den Aufruf An mein Volk, in dem er die Preußen und Deutschen zur Unterstützung im Kampf gegen Napoleon aufruft. In der Folgezeit melden sich Zehntausende als Freiwillige (die in sogenannten Freikorps organisiert werden). Oktober 1813: Völkerschlacht bei Leipzig Auch Österreich schloss sich am der neuen antinapoleonischen Koalition an. Russische, preußische und österreichische (und schwedische) Truppen besiegen Napoleon in
3 der Völkerschlacht bei Leipzig. Daraufhin räumen die französischen Truppen Deutschland. 1814: Die Alliierten (PR, ÖS, RUS) dringen in Frankreich ein und Napoleon dankt ab. Er wird nach Elba verbannt. 1815: Napoleon kommt von Elba zurück und wird bei Waterloo von PR und GB erneut besiegt. Er wird nach Sankt Helena verbannt Nationalismus Nach 1806 kommt es in Deutschland zu einer Verbreitung nationalistischer Ideen. Der Nationalismus verbreitet sich vor allem in den Kreisen der Akademiker, insbesondere der Studenten. Literaten wie Ernst Moritz Arndt versuchen mit ihren Schriften die Menschen für nationalistische Ziele zu gewinnen. Ihr unmittelbares Ziel ist zunächst eine Vertreibung der Franzosen aus Deutschland (durch eine Erhebung des Volks), dann die Gründung eines Nationalstaats. Die einfachen Leute (Bauern, Handwerker usw.) werden noch kaum davon erfasst. Nationalismus: Politische Bewegung, die sich nach der Französischen Revolution in Europa verbreitet hat. Die Kernthesen des Nationalismus sind die folgenden: (1) Die Menschheit kann eindeutig in Nationen eingeteilt werden, die sich alle durch ihre Kultur und Sprache eindeutig voneinander unterscheiden. Die Nationen sind schon sehr lange da. (2) Die Politik hat dem Wohl der Nation zu dienen, nicht dem Wohl einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe oder einer bestimmten Einzelperson. Im Zweifel kann das Wohl der eigenen Nation auf Kosten des Wohls einer anderen Nation verfolgt werden. (3) Jede Nation (oder zumindest die eigene) sollte in einem eigenen Staat leben, einem sogenannten Nationalstaat. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der Nationalismus keine rechte, sondern zumeist eine linke Bewegung. Die meisten Nationalisten verbinden nämlich mit dem oben genannten zweiten Punkt die Forderung nach einer Machtbeteiligung des Volks. Probleme: Die Kernthesen des Nationalismus sind falsch bzw. problematisch (1) Die Menschheit kann nicht eindeutig in Nationen eingeteilt werden. Es gibt z. B. stets Übergangszonen. Gehören Luxemburger zur deutschen oder französischen Nation oder bilden sie eine eigene? Was ist mit deutschsprachigen Lothringern, die sich als Franzosen ansehen? (2) Die Nationen sind nicht schon lange da gewesen. Die Ethnie der Deutschen gibt es nicht wie von den Nationalisten des 19. Jahrhunderts gedacht seit Christi Geburt (die Deutschen als direkte Nachfahren der alten Germanen). Einen Ethnos der Deutschen gibt es erst seit etwa 1000, als er aus verschiedenen anderen Völkern zusammenwuchs (unter anderem den Franken, Bajuwaren, Sachsen und Thüringern). Die Deutschen sind keine direkten Nachfahren der Germanen, da es im Laufe der Zeit zu einer erheblichen Vermischung mit anderen Ethnien gekommen ist (während der Völkerwanderung mit romanisierten Bevölkerungen westlich des Rheins, im Hochmittelalter mit slawischen Völkern im Osten, usw.) (3) Die Bildung von Nationalstaaten ist manchmal nur schwer möglich. Oft ist keine genaue Grenze zwischen verschiedenen Ethnien vorhanden, so dass es unmöglich ist, eine exakte Grenze festzulegen. (Bsp: Balkan) (4) Der Nationalismus hat eine Tendenz dazu, das Wohl der eigenen Nation auf Kosten des
4 Wohls anderer Nationen zu verfolgen. (5) Der Nationalismus hat eine Tendenz dazu, nationale Minderheiten mit Gewalt assimilieren zu wollen. Die Angehörigen einer Minderheit sollen ihre Sprache und eigene Kultur aufgeben, um Mitglieder der dominanten Nation zu werden. Befreiungskriege: Der Nationalismus spielte eine Rolle bei den Befreiungskriegen (1813). Nationalistische Literaten hatten schon mehrere Jahre zuvor zur Vertreibung der Franzosen durch eine Volkserhebung aufgerufen. Preußen und Russland wollten sich diese Kampfbereitschaft für ihren Kampf gegen Frankreich zu Nutze machen. Daher rief der preußische König mit An mein Volk die preußische Bevölkerung zur Unterstützung im Krieg gegen Frankreich auf. Zur Würdigung der Anstrengungen der einfachen Menschen stiftete der preußische König den ersten militärischen Orden, der ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche Herkunft vergeben wurde: das Eiserne Kreuz. Tatsächlich meldeten sich Zehntausende freiwillig zum Militärdienst. Insgesamt haben etwa Personen freiwillig in den preußischen Freikorps gedient. Während des Kriegs kam es beim Herannahen alliierter Truppen in einigen Städten zu spontanen Aufständen zur Unterstützung der antinapoleonischen Koalition. Dazu kommt, dass es zu umfangreichen Spenden der Bevölkerung für die Finanzierung des Krieges kam ( Gold gab ich für Eisen ). Die Befreiungskriege übten einen prägenden Einfluss auf den entstehenden deutschen Nationalismus aus. So wurden die Uniformfarben des Lützowschen Freikorps zu den Farben der Nationalbewegung: Schwarz Rot Gold. Außerdem hatte der deutsche Nationalismus eine starke antifranzösische Ausrichtung. Im Rückblick erschien es den Nationalisten so, als ob 1813 eine große massive nationalistische Erhebung des Volks stattgefunden hätte. Dies ist falsch. Zwar waren insbesondere die freiwillig kämpfenden Studenten tatsächlich in der Regel aus nationalistischen Motiven heraus aktiv geworden. Aber viele andere Menschen (vor allem aus den unteren sozialen Schichten) hatten sich aus ökonomischen Gründen erhoben. Napoleons Kontinentalblockade ruinierte den Handel und die aus seinen Kriegskontributionen und der Versorgung seiner Truppen erwachsenden Abgaben führten zu einer hohen finanziellen und materiellen Belastung. Die gegen Russland eingesetzte Grande Armee hatte in Deutschland mit Nahrungsmitteln und anderen Gütern versorgt werden müssen. Der Nationalismus war insgesamt noch die Bewegung einer Minderheit. Zudem war die Kriegsbeteiligung der Freiwilligen nicht kriegsentscheidend. Die große Mehrheit der Truppen bestand aus regulären Soldaten, die in Preußen zum Beispiel auf Grund der 1813 erst eingeführten Allgemeinen Wehrpflicht in der Armee dienen mussten.
5 2. Preußische Reformen ( ) 2.1. Hintergrund Preußen war im Vierten Koalitionskrieg vernichtend geschlagen worden. In dieser Situation konnten sich in der preußischen Führung reformbereite Kräfte durchsetzen, die einen Grund für die Niederlage bei der veralteten inneren Ordnung Preußens sahen. Frankreich hatte seit der Revolution Rechtsgleichheit, eine liberale Wirtschaftsordnung und die Allgemeine Wehrpflicht. Die Reformer sahen darin die Quellen von Frankreichs Stärke und wollten den Zustand in Preußen entsprechend verändern. Führende Gestalten: Freiherr Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein Fürst Karl August von Hardenberg Ziele: Stärkung Preußens durch (1) Förderung der ökonomischen Entwicklung durch eine liberale Wirtschaftsordnung und eine Reform der Bildung (2) Vergrößerung der Bereitschaft der einfachen Menschen zum Engagement für den Staat durch Beteiligung an der Macht (3) Vorbereitung der Allgemeinen Wehrpflicht [die durch den Frieden von Tilsit illegal war] 2.2. Das Reformwerk : Oktoberedikt. Das Oktoberedikt hob die Leibeigenschaft (die persönliche Unfreiheit) der Bauern auf. Ab jetzt waren die Bauern freie Menschen und konnten über ihr Leben selbst verfügen sie konnten ohne Erlaubnis eines Gutsherrn in eine Stadt ziehen und heiraten. Zudem wurde die Gewerbefreiheit eingeführt. Ab jetzt durfte jeder jeden Beruf ergreifen. Mit dem Oktoberedikt wurden die Bauern persönlich frei, aber noch nicht zu den Besitzern ihres Landes. Dies erfolgte durch das Regulierungsedikt von Dieses legte fest, dass die Bauern den ungeteilten Besitz an ihrem Land erwerben konnten durch die Zahlung einer Entschädigung an den Gutsherrn. 1808: Kommunalreform. In den Städten wurde die Selbstverwaltung durch die Bürger eingeführt. Die Städte wurden ab jetzt von einer Art Stadtrat (den Stadtverordneten), der nach einem Zensuswahlrecht von den männlichen Bürgern gewählt wurde, und dem Magistrat (Bürgermeister und Mitarbeiter) regiert. Der Magistrat wurde von den Stadtverordneten gewählt, benötigte aber die Zustimmung der königlichen Regierung. Der Versuch auf dem Land mit Landgemeinden ähnliche Selbstverwaltungsstrukturen zu schaffen scheiterte am Widerstand des Adels. Umstrukturierung der königlichen Regierung. Man begründet Ministerien, die für jeweils einen bestimmten Sachbereich zuständig sind. Jedem Ministerium stand ab jetzt ein Mann vor, der für seinen Sachbereich allein verantwortlich war. Vorher hatte das Kollegialprinzip gegolten: Alle Mitglieder des königlichen Kabinetts waren für alles zuständig und versuchte durch Diskussion kollegial die beste Lösung zu finden. 1812: Emanzipationsedikt. Die Juden erhielten in Preußen das volle Bürgerrecht, ihre
6 jahrhundertelange rechtliche Diskriminierung endete. Es gab allerdings einige Einschränkungen. Die Juden erhielten nämlich keinen Zugang zu Offiziers-, Justiz- und Verwaltungsämtern. Gendarmerie-Edikt. Bis dahin hatte der Adel vielerorts noch Privilegien in Gerichtsbarkeit und Verwaltung. So gab es Gebiete, die nicht der niederen Gerichtsbarkeit einer im eigentlichem Sinn staatlichen Institution unterstanden, sondern der privaten niederen Gerichtsbarkeit eines Adligen. Im Jahre 1812 wurde Preußen in Landkreise als untere staatliche Verwaltungseinheiten eingeteilt. In den Landkreisen unterlag die ganze Verwaltung der Kontrolle staatlicher Landräte. Und die Gerichtsbarkeit wurde auf staatliche Gerichte beschränkt. Damit waren die diesbezüglichen adligen Privilegien abgeschafft worden. Der Adel konnte aber 1816 durchsetzen, dass die Landräte in der Regel dem Adel entstammen sollten. Zwischen den Landkreisen und der königlichen Regierung traten staatsweit als Zwischeninstanz sogenannte Regierungsbezirke. Damals wurde die heutige Verwaltungsgliederung in ihrer Grundform eingeführt. 1818: Zollgesetz. In Preußen wurden die Binnenzölle abgeschafft. Preußen stellte ab jetzt einen vereinten Binnenmarkt dar. Verfassungsversprechen. Mehrfach verspricht der preußische König seinem Volk ein Verfassung mit einer Volksvertretung (Parlament) zu erlassen. Bildungsreformen von Wilhelm von Humboldt. Einführung des Abiturs, Modernisierung des Lehrplans Die Folgen (1) In Preußen beginnt die endgültige Bauernbefreiung. Diese sollte allerdings noch einige Jahrzehnte dauern. Die Bauern können sich erst im Laufe der Jahre schrittweise alle freikaufen. (2) Die Reformen gehen vor allem im wirtschaftlichen Bereich sehr weit. Durch die Gewerbefreiheit werden die Zünfte entscheidend geschwächt da ab nun jeder jedem Beruf nachgehen kann ohne Zunftmitgliedschaft sterben diese in den nachfolgenden Jahren aus. Die Reformen (die sich unter anderem an den Ideen von Adam Smith orientiert haben) schaffen eine liberale Wirtschaftsordnung, welche den Beginn der Industrialisierung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ermöglichte. Die Industrialisierung setzte zum Beispiel voraus, dass die Bauern das Land verlassen dürfen, um in den Städten zu leben und Arbeit zu suchen. Sie setzte auch die Gewerbefreiheit voraus, da die Regeln der Zünfte die freie Entfaltung des Unternehmertums behindert hätten. Die wirtschaftlichen Reformen wurden zum Fundament des wirtschaftlichen Aufstiegs Preußens im 19. Jahrhundert. (3) Anders als im wirtschaftlichen Bereich bleiben die Reformen im politischen Bereich Stückwerk. Die politische Modernisierung hinkte der ökonomischen hinterher. Preußen blieb letztlich ein autoritärer neoabsolutistischer Staat ohne Verfassung (aber mit einer begrenzten Selbstverwaltung der Städte). (4) Bestimmte Teile der preußischen Gesellschaft wurden nicht oder nur wenig modernisiert. Zwar stiegen in den folgenden Jahren zunehmend Bürgerliche in hohe staatliche Ämter auf, aber der Adel war bei den Führungspositionen der Armee und der Verwaltung überproportional vertreten. Auch im Diplomatischen Dienst waren sehr viele Adlige anzutreffen. Diese starke Stellung des Adels blieb auch später im
7 Deutschen Kaiserreich mehr oder weniger erhalten. (5) Die Reformen waren eine Revolution von oben. Preußen passte sich der von der französischen Revolution ausgehenden Modernisierung durch eine Revolution von oben an. Es fragt sich, ob es für die demokratische Entwicklung besser gewesen wäre, wenn die Veränderungen von unten gekommen wären Reformära in Deutschland Ähnliche Reformen wie in Preußen gab es in vielen deutschen Fürstentümern in der Zeit vor Dies gilt insbesondere für den Rheinbund, wo der französische Einfluss sehr stark war. Dabei sollte beachtet werden, dass innerhalb des Rheinbundes das Königreich Westphalen neu gegründet worden war. Sein König war Jerome, der Bruder von Napoleon. Auch in Westphalen wurden Reformen nach französischem Vorbild durchgeführt. Häufig gingen die Reformen in den Rheinbundstaaten im politischen Bereich weiter als in Preußen, während sie im wirtschaftlichen Bereich nicht so weit gingen. Das hatte später im 19. Jahrhundert zur Folge, dass die süddeutschen Staaten in der Regel liberaler und fortschrittlicher waren als Preußen. So hatten viele dieser Staaten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts anders als Preußen Verfassungen. In manchen Staaten gab es keine oder kaum Reformen. Dies gilt zum Beispiel für Mecklenburg. Aber es gilt auch für Österreich, das ab 1809 unter Führung des Ministers Klemens Wenzel Lothar von Metternich stand. Das hatte eine Verzögerung der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs zur Folge, die in ein wirtschaftliches Erstarken Preußens im Vergleich zu Österreich mündete.
8 3. Zeit der Restauration ( ) 3.1. Wiener Kongress 1814/15: Die Fürsten Europas sammelten sich in Wien, um Europa nach dem Ende der Napoleonischen Kriege neu zu ordnen. Unter den Versammelten befand sich eine große Zahl von Staatsoberhäuptern (Zar Alexander I. von Russland, Kaiser Franz I. von Österreich und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen). Die dominante Gestalt des Kongresses war der österreichische Minister Metternich. Bei den Verhandlungen setzen sich die konservativ gesinnten Politiker, welche die durch die Revolution verursachten gesellschaftlichen Veränderungen ablehnten, weitgehend durch. Als Folge davon lassen sich die Beschlüsse des Kongresses mit den folgenden Ideen zusammenfassen: (1) Legitimität. Rechtmäßige Herrschaft sollte nur noch ererbte Herrschaft sein. Die von Napoleon und der Revolution gestürzten Dynastien sollten in ihre Staaten zurückkehren. So bestiegen die Bourbonen erneut den französischen Königsthron. (2) Restauration. Die vorrevolutionären Zustände in Gesellschaft und Politik sollten soweit möglich wiederhergestellt werden. In vielen Fällen war dies allerdings nicht mehr möglich. Insbesondere blieben die preußischen Reformen alle in Kraft. Auch auf die Wiederherstellung der vielen kleinen Fürstentümer in Deutschland verzichtete man, da viele davon kaum lebensfähig gewesen wären und da die mittlerweile vergrößerten übrig gebliebenen mittelgroßen Staaten dagegen gewesen wären. Auf jeden Fall aber wollte man neue revolutionäre Veränderungen der Gesellschaft in Europa verhindern. Die neue Ordnung Europas sollte antirevolutionär sein. (3) Solidarität. Die europäischen Monarchien sollten gegen revolutionäre Bedrohungen und gegen Bedrohungen des Gleichgewichts der Großmächte zusammenhalten. Preußen, Österreich und Russland schlossen die Heilige Allianz, die sich genau diesen Zielen widmete. Beschlüsse: (1) Gründung des Deutschen Bundes. Der Deutsche Bund war eine relativ lose Föderation der deutschen Staaten. Die einzelnen Staaten blieben dabei unabhängig. Das zentrale Bundesorgan war der in Frankfurt am Main tagende Bundestag, ein ständig tagender Gesandtenkongress. Die Gesandten wurden nicht vom Volk gewählt, sondern von den Regierungen ernannt. Bei Veränderungen der Organisation des Bundes und bei Religionsfragen war ein einstimmiges Votum notwendig. Die Beschlüsse des Bundestages waren für die Mitgliedsstaaten bindend, die Ausführung lag aber allein in deren Händen. Und die Hoheit über Zoll-, Polizei- und Militärwesen verblieb bei den Einzelstaaten. Der Bund hatte also keine Möglichkeit, die Umsetzung seiner Beschlüsse zu erzwingen. Innerhalb des Bundestags hatte Österreich den Vorsitz. Bei Stimmengleichheit gab die österreichische Stimme den Ausschlag. Der Deutsche Bund diente Preußen und Österreich in den folgenden Jahrzehnten vor allem dazu, die kleineren deutschen Staaten zur Umsetzung einer restaurativen Politik zu zwingen. Dem Deutschen Bund gehörten zum Teil auch ausländische Herrscher an, da diese in Personalunion auch über deutsche Fürstentümer regierten: so der dänische König (Herzogtum Holstein) und zeitweise der britische König (Königreich Hannover). Teilweise verfügten deutsche Fürsten über Herrschaften außerhalb des Bunds (Preußen: Ostpreußen und Österreich: Ungarn). (2) Gründung der Heiligen Allianz (3) Der Wiener Kongress traf eine größere Zahl von territorialen Entscheidungen. Eine davon sei herausgegriffen: Preußen wird erheblich vergrößert. Es erhält einen Teil
9 Sachsens und das Rheinland. Ab da gehörte Neuss zu Preußen. Die vom Wiener Kongress gezogenen Grenzen erwiesen sich als relativ stabil. Erst um 1860 erfolgten mit der italienischen und deutschen Einigung größere Veränderungen. Europa erlebte nach dem Wiener Kongress eine längere Friedensphase. Zeitalter der Restauration: Auf dem Wiener Kongress hatten sich konservative Politiker weitgehend durchgesetzt. In der Folgezeit verloren die durchaus noch aktiven Reformer in den Fürstentümern schrittweise immer mehr an Einfluss. In Preußen konnte sich Hardenberg immer weniger gegen die konservativen Gegner der Reformpolitik durchsetzen. Hinter den Kulissen stritt Metternich entschieden gegen die Verfassungspläne, die in Preußen vor allem von Staatsminister Hardenberg vorangetrieben wurden. Metternich konnte sich dabei nicht zuletzt auf eine konservative Hofpartei, die so genannte Kamarilla, um den preußischen Kronprinzen, den späteren Friedrich Wilhelm IV., stützen. Die Konservativen und Metternich konnten sich am Ende durchsetzen. Hardenberg fiel beim König in Ungnade und damit verlor die Reformpartei in Preußen endgültig ihre Macht und verschwand. Als Ergebnis davon standen sich um 1820 nur noch zwei politische Bewegungen gegenüber: auf der einen Seite die konservativen Staatsführungen und ihre Anhänger (gegen gesellschaftliche Veränderungen, für Beibehaltung des Status quo oder sogar Wiederherstellung vorrevolutionärer Zustände, gegen Nationalstaat und Nationalismus, für Neoabsolutismus oder mittelalterlichen Ständestaat) und auf der anderen Seite eine nationalistische und liberale Bewegung (für eine Verfassung, für die Einrichtung eines Parlaments und Machtbeteiligung des Volks, für gesellschaftliche Veränderungen hin zu Rechtsgleichheit und persönlicher Freiheit und gegen adlige Privilegien, für Nationalstaat und Nationalismus). Die Position der Reformpartei wurde unter anderem auch durch das Verhalten der nationalistischen Studenten geschwächt. Diese gingen teilweise aus Enttäuschung über die Beschlüsse von Wien zum Terrorismus über und veranlassten Metternich und die Konservativen damit zu massiven Unterdrückungsmaßnahmen. In dieser Atmosphäre war es schwer für weitere Reformen einzutreten Unterdrückung der politischen Opposition Juni 1815: Gründung der Urburschenschaft in Jena. Von der politischen Entwicklung enttäuschte Studenten der Universität Jena schließen sich zu einer Burschenschaft zusammen (Bursche = Student). Bis dahin waren die Studenten in Landsmannschaften organisiert gewesen (zum Beispiel alle Schwaben in einer schwäbischen, alle Sachsen in einer sächsischen usw.). Diese Landsmannschaften waren unpolitisch gewesen. Die Jenaer Studenten lösten ihre Landsmannschaften auf und gründeten die politisch sehr aktive Burschenschaft. Diese setzte sich für die Einigung Deutschlands und die Gewährung von Mitbestimmungsrechten an das Volk ein. In der Folgezeit entstanden auch an anderen Universitäten ähnliche Burschenschaften. Die Urburschenschaft wählte sich Schwarz-Rot- Gold als ihre Farben aus, nach dem Vorbild des Lützowschen Freikorps, in dem etliche ihrer Mitglieder gedient hatten. 18. Oktober 1817: Wartburgfest. Die neue Burschenschaftsbewegung trat 1817 mit dem Wartburgfest an die Öffentlichkeit, um die diese für ihre Ziele zu gewinnen. Anlass war der Jahrestag der Reformation und der Völkerschlacht bei Leipzig. Beim Wartburgfest erschienen mehrere Hundert Studenten von 13 Universitäten, hielten verschiedene Reden und organisierten dann eine Bücherverbrennung unter anderem von Werken Augusts von
10 Kotzebue (ein Literat, der als Gegner des Nationalismus und Spion des russischen Zaren galt) und eine Verbrennung von Symbolen des Obrigkeitsstaats (zum Beispiel Uniformteile und einen militärischen Kommandostab). In der Folgezeit versuchten die studentischen Aktivisten die Burschenschaften deutschlandweit in einer Allgemeinen Deutschen Burschenschaft zu vereinigen : Mord an August von Kotzebue. Nicht alle Studenten blieben friedlich. Eine studentische Splittergruppe, der auch der Theologiestudent Karl Ludwig Sand gehörte, trat für terroristische Attentate ein. Sand ermordete den Literaten Kotzebue. September 1819: Der Mord an Kotzebue ermöglichte es Metternich zu einer massiven Unterdrückung der Burschenschaften überzugehen. Er setzte beim Bundestag die deutschlandweite Einführung der Karlsbader Beschlüsse durch. Ab nun waren die Burschenschaften verboten, Studenten konnten auf Grund von politischen Aktivitäten der Universität verwiesen werden und die Universitäten wurden durch Beauftragte der Regierungen überwacht. Der Deutsche Bund richtete sogar eine Zentralstelle ein (die Zentraluntersuchungskommission in Mainz), die die Aktivitäten der Burschenschaften bundesweit überwachen sollten. Zeitungen, Zeitschriften und Bücher unterlagen ab jetzt einer Zensur. Die politischen Aktivitäten der nationalistischen Studenten wurden als Volksverhetzung angesehen. Sie selbst wurden als Demagogen bezeichnet. Nationale und liberale Professoren wurden der Universität verwiesen. In der Folgezeit bleibt Deutschland oberflächlich betrachtet ruhig. Die Ziele und Ideen der Studenten leben allerdings im Untergrund weiter und verbreiten sich. Dies hat seine Ursache nicht zuletzt darin, dass insbesondere die intellektuelle Elite zur nationalen und liberalen Opposition gehörte. Diese Personen nahmen nach ihrer Ausbildung Schlüsselpositionen in der staatlichen Verwaltung und Gerichtsbarkeit, in der Kirche und im Wissenschaftsbetrieb ein. Von dort aus konnten ihre Ideen weiter verbreitet werden. Dazu trug auch bei, dass manche Fürstentümer die Karlsbader Beschlüsse nur halbherzig umsetzten (insbesondere relativ liberale Staaten in Süddeutschland). Das Ergebnis dieser Entwicklung kann beim Hambacher Fest beobachtet werden: Statt einiger hundert Personen nehmen Zehntausende Personen teil. 1830: Julirevolution in Frankreich. In Frankreich wird die wiederhergestellte Monarchie der Bourbonen durch eine neue Revolution erschüttert, die zur Flucht Karls X. und Thronübernahme durch den als liberaler geltenden Bürgerkönig Louis Philippe führte. Als Folge der Julirevolution kommt es auch in Deutschland zu erneuten Unruhen. Die Liberalen und Nationalen konnten in einigen Fürstentümern Umstürze organisieren und die Verkündung von Verfassungen erzwingen. Beispiel: In Kurhessen hatte Kurfürst Wilhelm II. versucht absolutistisch zu regieren und sich damit die Gegnerschaft der liberal-nationalen Opposition zugezogen. Dieser gelang es, den Unmut der Unterschichten über gleichzeitig herrschende wirtschaftlich-soziale Probleme auszunutzen und Unruhen zu entfachen. Die Regierung musste schließlich einlenken und der Einführung einer liberalen Verfassung zustimmen. Der Kurfürst selbst musste zu Gunsten seines Sohnes abdanken. Mai 1832: Hambacher Fest. Um 1830 konnte die Opposition in vielen Teilen Deutschlands wieder offener auftreten als vorher. Den Journalisten Johann Georg August Wirth und Philipp Jakob Siebenpfeiffer gelang es sogar mit dem Hambacher Fest eine Massenveranstaltung zu organisieren. Etwa Menschen versammelten sich zum Nationalfest der Deutschen. Die Organisatoren und Redner des Festes wurden in
11 Anschluss gerichtlich verfolgt : Frankfurter Wachensturm. Ein Teil der Teilnehmer des Hambacher Festes beschloss zu handeln. Sie wollten die beiden Frankfurter Polizeiwachen stürmen, sich die dort befindlichen Waffen aneignen und anschließend die Gesandten der deutschen Fürsten beim Bundestag gefangen zu nehmen. Dies sollte das Signal zu einer nationalen und demokratischen Erhebung in ganz Deutschland werden. Die Verschwörer hofften auf die Unterstützung der hessischen Bauern und Frankfurter Bürger. Diese Unterstützung blieb jedoch aus, so dass das Militär, das die Studenten bereits erwartete da die Putschpläne verraten worden waren, leichtes Spiel hatte. In der Folgezeit verschärfte der Deutsche Bund die Unterdrückung der Opposition wieder. 1837: Göttinger Sieben. Im Jahre 1837 wurde Ernst August I. König von Hannover (der anders als seine Vorgänger nicht mehr in Personalunion britischer König war). Er beschloss, die Verfassung des Königreiches aufzuheben. Dagegen protestierten sieben berühmte Professoren der Universität von Göttingen (unter anderem die Gebrüder Grimm). Diese wurden daraufhin entlassen. Ergebnis: Im Laufe der Jahre wuchs die Opposition immer weiter an. Die Staatsgewalt war mit ihrer Unterdrückungspolitik nicht dazu imstande gewesen ihre innenpolitischen Gegner auszuschalten. Dies hatte verschiedene Ursachen: (1) Manche Fürstentümer wandten die Unterdrückungsmaßnahmen nur lasch an. (2) Die Opposition umfasste vor allem die intellektuelle Elite, die nach ihrer Ausbildung gesellschaftliche Führungspositionen übernahm, von denen aus sie die Bevölkerung beeinflussen konnte. (3) Dem Staat fehlten die technischen und finanziellen Mittel zu einer effektiven Unterdrückung der Opposition. Diese sollten erst den Diktaturen im 20. Jahrhundert zur Verfügung stehen Politische Bewegungen In der hier betrachteten Zeit entstanden die wichtigsten politischen Richtungen des 19. Jahrhunderts. (1) Konservativismus. Die Konservative waren für die Beibehaltung des Status quo in Gesellschaft und Politik. Man strebte entweder einen absolutistischen oder einen ständischen Staat an. Die Privilegien des Adels sollten (soweit noch vorhanden und soweit möglich) verteidigt werden. Die Konservativen lehnten die nationale Idee ab. Sie waren international ausgerichtet: Die Heilige Allianz war ein konservatives Bündnis zur Bekämpfung von Revolutionen in ganz Europa und zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Großmächte und damit des Friedens in ganz Europa. (2) Die nationale und liberale Bewegung war in zwei Teile gespalten: (2a) Rechtsliberale (zeitgenössisch: Liberale). Die Rechtsliberalen traten für den Verfassungsstaat, für die Beteiligung des Volks an der Macht und für die Schaffung eines Nationalstaats ein. In diesem Staat sollte aber ein Zensuswahlrecht herrschen, da man den Unterschichten die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme an der Politik absprach. Man dachte, die armen Menschen hätten nicht genug Ahnung von Politik. Als Staatsform konnte man sich durchaus eine Monarchie (konstitutionelle Monarchie) vorstellen.
12 (2b) Linksliberale (zeitgenössisch: Demokraten). Die Linksliberalen traten für den Verfassungsstaat, für die Beteiligung des Volks an der Macht und für die Schaffung eines Nationalstaats ein. In diesem Staat sollten aber alle Menschen (bzw. Männer) das Wahlrecht haben. Als Staatsform stellte man sich oft eine Republik vor. Die Demokraten ähneln den Jakobinern der französischen Revolution. (3) Sozialismus. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen die ersten sozialistischen Gruppen. Seine klassische Form erhält der Sozialismus aber erst durch das Kommunistische Manifest von Karl Marx von Der Sozialismus war und ist nicht national. Er spielte in Deutschland erst nach etwa 1860 eine größere Rolle. (4) Politischer Katholizismus. Auch der politische Katholizismus begann sich in dieser Zeit zu bilden. Besonders anfangs war die Wahrung der Interessen der katholischen Kirche das Hauptziel dieser Bewegung (kirchliche Aufsicht über die Schulen, vom Staat nicht beeinträchtigte Kontrolle des Vatikans über die kirchliche Hierarchie in Deutschland, Verhinderung von katholisch-evangelischen Mischehen usw.). Der politische Katholizismus war in seinen Wert- und Moralvorstellungen natürlich katholisch-konservativ. Aber schon in der Revolution von 1848 zeigte sich eine ausgeprägte Aufgeschlossenheit für liberal-freiheitliche politische Strukturen. Viele katholische Politiker erhofften sich von mehr oder weniger demokratischen Strukturen nämlich gute Ausgangsbedingungen für ihr Engagement für die Interessen der Kirche. Anders als in einem absolutistischen Staat war es in einem konstitutionellen Staat nämlich möglich, auch auf die Politik eines mehrheitlich evangelischen Fürstentums mittels einer katholischen Partei Einfluss zu nehmen. Außerdem konnte der Katholizismus sich in einem liberal verfassten Staat besser als in einem absolutistischen Staat gegen Versuche der Regierung sich in kirchliche Belange einzumischen zur Wehr setzen 3.4. Pauperismus und Industrialisierung Die innenpolitischen Auseinandersetzungen sind nicht die einzigen Probleme, mit denen Deutschland während der hier betrachteten Zeit beschäftigt war. Die Zeit vor 1848 ist zugleich die Zeit, wo die Industrielle Revolution beginnt. Der Durchbruch der Industriellen Revolution wurde durch verschiedene Maßnahmen gefördert: (1) In vielen Staaten war es wie in Preußen zur Befreiung der Bauern und Einführung der Gewerbefreiheit gekommen. Diese waren die Voraussetzungen für die Industrialisierung. Insbesondere die Bauernbefreiung brauchte relativ lange zur Vollendung und dauerte in manchen Gebieten über die gesamte betrachtete Zeit hinweg an. (2) Preußen setzt zumindest auf wirtschaftlichem Gebiet seine liberale Politik fort werden die Binnenzölle innerhalb des Staats abgeschafft. Zugleich engagiert sich die preußische Politik für größere Zollzusammenschlüsse mit anderen Staaten, um einen großen Binnenmarkt zu schaffen. Die Regierung hatte angesichts des zersplitterten Staatsgebiets (ein Teil des Staats lag abgetrennt vom Rest im Westen) ein Eigeninteresse daran, die Zollgrenzen zu überwinden. Preußen übte großen Druck auf vor allem seine Nachbarn aus, damit diese sich dem preußischen Zollgebiet anschlossen. Preußens Bemühungen wurden durch die Werke des Nationalökonoms Friedrich List unterstützt, der sich von einer deutschen Zollgemeinschaft eine allgemeine Steigerung des Wohlstands versprach. Einen ersten Höhepunkt erreichte
13 diese Entwicklung 1834 mit der Gründung des Deutschen Zollvereins, dem neben Preußen eine ganze Reihe von mittelgroßen Staaten angehörte. Die Zollvereinigung wurde begleitet von ersten Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Maßeinheiten. Österreich blieb außerhalb des Zollvereins. (3) Dazu kamen umfassende Investitionen der deutschen Staaten in die Bildung, vor allem in die Ausbildung von Ingenieuren. Während derselben Zeit stieg das Bevölkerungswachstum in ganz Deutschland an. Die Ursachen davon sind unklar (bessere medizinische Versorgung? Veränderung der Wertvorstellungen der Menschen?). Da die Industrialisierung ungleich verlief in manchen Gebieten begann sie relativ früh und zeitigte entsprechend früh Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, während sie in anderen Gebieten relativ spät einsetzte. Die noch wenig industrialisierten Gebiete sollten große Probleme mit dem Bevölkerungswachstum und der neuen Konkurrenz der industriell gefertigen Produkte aus den industrialisierten Gebieten haben. Die traditionellen Betriebe gingen wegen der industriellen Konkurrenz zu Grunde und das Bevölkerungswachstum erzeugte Hunger. 1844: Schlesischer Weberaufstand. Als Beispiel für die Probleme des Pauperismus kann Schlesien genannt werden. Schlesien war vergleichsweise dicht besiedelt und besaß einen relativ großen Anteil an Gewerbe, nicht zuletzt Webereien. Die Bauernbefreiung kam in Schlesien nur langsam voran und technische Neuerungen hatten sich noch kaum ausgebreitet. Trotzdem musste Schlesien mit industrialisierten Gebieten konkurrierten. Das führte zu einer anhaltenden wirtschaftlichen Krise in den 1840ern. Im Jahre 1844 erhoben sich die Weber gegen ihr Elend Sie wurden vom preußischen Militär niedergeschlagen. In den industrialisierten Gebieten verursachte das Bevölkerungswachstum keine allzu großen Probleme. Der Pauperismus war vor allem ein Problem von einer zu langsamen Industrialisierung oder einer noch nicht erfolgten Industrialisierung.
14 4. Die Revolution von 1848/ Die Revolution 1846 und 1847: Missernten in Mitteleuropa, die in vielen Gebieten Versorgungsengpässe und Hunger auslösen. Ähnlich wie der Französischen Revolution von 1789 gingen auch der Revolution von 1848 Missernten voraus, welche vor allem bei den ärmeren Bevölkerungsschichten Unruhe auslösten. Die unteren Schichten, die ohnehin am Pauperismus zu leiden hatten, wandten sich aufgrund der Verschlechterung ihrer Situation zunehmend revolutionsbereiten Kräften zu bzw. waren während der Revolution dazu bereit, aktiv zu werden. Die Missernten halfen den (oftmals bürgerlichen) Revolutionären dabei am Anfang der Revolution die Unterstützung der Bevölkerungsmassen zu gewinnen. Februar 1848: Die Revolution von 1848 begann mit der Februarrevolution in Frankreich. Louis Philippe wird gestürzt und eine Republik ausgerufen. Die erneute Revolution in Frankreich löst nationale liberale Revolutionen in vielen Staaten Europas aus. Dazu gehörten neben Deutschland auch Italien, Polen und Ungarn. Die Revolution sollte letztendlich überall scheitern. März 1848: Märzrevolution in Deutschland : Mannheimer Volksversammlung. Die Revolution beginnt bereits Ende Februar, als Linksliberale im Großherzogtum Baden auf die Nachricht vom Sturz des französischen Königs hin eine Volksversammlung organisierten und dort eine Petition an den badischen Großherzog formulierten, welche die sogenannten Märzforderungen erhielt, die zu den zentralen Forderungen der Revolutionäre in ganz Deutschland wurden: (1) Volksbewaffnung mit freien Wahlen der Offiziere (2) Unbeschränkte Pressefreiheit (3) Schwurgerichte nach dem Vorbild Großbritanniens (also Schöffen als Laienrichter statt vom Staat ernannter beamteter Richter) (4) Sofortige Herstellung eines deutschen Parlaments, also deutsche Einheit. In den folgenden Tagen dehnte sich die revolutionäre Bewegung in allen deutschen Staaten aus. In vielen Orten kam es zu Volksversammlungen oder Demonstrationen des Volks. Häufig gaben die Fürsten (die von der Wucht der über sie hereinbrechenden Revolution überrascht worden waren) schnell nach und ernannten liberale Minister (Märzminister). Die Umwälzung verlief in vielen Staaten praktisch gewaltlos. Dies gilt aber nicht für Preußen und Österreich : Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Soldaten gibt der österreichische Minister Metternich auf. Er tritt zurück und flieht nach Großbritannien : Der preußische König versuchte eine Eskalation der Unruhen zu verhindern und gab den Forderungen der Revolutionäre zum größten Teil nach. Bei einer Veranstaltung zur Verlesung der Zugeständnisse vor dem Berliner Stadtschloss lösten sich zwei Schüsse. Ob die Schüsse beabsichtigt waren oder versehentlich abgegeben wurden, ist unklar. Die Schüsse lösen eine gewaltsame Eskalation der Situation aus. Es kommt zu Straßenkämpfen zwischen den Demonstranten und dem Militär, bei denen es mehrere hundert Tote gibt. König Friedrich Wilhelm IV. kapituliert schließlich und gibt den Forderungen der Revolutionäre noch weiter nach. So sagt er zu, dass Preußen eine Verfassung erhalten wird
15 und ernennt ein liberales Märzministerium. Am 19. März erscheint er vor den auf dem Schlosshof aufgebahrten Märzgefallenen und zieht als Zeichen der Ehrerbietung seine Mütze. Am 21. März reitet er mit schwarz-rot-goldener Schärpe durch Berlin und erklärt, er wolle Deutschlands Freiheit und Einigkeit. April 1848: Vorparlament. Nachdem die Revolution in ganz Deutschland gesiegt hat, beginnen die Revolutionäre die Wahlen zu einem ersten gesamtdeutschen Parlament zu organisieren. Im April 1848 trafen sich mehrere hundert Revolutionäre in Frankfurt. Dieses sogenannte Vorparlament legte fest, wann und wie gewählt werden sollte. Das Vorparlament war nicht gewählt worden. Einige Dutzend Revolutionäre hatten sich zuvor in Heidelberg getroffen und eine Liste aller Personen aufgestellt, die am Vorparlament teilnehmen sollten. Sie luden diese Personen zum Vorparlament ein. Anschließend wurde die Nationalversammlung gewählt. Das Wahlrecht zur Nationalversammlung war Sache der Einzelstaaten des Deutschen Bundes und wurde unterschiedlich gehandhabt. Die Nationalversammlung trat am 18. Mai 1848 in Frankfurt am Main zusammen. Parallel dazu löste sich der Deutsche Bund auf. Juni 1848: Die Nationalversammlung wählt Erzherzog Johann von Österreich zum provisorischen Staatsoberhaupt (mit dem Titel Reichsverweser). Da die Einzelstaaten die Kontrolle über ihre Armeen und Verwaltungen behielten, hat Johann nie wirkliche Macht gehabt Streitfragen und Probleme In der Nationalversammlung hatten Akademiker eine große Mehrheit. Es handelte sich um ein Professorenparlament. Die meisten anderen gesellschaftlichen Gruppen waren unterrepräsentiert. Die Nationalversammlung war bei ihrem Versuch eine Verfassung für ganz Deutschland auszuarbeiten schnell mit großen Problemen und Streitfragen konfrontiert. (a) Was sollte alles zu Deutschland dazu gehören? Es gab mehrere Möglichkeiten: (1) Großösterreichische Lösung. Alle Gebiete, die zum Kaiserreich Österreich gehörten gehört zum neuen deutschen Staat dazu. Bei dieser Lösung hätten sehr viele von Nichtdeutschen bewohnte Gebiete zu Deutschland gehört. Dies betrifft vor allem Ungarn, wo 1848 ebenfalls eine nationale Revolution ausgebrochen war. Ungarn strebte die Unabhängigkeit an. Diese Lösung wurde mehrfach vom österreichischen Herrscherhaus vorgeschlagen. (2) Großdeutsche Lösung. Alle als deutsch geltenden Gebiete des Kaiserreiches Österreich gehören zu Deutschland. Das hätte zur Folge gehabt, dass Ungarn nicht zu Deutschland gehörte hätte, aber Tschechien, da dieses als Teil Deutschlands galt, da es seit dem Mittelalter zum römisch-deutschen Reich und dann Deutschen Bund gehört hatte. Die Tschechen sahen sich natürlich nicht selbst auch als Deutsche an. (3) Kleindeutsche Lösung. Kein zum Kaiserreich Österreich gehörendes Gebiet gehört zum neuen vereinten Staat dazu. Damit wäre das heutige Österreich, das damals noch als selbstverständlicher Teil Deutschlands galt, aus Deutschland ausgeschieden. (b) Soll Deutschland ein Zensuswahlrecht haben oder das allgemeine Wahlrecht (wo alle Männer wählen dürfen)? (c) Soll Deutschland ein Zentralstaat, ein Bundesstaat oder ein loser Staatenbund werden? Q Deutschland war bis dahin nie ein Zentralstaat gewesen. Statt dessen hatte es schon damals eine lange bundesstaatliche Tradition. Auch das römisch-deutsche Reich kann
16 als Bundesstaat angesehen werden. (d) Soll das Staatsoberhaupt ein erblicher Monarch, ein gewählter Monarch oder ein gewählter Präsident sein? Die Rechtsliberalen traten häufig für den Bundesstaat, das Zensuswahlrecht und die kleindeutsche Lösung ein. Die Linksliberalen/Demokraten traten häufig für den Zentralstaat, das allgemeine Wahlrecht und die großdeutsche Lösung ein. Zugleich war mit dem Problem konfrontiert, dass die Nationalversammlung über keinerlei militärische Kräfte verfügte. Die Fürsten hatten die Kontrolle über die Armeen behalten. Dies machte sich bei Schleswig-Holstein-Konflikt unangenehm bemerkbar: Die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein sollten nach einem Vertrag von 1460 auf ewig unter einer gemeinsamen Herrschaft bleiben. Sie standen in Personalunion mit Dänemark, allerdings war nur Holstein Teil des Deutschen Bundes, während das Herzogtum Schleswig als ein dänisches Lehen galt. Deutsche Nationalisten forderten, Schleswig in den Deutschen Bund aufzunehmen und dem Herzogtum so eine Vertretung in der Nationalversammlung zu geben, während dänische Nationalisten Schleswig als Teil eines neuen dänischen Nationalstaats angliedern wollten. Im Auftrag des Deutschen Bundes besetzten preußische Truppen Schleswig-Holstein. Auf Drängen Großbritanniens, Russlands und Frankreichs vereinbarten Preußen und Dänemark dann aber am 26. August 1848 im schwedischen Malmö einen Waffenstillstand, der den Abzug aller Soldaten aus Schleswig- Holstein vorsah und das Land unter eine gemeinsame Verwaltung stellte. Die Frankfurter Nationalversammlung war nicht um ihre Zustimmung gefragt worden und musste der neuen Regelung schließlich gezwungenermaßen nachträglich zustimmen : Verabschiedung der Paulskirchenverfassung durch die Nationalversammlung (Verfassungstext: Die Nationalversammlung entschied sich für die kleindeutsche Lösung ohne Österreich. Die Bestimmungen wurden allerdings so gehalten, dass ein späterer Beitritt des als deutsch geltenden Österreich möglich sein sollte. So wurde festgelegt, wie viele Sitze Österreich im Staatenhaus haben sollte, wenn es Mitglied des vereinten Reichs wäre. Zudem entschied man sich für den Bundesstaat und für das allgemeine Wahlrecht. Zum Kaiser wurde der preußische König Friedrich Wilhelm IV. gewählt. Links: Friedrich Wilhelm IV. ( ) im Jahre Friedrich Wilhelm regierte von 1840 bis 1858 über Preußen. Er lehnte die Ideen der Revolution ab und war ein Anhänger des Absolutismus. Er war seiner Meinung nach von Gott als absolutistischer Herrscher eingesetzt worden. Außerdem bewunderte er das Mittelalter.
17 Verfassungsschema: Erläuterungen: Das Volkshaus wird durch das Volk direkt gewählt. Das Staatenhaus sollte von den Ländern (den Einzelstaaten) bestimmt werden. Erblicher Kaiser sollte der König von Preußen sein. Achtung: Diese Verfassung ist nie ratifiziert worden. Sie ist also nie in Kraft getreten Die Niederschlagung der Revolution Im Herbst des Jahres 1848 begann die Niederschlagung der Revolution durch die konservativen Fürsten. Die Revolution ist auf Grund verschiedener Probleme niedergeschlagen worden: (1) Fehlende Unterstützung durch die Bauern. Die Bauern stellten 1848 noch immer die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Die Revolution war im März 1848 nicht zuletzt auch deshalb erfolgreich gewesen, weil sich ihr in vielen Gebieten auch die Bauern (also die Mehrheit der Bevölkerung) angeschlossen hatte. Die Bauern verfolgten dabei ihre eigenen Interessen. Sie strebten eine Vollendung der Bauernbefreiung (in einzelnen Gebieten sogar den Beginn der Bauernbefreiung) an. Der Prozess der Bauernbefreiung dauerte ihnen zu lange. Die Fürsten und die Regierungen gingen nach dem Ausbruch der Revolution dazu über, die Bauernbefreiung überall schnell zu vollenden. Nach diesem Erfolg waren alle Ziele der Bauern erreicht worden. Sie wurden anschließend passiv und schauten der Niederschlagung der Revolution durch die konservativen Staatsgewalten einfach zu. Da die weitergehenden politischen Ziele der Revolutionäre nicht ihre Ziele gewesen waren, interessierte sie die weitere Entwicklung kaum. Die Bauern erwiesen sich in der Folgezeit sogar als tendenziell konservativ.
18 (2) Die Fürsten hatten die Kontrolle über die Armeen behalten. Die Revolutionäre hatten es im März 1848 nicht für notwendig gehalten, den Fürsten die Kontrolle über ihre Armeen vollständig zu entreißen und die obrigkeitstreuen Armeen vielleicht sogar aufzulösen. Gerade die Rechtsliberalen strebten eine konstitutionelle Monarchie an und lehnten daher einen solchen Schritt ab, da er einer vollständigen Demontage der Fürsten gleich kam. Man begnügte sich damit, dass die Ministerien von liberalen Politikern kontrolliert wurden. Das gab den Fürsten aber die Möglichkeit, zuerst ihre Kontrolle über die Armeen zu konsolidieren (Entlassung von unzuverlässigen Offizieren) und dann mit diesen Armeen die Niederschlagung der Revolution zu beginnen. Die Revolutionäre wiederum hatten es versäumt, sich eigene Streitkräfte zu verschaffen. Sie standen dem Militär der Fürsten ab Herbst 1848 ohne gleichwertige Kräfte gegenüber. Das hatte schon in der Schleswig-Holstein-Frage zu Problemen geführt und wiederholte sich hier. Dazu kam, dass insbesondere die Rechtsliberalen glaubten in ihren Auseinandersetzungen mit den Linksliberalen auf den militärischen Schutz der Fürsten angewiesen zu sein. Das machte die Rechtsliberalen besonders kompromissbereit. (3) Die Revolutionäre waren uneinig. Die Linksliberalen versuchten (mit gewissem Erfolg) die Unterschichten für ihre Ziele zu mobilisieren. Dies gelang ihnen vor allem in Süddeutschland, wo sie über so viel Massenanhang verfügten, dass sie mehrfach Aufstände organisieren konnten. Und insbesondere die radikalen Linksliberalen waren dazu bereit Gewalt für die Erreichung ihrer Ziele einzusetzen. Dies zeigte sich vor allem im Herbst 1848, nachdem die Nationalversammlung sich gezwungen gesehen hatte, dem Vertrag von Malmö zuzustimmen. Zugestimmt hatten vor allem rechtsliberale Gruppen. Aus Protest gegen den scheinbaren nationalen Verrat kam es zu bewaffneten Erhebungen radikaler Demokraten. Dazu gehörten die Septemberunruhen in Frankfurt am Main, einem Volksaufstand, den die Nationalversammlung schließlich durch preußische und österreichische Truppen niederschlagen ließ. Nach diesen Auseinandersetzungen eskalierte die Situation. Es kam in mehreren Staaten (vor allem Süddeutschlands) zu Erhebungen der Radikalen. Die Unruhen griffen aber auch auf Wien über, wo der Demokrat Robert Blum im Zuge der Auseinandersetzungen umkam. Diese Unruhen waren für die Rechtsliberalen ein Beweis für die gewalttätige Haltung der Linken und ihre Neigung zur Aufhetzung des Pöbels. Gegen diese linke Gefahr setzten sie auf die Unterstützung der Fürsten. Als die Revolution niedergeschlagen wurde, machten die Fürsten Zugeständnisse, um die Rechtsliberalen an sich zu binden. So wurden in den meisten Staaten oktroyierte (aufgezwungene) Verfassungen erlassen, die dem Volk zumindest eine gewisse Beteiligung an der Macht gewährten. Die Rechtsliberalen gaben sich mit diesen Zugeständnissen zunächst zufrieden. (4) Die Rechtsliberalen hofften auf die Unterstützung König Friedrich Wilhelms IV., dem die Nationalversammlung die Kaiserkrone geben wollte. Man hoffte darauf, damit den Staat Preußen auf der eigenen Seite zu haben. Aber Friedrich Wilhelm IV. lehnte die ihm angebotene Krone ab und demoralisierte die Rechtsliberalen damit. (5) Einige Historiker haben den Revolutionären bzw. speziell den Abgeordneten der Paulskirche vorgeworfen, dass sie viel zu lange über die deutsche Verfassung und die zukünftigen Strukturen des vereinten Deutschland diskutiert hätten. Während sie noch diskutiert hätten, hätte sich die Gegenrevolution organisiert. Andere Historiker haben denselben Sachverhalt als Problem gesehen, aber die Revolutionäre vom Vorwurf des Versagens freigesprochen: Die Revolutionäre hätten 1848 vor viel zu viel Problemen gestanden, so dass sie ihre Aufgabe nicht bewältigt hätten. Sie hätten nicht nur eine Verfassung ausarbeiten müssen, sondern gleichzeitig auch noch die deutschen Grenzen festlegen müssen. Außerdem hätten sie gleichzeitig auch mit außenpolitischen Problemen fertig werden müssen, wie den Auseinandersetzungen mit Dänemark.
Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert
 Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert Im Laufe seiner Eroberungskriege, verbreitete Napoleon, bewusst oder unbewusst, den, von der französischen Revolution erfundenen,
Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert Im Laufe seiner Eroberungskriege, verbreitete Napoleon, bewusst oder unbewusst, den, von der französischen Revolution erfundenen,
DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION
 DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION Niklas Roth Die Französische Revolution hatte in vielerlei Hinsicht große Auswirkungen auf die damaligen sozialen und politischen Verhältnisse und ihre Prinzipien der Freiheit,
DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION Niklas Roth Die Französische Revolution hatte in vielerlei Hinsicht große Auswirkungen auf die damaligen sozialen und politischen Verhältnisse und ihre Prinzipien der Freiheit,
Napoleon verändert die Landkarte Europas
 Klasse 8a Geschichte 13. 05. 2015 Napoleon verändert die Landkarte Europas Ziel: Feind: Maßnahme: Auflösung des: Schaffung des: Gebietsveränderungen durch: und Eroberungen: Errungenschaften: Klasse 8a
Klasse 8a Geschichte 13. 05. 2015 Napoleon verändert die Landkarte Europas Ziel: Feind: Maßnahme: Auflösung des: Schaffung des: Gebietsveränderungen durch: und Eroberungen: Errungenschaften: Klasse 8a
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Abiturfragen - Grundwissen Geschichte - Teil 3
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Abiturfragen - Grundwissen Geschichte - Teil 3 Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Thema: Abiturfragen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Abiturfragen - Grundwissen Geschichte - Teil 3 Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Thema: Abiturfragen
Frühkonstitutionalismus in Deutschland
 A 2003/6945 Carola Schulze V Frühkonstitutionalismus in Deutschland Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 11 1. Kapitel: Konstitutionalismus und Verfassung
A 2003/6945 Carola Schulze V Frühkonstitutionalismus in Deutschland Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 11 1. Kapitel: Konstitutionalismus und Verfassung
Territoriale Veränderungen durch Napoleon und dadurch nötige Reformen
 Territoriale Veränderungen durch Napoleon und dadurch nötige Reformen Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation Umverteilung der Gebiete durch die Reichsdeputation, einen Ausschuss beim RT in Regensburg,
Territoriale Veränderungen durch Napoleon und dadurch nötige Reformen Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation Umverteilung der Gebiete durch die Reichsdeputation, einen Ausschuss beim RT in Regensburg,
Was danach geschah -Weimarer Republik ( )
 Was danach geschah -Weimarer Republik (1919-1933) Parlamentarische Demokratie Vertreter: Phillip Scheidemann, Friedrich Ebert (SPD) Konzept: -Volk wählt Vertreter -Vertreter haben freies Mandat -bilden
Was danach geschah -Weimarer Republik (1919-1933) Parlamentarische Demokratie Vertreter: Phillip Scheidemann, Friedrich Ebert (SPD) Konzept: -Volk wählt Vertreter -Vertreter haben freies Mandat -bilden
Der Wiener Kongress 1814/15
 Der Wiener Kongress 1814/15 Einleitung Gestörte Nachtruhe Fürst Klemens von Metternicherhält eine Depesche... Napoleon hat Elba verlassen! Die Spitzen der europäischen Politik in Wien Kapitel 1 Stichwörter
Der Wiener Kongress 1814/15 Einleitung Gestörte Nachtruhe Fürst Klemens von Metternicherhält eine Depesche... Napoleon hat Elba verlassen! Die Spitzen der europäischen Politik in Wien Kapitel 1 Stichwörter
Deutschland im 19. Jahrhundert
 Manfred Görtemaker Deutschland im 19. Jahrhundert Entwicklungslinien Bundeszentrale für politische Bildung Inhalt I. Das Zeitalter der Französischen Revolution 14 Zeittafel 14 1. Die geistige Vorbereitung
Manfred Görtemaker Deutschland im 19. Jahrhundert Entwicklungslinien Bundeszentrale für politische Bildung Inhalt I. Das Zeitalter der Französischen Revolution 14 Zeittafel 14 1. Die geistige Vorbereitung
Staat und Politik
 2. 2 - Staat und Politik - Grundlagen eines Staates - Staats- und Regierungsformen Grundlagen eines Staates - Fragenkatalog 1. Über welche drei gemeinsamen Merkmale verfügen alle Staaten? 2. Wie hoch war
2. 2 - Staat und Politik - Grundlagen eines Staates - Staats- und Regierungsformen Grundlagen eines Staates - Fragenkatalog 1. Über welche drei gemeinsamen Merkmale verfügen alle Staaten? 2. Wie hoch war
Monarchie zur Republik wurde. Oktober 1918 österreichischen Abgeordnetenhauses deutsch österreichischen Staat Regierungsgeschäften.
 Ich möchte euch heute erzählen, wie Österreich von der Monarchie zur Republik wurde. Im Oktober 1918 versammelten sich die deutschsprachigen Mitglieder des österreichischen Abgeordnetenhauses in Wien.
Ich möchte euch heute erzählen, wie Österreich von der Monarchie zur Republik wurde. Im Oktober 1918 versammelten sich die deutschsprachigen Mitglieder des österreichischen Abgeordnetenhauses in Wien.
Inhaltsverzeichnis. Der autokratische Gendarm: Russland von Katharina II., der Großen, bis zu Nikolaus I. Edgar Hösch 12
 Inhaltsverzeichnis Europa im Zeitalter des Absolutismus Die europäischen Mächte in der Epoche des Ancien Regime {Fortsetzung) Der autokratische Gendarm: Russland von Katharina II., der Großen, bis zu Nikolaus
Inhaltsverzeichnis Europa im Zeitalter des Absolutismus Die europäischen Mächte in der Epoche des Ancien Regime {Fortsetzung) Der autokratische Gendarm: Russland von Katharina II., der Großen, bis zu Nikolaus
Clemens-August-Gymnasium, Cloppenburg Schuleigenes Fachcurriculum Geschichte Klasse 8
 Grundlage: Kerncurriculum für das Gymnasium, Schuljahrgänge 5-10, Geschichte, Jgs. 8 Lehrbuch: Geschichte und Geschehen G, Niedersachsen Band 4 Absolutismus und Aufklärung ca. 10 14 erläutern den Begriff
Grundlage: Kerncurriculum für das Gymnasium, Schuljahrgänge 5-10, Geschichte, Jgs. 8 Lehrbuch: Geschichte und Geschehen G, Niedersachsen Band 4 Absolutismus und Aufklärung ca. 10 14 erläutern den Begriff
Die Europäische Union
 Die Europäische Union Die Mitgliedsländer der Europäischen Union Im Jahr 1957 schlossen sich die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich der Niederlande unter
Die Europäische Union Die Mitgliedsländer der Europäischen Union Im Jahr 1957 schlossen sich die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich der Niederlande unter
a) Unterstreiche in grün durch welche Mittel die Vergrößerung des Herrschaftsgebietes erreicht wurde.
 M1: Der Aufstieg Brandenburg-Preußens zum Königtum Seit 1415 herrschten die Hohenzollern als Kurfürsten in Brandenburg. Friedrich III. wurde unter dem Namen Friedrich I. von Preußen zum König. Durch geschickte
M1: Der Aufstieg Brandenburg-Preußens zum Königtum Seit 1415 herrschten die Hohenzollern als Kurfürsten in Brandenburg. Friedrich III. wurde unter dem Namen Friedrich I. von Preußen zum König. Durch geschickte
zeitreise 3 zeitreise 2 Bayern Bayern Zeitreise Stoffverteilungsplan für Wirtschaftsschulen in Bayern, Klassenstufe 7
 zeitreise 2 zeitreise 3 Bayern Bayern Zeitreise Stoffverteilungsplan für Wirtschaftsschulen in Bayern, Klassenstufe 7 Klassenstufe 7 Zeitreise Bayern Band 2 Lehrplan Geschichte 7.1 Frühe Neuzeit (15 Unterrichtsstunden)
zeitreise 2 zeitreise 3 Bayern Bayern Zeitreise Stoffverteilungsplan für Wirtschaftsschulen in Bayern, Klassenstufe 7 Klassenstufe 7 Zeitreise Bayern Band 2 Lehrplan Geschichte 7.1 Frühe Neuzeit (15 Unterrichtsstunden)
Das Scheitern der bürgerlich-liberalen Einheits- und Freiheitsbewegung in Deutschland [Überblick von Paul]
![Das Scheitern der bürgerlich-liberalen Einheits- und Freiheitsbewegung in Deutschland [Überblick von Paul] Das Scheitern der bürgerlich-liberalen Einheits- und Freiheitsbewegung in Deutschland [Überblick von Paul]](/thumbs/53/31013195.jpg) Das Scheitern der bürgerlich-liberalen Einheits- und Freiheitsbewegung in Deutschland [Überblick von Paul] Wirkung der Französischen Revolution und Napoleons auf Deutschland - Ausgangssituation (um 1800)
Das Scheitern der bürgerlich-liberalen Einheits- und Freiheitsbewegung in Deutschland [Überblick von Paul] Wirkung der Französischen Revolution und Napoleons auf Deutschland - Ausgangssituation (um 1800)
VORANSICHT. Napoleon und der Wiener Kongress ein Rollenspiel um die Neuordnung Europas nach Napoleon. Das Wichtigste auf einen Blick
 V 19. Jahrhundert Beitrag 8 Rollenspiel um die Neuordnung Europas (Klasse 8) 1 von 36 Napoleon und der Wiener Kongress ein Rollenspiel um die Neuordnung Europas nach Napoleon Dirk Friedrichs, Hannover
V 19. Jahrhundert Beitrag 8 Rollenspiel um die Neuordnung Europas (Klasse 8) 1 von 36 Napoleon und der Wiener Kongress ein Rollenspiel um die Neuordnung Europas nach Napoleon Dirk Friedrichs, Hannover
Schuleigener Lehrplan Geschichte (Klasse 8)
 Schuleigener Lehrplan Geschichte (Klasse 8) Absolutismus und Aufklärung (Lehrbuch Bd. 3 alt, S.200-231) erläutern den Begriff Absolutismus Ludwig XIV. (1661-1715) ein erklären, dass Handeln von Men- als
Schuleigener Lehrplan Geschichte (Klasse 8) Absolutismus und Aufklärung (Lehrbuch Bd. 3 alt, S.200-231) erläutern den Begriff Absolutismus Ludwig XIV. (1661-1715) ein erklären, dass Handeln von Men- als
Deutschlands Verfassung
 Rudolf Weber-Fas Deutschlands Verfassung Vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart 1997 BOUVIER VERLAG BONN Inhalt Erster Teil: Vom Deutschen Bund zur Bundesrepublik Deutschland 1. Kapitel: Das Ende des alten
Rudolf Weber-Fas Deutschlands Verfassung Vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart 1997 BOUVIER VERLAG BONN Inhalt Erster Teil: Vom Deutschen Bund zur Bundesrepublik Deutschland 1. Kapitel: Das Ende des alten
Geschichte Europas
 Manfred Görtemaker Geschichte Europas 1850-1918 Verlag W. Kohlhammer Einleitung 9 I. Europa nach der Revolution 1. Der Sieg der Reaktion 11 a) Das Scheitern der demokratischen Erhebungen 11 b) Das Zweite
Manfred Görtemaker Geschichte Europas 1850-1918 Verlag W. Kohlhammer Einleitung 9 I. Europa nach der Revolution 1. Der Sieg der Reaktion 11 a) Das Scheitern der demokratischen Erhebungen 11 b) Das Zweite
Grußwort des Herrn Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rößler zum 25. Jahrestag der friedlichen Revolution am 09. Oktober 2014
 Grußwort des Herrn Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rößler zum 25. Jahrestag der friedlichen Revolution am 09. Oktober 2014 (Anrede) der 9. Oktober 1989 war der Höhepunkt der friedlichen Revolution. Mehr
Grußwort des Herrn Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rößler zum 25. Jahrestag der friedlichen Revolution am 09. Oktober 2014 (Anrede) der 9. Oktober 1989 war der Höhepunkt der friedlichen Revolution. Mehr
Geschichtsreferat 1848/1849. Martin Majewski 13c
 Geschichtsreferat 1848/1849 Martin Majewski 13c Inhalt: 1. Der Vormärz 1.1 Der Deutsche Bund 1.2 Restauration oder Reformen? 1.3 Die Julirevolution und der Vormärz 1.4 Der Pauperismus 2. Die Märzrevolution
Geschichtsreferat 1848/1849 Martin Majewski 13c Inhalt: 1. Der Vormärz 1.1 Der Deutsche Bund 1.2 Restauration oder Reformen? 1.3 Die Julirevolution und der Vormärz 1.4 Der Pauperismus 2. Die Märzrevolution
ON! DVD Föderalismus in Deutschland Arbeitsmaterialien Seite 1. Zu Beginn der Einheit bekommen die SchülerInnen
 ON! DVD Föderalismus in Deutschland Arbeitsmaterialien Seite 1 Föderalismus historisch Einstieg Zu Beginn der Einheit bekommen die SchülerInnen das Arbeitsblatt Deutsche Geschichte und versuchen im Gitternetz
ON! DVD Föderalismus in Deutschland Arbeitsmaterialien Seite 1 Föderalismus historisch Einstieg Zu Beginn der Einheit bekommen die SchülerInnen das Arbeitsblatt Deutsche Geschichte und versuchen im Gitternetz
NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8
 3 01 NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8 DIE DEUTSCHE NATIONALBEWEGUNG IN VORMÄRZ UND REVOLUTION (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
3 01 NATIONALISMUS, NATIONALSTAAT UND DEUTSCHE IDENTITÄT IM 19. JAHRHUNDERT 8 DIE DEUTSCHE NATIONALBEWEGUNG IN VORMÄRZ UND REVOLUTION (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
Fürstenstaat oder Bürgernation
 Horst Möller Fürstenstaat oder Bürgernation Deutschland 1763-1815 Siedler Vorwort 9 I. Einleitung: Vom österreichischpreußischen Dualismus zur revolutionären Herausforderung 13 1. Krieg und Frieden: das»mirakel
Horst Möller Fürstenstaat oder Bürgernation Deutschland 1763-1815 Siedler Vorwort 9 I. Einleitung: Vom österreichischpreußischen Dualismus zur revolutionären Herausforderung 13 1. Krieg und Frieden: das»mirakel
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Das 19. Jahrhundert - Das müssen Schüler in der Oberstufe wissen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das 19. Jahrhundert - Das müssen Schüler in der Oberstufe wissen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Das
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das 19. Jahrhundert - Das müssen Schüler in der Oberstufe wissen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Das
Französische Revolution (10 Stunden)
 Französische Revolution (10 Stunden) Frankreich in der Krise Grundzüge des Absolutismus Ständegesellschaft Von der Finanz- zur Staatskrise Interessen verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen kennen
Französische Revolution (10 Stunden) Frankreich in der Krise Grundzüge des Absolutismus Ständegesellschaft Von der Finanz- zur Staatskrise Interessen verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen kennen
Geschichte - betrifft uns
 1983 9 Weltwirtschaftskrise 1929-1933, Ursachen und Folgen (n.v.) 10 Armut und soziale Fürsorge vor der Industrialisierung 11 Frieden durch Aufrüstung oder Abrüstung 1918-1939 12 Europa zwischen Integration
1983 9 Weltwirtschaftskrise 1929-1933, Ursachen und Folgen (n.v.) 10 Armut und soziale Fürsorge vor der Industrialisierung 11 Frieden durch Aufrüstung oder Abrüstung 1918-1939 12 Europa zwischen Integration
nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19. jahrhundert 8
 3 01 nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19 jahrhundert 8 Die deutsche nationalbewegung in vormärz und revolution (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
3 01 nationalismus, nationalstaat und deutsche identität im 19 jahrhundert 8 Die deutsche nationalbewegung in vormärz und revolution (1815 1848) 10 Orientierung: Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz
Einführung in die Geschichte der Neuzeit Grundkurs BA Sitzung 5
 Einführung in die Geschichte der Neuzeit Grundkurs BA Sitzung 5 1789-1815 I. Die französische Revolution 1.) Ursachen Folgen der entschiedenen Umsetzung des Konzepts eines monarchischen Absolutismus in
Einführung in die Geschichte der Neuzeit Grundkurs BA Sitzung 5 1789-1815 I. Die französische Revolution 1.) Ursachen Folgen der entschiedenen Umsetzung des Konzepts eines monarchischen Absolutismus in
Krieg in der Geschichte Otto Dix Der Krieg (1923)
 Krieg in der Geschichte Otto Dix Der Krieg (1923) 1 Der Weg zum totalen Krieg Referenten: Sebastian Seidel, Nils Theinert, Stefan Zeppenfeld Gliederung Die Koalitionskriege 1792 1815 Der Amerikanische
Krieg in der Geschichte Otto Dix Der Krieg (1923) 1 Der Weg zum totalen Krieg Referenten: Sebastian Seidel, Nils Theinert, Stefan Zeppenfeld Gliederung Die Koalitionskriege 1792 1815 Der Amerikanische
Wer lebt in Europa? Die Entstehung der Europäischen Union
 Wer lebt in Europa? Europa wird von verschiedenen Nationen bewohnt. Die meisten Staaten Nord-, West-, Süd- und Mitteleuropas sind Mitglieder der Europäischen Union. Seit 2004 dehnt sich die EU immer weiter
Wer lebt in Europa? Europa wird von verschiedenen Nationen bewohnt. Die meisten Staaten Nord-, West-, Süd- und Mitteleuropas sind Mitglieder der Europäischen Union. Seit 2004 dehnt sich die EU immer weiter
Folgen der Französischen Revolution : Nationalismus und Nationalstaatsbildung in Europa
 Folgen der Französischen Revolution : Nationalismus und Nationalstaatsbildung in Europa Gliederung Einleitende Worte Definition des Nationalismus Merkmale Französische Revolution Folgen der Revolution
Folgen der Französischen Revolution : Nationalismus und Nationalstaatsbildung in Europa Gliederung Einleitende Worte Definition des Nationalismus Merkmale Französische Revolution Folgen der Revolution
Anschließend: Auf Napoleons Liebespfaden
 HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG 1789 1813 2013 Einführung in die Vorlesungsreihe Anschließend: Auf Napoleons Liebespfaden www.htwk-leipzig.de/studium-generale Dr. Martin Schubert
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG 1789 1813 2013 Einführung in die Vorlesungsreihe Anschließend: Auf Napoleons Liebespfaden www.htwk-leipzig.de/studium-generale Dr. Martin Schubert
Selbstüberprüfung: Europa und die Welt im 19. Jahrhundert. 184
 3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei
 der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
Bildungsstandards für Geschichte. Kursstufe (4-stündig)
 Stoffverteilungsplan und Geschehen Baden-Württemberg 11 Band 1 Schule: 978-3-12-430016-4 Lehrer: und Geschehen und Geschehen 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit
Stoffverteilungsplan und Geschehen Baden-Württemberg 11 Band 1 Schule: 978-3-12-430016-4 Lehrer: und Geschehen und Geschehen 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit
Gliederung Kindheit Regentschaft Reformen Konflikt zwischen Wilhelm und Bismarck Wirtschaftliche Blüte 1. Weltkrieg Abdankung Exil Tod Quellen
 Kaiser Wilhelm II. Gliederung Kindheit Regentschaft Reformen Konflikt zwischen Wilhelm und Bismarck Wirtschaftliche Blüte 1. Weltkrieg Abdankung Exil Tod Quellen Kindheit Geboren am 27. Januar 1859 in
Kaiser Wilhelm II. Gliederung Kindheit Regentschaft Reformen Konflikt zwischen Wilhelm und Bismarck Wirtschaftliche Blüte 1. Weltkrieg Abdankung Exil Tod Quellen Kindheit Geboren am 27. Januar 1859 in
Du hast vier Arbeitsblätter (AB) erhalten. Gehe folgendermaßen vor:
 Die Landgrafschaft HNA SonntagsZeit, 0.0.00, S., Jürgen Nolte AB Der Norden Hessens spielte Mitte des. Jahrhunderts als Landgrafschaft Hessen-Kassel mit gerade mal knapp 0 000 Einwohnern eine vergleichsweise
Die Landgrafschaft HNA SonntagsZeit, 0.0.00, S., Jürgen Nolte AB Der Norden Hessens spielte Mitte des. Jahrhunderts als Landgrafschaft Hessen-Kassel mit gerade mal knapp 0 000 Einwohnern eine vergleichsweise
Die Revolution von 1848 / Ein Überblick von Felix Heckert
 Ein Überblick von Felix Heckert 1) Langfristige Revolutionsursachen Bevölkerungswachstum Arbeitslosigkeit Landflucht Pauperismus Verschärfung der sozialen Gegensätze zwischen Armen und Reichen Adel: Weigerung
Ein Überblick von Felix Heckert 1) Langfristige Revolutionsursachen Bevölkerungswachstum Arbeitslosigkeit Landflucht Pauperismus Verschärfung der sozialen Gegensätze zwischen Armen und Reichen Adel: Weigerung
Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 )
 1815-1850 Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 ) Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie
1815-1850 Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk ( 1830 ) Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie
Flugblatt Frankreich Flugblatt Frankreich Hier ruht ganz Frankreich. Robespierre. Verfassungen von 1791 und 1793
 Flugblatt Frankreich 1789 Flugblatt Frankreich 1794 Hier ruht ganz Frankreich Robespierre Adel (2.Stand) Klerus (1.Stand) Bürger/Bauer (3.Stand) Q: Das Erwachen des Dritten Standes, Anonymes Flugblatt
Flugblatt Frankreich 1789 Flugblatt Frankreich 1794 Hier ruht ganz Frankreich Robespierre Adel (2.Stand) Klerus (1.Stand) Bürger/Bauer (3.Stand) Q: Das Erwachen des Dritten Standes, Anonymes Flugblatt
Die Verfassung von Französische Revolution Verfassung 1791 digitale-schule-bayern.de -Roman Eberth
 Die Verfassung von 1791 Die Verfassung von 1791 Die Verfassung von 1791 verfügte eine strenge Trennung der der politischen Organe der ausführenden Gewalt, der gesetzgebenden Gewalt und der Rechtsprechung.
Die Verfassung von 1791 Die Verfassung von 1791 Die Verfassung von 1791 verfügte eine strenge Trennung der der politischen Organe der ausführenden Gewalt, der gesetzgebenden Gewalt und der Rechtsprechung.
AM VORABEND DES ERSTEN WELTKRIEGS: STAATEN UND IHRE INTERESSEN
 AM VORABEND DES ERSTEN WELTKRIEGS: STAATEN UND IHRE INTERESSEN Ziele: Vorherrschaft in Europa, Wettstreit um die Kolonien Deutsches Kaiserreich wirtschaftliche, politische und militärische Großmacht Frankreich
AM VORABEND DES ERSTEN WELTKRIEGS: STAATEN UND IHRE INTERESSEN Ziele: Vorherrschaft in Europa, Wettstreit um die Kolonien Deutsches Kaiserreich wirtschaftliche, politische und militärische Großmacht Frankreich
Im Original veränderbare Word-Dateien
 Novemberrevolution und der Friedensvertrag von Versailles Aufgabe 1 Nennt die Gründe für die Meuterei der Matrosen in Wilhelmshaven. Aufgabe 2 Überlegt, warum sich auch Arbeiter den Aufständen in Kiel
Novemberrevolution und der Friedensvertrag von Versailles Aufgabe 1 Nennt die Gründe für die Meuterei der Matrosen in Wilhelmshaven. Aufgabe 2 Überlegt, warum sich auch Arbeiter den Aufständen in Kiel
Fachcurriculum Geschichte Klasse 7/8 LPE 7.1: Herrschaft im Mittelalter Inhalte Methoden und Schwerpunkte Daten und Begriffe
 Das Reich der Franken Pippin; Rolle des Papstes Karl der Große Reisekönigtum Lehnswesen Fachcurriculum Geschichte Klasse 7/8 LPE 7.1: Herrschaft im Mittelalter Quellen auf ihre Standortgebundenheit prüfen
Das Reich der Franken Pippin; Rolle des Papstes Karl der Große Reisekönigtum Lehnswesen Fachcurriculum Geschichte Klasse 7/8 LPE 7.1: Herrschaft im Mittelalter Quellen auf ihre Standortgebundenheit prüfen
Geschichte des jüdischen Volkes
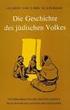 Geschichte des jüdischen Volkes Von den Anfängen bis zur Gegenwart Unter Mitwirkung von Haim Hillel Ben-Sasson, Shmuel Ettinger s Abraham Malamat, Hayim Tadmor, Menahem Stern, Shmuel Safrai herausgegeben
Geschichte des jüdischen Volkes Von den Anfängen bis zur Gegenwart Unter Mitwirkung von Haim Hillel Ben-Sasson, Shmuel Ettinger s Abraham Malamat, Hayim Tadmor, Menahem Stern, Shmuel Safrai herausgegeben
Woche 4: Kriege im Zeitalter des Nationalismus
 Woche 4: Kriege im Zeitalter des Nationalismus Internationale Konfliktforschung I: Kriegsursachen im historischen Kontext Seraina Rüegger ruegger@icr.gess.ethz.ch 12.10.2016 Seraina Rüegger Konfliktforschung
Woche 4: Kriege im Zeitalter des Nationalismus Internationale Konfliktforschung I: Kriegsursachen im historischen Kontext Seraina Rüegger ruegger@icr.gess.ethz.ch 12.10.2016 Seraina Rüegger Konfliktforschung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Industrialisierung im 19. Jahrhundert - komplett in 20 Arbeitsblättern!
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Industrialisierung im 19. Jahrhundert - komplett in 20 Arbeitsblättern! Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Industrialisierung im 19. Jahrhundert - komplett in 20 Arbeitsblättern! Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
2. Reformation und Dreißigjähriger Krieg
 THEMA 2 Reformation und Dreißigjähriger Krieg 24 Die Ausbreitung der Reformation LERNZIELE Voraussetzung der Ausbreitung der Reformation kennenlernen Die entstehende Glaubensspaltung in Deutschland anhand
THEMA 2 Reformation und Dreißigjähriger Krieg 24 Die Ausbreitung der Reformation LERNZIELE Voraussetzung der Ausbreitung der Reformation kennenlernen Die entstehende Glaubensspaltung in Deutschland anhand
Schule: Lehrer: Parlament Absolutismus. Intendant. Merkantilismus, merkantilistisch Manufaktur Aufklärung
 Stoffverteilungsplan Geschichte und Geschehen, Schleswig-Holstein Band 4 Schule: Lehrer: Orientierungshilfe G8 für die Sekundarstufe I Geschichte und Geschehen (Ausgabe G), Band 4 Historische Grundbegriffe
Stoffverteilungsplan Geschichte und Geschehen, Schleswig-Holstein Band 4 Schule: Lehrer: Orientierungshilfe G8 für die Sekundarstufe I Geschichte und Geschehen (Ausgabe G), Band 4 Historische Grundbegriffe
WERNER DAHLHEIM JULIUS CAESAR DIE EHRE DES KRIEGERS UND DIE NOT DES STAATES 2. AUFLAGE FERDINAND SCHONINGH PADERBORN MÜNCHEN WIEN ZÜRICH
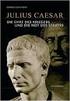 WERNER DAHLHEIM JULIUS CAESAR DIE EHRE DES KRIEGERS UND DIE NOT DES STAATES 2. AUFLAGE FERDINAND SCHONINGH PADERBORN MÜNCHEN WIEN ZÜRICH INHALT VORWORT 11 EINLEITUNG 13 I. DIE UMSTÄNDE DES LEBENS (1) DIE
WERNER DAHLHEIM JULIUS CAESAR DIE EHRE DES KRIEGERS UND DIE NOT DES STAATES 2. AUFLAGE FERDINAND SCHONINGH PADERBORN MÜNCHEN WIEN ZÜRICH INHALT VORWORT 11 EINLEITUNG 13 I. DIE UMSTÄNDE DES LEBENS (1) DIE
RÖMISCHES REICH. Wer bestimmt im Römischen Reich
 RÖMISCHES REICH 800 v. Chr. Griechische Polis entstehen 600 v. Chr. Solon 508 v. Chr. Kleisthenes (Isonomie) 500 v. Chr. Athen ist auf dem Höhepunkt. 500 v. Chr. in Rom werden die Könige vertrieben. MYTHOLOGISHE
RÖMISCHES REICH 800 v. Chr. Griechische Polis entstehen 600 v. Chr. Solon 508 v. Chr. Kleisthenes (Isonomie) 500 v. Chr. Athen ist auf dem Höhepunkt. 500 v. Chr. in Rom werden die Könige vertrieben. MYTHOLOGISHE
Die Koalitionskriege:
 Die Koalitionskriege: 1. Koalitionskrieg Die erste Koalition (1792-1797) war der erste Versuch der europäischen Mächte, die Französische Revolution und ihre Auswirkungen einzudämmen. Frankreich begann,
Die Koalitionskriege: 1. Koalitionskrieg Die erste Koalition (1792-1797) war der erste Versuch der europäischen Mächte, die Französische Revolution und ihre Auswirkungen einzudämmen. Frankreich begann,
mentor Grundwissen: Geschichte bis zur 10. Klasse
 mentor Grundwissen mentor Grundwissen: Geschichte bis zur 10. Klasse Alle wichtigen Themen von Bettina Marquis, Martina Stoyanoff-Odoy 1. Auflage mentor Grundwissen: Geschichte bis zur 10. Klasse Marquis
mentor Grundwissen mentor Grundwissen: Geschichte bis zur 10. Klasse Alle wichtigen Themen von Bettina Marquis, Martina Stoyanoff-Odoy 1. Auflage mentor Grundwissen: Geschichte bis zur 10. Klasse Marquis
Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien
 Englisch Florian Schumacher Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien Studienarbeit Inhaltsverzeichnis I. Der Faschismus in Großbritannien vor 1936... 2 1. Die Ausgangssituation Anfang der zwanziger
Englisch Florian Schumacher Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien Studienarbeit Inhaltsverzeichnis I. Der Faschismus in Großbritannien vor 1936... 2 1. Die Ausgangssituation Anfang der zwanziger
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Klausur mit Erwartungshorizont: Die Deutsche Bundesakte vom 08.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klausur mit Erwartungshorizont: Die Deutsche Bundesakte vom 08. Juni 1815 Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klausur mit Erwartungshorizont: Die Deutsche Bundesakte vom 08. Juni 1815 Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich
 Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich Buchners Kolleg. Themen Geschichte Nationalstaatsbildung Wurzeln unserer Identität (ISBN 978-3-7661-7317-1) C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG
Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich Buchners Kolleg. Themen Geschichte Nationalstaatsbildung Wurzeln unserer Identität (ISBN 978-3-7661-7317-1) C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG
Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg?
 Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg: Ein Konflikt gekennzeichnet durch massenhafte Gewalt 1. Raum: Die Bilanz: eine zerstörte Generation
Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg: Ein Konflikt gekennzeichnet durch massenhafte Gewalt 1. Raum: Die Bilanz: eine zerstörte Generation
BEREICH 2: DIE WELT: KRIEGE, KRISEN, HUNGERSNOT
 BEREICH 2: DIE WELT: KRIEGE, KRISEN, HUNGERSNOT DIE WELT ZUR ZEIT, ALS GOETHE LEBTE: KRIEGE UND KRISEN Goethe lebte in einer Zeit, in der sich die Welt stark veränderte. Vor allem Ereignisse wie der amerikanische
BEREICH 2: DIE WELT: KRIEGE, KRISEN, HUNGERSNOT DIE WELT ZUR ZEIT, ALS GOETHE LEBTE: KRIEGE UND KRISEN Goethe lebte in einer Zeit, in der sich die Welt stark veränderte. Vor allem Ereignisse wie der amerikanische
Wilhelminisches Zeitalter
 Wilhelminisches Zeitalter Kaiser Wilhelm II. Innen- und Außenpolitik Wilhelms II. Militarismus Kunst und Kultur zu Beginn des 20. Jhds. Der Weg in den 1. Weltkrieg Der 1. Weltkrieg - Verlauf Das Ende des
Wilhelminisches Zeitalter Kaiser Wilhelm II. Innen- und Außenpolitik Wilhelms II. Militarismus Kunst und Kultur zu Beginn des 20. Jhds. Der Weg in den 1. Weltkrieg Der 1. Weltkrieg - Verlauf Das Ende des
Die Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress
 Die Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress Mit Reinhard Stauber, Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt Betrifft: Geschichte Teil 1-5 Sendedatum: 13. September 17. September 2014 Gestaltung:
Die Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress Mit Reinhard Stauber, Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt Betrifft: Geschichte Teil 1-5 Sendedatum: 13. September 17. September 2014 Gestaltung:
Geschichte und Geschehen 3 Bayern (8. Jahrgangsstufe)
 Synopse Geschichte Klasse 8 auf Grundlage des Lehrplans 007 Geschichte und Geschehen BY Obligatorische und fakultative Inhalte ISBN 978---70-6 Themenbereich Lehrplan Geschichte und Geschehen Bayern (8.
Synopse Geschichte Klasse 8 auf Grundlage des Lehrplans 007 Geschichte und Geschehen BY Obligatorische und fakultative Inhalte ISBN 978---70-6 Themenbereich Lehrplan Geschichte und Geschehen Bayern (8.
INHALT. (1) DIE NOT DER REPUBLIK Der Zerfall aristokratischer Gleichheit Die Auflösung der Verfassung Der Bürgerkrieg Terror und Reform
 INHALT VORWORT................................................ 11 EINLEITUNG.............................................. 13 I. DIE UMSTÄNDE DES LEBENS (1) DIE NOT DER REPUBLIK...............................
INHALT VORWORT................................................ 11 EINLEITUNG.............................................. 13 I. DIE UMSTÄNDE DES LEBENS (1) DIE NOT DER REPUBLIK...............................
Schule im Kaiserreich
 Schule im Kaiserreich 1. Kapitel: Der Kaiser lebte hoch! Hoch! Hoch! Vor 100 Jahren regierte ein Kaiser in Deutschland. Das ist sehr lange her! Drehen wir die Zeit zurück! Das war, als die Mama, die Oma,
Schule im Kaiserreich 1. Kapitel: Der Kaiser lebte hoch! Hoch! Hoch! Vor 100 Jahren regierte ein Kaiser in Deutschland. Das ist sehr lange her! Drehen wir die Zeit zurück! Das war, als die Mama, die Oma,
Inhaltsverzeichnis Israel - Land der Hoffnung, Land des Leids Vorwort Neuanfang im Heiligen Land Aufstieg nach Jerusalem Wir sind ein Volk
 Inhaltsverzeichnis Israel - Land der Hoffnung, Land des Leids Vorwort Neuanfang im Heiligen Land Aufstieg nach Jerusalem Die erste Einwandererwelle Wir sind ein Volk Theodor Herzl erfand in Europa den
Inhaltsverzeichnis Israel - Land der Hoffnung, Land des Leids Vorwort Neuanfang im Heiligen Land Aufstieg nach Jerusalem Die erste Einwandererwelle Wir sind ein Volk Theodor Herzl erfand in Europa den
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
 1 Schwarz: UE Politisches System / Rikkyo University 2014 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lesen Sie den Text auf der folgenden Seite und ergänzen Sie das Diagramm! 2 Schwarz: UE Politisches
1 Schwarz: UE Politisches System / Rikkyo University 2014 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lesen Sie den Text auf der folgenden Seite und ergänzen Sie das Diagramm! 2 Schwarz: UE Politisches
Koalitionskriege. Koalitionskriege. Übersicht. Revolutionskriege. 1. Koalitionskrieg. 2. Koalitionskrieg. Napoleonische Kriege. 3.
 Koalitionskriege Referent: Stephan Tesch 21.01.2008 Folie: 1/24 Gliederung 1. 2. 3. 4. Referent: Stephan Tesch 21.01.2008 Folie: 2/24 Wechselnde Koalitionen gegen Frankreich Zwischen 1792 und 1807 (1792-1802)
Koalitionskriege Referent: Stephan Tesch 21.01.2008 Folie: 1/24 Gliederung 1. 2. 3. 4. Referent: Stephan Tesch 21.01.2008 Folie: 2/24 Wechselnde Koalitionen gegen Frankreich Zwischen 1792 und 1807 (1792-1802)
über das Maß der Pflicht hinaus die Kräfte dem Vaterland zu widmen.
 Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Arbeitsblatt 8 Ende des Ersten Weltkrieges
 Arbeitsblätter des in Kooperation gefördert Volksbundes Deutsche mit durch Kriegsgräberfürsorge e.v. Arbeitsblatt 8 Ende des Ersten Weltkrieges Arbeitsaufträge: 1. Überlegt in Kleingruppen, welche Gründe
Arbeitsblätter des in Kooperation gefördert Volksbundes Deutsche mit durch Kriegsgräberfürsorge e.v. Arbeitsblatt 8 Ende des Ersten Weltkrieges Arbeitsaufträge: 1. Überlegt in Kleingruppen, welche Gründe
vitamin de DaF Arbeitsblatt - zum Geschichte
 1. Die folgenden Fotos spiegeln einen Teil der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg wider. a) Schauen Sie sich die beiden Fotos an. Tauschen Sie sich zu folgenden Fragen aus: - Was ist auf den
1. Die folgenden Fotos spiegeln einen Teil der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg wider. a) Schauen Sie sich die beiden Fotos an. Tauschen Sie sich zu folgenden Fragen aus: - Was ist auf den
Inhalt. Statt einer Einleitung 1 Lust auf Demokratie? 11 2 Oder Demokratiefrust? 13
 Inhalt Statt einer Einleitung 1 Lust auf Demokratie? 11 2 Oder Demokratiefrust? 13 I Demokratie macht Staat 3 Was heißt überhaupt Demokratie? 15 4 Was ist der Unterschied zwischen Demokratie und Republik?
Inhalt Statt einer Einleitung 1 Lust auf Demokratie? 11 2 Oder Demokratiefrust? 13 I Demokratie macht Staat 3 Was heißt überhaupt Demokratie? 15 4 Was ist der Unterschied zwischen Demokratie und Republik?
Amerikanische und Französische Revolution
 Amerikanische und Französische Revolution Die Geschichte Neuenglands: Situation: Wirtschaft der Kolonien soll die englische stärken; Vertretung durch englische königliche Gouverneure; demokratische Grundlage
Amerikanische und Französische Revolution Die Geschichte Neuenglands: Situation: Wirtschaft der Kolonien soll die englische stärken; Vertretung durch englische königliche Gouverneure; demokratische Grundlage
Universität Duisburg-Essen Sommersemester Stundenprotokoll Emanzipation und Verbürgerlichung,
 Universität Duisburg-Essen Sommersemester 2008 Stundenprotokoll 02.06.2006 Emanzipation und Verbürgerlichung, 1789-1871 Deutsch- jüdische Geschichte und Kultur im europäischen Kontext Bestimmung des Begriffs:
Universität Duisburg-Essen Sommersemester 2008 Stundenprotokoll 02.06.2006 Emanzipation und Verbürgerlichung, 1789-1871 Deutsch- jüdische Geschichte und Kultur im europäischen Kontext Bestimmung des Begriffs:
Stoffverteilungsplan Geschichte und Geschehen Ausgabe Thüringen
 Stoffverteilungsplan Ausgabe Thüringen Schülerband 7/8 (978-3-12-443620-7) Legende: R = Regionaler Schwerpunkt = Wahlobligatorischer Lernbereich Lehrplan für den Erwerb der Europa im Mittelalter mittelalterliche
Stoffverteilungsplan Ausgabe Thüringen Schülerband 7/8 (978-3-12-443620-7) Legende: R = Regionaler Schwerpunkt = Wahlobligatorischer Lernbereich Lehrplan für den Erwerb der Europa im Mittelalter mittelalterliche
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Sonnenkönig Ludwig XIV. und der Absolutismus - Regieren zwischen Ehrgeiz, Macht und Prunksucht Das komplette Material finden Sie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Sonnenkönig Ludwig XIV. und der Absolutismus - Regieren zwischen Ehrgeiz, Macht und Prunksucht Das komplette Material finden Sie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Restauration und Vormärz in Deutschland - Vom Wiener Kongress bis 1848
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Restauration und Vormärz in Deutschland - Vom Wiener Kongress bis 1848 Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Restauration und Vormärz in Deutschland - Vom Wiener Kongress bis 1848 Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
DEMOKRATIE BRAUCHT UNS
 Nr. 1311 Dienstag, 06. Dezember 2016 DEMOKRATIE BRAUCHT UNS Wir sind die Klasse 3A der Komensky-Schule und präsentieren Euch heute die Themen: Du und die Gesetze, Demokratische Republik, Das Österreichische
Nr. 1311 Dienstag, 06. Dezember 2016 DEMOKRATIE BRAUCHT UNS Wir sind die Klasse 3A der Komensky-Schule und präsentieren Euch heute die Themen: Du und die Gesetze, Demokratische Republik, Das Österreichische
An die Stelle des alten Reiches tritt der Deutsche Bund, ein loser Zusammenschluss der 39 Einzelstaaten (35 Erbmonarchien und vier Freie Städte), die
 An die Stelle des alten Reiches tritt der Deutsche Bund, ein loser Zusammenschluss der 39 Einzelstaaten (35 Erbmonarchien und vier Freie Städte), die ihre volle Souveränität behalten. Einzige gesamtdeutsche
An die Stelle des alten Reiches tritt der Deutsche Bund, ein loser Zusammenschluss der 39 Einzelstaaten (35 Erbmonarchien und vier Freie Städte), die ihre volle Souveränität behalten. Einzige gesamtdeutsche
Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung
 Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung Teil 1 Kriegsbeginn und Fronterlebnis Trotz seines labilen Gesundheitszustandes wurde der Mannheimer Fritz
Der Erste Weltkrieg. Abschiede und Grenzerfahrungen. Alltag und Propaganda. Fragen zur Ausstellung Teil 1 Kriegsbeginn und Fronterlebnis Trotz seines labilen Gesundheitszustandes wurde der Mannheimer Fritz
Arbeitsblatt 1 Vorgeschichte und Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges
 Arbeitsblatt 1 Vorgeschichte und Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges Arbeitsauftrag 1. Lest euch in Kleingruppen den Text durch. Überlegt und diskutiert gemeinsam, ob der Ausbruch des Ersten
Arbeitsblatt 1 Vorgeschichte und Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges Arbeitsauftrag 1. Lest euch in Kleingruppen den Text durch. Überlegt und diskutiert gemeinsam, ob der Ausbruch des Ersten
Grundwissen Geschichte der 8. Klasse
 Grundwissen Geschichte der 8. Klasse Die Französische Revolution und Europa 14. Juli 1789 Beginn der Französischen Revolution: Sturm auf die Bastille 1806 Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Grundwissen Geschichte der 8. Klasse Die Französische Revolution und Europa 14. Juli 1789 Beginn der Französischen Revolution: Sturm auf die Bastille 1806 Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Die Schlafwandler wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. 3. Die wahren Motive
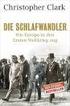 Die Schlafwandler wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog 3. Die wahren Motive Quellenblatt Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog A1: Die Vossische Zeitung berichtete am 29.06.1914: Einen grauenvollen
Die Schlafwandler wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog 3. Die wahren Motive Quellenblatt Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog A1: Die Vossische Zeitung berichtete am 29.06.1914: Einen grauenvollen
III. Die Revolution von 1848 und der Katholizismus
 1 III. Die Revolution von 1848 und der Katholizismus 1. Der allgemeinpolitische Rahmen - Märzrevolution in Deutschland als Kette von Erhebungen in Hauptstädte und Provinzstädte, sowie sozialen Unruhen
1 III. Die Revolution von 1848 und der Katholizismus 1. Der allgemeinpolitische Rahmen - Märzrevolution in Deutschland als Kette von Erhebungen in Hauptstädte und Provinzstädte, sowie sozialen Unruhen
Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich-
 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich- Albertz-Friedenspreises durch die Arbeiterwohlfahrt am 2. August 2005 in Berlin Lieber Klaus, verehrter Herr Vorsitzender,
Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich- Albertz-Friedenspreises durch die Arbeiterwohlfahrt am 2. August 2005 in Berlin Lieber Klaus, verehrter Herr Vorsitzender,
Für Menschenrechte und Säkularisierung stehen
 EU WAHLEN 2014 Für Menschenrechte und Säkularisierung stehen EHF Memorandum November 2013 ie europäischen Wahlen im Mai 2014 werden für Humanisten in D Europa entscheidend sein. Der Aufstieg von radikalen
EU WAHLEN 2014 Für Menschenrechte und Säkularisierung stehen EHF Memorandum November 2013 ie europäischen Wahlen im Mai 2014 werden für Humanisten in D Europa entscheidend sein. Der Aufstieg von radikalen
Geschichte Frankreichs
 Wolfgang Schmale Geschichte Frankreichs 16 Karten Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Inhaltsverzeichnis Teil I: Von Vercingetorix bis Clemenceau: Entstehung und Ausformung des Körpers Frankreich" 19 Abschnitt
Wolfgang Schmale Geschichte Frankreichs 16 Karten Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Inhaltsverzeichnis Teil I: Von Vercingetorix bis Clemenceau: Entstehung und Ausformung des Körpers Frankreich" 19 Abschnitt
Paul. Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart. Verlag C.H.Beck
 Paul Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart Verlag C.H.Beck INHALT I Einleitung: Fragen an Demokratie 9 II Anfänge Nicht wir: Die Erfindung der Demokratie in Athen 26 2 Herrschaft des Volkes: Funktionsweisen
Paul Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart Verlag C.H.Beck INHALT I Einleitung: Fragen an Demokratie 9 II Anfänge Nicht wir: Die Erfindung der Demokratie in Athen 26 2 Herrschaft des Volkes: Funktionsweisen
Westphalen im Jahre Innere Unruhen - Markus Stein September 2002
 Westphalen im Jahre 1809 - Innere Unruhen - Markus Stein September 2002 Unheilvolle Staatsgründung Hannover Preußen Braunschweig Hessen-Kassel Hoch militarisiert (Subsidienverträge mit England) Offiziere
Westphalen im Jahre 1809 - Innere Unruhen - Markus Stein September 2002 Unheilvolle Staatsgründung Hannover Preußen Braunschweig Hessen-Kassel Hoch militarisiert (Subsidienverträge mit England) Offiziere
Europäische Geschichte tabellarisch
 Europäische Geschichte tabellarisch Jan Bruners 1813 16. 19. Oktober Völkerschlacht bei Leipzig 1814 1. Vertrag von Chaumont 31. Einzug der Koalition in Paris 6. April Abdankung Napoleons 11. April Erklärung
Europäische Geschichte tabellarisch Jan Bruners 1813 16. 19. Oktober Völkerschlacht bei Leipzig 1814 1. Vertrag von Chaumont 31. Einzug der Koalition in Paris 6. April Abdankung Napoleons 11. April Erklärung
Literaturempfehlungen
 Der Erste Weltkrieg und die Suche nach Stabilität Literaturempfehlungen Nationalismus Nation ist Objekt von Loyalität und Ergebenheit Nation ist transzendent (übersinnlich), häufig Ersatz für Religion
Der Erste Weltkrieg und die Suche nach Stabilität Literaturempfehlungen Nationalismus Nation ist Objekt von Loyalität und Ergebenheit Nation ist transzendent (übersinnlich), häufig Ersatz für Religion
Kommunalreform in Dänemark
 Konrad-Adenauer-Stiftung Politik und Beratung Kommunalreform in Dänemark Bericht Mehr Informationen unter www.politik-fuer-kommunen.de Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Hauptabteilung Politik und Beratung
Konrad-Adenauer-Stiftung Politik und Beratung Kommunalreform in Dänemark Bericht Mehr Informationen unter www.politik-fuer-kommunen.de Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Hauptabteilung Politik und Beratung
Zeitreise, Ausgabe C (Rheinland-Pfalz) Band 2 Elemente/Projekte/ Abschlussseiten Das Zeitalter der Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen, S.
 Stoffverteilungsplan Zeitreise Rheinland-Pfalz Band 2 (3-12-425020-9) Schule: Lehrer: 8h Lehrplan Geschichte (Klassen 7-9/10) Realschule (1998/99) Das Zeitalter der Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen
Stoffverteilungsplan Zeitreise Rheinland-Pfalz Band 2 (3-12-425020-9) Schule: Lehrer: 8h Lehrplan Geschichte (Klassen 7-9/10) Realschule (1998/99) Das Zeitalter der Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen
Themenüberblick 11.1: Wie modern wurde die Welt um 1800?... 10
 Themenüberblick 11.1: Wie modern wurde die Welt um 1800?.................. 10 Kapitel 1: Die politischen Revolutionen in Amerika und Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts............................ 14
Themenüberblick 11.1: Wie modern wurde die Welt um 1800?.................. 10 Kapitel 1: Die politischen Revolutionen in Amerika und Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts............................ 14
Wie wählte Rinteln? Thomas Gräfe. Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln
 Geschichte Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln 1867-1912 Wissenschaftlicher Aufsatz Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen
Geschichte Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen im Wahlkreis Kassel I, im Kreis Rinteln und in der Stadt Rinteln 1867-1912 Wissenschaftlicher Aufsatz Thomas Gräfe Wie wählte Rinteln? Reichstagswahlen
Schweizer Geschichte. Bau der Untertorbrücke in Bern - Tschachtlanchronik
 Schweizer Geschichte Bau der Untertorbrücke in Bern - Tschachtlanchronik Schweizer Geschichte Gebiet der heutigen Schweiz als Teil des Heiligen Römischen Reiches Kaiser, resp. König ist in der Regel weit
Schweizer Geschichte Bau der Untertorbrücke in Bern - Tschachtlanchronik Schweizer Geschichte Gebiet der heutigen Schweiz als Teil des Heiligen Römischen Reiches Kaiser, resp. König ist in der Regel weit
man könnte fast sagen: Ingolstadt ist zur Zeit historische Kapitale des Freistaats!
 Sperrfrist: 11. Juni 2015, 15.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Eröffnung
Sperrfrist: 11. Juni 2015, 15.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Eröffnung
Teilaspekt 4: Sozialökonomische und verfassungsrechtliche Entwicklungen in Europa im 19. Jahrhundert
 Teilaspekt 4: Sozialökonomische und verfassungsrechtliche Entwicklungen in Europa im 19. Jahrhundert Strukturierungsvorschlag gemäß Variante B Thema der Reihe: Europa im 19. Jh. Einheit oder Vielfalt?
Teilaspekt 4: Sozialökonomische und verfassungsrechtliche Entwicklungen in Europa im 19. Jahrhundert Strukturierungsvorschlag gemäß Variante B Thema der Reihe: Europa im 19. Jh. Einheit oder Vielfalt?
