Die historische Wasserversorgung im Bahnpark Augsburg: Wasser für hundertzwanzig Lokomotiven
|
|
|
- Sabine Holzmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 Siegfried Baum: Die historische Wasserversorgung im Bahnpark Augsburg: Wasser für hundertzwanzig Lokomotiven Als die Augsburger Betriebswerkstätte 1906 von ihrem bisherigen Standort gegenüber dem Hauptbahnhof in den Süden, quasi auf die grüne Wiese verlegt wurde, muß es mehrere Gründe für so einen großen Schritt gegeben haben. Einer der triftigsten war sicher, dass der Rangierbahnhof aus allen Nähten platzte und dringend einer großzügigen Erweiterung bedurfte. Die zweifelsohne mit der Bw- Verlagerung auch erreicht wurde. Die Vorteile, sich auf dem neuen Gelände so einrichten zu können, wie es damals als notwendig erachtet wurde, überwogen wohl die Nachteile, die man sich mit der größeren Entfernung zum Geschehen am Hauptbahnhof zwangsläufig einhandelte. Ob Umweltgesichtspunkte und die Belästigung der Anwohner durch Rauch und Schmauch der Lokomotiven auch eine Rolle spielten, darf bei der damals dominanten Stellung der Eisenbahn dahin gestellt bleiben. Nicht von 1906, sondern schon von 1902 existiert eine Lokomotivstatistik der Kgl.Bay.Staats- Bahn, nach welcher die Betriebshauptwerkstätte Augsburg und die direkt angeschlossenen sieben Lokstationen über nicht weniger als 15 verschiedene Lokomotiv- Gattungen verfügten. Ernst Erhart, letzter Leiter des Bahnbetriebswerks Augsburg, berichtet in der Jubiläumsbroschüre des Bw (Lit.Nr.2), dass im Jahr 1914 von Augsburg aus nicht weniger als 123 (Dampf)- Lokomotiven betreut wurden. Der hervorragende Chronist der Lokomotivfabrik J.A. Maffei (und gebürtige Augsburger) Baron Ludwig Welser liefert uns im Rahmen seiner präzisen Beschreibung der bayerischen Dampflokomotiven leider keinen Hinweis, wie groß die Zahl der damals in Augsburg selbst stationierten Lokomotiven war. Unsere Arbeit trägt die Überschrift Wasser. Wasser, das für den Betrieb von Dampflokomotiven unerlässlich war. Bereits frühe Lagepläne des neuen Bahnbetriebswerks lassen erkennen, dass für die Gewinnung von Kesselspeisewasser zwei Brunnen existierten. Die Unterlagen erwähnen mehrmals, dass die bis heute vorhandenen Brunnen eine sehr unterschiedliche Tiefe hatten. Wir lesen einmal von 55 Metern und im anderen Fall werden 177 Meter genannt. Die erhaltenen Akten des Verkehrsmuseums Nürnberg, heute beim Bayer. Hauptstaatsarchiv in München bzw. beim Staatsarchiv in Augsburg, lassen uns im Unklaren, weshalb die zwei Brunnen in so unterschiedliche Tiefen gebohrt wurden. Trotz der Unsicherheit in der Aktenlage können wir davon ausgehen, dass die verantwortlichen Bauleute über die Augsburger Grundwasservorkommen sehr gut informiert waren. In Lageplänen der am Hauptbahnhof liegenden Betriebswerkstätte finden wir zwischen den zwei Rundhäusern ein Wasserhaus, aus dessen Zisternen nicht nur die Wasserkräne der Betriebswerkstätte, sondern auch die Wasserkräne auf den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs versorgt worden sein dürften. Als mit Aufgabe der Betriebswerkstätte auch das Wasserhaus geschleift wurde, ist anzunehmen, dass fortan die Wasserkräne des Hauptbahnhofs an das städtische Wasserleitungsnetz angeschlossen wurden. 1
2 2 Da das neue Bw auf dem Höhenrücken zwischen Wertach und Lech erstellt wurde, konnten die Bauherren davon ausgehen, dass sie trotz der höheren Lage womöglich auf das gleiche wasserführende Stockwerk stoßen würden, aus der auch das Wasser für das alte Werk gepumpt wurde. Da bekannt gewesen sein dürfte, wie sich bei entsprechender Wasserentnahme der Wasserspiegel verändert, mussten die Fachleute davon ausgehen, dass aus der fraglichen Blase in einem bestimmten Zeitraum nur eine bestimmte Menge entnommen werden konnte. Also, nach einer ergiebigeren Schicht gesucht werden musste. Und die fand man offenbar erst in einer Tiefe von 177 Metern. Bild Nr. 1: Lageplan des Bws, in welchem die zwei Brunnen noch eingezeichnet sind Wir dürfen voraussetzen, dass ihnen dabei die Kenntnis über die Ergiebigkeit der viel älteren Brauerei- Brunnen zu Hilfe kam. Augsburg verfügte um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert über eine größere Zahl von Brauereien, die bekanntlich alle ihre eigenen Brunnen hatten. Desgleichen wissen wir, dass auch die Textilbetriebe z.t. über eigene Tiefbrunnen verfügten. Nicht bekannt ist, bis in welche Tiefen da gebohrt wurde. Die einzige verlässliche Information stammt von der Riegele- Brauerei. Nachdem deren erster Brunnen ebenfalls in etwa eine Tiefe von 170 Metern gehabt habe, ist anzunehmen, dass sich zwischen dem oberen und der unteren Stockwerk keine weitere wasserführende Schicht finden ließ. Das Brauhaus Riegele sah sich Ende des 20. Jahrhunderts gar gezwungen, seinen Tiefbrunnen von ähnlicher Tiefe aufzugeben und durch einen neuen (mit einer Tiefe von 218 Metern) zu ersetzen, weil das bis dahin geförderte Wasser dermaßen mit Sand vermengt war, dass sogar die Stabilität der Brauereigebäude gefährdet gewesen sei. 2
3 3 Ein weiterer Beleg für Wasservorkommen in dieser Tiefe ist darin zu sehen, dass auch der dritte Tiefbrunnen, der 1937/38 auf dem Bw- Gelände gebohrt wurde, ebenfalls in eine Tiefe von 177 Metern vorgetrieben wurde. Wie diffizil das System Tiefbrunnen behandelt wurde, ersehen wir daran, dass mit dem Rückgang an Kesselspeisewasserbedarf durch die Abstellung der Dampfloks dieser dritte Brunnen nicht nur stillgelegt, sondern das Brunnenrohr sogar verfüllt wurde. In der wasserrechtlichen Genehmigung von 1973 durch die Bundesbahndirektion München wird dieser Brunnen gar nicht mehr erwähnt. Wie ergiebig die Brunnen waren, und offenbar hierfür auch Bedarf bestand, sehen wir am Eintrag im Augsburger Wasserbuch aus der erwähnten Genehmigung. Die erhaltene Fördertechnik auf dem Bahnpark- Gelände Brunnen I In allen Plänen wird der (südlichere) Brunnen mit der geringeren Tiefe als Brunnen I bezeichnet, der nach Angaben der Direktion nur dann in die Wasserförderung einbezogen werden sollte, wenn der Brunnen II nicht zur Verfügung stand. Die Tiefe des Brunnenvorschachts wird mit 8,4 m unter Gelände angegeben. In historischer Hinsicht von ganz besonderer Bedeutung ist, dass der Schacht mit einem Innendurchmesser von geschätzt sechs Metern mit Klinkern gemauert ist. Das Mauerwerk vermittelt dem Beschauer den Eindruck, in das Innere eines gemauerten Fabrikschornsteins zu schauen. Es bedarf einer nicht ganz unproblematischen Begehung, um festzustellen, ob es nur Optik ist, oder ob tatsächlich die Klinkersteine bei der Fertigung der Rundung des Schachts angepasst wurden. Mit einem Wort: Ein fabelhaftes Stück des weiter unten noch hervorzuhebenden Gesamt- Ensembles dieser Wasserförderanlage. Bild Nr. 2: Detailfoto, in welchem das Mauerwerk und die Kreiselpumpe zu sehen sind 3
4 4 Die maximal erlaubte tägliche Entnahme von 180 m³ entsprach einer sekündlichen Förderung von vier Litern. Bei dieser Entnahme sank der Wasserspiegel um 4 Meter. Als (heute noch vorhandene) Fördereinrichtung wird eine horizontale Kreiselpumpe (mit Saugrohrleitung) beschrieben. 8,4 Meter unter Gelände und für die Saugrohrleitung eine max. Länge von ca. 9,5 Meter (physikalische Gründe - siehe weiter unten!) und schlussendlich die Absenkung um 4 Meter: Hieße, dass der Wasserspiegel nie tiefer als Meter unter der Erdoberfläche stehen durfte. Bei einer Besichtigung des Schachts am 7. August 2014 stand das Wasser im Brunnenrohr fast bis zum Rand. Die Akustik eines in das Wasser geworfenen Steins bestätigte den Anschein eines hochstehenden Wasserspiegels. Brunnen II Im Gegensatz zu Brunnen I ist der Schacht dieses Brunnens in Stampfbeton ausgeführt und hat einen Innendurchmesser von 1,50 Meter. Entgegen der Eintragung im Wasserbuch(mit 2 Metern) liegt der Schachtboden 2,60 Meter unter der Erdoberfläche. Die Brunnentiefe betrage 177 Meter. Das eiserne Brunnenrohr ist heute mit einem massiven Eisendeckel verschlossen. Hier hatte die Direktion eine max. Entnahme von 6,5 l/s bzw. max. 350 m³ pro Tag erlaubt. Bei einer mittleren Entnahme sank der Wasserspiegel um stattliche 5 Meter ab! Als Fördereinrichtung ist eine Tauchkreiselpumpe angegeben. Bild Nr. 3: Gesamtansicht von außen mit Häuschen und Drei- Bein Der Schacht ist mit einem verfahrbaren Holzgehäuse abgedeckt, und über dem Schacht steht ein massives Drei- Bein, an welchem der Flaschenzug für das Hochziehen der Tauchpumpe angebracht wurde, wenn Revisions- oder Reparaturarbeiten anstanden. Die eisernen Rohrleitungen aus der Pumpe haben einen Außendurchmesser von 60 mm, was demnach einem zwei- zölligen Rohr entspricht. Interessant: Zur Weiterleitung des Wassers in das 4
5 5 Wasserhaus ist das 2- zöllige Rohr an ein Rohr mit einem Außendurchmesser von ca. 15 cm angeflanscht. Der Übergang aus dem dünnen in das dicke Rohr dürfte eine beachtliche Verlangsamung des Wasserstrahls zur Folge gehabt haben. Bild Nr. 4 Blick in den Brunnenschacht II Noch ein Kuriosum, das mehrere Fragen aufwirft: Zwischen dem Pumpenrohr und dem Abgang in Richtung Wasserhaus ist eine recht neu wirkende Wasseruhr eingebaut, die als Herstellungsjahr 1979 aufweist und einen Zählerstand von m³ anzeigt. Heißt: Obwohl 1979 das Bw Augsburg längst dampffrei war, und lt. Angaben der ehem. Bw- Mitarbeiter schon weit davor die Speisewasserversorgung an das städtische Netz angeschlossen worden sei, muß der Brunnen noch in Betrieb gewesen sein. Die Jahreszahl 1979 und auch der Zählerstand sind eindeutige Belege! Ein weiterer Hinweis auf die relativ lange eigene Wasserförderung ist dem Bericht eines Lokführers zu entnehmen, wonach es in einer sehr kalten Winternacht (nach den meteorologischen Aufzeichnungen wurden in Augsburg in einer der ersten Januarnächte 1985 achtzehn Minusgrade gemessen) zu einem Riss in einer Speiseleitung kam und sich nicht nur im Erdgeschoß des Wasserhauses, sondern auch auf dem Platz davor binnen kürzester Frist ein dicker Eispanzer bildete, der wohl der Grund war, die eigene Wasserförderung endgültig aufzugeben. Die Rohre und die Kreiselpumpe in Schacht I und auch die Abdeckung machen zwar keinen jungfräulichen Eindruck, stellen sich aber Jahre nach Außerbetriebnahme in einem Zustand dar, der darauf schließen lässt, dass die beiden Anlagen mit großer Wahrscheinlichkeit erst weit nach Ende des 2. Weltkriegs eingebaut wurden. Gerade die Optik der Förderpumpe in Schacht 1 lässt auf kein zu großes Alter schließen. Nicht anders der nebenstehend abgebildete Schieber mit Rückschlagventil im Schacht von Brunnen II. Heißt: Sie wurden im 5
6 6 Verlauf der Jahrzehnte als (über)- lebensnotwendig stets in einem guten Zustand gehalten und ganz offensichtlich auch partiell erneuert und gepflegt! Die Optik der Brunnenschächte, hier Stampfbeton, dort das bestens erhaltene Klinkermauerwerk lassen den Schluss zu, dass die Anlagen bei den Bombenangriffen keinen Schaden genommen haben. Zumal erzählt wird, dass die dem Bw geltenden Bomben über dem nahen Siebentischwald abgeworfen wurden. Obwohl Herr Erhart unwahrscheinlich viel Material des damals schon in Auflösung begriffenen Bahnbetriebswerks gerettet hat, finden sich in seinen Unterlagen keine näheren Angaben zu den Brunnen bzw. deren Fördereinrichtungen. So dass auch nicht mehr feststellbar ist, wann die Anlagen nach einer internen Anweisung letztmals grundüberholt wurden. Bild Nr. 5: Detailfoto des Schiebers Die Fördertechnik der Brunnen im Verlauf der Jahrzehnte Es ist völlig ausgeschlossen, dass die in der erwähnten Genehmigung von 1973 beschriebenen Fördereinrichtungen bereits 1906 eingebaut waren. Zwar war der Einsatz von Elektromotoren um 1906 zum Antrieb von Zentrifugalpumpen absolut kein Neuland mehr, aber nach einer Auskunft der 140- Jahre- alten Pumpenfirma Klein- Schanzlin- Becker (KSB- Pumpen) im pfälzischen Frankenthal wurde die Unterwassertauchpumpe erst 1918 erfunden. Das System Kreiselpumpe selbst ist viel, viel älter. Schließlich gilt Denis Papin als deren Erfinder, der das Prinzip bereits Ende des 17. Jahrhunderts gefunden habe. Nachdem mehrere Anfragen bei Firmen und Institutionen unbeantwortet blieben, gab es im Sommer 2014 unverhofft einen interessanten Hinweis aus dem Hause KSB zu den 6
7 7 Erzeugnissen der Nürnberger Pumpenfirma AMAG- Hilpert- Pegnitzhütte, die 1959 in der Pfälzer AG aufging. Als die AMAG 1954 ihr 100- jähriges Bestehen feiern konnte, geht der Autor einer Jubiläumsschrift Gert von Kluss auf solche Spezialitäten nur am Rande ein. Stattdessen stellte KSB aus seinem Fundus Werbeunterlagen der alten AMAG zur Verfügung, die uns einen ausgezeichneten Überblick geben, wie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Wasser, auch aus großen Tiefen, gefördert werden konnte. Aus rein physikalischen Gründen ist Wasser- Saugen aus einer Tiefe von mehr als 10 Metern in unseren Breiten nicht möglich ist. Die uns umgebende Atmosphäre von gewöhnlicherweise rund 1 bar entspricht dem Druck einer Wassersäule von ca. 10 Metern. Da jede Förderung aus der Tiefe mit Reibung, auch mit leichten Undichtigkeiten verbunden ist, gehen Brunnenbauer davon aus, dass ein reiner Saugbetrieb maximal bis zu einer Tiefe von ca. 9,50 Metern möglich ist. Soll Wasser aus größeren Tiefen nach oben gefördert werden, muss die Pumpe in die Tiefe und aus dem Saugen wird ein Heben, ein Drücken. Die Alternative zur Kreiselpumpe, die auch in der Erdölförderung bis in unsere Tage verwendet wird, ist die unten liegende Kolbenpumpe, deren Kolben über ein Gestänge von einer Maschine an der Erdoberfläche bzw. in einem gut zugänglichen Brunnenschacht bewegt wird. Die in gleichmäßigem Rhythmus auf und ab gehenden Pferdeköpfe der Erdölpumpen treiben bis heute über ein Gestänge die unten liegenden Hebeanlagen an. Bild Nr. 6: Skizze aus dem Niederstraßer mit Kreiselpumpe unten (Seite 526) Das Thema Wasserförderung ist so komplex und interessant, dass wir etwas weiter ausholen und die von der AMAG beschriebenen Pumpvarianten hier zumindest in groben Zügen vorstellen wollen. Zuvor noch ein Abstecher zum Herausgeber des Leitfadens für den 7
8 8 Dampflokomotivdienst (Erstausgabe 1934) Leopold Niederstraßer. Er ist auch solchen Dingen nachgegangen und hat mit der nebenstehenden Skizze dargestellt, wie die im Wasser liegende Kreiselpumpe durch einen im oberirdischen Pumpenhaus eingebauten Elektromotor über ein Gestänge angetrieben wurde. Wir tappen im Dunkeln, über welche Tiefen solche Antriebsgestänge möglich waren. Auch, ob diese Gestänge zwischen Motor und Pumpe radial abgestützt werden mussten. Hing sicher auch von der Drehzahl ab. Dazu liefert uns Prof. Ruckdeschel (siehe Lit.Nr. 10) einen Hinweis, dass in den von ihm untersuchten und beschriebenen Förderanlagen die Kreiselpumpen mit einer Drehzahl von ca U/min betrieben wurden. Zu vermuten ist, dass die Erstausstattung im neuen Augsburger Bw wahrscheinlich über viele Jahre beibehalten wurde. Wenn die im Wasser liegende Tauchpumpe heutiger Konstruktion erst 1918 erfunden wurde, ist davon auszugehen, dass es doch Jahre dauerte, bis das System Marktreife erlangte. Die nebenstehende AMAG- Anzeige bewirbt die Tiefbrunnen- Kreiselpumpe. Nachdem die rechts gezeigte Type den Tauchmotor unter der Pumpe zeigt, ist anzunehmen, dass das erwähnte Patent von 1918 schon Eingang in die Produktion gefunden hatte, also die Anzeige aus einer Zeit nach dem 1. Weltkrieg stammen muß. Die links gezeigte Pumpe könnte nach dem Prinzip gebaut gewesen sein, wie es Niederstraßer beschreibt. Allein aus Gründen der dynamischen Bewegung ist davon auszugehen, dass der motorische Antrieb einer unten liegenden Kreiselpumpe von oben längenmäßig sehr begrenzt war. 8
9 9 Bild Nr. 7 Werbeanzeige der Nürnberger AMAG- Hilpert- Pegnitz- Hütte 9
10 10 Eine interessante Variante war wohl das gezeigte AMAG- Patent in Gestalt einer Kolbenpumpe mit Hohlschwimmergestänge, das dergestalt funktionierte, dass rein aus Gewichtsgründen der größte Teil des Pumpengestänges von einem absolut dichten Zylinder umgeben war und dieser Zylinder im gespannten (siehe nächster Absatz) Wasser des Tiefbrunnens so viel Auftrieb erhielt, dass auch bei größeren Tiefen das Gestängegewicht nicht von Bedeutung war. Eine weitere Möglichkeit, größere Tiefen als besagte 9,5 Meter zu überwinden bot die Pumpanlage mit Pressluftbetrieb! Vielleicht ist es fast verwegen diese Pumpmethode als eine frühe allerdings völlig umweltungefährliche Art von Fracking zu betrachten. Während bei dem heutigen und sehr umstrittenen Fracking Gas mit Hilfe nirgends präzise beschriebener Chemikalien aus dem Gestein gepresst wird, griffen die Techniker vor Jahrzehnten zur Pressluft, in dem sie diese in das Brunnenrohr einleiteten und damit das Wasser nach oben trieben. Das Fehlen jedweder beweglichen Teile im Brunnen, die absolute Frostsicherheit, auch dass Schlamm, Sand und Kies nicht nach oben kamen, waren unbestreitbare Vorzüge dieser Pumpenkonstruktion, die (indirekt) sogar uns einen Beweis für die Theorie des gespannten Wassers liefert, da das Wasser aus der Tiefe ja nur nach oben gedrückt werden konnte, wenn die Wasserblase in der Tiefe quasi druckdicht war. Dass dem so gewesen sein muß, sehen wir an einem AMAG- Werbehinweis, in dem darauf hingewiesen wird, dass kein Luftverbrauch stattfand, sondern nur die durch Undichtigkeiten verlorengehende Luft ersetzt werden musste. Da, wie schon mehrmals vermerkt, zu diesen technischen Einrichtungen keine Unterlagen mehr verfügbar sind, sind wir auf Vermutungen und hilfsweise auf Berichte in technischen Zeitschriften (siehe Dinglers Polytechnisches Journal) angewiesen. Nachdem die elektrisch betriebene Kreiselpumpe längst en- vogue war, können wir zumindest beim Brunnen I davon ausgehen, dass die Pumpe auf dem Schachtboden situiert war und das Saugrohr mit der beschriebenen Länge von 9,5 Meter wohl nie im Trockenen stand. Ob es je gelingen wird, die Wasserförderung im tiefen Brunnen für die Anfangsjahre belegen zu können ist fraglich. In einem großen Aufsatz, der in zwei Jahrgängen (1907 und 1908) des schon erwähnten Dingler schen Polytechnischen Journals gedruckt wurde und die Überschrift Neue Pumpen und Kompressoren trägt, beschreibt ein Prof. F. Freytag aus Chemnitz eine Vielzahl der in diesen Jahren bereits im Einsatz befindlichen Zentrifugal, Hoch- und Niederdruckzentrifugalpumpen, auch Elvolventenpumpen, woraus zu ersehen ist, dass auch für das Hochbringen des Wassers aus diesem tiefen Brunnen eine größere Anzahl von Pumpenvarianten zur Verfügung gestanden hat. Wir finden unter den Anbietern bekannte Firmennamen, wie C.H. Jäger & Co aus Leipzig- Plagwitz oder Sulzer- Winterthur, Hilpert aus Nürnberg, KSB- Frankenthal oder auch die Lokomotivfabrik R. Wolf, Magdeburg- Buckau. Wer mit Wasser beruflich oder privat zu tun hat, weiß, dass Wasser durch seine chemische Zusammensetzung aus Sauerstoff und Wasserstoff mit der chem. Formel H²O ein aggressives Medium ist, das zusätzlich (aggressiven) Sauerstoff bindet, wodurch es damals nur eine Metall- Legierung gab, die nicht korrodierte: Rotguss bzw. die ähnlich zusammengesetzte Bronze. Wohl nicht ohne Grund wird bei der AMAG- Pressluftpumpe darauf hingewiesen, dass das Fußstück aus Bronze hergestellt war. Auf den heutigen nicht- rostenden Tausend- Sassa (Chrom- Nickel)- Stahl (Niro) wurde Krupp erst 1913 ein entsprechendes Patent erteilt. 10
11 11 Mit anderen Worten: Allein aus Kostengründen konnten nicht alle Teile der Wasserversorgung aus wasserresistenten Materialien verwendet werden. Was bedeutet, dass das szt. Pumpensystem incl. der Rohrleitungen in den Bw- Brunnen nicht nur gewartet, sondern höchstwahrscheinlich auch mehrmals ersetzt werden musste. Insofern ist das erhaltene Drei- Bein über dem nördlichen Pumpenschacht auch als ein wichtiges Requisit für das Bergen und Niederbringen der Tiefpumpe zu betrachten, so unscheinbar es bei erstem Besehen erscheinen mag. Die Grundwasser- Ströme Wasserwirtschaftler weisen in allen Gesprächen darauf hin, dass wir uns die Grundwasservorkommen nicht als einen unterirdischen See mit einem einigermaßen ebenen Seeboden vorzustellen haben. Der Bericht zu der weiter oben schon erwähnten 3. Brunnenbohrung von 1937/38 erwähnt, dass der Höhenrücken zwischen Lech und Wertach ausschließlich aus Sand, sog. Flinz (=ist ganz feiner Sand), Löss und Mergel besteht. Aus neueren Bohrungen ist bekannt, dass sich diese Gemengelage auch im Norden der Stadt, sowohl links der Wertach (nördliches Oberhausen), aber auch auf der rechten Lechseite (z.b. Firnhaberau und weiter Lech- abwärts) nachweisen lässt. Die Löss- Böden im Lechtal galten über Jahrhunderte für die Landwirtschaft als beste Böden! Eine erdgeschichtliche Abhandlung schreibt, dass die Sand- Löss- Schicht stellenweise bis in eine Tiefe von 500 Metern reiche. Dem gegenüber kennen wir den sog. Lech- Schotter, der, wie der Name sagt, speziell in der Lechebene vorkommt, und aus welchem das oberflächennahe Grundwasser u.a. auch für die Augsburger Trinkwasserversorgung im Siebentischwald genutzt wird. Als in den 1980er- Jahren entlang des Hammerschmiedwegs (= nördliche Verbindungsstraße zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede) das Augsburger Tiefbauamt einen Abwasserkanal bis in eine Tiefe von 12 Metern zu verlegen hatte, bestand für Amt und Baufirma das Problem, den tiefen Kanalschacht ausschließlich in den mächtigen Sandschichten verlegen zu müssen. Was die Baugrubensicherung gewaltig erschwerte, und das schon erwähnte oberflächennahe Grundwasser in nicht geringen Mengen abgepumpt werden musste und über den dort seit Jahrzehnten trocken gefallenen Sonnenbach wieder in das Erdreich zurückgeleitet wurde. Die Erkundungen der Wasserwirtschaft ergaben, dass es sich zumindest in den tiefen Schichten um einen Grundwasserstrom handelt, der am Nordrand der Alpenkette seinen Anfang nimmt und erst vom (unterirdischen) Gebirgsstock der Schwäbischen Alp aufgehalten wird. Die nassen Riedwiesen entlang der Donau seien der Beweis für den Rückstau. Der bekanntlich von der Landeswasserversorgung Württemberg genutzt wird, in dem aus Tiefbrunnen das Trinkwasser für zehn Städte Württembergs, u.a. auch für Ulm und Stuttgart gewonnen und über ein mehrere hundert Kilometer langes Leitungsnetz befördert wird. Die wichtigsten Anlagen stehen bei Langenau und im Hürbetal. Aber auch das sog. Karstwasser aus der recht ergiebige Brunnenbuchquelle bei Dischingen (südlich Neresheim) ist in dieses Wasserversorgungssystem mit einbezogen. Gleichzeitig berichten Fachleute des Brunnenbaus, dass sich der Grundwasserstrom im Großraum Augsburg in den oberflächennäheren Schichten sehr langsam aus südöstlicher in 11
12 12 nordwestliche Richtung bewege. Da, wie weiter oben schon angemerkt, wir uns die Stockwerkssohle nicht als bretteben vorzustellen haben, sondern diese aus Senken und Höckern besteht, wurde bei Brunnenbohrungen wiederholt festgestellt, dass im Nahbereich des Lechs z.t. viel tiefer gebohrt werden musste, als weiter südöstlich. Da alte Unterlagen zum Wasserbuch der Stadt Augsburg im 2. Weltkrieg den Bomben zum Opfer fielen, und auch die Beschreibung der 3. Bohrung an der Firnhaberstraße nicht erkennen lässt, ob in diesem Bereich auch eine ergiebige Menge oberflächennahes Wasser gefunden wurde, muß davon ausgegangen werden, dass sich die Brunnenbohrer von damals auf das gespannte Tiefenwasser konzentrierten und somit offenbar von Anfang an der erste Brunnen bis 55 Meter vorgetrieben wurde. Gab es Veranlassung, weshalb genau in dieser Ecke des neuen Bahnbetriebswerks gebohrt wurde? Nein! Man bohrte dort, weil einfach Platz war. Die bis heute erhaltene Grünfläche im Bereich der zwei Brunnen hat nichts mit einer Art von Trinkwasserschutzzone zu tun. Die Bahn brauchte ja Kesselspeisewasser. Und die Brunnenbohrer brauchten Platz für ihre Baustelle und die Gerätschaften. Wenn das Wasser von Anfang an in besagter Tiefe vermutet wurde, kann man auch ausschließen, dass für die Standortwahl evtl. ein Wünschelrutengänger zu Rate gezogen wurde, denn deren Erspüren von Wasseradern reiche bestenfalls in Tiefen bis um die 10 Meter. Das gespannte Wasser Erkundigungen sowohl beim letzten Bw- Werkmeister, der für die Wasserförderanlagen verantwortlich zeichnete, wie auch bei einem Fachmann der Wasserwirtschaft ergaben, dass die Förderpumpen, wie sie im Wasserbuch beschrieben sind, wohl schon immer in dieser geringen Tiefe eingebaut waren, weil in beiden Brunnen sogenanntes gespanntes Wasser vorhanden ist, das nach einer persönlichen Messung mittels Lot Ende Juli 2014 bis 35 Meter unter dem Boden des Brunnenschachts II steht. Die Wasserwirtschaft unterscheidet zwei Arten von Grundwasser : Erstens das sog. oberflächennahe Grundwasser, dessen Tiefe in der Lechfeld- Schotterebene je nach Lage, in etwa bis zu einer Tiefe von Metern reiche. Im Brunnen I scheint der Wasserstand noch höher zu sein! Was hier wohl nicht mit dem hohen Grundwasserstand, sondern mit der Spannung aus der in 55 Metern Tiefe liegenden Blase wohl besser definiert ist. Wasser kann dank seines spezifischen Gewichts nur von oben nach unten fließen. Die Wasserwirtschaft geht davon aus, dass Tiefenwasser, das irgendwann einmal als Regen auf die Erde traf, bis zu 100 Jahren (und mehr) benötigt, bis es sich in diesen Tiefen sammeln kann. Da gottlob die Niederschläge dafür sorgen, dass dieser Sickerprozess (hoffentlich) nie aufhört und somit da unten kontinuierlich ein gewisser Nachschub vorhanden ist, ohne Entnahme aber die wasserführende Schicht irgendwann einmal voll wäre, kommt es zu einem natürlichen Druck in diesen Vorkommen. Und diesen Druck bezeichnet die Wasserwirtschaft als gespanntes Wasser, das sich bekanntlich am deutlichsten in dem Phänomen der artesischen Brunnen bemerkbar macht, als dort der Druck von unten so groß ist, dass es in verschiedenen Gegenden Brunnen gab oder noch gibt, aus denen Jahr- aus- Jahr- ein Wasser in recht unterschiedlicher Menge ohne jede technische Hilfe an der Erdoberfläche zutage tritt. Und diesen Effekt, in abgeschwächter Form, nutzten auch die 12
13 13 Brunnenexperten von der Firnhaberstraße, so dass sie in der Lage waren, die Pumpen bzw. Entnahmevorrichtungen in einer relativ geringen Tiefe einbauen zu können. Der hohe Wasserstand in den zwei Brunnen wurde bei den Fachleuten des Bahnbetriebswerks zuweilen auch mit dem physikalischen Gesetz der kommunizierenden Röhren beschrieben. Die Beschreibung ist nicht ganz korrekt, denn wir haben es bei einem Tiefbrunnenrohr nur mit einer Röhre zu tun, und die zweite Röhre gibt es nicht. Wie oben beschrieben, kommt der hohe Wasserstand durch den artesischen Druck aus der tiefliegenden Wasserblase zustande. Es würde uns zu weit vom Thema wegführen, dem zum Zeitpunkt der Berichterstattung festgestellten Rückgang der Wassersäule um mehr als 10 Meter in Brunnen II nachzuspüren. Es sind mehrere Gründe denkbar. Die unterschiedlich hohen Wasserstände in den beiden Brunnen belegen, dass wir es mit großer Wahrscheinlichkeit mit zwei verschiedenen Wässern aus zwei verschiedenen Stockwerken zu tun haben! Ein Wassertest wird diese Vermutung belegen, da nach Angabe des Wasserwirtschaftsamtes Tiefenwasser auf seinem Weg nach unten jede Sauerstoffanreicherung verliert, während oberflächennahes Wasser noch eine gewisse Menge Sauerstoff gebunden hat. Die Bohrtechnik um 1906 Zu unserem fast detektivischen Nachspüren der Wasserförderung zählt auch die Frage wie wurden um die Wende zum 20. Jahrhundert Brunnen gebohrt? Nachdem zwei Anfragen bei Spezialunternehmen keine Auskunft brachten, ergab ein nochmaliges Nachfassen beim mittelständischen Brunnenbauunternehmen Joanni in Zusmarshausen, dass die Brunnenbohrerei bis weit in das 20. Jahrhundert hinein eine relativ mühsame und sehr zeitaufwändige Arbeit gewesen sei. Nachdem der Dieselmotor bekanntlich in der Anfangsphase sehr groß und schwer ausgefallen war und erst Anfang der 1920er- Jahre so klein gebaut werden konnte, dass er in einem Lastkraftwagen Platz fand, ist davon auszugehen, dass frühere Bohrungen entweder mit Pferdekraft und Göpel oder mittels Dampfmaschine erfolgten. Herr Joanni jr. bemerkte in einem Telefonat, dass für das Hochbringen des Bohrmaterials sog. Schappen, heute besser bekannt unter dem Begriff Bohrgreifer, eingesetzt wurden. Lt. Lexikon ist eine Schappe ein stabiles Stahlrohr, bei dem an der unteren Rohrspitze zwei oder drei bewegliche und spitzzulaufende Schäufelchen angebracht sind, die mittels Seilzug geöffnet bzw. geschlossen werden können. Die Technik unterscheidet Ausführungen mit einem bzw. mit zwei Seilen. Lässt man den Bohrgreifer ( Schappe ) mit geöffneten Schäufelchen in die Tiefe stürzen, wird das Erdreich in den Greifer gepresst. Wie bei einer Baggerschaufel wird durch das innenliegende Seil der Greifer geschlossen und kann hochgezogen und oben entleert werden. Solche Geräte benötigen als Führung in die Tiefe das sog. Brunnenrohr, dessen Teilstücke mit einem Großgewinde zusammengeschraubt und von oben durch Drehen in die Tiefe gedrückt bzw. gedreht wurden. In einem Aufsatz von 1890 wird gar von einem Schloss berichtet, mit dessen Hilfe abgebrochenes Bohrgestänge kraftschlüssig erfasst und wieder nach oben gezogen werden konnte. Schappen bzw. Bohrgreifer konnten nur in relativ weichem Material eingesetzt werden. Wenn wir in einer Ausgabe von 1890 des Dingler schen Journals lesen, dass in diesen Jahren 13
14 14 Bohrungen bis in eine sagenhafte Tiefe von 1000 Meter niedergebracht wurden, war es unumgänglich, dass die Tiefenbohrtechnik auch auf harte Gesteinsschichten stieß, die anderes Bohrwerkzeug erforderten. Wenn wir uns dieser Technik nähern, wird vielfach übersehen, dass die Bergwerkstechnik und vor allem die Tunnelbohrtechnik am Beginn des 20. Jahrhunderts bereits Jahrzehnte hinter sich hatte. Als das Augsburger Bw in Betrieb ging, war der Gotthard- Tunnel bereits 20 Jahre in Betrieb! Ergo: Die Tiefenbohrung absolut nicht mehr am Anfang stand. (Siehe auch weiter unten!) Für hartes Gestein gab es sog. Freifallhämmer, mit welchen ähnlich einer Schlagbohrmaschine das harte Gestein zertrümmert wurde, oder mit Diamanten bestückte Bohrmeißel. Weil auch unedler Diamant offenbar schon immer teuer und rar war, hatte man einen Ersatz in Form von sog. Kupferschuhen gefunden. Diese seien mit einer Schmirgelmasse umstrichen worden und im Vergleich zum Diamant nur ein Grad weicher gewesen. Aber eben viel billiger. Die viel ältere, aber deutlich aufwändigere und viel gefährlichere Brunnen- Bohrtechnik lief dergestalt ab, dass solche Brunnen mit so einem Durchmesser angelegt wurden, dass ein Mann sich in gebückter Haltung innerhalb eines stabilen Schachtmantels buchstäblich nach unten schaufelte und bei diesem Schaufeln das Erdreich unter der Schalung entfernt wurde. Dass die Arbeit in mehrerlei Hinsicht nicht ungefährlich war, bedarf wohl kaum eines Hinweises. Prof. Karl Kling, Begründer des noch heute seinen Namen tragenden Ingenieurbüros in Krumbach, berichtet, dass diese Brunnenbauer speziell in Vorderasien zu den bestbezahlten Beschäftigten zählten. Diese Art von Brunnenbohrung klingt bei erstem Anschein zwar sehr exotisch und wurde beim Erbohren der Brunnen an der Firnhaberstraße mit Sicherheit nicht eingesetzt, doch habe in einem Schrebergartengelände von Diedorf ein einzelner Mann auf diese Art ganz allein, nur unter Mitarbeit seiner Ehefrau nach dem 2. Weltkrieg einen Brunnenschacht bis in eine Tiefe von ca. 25 Metern gegraben. Da zu dieser Zeit dort auch kein elektrischer Strom zur Verfügung stand, nutze der pfiffige und kühne Brunnenbauer das Sonnenlicht, das er mit Spiegeln in die Tiefe lenkte. Die Aufgabe seiner Frau war es, mittels Seilwinde nicht nur die vollen Kübel nach oben zu holen, sondern auch ihren Mann in die Tiefe zu lassen und auch wieder hoch zu holen! Zurück zur Brunnenbohrerei an der Firnhaberstraße: Herr Joanni kennt die alte Bohrtechnik nur noch vom Hörensagen und ist sich sicher, dass Brunnenbauten in diese Tiefe wahrscheinlich deutlich mehr als ein Jahr benötigten. Bei Gad (Lit.Nr.6) lesen wir, dass an vielen Tagen oft nicht mehr als 40 cm geschafft wurden. Wer je beobachten konnte, wie z.t. dürftig das Erdreich ausfällt, das bei einem Niederbringen der Schappe gewonnen wird, zweifelt keine Sekunde an dieser Einschätzung. Es ist anzunehmen, dass die Dampfmaschine nicht nur zum Antrieb der Seilwinde für das Hoch- und Niederbringen der Schappe eingesetzt wurde, sondern, dass auch für das Drehen des Borgestänges und das Nach- unten- Bohren des Brunnenrohrs schon bald die menschliche oder tierische Kraft durch die Dampfmaschine ersetzt wurde. Ein Letztes zu diesem Thema: Wir Heutige fragen uns, wie unsere Altvorderen am Beginn des 20. Jahrhunderts es mit welchen Mitteln geschafft hatten, einen Brunnen bis in eine Tiefe von 177 zu bohren. Alles ein Klacks! Wir haben einen glaubhaften Bericht in Lit.Nr. 15, dass 14
15 15 im Raum Erfurt schon 1827 eine Bohrung bis in eine Tiefe von 335 Metern abgeteuft wurde, die damals welch Wunder - als die tiefste Bohrung der Welt galt! Das Wasserhaus Wer sich mit den bayerischen Nebenbahnen beschäftigt hat, wird festgestellt haben, dass es auf bzw. an den Bahnsteigen der Endstationen keine Wasserkräne gab. Diese waren, wie die zugehörigen Reservoirs in den Lokschuppen, im bayer. Sprachgebrauch als Maschinenhäuser bezeichnet. Warum? Die Wasserversorgung durfte durch Frost nicht gefährdet sein! Was auch der schon erwähnte Buchautor Leopold Niederstraßer in seinem Leitfaden bemerkt, wurde in Bayern seit jeher beachtet, dass die Wasserreservoirs und Wasserkräne frostsicher untergebracht waren und gegebenenfalls sogar für Wärme aus entsprechenden Ofenheizungen gesorgt werden konnte. Dass es in anderen Gegenden auch anders zuging, sehen wir an zwei museal erhaltenen Wassertürmen. Der eine zählte zum ehem. Bahnbetriebswerks (und heutigen Eisenbahnmuseums) in Bochum- Dahlhausen, und der andere gehörte zum alten Bw Berlin- Anhalter Bahnhof. In beiden Fällen waren die eisernen Wasserbehälter ohne jeden Frostschutz aufgestellt worden. Bild Nr. 9: Foto des Wasserhauses von Norden her Daher braucht uns nicht zu wundern, dass die Zisternen sowohl der alten Betriebswerkstätte (gegenüber dem Hauptbahnhof) wie auch die des neuen Augsburger Bahnbetriebswerks im obersten Stockwerk (unter dem schon damals isolierten) Dach eines eigens errichteten Wasserhauses eingebaut wurden. Weshalb Wasserhaus und nicht Wasserturm? Die zwei äußeren Zisternen haben die Ausmaße von 8,4 x 4,0 x 2,5 Meter und die mittlere die 15
16 16 Größe von 8,4 x 5,2 x 2,5 Metern. Die Grundfläche aller drei Behälter beträgt demnach rund 110 Quadratmeter. Für Kontroll- und Revisionsarbeiten, aber wohl auch mit Rücksicht auf die Statik mussten von Anfang auch entsprechende Zwischenräume geplant werden, so dass wir es schlussendlich mit einer Gesamtfläche von 150 Quadratmetern zu tun haben. Und damit auch erkennbar wird, dass solche Ausmaße für einen Wasserturm der damaligen Zeit doch eindeutig zu groß gewesen wären. Bild Nr. 10: Skizze des Wasserhauses (Sammlung Erhart) von 1916 Die drei vollgefüllten Zisternen hatten ein Fassungsvermögen von rund 250 Kubikmetern. Addieren wir zum reinen Wassergewicht noch das des Stahls von vielleicht Tonnen dazu, kommen wir auf ein Gesamtgewicht von ca. 275 Tonnen. Dies entspricht in etwa dem Gewicht von zwei Dampfschnellzuglokomotiven, wie sie der Besucher in der Montierung nebenan sehen kann. Dass die Bauleute diese Belastung beim Bau kalkulierten, wird an den mächtigen Mauern des Wasserhauses sichtbar. Im Gegensatz zu anderen Gebäuden dieser Größe haben hier die tragenden Wände eine Mauerstärke von 60 cm, im Keller und an einigen anderen Stellen beträgt die Mauerdicke gar 75 cm! Prof. Wilhelm Ruckdeschel (früher Leiter des Instituts für Technikgeschichte an der Fachhochschule Augsburg) beschreibt in Lit.Nr. 10 die Wassertürme der Lechfeldgemeinden Schwabmünchen, Bobingen, Stadtbergen und Gersthofen. Diese Wassertürme entstanden interessanterweise ziemlich genau in jenen Jahren, in welchen auch das Bahnbetriebswerk an der Firnhaberstraße gebaut wurde. Im Gegensatz zu den Bw- Zisternen wurden die Reservoirs dieser gemeindlichen Wassertürme nicht aus Stahl bzw. Eisen, sondern ausschließlich aus Beton gefertigt. Die Türme von Schwabmünchen und Bobingen trugen 16
17 17 zwei Behälter mit zusammen 150 m³, während die von Stadtbergen und Gersthofen nur ein Reservoir enthielten. Mit 30 Meter über Terrain führte der Schwabmünchner die Reihe an. Was bewog die Erbauer, sich für diesen schweren Baustoff zu entscheiden, zumal die Wassertürme um Längen höher gebaut wurden, als das Wasserhaus des Bahnbetriebswerks? Ruckdeschel schreibt zum Gersthofer Turm Die Zeit der eisernen Hochbehälter auf historisierender Architektur ist nun gerade vorbei.. Wenn die Kgl.Bay.Staatsbahn sich im Fall Augsburg dennoch für eiserne Behälter entschied, dürfte das ausschließlich statische Gründe gehabt haben. Wenn die 150 m³ von Schwabmünchen lt. Ruckdeschel bereits eine Last von 200 to bedeuteten, bedarf es keiner weiteren Erklärung, weshalb in Augsburg mit einem fast doppelten Fassungsvermögen unverändert auf Eisen gesetzt wurde. Dass auch technisch die Zeit nicht stehen blieb, sehen wir am Wasserturm des früheren Bahnbetriebswerks Hamburg- Altona. Hier wurde in den Jahren 1954/55 ein neuer Wasserturm ausschließlich in Stahlbeton erstellt, dessen sog. Flachbodenbehälter ein Fassungsvermögen von stattlichen 500 m³ gehabt hat, bzw. noch hat, da er nach Ende der Dampflokzeit unter Denkmalschutz gestellt wurde. Das Interessante an diesem immerhin 37 m hohen, kühnen Bauwerk: Die tragenden Elemente, sprich der Turm selbst, besteht aus einem inneren zylindrischen Turmkern und vier mächtigen Betonpfählen, deren Flucht sich von oben nach unten sogar verjüngt! 17
18 18 Bild Nr. 11: Zisterne 18
19 19 Was war im Anbau? Die nebenstehende Planskizze des ursprünglichen Hauses zeigt (von Norden betrachtet) auf der rechten Seite einen Gebäudeteil, dessen Dach das des übrigen Gebäudes um gut und gerne drei Meter überragte. Weshalb? Wir waren anfänglich bei der Suche nach einer griffigen Antwort auf Vermutungen angewiesen, die jedoch seit Januar 2015 sogar richtig belegt werden können. Die Eisenbahn, und hier die Dampflokfachleute hatten schon in den ersten Jahrzehnten erkannt, dass Wasser nicht gleich Wasser ist! Auch wenn Wasser für das menschliche Auge optisch glasklar und rein daherkommt, enthält es eine Menge Stoffe, die beim Verdampfen frei gesetzt werden und sich im Kesselinneren als unerwünschte Ablagerungen, als Kesselstein, bemerkbar machen und den Wärmedurchgang und damit die Dampfleistung des Kessels massiv behindern würden. Das beste Beispiel aus dem Haushalt ist der vielfach verwendete Wasserkocher, an dessen Wänden und insbesondere im Bereich der darunter liegenden Heizspirale sich je nach Wasserhärte unerfreuliche grau- gelbliche Ablagerungen bemerkbar machen. Apropos Wasserhärte: Bei den Härtebildnern unterscheidet die Wasserchemie die vorübergehende und die bleibende Wasserhärte. Während wir es bei Ersterer mit einer Verbindung von Magnesium und Kalzium mit Kohlensäure zu tun haben, wird die bleibende Härte als eine Verbindung von Sulfaten und Chloriden mit diesen beiden Elementen beschrieben. Nicht zuletzt durch den 2. Weltkrieg und die schweren Jahre danach konnte sich die junge Deutsche Bundesbahn erst Anfang der 1950er- Jahre mit der schon Jahre zuvor in den USA gefundenen und erfundenen inneren Kesselspeisewasseraufbereitung (Nalco) auseinandersetzen und einführen. Bis dahin behalf sich der Dampflokbetrieb mit der (äußeren) Wasseraufbereitung, wozu Chemikalien und zwar Ätzkalk und Soda eingesetzt wurden. 19
20 20 Bild Nr. 12: Skizze Kalk- Soda- Verfahren aus Niederstraßer (Seite 528) Leopold Niederstraßer hat uns in seinem bereits wiederholt erwähnten Leitfaden auch eine Skizze einer solchen Wasseraufbereitungsanlage nach dem Kalk- Soda- Verfahren hinterlassen. Und diese Einrichtung müssen wir mit großer Wahrscheinlichkeit in dem oben erwähnten seitlichen Gebäudeteil vermuten! Ein über mehrere Ausgaben reichender Aufsatz eines Ingenieurs Grimmer (Lit.Nr. 7) beschreibt wiederum im Dingler von 1906 mit einer Vielzahl von Skizzen das Kalk- Soda- Verfahren in mehreren Varianten, so dass kaum noch Zweifel bestehen, dass der Anbau eine solche Anlage enthalten haben muß, zumindest für den Einbau vorgesehen war. Kurz vor Abschluss des Manuskripts erreichte den Verfasser ein Lehrheft der frühen Deutschen Bundesbahn aus dem Jahr 1957 (Lit.Nr. 13), das sowohl das von Niederstraßer beschriebene Verfahren, als auch ein Baryth- Soda- Verfahren beschreibt und die einfachen Prinzipskizzen echte Parallelen zur oben erwähnten Zeichnung von 1916 erkennen lassen. Die Niederstraßer sche Skizze beschreibt die eingezeichneten großen Behälter, als Kalksättiger und als Reaktions- und Klärbehälter. Nachdem bei allen drei Behältern das Kaltwasser im natürlichen Gefälle (von oben nach unten) durch die Behälter geleitet werden musste, kann angenommen werden, dass im Augsburger Wasserhaus die Behälter sowohl nebeneinander, als auch über einander angeordnet waren, wodurch das mehrmalige Hochpumpen entfallen konnte, hierfür aber ein entsprechend hohes Gebäude von Nöten war. Nachteil: Die Kalkbrocken (im obersten Kalksättiger ) mussten auch hochgebracht werden, wozu evtl. ein leichter Kran eingebaut war, was auch das höhere Dach erklären würde. 20
21 21 Die Zeichnung vom Oktober 1916 zeigt in der Darstellung der Stirnseite des Gebäudes zwei nebeneinander stehende Behälter. Die Einschnürung des linken Behälters ließe auf den von Niederstraßer dargestellten Kalksättiger schließen, währen der rechte Behälter einen Wasserzulauf von oben erkennen lässt, der in der Zeichnung mit Rohwasser bezeichnet ist. Letzte Sicherheit in der Annahme liefert der kleine Behälter im Kellergeschoß, der nach Niederstraßer entweder als Behälter für die Kalkmilch oder als Kiesfilter gedeutet werden kann. Wir dürfen davon ausgehen, dass demnach Ätzkalk und Soda bis zur Einführung der inneren Kesselspeisewasseraufbereitung die einzigen Möglichkeiten boten, zumindest einem Teil des Speisewassers seine Härte zu nehmen. Interessant: Auch bei der Wasseraufbereitung in Kraftwerken fällt als Abfall aus einem Kalk- Soda- Verfahren, in Verbindung mit Eisen- 3- Chlorid, ein gelblicher Sand an, den die Kraftwerke kostenlos an die Landwirtschaft abgeben und dort zur Regeneration nährstoffarmer Böden eingesetzt wird. Bei einer Begehung des Gebäudes im Mai 2014 wurde festgestellt, dass dieser Gebäudeteil sich bis auf die Treppen von oben bis unten leergeräumt zeigt. Die Treppen machen einen alten Eindruck. Heißt: Sie könnten zur Erstausstattung des Gebäudes gehört haben. Da die Treppen entlang der Außenwände angelegt sind, bleibt die (berechtigte) Vermutung, dass die Treppen um die diversen Behälter angeordnet werden mussten und so nach oben bis zu den Zisternen geführt haben. Das Nebulöse um diesen Anbau findet seinen Höhepunkt darin, dass sich trotz intensiven Nachfragens nicht klären ließ, wann dieser Gebäudeteil leergeräumt und der Dachaufsatz entfernt wurde. Heute zeigt das Dach des Wasserhauses eine einheitliche Firstflucht. Des Rätsels Lösung.. gibt es! Im Januar 2015 tauchte eine Arbeit des Instituts für Technikgeschichte an der FH Augsburg (Frau Anita Kuisle) auf, die unsere Vermutung bestätigt! Im Anbau war die sog. Wasserreinigungsanlage, welche einen Wasserdurchsatz von bis zu 50 cbm pro Stunde gehabt habe. Leider fehlen Angaben, nach welchem Verfahren gearbeitet wurde. Aber es gibt noch einen weiteren, hochinteressanten Hinweis: Die Anlage wurde hier gar nicht fabrikneu eingebaut, sondern hatte zuvor bereits in der alten Betriebswerkstätte gegenüber dem Hauptbahnhof ihren Dienst getan. Ein guter Beleg, dass man offenbar auch schon in frühen Jahren der Qualität der Kesselspeisewässer große Aufmerksamkeit schenkte. Und noch eine (fast)- Lösung: Ein Foto vom 25. September 1960 in Lit.Nr.12 lenkt den Blick des Betrachters sicher zunächst auf die Lokparade im südlichen Rundhaus, doch hat uns der Fotograf unfreiwillig zwei Beweise geliefert: a), dass der hinter dem Rundschuppendach aufragende Anbau Ende 1960 noch vorhanden war, und b), ist ganz am linken Bildrand ein Wasserkran zu erkennen. Über deren Situierung wird in einem der folgenden Kapitel berichtet. Sowohl der Anbau wie auch das rechts davon erkennbare Dach des Wasserhauses mit den vier Schornsteinen, wie auch die ganz links gerade noch erkennbare Ecke des nördlichen Nachbarn belegen, dass die 21
22 22 Lokparade vor dem heute nur noch als Ruine vorhandenen südlichen Schuppens fotografiert wurde. Bild Nr. 13: Repro des im Text erwähnten Fotos von U. Montfort. Über der rechten Lok BR 38 ist das Dach des Anbaus gut zu erkennen! Bezeichnend, dass auf das ohnehin erhöhte Dach noch zusätzlich ein kleiner Aufsatz gebaut worden war! Hartes Wasser weiches Wasser Trotz Außerbetriebnahme sind im Wasserhaus noch alle Rohrinstallationen vorhanden, ja sogar ein hölzerner Stopfen liegt noch am Boden. Auch die oben beschriebenen Rohre mit den beachtlichen Durchmessern sind noch vorhanden. Es gab dreierlei Rohrleitungen: Die nicht ganz so dicken Leitungen von den Brunnen zu den Zisternen, dann die dicken zu den Wasserkränen, und schlussendlich hatte jede Zisterne auch noch ein sog. Überlaufrohr. Diese sind als quasi Notüberlauf zu sehen, denn jede Zisterne verfügte über ein Schwimmerventil, das bei Erreichen des Höchstwasserstands den Zulauf abzuschließen hatte. Zu obiger Überschrift gibt es seitens der früheren Bw- Beschäftigten mehrere interessante Feststellungen bzw. Aussagen: Zum Rohwasser selbst haben wir zwei Berichte: Zum Einen schreibt der Verfasser über den 3. Brunnen (Lit.Nr. 11), dass die Gesamthärte 12,8 dh betragen habe, und bezeichnet es als mittelhart. 22
23 23 Die zweite, noch interessanter Aussage liefert uns der weiter oben erwähnte Werkmeister, der sich erinnern kann, dass entgegen der amtlichen Vorgabe - die Wasserförderung vornehmlich aus dem Brunnen 1 gesteuert wurde, da dieser ein spürbar weicheres Wasser lieferte, als der tiefe Brunnen 2. Ein ehem. Lokführer hat in Erinnerung, dass dieses Wasser nur eine Härte von fünf dh gehabt habe. Hieße, dass die Wässer des seichteren Brunnens während ihrer Versickerung durch die Erdschichten schlicht und einfach weniger Möglichkeit hatten, sich vorwiegend mit Magnesium und Kalzium anzureichern. Dass diese These nicht von der Hand zu weisen ist, sehen wir an der Mozartquelle der Riegele Brauerei. Auf dem langen Weg durch die Erdschichten bis in eine Tiefe von mehr als 200 Metern konnte das Wasser so viele Mineralien aufnehmen und auflösen, dass es die Brauerei heute als Mineralwasser vermarkten kann. Das aus der Enthärtungsanlage gewonnene Wasser wurde nicht in die Wasserkräne geleitet, sondern wurde lt. Herrn Erhart nur zum Befüllen der frisch ausgewaschenen Lokomotiven verwendet. Die Skizze im Niederstraßer deutet an, dass das aus dem Hochschichtkiesfilter kommende Wasser zunächst in eine Reinwassergrube und von dort in einen Hochbehälter geleitet wurde. Wir haben leider keine Kenntnis, wie das in Augsburg organisiert war, zumal auch unbekannt ist, welche Stundenleistung die Enthärtungsanlage hatte. Wasserturm In einem von Herrn Erhart geretteten Bw- Lageplan aus dem Jahr 1947 ist die Wasserenthärtung in einem eigenen Gebäude in der Nähe des nördlichen Rundschuppens eingezeichnet. Erhart kann sich an die Existenz des Gebäudes noch erinnern. Leider finden sich keine Angaben, wann diese Enthärtungsanlage in Betrieb ging. Zu vermuten ist, dass es vielleicht zu jenem Zeitpunkt geschehen sein könnte, als zusätzlich zu den Zisternen im Wasserhaus Anfang der 1940er- Jahre noch ein Wasserturm errichtet wurde. Und auch für dessen Wasser eine (externe) Wasseraufbereitung vorgesehen werden musste. 23
24 24 Bild Nr. 14: SW- Foto Erhart vom Wasserturm. Aus dem Dach ragt ein Schornstein, was bestätigt, dass auch in diesem spät erbauten Gebäude an den Frostschutz gedacht wurde. 24
25 25 In der umfangreichen Erhart schen Fotosammlung finden wir auch Aufnahmen dieses sehr einfachen, quadratisch gebauten Wasserturms, der lt. einem Lageplan auf Höhe der Schlackengrube, südlich des Stellwerks Bw- Süd errichtet wurde. Zum warum tappen wir wiederum im Dunkeln. Ein Grund könnte gewesen sein, dass die Deutsche Reichsbahn mit Beginn des 2. Weltkriegs auf Nummer sicher gehen wollte, und die damaligen Sicherheitsüberlegungen unterstellten, dass bei einem durch Bomben beschädigten Wasserhaus die Versorgung der Dampfloks ernsthaft gefährdet worden wäre, was zur Errichtung dieses Ersatz- Reservoirs geführt haben könnte. Die nicht unbeträchtliche Entfernung zwischen Wasserhaus und Wasserturm von ca. 350 Metern kann als Indiz dieser Vermutung gewertet werden. Die sicher nie publik gemachte Angst- Strategie könnte auch durch den seit 1931/33 bzw existierenden elektrischen Betrieb zwischen München und Stuttgart bzw. Nürnberg verstärkt worden sein. Die Fahrleitung galt sicher als schwächstes Glied dieses Betriebs, zumal während des 1. Weltkriegs der elektrische Betrieb auf den wenigen Netzen nahezu vollständig eingestellt war. Bei einer großflächigen Beschädigung der Fahrleitung wäre der Einsatz von Elloks nicht mehr möglich gewesen, und an deren Stelle hätten zusätzliche Dampfloks eingesetzt werden müssen. Die Wasser benötigt hätten! Der neue Wasserturm wurde im Gegensatz zu den alten Bauten ohne jeden Schnick- Schnack erstellt und lediglich der Behälterbereich (wohl aus Gründen des Frostschutzes) wurde mit einer Holzverkleidung versehen. Da es sich um einen Kriegsbau handelt, und alles in diesem Zusammenhang Entstandene großer Geheimhaltung unterlag, sind uns auch keine näheren Angaben oder gar Zeichnungen erhalten bzw. noch zugänglich. Nach den erhaltenen Lageplänen und dem Foto könnte der Turm eine Grundfläche von maximal 8 x 8 Meter (ca. 1/3 der 23- m- Drehscheibe) gehabt haben. Es ist davon auszugehen, dass das Wasserreservoir sicher nicht mehr in Stahl, sondern in Beton, und dieses schon aus statischen Gründen kreisrund gebaut war. Gehen wir von einem maximalen Innendurchmesser von vielleicht 7 Metern und einer Zisternenhöhe von 2,5 Metern aus, hätte das Reservoir ein Fassungsvermögen von rund 100 Kubikmetern gehabt. In einer Luftaufnahme des Bws aus südlicher Richtung von 1960 sind sowohl der Wasserturm, wie das Süd- Stellwerk und weiter nördlich auch noch der Turm der Besandungsanlage deutlich zu erkennen. Wir tappen wieder im Dunkeln, wann der Turm geschleift wurde. Nicht auszuschließen, dass das Ende der Dampflokzeit 1971 bzw. der Anschluss an die städtische Wasserleitung auch für ihn das Aus bedeutet haben. 25
26 26 Bild Nr. 15: Luftaufnahme des Bw um Im rechten unteren Drittel des Fotos sind links eines langgestreckten Gebäudes mit Satteldach und daneben die hellen Baukörper des Wasserturms und des Süd- Stellwerks gut auszumachen. Auf Höhe des (undeutlich zu erkennenden) südlichen Rundhauses ragt der helle Turm der Besandungsanlage heraus. Weiter bemerkenswert: Auf dem Bw- Gelände entdecken wir vier hohe Schornsteine, wovon zwei an den beiden Rundschuppen ausschließlich für den zentralen Rauchabzug der Lokomotiven benötigt wurden. (Foto: Sammlung Erhart) Bw- Broschüre Seite 70. Die Wasserkräne Die erhaltenen Grundrisszeichnungen und die Erinnerungen der Herren Erhart und Wöhrl bestätigen, dass das Bw in seiner Blütezeit mit drei Wasserkränen ausgestattet war. Je ein Wasserkran befand sich an der Zufahrt zu den beiden Drehscheiben, und den dritten finden wir auf Höhe der Schlackengrube. Wie die Skizze zeigt, war dieser Wasserkran so angeordnet, dass während des Ausschlackens gleichzeitig Wasser gefasst werden konnte. Auch die mit heißer Glut und Asche gefüllten Schlackenhunte konnten so problemlos abgelöscht werden, so dass ein Verbringen in den bereitstehenden Schlackenwagen ohne jede Brandgefahr möglich war. Zur Ausführung der Wasserkräne haben wir leider nur ganz spärliche Informationen. L. Niederstraßer schreibt, dass für die Auslaufwassermenge mehrere Vorgaben existierten, die von 2 m³ über 5m³ bis 10 m³ pro Minute reichten, wenn Schnellzugloks an Bahnsteigen während eines kurzen Aufenthalts nachfassen mussten. Betrachten wir uns im Wasserhaus die properen Leitungen, die in einem Plan mit einem Durchmesser von 250 mm angegeben sind, ist davon auszugehen, dass da schon 5 m³ minütlich abfließen konnten. 26
27 27 Bild Nr. 16: dicker Holzstopfen (der Vergleich zu den Männerbeinen zeigt den beachtlichen Durchmesser dieser Stopfen). 27
28 28 Die größten Loks, die das Bw Augsburg je beherbergte, zählten zur Baureihe 50. Und deren T 26- Tender hatten ein Fassungsvermögen von 26 m³. Da die Tender ja nie bis zum letzten Tropfen leer gefahren wurden, also vielleicht maximal 20 m³ fehlten, hätte das Wasserfassen bei der angenommenen Durchflussmenge von 5 m³ gerademal 4 Minuten gedauert. Da das Gesamtfassungsvermögen aller vier Zisternen (incl. Wasserturm) bei rund 350 m³ lag, hätten (theoretisch) aus dem Gesamtwasservorrat binnen Minuten immerhin mind. 17 Lokomotiven dieser Baureihe befüllt werden können. Bei nur drei Wasserkränen eine rein rechnerische Größe, die uns aber vor Augen führen soll, welche Wassermenge da gespeichert war. Bild Nr. 17: Erinnerungsfoto des 1983 stillgelegten letzten Wasserkrans Wann von den ehemals vorhandenen drei Wasserkränen die ersten zwei stillgelegt wurden, konnte nicht definitiv geklärt werden. Der letzte, der 1983 an der südlichen Drehscheibe stillgelegt wurde, war wie das Erinnerungsfoto zeigt, ein normaler Kran mit festem Ausleger, also kein sog. Gelenkkran, wie sie speziell an den Bahnsteigen aufgestellt waren. Hieß: Der Lokführer musste fast punktgenau anhalten, da auch die Einfüllöffnungen der Tender bzw. Wasserkästen nicht gar so viel Spielraum beließen. Der erwähnte Wasserkran war lt. Foto kleiner, als der wieder aufgebaute Wasserkran gegenüber dem sog. Übernachtungsgebäude. Der Neue konnte vor einigen Jahren aus einem Bw der ehem. Reichsbahn in der DDR beschafft werden. 28
29 29 Bild Nr. 18: Der neue Wasserkran im Bahnpark Übrigens: Das letzte Speisewasser ging nicht an die Dampflokomotiven, sondern an Diesellokomotiven. Die zwar nie zum Augsburger Bw- Bestand gehörenden, aber hier wendenden V 200 des Bw Kempten hatte an der Außenwand ausklappbare 29
30 30 Wassertaschen, über welche an einigen Wasserkränen Speisewasser für die Dampfheizung gefasst werden konnte. Das Wasserfassen der einmotorigen V 100 für das Zugheizaggregat geschah mit einem Schlauch, dessen Kupplung aus dem Bereich Feuerwehr stammte. Bild Nr. 19: Wassertasche an einer V
31 31 Das Ende und das Erbe Bereits mit der Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung aus dem Jahr 1973 hatten wir Grund, uns über diesen Vorgang zu wundern. Zum einen, als zu diesem Zeitpunkt das Ende des Dampflokeinsatzes beim Augsburger Bahnbetriebswerk vollständig vollzogen worden war. Zum anderen: Dass es zu diesem Zeitpunkt den schon erwähnten Anschluss an die städtische Wasserversorgung bereits gab und die Aufgabe des letzten Wasserkrans absehbar war. Viele Wochen sah es während der Recherchen so aus, dass das Ende der Bw- eigenen Wasserförderung mit Mitte der 1970er- Jahre unzweifelhaft richtig beschrieben gewesen wäre. Doch die Entdeckung der Jahresangabe auf der Wasseruhr (1979) im Brunnenschacht II brachte die Aussage ins Wanken. Und dann folgende Gespräche mit früheren Lokführern ergaben, dass wie weiter oben ausgeführt offenbar auch Anfang der 1980er- Jahre die eigene Wasserförderung noch nicht total stillgelegt war. Erst der erwähnte Frostschaden habe schlussendlich zur Einstellung geführt. Ob nun Mitte der 1970er- Jahre oder erst 1985 es handelt sich um eine lange Zeit, in welcher sowohl die zwei Tiefbrunnen incl. der zugehörigen Förderpumpen und - Leitungen und auch das Wasserhaus incl. der obenliegenden Zisternen nicht angetastet bzw. in ihrem Bestand verändert oder gar rückgebaut wurden. Wenn ein Automobil, das gerademal 30 Jahre in passablem Zustand überdauert hat, in die Kategorie technisches Kulturgut aufgenommen und mit einem Zusatz im Kennzeichen (H- Nummer) aus der Masse der Millionen anderer Straßenfahrzeuge herausgehoben wird, sollte das auch für technische Einrichtungen der Wasserversorgung der Eisenbahn gelten. Seit einigen Jahren gibt es massive Bemühungen, die alte Augsburger Wassertechnik eines Caspar Walter und des berühmten Stadtbaumeisters Elias Holl auf den Schild eines Weltkulturerbes erheben zu lassen. Es ist unbestritten, dass wir es hier mit Methusalems der Trinkwassergewinnung zu tun haben. Dabei sollte nicht verkannt werden, dass wir in dem kompletten Erhalt der Wasserförderung und Speicherung an der Firnhaberstraße von einem echten Glücksfall sprechen können, die in ihrer Gesamtheit die Jahre seit Stilllegung des Bahnbetriebswerks unbeschadet überdauern konnte und auf eine ähnliche Respektstufe gestellt werden sollte, wie die erwähnten Anlagen am Roten Tor. Womit das behördliche Verlangen, diese Brunnen zu verfüllen, aus Gründen des allgemeinen Grundwasserschutzes zwar verständlich erscheint, aber bei entsprechender Sicherung auch das Historische durch einen Erhalt gewürdigt werden sollte. Insbesondere dann, wenn eine Wasseruntersuchung reines Tiefenwasser anzeigen sollte, und dieses nicht durch in das Brunnenrohr eingedrungenes, oberflächennahes Grundwasser verunreinigt ist. Und - wenn wir uns von einem jungen Brunnenbauer sagen lassen können, wie viele Monate wohl ins Land gehen mussten, ehe unsere Altvorderen als Brunnenbauer da unten am Ziel waren, ist zu wünschen, dass Denkmalschutz und behördliches Verlangen einen akzeptablen Mittelweg finden können. 31
32 32 Bild Nr. 20: Original- Fenster im obersten Stockwerk des Wasserhauses 32
33 33 Das Gleiche gilt auch für das Wasserhaus, das sich (leider) viel banaler, weniger ehrwürdig vor uns auftut, als ein Wasserturm, wie sie in den erwähnten Orten des Lechfelds alle erhalten sind und als technische Denkmale gepflegt werden. Da hat es unser Wasserhaus viel schwerer, noch dazu, weil uns dieses Gebäude mit einer ganz einfachen und schlichten Fassade gegenübertritt. Dass wir in seinem Obergeschoß diese drei vor Ort genieteten Zisternen in einem optisch sehr guten Zustand vorfinden, macht auch das Gebäude mit seinem massiven Mauerwerk zwangsläufig zu einem technischen Denkmal. Bei der denkmalpflegerischen Bewertung sollte berücksichtigt werden, dass das Wasserhaus als Wasserturm zwar um Jahrhunderte jünger ist, als die Türme am Roten Tor, diese aber lt. Ruckdeschel im strengen Sinne gar keine Funktion als Reservoir hatten, sondern nur als Puffer gedacht waren, um den stoßweisen Zulauf der Kolbenpumpen auszugleichen. Ebenso verdient die Nietbauweise der drei stattlichen Behälter (vermutlich aus ganz einfachem Flusseisen) im denkmalpflegerischen Sinne besonders hervorgehoben zu werden. Bild Nr. 21: dicke und dünne Wasserleitungen Dass das Gebäude im Laufe der Jahrzehnte vorwiegend für die Verwaltung des Bws genutzt wurde, sich dort bis fast zum Schluss sogar Geschäftsräume der Sparda- Bank befanden, sollte die Wertschätzung der in die Jahre gekommenen Bausubstanz nicht schmälern. 33
Bohranleitung für einen Bohrbrunnen
 Vorbemerkung: Bohranleitung für einen Bohrbrunnen Die immer weiter steigenden Brauchwasserpreise machen eine Überlegung der Eigenversorgung zur Beregnung des Gartens lohnenswert. Die Herstellung eines
Vorbemerkung: Bohranleitung für einen Bohrbrunnen Die immer weiter steigenden Brauchwasserpreise machen eine Überlegung der Eigenversorgung zur Beregnung des Gartens lohnenswert. Die Herstellung eines
Hygienische Anforderungen. an Trinkwasser im österreichischen Lebensmittelbuch. Hygienische Anforderungen. Hygienische Anforderungen
 ÖLMB Kapitel B1 Trinkwasser (3) Alle Einrichtungen der Förderung, des Transportes, der Speicherung, der Aufbereitung und der Verteilung des Wassers (Wasserversorgungsanlage) müssen so errichtet, betrieben
ÖLMB Kapitel B1 Trinkwasser (3) Alle Einrichtungen der Förderung, des Transportes, der Speicherung, der Aufbereitung und der Verteilung des Wassers (Wasserversorgungsanlage) müssen so errichtet, betrieben
Unterrichtsmaterialien
 Unterrichtsmaterialien Arbeitsblatt Maschinen und Fortbewegung Lösungen 1. Tretkran (Ebene A) 1.1 Wie ermöglicht es der Tretkran, sehr große Lasten zu heben? Mit welchem Übersetzungsverhältnis wird die
Unterrichtsmaterialien Arbeitsblatt Maschinen und Fortbewegung Lösungen 1. Tretkran (Ebene A) 1.1 Wie ermöglicht es der Tretkran, sehr große Lasten zu heben? Mit welchem Übersetzungsverhältnis wird die
Posten 3: Strom aus Wasserkraft Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Die Sch lösen in Gruppen den vorliegenden Posten unter Einbezug der vorhandenen Unterlagen und Materialien. Ziel Material Die Sch sind in der Lage, die unterschiedlichen
Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Die Sch lösen in Gruppen den vorliegenden Posten unter Einbezug der vorhandenen Unterlagen und Materialien. Ziel Material Die Sch sind in der Lage, die unterschiedlichen
Herstellung von Mauerwerk
 Herstellung von Mauerwerk Handvermauerung und Mauern mit Versetzgerät Bei der Handvermauerung hebt der Maurer die einzelnen Steine von Hand in das frische Mörtelbett (Abb. KO2/1). Die Handvermauerung findet
Herstellung von Mauerwerk Handvermauerung und Mauern mit Versetzgerät Bei der Handvermauerung hebt der Maurer die einzelnen Steine von Hand in das frische Mörtelbett (Abb. KO2/1). Die Handvermauerung findet
5.3. Wärmebrücken an Treppen
 5.3. Wärmebrücken an Treppen Wärmebrücken zwischen Treppen und angrenzenden Bauteilen können entstehen, wenn - unterschiedliche Temperaturen in Treppenhäusern und angrenzenden Räumen bestehen, - Treppenläufe
5.3. Wärmebrücken an Treppen Wärmebrücken zwischen Treppen und angrenzenden Bauteilen können entstehen, wenn - unterschiedliche Temperaturen in Treppenhäusern und angrenzenden Räumen bestehen, - Treppenläufe
Projekt EMPIRIE Kolben und Ringe
 er Kolben Ein Kolben ist ein zylinderförmiges Maschinenbauteil, das sich in einem Zylinder auf und ab bewegt. Die Aufgabe des Kolbens ist in einer Kolbenmaschine physikalischen Druck in Bewegung umzusetzen
er Kolben Ein Kolben ist ein zylinderförmiges Maschinenbauteil, das sich in einem Zylinder auf und ab bewegt. Die Aufgabe des Kolbens ist in einer Kolbenmaschine physikalischen Druck in Bewegung umzusetzen
LQS EWS Anlage 5. Arbeitsanweisung zum Mess-System CEMTRAKKER gemäß Leitlinie 3.3.4 (LQS EWS, Stand März 2015) Arbeitsschritte CEMTRAKKER
 Arbeitsanweisung zum Mess-System CEMTRAKKER gemäß Leitlinie 334 (LQS EWS, Stand März 2015) Nr Arbeitsschritte CEMTRAKKER 1 Arbeitsschritt 1 Die Messung erfolgt über ein mit Wasser gefülltes Rohr der Erdwärmesonde
Arbeitsanweisung zum Mess-System CEMTRAKKER gemäß Leitlinie 334 (LQS EWS, Stand März 2015) Nr Arbeitsschritte CEMTRAKKER 1 Arbeitsschritt 1 Die Messung erfolgt über ein mit Wasser gefülltes Rohr der Erdwärmesonde
Patent nr: NL 1026138 / EP 1593305 / US 2005/0258188-A1
 UltraSieve III Patent nr: NL 1026138 / EP 1593305 / US 2005/0258188-A1 Gebrauchsanleitung Funktionsweise Der UltraSieve ist ein Vorfilter um feinste Schmutzpartikel aus dem Wasser zu holen. Das System
UltraSieve III Patent nr: NL 1026138 / EP 1593305 / US 2005/0258188-A1 Gebrauchsanleitung Funktionsweise Der UltraSieve ist ein Vorfilter um feinste Schmutzpartikel aus dem Wasser zu holen. Das System
Rathaus. Hof. Rennbahn Münsterplatz Elisengarten
 Ein archäologischer Rundgang durch die historische Altstadt Die 8 archäologischen Stationen befinden sich im historischen Stadtkern Aachens. Der Rundgang dauert etwa 30Min und beträgt je nach Route zwischen
Ein archäologischer Rundgang durch die historische Altstadt Die 8 archäologischen Stationen befinden sich im historischen Stadtkern Aachens. Der Rundgang dauert etwa 30Min und beträgt je nach Route zwischen
Die Energiewerkstatt
 NUTZMÜLL e. V. Recyclinghof Altona Die Energiewerkstatt Anleiter: L. Dee Doughty Boschstraße 15 / Haus B 22761 Hamburg Telefon: 040/890663-0 FAX: 040/89 53 97 www.nutzmuell.de Die Energiewerkstatt Ziel
NUTZMÜLL e. V. Recyclinghof Altona Die Energiewerkstatt Anleiter: L. Dee Doughty Boschstraße 15 / Haus B 22761 Hamburg Telefon: 040/890663-0 FAX: 040/89 53 97 www.nutzmuell.de Die Energiewerkstatt Ziel
Hydrostatik auch genannt: Mechanik der ruhenden Flüssigkeiten
 Hydrostatik auch genannt: Mechanik der ruhenden Flüssigkeiten An dieser Stelle müssen wir dringend eine neue physikalische Größe kennenlernen: den Druck. SI Einheit : Druck = Kraft Fläche p = F A 1 Pascal
Hydrostatik auch genannt: Mechanik der ruhenden Flüssigkeiten An dieser Stelle müssen wir dringend eine neue physikalische Größe kennenlernen: den Druck. SI Einheit : Druck = Kraft Fläche p = F A 1 Pascal
Wasserkraftwerk selbst gebaut
 6 Kraftwerk mit Peltonturbine Wohl am einfachsten ist ein Picokraftwerk mit einer Peltonturbine zu realisieren. Vor allem wenn schon eine ausgiebige Quelle in angemessener Fallhöhe zur Verfügung steht
6 Kraftwerk mit Peltonturbine Wohl am einfachsten ist ein Picokraftwerk mit einer Peltonturbine zu realisieren. Vor allem wenn schon eine ausgiebige Quelle in angemessener Fallhöhe zur Verfügung steht
Hinweise zu den Aufgaben:
 Versuchsworkshop: Arbeitsaufgaben Lehrerblatt Hinweise zu den Aufgaben: Blatt 1: Die Papierschnipsel werden vom Lineal angezogen.es funktioniert nicht so gut bei feuchtem Wetter. Andere Beispiele für elektrische
Versuchsworkshop: Arbeitsaufgaben Lehrerblatt Hinweise zu den Aufgaben: Blatt 1: Die Papierschnipsel werden vom Lineal angezogen.es funktioniert nicht so gut bei feuchtem Wetter. Andere Beispiele für elektrische
Montage- und Bedienungsanleitung
 UltraSieve MIDI Patent nr: NL 1026138 / EP 1593305 / US 2005/0258188-A1 Montage- und Bedienungsanleitung Funktionsweise Der UltraSieve ist ein Vorfilter um feinste Schmutzpartikel aus dem Wasser zu holen.
UltraSieve MIDI Patent nr: NL 1026138 / EP 1593305 / US 2005/0258188-A1 Montage- und Bedienungsanleitung Funktionsweise Der UltraSieve ist ein Vorfilter um feinste Schmutzpartikel aus dem Wasser zu holen.
Beitrag: Umweltschaden durch Erdgasförderung Giftige Stoffe im Boden
 Manuskript Beitrag: Umweltschaden durch Erdgasförderung Giftige Stoffe im Boden Sendung vom 5. Juni 2012 von Christian Wilk Anmoderation: Giftiges Benzol im Boden! Schuld sind undichte Rohre. Ausgerechnet
Manuskript Beitrag: Umweltschaden durch Erdgasförderung Giftige Stoffe im Boden Sendung vom 5. Juni 2012 von Christian Wilk Anmoderation: Giftiges Benzol im Boden! Schuld sind undichte Rohre. Ausgerechnet
Holz Pichler WIRTSCHAFT
 Wald und Forst Die schönsten Bäume des Landes stehen hier. Die Holzverarbeitung blickt auf eine lange Tradition zurück und war von jeher die Verbindung mit der Außenwelt, auch als die Baumstämme noch mit
Wald und Forst Die schönsten Bäume des Landes stehen hier. Die Holzverarbeitung blickt auf eine lange Tradition zurück und war von jeher die Verbindung mit der Außenwelt, auch als die Baumstämme noch mit
Wie kommt das Wasser in die Flasche?
 Wie kommt das Wasser in die Flasche? Wie kommt das Wasser in die Flasche? Eine Geschichte von Nicole Künzel mit Bildern von Sigrid Leberer Schnaufend wirft sich Fabian auf einen Küchenstuhl. Wir haben
Wie kommt das Wasser in die Flasche? Wie kommt das Wasser in die Flasche? Eine Geschichte von Nicole Künzel mit Bildern von Sigrid Leberer Schnaufend wirft sich Fabian auf einen Küchenstuhl. Wir haben
ecoterm wärmepumpe EINFACH. EFFIZIENT. ZUVERLÄSSIG.
 ecoterm wärmepumpe EINFACH. EFFIZIENT. ZUVERLÄSSIG. 2 ECOTERM Innovativer Ansatz und die Verwendung von einzigartiger Technologie in der Welt von Wärmepumpen, ermöglicht eine Reihe von nützlichen Vorteilen,
ecoterm wärmepumpe EINFACH. EFFIZIENT. ZUVERLÄSSIG. 2 ECOTERM Innovativer Ansatz und die Verwendung von einzigartiger Technologie in der Welt von Wärmepumpen, ermöglicht eine Reihe von nützlichen Vorteilen,
Günstiger Wohnraum ist knapp Wie kann man die Not lindern?
 Montag, 28. Dezember 2015 BZ-Interview Günstiger Wohnraum ist knapp Wie kann man die Not lindern? Studenten, Niedriglöhner, Flüchtlinge sie alle brauchen günstigen Wohnraum. Klar ist: In Deutschland muss
Montag, 28. Dezember 2015 BZ-Interview Günstiger Wohnraum ist knapp Wie kann man die Not lindern? Studenten, Niedriglöhner, Flüchtlinge sie alle brauchen günstigen Wohnraum. Klar ist: In Deutschland muss
Planungshilfe Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.v.
 Planungshilfe Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.v. GEBÄUDEEINFÜHRUNGEN einfach gasdicht wasserdicht Damit Ihr Haus... Durchdringungen zuverlässig abdichten! Feuchte Keller oder Wasser
Planungshilfe Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.v. GEBÄUDEEINFÜHRUNGEN einfach gasdicht wasserdicht Damit Ihr Haus... Durchdringungen zuverlässig abdichten! Feuchte Keller oder Wasser
Protokoll zu Versuch E5: Messung kleiner Widerstände / Thermoelement
 Protokoll zu Versuch E5: Messung kleiner Widerstände / Thermoelement 1. Einleitung Die Wheatstonesche Brücke ist eine Brückenschaltung zur Bestimmung von Widerständen. Dabei wird der zu messende Widerstand
Protokoll zu Versuch E5: Messung kleiner Widerstände / Thermoelement 1. Einleitung Die Wheatstonesche Brücke ist eine Brückenschaltung zur Bestimmung von Widerständen. Dabei wird der zu messende Widerstand
POLY SAFE GESCHOSSFANGWÄNDE
 Für Ihre Schießanlagen POLY SAFE GESCHOSSFANGWÄNDE Dr. Karl-Heinz Albert Goldgrubenstr. 38 61440 Oberursel Tel. / Fax: (06172) 99 77 68 E-Mail: albert@albert-adhesives.eu www.albert-adhesives.eu POLY SAFE
Für Ihre Schießanlagen POLY SAFE GESCHOSSFANGWÄNDE Dr. Karl-Heinz Albert Goldgrubenstr. 38 61440 Oberursel Tel. / Fax: (06172) 99 77 68 E-Mail: albert@albert-adhesives.eu www.albert-adhesives.eu POLY SAFE
Geschichte Arbeitsblätter
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag In einer Gruppenarbeit wird ein grober Abriss der Holzheizung gemeinsam vorbereitet und präsentiert, nach dem Motto Von Familie Feuerstein zur modernen Holzheizung.
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag In einer Gruppenarbeit wird ein grober Abriss der Holzheizung gemeinsam vorbereitet und präsentiert, nach dem Motto Von Familie Feuerstein zur modernen Holzheizung.
Lernziele zu SoL: Druck, Auftrieb
 Lernziele zu SoL: Druck, Auftrieb Theoriefragen: Diese Begriffe müssen Sie auswendig in ein bis zwei Sätzen erklären können. a) Teilchenmodell b) Wie erklärt man die Aggregatzustände im Teilchenmodell?
Lernziele zu SoL: Druck, Auftrieb Theoriefragen: Diese Begriffe müssen Sie auswendig in ein bis zwei Sätzen erklären können. a) Teilchenmodell b) Wie erklärt man die Aggregatzustände im Teilchenmodell?
In der oben gezeichneten Anordnung soll am Anfang der Looping-Bahn (1) eine Stahlkugel reibungsfrei durch die Bahn geschickt werden.
 Skizze In der oben gezeichneten Anordnung soll am Anfang der Looping-Bahn (1) eine Stahlkugel reibungsfrei durch die Bahn geschickt werden. Warum muß der Höhenunterschied h1 größer als Null sein, wenn
Skizze In der oben gezeichneten Anordnung soll am Anfang der Looping-Bahn (1) eine Stahlkugel reibungsfrei durch die Bahn geschickt werden. Warum muß der Höhenunterschied h1 größer als Null sein, wenn
1/6. Welche Antwort ist richtig: Wie entsteht aus organischen Kohlenstoffverbindungen das gasförmige Kohlendioxid?
 1/6 Der Kohlenstoffkreislauf Arbeitsblatt B Material: Inhalte des Factsheets Grundlagen zum Klimawandel Der Wasserkreislauf (siehe Arbeitsblatt A) ist leicht erklärt: Wasser verdunstet, in höheren Schichten
1/6 Der Kohlenstoffkreislauf Arbeitsblatt B Material: Inhalte des Factsheets Grundlagen zum Klimawandel Der Wasserkreislauf (siehe Arbeitsblatt A) ist leicht erklärt: Wasser verdunstet, in höheren Schichten
Untersuchungsbericht. über die Änderung. der Trinkwasserqualität. nach der Umstellung. im Versorgungsbereich. Bomlitz / Benefeld 10-06-15
 Untersuchungsbericht über die Änderung der Trinkwasserqualität nach der Umstellung im Versorgungsbereich Bomlitz / Benefeld 1 Inhaltsverzeichnis Seite Aufgabe 3 Untersuchung 4-5 Ergebnis 6 Vergleich des
Untersuchungsbericht über die Änderung der Trinkwasserqualität nach der Umstellung im Versorgungsbereich Bomlitz / Benefeld 1 Inhaltsverzeichnis Seite Aufgabe 3 Untersuchung 4-5 Ergebnis 6 Vergleich des
Forschungsaufträge «BodenSchätzeWerte Unser Umgang mit Rohstoffen»
 Forschungsaufträge «BodenSchätzeWerte Unser Umgang mit Rohstoffen» Altersstufe Geeignet für 9- bis 14-Jährige. Konzept Die Forschungsaufträge laden ein, die Sonderausstellung von focusterra im Detail selbständig
Forschungsaufträge «BodenSchätzeWerte Unser Umgang mit Rohstoffen» Altersstufe Geeignet für 9- bis 14-Jährige. Konzept Die Forschungsaufträge laden ein, die Sonderausstellung von focusterra im Detail selbständig
Wie stelle ich Kärtchen her, auf denen hinten die Lösung aufgedruckt ist?
 Wie stelle ich Kärtchen her, auf denen hinten die Lösung aufgedruckt ist? 1. Fragen- und Lösungsblätter ausdrucken! 3. Von beiden Blättern den Rand abschneiden! 2. Jeweiliges Lösungsblatt zum richtigen
Wie stelle ich Kärtchen her, auf denen hinten die Lösung aufgedruckt ist? 1. Fragen- und Lösungsblätter ausdrucken! 3. Von beiden Blättern den Rand abschneiden! 2. Jeweiliges Lösungsblatt zum richtigen
Optische Phänomene im Sachunterricht
 Peter Rieger Uni Leipzig Optische Phänomene im Sachunterricht Sehen Schatten Spiegel Brechung Optische Phänomene im Sachunterricht Die Kinder kennen die Erscheinung des Schattens, haben erste Erfahrungen
Peter Rieger Uni Leipzig Optische Phänomene im Sachunterricht Sehen Schatten Spiegel Brechung Optische Phänomene im Sachunterricht Die Kinder kennen die Erscheinung des Schattens, haben erste Erfahrungen
Dränung und deren Grundsätze
 Dränung und deren Grundsätze Grundstücksentwässerung und Ausführung der Dränage Ausführung der Dränage Eine Abdichtung mit Dränung ist bei schwach durchlässigen Böden auszuführen, bei denen mit Stau- oder
Dränung und deren Grundsätze Grundstücksentwässerung und Ausführung der Dränage Ausführung der Dränage Eine Abdichtung mit Dränung ist bei schwach durchlässigen Böden auszuführen, bei denen mit Stau- oder
GUV GmbH plant und überwacht Sanierung des Hochbehälters Dölme der Samtgemeinde Bevern
 GUV GmbH plant und überwacht Sanierung des Hochbehälters Dölme der Samtgemeinde Bevern Auszug aus Täglicher Anzeiger, Holzminden Weitergehende Erläuterungen zur abgeschlossenen Sanierung des Hochbehälters
GUV GmbH plant und überwacht Sanierung des Hochbehälters Dölme der Samtgemeinde Bevern Auszug aus Täglicher Anzeiger, Holzminden Weitergehende Erläuterungen zur abgeschlossenen Sanierung des Hochbehälters
MONTAGEANLEITUNG MULTI-DECK
 Wissenswertes rund um Multi-Deck Sie haben sich mit dem Multi-Deck für ein Qualitätsprodukt aus dem Werkstoff BPC entschieden. Der Verbundwerkstoff BPC (Bamboo- Polymere-Composites) ist eine Kombination
Wissenswertes rund um Multi-Deck Sie haben sich mit dem Multi-Deck für ein Qualitätsprodukt aus dem Werkstoff BPC entschieden. Der Verbundwerkstoff BPC (Bamboo- Polymere-Composites) ist eine Kombination
Beispiellösungen zu Blatt 19
 µathematischer κorrespondenz- zirkel Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen Aufgabe 1 Beispiellösungen zu Blatt 19 a) In dem Buch der Wahrheit stehen merkwürdige Dinge: Auf der ersten
µathematischer κorrespondenz- zirkel Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen Aufgabe 1 Beispiellösungen zu Blatt 19 a) In dem Buch der Wahrheit stehen merkwürdige Dinge: Auf der ersten
Vortrag Wärmepumpen. Wärmepumpen
 Vortrag Wärmepumpen Wärmepumpen Wärmepumpen sind bei diesem Vortrag die vielleicht bekannteste und am häufigsten eingesetzte Variante der alternativen Heizsysteme. Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass eine
Vortrag Wärmepumpen Wärmepumpen Wärmepumpen sind bei diesem Vortrag die vielleicht bekannteste und am häufigsten eingesetzte Variante der alternativen Heizsysteme. Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass eine
Dipl.-Ing. Architekt Jules-Verne-Straße 18 14089 Berlin. kostenlos für Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anstalt des öffentlichen Rechts U-Bahn Anlagen
 Datum: 10.11.2006 Beispielhafte Thermografische Untersuchung von Wänden und Decken im Tunnel der U-Bahnlinie 7 bei km 110,6 +27 bis +50 Einfahrt Hpu (Gleis 2) Auftraggeber: JAS Architekturbüro Dipl.-Ing.
Datum: 10.11.2006 Beispielhafte Thermografische Untersuchung von Wänden und Decken im Tunnel der U-Bahnlinie 7 bei km 110,6 +27 bis +50 Einfahrt Hpu (Gleis 2) Auftraggeber: JAS Architekturbüro Dipl.-Ing.
Information zur Ausführung von Eigenleistungen bei der Erstellung von Netzanschlüssen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung
 Information zur Ausführung von Eigenleistungen bei der Erstellung von Netzanschlüssen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, auf Grundlage der Niederspannungsanschlussverordnung
Information zur Ausführung von Eigenleistungen bei der Erstellung von Netzanschlüssen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, auf Grundlage der Niederspannungsanschlussverordnung
im Auftrag der Firma Schöck Bauteile GmbH Dr.-Ing. M. Kuhnhenne
 Institut für Stahlbau und Lehrstuhl für Stahlbau und Leichtmetallbau Univ. Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann Mies-van-der-Rohe-Str. 1 D-52074 Aachen Tel.: +49-(0)241-8025177 Fax: +49-(0)241-8022140 Bestimmung
Institut für Stahlbau und Lehrstuhl für Stahlbau und Leichtmetallbau Univ. Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann Mies-van-der-Rohe-Str. 1 D-52074 Aachen Tel.: +49-(0)241-8025177 Fax: +49-(0)241-8022140 Bestimmung
Kartenlegen leicht erlernbar Fernkurs Tarot
 Inhaltsverzeichnis Vorwort Seite 7 Tarot leicht erlernbar Seite 10 Die Bedeutung der 22 großen Arkanen Lektion 1 Seite 18 Testaufgaben 1 Seite 67 Lektion 2 Seite 70 Testaufgaben 2 Seite 99 Lektion 3 Seite
Inhaltsverzeichnis Vorwort Seite 7 Tarot leicht erlernbar Seite 10 Die Bedeutung der 22 großen Arkanen Lektion 1 Seite 18 Testaufgaben 1 Seite 67 Lektion 2 Seite 70 Testaufgaben 2 Seite 99 Lektion 3 Seite
Herzogenmühlestrasse Zürich, 2011
 Michael Meier und Marius Hug Architekten Zürich Herzogenmühlestrasse Zürich, 2011 Wohnhaus mit Scheune eingeladener Wettbewerb 2008, 1. Preis, Realisierung 2010 Anlagekosten CHF 2.1 Mio Bauherrschaft Liegenschaftenverwaltung
Michael Meier und Marius Hug Architekten Zürich Herzogenmühlestrasse Zürich, 2011 Wohnhaus mit Scheune eingeladener Wettbewerb 2008, 1. Preis, Realisierung 2010 Anlagekosten CHF 2.1 Mio Bauherrschaft Liegenschaftenverwaltung
BBCC.NRW. Glasfaser-Roll-Out - Alternative Verlegemethoden. Breitbandkompetenzzentrum NRW BBCC.NRW. für wirtschaftliche Breitband-Projekte (?
 Glasfaser-Roll-Out - Alternative Verlegemethoden für wirtschaftliche Breitband-Projekte (?) Breitbandkompetenzzentrum NRW Prof. Dr.-Ing. Stephan Breide i.hs. FH-Südwestfalen 59872 Meschede Agenda Einführung:
Glasfaser-Roll-Out - Alternative Verlegemethoden für wirtschaftliche Breitband-Projekte (?) Breitbandkompetenzzentrum NRW Prof. Dr.-Ing. Stephan Breide i.hs. FH-Südwestfalen 59872 Meschede Agenda Einführung:
RepoRtage 56 9-10 2014
 Reportage 56 9-10 2014 Stylisches Pool-Design Einen blauen Fleck im Garten wollte der Bauherr nicht. Das Schwimmbecken sollte sich im Design ganz dem Wohnhaus und der Terrasse unterordnen. Heraus kam ein
Reportage 56 9-10 2014 Stylisches Pool-Design Einen blauen Fleck im Garten wollte der Bauherr nicht. Das Schwimmbecken sollte sich im Design ganz dem Wohnhaus und der Terrasse unterordnen. Heraus kam ein
Inhalt. 99 Das nördliche Pfersee. Das südliche Pfersee. Spurensuche. Pfersee von oben. Wertach Vital
 Beatrice Schubert Angelika Prem Stefan Koch Inhalt 11 Spurensuche 19 Pfersee von oben 27 Entlang der Augsburger Straße von der Luitpoldbrücke bis Herz Jesu 26 und weiter bis zu Stadtgrenze 50 67 Das südliche
Beatrice Schubert Angelika Prem Stefan Koch Inhalt 11 Spurensuche 19 Pfersee von oben 27 Entlang der Augsburger Straße von der Luitpoldbrücke bis Herz Jesu 26 und weiter bis zu Stadtgrenze 50 67 Das südliche
Schrank, Thermometer Haar-Föhn, Uhr / Stoppuhr 1 Glas oder Becher mit einem Eiswürfel Lösungsblätter
 Lehrerkommentar MST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Lehrplan: Aus den verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen grundlegende Begriffe kennen (Atmosphäre, Treibhaus-Effekt, Kohlendioxid,
Lehrerkommentar MST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Lehrplan: Aus den verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen grundlegende Begriffe kennen (Atmosphäre, Treibhaus-Effekt, Kohlendioxid,
Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik. Versuchsbericht für das elektronische Praktikum. Praktikum Nr. 2. Thema: Widerstände und Dioden
 Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik Versuchsbericht für das elektronische Praktikum Praktikum Nr. 2 Name: Pascal Hahulla Matrikelnr.: 207XXX Thema: Widerstände und Dioden Versuch durchgeführt
Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik Versuchsbericht für das elektronische Praktikum Praktikum Nr. 2 Name: Pascal Hahulla Matrikelnr.: 207XXX Thema: Widerstände und Dioden Versuch durchgeführt
In Aktion. Windenergie: Ein kleiner
 Windenergie: Ein kleiner Ort schreibt Geschichte! Schneebergerhof das klingt so klein, wie der Ort auch tatsächlich ist. Und doch schreibt der zu Gerbach im Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) gehörende
Windenergie: Ein kleiner Ort schreibt Geschichte! Schneebergerhof das klingt so klein, wie der Ort auch tatsächlich ist. Und doch schreibt der zu Gerbach im Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) gehörende
Statkraft in Deutschland
 Statkraft in Deutschland Bremen Dörverden Hannover Düsseldorf Kassel Wiesbaden Handel Biomasse/ Fernwärme Gaskraft Wasserkraft Herzlich willkommen in Dörverden Das Wasserkraftwerk Dörverden wurde in den
Statkraft in Deutschland Bremen Dörverden Hannover Düsseldorf Kassel Wiesbaden Handel Biomasse/ Fernwärme Gaskraft Wasserkraft Herzlich willkommen in Dörverden Das Wasserkraftwerk Dörverden wurde in den
Hürlimann-Areal Zürich (ZH) Ehemalige Brauerei Hürlimann
 Beispiele erfolgreicher Umnutzungen von Industriebrachen 2 Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Boden und Biotechnologie 3003 Bern Tel. 031 323 93 49 altlasten@bafu.admin.ch (ZH) Ehemalige Brauerei Hürlimann
Beispiele erfolgreicher Umnutzungen von Industriebrachen 2 Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Boden und Biotechnologie 3003 Bern Tel. 031 323 93 49 altlasten@bafu.admin.ch (ZH) Ehemalige Brauerei Hürlimann
Nord-Süd- Strecke. einst und jetzt. Sonder. Konrad Koschinski. www.eisenbahn-journal.de. Deutschland 12,50
 www.eisenbahn-journal.de Deutschland 12,50 Österreich 13,75 Schweiz sfr. 25,00 Belgien, Luxemburg 14,40 Niederlande 15,85 Italien, Spanien 16,25 Portugal (con.) 16,40 B 10533 F ISBN 978-3-89610-387-1 Best.-
www.eisenbahn-journal.de Deutschland 12,50 Österreich 13,75 Schweiz sfr. 25,00 Belgien, Luxemburg 14,40 Niederlande 15,85 Italien, Spanien 16,25 Portugal (con.) 16,40 B 10533 F ISBN 978-3-89610-387-1 Best.-
Typische Nutzungsmängel
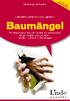 Durchfeuchtung an baulichen Schwachstellen, z.b. an Wärmebrücken infolge von Oberflächenwasser bei normaler Wohnungsnutzung (20 C und 50 Prozent innen bzw. 5 C außen) Typische Nutzungsmängel Boden zu niedrige
Durchfeuchtung an baulichen Schwachstellen, z.b. an Wärmebrücken infolge von Oberflächenwasser bei normaler Wohnungsnutzung (20 C und 50 Prozent innen bzw. 5 C außen) Typische Nutzungsmängel Boden zu niedrige
Wasser und Abwasser. 1.Kapitel: Die Bedeutung des Wassers
 Wasser und Abwasser 1.Kapitel: Die Bedeutung des Wassers Wer Durst hat, muss trinken. Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und ohne Zufuhr von Süßwasser stirbt ein Mensch nach wenigen Tagen. Nicht
Wasser und Abwasser 1.Kapitel: Die Bedeutung des Wassers Wer Durst hat, muss trinken. Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und ohne Zufuhr von Süßwasser stirbt ein Mensch nach wenigen Tagen. Nicht
Probleme mit Kanal- oder Abwasserleitungen. oft gelöst, indem man die defekten Altrohre durch neue Rohrleitungen ersetzt.
 Probleme mit Kanal- oder Abwasserleitungen im Haus werden allzu oft gelöst, indem man die defekten Altrohre durch neue Rohrleitungen ersetzt. Das heißt, Stemm- und Aufbrucharbeiten mit erheblicher Belästigung
Probleme mit Kanal- oder Abwasserleitungen im Haus werden allzu oft gelöst, indem man die defekten Altrohre durch neue Rohrleitungen ersetzt. Das heißt, Stemm- und Aufbrucharbeiten mit erheblicher Belästigung
Wertsteigerung Frei Haus. Der Kostenlose Glasfaseranschluss für Hauseigentümer.
 Wertteigerung Frei Hau. Der Kotenloe Glafaeranchlu für Haueigentümer. Darüber freuen ich nicht nur Ihre Mieter. 40 Millimeter, 1.000 Vorteile. Im Bereich der Kommunikation it Glafaer die Zukunft. 12.000
Wertteigerung Frei Hau. Der Kotenloe Glafaeranchlu für Haueigentümer. Darüber freuen ich nicht nur Ihre Mieter. 40 Millimeter, 1.000 Vorteile. Im Bereich der Kommunikation it Glafaer die Zukunft. 12.000
Schönenwerd 949.49. Wasserburg Schönenwerd (Koordinate 674 700/250 200)
 Schönenwerd Wasserburg Schönenwerd (Koordinate 674 700/250 200) 12. Jh. Die Wasserburg Schönenwerd wurde vermutlich zu Beginn des 12. Jh. auf einem,,werd, einer kleinen Insel, erbaut. Sie bestand aus einem
Schönenwerd Wasserburg Schönenwerd (Koordinate 674 700/250 200) 12. Jh. Die Wasserburg Schönenwerd wurde vermutlich zu Beginn des 12. Jh. auf einem,,werd, einer kleinen Insel, erbaut. Sie bestand aus einem
Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 2010 im Fach Mathematik. 26. Mai 2010
 Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 00 im Fach Mathematik 6. Mai 00 Arbeitsbeginn: 0.00 Uhr Bearbeitungszeit: 0 Minuten Zugelassene
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 00 im Fach Mathematik 6. Mai 00 Arbeitsbeginn: 0.00 Uhr Bearbeitungszeit: 0 Minuten Zugelassene
Fachbegriffe für die mechanischen Kleinbuchungsmaschinen
 Peter Haertel Fachbegriffe für die mechanischen Kleinbuchungsmaschinen Einführung: Unter Kleinbuchungsmaschinen sind nur solche Maschinen zu verstehen, die durch Weiterentwicklung serienmäßig gefertigter
Peter Haertel Fachbegriffe für die mechanischen Kleinbuchungsmaschinen Einführung: Unter Kleinbuchungsmaschinen sind nur solche Maschinen zu verstehen, die durch Weiterentwicklung serienmäßig gefertigter
Digitalfotos bearbeiten mit Photoshop Elements 7.0
 Das große Buch Digitalfotos bearbeiten mit Photoshop Elements 7.0 Pavel Kaplun Dr. Kyra Sänger DATA BECKER Unauffällige Methoden der Rauschunterdrückung 6.3 Unauffällige Methoden der Rauschunterdrückung
Das große Buch Digitalfotos bearbeiten mit Photoshop Elements 7.0 Pavel Kaplun Dr. Kyra Sänger DATA BECKER Unauffällige Methoden der Rauschunterdrückung 6.3 Unauffällige Methoden der Rauschunterdrückung
POMMERN - IMMOBILIEN REINCKE
 Am Dorfrand! Großes Grundstück, großes Haus mit weitem Blick auf Wiesen und Felder! Exposé Nr. PZ 0111 Pelsin Haustyp: ursprünglich Doppelhaus Baujahr:1940 Wohnfläche: 160 m² Wohnfläche: ca 160 m² Nutzfläche
Am Dorfrand! Großes Grundstück, großes Haus mit weitem Blick auf Wiesen und Felder! Exposé Nr. PZ 0111 Pelsin Haustyp: ursprünglich Doppelhaus Baujahr:1940 Wohnfläche: 160 m² Wohnfläche: ca 160 m² Nutzfläche
11.3.4 Auslegung der Wärmequelle Erdreich
 11.3.4 Auslegung der Wärmequelle Erdreich Normative Grundlagen Die Auslegung der Geothermieanlage für die Wärmequelle Erdreich wird in VDI 4640 ausführlich beschrieben. Dabei werden zwei Fälle unterschieden.
11.3.4 Auslegung der Wärmequelle Erdreich Normative Grundlagen Die Auslegung der Geothermieanlage für die Wärmequelle Erdreich wird in VDI 4640 ausführlich beschrieben. Dabei werden zwei Fälle unterschieden.
Maji Africa - Wasser in Afrika
 Maji Africa - Wasser in Afrika Die Spenden des Comenius Projektes It s all in a drop haben den Bau der Quellfassung Mshikajembe im Dorf Ibwanzi im südlichen Hochland von Tansania ermöglicht. Von 2009 bis
Maji Africa - Wasser in Afrika Die Spenden des Comenius Projektes It s all in a drop haben den Bau der Quellfassung Mshikajembe im Dorf Ibwanzi im südlichen Hochland von Tansania ermöglicht. Von 2009 bis
Physik im Kontext Sekundarstufe 1 - Mechanik Berlin. Tragen von Lasten. Circa 45 min. Leitende Fragestellung, Problem
 Tragen von Lasten Bezug zu Bildungsstandards / Rahmenplan Kräfte nach Betrag, Angriffspunkt und Richtung unterscheiden können. Kräfte, u.a. Gewichtskraft; Darstellung von Kräften durch Vektoren 1 Dauer
Tragen von Lasten Bezug zu Bildungsstandards / Rahmenplan Kräfte nach Betrag, Angriffspunkt und Richtung unterscheiden können. Kräfte, u.a. Gewichtskraft; Darstellung von Kräften durch Vektoren 1 Dauer
Versuchsprotokoll - Michelson Interferometer
 Versuchsprotokoll im Fach Physik LK Radkovsky August 2008 Versuchsprotokoll - Michelson Interferometer Sebastian Schutzbach Jörg Gruber Felix Cromm - 1/6 - Einleitung: Nachdem wir das Interferenzphänomen
Versuchsprotokoll im Fach Physik LK Radkovsky August 2008 Versuchsprotokoll - Michelson Interferometer Sebastian Schutzbach Jörg Gruber Felix Cromm - 1/6 - Einleitung: Nachdem wir das Interferenzphänomen
S Ü D W E S T R U N D F U N K F S - I N L A N D R E P O R T MAINZ S E N D U N G: 20.09.2011
 Diese Kopie wird nur zur rein persönlichen Information überlassen. Jede Form der Vervielfältigung oder Verwertung bedarf der ausdrücklichen vorherigen Genehmigung des Urhebers by the author S Ü D W E S
Diese Kopie wird nur zur rein persönlichen Information überlassen. Jede Form der Vervielfältigung oder Verwertung bedarf der ausdrücklichen vorherigen Genehmigung des Urhebers by the author S Ü D W E S
Taupunkt Lüftungssteuerung
 Taupunkt Lüftungssteuerung Feuchte Keller? Schimmel? Die Taupunkttemperatur ist das Maß der absoluten Feuchtigkeit in der Luft. Je niedriger diese Temperatur ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen.
Taupunkt Lüftungssteuerung Feuchte Keller? Schimmel? Die Taupunkttemperatur ist das Maß der absoluten Feuchtigkeit in der Luft. Je niedriger diese Temperatur ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen.
Gutachten. Anton Spiegel. Dornbirn, xxx. Bodenlegermeister
 xxx xxx xx Dornbirn, xxx Gutachten Auftraggeber: Firma xxx GesmbH, xx Projekt: Wohnanlage xxx xxx Bauträger GmbH, xxx Auftrag: Besichtigung und Beurteilung der Laminatböden Besichtigung und Begutachtung:
xxx xxx xx Dornbirn, xxx Gutachten Auftraggeber: Firma xxx GesmbH, xx Projekt: Wohnanlage xxx xxx Bauträger GmbH, xxx Auftrag: Besichtigung und Beurteilung der Laminatböden Besichtigung und Begutachtung:
Physik * Jahrgangsstufe 8 * Druck in Gasen
 Physik * Jahrgangsstufe 8 * Druck in Gasen Ein Fahrradschlauch oder ein aufblasbares Sitzkissen können als Hebekissen dienen. Lege dazu auf den unaufgepumpten Schlauch ein Brett und stelle ein schweres
Physik * Jahrgangsstufe 8 * Druck in Gasen Ein Fahrradschlauch oder ein aufblasbares Sitzkissen können als Hebekissen dienen. Lege dazu auf den unaufgepumpten Schlauch ein Brett und stelle ein schweres
Kaltscherklapp. Liebe Leser, Beilage zu Neues aus Langen Brütz Nr. 6 Januar 2013
 Kaltscherklapp Beilage zu Neues aus Langen Brütz Nr. 6 Januar 2013 Liebe Leser, als 24 Seiten Neues aus Langen Brütz gefüllt waren und ich eine Woche lang darüber glücklich war, regte mich ein Besucher
Kaltscherklapp Beilage zu Neues aus Langen Brütz Nr. 6 Januar 2013 Liebe Leser, als 24 Seiten Neues aus Langen Brütz gefüllt waren und ich eine Woche lang darüber glücklich war, regte mich ein Besucher
Wie stark ist die Nuss?
 Wie stark ist die Nuss? Bild einer Klett-Werbung Untersuchungen von Eric Hornung, Sebastian Lehmann und Raheel Shahid Geschwister-Scholl-Schule Bensheim Wettbewerb: Schüler experimentieren Fachrichtung
Wie stark ist die Nuss? Bild einer Klett-Werbung Untersuchungen von Eric Hornung, Sebastian Lehmann und Raheel Shahid Geschwister-Scholl-Schule Bensheim Wettbewerb: Schüler experimentieren Fachrichtung
Kann man Wärme pumpen? Die Wärmepumpe
 Kann man Wärme pumpen? Die Wärmepumpe Inhalt 1. Was ist eine Wärmepumpe? Wie funktioniert sie? 2. Experimente 2.1 Welchen Wirkungsgrad hat die Wärmepumpe? (Experiment 1) 2.2 Wie groß ist die spezifische
Kann man Wärme pumpen? Die Wärmepumpe Inhalt 1. Was ist eine Wärmepumpe? Wie funktioniert sie? 2. Experimente 2.1 Welchen Wirkungsgrad hat die Wärmepumpe? (Experiment 1) 2.2 Wie groß ist die spezifische
BESONDERE LEISTUNGSFESTSTELLUNG 2011 PHYSIK KLASSE 10
 Staatliches Schulamt Bad Langensalza BESONDERE LEISTUNGSFESTSTELLUNG 2011 PHYSIK KLASSE 10 Arbeitszeit: 120 Minuten Hilfsmittel: Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung Taschenrechner Tafelwerk Der Teilnehmer
Staatliches Schulamt Bad Langensalza BESONDERE LEISTUNGSFESTSTELLUNG 2011 PHYSIK KLASSE 10 Arbeitszeit: 120 Minuten Hilfsmittel: Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung Taschenrechner Tafelwerk Der Teilnehmer
1. Berechnung von Antrieben
 Berechnung von Antrieben 1-1 1. Berechnung von Antrieben Allgemeines Mit den Gleichstrommotoren wird elektrische Energie in eine mechanische Drehbewegung umgewandelt. Dabei wird dem Netz die Leistung =
Berechnung von Antrieben 1-1 1. Berechnung von Antrieben Allgemeines Mit den Gleichstrommotoren wird elektrische Energie in eine mechanische Drehbewegung umgewandelt. Dabei wird dem Netz die Leistung =
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt für die Klassen 5 bis 6: Magnetismus
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt für die Klassen 5 bis 6: Magnetismus Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt für die Klassen 5 bis 6: Magnetismus Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT
DE Ferro Natürliche Wasseraufbereitung
 DE Ferro Natürliche Wasseraufbereitung Befreit Ihr Grundwasser von Eisen, Mangan und Ammonium Mit Erfolgsgarantie! Die DE Ferro-Familie Für Haus und Garten! Kennen Sie das Dilemma? Da hat man einen eigenen
DE Ferro Natürliche Wasseraufbereitung Befreit Ihr Grundwasser von Eisen, Mangan und Ammonium Mit Erfolgsgarantie! Die DE Ferro-Familie Für Haus und Garten! Kennen Sie das Dilemma? Da hat man einen eigenen
Inhalt. 1. Kapitel: Körper und Sinne. 3. Kapitel: Wasser, Luft und Wetter. 2. Kapitel: Die Zeit
 Inhalt 1. Kapitel: Körper und Sinne Sinneswahrnehmungen Lehrerteil.............................. 6 Bewegte Bilder.................... 1/2.... 12 Mach dich unsichtbar............... 1/2.... 14 Augen auf!.......................
Inhalt 1. Kapitel: Körper und Sinne Sinneswahrnehmungen Lehrerteil.............................. 6 Bewegte Bilder.................... 1/2.... 12 Mach dich unsichtbar............... 1/2.... 14 Augen auf!.......................
BENUTZERHANDBUCH. Gelenkarmmarkise. Sunset, Suncare, Sunshine, Sunpower
 BENUTZERHANDBUCH Gelenkarmmarkise Sunset, Suncare, Sunshine, Sunpower Wichtige Sicherheitsvorkehrungen WARNHINWEIS: ES IST WICHTIG FÜR IHRE PERSÖNLICHE SICHERHEIT, DIESEN ANWEISUNGEN FOLGE ZU LEISTEN.
BENUTZERHANDBUCH Gelenkarmmarkise Sunset, Suncare, Sunshine, Sunpower Wichtige Sicherheitsvorkehrungen WARNHINWEIS: ES IST WICHTIG FÜR IHRE PERSÖNLICHE SICHERHEIT, DIESEN ANWEISUNGEN FOLGE ZU LEISTEN.
Von-sich-weg-Schnitzen
 die Punkte C und G hin zu schnitzen und an diesen Stellen anzuhalten, ist erheblich schwieriger. Wenn man das nicht beachtet, spaltet man leicht große Stücke ab, die eigentlich stehen bleiben sollten.
die Punkte C und G hin zu schnitzen und an diesen Stellen anzuhalten, ist erheblich schwieriger. Wenn man das nicht beachtet, spaltet man leicht große Stücke ab, die eigentlich stehen bleiben sollten.
PREISLISTE / ASPHALT- & BETONSCHNEIDETECHNIK / DIAMANTKERNBOHRUNGEN / WANDSÄGEN / SEILSÄGEN / ERDVERDRÄNGUNGSRAKETEN
 PREISLISTE / ASPHALT- & BETONSCHNEIDETECHNIK / DIAMANTKERNBOHRUNGEN / WANDSÄGEN / SEILSÄGEN / ERDVERDRÄNGUNGSRAKETEN AGB s / LEISTUNGS- UND HAFTUNGSBEDINGUNGEN Leistungs- und Haftungsbedingungen des Auftraggebers
PREISLISTE / ASPHALT- & BETONSCHNEIDETECHNIK / DIAMANTKERNBOHRUNGEN / WANDSÄGEN / SEILSÄGEN / ERDVERDRÄNGUNGSRAKETEN AGB s / LEISTUNGS- UND HAFTUNGSBEDINGUNGEN Leistungs- und Haftungsbedingungen des Auftraggebers
Handbuch Individual-Programm
 3 3.2.1 Inhalt Kapitel Thema Stand 3.2.1 Stehende Türsysteme Alu-Gleittüren Inhalt 10/2010 3.2.2 Stehende Türsysteme Alu-Gleittüren Merkmale 10/2010 3.2. Alu-Gleittüren Nutzungsmöglichkeiten 10/2010 3.2.4.1
3 3.2.1 Inhalt Kapitel Thema Stand 3.2.1 Stehende Türsysteme Alu-Gleittüren Inhalt 10/2010 3.2.2 Stehende Türsysteme Alu-Gleittüren Merkmale 10/2010 3.2. Alu-Gleittüren Nutzungsmöglichkeiten 10/2010 3.2.4.1
Unsere Gruppe beim Aufbauen der Schokoladentafeln und der Schokoriegel
 Unser Marktstand Unsere Gruppe hat am Mittwoch, 27.9, in der 2. Aktionswoche der fairen Wochen, den Stand auf den Marktplatz zum Zentrum für Umwelt und Mobilität aufgebaut und dekoriert. Wir dekorierten
Unser Marktstand Unsere Gruppe hat am Mittwoch, 27.9, in der 2. Aktionswoche der fairen Wochen, den Stand auf den Marktplatz zum Zentrum für Umwelt und Mobilität aufgebaut und dekoriert. Wir dekorierten
Der Schlossgeist. Vereinsblatt. Förderverein Schlossruine Hartenstein e.v. FVSH e.v.
 Der Schlossgeist Vereinsblatt Förderverein Schlossruine Hartenstein e.v. FVSH e.v. Herzlich willkommen! Nach langer Pause gibt es jetzt wieder eine Ausgabe unseres Vereinsblattes. In den letzten Jahre
Der Schlossgeist Vereinsblatt Förderverein Schlossruine Hartenstein e.v. FVSH e.v. Herzlich willkommen! Nach langer Pause gibt es jetzt wieder eine Ausgabe unseres Vereinsblattes. In den letzten Jahre
Motorkunde 5. 1. Motorkennlinien, praktische Arbeiten am Dieselmotor (Entlüften, Einstellarbeiten)
 Motorkunde 5 1. Motorkennlinien, praktische Arbeiten am Dieselmotor (Entlüften, Einstellarbeiten) 2. Ventilspiel Kontrollieren und Einstellen Vollastkennlinie: Die Charakteristik eines Motors kann auf
Motorkunde 5 1. Motorkennlinien, praktische Arbeiten am Dieselmotor (Entlüften, Einstellarbeiten) 2. Ventilspiel Kontrollieren und Einstellen Vollastkennlinie: Die Charakteristik eines Motors kann auf
1957 Mercedes 300 SL Roadster
 1957 Mercedes 300 SL Roadster MODELLVORSTELLUNG Rolf Stratemeyer September 2008 Bewertung Minichamps, 1:18, 1957 Mercedes 300 SL Roadster silbern Im Autoquartett der frühen sechziger Jahre war er nicht
1957 Mercedes 300 SL Roadster MODELLVORSTELLUNG Rolf Stratemeyer September 2008 Bewertung Minichamps, 1:18, 1957 Mercedes 300 SL Roadster silbern Im Autoquartett der frühen sechziger Jahre war er nicht
Die Bibliothek sei genau der Ort den ich ohnehin habe aufsuchen wollen Schon seit längerem Schon seit Kindsbeinen Die Bemerkung hätte ich mir sparen
 Und einmal war ich in einem berühmten medizinischen Institut Wie ich dahin kam weiss ich nicht mehr Das heisst doch Ich weiss schon wie Ich weiss nur nicht mehr Warum Ich war aufgestanden und hatte ein
Und einmal war ich in einem berühmten medizinischen Institut Wie ich dahin kam weiss ich nicht mehr Das heisst doch Ich weiss schon wie Ich weiss nur nicht mehr Warum Ich war aufgestanden und hatte ein
Inhalt. 1 Grundsätze
 Werknorm Oktober 2013 Versorgungsnetze HAUSANSCHLUSSEINRICHTUNGEN IN GEBÄUDEN 1 Grundsätze Inhalt 2 Regelabstände 3 Ausführungsvarianten 4 Gebäudeeinführungen 5 Besondere Verweisung Mehrspartenhauseinführung
Werknorm Oktober 2013 Versorgungsnetze HAUSANSCHLUSSEINRICHTUNGEN IN GEBÄUDEN 1 Grundsätze Inhalt 2 Regelabstände 3 Ausführungsvarianten 4 Gebäudeeinführungen 5 Besondere Verweisung Mehrspartenhauseinführung
Also kann nur A ist roter Südler und B ist grüner Nordler gelten.
 Aufgabe 1.1: (4 Punkte) Der Planet Og wird von zwei verschiedenen Rassen bewohnt - dem grünen und dem roten Volk. Desweiteren sind die Leute, die auf der nördlichen Halbkugel geboren wurden von denen auf
Aufgabe 1.1: (4 Punkte) Der Planet Og wird von zwei verschiedenen Rassen bewohnt - dem grünen und dem roten Volk. Desweiteren sind die Leute, die auf der nördlichen Halbkugel geboren wurden von denen auf
linthal 2015 aktuell
 linthal 2015 aktuell Newsletter der Kraftwerke Linth-Limmern AG Oktober 2012 Eindrücklicher Stahlwasserbau 1051 Meter lang werden die beiden Druckschächte, welche den Muttsee mit dem Limmernsee verbinden.
linthal 2015 aktuell Newsletter der Kraftwerke Linth-Limmern AG Oktober 2012 Eindrücklicher Stahlwasserbau 1051 Meter lang werden die beiden Druckschächte, welche den Muttsee mit dem Limmernsee verbinden.
5.4 Lagenwechsel minimieren oder das Bohren von Löchern in Leiterplatten
 5.4 Lagenwechsel minimieren oder das Bohren von Löchern in Leiterplatten Autoren: Martin Grötschel, Thorsten Koch und Nam Dũng Hoàng 5.4.1 Aufgabe Diese Aufgabe behandelt ein Problem, das beim Entwurf
5.4 Lagenwechsel minimieren oder das Bohren von Löchern in Leiterplatten Autoren: Martin Grötschel, Thorsten Koch und Nam Dũng Hoàng 5.4.1 Aufgabe Diese Aufgabe behandelt ein Problem, das beim Entwurf
Untersuchungen zum Feuchteverhalten einer. Lehmwand mit Vollwärmeschutz
 Untersuchungen zum Feuchteverhalten einer Lehmwand mit Vollwärmeschutz Einleitung Durch die Bauherrenschaft wurde gefordert, dass ihr Einfamilienhaus als modernes Fachwerkhaus nach den Kriterien des nachhaltigen
Untersuchungen zum Feuchteverhalten einer Lehmwand mit Vollwärmeschutz Einleitung Durch die Bauherrenschaft wurde gefordert, dass ihr Einfamilienhaus als modernes Fachwerkhaus nach den Kriterien des nachhaltigen
Winterbetrieb von Windkraftanlagen
 Winterbetrieb von Windkraftanlagen von Manfred Lührs, Süderdeich Die "Neue Energie" vom Februar 1996, ebenso die "Windpower Monthly" und die "Wind/Energie /Aktuell" im Januar beeindrucken auf ihren Titelbildern
Winterbetrieb von Windkraftanlagen von Manfred Lührs, Süderdeich Die "Neue Energie" vom Februar 1996, ebenso die "Windpower Monthly" und die "Wind/Energie /Aktuell" im Januar beeindrucken auf ihren Titelbildern
Presseinformation. Was kostet Autofahren im Vergleich zu 1980 wirklich?
 Presseinformation Was kostet Autofahren im Vergleich zu 1980 wirklich? Die strategische Unternehmensberatung PROGENIUM berechnet die Vollkosten eines Automobils über die vergangenen drei Jahrzehnte und
Presseinformation Was kostet Autofahren im Vergleich zu 1980 wirklich? Die strategische Unternehmensberatung PROGENIUM berechnet die Vollkosten eines Automobils über die vergangenen drei Jahrzehnte und
GARAGEN TORE THERMALSAFE DOOR
 GARAGEN THERMALSAFE DOOR garagen LUFTDICHTIGKEIT KLASSE 4 U-WERT Durchschnittlich 22% höhere Dämmwirkung Die thermische Effizienz und die Verringerung der Luftdurchlässigkeit sind ausschlaggebende Aspekte
GARAGEN THERMALSAFE DOOR garagen LUFTDICHTIGKEIT KLASSE 4 U-WERT Durchschnittlich 22% höhere Dämmwirkung Die thermische Effizienz und die Verringerung der Luftdurchlässigkeit sind ausschlaggebende Aspekte
BEWERBUNG. Klaus Peter K n e v e l s Diplom-Ingenieur Architekt UM DIE TEILNAHME AN DER VERGABE DES RHEINISCHEN DENKMALPREISES 2004
 BEWERBUNG UM DIE TEILNAHME AN DER VERGABE DES RHEINISCHEN DENKMALPREISES 2004 ALTE SCHULE HERSEL RHEINSTRASSE 190 53332 BORNHEIM OBJEKT Geschichte des Schulgebäudes Bei dem Gebäude handelt es sich um ein
BEWERBUNG UM DIE TEILNAHME AN DER VERGABE DES RHEINISCHEN DENKMALPREISES 2004 ALTE SCHULE HERSEL RHEINSTRASSE 190 53332 BORNHEIM OBJEKT Geschichte des Schulgebäudes Bei dem Gebäude handelt es sich um ein
Benjamin Brückner Johannisallee7 04317 Leipzig Fon: 0176/20513065. Wettmaitresse
 Wettmaitresse Es muss einen Gott geben. Denn nur so kann ich mir erklären, warum die neue Kneipe namens S-Bar eröffnete. Sie bot nicht nur frisches Bier und leckere Kartoffelgitter, sondern veranstaltete
Wettmaitresse Es muss einen Gott geben. Denn nur so kann ich mir erklären, warum die neue Kneipe namens S-Bar eröffnete. Sie bot nicht nur frisches Bier und leckere Kartoffelgitter, sondern veranstaltete
Keine Ausweitung von Massen-Gentests - Recht der Bürger auf Datenschutz garantieren Antrag der Fraktion FDP gehalten im 114. Plenum am 10.
 Keine Ausweitung von Massen-Gentests - Recht der Bürger auf Datenschutz garantieren Antrag der Fraktion FDP gehalten im 114. Plenum am 10. Juli 2007 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen
Keine Ausweitung von Massen-Gentests - Recht der Bürger auf Datenschutz garantieren Antrag der Fraktion FDP gehalten im 114. Plenum am 10. Juli 2007 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen
Erdwärmenutzung. für Ein- und Mehrfamilienhäuser
 Erdwärmenutzung für Ein- und Mehrfamilienhäuser Eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Brennstoffsystemen Die zu erwartenden dauerhaften Ölpreissteigerungen und das Bemühen
Erdwärmenutzung für Ein- und Mehrfamilienhäuser Eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Brennstoffsystemen Die zu erwartenden dauerhaften Ölpreissteigerungen und das Bemühen
Kodo Sawaki in Zazen ANLEITUNG ZUR ZEN-MEDITATION
 ANLEITUNG ZUR ZEN-MEDITATION Durch die Zen-Meditation (Zazen) können wir Körper und Geist beruhigen, so dass sie in dieser Ruhe wieder zu ihrer ursprünglichen Einheit zusammenfinden. So entdecken wir das
ANLEITUNG ZUR ZEN-MEDITATION Durch die Zen-Meditation (Zazen) können wir Körper und Geist beruhigen, so dass sie in dieser Ruhe wieder zu ihrer ursprünglichen Einheit zusammenfinden. So entdecken wir das
