Doreen Schwarz. Strategische Personalplanung und Humankapitalbewertung
|
|
|
- Käthe Amsel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Doreen Schwarz Strategische Personalplanung und Humankapitalbewertung
2 GABLER RESEARCH
3 Doreen Schwarz Strategische Personalplanung und Humankapitalbewertung Simulationen anhand der Cottbuser Formel Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Christiane Hipp RESEARCH
4 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über < abrufbar. Dissertation Brandenburgische Technische Universität Cottbus, 009. Auflage 00 Alle Rechte vorbehalten Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 00 Lektorat: Ute Wrasmann Anita Wilke Gabler Verlag ist eine Marke von Springer Fachmedien. Springer Fachmedien ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Printed in Germany ISBN
5 Für Nele Aurelia
6 Geleitwort Ausgangspunkt der vorliegenden Dissertation von Doreen Schwarz ist der demografische Wandel. Bereits seit einigen Jahren werden die Konsequenzen immer wieder diskutiert und notwendige Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen für Politik und Wirtschaft angemahnt. Gerade der Rückgang sowie die Alterung des Erwerbspersonenpotenzials lassen bei vielen Firmen die Alarmglocken klingeln. Doch ob und in welcher Form sich Nachwuchsprobleme und Überalterung tatsächlich für die eigene Firma als problematisch erweisen werden, ist aufgrund mangelnder Analysemethoden nicht immer klar erkennbar. Während in der aktuellen Literatur hauptsächlich Beispiele zur Personalentwicklung (z.b. life long learning) sowie zum Wissenstransfer, zur Personalbindung und zum Gesundheitsmanagement vorgeschlagen werden, fehlen konkrete Analysemethoden für eine dem Wandel angepasste und vor allem vorausschauende Personalplanung. Um Unternehmen eine verbesserte, langfristige Personalplanung zu ermöglichen, hat Frau Schwarz im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit bei mir am Lehrstuhl einen neuen Ansatz entwickelt. Sie hat es geschafft, neben einer dynamischen Personal- und Altersstrukturprognose das Erfahrungswissen und die Qualifikation mit in die Analyse aufzunehmen und zu operationalisieren. Ganz besonders interessant ist dabei die Berücksichtigung des Erfahrungswissens. Gerade bei unternehmensspezifischem Erfahrungswissen ist die Frage des Transfers und damit die rechtzeitige Rekrutierung neuer Mitarbeiter von großer Bedeutung, da nur im Zeitverlauf dieses Wissen aufgebaut werden kann. Hier sind zudem unterstützende Maßnahmen wie Mentoring oder eine umfassende Einarbeitungsphase notwendig. Die Arbeit von Frau Schwarz ist als sehr innovativ und zukunftsweisend einzuschätzen. Besonders gelungen ist die breite und fundierte theoretische Herleitung und Zusammenführung verschiedener Ansätze zu einem Simulationsmodell. Die Einbettung der von Frau Schwarz entwickelten Cottbuser Formel zeigt anhand des Planungshorizontes deutlich die Zukunftsorientierung des Ansatzes. Somit können nicht nur ex post die Veränderungen bewertet, sondern die Effekte zukünftiger Veränderungen ( Was-passiert-wenn -Betrachtungen) antizipiert werden. Das ist von großem Wert für Entscheidungsträger und unterstützt die Qualität der unternehmerischen Entscheidungsfindung. Die Bewertung und Überprüfung des Modells wird anhand eines Beispielunternehmens vorgenommen. Hierbei wird deutlich, was Unternehmen konkret aus der Analyse für die eigene Personalplanung lernen können. VII
7 Die vorliegende Arbeit wurde von der Fakultät Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus als Dissertation angenommen. Die Arbeit gibt wichtige Impulse für die Diskussion zum angepassten Umgang mit dem demografischen Wandel auf Unternehmensebene und unterstreicht in besonderem Maße die interdisziplinäre, theoretisch fundierte und zugleich innovative Ausrichtung der Forschungsaktivitäten an meinem Lehrstuhl. In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern viel Spaß sowie eine positive Aufnahme in Wissenschaft und Wirtschaft. Prof. Dr. Christiane Hipp VIII
8 Vorwort Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen meiner Tätigkeit an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (BTU) am Lehrstuhl ABWL und Besondere der Organisation, des Personalmanagement sowie der Unternehmensführung. Das Thema der Dissertation ergab sich aus einem an mich herangetragenen Projekt, für die Verwaltung der BTU eine Personalbestandsplanung unter Berücksichtigung der alternden Belegschaft durchzuführen. Parallel zum Auftakt dieses Projektes bot sich mir die Möglichkeit, an der Universität in Bergen/ Norwegen an System-Dynamics-Kursen teilzunehmen. Schließlich führte mein steigendes Interesse an beiden Themen dazu, sie zu kombinieren und zu einem Promotionsthema auszubauen. Mit dem Voranschreiten der Arbeit wurde das Thema der demografischen Entwicklung, und insbesondere das der alternden Belegschaft, immer populärer. Hauptsächlich waren in der Literatur jedoch nur Bestandsaufnahmen dieser Problematik sowie allgemeingültige Ratschläge zu finden, nicht jedoch konkrete Vorschläge zur wirklich strategischen quantitativen und qualitativen Personalplanung. Ebenso wenig wurden auf praxisnahen Konferenzen greifbare Lösungen für die Personalverantwortlichen angeboten. Das Ziel meiner Arbeit war es deshalb, ein Personalplanungstool zu erarbeiten, mit dem Personalplaner den Personalbestand der Zukunft simulieren können, welcher durch die firmenspezifischen Personalmaßnahmen zu erwarten ist. Mit diesem Tool soll es für mittelständische und große Unternehmen möglich sein, vorausschauend zu agieren und einen strategischen Wettbewerbsvorteil im Kampf um qualifiziertes Personal und Nachwuchskräfte zu generieren. Die unternehmerische Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer bestimmten Personalausstattung führte mich darüber hinaus zum Humankapitalmanagement. Der Fokus lag dabei auf der bisher in der Literatur noch nicht betrachteten expliziten Bewertung des Fach- und vor allem des Erfahrungswissens der Mitarbeiter. Gerade Letzteres ist enorm wichtig, fand jedoch bei Verjüngungskuren von Unternehmen bzw. bei Ausgliederungsmodellen von älteren Beschäftigten keine nennenswerte Berücksichtigung. Anhand des Humankapitalwertes nach der eigens erstellten Cottbuser Formel können nunmehr solche und andere personalpolitische Maßnahmen von internen als auch externen Stakeholdern bewertet werden. Auch wenn eine Dissertationsschrift in eigener Regie durchgeführt wird, haben doch sehr viele Personen einen wesentlichen Anteil am Erfolg dieser Arbeit. Dazu gehört in erster Linie meine Doktormutter Frau Prof. Dr. Christiane Hipp. Sie gestand mir große Freiräume hinsichtlich meiner thematischen Ausrichtung zu, stand trotz ihrer vielfäl- IX
9 tigen Verpflichtungen und ihres engen Zeitplans jederzeit geduldig für Diskussionen zur Verfügung und hielt mir in der heißen Phase den Rücken für konzentriertes Arbeiten und Schreiben frei. Für das vertrauensvolle und harmonische Arbeitsklima gilt ihr mein herzlichster Dank. Ebenso möchte ich Frau Prof. Dr.-Ing. Irene Krebs danken, die den Vorsitz meiner Promotionskommission übernahm und für eine zügige Anberaumung der mündlichen Aussprache sorgte. Darüber hinaus danke ich den direkten Arbeitskollegen und -kolleginnen, vor allem dem gesamten Team des Lehrstuhls ABWL und Besondere der Organisation, des Personalmanagement sowie der Unternehmensführung. Ich werde mich sehr gerne an die vielen unterhaltsamen Gegebenheiten erinnern, die uns über den Arbeitsalltag hinaus verbinden. Mit einigen Arbeitskollegen und -kolleginnen entwickelte sich eine sehr enge Freundschaft. Ich bin dankbar dafür, dass ich gemeinsam mit Claudia Lubk, Axel Lubk, Matthias J. Kaiser und Prof. Dr. Birgit Verworn den größten Abschnitt meines Promotionsweges gehen konnte. Sie alle waren nicht nur in den betrüblichen Momenten eine große und zuverlässige Hilfe; sie standen jederzeit bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite, waren Motivatoren, Diskussionspartner, Vertraute und Begleiter sehr unterhaltsamer freizeitlicher Ablenkungsmanöver. Danken möchte ich auch meinen Ansprechpartnern des an dieser Arbeit beteiligten Projektunternehmens. Ohne das Interesse des damaligen Geschäftsbereichsleiters für Personal und Organisation wäre es mir nicht möglich gewesen, mit konkreten Zahlen die Praxistauglichkeit des Ansatzes zu belegen. Der umfangreiche Datenschatz wurde von den Verantwortlichen für Personalcontrolling sowie Personalentwicklung zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit für meine Zwecke zusammengestellt und aufbereitet und mir großzügig zur Verfügung gestellt. Dafür und für die stete Gesprächsbereitschaft gilt allen drei Personen mein außerordentlicher Dank. Zu guter Letzt hat mein privates Umfeld einen maßgeblichen Anteil an der Vollendung dieses Werkes. Das endlose Verständnis von Freunden und der Familie für die wenige Zeit, die seltenen Telefonate und die noch selteneren Treffen ist ihnen hoch anzurechnen. Das Wissen um ihren Rückhalt half, sich trotz arbeitsintensiver Wochenenden nicht einsam zu fühlen. Ich danke meiner Familie, die jederzeit hinter mir stand und mich aus voller Kraft in jeglicher Hinsicht unterstützte. Insbesondere meiner Mutter möchte ich herzlichst danken, die mich aus fachlicher Perspektive in meiner Idee bestärkte, sehr gute Tipps gab, mich bei jedem Motivationstief mit ermutigenden Worten unterstützte und sich als Lektorin akribisch durch mein Manuskript las. Meinen Eltern, Dr.-Ing. Ines Schwarz und Wolfgang Schwarz, verdanke ich meine Erziehung, meine Ausbildung und zu einem maßgeblichen Teil meinen bisherigen Lebensweg. Ich bin ihnen für all das unendlich dankbar. X
10 Schließlich möchte ich meinem Freund und Partner, Dr. Lars Weber, seinerzeit ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter, von Herzen danken. Er hat jedes Hoch und jedes Tief hautnah miterlebt und war in einer Person Leidensgenosse, Motivator, fachlicher Kritiker und meine liebste Ablenkung in der wenigen Freizeit. Es war ein sehr großes Glück, diese Zeit mit ihm gemeinsam zu erleben und durchzustehen. Allein wäre das Projekt Promotion wohl kaum zu diesem erfolgreichen Abschluss gekommen. Ich danke ihm für seine Liebe, sein Verständnis und seine enorme Unterstützung. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam geschafft und erlebt haben. Unsere Tochter ist das wunderbare Ergebnis dieses Zusammenhaltes und das i-tüpfelchen unseres Jahres 009. Sie ist Symbol für den Abschluss der überaus erfolgreichen Zeit in Cottbus und gleichzeitig Symbol für den Beginn einer neuen Ära. Ihr sei dieses Buch gewidmet. Doreen Schwarz XI
11 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...XVII Einleitung.... Aktualität des Themas.... Problemstellung und Forschungsschwerpunkte Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen... 5 Personalmanagement als Unternehmensfunktion Historischer Abriss Personalarbeit in der Praxis Personalarbeit in der Forschung Theoretische Grundlagen des Personalmanagements Strukturierung des Personalmanagements Ebenen und Dynamik innerhalb des Personalmanagements Strategische Personalplanung als Teil des strategischen HRMs Strategische Personalbedarfsplanung Strategische Personalbestandsplanung Strategische Personalveränderungsplanung Umgang mit Entwicklungstreibern des Personalmanagements Allgemeine Entwicklungstreiber Wirtschaftliche Treiber Politische Treiber Gesellschaftliche Treiber Wissenschaftliche Treiber Demografischer Trend mit Blick auf das Erwerbspersonenpotenzial Demografiebedingte Handlungsfelder strategischer Personalplanung Kapitelfazit Humanressourcen und -kapital als Forschungsfeld Der ressourcenbasierte Ansatz Der Resource-Based View in Bezug auf Humanressourcen Ressourceneigenschaften in Bezug auf Humanressourcen Bewertung des Resource-Based View Humankapitalmanagement Status quo der Forschung Betriebswirtschaftliche Ansätze der Humankapitalwertberechnung XIII
12 3... Marktwertorientierte Ansätze Rechnungswesenorientierte Ansätze Indikatorenbasierte Ansätze Wertschöpfungsorientierte Verfahren Ertragsorientierte Verfahren Ansatz der Saarbrücker Formel Resümee zum Stand der Humankapitalwertberechnung Neuer Weg der Humankapital-Bewertung die Cottbuser Formel Neu-Interpretation der Entgeltkomponente Marktlohn im Sinne des Arbeitsmarktmodells Marktlohn als Durchschnittswert Ergebnis der Diskussion Ausschluss des Motivationsindexes Realisierung einer dynamischen Berechnung Explizite Subsumtion der Wissensarten Erfassung des Fachwissens Erfassung des Erfahrungswissens Synthese zu einer Formel Sicherstellung der dimensionalen Konsistenz Kapitelfazit Deskriptive Auswertung der Unternehmensdaten Informationen über das Projektunternehmen Personalbestand Mitarbeiterstamm in den Funktionsbereichen Auszubildende Personalbewegungen Ausstiege in den Funktionsbereichen Einstellungen in den Funktionsbereichen Einstellungen von Auszubildenden und Absolventenübernahmen Entlohnung in den Funktionsbereichen Personalentwicklungskosten Kapitelfazit Systemdynamische Modellierung des Personalplanungssystems Der systemdynamische Ansatz im Überblick Historische Entwicklung und Einordnung des Ansatzes Wesentliche Bausteine systemdynamischer Modelle Rückkopplungen XIV
13 5... Bestands- und Flussgrößen Verzögerungen Altersketten und Coflows Bewertung des systemdynamischen Ansatzes Arbeitsspezifisches systemdynamisches Personalplanungsmodell Teil A: Alterskette für die quantitative Personalplanung Teil B: Humankapital-Coflow Modellgrenzen und Rahmenparameter Überprüfung des Modells und des Modellverhaltens Verhaltenstest I Verhaltenstest II Verhaltenstest III Resümee zum systemdynamischen Personalplanungsmodell Kapitelfazit Exemplarische Strategiesimulation am Personalplanungsmodell Szenario : Business as usual Auswirkungen auf die Alters- und Personalstruktur Auswirkungen auf den Fachwissensbestand Auswirkungen auf den Erfahrungswissensbestand Auswirkungen auf den Humankapitalwert und Resümee Szenario : Jeder wird gebraucht Auswirkungen auf die Alters- und Personalstruktur Auswirkungen auf den Fachwissensbestand Auswirkungen auf den Erfahrungswissensbestand Auswirkungen auf den Humankapitalwert und Resümee Szenario 3: Jugend zählt Auswirkungen auf die Alters- und Personalstruktur Auswirkungen auf den Fachwissensbestand Auswirkungen auf den Erfahrungswissensbestand Auswirkungen auf den Humankapitalwert und Resümee Kapitelfazit Erkenntnisse der Arbeit Zusammenfassung Handlungsempfehlungen für Unternehmen Handlungsempfehlungen für die Forschung... 3 Literaturverzeichnis Anhang XV
14 Abbildungsverzeichnis Abbildung -: Kontext unternehmensexterner und -interner demografischer Entwicklung... Abbildung -: Gliederungsdesign... 6 Abbildung -: Entwicklungsphasen der Personalarbeit... 9 Abbildung -: Zentrale Ansätze in der deutschsprachigen Personalforschung... 3 Abbildung -3: Vergleich von Personalverwaltung und Personalmanagement... 4 Abbildung -4: Merkmale der Ebenen des Personalmanagements... 9 Abbildung -5: Dynamik des Personalmanagement-Feedback-Prozesses... 0 Abbildung -6: Teilpläne der strategischen Personalplanung... 3 Abbildung -7: Differenzierung und Zusammenhänge der Personalbedarfsarten... 6 Abbildung -8: Personalbewegungen... 9 Abbildung -9: Anlässe und Formen der Personalveränderung... 3 Abbildung -0: Konzepte der Personalentwicklung Abbildung -: Entwicklungstreiber des Personalmanagements Abbildung -: Wichtige Rechtsquellen des Arbeitsrechts Abbildung -3: Anhebung der Regelaltersgrenze Abbildung -4: Dynamik der Bevölkerungsentwicklung Abbildung -5: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland zum Abbildung -6: Änderung des Bevölkerungsbestands nach Bundesländern Abbildung -7: Zahl der Erwerbspersonen im Zeitraum Abbildung 3-: Auszug von Ressourceneigenschaften im Sinne des RBV Abbildung 3-: Ressourceneigenschaften und ihr Beitrag zur Wettbewerbsposition 60 Abbildung 3-3: Auswahl von Ressourcenkategorisierungen... 6 Abbildung 3-4: Achenbachs Ressourcenkategorisierung... 6 Abbildung 3-5: Humankapital als Bestandteil des Unternehmenswertes... 7 Abbildung 3-6: Bilanzierungsrichtlinien für Humanressourcen Abbildung 3-7: Übersicht populärster Ansätze zu Humankapitalbewertung Abbildung 3-8: Intangible Assets Monitor Abbildung 3-9: Architektur des Human Potenzial Index Abbildung 3-0: Neoklassisches Arbeitsmarktmodell... 0 Abbildung 3-: Determinanten des freiwilligen Ausstiegs Abbildung 3-: Zusammenhänge der Variablen in der Saarbrücker Formel Abbildung 3-3: Graphische Unterscheidung von Integration und Differentiation.. 0 Abbildung 3-4: Bedeutung einzelner Terme der Saarbrücker Formel... 3 Abbildung 3-5: Erfahrungswissen und Erfahrungswissens-Zuwachs... 0 XVII
15 Abbildung 3-6: Zusammensetzung des Arbeitsprozesswissens... Abbildung 3-7: Neuinterpretation wissensrelevanter Komponenten im Überblick. 4 Abbildung 4-: Mitarbeiterbestand in den zehn Funktionsgruppen Abbildung 4-: Altersstruktur des Unternehmens Abbildung 4-3: Bestand nach Funktionsgruppen und Altersklassen Abbildung 4-4: Anteile der Funktionsbereiche am Gesamtbestand Abbildung 4-5: Anteile führender, kaufmännischer, gewerblicher FTE... 4 Abbildung 4-6: Bestand an Auszubildenden... 4 Abbildung 4-7: Anzahl an Ausstiegen nach Gründen und Altersklassen... 4 Abbildung 4-8: Ausstiegsquoten nach Gründen und Altersklassen Abbildung 4-9: Geometrisches Mittel der Ausstiegsquoten für Abbildung 4-0: Absolute und relative Neueinstellungen nach Funktionsbereichen 45 Abbildung 4-: Einstellungen nach Funktionsbereichen und Altersklassen Abbildung 4-: Mittelwert der Einstellungsquoten für Abbildung 4-3: Neueinstellungen von Auszubildenden und Absolventenzahlen Abbildung 4-4: Übernahmen von Auszubildenden nach Funktionsbereichen Abbildung 4-5: Arithmetisches Mittel der Übernahmequoten für Abbildung 4-6: Durchschnittliches Jahresbruttoentgelt in den Funktionsbereichen 50 Abbildung 5-: Typen wissenschaftlicher Modelle nach der Darstellungsform Abbildung 5-: Beispiele für Wechselwirkungsschleifen Abbildung 5-3: Einfaches Bestands-Flussgrößen-Diagramm Abbildung 5-4: Bestands-Flussgrößen-Diagramm mit den Rückkopplungen... 6 Abbildung 5-5: Anpassungsformen von Systemen... 6 Abbildung 5-6: Allgemeine Darstellung einer Alterskette Abbildung 5-7: Systemantwort auf Verzögerungen bei einer Stufenfunktion Abbildung 5-8: Generische Coflow-Struktur mit einer relevanten Eigenschaft Abbildung 5-9: Änderungskosten mit und ohne Simulationsverfahren... 7 Abbildung 5-0: Schematische Darstellung der Indexbildung... 7 Abbildung 5-: Alterskette in System-Dynamics-Symbolik Abbildung 5-: Fachwissens-Coflow in System-Dynamics-Symbolik Abbildung 5-3: Erfahrungswissens-Coflow in System-Dynamics-Symbolik Abbildung 5-4: Simulationsmodell in System-Dynamics-Symbolik... 8 Abbildung 5-5: Endogene, exogene und ausgeschlossene Modellvariablen Abbildung 5-6: Variablenwerte für den Verhaltenstest I Abbildung 5-7: Simulationsergebnisse des Verhaltenstests I Abbildung 5-8: Simulationsergebnisse des Verhaltenstests II Abbildung 5-9: Simulationsergebnisse des Verhaltenstests III... 9 Abbildung 5-0: Zusammenhänge der Variablen in der Cottbuser Formel Abbildung 6-: Variablenwerte für das Szenario Business as usual XVIII
16 Abbildung 6-: Business as usual : Einstellungen und Ausstiege Abbildung 6-3: Business as usual : Alters- und Personalstruktur... 0 Abbildung 6-4: Business as usual : Wertänderungen des Fachwissens... 0 Abbildung 6-5: Business as usual : Wert des Fachwissens Abbildung 6-6: Business as usual : Wertänderungen des Erfahrungswissens Abbildung 6-7: Business as usual : Wert des Erfahrungswissens Abbildung 6-8: Business as usual : Humankapitalwert Abbildung 6-9: Variablenwerte für das Szenario Jeder wird gebraucht Abbildung 6-0: Jeder wird gebraucht : Einstellungen und Ausstiege Abbildung 6-: Jeder wird gebraucht : Alters- und Personalstruktur... 0 Abbildung 6-: Jeder wird gebraucht : Wertänderungen des Fachwissens... 0 Abbildung 6-3: Jeder wird gebraucht : Wert des Fachwissens... Abbildung 6-4: Jeder wird gebraucht : Wertänderungen des Erfahrungswissens. 3 Abbildung 6-5: Jeder wird gebraucht : Wert des Erfahrungswissens... 4 Abbildung 6-6: Jeder wird gebraucht : Humankapitalwert... 4 Abbildung 6-7: Variablenwerte für das Szenario Jugend zählt... 6 Abbildung 6-8: Jugend zählt : Einstellungen und Ausstiege... 7 Abbildung 6-9: Jugend zählt : Alters- und Personalstruktur... 8 Abbildung 6-0: Jugend zählt : Wertänderungen des Fachwissens... 9 Abbildung 6-: Jugend zählt : Wert des Fachwissens... 0 Abbildung 6-: Jugend zählt : Wertänderungen des Erfahrungswissens... 0 Abbildung 6-3: Jugend zählt : Wert des Erfahrungswissens... Abbildung 6-4: Jugend zählt : Humankapitalwert... Abbildung 7-: Schematische Darstellung der Saarbrücker Formel (SF)... 7 Abbildung 7-: Schematische Darstellung der Cottbuser Formel (CF)... 7 Abbildung 7-3: Exemplarische Auflistung von Bestands- und Flussgrößen... 3 Abbildung A- : Ansätze der Humankapitalrechnung (Teil ) Abbildung A- : Ansätze der Humankapitalrechnung (Teil ) Abbildung A- 3: Ansätze der Humankapitalrechnung (Teil 3) XIX
17 The dominant factor for business in the next two decades is not going to be economics or technology. It will be demographics. (Drucker, 997, S. 0) Einleitung. Aktualität des Themas Die demografische Entwicklung und die Auswirkungen dieser auf die verschiedensten wirtschaftlichen, politischen oder gesellschaftlichen Bereiche sind inzwischen Inhalt vieler Studien. Für die personalpolitischen Konsequenzen scheinen sich Unternehmen bislang nur wenig zu interessieren (von Eckardstein, 004, S. 67) und trotz zunehmender Projekte und Veröffentlichungen zur Problematik der Bevölkerungsentwicklung aus betriebswirtschaftlicher Perspektive mangelt es noch immer an empirischen Daten zu betrieblichen Konsequenzen und Herausforderungen (Prezewowsky, 007a, S. ). Die demografischen Megatrends Alterung und Schrumpfung (Prezewowsky, 007a, S. 34) sind im Allgemeinen jedoch auch für firmeninterne Belegschaftsstrukturen zu erwarten und lassen deshalb auf einen enormen Handlungsbedarf für die strategische Personalplanung in Unternehmen schließen. Die Zusammenhänge sind in der Abbildung - visualisiert. Demografische Entwicklung unternehmensextern Alterung dauerhaft niedrige Geburtenziffer auch durch historische Ereignisse Lebenserwartung steigt Schrumpfung Wanderungsbewegung zu Ungunsten für den Bestand Sterbeziffer übertrifft Geburtenziffer Erwerbspersonenpotenzial Angebot Nachfrage unternehmensintern Alterung Versäumte Einstellungen von Nachwuchskräften Gesetzliche Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre Schrumpfung Bisherige Frühverrentung Betriebsbedingte Kündigungen Lebensphasenbedingte Fluktuation Abbildung -: Kontext unternehmensexterner und -interner demografischer Entwicklung Quelle: Eigene Darstellung. D. Schwarz, Strategische Personalplanung und Humankapitalbewertung, DOI 0.007/ _, Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 00
18 Die mit der Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials zusammenhängende erwartete Verknappung spezifischer Qualifikationen führt dazu, dass Unternehmen in strukturschwachen Regionen benachteiligt sind. Sie können unter Umständen ihren Personalersatzbedarf aufgrund hoher Verrentungszahlen, die der Belegschaftsalterung in den letzten Jahren geschuldet ist immer schwerer decken. Öffentliche Institutionen, kleine und mittelständische Unternehmen haben zudem meist weder die finanziellen Mittel, Personal auf Vorrat einzustellen, noch können sie mit dem Image und den Anreizstrukturen großer Unternehmen wettstreiten. Da mit den internen Alterungsprozessen oft sehr unterschiedliche Befindlichkeiten und Planungshorizonte angesprochen werden, besteht die Gefahr, das Alterungsproblem zunächst zu unterschätzen oder sogar zu übersehen (Hübner & Wahse, 00, S. 77). Aber Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dürfen den internen Personalstrukturwandel nicht länger ignorieren. Die Entwicklung mittel- bis langfristiger Strategien scheint jedoch aufgrund der nicht zu unterschätzenden Wechselwirkungen im In- und Umsystem des Unternehmens sowie der zeitverzögerten Effekte immer weniger fundiert. Erfolgreicher Umgang mit dieser Komplexität und der Entscheidungsfindung in komplexen Situationen gehört deshalb zu den zentralen Erfordernissen in unserer heutigen Gesellschaft (Müller & Funke, 995, S. 57) und verlangt von Führungskräften eine Änderung ihrer Denk- und Handlungsweisen (Snowden & Boone, 007, S. 3). Handeln wie bisher ist zukünftig keine wettbewerbsfähige Alternative, da sich die Arbeitskräftesituation in den nächsten Jahren eben nicht wie in der Vergangenheit entwickeln wird. Unternehmen werden ihren Personal- und Qualifikationsbedarf langfristiger planen müssen, was neue Wege und neue Entscheidungsgrundlagen erfordert. Gleichzeitig wird es damit immer wichtiger, die Konsequenzen der strategischen Personalplanung nicht nur am aktuellen Personalbestand und den Personalkosten zu messen, sondern an immateriellen Werten. Der Humankapitalwert eines Unternehmens wird in der Literatur insofern als Indikator diskutiert, um die Handlungen des (Personal-)Managements zu bewerten. Da bisher entwickelte Ansätze zur Humankapitalwertbestimmung große Schwächen aufweisen, besteht ein enormer Forschungsbedarf zur Entwicklung eines Bewertungsinstrumentes für einen auf unternehmensspezifischen Personaldaten basierenden Humankapitalwert.
19 . Problemstellung und Forschungsschwerpunkte Die Problemstellung für diese Arbeit ergibt sich aus den bisher nicht im Zusammenhang behandelten Themenbereichen demografiebedingtes Personalmanagement (u.a. Staudinger, 007), Humankapitalmanagement (u. a. Becker, 008; Scholz, Stein & Bechtel, 006; Riese, 007) und systemdynamische Simulation im Human Resource Management (u. a. Tabacaru, 006; Hafeez, Aburawi & Norcliffe, 004; Maasch, 996). Folgende Leitgedanken sollen die Relevanz dieser kombinierten Themenbearbeitung unterstützen: In theory, those managers who are aware of the demographic changes will be best equipped to operate recruitment campaigns in an increasingly competitive market; those who are unaware and make no provision for the changes, may suffer, if the current surplus of unemployed graduates is absorbed, and competition for qualified young people intensifies. If recruitment managers are unaware of the competition of the labour market and of any changes in their target age group, then their ability to be effective is brought into question. (Hodgkinson et al., 996, S. 9) Die Diskussion um die Humankapitalwertbestimmung hat in den letzten Jahren in Deutschland wieder zugenommen. Nicht zu letzt auch aufgrund der Saarbrücker Formel (Scholz, Stein & Bechtel, 006), die durch ihre Entwickler in der Praxis angewendet, in der Literatur jedoch stark kritisiert wird. Wesentliche Gründe für dieses ehrgeizige Engagement, ein Instrument zur Bewertung des betrieblichen Humankapitals zu erarbeiten, sind in den folgenden Aspekten zu sehen: erstens, zunehmende Anerkennung des Personals als strategische Ressource (auch im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Fachkräftemangel) und nicht nur als Kostenfaktor, zweitens, Auskunft für das Personalmanagement und die Unternehmensleitung über die Entwicklung des Humankapitalwertes und Formulierung adäquater Strategien zur Erhöhung sowie drittens, Bewertung des immateriellen Vermögens eines Unternehmens und Angabe dieses Wertes in der Bilanz zur Unterrichtung externer Stakeholder. Ziel sollte es schließlich sein, dass sich die Wissenschaft der Bewertung von Humanressourcen objektiv und ohne Hass und Leidenschaft widmet, um zu messen, was an betrieblichem Humankapital vorhanden ist, und wie es sich verändert (Becker, 008, S. 33). Staudinger, 007: Dazu gehören Kompetenzmanagement, Diversity Management, Erfahrungstransfer und Wissensmanagement, Gesundheitsmanagement, Unternehmensklima. 3
20 Malik bezeichnete es als Fehlentwicklung, dass im Bereich des Managements in Publikationen mit Begriffen wie System, Subsystem, Interaktion, Selbstorganisation, Feedback, Komplexität usw. argumentiert wird, ihre praktischen Konsequenzen und Anwendungsmöglichkeiten aber kaum sichtbar gemacht werden. Denn gerade weil Systemtheorie und Kybernetik sehr abstrakt sind, sollte erheblicher Aufwand betrieben werden, diese zu konkretisieren (Malik, 006, S. 5). Führungskräfte benötigen neben Instinkt, Intellekt und Charisma heute Werkzeuge und Konzepte, um ihre Unternehmen sicher durch weniger bekannte Gewässer zu steuern (Snowden & Boone, 007, S. 4). Inspiriert durch diese Aussagen ist es Ziel dieser Arbeit, das System der strategischen Personalplanung computergestützt nach kybernetischen Erkenntnissen abzubilden, geplante Strategien an diesem Modell zu simulieren und das daraus folgende Verhalten des Systems in der Zukunft zu prognostizieren. Die Evaluation dieser Strategien erfolgt anhand des durch sie beeinflussten Humankapitalwertes. Aufgrund der Berücksichtigung relevanter, mit dem Personalbestand zusammenhängender Wechselwirkungen, werden so die intendierten und nicht intendierten Konsequenzen dieser Strategien für das System aufgedeckt. Dadurch lassen sich Strategien noch vor der Implementierung bewerten und gegebenenfalls in Iterationsprozessen solange anpassen, bis der gewünschte Zustand des modellierten Systems erreicht ist. Ziel ist es, die Personalplanung mit diesem Werkzeug so auszurichten, dass die Organisation hinsichtlich der Quantität (Personalbestand) und Qualität (Wert) ihrer Humanressourcen, insbesondere vor dem Hintergrund der demografiebedingten Veränderungen, wettbewerbsfähig aufgestellt ist. Hauptanwendungsbereiche für computergestützte Simulationen in der Personalarbeit sind bisher die Eignungsdiagnostik und die Weiterbildung, wobei beispielsweise der systemdynamische Management Flight Simulator zum Einsatz kommt, um Systemdenken zu vermitteln, kognitive Fähigkeiten zu trainieren und mentale Modelle für praktische komplexe Management-Probleme zu bilden (Funke, 995, S. 0 f.; Hasselmann, 995, S. 37). Als reale Entscheidungsgrundlage in der Personalarbeit lassen sich diese Simulationsmodelle bisher kaum finden. Insofern ist diese Arbeit eine innovative Ergänzung zu den Veröffentlichungen, die verschiedene Maßnahmen zur Bewältigung demografischer Herausforderungen ausschließlich deskriptiv abhandeln. Einige Autoren empfehlen zu Recht verstärkte Anstrengungen in der Nachwuchs- 4
21 rekrutierung, keine vorzeitige Externalisierung älterer Arbeitnehmer, verstärkte Weiterbildungsanstrengungen oder auch wirksamere Personalbindungsprogramme (z. B. Holz & Da-Cruz, 007; Prezewowsky, 007b, S. 385, 386). Ein Manko dieser Arbeiten ist allerdings, dass Unternehmen entsprechender Größe aufgrund der dynamischen Wechselwirkungen nicht genau antizipieren können, wie stark sie zukünftig von der Belegschaftsalterung betroffen sein werden. Kurz: Ob verstärktes Engagement für ein Unternehmen notwendig ist und wie es den Bedarf für die mittel- bis langfristige Planung ermitteln kann, wird bisher in der Literatur nicht behandelt. Es ist deshalb ein Novum, das System der Personalplanung in seiner Komplexität und mit seiner Dynamik ausgehend von der Personalstruktur zu analysieren, zu modellieren und Strategien anhand personalwirtschaftlicher Indikatoren ex ante zu evaluieren. Entsprechend wird folgenden Forschungsaufgaben nachgegangen: Konzeption einer theoriebasierten Formel zur Berechnung des unternehmensspezifischen Humankapitalwertes, Erstellung eines systemdynamischen Personalplanungsmodells, welches die quantitative Personalplanung (Alters- und Personalstruktur) und die qualitative Personalplanung (Humankapitalwert) integriert, die Aufgaben der strategischen Personalplanung abdeckt und Unternehmen spezifisch für den internen demografischen Wandel rüstet. Vorstellung der Funktionstüchtigkeit des Simulationsmodells anhand realistischer Personaldaten und Evaluation exemplarischer Personalstrategien hinsichtlich ihrer mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die Alters- und Personalstruktur sowie den Humankapitalwert..3 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen Im Anschluss an diese Einleitung werden sechs Kapitel folgen. Die Abbildung - visualisiert den Aufbau. Im zweiten Kapitel werden die fundamentalen Aspekte des strategischen Personalmanagements innerhalb eines Unternehmens erörtert. Die strategische Personalplanung ist ein wesentlicher Teil des strategischen Personalmanagements, die hinsichtlich ihrer Funktionen detailliert beschrieben wird. Die zu erläuternden Entwicklungstreiber des Personalmanagements und der Personalplanung weisen darauf hin, dass diese Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird für Personenbezeichnungen keine Paarformel (z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) verwendet. Die verwendeten Begriffe wie Mitarbeiter, Arbeitnehmer, etc. schließen beide Geschlechtsformen ein. 5
22 Unternehmensbereiche von vielen Faktoren abhängig sind. Dieses Kapitel schließt mit der Erkenntnis, dass die Personalplanung ein dynamisches, komplexes System ist und daher zur Planungsunterstützung einer Methode bedarf, die den Umgang mit Komplexität und Dynamik ermöglicht.. Einleitung. Personalmanagement als Unternehmensfunktion 3. Theoretische Grundlagen 4. Empirische Analyse Resource-based View Humankapitalrechnung Deskriptive Auswertung der spezifischer Personaldaten 5. Systemdynamische Modellierung System Dynamics Modellerstellung Modellbewertung 6. Exemplarische Strategiesimulation 7. Erkenntnisse der Arbeit Abbildung -: Gliederungsdesign Quelle: Eigene Darstellung. Das folgende dritte Kapitel befasst sich mit zwei theoretischen Ansätzen, die das Personalmanagement tangieren. Es werden die thematisch stark zusammenhängenden Ansätze des ressourcenbasierten Ansatzes (Resource-Based View = RBV) und des Humankapitalmanagements vorgestellt. Während der RBV die strategische Bedeutung von Humanressourcen erklärt und damit die Wichtigkeit langfristiger Personalplanung betont, befasst sich das Humankapitalmanagement mit der Wertbestimmung der Humanressourcen. Dieser Aspekt gewinnt im Zuge der Diskussion um die Erfassung immaterieller Vermögenswerte und Anpassung externer Rechnungslegungsvorschriften an Relevanz. Aufgrund der fundamentalen Schwächen des populär gewordenen Ansatzes zur Humankapitalwertberechnung auf Basis von Personaldaten ( Saarbrücker Formel ), wird eine die Kritik aufgreifende, verbesserte und erweiterte Cottbuser Formel theoretisch fundiert entwickelt. Im vierten Kapitel wird die Datenbasis deskriptiv vorgestellt. Dazu gehören die im Rahmen einer Primärerhebung ermittelten personalbezogenen Daten des Projektunternehmens. Diese Daten beschränken sich auf die Informationen, die für die Personalplanung und die Humankapitalwertbestimmung relevant sind. Dazu gehören Personalbestandsdaten ebenso wie Fluktuationsdaten, Gehaltsstrukturen, Ausbildungszahlen, etc. Die wesentlichen Informationen stehen für die Jahre 005, 006 sowie 6
23 007 zur Verfügung und sind aufgeschlüsselt nach Abteilungen (Funktionsgruppen) und dem Alter der Mitarbeiter. Da es sich hierbei um hoch sensible Daten des Beispielunternehmens handelt, sind alle Ausführungen in dieser Arbeit anonymisiert. Im Folgenden wird deshalb auch von dem Projektunternehmen gesprochen. Das sich im fünften Kapitel anschließende Methodenkapitel befasst sich im ersten Abschnitt mit dem Ansatz der systemdynamischen Modellierung (System Dynamics). Hier werden sowohl dessen Herkunft und Begrifflichkeiten geklärt als auch die grundsätzlichen Modellbausteine erläutert. Anhand des im zweiten Abschnitt entstehenden computergestützten Simulationsmodells bestehend aus dem Alters- und Personalstrukturmodell (Alterskette) und der Cottbuser Formel (Coflow-Struktur) wird deutlich, dass der Mensch nicht mehr in der Lage sein kann, diese komplexen Strukturen zu erfassen, zu verarbeiten und rationale Entscheidungen treffen zu können. Im dritten Abschnitt dieses fünften Kapitels erfolgt die Modellevaluation. Die Logik und Robustheit des Modells sind ausschlaggebend dafür, wie realistisch die im sechsten Kapitel simulierten Szenarien sind. Relevante Strategievariationen beziehen sich dabei auf die Personalplanungspolitik. Dadurch wird es möglich, den von Malik (006) kritisierten hohen Abstraktionsgrad von Systemen zu reduzieren und konkrete Simulationsergebnisse zu präsentieren. Die erstellten Szenarien zeigen, welche Effekte Alters- und Personalstrukturveränderungen auf den Bestand an Fachund Erfahrungswissen und schließlich auf den Humankapitalwert haben. Grundsätzlich ist bereits an dieser Stelle zu betonen, dass die Modellstruktur aufgrund des theoretischen Bezugs zum Großteil unternehmensunspezifisch und generalisierbar ist. Die Simulationsergebnisse sind dagegen nicht verallgemeinerbar, da diese vor allem auf den spezifischen Daten des Projektunternehmens basieren. Eine individuelle Bewertung der Alters- und Personalstruktur sowie des Humankapitalwertes ist für jedes Unternehmen zu empfehlen, da angesichts der Komplexität von Organisationen und der unterschiedlichen internen und externen Einflussfaktoren keine generell gültigen Aussagen (Prezewowsky, 007a, S. 3) und Lösungen zum Überstülpen (Gesellschaft für Arbeitsschutz- und Humanisierungsforschung mbh Volkholz und Partner, 006, S. 9) getroffen werden können. Im abschließenden siebten Kapitel folgen die Zusammenfassung der Arbeit, Handlungsempfehlungen für Unternehmen und der Ausblick für weitere Forschungsaktivitäten. 7
24 Old-fashioned methods that rely on seat-of-the-pants forecasts and activities cannot be expected to lead to optimal results. (Walker, 969, S. 6) Personalmanagement als Unternehmensfunktion. Historischer Abriss.. Personalarbeit in der Praxis Anders als in anderen betriebswirtschaftlichen Disziplinen hat sich die Personalfunktion in Unternehmen eher etabliert als die Auseinandersetzung mit diesem Thema in der Forschung (Staehle, 994, S. 736). Verwaltungsarbeit, die durch das beschäftigte Personal entstand, gab es seit jeher. Allerdings haben sich im Laufe der letzten 50 bis 60 Jahre diese Tätigkeitsfelder insofern verändert, als dass inzwischen eher von der Arbeit mit dem und der Arbeit für das beschäftigte(n) Personal gesprochen werden kann. Die verschiedenen Entwicklungsphasen der Personalarbeit werden in der relevanten Literatur zum Teil unterschiedlich deklariert, insbesondere die letzten zwei Dekaden betreffend. Die Abbildung - stellt daher nur eine Möglichkeit dar, diese Phasen einzuteilen Personalverwaltung Personalstrukturierung Personalentwicklung Personalstrategie Personalinterfunktionalität Personalkompetenzintegration Abbildung -: Entwicklungsphasen der Personalarbeit Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Scholz, 000, S. 33. Rückblickend lässt sich für jedes Jahrzehnt ein anderer Schwerpunkt der Personalarbeit identifizieren. Das bedeutet gleichzeitig, dass sich das Aufgabenspektrum der Personalarbeit in jeder Periode unter anderem bedingt durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Einflüsse erweiterte. Die anfänglichen Aktivitäten und Schwerpunkte des Personalbereichs sind zumeist auch noch in den Folgephasen relevant. Allerdings ist festzustellen, dass nicht alle Unternehmen diese Phasen sukzessiv durchlaufen haben, so dass gegenwärtig in der Praxis zum Teil ganz unterschiedliche Fokusse die Personalarbeit bestimmen (Scholz, 000, S. 33). D. Schwarz, Strategische Personalplanung und Humankapitalbewertung, DOI 0.007/ _, Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 00 9
25 Die ursprüngliche Tätigkeit, die im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Mitarbeitern anfiel, war die reine Personalverwaltung. Dazu gehörten die Aufgaben der Lohn- und Gehaltsabrechnung, eine rudimentäre Personaleinsatzplanung (Scholz, 000, S. 3) sowie die Bereitstellung gesunder und möglichst billiger Arbeitskräfte (Wunderer & Dick, 007, S ; Berthel, 989, S. 353 ff.). An strategische Ziele der Personalarbeit war in dieser Phase kaum zu denken. Anfang der 960er Jahre waren erste Strukturierungsmaßnahmen im Personalbereich erkennbar, die auch dazu führten, dass Personalabteilungen als separate Funktion in Unternehmen anerkannt wurden (Scholz, 000, S. 33). Die konkreten Aufgaben bestanden zu dieser Zeit vor allem in der Personalverwaltung, -planung und -einstellung sowie Entgeltfindung, juristischen Konfliktregelung und die Anpassung der Mitarbeiter an komplexere organisatorische Anforderungen (Wunderer & Dick, 007, S ). Ab den 970er Jahren begann sich die Personalarbeit mehr an den Mitarbeitern selbst auszurichten. Die Anpassung des Personals an organisatorische Anforderungen wandelte sich hin zur Anpassung der Organisation an die Mitarbeiter (Wunderer & Dick, 007, S ). Wunderer bezeichnete diesen Entwicklungsabschnitt deshalb auch als Humanisierungsphase (ebenda). Stellenbeschreibungen, formalisierte Zielvereinbarungen, Personalentwicklung und Personalbetreuung waren sehr wichtige Führungsinstrumente und die Umsetzung des Betriebsverfassungsgesetzes rückte die Personalabteilung in eine formal-juristische Schlüsselrolle (Scholz, 000, S. 3). Ziel war es, mit diesen Mitteln das Personal zu aktivieren und Mitarbeiterzufriedenheit zu schaffen (Scholz, 000, S. 33; Wunderer & Dick, 007, S ). Mit Beginn der 980er Jahre wurde die Personalarbeit an ökonomischen Prinzipien ausgerichtet. Begründet durch ein hohes Lohnniveau in Deutschland und strukturelle Arbeitsmarktprobleme stand die Wertschöpfung durch die Personalarbeit im Vordergrund (Scholz, 000, S. 3, 33). Die zum Teil durch amerikanische und japanische Vorbilder entstandene strategische Ausrichtung (Scholz, 000, S. 3) bezog sich auf die kostenorientierte Anpassung der Organisation und des Personals an veränderte Rahmenbedingungen, auf die Flexibilisierung der Arbeit und der Arbeitskräfte, auf die Rationalisierung des Entwicklungspotenzials sowie auf die Freisetzungspolitik in Unternehmen (Wunderer & Dick, 007, S ). Hiermit wird deutlich, dass die Personalstrategie vor allem von der Produkt- und Marktstrategie abhängig war (ebenda). Die Ausrichtung an wirtschaftlichen Aspekten setzte sich auch in den 990er Jahren aufgrund der Rezession und breit angewendeter Konzepte wie Lean Management und Business Reengineering (Scholz, 000, S. 3) fort. Die Aufgabe der Personalabteilung bestand vor allem darin, die Profitabilität des Unternehmens zu verbessern und in diesem Zusammenhang die teilweise massiven Umstrukturierungsmaßnahmen zu be- 0
26 gleiten sowie die personalwirtschaftlichen Ziele und Strategien vertikal durchzusetzen (Scholz, 000, S. 3; Wunderer & Dick, 007, S ). Interfunktionalisierung der Personalarbeit heißt demnach, dass jede Führungskraft in einem gewissen Rahmen Aufgaben eines Personalmanagers wahrzunehmen hatte (Scholz, 000, S. 3). Scholz definierte ab 000 eine letzte Entwicklungsphase: die Personalkompetenzintegration. Grund für diese Bezeichnung waren die damals antizipierten Merkmale der künftigen Personalarbeit, wie Virtualisierung und die damit erforderliche Integration der verteilten personalwirtschaftlichen Kompetenzen (Scholz, 000, S. 33). Zukünftige Schwerpunkte der praktischen Personalarbeit sind schwer zu antizipieren. Sicher scheint jedoch, dass sie hinsichtlich der zunehmenden Markt-, Organisations-, Technologie- und Wertedynamik sowie der Globalisierung 3 (Scholz, 000, S. 7) sehr vielschichtig werden. Für den europäischen Wirtschaftsraum untersuchten die Europäische Vereinigung für Personalführung und die Strategieberatung Boston Consulting Group die Trends in der Personalarbeit. In diesem Kontext wurden.355 Personaler und Führungskräfte durch einen Fragebogen und 0 durch Interviews in 7 europäischen Ländern zu personalwirtschaftlichen Schwerpunkten und Herausforderungen bis zum Jahr 05 befragt (Daniel, Leicht & Strack, 007, S. 6). Besonders bedeutsam sind aus der Sicht der Befragten das Talentmanagement, der demografische Wandel, die Entwicklung zur lernenden Organisation, die Work-Life-Balance sowie das Change-Management und damit einhergehend die Transformation der Unternehmenskultur (ebenda). Darüber hinaus ist die Erkenntnis dieser Studie, dass diese fünf Themenfelder nicht nur besonders bedeutsam, sondern aufgrund der geringen Fähigkeiten der Personalverantwortlichen im Umgang mit ihnen außerordentlich zukunftskritisch sind (ebenda, S. 7)... Personalarbeit in der Forschung Während Personalarbeit schon lange in Unternehmen praktiziert wurde, beschäftigten sich Forscher erst später mit dieser Thematik (Staehle, 994, S. 736). Die durch die Existenz von Personal in Organisationen geschaffenen Probleme könnten Auslöser für das personaltheoretische Interesse gewesen sein, mit dem Ziel, Aussagen über Gestaltungsbeiträge zum Einsatz von Personal in Unternehmungen gemäß unternehmerischen, sozialen und individuellen Zielen zu treffen (Drumm, 008, S. 0 f.). Zwischen 900 und 950 gingen wesentliche Impulse für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit personalbezogenen Fragen im Unternehmen von US-ameri- 3 Vergleiche die Beschreibung der Einflussfaktoren im Abschnitt.3..
27 kanischen Forschern aus zu nennen seien hier vor allem Taylor und Gilbreth ( Scientific Management ), Munsterberg ( Angewandte Psychologie ) sowie Mayo, Roethlisberger, u. a. ( Human-Relations-Bewegung und Hawthorne-Experimente) (Klimecki & Gmür, 005, S. 0 ). In den darauffolgenden Jahren kristallisierten sich weitere Forschungsschwerpunkte heraus (Scholz, 000, S ): Die 950er und 60er Jahre waren vom individuellen Führungsansatz geprägt. In den 970er Jahren standen die Humanvermögensrechnung, der Personalplanungsansatz und verhaltensorientierte Systemansätze im Vordergrund. Die Orientierung an Interessengruppen führte in den 980er Jahren zu Ansätzen wie dem individuellen Entwicklungsansatz mit systematischer Personalentwicklung, dem strategischen Planungsansatz (Michigan-Ansatz, Harvard-Konzept), dem ökonomischen Ansatz als Weiterentwicklung der Humanvermögensrechnung, dem personellen Stimmigkeitsansatz, der aus dem Zusammenwirken von Entwicklungs- und Strategieansatz resultierte, sowie dem Kulturansatz, d. h. einem an der Unternehmenskultur orientierten Personalführungsansatz. In den 990er Jahren war die Personalmanagement-Forschung aufgrund der Komplexität des Forschungsfeldes und der hohen Interdisziplinarität vor allem durch Spezialisierung gekennzeichnet. Ihr Ergebnis ist in der US-amerikanischen Forschung ein Kontinuum, an dessen Polen der Market-Based View (Marktbelange beeinflussen die Strategie) bzw. der Resource-Based View (Personalbelange beeinflussen die Strategie) stehen. In Deutschland fand die akademische Auseinandersetzung mit der Personallehre anfangs (Dietrich, 94; Fischer, 99) unter dem Begriff der sozialen Unternehmensführung statt, denn als eigenständiges Teilgebiet innerhalb der Betriebswirtschaftslehre war dieses Fach zu dem Zeitpunkt noch nicht anerkannt (Klimecki & Gmür, 998b, S. 0, -5): Nach 945 galt es in der BRD die autoritären Strukturen vor allem im großindustriellen Bereich aufzulösen und durch Gesetze wie das Montan-Mit-bestimmungsrecht von 95, das Betriebsverfassungsgesetz von 95 und das Mitbestimmungsgesetz von 976 demokratischer zu gestalten (auch Böck, 00, S. ). Parallel zur Bildungsexpansion Mitte der 970er Jahre fand aufgrund des Mangels an hochqualifiziertem Personal eine rasante Institutionalisierung des psychologieund soziologiebezogenen Personalwesens an Hochschulen der BRD statt. Die 980er Jahre waren geprägt von der Human-Relations-Tradition und gleichzeitig dem ökonomisch orientierten Human Resource Management, begleitet vom Personal-Controlling-Ansatz und der mikroökonomischen Theorie. Die Schere zwischen beiden Ansätzen öffnete sich Anfang der 90 Jahre aufgrund der wachsenden strukturellen Arbeitslosigkeit.
28 Personaladministration Planung/ Verwaltung Rechtliche, mitbestimmungsrelevante Aspekte; Umsetzung strategischer Vorgaben z. B. Marr, Oechsler Personalmanagement Information Entwicklung Controlling Management Anpassung der Trainings- und Humanressourcen als Ganzheitlichkeit; Informations- und Entwicklungs- Kostenfaktor; Beeinflussung durch Kommunikationskonzeptionen Personalmanagement mehrere prozesse an Situation, als Quelle betrieblicher wissenschaftliche Strategien & Ziele Wertschöpfung Disziplinen z. B. Domsch, Hentze z. B. Eckardstein, z. B. Potthoff, z. B. Scholz, Weber Wunderer Ackermann, Berthel Abbildung -: Zentrale Ansätze in der deutschsprachigen Personalforschung Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Scholz, 000, S. 45. Aus diesen amerikanischen und nationalen Ursprüngen haben sich kaleidoskopartig potenzielle Inhalte des Personalmanagements aufgetan, die aus diversen fachlichen Perspektiven behandelt wurden und damit neue theoretische Ansätze begründeten (Scholz, 000, S. 44). Seit Anfang der 980er Jahre haben sich dadurch in Deutschland fünf zentrale akademische Ansätze heraus kristallisiert (ebenda). Wie die Abbildung - zeigt, lassen sich diese wissenschaftlichen Orientierungen zwischen der Personaladministration und dem Personalmanagement einbetten. Die Trennung in Personaladministration und Personalmanagement wurde mit identischen Inhalten aus der amerikanischen Forschung übernommen (Scholz, 996, S. 3). Personalmanagement steht dabei für eine ganzheitliche, handlungs- und wettbewerbsorientierte Perspektive, deren Ziele die Zufriedenheit der Organisationsmitglieder und die Wirtschaftlichkeit sind (Scholz, 000, S. 44; Scholz, 996, S. 3; Holtbrügge, 005, S. ). Da die Umwelt in diesem Ansatz als dynamisch angenommen wird, sind im Personalmanagement Instrumente wie die leistungsorientierte Bezahlung, Partizipation bzw. Personalcontrolling erforderlich (Holtbrügge, 005, S. ), mit denen die Leistung beeinflusst, gemessen und gegebenenfalls angepasst werden kann. Betriebswirtschaftliche und verhaltenswissenschaftliche Grundlagen stehen primär im Vordergrund (ebenda). Der Gegenpol zum Personalmanagement ist die traditionelle Personalverwaltung (Scholz, 000, S. 44; Scholz, 996, S. 3), die bürokratisch ausgerichtet und auf die korrekte institutionelle Regelung aller Aktivitäten und Arbeitsproduktivität fokussiert ist (Holtbrügge, 005, S. ). Entsprechend sind rechtliche, verwaltungs- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen relevant. In der Abbildung -3 sind diese beiden Extrema zusammenfassend gegenübergestellt. 3
29 Merkmale Ziele Leitbilder Wissenschaftliche Grundlagen Umweltzustand Antriebskräfte Instrumente Personalverwaltung Rechtmäßigkeit, Arbeitsproduktivität Bürokratie (Verwaltungsorientierung) Recht, Verwaltungswissenschaften, Ingenieurwissenschaften Statisch Gesetzgeber Dienstanweisungen und Verwaltungsvorschriften, Senioritätsprinzip, Hierarchie, formale Qualifikationen Personalmanagement Zufriedenheit, Wirtschaftlichkeit Markt (Wettbewerbsorientierung) Betriebswirtschaftslehre, Verhaltenswissenschaften Dynamisch Wettbewerb Leistungsorientierte Anreizsysteme, Partizipation, Personalcontrolling, Gruppenarbeit Abbildung -3: Vergleich von Personalverwaltung und Personalmanagement Quelle: Holtbrügge, 005, S.. In dem Wirtschaftlichkeitsgedanken, der Wettbewerbsorientierung sowie im Dynamikverständnis ist für die vorliegende Arbeit der Fokus auf das Personalmanagement begründet. Schwierigkeiten innerhalb dieses akademischen Ansatzes bereiten allerdings die in der Literatur verwendeten diversen und oft nicht eindeutig abgrenzbaren Begrifflichkeiten (Lucht, 007, S. 0; Brewster, 995, S. ). Neben Personalmanagement gehören dazu beispielsweise Bezeichnungen wie Personalwirtschaft oder Personalwesen. Gaugler und seine Kollegen gehen damit wie folgt um (Gaugler, Oechsler & Weber, 004, S. 654 f.): Solange Personalwesen nicht institutionell interpretiert wird und insbesondere die Geschäftsführung, die Personalabteilung, betriebliche Führungskräfte sowie die Betriebsratsmitglieder unter einem Dach zusammenfasst, können die genannten Begriffe als sinnverwandte Wörter verstanden werden. Inhaltlich gibt es nur geringe Unterschiede zur Benennung desselben Aufgabenkomplexes. Bezüglich der Abgrenzung der Begriffe Personalmanagement und Human Resource Management verdeutlicht letzterer viel prägnanter, dass die Mitarbeiter als erfolgskritische Ressource verstanden werden (Conrad, 003, S. 7; Staffelbach, 993, S. ). Personalmanagement hingegen verweist eher auf die Personalfunktion als Teil eines umfassenden personalbezogenen und dem ökonomischen Prinzip folgenden Unternehmensführungsprozesses (Lucht, 007, S. 5; Scholz, 000, S. 53). Allerdings spielt diese Akzentuierung in immer mehr Publikationen scheinbar keine Rolle mehr. Die Verwendung beider Termini geschieht sehr häufig synonym (Lucht, 007, S. 5; vgl. hierzu beispielsweise Neuberger, 004, S. 94; Schirmer, 004, S. 73; von Eckardstein, 004, S. 67; Scholz, 000, S. 55). In Anlehnung an diese Autoren sind die Bezeichnungen Personalmanagement und Human Resource Management (HRM) in der vorliegenden Arbeit als gleichbedeutend zu betrachten. 4
30 ..3 Theoretische Grundlagen des Personalmanagements Personalmanagement ist eine angewandte Wissenschaft, die vorhandene Theorien verschiedener Provenienz kontextspezifisch nutzt (Weibler & Wald, 004, S. 59 ff.). Die Personaltheorie existiert demnach nicht (Nienhüser, 996, S. 48 ff.). Die Vielfalt ist immens und es scheint sogar, als könnte für jedes personalwirtschaftliche Aufgabenfeld eine Reihe passender Erklärungsansätze gefunden werden. Hinsichtlich der Steuerung des menschlichen Verhaltens beispielsweise finden meistens arbeits- und organisationspsychologische Ansätze, mit Fokus auf das Verhältnis von Personal und Organisation, Gestaltung von Arbeitsplätzen und Aufgaben, sowie soziologische Ansätze, mit Fokus auf Beziehungen mit äußeren und inneren Interessengruppen, Anwendung (Matiaske, 004, S. 56). Exemplarisch seien an dieser Stelle folgende theoretische Ansätze genannt: Human-Relations-Ansatz (Mayo/Roethlisberger, ), motivationstheoretische Ansätze wie die Bedürfnispyramide von Maslow (943, 970), die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg (966), die Gerechtigkeitstheorie von Adams basierend auf der Anreiz-Beitrags-Theorie von March/Simon (958), die VIE- Theorie von Vroom (964) und das Motivationsmodell von Porter/ Lawler (968), der konfliktorientierte Ansatz von Marr/ Stitzel (979) sowie der Kontingenzansatz oder situative Ansatz der 970er/80er Jahre (Holtbrügge, 005, S. 7 3). Entsprechend der Entwicklung des Personalmanagements in der Praxis wurden in der Forschung später auch Theorien und Ansätze entwickelt, die weniger das individuelle Verhalten erklären, sondern großes Potenzial im Hinblick auf die theoretische Erklärung personalstrategischer Handlungen haben. Häufig in diesem Zusammenhang genutzte theoretische Ansätze sind (Holtbrügge, 005, S. 7 3; Festing, Groening & Weber, 998, S. 409; Wright & McMahan, 99, S. 300): die ressourcenorientierte Perspektive bzw. der Resource-Based View, der kybernetische Systemansatz und institutionenökonomische Ansätze, insbesondere die Transaktionskostentheorie und die Prinzipal-Agenten-Theorie. Die grundlegende Annahme des ressourcenorientierten Ansatzes ist, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der Organisation weniger umweltbedingt ergibt, sondern vielmehr auf dem Aufbau und der Nutzung unternehmungsspezifischer Ressourcen basiert (Holtbrügge, 005, S. 6; Scholz, 000, S. 50). Personelle Ressourcen sind demnach besonders gut geeignet, nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufgrund ihres vielfältigen, aufgabenübergreifenden Einsatzspektrums, der sozialen Einbettung, beschränkter Mobilität und geringer Abnutzung bei entsprechenden Bildungsinvestitionen aufzubauen (u. a. Lucht, 007, S. 89; Holtbrügge, 005, S. 6; Barney, 99, S. ). Der kybernetische Ansatz integriert Überlegungen zur ganzheitlichen und informatorischen Verknüpfung der verschiedenen Teilfunktionen des Personalmanagements 5
31 (Scholz, 000, S. 4). Es wird angenommen, dass die Effizienz des Personalmanagements dann am höchsten ist, wenn die verschiedenen personalpolitischen Instrumente integrativ aufeinander abgestimmt und in übergeordnete Zusammenhänge der Unternehmung und der Umwelt eingeordnet werden (Holtbrügge, 005, S. 5). Insofern ist es mit diesem Ansatz möglich, die Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Funktionen des Personalmanagements deutlich zu machen, was vor allem für Großunternehmungen relevant ist, in denen personalpolitische Entscheidungen in unterschiedlichen Bereichen und häufig ohne genaue Kenntnis voneinander getroffen werden (Holtbrügge, 005, S. 5). Institutionenökonomische Analysen betrieblicher Personalpolitik breiten sich seit der zweiten Hälfte der 990er Jahre im deutschsprachigen Raum aus (Backes-Gellner, Lazear & Wolff, 00, S. V). Zum Untersuchungsgegenstand im Rahmen dieser ökonomischen Ansätze gehören die mikroökonomische Betrachtung von Kooperationschancen und Interessenkonflikten im Arbeitsverhältnis (Sadowski, 00, S. V), die Analyse effizienter Personalentwicklung und Entlohnung oder auch die Organisation unternehmensinterner Leistungswettbewerbe und interne Arbeitsmärkte (Backes-Gellner, Lazear & Wolff, 00; Alewell & Martin, 006, S. 83; siehe auch Jans, 00, S. ). Aufgrund der generellen Kritik und des äußerst prämissenabhängigen Erklärungsbeitrags (Williamson, 985, S. 390 ff.; Richter & Furubotn, 003; Eigler, 997, S. 6; Alewell & Martin, 006, S. 83), ist die mikroökonomische Herangehensweise umstritten. Zudem ist die Operationalisierung und Messung der entstehenden (Agenturbzw. Transaktions-)Kosten problematisch (Ebers & Gotsch, 00, S. 4, 43). Insgesamt werden lediglich bekannte Tatbestände in mikroökonomischen Modellen abgebildet, so dass dieser Modellplatonismus wenig praktischen und keinen theoriebildenden Nutzen hat (Scholz, 000, S. 54). Jedem dieser theoretischen Ansätze sind in seiner Anwendbarkeit auf bestimmte Probleme Grenzen gesetzt. Meist werden die zugrundeliegenden Annahmen als zu restriktiv kritisiert. Die hier genannten institutionenökonomischen Ansätze thematisieren die Austauschbeziehungen zwischen Akteuren, konkrete ökonomische Institutionen hinsichtlich ihrer Verhaltenswirkung (Kieser, 00, S. 99) und vertragstheoretische Problemstellungen (Jans, 00, S. ). Dabei greift die Transaktionskostentheorie beispielsweise Erklärungstatbestände wie Formierungsprozesse und -kontexte von Personalstrategien kaum auf (Jans, 00, S. ). Ihre Eignung für Analysen personalwirtschaftlicher Problemfelder ist stark eingeschränkt (Alewell & Martin, 006, S. 87). Der ressourcenorientierte Ansatz verleiht dem strategischen HRM eher ein solides und theoretisches Fundament (Wright & McMahan, 99, S. 300 ff.). Da in der personalstrategischen Forschung den Mitarbeitern eines Unternehmens ein sehr hoher Wert im Sinne der Erreichung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile beigemessen 6
32 wird (Becker & Gerhart, 996, S. 780, 78), soll die Wichtigkeit des Themas der vorliegenden Arbeit mit diesem ressourcenorientierten Ansatz begründet werden (siehe Kapitel 3). Auch der kybernetische Systemansatz findet Eingang in diese Arbeit. Die Methode der systemdynamischen Modellierung entstammt der kybernetischen Denkweise und ermöglicht die Erfassung der Dynamik und Komplexität des Personalsystems.. Strukturierung des Personalmanagements.. Ebenen und Dynamik innerhalb des Personalmanagements Wie auch der allgemeine Managementprozess ist das Personalmanagement grundsätzlich in die drei Ebenen des strategischen, taktischen und operativen Personalmanagements zu untergliedern (Scholz, 000, S. 88). Das operative Personalmanagement beschäftigt sich mit dem Management von Beschäftigungsverhältnissen in einem Unternehmen (Chadwick, 005, S. 00; Scholz, 000, S. 0). Es befasst sich ausschließlich mit der Umsetzung von Plänen und personellen Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise dem Fähigkeitsprofil eines Mitarbeiters, dem Anforderungsprofil eines Arbeitsplatzes sowie individuellen Personalentwicklungs- und Förderungsmaßnahmen (Klimecki & Gmür, 998b, S. 3; Scholz, 000, S. 0). Dabei geht es auch darum, ob und wie die verfügbaren Personalbereiche und Adressaten des Personalmanagements in den Prozess der Implementierung beteiligt werden (Klimecki & Gmür, 005, S. 4). Kennzeichnend für operatives Verhalten sind die Kurzfristigkeit umgesetzter Maßnahmen, die vorwiegende Einbindung unterer Hierarchieebenen sowie die starke Differenzierung der Teilpläne (Lucht, 007, S. 43). Das dem operativen Personalmanagement gegenüberstehende Pendant strategisches Personalmanagement findet erst in den letzten zwei Jahrzehnten verstärktes Forschungsinteresse (Ferris, Hochwarter, Buckley, Harrell-Cook & Frink, 999, S ). Es impliziert einen organisationalen Systemansatz (Chadwick, 005, S. 00) und einen Bezug zur Firmenleistung (Mayson & Barrett, 006, S. 448; Boxall & Purcell, 000, S. 84). Forscher im Bereich des strategischen HRMs fokussieren mehr auf das Management der Belegschaft als Ganzes und auf die Kombination personalbezogener Maßnahmen als auf individuelle Aufgaben, deren Aufgabenträger und isolierte Maßnahmen (Lepak & Snell, 00, S. 57). Strategisch bedeutet demnach eher die Untersuchung globalerer Zusammenhänge innerhalb der Personalarbeit sowie die Zusammenhänge zwischen Personalarbeit und anderen Unternehmensfunktionen und weniger die Beschäftigung mit Details. Basierend auf Personalleitbildern und Unternehmensstrategien ergeben sich wenig ausdifferenzierte Personalstrategien, mit denen obere Hierarchieebenen für einen Zeitraum von in der Regel mehreren Jahren Ziel- 7
33 punkte definieren, an denen sich operative Maßnahmen ausrichten sollen (Lucht, 007, S. 43; Horváth, 006, S. 7; Klimecki & Gmür, 005, S. 4 f.; Macharzina & Wolf, 005, S. 58 ff.; Wimmer & Neuberger, 998, S. 39; Kräkel & Schauenberg, 998, S. 85). Dazu zählen beispielsweise Festlegungen zum Anteil an Auszubildenden, zum Umfang betrieblicher Weiterbildung, zur Belegschaftsstruktur nach quantitativen und qualitativen Kriterien oder auch zur Vergütungsstruktur bzw. zum Vergütungsniveau (von Eckardstein, 004, S. 60 6; Scholl, 998, S. 95; Weber, 97, S. 34). Das strategische HRM 4 geht davon aus, dass die Mitarbeiter 5 eine Quelle des strategischen Wertes sind und durch ihre Entwicklung, Beschäftigung und Organisation gemeinsam mit anderen strategischen Ressourcen des Unternehmens zur Unternehmensleistung und Nachhaltigkeit beitragen (Lucht, 007, S. 3; Wunderer & Dick, 007, S. 76; Mayson & Barrett, 006, S. 448). Oft wird deshalb die Personalstruktur als eine eigenständige erfolgs- und existenzsichernde strategische Zielgröße angesehen, denn infolge zunehmender Umweltkomplexität sind vor allem die Qualifikationen des Personals eine der wenigen nachhaltigen Erfolgspotenziale für die Unternehmensentwicklung (Klimecki & Gmür, 998b, S. 35). Die taktische Ebene hat eine Vermittlerfunktion zwischen Strategie und Operation inne: zum einen werden strategische Vorgaben auf Gruppenbasis disaggregiert und der operativen Planung nahegebracht (top down), zum anderen werden Informationen des operativen Personalmanagements aggregiert und der strategischen Planung zur Verfügung gestellt (bottom up) (Scholz, 000, S. 0). Die im Personalmanagement anfallenden Aufgaben werden auf jeder dieser drei Ebenen ausgeführt (Scholz, 000, S. 88 ff.). Sie unterscheiden sich allerdings in ihrem jeweiligen Wirkungshorizont, in der Art der formulierten Ziele, der Analyseeinheit 4 5 Einhergehend mit der strategischen Ebene des Personalmanagements findet der Begriff der Personalpolitik in der Literatur Verwendung. Inzwischen hat sich ein duales Verständnis diese Bezeichnung betreffend herausgebildet: zum einen werden unter Personalpolitik Grundsatzentscheidungen im Personalbereich (policies) verstanden, zum anderen findet Personalpolitik Verwendung, um den politischen Prozess zur Durchsetzung oft divergierender Interessen (politics) auszudrücken (von Eckardstein, 004, S. 66 f.; zur Abgrenzung Martin & Nienhüser, 998, S. 9, 57, 67; Scholl, 998, S. 95; Bisani, 995, S. 38 f.; Klimecki & Gmür, 998a, S. 375, 384; Bartscher-Finzer & Martin, 998, S. 5). Auch wenn beide Interpretationen zusammenhängen und Grundsatzentscheidungen aufgrund (personal-)politischer Prozesse ständigen Veränderungen unterliegen (Scholl, 998, S. 95), spielt das prozessuale Verständnis in der vorliegenden Arbeit keine primäre Rolle. Personalpolitik wird aus diesem Grund im Folgenden als Grundsatz- bzw. Metaentscheidung rationaler Akteure der Unternehmensleitung (Alewell & Hackert, 998, S. 34) verstanden. Damit entspricht dieses Politikverständnis aufgrund der inhaltlichen Beschreibung als Plan dem Begriff der Personalstrategie im Rahmen des strategischen Human Resource Managements (von Eckardstein, 004, S. 67). Anmerkung: Nach Holtbrügge werden Mitarbeiter wie folgt definiert: Mitarbeiter sind neben den Führungskräften individuelle Akteure des Personalmanagements, die in die Subtypen Arbeitnehmer (d. h. Arbeiter, Angestellte, Auszubildende sowie Volontäre/ Praktikanten), Arbeitnehmerähnliche, Leiharbeiter und Beamte unterschieden werden können (Holtbrügge, 005, S. 33, 34). 8
34 sowie der Analyseart (Spengler, 008, S. ; Nicolai, 007, S. 508 f.; Nolte, 006, S. 4 5; Wimmer & Neuberger, 998, S. 85, 04 f.). Die nachfolgende Abbildung fasst diese Kriterien zusammen. Strategisches Personalmanagement Erfolgswirkung: langfristig Zielformulierung eng verbunden mit Unternehmensplanung Analyseeinheit ist die globale Altersund Personalstruktur quantitativ Taktisches Personalmanagement Erfolgswirkung: mittelfristig Formulierung konkreter Ziele und Inhalte der Maßnahmen Analyseeinheit sind gleichartige Stellen oder Qualifikationen quantitativ und qualitativ Operatives Personalmanagement Erfolgswirkung: kurzfristig/ unterjährig Formulierung handlungsbezogener Maßnahmen Analyseeinheit ist das Individuum qualitativ Abbildung -4: Merkmale der Ebenen des Personalmanagements Quelle: Eigene Darstellung. Den Rahmen für die Personalstrategie bildet zum einen die immanente Rückkopplung zwischen Entscheidungen und Ergebnissen aller drei Ebenen (Alewell & Hackert, 998, S. 34; Kahle, 998, S. 370). Das heißt beispielsweise, dass der Personalbestand und die Personalstruktur durch Reaktionen der Mitarbeiter auf gewisse strategische Entscheidungen beeinflusst werden und diese Veränderungen in Bestand und Struktur die personalpolitischen Möglichkeiten der Unternehmung bestimmen. Kahle spricht in diesem Zusammenhang von den innerorganisatorischen Logiken (Kahle, 998, S. 370). Zum anderen begründet die in hohem Grade marktlich determinierte Unternehmensstrategie bzw. -struktur das personalpolitische Vorgehen (ebenda). Dieser Rückkopplungsprozess ist in der Abbildung -5 visualisiert und erweitert den bekannten Managementzyklus. Dessen Grundbausteine der Zielfestlegung, der Messung der Ist-Situation, des Soll-Ist-Vergleichs sowie der sich anschließenden Korrekturmaßnahmen (Steahle, 994, S. 57) sind integriert. Diese Darstellung zeigt die Abhängigkeiten innerhalb des Personalsystems (Insystem) sowie die Wechselwirkungen mit dessen Umsystem (Scholz, 987, S. 64). Beginnend mit einem gewünschten Soll-Zustand des Personalsystems wird in der Literatur von einer Mehrfachzielsetzung gesprochen. Dabei müssen sowohl soziale Ziele im Sinne der Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt werden, als auch wirtschaftliche Ziele des Arbeitgebers (Mag, 004, S. 60; Hafeez, Aburawi & Norcliffe, 004, S. ). Letztere beinhalten die Versorgung des Unternehmens mit der richtigen Quantität und der richtigen Qualität von Mitarbeitern, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu möglichst kostengünstigen Bedingungen (Breyer-Mayländer, 004, S. 75; von Eckardstein, 004, S. 60 6). Der Vergleich dieses definierten Zustands mit dem 9
35 aktuellen Zustand des Personalsystems kann Diskrepanzen aufdecken, die es durch korrektive Handlungen zu reduzieren gilt (Sterman, 004, S. 4). Legende: + vs. + Positiver Kreislauf = sich selbstverstärkender Prozess vs. Negativer Kreislauf = sich selbst ausgleichender Prozess Kausalzusammenhang = x bewirkt y Kausalzusammenhang mit Verzögerungswirkung Da die Personalstrategie ausschlaggebend ist für die Maßnahmen auf operativer Ebene, muss diese zunächst in Richtung des Soll-Zustandes ausgerichtet werden. Die Anpassung der Personalstrategie geschieht allerdings nicht autonom. Inwiefern die Unternehmensstrategie ihren Einfluss geltend macht, diskutierte Scholz in seiner Arbeit. Von den vier Möglichkeiten. völlige Unabhängigkeit beider Strategien,. Personalstrategie folgt der Unternehmensstrategie, 3. Unternehmensstrategie folgt der Personalstrategie und 4. Personalstrategie ist Teil der Unternehmensstrategie sei lediglich die letzte Alternative zielführend (Scholz, 000, S. 9 f.; Oechsler, 006, S. 38), da nur dann alle Ressourcen in der bestmöglichen Verbindung genutzt werden könnten (Scholz, 000, S. 93; Bell, 974, S. 8). Während die Personalstrategie mit ihrer Ressourcenorientierung die Signifikanz von Human Ressourcen für den unternehmerischen Erfolg erklärt, macht die Unternehmensstrategie mit ihrer Produkt- und Marktorientierung die Vorgaben für den Personalbereich (Lucht, 007, S. 4; Scholz, 000, S. 9). Die strategieadäquate Ausrichtung ist notwendige Bedingung für strategisches Verhalten und für strategische Effizienz (Scholz, 987, S. 66). Sind beide Strategien aufeinander abgestimmt, werden die personalstrategischen Vorgaben auf taktischer Ebene im operativen Personalmanagement umgesetzt und die Mitarbeiter dazu veranlasst, einen Beitrag zur Erreichung der organisationalen Ziele zu leisten (Walgenbach, 998, S. 67 f.). Der Zyklus schließt sich mit der Messung der erreich- Unternehmensleistung gewünschte Unternehmensleistung Verzögerung durch Aggregation operative Umsetzung Einfluss auf Umsystem Verzögerung durch Disaggregation ressourcenorientiert Diskrepanz. Soll-Zustand des Personalsystems Ist-Zustand des Personalsystems Balance zwischen Stabilisierung und Personalstrategie Strategische Stimmigkeit Unternehmensstrategie Verzögerung durch Flexibilisierung Messung, Berichterstattung Verzögerung durch marktorientiert Diskrepanz Beratung, Abwägung der Alternativen Abbildung -5: Dynamik des Personalmanagement-Feedback-Prozesses Quelle: Eigene Darstellung, i.a. an Aussagen von Lucht, 007, S. 4; Sterman, 004, S. 4; Scholz, 987, S. 64 ff.; Scholz, 000, S. 0; Staehle, 994, S ; Breyer-Mayländer, 004, S. 75; Klimecki & Gmür, 005, S., 390; Klimecki & Gmür, 998a, S. 380; Walgenbach, 998, S. 67 f. 0
36 ten Ergebnisse und einem erneuten Soll-Ist-Vergleich (Bröckermann, 997, S. 43; Steahle, 994, S. 57). Entscheidend für das Verständnis der aus diesem Feedback-Prozess resultierenden Dynamik sind unter anderem die Zeitverzögerungen. Diese sind eine wichtige Ursache des Kräftespiels in nahezu allen Systemen 6 (Sterman, 004, S. 409). Solche Verzögerungen ergeben sich beispielsweise dadurch, dass Handlungsbedarfe erst wahrgenommen, entsprechende Messungen durchgeführt, Berichte erstattet, Handlungsalternativen erarbeitet (Maasch, 996, S. 7 8, Sterman, 004, S. 409) bzw. auf taktischer Ebene Vorgaben disaggregiert und Informationen aggregiert werden müssen (Scholz, 000, S. 0). Andererseits resultiert das dynamische Verhalten eines solchen Systems aus den jeweiligen Rückkopplungsschleifen, die entweder selbstverstärkend (positive Rückkopplung) oder selbstkorrigierend (negative Rückkopplung) sein können (Sterman, 004, S. 3). Der Einfluss der Unternehmensstrategie auf die Personalstrategie und umgekehrt sind positive Verknüpfungen, da sie aufeinander abgestimmt und damit einen sich selbst verstärkenden Prozess bedingen. So bedeutet diese Selbstverstärkung einerseits, dass die Festlegung eines reduzierten Personalbudgets auf Unternehmensebene die Eingrenzung der Weiterbildungsplanungen nach sich zieht. Andererseits führt eine unternehmerische Expansionsentscheidung zur gesteigerten Personalbeschaffungsplanung. Soll-Ist-Vergleiche in einem System provozieren dagegen immanente Korrekturen aufgrund des angestrebten Gleichgewichtszustandes (Sterman, 004, S. 3). Ausschlaggebend ist der gemessene aktuelle Systemzustand: je mehr die Ergebnisse dem gewünschten Ziel entsprechen, desto geringer die Differenz (negative Verknüpfung), desto weniger Handlungsbedarf (positive Verknüpfung) und desto geringer die Veränderung des Systems (positive Verknüpfung). Ein Beispiel mit dem gewünschten Ziel einer dauerhaften Personalbedarfsdeckung verdeutlicht dieses Prinzip: Ergibt die jährliche Personalbestandsanalyse eine Unterdeckung, folgt eine erhöhte Soll-Ist-Diskrepanz, die einen erhöhten personalstrategischen Handlungsbedarf impliziert. Beispielsweise folgen daraus Entscheidungen zum Ausbau des internen Arbeitsmarktes und der Medienoptimierung für Stellenanzeigen (Scholz, 004, S. 389 ff.). Auf operativer Ebene führen diese Entscheidungen z. B. zu ver- 6 Vgl. Bossel, 004, S. 35 f.: Viele Objekte in der Erfahrungswelt werden als System bezeichnet. Zentrale Kriterien, um ein Objekt als System zu verstehen, sind. ein vorhandener Systemzweck,. vorhandene Wirkungsverknüpfungen zwischen Systemelementen sowie 3. die vorhandene Systemintegrität, d. h. Unteilbarkeit des Systems. Es wird von dynamischen Systemen gesprochen, wenn Systeme in einem relevanten Zeitraum ihren Zustand verändern. Dynamische Systeme sind gekennzeichnet durch Rückkopplungsprozesse, die Unterscheidung von Bestands- und Bewegungsgrößen, Zeitverzögerungen und nichtlinearem Verhalten über die Zeit (Sterman, 004, S. ). Ausführlich dazu im Kapitel Systemdynamik.
37 stärkten Personalentwicklungsgesprächen und Umsetzung von Fördermaßnahmen bzw. zu verstärkter externer Personalsuche und Personalauswahl. Erfolg dieser Aktivitäten würde sich am Ende dieser Periode in einer reduzierten Soll-Ist-Differenz äußern. Dieser Prozess ist iterativ. Er zielt auf Stabilität ab, erfordert aber gleichzeitig Flexibilität für Anpassung (Breyer-Mayländer, 004, S. 75; Klimecki & Gmür, 005, S. ). Der dritte Wirkungskreislauf bezieht sich auf den Beitrag der Personalarbeit, bspw. in Form von Produktivitätskennzahlen (Gmür & Schwerdt, 005, S. 3 4) oder Kündigungsquoten (Wright & McMahan, 99, S. 306), zur Unternehmensleistung. Einige Studien aus der Erfolgsfaktorenforschung zeigen, dass der Einfluss personalwirtschaftlicher Maßnahmen auf den Unternehmenserfolg nicht zu unterschätzen ist (Bonn, Gmür & Klimecki, 004, S. 9; Wächter, 974, S. 8; Holtbrügge, 007, S. 6). Insbesondere die Personalplanung (Koch & McGrath, 996, S. 335 ff.), das Verhaltensmanagement bspw. durch leistungsorientierte Entgeltmodelle (Delery & Doty, 996, S. 80 ff.) sowie Personalauswahl, Training und Anreizsysteme (Delaney & Huselid, 996, S. 949 ff.; Gmür & Schwerdt, 005) tragen zur Unternehmensleistung entscheidend bei (Shipton, West, Dawson, Birdi & Patterson, 006, S. 4, 9). Da die erreichte gesamtorganisationale Leistung wiederum mit einem Soll-Wert verglichen und die Unternehmensstrategie entsprechend der Diskrepanz angepasst wird, handelt es sich auch hierbei um eine negative Wirkungsschleife. Entsprechend dieser entstehenden Dynamik und des langfristigen Wirkungshorizonts allein im Personalsystem muss kaum mehr betont werden, dass Personalarbeit zukunftsorientiert ausgerichtet und sich gegenseitig beeinflussende Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden müssen (Köchling, 00, S. ). Gerade die Wirkungszusammenhänge personalbezogener Handlungen sind entscheidender für den Unternehmenserfolg als eine spezifische Variable allein (Shipton et al., 006, S. 4, 9)... Strategische Personalplanung als Teil des strategischen HRMs An der Prozesslogik der Personalarbeit ausgerichtet, definierte Scholz 9 Felder im Personalmanagement (Scholz, 000, S. 83). Allerdings sind diese personalwirtschaftlichen Funktionen in der Literatur nicht eindeutig. Entsprechend argumentierte Drumm, dass die Aufzählung und Analyse aller personalwirtschaftlicher Problemfelder aufgrund des kontinuierlichen Wandels personalwirtschaftlicher Probleme weder sinnvoll noch hilfreich ist (Drumm, 008, S. 3). So ist die Ausrichtung und Bedeutung des Personalwesens wohl auch mit der Größe des Unternehmens verknüpft (Tiedtke, 007, S. 344; Mag, 004, S. 6). Die strategische Personalplanung ist ein wesentlicher Teil des strategischen Personalmanagements und damit der strategischen Unternehmensplanung (Wilson, 97, S. 3; Idris & Eldridge, 998, S. 349). Wie auf der übergeordneten Ebene des Personal-
38 managements wird die Personalplanung ebenfalls in die strategische, die taktische und die operative Personalplanung unterschieden. Die strategische Personalplanung ist dabei der Ausgangspunkt aller anderen Personalplanungsebenen (Beck, 00, S. 09) und kann als Schnittstelle zwischen operativer bzw. taktischer Personalplanung und strategischer Unternehmensplanung verstanden werden (Wimmer & Neuberger, 998, S. 43, 5). Bereits die Darstellung des simplifizierten Managementprozesses zeigt, wie wechselseitig abhängig die Personalstrategie in das Gesamtsystem eingebunden ist. Die Verknüpfung mit weiteren exogenen und endogenen dynamischen Subsystemen wurde in dieser Abbildung noch nicht verarbeitet. Die strategische Personalplanung ist allerdings interdependent verwoben, so dass von einem multioperativen, multitemporalen und multipersonalen Vorgang gesprochen werden kann (Witte, 968, S. 65 ff.). Um in diesem Komplexitätsraum überhaupt fundierte, zielorientierte Entscheidungen treffen zu können, muss dieser strukturiert und zielorientiert reduziert werden (Weinmann, 978, S. 4 5). Entsprechend wird die Personalplanung in diverse Teilplanungen gegliedert. Welche Teilplanungen in welchem Ausmaß zur Personalplanung gehören, wird in der Literatur allerdings nicht einheitlich sondern kontextabhängig definiert (vgl. dazu u. a. Holtbrügge, 005; Scholz, 000; Mag, 004; Jung, 008, S. 37). Den kleinsten gemeinsamen Nenner bilden die Bedarfsplanung (Soll), die Bestandsplanung (Ist) und die Veränderungsplanung, bestehend aus der Beschaffungs-, der Entwicklungs- sowie der Freisetzungsplanung (Mag, 004, S. 604; Scholz, 000, S. 383; Khoong, 996, S. 6 7; Nolte, 006, S. 4 5; Wimmer & Neuberger, 998, S ; Holtbrügge, 005, S. 73). Entsprechend der oben verwendeten Darstellungsweise ergibt sich für die strategische Personalplanung folgender Feedback-Prozess (vgl. Abbildung -6). Ersatzbedarfsplanung Erweiterungsbedarfsplanung Reservebedarfsplanung Bedarfsplanung auf Basis der Analyse der Bestands- und Bewegungsdaten Bestandsplanung Beschaffungsplanung Entwicklungsplanung Freisetzungsplanung Veränderungsplanung Diskrepanz Abbildung -6: Teilpläne der strategischen Personalplanung Quelle: Eigene Darstellung. Auch im Rahmen der Personalplanung geht es entsprechend darum, zukünftige Entwicklungen, Ereignisse und Situationen zu antizipieren (Nolte, 006, S. 3) und im 3
39 Zusammenhang zu betrachten (Zülch & Becker, 008, S. 7). Der definierte Soll- Zustand wird mit dem Ist-Zustand verglichen. Korrektive Handlungen reduzieren die potenzielle Diskrepanz in Richtung des gewünschten Zustands. Dieser sich selbstkorrigierende Feedback-Prozess ist iterativ (Beck, 00, S. 09). Es ist festzuhalten, dass die Personalplanung zumindest in der Wissenschaft als der Inbegriff eines idealtypischen rationalen Personalmanagements gilt, denn im Gegensatz zu einer ad hoc betriebenen Personalarbeit steht sie für Konzepte wie Strategie, Integration und Zukunftsorientierung (Wimmer & Neuberger, 998, S. 4). Ihre Aufgabe ist es, durch Analyse vergangener und zukünftiger Entwicklungen die Unternehmen vor den Auswirkungen unerwarteter Ereignisse wie etwa Personalengpässen oder teuren Personalüberhängen zu schützen (Wimmer & Neuberger, 998, S. 5). Strategische Personalplanung findet unternehmensspezifisch mit eigens festgelegten zweckdienlichen Methoden statt und umfasst folgende zusammenhängende Elemente (Wimmer & Neuberger, 998, S. 0-; Bell, 974, S. 9 f., 69 f.; Walker, 969, S. 54 f., 73; Maasch, 996, S. 34): systematische Analyse der internen Personalsituation nach relevanten Kriterien, Analyse des externen Personalangebots hinsichtlich Erwerbspersonenpotenzial nach Qualifikation in der relevanten Region und abhängig von der Konkurrenznachfrage, Planung bzw. Prognose des Personalbedarfs nach relevanten Kriterien, zielorientiertes Vorgehen und Abgleich mit der Unternehmensplanung, Entwicklung von Handlungsalternativen zur Erreichung der Ziele, Entscheidungsfindung und Anweisung zur Realisierung der gewählten Alternative, Implementierung sowie spätere Evaluation des Beitrags der Maßnahmen hinsichtlich des angestrebten Ziels. Diese Prozesselemente spiegeln die einzelnen Schritte des in Abbildung -5 visualisierten Management-Feedback-Prozesses wider. Es handelt sich um ein iteratives Vorgehen. Wichtig ist dabei, dass die Personalplanung sowohl mit den Subsystemen der Organisation als auch mit der Umwelt, vor allem mit dem Arbeitsmarkt, interagiert (Idris & Eldridge, 998, S. 347; Holtbrügge, 007, S. 4; Wright & McMahan, 99, S. 306). Die Vorteile einer effektiven Personalplanung liegen arbeitgeberseitig in der Steuerung hin zu einer adäquaten Personalausstattung, in der daraus folgenden Möglichkeit, Personalkosten zu senken und Gewinne zu steigern, sowie in der Umsetzbarkeit der personalpolitischen Vorgaben der Unternehmensplanung (Prezewowsky, 007a, S. 4; Wimmer & Neuberger, 998, S ). Zudem ist langfristige Planung relevant, um den gestiegenen Bedarf an Hochqualifizierten trotz langwieriger Beschaffungs- und Ausbildungszeiten zu decken (Walker, 969, S. 53). Aus Arbeitnehmersicht schafft eine systematische Personalplanung mehr Sicherheit des Arbeitsplatzes 4
40 und verhindert negative Auswirkungen bei technischem oder organisatorischem Wandel (Wimmer & Neuberger, 998, S ). Die Akzeptanz einer Personalplanung steigt zusätzlich, wenn es einen erhöhten Problemdruck beispielsweise aufgrund des demografischen Wandels gibt, wenn die Personalplanungsmethode effizient und effektiv ist, wenn die Entwicklung und der Einsatz der Methode durch Fachpromotoren und Machtpromotoren 7 unterstützt wird und wenn die Planungsmethode keine subjektiven Ermessensspielräume reduziert (Scholz, 994, S. 4; RKW, 996, S. 7).... Strategische Personalbedarfsplanung Die strategische Personalbedarfsplanung steht am Anfang des Planungsprozesses. Sie ist Bindeglied zwischen der Produkt- und Marktstrategie und der Organisationsstrukturstrategie (Scholz, 000, S. 5, 60; Kossbiel, 99, S. 603 f.; Nolte, 006, S. 5 6; Edwards, 983, S. 03 f.). Ihre Aufgabe besteht in der Ermittlung des zur Erfüllung der Unternehmensaufgabe erforderlichen Soll-Personalbedarfs (Mag, 004, S. 60; Khoong, 996, S. 6 7), der entweder als eine Gesamtzahl oder als Zahlentupel 8 ausgedrückt werden kann (Kossbiel, 99, S. 596). Der Personalbedarf gibt an, wie viele Mitarbeiter (quantitative Dimension), mit welcher Qualifikation (qualitative Dimension), zu welcher Zeit (temporale Dimension), an welcher Stelle des Unternehmens (lokale Dimension) erforderlich sind (Scholz, 000, S. 5; Kossbiel, 99, S. 597; El Agizy, 97, S. 3; Mag, 004, 604 f.). Bei der Auswahl der Bedarfsplanungsinstrumente spielt unter anderem die Dynamik der Umwelt eine Rolle. So werden in einer eher statischen Umwelt arbeitswissenschaftliche sowie mathematische Verfahren wie Trendverfahren, Korrelation/ Regression und Modellbildung/ Simulationen eingesetzt; in einer dynamischen Umwelt finden vor allem intuitive Verfahren wie Schätzungen, Funktionendiagramme, Netzplantechnik und die Stellenplan-/ Arbeitsplatzmethode Anwendung (ausführlich dazu Oechsler, 006, S. 66). 7 8 Das Promotorenmodell wurde primär entwickelt, um Innovationsprozesse zu erklären und zu gestalten (Witte, 999, S. ). Die Aufgabe des Fachpromotors innerhalb eines Innovationsprozesses ist es, mit objektspezifischem Fachwissen sachliche Problemlösungen zu erarbeiten und den Machtpromotor, d. h. eine hochrangige Führungsperson, bei der Durchsetzung des Innovationsprozesses und Überzeugungsarbeit zu unterstützen (Pietsch, 003, S. 75). Das Ursprungs-Promotorenmodell aus den frühen 970er Jahren wurde im Laufe der Zeit insbesondere durch Hauschildt und Chakrabarti weiterentwickelt, die den Prozess- Promotor neu in das Modell aufgenommen haben (Wieseke, 004, S. 48). Verschiedene Teilpersonalbedarfe können sich aus der Differenzierung nach der Qualifikation des Personals bzw. nach der organisatorischen Einbettung ergeben. 5
41 Personalbedarf ist differenzierbar in den Ersatzbedarf, den Erweiterungsbedarf sowie den Reservebedarf (Nicolai, 007, S. 508 f.). Der Erweiterungsbedarf ergibt sich ausschließlich aus der Unternehmensplanung. Soll beispielsweise eine bestimmte Abteilung personell ausgebaut bzw. neu aufgebaut werden, entsteht entsprechend der zeitlichen, räumlichen, qualitativen und quantitativen Vorgaben zusätzlicher Bedarf an Mitarbeitern. Ersatzbedarf, der sich auf die aktuellen und voraussichtlichen Mitarbeiterabgänge bezieht, und Reservebedarf, mit dem personelle Fehlzeiten kompensiert werden sollen, (Nicolai, 007, S. 508 f.) sind sowohl von der Unternehmensstrategie als auch von der Dynamik des Insystems abhängig. Feststehende Personalab- und -zugänge bestimmen beispielsweise den Ersatzbedarf, wenngleich strategisch bedingt nicht jede Kündigung, Pensionierung etc. einen solchen Bedarf auslöst (Weinmann, 978, S. 73; Oechsler, 006, S. 65; Bell, 974, S. 43). Die Bedarfsplanung und die Bestandsplanung sind demnach nicht trennscharf voneinander abzugrenzen (Scholz, 000, S. 39). Die Abbildung -7 stellt deshalb die Zusammenhänge zwischen den Arten des Personalbedarfs und die Veränderungsgrößen vereinfacht und nur auf die Quantität bezogen dar. + - Anzahl der Mitarbeiter Bestand t 0 voraussichtliche / feststehende Abgänge feststehende Zugänge Bewegung t 0 -t Variante : Bestand t bei übererfüllter Bedarfsdeckung Variante : Bestand t bei erfüllter Bedarfsdeckung Variante 3: Bestand t bei nicht erfüllter Bedarfsdeckung Soll-Personalbestand davon: Reservebedarf Erweiterungsbedarf Ersatzbedarf - Personelle Unterdeckung + Personelle Überdeckung Ist-Personalbestand Bewegungsgrößen t 0 Stichtag der Periode t 0 -t Zeitraum zwischen t 0 & t t Stichtag der Folgeperiode Abbildung -7: Differenzierung und Zusammenhänge der Personalbedarfsarten Quelle: Eigene Darstellung i. A. an Nüssgens, 975, S. 03; Wimmer & Neuberger, 998, S. 99; Oechsler, 006, S. 65. Ausgehend von einem fiktiven Personalbestand zum Zeitpunkt t 0 verlangen die unternehmensstrategisch vorgegebene Sollgröße sowie diverse Personalbewegungen im Verlauf der Folgeperiode (t 0 -t ) korrektive Handlungen zur Deckung der verschiedenen Personalbedarfe zum Zeitpunkt t. Bereits hier wird deutlich, dass die Bewegungsgrößen, d. h. die Fluktuation bzw. Schwankung (Baillod, 99, S. ), den ent- 6
42 scheidenden Einfluss auf den Bestand der Folgeperiode haben. Da überhastete Personalbeschaffungen und Umsetzungen von Personalentwicklungsmaßnahmen ebenso wie dringende Personalfreisetzung aufgrund von Personalüberhängen sehr kostenintensiv sind (Scholz, 000, S. 5), gilt es, dies durch gute Planung zu vermeiden. Möglich ist dies einerseits durch eine gute Unternehmensstrategie, andererseits durch eine solide Personalbestandsplanung, deren Grundlage der oft unzureichend verwendete, aber vorhandene Datenbestand jeder Organisation ist.... Strategische Personalbestandsplanung Die Personalbestandsplanung ist die Feststellung des Status quo der Kenntnisse und der demografischen Charakteristika zu einem bestimmten Planungszeitpunkt und eine darüber hinaus gehende Prognose der künftigen Entwicklung dieser Struktur [...] (Nolte, 006, S. 5 6). Das heißt: Während bei der Personalbedarfsplanung vom Soll gesprochen wird, gilt es bei der Personalbestandsplanung, das Ist und das Wird zu analysieren. Letzteres scheint besondere Schwierigkeiten zu verursachen, denn für eine Prognose spielt die aus den Veränderungen über die Zeit (Bell, 974, S. 43) sowie aus den Verzögerungen resultierende interne Dynamik der Personalstruktur die wesentliche Rolle (vgl. dazu Khoong, 996, S. 6 f.). Basis für die strategische Bestandsplanung ist die Analyse des Ist-Bestandes. Darunter wird die zahlenmäßige Verteilung der Gesamtbelegschaft nach mindestens einem Kriterium verstanden (Scholz, 000, S. 337). Nützliche Kriterien sind z. B. das Alter der Organisationsmitglieder, der Dienstrang und die Qualifikation (Holtbrügge, 005, S. 73; Scholz, 000, S. 337; Huber, 974, S. 3). Die Personalbestandsanalyse hat nicht nur eine entscheidungsvorbereitende Funktion für die Personalveränderungsplanung. Eine nach mehreren Merkmalen differenzierte Auflistung des Personalbestands bildet darüber hinaus die Basis für die Berechnung diverser Personalkennzahlen (Martina & Hartung, 005, S. 5; Schulte, 990, S. 8 ff.), die in bestimmten Berichterstattungen Verwendung finden können (Scholz, 000, S. 330; Nagels & Da- Cruz, 007, S. 63). Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist diese Bestandsanalyse unter dem Begriff der Altersstrukturanalyse (Gesellschaft für Arbeitsschutz- und Humanisierungsforschung mbh Volkholz und Partner, 006, S. 9) auch im nicht wissenschaftlichen Sprachgebrauch populär geworden. Inzwischen gibt es viele verschiedene 7
43 Anbieter, die sich der Programmierung von Altersstrukturanalyse-Werkzeugen verschrieben haben. 9 Für die Bestimmung des zukünftigen Bestandes (Wird) sind allerdings nicht nur Bestandsdaten erforderlich, sondern viel wesentlicher die Bewegungsdaten über einen möglichst langen Vergangenheitszeitraum hinweg. Erst mit diesen Bewegungsdaten können die zukünftigen Veränderungen abgeschätzt bzw. prognostiziert werden. So betonte Edwards bereits 983: It should be stressed that if data on leavers are not currently available, there is no alternative but to wait until some collecting has been done; manpower planning models without leavers data are of little value, and borrowing wastage figures from elsewhere is extremely inadvisable (Edwards, 983, S. 036). Bewegung, synonym auch Fluktuation, ist ein universeller Prozess in sozialen Systemen, der in der betriebswirtschaftlichen Forschung sowohl zwischen- als auch innerbetriebliche Schwankung, d. h. entweder Zunahme oder Abnahme des Personalbestandes, meint (Weller, 007, S. 7 8). Personalbewegungen sind jene Vorgänge, die als intervenierende Variablen in die personalpolitische Zweck-Mittel-Relation eingreifen (Dincher, 99, S. 873). Die in der Abbildung -7 benannten Personalzugänge und Personalabgänge können nach Gründen weiter untergliedert werden. Personalzugänge sind unterteilbar in Neueintritte/ Neueinstellungen, Wiedereintritte und Betriebswechsel, d. h. Zugänge aus getrennt verwalteten Betriebseinheiten. Personalabgänge umfassen die durch das Unternehmen veranlassten Abgänge/ Entlassungen, die individuumsinitiierten Abgänge aus privaten Gründen und die unvermeidbare Fluktuation. Letztere ist definiert durch natürliche, d. h. weder betrieblich noch individuell verursachte Bewegungen wie Renteneintritt, Tod bzw. Krankheit (Dincher, 99, S. 874) sowie den Ausstieg aus dem Unternehmen aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages. Die Integration der innerbetrieblichen Stellenwechsel zum Fluktuationsbegriff ist nicht unumstritten, da es sich um differenziert zu bewertende und zu behandelnde Phänomene handelt (Dincher, 99, S. 874). Da diese intraorganisationalen Bewegungen vor allem auf taktischer und operativer Ebene der Personalbestandsplanung entscheidend sind (Scholz, 000, S. 360, 363) und diese für das Projektunternehmen keine Relevanz haben, beschränken sich die weiteren Ausführen auf die interorganisationalen Personalzu- und -abgänge. 9 Detaillierte Ausführungen dazu im Abschnitt
44 Personalbewegungen Neueintritt Aufstieg Wiedereintritt Personalzugänge Personalabgänge Innerbetriebliche Stellenwechsel Umsteigen Betriebswechsel Abstieg Pensionierung Entlassung Organisationsinitiierte Fluktuation Individuumsinitiierte Fluktuation Unvermeidbare Fluktuation Tod/ Krankheit Fristablauf Selbständigkeit Firmenwechsel Aussetzen Abbildung -8: Personalbewegungen Quelle: Eigene Darstellung i. A. an Baillod, 99, S. 0. Grauschattierungen zeigen die Bewegungen, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. Festzuhalten ist, dass eine Personalbestandsplanung nicht nur auf einer Bestandsanalyse, sondern auf einer Bestands- und Bewegungsgrößen-Analyse beruht (Maasch, 996, S. 34; Bell, 974, S ; Edwards, 983, S. 036). Selbst wenn insbesondere die unvermeidbaren Personalbewegungen die Unsicherheit der Planung erhöhen (Weinmann, 978, S ), ist es wichtiger die Fluktuation so weit wie möglich zu integrieren, als auf sie zu verzichten und damit statisch zu planen. Denn Personalbewegungsdaten, getrennt nach Mitarbeitergruppen bestimmter Organisationseinheiten und nach Fluktuationsarten, sind entscheidende Informationen für Bestandsentwicklungsberechnungen und die Entwicklung von Simulationsmodellen zur Bestandsplanung (Maasch, 996, S. 4). Zudem ergeben sich aus Auswertung der Fluktuation wertvolle Hinweise für die Personalbindungsstrategien, denn letztlich sind die direkten und indirekten Kosten der Fluktuation, wie z. B. Rekrutierungs-, und Einarbeitungskosten, Kosten durch potenzielle Leistungsabnahme nach Kündigung, Kosten durch das Auslösen weiterer Kündigungen, betriebswirtschaftlich nicht zu unterschätzen (Baillod, 99, S. 5 8; Nieder, 004, S. 759). Je detaillierter und gruppenspezifischer die Personaldaten ausgewertet werden sollen, desto mehr sind spezifische Lösungstechniken erforderlich (Scholz, 000, S. 338). Um das Wird zu bestimmen, stehen nach Scholz der strategischen Personalbestandsplanung folgende Methoden zur Verfügung (Scholz, 000, S ): einfache Simulationsstudien: Neben Personalbestand werden historische und sachlogische Beziehungen quantifiziert und in einem simplen Tabellenkalkulationsblatt (Scholz, 000, S. 340) eingepflegt. Die Einsatzbereiche sind allerdings begrenzt. 9
45 Analyse durch Markoff-Ketten: Sie erlauben das Abschätzen der zu erwartenden Entwicklung der Personalstruktur, indem Personalbewegungen der Vergangenheit analysiert werden. Daraus ergeben sich sogenannte Übergangswahrscheinlichkeiten. Allerdings sind diese Wahrscheinlichkeiten konstant, da Rückkopplungen im System nicht berücksichtigt werden. Endogene Parameteränderungen sind demnach nicht möglich. Analyse mit System-Dynamics-Modellen: systemdynamische Modelle bauen auf dem aus der Kybernetik bekannten Bestands-Fluss-Größen-Konzept auf. Ein Bestand ändert sich demnach durch diverse Zuflüsse (Personalzugänge) und Abflüsse (Personalabgänge). Diese Flüsse sind zeitabhängig (bspw. 0 Mitarbeiter pro Jahr) und verursachen dadurch die realistischen Verzögerungen. Die Zusammenhänge lassen sich mit spezifischer Software zunächst grafisch darstellen und anschließend in ein mathematisches Modell überführen. Es sind jederzeit Parameteränderungen exogener und endogener Art durchführbar. Dadurch ist es möglich, über die reine Bestandsprognose hinaus verschiedene Szenarien durch simultane Veränderung mehrerer Parameter am Modell zu evaluieren. Dieses Vorgehen kann konkrete Handlungen in der Realität konstatieren. Ein weiterer Vorteil zu den anderen methodischen Ansätzen ist, dass bei systemdynamischen Modellen nicht nur konstante, sondern auch variable Raten abgebildet werden können. Ein in der Literatur dokumentiertes Planungsmodell mit System Dynamics stammt von Weinmann (978), basierend auf Daten der BASF Ludwigshafen. Da allerdings die Nachfrage nach präzisen Personalplanungstechniken der 70er Jahre aufgrund drastischer politischer und ökonomischer Veränderungen Ende der 80er und 90er Jahre abnahm, wurden formale, quantitative Verfahren weniger und qualitative Verfahren wie die Szenarioplanung mehr und mehr nachgefragt (Wimmer & Neuberger, 998, S. 50 5). Wahrscheinlich erlebten formale Verfahren auch aufgrund der dynamischen Effekte der Bevölkerungsentwicklung eine Renaissance. Jüngere systemdynamische Modelle kommen von Maasch (996), basierend auf Daten des gesamten Personalbestands der BASF AG Ludwigshafen sowie von Schwarz (006), basierend auf Bereichsdaten der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Insbesondere bezogen auf die Methodeneffizienz und Methodeneffektivität basieren Planungen sehr häufig auf Prognosen, um unerwünschte Entwicklungen zu verhindern und die Wahrscheinlichkeit der Erreichung gewünschter Zustände zu erhöhen (Ackoff, 970, S. 4). Über die Schaffung einer höheren Planungssicherheit hinaus ist ein Personalprognosemodell ressourcenschonend, da unterschiedliche Szenarien unter Einbeziehung organisationsspezifischer Besonderheiten am Modell simuliert werden können (Günther & Berendes, 007, S. 5). Weiterhin argumentierte Walker bereits 969, dass mit Personalprognosemodellen Nachbesetzungen für regulär aussteigende Schlüssel- 30
46 personen langfristig geplant sowie strategische Rekrutierungsprogramme für Ersatzbedarfe definierbar sind und sie dadurch letztendlich die organisationale Effektivität verbessern (Walker, 969, S. 6). Kurzfristige Planungen oder Korrekturen sind nur notwendig, weil sofortiger Handlungsbedarf durch nicht erwartete Entwicklungen entstanden ist (Walker, 969, S. 54; Wächter, 974, S. 7)....3 Strategische Personalveränderungsplanung Schließlich ist die Personalveränderungsplanung der Teil der Personalplanung, mit der bestimmte Fehlentwicklungen bzw. identifizierte Diskrepanzen zwischen Bestand und Bedarf korrigiert werden sollen (Edwards, 983, S ; Bell, 974, S. 77 ff.). Als Maßnahmen zur Bedarfsdeckung (Holtbrügge, 005, S. 73) stehen dabei die Personalbeschaffung, die Personalentwicklung sowie die Personalfreisetzung zur Auswahl, die Scholz folgendermaßen systematisiert hat: qualitativer Bedarf quantitativer Bedarf Bestand < Bedarf Bestand = Bedarf Bestand > Bedarf Bestand < Bedarf Bestand = Bedarf Bestand > Bedarf Beschaffung und Beschaffung und evtl. 3 Beschaffung und evtl. Entwicklung punktuelle Entwicklung punktuelle Entwicklung 4 Entwicklung/ Beschaffung 5 6 evtl. und evtl. punktuelle evtl. punktuelle Entwicklung punktuelle Entwicklung und Freisetzung punktuelle Freisetzung 7 Entwicklung/ Beschaffung 8 punktuelle Entwicklung 9 punktuelle Entwicklung und punktuelle Freisetzung punktuelle Freisetzung Freisetzung Abbildung -9: Anlässe und Formen der Personalveränderung Quelle: i. A. an Scholz, 000, S Entsprechend dem quantitativen, d. h. zahlenmäßigen, und qualitativen, d. h. fähigkeitsbezogenen, Ist- und Sollabgleich ergeben sich verschiedene Maßnahmen. Ist der jeweilige Bestand geringer als der Bedarf sind personal- und qualifikationserhöhende Maßnahmen zu planen bzw. durchzuführen (Felder, 4). Ist der quantitative Personalbedarf nicht zu decken, können Weiterbildungen und gemachte Erfahrungen die Arbeitsproduktivität des vorhandenen Personals steigern und somit substituierend wirken (Weinmann, 978, S. 35). Umgekehrt sind personal- und dadurch qualifikationsreduzierende Handlungen nötig, wenn der Bestand größer ist als der Bedarf (Felder 3, 6-9). Aufgrund der Orientierung der strategischen Personalentwicklungsplanung an der Unternehmensstrategie (Oechsler, 006, S. 498), der Effizienzerhöhung (Bell, 974, S. 77 ff.) sowie der Motivationswirkung von Trainingsangeboten (Weber, 993, S. 08) können einzelne qualifikationserhöhende Maßnahmen aber auch sinn- 3
47 voll sein, wenn der Bestand dem Bedarf entspricht (Felder, 5) bzw. der Bestand höher ist als der Bedarf (Felder 6, 8, 9) (Scholz, 000, S. 384, 389). Beschaffungsplanung auf strategischer Ebene bewirkt eine Veränderung der Beschaffungsstrategien, d. h. beispielsweise Aufbau oder Stärkung des internen Arbeitsmarktes, Medienoptimierung bei Rekrutierung auf dem externen Arbeitsmarkt oder auch Ausbau des relevanten externen Arbeitsmarktes (Scholz, 000, S. 393, 396, 404). Bei der strategischen Entwicklungsplanung stehen zweierlei Aspekte im Fokus: Zum einen können hiermit die Arbeitnehmerinteressen befriedigt und dadurch Motivationseffekte erzielt werden (Scholz, 000, S. 407). Zum anderen kann strategische, an Unternehmenszielen ausgerichtete Personalentwicklung und -ausbildung wertschöpfendes Arbeitskräftepotenzial hervorbringen und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sichern (Scholz, 000, S. 407). Weiterbildung stellt eine Investition in das Humankapital des Unternehmens dar, die sich mittelfristig auf den Unternehmenserfolg auswirkt (Barney, 99; Nolte, 006, S. 0). Der Mensch als Träger organisationalen Wissens wird somit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor (Prezewowsky, 007a, S. 33; Probst, Gibbert & Raub, 004, S. 039 f.; Morosini, 004, S. 5 5). Problematisch ist allerdings die mangelnde Quantifizierbarkeit der Entwicklungsmaßnahmen sowie der Erfahrungen und Fähigkeiten eines Mitarbeiters (Scholz, 000, S. 4; Weiß, 998, S. 9). Dies erschwert vor allem auch die Bewertung dieses Potenzials im Rahmen der Humankapitalberechnung (Kröll, 003, S. 359). Ein Grund dafür liegt darin, dass es in der Literatur keine Analysekriterien gibt, um die Erfahrungen und die Fähigkeiten zu bewerten (Kröll, 003, S. 359). Darüber hinaus ist Personalentwicklung auf vielerlei, oft nicht messbare Wege möglich (Fitz-Enz, 000, S. 98, 99). Jede Betreuung durch den Vorgesetzten, selbstinitiiertes Training, formaler Lehrgang, Job Rotation (Fitz-Enz, 000, S. 98, 99), Arbeitsgespräche, Arbeitskreise, internes Seminar und die Verwendung von Wissensdatenbanken (Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), 005, S. 4) stellt eine Form von Personalentwicklung dar. Die Abbildung -0 spiegelt eine Variante der Strukturierung dieser Bildungswege wider. Während Into-the-Job-Maßnahmen ein neues Organisationsmitglied zur Tätigkeitsausübung erst befähigen sollen, werden On-the-Job-Maßnahmen eingesetzt, um mit Hilfe der Gestaltung der Arbeitsumgebung und der Personalbeziehungen am Arbeitsplatz neue Qualifikationen aus der Tätigkeit heraus zu generieren (Klimecki & Gmür, 005, S. 08 f.). Near-the-Job-Maßnahmen sowie Off-the-Job-Konzepte finden in Distanz zum gewohnten Arbeitsplatz statt: bei ersteren wird die zu entwickelnde Person vorübergehend aus dem Tagesgeschäft ausgegliedert, um Wissenszuwachs z. B. durch organisierten Erfahrungsaustausch zu erreichen; Off-the-Job meint hingegen unternehmensextern stattfindende Personalentwicklung von Fachseminaren, über Freistellungen für ein Studium, bis hin zu Teambildungsprogrammen (ebenda, S. 3-3
48 5). Eine trennscharfe Abgrenzung zwischen Lernen außerhalb des Arbeitsprozesses, arbeitsintegriertem Lernen und Arbeiten mit Lerneffekten ist in der Praxis allerdings kaum möglich (Weiß, 998, S. 9). Als Konsequenz aus dieser Vielfalt formulierte Fitz-Enz: The irony of development programs is that nine times out of ten, their payback is virtually unknown (Fitz-Enz, 000, S. 99). Konzepte der Personalentwicklung into-the-job on-the-job near-the-job off-the-job Berufsausbildung Juniorfirma Einarbeitung Trainee-Programm Lernpartnerschaft Qualifikationsfördernde Arbeitsgestaltung Lernstatt Entwicklungsarbeitsplatz Quality Circle on-the-job (i.e.s.) Konferenz Fachseminar Studium an Fach-/ Hochschule Erlebnispädagogik Mentoring Coaching Mitarbeitergespräch Job enlargement Job enrichment Job rotation Gelenkte Erfahrungsvermittlung Stellvertretung Projektarbeit Abbildung -0: Konzepte der Personalentwicklung Quelle: i. A. an Klimecki & Gmür, 998b, S. ; Klimecki & Gmür, 005, S Insofern wird der dringende Bedarf nach Messung und Optimierung des Wertes des Personals im Rahmen des Humankapitalmanagements diskutiert (Scholz, Stein & Bechtel, 006, S. 5, 9; Scholz, 000, S. 336). Die zunehmende Wertschöpfungsorientierung 0 führt jedoch dazu, dass die strategischen Personalaktivitäten wertmäßig beurteilt werden müssen (Scholz, 000, S. 336; Oechsler, 006, S. 8). So schreibt 35 HGB vor, dass nicht nur finanzielle sondern auch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, wie Informationen über Arbeitnehmerbelange, im Konzernlagebericht darzustellen sind, sofern sie zum Verständnis des Geschäftsverlaufs oder der Lage beitragen (Handelsgesetzbuch, 35). Auch das Deutsche Rechnungslegungs-Standards- Committee (005) empfiehlt im DRS, Informationen über das intellektuelle Kapital und damit auch über das Humankapital in den Konzernlagebericht aufzunehmen (Holtbrügge, 007, S. 6). Da der Wert des Humankapitals von den Weiterbildungsaktivitäten und der Personalstruktur abhängt, bietet sich eine zusammenhängende Analyse in dieser Arbeit an. Aus 0 Wertschöpfung ist die Differenz zwischen den vom Unternehmen an die externen Kunden abgegebenen Leistungen und den von den Lieferanten übernommenen Leistungen oder anders ausgedrückt: Wertschöpfung ist die Eigenleistung einer Organisation (Oechsler, 006, S. 6). 33
49 diesem Grund folgen ausführliche Erläuterungen zum Humankapitalmanagement im dritten Kapitel..3 Umgang mit Entwicklungstreibern des Personalmanagements.3. Allgemeine Entwicklungstreiber Die Aufgaben des Personalmanagements ergeben sich nicht nur aus den Veränderungen des Insystems, im Sinne der Stabilisierung der Personalstruktur aufgrund ablaufoder aufbauorganisatorischer Veränderungen, Fluktuation, Fehlzeiten, etc. (Klimecki & Gmür, 005, S. 40; Scholz, 000, S. 5; Fitz-Enz, 000, S. 96, 97), sondern auch aus den Veränderungen des Umsystems, d. h. von der Unternehmensstrategie sowie der Umwelt (Holtbrügge, 005, S. 75 f.). In den vorherigen Abschnitten wurde der Einfluss der Unternehmensstrategie auf das Personalmanagement und insbesondere die Personalbedarfsplanung mehrfach angesprochen. Im Detail werden hierzu finanzwirtschaftliche, technologiewirtschaftliche und leistungswirtschaftliche Ergebnisse herangezogen, deren Übereinstimmungsgrad mit dem gewünschten Zustand die unternehmensstrategischen und damit personalstrategischen Korrekturen festlegen (vgl. Abbildung -5). Während zu den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen bspw. die Rentabilität, die Liquidität, die Kapitalbindung oder das Investitionsvolumen gehören, kennzeichnen technologiewirtschaftliche Daten z. B. die Komplexität der Arbeitsmittel, der Automatisierungsgrad und der Produktivitätsfaktor (Klimecki & Gmür, 005, S. 40). Im Rahmen leistungswirtschaftlicher Entscheidungen wird die qualitative oder quantitative Veränderung von Wertschöpfungsprozessen im Sinne der Unternehmensexpansion oder -verschlankung bestimmt (ebenda). Alle diese Daten, einschließlich der unternehmerischen Lebenszyklusphase (Holtbrügge, 007, S. 76, 77) geben den Entscheidungsträgern auf höchster Ebene Aufschluss darüber, inwiefern Personal beschafft, entwickelt bzw. eingesetzt werden muss (Klimecki & Gmür, 005, S. 40). Wirtschaft insbes. Globalisierung, Technologieentwicklung, Arbeitsmarkt 3 Gesellschaft Kultur, Wertwandel Einfluss auf das strategische HRM, insbes. Personalplanung Politik Gesetze, Interessensvertretungen 4 Wissenschaft Theorien, Methoden Abbildung -: Entwicklungstreiber des Personalmanagements Quelle: Eigene Darstellung. 34
50 Darüber hinaus existieren, wie die Abbildung - zeigt, wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und nicht zuletzt wissenschaftliche Treiber, die die Handlungsoptionen des Personalmanagements beeinflussen. Diese sollen im Folgenden kurz erläutert werden; die Reihenfolge der Abhandlung spiegelt die Bedeutung für Unternehmen wider (Wunderer & Dick, 007, S. 7 46; mit dem Wichtigsten beginnend)..3.. Wirtschaftliche Treiber Durch eine Unternehmensbefragung in ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen des Cranfield Projekts Anfang der 990er Jahre konnte belegt werden, dass Personalmanagement und die Personalplanung von den allgemeinen ökonomischen und strukturellen Veränderungen beeinflusst sind (Klimecki & Gmür, 005, S. 47). In diesem Kontext spielen die Globalisierung, die Technologieentwicklung sowie die Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt für die wirtschaftlichen Bedingungen eine bedeutende Rolle (Oechsler, 006, S. 98). Globalisierung meint dabei internationales Marktengagement und internationale Verflechtung von Wirtschaftssubjekten, welche sich als Aktivitäten in Form von Export, Lizenzverträgen, Joint Ventures oder Gründung ausländischer Tochtergesellschaften äußern können (ebenda, S ). Die Wettbewerbsbedingungen werden sich dadurch zukünftig massiv verändern: der Wettbewerb wird aggressiver, zunehmend globale Aktionen führen zu wechselnden Konkurrenten und Arenen, die Wettbewerbsregeln werden immer weniger bekannt sein und die Aktivitäten richten sich neben Produkten, Dienstleistungen und Innovationen verstärkt auf Markt- und Branchenerweiterungen (Zahn, 997, S. 3). Aufgrund des Wettbewerbs werden auch die Technologieentwicklungen immer rasanter, die Produktlebenszyklen dagegen immer kürzer (Oechsler, 006, S. 00). Die Unternehmen geraten durch die zunehmende Wettbewerbsdynamik immer mehr unter Zeitdruck und Bedrängnis, denn die durch die Globalisierung vereinfachten Marktzugänge gefährden sicher geglaubte Besitzstände (Scholz, 000, S. ). Durch die Internationalisierung sind Wissen, Arbeit und Kapital zu mobilen Produktionsfaktoren geworden, wobei Kapital der Faktor mit der höchsten Mobilität Brewster, Hegewisch, Mayne & Tregaskis, 994, S : Das Cranfield Project wurde von Price Waterhouse und der Cranfield School of Management durchgeführt. Das Projekt war als jährliche Erhebung konzipiert, beginnend 989/990, um Trends in den ursprünglich 5 Ländern (Westdeutschland, Spanien, Frankreich, Schweden und Großbritannien) zu analysieren. Es gab zwei Untersuchungsziele: Erstens sollte der Einfluss der steigenden Europäisierung von Unternehmen auf HRM Maßnahmen, insbesondere auf die internationale Angleichung von Personalstrategien, untersucht werden. Zweitens galt es herauszufinden, inwieweit es eine Verschiebung in Richtung eines strategischen HRM gab, d. h. inwieweit Personalstrategien von der Unternehmensstrategie beeinflusst werden. In den 3 Jahren von 989/90 bis 99/9 nahmen pro Jahr durchschnittlich etwa Unternehmen teil. Die Rücklaufquote betrug im ersten Jahr %, in den Folgejahren 7%. 35
51 ist (Steger & Kummer, 00, S. 84). Die starke Verhandelbarkeit dieser Faktoren und durch internationales Benchmarking entstehende Renditeerwartungen führen schließlich zu permanentem Rationalisierungsdruck (Scholz, 000, S. ; Steger & Kummer, 00, S. 84; von Eckardstein, 004, S. 67). Die entsprechende unternehmensstrategische Antwort auf diese Entwicklungen hat auch Konsequenzen für das Personalmanagement (Klimecki & Gmür, 005, S. 47). Dazu gehören primär eine veränderte Personalbedarfsplanung in quantitativer und qualitativer Hinsicht (Morschhäuser, 000, S. 9; Fitz-Enz, 000, S. 96 f.), eine veränderte und eventuell international ausgerichtete Personalbeschaffung, eine angepasste Personalentwicklung hinsichtlich der kürzer werdenden Halbwertszeit des technologischen Wissens sowie eine entsprechende Freisetzungsplanung und eine damit einhergehende Konfrontation mit den sozialen Folgeproblemen (Scholz, 000, S. ; Oechsler, 006, S. 99; Wunderer & Dick, 00, S. 9). Die Dynamik des Marktes und die potenziellen Arbeitsmöglichkeiten für Mitarbeiter mit gefragten Qualifikationen ist im Sinne der Personal- und Know-how-Bindung ebenfalls eine Herausforderung für das Management (Hafeez et al., 004, S. ; Hodgkinson, Snell, Daley & Payne, 996, S. 84). Zudem gilt es, auch die Arbeitsbedingungen an diese Dynamik anzupassen, denn die Potenziale der Informations- und Kommunikationstechnologie führen zu zeit- und raumunabhängiger Arbeit (Picot, Reichwald & Wigand, 003, S. 455). In diesem Zusammenhang finden sich in der Literatur Begriffe wie Electronic Human Resource Management, Electronic-Business Personal oder Cyber Human Resource Management (Oechsler, 006, S. 00; Klimecki & Gmür, 005, S. 48). Neben der Globalisierung und der technologischen Entwicklung ist der Arbeitsmarkt ein weiterer Treiber der Personalarbeit (Oechsler, 006, S. 0). Er stellt gewissermaßen ständig einen latenten Engpassfaktor dar und muss deshalb in die betriebliche Personalplanung einbezogen werden (Weinmann, 978, S. 4). Gelingt es einem Unternehmen nicht rechtzeitig, strukturelle Verschiebungen im Arbeitsmarkt zu erkennen und antizipativ zu agieren, führt dies zu Problemen in späteren Planungsphasen (Scholz, 000, S. ). Während nach der politischen Wende in Deutschland der gespaltene Arbeitsmarkt problematisch war (Scholz, 000, S. ), werden die gegenwärtigen Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt für die Unternehmen immer spürbarer. Diese sind bedingt durch die fortschreitende europäische Integration (ebenda), durch die anhaltende Arbeitslosigkeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt (Oechsler, 006, S. 0) und die gleichzeitige Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung (Köchling, 000, S. 8; von Eckardstein, 004, S. 67). Insbesondere die erst seit kurzem in der Praxis wahrgenommene Gefährdung durch die demografische Entwick- 36
52 lung beeinflusst die zeitgenaue Personalbedarfsdeckung. Aufgrund der Wichtigkeit der Arbeitskräfteverfügbarkeit auf dem externen Arbeitsmarkt und der gleichzeitigen Verschlechterung dieser wird diese Problematik in einem gesonderten Abschnitt (Kapitel.3.) behandelt. Dies nicht zuletzt auch deswegen, weil in diesem Zusammenhang Altersstrukturanalysen populär geworden sind und Unterstützung bei der Problemlösung versprechen..3.. Politische Treiber Arbeitsrecht und kollektive Arbeitsbeziehungen sind anders als bei wirtschaftlichen Treibern von den Unternehmen kaum beeinflussbar (Klimecki & Gmür, 005, S. 47). Diesbezüglich gibt es nicht nur nationale, sondern auch internationale und europäische Regelungen zu beachten (Oechsler, 006, S. 40). Beispielhaft seien hier die folgenden genannt (vgl. Oechsler, 006, S. 40-5): international: Regelungen der International Labour Organization (ILO), Europäische Menschenrechtskonvention, Europäische Sozialcharta; europäisch: europäisches Arbeits- und Sozialrecht mit folgenden personalbezogenen Regelungsbereichen: Soziale Sicherheit und Ordnung, Schutz und Würde des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz, Chancengleichheit von Mann und Frau (Personalpolitik); Informationspflichten bei Betriebsschließungen und Betriebsübergängen (Personalplanung); Freizügigkeit der Arbeitnehmer, freier Zugang zur Beschäftigung und Gleichbehandlung der Arbeitnehmer, Anerkennung von Hochschulzeugnissen (Personalauswahl); Regelungen zu maximalen Arbeitszeiten und zum Mindesturlaub, Regelungen zur Zeitarbeit und zu Befristungen sowie zu Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz (Personalorganisation); Diskriminierungsverbot (Personalentgelt); Entsendung von Arbeitnehmern; Richtlinie über die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten (Personalentwicklung). Auf nationaler Ebene ist das Arbeitsrecht unterteilbar in das individuelle Arbeitsrecht und das kollektive Arbeitsrecht. Einen Überblick über die wichtigsten Rechtsquellen bietet die Abbildung -. Das Individualarbeitsrecht ist für die Gestaltung der einzelnen Vertragsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bindend und basiert auf der Annahme, dass der Arbeitnehmer der wirtschaftlich und sozial schwächere Vertragspartner ist (Klimecki & Gmür, 005, S. 40; Holtbrügge, 007, S. 66). Es besteht aus dem Arbeitsvertragsrecht sowie dem Arbeitsschutzrecht (Holtbrügge, 007, S. 64). Das kollektive Arbeitsrecht regelt die mittelbaren Beziehungen zwischen Arbeitgeber (bzw. den Arbeitgeberverbänden), Arbeitnehmer (bzw. den Gewerkschaften) und dem Staat und gliedert sich in Tarifvertragsrecht und Mitbestimmungsrecht (Klimecki & Gmür, 005, S. 4; Holtbrügge, 007, S. 64). Die entstehenden Arbeitgeber-Arbeitnehmer- 37
53 Beziehungen stellen dann den rechtlichen Handlungsrahmen für das Personalmanagement dar (Oechsler, 006, S. 40). Arbeitsrecht Individuelles Arbeitsrecht Kollektives Arbeitsrecht Arbeitsvertragsrecht Arbeitsschutzrecht Tarifvertragsrecht Mitbestimmungsrecht Arbeitnehmerüberlassungsgesetz Arbeitsschutzgesetz Arbeitszeitgesetz / Bundesurlaubsgesetz Beschäftigungsförderungsgesetz Berufsbildungsgesetz Betriebsverfassungsgesetz insbes. 75, 8-84 Bürgerliches Gesetzbuch Entgeltfortzahlungsgesetz Grundgesetz Jugendarbeitsschutzgesetz Kündigungsschutzgesetz / Mutterschutzgesetz Schwerbehindertengesetz Sozialgesetzbuch Teilzeit- und Befristungsgesetz Tarifvertragsgesetz Betriebsverfassungsgesetze (BetrVG 95, 97) Montan-Mitbestimmungsgesetz Mitbestimmungsgesetz Vertretungsgesetz für das Bundespersonal Abbildung -: Wichtige Rechtsquellen des Arbeitsrechts Quelle: Eigene Darstellung i.a. an Holtbrügge, 007, S. 64; Klimecki & Gmür, 005, S. 4 f. Das individuelle und kollektive Arbeitsrecht wird zunehmend von europäischen Normen überlagert bspw. hinsichtlich des Gebotes der Gleichbehandlung aller Bewerber und Arbeitnehmer aus EU-Ländern und hinsichtlich der Institutionalisierung europäischer Betriebsräte (Klimecki & Gmür, 005, S. 4 f.). Diese hohe Regulierungsdichte in Deutschland beschränkt die Beschaffung und Freisetzung von Personal erheblich (Klimecki & Gmür, 998b, S. 47). Dies führt beispielsweise zu den Paradoxa, dass aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes Arbeitgeber weniger Mitarbeiter einstellen, als nach der Personalbedarfsplanung sinnvoll wäre und oft auch zögern, ältere Arbeitsuchende, Schwerbehinderte und Frauen zu beschäftigen (Holtbrügge, 007, S. 66). Deshalb ist eine solide Personalplanung in europäischen Ländern aufgrund der europäischen Richtlinien, des Arbeitsrechts und des Einflusses von Gewerkschaften wahrscheinlich wichtiger als z. B. in den USA (Edwards, 983, S. 03). Ganz besonderen Einfluss auf die strategische Personalplanung, insbesondere die Ersatzbeschaffungsplanung hat die Änderung des Sozialgesetzbuches SGB II, 7a. Es handelt sich hierbei um die veränderten Vorschriften der Altersgrenze für den Renteneintritt, die am..008 in Form des Rentenversicherungs-Altersanpassungsgesetztes in Kraft getreten sind (Deutscher Bundestag, 007, no. Artikel 7 Inkrafttreten ). Danach wird ab 0 schrittweise das gesetzliche Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre angehoben, um die durch vorgezogene Renteneintritte und steigende Lebenserwartung verursachte Leistungsausweitung der gesetzlichen Rentenversicherung zu 38
54 begrenzen und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Systems nachhaltig zu stabilisieren (Bucher-Koenen & Wilke, 008, S. ; Brussig & Knuth, 006, S. 307; Oechsler, 006, S. 56). 68 Renteneintritt mit Vollendung des Lebensalters von Anhebung um jeweils Monat Anhebung um jeweils Monate G eburtsjahrgang Abbildung -3: Anhebung der Regelaltersgrenze Quelle: Deutscher Bundestag, 007. Neben einigen Ausnahmen ist die Regelaltersgrenze ausschlaggebend für zukünftige Planungen. Die Anhebung des Renteneintrittsalters sieht anfänglich eine Anpassung in monatlichen, anschließend in zweimonatlichen Schritten vor (Bucher-Koenen & Wilke, 008, S. 6; Clemens, 006, S. 63). Die Regelung bestimmt damit den gesetzlichen Renteneintrittszeitpunkt abhängig vom Geburtsjahr ab den nach 946 geborenen Jahrgängen (Bucher-Koenen & Wilke, 008, S. 6). Die Jahrgänge 964 und jünger arbeiten nach dieser Neuregelung im Normalfall bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres, wie in der Abbildung -3 dargestellt ist. Zwar gibt es für langjährig Versicherte, Schwerbehinderte und bei Erwerbsminderung vorzeitige Rentenbezugsmöglichkeiten, allerdings sind diese zum Teil mit erheblichen Einbußen verbunden (ebenda, S. 7). Bei einer strategischen Personalbedarfsplanung müssen so auch gesetzliche Regelungen zum Renteneintrittsalter beachtet werden. Über die langfristige Ersatzplanung hinaus ergeben sich personalpolitische Überlegungen zur Förderung des Wissenstransfers ( flow of knowledge, Wright, Dunford & Snell, 00, S. 75), zur Förderung der Leistungs- und Innovationsfähigkeit (Kleefeld, 008, S. 8; Schneider & Stein, 006, S. ) bzw. zur Anpassung von Entlohnungsstrukturen. Vgl. für einen detaillierten Überblick Fuchs,
55 .3..3 Gesellschaftliche Treiber Die fortschreitende Globalisierung und Migrationsbewegungen führen dazu, dass ein international tätiges und international besetztes Unternehmen verschiedene Landesspezifika beachten muss (Oechsler, 006, S. 06, 09). Einerseits müssen besondere arbeits-, steuer-, und sozialrechtliche Rahmenbedingungen beachtet werden (Oechsler, 006, S. 08), andererseits tragen die Mitarbeiter kulturelle Unterschiede in das Unternehmen und schaffen so eine gewisse Heterogenität an Werthaltungen, Einstellungen und Bedürfnissen (Scherm & Süß, 00, S. 846). Infolge der Multikulturalität finden sich in einem heterogen zusammengesetzten Unternehmen auch unterschiedliche Werte (Oechsler, 006, S. 09). Werte werden dabei definiert als relativ stabile individuelle Überzeugungen, die die Wahrnehmung, Präferenzen, Erwartungen, Einstellungen und das Verhalten einer Person beeinflussen (Weinert, 998, S. 6 f.; Stummer, 006, S. 0). Die Individuen sind demnach Träger dieser Einstellungen, die allerdings gesellschaftlich vermittelt werden (Oechsler, 006, S. 09). Auch wenn Werte eher stabil sind, gibt es Hinweise darauf, dass sich Werte durch ökonomische, technologische und sozio-politische Umwälzungen wandeln können (Stitzel, 004, S. 993; Klimecki & Gmür, 998b, S. 43). Dies geschieht entweder durch Ersatz neuer gegen alte Werte oder durch Verschiebung der Bedeutung und Intensität bestimmter Werte (Oechsler, 006, S. 09 f.). Hinsichtlich des Wertewandels die Lebens- und Arbeitswerte betreffend, lassen sich seit den 940er Jahren vier Phasen erkennen (Weinert, 998, S. 7): Die 40er bis 50er Jahre waren gekennzeichnet durch harte Arbeit, konservative Haltung, Loyalität gegenüber der Organisation. Es ging um das Bemühen, sich eine eigene Existenz aufzubauen (Opaschowski, 994, S. 9 f.). In den 60er und 70er Jahren standen die Lebensqualität, die Nonkonformität, die Suche nach Autonomie und Loyalität sich selbst gegenüber im Vordergrund. Die 70er und 80er Jahre waren geprägt vom Leistungs- und Erfolgsstreben, vom Ehrgeiz und der Loyalität der eigenen Karriere gegenüber. Seit den 90er Jahren geht es um Flexibilität, Unabhängigkeit, Arbeits- und Lebenszufriedenheit, Freizeit und Erholung (Klimecki & Gmür, 005, S. 49) sowie Individualisierung und Selbstentfaltung (Stitzel, 004, S. 994). Statt des Karrierestrebens steht die Sinnsuche im Vordergrund: es wird gearbeitet, um zu leben (Wunderer & Dick, 007, S. 7 46) und Spaß zu haben (Stitzel, 004, S. 995). Die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verwischen zunehmend und die Aktivitäten in beiden Bereichen sind durch Produktivität und Nützlichkeit gekennzeichnet (Opaschowski, 994, S. 9 f.). Allerdings zeichnet sich hinsichtlich der Arbeitseinstellungen zwischen Ost- und Westdeutschland ein Unterschied ab: Während die westdeutschen Frauen und Männer stärker auf Karriere, Selbstver- 40
56 wirklichung und Freizeit orientiert sind, fokussieren die Ostdeutschen auf Erwerbstätigkeit, Einkommen und das Vereinbaren von Familie und Arbeit (Dorbritz, Lengerer & Ruckdeschel, 005, S. 7). Diese Werterelevanz beeinflusst in hohem Maße die Ziele von Organisationen, die Kooperation von Organisationsmitgliedern und das Verhalten von Mitarbeitern (Stitzel, 004, S. 989), so dass der Personalpolitik auch in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zukommt. Daraus ergeben sich konkrete personalstrategische Zielstellungen wie z. B. das Erreichen der Zielkompatibilität zwischen Unternehmen und Mitarbeiter durch geeignete Personalauswahlkonzepte, wirksame Anreizsysteme und Förderung einer Organisationskultur (Stitzel, 004, S. 996; Scholz, 000, S. ; Holtbrügge, 007, S. 83 f.). Allerdings ist eine 00%-ige Werteharmonie aufgrund der Informationsasymmetrien 3 zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Individualisierung und der Schichtzugehörigkeit der Mitarbeiter weder umsetzbar noch ist sie für die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens gewünscht (Stitzel, 004, S. 996 f.). Wirksame Elemente, um allerdings die individuellen Werte unterstützen zu können, sind die Personalentwicklungs- und Karriereplanung sowie die Personaleinsatzplanung einschließlich der Entwicklung sinnvoller Arbeitszeitmodelle (Stitzel, 004, S. 997; Oechsler, 006, S. 0) Wissenschaftliche Treiber Wie bereits im Abschnitt..3 angedeutet, spielen für das Personalmanagement eine Reihe wissenschaftlicher Disziplinen eine wesentliche Rolle. Entsprechend vielfältig sind die Forschungsinhalte im deutschsprachigen Raum. Eine Analyse der Internetseiten von 4 personalwirtschaftlichen Institutionen durch Scholz und seine Kollegen zeigte Forschungsaktivitäten insbesondere in den Bereichen Personalentwicklung, internationales Personalmanagement, Personaleinsatz sowie Personalkostenmanagement und Anreizgestaltung (Scholz, 000, S. 47). Neue Konzepte können dabei auf zweierlei Wegen zustande kommen. Sie können entweder rein aus dem Austausch wissenschaftlicher Disziplinen und durch Übertragung bestimmter Erkenntnisse entstehen, wie beispielsweise die Theorie der Selbstorganisation (Probst, 987) und die Theorie des organisationalen Lernens (Senge, 990) 3 Informationsasymmetrien im Sinne der personalökonomischen Perspektive ergeben sich zwischen Prinzipal und Agent durch versteckte Eigenschaften (hidden characteristics), versteckte Informationen und Aktionen (hidden information/ hidden action) und versteckte Intentionen (hidden intentions). Diese Asymmetrien können mit Hilfe verschiedener Konzepte wie Signalsetzung (signalling), Auswahlverfahren (screening), Selbstselektionsmechanismen (self selection), Kontrolle (monitoring) und Interessensangleichung durch entsprechende Anreizmechanismen reduziert werden. Vgl. dazu Backes-Gellner, Lazear & Wolff, 00. 4
57 (Klimecki & Gmür, 998b, S. 48). Auf der anderen Seite stehen Wissenschaft und Praxis in einem Wechselverhältnis, in dem die Forschung Probleme aus der Praxis aufgreift und konzeptionelle Lösungsvorschläge erarbeitet und die Praxis diese nutzt und gegebenenfalls verbreitet (Klimecki & Gmür, 998b, S. 48 f.). Entsprechend orientiert sich diese Arbeit an den Entwicklungen der personalwirtschaftlichen Praxis und erarbeitet ein Personalplanungs- und Personalcontrollingmodell, um das Bedürfnis nach Bewertung des Humankapitalwertes sowie in Zeiten der Alterung und des Fachkräftemangels das Bedürfnis nach Planungssicherheit die Personalstruktur betreffend zu befriedigen. Da die unternehmensspezifische Personalstruktur mit ihren quantitativen und qualitativen Kenngrößen Basis der Wertmessung ist (Scholz, Stein & Bechtel, 006), werden diese beiden Aspekte entsprechend der im strategischen HRM geforderten ganzheitlichen Betrachtung von einander abhängig modelliert. Die Konsequenzen einer bewussten bzw. einer demografisch erzwungenen Personalstrukturveränderung werden anhand personalwirtschaftlicher Kennzahlen der Fluktuation, Fehlzeiten und dem Humanvermögenswert gemessen. Insbesondere die strategische Personalbestandsplanung verfügt hierbei über Forschungspotenzial, da bisher vor allem auf die Entwicklungsplanung fokussiert wurde (Achenbach, 003, S. 60, 69). Die Grundlagen der Modellerstellung entstammen der systemtheoretisch-kybernetischen Forschung und den Human Accounting-Ansätzen. Die systemtheoretische Herangehensweise erfüllt damit gleichzeitig die Forderung, die in der Realität existierende Komplexität in die Forschung einzubeziehen und Konzepte weniger durch praxisferne Annahmen zu beschränken (Dipboye, 007, S. 0)..3. Demografischer Trend mit Blick auf das Erwerbspersonenpotenzial Demografie beschreibt mit Zahlen und Kennziffern, wie sich die Bevölkerung eines Landes in ihrer Zahl und ihren Strukturen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Gesundheitszustand, etc.) durch demografische Verhaltensmuster (Wanderungsbewegungen, Gebären von Kindern, Sterben, Heiraten, etc.) verändert (BiB, 008a; Baade, 007, S. 5). Bevölkerungswissenschaft dagegen ist der übergeordnete Begriff und befasst sich zusätzlich mit den Wechselwirkungen zwischen der Bevölkerungsentwicklung und anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Wirtschaft, Politik oder der Umwelt (BiB, 008a). Bevölkerungswissenschaftlich ist das Ziel, die Bevölkerung in einem demografischen Gleichgewicht zu halten, bei dem die Einwohnerzahl weder einem permanenten Wachstum noch einer permanenten Schrumpfung unterliegt und sich die vorhandene Altersstruktur konstant entwickelt (Birg, 003, S. 6). 4
58 Einen Gleichgewichtszustand zu erreichen, ist kaum möglich, da die Bevölkerung von gegenläufigen Rückkopplungen abhängig ist, wie die Abbildung -4 zeigt, und wird deshalb permanent schwanken. Wie sich die Bevölkerungszahl entwickelt, ist abhängig vom aktuellen Bevölkerungsbestand, von den Bevölkerungszugängen, bestimmt durch die Fertilitätsrate und die Zuwanderungsquote, sowie von den Bevölkerungsabgängen, bestimmt durch die Mortalitätsrate und die Abwanderungsquote (Bähr, 004, S. 5). 4 Die Raten und Quoten sind dabei nicht dauerhaft konstant, sondern können sich in Abhängigkeit der Umfeldbedingungen (bspw. medizinischer Fortschritt, politische Situation, Aufnahmekapazität eines Landes) verändern. Dadurch ist die Wirkungsstärke der positiven und negativen Rückkopplungen variabel und die Bevölkerungsentwicklung, wie in allen realen Systemen, nicht linear (Sterman, 004, S. 84). Legende: Fertilitätsrate. Postiver Kreislauf Geburten. Negativer Kreislauf Kausalzusammenhang Bestand zum definierten Zeitpunkt Abwanderungsquote. Bewegungsgröße; Änderung je Zeiteinheit Systemgrenze Zuwanderungsquote Abwanderungen. Weltbevölkerung Zuwanderungen. Sterbefälle. Mortalitätsrate. Abwanderungsquote Zuwanderungen Geburten Bevölkerung Deutschlands Abwanderungen Sterbefälle Fertilitätsrate Aufnahmefähigkeit Kapazitätsgrenze Mortalitätsrate Schocks Abbildung -4: Dynamik der Bevölkerungsentwicklung Quelle: Eigene erweiterte Darstellung in Anlehnung an Sterman, 004, S. 85. Der Bevölkerungsrückgang in Deutschland vollzieht sich bereits seit einigen Jahrzehnten (Kistler, 006, S. 4) vordergründig aufgrund der seit langem nicht bestandserhaltenden Geburtenziffer. Dies führt zu einer sinkenden Anzahl potenzieller Mütter und schließlich zu einer weiteren Abnahme der Geburten. Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Die Abwechslung der Stärke der positiven 4 Während Fertilitätsrate und Mortalitätsrate auch als natürliche Bevölkerungsbewegung bezeichnet werden, können die Zu- und Abwanderungen unter dem Begriff der räumlichen Bevölkerungsbewegung zusammengefasst werden (Bähr, 004, S., 5, 47). 43
59 und negativen Rückkopplungen begründet sich in den in der Abbildung -5 visualisierten historischen Umfeldbedingungen. Die Erkenntnisse des BiB (008b, S. 4) zusammenfassend sind folgende Einflüsse wesentlich für den derzeitig wahrgenommenen demografischen Wandel: Die Tiefe der Einschnitte durch den ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise sind aufgrund der hohen Sterblichkeit in den Altersjahren kaum mehr zu erkennen. Allerdings ist der vorhandene Frauenüberschuss nicht allein auf die höhere Lebenserwartung zurückzuführen, sondern vor allem darauf, dass die Männer im Krieg gefallen bzw. frühzeitig an den Kriegsverletzungen verstorben sind (Kistler, 006, S. 4). Der Aufschwung nach der Weltwirtschaftskrise und die Familienpolitik des Dritten Reichs führten zu einer erhöhten Fertilitätsrate. Die positive Wirkungsschleife im Bevölkerungssystem gewann an Stärke mit der Konsequenz eines starken Bevölkerungswachstums. Der folgende deutliche Einschnitt im Bevölkerungsaufbau begründet sich im Ausbruch des zweiten Weltkrieges. Die stark zurückgegangene Geburtenziffer bis Kriegsende führte im langfristigen Verlauf wiederum dazu, dass 0 bis 30 Jahre später eine ganze Elterngeneration schwach besetzt war. Zunächst allerdings bekamen die nach der Weltwirtschaftskrise Geborenen nach Kriegsende verstärkt Kinder, zusätzlich motiviert durch das Wirtschaftswunder im früheren Bundesgebiet und der Aufbruchstimmung in der ehemaligen DDR. Die sogenannte Baby-Boom-Generation kam in dieser Zeit zur Welt. Abbildung -5: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland zum Quelle: BiB, 008b, S. 5 basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Der sich anschließende starke Geburtenrückgang zwischen 965 und 975 lässt sich durch die fehlende Elterngeneration, den Trend der Individualisierung, der veränderten 44
60 Rolle der Frau, vor allem aber durch die Freigabe der Antibabypille und die Liberalisierung der Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch erklären. Seitdem ist bis auf Nachholeffekte Ende der 970er und Anfang der 980er Jahre ein konstant niedriges Geburtenniveau zu verzeichnen. Der Tiefstand von 0,77 Kindern pro Frau (zusammengefasste Geburtenziffer, Statistisches Bundesamt, 006a, S. 8) wurde in den Jahren nach der politischen Wende erreicht, der die Generation der heute ca. - bis 9-Jährigen reduzierte. Seit Mitte der 990er Jahre steigt die Geburtenziffer in Deutschland wieder an. Im Jahr 007 lag diese bei durchschnittlich,37 Kindern pro Frau (Statistisches Bundesamt, o. J.). Da diese Geburtenziffer für die Bestandserhaltung zu gering ist, wird die Bevölkerung in Deutschland weiter schrumpfen. Regional betrachtet gibt es allerdings in Deutschland ein Nebeneinander von Bevölkerungsschrumpfung und -wachstum. Der Ost-West-Gegensatz in der Bevölkerungsentwicklung wird neben den Auswirkungen des niedrigen Geburtenniveaus in Ostdeutschland nach 990 und der geringeren Lebenserwartung in Ostdeutschland vor allem durch die Binnenwanderungen bestimmt (BiB, 008b, S. 33; Dienel, 005, S. 7). Während vor allem im Süden und Nordwesten Deutschlands die Bevölkerungszahl stabil bleibt oder sogar steigt, sinkt sie bis 00 fast flächenübergreifend in Ost- und Mitteldeutschland (Bucher & Schlömer, 006a, S. ). Aufgrund der Sterbeüberschüsse ist in den darauffolgenden 30 Jahren deutschlandweit mit Schrumpfung zu rechnen (ebenda). Die Abbildung -6 zeigt die kumulierte Veränderung im Bevölkerungsbestand des jeweiligen Bundeslandes im Zeitraum von 990 bis 006. Abbildung -6: Änderung des Bevölkerungsbestands nach Bundesländern Quelle: BiB, 008b, S. 3 nach Daten des Statistischen Bundesamtes. Während in den Jahren zwischen 990 und 006 die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Berlin stetig Einwohner verloren, stieg die Bevölkerungszahl in den meisten Ländern des früheren 45
61 Bundesgebiets. Faktoren, die die Abwanderungsentscheidung beeinflussen, können in Anlehnung an Dienel wie folgt zusammengefasst werden (005, S. ): Einerseits bestimmen exogene Faktoren wie Arbeitsplatzangebot, Lebensbedingungen und Image der Herkunftsregion, Grundbesitz, soziale Netzwerke oder auch Verantwortlichkeiten in regionalen Ämtern die Abwanderungsentscheidung. Anderseits wird diese von endogenen Faktoren wie Qualifikationsniveau, Grad der Berufs- bzw. Familienorientierung sowie der Ausprägung von Motivation, Unabhängigkeit und zielgerichteter Lebensplanung sowie Ortsgebundenheit/ Identität beeinflusst. Da die demografische Entwicklung kein kurzfristig entstehendes Phänomen ist, äußern sich diese vergangenen und zum Teil anhaltenden außerordentlichen Entwicklungen entsprechend negativ in den Prognosen. Im Zeitraum von 006 bis 050 wird sich nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 5 folgende Entwicklung ergeben (006a, S. 57, 58): Die Anzahl der Gesamtbevölkerung sinkt von ca. 8,4 Mio. auf etwa 68,7 Mio. Personen. Das entspricht einer Schrumpfung von 7%. Die Anzahl unter 0-Jähriger sinkt von ca. 6,5 Mio. auf 0,3 Mio. bzw.,4 Mio. Personen. Das bedeutet, dass der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe an der Gesamtbevölkerung von einem Fünftel auf ca. 5,% bzw. 5,4% sinkt. Das entspricht einer Schrumpfung von ca. 37% bzw. ca. 3%. Die Anzahl der Personen im Erwerbsalter, d. h. zwischen 0 und 65 Jahren, sinkt von ca. 50 Mio. auf ca. 35,5 Mio. bzw. 39 Mio. Menschen. Das bedeutet, dass der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe an der Gesamtbevölkerung von 60,8% auf ca. 5,7% bzw. 5,8% sinkt. Das entspricht einer Schrumpfung von ca. 30% bzw. %. Auch wenn aufgrund der Heraufsetzung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre hochgerechnet ca. Mio. Personen mehr auf dem Arbeitsplatz zur Verfügung stehen (ebenda, S. ), ist die Reduktion des Erwerbspersonenpotenzials 6 erheblich. 5 6 Die Angaben beziehen sich auf die mittlere Variante der Bevölkerungsvorausberechnung mit folgenden Annahmen: annähernd konstante zusammengefasste Geburtenziffer von ca.,4 Kindern je Frau, Anstieg der Lebenserwartung bei Männern um 7,6 Jahre auf 83,5 bei Geburt im Jahr 050 bzw. bei Frauen um 6,5 Jahre auf 88 Jahre bei Geburt im Jahr 050 sowie einem Wanderungssaldo von bzw Personen pro Jahr (Statistisches Bundesamt, 006a, S. 5, 3). Erwerbspersonen sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland (Inländerkonzept), die eine unmittelbar oder mittelbar auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben oder suchen (Selbständige, mithelfende Familienangehörige, abhängig Beschäftigte), unabhängig von der Bedeutung des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne Rücksicht auf den Umfang der von ihnen tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Erwerbspersonen setzen sich aus den Erwerbstätigen und den Erwerbslosen zusammen. (Statistisches Bundesamt, 006b, S. 75). Erwerbspersonen sind Bestandteil des Erwerbspersonenpotentials. Letzteres umfasst zusätzlich die Stille Reserve ( Entmutigte Personen, die bei ungünstiger Arbeitsmarktlage die Arbeitssuche entmutigt aufgeben, aber bei guter Arbeitsmarktlage Arbeitsplätze nachfragen, Personen in kurzfristigen Warteschleifen des Bildungs- und Ausbildungssystems oder in Maßnah- 46
62 Die Anzahl der über 65-Jährigen steigt von ca. 5,8 Mio. auf etwa,8 Mio. bzw. 3,5 Mio. Personen. Das bedeutet, dass der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe an der Gesamtbevölkerung von 9% auf ca. 33% bzw. 3% ansteigt. Das entspricht einem Zuwachs von ca. 44% bzw. 48%. In Anbetracht der Wanderungsbewegungen in den letzten Jahren innerhalb Deutschlands wird diese Entwicklung in den Neuen Bundesländern noch dramatischer ausfallen. Hochrechnungen des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung weisen eine Senkung der Bevölkerungszahl von ca. 7 Mio. in 00 auf 3, Mio. in 050 aus (Bucher & Schlömer, 006a, S. 0) 7. Als Ergebnis aller demografischen Einflussfaktoren ist festzuhalten, dass die Bevölkerung Deutschlands unter den genannten Annahmen schrumpft als auch altert. Diese demografischen Megatrends der Alterung und Schrumpfung sind auch in Bezug auf das Erwerbspersonenpotenzial zu beobachten (Prezewowsky, 007a, S. 34). Aufgrund der Betrachtung eines speziellen Bevölkerungsausschnitts (Bevölkerung zwischen 5 und 65 bzw. 67 Jahren) ist diese Entwicklung allerdings nicht im Maßstab : auf den Arbeitsmarkt übertragbar (Bucher & Schlömer, 006b, S. 63, 65). Auf Bundesebene prognostiziert das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung von 00 bis 00 eine Senkung der erwerbsfähigen Bevölkerung um 3,4% von 55,7 Mio. auf 53,8 Mio. Personen (Bucher & Schlömer, 006b, S. 65). Dieser insgesamt scheinbar nur geringe Verlust spielt sich allerdings großflächig betrachtet im ostdeutschen Raum ab. Während nämlich in den alten Bundesländern das Erwerbspersonenpotenzial sogar um 0,3% steigt (von ca. 43,7 Mio. Personen in 00 auf ca. 43,9 Mio. Personen in 00), sinkt dieses Potenzial in den neuen Ländern um 6,7% (von ca.,9 Mio. Personen in 00 auf ca. 9,9 Mio. Personen in 00) (ebenda, S. 64). Selbst in den Agglomerationsräumen der neuen Bundesländer ist dieser Trend nicht aufzuhalten. Hier wird die Zahl Erwerbsfähiger um 0% sinken, während sie in den verstädterten Räumen um 3,5% bzw. in den ländlichen Räumen um,% sinken wird (ebenda, S. 65, 67). Differenziert nach Kreisen und Regionen zeigt sich die Entwicklung weniger eindeutig hinsichtlich des Ost-West-Gefälles. Kleinflächig analysiert wird es sowohl im Westen 7 men der beruflichen Weiterbildung, Personen, die jeweils aus Arbeitsmarktgründen vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. ), Personen, die unter anderen Rahmenbedingungen erwerbsbereit sind sowie sonstige Nichterwerbspersonen. Das Erwerbspersonenpotential umfasst damit alle Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 6 und 64 Jahren (in den in dieser Arbeit verwendeten Statistiken) (Fuchs, 00, S. 79, 8). Bei der Annahmensetzung werden regionale Besonderheiten berücksichtigt. Räume, die im demografischen Geschehen eher homogen sind werden definiert und deren Eigenschaften in die Zukunft fortgeschrieben. Dadurch ergeben sich regional unterschiedliche Fertilitätsraten und Mortalitätsraten. Das Wanderungsverhalten wird durch Fortzugsraten operationalisiert. Diese werden für jeden der 440 Kreise geschätzt. Nähere Erläuterungen in BBR, 006, S
63 Deutschlands Räume mit abnehmendem Erwerbspersonenpotenzial geben als auch Wachstumsinseln im Osten (Bucher & Schlömer, 006b, S. 67). Allerdings zeigt sich aufgrund der vergangenen demografischen Verschiebungen auch eine deutliche Unterscheidung in der inneren Zusammensetzung des Erwerbspersonenpotenzials. Die Altersentwicklung ist in der Abbildung -7 entsprechend der Einteilung in zwei grobe Altersgruppen dargestellt. über 5 bis unter 45-Jährige 45 bis unter 65-Jährige % % % % % % % % Abbildung -7: Zahl der Erwerbspersonen im Zeitraum Quelle: i. A. an Bucher & Schlömer, 006b, S. 67. Grund dieser Entwicklung ist, dass die räumlichen Umverteilungen vorwiegend von der mobileren, jüngeren Gruppe getragen wurden (Bucher & Schlömer, 006b, S. 69). Bis auf wenige Ausnahmen, wie dem Großraum München und Kreise im suburbanen Raum größerer Städte 8, sinkt deutschlandweit die Zahl der Arbeitskräfte zwischen 6 und 44 Jahren in bedeutendem Maße (ebenda, S. 69). Hierfür ist die geringe Geburtenziffer in der Vergangenheit der Hauptgrund. Da in Ostdeutschland zusätzlich die Binnenwanderung von Ost nach West seit der politischen Wende nachwirkt, schrumpft der Anteil der jüngeren Gruppe hier besonders stark. Die Zahl der älteren Erwerbsfähigen wird sehr stark von der Baby-Boom-Generation geprägt. Die Wende zur Schrumpfung dieser Altersgruppe wird in den neuen Bundesländern früher, d. h. ca. zwischen 00 und 0, eintreten (ebenda, S. 69). Sobald diese geburtenstarken Jahr- 8 Diese Räume profitieren vor allem vom Zuzug junger Familien. Diese Dynamik ist weniger den Arbeitsmärkten als vielmehr den günstigeren Wohnungsmarktbedingungen geschuldet (Bucher & Schlömer, 006b, S. 69). 48
Den demografischen Wandel meistern durch Aufdecken des unsichtbaren Kapitals. Wissen bewerten, steuern und entwickeln mittels Cottbuser Formel
 Den demografischen Wandel meistern durch Aufdecken des unsichtbaren Kapitals. Wissen bewerten, steuern und entwickeln mittels Cottbuser Formel Strategische Personalplanung, Norddeutsche Landesbank, Hannover
Den demografischen Wandel meistern durch Aufdecken des unsichtbaren Kapitals. Wissen bewerten, steuern und entwickeln mittels Cottbuser Formel Strategische Personalplanung, Norddeutsche Landesbank, Hannover
Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann. Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor
 Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor Institutionenkonflikt,
Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor Thomas Armbrüster / Johannes Banzhaf / Lars Dingemann Unternehmensberatung im öffentlichen Sektor Institutionenkonflikt,
Janine Linßer. Bildung in der Praxis Offener Kinder- und Jugendarbeit
 Janine Linßer Bildung in der Praxis Offener Kinder- und Jugendarbeit VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte
Janine Linßer Bildung in der Praxis Offener Kinder- und Jugendarbeit VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte
Michael Pfeifer Bildungsbenachteiligung und das Potenzial von Schule und Unterricht
 Michael Pfeifer Bildungsbenachteiligung und das Potenzial von Schule und Unterricht Michael Pfeifer Bildungsbenachteiligung und das Potenzial von Schule und Unterricht Lesekompetenz bei sozioökonomisch
Michael Pfeifer Bildungsbenachteiligung und das Potenzial von Schule und Unterricht Michael Pfeifer Bildungsbenachteiligung und das Potenzial von Schule und Unterricht Lesekompetenz bei sozioökonomisch
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Christine Schlickum. Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa
 Christine Schlickum Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa Christine Schlickum Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa Eine quantitative Studie zum Umgang von Schülerinnen
Christine Schlickum Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa Christine Schlickum Selbst- und Fremdzuschreibungen im Kontext von Europa Eine quantitative Studie zum Umgang von Schülerinnen
Andrej Vizjak. Gewinnen gegen die Größten
 Andrej Vizjak Gewinnen gegen die Größten Andrej Vizjak Gewinnen gegen die Größten Erfolgsformeln krisengeschützter Unternehmen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Andrej Vizjak Gewinnen gegen die Größten Andrej Vizjak Gewinnen gegen die Größten Erfolgsformeln krisengeschützter Unternehmen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager
 Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Wirtschaftliche Unternehmensführung im Architektur- und Planungsbüro
 Wirtschaftliche Unternehmensführung im Architektur- und Planungsbüro Dietmar Goldammer Wirtschaftliche Unternehmensführung im Architektur- und Planungsbüro Rechtsform Personalpolitik Controlling Unternehmensplanung
Wirtschaftliche Unternehmensführung im Architektur- und Planungsbüro Dietmar Goldammer Wirtschaftliche Unternehmensführung im Architektur- und Planungsbüro Rechtsform Personalpolitik Controlling Unternehmensplanung
Otger Autrata Bringfriede Scheu. Soziale Arbeit
 Otger Autrata Bringfriede Scheu Soziale Arbeit VS RESEARCH Forschung, Innovation und Soziale Arbeit Herausgegeben von Bringfriede Scheu, Fachhochschule Kärnten Otger Autrata, Forschungsinstitut RISS/Universität
Otger Autrata Bringfriede Scheu Soziale Arbeit VS RESEARCH Forschung, Innovation und Soziale Arbeit Herausgegeben von Bringfriede Scheu, Fachhochschule Kärnten Otger Autrata, Forschungsinstitut RISS/Universität
Andrea Hausmann. Kunst- und Kulturmanagement
 Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kunst- und Kulturmanagement Herausgegeben von Andrea Hausmann Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kompaktwissen
Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kunst- und Kulturmanagement Herausgegeben von Andrea Hausmann Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Andrea Hausmann Kunst- und Kulturmanagement Kompaktwissen
Karin Sanders Andrea Kianty. Organisationstheorien
 Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Eine Einführung Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Karin Sanders Andrea Kianty Organisationstheorien Eine Einführung Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Hannes Peterreins / Doris Märtin / Maud Beetz. Fairness und Vertrauen in der Finanzberatung
 Hannes Peterreins / Doris Märtin / Maud Beetz Fairness und Vertrauen in der Finanzberatung Hannes Peterreins Doris Märtin / Maud Beetz Fairness und Vertrauen in der Finanzberatung Spielregeln für ein partnerschaftliches
Hannes Peterreins / Doris Märtin / Maud Beetz Fairness und Vertrauen in der Finanzberatung Hannes Peterreins Doris Märtin / Maud Beetz Fairness und Vertrauen in der Finanzberatung Spielregeln für ein partnerschaftliches
Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule
 Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule Schule und Gesellschaft Band 54 Herausgegeben von Franz Hamburger Marianne Horstkemper Wolfgang Melzer Klaus-Jürgen Tillmann Philipp
Philipp Bornkessel Jupp Asdonk (Hrsg.) Der Übergang Schule Hochschule Schule und Gesellschaft Band 54 Herausgegeben von Franz Hamburger Marianne Horstkemper Wolfgang Melzer Klaus-Jürgen Tillmann Philipp
Lars Binckebanck (Hrsg.) Verkaufen nach der Krise
 Lars Binckebanck (Hrsg.) Verkaufen nach der Krise Lars Binckebanck (Hrsg.) Verkaufen nach der Krise Vertriebliche Erfolgspotenziale der Zukunft nutzen Strategien und Tipps aus Forschung, Beratung und Praxis
Lars Binckebanck (Hrsg.) Verkaufen nach der Krise Lars Binckebanck (Hrsg.) Verkaufen nach der Krise Vertriebliche Erfolgspotenziale der Zukunft nutzen Strategien und Tipps aus Forschung, Beratung und Praxis
Swetlana Franken. Verhaltensorientierte Führung
 Swetlana Franken Verhaltensorientierte Führung Swetlana Franken Verhaltensorientierte Führung Handeln, Lernen und Diversity in Unternehmen 3., überarbeitete und erweiterte Auflage Bibliografische Information
Swetlana Franken Verhaltensorientierte Führung Swetlana Franken Verhaltensorientierte Führung Handeln, Lernen und Diversity in Unternehmen 3., überarbeitete und erweiterte Auflage Bibliografische Information
David Reichel. Staatsbürgerschaft und Integration
 David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration VS RESEARCH David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration Die Bedeutung der Einbürgerung für MigrantInnen VS RESEARCH Bibliografische Information der
David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration VS RESEARCH David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration Die Bedeutung der Einbürgerung für MigrantInnen VS RESEARCH Bibliografische Information der
Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis. Kompetenz in der Hochschuldidaktik
 Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis Kompetenz in der Hochschuldidaktik Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis Kompetenz in
Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis Kompetenz in der Hochschuldidaktik Nadja-Verena Paetz Firat Ceylan Janina Fiehn Silke Schworm Christian Harteis Kompetenz in
Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur
 essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
Innovative Personalmanagement- Konzepte
 Innovative Personalmanagement- Konzepte Springer Gabler Results richtet sich an Autoren, die ihre fachliche Expertise in konzentrierter Form präsentieren möchten. Externe Begutachtungsverfahren sichern
Innovative Personalmanagement- Konzepte Springer Gabler Results richtet sich an Autoren, die ihre fachliche Expertise in konzentrierter Form präsentieren möchten. Externe Begutachtungsverfahren sichern
360 -Beurteilung und Persönlichkeitstest in der Führungsbeurteilung
 360 -Beurteilung und Persönlichkeitstest in der Führungsbeurteilung Stefanie Puckett 360 -Beurteilung und Persönlichkeitstest in der Führungsbeurteilung Zur Vorhersage von Führungserfolg und -potenzial
360 -Beurteilung und Persönlichkeitstest in der Führungsbeurteilung Stefanie Puckett 360 -Beurteilung und Persönlichkeitstest in der Führungsbeurteilung Zur Vorhersage von Führungserfolg und -potenzial
Xavier Gilbert / Bettina Büchel / Rhoda Davidson. Erfolgreiche Umsetzung strategischer Initiativen
 Xavier Gilbert / Bettina Büchel / Rhoda Davidson Erfolgreiche Umsetzung strategischer Initiativen Xavier Gilbert / Bettina Büchel Rhoda Davidson Erfolgreiche Umsetzung strategischer Initiativen Sieben
Xavier Gilbert / Bettina Büchel / Rhoda Davidson Erfolgreiche Umsetzung strategischer Initiativen Xavier Gilbert / Bettina Büchel Rhoda Davidson Erfolgreiche Umsetzung strategischer Initiativen Sieben
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Cyrus Achouri. Human Resources Management
 Cyrus Achouri Human Resources Management Cyrus Achouri Human Resources Management Eine praxisbasierte Einführung GABLER Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Cyrus Achouri Human Resources Management Cyrus Achouri Human Resources Management Eine praxisbasierte Einführung GABLER Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Cyrus Achouri. Recruiting und Placement
 Cyrus Achouri Recruiting und Placement Cyrus Achouri Recruiting und Placement Methoden und Instrumente der Personalauswahl und -platzierung Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Cyrus Achouri Recruiting und Placement Cyrus Achouri Recruiting und Placement Methoden und Instrumente der Personalauswahl und -platzierung Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Coaching in der Sozialwirtschaft
 Coaching in der Sozialwirtschaft Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. Springer Results richtet sich an Autoren, die ihre fachliche Expertise in konzentrierter Form präsentieren möchten. Externe Begutachtungsverfahren
Coaching in der Sozialwirtschaft Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. Springer Results richtet sich an Autoren, die ihre fachliche Expertise in konzentrierter Form präsentieren möchten. Externe Begutachtungsverfahren
Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur
 essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
Maximilian Lackner. Talent-Management spezial
 Maximilian Lackner Talent-Management spezial Maximilian Lackner Talent-Management spezial Hochbegabte, Forscher, Künstler erfolgreich führen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Maximilian Lackner Talent-Management spezial Maximilian Lackner Talent-Management spezial Hochbegabte, Forscher, Künstler erfolgreich führen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Andrea Friedrich. Personalarbeit in Organisationen Sozialer Arbeit
 Andrea Friedrich Personalarbeit in Organisationen Sozialer Arbeit Andrea Friedrich Personalarbeit in Organisationen Sozialer Arbeit Theorie und Praxis der Professionalisierung Bibliografische Information
Andrea Friedrich Personalarbeit in Organisationen Sozialer Arbeit Andrea Friedrich Personalarbeit in Organisationen Sozialer Arbeit Theorie und Praxis der Professionalisierung Bibliografische Information
Die Reihe wendet sich an Praktiker und Wissenschaftler gleichermaßen und soll insbesondere auch Nachwuchswissenschaftlern Orientierung geben.
 BestMasters Mit BestMasters zeichnet Springer die besten Masterarbeiten aus, die an renommierten Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden sind. Die mit Höchstnote ausgezeichneten
BestMasters Mit BestMasters zeichnet Springer die besten Masterarbeiten aus, die an renommierten Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden sind. Die mit Höchstnote ausgezeichneten
Multi-Channel im stationären Einzelhandel
 essentials essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. essentials informieren
essentials essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. essentials informieren
Bernhard Schmidt. Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer
 Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bildungsverhalten. Bildungsinteressen. Bildungsmotive
Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bernhard Schmidt Weiterbildung und informelles Lernen älterer Arbeitnehmer Bildungsverhalten. Bildungsinteressen. Bildungsmotive
Thomas Schäfer. Statistik I
 Thomas Schäfer Statistik I Basiswissen Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Kriz Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Markus Bühner, Prof. Dr. Thomas Goschke, Prof. Dr. Arnold Lohaus, Prof. Dr.
Thomas Schäfer Statistik I Basiswissen Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Kriz Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Markus Bühner, Prof. Dr. Thomas Goschke, Prof. Dr. Arnold Lohaus, Prof. Dr.
Die Ausrichtung des IT-Service- Managements auf die Digitalisierung
 Die Ausrichtung des IT-Service- Managements auf die Digitalisierung Nikolaos Mitrakis Die Ausrichtung des IT-Service- Managements auf die Digitalisierung Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Frank Victor
Die Ausrichtung des IT-Service- Managements auf die Digitalisierung Nikolaos Mitrakis Die Ausrichtung des IT-Service- Managements auf die Digitalisierung Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Frank Victor
Konzeption von Kommunikation
 Konzeption von Kommunikation Klaus Merten Konzeption von Kommunikation Theorie und Praxis des strategischen Kommunikationsmanagements Klaus Merten Münster, Deutschland ISBN 978-3-658-01466-7 DOI 10.1007/978-3-658-01467-4
Konzeption von Kommunikation Klaus Merten Konzeption von Kommunikation Theorie und Praxis des strategischen Kommunikationsmanagements Klaus Merten Münster, Deutschland ISBN 978-3-658-01466-7 DOI 10.1007/978-3-658-01467-4
Christian Deindl. Finanzielle Transfers zwischen Generationen in Europa
 Christian Deindl Finanzielle Transfers zwischen Generationen in Europa Alter(n) und Gesellschaft Band 22 Herausgegeben von Gertrud M. Backes Wolfgang Clemens Christian Deindl Finanzielle Transfers zwischen
Christian Deindl Finanzielle Transfers zwischen Generationen in Europa Alter(n) und Gesellschaft Band 22 Herausgegeben von Gertrud M. Backes Wolfgang Clemens Christian Deindl Finanzielle Transfers zwischen
Tobias Kollmann Holger Schmidt. Deutschland 4.0 Wie die Digitale Transformation gelingt
 Tobias Kollmann Holger Schmidt Deutschland 4.0 Wie die Digitale Transformation gelingt Deutschland 4.0 Tobias Kollmann Holger Schmidt Deutschland 4.0 Wie die Digitale Transformation gelingt Professor Dr.
Tobias Kollmann Holger Schmidt Deutschland 4.0 Wie die Digitale Transformation gelingt Deutschland 4.0 Tobias Kollmann Holger Schmidt Deutschland 4.0 Wie die Digitale Transformation gelingt Professor Dr.
Ralf Brand. Sportpsychologie
 Ralf Brand Sportpsychologie Basiswissen Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Kriz Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Markus Bühner, Prof. Dr. Thomas Goschke, Prof. Dr. Arnold Lohaus, Prof.
Ralf Brand Sportpsychologie Basiswissen Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Kriz Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Markus Bühner, Prof. Dr. Thomas Goschke, Prof. Dr. Arnold Lohaus, Prof.
Grit Höppner. Alt und schön
 Grit Höppner Alt und schön VS RESEARCH Grit Höppner Alt und schön Geschlecht und Körperbilder im Kontext neoliberaler Gesellschaften VS RESEARCH Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Grit Höppner Alt und schön VS RESEARCH Grit Höppner Alt und schön Geschlecht und Körperbilder im Kontext neoliberaler Gesellschaften VS RESEARCH Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Rogier Crijns Nina Janich (Hrsg.) Interne Kommunikation von Unternehmen
 Rogier Crijns Nina Janich (Hrsg.) Interne Kommunikation von Unternehmen VS RESEARCH Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation Band 6 Herausgegeben von Prof. Dr. Nina Janich, Technische Universität
Rogier Crijns Nina Janich (Hrsg.) Interne Kommunikation von Unternehmen VS RESEARCH Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation Band 6 Herausgegeben von Prof. Dr. Nina Janich, Technische Universität
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Arnd-Michael Nohl. Interview und dokumentarische Methode
 Arnd-Michael Nohl Interview und dokumentarische Methode Qualitative Sozialforschung Band 16 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung
Arnd-Michael Nohl Interview und dokumentarische Methode Qualitative Sozialforschung Band 16 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung
Ines Sausele-Bayer. Personalentwicklung als pädagogische Praxis
 Ines Sausele-Bayer Personalentwicklung als pädagogische Praxis Organisation und Pädagogik Band 10 Herausgegeben von Michael Göhlich Ines Sausele-Bayer Personal - entwicklung als pädagogische Praxis Bibliografische
Ines Sausele-Bayer Personalentwicklung als pädagogische Praxis Organisation und Pädagogik Band 10 Herausgegeben von Michael Göhlich Ines Sausele-Bayer Personal - entwicklung als pädagogische Praxis Bibliografische
Felix Huth. Straßenkinder in Duala
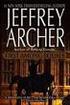 Felix Huth Straßenkinder in Duala VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte Ergebnisse aus Forschungsprojekten
Felix Huth Straßenkinder in Duala VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte Ergebnisse aus Forschungsprojekten
Markus M. Müller Roland Sturm. Wirtschaftspolitik kompakt
 Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Markus M. Müller Roland Sturm Wirtschaftspolitik kompakt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Liane Buchholz. Strategisches Controlling
 Liane Buchholz Strategisches Controlling Liane Buchholz Strategisches Controlling Grundlagen Instrumente Konzepte Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Liane Buchholz Strategisches Controlling Liane Buchholz Strategisches Controlling Grundlagen Instrumente Konzepte Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Grundlagen der doppelten Buchführung
 Grundlagen der doppelten Buchführung Michael Reichhardt Grundlagen der doppelten Buchführung Schritt für Schritt einfach erklärt 2., aktualisierte Auflage Prof. Dr. Michael Reichhardt Hochschule Karlsruhe
Grundlagen der doppelten Buchführung Michael Reichhardt Grundlagen der doppelten Buchführung Schritt für Schritt einfach erklärt 2., aktualisierte Auflage Prof. Dr. Michael Reichhardt Hochschule Karlsruhe
Claudia Steckelberg. Zwischen Ausschluss und Anerkennung
 Claudia Steckelberg Zwischen Ausschluss und Anerkennung Claudia Steckelberg Zwischen Ausschluss und Anerkennung Lebenswelten wohnungsloser Mädchen und junger Frauen Bibliografische Information der Deutschen
Claudia Steckelberg Zwischen Ausschluss und Anerkennung Claudia Steckelberg Zwischen Ausschluss und Anerkennung Lebenswelten wohnungsloser Mädchen und junger Frauen Bibliografische Information der Deutschen
Frank Hillebrandt. Praktiken des Tauschens
 Frank Hillebrandt Praktiken des Tauschens Wirtschaft + Gesellschaft Herausgegeben von Andrea Maurer und Uwe Schimank Beirat: Jens Beckert Christoph Deutschmann Susanne Lütz Richard Münch Wirtschaft und
Frank Hillebrandt Praktiken des Tauschens Wirtschaft + Gesellschaft Herausgegeben von Andrea Maurer und Uwe Schimank Beirat: Jens Beckert Christoph Deutschmann Susanne Lütz Richard Münch Wirtschaft und
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Wettbewerbsintensität im Profifußball
 Wettbewerbsintensität im Profifußball Tim Pawlowski Wettbewerbsintensität im Profifußball Eine empirische Untersuchung zur Bedeutung für die Zuschauer RESEARCH Tim Pawlowski Köln, Deutschland ISBN 978-3-658-00210-7
Wettbewerbsintensität im Profifußball Tim Pawlowski Wettbewerbsintensität im Profifußball Eine empirische Untersuchung zur Bedeutung für die Zuschauer RESEARCH Tim Pawlowski Köln, Deutschland ISBN 978-3-658-00210-7
Christoph Wiethoff. Übergangscoaching mit Jugendlichen
 Christoph Wiethoff Übergangscoaching mit Jugendlichen Christoph Wiethoff Übergangscoaching mit Jugendlichen Wirkfaktoren aus Sicht der Coachingnehmer beim Übergang von der Schule in die Ausbildung Bibliografische
Christoph Wiethoff Übergangscoaching mit Jugendlichen Christoph Wiethoff Übergangscoaching mit Jugendlichen Wirkfaktoren aus Sicht der Coachingnehmer beim Übergang von der Schule in die Ausbildung Bibliografische
Experimente in der Politikwissenschaft
 Experimente in der Politikwissenschaft Ina Kubbe Experimente in der Politikwissenschaft Eine methodische Einführung Ina Kubbe Institut für Politikwissenschaft Leuphana Universität Lüneburg Lüneburg Deutschland
Experimente in der Politikwissenschaft Ina Kubbe Experimente in der Politikwissenschaft Eine methodische Einführung Ina Kubbe Institut für Politikwissenschaft Leuphana Universität Lüneburg Lüneburg Deutschland
Iris Winkler. Aufgabenpräferenzen für den Literaturunterricht
 Iris Winkler Aufgabenpräferenzen für den Literaturunterricht VS RESEARCH Iris Winkler Aufgabenpräferenzen für den Literaturunterricht Eine Erhebung unter Deutschlehrkräften VS RESEARCH Bibliografische
Iris Winkler Aufgabenpräferenzen für den Literaturunterricht VS RESEARCH Iris Winkler Aufgabenpräferenzen für den Literaturunterricht Eine Erhebung unter Deutschlehrkräften VS RESEARCH Bibliografische
Reiner Keller. Diskursforschung
 Reiner Keller Diskursforschung Qualitative Sozialforschung Band 14 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung Praktiken Methodologien
Reiner Keller Diskursforschung Qualitative Sozialforschung Band 14 Herausgegeben von Ralf Bohnsack Uwe Flick Christian Lüders Jo Reichertz Die Reihe Qualitative Sozialforschung Praktiken Methodologien
Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung
 Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung Grundlagen, Methoden, Fallbeispiele 2., vollständig
Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung Ulrich Schacht / Matthias Fackler (Hrsg.) Praxishandbuch Unternehmensbewertung Grundlagen, Methoden, Fallbeispiele 2., vollständig
Günther Bourier. Statistik-Übungen
 Günther Bourier Statistik-Übungen Günther Bourier Statistik-Übungen Beschreibende Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung Schließende Statistik 4., aktualisierte Auflage Bibliografische Information der Deutschen
Günther Bourier Statistik-Übungen Günther Bourier Statistik-Übungen Beschreibende Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung Schließende Statistik 4., aktualisierte Auflage Bibliografische Information der Deutschen
Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft
 Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft Für Thomas Heinze Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft Perspektiven aus Theorie und
Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft Für Thomas Heinze Verena Lewinski-Reuter Stefan Lüddemann (Hrsg.) Kulturmanagement der Zukunft Perspektiven aus Theorie und
Stefan Calefice. 20 Jahre Begrüßungsgeld
 Stefan Calefice 20 Jahre Begrüßungsgeld Stefan Calefice 20 Jahre Begrüßungsgeld 100 Mark auf Zeitreise Was ist daraus geworden? Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Stefan Calefice 20 Jahre Begrüßungsgeld Stefan Calefice 20 Jahre Begrüßungsgeld 100 Mark auf Zeitreise Was ist daraus geworden? Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Der Direktvertrieb in Mehrkanalstrategien
 essentials essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. essentials informieren
essentials essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. essentials informieren
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Waltraud Martius. Fairplay Franchising
 Waltraud Martius Fairplay Franchising Waltraud Martius Fairplay Franchising Spielregeln für partnerschaftlichen Erfolg 2., erweiterte Auflage Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Waltraud Martius Fairplay Franchising Waltraud Martius Fairplay Franchising Spielregeln für partnerschaftlichen Erfolg 2., erweiterte Auflage Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Jan Skopek. Partnerwahl im Internet
 Jan Skopek Partnerwahl im Internet Jan Skopek Partnerwahl im Internet Eine quantitative Analyse von Strukturen und Prozessen der Online-Partnersuche Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Jan Skopek Partnerwahl im Internet Jan Skopek Partnerwahl im Internet Eine quantitative Analyse von Strukturen und Prozessen der Online-Partnersuche Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Sabine Maschke Ludwig Stecher. In der Schule
 Sabine Maschke Ludwig Stecher In der Schule Sabine Maschke Ludwig Stecher In der Schule Vom Leben, Leiden und Lernen in der Schule Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Sabine Maschke Ludwig Stecher In der Schule Sabine Maschke Ludwig Stecher In der Schule Vom Leben, Leiden und Lernen in der Schule Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Richard K. Streich. Fit for Leadership. Entwicklungsfelder zur Führungspersönlichkeit
 Fit for Leadership Richard K. Streich Fit for Leadership Entwicklungsfelder zur Führungspersönlichkeit Richard K. Streich Comment! Coaching und Communication Paderborn, Deutschland ISBN 978-3-658-03520-4
Fit for Leadership Richard K. Streich Fit for Leadership Entwicklungsfelder zur Führungspersönlichkeit Richard K. Streich Comment! Coaching und Communication Paderborn, Deutschland ISBN 978-3-658-03520-4
Isabel Kusche. Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System
 Isabel Kusche Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System Isabel Kusche Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System Bibliografische
Isabel Kusche Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System Isabel Kusche Politikberatung und die Herstellung von Entscheidungssicherheit im politischen System Bibliografische
Heike Bruch/Stefan Krummaker/Bernd Vogel (Hrsg.) Leadership Best Practices und Trends
 Heike Bruch/Stefan Krummaker/Bernd Vogel (Hrsg.) Leadership Best Practices und Trends Heike Bruch/Stefan Krummaker/ Bernd Vogel (Hrsg.) Leadership Best Practices und Trends Unter Mitarbeit von Dipl.-Ök.
Heike Bruch/Stefan Krummaker/Bernd Vogel (Hrsg.) Leadership Best Practices und Trends Heike Bruch/Stefan Krummaker/ Bernd Vogel (Hrsg.) Leadership Best Practices und Trends Unter Mitarbeit von Dipl.-Ök.
Video-Marketing mit YouTube
 Video-Marketing mit YouTube Christoph Seehaus Video-Marketing mit YouTube Video-Kampagnen strategisch planen und erfolgreich managen Christoph Seehaus Hamburg Deutschland ISBN 978-3-658-10256-2 DOI 10.1007/978-3-658-10257-9
Video-Marketing mit YouTube Christoph Seehaus Video-Marketing mit YouTube Video-Kampagnen strategisch planen und erfolgreich managen Christoph Seehaus Hamburg Deutschland ISBN 978-3-658-10256-2 DOI 10.1007/978-3-658-10257-9
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Oliver Kruse I Volker Wittberg (Hrsg.) Fallstudien zur Unternehmensführung
 Oliver Kruse I Volker Wittberg (Hrsg.) Fallstudien zur Unternehmensführung Oliver Kruse I Volker Wittberg (Hrsg.) Fallstudien zur Unternehmensführung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Oliver Kruse I Volker Wittberg (Hrsg.) Fallstudien zur Unternehmensführung Oliver Kruse I Volker Wittberg (Hrsg.) Fallstudien zur Unternehmensführung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Petra Hornig. Kunst im Museum und Kunst im öffentlichen Raum
 Petra Hornig Kunst im Museum und Kunst im öffentlichen Raum Petra Hornig Kunst im Museum und Kunst im öffentlichen Raum Elitär versus demokratisch? Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Petra Hornig Kunst im Museum und Kunst im öffentlichen Raum Petra Hornig Kunst im Museum und Kunst im öffentlichen Raum Elitär versus demokratisch? Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit
 Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit Shih-cheng Lien Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit Eine Analyse für West-
Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit Shih-cheng Lien Wohnstandort und räumliche Mobilität im Kontext steigender Frauenerwerbstätigkeit Eine Analyse für West-
Michael Bayer Gabriele Mordt. Einführung in das Werk Max Webers
 Michael Bayer Gabriele Mordt Einführung in das Werk Max Webers Studienskripten zur Soziologie Herausgeber: Prof. Dr. Heinz Sahner, Dr. Michael Bayer und Prof. Dr. Reinhold Sackmann begründet von Prof.
Michael Bayer Gabriele Mordt Einführung in das Werk Max Webers Studienskripten zur Soziologie Herausgeber: Prof. Dr. Heinz Sahner, Dr. Michael Bayer und Prof. Dr. Reinhold Sackmann begründet von Prof.
Zeitmanagement in der beruflichen Bildung
 Zeitmanagement in der beruflichen Bildung Stefan Dornbach Zeitmanagement in der beruflichen Bildung Jugendliche im Umgang mit zeitlichen Anforderungen der modernen Arbeitswelt Stefan Dornbach Berlin, Deutschland
Zeitmanagement in der beruflichen Bildung Stefan Dornbach Zeitmanagement in der beruflichen Bildung Jugendliche im Umgang mit zeitlichen Anforderungen der modernen Arbeitswelt Stefan Dornbach Berlin, Deutschland
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik
 Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik Familienwissenschaftliche Studien Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik
Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik Familienwissenschaftliche Studien Alexander Dilger Irene Gerlach Helmut Schneider (Hrsg.) Betriebliche Familienpolitik
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
 Erhard Cramer Udo Kamps Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik Eine Einführung für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 4. Auflage Springer-Lehrbuch
Erhard Cramer Udo Kamps Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik Eine Einführung für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 4. Auflage Springer-Lehrbuch
Robert Rieg. Planung und Budgetierung
 Robert Rieg Planung und Budgetierung Robert Rieg Planung und Budgetierung Was wirklich funktioniert Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Robert Rieg Planung und Budgetierung Robert Rieg Planung und Budgetierung Was wirklich funktioniert Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Jörg Freiling I Tobias Kollmann (Hrsg.) Entrepreneurial Marketing
 Jörg Freiling I Tobias Kollmann (Hrsg.) Entrepreneurial Marketing Jörg Freiling I Tobias Kollmann (Hrsg.) Entrepreneurial Marketing Besonderheiten, Aufgaben und Lösungsansätze für Gründungsunternehmen
Jörg Freiling I Tobias Kollmann (Hrsg.) Entrepreneurial Marketing Jörg Freiling I Tobias Kollmann (Hrsg.) Entrepreneurial Marketing Besonderheiten, Aufgaben und Lösungsansätze für Gründungsunternehmen
Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem
 Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem VS RESEARCH Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem Von der Fürsorgeschule
Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem VS RESEARCH Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem Von der Fürsorgeschule
Peter tom Suden. Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht
 Peter tom Suden Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht Peter tom Suden Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht Einführung, Signatur, Dokumentation Bibliografische Information
Peter tom Suden Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht Peter tom Suden Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht Einführung, Signatur, Dokumentation Bibliografische Information
Altans Aichinger. Resilienztörderung mit Kindern
 Altans Aichinger Resilienztörderung mit Kindern Alfans Aicrlinger Resilienzförderung mit Kindern Kinderpsychadrama Band 2 VS VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Altans Aichinger Resilienztörderung mit Kindern Alfans Aicrlinger Resilienzförderung mit Kindern Kinderpsychadrama Band 2 VS VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Instrumente des Care und Case Management Prozesses
 Instrumente des Care und Case Management Prozesses Ingrid Kollak Stefan Schmidt Instrumente des Care und Case Management Prozesses Mit 23 Abbildungen 123 Prof. Dr. Ingrid Kollak Alice Salomon Hochschule
Instrumente des Care und Case Management Prozesses Ingrid Kollak Stefan Schmidt Instrumente des Care und Case Management Prozesses Mit 23 Abbildungen 123 Prof. Dr. Ingrid Kollak Alice Salomon Hochschule
Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Kindertagesbetreuung im Wandel
 Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Kindertagesbetreuung im Wandel Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Kindertagesbetreuung im Wandel Perspektiven für die Organisationsentwicklung Bibliografische Information der Deutschen
Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Kindertagesbetreuung im Wandel Sybille Stöbe-Blossey (Hrsg.) Kindertagesbetreuung im Wandel Perspektiven für die Organisationsentwicklung Bibliografische Information der Deutschen
Henning Schluß. Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse
 Henning Schluß Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse Henning Schluß Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse Analysen zum Verhältnis von Pädagogik und Religion Bibliografische Information der
Henning Schluß Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse Henning Schluß Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse Analysen zum Verhältnis von Pädagogik und Religion Bibliografische Information der
Olaf Struck. Flexibilität und Sicherheit
 Olaf Struck Flexibilität und Sicherheit Forschung Gesellschaft Olaf Struck Flexibilität und Sicherheit Empirische Befunde, theoretische Konzepte und institutionelle Gestaltung von Beschäftigungsstabilität
Olaf Struck Flexibilität und Sicherheit Forschung Gesellschaft Olaf Struck Flexibilität und Sicherheit Empirische Befunde, theoretische Konzepte und institutionelle Gestaltung von Beschäftigungsstabilität
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Lothar Volkelt. Kompakt Edition: Geschäftsführer im Konzern
 Lothar Volkelt Kompakt Edition: Geschäftsführer im Konzern Lothar Volkelt Kompakt Edition: Geschäftsführer im Konzern Aufgaben, Geschäftsführerverträge, Rechte und Pfl ichten Bibliografische Information
Lothar Volkelt Kompakt Edition: Geschäftsführer im Konzern Lothar Volkelt Kompakt Edition: Geschäftsführer im Konzern Aufgaben, Geschäftsführerverträge, Rechte und Pfl ichten Bibliografische Information
Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur
 essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
essentials Springer Essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
Thomas Schäfer. Statistik II
 Thomas Schäfer Statistik II Basiswissen Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Kriz Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Markus Bühner, Prof. Dr. Thomas Goschke, Prof. Dr. Arnold Lohaus, Prof.
Thomas Schäfer Statistik II Basiswissen Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Jürgen Kriz Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Markus Bühner, Prof. Dr. Thomas Goschke, Prof. Dr. Arnold Lohaus, Prof.
Wibke Riekmann. Demokratie und Verein
 Wibke Riekmann Demokratie und Verein Wibke Riekmann Demokratie und Verein Potenziale demokratischer Bildung in der Jugendarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Wibke Riekmann Demokratie und Verein Wibke Riekmann Demokratie und Verein Potenziale demokratischer Bildung in der Jugendarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Friedhelm Vahsen Gudrun Mane. Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit
 Friedhelm Vahsen Gudrun Mane Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit VS RESEARCH Friedhelm Vahsen Gudrun Mane Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit VS RESEARCH Bibliografische Information
Friedhelm Vahsen Gudrun Mane Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit VS RESEARCH Friedhelm Vahsen Gudrun Mane Gesellschaftliche Umbrüche und Soziale Arbeit VS RESEARCH Bibliografische Information
Christina Schlegl. Mut zur Veränderung. Strategien der Annäherung an den Anderen
 Mut zur Veränderung Christina Schlegl Mut zur Veränderung Strategien der Annäherung an den Anderen Christina Schlegl Braunschweig, Deutschland ISBN 978-3-658-17120-9 ISBN 978-3-658-17121-6 (ebook) DOI
Mut zur Veränderung Christina Schlegl Mut zur Veränderung Strategien der Annäherung an den Anderen Christina Schlegl Braunschweig, Deutschland ISBN 978-3-658-17120-9 ISBN 978-3-658-17121-6 (ebook) DOI
Josef Maisch. Wissensmanagement am Gymnasium
 Josef Maisch Wissensmanagement am Gymnasium Forschung PädagogikFr Josef Maisch Wissensmanagement am Gymnasium Anforderungen der Wissensgesellschaft Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Josef Maisch Wissensmanagement am Gymnasium Forschung PädagogikFr Josef Maisch Wissensmanagement am Gymnasium Anforderungen der Wissensgesellschaft Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Thomas Geisen. Arbeit in der Moderne
 Thomas Geisen Arbeit in der Moderne Thomas Geisen Arbeit in der Moderne Ein dialogue imaginaire zwischen Karl Marx und Hannah Arendt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Thomas Geisen Arbeit in der Moderne Thomas Geisen Arbeit in der Moderne Ein dialogue imaginaire zwischen Karl Marx und Hannah Arendt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Dietmar Richard Graeber. Handel mit Strom aus erneuerbaren Energien
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Erfolgreiches Produktmanagement
 Erfolgreiches Produktmanagement Klaus Aumayr Erfolgreiches Produktmanagement Tool-Box für das professionelle Produktmanagement und Produktmarketing 4., aktualisierte und erweiterte Auflage Klaus Aumayr
Erfolgreiches Produktmanagement Klaus Aumayr Erfolgreiches Produktmanagement Tool-Box für das professionelle Produktmanagement und Produktmarketing 4., aktualisierte und erweiterte Auflage Klaus Aumayr
