Lokalanästhetika in der Zahnheilkunde
|
|
|
- Frieder Kerner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Diplomarbeit Lokalanästhetika in der Zahnheilkunde eingereicht von Cand. med. dent. Nikola Adamovic Geb.Dat.: zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Zahnheilkunde (Dr. med. dent.) an der Medizinischen Universität Graz ausgeführt am Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie unter der Anleitung von Univ.-Prof. Dr. Josef Donnerer und Ao. Univ.-Prof. Dr. Rufina Schuligoi Ort, Datum.. (Unterschrift)
2 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Graz, am Unterschrift i
3 ii
4 Danksagungen Ganz besonderer Dank gilt Herrn Univ.-Prof. Dr. Josef Donnerer und Frau Univ.-Prof. Dr. Rufina Schuligoi für die freundliche Unterstützung beim Erstellen dieser Diplomarbeit. Weiterhin möchte ich meinen Eltern Mladen und Zdravka sowie meiner Schwester Kristina für ihre Liebe, Geduld und Unterstützung danken. Sie haben ebenso zum Erfolg meines Studiums und dieser Diplomarbeit beigetragen. iii
5 Zusammenfassung Seit ihrer Einführung in die zahnmedizinische Praxis vor ca. 130 Jahren haben die Lokalanästhetika eine stetige Entwicklung durchgemacht. Es hat alles mit Cocain begonnen, welches relativ schnell wegen massiver Nebenwirkungen und wegen des Suchtpotentials vom Markt genommen wurde. Es wurde durch Procain ersetzt und in der Folge sind laufend neue Substanzen produziert und auf den Markt gebracht worden. In der vorliegenden Arbeit werden die neurophysiologischen Grundlagen sowie die Pharmakologie der Lokalanästhetika und Vasokonstriktoren beschrieben. Weiters werden die verschiedenen Formen der Lokalanästhesie, deren Bedeutung in der zahnmedizinischen Praxis, die verfügbaren Präparate sowie Zukunfttrends dargestellt. Zur Bearbeitung der Fragestellung wurden entsprechende Kapitel aus zahnmedizinischen und pharmakologischen Fachbüchern sowie Artikel aus zahnmedizinischen Zeitschriften herangezogen, ergänzt durch eine Literaturrecherche in PubMed und Internet. Der Einsatz der Lokalanästhetika sollte zielspezifisch und streng indiziert erfolgen. Ester- Lokalanästhetika (Procain, Tetracain) haben heutzutage keine Bedeutung mehr in der Praxis wegen ihrer beträchtlichen Nebenwirkungen und häufigen allergischen Reaktionen. Von den Amid-Lokalanästhetika zeigen die Articain-Präparate (4%ige mit 1: und 1: Adrenalin als Vasokonstriktorzusatz und 4%ige ohne Vasokonstriktor) die günstigsten Eigenschaften und werden heute am meisten in der Praxis genutzt. Weiters werden Prilocain 3% und Bupivacain 0,5% von österreichischen Experten empfohlen. Von der Art der Lokalanästhesie und vom Patienten hängt es ab, ob ein Vasokonstriktorzusatz verwendet wird oder nicht. Bei Risikopatienten und Kindern ist die Selektion des Lokalanästhetikums, des Vasokonstriktors und die Dosis besonders zu beachten. Lokalanästhesie, als örtlich reversible Schmerzausschaltung, ist eine der wichtigsten Säulen in der modernen Zahnheilkunde. Eine adäquate und schmerzfreie Behandlung von Patienten ist ohne sie kaum vorstellbar. Lokalanästhetika sind wahrscheinlich die am häufigsten applizierten pharmakologischen Wirkstoffe in der zahnärztlichen Praxis und dementsprechend sowohl für die Forschung als auch für den Zahnarzt/die Zahnärztin in der Praxis besonders interessant. iv
6 Abstract Since their first use in dental practice approximately 130 years ago, local anesthetics have undergone steady development. It all started with cocaine, however the substance was soon abandoned due to extensive side effects and due its addiction potency. Cocaine was replaced by procaine, and since then a number of new substances have been produced and introduced into the market. In the present paper the neurophysiological background, the pharmacology of local anesthetics, and the vasoconstrictor substances used are described. The different forms of application of local anesthetics, the drug preparations, their value in dental practice and future trends will be presented as well. For this purpose, adequate chapters in dental medicine and pharmacology textbooks, articles selected from dental medicine journals, as well as a search in PubMed and in the Internet were used. Local anesthetics should be used according to their indications and after a thorough anamnesis of the patient. Ester local anesthetics (procaine, tetracaine) are no longer in use due to their side effects and due to allergic reactions. Articaine preparations (4% with 1: and 1: epinephrine added as a vasoconstrictor substance, and 4% without vasoconstrictor) show a favorable efficacy/side effect profile and they are used most frequently in dental practice nowadays. Furthermore, prilocaine as a 3% solution and bupivacaine 0.5% are also recommended by Austrian experts. It depends on the type of application and on the patient, if preparations with or without a vasoconstrictor substance are used. In multimorbid patients and in children specific care has to be taken in the selection of the local anesthetic, the vasoconstrictor substance, and the maximum dose. Local anesthesia, representing reversible local pain elimination, is one of the most important tools in modern dentistry. An adequate pain management in dental surgery is hardly imaginable without them. Local anesthetics are probably the most frequently used pharmacological substances in dental practice, and this makes these compounds so interesting both for research as well as for the medical profession. v
7 Inhaltsverzeichnis Danksagungen... iii Zusammenfassung... iv Abstract... v Inhaltsverzeichnis... vi Glossar und Abkürzungen... viii Abbildungsverzeichnis... ix Tabellenverzeichnis... xii 1 Einleitung Grundlagen der Lokalanästhesie Geschichte der zahnärztlichen Lokalanästhesie Voraussetzungen für die Lokalanästhesie Neurophysiologische Grundlagen Aufbau peripherer Nerven Membranpotential und physiologische Erregungsübertragung Schmerz Schmerzarten Prinzipien der Analgesie durch Lokalanästhetika in der Zahnmedizin Material und Methoden Ergebnisse Resultate Pharmakologie der Lokalanästhetika Struktueller Aufbau und Stereoisomerie der Lokalanästhetika Chemisch-physikalische Eigenschaften von Lokalanästhetika Pharmakodynamik der Lokalanästhetika Pharmakokinetik der Lokalanästhetika Nebenwirkungen und Komplikationen der Lokalanästhetika Kontraindikationen Wechselwirkungen Pharmakologie der vasokonstriktorischen Substanzen Adrenalin (Epinephrin, Suprarenin ) vi
8 3.2.2 Noradrenalin (Nor-Epinephrin, Arterenol, Levarterenol, Nor-Exadrin ) Felypressin Ornipressin (POR 8) Weitere Zusätze in Lokalanästhetikalösungen Antioxidans Methylparaben Natriumchlorid und destilliertes Wasser Organisatorische Aspekte, Instrumentarium und Applikationsempfehlungen einer Lokalanästhesie Instrumentarium Empfehlungen zur Applikation von Lokalanästhetika Formen der Lokalanästhesie Oberflächenanästhesie Infiltrationsanästhesie Intraligamentäre Anästhesie Leitungsanästhesie Indikationen der Lokalanästhesie Lokalanästhetika bei Risikopatienten Alternativen und Zukunfttrends der Lokalanästhesie Einteilung der Lokalanästhetika Ester-Lokalanästhetika Amid-Lokalanästhetika Diskussion Literaturverzeichnis vii
9 Glossar und Abkürzungen AMSA-anterior middle superior alveolar Amp. Ampule Aq. dest. destilliertes Wasser bzw.- beziehungsweise ca. - circa C-CLAD - Computer-controlled local anesthetic delivery system CGRP - Calcitonin gene-related peptide EMLA- eutetic mixture of local anesthetics KG Körpergewicht HHL-Hypophysenhinterlappen HMV-Herzminutenvolumen ILA Intraligamentäre Anästhesie MKG-Chirurgie Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie P-ASA- palatal anterior superior alveolar PGE 2 - Prostaglandin, Prostazyklin s.- siehe sog. - sogenannt TENS transkutane elektrische Nerven Stimulation TRPV 1 transient rezeptor potential vanilloid type 1 v.a. vor allem z. B. zum Beispiel viii
10 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 Nervenquerschnitt. Quelle: Lüllmann H, Mohr K, Hein L. Nozizeptives System. In: Lüllmann H, Mohr, K, Hein L, editors. Pharmakologie und Toxikologie: Arzneimittelwirkungen verstehen - Medikamente gezielt einsetzen. Ein Lehrbuch für Studierende der Medizin, der Pharmazie und der Biowissenschaften, eine Informationsquelle für Ärzte, Apotheker und Gesundheitspolitiker ; 130 Tabellen. 17th ed. Stuttgart, New York, NY: Thieme; pp Abbildung 2 Schematische Darstellung der physiologischen Erregungsübertragung. Quelle: Malamed SF. Neurophysiology. In: Malamed SF, editor. Handbook of local anesthesia. 6th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby; pp Abbildung 3 Schematische Darstellung der Erregunsübertragung in den myelinisierten und nicht myelinisierten Nervenfasern. Quelle: Ziegler A. Die Lokalanästhetika in der Zahnmedizin. Quintessenz 2009; 60(12): Abbildung 4 Schematische Darstellung der Schmerzentstehung im afferenten nozizeptiven Neuron. Quelle: Höllt V., Allgaier C. Analgetika. In: Aktories K, Forth W, Allgaier C. Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie: Für Studenten der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Chemie und Biologie sowie für Ärzte, Tierärzte und Apotheker : mit 305 Tabellen. 10th ed. München: Elsevier, Urban & Fischer; pp Abbildung 5 A, Typische Struktur der Lokalanästhetika. B, Estertyp der Lokalanästhetika. C, Amidtyp der Lokalanästhetika. Quelle: Malamed SF. Neurophysiology. In: Malamed SF, editor. Handbook of local anesthesia. 6th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby; pp Abbildung 6 Stereoisomerie am Beispiel von S(-)-Bupivacain und R(+)-Bupivacain. Quelle: Bräu M. Lokalanästhetika: Pharmakologie und Pharmakokinetik. Quintessenz 2006; 57(9): Abbildung 7 Dissoziation der Lokalanästhetika im Gewebe. Quelle: Biel M. Lokalanästhetika. In: Aktories, K, Förstermann U, Hofmann F-B, Starke K, editors. Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 10th ed. München: Elsevier, Urban & Fischer; pp Abbildung 8 Strukturmodell des spannungsabhängigen Natriumkanals. Quelle: Biel M. Lokalanästhetika. In: Aktories, K, Förstermann U, Hofmann F-B, Starke K, editors. ix
11 Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 10th ed. München: Elsevier, Urban & Fischer; pp Abbildung 9 Adrenalin. Quelle: Adrenalin: Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch [cited 2012 Nov 17]. Available from: URL: 1?rskey=Wm343l&result=7&q=&dbq_0=adrenalin&dbf_0=psyfulltext&dbt_0=fulltext&o_0=AND&searchwithindbid_1=PSCHYKW&searchwithindbid _2=natur-online&searchwithindbid_3=sozmed-online&searchwithindbid_4=twonline&searchwithindbid_5=hunnius-online&searchwithindbid_6=pflegeonline&searchwithindbid_7=ppp-online Abbildung 10 Noradrenalin. Quelle: Noradrenalin : Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch [cited 2012 Nov 17]. Available from: URL: 3?rskey=XSXjVP&result=114&q=&dbq_0=noradrenalin&dbf_0=psyfulltext&dbt_0=fulltext&o_0=AND&searchwithindbid_1=PSCHYKW&searchwithindbid _2=natur-online&searchwithindbid_3=sozmed-online&searchwithindbid_4=twonline&searchwithindbid_5=hunnius-online&searchwithindbid_6=pflegeonline&searchwithindbid_7=ppp-online Abbildung 11 Applikationsarten der Lokalanästhesie. Quelle: Gierl F. Die Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. Quintessenz Team-Journal 2009; 39: Abbildung 12 Lokalanästhetika vom Ester-Typ. Quelle: Lokalanästhetika: Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch [cited 2012 Nov 17]. Available from: URL: 6?language Abbildung 13 Procain. Quelle: Procain : Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch [cited 2012 Nov 17]. Available from: URL: 5?language Abbildung 14 Metabolische Hydrolyse von Procain. Quellen: Malamed SF. Pharmacology of local anesthetics. In: Malamed SF, editor. Handbook of local anesthesia. 6th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby; S.25-38; and Tucker GT. Biotransformation and toxicity of local anesthetics. Acta Anaesthesiol Belg 1975; 23: Abbildung 15 Tetracain. Quelle: PharmaWiki - Tetracain [cited 2012 Oct 16]. Available from: URL: 61 x
12 Abbildung 16 Lokalanästhetika vom Amid-Typ. Quelle: Lokalanästhetika: Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch [cited 2012 Nov 17]. Available from: URL: 6?language Abbildung 17 Lidocain. Quelle: PharmaWiki - Lidocain [cited 2012 Oct 16]. Available from: URL: 65 Abbildung 18 Metabolischer Abbauweg des Lidocain. Quellen: Malamed SF. Pharmacology of local anesthetics. In: Malamed SF, editor. Handbook of local anesthesia. 6th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby; pp.25-38; and Keenaghan JB, Boyes RN. The tissue distribution, metabolism and excretion of lidocaine in rats, guinea pigs, dogs and man. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1972; 180(2): Abbildung 19 Mepivacain. Quelle: PharmaWiki - Mepivacain [cited 2012 Oct 16]. Available from: URL: 69 Abbildung 20 Bupivacain. Quelle: PharmaWiki - Bupivacain [cited 2012 Oct 16]. Available from: URL: 72 Abbildung 21 Prilocain. PharmaWiki - Prilocain; 2012 [cited 2012 Oct 16]. Available from: URL: 74 Abbildung 22 Metabolismus von Prilocain. In: Malamed SF, editor. Handbook of local anesthesia. 6th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby; pp Abbildung 23 Articain. Quelle: Articain: Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch [cited 2012 Nov 17]. Available from: URL: 1?rskey=BtLab9&result=2&q=&dbq_0=articain&dbf_0=psyfulltext&dbt_0=fulltext&o_0=AND&searchwithindbid_1=PSCHYKW&searchwithindbid _2=natur-online&searchwithindbid_3=sozmed-online&searchwithindbid_4=twonline&searchwithindbid_5=hunnius-online&searchwithindbid_6=pflegeonline&searchwithindbid_7=ppp-online xi
13 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Anatomische und Physiologische Eigenschaften von Nervenfaserklassen. Quelle: Lüllmann H, Mohr K, Hein L. Nozizeptives System. In: Lüllmann H, Mohr, K, Hein L, editors. Pharmakologie und Toxikologie: Arzneimittelwirkungen verstehen - Medikamente gezielt einsetzen ; ein Lehrbuch für Studierende der Medizin, der Pharmazie und der Biowissenschaften, eine Informationsquelle für Ärzte, Apotheker und Gesundheitspolitiker ; 130 Tabellen. 17th ed. Stuttgart, New York, NY: Thieme; pp Tabelle 2 Chemische und physikalische Eigenschaften der Lokalanästhetika. Daten aus Bräu M. Lokalanästhetika: Pharmakologie und Pharmakokinetik. Quintessenz 2006; 57(9): Tabelle 3 Klinische Einteilung und Maßnahmen zur Behandlung von Lokalanästhetikaintoxikationen. Modifiziert nach Schwenzer N, Schwenzer-Zimmerer K. Lokale Schmerzausschaltung (Lokalanästhesie). In: Schwenzer N, Ehrenfeld M, editors. Chirurgische Grundlagen. 4th ed. Stuttgart: Thieme; pp Tabelle 4 Schweregrad-Einteilung und Behandlung anaphylaktoider Reaktionen. Modifiziert nach Kröll W, Schroll K. Lokalanästhesie. In: Schroll K, Watzek G, editors. Zahnärztliche Chirurgie. Band 1. Wien: Verlag Wilhelm Maudrich; pp Tabelle 5 Häufig eingesetzte Leitungsanästhesien in der Zahnmedizin, Versorgungsgebiete einzelner Nerven und zugehörige Injektionsorte. Modifiziert nach Daubländer M, Kämmerer P. Aktueller Stand der zahnärztlichen Lokalanästhesie. Quintessenz 2010; 61(8): Tabelle 6 Auswahl gebräuchlicher lokalanästhetischer Tetracain-Präparate in Österreich. Modifiziert nach Austria-Codex Schnellhilfe 2012/2013: Schnellinformation, Wirkstoffverzeichnis, Indikationsverzeichnis, Firmenverzeichnis, Gesetze. 67th ed.: Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft; xii
14 Tabelle 7 Auswahl gebräuchlicher lokalanästhetischer Lidocain-Präparate in Österreich. Modifiziert nach Austria-Codex Schnellhilfe 2012/2013: Schnellinformation, Wirkstoffverzeichnis, Indikationsverzeichnis, Firmenverzeichnis, Gesetze. 67th ed.: Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft; Tabelle 8 Auswahl gebräuchlicher lokalanästhetischer Mepivacain-Präparate in Österreich.. Modifiziert nach Austria-Codex Schnellhilfe 2012/2013: Schnellinformation, Wirkstoffverzeichnis, Indikationsverzeichnis, Firmenverzeichnis, Gesetze. 67th ed.: Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft; Tabelle 9 Auswahl gebräuchlicher lokalanästhetischer Bupivacain-Präparate in Österreich. Modifiziert nach Austria-Codex Schnellhilfe 2012/2013: Schnellinformation, Wirkstoffverzeichnis, Indikationsverzeichnis, Firmenverzeichnis, Gesetze. 67th ed.: Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft; Tabelle 10 Auswahl gebräuchlicher lokalanästhetischer Prilocain-Präparate in Österreich. Modifiziert nach Austria-Codex Schnellhilfe 2012/2013: Schnellinformation, Wirkstoffverzeichnis, Indikationsverzeichnis, Firmenverzeichnis, Gesetze. 67th ed.: Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft; Tabelle 11 Auswahl gebräuchlicher Articain-Präparate in Österreich. Modifiziert nach Austria-Codex Schnellhilfe 2012/2013: Schnellinformation, Wirkstoffverzeichnis, Indikationsverzeichnis, Firmenverzeichnis, Gesetze. 67th ed.: Österreichische Apotheker- Verlagsgesellschaft; xiii
15 1 Einleitung 1.1 Grundlagen der Lokalanästhesie Lokalanästhesie oder örtliche Betäubung wird als Empfindungsverlust in einem umschriebenen Bereich des Körpers definiert, welche durch eine Erregungsdepression in Nervenenden oder durch eine Hemmung der Erregungsleitung in peripheren Nerven verursacht wird (1, 2). Lokale Schmerzbehandlung ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Aspekte der Patientenversorgung in der Zahnmedizin. Optimierung der Mitteln und Techniken zur Lokalanästhesie sind wahrscheinlich die wichtigsten Fortschritte, die in der zahnmedizinischen Wissenschaft aufgetreten sind (3). Das Applizieren von Lokalanästhetika stellt das häufigste pharmakologisch relevante Verfahren in der zahnärztlichen Praxis dar, weil sehr viele invasive Verfahren in der Praxis unter lokaler Schmerzeliminierung erfolgen. Schliephake und Strauß (4) definieren Lokalanästhesie als die iatrogen induzierte reversible, lokale Ausschaltung der Funktion sensibler Neurone (4). Fakler und Hein (5) berichten, dass es bei der Lokalanästhesie zu einer reversiblen, zeitlich und örtlich begrenzten Beeinträchtigung der Leitfähigkeit eines Nervs ohne morphologische Veränderungen kommt (5). Ein wichtiges Merkmal der Lokalanästhesie ist das Hervorrufen eines Empfindungsverlustes ohne Induzieren einer Bewusstlosigkeit. In diesem wichtigen Bereich unterscheidet sich Lokalanästhesie drastisch von der Allgemeinanästhesie (1) Geschichte der zahnärztlichen Lokalanästhesie Eine schmerzlose Durchführung zahnärztlicher Tätigkeit war nicht immer möglich. Die ersten Beiträge für die Lösung dieser Problematik und adäquate Anästhesie sind naturgemäß von Zahnärzten präsentiert worden (6). Die Entdeckung einer Gruppe von Chemikalien im 19. Jahrhundert, mit der Fähigkeit den Schmerz ohne Verlust von Bewusstseins zu hemmen, war einer der kardinalen Schritte in der Weiterentwicklung der medizinischen und zahnmedizinischen Berufe (1). Die ersten Versuche in der Schmerzeliminierung haben am Anfang gute Ergebnisse gebracht. 14
16 Im Jahr 1844 hat H. Wells einen Molaren in Lachgasanalgesie entfernt. Diese Methode war jedoch nicht erfolgreich. Im Jahr 1846 haben Morton und Jackson eine schmerzfreie Zahnentfernung unter Verwendung von Äther durchgeführt. Grund dafür, dass diese Methode nicht ein breiteres Anwendungsspektrum bekommen hat, war die große Anzahl von Komplikationen und Vorfällen (6). In der lokalanästhetischen Entwicklung unterscheidet man drei Stufen: die erste umfasst die standardmäßige Optimierung der Injektionsspritzen, die zweite war die Synthese von verschiedenen lokalbetäubenden chemischen Stoffen, sowie als dritte Stufe die Synthese von verschiedenen Vasokonstriktoren (7). Die Lokalanästhetika, die derzeit auf dem Markt sind, können indirekt von Cocain abgeleitet werden (4). Im Jahr 1860 hat Niemann, welcher als Chemiker in Göttingen tätig war, das Cocain aus dem südamerikanischen Kokastrauch isoliert. Experimentelle Analysen von Kokainlösungen wurden von einem Mediziner aus Peru, Moreno, im Jahr 1868, und von seinem Zeitgenossen von Anrep aus Würzburg im Jahr 1880 durchgeführt (7). Aber erst durch den Wiener Ophthalmologen Carl Koller kommt es zum Durchbruch in der Anwendung von Cocain für die Lokalanästhesie. Er hat experimentell sowohl an Versuchstieren als auch an sich selbst die Betäubungsmöglichkeiten des Cocain untersucht, dabei entdeckte er, dass das Cocain die Hornhaut schmerzunempfindlich macht (8). Cocain wirkt durch eine Hemmung der Reizweiterleitung; weiters hemmt es die Wiederaufnahme von Noradrenalin in den präsynaptischen Spalt, wodurch ein Anstieg und eine Wirkungsverlängerung des körpereigenen Noradrenalins hervorgerufen werden. Diese Eigenschaften führen lokal zu einer Vasokonstriktion und systemisch zum Anstieg der Wachheit und der subjektiven Wahrnehmung, wodurch sich ein Suchtpotenzial entwickeln kann (4). Im Jahr 1883 hat Koller die erste schmerzlose Glaukomoperation unter Verwendung einer 2 %igen Cocainlösung durchgeführt, dabei wurde diese in den Konjuktivalsack eingetropft (7). Bald nachdem hat sich die Cocainanwendung sehr schnell in Europa und USA für die Lokalanästhesie verbreitert und etabliert. Der bekannte amerikanische Chirurg William Halsted hat als erster im Jahre 1884 Cocainlösung appliziert und damit eine Blockade von N. infraorbitalis und N. alveolaris inferior erzielt. Er hat mehrere Injektionstechniken für die Regionalanästhesie entwickelt, einige davon sind sogar noch heute für die Praxis der Zahnheilkunde essentiel (8). Im Jahr 1886 wurde auf der 25. Jahreshauptversammlung des Centralvereins Deutscher Zahnärzte sowohl über positive als auch negative Erfahrungen, sowie über das 15
17 Suchtpotential von Cocain berichtet. Diese Berichte sorgten für eine abgeschwächte Begeisterung im Bezug auf die Cocainwirkung (6). Der Leipziger Chirurg Braun hat im Jahr 1903 die Kombination von Cocainlösungen und Adrenalin empfohlen. Im Jahr 1904 ist Stolz, einem Chemiker aus Deutschland, die Synthese des Adrenalins gelungen. Dieses wurde dann unter dem Warenzeichen Suprarenin von der Fa. Hoechst verkauft (7). Die moderne Lokalanästhesie verdankt ihren Durchbruch dem Procain, welches im Vergleich zu Cocain weniger gesundheitsschädliche Wirkungen aufweist. Dieser Benzoesäureabkömling wurde erstmals 1905 von Einhorn, dem Münchener Chemiker, entwickelt und dann unter dem Handelsnamen Novocain auf den Markt gebracht (9). Am Anfang des XX. Jahrhunderts wurde Cocain hinsichtlich der lokalanästhetischen Anwendung vom Procain ersetzt (4). Im Vergleich zu Cocain hat Procain nicht so starke Wirkung, was aber durch Adrenalinzusatz verbessert werden konnte (6). Braun hat Novocain auch zur Zahnentfernung empfohlen. Aus dem Wirkstoff Procain lässt sich in Kombination mit Suprarenin und 0,6-0,9 %iger NaCl-Lösung eine anästhetisch wirkende Lösung herstellen (7). G. Fisher hat mit seinem im Jahr 1911 erschienenem Buch Die örtliche Betäubung in der Zahnheilkunde die Pharmakologie von Lokalanästhetika beschrieben. Ihm ist auch die Anfertigung eines speziellen Systems (Spritze), welches für die Applikation von Lokalanästhetika dient, zu verdanken. Eine zeitlang waren die 2- und 4%ige Procainlösungen das Mittel der Wahl (9). Im Jahr 1917 hat Cook die Zylinderampulle (Cartridge) entworfen (7). Dem schwedischen Chemiker Löfgren ist es zu danken, dass es 1943 zur Synthese von Lidocain, einem neuen Säureamidtyp-Anästhetikum, gekommen ist. Lidocain war potenter und weniger allergisierend als Procain und andere Ester-Lokalanästhetika (8). Schmidt- Westhausen und Reichart (7) sind aber der Meinung, dass Löfgren erst zwischen Lidocain synthetisiert und der Welt vorgestellt hat (7). In der Folge kam es zur Entwicklung von weiteren Lokalanästhetika: Mepivacain (1956), Prilocain (1960), Bupivacain (1963), Etidocain (1971), Articain (1975), Ropivacain (1997) und Levobupivacain (1999) (10). Im Vergleich zu Cocain haben die synthetischen Substanzen keinen vasokonstriktorischen Effekt, was aber durch Vasokonstriktorenzusatz problemlos gelöst werden konnte (11). 16
18 Dank Muschaweck und Rippel kam es im Jahr 1976 zur Synthese des Articains in der Fa. Hoechst (Deutschland) (7). Articain wurde ursprünglich als Carticain im Jahr 1969 synthetisiert und ist 1976 in Deutschland zugelassen worden. Der Name wurde 1984 geändert und es ist im selben Jahr in Canada, 1998 in Großbritanien, 2000 in USA und 2005 in Australien zugelassen worden (12). Der Vorteil von Lokalanästhetika des Säureamid-Typs ist die niedrige Rate an Nebenwirkungen im Vergleich zu denen des Ester-Typs, weshalb sie kontinuerlich und schlussendlich bis Mitte 1990er total die letzteren im Gebrauch abgelöst haben (8) Voraussetzungen für die Lokalanästhesie Das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von mehreren verschiedenen Lokalanästhetika, die sich auf dem Markt befinden, ermöglichen Zahnmedizinern eine adäquate Auswahl. Die Auswahl richtet sich nach bestimmten Eigenschaften, wie z. B. Zeitpunkt des Wirkbeginns und der Wirkdauer, Blutgerinnungsstatus und dem Grad der kardialen Nebenwirkungen. Für jeden einzelnen Patienten und für jede spezifische zahnärztliche Behandlung sind Lokalanästhetika individuell auszuwählen (8). Es ist wichtig, die Indikation beim Gebrauch von Lokalanästhetika streng zu setzen. Den Grundstein für die sichere Anwendung und Applikation von lokalbetäubenden Substanzen bilden die Kenntniss über ihren Wirkmechanismus, Nebenwirkungen und ihre Pharmakokinetik. Dasselbe gilt für die vasokonstriktorischen Zusätze in Lokalanästhetikalösungen. Für die Versorgung von Risikopatienten und alten multimorbiden Patienten ist die adäquate Auswahl von Substanzen und Applikationstechnik wegen möglicher Kontraindikationen unerlässlich. Die Vorbeugung eines möglichen Zwischenfalls ist auch forensich betrachtet eine zwingende Notwendigkeit beim Gebrauch von Lokalanästhetika. Dies kann durch exakte Anamneseerhebung, Monitoring oder durch Kontrolle von möglichen Komplikationen geschehen (7). Folgende Eigenschaften soll eine im Klinikalltag eingesetzte lokalanästhetische Substanz aufweisen: Wasserlöslichkeit Gewebeverträglichkeit Sterilisierbarkeit (11). Moore und Hersh (13) nennen bestimmte Eigenschaften, die ein ideales Lokalanästhetikum charakterisieren: 17
19 Reizlose Verabreichung Kein allergenes Potenzial Schneller Wirkungseintritt und adäquate Wirkungsdauer Wirkungsreversibilität Minimale systemische Toxizität Selektive Wirkung auf Nozizeptoren (13). Neben diesen Qualitäten listet Bennett (1, 14) andere wünschenswerte Eigenschaften von Lokalanästhetika auf: Lösungsstabilität und Fähigkeit zur Biotransformation Sterilisierbarkeit (1, 14). Daraus folgt, dass die Lokalanästhesie unbedenklich, gewebsschonend, störungssicher, preiswert und beinahe nicht belastend sein soll. Die Grundvoraussetzung für die Durchführung einer Lokalanästhesie ist das Einverständnis und die Einwilligung des Patienten zur Therapie. Ist dies nicht der Fall, sollte man die therapeutischen Maßnahmen zur Schmerzbefreiung keinesfalls anwenden. Ein wichtiger Aspekt ist auch die psychologische Beratung von ängstlichen Patienten, weil sich Angst und Schmerzgefühl gegenseitig bedingen und potenzieren können. Schlussendlich sind für eine erfolgreiche und sichere Durchführung von Lokalanästhesie sowohl die adäquate Technik als auch die entsprechende lokalanästhetische Substanz sowie die psychologische Komponente ausschlaggebend (6). 1.2 Neurophysiologische Grundlagen Aufbau peripherer Nerven Das Neuron oder die Nervenzelle bilden die strukturelle Basis des Nervensystems. Es ist in der Lage, die Impulse zwischen dem ZNS und allen Teilen des Körpers zu übertragen. Es gibt zwei grundlegende Typen des Neurons: die sensorisch, afferenten und die motorisch efferenten Neurone. Die beiden Nervenzelltypen weisen einige bedeutende Unterschied hinsichtlich ihrer Grundstruktur auf (1). 18
20 Abbildung 1 Nervenquerschnitt. Das Endoneurium und die Axone bilden eine Einheit, die vom Gefäßsystem und Epineurium durch kontinuierliche Barrieren isoliert ist. Das ungefensterte Kapillarendothel und das Perineurium sind durch Zonulae occcludentes (Tight junctions) dicht abgeschlossen. Auf diese Weise enstehen die Barrieren, die nur durch lipophile Substanzen penetriert werden können. Quelle: Lüllmann H, Mohr K, Hein L. Nozizeptives System. In: Lüllmann H, Mohr, K, Hein L, editors. Pharmakologie und Toxikologie: Arzneimittelwirkungen verstehen - Medikamente gezielt einsetzen. Ein Lehrbuch für Studierende der Medizin, der Pharmazie und der Biowissenschaften, eine Informationsquelle für Ärzte, Apotheker und Gesundheitspolitiker ; 130 Tabellen. 17th ed. Stuttgart, New York, NY: Thieme; pp Strukturell gesehen sind die meisten peripheren Nerven gemischte Nerven mit Neuronen sowohl für die afferente als auch für die efferente Funktion. Zum afferenten Modus gehören sensible und sensorische Fasern, zum efferenten vegetative und motorische Fasern. Die sensiblen und motorischen Fasern unterscheiden sich in der Lokalisation ihrer Zellkörper: die des sensiblen Typs sind in den spinalen Hinterwurzelganglien oder in den Ganglien der Hirnnerven lokalisiert; diejenige des motorischen Typs sind im Vorderhorn des Rückenmarks oder in den motorischen Kerngebieten der Hirnnerven lokalisiert (6). Vom Zellkörper ausgehend führen die Axone der primären sensiblen Neurone sowohl in die Peripherie als auch in das ZNS (pseudounipolare Neurone), wo sie mit ihren baumartigen Verzweigungen die peripheren Gewebe innervieren oder Informationen zu den zweiten sensiblen Neuronen im ZNS weiterleiten. Die Axone können als kabelähnliche Strukturen aufgefasst werden (1). Jeder periphere Nervenstrang (s. Abb. 1) ist von innen nach außen von 3 Hüllen ausgekleidet. Als erstes (ganz innen) liegt das Endoneurium, gefolgt von Perineurium, welches mehrere Axone umgibt, und als letzteres (ganz außen) befindet sich das 19
21 Epineurium, welches wiederum mehrere solcher Einheiten umhüllt. Für die Wirkung der Lokalanästhetika ist die Penetration des Wirkstoffes von großer Bedeutung, dabei gelangt er durch diese Hüllen zum Zielort, wo er seine Wirkung entfalten kann. In der Klassifikation von Axone lassen sich myelinisierte und nichtmyelinisierte unterscheiden. Myeliniesierte oder markhaltige Axone haben eine Barriere von Schwann schen Zellen, nicht myelinisierte sind barrierenfrei und werden auch zu den dünnen Nervenfasern zugeordnet. Im Bezug auf den Radius lassen sich Nervenfasern in A-, B- und C-Fasern und in die jeweiligen Subklassen einteilen (6). Tabelle 1 Anatomische und Physiologische Eigenschaften von Nervenfaserklassen. Faserklasse Subklasse Durchmesser (µ) Myelinscheide Leitungsgeschwindigkeit (m/s) Lokalisation A Alfa efferent (Muskel) A Alfa afferent (Muskelspindel) Aufgabe motorisch sensomotorisch A Beta afferent (Haut) Propriozeption A Gamma efferent (Muskelspindel) A Delta afferent (sensorisch) B < präganglionär autonom C sc 0,3-1,3-0,7-1,3 postganglionär autonom C dc 0,4-1,2-0,1-2,0 afferent (sensorisch) Muskeltonus Temperatur, Schmerz, Berührung Autonome Regulation Autonome Regulation Temperatur, Schmerz Modifiziert nach Kröll W, Schroll K. Lokalanästhesie. In: Schroll K, Watzek G, editors. Zahnärztliche Chirurgie. Band 1. Wien: Verlag Wilhelm Maudrich; pp
22 1.2.2 Membranpotential und physiologische Erregungsübertragung Im Bezug auf lokalanästhetische Substanzen hat der Radius einer Nervenfaser Einfluss sowohl auf seine Reizleitung, Modus operandi und Aufgabenbereich, als auch auf seine Sensitivität. Die Dicke der Nervenfaser ist hinsichtlich dessen indirekt proportional zur Wirksensitivität (6). Abbildung 2 Schematische Darstellung der physiologischen Erregungsübertragung. Quelle: Malamed SF. Neurophysiology. In: Malamed SF, editor. Handbook of local anesthesia. 6th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby; pp Mit einer Dicke von ca. 0,0070-0,0080 µm wird die Zellmembran als eine selektiv premeable, flexible und nicht dehnbare Struktur definiert, die aus einer 21
23 Lipidmoleküldoppelschicht und assozierten Proteinen, Lipiden und Kohlenhydraten aufgebaut ist (1). Durch die Zellmembranen erstrecken sich die Kanäle, welche als Eintrittspforten für geladene Partikel dienen. Bedingt durch die Erregungslage der Zellmembran können diese Kanäle eine geöffnete oder nicht geöffnete Position einnehmen. Wegen des unterschiedlichen elektrochemischen Gradienten zwischen dem Intrazellulär- (K +, Na + ) und dem Extrazellulärraum (K +, Na + ) bildet sich ein Ruhepotential von -70 bis -90 mv auf der Zellmembranoberfläche aus. Obwohl die Zellmembran permeabel für Na + - Ionen ist, bleibt das Ruhepotential durch die Aktivität der Natrium-Kalium-Pumpe (Na + raus, K + rein) aufrecht. Bei der Depolarisation kommt es durch die Erregung entlang der gesamten Nervenmembran zu einer Änderung des Ruhepotenzials, welches am Höhepunkt einen Wert von -50 mv zeigt. Dadurch erreicht die Zellmembran für Natriumionen höchste Durchlässigkeit, was zu einer Umkehr des Potentials mit Werten von ca. +30 bis +40 mv führt. Letztendlich sinkt die Permeabilität der Membran für Natriumionen und steigt für Kaliumionen, wodurch diese aus dem Zellinneren strömen und sich dadurch wieder ein Ruhepotential einstellt; dies wird als Repolarisation bezeichnet (6). Sowohl die Depolarisation als auch die Repolarisation erfolgen in 1 msec, nämlich Depolarisation braucht ca. 0,3 msec und Repolarisation 0,7 msec (1). Abbildung 3 Schematische Darstellung der Erregunsübertragung in den myelinisierten und nicht myelinisierten Nervenfasern. Aktionspotentiale in den myelinisierten Nervenfasern verbreiten sich durch 22
24 saltatorische Erregung von einem zu anderen Ranvier schen Schnürring. Es müssen dabei zumindest 3 Schnürringe unerregt bleiben damit es zur Unterbrechung von Aktionspotentialen kommen kann. Quelle: Ziegler A. Die Lokalanästhetika in der Zahnmedizin. Quintessenz 2009; 60(12): Die Depolarisation und die Repolarisation verlaufen im Bereich von markhaltigen Nervenfasern an den sog. Ranvier schen Schnürringen, wie oben beschrieben, ab. Diese Stellen sind nicht von Markscheiden umhüllt und die Reizleitung erfolgt saltatorisch von einem zu anderen Schnürring (6) Schmerz In diesem Abschnitt wird zunächst näher auf die Begriffe Schmerz und Nozizeption sowie auf die verschiedenen Schmerzarten eingegangen. Der Schmerz ist ein mit Emotionen einhergehendes bzw. subjektiv wahrnehmbares Empfindungserlebnis, welches durch Schädigungen bzw. pathophysiologische Veränderungen im Körper oder an Körperoberflächen hervorgerufen wird. Die Wahrnehmung, Ausbreitung und zentralnervöse Verarbeitung noxischer bzw. schädlicher Reize wird als Nozizeption bezeichnet und unterliegt dem sog. nozizeptiven System. Unter Nozizeption versteht man den neuronalen, ohne Empfindungseinfluss ablaufenden bzw. den objektiven Prozess. Nozizeptive Reize werden auch als Schmerzreize bezeichnet, die spezifische Sensoren sog. Nozizeptoren stimulieren und somit deren Funktion entfalten (15). Wie bereits erwähnt ist Schmerz eine Reaktion auf physische oder funktionelle Schädigungen des Körpers. Seine Aufgabe besteht darin, weitere Defizite zu vermeiden, was durch das Wahrnehmen von Schmerz (Nozizeption), bewirkt wird. Die Schmerzwahrnehmung wird vom PNS und ZNS reguliert (16). 23
25 Abbildung 4 Schematische Darstellung der Schmerzentstehung im afferenten nozizeptiven Neuron. Quelle: Höllt V., Allgaier C. Analgetika. In: Aktories K, Forth W, Allgaier C. Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie: Für Studenten der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Chemie und Biologie sowie für Ärzte, Tierärzte und Apotheker : mit 305 Tabellen. 10th ed. München: Elsevier, Urban & Fischer; pp Schmerzen werden als komplexe Wahrnehmungen beschrieben, die aber durch einfache somatische Aktionen hervorgerufen werden. Die Entstehung und Weiterleitung der Aktionspotentiale (s. Abb. 4) geschieht durch die Reizung von Nozizeptoren. Sie werden durch unterschiedliche Botenstoffe aktiviert, wie z. B. PGE 2, Serotonin, Bradykinin, Adenosin, Capsaicin, ATP. Zu diesem System gehören auch verschiedene Ionenkanäle, wie der TRPV 1 (Vanilloid-Rezeptor 1) und spannungsabhängige Na + Kanäle. Daneben ist das System in der Lage die Botenstoffe wie Substanz P und CGRP zu sezernieren. Substanz P und CGRP wirken vasodilatatorisch, und TRPV 1 reagiert auf Temperaturreize (Erhitzung > 43 C), H + -Konzentration, Capsaicin und Endocannabinoide (17). Höllt und Allgaier (18) benennen diesen Rezeptor als Vanilloid-Rezeptor (TRPVR1). Durch die Aktivität dieses Rezeptors bzw. Ionenkanals kommt es zum Fluss von Natrium und Calcium-Ionen in das Zellinnere und in weiterer Folge zu einer Kaskadenreaktion mit einer Zellmembrandepolarisation, Aktivierung von spannungsabhängigen Natriumkanälen und Entstehung von Reizpotentialen (18). Diese Stimuli und Reizpotentiale werden als Schmerzen empfunden. Die Impulse von Nozizeptoren gelangen zuerst in das Hinterhorn des Rückenmarks, dort werden sie umgeschaltet und über aufsteigende Schmerzbahnen in höhere ZNS Regionen weitergeleitet. Durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener Strukturen im ZNS wie dem limbischen System, Thalamus und sensitiven Cortex kommt es zur 24
26 Impulsverarbeitung und schlussendlich zur Schmerzempfindung (17). Die im Gehirn eintreffenden, durch Schädigungen hervorgerufenen Impulse, werden als Schmerz registriert und wahrgenommen, die Schmerzintensität steigt mit der Anzahl der eintreffenden Impulse (16). Die Interpretation von Schmerzreizen wird sowohl vom persönlichen Emotionszustand als auch von Umweltfaktoren beeinflusst (17) Schmerzarten Die Klassifizierung des Schmerzes kann nach unterschiedlichen Gesichtspunkten erfolgen: nach Entstehungsort: Schmerzen im Abdomen, etc. Entstehungsätiologie: abhängig von der Erkrankung, z. B. Schmerzen nach chirurgischen Eingriffen Zeitdauer: akute Schmerzen, chronische Schmerzen Pathogenese: nozizeptive Schmerzen, neuropathische Schmerzen, durch psychologische Prozesse (mit-)bedingte Schmerzen (15). Im Prinzip lassen sich Schmerzen nach Lokalisation und Dauer unterscheiden. Zur Lokalisationskomponente werden somatische und viszerale, und zur Dauerkomponente akute und chronische Schmerzen gezählt. Oberflächenschmerzen und Tiefenschmerzen sind somatische Schmerzen, die auf der Oberfläche bzw. in tief gelegenen Strukturen auftreten. Die viszeralen Schmerzen betreffen die Eingeweide und enstehen durch Ischämie, entzündliche Prozesse sowie Traumen. Akutschmerzen entstehen plötzlich und enden mit Erholung des Organismus und Beseitigung der auslösenden Reize. Sie lösen Abwehr- und Fluchtreaktionen des Organismus aus. Chronische Schmerzen sind wiederkehrende und länger dauernde Schmerzen, die durch eine Chronifizierung von schmerzauslösenden Zuständen entstehen. Bei der Ätiologie des Übergangs von akuten in chronische Schmerzzustände spielt auch das sog. Schmerzgedächtnis eine wichtige Rolle. Dabei kommt es durch häufige akute Schmerzen zu neurochemischen und eventuell sogar strukturellen Veränderungen des Gehirns und der nozizeptiven Bahnen. Hinsichtlich pathophysiologischer Betrachtung werden nozizeptive, Entzündungs-, neuropathische und funktionelle Schmerzen unterschieden (18). 25
27 1.2.5 Prinzipien der Analgesie durch Lokalanästhetika in der Zahnmedizin Analgesie wird als Blockierung der Schmerzempfindung definiert. Es wird zwischen iatrogener (z. B im Rahmen der Anästhesie, Analgosedierung bzw. Schmerztherapie) und pathologischer Analgesie (infolge Ausfalls sensibler Nervenbahnen des zentralen oder peripheren Nervensystems) unterschieden (19). Das Empfinden von Schmerzen kann durch Arzneistoffe auf drei Arten blockiert werden, und zwar durch Blockade der Reizentstehung, der Reizweiterleitung und/oder der Schmerzempfindung. Lokalanästhetika sind in der Lage, die Impulsentstehung und die Impulsleitung auszuschalten, indem sie die Ausbildung und Weiterleitung von Aktionspotentialen durch Blockade der spannungsabhängigen Na + -Kanäle des neuronalen Axons reversibel hemmen (17). In der Zahnmedizin wird die Lokalanästhesie oder örtliche Betäubung zur Blockierung von N. maxillaris und N. mandibularis eingesetzt. Diese Nerven sind für die sensible Versorgung der Mundhöhle, Zähne, Ober- und Unterkiefer sowie Gesichtweichteile verantwortlich (9). Die Nervenendigungen von primären schmerzweiterleitenden Fasern werden durch Aktionspotentiale, die durch Noxen ausgelöst werden, stimuliert und verbreiten die erhaltenden Signale in verschiedene Bereiche des ZNS. Die Ursachen für die Stimulation können verschiedene Pathologien (Infektionen, Karies, Verletzungen) oder die Zahnbehandlung selbst sein. Durch zahlreiche Botenstoffe und Neuropeptide, die während der Schmerzentstehung vermehrt freigesetzt werden, kommt es zur Aktivierung von C- und A-delta-Fasern im Bereich von Pulpa, Zahnhalteapparat, Schleimhaut und Periost. Dies führt zur Schmerzempfindung, wodurch eine weitere Schädigung verhindert werden soll. Lokalanästhetika vermögen diese Signalkaskade bzw. deren Entstehung durch Hemmung der spannungsabhängigen Natriumkanäle zu blockieren (20). Damit die Natriumkanäle auf diese Art und Weise gehemmt werden können, muss das Lokalanästhetikum im direkten Bereich des zu blockierenden Nervs lokal verabreicht werden. Erst wenn eine bestimmte Konzentration der betäubenden Substanz an den Natriumkanälen angelangt ist, kommt es zur vollständigen Unterbindung des Natriumstroms und der Reizweiterleitung (16). Dabei werden nicht nur sensible, sondern auch vegetative Nervenfasern blockiert, was wiederrum zur Gefäßerweiterung führt. Sind besonders hohe Konzentrationen am Wirkort vorhanden, so werden auch motorische 26
28 Nerven von der betäubenden Wirkung des Lokalanästhetikums betroffen, was sich dann als Parese (z. B. des N. facialis) bemerkbar macht (20). Die lipophilen aromatischen Reste und Alkylgruppen der Lokalanästhetika ermöglichen eine gute Diffusion in und durch die Nervenscheiden gemischter Nerven und führen zu einer Ausschaltung des Temperatur-, Schmerz- und Berührungssinnes in absteigender Reihenfolge, um schließlich auch die Funktion motorischer Anteile zu unterbinden. Eine Ausschaltung von Vibrations- und Druckempfindung findet häufig nur unvollständig statt (4). Fakler und Hein (5) berichten, dass die motorischen Nervenfasern als letzte ihrer Funktion verlieren. Beim Nachlassen der narkotisierten Wirkung werden zuerst die motorischen, dann die vegetativen und zuletzt die sensorischen Nerven ihre Funktionsfähigkeit wieder erhalten. Letztendlich kommt es auch wieder zur Schmerzwahrnehmung (5). Sowohl die C- als auch die A-delta-Fasern werden durch die Lokalanästhetika recht gut unterbunden. Bei den erst genannten muss die stetige Signalweiterleitung und bei den letzt genannten eine bestimmte Anzahl an Ranvier schen Schnürringen gehemmt werden, da die Reizausbreitung kaskadenartig verläuft. Peripher liegende sensible Nerven setzen sich aus zahlreichen Axonen zusammen, welche wiederum mehrere, vom Perineurium umhüllte, Faszikel bilden. Da die proximalen Gewebsbezirke von Mantelfasern und die distalen von Kernfasern innerviert werden, kommt es erst mit einer Verzögerung zur vollständigen Hemmung, da eine gewisse Konzentration der lokalanästhetischen Substanz nötig ist, um vorerst nur die Reizweiterleitung an Mantelfasern zu unterbinden, wohingegen für die Kernfasern eine noch viel höhere von Nöten ist. Als Beispiel dafür kann die Schmerzunterdrückung auf den N. alveolaris inferior genannt werden, wobei die Taubheit zuerst im Molarenbereich und mit Verzögerung in der Unterlippe auftritt. Beim Abklingen der Wirkung wird das Schmerzempfinden zuerst im Zahnbereich beobachtet, die Weichteile bleiben dagegen länger betäubt (20). Wie bereits erwähnt, werden sensorische vor den motorischen Fasern blockiert, weswegen sie auch durch geringere Konzentrationen des Lokalanästhetikums gehemmt werden können. Der Grund dafür sind die höhere Impulsfrequenz und eine längere Aktionspotentialdauer, weiters könnten der Umfang sowie der Abstand der Ranvier- Schnürringe eine Rolle spielen. Bei der kaskadenartigen Reizweiterleitung wird nur die Membran an den Schnürringen depolarisiert, daher sind hohe Konzentrationen des Lokalanästhetikums notwendig, da bei den motorischen Nerven größere Flächen behandelt werden müssen, um eine betäubende Wirkung zu erzielen (21). 27
29 2 Material und Methoden In dieser Diplomarbeit werden als Material entsprechende Kapitel aus zahnmedizinischen und pharmakologischen Fachbücher sowie Artikeln aus zahnmedizinischen Zeitschriften, PubMed und Internet genützt. Als Methode zur Beantwortung der Problematik wird Literaturrecherche gemacht. In Suchmaschinen wie Pub Med und Google wurder nach folgenden Begriffen gesucht: o local anesthetics dentistry, o local anesthesia dentistry, o amide local anesthetics, o local anesthetics review, o local anesthetics dental, o lidocaine, o complications local anesthetics dentistry, o local anesthetics toxicity, o articaine. Ich habe mich bemüht den aktuellsten Überblick über Lokalanästhetika in der Zahnmedizin durch den neuesten und aktuellsten Stand der Literatur zu verschaffen. 28
30 3 Ergebnisse Resultate 3.1 Pharmakologie der Lokalanästhetika Struktueller Aufbau und Stereoisomerie der Lokalanästhetika Eine in der Zahnmedizin verwendete Injektionslösung des Lokalanästhetikums hat folgende strukturelle Komponenten: den Wirkstoff, den Vasokonstriktor (nicht immer erforderlich), ein Puffer-System, Antioxidans und Konservierungsmittel (nicht immer erforderlich). Als Volumengeber und Substanzträger dient bidestilliertes Wasser. In Mehrfachentnahmesystemen werden Methylparabensulfit und Natriumdisulfit für die Bewahrung der Sterilität zugesetzt. Diese Konservierungsmittel sollten bei allergischen Patienten nicht zur Anwendung kommen (9). Die Leitsubstanz lokalanästhetisch wirkender Stoffe ist Cocain. Alle abgeleitenden Substanzen setzen sich aus zwei, über eine Zwischenglied, miteinander verbunden Komponenten zusammen, nämlich einem lipophilen Molekülanteil mit einem aromatischen Rest, sowie einer substituierten Aminogruppe, die den hydrophilen Anteil darstellt (5). Abbildung 5 A, Typische Struktur der Lokalanästhetika. B, Estertyp der Lokalanästhetika. C, Amidtyp der Lokalanästhetika. Quelle: Malamed SF. Neurophysiology. In: Malamed SF, editor. Handbook of local anesthesia. 6th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby; pp
31 Die Lokalanästhetika unterteilt man in Hinblick auf ihre chemische Struktur in Ester und Säureamide. In der Strukturformel der Moleküle werden drei spezifische Sektionen unterschieden, diese spielen eine bedeutende Rolle für das Ausmaß der Wirkung, der Wirkdauer, des Metabolismus der Substanzen sowie ihrer Toxizität: 1. Der aromatische Rest des Moleküls, welcher ein Benzol-, Anilid- oder Thiophenring sein kann, ist für die Lipophilie der Substanz verantwortlich. Diese bestimmt die Stärke der anästhetischen Wirkung und die Konzentration der Substanz in der Zellmembran. 2. Die substituierte Aminogruppe, die den hydrophilen Bestandteil des Moleküls bildet, kann protoniert werden und bestimmt in dieser Form den basischen bzw. den kationischen Charakter des Moleküls, dieser wiederrum bestimmt den Wirkungseintritt und ist vom ph-wert des Gewebes abhängig. 3. Die Alkylkette, die den fettlöslichen mit dem fettabstoßenden Molekülabschnitt miteinander vereinigt, ist für die Lipidlöslichkeit, die Wirkstärke sowie die Proteinbindungsfähigkeit verantwortlich (7). Quartäre Analoga der lokalanästhetischen Substanzen sind wegen fehlender Lipidlöslichkeit und ständiger Ionisierung komplett wirkungslos. Sie können nur bedingt wirken, wenn sie direkt auf die innere Oberfläche der Nervenzellmembran verteilt werden (11). Abbildung 6 Stereoisomerie am Beispiel von S(-)-Bupivacain und R(+)-Bupivacain. Quelle: Bräu M. Lokalanästhetika: Pharmakologie und Pharmakokinetik. Quintessenz 2006; 57(9):
32 Bräu (16) berichtet über das Vorhandensein der Stereoisomerie bei Lokalanästhetika (s. Abb. 6). Sie besitzen ein chirales C-Atom mit vier verschiedenen Substituenten. Je nachdem wie diese angeordnet sind, unterscheidet man zwei sich räumlich unterschiedliche Molekülstrukturen, die man als Stereoisomere oder Enantiomere bezeichnet. Diese weisen gleiche physikochemische Merkmale auf, aber differieren in ihrer biologischen Aktivität. Ein weiteres Merkmal der Enantiomere ist die Unterscheidung in der Drehung des polarisierten Lichtes. Dieses kann nach links oder rechts gedreht werden (L-linksdrehend, R-rechtsdrehend). Bei der Synthese werden beide Formen zu gleichen Anteilen gebildet und ergeben ein Gemisch, das s.g. Razemat. Die meisten lokalanästhetischen Substanzen werden als Razemate produziert (16) Chemisch-physikalische Eigenschaften von Lokalanästhetika Lokalanästhetika sind schwache Basen und gehören zur Gruppe der sekundären oder tertiären Amine. Nur Benzocain folgt nicht dieser Aufteilung und gehört zur Gruppe der aromatischen Amine. Sie sind nur in Form von Salzen, wie z. B. als Hydrochlorid, wasserlöslich. Der ph-wert der Lokalanästhetikalösungen beträgt 4-6, der pka 7,8 bis 9 und der Dissoziationsgrad im Gewebe 3-40 % (11). Abbildung 7 Dissoziation der Lokalanästhetika im Gewebe. Quelle: Biel M. Lokalanästhetika. In: Aktories, K, Förstermann U, Hofmann F-B, Starke K, editors. Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 10th ed. München: Elsevier, Urban & Fischer; pp Nach Schmidt-Westhausen und Reichart(7) liegt der ph-wert der lokalanästhetischen Substanzen in Lösung als Hydrochlorid bei 3,5 bis 6,8. Der pka-wert der freien Base liegt zwischen 7,5 und 9, abhängig vom Basenanteil. Bei niedrigen ph-werten, die z. B. im 31
33 Rahmen entzündlicher Prozesse herrschen, nimmt der Anteil der freien Base ab, wodurch die Diffusionsneigung herabgesetzt wird und es in weiterer Folge zur Verminderung des lokalanästhetischen Effektes kommt. Lokalanästhetika können ausschließlich in basischer Form den Zielort erreichen, was durch vorhergehende Neutralisierung der injizierten sauren Lösung mittels Gewebe-Pufferssystemen möglich gemacht wird (7). Nach Reichl et al. (21) beträgt der pka-wert typischer Lokalanästhetika 7,5 bis 9, daher kommen diese bei physiologischen ph-werten zu 50-5 % in der nicht ionisierten, lipophilen und damit therapeutisch wirksamen Form vor. Im Gegensatz dazu müsste die kationische Form in eine bipolare umgesetzt werden, um wirksam sein zu können (21). Malamed (1) berichtet dass der pka von Lokalanästhetika einen Wert von 7,5 bis 10 beträgt. Da sie jedoch schwach basisch sind, verbinden sie sich leicht mit Säuren zu Lokalanästhetika-Salzen, in welcher Form sie gut wasserlöslich und vergleichsweise stabil sind. Lokalanästhetika, die zur Injektion verwendet werden, sind am häufigsten mit Hydrochlorid HCl kombiniert (z. B. Lidocain HCl, Articain HCl) (1). Von der Dissoziationskonstanten (pka-wert) und dem herrschenden ph-wert des Applikationsortes hängt der Bindungs- und Ladungszustand der Aminogruppe der Lokalanästhetika ab. Je nach Milieu kann sie entweder in ungeladener oder in der positiv geladener Form existieren (21). Eine suffiziente Anästhesie ist im entzündeten Gewebe nicht möglich, weil dort nur kleine Anteile des Lokalanästhetikums in der lipidlöslichen, ungeladenen Form vorliegen (11). Die Lipidlöslichkeit der lokal betäubenden Substanzen beeinflusst die Effizienz und Toxizität, die mit steigender Lipophilie zunimmt. Die Beschaffenheit der lokalanästhetischen Substanzen bestimmt ihren Abbauort, die Abbaurate, die Abbauprodukte und die ganzheitliche Toxizität sowie die allergische Potenz im Organismus. Der aromatische Rest des Moleküls ist für die Eliminierungsdynamik und für das Auftreten allergischer Reaktionen verantwortlich. In der Zahnmedizin haben die Lokalanästhetika vom Estertyp wegen ihrer Giftigkeit und ihrer allergischen Potenz an Bedeutung verloren und sind durch den Amidtyp vollständig ersetzt worden. Für die Wirkung von Lokalanästhetika sind folgende Kriterien entscheidend: 1. Lipophilie ist für die Wirkungsstärke ausschlaggebend. 2. Bindungstendenz des Rezeptors sowie die Bindungsdauer entscheidet über die Wirkungslänge. 3. pka-wert, der mit dem Wirkungseintritt korreliert (7). 32
34 Tabelle 2 Chemische und physikalische Eigenschaften der Lokalanästhetika. Substanz Relative Potenz Wirkungseintritt Wirkdauer Partitionskoeffizient pka- Wert Plasmaproteinbindung Articain 4 schnell mittel 79 7,8 95 % Lidocain 2 schnell mittel 182 8,2 64 % Prilocain 2 schnell mittel 129 7,9 55 % Mepivacain 2 schnell mittel 89 7, % Bupivacain 8 mittel lang 257 8,2 95 % Procain 1 lang kurz 83 9,1 5,8 % Tetracain 8 lang lang ,6 75 % Daten aus Bräu M. Lokalanästhetika: Pharmakologie und Pharmakokinetik. Quintessenz 2006; 57(9):925 9 Wie bereits oben erwähnt, können Lokalanästhetika die Zellmembran nur in der lipophilen Form penetrieren. Je nach vorliegendem ph-wert im Zytosol dissoziert das basische Amin und geht in die geladene, polare Form über, in welcher es mit dem Natriumkanal reagieren kann. Vor der Verabreichung des Lokalanästhetikums soll dessen pka-wert unter Berücksichtigung des Applikationsortes so gewählt werden, dass dieses unter physiologischen ph-verhältnissen außerhalb der Zelle in ausreichend großer Menge in ungeladener (Transportform) bzw. innerhalb der Zelle in geladener Wirkform vorkommt. Diese Zusammenhänge spielen in der Praxis eine wichtige Rolle, da die Bedeutung des ph-wertes im Gewebe (z.b. Azidose bei inflammatorischen Prozessen) den prozentuellen Transportformanteil herabsetzten kann, wodurch geringe Konzentrationsmengen an den Wirkort gelangen, folge dessen kann der Effekt wegfallen bzw. nicht vollständig zur Geltung kommen (22) Pharmakodynamik der Lokalanästhetika Unter Pharmakodynamik einer Substanz versteht man ihren Wirkmechanismus bzw. den molekularen Mechanismus, mit welchem sie ihre Wirkung erzielt. Das Konzept von der Wirkung der Lokalanästhetika ist im Prinzip einfach: Sie verhindern sowohl die Entstehung als auch die Weiterleitung eines Nervenimpulses. Im Endeffekt produzieren die Lokalanästhetika eine chemische Unterbrechung zwischen der Quelle des Impulses (z.b. Skalpelleinschnitt in Weichteilen) und dem Gehirn. Daher wird der unterbrochene Impuls, der das Gehirn nicht erreicht, nicht als Schmerz empfunden (1). 33
35 Die Reizentstehung resultiert aus einer raschen kaskadenartigen Veränderung der Membranpermeabilität, wodurch die Nervenzelle ihre Durchlässigkeit für Natrium-, Kalium- und Calciumionen ändert (22). Lokalanästhetika bewirken eine reversible Blockade der Reizbildung und Reizweiterleitung (21). Bei Durchführung von schmerzinduzierenden medizinischen Eingriffen ist eine derartige Wirkweise an sensorischen Nervenfasern wünschenswert (21). Die Wirkintensität ist direkt proportional der verabreichten Dosis, dabei vermag das Lokalanästhetikum an den spezifischen Rezeptor zu binden und somit die Konformation des spannungsabhängigen Natriumkanals zu ändern, wodurch dieser inaktiviert wird. Weitere Faktoren, die die Wirkung beeinflussen können, sind die Ausdehnung der Nervenzell-Membran oder die Einbettung des Wirkstoffes in diese (7, 23, 24). Folgende Determinanten haben Einfluss auf die Wirkungen von Lokalanästhetika: ihre physikalisch-chemischen Merkmale, Galenik der Spezialitäten, Dosis, ph-wert des Gewebes, Struktur und Membranpotential der Nervenfaser, Ausmaß des Diffusionsweges zwischen Applikations- und Wirkort, lokale Vaskularisations- und Durchblutungsverhältnisse sowie die Verabreichungstechnik (7). 34
36 Abbildung 8 Strukturmodell des spannungsabhängigen Natriumkannals. Im oberen Teil der Abbildung ist ein Modell des Kanals mit vier homologen Domänen dargestellt. Die Spannungssensoren sind positiv geladen und mit einem + gekennzeichnet. Die Inaktivierungsdomäne ist in Hellrot abgebildet. Aminosäurereste der Helices IS6 (dunkelrot), IIIS6 (grün) und IVS6 (blau) bilden den Bindungsort von Lokalanästhetika, der in der Pore des Kanals lokalisiert ist. Im unteren Teil der Abbildung ist ein dreidimensionales Modell des Bindungsortes dargestellt. Quelle: Biel M. Lokalanästhetika. In: Aktories, K, Förstermann U, Hofmann F-B, Starke K, editors. Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 10th ed. München: Elsevier, Urban & Fischer; pp K + -Kanäle und andere Ionenkanäle können bei sehr hohen Konzentrationen von Lokalanästhetika auch blockiert werden. Folgende Faktoren sind ausschlaggebend für die Verweildauer einer lokalanästhetischen Substanz an der Applikationsstellle: nämlich die Proteinbindung, die lokale Hämostase und bei Estersubstanzen auch die enzymatische Spaltung. Der pka-wert und die Lipidlöslichkeit bestimmen die Anreicherung der lokalanästhetischen Substanz in der Nervenmembran. Dort kommt es zur Bindung an die spannungsabhängigen Natriumkanäle. Der spannungsabhängige Natriumkanal (s. Abb. 8) ist ein Ionenkanal, der eine Struktur mit 4 homologen Domänen aufweist. Diese Domäne 35
37 haben jeweils 6 α- helikale Transmembransegmente (S1-S6). Das vierte Segment einer Domäne stellt einen funktionellen Spannungsfühler dar. Die Na + -leitende Öffnung des Ionenkanals setzt sich aus Aminosäuren von S6 und pore loops zusammen. Bei der Interaktion des Lokalanästhetikums mit den Aminösäureresten des S6 der ersten, dritten und vierten Domäne werden die Na + -Kanäle blockiert. Im Laufe der Reizweiterleitung werden 3 funktionelle Zustände des Natriumkanals (geschlossen-offen-inaktiviert) unterschieden. Der Grund für die sog. use-dependence ist die Interaktion und Bindung der lokalanästhetischen Substanzen an die inaktivierte Zustandsform der Natriumkanäle (11). Beim Übergang des Lokalanästhetikums von der Applikationsstelle über den Zwischenzellraum des Bindegewebes zu den sensiblen Nervenfasern muss es das Perineurium überwinden. Dieses setzt sich aus, durch Zonulae occludentes verbundene Bindegewebszellen, die eine unpolare Schranke bilden, zusammen. Die nichtionisierte Strukturform des Lokalanästhetikums kann das Perineurium bzw. die Membran des Axons passieren und in den Endoneuralraum bzw. Axonplasma gelangen, wo es in Abhängigkeit des dort herrschenden ph-werts ionisiert wird. Weiters findet eine Diffusion aus dem Endoneuralraum über das ungefensterte Kapillarendothel ins Blut statt. Die Schnelligkeit des Übergangs in den Endoneuralraum bzw. in das Axoplasma, sowie das Abdiffundieren in das Kapillarblut, bestimmen letztendlich die Konzentration des Lokalanästhetikums am Wirkort. Die Anflutungszeit des Wirkstoffs ist umso schneller je größer der Konzentrationsgradient zwischen dem Bindegewebesdepot und dem Endoneuralraum ist. Nennenswert ist auch, dass Injektionslösungen mit geringer Dosis wirkungslos sind, wobei zu hohe Konzentrationen zu systemischen Intoxikationen, aufgrund des zu intensiven Übergangs ins Blut, führen können (21). Lang wirkende lipophile Lokalanästhetika reichern sich am Applikationsort und kurz wirksame schwach lipophile Lokalanästhetika bewirken eine systemische Anreicherung (9). Neben ihrer Wirkung auf die Entstehung von Aktionspotentialen in den peripheren Nervenzellen üben die lokalanästhetischen Substanzen zugleich eine Wirkung auf andere Zielorgane im Organismus aus. Dies geschieht immer dort, wo die Impulsleitung erfolgt. Zu solchen Zielorganen zählt man das ZNS, glatte Muskelzellen, das Herz-Kreislauf- System und die neuromuskuläre Endplatte. Die Wirkungen auf das ZNS können sowohl anregend (eigentlich enthemmend) als auch direkt hemmend sein. Anregende Reaktionen manifestieren sich in Tremor, Unruhe bis zu Krampfanfällen. Je potenter ein Lokalanästhetikum ist, desto häufiger treten die zentralnervösen Nebenwirkungen auf. Im Anschluss auf die anregende Reaktion kommt es häufig zu einer ZNS-hemmenden Phase, 36
38 welche sogar tödlich für die Patienten sein kann. Systemisch auf das Herz wirken Lokalanästhetika negativ chronotrop, negatv inotrop und negativ bathmotrop. Außerdem können sie zu einer Gefäßerweiterung führen. Ganz selten und wahrscheinlich durch eine Wirkung auf Herzschrittmacher oder durch Kammerflimmern verursacht, kann es zu akuter Herzinsuffizienz und plötzlichem Herztod kommen (6) Pharmakokinetik der Lokalanästhetika Pharmakokinetische Eigenschaften liefern Aussagen über die Verteilung und Biotransformation von Arzneistoffen. Einen besonderen Einfluss auf Eliminationshalbwertszeit haben die Proteinbindungsfähigkeit, die Lipidlöslichkeit und die Biotransformation des Lokalanästhetikums. Mit steigender Lipidlöslichkeit nimmt die Wirksamkeit und Toxizität zu, wobei sie bei starker Affinität zur Proteinbindung abnimmt. Weiters vermindert die Plasmaproteinbindung die Plazentagängigkeit und unerwünschte Wirkungen (25 29). Lokalanästhetische Substanzen werden vom Applikationsort durch Diffusion in den Blutkreislauf aufgenommen. Es kommt im Blut zu einer Bindung an Glykoproteine, deren Konzentration charakteristisch ist für jede Person. Der Glykoproteinspiegel wird durch verschiedene Fremdstoffe (z. B. Ovulationshemmer, Hydantoine) und Krankheiten bestimmt (7). Folgende Faktoren beeinflussen die Resorption des Lokalanästhetikums aus dem Gewebedepot, nämlich die applizierte Dosis, der Vasokonstriktorenzusatz, die anatomischen Eigenschaften, der Applikationsort und die physikochemischen Besonderheiten des Wirkstoffs selbst (6). Auch aus dem Blutkompartment wird Lokalanästhetikum in die Gewebe aufgenommen, und zwar der Anteil, der nicht an Plasmaproteine gebunden ist. Die Blutspiegel und damit die systemische Giftigkeit des Lokalanästhetikums sinken sowohl durch die Gewebebindung als auch durch seine Verteilung. Als Maß für die Substanzverteilung im Körper gilt das Verteilungsvolumen; es ist unterschiedlich groß bei verschiedenen Lokalanästhetika (7, 23, 24). Ein Zwei- oder Drei-Kompartiment-Modell erläutert die Modalität für die systemische Verteilung von lokalanästhetischen Substanzen. Es setzt sich zusammen aus einer schnellen α-phase, einer langsamen β-phase, dem Stoffwechsel und der Eliminierung der lokalanästhetischen Substanz. In der α-phase kommt es zur Verteilung von Lokalanästhetika in sehr gut durchblutete Gewebe (z. B. Hirn, Herz, Nieren und Leber), 37
39 und in der β-phase kommt es zur Verteilung in weniger gut durchblutete Gewebe wie der Muskulatur und des Darms (6). Die Giftigkeit und das Ausmaß des analgetischen Effekts verschiedener Lokalanästhetika werden auf die Toxizität von Procain bezogen, wobei diese 1 beträgt. Die pharmakologischen Kenndaten verschiedener Lokalanästhetika, wie z. B. Wirkungsbeginn, Wirkungsintensität, Giftigkeit und Wirkungsdauer, sind nur etwaige Werte, welche durch verschiedene experimentelle Studien erhalten worden sind. Man kann die Grenzdosis des Lokalanästhetikums folgendermaßen berechnen: Grenzdosis (mg/kg KG) = toxischer Blutspiegel (mg/l) x Verteilungsvolumen (l/kg KG) (7). Die Berechnung der sog. Individuellen Grenzdosis kann nach folgender Formel erfolgen: Grenzdosis (ml) = Grenzdosis (mg/kg KG) x Körpergewicht (kg) / Konzentration der LA-Lösung (%) x 10 (5). Zu berücksichtigen sind der individuelle Körperbau des Patienten und die Tatsache, dass in der Zahnmedizin das Applizieren der Lokalanästhetika in ein stark durchblutetes Gewebe erfolgt. Die systemische Toxizität wird durch folgende Faktoren beeinflusst, nämlich Serumproteinbindungsfähigkeit, pulmonaler First-Pass-Effekt und Säure-Basen-Status. Wirkungsdauer und Wirkungsbeginn von Lokalanästhetika sind abhängig von lokalen Gewebeverhältnissen, von resorptionshemmenden Hilfsstoffen (Vasokonstriktoren) und von Clearance-Aspekten (7). Bräu (16) informiert, dass das Wirkungsende von Lokalanästhetika erst nach Resorption in den Blutkreislauf stattfindet. Vasokonstriktoren können die Resorptionsdauer verlängern, was zu einer Verlängerung der Wirkdauer führt. Der in den Blutkreislauf gelangte Wirkstoff kann in Abhängigkeit von seiner Struktur und Lipophilie an Plasmaproteine (Albumin und α 1 -saures Glykoprotein) gebunden werden, wodurch es zu einer Toxizitätsabnahme kommt. Dagegen wird der nicht gebundene Wirkstoffanteil im Plasma verstoffwechselt. Die Lokalanästhetika, bei denen die Plasmabindung stärker ausgeprägt ist, haben generell eine höhere Affinität zu biologischen Strukturen, weshalb geringere Höchstdosen zugelassen sind (16). Je nach Verbindungsglied zwischen dem lipophilen und hydrophilen Rest sind zwei Abbauwege zu unterscheiden. Beim Ester-Bindungstyp erfolgt der enzymatische Abbau mittels Cholinesterase (25, 29 32). Dabei wird das Lokalanästhetikum zur Paraaminobenzoesäure abgebaut, dieses vermag Allergien auszulösen. Daher können Lokalanästhetika vom Estertyp bei Patienten, die an Cholinesterasemangel leiden, toxische 38
40 Erscheinungen hervorrufen (16). Lokalanästhetika vom Amid-Typ können durch zwei Enzyme verstoffwechselt werden, dabei erfolgt der Abbau mittels Leber- Monoaminoxygenasen langsamer, wohingegen der Abbau mittels Carboxylesterasen rascher möglich ist. Beide Metabolisierungsvorgänge haben Auswirkungen auf die Eliminationshalbwertszeit des Pharmakons. Dabei ist zu beachten, dass je länger ein Wirkstoff im Körper verbleibt, umso länger dauert auch seine systemische Wirkung (25, 29 32) Nebenwirkungen und Komplikationen der Lokalanästhetika Nebenwirkungen Jedesmal wenn ein Medikament verabreicht wird, können zwei Arten von Wirkungen beobachtet werden: therapeutisch erwünschte Wirkungen, die einen positiven Effekt erzielen und unerwünschte Wirkungen, die einen negativen Einfluss auf den Körper haben. Die letztgennanten, sog. unerwünschte Arzneimittelwirkungen oder Nebenwirkungen werden heute in der englischsprachigen Litaeratur am häfigsten als ARD (adverse drug reaction) bezeichnet. Als Synonyme findet man in Literatur folgende Begriffe: side effects, adverse experiences, drug-induced disease, diseases of medical progress, secondary effects, intolerance (33). Die lokalanästhetischen Substanzen weisen folgende Nebenwirkungen auf: Eine blockierende Wirkung auf das Herz, die aufgrund hoher Affinität zur Proteinbindung oder durch versehentliche intravasale Injektion zustande kommen kann. Als Folge kann eine Verlängerung der QT-Zeit mit nachfolgendem Auftreten von Torsade de pointes entstehen. Die Intoxikation kann sich verschlechtern bis zu einem totalen atrioventrikulären Block mit Kammerstillstand, welcher unbehandelt schnell mit dem Tode des Patienten aufgrund zentraler Anoxie einhergeht. Eine stimulierende Wirkung auf das ZNS, kann durch eine Blockade inhibitorischer Neurone verursacht werden. Anfangssymptome sind periorales Kribbeln, Ohrengeräusche, verwaschene Sprache, Tremor und anxiöse Zustände. In der weiteren Folge können klonische Krampfanfälle vorkommen, welche zur Atemlähmung und zentraler Anoxie führen können. Allergische Reaktionen (17). 39
41 Durch Resorption im Bereich des Kapillarendothels kommt es zur Aufnahme von lokalanästhetischen Substanzen in den Kreislauf. Bei einem massiven Anstieg der Konzentration dieser Substanzen im Plasma sind systemisch-toxische Reaktionen zu erwarten (6). Bei der Applikation von hohen Lokalanästhetikadosen in den systemischen Kreislauf selbst können dementsprechende Nebenwirkungen am Herzen und am ZNS sofort auftreten. Diese sind Folge des sog. use dependent block. Darunter versteht man eine umso stärkere Hemmung der spannungsabhängigen Natriumkanäle, je häufiger sie verwendet werden, d.h. je häufiger sie stimuliert werden. Besonders in ständig elektrisch aktiven Geweben, wie dem Herz-Reizleitungssystem und dem ZNS, führt der usedependent block rasch zu einer negativen Beeinflussung des spannungsabhängigen Natriumkanals (16). Komplikationen Bei der Applikation von Lokalanästhetika wird zwischen lokalen und systemischen Komplikationen unterschieden. Schwenzer und Schwenzer-Zimmerer (9) ergänzen diese Einteilung um sog. Anästhesieversager (9). Lokale Komplikationen Malamed (34) berichtet über folgende lokale Komplikationen im Bereich der Zahnheilkunde, über ihre Ursachen, Prävention und Management anhand von mehreren klinischen Studien: Kanülenbruch, prolongierte Anästhesie oder Parästhesie, Facialisparese, Trismus (Kieferklemme), Hämatome (durch Gefäßverletzung), Schmerzen und Brennen am Injektionsort, Infektionen, Ödeme, Weichteilverletzungen, Gewebeablösung und postanästhetische intraorale Ulzerationen (34). Schliephake und Strauß (4) informieren auch über Gefäßspasmen und Nekrosen als mögliche lokale Komplikationen, die bei Applikation von Lokalanästhetika auftreten können (4). Fakler und Hein (5) nennen weitere Komplikationen wie z.b. Aspiration von abgebrochenen Kanülen, die während der Applikation auftreten kann. Weiters sind Bissverletzungen und Verbrennungen bei Nahrungsaufnahme im noch betäubtem Zustand, sowie mangelhafte Kontrolle der Empfindung, zu nennen. Daher ist stets darauf zu achten, den Patienten richtig aufzuklären (5). 40
42 Systemische Komplikationen Systemisch auftretende Komplikationen können sowohl spezifischen als auch unspezifischen Charakter haben, abhängig von der Zusammensetzung der Lokalanästhetikum-Lösung bzw. ob Hilfsstoffe wie Vasokonstriktoren oder Konservierungsmittel (Parabene) zugesetzt wurden (35). Folgende Allgemeinsymptome können im Zusammenhang mit der Applikation der Lokalanästhetika auftreten, nämlich vasovagale Synkopen, Schocksymptomatik, Hyperventilationstetanie (vorwiegend bei jüngeren weiblichen Patienten), Intoxikationen und allergische Antworten (9). Systemisch kann das Lokalanästhetikum auf unterschiedlicher Weise wirken: unabsichtliche intravasale Injektion, verstärkte lokale Aufnahme (infolge eines Entzündungsprozesses) und ebenso relative oder absolute Überdosierung (4). Ätiologisch ist eine Intoxikation mit Lokalanästhetika auf absolute oder relative Überdosierung zurückzuführen (5, 7). Überdosierung mit einem Lokalanästhetikum wird definiert als ein zu hoher Blutspiegel des Lokalanästhetikums, durch welchen klinische Zeichen und Symptome in verschiedenen Zielorganen und Geweben auftreten können. Prädisponierende Faktoren sind: Patienten-assoziiert: Alter, Gewicht, andere Medikamente, Genetik, Nachweis einer Krankheit, Geisteshaltung und Umwelt. Lokalanästhetika-assoziiert: Vasoaktivität, Konzentration der Substanz, Dosis, Verabreichungsweg, Injektionsrate, Durchblutung des Injektionsortes, Vasokonstriktorenzusatz Die Gefahr einer Überdosierung mit Lokalanästhetika ist am häufigsten bei Kleinkindern, vor allem dann, wenn zusätzlich folgende Faktoren gemeinsam auftreten: Behandlung aller 4 Quadranten in einer Sitzung Applikation des reinen Lokalanästhetikums ohne Vasokonstriktorenzusatz (z. B. Mepivacain 3 % oder Prilocain 4 %) Gleichzeitige Applikation von Lokalanästhetika in alle 4 Quadranten Überschreiten der empfohlenen Maximaldosis im Bezug auf das Körpergewicht (33). 41
43 Tabelle 3 Klinische Einteilung und Maßnahmen zur Behandlung von Lokalanästhetikaintoxikationen Schweregrad Symptomatik Sofortmaßnahmen Leichte Intoxikation - Ohrensausen - Schwindel - taubes Gefühl im perioralen Bereich - Metallgeschmack - Benommenheit - Zittern Mittelschwere - Erbrechen Intoxikation - Sprechstörungen - Bewusstseinsverlust - Muskelzuckungen - klonisch-tonische Krämpfe Schwere Intoxikation - ZNS-Depression - Koma - unregelmäßige Atmung - Atemstillstand - Blutdruckabfall - Bradykardie - Hyposystolie Leichte und mittelschwere Intoxikation: - Injektion abbrechen - Flachlagerung mit angehobenem Oberkörper - Sauerstoffzufuhr mg Midazolam (Dormicum) i.m. (0,15-0,2mg/kg KG) Adrenalin i.v. (1ml auf 10ml 0,9%iger NaCl-Lösung) oder intralingual (0,2-0,5mg) - Intubation - Beatmung mit Sauerstoff - Katecholamine und Volumenzufuhr zur Behandlung der Kreislaufdepression Modifiziert nach Schwenzer N, Schwenzer-Zimmerer Katja. Lokale Schmerzausschaltung (Lokalanästhesie). In: Schwenzer N, Ehrenfeld M, editors. Chirurgische Grundlagen. 4th ed. Stuttgart: Thieme; pp Biel (11) informiert, dass bei der Intoxikation mit lokalanästhetischen Substanzen zuerst die Vitalparameter des Organismus gesichert werden sollten mit z. B. Sauerstoffbeatmung und Herzdruckmassage. Zur Unterdrückung von Krämpfen empfiehlt er die i.v. Injektion von Diazepam (15-30 mg) oder Thiopental (Trapanal, mg). Ausnahmsweise sind in besonderen Fällen die zusätzliche Injektion des depolarisierenden Muskelrelaxans Suxamethonium und eine Intubation erforderlich (11). Allergie ist eine Unverträglichkeitsreaktion, die durch Wirkung und wiederholte Exposition von einem bestimmten Allergen entsteht. Allergische Reaktionen haben ein breites Spektrum an klinischen Manifestationen, welche als leichte und verzögerte Reaktionen (innerhalb von 48 Stunden) bis zu unmittelbaren und häufig 42
44 lebensbedrohlichen Reaktionen (innerhalb von Sekunden) nach dem Kontakt mit dem Allergen auftreten können (33). Die Amid-Typ Lokalanästhetika rufen so gut wie nie allergische Reaktionen hervor. Die sporadisch auftretenden allergischen Reaktionen werden durch Konservierungsmittel wie z.b. Methylparaben oder durch Antioxidantien für Catecholaminlösungen (Natriummetabisulfit) verursacht. Bei Ester-Typ Lokalanästhetika, die eine paraständige Aminogruppe in der Struktur enthalten, sind häufiger allergische Reaktionen zu beobachten (11). Epinephrin- und Latex-Allergie können in Verbindung mit Lokalanästhetika ebenfalls auftreten (33). Tabelle 4 Schweregrad-Einteilung und Behandlung anaphylaktoider Reaktionen. Schweregrad Symptome Sofortmaßnahmen Monitoring I Exanthem, Pruritus, Urtikaria, Sofortiger Stopp des Blutdruck, Puls, Konjunktivitis, Rhinitis, evtl. zugeführten Medikamentes, Atmung, Nausea, Erbrechen, Antihistaminikum i.v., z.b.: Bewußtseinslage, Temperaturanstieg Tavegyl 1-2 x 2mg. Sauerstoff Kontrolle mind. 30 nasal min II Bronchospasmus, Antihistaminikum + wie bei I, Kontrolle Tachykardie, evtl. Arrhytmien, Kortikosteroid z.b.: Urbason mind. bis zu 1 Stunde Hypotension solubile 1-2 Amp. zu 40 mg Sauerstoff nasal III Bronchospasmus, ausgeprägte Adrenalin 0,1-0,3 mg i.v. wie bei I, EKG, Hypotension, Angiödem, Kortikosteroide wie unter II, Blutgasanalyse, Larynxödem, Schock Volumensubstitution, evtl. Diurese, Kontrolle Intubation und Beatmung mind. 24 Std. IV Kreislauf- und/oder Reanimationsmaßnahmen wie bei III, Atemstillstand kontinuierliches kardiopulmonales Monitoring Modifiziert nach Kröll W, Schroll K. Lokalanästhesie. In: Schroll K, Watzek G, editors. Zahnärztliche Chirurgie. Band 1. Wien: Verlag Wilhelm Maudrich; pp
45 3.1.6 Kontraindikationen Kontraindikationen für Lokalanästhetikagebrauch sind massive Reizbildungs- oder Reizleitungsstörungen am Herzen, akute entgleiste Herzinsuffizienz und schwere Hypotonie (25). Fakler und Hein (5) führen ihrerseits folgende Kontraindikationen für Lokalanästhesie an: kein Einverständnis des Patienten, Allergie, mangelhafte Kooperation des Patienten, kardiale Dekompensation, schwere Rhythmusstörungen, Leitungsanästhesie (N. alveolaris inferior) bei Gerinnungsstörungen (5) Wechselwirkungen Müller und Nentwig (25) berichten über mögliche Wechselwirkungen bei gleichzeitiger Applikation von in der Leber verstoffwechselten Lokalanästhetika und Erythromycin und Cimetidin. In diesem Fall wird der Metabolismus der zwei letztgenannten vermindert. Werden jedoch andere Pharmaka wie z.b. Propranolol, Diltiazem oder Verapamil, die die renale Ausscheidungsrate negativ beeinflussen, zusammen mit Lokalanästhetika verabreicht, so kann dadurch die Eliminationshalbwertszeit verlängert werden (25). Malamed (36) berichtet über Wechselwirkungen von Lokalanästhetika mit oralen Kontrazeptiva, β-blocker, Kalziumkanal-Blocker, ACE-Hemmer, anderen Antihypertensiva, Antikoagulanzien, Antihystaminika, Antibiotika, Anabolika, Kortikosteroiden, Neuropharmaka und verschiedenen illegalen Drogen (Streetdrugs), ohne näher auf die Mechanismen einzugehen (36). 3.2 Pharmakologie der vasokonstriktorischen Substanzen Alle injizierbaren therapeutisch wirksamen Lokalanästhetika verursachen einen gewissen Grad an Vasodilatation. Das kann von signifikant (Procain) zu minimal (Prilocain, Mepivacain) varieren bzw. von Applikationsort und individueller Patientenreaktion abhängig sein. Als Ursache wird der Entzug des normalerweise ständig vorhandenen Sympathikus-Vasokonstriktorentonus auf die Blutgefäße angesehen. Sympathische autonome Fasern sind auch unmyeliniert und werden sehr rasch von den Lokalanästhetika blockiert. Nach Applikation der Lokalanästhetika kommt es durch die Vasodilatation zu 44
46 einer gesteigerter Durchblutung und Perfusion des lokalen Gewebes. Diese Steigerung der Perfusion hat als Ergebniss folgende Reaktionen: Erhöhte Absorption von Lokalanästhetika in das Kardiovaskuläre System Hohes Plasmaniveau der Lokalanästhetika mit steigendem Risiko für Intoxikation. Verkürzte Wirkdauer und Anästhesietiefe, weil die Lokalanästhetika von ihrem Applikationsort wegdiffundieren. Erhöhte Blutung an der Applikationsstelle wegen erhöhter Perfusion (37). Die Vasokonstriktoren im Lokalanästhetikum haben die Aufgabe, die eigentliche Wirksubstanz für eine längere Zeit am Wirkort zu halten um eine angemessene lokale Wirkung mit geringen systemischen Nebenwirkungen zu erzielen (21). Die therapeutische Breite des Lokalanästhetikums wird als Differenz zwischen therapeutisch wirksamer und toxischer Dosis definiert und wird durch den Zusatz an Vasokonstriktor erhöht (5). Der Zusatz eines Vasokonstriktors hat oft positive Wirkungen, da er an der Operationsstelle die Blutung minimiert, was ein übersehbares Operieren ermöglicht und die Operationsdauer verkürzt (5, 21). Es sind folgende negativen Nebeneffekte der Vasokonstriktoren des Katecholamin-Typs zu nennen: reaktive Hyperämie im Operationsgebiet nach Nachlassen des vasokonstriktorischen Effekts und systemisch stimulierende Wirkungen auf das Herz- Kreislauf-System. Kontraindiziert ist auch die Verwendung von Vasokonstriktoren in Kombination mit Lokalanästhetika im Bereich von Akren (Finger, Zehen) (21). Herausragend ist die Stabilität des Katecholaminzusatzes, jedoch muss geachtet werden dass die Lagerungstemperatur 20 C nicht überschreitet. Weiters soll die Lichteinwirkung vermieden und ein besonderes Augenmerk auf das Ablaufdatum gerichtet werden (7). Adrenalin, Noradrenalin und das HHL-Hormon Felypressin werden als Vasokonstriktoren in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde verwendet. Während Felypressin nur auf das postkapilläre Gefäßbett wirkt, wirken die Sympathikomimetika Adrenalin und Noradrenalin sowohl auf die prekapillären als auch auf die postkapillären Gefäße (7, 9). Die gefäßkontrahierenden Zusätze sind durch folgende Eigenschaften charakterisiert: Sie verlängern die Resorptionszeit und vermindern die systemische Giftigkeit des Lokalanästhetikums Sie verlängern die Wirkdauer und reduzieren den Plasmaspiegel des Lokalanästhetikums (9). Es stellt sich die Frage was der Nutzen des Vasokostriktorenzusatzes ist? In erster Linie ist es der Anstieg in der Dauer und in der Amplitude der Anästhesie, gefolgt vom Einfluss auf 45
47 örtliche Hämostasereaktionen. Außerdem sinkt im Serum die Maximalkonzentration der Lokalanästhetika (7). Die Haltbarkeit von Lokalanästhetikakarpulen, welche einen Vasokonstriktor enthalten, beträgt 18 Monate und bei denjenigen ohne Vasokonstriktor ca. 36 Monate (37) Adrenalin (Epinephrin, Suprarenin ) Abbildung 9 Adrenalin. Quelle: Adrenalin: Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch [cited 2012 Nov 17]. Available from: URL: &result=7&q=&dbq_0=adrenalin&dbf_0=psyfulltext&dbt_0=fulltext&o_0=and&searchwithindbid_1=pschykw&searchwithindbid_2=naturonline&searchwithindbid_3=sozmed-online&searchwithindbid_4=tw-online&searchwithindbid_5=hunniusonline&searchwithindbid_6=pflege-online&searchwithindbid_7=ppp-online. Fakler und Hein (5) berichten, dass das über α 1 - und α 2 -adrenerge Rezeptoren wirkende Adrenalin eine Verengung der glatten Gefäßmuskulatur bewirkt und als Vasokonstriktorzusatz das Mittel der Wahl ist (5). Adrenalin führt zur Kontraktion von Kleingefäßen in Haut und Schleimhaut. Durch seine Wirkung auf die β 1 - und β 2 - Rezeptoren kommt es zur erhöhten Herzfrequenz, Hypertension und einer Steigerung des HMV. Besonders betroffen sind dabei die Patienten mit Hyperthyreose. Die Konzentration von Adrenalin in lokalanästhetischen Lösungen beträgt 5-20µg/ml und die Höchstdosis beträgt ca. 150 µg (9). Bei der Intoxikation mit Adrenalin tritt folgende Symptomatik auf: Allgemeinsymptomatik: Blassgesichtigkeit, kalter Schweiß, Mydriasis, Unruhe, Angstzustände Spezielle Symptomatik: erhöhte Herzfrequenz, Hypertonus Dekompensationssymptomatik: Schwindel, Bewusstlosigkeit, tachykarde Arrhythmie, Dyspnoe, akutes Herzversagen, Kardioplegie (7, 38, 39). 46
48 Zusätzlich können pochende Kopfschmerzen, Palpitationen und Schwäche als Symptome einer Adrenalinintoxikation auftreten (33) Noradrenalin (Nor-Epinephrin, Arterenol, Levarterenol, Nor- Exadrin ) Abbildung 10 Noradrenalin. Quelle: Noradrenalin : Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch [cited 2012 Nov 17]. Available from: URL: &result=114&q=&dbq_0=noradrenalin&dbf_0=psyfulltext&dbt_0=fulltext&o_0=and&searchwithindbid_1=pschykw&searchwithindbid_2=naturonline&searchwithindbid_3=sozmed-online&searchwithindbid_4=tw-online&searchwithindbid_5=hunniusonline&searchwithindbid_6=pflege-online&searchwithindbid_7=ppp-online. Nach Fakler und Hein (5) ist beim Noradrenalin im Vergleich zu Adrenalin die α- Rezeptoren vermittelte vasokonstriktorische Wirkung stärker ausgeprägt, da β 2 -Rezeptoren nicht aktiviert werden. Daher wirkt sich dieses auf den peripheren Gefäßwiderstand und den arteriellen Mitteldruck aus, wodurch eine Steigerung hervorgerufen wird (5). Die limitierte Wirkung auf β 1 -Rezeptoren führt zu einer initialen Tachykardie und in der Folge zu einem Hypertonus. Das System reagiert daraufhin mit einer parasympathischen Gegenregulation. Die Anwendung von Noradrenalin ist deshalb kontraindiziert bei Patienten mit Hypertonus und kardialer Dekompensation. Es ist weniger vasokonstriktorisch wirksam als Adrenalin und wird demzufolge in höherer Konzentration (40-100µg/ml) zu lokalanästhetischen Lösungen zugesetzt. Wegen größerer Komplikationsraten und möglicher Nebenwirkungen sind die Präparate mit Adrenalin eher zu bevorzugen (9). Symptome der Noradrenalinintoxikation sind unspezifisch: Blassgesichtigkeit, kalter Schweiß, Cephalea, Hypertonus, Bradykardie, reflektorisch akutes Herzversagen, Kardioplegie (7, 39). Die Mischpräparate aus Epinephrin und Norepinephrin sind ungeeignet (7, 40). 47
49 3.2.3 Felypressin Felypressin oder Octapressin ist ein künstlich hergestelltes HHL-Horomon, welches im Bezug auf die Struktur Unterschiede zu Adiuretin aufweist (9). Seine Strukturformel lautet 2-(Phenylalanin)-8-Lysinvasopressin (41). Es wirkt deutlich schwächer vasokonstriktorisch auf die Kleingefäße als Adrenalin und Noradrenalin. Felypressin beeinflusst die Uterusmuskulatur und besitzt auch antidiuretische Wirkung (9). Felypressin in gebräuchlichen Dosen bewirkt im Gegensatz zu Katecholaminen keine Rhythmusstörungen. Daher wird es bei Patienten mit kardialen Schädigungen als Alternativlösung eingesetzt. Die Lokalanästhetika beinhalten üblicherweise 0,03 IE Felypressin/ml (z.b Xylonest), eine Menge die 6 ml übersteigt, sollte gemieden werden (5) Ornipressin (POR 8) Ornipressin wird als [8-Ornithin]Vasopressin definiert (42). Ornipressin oder POR 8 ist ein Peptid mit etwa gleicher Wirkung wie Felypressin. Es wird selten in der Zahnmedizin verwendet. Eine Ampulle mit Ornipressin enthält 5 IE/ml. Es wird kombiniert mit einer 2 %igen Lidocainlösung indem 1 IE in 10 ml 2 %igen Lidocain zugesetzt wird. Die Höchstdosis beträgt ca. 2 IE. Bei Intoxikation mit Ornipressin kommt es zur Tachykardie und Herzrhythmusstörungen. Es ist kontraindiziert bei Patienten mit Herz-Kreislauf- Problemen (9). In der Vergangenheit sind einzelne fatale Zwischenfälle mit tödlichen Konsequenzen in der Literatur beschrieben worden, und damit ist Ornipressin nicht mehr als die erste Wahl einzustufen. Die Anwendung ist besonders in der Schwangerschaft kontraindiziert, weil eine gewisse myotone Komponente vorhanden ist, und eine Tendenz zur Auslösung von Uteruskontraktionen besteht (4). 48
50 3.3 Weitere Zusätze in Lokalanästhetikalösungen Antioxidans Natriumhydrogensulfit wird als Prophylaxe gegen die Katecholaminoxidation zu Lokalanästhetikalösungen hinzufügt. Nach einiger Zeit wird der Oxidationsstabilisator aufgebraucht und es kommt zur Selbstoxidation des Adrenalins. Bei sulfitsensitiven Patienten, vor allem Asthmatikern, kann es sogar Asthmaanfälle auslösen. Es wird angenommen, dass die Sulfitsensitivität bei ca. 5 % dieser Patienten vorkommen kann (7) Methylparaben Lokalanästhetika-Lösungen können in Vorratsflaschen mit Konservierungsmittel versetzt werden, was aber bei Verwendung von Zylinderampullen nicht notwendig ist. Methylparaben (Methyl-4-Hydrobenzoat) übt eine antimikrobielle Wirkung auf grammpositive Bakterien und Pilze aus (7). Müller und Nentwig (25) informieren, dass Methylparaben nur in Mehrfachentnahmeflaschen enthalten ist (25). Das Methylparaben ist in der Lage, wegen den sog. Paragruppen die anaphylaktische Reaktion auszulösen. Man empfiehlt deshalb die Anwendung von methylparabenfreien Präparaten (7) Natriumchlorid und destilliertes Wasser Natriumchlorid wird in Lokalanästhetikalösungen zugesetzt um sie zu isotonisieren. Destilliertes Wasser wird als Lösungsmittel für Lokalanästhetika eingesetzt und dient auch als Volumengeber bei Verwendung der Karpulen (43). 49
51 3.4 Organisatorische Aspekte, Instrumentarium und Applikationsempfehlungen einer Lokalanästhesie Es ist wichtig, folgende Faktoren bei der Selektion und Applikation von Lokalanästhetika zu berücksichtigen: Schmerzdauer und damit Dauer der Lokalanästhetikawirkung Potenzieller Bedarf der Schmerzkontrolle nach Behandlung Möglichkeit der Selbstverletzung der Patienten in der postoperativen Phase Blutstillung Vorhandensein von relativen und/oder absoluten Kontraindikationen der gewählten Lokalanästhetikalösung (44) Instrumentarium Das notwendige Instrumentarium zur Verabreichung von Lokalanästhetikalösungen beinhaltet v.a. Spritzensysteme und Kanülen (7). Es werden folgende Spritzensysteme unterschieden: Karpulensysteme, Einmalspritzen (Kunststoffspritzen), Spritzen mit Sicherheitssystemen und C-CLAD (Computer-controlled local anesthetic delivery systems) (45). In der Praxis haben sich die Karpulensysteme (Zylinderampullen mit entsprechendem Halter) etabliert. Diese vermeiden intravasale Injektion des Lokalanästhetikums durch aktive oder passive Aspiration (46). Es empfiehlt sich in der Praxis die Kanülen mit mm bzw mm Länge und mit einem Radius von 0,4-0,5 mm (für ILA 0,3 mm) zu verwenden (7) Empfehlungen zur Applikation von Lokalanästhetika. Die Verabreichung der lokalanästhetischen Lösung umfasst Punktion, Aspiration und Injektion. Man unterscheidet folgende Maßnahmen, die bei Verabreichung von lokanästhetischen Lösungen von Bedeutung sind: Nach erfolgter Punktion sollte man mindestens in zwei Ebenen aspirieren. Einsatz eines kleinen Depots für die sichere Anästhesie der Injektionsstelle. Applikation der Lokalanästhetikalösung sollte unter Abgabe kleiner Dosen bis zur tatsächlichen Injektionsstelle erfolgen. 50
52 Behandlung erst nach Ausbildung der Anästhesie (ca. 3 min) (7). 3.5 Formen der Lokalanästhesie Folgende Formen von Lokalanästhesie werden unterschieden, nämlich Infiltrations-, Leitungs- und Oberflächenanästhesie (s. Abb. 11). Die Lokalanästhetika werden auf dem Wege der Infiltration in das zu behandelnde Gebiet verabreicht (Infiltrationsanästhesie). Eine andere Möglichkeit ist die Injektion im Bereich der Nerven, die die sensiblen Fasern aus dem Behandlungsort tragen (Leitungsanästhesie am Nerven, z. B. N. maxillaris oder N. mandibularis). Weiters kann das Aufbringen des betäubenden Mittels auf Haut oder Schleimhäute erfolgen (Oberflächenanästhesie). In diesem Fall muss der Wirkstoff vom Verabreichungsort zum Wirkort (dem zu behandelnden Nerv) diffundieren (21). Abbildung 11 Applikationsarten der Lokalanästhesie. Quelle: Gierl F. Die Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde. Quintessenz Team-Journal 2009; 39: Nach Fakler und Hein (5) ist auch die intraligamentäre Anästhesie eine lokalanästhetische Behandlungsmethode in der Zahnarztpraxis (5) Oberflächenanästhesie Die Oberflächenanästhesie wird als örtliche Diffusion der direkt auf die Schleimhaut der Mundhöhle und Nasenhöhle applizierten Lokalanästhetika definiert. Typische Vertreter der 51
Physiologische Grundlagen. Inhalt
 Physiologische Grundlagen Inhalt Das Ruhemembranpotential - RMP Das Aktionspotential - AP Die Alles - oder - Nichts - Regel Die Klassifizierung der Nervenfasern Das Ruhemembranpotential der Zelle RMP Zwischen
Physiologische Grundlagen Inhalt Das Ruhemembranpotential - RMP Das Aktionspotential - AP Die Alles - oder - Nichts - Regel Die Klassifizierung der Nervenfasern Das Ruhemembranpotential der Zelle RMP Zwischen
1 Bau von Nervenzellen
 Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
 Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
7.1. Die Rückenmarknerven (Die Spinalnerven): Siehe Bild Nervenbahnen
 7. Das periphere Nervensystem: 7.1. Die Rückenmarknerven (Die Spinalnerven): Siehe Bild Nervenbahnen 7.2. Die Hirnnerven: Sie stammen aus verschiedenen Zentren im Gehirn. I - XII (Parasympathikus: 3,7,9,10)
7. Das periphere Nervensystem: 7.1. Die Rückenmarknerven (Die Spinalnerven): Siehe Bild Nervenbahnen 7.2. Die Hirnnerven: Sie stammen aus verschiedenen Zentren im Gehirn. I - XII (Parasympathikus: 3,7,9,10)
Schmerz, Grundlagen AB 1-1, S. 1
 Schmerz, Grundlagen AB 1-1, S. 1 Text 1: Schmerzqualitäten Zunächst einmal unterscheidet man zwischen somatischen und visceralen Schmerzen. Somatischer Schmerz geht von der Haut, von Muskeln, Gelenken,
Schmerz, Grundlagen AB 1-1, S. 1 Text 1: Schmerzqualitäten Zunächst einmal unterscheidet man zwischen somatischen und visceralen Schmerzen. Somatischer Schmerz geht von der Haut, von Muskeln, Gelenken,
Unterschied zwischen aktiver und passiver Signalleitung:
 Unterschied zwischen aktiver und passiver Signalleitung: Passiv: Ein kurzer Stromimpuls wird ohne Zutun der Zellmembran weitergeleitet Nachteil: Signalstärke nimmt schnell ab Aktiv: Die Zellmembran leitet
Unterschied zwischen aktiver und passiver Signalleitung: Passiv: Ein kurzer Stromimpuls wird ohne Zutun der Zellmembran weitergeleitet Nachteil: Signalstärke nimmt schnell ab Aktiv: Die Zellmembran leitet
abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung
 abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Bau Nervenzelle Neuron (Nervenzelle) Dentrit Zellkörper Axon Synapse Gliazelle (Isolierung) Bau Nervenzelle Bau Nervenzelle Neurobiologie
abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Bau Nervenzelle Neuron (Nervenzelle) Dentrit Zellkörper Axon Synapse Gliazelle (Isolierung) Bau Nervenzelle Bau Nervenzelle Neurobiologie
2.1. Allgemeine Sinnesphysiologie
 2.1. Allgemeine Sinnesphysiologie Sender Licht Druck Schallwellen Sendecode Mechanorezeptor Selektiv - sensitiver Übersetzer Verstärker Empfänger neurales Signal Reiz Strukturelle Änderung der Membrankanäle
2.1. Allgemeine Sinnesphysiologie Sender Licht Druck Schallwellen Sendecode Mechanorezeptor Selektiv - sensitiver Übersetzer Verstärker Empfänger neurales Signal Reiz Strukturelle Änderung der Membrankanäle
BK07_Vorlesung Physiologie. 05. November 2012
 BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie. - Erregungsausbreitung -
 Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Gädecke: Isolation des Alkaloids aus Erythroxylon coca. Thomas Moreno y Maiz, peruanischer Generalarzt: erste Anwendung in Tierversuchen
 Lokalanästhetika Erythroxylon coca ocastrauch ocain T. ocain ocainund Lokalanästhesie 1855 1859 1868 1884 1884 1885 Gädecke: Isolation des Alkaloids aus Erythroxylon coca Riemann: Reindarstellung von ocain
Lokalanästhetika Erythroxylon coca ocastrauch ocain T. ocain ocainund Lokalanästhesie 1855 1859 1868 1884 1884 1885 Gädecke: Isolation des Alkaloids aus Erythroxylon coca Riemann: Reindarstellung von ocain
Neuronale Signalverarbeitung
 neuronale Signalverarbeitung Institut für Angewandte Mathematik WWU Münster Abschlusspräsentation am 08.07.2008 Übersicht Aufbau einer Nervenzelle Funktionsprinzip einer Nervenzelle Empfang einer Erregung
neuronale Signalverarbeitung Institut für Angewandte Mathematik WWU Münster Abschlusspräsentation am 08.07.2008 Übersicht Aufbau einer Nervenzelle Funktionsprinzip einer Nervenzelle Empfang einer Erregung
Einige Grundbegriffe der Elektrostatik. Elementarladung: e = C
 Einige Grundbegriffe der Elektrostatik Es gibt + und - Ladungen ziehen sich an Einheit der Ladung 1C Elementarladung: e = 1.6.10-19 C 1 Abb 14.7 Biologische Physik 2 Parallel- und Serienschaltung von Kondensatoren/Widerständen
Einige Grundbegriffe der Elektrostatik Es gibt + und - Ladungen ziehen sich an Einheit der Ladung 1C Elementarladung: e = 1.6.10-19 C 1 Abb 14.7 Biologische Physik 2 Parallel- und Serienschaltung von Kondensatoren/Widerständen
Übung 6 Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester Nervenzellen: Kapitel 4. 1
 Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 21. 04. 08-16:30
Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 21. 04. 08-16:30
Weitere Nicht-Opioid-Analgetika
 Analgetika II apl. Prof. Dr. med. A. Lupp Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universitätsklinikum Jena Drackendorfer Str. 1, 07747 Jena Tel.: (9)325678 oder -88 e-mail: Amelie.Lupp@med.uni-jena.de
Analgetika II apl. Prof. Dr. med. A. Lupp Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universitätsklinikum Jena Drackendorfer Str. 1, 07747 Jena Tel.: (9)325678 oder -88 e-mail: Amelie.Lupp@med.uni-jena.de
Nanostrukturphysik II Michael Penth
 16.07.13 Nanostrukturphysik II Michael Penth Ladungstransport essentiell für Funktionalität jeder Zelle [b] [a] [j] de.academic.ru esys.org giantshoulders.wordpress.com [f] 2 Mechanismen des Ionentransports
16.07.13 Nanostrukturphysik II Michael Penth Ladungstransport essentiell für Funktionalität jeder Zelle [b] [a] [j] de.academic.ru esys.org giantshoulders.wordpress.com [f] 2 Mechanismen des Ionentransports
Membranen und Potentiale
 Membranen und Potentiale 1. Einleitung 2. Zellmembran 3. Ionenkanäle 4. Ruhepotential 5. Aktionspotential 6. Methode: Patch-Clamp-Technik Quelle: Thompson Kap. 3, (Pinel Kap. 3) 2. ZELLMEMBRAN Abbildung
Membranen und Potentiale 1. Einleitung 2. Zellmembran 3. Ionenkanäle 4. Ruhepotential 5. Aktionspotential 6. Methode: Patch-Clamp-Technik Quelle: Thompson Kap. 3, (Pinel Kap. 3) 2. ZELLMEMBRAN Abbildung
Anatomie/Physiologie 19.05.04 (Dr. Shakibaei) Nervengewebe. besteht aus 2 Bestandteilen:
 Anatomie/Physiologie 19.05.04 (Dr. Shakibaei) Nervengewebe besteht aus 2 Bestandteilen: Nervenzelle ( Neuron : Signal aufnehmen, verarbeiten und weiterleiten) Gliazelle, Stützzelle: div. metabolische Funktionen
Anatomie/Physiologie 19.05.04 (Dr. Shakibaei) Nervengewebe besteht aus 2 Bestandteilen: Nervenzelle ( Neuron : Signal aufnehmen, verarbeiten und weiterleiten) Gliazelle, Stützzelle: div. metabolische Funktionen
Schmerz. Schmerzempfindung
 Schmerzempfindung Definition Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung einhergeht oder von Betroffenen so beschrieben wird, als wäre
Schmerzempfindung Definition Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung einhergeht oder von Betroffenen so beschrieben wird, als wäre
Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung
 Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang CHRISANA Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung Inhaltsverzeichnis des Moduls Nervensystem Anatomie des
Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang CHRISANA Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung Inhaltsverzeichnis des Moduls Nervensystem Anatomie des
Anatomie des Nervensystems
 Anatomie des Nervensystems Gliederung Zentrales Nervensystem Gehirn Rückenmark Nervensystem Peripheres Nervensystem Somatisches Nervensystem Vegetatives Nervensystem Afferente Nerven Efferente Nerven Afferente
Anatomie des Nervensystems Gliederung Zentrales Nervensystem Gehirn Rückenmark Nervensystem Peripheres Nervensystem Somatisches Nervensystem Vegetatives Nervensystem Afferente Nerven Efferente Nerven Afferente
Patienteninformation. Was Sie über Schmerzen wissen sollten. Die mit dem Regenbogen
 Patienteninformation Was Sie über Schmerzen wissen sollten Die mit dem Regenbogen Patienteninformation Warnsignale des Körpers Schmerzen sind Warnsignale des Körpers. Sie zeigen an, dass etwas nicht in
Patienteninformation Was Sie über Schmerzen wissen sollten Die mit dem Regenbogen Patienteninformation Warnsignale des Körpers Schmerzen sind Warnsignale des Körpers. Sie zeigen an, dass etwas nicht in
Reizleitung in Nervenzellen. Nervenzelle unter einem Rasterelektronenmikroskop
 Reizleitung in Nervenzellen Nervenzelle unter einem Rasterelektronenmikroskop Gliederung: 1. Aufbau von Nervenzellen 2. Das Ruhepotential 3. Das Aktionspotential 4. Das Membranpotential 5. Reizweiterleitung
Reizleitung in Nervenzellen Nervenzelle unter einem Rasterelektronenmikroskop Gliederung: 1. Aufbau von Nervenzellen 2. Das Ruhepotential 3. Das Aktionspotential 4. Das Membranpotential 5. Reizweiterleitung
Schematische Übersicht über das Nervensystem eines Vertebraten
 Schematische Übersicht über das Nervensystem eines Vertebraten Die Integration des sensorischen Eingangs und motorischen Ausgangs erfolgt weder stereotyp noch linear; sie ist vielmehr durch eine kontinuierliche
Schematische Übersicht über das Nervensystem eines Vertebraten Die Integration des sensorischen Eingangs und motorischen Ausgangs erfolgt weder stereotyp noch linear; sie ist vielmehr durch eine kontinuierliche
Natriumkanäle: Neue Zielscheiben für Schmerzmittel. Förderpreis für Schmerzforschung an Münchner Forscher verliehen
 Natriumkanäle: Neue Zielscheiben für Schmerzmittel Förderpreis für Schmerzforschung an Münchner Forscher verliehen Berlin (8. Oktober 2008) - Eine über 40 Jahre alte Theorie zur Funktion von Schmerzrezeptoren
Natriumkanäle: Neue Zielscheiben für Schmerzmittel Förderpreis für Schmerzforschung an Münchner Forscher verliehen Berlin (8. Oktober 2008) - Eine über 40 Jahre alte Theorie zur Funktion von Schmerzrezeptoren
Entdeckungen unter der Schädeldecke. Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie
 Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Transmitterstoff erforderlich. und Tremor. Potenziale bewirken die Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen. Begriffen
 4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
Adrenalin in digitalen Blocks führt zu Nekrose. Mythos oder Wahrheit?
 Adrenalin in digitalen Blocks führt zu Nekrose. Mythos oder Wahrheit? Frank Mattes Ambulantes Operationszentrum (AOZ) Tuttlingen Seite 1 11 Hintergrund In den USA ist die Verwendung von Mischungen aus
Adrenalin in digitalen Blocks führt zu Nekrose. Mythos oder Wahrheit? Frank Mattes Ambulantes Operationszentrum (AOZ) Tuttlingen Seite 1 11 Hintergrund In den USA ist die Verwendung von Mischungen aus
Jürgen Sandkühler. Downloads:
 Jürgen Sandkühler Downloads: http://cbr.meduniwien.ac.at Neuroinflammation beim Schmerz - Optionen für die Prävention und Therapie chronischer Schmerzen Jürgen Sandkühler Zentrum für Hirnforschung Medizinische
Jürgen Sandkühler Downloads: http://cbr.meduniwien.ac.at Neuroinflammation beim Schmerz - Optionen für die Prävention und Therapie chronischer Schmerzen Jürgen Sandkühler Zentrum für Hirnforschung Medizinische
Schmerztherapie. Bearbeitet von Thomas Cegla, Antje Gottschalk
 Schmerztherapie Bearbeitet von Thomas Cegla, Antje Gottschalk 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 300 S. Paperback ISBN 978 3 13 145741 7 Format (B x L): 14 x 10300 cm Weitere Fachgebiete > Medizin > Sonstige
Schmerztherapie Bearbeitet von Thomas Cegla, Antje Gottschalk 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 300 S. Paperback ISBN 978 3 13 145741 7 Format (B x L): 14 x 10300 cm Weitere Fachgebiete > Medizin > Sonstige
Zentrales Nervensystem
 Zentrales Nervensystem Funktionelle Neuroanatomie (Struktur und Aufbau des Nervensystems) Neurophysiologie (Ruhe- und Aktionspotenial, synaptische Übertragung) Fakten und Zahlen (funktionelle Auswirkungen)
Zentrales Nervensystem Funktionelle Neuroanatomie (Struktur und Aufbau des Nervensystems) Neurophysiologie (Ruhe- und Aktionspotenial, synaptische Übertragung) Fakten und Zahlen (funktionelle Auswirkungen)
Die sympathische und sensible Atemwegsinnervation der Ratte: Herkunft und neurochemische Charakterisierung
 Aus der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Die sympathische und sensible Atemwegsinnervation
Aus der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Die sympathische und sensible Atemwegsinnervation
NaCl. Die Originallinolschnitte, gedruckt von Marc Berger im V.E.B. Schwarzdruck Berlin, liegen als separate Auflage in Form einer Graphikmappe vor.
 NaCl Künstlerische Konzeption: Xenia Leizinger Repros: Roman Willhelm technische Betreuung und Druck: Frank Robrecht Schrift: Futura condensed, Bernhard Modern Papier: Igepa Design Offset naturweiß 120
NaCl Künstlerische Konzeption: Xenia Leizinger Repros: Roman Willhelm technische Betreuung und Druck: Frank Robrecht Schrift: Futura condensed, Bernhard Modern Papier: Igepa Design Offset naturweiß 120
Molekulare Ursachen neuraler Krankheiten: Schmerzwahrnehmung. von David Kartte & Michael Bell
 Molekulare Ursachen neuraler Krankheiten: von David Kartte & Michael Bell Gliederung Definition von Schmerz Schmerzarten & - komponenten Nozizeptoren Aufbau A- & C-Fasern Ausstattung mit Ionenkanälen Temperatursinn
Molekulare Ursachen neuraler Krankheiten: von David Kartte & Michael Bell Gliederung Definition von Schmerz Schmerzarten & - komponenten Nozizeptoren Aufbau A- & C-Fasern Ausstattung mit Ionenkanälen Temperatursinn
Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen
 Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen Kontaktpunkt zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen Nervenzelle und Zielzelle (z.b. Muskelfaser) Synapse besteht aus präsynaptischen Anteil (sendendes
Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen Kontaktpunkt zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen Nervenzelle und Zielzelle (z.b. Muskelfaser) Synapse besteht aus präsynaptischen Anteil (sendendes
Manuelle Therapie und vegetatives Nervensystem. Die Sicht eines Grundlagenforschers
 Manuelle Medizin SAMM Interlaken 2012 Die Sicht eines Grundlagenforschers Wilfrid Jänig Physiologisches Institut Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Kiel Erkrankungen (einschließlich Schmerzkrankheit)
Manuelle Medizin SAMM Interlaken 2012 Die Sicht eines Grundlagenforschers Wilfrid Jänig Physiologisches Institut Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Kiel Erkrankungen (einschließlich Schmerzkrankheit)
Zelltypen des Nervensystems
 Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
2.) Material und Methode
 1.) Einleitung: Wenn man unser Nervensystem und moderne Computer vergleicht fällt erstaunlicherweise auf, dass das Nervensystem ungleich komplexer ist. Dazu ein kurzer Überblick: Das menschliche Nervensystem
1.) Einleitung: Wenn man unser Nervensystem und moderne Computer vergleicht fällt erstaunlicherweise auf, dass das Nervensystem ungleich komplexer ist. Dazu ein kurzer Überblick: Das menschliche Nervensystem
Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle
 Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle 1 Extrazellulär Entstehung des Ruhepotentials K+ 4mM Na+ 120 mm Gegenion: Cl- K + kanal offen Na + -kanal zu Na + -K + Pumpe intrazellulär K+ 120 mm Na+ 5 mm
Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle 1 Extrazellulär Entstehung des Ruhepotentials K+ 4mM Na+ 120 mm Gegenion: Cl- K + kanal offen Na + -kanal zu Na + -K + Pumpe intrazellulär K+ 120 mm Na+ 5 mm
Die differenzierte Lokalanästhesie
 Die differenzierte Lokalanästhesie Die lokale Schmerzausschaltung ist für die moderne Zahnheilkunde von zentraler Bedeutung. Je differenzierter die einzelnen relevanten Parameter erhoben und beachtet werden,
Die differenzierte Lokalanästhesie Die lokale Schmerzausschaltung ist für die moderne Zahnheilkunde von zentraler Bedeutung. Je differenzierter die einzelnen relevanten Parameter erhoben und beachtet werden,
REFLEKTIEREN & MOTIVIEREN LOKALANÄSTHESIE. Ester und Amide
 1 2 3 3 4 4 5 5 0 2 4 11 Rund vier Jahrzehnte vor der Lokalanästhesie brachte die Bostoner Kugel (s. Einstiegsbild) mit Äther-Dampf 1 den Sieg über den Schmerz. Damit versetzten der Zahnarzt Thomas Morton
1 2 3 3 4 4 5 5 0 2 4 11 Rund vier Jahrzehnte vor der Lokalanästhesie brachte die Bostoner Kugel (s. Einstiegsbild) mit Äther-Dampf 1 den Sieg über den Schmerz. Damit versetzten der Zahnarzt Thomas Morton
Aufbau und Funktionweise der Nervenzelle - Wiederholung Vorlesung -
 Aufbau und Funktionweise der Nervenzelle - Wiederholung Vorlesung - Fragen zur Vorlesung: Welche Zellen können im Nervensystem unterschieden werden? Aus welchen Teilstrukturen bestehen Neuronen? Welche
Aufbau und Funktionweise der Nervenzelle - Wiederholung Vorlesung - Fragen zur Vorlesung: Welche Zellen können im Nervensystem unterschieden werden? Aus welchen Teilstrukturen bestehen Neuronen? Welche
Checkliste zur Kausalitätsattribuierung bei vermuteter toxischer Polyneuropathie
 Aus dem Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Zentrum für Gesundheitswissenschaften Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin Direktor: Prof. Dr.
Aus dem Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Zentrum für Gesundheitswissenschaften Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin Direktor: Prof. Dr.
9 Nozizeption und Schmerz
 9.1 Nozizeption und Schmerz bei Reizeinwirkung 9 Nozizeption und Schmerz H. O. Handwerker und H.-G. Schaible 229 9 > > Einleitung Schmerz spürt man, wenn man einen kräftigen Schlag erhält, aber auch wenn
9.1 Nozizeption und Schmerz bei Reizeinwirkung 9 Nozizeption und Schmerz H. O. Handwerker und H.-G. Schaible 229 9 > > Einleitung Schmerz spürt man, wenn man einen kräftigen Schlag erhält, aber auch wenn
Gelöste Teilchen diffundieren von Orten höherer Konzentration zu Orten geringerer Konzentration
 1 Transportprozesse: Wassertransport: Mit weinigen ausnahmen ist die Zellmembran frei durchlässig für Wasser. Membrantransport erfolgt zum größten Teil über Wasserkanäle (Aquaporine) sowie über Transportproteine
1 Transportprozesse: Wassertransport: Mit weinigen ausnahmen ist die Zellmembran frei durchlässig für Wasser. Membrantransport erfolgt zum größten Teil über Wasserkanäle (Aquaporine) sowie über Transportproteine
Warum hat mein Patient Schmerzen? Hans-Georg Schaible Institut für Physiologie 1/ Neurophysiologie Universität Jena
 Warum hat mein Patient Schmerzen? Hans-Georg Schaible Institut für Physiologie 1/ Neurophysiologie Universität Jena Fragen, die gestellt werden müssen: 1) Wodurch sind die Schmerzen entstanden? Einordnung
Warum hat mein Patient Schmerzen? Hans-Georg Schaible Institut für Physiologie 1/ Neurophysiologie Universität Jena Fragen, die gestellt werden müssen: 1) Wodurch sind die Schmerzen entstanden? Einordnung
Spastik und Schmerz. S. Rehm, R. Baron Sektion für Neurologische Schmerzforschung und -therapie Klinik für Neurologie, Kiel
 Spastik und Schmerz S. Rehm, R. Baron Sektion für Neurologische Schmerzforschung und -therapie Klinik für Neurologie, Kiel Deutschland: häufigster Grund für Arztbesuche 5-9 Millionen Patienten mit chronischen
Spastik und Schmerz S. Rehm, R. Baron Sektion für Neurologische Schmerzforschung und -therapie Klinik für Neurologie, Kiel Deutschland: häufigster Grund für Arztbesuche 5-9 Millionen Patienten mit chronischen
Die Bearbeitung erfolgt mit Textausschnitten des Buches Chemie Teil 2 (Diesterweg Verlag)
 Pharmazeutische Chemie Seite 1 Die Bearbeitung erfolgt mit Textausschnitten des Buches Chemie Teil 2 (Diesterweg Verlag) Fragen zu der sp³ Hybridisierung (S. 124-128): 1.) Notieren Sie die Elektronenverteilung
Pharmazeutische Chemie Seite 1 Die Bearbeitung erfolgt mit Textausschnitten des Buches Chemie Teil 2 (Diesterweg Verlag) Fragen zu der sp³ Hybridisierung (S. 124-128): 1.) Notieren Sie die Elektronenverteilung
1 Physiologische Grundlagen von Nozizeption und Schmerz
 1 Physiologische Grundlagen von Nozizeption und Schmerz Hans-Georg Schaible 1.1 Nozizeption und Schmerz Nozizeption ist die Erkennung und Verarbeitung von gewebeschädigenden (noxischen) Reizen durch das
1 Physiologische Grundlagen von Nozizeption und Schmerz Hans-Georg Schaible 1.1 Nozizeption und Schmerz Nozizeption ist die Erkennung und Verarbeitung von gewebeschädigenden (noxischen) Reizen durch das
Transduktion bei den Nozizeptoren
 Transduktion bei den Nozizeptoren AB 2-1 Aufgabe 1 Beschriften Sie die Abbildung mit folgenden Begriffen: Fasern des Cytoskletts - Zellmembran - Natrium- Ionen - Einströmen von Natrium-Ionen, geschlossener
Transduktion bei den Nozizeptoren AB 2-1 Aufgabe 1 Beschriften Sie die Abbildung mit folgenden Begriffen: Fasern des Cytoskletts - Zellmembran - Natrium- Ionen - Einströmen von Natrium-Ionen, geschlossener
Lückentexte. Muskelzelle (allgemeines) Die Muskelzelle besitzt im hohen Maße die Fähigkeit zum Zusammenziehen (Kontraktion)
 Lückentexte Muskelgewebe Muskelzelle (allgemeines) Die Muskelzelle besitzt im hohen Maße die Fähigkeit zum Zusammenziehen (Kontraktion) Die Muskelzelle lagert Myoglobin als Sauerstoffspeicher ein, das
Lückentexte Muskelgewebe Muskelzelle (allgemeines) Die Muskelzelle besitzt im hohen Maße die Fähigkeit zum Zusammenziehen (Kontraktion) Die Muskelzelle lagert Myoglobin als Sauerstoffspeicher ein, das
Aktionspotential - Variante 1: vom Text zum Fließdiagramm -
 Aktionspotential - Variante 1: vom Text zum Fließdiagramm - Über das Axon leiten Nervenzellen Informationen verschlüsselt in Form von elektrischen Impulsen weiter, den Aktionspotentialen. Dabei verändern
Aktionspotential - Variante 1: vom Text zum Fließdiagramm - Über das Axon leiten Nervenzellen Informationen verschlüsselt in Form von elektrischen Impulsen weiter, den Aktionspotentialen. Dabei verändern
Autoimmunerkrankung Erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen körpereigenes Gewebe richtet.
 Glossar Adhärenz Therapietreue: Konsequentes Einhalten der Therapie. Autoimmunerkrankung Erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen körpereigenes Gewebe richtet. Axon Fortsatz einer Nervenzelle, der
Glossar Adhärenz Therapietreue: Konsequentes Einhalten der Therapie. Autoimmunerkrankung Erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen körpereigenes Gewebe richtet. Axon Fortsatz einer Nervenzelle, der
Tutoriat zur Vorlesung Neuronale Informationsverarbeitung im HS 2010
 Tutoriat zur Vorlesung Neuronale Informationsverarbeitung im HS 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Wie definiert man elektrische
Tutoriat zur Vorlesung Neuronale Informationsverarbeitung im HS 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Wie definiert man elektrische
Expression und Funktion. von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten. Hirngewebe der Maus
 Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Wdh. Aufbau Struktur Gehirn
 KW38 MKPs Orga Wdh. Aufbau Struktur Gehirn ZNS/PNS Videotime HA: Gehirn limbisches System Das limbische System 31.3 (S. 418) Aufgabe: Aufgabe 31.3 mit Verwendung der Fachbegriffe in Form eines Lernscripts.
KW38 MKPs Orga Wdh. Aufbau Struktur Gehirn ZNS/PNS Videotime HA: Gehirn limbisches System Das limbische System 31.3 (S. 418) Aufgabe: Aufgabe 31.3 mit Verwendung der Fachbegriffe in Form eines Lernscripts.
7 Neurobiologie. 7.1 Die Nervenzelle. Aufgabe 7.1-1: Bau der Nervenzelle
 7 Neurobiologie 7.1 Die Nervenzelle Aufgabe 7.1-1: Bau der Nervenzelle a) Benenne die Bestandteile der Nervenzelle! b) Welche Aufgaben haben die einzelnen Bestandteile der Nervenzelle? c) Fertige von den
7 Neurobiologie 7.1 Die Nervenzelle Aufgabe 7.1-1: Bau der Nervenzelle a) Benenne die Bestandteile der Nervenzelle! b) Welche Aufgaben haben die einzelnen Bestandteile der Nervenzelle? c) Fertige von den
Neuronale Grundlagen bei ADHD. (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung. Dr. Lutz Erik Koch
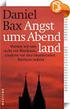 Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Das Neuron (= Die Nervenzelle)
 Das Neuron (= Die Nervenzelle) Die Aufgabe des Neurons besteht in der Aufnahme, Weiterleitung und Übertragung von Signalen. Ein Neuron besitzt immer eine Verbindung zu einer anderen Nervenzelle oder einer
Das Neuron (= Die Nervenzelle) Die Aufgabe des Neurons besteht in der Aufnahme, Weiterleitung und Übertragung von Signalen. Ein Neuron besitzt immer eine Verbindung zu einer anderen Nervenzelle oder einer
Glia- sowie Nervenzellen (= Neuronen) sind die Bausteine des Nervensystems. Beide Zellarten unterscheiden sich vorwiegend in ihren Aufgaben.
 (C) 2014 - SchulLV 1 von 5 Einleitung Du stehst auf dem Fußballfeld und dein Mitspieler spielt dir den Ball zu. Du beginnst loszurennen, denn du möchtest diesen Ball auf keinen Fall verpassen. Dann triffst
(C) 2014 - SchulLV 1 von 5 Einleitung Du stehst auf dem Fußballfeld und dein Mitspieler spielt dir den Ball zu. Du beginnst loszurennen, denn du möchtest diesen Ball auf keinen Fall verpassen. Dann triffst
MOR-NRI neue Substanzklasse im Bereich zentral wirksamer Analgetika
 Behandlung starker chronischer Schmerzen Neues zentral wirksames Analgetikum Palexia retard ist nun verfügbar Hamburg (8. September 2010) - Ab Oktober 2010 wird mit PALEXIA retard (Wirkstoff Tapentadol)
Behandlung starker chronischer Schmerzen Neues zentral wirksames Analgetikum Palexia retard ist nun verfügbar Hamburg (8. September 2010) - Ab Oktober 2010 wird mit PALEXIA retard (Wirkstoff Tapentadol)
Erregungsübertragung an Synapsen. 1. Einleitung. 2. Schnelle synaptische Erregung. Biopsychologie WiSe Erregungsübertragung an Synapsen
 Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin
 Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin Klinische Doppelblindstudie über den präoperativen Einsatz von Methylprednisolonsuccinat beim thorakolumbalen Bandscheibenvorfall
Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin Klinische Doppelblindstudie über den präoperativen Einsatz von Methylprednisolonsuccinat beim thorakolumbalen Bandscheibenvorfall
1 Implantat-Akupunktur Einführung Die klassische Ohrakupunktur Die Suche nach Langzeitstimulation Implantat-Akupunktur 6
 Inhalt 1 Implantat-Akupunktur 2 1.1 Einführung 2 1.2 Die klassische Ohrakupunktur 4 1.3 Die Suche nach Langzeitstimulation 5 1.4 Implantat-Akupunktur 6 2 Die Implantate 10 2.1 Titan-Implantate 10 2.2 Resorbierbare
Inhalt 1 Implantat-Akupunktur 2 1.1 Einführung 2 1.2 Die klassische Ohrakupunktur 4 1.3 Die Suche nach Langzeitstimulation 5 1.4 Implantat-Akupunktur 6 2 Die Implantate 10 2.1 Titan-Implantate 10 2.2 Resorbierbare
Postsynaptische Potenziale
 Postsynaptisches Potenzial Arbeitsblatt Nr 1 Postsynaptische Potenziale Links ist eine Versuchsanordnung zur Messung der Membranpotenziale an verschiedenen Stellen abgebildet. Das Axon links oben wurde
Postsynaptisches Potenzial Arbeitsblatt Nr 1 Postsynaptische Potenziale Links ist eine Versuchsanordnung zur Messung der Membranpotenziale an verschiedenen Stellen abgebildet. Das Axon links oben wurde
Hier geht s zum Buch >> Botenstoffe für Glück und Gesundheit
 Leseprobe aus: Botenstoffe für Glück und Gesundheit von Diethard Stelzl. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Hier geht s zum Buch >> Botenstoffe für Glück
Leseprobe aus: Botenstoffe für Glück und Gesundheit von Diethard Stelzl. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Hier geht s zum Buch >> Botenstoffe für Glück
Biomembranen Transportmechanismen
 Transportmechanismen Barrierewirkung der Membran: freie Diffusion von Stoffen wird unterbunden durch Lipidbilayer selektiver Stofftransport über spezielle Membranproteine = Translokatoren Semipermeabilität
Transportmechanismen Barrierewirkung der Membran: freie Diffusion von Stoffen wird unterbunden durch Lipidbilayer selektiver Stofftransport über spezielle Membranproteine = Translokatoren Semipermeabilität
Hilfe bei Rückenschmerzen - Ohne Medikamente. - Information für Ärzte und Therapeuten -
 Hilfe bei Rückenschmerzen - Ohne Medikamente - Information für Ärzte und Therapeuten - Das Verfahren im bomedus Rückenband wurde seit 2012 mit dem Universitätsklinikum Bonn in klinischen Studien erforscht.
Hilfe bei Rückenschmerzen - Ohne Medikamente - Information für Ärzte und Therapeuten - Das Verfahren im bomedus Rückenband wurde seit 2012 mit dem Universitätsklinikum Bonn in klinischen Studien erforscht.
Bereichslokalisation und Differenzierung in der OMT. OMT.BWS.SOLTAU2010.Teil1
 OMT.BWS.SOLTAU2010.Teil1 Peripher nozizeptiv Peripher neurogen Schmerzmechanismen Zentral / affektiv Zentral neurogen Schmerzmechanismen Gewebeschaden mit Reizung der Nozizeptoren Physiologische Wundheilung
OMT.BWS.SOLTAU2010.Teil1 Peripher nozizeptiv Peripher neurogen Schmerzmechanismen Zentral / affektiv Zentral neurogen Schmerzmechanismen Gewebeschaden mit Reizung der Nozizeptoren Physiologische Wundheilung
Membran- und Donnanpotentiale. (Zusammenfassung)
 Membranund Donnanpotentiale (Zusammenfassung) Inhaltsverzeichnis 1. Elektrochemische Membranen...Seite 2 2. Diffusionspotentiale...Seite 2 3. Donnanpotentiale...Seite 3 4. Zusammenhang der dargestellten
Membranund Donnanpotentiale (Zusammenfassung) Inhaltsverzeichnis 1. Elektrochemische Membranen...Seite 2 2. Diffusionspotentiale...Seite 2 3. Donnanpotentiale...Seite 3 4. Zusammenhang der dargestellten
Nervensysteme 19. Nervensysteme im Vergleich. Einfache Nervennetze. Regenwurm Längsschnitt, Kopfregion. Oesophagus Segment.
 Nervensysteme 19 Nervensysteme im Vergleich Einfache Nervennetze Bauchmark Cephalisation Gehirn Quelle: Deutsch u.a.: klar. Biologie 6, Seite 19 Regenwurm Längsschnitt, Kopfregion Pharynx Oesophagus Segment
Nervensysteme 19 Nervensysteme im Vergleich Einfache Nervennetze Bauchmark Cephalisation Gehirn Quelle: Deutsch u.a.: klar. Biologie 6, Seite 19 Regenwurm Längsschnitt, Kopfregion Pharynx Oesophagus Segment
Nervenphysiologie 3.4.3
 Bewegungssystem 3.4.3 Nervenphysiologie präsynaptische Endigung Dendriten Zellkörper Axonhügel Axon Bau und Einteilung der Neurone Neurone bestehen aus einem Zellkörper und Nervenfortsätzen und sind zur
Bewegungssystem 3.4.3 Nervenphysiologie präsynaptische Endigung Dendriten Zellkörper Axonhügel Axon Bau und Einteilung der Neurone Neurone bestehen aus einem Zellkörper und Nervenfortsätzen und sind zur
Die Muskulatur des Menschen
 Die Muskulatur des Menschen Motorische Einheit Im Zentrum der Muskelkontraktion steht die motorische Einheit. Sie besteht aus einem Motoneuron und der von diesem Motoneuron innervierten 1 Gruppe von Muskelfasern.
Die Muskulatur des Menschen Motorische Einheit Im Zentrum der Muskelkontraktion steht die motorische Einheit. Sie besteht aus einem Motoneuron und der von diesem Motoneuron innervierten 1 Gruppe von Muskelfasern.
Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften
 Aktionspotential Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften V m (mv) 20 Overshoot Aktionspotential (Spike) V m Membran potential 0-20 -40 Anstiegsphase (Depolarisation) aktive Antwort t (ms) Repolarisation
Aktionspotential Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften V m (mv) 20 Overshoot Aktionspotential (Spike) V m Membran potential 0-20 -40 Anstiegsphase (Depolarisation) aktive Antwort t (ms) Repolarisation
Entstehung chronischer Schmerzen
 Entstehung chronischer Schmerzen.1 Was ist Schmerz eigentlich?. Schmerzkrankheit.3 Akuter Schmerz und chronischer Schmerz 5. Schmerzverarbeitung auf neuronaler Ebene 6..1 Der Weg vom Schmerzreiz zum Gehirn
Entstehung chronischer Schmerzen.1 Was ist Schmerz eigentlich?. Schmerzkrankheit.3 Akuter Schmerz und chronischer Schmerz 5. Schmerzverarbeitung auf neuronaler Ebene 6..1 Der Weg vom Schmerzreiz zum Gehirn
Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000
 Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000 am 15.11.2000 von 13.45 15.15 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 50 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach 1. Wie erfolgt
Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000 am 15.11.2000 von 13.45 15.15 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 50 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach 1. Wie erfolgt
Physiologische Komponente. Erlebenskomponente
 Emotion Physiologische Komponente Kognitive Komponente Konative Komponente Vegetative Reaktionen (z.b. EDA; Puls) Zentral nervöse Prozesse (z.b. Aktivierung d. Amygdala) Bewertung der Situation (z.b. gut
Emotion Physiologische Komponente Kognitive Komponente Konative Komponente Vegetative Reaktionen (z.b. EDA; Puls) Zentral nervöse Prozesse (z.b. Aktivierung d. Amygdala) Bewertung der Situation (z.b. gut
Biologische Psychologie I
 Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Wie aus Gefahrensignalen Schmerzen werden
 Wie aus Gefahrensignalen Schmerzen werden Einführung Unser außergewöhnliches Gefahrenmeldesystem Eine genauere Betrachtung der Alarmsignale 4 Botschaften senden 8 Das Alarmsignal erreicht das Rückenmark
Wie aus Gefahrensignalen Schmerzen werden Einführung Unser außergewöhnliches Gefahrenmeldesystem Eine genauere Betrachtung der Alarmsignale 4 Botschaften senden 8 Das Alarmsignal erreicht das Rückenmark
WEISHEITSZÄHNE KURZINFO
 Prof. Dr. Dhom & Kollegen Bismarckstr. 27 67059 Ludwigshafen Homepage: http://www.prof dhom.de E Mail: praxis@prof dhom.de (mailto:praxis@prof dhom.de) Telefon: 0621 68124444 (tel:0621 68124444) Telefax:
Prof. Dr. Dhom & Kollegen Bismarckstr. 27 67059 Ludwigshafen Homepage: http://www.prof dhom.de E Mail: praxis@prof dhom.de (mailto:praxis@prof dhom.de) Telefon: 0621 68124444 (tel:0621 68124444) Telefax:
Zelluläre Kommunikation
 Zelluläre Kommunikation 1. Prinzipien der zellulären Kommunikation?? 2. Kommunikation bei Nervenzellen Die Zellen des Nervensystems Nervenzellen = Neuronen Gliazellen ( Glia ) Astrozyten Oligodendrozyten
Zelluläre Kommunikation 1. Prinzipien der zellulären Kommunikation?? 2. Kommunikation bei Nervenzellen Die Zellen des Nervensystems Nervenzellen = Neuronen Gliazellen ( Glia ) Astrozyten Oligodendrozyten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Reinste Nervensache. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Reinste Nervensache Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 30 Das Nervensystem des Menschen (Kl. 9/10) Der
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Reinste Nervensache Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 30 Das Nervensystem des Menschen (Kl. 9/10) Der
Wie viele Neuronen hat der Mensch? a b c
 Wie viele Neuronen hat der Mensch? a. 20 000 000 000 b. 500 000 000 000 c. 100 000 000 000 000 Aus Eins mach Viele Konzentration und Spezialisierung Alle Neurone = Nervensystem Axone Nerven Zellkörper
Wie viele Neuronen hat der Mensch? a. 20 000 000 000 b. 500 000 000 000 c. 100 000 000 000 000 Aus Eins mach Viele Konzentration und Spezialisierung Alle Neurone = Nervensystem Axone Nerven Zellkörper
Postoperative Komplikationen
 48 Chirurgische Komplikationen Postoperative Komplikationen Häufige Komplikationen! Nach enoralen Operationen sind starke Wundschmerzen als Folge einer Reizung örtlich sensibler Nervenfasern, lokale Blutungen
48 Chirurgische Komplikationen Postoperative Komplikationen Häufige Komplikationen! Nach enoralen Operationen sind starke Wundschmerzen als Folge einer Reizung örtlich sensibler Nervenfasern, lokale Blutungen
In der Membran sind Ionenkanäle eingebaut leiten Ionen sehr schnell (10 9 Ionen / s)
 Mechanismen in der Zellmembran Abb 7.1 Kandel Neurowissenschaften Die Ionenkanäle gestatten den Durchtritt von Ionen in die Zelle. Die Membran (Doppelschicht von Phosholipiden) ist hydrophob und die Ionen
Mechanismen in der Zellmembran Abb 7.1 Kandel Neurowissenschaften Die Ionenkanäle gestatten den Durchtritt von Ionen in die Zelle. Die Membran (Doppelschicht von Phosholipiden) ist hydrophob und die Ionen
ALLES ÜBER SCHMERZEN. Solutions with you in mind
 ALLES ÜBER SCHMERZEN www.almirall.com Solutions with you in mind WAS IST DAS? Schmerzen werden beschrieben als unangenehmes Sinnes- und Emotionserleben in Verbindung mit einem schädlichen Reiz. Schmerzen
ALLES ÜBER SCHMERZEN www.almirall.com Solutions with you in mind WAS IST DAS? Schmerzen werden beschrieben als unangenehmes Sinnes- und Emotionserleben in Verbindung mit einem schädlichen Reiz. Schmerzen
BK07_Vorlesung Physiologie 29. Oktober 2012
 BK07_Vorlesung Physiologie 29. Oktober 2012 1 Schema des Membrantransports Silverthorn: Physiologie 2 Membranproteine Silverthorn: Physiologie Transportproteine Ionenkanäle Ionenpumpen Membranproteine,
BK07_Vorlesung Physiologie 29. Oktober 2012 1 Schema des Membrantransports Silverthorn: Physiologie 2 Membranproteine Silverthorn: Physiologie Transportproteine Ionenkanäle Ionenpumpen Membranproteine,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 2 M 2 Das Immunsystem eine Übersicht Das
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 2 M 2 Das Immunsystem eine Übersicht Das
Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie. Patienteninformation
 Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie Patienteninformation Ein kurzer Überblick Zentraler Aufwachraum Forschung Die Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie des Inselspitals
Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie Patienteninformation Ein kurzer Überblick Zentraler Aufwachraum Forschung Die Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie des Inselspitals
Wirksamkeit der Komplementärmedizin am Beispiel der Akupunktur - Möglichkeiten der Integration in die Schulmedizin
 Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie (Direktor: Prof. Dr. med. Stefan N. Willich), Charité - Universitätsmedizin Berlin HABILITATIONSSCHRIFT Wirksamkeit der Komplementärmedizin
Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie (Direktor: Prof. Dr. med. Stefan N. Willich), Charité - Universitätsmedizin Berlin HABILITATIONSSCHRIFT Wirksamkeit der Komplementärmedizin
Zentrale Sensitisierung als Grundlage chronischer Schmerzen
 Zentrale Sensitisierung als Grundlage chronischer Schmerzen Prof. B. Radanov Klinik Wilhelm Schulthess Lengghalde 2 8008 Zürich Ziele der Präsentation 1. Was ist zentrale Sensitisierung 2. Ist zentrale
Zentrale Sensitisierung als Grundlage chronischer Schmerzen Prof. B. Radanov Klinik Wilhelm Schulthess Lengghalde 2 8008 Zürich Ziele der Präsentation 1. Was ist zentrale Sensitisierung 2. Ist zentrale
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW BI GK HT 1 Seite 1 von 6. Unterlagen für die Lehrkraft. Abiturprüfung Biologie, Grundkurs
 Seite 1 von 6 Unterlagen für die Lehrkraft Abiturprüfung 2007 Biologie, Grundkurs 1. Aufgabenart I Bearbeitung fachspezifischen Materials mit neuem Informationsgehalt 2. Aufgabenstellung Thema: Pflanzenschutz
Seite 1 von 6 Unterlagen für die Lehrkraft Abiturprüfung 2007 Biologie, Grundkurs 1. Aufgabenart I Bearbeitung fachspezifischen Materials mit neuem Informationsgehalt 2. Aufgabenstellung Thema: Pflanzenschutz
Grundlagen Schmerztherapie P.Machacek. Definition
 Grundlagen Schmerztherapie P.Machacek Definition Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht oder von betroffenen Personen
Grundlagen Schmerztherapie P.Machacek Definition Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht oder von betroffenen Personen
Herz und Kreislauf Teil 3
 24. TOGGENBURGER ANÄSTHESIE REPETITORIUM Herz und Kreislauf Teil 3 Zellphysiologie Medikamente Salome Machaidze Miodrag Filipovic miodrag.filipovic@kssg.ch Anästhesiologie & Intensivmedizin Unter Verwendung
24. TOGGENBURGER ANÄSTHESIE REPETITORIUM Herz und Kreislauf Teil 3 Zellphysiologie Medikamente Salome Machaidze Miodrag Filipovic miodrag.filipovic@kssg.ch Anästhesiologie & Intensivmedizin Unter Verwendung
Hepatitis C im Dialog
 Hepatitis C im Dialog 100 Fragen - 100 Antworten Herausgegeben von Stefan Zeuzem 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com
Hepatitis C im Dialog 100 Fragen - 100 Antworten Herausgegeben von Stefan Zeuzem 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com
Schmerz. Leitlinie. Empfehlungen der Fachgesellschaft zur Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen
 Schmerz Leitlinie Empfehlungen der Fachgesellschaft zur Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen Herausgeber DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie
Schmerz Leitlinie Empfehlungen der Fachgesellschaft zur Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen Herausgeber DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie
