Technische Universität München Lehrstuhl für Technologie der Brauerei I und Getränketechnologie
|
|
|
- Rudolph Gerhardt Biermann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Technische Universität München Lehrstuhl für Technologie der Brauerei I und Getränketechnologie Untersuchungen zu enzymatischen Abbauprodukten beim Maischen im Hinblick auf die Entwicklung eines Prozessführungssystems Torsten Dickel Vollständiger Abdruck der von der Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) genehmigten Dissertation. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Dr. agr. habil. Harun Parlar Prüfer der Dissertation: 1. Univ.-Prof. Dr.-Ing., Dr. Ing. habil. Werner Back 2. Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Antonius Delgado Die Dissertation wurde am bei der Technischen Universität München eingereicht und durch die Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt am angenommen.
2 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis 5 Abbildungsverzeichnis 8 Abkürzungen 12 1 Einleitung 13 2 Grundlagen Makromoleküle in Gerste Eiweißbestandteile des Gerstenkorns Kohlenhydrate in Gerste α-glycosidisch verbundene Kohlenhydrate β-glycosidisch verbundene Kohlenhydrate Aufbau des -Glucans Aufbau der Pentosane Enzyme und ihre Eigenschaften Bedeutung der Enzyme Funktionen und Nomenklatur Enzymatische Reaktionen und ihre Beeinflussung Stoffliche Veränderungen während der Mälzung Zellwandlösung im Korn Eiweißlösung Stärkelösung Der Maischprozess als Lösungsvorgang Physikalische und enzymatische Lösung Maischparameter und deren Beeinflussung ph-wert Brauwasser Maischesäuerung Maischekonzentration/Gussführung Temperatur-Zeit-Führung Dekoktion/Infusion Kennzahlen zur Beurteilung der Lösungsvorgänge in Malz und Maische/Würze Zytolytische Kennzahlen Proteolytische Kennzahlen 41
3 Inhaltsverzeichnis Amylolytische Kennzahlen Physikalische Eigenschaften von Extraktlösungen Dichte Schallgeschwindigkeit Leitfähigkeit Viskosität 45 3 Material und Methoden Rohstoffe Brauwasser Malz Labormaischen Pilotbrauerei des Lehrstuhls Messstrecke zur Erfassung der physikalischen Eigenschaften der Maische Maischverfahren Brauverfahren Nasschemische Analysen der Maischen Aufbereitung der Proben FAN und alternative Eiweißerfassungsmethoden Fotometrische Jodprobe Fluorimetrische Messung des -Glucan Extraktmessung Chromatographische Messmethoden an Maische HPLC zur Zuckeranalytik: Gelchromatographische Untersuchungen auf Molekülgrößenverteilung Glucan-Analyse Eiweißanalyse Analyse der vergärbaren Zucker Methoden zur Beurteilung der Bierqualität Sensorische Analyse zur Beurteilung des Geschmacks Sensorische Bewertung der Geschmacksstabilität Beurteilung der Schaumhaltbarkeit Rechnerische Methoden 69
4 Inhaltsverzeichnis Temperaturkorrektur der physikalischen Werte Statistische Methoden 70 4 Ergebnisse und Diskussion Labormaischen zur Methodenentwicklung Eiweißmessmethoden und ihre Reproduzierbarkeit Der Verlauf der fotometrischen Jodprobe und des Extraktes Verhältnisse bezüglich -Glucan Maischen aus der Pilotsudanlage Analytische Werte unter Abwandlung des Temperatur-Zeit-Profils und der Malzqualität Verlauf des -Glucan Verlauf des FAN Verlauf des Extraktes Zeitlicher Verlauf der Jodprobe Korrelation der physikalischen Messungen mit nasschemischen Analysen FAN und Leitfähigkeit Viskosität und Phasen der Amylolyse Dichte, Schallgeschwindigkeit und der Extraktgehalt Betrachtung der Molekülgrößenverteilungen Glucan Eiweiß Vergärbare Zucker Qualität von Bieren aus abgewandelten Maischen Biere aus unterschiedlich langen Praxismaischverfahren Biere aus unterschiedlich langen Maischverfahren mit Eybenrasten Biere aus Eybenmaischen mit unterschiedlicher Malzqualität Schlussfolgerungen und Perspektiven Zusammenfassung Literaturverzeichnis Tabellenanhang 137 Lebenslauf 156
5 Tabellenverzeichnis 5 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: 5-Jahres-Mittelwerte der Daten der Frühvermälzungen Tabelle 2: Hydrolasen beim Mälzen und Maischen,,...23 Tabelle 3: Enzyme des Malzes und ihr Verhalten beim Maischen...33 Tabelle 4: Wasseranalytische Kennzahlen der Pilotsudanlage nach MEBAK...47 Tabelle 5: Malzanalyse zweier verwendeter Malze...48 Tabelle 6: Malzanalyse zweier weiterer verwendeter Malze...49 Tabelle 7: Eiweißmolekülgrößenstandard zur Kalibrierung...68 Tabelle 8: Konstanten zur Temperaturkorrektur...70 Tabelle 9: Ergebnisse der sensorischen Prüfung von Bieren variierter Maischen aus dem Malz Danuta Tabelle 10: Schaumzahlen nach Ross und Clark für Biere aus Maischen des Malze Danuta Tabelle 11: Ergebnisse der sensorischen Prüfung der Biere variierter Maischen mit Eyben-Temperaturrasten Tabelle 12: Ergebnisse der sensorischen Prüfung der Biere von Eybenmaischen mit unterschiedlichen Malzqualitäten Tabelle 13: Schaumzahlen nach Ross und Clark für Biere aus Maischen verschiedener Malzmischungen Tabelle 14: Werte der Extinktionsdifferenz zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Fotometern Tabelle 15: Extinktionswerte von Eiweißstandards verschiedener Konzentrationen Tabelle 16: Gegenüberstellung von Kjehldahl und Coommassie-Blau-Färbung Tabelle 17: Eiweißgehalte (Coomassie-Blau-Färbung) in zwei Maischversuchen Tabelle 18: Extinktionsdifferenzwerte nm zweier Laboranten der gleichen Würzen Tabelle 19: Löslicher Stickstoff nach Kjehldahl und zugehörige Werte der Extinktionsdifferenz über alle Labormaischversuche Tabelle 20: FAN-Werte und Lösl. N-Werte nach Kjehldahl über drei Kongressmaischversuche und deren Mittelwerte...140
6 Tabellenverzeichnis 6 Tabelle 21: FAN-Werte und Lösl. N-Werte nach Kjehldahl über zwei Eybenmaischmaischversuche und deren Mittelwerte Tabelle 22: Werte der Jodprobe und des Extraktes über zwei Kongressmaischverfahren im Labormaßstab Tabelle 23: Werte der Jodprobe und des Extraktes über zwei Eybenmaischverfahren Tabelle 24: -Glucangehalte einer Kongressmaische gemessen mit Foss Tecator Tabelle 25 -Glucangehalte zweier Maischversuche mit dem Malz Neruda Tabelle 26: -Glucangehalte zweier Maischversuche mit dem Malz Danuta Tabelle 27: -Glucangehalte unterschiedlich langer Maischverfahren Tabelle 28: -Glucangehalte in 5 Eybenmaischen im Pilotsudwerk Tabelle 29: FAN- Gehalte von 3 kurzen Pilotmaischen des Malzes Neruda in mg/l Tabelle 30: FAN- Gehalte von 3 kurzen Pilotmaischen des Malzes Danuta in mg/l Tabelle 31: FAN-Gehalte unterschiedlich langer Maischverfahren Tabelle 32: FAN-Werte in mg/100 ml über 6 Eybenmaischversuche im Pilotsudwerk Tabelle 33: Extrakt-Gehalte in GG % von drei Maischversuchen mit Malz Danuta Tabelle 34: Extrakt-Gehalte in GG % von drei Maischversuchen mit Malz Neruda Tabelle 35: Extraktgehalte unterschiedlich langer Maischverfahren Tabelle 36: Extraktgehalte in GG% über 6 Eybenmaischversuche im Pilotsudwerk Tabelle 37: Werte der fotometrischen Jodprobe und Extraktwerte für drei Versuche eines Maischverfahrens mit Malz Neruda Tabelle 38: Werte der fotometrischen Jodprobe und Extraktwerte für drei Versuche eines Maischverfahrens mit Malz Danuta Tabelle 39: Werte der fotometrischen Jodprobe unterschiedlich langer Maischverfahren Tabelle 40: Umrechnung der Jodprobenwerte von Tabelle 39 auf den Extraktgehalt 12 %GG...149
7 Tabellenverzeichnis 7 Tabelle 41: Werte der fotometrischen Jodprobe über 4 Versuche mit Eybenmaischverfahren im Pilotsudwerk auf 12 % berechnet Tabelle 42: Umrechnung der Werte der fotometrischen Jodprobe für Tabelle 41 auf 12 % Extrakt Tabelle 43: Werte der temperaturkorrigierten Leitfähigkeit in ms/cm und des FAN- Gehaltes in mg/100 ml für 5 gleich gehaltene Versuche nach dem Eybenmaischverfahren Tabelle 44 Mittelwerte der Größen aus Tabelle Tabelle 45: Werte der online-jodprobe für ein Eybenmaischverfahren Tabelle 46: Extraktwerte über 5 gleich gehaltene Eybenmaischverfahren Tabelle 47: Werte der online gemessenen Dichte in g/l über 5 gleich gehaltene Eybenmaischverfahren Tabelle 48: Werte der online gemessenen Schallgeschwindigkeit in m/s über 5 gleich gehaltene Eybenmaischverfahren Tabelle 49: Kalibriereiweiße mit Molekülgröße und Retentionszeiten Tabelle 50: Werte von Zuckern über ein Eybenmaischverfahren mit 100 % Spitzmalz Tabelle 51: Werte von Zuckern in g/l über ein Eybenmaischverfahren mit 50 % Spitzmalz und 50 % Pilsener Malz Tabelle 52: Werte von Zuckern in g/l über ein isothermes (60 C) Maischverfahren mit 30 % Spitzmalz und 70 % Pilsener Malz...155
8 Abbildungsverzeichnis 8 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Strukturformel einer Polypeptidkette...16 Abbildung 2: Struktur von Stärkemolekülen...18 Abbildung 3: Modell der Zellwandstruktur der stärkeführenden Zellen im Gerstenendosperm...19 Abbildung 4: Cellobiose - Grundbaustein der Cellulose...20 Abbildung 5: Aufbau eines -Glucan-Moleküls...20 Abbildung 6: Aufbau einer Pentosankette aus dem Mehlkörper...21 Abbildung 7: Keimendes Gerstenkorn...25 Abbildung 8: Schema des -Glucanabbaus...26 Abbildung 9: Schema des Pentosanabbaus...27 Abbildung 10: Enzymatischer Abbau der Eiweißfraktionen...28 Abbildung 11: Schema des Stärkeabbaus...30 Abbildung 12: Lösungsvorgänge beim Maischen...32 Abbildung 13: Aufbau des Pilotsudwerks...52 Abbildung 14: Schema der Messanlage und ihrer Anbindung an den Maischbottich...55 Abbildung 15: Temperatur-Zeit-Profil eines Kongressmaischverfahren...57 Abbildung 16: Temperatur-Zeit-Profil eines Eyben-Maischverfahren...58 Abbildung 17: Ausgangs-Temperatur-Zeit-Profil des variablen Maischverfahren 59 Abbildung 18: Gär-, Reifungs- und Lagerverfahren der Biere...61 Abbildung 19: Extinktionsdifferenzergebnisse zweier verschiedener Laboranten zu Werten des löslichen Stickstoffs derselben Würzen...72 Abbildung 20: Werte der Extinktionsdifferenz an verschiedenen Photometern zu verschiedenen Zeitpunkten...72 Abbildung 21: Löslicher Stickstoff nach Kjeldahl und Extinktionsdifferenz über alle Versuche...73 Abbildung 22: Darstellung einer Kalibriergeraden der Coomassie-Blau- Färbemethode...74 Abbildung 23: Eiweißgehalt von Würzen mit Coomassie-Färbung und löslichem Stickstoff nach Kjeldahl...75 Abbildung 24: Verlauf der mittels Coomassie-Blau-Färbung erhaltenen Eiweißgehalte zweier Versuche über Kongressmaischverfahren unter Variation der Malzqualität...76
9 Abbildungsverzeichnis 9 Abbildung 25: Verlauf der Mittelwerte (n = 3) proteolytischer Kennzahlen über Kongressmaischversuche...78 Abbildung 26: Verlauf der Mittelwerte (n = 2) proteolytischer Kennzahlen über Eybenmaischversuche...78 Abbildung 27: Verlauf der fotometrischen Jodprobe und des Extraktes bei Kongressmaischverfahren im Labormaßstab...80 Abbildung 28: Verlauf der fotometrischen Jodprobe und des Extraktes bei Eybenmaischverfahren im Labormaßstab...80 Abbildung 29: Verlauf der auf 12 % Extraktgehalt berechneten fotometrischen Jodprobe bei Kongressmaischverfahren...81 Abbildung 30: Verlauf der auf 12 % Extaktgehalt berechneten fotometrischen Jodprobe bei Eybenmaischverfahren...81 Abbildung 31: Verlauf des hochmolekularen -Glucan während eines Kongressmaischverfahrens...83 Abbildung 32: Verlauf der -Glucan-Konzentration zweier gleicher Versuche für ein kurz gehaltenes Maischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Neruda...86 Abbildung 33: Verlauf der -Glucan-Konzentration zweier gleicher Versuche für ein kurz gehaltenes Maischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Danuta...86 Abbildung 34: Verlauf der -Glucan-Konzentrationen für variierte Maischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Danuta...87 Abbildung 35: Verlauf der -Glucan-Konzentrationen in 5 Eybenmaischen im Pilotsudwerk...89 Abbildung 36: Mittelwert (n = 5) der -Glucan-Gehalte in Pilotmaischen...89 Abbildung 37: Verlauf der FAN-Konzentration für drei Versuche eines kurz gehaltenen Maischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Neruda...90 Abbildung 38: Verlauf der FAN-Konzentration für drei Versuche eines kurz gehaltenen Maischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Danuta...91 Abbildung 39: Verlauf der FAN-Konzentrationen für variierte Maischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Danuta...91 Abbildung 40: Verlauf der FAN-Konzentrationen in 6 Pilotmaischen mit einer Mischung aus 30 % Spitz- und 70 % Pilsener Malz...92 Abbildung 41: Mittelwert (n = 6) der FAN-Gehalte in Pilotmaischen (Eybenverfahren)...93
10 Abbildungsverzeichnis 10 Abbildung 42: Verlauf des Extraktgehaltes für drei Versuche eines kurz gehaltenen Pilotmaischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Neruda...94 Abbildung 43: Verlauf des Extraktgehaltes für drei Versuche eines kurz gehaltenen Pilotmaischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Danuta...94 Abbildung 44: Verlauf der Extrakt-Konzentrationen für variierte Pilotmaischverfahren mit Malz aus der Gerstensorte Danuta...96 Abbildung 45: Verlauf der Extraktgehalte in Eybenmaischen im Pilotsudwerk...97 Abbildung 46: Mittelwert (n = 6) der Extraktgehalte von Pilotmaischen (Eybenverfahren)...97 Abbildung 47: Verlauf der fotometrischen Jodprobe (berechnet auf 12 % Extrakt) für 3 Versuche eines kurz gehaltenen Maischverfahren mit Malz Neruda...99 Abbildung 48: Verlauf der fotometrischen Jodprobe (berechnet auf 12 % Extrakt) für 3 Versuche eines kurz gehaltenen Maischverfahren mit Malz Danuta...99 Abbildung 49: Verlauf der fotometrischen Jodprobe berechnet auf 12 % Extraktgehalt für variierte Pilotmaischverfahren mit Malz Danuta Abbildung 50: Verlauf der fotometrischen Jodprobe berechnet auf 12 % Extrakt in 4 Pilotsudwerkmaischen nach dem Eybenmaischverfahren Abbildung 51: Mittelwert (n = 4) der Werte der fotometrischen Jodprobe in Pilotmaischen (Eybenmaischverfahren) Abbildung 52: Verläufe der auf 20 C berechneten Leitfähigkeit und des FAN über 5 Maischversuche (Eybenverfahren) Abbildung 53: Verläufe der Mittelwerte (n = 5) von FAN und auf 20 C berechneter Leitfähigkeit Abbildung 54: Wertepaare des FAN und der auf 20 C berechneten Leitfähigkeit über 5 gleich gehaltene Maischversuche Abbildung 55: Wertepaare des FAN und der auf 20 C berechneten Leitfähigkeit über 5 gleiche Maischversuche nur unterhalb der Stärkeverkleisterung Abbildung 56: Verlauf der auf 20 C berechneten Viskosität und des Extraktes in 2 Maischversuchen Abbildung 57: Beispiel für den Verlauf der online-jodprobe während eines Maischversuches Abbildung 58: Verlauf der Mittelwerte (n = 5) der Dichte der Maische (berechnet auf 20 C) und des Extraktes (Labor) bei gleich gehaltenen Maischverfahren...108
11 Abbildungsverzeichnis 11 Abbildung 59: Verlauf der Mittelwerte (n = 5) der Schallgeschwindigkeit der Maische (berechnet auf 20 C) und des Extraktes (Labor) bei gleich gehaltenen Maischverfahren Abbildung 60: Chromatogramm einer Maischeprobe zur Detektion von -Glucan Abbildung 61: Chromatogramm des -Glucan-Molekülgrößenkits Abbildung 62: Eichkurve der Molekülgrößentrennung der Säule HiLoad 26/60 Superdex 200 prep grade zur Eiweißtrennung Abbildung 63: Probenahmeplan bei Eybenmaischen Abbildung 64: Chromatogramme der Eiweißmolekülgrößenverteilung der Maischproben Abbildung 65: Chromatogramme der Eiweißmolekülgrößenverteilung der Maischproben Abbildung 66: Chromatogramme der Eiweißmolekülgrößenverteilung der Maischproben Abbildung 67: Verlauf von Zuckerkonzentrationen über ein Eybenmaischverfahren unter Verwendung von 100 % Spitzmalz Abbildung 68: Verlauf von Zuckerkonzentrationen über ein Eybenmaischverfahren unter Verwendung von 50 % Spitzmalz und 50 % Pilsener Malz Abbildung 69: Verlauf von Zuckerkonzentrationen über ein isothermes Maischverfahren unter Verwendung von 30 % Spitzmalz und 70 % Pilsener Malz Abbildung 70: Temperatur-Zeit-Profile der variierten Maischen mit Malz der Gerstensorte Danuta Abbildung 71: Temperatur-Zeit-Profile der am Eybenmaischverfahren orientierten Maischen...122
12 Abkürzungen 12 Abkürzungen % GG Gewichts-Gewichtsprozent = Massenanteil aa ausgeglichene Alkalität ASBC American Society of Brewing Chemists ber. a. berechnet auf CIP Cleaning in Place = automatische Reinigung dest. Wasser destilliertes Wasser DLG: Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Frankfurt am Main DMS Dimethylsulfid EBC European Brewery Convention ELG Eiweißlösungsgrad EVG s scheinbarer Endvergärungsgrad FAN freier Amino-Stickstoff FIA Fließ-Injektions-Analyse GA Gesamtalkalität GPC Gelpermeationschromatographie HPLC hochauflösende Flüssigchromatographie KH Karbonathärte M Tr S Malztrockensubstanz max. maximal MEBAK Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommission MG Molekulargewicht MS-Differenz Mehl-Schrot-Differenz PC Personal Computer RA Restalkalität RI-Detektor Refraktions-Index-Detektor SEC Größenausschlusschromatographie SPS Speicherprogrammierbare Steuerung TUM Technische Universität München UV ultraviolett VZ 45 C Vergleichszahl 45 C VZ 65 C Vergleichszahl 65 C wfr. wasserfrei
13 1 Einleitung 13 1 Einleitung Bier ist ein Produkt aus natürlich gewachsenen Rohstoffen. Die Qualität des Wassers kann über Aufbereitungsverfahren reguliert und somit weitgehend konstant gehalten werden. Die physiologischen Eigenschaften der verwendeten Hefe sind durch Einsatz von Reinzuchthefe und definierten Aufzucht- und Gärverfahren annähernd gleich bleibend. Die Rohstoffe Hopfen und Malz bzw. Gerste unterliegen durch die Züchtung und die schwankenden Aufwuchsbedingungen einer starken Beeinflussung. Bei der Braugerste kommt neben Resistenz- und Ertragszüchtung auch Qualitätszüchtung zu Einsatz, um die folgenden Eigenschaften zu verbessern: Ausbeute von Malz, Verarbeitbarkeit (Beschleunigung aller kapazitätsbestimmenden Prozessschritte wie Maischen, Läuterung, Gärung, Reifung, Filtration) zum Bier, sensorisch fassbare Qualität des Bieres (Geruch, Geschmack, Vollmundigkeit, Rezenz, Bittere, Farbe, Schaum), Geschmacks- und Trübungsstabilität des Bieres. So ergeben sich durch den Züchtungsfortschritt wie in Tabelle 1 dargestellt trotz gleich gehaltener Mälzungsverfahren veränderte Malzeigenschaften. Beim Maischen werden die Inhaltsstoffe des Malzes gelöst und weiter abgebaut. Hier kann auf veränderte Malzeigenschaften durch Variation von Prozessparametern ausgleichend reagiert werden. Um die Qualität der Maischen, der daraus gewonnenen Würzen und damit des Endproduktes Bier konstant zu halten, müsste die Malzqualität jeder verwendeten Charge und Mischung vorher bestimmt werden und ein entsprechendes Maischprogramm angepasst werden.
14 1 Einleitung 14 Tabelle 1: 5-Jahres-Mittelwerte der Daten der Frühvermälzungen bis 1986 bis 1991 bis 1996 bis Trend Kennzahl Einheit Extrakt, wfr. % 81,1 81,4 81,1 82,6 Viskosität mpas, 1,507 1,496 1,461 1,458 8,6 % Friabilimeter- % 79,7 81,2 87,9 89,2 wert Korneiweiß, wfr. % 10,4 10,5 10,4 9,8 löslicher mg/100 g Stickstoff MTrS. Kolbachzahl % 41,1 42,6 44,4 46,9 VZ 45 C % 35,7 37,7 40,8 42,4 EVG, % 81,2 80,7 81,8 83,2 scheinbar -Amylase, wfr. ASBC Maßgeblicher Parameter des Maischprozesses ist die Temperatur-Zeit-Führung. Diese wird vor allem empirisch und oft auch traditionell (Werbespruch: nach jahrhundertealtem Rezept gebraut ) festgelegt. Wünschenswert wäre es jedoch, wenn während des Maischens Qualitätsschwankungen erkannt und direkt beeinflusst werden könnten, um die Qualität konstant zu halten. Eine derartige Regelung würde im Zusammenhang mit der ständigen Verbesserung der Gersten- und damit der Malzqualität den Maischprozess gegenüber traditionellen Verfahren vereinfachen und deutlich abkürzen. Dadurch könnte die Sudfolge in vielen Brauereien erhöht werden, da das Maischen, insbesondere nachdem die Würzetrennverfahren bei Läuterbottich und Maischefilter stark verbessert worden sind, der begrenzende Prozessschritt im Sudhaus ist. Das Ergebnis dieser Erhöhung wäre eine verbesserte Kostenstruktur durch die gesteigerte Kapazitätsauslastung. 2 Ein System, welches online den Fortschritt der Vorgänge beim Maischen erkennen und danach geregelt den Prozess führen könnte, brächte also zwei Vorteile: 1 2 Vgl.: Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Qualitätsgerstenanbaues im Bundesgebiet e. V. (Hrsg.): Braugersten-Jahrbuch. Eichenau Vgl.: Schwill-Miedaner, Annette et al.: Untersuchungen zur Zeitoptimierung von Maischverfahren. In: Brauwelt. Nr. 12. Nürnberg S
15 1 Einleitung Qualitätskonstanz durch rohstoffabhängige Prozessführung 2. Zeitersparnis und dadurch Kostensenkung Über prozessbegleitende Analytik beim Maischen zur Bestimmung des Prozessfortschritts wird in der Literatur bereits berichtet. 3,4 Eine Rückkoppelung der Analysenergebnisse auf die Prozessführung wurde bisher aber noch nicht erreicht. Aus diesem Grunde wurde das Forschungsvorhaben Entwicklung eines Prozessführungssystems zur Optimierung der zytolytischen, proteolytischen und amylolytischen Abbauvorgänge beim Maischen der Arbeitsgemeinschaft industrielle Forschungsvereinigung Otto von Guericke e. V. (Forschungsvorhaben 12552N) eingeleitet. Dieses Projekt entstand unter Federführung des Lehrstuhls für Fluidmechanik und Prozessautomation in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Technologie der Brauerei I und Getränketechnologie am Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München. Die vorliegende Arbeit stellt einen Teil des Forschungsprojektes. Zielsetzung war, den Fortschritt des Maischprozesses mittels Analyse der enzymatischen Abbauprodukte zu beurteilen und mit physikalischen online-messmethoden darzustellen sowie im Hinblick auf die gewünschte Bierqualität zu beeinflussen. 3 4 Vgl.: Einsiedler, Frank et al.: Experimentelle Untersuchung komplexer biochemischer und technologischer Prozesse am Beispiel des Maischens. Teil 1-3. In: Monatsschrift für Brauwissenschaft. Hefte 9/10, 11/12 und Heft 1/2. Nürnberg Vgl.: Wilke, J. und B. Parthey: Prozessnahe Biermaische-Analytik. In: Monatsschrift für Brauwissenschaft. Heft 3/4. Nürnberg S
16 Grundlagen 16 2 Grundlagen 2.1 Makromoleküle in Gerste Der überwiegende Teil der Gerstenmasse besteht aus unlöslichen Makromolekülen, die das Korn nachdem es niedermolekulare, gelöste Nährstoffe aufgenommen hat zur Einlagerung aufbaut. 5 Zum einen sind dies Kohlenhydrate, die Zucker als Grundbaustein haben, zum anderen Eiweiße, die aus Aminosäuren bestehen. Stärke als größte Kohlenhydratfraktion macht ca. 63 % der Gerstentrockenmasse aus, Eiweiß ca. 11 % Eiweißbestandteile des Gerstenkorns Innerhalb des Gerstenkorns befindet sich Eiweiß in der Kornumhüllung, im Keimling und im Mehlkörper. In diesem wiederum findet sich Eiweiß als Klebereiweiß in der Aleuronschicht, als Reserveeiweiß und als Gewebeeiweiß in den Zellmembranen des Endosperms. 7 Eiweiße, auch Proteine genannt, sind Polypeptide, also durch Säure- Amid-Bindungen miteinander verknüpfte Aminosäuren mit einem Molekulargewicht von bis mehrere Da. 8 Abbildung 1 zeigt die Struktur einer solchen Peptidkette. Abbildung 1: Strukturformel einer Polypeptidkette Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): Handbuch der Brauerei-Praxis. 3. Aufl. Nürnberg S. 2. Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1: Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S. 26. Vgl.: ebenda, S. 35. Vgl.: Karlson, Peter: Kurzes Lehrbuch der Biochemie für Mediziner und Naturwissenschaftler. 14. Aufl. Stuttgart S. 23. Vgl.: ebenda, S. 24.
17 Grundlagen 17 Die Eiweißkörper in der Gerste werden nach ihrer Löslichkeit in verschiedenen Lösungsmitteln in folgende Fraktionen unterteilt: 10 - Albumine, - Globuline, - Prolamine (nach Hartong: Gliadine oder Hordeine), - Gluteline. Die nativen Gersteneiweißfraktionen lösen sich teilweise nicht in Wasser, sondern werden erst durch ihre Degradation während des Mälzungs- und Maischprozesses löslich gemacht Kohlenhydrate in Gerste Kohlenhydrate sind Zucker oder zuckerähnliche Substanzen und höher- bis hochmolekulare Stoffe, die diese als Grundbaustein haben. 12 Sie stellen mit der Cellulose die mengenmäßig bedeutendste organische Verbindung in der Natur. 13 Zum einen erfüllen sie Gerüstfunktionen als β-glycosidisch verbundene Kohlenhydrate, zum anderen dienen sie α-glycosidisch verbunden als Reservestoff bzw. Energieträger Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1: Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S. 42 f. 11 Vgl.: Hartong, B. D.: Die koagulierbaren und die kälteempfindlichen Eiweißkörper. In: Wochenschrift für Brauerei. Jahrgang Nr.5. Berlin S. 33 ff. 12 Vgl.: Dellweg, Hanswerner (Hrsg.) et al.: Römpp Lexikon Biotechnologie. Stuttgart S Vgl.: Falbe, Jürgen. u. Manfred Regitz (Hrsg.): Römpp Chemie Lexikon Band Aufl. Stuttgart S Vgl.: ebenda.
18 Grundlagen α-glycosidisch verbundene Kohlenhydrate Den größten Teil der sogenannten α-glucane stellt die Stärke. Diese teilt sich wiederum in 2 Fraktionen auf. Ein Anteil von % der Gerstenstärke ist Amylose, eine lineare Helix aus α-1 4-verbundenen Glucoseeinheiten mit einem Molekülgewicht von bis zu Da. Die restlichen % der Stärke werden durch Amylopektin (auch iso-amylose) gebildet. Dieses besteht aus verzweigten Molekülketten, die neben den linearen α-1 4-Folgen auch α-1 6-verbundene Verästelungen haben. Abbildung 2 veranschaulicht die Struktur dieser Verbindungen. Abbildung 2: Struktur von Stärkemolekülen β-glycosidisch verbundene Kohlenhydrate Die Gerüstsubstanz der Gerstenzellwände in den Spelzen, im Keimling sowie in Frucht- und Samenschale ist die Cellulose, während es im Mehlkörper die Hemicellulosen und Pentosane sind. 16 Diese Stoffe sind β-glycosidisch verbundene Kohlenhydrat-Makromoleküle. Bamforth gibt ein Modell zum Aufbau der Zellwände des stärketragenden Gerstenendosperms an, wie es in Abbildung 3 dargestellt ist. 15 Vgl.: Dellweg, Hanswerner (Hrsg.) et al.: Römpp Lexikon Biotechnologie. Stuttgart S Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1: Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S. 31.
19 Grundlagen 19 Abbildung 3: Modell der Zellwandstruktur der stärkeführenden Zellen im Gerstenendosperm 17 Die Zellwand enthält als Gerüst β-glucan, das nach außen hin durch Xylan, ein Pentosan, begrenzt wird. Auf der zelläußeren Seite sind neben Arabinose phenolische Reste (= Ferulasäure) und Acetylreste angelagert, welche fluoreszieren und so nachweisbar sind Bamforth, Charles und Makoto Kanauchi: A Simple Model for the Cell Wall of the Starchy Endosperm in Barley. In: Journal of The Institute of Brewing. Volume S Vgl.: Fincher, G. B.: Ferulic Acid in Barley Cell Walls: A Fluorescence Study. In: Journal of the Institute of Brewing. Volume S
20 Grundlagen Aufbau des -Glucans Zu den -Glucanen sind unter anderem die Cellulose, sowie die Hemicellulosen zu zählen. 19 Cellulose wie auch die Hemicellulosen bestehen aus Cellobiose, die, wie in Abbildung 4 dargestellt, zu Makromolekülen und -1 3-glycosidisch verbunden ist. Abbildung 4: Cellobiose - Grundbaustein der Cellulose 20 Cellulose und Hemicellulosen unterscheiden sich nach Narziß 21 in ihrer Struktur und in ihrer Löslichkeit aufgrund verschiedener Polymerisationsgrade. 22 Neben glycosidischen Bindungen (ca. 70 %), wie in Abbildung 4 dargestellt, sind in den Gerstenzellwandmakromolekülen auch -1 3-glycosidische Bindungen (ca. 30 %) in unregelmäßigen Sequenzen vorhanden. 23 Abbildung 5 demonstriert den Aufbau einer -Glucan-Kette. Abbildung 5: Aufbau eines -Glucan-Moleküls Vgl.:Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1: Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S Falbe, Jürgen u. Manfred Regitz (Hrsg.): Römpp Chemie Lexikon Band 1. Stuttgart. 9. Aufl S Vgl.: Narziß, Ludwig: a.a.o. S Vgl.: Falbe, Jürgen u. Manfred Regitz (Hrsg.): a.a.o. S Vgl.: Narziß, Ludwig: a.a.o. S Narziß, Ludwig: a.a.o. S. 32.
21 Grundlagen Aufbau der Pentosane Die Pentosane setzen sich meist aus einer Xylan-Kette ( -1 4-verbundene D- Xylosepyranoseeinheiten) mit verschiedenen Seitenketten aus Xylose, Arabinose, Glucuronsäure und Ferulasäure zusammen. In chemischer Strukturformel gibt dies Abbildung 6 wieder. H H H H H H H O H O H O H H O H O H H O H O H O H H O H O H O H H O H O H O H H H H H H O H H O H O O H H O H H H O O H O H C H 2 O O H H H C H 2 O O H H H H O H H O H Abbildung 6: Aufbau einer Pentosankette aus dem Mehlkörper Die Pentosane der Gerste sind zu 75 % in den Spelzen lokalisiert, 25 % sind in den Zellwänden des Endosperms zu finden Enzyme und ihre Eigenschaften Bedeutung der Enzyme Enzyme sind Biokatalysatoren, das heißt, sie erniedrigen die Aktivierungsenergie einer Reaktion und beschleunigen damit die Einstellung eines Gleichgewichtes zwischen Reaktionsedukt und -produkt. Die Reaktionen des Stoffwechsels werden von ihnen katalysiert, sowohl intra- wie auch extrazellulär. 26 Sie zeichnen sich durch eine hohe Substratspezifität aus, das heißt sie handhaben nur einen Metaboliten und 25 Vgl.: Preece, I. A. und J. Hobkirk: Non-Starchy Polysaccharides of Cereal Grains. V. Some Hemicellulose Fractions. In: Journal of The Institute of Brewing. Volume S. 490 ff. 26 Vgl.: Karlson, Peter: Kurzes Lehrbuch der Biochemie für Mediziner und Naturwissenschaftler. 14. Aufl. Stuttgart S. 23.
22 Grundlagen 22 dessen Stoffwechselprodukt. Außerdem sind sie durch Wirkungsspezifität charakterisiert. Sie beschleunigen nur eine bestimmte vieler möglicher Umwandlungsreaktionen des Metaboliten. 27 Fast alle Enzyme sind Proteine. 28 Innerhalb der Proteine sind die Enzyme den Globulären oder Sphäroproteinen zuzuordnen, das heißt sie sind in Wasser und verdünnten Salzlösungen löslich und ihre Moleküle sind sphärisch. 29 Ihr Molekulargewicht beträgt zwischen und mehreren Da. 30 Die räumliche Gestalt der Moleküle ist für ihre Spezifität und Effektivität verantwortlich Funktionen und Nomenklatur Die Enzyme sind ihrer Reaktionsspezifität nach eingeteilt. Diese Einteilung fand durch eine internationale Kommission statt und gliedert die Enzyme in sechs Klassen: 32 Oxidoreduktasen, Transferasen, Hydrolasen, Lyasen, Isomerasen, Ligasen. Während des Mälzens und Maischens sind vor allem die Hydrolasen wichtig sie spalten unter Wassereinschluss Makromoleküle auf. Dies kann entweder vom Molekülende geschehen dann handelt es sich bei dem entsprechenden Enzym um ein Exoenzym oder von der Molekülmitte her, wenn ein Endoenzym die Spaltung bewirkt. Innerhalb der Hydrolasen wiederum sind für den Maischprozess neben den Esterasen die Glycoside und Peptidbindungen spaltenden Enzyme wichtig. Folgende Tabelle 2 gibt eine Übersicht der beim Mälzen und Maischen wichtigen makromolekülspaltenden Enzyme wieder. 27 Vgl.: Schlegel, Hans G.: Allgemeine Mikrobiologie. 2. Aufl. Stuttgart S Vgl.: Karlson, Peter: Kurzes Lehrbuch der Biochemie für Mediziner und Naturwissenschaftler. 14. Aufl. Stuttgart S Vgl.: Karlson, Peter: ebenda. S Vgl.: Karlson, Peter: ebenda. 31 Vgl.: Belitz, Hans-Dieter et al.: Lehrbuch der Lebensmittelchemie. 5. Aufl. Berlin S. 90.
23 Grundlagen 23 Tabelle 2: Hydrolasen beim Mälzen und Maischen 33,34,35 Enzym katalysierte Reaktion Carbohydrasen Abbau von Stärke, Hemicellulosen und Cellulose -Amylase Spaltung der -1 4-Bindungen der Amylose und des (dextrinogene Amylopektins vom Innern zu Oligosacchariden Amylase) -Amylase Spaltung der Amylose vom nichtreduzierenden Ende her zu (saccharogene Maltose, des Amylopektins bis zu Grenzdextrinen Amylase) (Oligosaccharide mit -1 6-Bindungen) Maltase Spaltung von Maltose zu Glucose Grenzdextrinase Spaltung der -1 6-Bindungen von Grenzdextrinen R-Enzym Spaltung der -1 6-Bindungen von Grenzdextrinen und Amylopectin von außen -Glucosidase Freisetzung von Glucose aus Amylose und Amylopektin Saccharase Spaltung von Saccharose zu Glucose und Fructose -Glucan-Solubilase Herauslösen von Hemicellulosen- -Glucan aus der Zellproteinmatrix Endo Spaltung von -1 4-Bindungen in hochmolekularem -Glucan Glucanase Endo Spaltung von -1 3-Bindungen in hochmolekularem -Glucan Glucanase Exo- -Glucanase Abspaltung von Cellobiose und Laminaribiose von hochmolekularem -Glucan Endo-Xylanase Spaltung von hochmolekularem Pentosan Cellobiase Spaltung von Cellobiose zu Glucose Laminaribiase Spaltung von Laminaribiose zu Glucose Cellulase Spaltung von Dextrinen zu Glucose Proteasen Spaltung von Peptidbindungen Endopeptidasen Aminosäurensequenzspezifischer Abbau hochmolekularer Proteine zu Poly- und Oligopeptiden Carboxypeptidasen Hydrolyse der Peptide vom Carboxylgruppenende her Aminopeptidasen Hydrolyse der Peptide vom Aminogruppenende her Dipeptidasen Abtrennung von Dipeptiden vom Molekülende her 32 Vgl.: Belitz, Hans-Dieter et al.: Lehrbuch der Lebensmittelchemie. 5. Aufl. Berlin S Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): Handbuch der Brauerei-Praxis. 3. Aufl. Nürnberg S. 4 ff. 34 Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1: Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S. 61 ff. 35 Vgl.: Belitz, Hans-Dieter et al.: a.a.o. S. 323 ff.
24 Grundlagen Enzymatische Reaktionen und ihre Beeinflussung Enzyme erhöhen Reaktionsgeschwindigkeiten. Sie beschleunigen also die Einstellung des Gleichgewichtes von Edukt und Produkt einer Reaktion. Hierbei können sie in ihrer Wirkungsweise positiv und negativ beeinflusst werden. Dies kann durch die Substratkonzentration, das Ionenmilieu, die Anwesenheit von Aktivatoren bzw. Inhibitoren und die Umgebungstemperatur geschehen. Ab einer bestimmten Temperatur ist das Enzym jedoch denaturiert und damit irreversibel inaktiviert. 36 Es gibt also für die Enzymwirkung Optimalbedingungen, die der Mälzer oder der Brauer herstellen oder umgehen kann, je nachdem, ob er die Wirkung des Enzyms wünscht oder nicht. Während der Mälzung kann auf die Enzymarbeit durch folgende Parameter regulierend eingewirkt werden: 37 - Keimtemperatur. - Keimgutfeuchte. - Keimdauer. - Verhältnis Frischluft/Umluft (O 2 /CO 2 ). Beim Maischen beeinflussen die Parameter - Brauwasserzusammensetzung, - Schüttung/Gussführung, - Maische-pH, - Temperatur-Zeitführung und thermisch-physikalischer Aufschluss des Substrates durch Kochung (Dekoktion) das Wirkungsausmaß der Enzyme. 38 Außerdem beeinflusst die Feinheit der Schrotung des Malzes die Angriffsmöglichkeiten für die Enzyme und somit deren Wirkung. 39 Dies ist jedoch ein Schrotungs- und kein Maischparameter. 36 Vgl.: Falbe, Jürgen. u. Manfred Regitz (Hrsg.): Römpp Chemie Lexikon Band Aufl. Stuttgart S Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): Handbuch der Brauerei-Praxis. 3. Aufl. Nürnberg S. 29 f. 38 Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): ebenda. S. 112 f. 39 Vgl.: Schwill-Miedaner, Annette et al.: Untersuchungen zur Zeitoptimierung von Maischen. In: Brauwelt Heft 12. Nürnberg S. 466.
25 Grundlagen Stoffliche Veränderungen während der Mälzung Mälzen bedeutet, Getreidekörner zum Keimen zu bringen. Dies geschieht durch Wasserzugabe beim Prozessschritt Weichen, bis ein Wassergehalt von ca. 38 % erreicht ist. Hierdurch fangen zum einen bereits in der Rohgerste vorhandene Enzyme an zu wirken, zum anderen werden Enzyme gebildet. Diese lässt man während der Keimung bei einem Wassergehalt von % und Temperaturen von C in ihrer Aktivität erstarken und wirken. Anschließend wird das sogenannte Grünmalz gedarrt, um es haltbar zu machen und ein Aromaprofil auszubilden. 40 Ein keimendes Gerstenkorn mit eingezeichneten Gestaltsmerkmalen, die sich während des Mälzens verändern, ist in der Abbildung 7 im Querschnitt dargestellt. Abbildung 7: Keimendes Gerstenkorn 41 Die enzymatisch bedingten stofflichen Veränderungen von der Gerste zum Produkt Malz sind im Folgenden erläutert Zellwandlösung im Korn Die Zellwandlösung oder Zytolyse beginnt beim Mälzen mit einem Aktivitätsanstieg der in der Gerste bereits vorhandenen Exoenzyme des Zellwandabbaus (siehe 40 Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): Handbuch der Brauerei-Praxis. 3. Aufl. Nürnberg S. 29 f. 41 Palmer, G. H.: Modes of Action of Gibberellins During Malting. In: European Brewery Convention. Proceedings of the 13 th Congress Estoril Amsterdam S. 64.
26 Grundlagen ). Auch die -Glucan-Solubilase, die ebenfalls in Gerste vorliegt, 42 steigert bei Mälzungsbeginn ihre Aktivität und löst β-glucan aus der Zellmatrix, um es für die sich bildenden Endoenzyme angreifbar zu machen. 43 So werden die Zellwände des Gerstenendosperms allmählich aufgelöst und das Korn wird zerreibbar. Die Stärke, die sich innerhalb der Zellwände befindet, wird für die stärkeabbauenden Enzyme zugänglich, ein Energiestoffwechsel wird so erst möglich 44 (siehe 2.3.3). Die Abbauvorgänge der Pentosane und der -Glucane stellt Narziß wie in Abbildung 8 und Abbildung 9 gezeigt dar. Angemerkt sein soll nur kurz, dass die Existenz der - Glucan-Solubilase nicht von allen Autoren gefordert wird. Erdal und Gjertsen 45 beschreiben beispielsweise den Mechanismus der -Glucan-Freisetzung als Zusammenspiel von temperaturbedingter Stärkeverkleisterung und Enzymatik. Der größere Teil der Autoren bevorzugt jedoch das Modell der -Glucan-Solubilase. Abbildung 8: Schema des -Glucanabbaus Vgl.: Bamforth, C.W.: Enzymolysis of β-glucan. In: European Brewery Convention Proceedings of the 11 th Congress Copenhagen London S Vgl.: Narziß, Ludwig: Abriß der Bierbrauerei. 6. Aufl. Weinheim S. 25 f. 44 Vgl.:Thompson, R. G.und D. E. LaBerge: Barley Endosperm Cell Walls: A Review of Cell Wall Polysaccharides and Cell Wall-Degrading Enzymes. MBAA Technical Quarterly. Volume 14. Nr S Vgl.: Erdal, K. und Gjertsen, P.: -Glucans in Malting and Brewing. In: European Brewery Convention Proceedings of the 11 th Congress Madrid Amsterdam S Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1 Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S. 161.
27 Grundlagen 27 Abbildung 9: Schema des Pentosanabbaus 47 Der Abbau der Zellwandbausteine bedeutet also zunächst die Lösung größerer Moleküle, die dann zu Dextrinen mittlerer Größe abgebaut werden, um schließlich zu Di- und Monosacchariden zerlegt zu werden. Dies geschieht allerdings beim Mälzungsvorgang bei weitem nicht vollständig. Während der Gehalt an hochmolekularem β-glucan im Malz auf bis zu 5 % seines Ausgangswertes in Gerste sinken kann, 48 sind von den Pentosanen noch 80 % des ursprünglichen Gehaltes nach der Mälzung vorhanden. 49 Positiv beeinflusst werden kann die Zytolyse durch Keimtemperaturen um C und eine gute O 2 -Versorgung, 50 vor allem aber durch einen höheren Weichgrad (= Wassergehalt) sowie längere Keimdauer Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1 Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S Vgl.: Schuster, K. et al.: Über die Gummistoffe der Gerste und ihr Verhalten während der Malz- und Bierbereitung. In: Brauwissenschaft Heft 4. Jahrgang 20. Nürnberg S. 186 ff. 49 Vgl.: Narziß, Ludwig: a.a.o. S Vgl.: Narziß, Ludwig: ebenda. S Vgl.: Narziß, Ludwig: ebenda. S. 162 f.
28 Grundlagen Eiweißlösung Die hochmolekularen Eiweiße liegen im Gerstenkorn im Aleuron, unterhalb der Aleuronschicht als Reservesubstanz und im Endosperm als Kittsubstanz vor. Mit dem Abbau dieser Kittsubstanz ist zum einen die in den Endospermzellen gespeicherte Stärke für degradierende Enzyme zugänglich, zum anderen wird für den Aufbau eines Wurzel- und Blattkeims niedermolekulares Eiweiß, vor allem Aminosäuren, frei. Benötigt werden diese auch zur Synthese von weiteren hydrolytischen Enzymen. 52 Abbildung 10 zeigt die Abbau- und Synthesewege der Proteine beim Mälzen. Abbildung 10: Enzymatischer Abbau der Eiweißfraktionen Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1 Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S Narziß, Ludwig: ebenda. S. 166.
29 Grundlagen 29 Hohe Weichgrade (um %) fördern den Eiweißabbau stark. Ebenfalls sind eine gute O 2 -Versorgung beim Weichen und Keimtemperaturen um C förderlich. 54,55 Eine Erhöhung des Umluftanteils während der Keimung erhöht den im Korn verbleibenden Anteil gelösten Eiweißes. Dadurch wird nicht soviel Baustoff in den Keim abtransportiert Stärkelösung Die Stärke liegt in der Gerste in den Zellen des Endosperms als Körner verschiedener Größe vor. Diese Zellen sind von Hemicellulosemembranen umgeben und mit Proteinen verklebt. Bevor die Stärke angreifbar wird, muss also zunächst ein Zellwand- und Eiweißabbau stattfinden. 57 Ursprünglich befindet sich in der Gerste ein Anteil von ca. 2 % Mono- und Disacchariden, die zur Energiegewinnung für das Korn vor der Keimung dienen. 58 Während der Keimung wird die Stärke dann von - und - Amylase zu Zuckereinheiten abgebaut, die wiederum dem Keimling als Energieträger oder Baustoff für Stärke zur Verfügung stehen. Dabei fallen Abbauprodukte mit Verzweigungen, die Dextrine, an. 59 Diese werden dann von der sogenannten Grenzdextrinase weiter zersetzt. Einen Überblick über den enzymatischen Stärkeabbau gibt die Abbildung Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): Handbuch der Brauerei-Praxis. 3. Aufl. Nürnberg S Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1 Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S Vgl.: Narziß, Ludwig: ebenda. S Vgl.: Narziß, Ludwig: ebenda. S Vgl.: Narziß, Ludwig: ebenda. S Vgl.: Narziß, Ludwig: ebenda. S. 152.
30 Grundlagen 30 Abbildung 11: Schema des Stärkeabbaus 60 Wichtig ist ein geringes Ausmaß des Stärkeabbaus beim Mälzen. Sie wird sonst als Zucker in den Stoffwechsel überführt und veratmet oder dem Blattkeim bzw. dem Wurzelkeim als Metabolit zur Verfügung gestellt und geht so als Extrakt verloren. Von Bedeutung ist vielmehr die ausgeprägte Aktivierung und Bildung von amylolytischen Enzymen beim Mälzen, die ihre Wirkung beim Maischen entfalten. Beeinflussbar ist dies bei der Keimung durch eine hohe Keimgutfeuchte (bis 46 %) und nicht mehr als 5 % CO 2 -Gehalt in der dem Keimgut zugeführten Luft. Bei fallender Temperaturführung werden am Anfang der Keimung die Enzyme aktiviert und 60 Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1. Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S. 151.
31 Grundlagen 31 gebildet. Der Verlust von extraktbildender Stärke bzw. Zuckern wird jedoch gebremst. Mit steigender Keimzeit erstarken zwar die Enzyme, aber ebenfalls steigt der beschriebene Schwand Der Maischprozess als Lösungsvorgang Der Maischprozess hat die Aufgabe, Extrakt aus dem geschroteten Malz in Wasser zu lösen. Zum einen soll möglichst viel vergärbarer Extrakt (Zucker, Abbauprodukte der Stärke) gelöst werden, zum anderen möglichst wenig problembereitender Extrakt (filtrationshemmende hochmolekulare -Glucane). Weiter sollen in der späteren Würze ausreichend, aber nicht zu viel hochmolekulares Eiweiß zur Schaumbildung und Aminosäuren zur Hefenahrung vorhanden sein. Zwar legt die Malzauflösung grundsätzlich die Grenzen der Möglichkeiten beim Maischen fest, dennoch ist es innerhalb dieser Grenzen möglich, mangelnder Malzlösung entgegenzusteuern bzw. die Würzezusammensetzung in einer gewünschten Art zu beeinflussen Physikalische und enzymatische Lösung In der Bierbereitung wird zunächst das Malz geschrotet, also mechanisch zerkleinert, und anschließend gemaischt. Dies bedeutet eine Vermischung des Schrotes, genannt Schüttung, mit Wasser, genannt Guss, also die Herstellung eines Fest- Flüssig-Gemisches, einer Suspension, genannt Maische. Diese Suspension verändert ihre Zusammensetzung mit der Zeit, da einerseits Inhaltsstoffe des Malzes unverändert physikalisch in Lösung gehen. Andererseits entfalten die Enzyme, die sich beim Mälzen gebildet haben, unter dem Einfluss des Wassers ihre Wirkung und verändern unlösliche Malzinhaltsstoffe so, dass sie in Lösung gehen. Abbildung 12 gibt einen Überblick über diese Lösungsvorgänge und ihr Zusammenwirken. Sie stellt auch die Fachbegriffe innerhalb dieser Prozesse dar. 61 Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 1. Die Technologie der Malzbereitung. 7. Aufl. Stuttgart S. 153 ff. 62 Vgl.: Schwill-Miedaner, Annette: Derzeitige Schwerpunkte der Brauereitechnologie. In: Der Weihenstephaner. 70. Jahrgang. Heft 1. Nürnberg S. 26.
32 Grundlagen 32 disperse Phase kontinuierliche Phase Schrot: Schüttung Wasser: Guss Suspension: Maische Diffusion - Desagglomeration - Quellung - Verkleisterung Enzymatik - Hydrolyse - Lösung Abbildung 12: Lösungsvorgänge beim Maischen 63 Die Tabelle 3 listet beim Maischen aktive Malzenzyme mit ihren maischerelevanten Eigenschaften auf. Dies sind Wirkungsoptima und Inaktivierungstemperaturen der Enzyme. 63 Vgl.: Herrmann, Jan: Entwicklung von Messmethoden zur Untersuchung der rheologischen Eigenschaften der Maische. Dissertation. TU München S. 31.
33 Grundlagen 33 Tabelle 3: Enzyme des Malzes und ihr Verhalten beim Maischen 64 Enzym Wirkungsoptima in Maische ph Temperatur/ C Hauptklasse 1: Oxidoreduktasen Peroxidase Lipoxigenase 6, Polyphenoloxidase Hauptklasse 3: Hydrolasen Lipase 6, Saure Phosphatase 4,5-5, α-amylase 5,6-5, β-amylase 5,4-5, Cellulase 4,5-5, Laminarinase 5, Endo-β-1 4-Glucanase 4,7-5, Grenzdextrinase 5, Maltase 6, β-mannosidase Invertase 5, Exo- und Endoxylanasen 5,0 45 Endo-β-1 3-Glucanase 4,7-5, Exo-β-Glucanasen 4, Pullulanase 5,0-5, Arabinosidase 4,6-4, β-glucan-solubilase mit Esteraseaktivität 6,6-7, β-glucan-solubilase mit 4,6-4, Carboxypeptidaseaktivität Aminopeptidasen 7, Carboxypeptidasen 5, Dipeptidasen 7,2-8, Endopeptidasen 5,0-5, Inaktivierungstemperatur/ C Maischparameter und deren Beeinflussung Die obige Tabelle 3 zeigt die Wirkungsoptima im ph-wert und in der Temperatur der Malzenzyme beim Maischen. Außerdem besitzen die Enzyme Inaktivierungstemperaturen. Dies macht sie über die Maischparameter ph-wert, Gussverhältnis und Temperatur-Zeit-Führung regulierbar. 64 Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): Handbuch der Brauerei-Praxis. 3. Aufl. Nürnberg S. 58.
34 Grundlagen ph-wert Auf den ph-wert der Maische kann man über zwei Parameter Einfluss nehmen: Über die Zusammensetzung des Brauwassers und über die Maischesäuerung. Abgesehen von der Regulierung der Enzyme bietet ein niedriger ph-wert beim Maischen die Vorteile, dass die Gerbstoffe weniger stark aus den Spelzen ausgelaugt sowie höhermolekulare Eiweiße beim Würzekochen stärker ausgeschieden werden. Die Bittere des entstehenden Bieres wird dadurch feiner und die kolloidale Stabilität erhöht. Zur besseren Ausdampfung von unerwünschten Aromastoffen (DMS: Dimethylsulfid) und zur höheren Hopfenbitterstoffausbeute ist ein hoher ph-wert beim Kochen vorteilhaft Brauwasser Wasser ist in der Natur nie chemisch rein vorhanden, sondern immer mit gelösten Salzen und Gasen versetzt. Diese gelösten Substanzen nehmen auf zusätzliche Lösungsvorgänge wie den Maischprozess Einfluss. Hier sind in erster Linie die Härtebildner, die Erdalkalimetalle (Beryllium Be, Magnesium Mg, Kalzium Ca, Strontium Sr und Barium Ba) 66 und deren Karbonationen zu nennen. Der Gehalt an Kalzium und Magnesium, welche vorwiegend in natürlichen Wässern vorkommen, sowie an Hydrogenkarbonat (HCO - 3 ) beeinflussen stark die Acidität, also die dissoziierten und die potenziell dissoziierenden Säuren in der Maische. 67 Kalzium und Magnesium wirken aciditätsfördernd, Hydrogenkarbonat wirkt aciditätsvernichtend. Die Hydrogenkarbonationen bewirken mit den sich aus dem Malz lösenden Phosphaten (H 2 PO - 4, primäres Phosphat) zunächst folgende Reaktion: H 2 PO HCO - 3 HPO H 2 O + CO 2 Unter Kohlendioxidfreisetzung (CO 2 ) entstehen hierbei schwach alkalische sekundäre Phosphate (HPO 2-4 ), die wiederum zu stark alkalisch wirkenden tertiären Phosphaten (PO 3-4 ) weiterreagieren können: HPO HCO - 3 PO H 2 O + CO 2 65 Vgl.: Kunze, Wolfgang, Technologie Bauer und Mälzer. 8. Aufl. Berlin S. 216 u Vgl.: Christen, Hans Rudolf: Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie. 7. Aufl. Frankfurt am Main S Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): Handbuch der Brauerei-Praxis. 3. Aufl. Nürnberg S. 70 ff.
35 Grundlagen 35 Die aciditätsfördernde Wirkung des Kalziums und des Magnesiums wiederum beruht auf der Fähigkeit, mit den sekundären Phosphaten zu sauer wirkenden primären Phosphaten zu reagieren: 3 Ca HPO Ca 3 (PO 4 ) H 2 PO 4 Das tertiäre Kalziumphosphat fällt aus, und die entstandenen primären Phosphate wirken sauer. Magnesium hat eine schwächer aciditätsfördernde Wirkung, es fällt als Salz mit tertiärem Phosphat nur unter hohen Temperaturen aus. Um die aciditätsbeeinflussenden Wirkungen der Ionen gegenüberzustellen und eine Aussage über die brautechnologische Eignung eines Wassers treffen zu können, ist der Begriff der Restalkalität eingeführt worden. Er berücksichtigt, dass 3,5 mol Kalzium oder 7 mol Magnesium die aciditätsvernichtende Wirkung von 1 mol Hydrogenkarbonat aufheben können. Die Restalkalität (RA) ist folgendermaßen definiert: RA = GA - aa mit Gesamtalkalität (GA) = Kabonathärte (KH) = Gehalt an Karbonat [CO 2-3 ] und Hydrogenkarbonat [HCO - 3 ] sowie ausgeglichene Alkalität (aa) = 1 / 3,5 [Ca 2+ ] + 1 / 7 [Mg 2+ ] Für den ph-wert in Maische und die Restalkalität gilt der Zusammenhang, dass eine Erhöhung der Restalkalität um 10 dh (= Grad deutscher Härte) den Maische-pH- Wert um 0,3 erhöht. 68 Einen Sonderfall stellen sodaalkalische Wässer dar. Soda ist ein basisch wirkendes Salz: Na 2 CO 3. Wenn die Karbonathärte des Wassers höher ist als die Summe von Kalzium- und Magnesiumhärte, spricht man von sodaalkalischem Wasser, da davon auszugehen ist, dass Natrium als ergänzendes Kation zu Hydrogenkarbonat vorhanden ist. Natrium hat keine aciditätsfördernde Wirkung; es geht keine Fällungsreaktion mit sekundären Phosphaten ein. 69 Sodaalkalische Wässer sollten durch Entsalzung aufbereitet werden. 68 Vgl.: Heyse, Karl-Ullrich (Hrsg.): Handbuch der Brauerei-Praxis. 3. Aufl. Nürnberg S. 73f. 69 Vgl.: Narziß, Ludwig: Die Bierbrauerei. Band 2. Die Technologie der Würzebereitung. 7. Aufl. Stuttgart S. 24.
Di- und Polysaccharide
 Di- und Polysaccharide Glycoside und Disaccharide Zwischen Zucker- und Alkoholmolekülen kann eine Kondensationsreaktion 1 stattfinden, indem die H-Gruppe des Alkohols mit der H-Gruppe am C1-Atom des Zuckermoleküls
Di- und Polysaccharide Glycoside und Disaccharide Zwischen Zucker- und Alkoholmolekülen kann eine Kondensationsreaktion 1 stattfinden, indem die H-Gruppe des Alkohols mit der H-Gruppe am C1-Atom des Zuckermoleküls
SCHROTEN In der Schrotmühle der Brauerei wird das Malz in Spelzen, Grobgrieße, Feingrieße und Mehl zerkleinert.
 Es ist schon eine Kunst so ein charakteristisch wohlschmeckendes Kölsch wie Mühlen Kölsch zu brauen. Die langjährige Erfahrung unseres Braumeisters gewährleistet die gleich bleibende Qualität. Mühlen Kölsch
Es ist schon eine Kunst so ein charakteristisch wohlschmeckendes Kölsch wie Mühlen Kölsch zu brauen. Die langjährige Erfahrung unseres Braumeisters gewährleistet die gleich bleibende Qualität. Mühlen Kölsch
ENZYME. Teil 1: Grundlagen und Substratbestimmungen
 ENZYME Teil 1: Grundlagen und Substratbestimmungen Metastabiler Zustand Beispiel: Glucose-6-Phosphat + H 2 O [Glc6P] [H 2 0] K = = 1.135 x 10 [Glc] [Pi] -3 Gleichgewicht stark auf Seite von Glc + Pi Glucose
ENZYME Teil 1: Grundlagen und Substratbestimmungen Metastabiler Zustand Beispiel: Glucose-6-Phosphat + H 2 O [Glc6P] [H 2 0] K = = 1.135 x 10 [Glc] [Pi] -3 Gleichgewicht stark auf Seite von Glc + Pi Glucose
Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium):
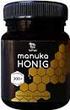 Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium): Bildung, Wirkung, Konsequenzen DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) vorgelegt der Fakultät
Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium): Bildung, Wirkung, Konsequenzen DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) vorgelegt der Fakultät
Artikelliste. Analytik. Chemisch-technisch. Gerste: Keimfähigkeit (EBC Methode) Sortierung (EBC-Methode) Gerste, Malz
 CT-1010 Gerste: Keimfähigkeit (EBC Methode) CT-1020 Sortierung (EBC-Methode) Gerste, Malz CT-1240 visueller Schimmelbefall (rote Körner) Gerste, Malz CT-2010 Handbonitierung Gerste, Malz CT-2030 Malz:
CT-1010 Gerste: Keimfähigkeit (EBC Methode) CT-1020 Sortierung (EBC-Methode) Gerste, Malz CT-1240 visueller Schimmelbefall (rote Körner) Gerste, Malz CT-2010 Handbonitierung Gerste, Malz CT-2030 Malz:
Versuchsergebnisse aus Bayern 2015
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2015 Sortenversuch WINTERWEIZEN Malzqualität Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Versuchsergebnisse aus Bayern 2015 Sortenversuch WINTERWEIZEN Malzqualität Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Klausur zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach (SS2011)
 Klausur zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach (SS2011) Musterlösung 1. (10P) Was ist richtig (mehrere Richtige sind möglich)? a) Amylose und Amylopektin bestehen nur aus D-Glucose
Klausur zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach (SS2011) Musterlösung 1. (10P) Was ist richtig (mehrere Richtige sind möglich)? a) Amylose und Amylopektin bestehen nur aus D-Glucose
Weitere Übungsfragen
 1 Strategie bei multiple choice Fragen Wie unterscheidet sich Glucose von Fructose? (2 Punkte) Glucose hat 6 C Atome, Fructose hat nur 5 C Atome. In der Ringform gibt es bei Glucose α und β Anomere, bei
1 Strategie bei multiple choice Fragen Wie unterscheidet sich Glucose von Fructose? (2 Punkte) Glucose hat 6 C Atome, Fructose hat nur 5 C Atome. In der Ringform gibt es bei Glucose α und β Anomere, bei
5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE. T. Golubkova, M. Murkovic
 5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE T. Golubkova, M. Murkovic Institut für Biochemie Technische Universität, Graz, Österreich Einleitung Während
5- HYDROXYMETHYL-2-FURANSÄURE ERARBEITUNG EINES MODELLSYSTEMS ZUR BILDUNG IN GERÖSTETEM KAFFEE T. Golubkova, M. Murkovic Institut für Biochemie Technische Universität, Graz, Österreich Einleitung Während
Enzyme (Teil 1) Aminosäuren, Aufbau, Eigenschaften & Funktion. Mag. Gerald Trutschl
 Enzyme (Teil 1) Aminosäuren, Aufbau, Eigenschaften & Funktion Mag. Gerald Trutschl 1 Inhalt 1. Einführung 2. Aufbau: - Aminosäuren - Peptidbindung - Primärstruktur - Sekundärstruktur - Tertiär- und Quatärstrukturen
Enzyme (Teil 1) Aminosäuren, Aufbau, Eigenschaften & Funktion Mag. Gerald Trutschl 1 Inhalt 1. Einführung 2. Aufbau: - Aminosäuren - Peptidbindung - Primärstruktur - Sekundärstruktur - Tertiär- und Quatärstrukturen
Enzyme SPF BCH am
 Enzyme Inhaltsverzeichnis Ihr kennt den Aufbau von Proteinen (mit vier Strukturelementen) und kennt die Kräfte, welche den Aufbau und die Funktion von Enzymen bestimmen... 3 Ihr versteht die Einteilung
Enzyme Inhaltsverzeichnis Ihr kennt den Aufbau von Proteinen (mit vier Strukturelementen) und kennt die Kräfte, welche den Aufbau und die Funktion von Enzymen bestimmen... 3 Ihr versteht die Einteilung
EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG. (43) Veröffentlichungstag: Patentblatt 2011/43
 (19) (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (11) EP 2 380 967 A1 (43) Veröffentlichungstag: 26.10.2011 Patentblatt 2011/43 (21) Anmeldenummer: 11163165.1 (51) Int Cl.: C12C 7/04 (2006.01) C12C 11/06 (2006.01)
(19) (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (11) EP 2 380 967 A1 (43) Veröffentlichungstag: 26.10.2011 Patentblatt 2011/43 (21) Anmeldenummer: 11163165.1 (51) Int Cl.: C12C 7/04 (2006.01) C12C 11/06 (2006.01)
Sommersemester Nennen Sie vier Spezialmalze und ihre Weizenmalz Farbmalz Herstellung Spitzmalz Brühmalz. Karamelmalz 4
 P r ü f u n g s f r a g e n Sommersemester 2005 B r a u e r e i t e c h n o l o g i e 1. Welche Anforderungen stellt der Brauer Keimfähigkeit > 98 % Aussehen & Geruch 0,5 an zweizeilige Sommer-Braugerste?
P r ü f u n g s f r a g e n Sommersemester 2005 B r a u e r e i t e c h n o l o g i e 1. Welche Anforderungen stellt der Brauer Keimfähigkeit > 98 % Aussehen & Geruch 0,5 an zweizeilige Sommer-Braugerste?
Einführung in die praktische Biochemie
 H.Aebi BOTAN. INSTITUT Medizinisch-chemisches Institut der Universität Bern lechn. HOCM^rur ir r- 6100 - ' ochul^ Einführung in die praktische Biochemie für Studierende der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie
H.Aebi BOTAN. INSTITUT Medizinisch-chemisches Institut der Universität Bern lechn. HOCM^rur ir r- 6100 - ' ochul^ Einführung in die praktische Biochemie für Studierende der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie
Vortrag von Dr. Uwe Hilgers auf dem Bildungskongress in Dortmund am Dr. Uwe Hilgers. Optimierung. Quantitative.
 Die alkoholische Gärung Vortrag von Dr. Uwe Hilgers auf dem Bildungskongress in Dortmund am 12.3.2011 Dr. Uwe Hilgers Überblick Optimierung der der Gärung Einordnung in in eine eine Unterrichtsreihreihe
Die alkoholische Gärung Vortrag von Dr. Uwe Hilgers auf dem Bildungskongress in Dortmund am 12.3.2011 Dr. Uwe Hilgers Überblick Optimierung der der Gärung Einordnung in in eine eine Unterrichtsreihreihe
Dissoziation, ph-wert und Puffer
 Dissoziation, ph-wert und Puffer Die Stoffmengenkonzentration (molare Konzentration) c einer Substanz wird in diesem Text in eckigen Klammern dargestellt, z. B. [CH 3 COOH] anstelle von c CH3COOH oder
Dissoziation, ph-wert und Puffer Die Stoffmengenkonzentration (molare Konzentration) c einer Substanz wird in diesem Text in eckigen Klammern dargestellt, z. B. [CH 3 COOH] anstelle von c CH3COOH oder
Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung
 Medizin Vanessa Schuh Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung Masterarbeit UNTERSUCHUNGEN ZUR STABILITÄT UND ANTIOXIDATIVEN WIRKUNG VON FLAVONOIDEN IM ZITRONENSAFT Masterarbeit
Medizin Vanessa Schuh Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung Masterarbeit UNTERSUCHUNGEN ZUR STABILITÄT UND ANTIOXIDATIVEN WIRKUNG VON FLAVONOIDEN IM ZITRONENSAFT Masterarbeit
Montag, 12. Juli 2010. Biologische Säuerung
 Biologische Säuerung Übersicht 1. Welche möglichen technologischen Verbesserungen ergeben sich durch den Einsatz der biologischen Säuerung? 2. Die Maischesäuerung 3. Die Würzesäuerung 4. Technische und
Biologische Säuerung Übersicht 1. Welche möglichen technologischen Verbesserungen ergeben sich durch den Einsatz der biologischen Säuerung? 2. Die Maischesäuerung 3. Die Würzesäuerung 4. Technische und
P9 Kunststoffe Moleküle ohne Ende
 SLZB Fachbereich Naturwissenschaften Fachinternes Curriculum für das Fach Chemie Klasse 10 2014/15 P9 Kunststoffe Moleküle ohne Ende 10 Bedeutung Kunststoffe Monomer, Polymer, Makromoleküle Polymerisation
SLZB Fachbereich Naturwissenschaften Fachinternes Curriculum für das Fach Chemie Klasse 10 2014/15 P9 Kunststoffe Moleküle ohne Ende 10 Bedeutung Kunststoffe Monomer, Polymer, Makromoleküle Polymerisation
Praktikumsrelevante Themen
 Praktikumsrelevante Themen Lösungen Der Auflösungsprozess Beeinflussung der Löslichkeit durch Temperatur und Druck Konzentration von Lösungen Dampfdruck, Siede- und Gefrierpunkt von Lösungen Lösungen von
Praktikumsrelevante Themen Lösungen Der Auflösungsprozess Beeinflussung der Löslichkeit durch Temperatur und Druck Konzentration von Lösungen Dampfdruck, Siede- und Gefrierpunkt von Lösungen Lösungen von
VERDAUUNG. Der lange Weg durch den Verdauungstrakt
 VERDAUUNG Der lange Weg durch den Verdauungstrakt Sonja Zankl SS 2002 DEFINITION Abbau der Nahrungsstoffe im Verdauungstrakt in resorptionsfähige Bestandteile & Aufnahme in Blut bzw. Lymphe Wozu Verdauung?
VERDAUUNG Der lange Weg durch den Verdauungstrakt Sonja Zankl SS 2002 DEFINITION Abbau der Nahrungsstoffe im Verdauungstrakt in resorptionsfähige Bestandteile & Aufnahme in Blut bzw. Lymphe Wozu Verdauung?
Aminosäuren 1. Aufbau der Aminosäuren
 Aminosäuren 1 Aufbau der Aminosäuren Aminosäuren bestehen aus einer Carbonsäuregruppe und einer Aminogruppe. Die einfachste Aminosäure ist das Glycin mit 2 Kohlenstoffatomen. Das Kohlenstoffatom nach der
Aminosäuren 1 Aufbau der Aminosäuren Aminosäuren bestehen aus einer Carbonsäuregruppe und einer Aminogruppe. Die einfachste Aminosäure ist das Glycin mit 2 Kohlenstoffatomen. Das Kohlenstoffatom nach der
D-(+)-Biotin (Vitamin H)
 D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
Enzyme. 1. Stonewashed Jeans, Waschmittel, Gallseife. 2. Enzyme in Waschmitteln
 Enzyme 1. Stonewashed Jeans, Waschmittel, Gallseife Obwohl die«produkte den meisten Menschen bekannt sind, wissen die wenigsten. dass bei deren Herstellung Enzyme eine wichtige Rolle spielen. Enzyme sind
Enzyme 1. Stonewashed Jeans, Waschmittel, Gallseife Obwohl die«produkte den meisten Menschen bekannt sind, wissen die wenigsten. dass bei deren Herstellung Enzyme eine wichtige Rolle spielen. Enzyme sind
Übungsaufgaben Chemie Nr. 3
 Übungsaufgaben Chemie Nr. 3 22) Wie hoch ist die Molarität der jeweiligen Lösungen, wenn die angegebene Substanzmenge in Wasser gelöst und auf 200 ml aufgefüllt wurde? a) 58.44g NaCl (Kochsalz) b) 100
Übungsaufgaben Chemie Nr. 3 22) Wie hoch ist die Molarität der jeweiligen Lösungen, wenn die angegebene Substanzmenge in Wasser gelöst und auf 200 ml aufgefüllt wurde? a) 58.44g NaCl (Kochsalz) b) 100
n Pentan 2- Methylbutan 2,2, dimethylpropan ( Wasserstoffatome sind nicht berücksichtigt )
 Grundwissen : 10 Klasse G8 Kohlenwasserstoffe Alkane Einfachbindung (σ -Bindung, kovalente Bindung ) : Zwischen Kohlenstoffatomen überlappen halbbesetzte p- Orbitale oder zwischen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen
Grundwissen : 10 Klasse G8 Kohlenwasserstoffe Alkane Einfachbindung (σ -Bindung, kovalente Bindung ) : Zwischen Kohlenstoffatomen überlappen halbbesetzte p- Orbitale oder zwischen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen
Löslich in entmineralisiertem, ph-eingestelltem Wasser und Alkohol
 Hexahop 95 Hexahop 95 ist eine wässrige Lösung, standardisiert auf 20 %, aus Hexahydro-Iso-α-Säuren, die aus CO 2 Hopfenextrakt mittels patentiertem wässrigen Prozess gewonnen wird. Hexahop 95 verbessert
Hexahop 95 Hexahop 95 ist eine wässrige Lösung, standardisiert auf 20 %, aus Hexahydro-Iso-α-Säuren, die aus CO 2 Hopfenextrakt mittels patentiertem wässrigen Prozess gewonnen wird. Hexahop 95 verbessert
Verdauung. Einführung
 Verdauung Seite 1 Verdauung Einführung Die verwertbaren Inhaltsstoffe der menschlichen Nahrung liegen zum größten Teil in einer Form vor, in der sie nicht resorbiert werden können, z.b. als Polymere, wie
Verdauung Seite 1 Verdauung Einführung Die verwertbaren Inhaltsstoffe der menschlichen Nahrung liegen zum größten Teil in einer Form vor, in der sie nicht resorbiert werden können, z.b. als Polymere, wie
F Ü R S T U D I E R E N D E D E R M E D I Z I N BIOCHEMISCHES INSTITUT DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
 B I O C H E M I S C H E S P R A K T I K U M F Ü R S T U D I E R E N D E D E R M E D I Z I N BIOCHEMISCHES INSTITUT DER UNIVERSITÄT ZÜRICH 2003 INHALTSVERZEICHNIS *) Zum Biochemischen Praktikum steht Ihnen
B I O C H E M I S C H E S P R A K T I K U M F Ü R S T U D I E R E N D E D E R M E D I Z I N BIOCHEMISCHES INSTITUT DER UNIVERSITÄT ZÜRICH 2003 INHALTSVERZEICHNIS *) Zum Biochemischen Praktikum steht Ihnen
Abb. 1: Haworth-Projektionsformel von Lactose
 G8 Abituraufgaben Chemie Kohlenhydrate 2011/A1 1 Milchzucker (Lactose) kommt in der Kuhmilch mit einem Massenanteil von ca. 4,5 % vor. Personen, die an einer Lactose-Unverträgiichkeit leiden, fehlt das
G8 Abituraufgaben Chemie Kohlenhydrate 2011/A1 1 Milchzucker (Lactose) kommt in der Kuhmilch mit einem Massenanteil von ca. 4,5 % vor. Personen, die an einer Lactose-Unverträgiichkeit leiden, fehlt das
BIOCHEMIE. Prof. Manfred SUSSITZ. über(be)arbeitet und zusammengestellt nach Internetvorlagen:
 BIOCHEMIE Prof. Manfred SUSSITZ über(be)arbeitet und zusammengestellt nach Internetvorlagen: Medizinische Fakultät, Universität Erlangen http://www2.chemie.uni-erlangen.de/projects/vsc/chemie-mediziner-neu/start.html
BIOCHEMIE Prof. Manfred SUSSITZ über(be)arbeitet und zusammengestellt nach Internetvorlagen: Medizinische Fakultät, Universität Erlangen http://www2.chemie.uni-erlangen.de/projects/vsc/chemie-mediziner-neu/start.html
BIOLOGIE. Karin Furch. Experimentelle FACHBI = REICH. Inv.-Nr. DIESTERWEG SÄLLE. Studienbücher BIOLOGIE (IOJ
 Studienbücher BIOLOGIE Karin Furch Experimentelle FACHBI = REICH BIOLOGIE (IOJ der Technischen Hochschule. Darmstadt - Bibliothek - D - 6100 Darmstadt / B. R. D. Schnittspahnstraße ^ Inv.-Nr. DIESTERWEG
Studienbücher BIOLOGIE Karin Furch Experimentelle FACHBI = REICH BIOLOGIE (IOJ der Technischen Hochschule. Darmstadt - Bibliothek - D - 6100 Darmstadt / B. R. D. Schnittspahnstraße ^ Inv.-Nr. DIESTERWEG
Fachbereich Ökotrophologie Prof. Häusler SoSe 2005 Biochemie Definition und Fachgebiete
 Biochemie Definition und Fachgebiete Grenzwissenschaft zwischen Chemie, Biologie, Agrarwissenschaften und Medizin Spezialgebiete wie Immunchemie, Neurochemie, Pathobiologie, Genetik, Molekularbiologie,
Biochemie Definition und Fachgebiete Grenzwissenschaft zwischen Chemie, Biologie, Agrarwissenschaften und Medizin Spezialgebiete wie Immunchemie, Neurochemie, Pathobiologie, Genetik, Molekularbiologie,
Steigerung der Aminosäureausbeute in der grünen Bioraffinerie
 1 Steigerung der Aminosäureausbeute in der grünen Bioraffinerie GRÜNE BIORAFFINERIE WARUM? Idee Gewinnung von Produkten aus einfachen Rohmaterialien Erhöhung der Wertschöpfung des Rohstoffes Gras bzw.
1 Steigerung der Aminosäureausbeute in der grünen Bioraffinerie GRÜNE BIORAFFINERIE WARUM? Idee Gewinnung von Produkten aus einfachen Rohmaterialien Erhöhung der Wertschöpfung des Rohstoffes Gras bzw.
Stärkeaufbau. Viktor Bindewald Inhaltsverzeichnis. Versuchsprotokoll
 Stärkeaufbau Versuchsprotokoll Viktor Bindewald 1.12.2005 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 1.1 Jod-Stärkenachweis.............................. 2 1.2 Energetische Kopplung............................
Stärkeaufbau Versuchsprotokoll Viktor Bindewald 1.12.2005 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 1.1 Jod-Stärkenachweis.............................. 2 1.2 Energetische Kopplung............................
10. Jahrgang SIS - Schulinternes Curriculum Chemie SI
 Thema Unterrichtsvorhaben Standards und Kompetenzen aus Klasse 9 Kompetenzschwerpunkte Weiterführende Standards und Kompetenzen des Rahmenlehrplans aus Klasse 9 am Anfang der Jahrgangsstufe 10 aufgreifen,
Thema Unterrichtsvorhaben Standards und Kompetenzen aus Klasse 9 Kompetenzschwerpunkte Weiterführende Standards und Kompetenzen des Rahmenlehrplans aus Klasse 9 am Anfang der Jahrgangsstufe 10 aufgreifen,
Wasserstoffbrückenbindung, H 2 O, NH 3, HF, Wasserstoff im PSE, Isotope, Vorkommen, exotherme Reaktion mit Sauerstoff zu Wasser, Energieinhalt,
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Das Element Wasserstoff und seine Verbindungen Wasserstoffbrückenbindung, H 2 O, NH 3, HF, Wasserstoff im PSE, Isotope, Vorkommen, exotherme Reaktion mit Sauerstoff
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Das Element Wasserstoff und seine Verbindungen Wasserstoffbrückenbindung, H 2 O, NH 3, HF, Wasserstoff im PSE, Isotope, Vorkommen, exotherme Reaktion mit Sauerstoff
Die Geschichte. Die Zutaten
 Die Geschichte Das Bier wurde vermutlich durch einen Zufall entdeckt. Ein Bauer hatte die geerntete Gerste im Regen vergessen und er hatte sie danach zum Trocknen in der Sonne gelassen. So wurde die Gerste
Die Geschichte Das Bier wurde vermutlich durch einen Zufall entdeckt. Ein Bauer hatte die geerntete Gerste im Regen vergessen und er hatte sie danach zum Trocknen in der Sonne gelassen. So wurde die Gerste
spaltet. Der Sauerstoff entflammt den Glimmspan. Bei der katalytischen Substanz handelt es sich um das Enzym Katalase.
 ENZYMATIK 1. Vorversuch Versuch Spaltung von Wasserstoffperoxid (H 2 O 2 ) Material: Bäckerhefe, Braunstein (MnO 2 ), Wasserstoffperoxid, Rundkolben, Stativ, Brenner, Glimmspan Durchführung 1: 5ml Wasserstoffperoxid
ENZYMATIK 1. Vorversuch Versuch Spaltung von Wasserstoffperoxid (H 2 O 2 ) Material: Bäckerhefe, Braunstein (MnO 2 ), Wasserstoffperoxid, Rundkolben, Stativ, Brenner, Glimmspan Durchführung 1: 5ml Wasserstoffperoxid
Zusatzinformationen Kohlenhydrate Monosaccharide
 Zusatzinformationen Kohlenhydrate Monosaccharide Monosaccharide Sind die einfachsten Kohlenhydrate. Müssen nicht enzymatisch gespalten werden und können deshalb vom Verdauungstrakt direkt ins Blut aufgenommen
Zusatzinformationen Kohlenhydrate Monosaccharide Monosaccharide Sind die einfachsten Kohlenhydrate. Müssen nicht enzymatisch gespalten werden und können deshalb vom Verdauungstrakt direkt ins Blut aufgenommen
Brauanlage BBO 100-3-0 HA (3 Behälter-Brauanlage) zur Herstellung von 80 bis 100 L Würze je Braugang. Leistungsparameter:
 Brauanlage BBO 100-3-0 HA (3 Behälter-Brauanlage) zur Herstellung von 80 bis 100 L Würze je Braugang Leistungsparameter: In ca. 10 Stunden können bis 500 Liter Würze gebraut werden mit dem beschleunigten
Brauanlage BBO 100-3-0 HA (3 Behälter-Brauanlage) zur Herstellung von 80 bis 100 L Würze je Braugang Leistungsparameter: In ca. 10 Stunden können bis 500 Liter Würze gebraut werden mit dem beschleunigten
Proteinbestimmung. Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der Proteinbestimmung mit den folgenden Lehrzielen:
 Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Diese Lerneinheit befasst sich mit der Beschreibung von verschiedenen Methoden der mit den folgenden Lehrzielen: Verständnis der Prinzipien der sowie deren praktischer Durchführung Unterscheidung zwischen
Sicherheit bei der Qualitätskontrolle durch den Calibrierdienst Doemens
 Sicherheit bei der Qualitätskontrolle durch den Calibrierdienst Doemens Der Analysenverbund für Getreide und Malz des Calibrierdienst Doemens (CD) ist bekanntlich ein freiwilliger Zusammenschluss von über
Sicherheit bei der Qualitätskontrolle durch den Calibrierdienst Doemens Der Analysenverbund für Getreide und Malz des Calibrierdienst Doemens (CD) ist bekanntlich ein freiwilliger Zusammenschluss von über
Basiskenntnistest - Chemie
 Basiskenntnistest - Chemie 1.) Welche Aussage trifft auf Alkohole zu? a. ) Die funktionelle Gruppe der Alkohole ist die Hydroxygruppe. b. ) Alle Alkohole sind ungiftig. c. ) Mehrwertige Alkohole werden
Basiskenntnistest - Chemie 1.) Welche Aussage trifft auf Alkohole zu? a. ) Die funktionelle Gruppe der Alkohole ist die Hydroxygruppe. b. ) Alle Alkohole sind ungiftig. c. ) Mehrwertige Alkohole werden
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS Enzymregulation. Marinja Niggemann, Denise Schäfer
 Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Ungefähre Zusammensetzung des Blutes und des Blutplasmas. Die häufigsten Bestandteile des Blutplasmas (Mittelwerte)
 Puffer /Zusammensetzung des Blutes 1 Zusammensetzung des Blutes Das Blut der Wirbeltiere besteht zu 55% aus flüssigem Blutplasma und zu 45% aus darin schwimmenden festen Bestandteilen, den Blutkörperchen.
Puffer /Zusammensetzung des Blutes 1 Zusammensetzung des Blutes Das Blut der Wirbeltiere besteht zu 55% aus flüssigem Blutplasma und zu 45% aus darin schwimmenden festen Bestandteilen, den Blutkörperchen.
Vortrag Enzyme. Sebastian Kurfürst. sebastian(at)garbage-group.de.
 Enzyme Vortrag Enzyme Sebastian Kurfürst /bio.html sebastian(at)garbage-group.de 1 Gliederung 1.Einführung 2.Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen 3.Enzyme ein Biokatalysator 4.Aufbau 5.Substrat-,
Enzyme Vortrag Enzyme Sebastian Kurfürst /bio.html sebastian(at)garbage-group.de 1 Gliederung 1.Einführung 2.Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen 3.Enzyme ein Biokatalysator 4.Aufbau 5.Substrat-,
Peptide Proteine. 1. Aminosäuren. Alle optisch aktiven proteinogenen Aminosäuren gehören der L-Reihe an: 1.1 Struktur der Aminosäuren
 1. Aminosäuren Aminosäuren Peptide Proteine Vortragender: Dr. W. Helliger 1.1 Struktur 1.2 Säure-Basen-Eigenschaften 1.2.1 Neutral- und Zwitterion-Form 1.2.2 Molekülform in Abhängigkeit vom ph-wert 1.3
1. Aminosäuren Aminosäuren Peptide Proteine Vortragender: Dr. W. Helliger 1.1 Struktur 1.2 Säure-Basen-Eigenschaften 1.2.1 Neutral- und Zwitterion-Form 1.2.2 Molekülform in Abhängigkeit vom ph-wert 1.3
Einflussfaktoren der Proteinbildung beim Weizen
 Einflussfaktoren der Proteinbildung beim Weizen Kontakt Dr. Helge Stephan, Landwirtschaftskammer S-H Abteilung: Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Umwelt Tel. 04331/9453330, 05..2015 E-Mail: hstephan@lksh.de
Einflussfaktoren der Proteinbildung beim Weizen Kontakt Dr. Helge Stephan, Landwirtschaftskammer S-H Abteilung: Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Umwelt Tel. 04331/9453330, 05..2015 E-Mail: hstephan@lksh.de
Versuchsprotokoll:Stärkespaltung
 Versuchsprotokoll:Stärkespaltung Zeitaufwand: Aufbau: 5 Minuten Durchführung: 20 Minuten Abbau/Entsorgung:: 5 Minuten Chemikalien: Chemikalie Menge R-Sätze S-Sätze Gefahrensymbol Schuleinsatz Pentahydrat
Versuchsprotokoll:Stärkespaltung Zeitaufwand: Aufbau: 5 Minuten Durchführung: 20 Minuten Abbau/Entsorgung:: 5 Minuten Chemikalien: Chemikalie Menge R-Sätze S-Sätze Gefahrensymbol Schuleinsatz Pentahydrat
INAUGURAL - DISSERTATION. zur. Erlangung der Doktorwürde. der. Naturwissenschaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät. der
 INAUGURAL - DISSERTATION zur Erlangung der Doktorwürde der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät der Ruprecht - Karls - Universität Heidelberg vorgelegt von Apothekerin Friedburg Preßmar
INAUGURAL - DISSERTATION zur Erlangung der Doktorwürde der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät der Ruprecht - Karls - Universität Heidelberg vorgelegt von Apothekerin Friedburg Preßmar
Malzenzyme für die Diät- und Drybierherstellung
 Malzenzyme für die Diät- und Drybierherstellung Fachvortrag am 16.05.2014 Beuth Hochschule Symposium Enzymeinsatz in der Lebensmitteltechnologie Dr. Jürgen Schöber f t fermtecgmbh... Köpenicker Straße
Malzenzyme für die Diät- und Drybierherstellung Fachvortrag am 16.05.2014 Beuth Hochschule Symposium Enzymeinsatz in der Lebensmitteltechnologie Dr. Jürgen Schöber f t fermtecgmbh... Köpenicker Straße
endotherme Reaktionen
 Exotherme/endotherme endotherme Reaktionen Edukte - H Produkte Exotherme Reaktion Edukte Produkte + H Endotherme Reaktion 101 Das Massenwirkungsgesetz Das Massenwirkungsgesetz Gleichgewicht chemischer
Exotherme/endotherme endotherme Reaktionen Edukte - H Produkte Exotherme Reaktion Edukte Produkte + H Endotherme Reaktion 101 Das Massenwirkungsgesetz Das Massenwirkungsgesetz Gleichgewicht chemischer
Möglichkeiten der Qualitätsbeurteilung von Fleisch und Fleischerzeugnissen durch den Verbraucher BAFF KULMBACH 2002 CH-SCHW
 Möglichkeiten der Qualitätsbeurteilung von Fleisch und Fleischerzeugnissen durch den Verbraucher Qualität von Fleisch und Fleischerzeugnissen Qualität Güte wertschätzend "Qualitätsfleisch Beschaffenheit
Möglichkeiten der Qualitätsbeurteilung von Fleisch und Fleischerzeugnissen durch den Verbraucher Qualität von Fleisch und Fleischerzeugnissen Qualität Güte wertschätzend "Qualitätsfleisch Beschaffenheit
Materialien- Handbuch Kursunterricht Chemie
 Materialien- Handbuch Kursunterricht Chemie Band 5 Makromoleküle Biochemie Herausgeber: Dr. Heinz Wambach unter Mitwirkung von Dr. Uwe Hilgers Universitöts- und Landesbibüothek Darrr.stadt Bibliothek Biologie
Materialien- Handbuch Kursunterricht Chemie Band 5 Makromoleküle Biochemie Herausgeber: Dr. Heinz Wambach unter Mitwirkung von Dr. Uwe Hilgers Universitöts- und Landesbibüothek Darrr.stadt Bibliothek Biologie
Auswahlverfahren Medizin Prüfungsgebiet Chemie. 6.Termin Organische Chemie Naturstoffe
 Auswahlverfahren Medizin Prüfungsgebiet Chemie 6.Termin Organische Chemie Naturstoffe Kursleiter Mag. Wolfgang Mittergradnegger IFS Kurs 2009 Organische Chemie Naturstoffe Fette Kohlenhydrate Proteine
Auswahlverfahren Medizin Prüfungsgebiet Chemie 6.Termin Organische Chemie Naturstoffe Kursleiter Mag. Wolfgang Mittergradnegger IFS Kurs 2009 Organische Chemie Naturstoffe Fette Kohlenhydrate Proteine
Inhaltsverzeichnis. Vorwort Zur Gestaltung des Buches
 Hans Rudolf Christen Struktur Stoff Reaktion Allgemeine und anorganische Chemie Sekundarstufe I 5401 Diesterweg Salle Frankfurt am Main Berlin München Verlag Sauerländer Aarau Vorwort Zur Gestaltung des
Hans Rudolf Christen Struktur Stoff Reaktion Allgemeine und anorganische Chemie Sekundarstufe I 5401 Diesterweg Salle Frankfurt am Main Berlin München Verlag Sauerländer Aarau Vorwort Zur Gestaltung des
Ofen und Tannur. Martina Gastl - Jour Fix Ofen und Herd
 Ofen und Tannur 33 Martina Gastl - Jour Fix - 12.05.09-33 Ofen und Herd Ofen und Herd Kochen mit cooking pot und Feuerböcken Martina Gastl - Jour Fix - 12.05.09-34 Gerstenfunde in Tall Bazi gekeimte Gerste
Ofen und Tannur 33 Martina Gastl - Jour Fix - 12.05.09-33 Ofen und Herd Ofen und Herd Kochen mit cooking pot und Feuerböcken Martina Gastl - Jour Fix - 12.05.09-34 Gerstenfunde in Tall Bazi gekeimte Gerste
Säuren und Basen. Dr. Torsten Beweries AC I - Allgemeine Chemie LAC-CH01 WS 2016/17.
 Säuren und Basen Dr. Torsten Beweries AC I - Allgemeine Chemie LAC-CH01 WS 2016/17 torsten.beweries@catalysis.de http://www.catalysis.de/forschung/koordinationschemische-katalyse/koordinationschemische-wasserspaltung/
Säuren und Basen Dr. Torsten Beweries AC I - Allgemeine Chemie LAC-CH01 WS 2016/17 torsten.beweries@catalysis.de http://www.catalysis.de/forschung/koordinationschemische-katalyse/koordinationschemische-wasserspaltung/
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt 20.05.2016 Seite 1 von 5
 Seite 1 von 5 Schwerpunktbericht 11-2015 Bestimmung der Osmolalität bei als isotonisch ausgelobten Erfrischungsgetränken und alkoholfreiem Bier Fachbereich 3 Lebensmittelsicherheit Bei zahlreichen Erfrischungsgetränken
Seite 1 von 5 Schwerpunktbericht 11-2015 Bestimmung der Osmolalität bei als isotonisch ausgelobten Erfrischungsgetränken und alkoholfreiem Bier Fachbereich 3 Lebensmittelsicherheit Bei zahlreichen Erfrischungsgetränken
Technische Universität München. Lehrstuhl für Technische Mikrobiologie und Technologie der Brauerei II
 - OAÄ Technische Universität München Lehrstuhl für Technische Mikrobiologie und Technologie der Brauerei II Elektrophoretische und immunchemische Untersuchungen von Hopfenproteinen zur Sortendifferenzierung
- OAÄ Technische Universität München Lehrstuhl für Technische Mikrobiologie und Technologie der Brauerei II Elektrophoretische und immunchemische Untersuchungen von Hopfenproteinen zur Sortendifferenzierung
Referat : Aufbau v. Proteinen u. ihre Raumstruktur
 Referat : Aufbau v. Proteinen u. ihre Raumstruktur 1. Einleitung Unsere Körperzellen enthalten einige Tausend verschiedene Proteine wobei man schätzt, das insgesamt über 50 000 verschiedene Eiweißstoffe
Referat : Aufbau v. Proteinen u. ihre Raumstruktur 1. Einleitung Unsere Körperzellen enthalten einige Tausend verschiedene Proteine wobei man schätzt, das insgesamt über 50 000 verschiedene Eiweißstoffe
Übungsklausur zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach
 Übungsklausur zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach 1. (10P) Was ist richtig (mehrere Richtige sind möglich)? a) Fructose besitzt 5 Kohlenstoffatome. FALSCH, Fructose besitzt
Übungsklausur zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach 1. (10P) Was ist richtig (mehrere Richtige sind möglich)? a) Fructose besitzt 5 Kohlenstoffatome. FALSCH, Fructose besitzt
Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
 A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
Kohlenwasserstoffe. Alkane. Kohlenwasserstoffe sind brennbare und unpolare Verbindungen, die aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen aufgebaut sind.
 2 2 Kohlenwasserstoffe Kohlenwasserstoffe sind brennbare und unpolare Verbindungen, die aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen aufgebaut sind. 4 4 Alkane Alkane sind gesättigte Kohlenwasserstoffverbindungen
2 2 Kohlenwasserstoffe Kohlenwasserstoffe sind brennbare und unpolare Verbindungen, die aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen aufgebaut sind. 4 4 Alkane Alkane sind gesättigte Kohlenwasserstoffverbindungen
Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo
 Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de innere Energie U Energieumsatz bei
Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de innere Energie U Energieumsatz bei
Planung, Bau und Betrieb von Chemieanlagen - Übung Allgemeine Chemie. Allgemeine Chemie. Rückblick auf vorherige Übung
 Planung, Bau und Betrieb von Chemieanlagen - Übung Allgemeine Chemie 1 Allgemeine Chemie Rückblick auf vorherige Übung 2 Löslichkeit Was ist eine Lösung? - Eine Lösung ist ein einphasiges (homogenes) Gemisch
Planung, Bau und Betrieb von Chemieanlagen - Übung Allgemeine Chemie 1 Allgemeine Chemie Rückblick auf vorherige Übung 2 Löslichkeit Was ist eine Lösung? - Eine Lösung ist ein einphasiges (homogenes) Gemisch
Wie entsteht unser Bier?
 Wie entsteht unser Bier? Rohstoffe: Wasser: Wasser (Brauwasser) ist der Hauptbestandteil des Bieres (mehr als 90%). Meist ist dieses Wasser besser als das normale Trinkwasser. Brauwasser Malz: Das Malz
Wie entsteht unser Bier? Rohstoffe: Wasser: Wasser (Brauwasser) ist der Hauptbestandteil des Bieres (mehr als 90%). Meist ist dieses Wasser besser als das normale Trinkwasser. Brauwasser Malz: Das Malz
Übungsfragen zur Vorlesung Einführung in die Biologie, Zell- und Molekularbiologie Teil Biochemie PD Dr. Udo Rau. (Biomoleküle allgemein)
 Übungsfragen zur Vorlesung Einführung in die Biologie, Zell- und Molekularbiologie Teil Biochemie PD Dr. Udo Rau (Biomoleküle allgemein) 1) Aus welchen Elementen besteht die Zelle zu 99%? 2) Warum ist
Übungsfragen zur Vorlesung Einführung in die Biologie, Zell- und Molekularbiologie Teil Biochemie PD Dr. Udo Rau (Biomoleküle allgemein) 1) Aus welchen Elementen besteht die Zelle zu 99%? 2) Warum ist
Klausur : Allgemeine und Anorganische Chemie. Name...Fachrichtung... Matr.-Nr...
 Klausur : Allgemeine und Anorganische Chemie Mo. 1.03.11 : 13.30 16.30 Uhr 1 Beantworten Sie maximal zehn Fragen. Für jede Frage gibt es maximal 10 Punkte; die Klausur gilt als bestanden, wenn 50 Punkte
Klausur : Allgemeine und Anorganische Chemie Mo. 1.03.11 : 13.30 16.30 Uhr 1 Beantworten Sie maximal zehn Fragen. Für jede Frage gibt es maximal 10 Punkte; die Klausur gilt als bestanden, wenn 50 Punkte
Thermodynamik & Kinetik
 Thermodynamik & Kinetik Inhaltsverzeichnis Ihr versteht die Begriffe offenes System, geschlossenes System, isoliertes System, Enthalpie, exotherm und endotherm... 3 Ihr kennt die Funktionsweise eines Kalorimeters
Thermodynamik & Kinetik Inhaltsverzeichnis Ihr versteht die Begriffe offenes System, geschlossenes System, isoliertes System, Enthalpie, exotherm und endotherm... 3 Ihr kennt die Funktionsweise eines Kalorimeters
Kettenreaktionen. Kapitel 2. In diesem Kapitel sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:
 Kapitel 2 Kettenreaktionen In diesem Kapitel sollen die folgenden Fragen beantwortet werden: Was versteht man unter einer Kettenreaktion? Welches sind die verschiedenen Typen von Reaktionsschritten, die
Kapitel 2 Kettenreaktionen In diesem Kapitel sollen die folgenden Fragen beantwortet werden: Was versteht man unter einer Kettenreaktion? Welches sind die verschiedenen Typen von Reaktionsschritten, die
Der Einfluss verschiedener Hopfenfraktionen auf die Inhibierung der Rotfärbung von Gerstenmalzmaischen
 Technische Universität München Center of Life and Food Sciences Weihenstephan Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität Prof. Dr.-Ing. Fritz Jacob Der Einfluss verschiedener Hopfenfraktionen
Technische Universität München Center of Life and Food Sciences Weihenstephan Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität Prof. Dr.-Ing. Fritz Jacob Der Einfluss verschiedener Hopfenfraktionen
C Säure-Base-Reaktionen
 -V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
-V.C1- C Säure-Base-Reaktionen 1 Autoprotolyse des Wassers und ph-wert 1.1 Stoffmengenkonzentration Die Stoffmengenkonzentration eines gelösten Stoffes ist der Quotient aus der Stoffmenge und dem Volumen
Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen. Prof. Dr. Thomas Kirner
 Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen Prof. Dr. Thomas Kirner 21.07.2015 Voraussetzungen Fermentation von Biomasse Mikroorganismen interagieren in einem komplexen
Analytische Methoden und Verfahren zur Überwachung und Optimierung von Biogasanlagen Prof. Dr. Thomas Kirner 21.07.2015 Voraussetzungen Fermentation von Biomasse Mikroorganismen interagieren in einem komplexen
a) Vervollständigen Sie das Freie-Enthalpie-Diagramm der Reaktion, indem Sie den zutreffenden Buchstaben A D in die leeren Kreise setzen:
 1. Aufgabe Für die Reaktion R-X + u R-u + X findet man folgendes Reaktionsdiagramm: a) Vervollständigen Sie das Freie-Enthalpie-Diagramm der Reaktion, indem Sie den zutreffenden Buchstaben A D in die leeren
1. Aufgabe Für die Reaktion R-X + u R-u + X findet man folgendes Reaktionsdiagramm: a) Vervollständigen Sie das Freie-Enthalpie-Diagramm der Reaktion, indem Sie den zutreffenden Buchstaben A D in die leeren
Mechanismus der Enzymkatalyse
 Mechanismus der Enzymkatalyse Allgemeine Prinzipien Annäherung des Substrats an das aktive Zentrum des Enzyms Enzym und Substrat treten in Wechselwirkung: Bildung des [ES]-Komplexes. Konformationsänderung
Mechanismus der Enzymkatalyse Allgemeine Prinzipien Annäherung des Substrats an das aktive Zentrum des Enzyms Enzym und Substrat treten in Wechselwirkung: Bildung des [ES]-Komplexes. Konformationsänderung
DIFFUSION / OSMOSE INHALTSSTOFFE DER ZELLE VERSUCHSÜBERSICHT
 1 BIOLOGIE KURZPRAKTIKA DIFFUSION / OSMOSE INHALTSSTOFFE DER ZELLE VERSUCHSÜBERSICHT Versuch Aufgaben Zeitaufwand Erledigt Nr. 1 Diffusion von Kaliumpermanganat Ablesen der Messwerte zu Beginn und am Ende
1 BIOLOGIE KURZPRAKTIKA DIFFUSION / OSMOSE INHALTSSTOFFE DER ZELLE VERSUCHSÜBERSICHT Versuch Aufgaben Zeitaufwand Erledigt Nr. 1 Diffusion von Kaliumpermanganat Ablesen der Messwerte zu Beginn und am Ende
Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie)
 Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie) Teilnehmer/in:... Matrikel-Nr.:... - 1. Sie sollen aus NaCl und Wasser 500 ml einer Lösung herstellen, die
Abschlussklausur Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 2 (Geologie, Geophysik und Mineralogie) Teilnehmer/in:... Matrikel-Nr.:... - 1. Sie sollen aus NaCl und Wasser 500 ml einer Lösung herstellen, die
Anorganische-Chemie. Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E
 Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E 3.039 stefan.wuttke@cup.uni-muenchen.de www.wuttkegroup.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2014/2015 Inhaltliche Schwerpunkte Stöchiometrie
Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E 3.039 stefan.wuttke@cup.uni-muenchen.de www.wuttkegroup.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2014/2015 Inhaltliche Schwerpunkte Stöchiometrie
Zellstrukturen und Ihre Funktionen Lysosomen
 Zellstrukturen und Ihre Funktionen Lysosomen Enzym Abbau von Carboxypeptidase Proteine Endopeptidase Kathepsin saure DNase saure RNase Phospholipase saure Lipase -Glukuronidase -Galactosidase -Glukosidase
Zellstrukturen und Ihre Funktionen Lysosomen Enzym Abbau von Carboxypeptidase Proteine Endopeptidase Kathepsin saure DNase saure RNase Phospholipase saure Lipase -Glukuronidase -Galactosidase -Glukosidase
GRUNDWISSEN CHEMIE 10. KLASSE
 Grundwissen der 10. Klasse hemie GRUNDWISSEN EMIE 10. KLASSE (LS Marquartstein Sept. 2013) 2009 Zannantonio/Wagner LS Marquartstein 1 Grundwissen der 10. Klasse hemie Alkane= gesättigte KW: In ihren Molekülen
Grundwissen der 10. Klasse hemie GRUNDWISSEN EMIE 10. KLASSE (LS Marquartstein Sept. 2013) 2009 Zannantonio/Wagner LS Marquartstein 1 Grundwissen der 10. Klasse hemie Alkane= gesättigte KW: In ihren Molekülen
Beschreiben Sie den Aufbau und die Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe. Beschreiben Sie die Alkane allgemein.
 den Aufbau und die Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe. nur Kohlenstoff- und Wasserstoffatome mit einander verbunden Kohlenstoffatom ist vierbindig Wasserstoffatom ist einbindig Skelett aller KW wird
den Aufbau und die Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe. nur Kohlenstoff- und Wasserstoffatome mit einander verbunden Kohlenstoffatom ist vierbindig Wasserstoffatom ist einbindig Skelett aller KW wird
Flüchtige organische Säuren. Skript Kapitel 5.5.2, Seite 108
 Flüchtige organische Säuren Skript Kapitel 5.5.2, Seite 108 201409_V1_#1 Schlammfaulung allgemein Die Schlammfaulung dient der Stabilisierung von Klärschlämmen Dazu wird eine anaerobe (sauerstofffreie)
Flüchtige organische Säuren Skript Kapitel 5.5.2, Seite 108 201409_V1_#1 Schlammfaulung allgemein Die Schlammfaulung dient der Stabilisierung von Klärschlämmen Dazu wird eine anaerobe (sauerstofffreie)
Schwerpunktfach Biologie / Chemie Teil: Fächerübergreifender Teil Chemie
 Gruppe / Kandidat/in Nr...., Basel / Zürich Name / Vorname:... Schwerpunktfach Biologie / hemie Teil: Fächerübergreifender Teil hemie Verfasser: Richtzeit: Hilfsmittel: Hinweise: Punktemaximum: R. Guenin,
Gruppe / Kandidat/in Nr...., Basel / Zürich Name / Vorname:... Schwerpunktfach Biologie / hemie Teil: Fächerübergreifender Teil hemie Verfasser: Richtzeit: Hilfsmittel: Hinweise: Punktemaximum: R. Guenin,
Lösung 7. Allgemeine Chemie I Herbstsemester Je nach Stärke einer Säure tritt eine vollständige oder nur eine teilweise Dissoziation auf.
 Lösung 7 Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012 1. Aufgabe Je nach Stärke einer Säure tritt eine vollständige oder nur eine teilweise Dissoziation auf. Chlorwasserstoff ist eine starke Säure (pk a = 7),
Lösung 7 Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012 1. Aufgabe Je nach Stärke einer Säure tritt eine vollständige oder nur eine teilweise Dissoziation auf. Chlorwasserstoff ist eine starke Säure (pk a = 7),
Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Enzyme im Alltag Welche Rolle spielen Enzyme in unserem Leben/beim Ablauf verschiedener Stoffwechselreaktionen?
 Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Enzyme im Alltag Welche Rolle spielen Enzyme in unserem Leben/beim Ablauf verschiedener Stoffwechselreaktionen? Inhaltsfelder: IF 1 (Biologie der Zelle), IF 2 (Energiestoffwechsel)
Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Enzyme im Alltag Welche Rolle spielen Enzyme in unserem Leben/beim Ablauf verschiedener Stoffwechselreaktionen? Inhaltsfelder: IF 1 (Biologie der Zelle), IF 2 (Energiestoffwechsel)
Schutz Sekretion Resorption. Gerhard Löffler
 Schutz Sekretion Resorption Gerhard Löffler Mundhöhle Rachen Speiseröhre Magen Dünndarm Dickdarm mit Enddarm Bauchspeicheldrüse Gerhard Löffler Leber Wasser Elektrolyte Schleim Salzsäure
Schutz Sekretion Resorption Gerhard Löffler Mundhöhle Rachen Speiseröhre Magen Dünndarm Dickdarm mit Enddarm Bauchspeicheldrüse Gerhard Löffler Leber Wasser Elektrolyte Schleim Salzsäure
BIERBRAUEN 1. Jede Schülergruppe besorgt
 1 Rezeptur variiert nach Monika Kallfelz Bierbrauen im Kochtopfmaßstab Jede Schülergruppe besorgt 1 Kochtopf ca. 10 Liter 1 weiteres großes Gefäß, z.b. sehr sauberen Putzeimer 1 leistungsstarke Kochplatte
1 Rezeptur variiert nach Monika Kallfelz Bierbrauen im Kochtopfmaßstab Jede Schülergruppe besorgt 1 Kochtopf ca. 10 Liter 1 weiteres großes Gefäß, z.b. sehr sauberen Putzeimer 1 leistungsstarke Kochplatte
EnzymeLab.
 Das Enzyme Lab ist ein virtuelles Labor in dem enzymatische Reaktionen getestet werden können. Dem Benutzer sollen hier in einfacher Form Prinzipien der Enzymkinetik und die experimentelle Laborarbeit
Das Enzyme Lab ist ein virtuelles Labor in dem enzymatische Reaktionen getestet werden können. Dem Benutzer sollen hier in einfacher Form Prinzipien der Enzymkinetik und die experimentelle Laborarbeit
Enzyme (Teil 2) Enzymatische Reaktion, Thermodynamik & Enzyme im Detail. Mag. Gerald Trutschl
 Enzyme (Teil 2) Enzymatische Reaktion, Thermodynamik & Enzyme im Detail Mag. Gerald Trutschl 1 Inhalt 1. Enzym Reaktion im Detail 2. Thermodynamische Reaktion 3. Katalysemechanismen 4. Michaelis-Menten-Konstante
Enzyme (Teil 2) Enzymatische Reaktion, Thermodynamik & Enzyme im Detail Mag. Gerald Trutschl 1 Inhalt 1. Enzym Reaktion im Detail 2. Thermodynamische Reaktion 3. Katalysemechanismen 4. Michaelis-Menten-Konstante
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau
 Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Ethanolbildung in Bananen
 Ethanolbildung in Bananen Peter Bützer Inhalt 1 Einführung... 1 2 Modell... 2 2.1 Annahmen:... 2 2.2 Simulation(Typ 1)... 2 2.3 Dokumentation (Gleichungen, Parameter)... 3 2.4 Vergleich der Simulation
Ethanolbildung in Bananen Peter Bützer Inhalt 1 Einführung... 1 2 Modell... 2 2.1 Annahmen:... 2 2.2 Simulation(Typ 1)... 2 2.3 Dokumentation (Gleichungen, Parameter)... 3 2.4 Vergleich der Simulation
Gerinnung von Proteinen
 V11 Gerinnung von Proteinen Fach Klasse Überthema Feinthema Zeit Chemie Q2 Aminosäuren, Peptide, Polypeptide Proteine 20 Minuten Zusammenfassung: Die Gerinnung von Eiklar wird durch Zugabe von gesättigter
V11 Gerinnung von Proteinen Fach Klasse Überthema Feinthema Zeit Chemie Q2 Aminosäuren, Peptide, Polypeptide Proteine 20 Minuten Zusammenfassung: Die Gerinnung von Eiklar wird durch Zugabe von gesättigter
Auf dem Weg zum guten Karlsberg Bier.
 Auf dem Weg zum guten Karlsberg Bier. Rohstoffe Der Hopfen das grüne Gold Edler Hopfen verleiht den Karlsberg Bieren ihr typisches Aroma, ihren charakteristischen, frischen Geschmack sowie die Festigkeit
Auf dem Weg zum guten Karlsberg Bier. Rohstoffe Der Hopfen das grüne Gold Edler Hopfen verleiht den Karlsberg Bieren ihr typisches Aroma, ihren charakteristischen, frischen Geschmack sowie die Festigkeit
BIOCHEMIE. Teil 2: Aminosäuren, Proteine, Enzyme. Urheberrechtlich geschütztes Material. Lernkarteikarten Veterinärmedizin - BIOCHEMIE
 Lernkarteikarten Veterinärmedizin - BIOCHEMIE BIOCHEMIE 2014 Teil 2: Aminosäuren, Proteine, Enzyme Vetbrainfood - Tiermedizinische Lernkarteikarten - Diplombiologin und Tierärztin G. Glück Liebe/r Biochemie-Interessierte,
Lernkarteikarten Veterinärmedizin - BIOCHEMIE BIOCHEMIE 2014 Teil 2: Aminosäuren, Proteine, Enzyme Vetbrainfood - Tiermedizinische Lernkarteikarten - Diplombiologin und Tierärztin G. Glück Liebe/r Biochemie-Interessierte,
Organische Chemie 1 Teil 2 1. Vorlesung, Dienstag
 Inhalte der 1. Vorlesung: 1. Die Reaktivität organischer Moleküle 1.1 Warum geschehen Chemische Reaktionen 1.2 Gleichgewichtsreaktionen, Ungleichgewichtsreaktionen 1.2.1 Triebkraft chemischer Reaktionen
Inhalte der 1. Vorlesung: 1. Die Reaktivität organischer Moleküle 1.1 Warum geschehen Chemische Reaktionen 1.2 Gleichgewichtsreaktionen, Ungleichgewichtsreaktionen 1.2.1 Triebkraft chemischer Reaktionen
Sekundärwand Zellumen
 Kohlenhydrate Kohlenhydrate in Pressschnitzeln Pressschnitzel bestehen überwiegend aus den Zellwand- oder Gerüstkohlenhydraten Pektin, Hemicellulose und Cellulose, wobei die anteilig jeweils etwas ein
Kohlenhydrate Kohlenhydrate in Pressschnitzeln Pressschnitzel bestehen überwiegend aus den Zellwand- oder Gerüstkohlenhydraten Pektin, Hemicellulose und Cellulose, wobei die anteilig jeweils etwas ein
Universität Regensburg
 Universität Regensburg Fakultät für Chemie und Pharmazie 93040 Regensburg 14. März 2006 Institut für Anorganische Chemie Prof. Dr. R. Winter 1. Was besagt das Moseleysche Gesetz? Welche Größe kann man
Universität Regensburg Fakultät für Chemie und Pharmazie 93040 Regensburg 14. März 2006 Institut für Anorganische Chemie Prof. Dr. R. Winter 1. Was besagt das Moseleysche Gesetz? Welche Größe kann man
Seminar: Löse- und Fällungsgleichgewichte
 1 Seminar: Löse- und Fällungsgleichgewichte Ziel des Seminars: Lösungs- und Fällungsgleichgewichte sollen verstanden werden. Weiters soll durch praxisrelevante Beispiele die medizinische und klinische
1 Seminar: Löse- und Fällungsgleichgewichte Ziel des Seminars: Lösungs- und Fällungsgleichgewichte sollen verstanden werden. Weiters soll durch praxisrelevante Beispiele die medizinische und klinische
