LEHRGANG ZUR AUSBILDING VON DIPLOMSKILEHRERINNEN UND - SKILEHRERN UND DIPLOMSKIFÜHRERINNEN UND -SKIFÜHRERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL
|
|
|
- Liane Geier
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 von 12 LEHRGANG ZUR AUSBILDING VON DIPLOMSKILEHRERINNEN UND - SKILEHRERN UND DIPLOMSKIFÜHRERINNEN UND -SKIFÜHRERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Anlage A.8 Der Lehrgang zur Ausbildung von Skilehrerinnen und Skilehrern sowie Skiführerinnen und Skiführern hat unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes über Schulen zur Ausbildung von Bewegungserziehern und Sportlehrern (Bundessportakademiengesetz) zur Aufgabe, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehend mit den erzieherischen und fachlichen Aufgaben einer Skilehrerin und eines Skilehrers vertraut zu machen. Die Ausgebildeten müssen in der Lage sein, nach dem österreichischen Skilehrweg zu unterrichten. Skilehrerinnen und Skilehrer sowie Skiführerinnen und Skiführer im Sinne dieser Verordnung sind nach den folgenden Bestimmungen ausgebildete und qualifizierte Fachlehrer für den erwerbsgemäßen Skiunterricht, die befähigt sind, einen dem österreichischen Skilehrweg entsprechenden Unterricht in allen Altersstufen zu erteilen. II. STUNDENTAFEL (Es wird das Gesamtausmaß der Unterrichtseinheiten je Unterrichtsgegenstand, auch im Falle der Einbeziehung von Formen des Fernunterrichtes, angegeben.) A. Pflichtmodule Modul I Skilauf PÜ PMÜ Theorie Theorie: 1. Religion (Ethik) 4 2. Deutsch 8 12 (Kommunikation/Medienarbeit) 3. Englisch Organisation des Sports 2 5. Betriebskunde und Recht 5 6. Geschichte des Sports 4 7. Gerätekunde und Ausrüstung 4 8. Naturkunde und Ökologie 3 9. Sportbiologie Sportpädagogik und Sportmethodik Bewegungslehre und Biomechanik Trainingslehre Seminar für Fachfragen 20 Praxis: 14. Fitnesstraining für Schneesportarten Skilauf und alternative Schneesportarten Aktuelle Fachgebiete Zwischensumme Summe Modul B. Freigegenstände 17. Skirennlauf C. Pflichtpraktikum Außerhalb des Unterrichtes: Anleitung von Skigruppen im Ausmaß von 6 Monaten. Die Bestätigung über die erbrachte Praxiszeit ist bis zum Beginn der kommissionellen Abschlussprüfung vorzulegen. Modul II Freeriden und Alpinkurs PÜ PMÜ Theorie Theorie: 1. Orientierung 4 2. Risikomanagement und Unfallkunde 2 3. Wetterkunde 2 4. Tourenplanung/Tourenführung 3
2 2 von 12 Modul II Freeriden und Alpinkurs PÜ PMÜ Theorie 5. Schnee- und Lawinenkunde 4 6. Seminar für Fachfragen 3 Praxis: 7. Variantenskilauf (Freeriden) Rettungsübungen 5 2 Zwischensumme Summe Modul 2 63 Modul III Skiführerausbildung PÜ PMÜ Theorie Theorie: 1. Wetterkunde 2 2. Risikomanagement und Unfallkunde 4 3. Materialkunde 4 4. Schnee- und Lawinenkunde 4 5. Orientierung 4 6. Seminar für Fachfragen 3 Praxis: 7. Skitouren Rettungsübungen 8 6 Zwischensumme Summe Modul III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE Die Entwicklung der angehenden Diplomskilehrer reicht von den allgemeinen Grundlagen des Skifahrens, weiter bis zur praktisch-methodischen Vertiefung des es (Meisterstufe, Fortbildung), der Festigung des Eigenkönnens und der Perfektionierung der Skitechnik. Um spezielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Freeriden und dem damit verbundenen Verhalten im alpinen Bereich, jenseits gesicherter Skipisten vorzubereiten und zu erreichen, sind die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer mit speziellen Methoden und modernen Erkenntnissen und Fertigkeiten vertraut zu machen. Die unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Formen bzw. Disziplinen des Skilehrwesens machen es notwendig, für einzelne Gegenstände des Lehrplans ein variables Stundenausmaß anzuführen. Das Mindeststundenausmaß muss jedoch eingehalten werden, damit das geforderte Lehrziel erreicht werden kann. Im Bereich der n werden die entsprechenden Lernergebnisse des Gegenstandes beschrieben. Lernergebnisse sind durch eine Inhaltsdimension und eine Handlungsdimension gekennzeichnet. Die Handlungsdimension, d.h. die Ebene auf welcher Lernstufe die Teilnehmerin/der Teilnehmer den Inhalt eines Lernergebnisses erwerben soll, sind durch die Buchstaben (A), (B) und (C) gekennzeichnet. Dabei kennzeichnet (A) die Lernstufe Wiedergeben : Informationen wiedergeben können, Bescheid wissen über, effektive Verhaltensstrategien kennen, (B) die Lernstufe Anwenden : Fakten interpretieren, vergleichen und gegeneinander abwägen können, Muster erkennen können, Probleme unter Anwendung von Skills und Wissen lösen können, angeeignetes Wissen in die Anleitung von Sportgruppen umsetzen können, (C) die Lernstufe Analysieren/Evaluieren : Urteile auf Basis von Kriterien und Standards fällen können, bekannte Elemente zu einem neuen Muster oder einer neuen Struktur zusammenfügen können, Ursachen für nicht zielführendes Verhalten erkennen können, aus Erfahrungen neue Optionen generieren können, In den einzelnen Unterrichtsstunden ist die pädagogische Zielsetzung zu berücksichtigen. In allen Gegenständen, besonders in den theoretischen, ist auf die spätere Berufsausübung der Skilehrer Bedacht zu nehmen. Der ist zum besseren Verständnis und zur leichteren Anwendung in der Praxis unter Einsatz von Anschauungsmaterial wie Videos, Demonstrationen usw. zu vermitteln. Fächerübergreifender Unterricht ist anzustreben und auf die Querverbindungen in den einzelnen Gegenständen ist hinzuweisen.
3 3 von 12 In allen praxisbezogenen Gegenständen sind methodische Hinweise zu geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zur Selbstständigkeit anzuregen. IV. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUNTERRICHT (Bekanntgabe gemäß 2 Abs. 2 des Religionsunterrichtsgesetzes) a) Katholischer Religionsunterricht Der Lehrplan für den Religionsunterricht im Lehrplan zur Ausbildung von Sportlehrern (Anlage A.1) ist sinngemäß anzuwenden, wobei die Religionslehrerin und der Religionslehrer nach pädagogischen und methodischen Gesichtspunkten auszuwählen ist. b) Evangelischer Religionsunterricht : Siehe Anlage A. 1, Abschnitt IV. : Siehe Anlage A. 1 Abschnitt IV. Der ist entsprechend der Ausbildungsdauer zu kürzen und zu raffen. V. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES Modul I: Skilauf 1. Religion und Ethik Siehe Anlage A.1, Abschnitt IV. 2. Deutsch und Kommunikation : Referate über verschiedene skitechnische und alpine Fachthemen unter Verwendung der Grundlagen von Kommunikation und Präsentation zielgruppenadäquat präsentieren. (B) : Einführung in die Fachterminologie, Moderations- und Präsentationstechniken, kritische Auseinandersetzung mit Fachliteratur, Feedback als wesentliches Element der Kommunikation, Referate, 3. Englisch : einfache Anweisungen geben, um den Skiunterricht in der Fremdsprache halten zu können (B); Lehrauftritte zu vorgegebenen Themen in englischer Sprache abhalten (B); sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern (B); einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Argumente angeben (B). : Lehrauftritt in englischer Sprache; Vorstellen der Wintersportgeräte; Begrifflichkeiten vom Skianfänger bis zur Meisterstufe; Präsentation zu einem skispezifischen Thema; Sportberichte (Hören und Lesen); Festigung der grammatikalischen Grundregeln; Schulung der Aussprache und des sprachlichen Ausdrucks; einfachste Konversation im Hinblick auf die spätere Unterrichtserteilung; Alltagssprache mit Bezug zum Sport.
4 4 von 12 : 4. Organisation des Sports : die wesentlichen Eckpfeiler der Organisation des Sports insbesondere des Ski Sports in Österreich sowie auf internationaler Ebene benennen (A); : Staatliche und föderative Verankerung des Sports; Förderstrukturen in Österreich; Ausbildungsstrukturen in Österreich; Stellung und Bedeutung der Bundessportakademien in der Ausbildungslandschaft für den Sport; Organisation der alpinen Vereine in Österreich: Zielsetzungen, Aufgaben, Ehrenamtlichkeit; Internationale Institutionen: ISIA etc. Ausbildungswege/Modelle (Vereinssport Berufsausbildung). 5. Betriebskunde und Recht : : in Grundzügen die rechtliche Situation ihres Aufgaben- und Tätigkeitsbereiches abschätzen (B); wichtige Fachtermini der gesetzlichen Grundlagen des Skisports erläutern (A); das Verhalten als Skilehrer nach einem Unfall aus rechtlicher Sicht widergeben (A). : Gesetzliche Grundlagen des Skisports bzw. des Freizeitrechts in Österreich; Pflichten und Rechte von Skilehrerinnen und Skilehrern; Klärung der Begriffe: Sorgfaltsmaßstab, Fahrlässigkeit, Maßfigur, Schadensfälle und Haftungsfragen im Straf- und Zivilrecht; Verwaltungsrecht; Versicherungsfragen; Möglichkeiten der Krisenintervention (Notfallhotline); Abgrenzung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Skischulrecht, Rechtsformen der alpinen Vereine; Gemeinnützigkeit, rechtliche Konsequenzen nach einem Unfall. 6. Geschichte des Sports : die historischen Grundlagen des Skisports mit besonderen Hinweisen auf spezielle Entwicklungen in Österreich wiedergeben (B). : Überblick über die Entwicklung des Skisports; Darlegung der einzelnen Schwerpunkte und Perioden sowie Aufzeigen der hiefür verantwortlichen Hintergründe. 7. Gerätekunde und Ausrüstung : : den Stand der modernen Materialentwicklung erläutern (A); die Pflege und Instandhaltung adäquater Übungsmaterialien und Übungsinfrastruktur für alle Bereiche des Unterrichts erläutern (A); Ski- und sonstige Ausrüstung für den Skisport pflegen (B). : Grundsätze für die Anlage und Präparierung von Übungsparcours und Skipisten; Pflege und Wartung der Skiausrüstung zur Erhaltung ihrer Funktionstüchtigkeit. 8. Natur und Ökologie Zusammenhänge in der Winterökologie diskutieren (B); Waldschutzzonen erkennen und damit verbundene Abfahrten vor einem ökologischen Hintergrund angepasst durchführen (B).
5 5 von 12 Der Lebensraum von Tieren und Pflanzen im winterlichen Gebirge; Lebensraum und Überlebensstrategien von Tieren und Pflanzen im Winter; Stellenwert und Problematiken von Ruheund/oder Schutzgebieten, Betretungsrechte und Nutzungskonflikte. 9. Sportbiologie die Grundlagen der Energiebereitstellung mit Belastungen im Skisport in Beziehung setzen und diese erklären (A); Hauptbewegungen beim Skilauf und die dabei angesprochenen Muskelgruppen widergeben (A); sportbiologische Hintergründe für Kräftigungsübungen zur Vorbereitung und Verletzungsprophylaxe im Skilauf erklären (B); sportbiologische Hintergründe für Koordinationsübungen zur Vorbereitung und Verletzungsprophylaxe im Skilauf vorzeigen (B). Energiebereitstellung; Belastungskomponenten des Skisports; Grundlagen des Herz Kreislaufsystems; Gelenk- und Muskelapparat; physiologische Grundlagen der Kräftigung von Muskeln; physiologisch richtige Bewegungsausführungen; physiologische Auswirkungen unterschiedlicher Krafttrainingsübungen (intramuskulär/intermuskulär); physiologische Wirkungen von Training auf labilen Untergründen. 10. Pädagogik, Didaktik und Methodik : : im Grundlagen- und Freizeitbereich Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren ein Basiswissen des österreichischen Skilehrwegs und der entsprechenden Lehrmethoden vermitteln (B); Einzel-,Gruppen- und Großgruppenunterricht selbständig leiten und führen (B); im Leistungsbereich Kindern, Jugendliche, Erwachsenen und Senioren ein vertiefendes Spezialwissen der österreichischen Skilehrmethode vermitteln (B); Übungseinheiten sowohl für den Breitensportbereich als auch für den kommerziellen Bereich selbständig führen und leiten (B). Skiausbildungen planen und organisieren (B). Grundsätze und Methoden des österreichischen Skilehrwegs; Vermittlung der Basis des österreichischen Skilehrwegs; Einführung in breiten- und freizeitsportliche Maßnahmen; Planen und Durchführung von Einzel- und Großgruppenunterricht im Anfänger-, Fortgeschrittenen- und Meisterbereich (in allen Stufen); methodische Hilfsmittel; Grundlage der allgemeinen Methodik; hilfreiche Persönlichkeitseigenschaften der Skilehrerin und des Skilehrers; Gruppenführung, Gruppendynamik und Konfliktbewältigung; Vertiefung der Unterrichtsanalyse (Lehrmethoden, Unterrichtsplanung, Planung und Verwendung methodischer Hilfen); Vorbereitung und Planung des Unterrichts; Unterrichtszielkontrolle; Intensivierung des Unterrichts; Unterrichtliche Maßnahmen zur Förderung des Sicherheitsdenkers; methodische Hilfsmittel zur Informationsübermittlung und zur Erleichterung des motorischen Lernvorganges; methodische Maßnahmen in den einzelnen Lernstufen. 11. Bewegungslehre und Biomechanik Grundbegriffe der Ski-Fachterminologie erklären (A); Grundbegriffe der Technik im eigenen Bewegungsverhalten umsetzen (B); das Bewegungsverhalten anderer mit den korrekten technischen Grundbegriffen beschreiben (B); Bewegungen fachterminologisch richtig beschreiben (B);
6 6 von 12 Bewegungen bei Skifahrerinnen und Skifahrern erkennen und mit Theoriemodellen der Bewegungslehre in Verbindung setzen (C); grundsätzliche Überlegungen zur Bewegungskorrektur anwenden (B). Allgemeine Gesetze und Prinzipien der Sportmotorik; sportmotorische Eigenschaften sowie Beurteilung aus der Sicht der Bewegungslehre; Bewegungseigenschaften und ihre Verbesserung; Spezielle Fragen und Probleme der Biomechanik; Testverfahren und Probleme der Technikschulung; Grundbegriffe (z. B. Kurvenverhalten, einwärts driften, auswärts driften) und grundlegende Bewegungen (hoch tief, vor zurück, seitlich, Rotationsbewegungen); Physikalische Grundlagen der Kurvenfahrt (Zentripetal/Zentrifugalkraft), Kurvenverhalten in unterschiedlichen Könnens-Stufen (Lernen Anwenden Perfektionieren). Grundlegende Erkenntnisse der Bewegungslehre des alpinen Skilaufs; Unterschiedliche Herangehensweisen an Bewegungskorrektur (Bewegungsanweisung, differentieller Ansatz, Bewegungsaufgabe, Wahrnehmungsaufgabe, ); Unterschiede zwischen Ist- und Sollbildern, Anwendung unterschiedlicher Korrekturkonzepte. 12. Trainingslehre erklären, wie durch systematisches und regelmäßiges Bewegen bzw. sportliches Training funktionelle und strukturelle Anpassungen im Organismus ausgelöst werden (A); das Training von leistungsbestimmenden Merkmalen für den Skilauf methodisch unterstützen (B); die körperliche Vorbereitung als Maßnahme der Risikoreduktion methodisch anleiten und organisieren (B). Leistungsbestimmende Merkmale und Möglichkeiten zur Verbesserung der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten; Belastungsgrundsätze; Belastungsmethoden; Leistungskontrollen; Grundlagen der Trainingsplanung; motorische Entwicklung. 13. Seminar für Fachfragen spartenspezifischen Themen als Vorbereitung auf die Berufsausbildung analysieren und bewerten (B); aktuelle Entwicklungen im Tourismus beschreiben (A); spezielle Umweltproblemen im Bereich des Wintersports erklären (A); die Skischul-Betriebsordnung erläutern (A); Fragen zu sportartspezifischen Themen formulieren (B); Elemente aus unterschiedlichen Lehrplänen anwendungsorientiert zusammen- bzw. weiterzuführen (C). Referate und Diskussionen über aktuelle Sachfragen (zb Tourismus, Skilehrwesen, Hotellerie, Seilbahnwirtschaft, Wintersportindustrie, Skilauf und Umwelt); Topographie der Skigebiete. Spezielle Berufsfragen (Weiterbildung, Berufsmöglichkeiten, Leistungserhebungen, Massenmedien, Skilauf und Umwelt usw.); Grundsätze für den Umgang mit Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen sowie mit Gleichgestellten und Vorgesetzten; Internationale Entwicklungen und Einflüsse auf Österreich im Bereich des Tourismus und des Skilaufs. 14. Fitnesstraining für Schneesportarten ein Standardprogramm zur Kräftigung, skispezifischer Kondition, Kraftausdauer, Ausdauer und Koordination durchführen (B);
7 7 von 12 unterschiedliche Aufwärmprogramme durchführen, die an die Anforderungen der Skisportlerinnen und Skisportler abgestimmt sind (B); ein Dehnprogramm für die Hauptmuskelgruppe für unterschiedliche Ziele (Aufwärmen, Regeneration, ) durchführen (B). Training als Prozess; grundlegende Trainingsprinzipien; konditionellen Eigenschaften (Kraftfähigkeit und Ausdauerfähigkeit); Trainingsmaßnahmen zur aktiven Regeneration. 15. Skilauf und alternative Schneesportarten (Unterrichtspraxis und Eigenkönnen) Übungen zum technischen Leitkonzept des Skilaufs (österreichischer Skilehrweg) mit den wesentlichen Bewegungsmerkmalen demonstrieren (C); einen adäquaten Ordnungsrahmen für Übungen zum technischen Leitkonzept (alle Stufen) herstellen (B); die methodischen Besonderheiten für den Skiunterricht von Kindern und Jugendlichen widergeben (A); einen adäquaten Sicherheitsrahmen für die Durchführung eines Rennlaufs umsetzen (A); einen Übungsbetrieb in allen Stufen selbständig organisieren (C); einen Übungsbetrieb für Kinder und Jugendliche selbständig gestalten und adaptieren (A); mit besonderen Anforderungen von Kunden (physische Einschränkungen, Einschränkung der Wahrnehmungsfähigkeit, Gewicht von Schneesportlerinnen und Schneesportlern, ) umgehen (B); Rückmeldungen über ihr persönliches Können in die Verbesserung der eigenen Skitechnik in den Bereichen Gelände- und Schulefahren sowie Rennlauf integrieren (B); ihr persönliches Können in den Bereichen Gelände- und Schulefahren sowie Rennlauf nach unterschiedlichen Qualitätskriterien evaluieren (C); Konsequenzen und Maßnahmen aus der Evaluation des eigenen Könnens für die weitere Anhebung der eigenen Kompetenz in den Bereichen Gelände- und Schulefahren sowie Rennlauf ableiten (C). Methodischer Aufbau des österreichischen Skilehrwegs in allen Stufen; Methodischer Aufbau Rennlauf (zb Riesentorlauf, ); methodische Besonderheiten des Skilaufs von Kindern und Jugendlichen; Methodische Hilfsmittel (Kurzcarver, ); unterschiedliche Ordnungsrahmen; Methodische Übungsreihen in allen Stufen (Kinder und Jugendliche, Anforderungen für Kunden und Kundinnen mit besonderen Bedürfnissen, ); Ordnungsrahmen und Ordnungsrahmenwechsel; Praxisübungen zur Verbesserung des Eigenkönnens im Geländefahren, im Schulefahren sowie im Rennlauf; Bewegen in unterschiedlichen Geländearten und Schneearten; Technikübungen für den Riesentorlauf. 16. Aktuelle Fachgebiete ihre Fertigkeiten in unterschiedlichen Gleitsportarten erweitern (B). Als aktuelle Fachgebiete sind jene Gleitsportarten heranzuziehen, die über mehrere Jahre hinweg breite Akzeptanz genießen, wie zb spezielle Rennlauftechniken, Snowboarden, Telemarken, Langlaufen, Shortcarven mit Kurzgleitern. B. Freigegenstände 17. Skirennlauf ihre Fertigkeiten im Skirennlauf leistungsmäßig erweitern (B).
8 8 von 12 Arbeit an individuellen Mustern zur Verbesserung der Rennlautechnik. C. Pflichtpraktikum Unterrichtspraxis Bis zur komm. Abschlussprüfung ist an Skischulen im Sinne der landesgesetzlichen Regelungen eine 6-monatige Unterrichtspraxis zu absolvieren. Davon können bis zu 5 Monate durch eine entsprechend lange Praxis vor dem Eintritt in den Ausbildungslehrgang ersetzt werden. Modul II: Freeriden und Alpinkurs 1. Orientierung sich im hochalpinen Gelände ohne Karte und technische Hilfsmittel orientieren (B); den exakten Standort und das umliegende Gelände auf einer topografischen Karte beim Freereiden unter Einbeziehung aller vorhandenen Möglichkeiten bestimmen (B); unter Verwendung von Orientierungshilfen und der Berücksichtigung aktueller Verhältnisse geeignete Tourenziele für das Freeriden festlegen (C); Eigenschaften, Gliederung und Funktion der Karte; kartographische Gestaltungsmöglichkeiten (Maßstab, Schrift, Höhenlinien, Signaturen etc.); Kartenrandangaben; Funktion und Handhabung technischer Orientierungshilfen (Bussole, Höhenmesser, GPS, etc.); Methoden zur Orientierung im Gelände mit und ohne Hilfsmittel; Skizzen, Topos, 2. Risikomanagement und Unfallkunde eine Planungen für das Freeriden unter Einbindung methodischer Elemente des Risikomanagements vornehmen (C); anhand der Planungen für das Freeriden die Führung der Gruppe im Gelände vornehmen und Entscheidungen treffen (C); konkrete Handlungspläne für worst-case Szenarien entwerfen (C). Analyse von Bergsportunfällen; Unfallstatistik; Unfall-Ursachenforschung; Strategien zur Risikominimierung; Standardmaßnahmen; Unfallmuster im Skihochtourenbereich; Alpine Gefahren; Literatur zur Unfallforschung. 3. Wetterkunde grundsätzliche Wetterphänomene theoretisch begründet beschreiben (A); an geeigneten Stellen einen aktuellen Wetterbericht einholen und diesen in seiner Bedeutung interpretieren (B); Entscheidungen über die Durchführung von Freeridefahrten auf Basis des aktuellen Wetterberichts argumentieren (C). Physikalische Grundlagen (Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit); wetterbestimmende Luftmassen; Wind; Niederschlag; Frontsysteme; Wolkenformen und Wettererscheinungen (Gewitter und Blitz); Großwetterlage; typische Alpinwetterlagen; Wetterprognose (Informationsmöglichkeiten, Interpretation und entsprechendes Handeln); Wetteränderungen im Tourenverlauf.
9 9 von Tourenplanung/Tourenführung anspruchsvolle Variantenabfahren mit hohem Risikobewusstsein planen (B); ; Geländebeurteilungen mit dem Schwerpunkt auf das Kartenlesen; Erkennen von potentiellen Gefahrenbereichen; grundsätzlicher Sicherheitsrahmen in der Abfahrt; Organisation der Gruppe in Abfahrt; Gruppenführung (pädagogisch/psychologisch) in Theorie und Praxis; Tourenplanung; Vergleich Tourenplanung mit der tatsächlichen Umsetzung. 5. Schnee- und Lawinenkunde theoretische Grundlagen zur Schneeentstehung und dessen Umwandlung reproduzieren (A); einfache praktische Tests zur Schneedeckenanalyse vornehmen und die gewonnenen Ergebnisse interpretieren (C). Schneeentstehung; Schneearten; Umwandlungsformen; günstige und ungünstige Witterungseinflüsse und deren Auswirkung auf die Schneedecke; Schneedeckentests; Schwachstellen innerhalb der Schneedecke; gebundene und ungebundene Schneeformen. 6. Seminar für Fachfragen Fragen zu aktuellen, spartenspezifischen Themen formulieren (B); Wissenselemente aus unterschiedlichen Lehrplangebieten anwendungsorientiert zusammenfügen (C). Zusammenführung wissensorientierter Fachinhalte diverser Lehrplangebiete; Unterstützung der weiterführenden Integration und Anwendungsorientierung der Lehrplaninhalte. 7. Variantenskilauf (Freeriden) Abfahrten im freien Skiraum risikobewusst planen und durchführen (C); anspruchsvolle Varianten mit hohem Risikobewusstsein unternehmen (B); Eigen- und Fremdanweisungen beim Fahren im Gelände sicher und zügig umsetzen (B). Festigung und Verbesserung des Eigenkönnens in der praktischen Geländebeurteilung und im Erkennen von potentiellen Gefahrenbereichen; Aufbau eines grundsätzlichen Sicherheitsrahmens in der Praxis; Organisation der Gruppe in kurzem Aufstieg und Abfahrt; Gruppenführung (pädagogisch/psychologisch) in der Praxis; Tourenplanung; Methoden der Risikoabwägung; Spur fahren; Korridor fahren; lange Radien kurze Radien; Einzelfahrten; Reflexion von Führungstätigkeit der Schneesportgruppe im Gelände. 8. Rettungsübungen Bildungs-und Lehraufgabe die Funktion von und die Arbeitsweise mit Verschütteten Suchgeräten erklären (A); eine Verschüttetensuche organisieren und durchführen (B); behelfsmäßige Methoden zur Sofortbergung von Verletzten anwenden (B);
10 10 von 12 die unterschiedlichen Rettungstechniken situativ zur Lösung von Notsituationen kombinieren (C). Funktion verschiedener Verschütteten Suchgeräte; Suchstrategien; Sondieren und Schaufeln; Strategien bei Mehrfach bzw. Mehrpersonenverschüttungen; Bergung und Abtransport (Vorbereitung für Helikopterabtransport). Modul III: Skiführerausbildung 1. Wetterkunde an geeigneten Stellen einen aktuellen Wetterbericht einholen und diesen in seiner Bedeutung interpretieren (B); Entscheidungen über die Durchführung einer Skitour auf Basis des aktuellen Wetterberichts argumentieren (C). Physikalische Grundlagen (Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit); wetterbestimmende Luftmassen; Wind; Niederschlag; Frontsysteme; Wolkenformen und Wettererscheinungen (Gewitter und Blitz); Großwetterlage; typische Alpinwetterlagen; Wetterprognose (Informationsmöglichkeiten, Interpretation und entsprechendes Handeln); Wetteränderungen im Tourenverlauf; 2. Risikomanagement und Unfallkunde : eine Tourenplanung für Skitouren unter Einbindung methodischer Elemente des Risikomanagements vornehmen (B); anhand der Tourenplanung die Führung der Gruppe im Gelände vornehmen und Entscheidungen treffen (C); konkrete Handlungspläne für worst-case Szenarien entwerfen (C). Unterschiedliche Methoden des Risikomanagements (Stop or Go, Reduktionsmethode, Snowcard, etc.); Verschnitt aus den Fachgebieten Schnee-und Lawinenkunde, Wetterkunde, Orientierung, Sportpsychologie; Lawinenlagebericht, Gelände, Schnee- und Witterungsverhältnisse. 3. Materialkunde eine Skitourenausrüstung zweckmäßig und sicher einsetzen (B); die Notfallausrüstung für das Skitourengehen erklären und einsetzen (B); Personen beim Kauf adäquater Skitourenausrüstung beraten (B). Normen; Beurteilung der aktuellen Skitourenausrüstung in Bezug auf Funktionalität und Sicherheit; Persönliche Sicherheitsausrüstung; richtiger Umgang mit der Ausrüstung und deren sachgemäße Wartung; Verleihsystematik in der Praxis; Innovationen am Markt (Vorteile und Probleme); Notfallausrüstung (LVS; Schaufel, Sonde, Auftriebssysteme,, ). 4. Schnee und Lawinenkunde unterschiedliche theoretische Zugänge zur praktischen Lawinenkunde benennen und auf ihre Anwendbarkeit hin überprüfen (B); Schneearten und Umwandlungsformen, Lawinenarten sowie die Bildung und Auslösung von Lawinen erklären (A);
11 11 von 12 einen Lawinenlagebericht an zuständiger Stelle einholen, interpretieren und verifizieren (C); Schneedeckenanalysen im Gelände durchführen und die Ergebnisse interpretieren (B); Gefahrenpotenziale unter Berücksichtigung des Wissens über lawinenbildenden Faktoren erkennen und Entscheidungen unter Zuhilfenahme von Methoden der Risikoabwägung treffen (C); mit der Kombination von Lawinengefahr, Spaltensturzgefahr und Absturzgefahr adäquat umgehen und anhand ihrer Kompetenzen zu richtigen Entscheidungen kommen (C). Entstehung und Ablagerung von Schnee; Umwandlungen (physikalische Theorien zur Schneeumwandlung, Einflussfaktoren,...); Aufbau der Schneedecke (Schichten, Spannungen und Festigkeiten in der Schneedecke... ); Lawinenbildung (Arten und Entstehung von Lawinen, geländebedingte Faktoren,...);Auslösung von Lawinen; Schneedeckentests (CT; ECT; Rutschblock,...); Schneeprofilaufnahme und -interpretation; aktuelle Methoden zur Risikominimierung (probabilistisch, analytisch, intuitiv,...); Konsequenzen aus Erkenntnissen der Schnee- und Lawinenkunde zum grundsätzlichen Sicherheitsrahmen für das Führen von Gruppen auf Skihochtouren; Gefahrenkombinationen auf Skihochtour (Lawine, Spalte, Absturz). 5. Orientierung : die Grundlagen der Orientierung und Funktionsweise von technischen Orientierungshilfen wiedergeben (B); sich im Gelände ohne Karte und technische Hilfsmittel orientieren (B); den exakten Standort und das umliegende Gelände auf einer topografischen Karte auf einer Bergtour unter Einbeziehung aller vorhandenen Möglichkeiten bestimmen (B); unter Verwendung von Orientierungshilfen und der Berücksichtigung aktueller Verhältnisse geeignete Tourenziele festlegen (C). Eigenschaften, Gliederung und Funktion der Karte; kartographische Gestaltungsmöglichkeiten (Maßstab, Schrift, Höhenlinien, Signaturen etc.); Kartenrandangaben; Funktion und Handhabung technischer Orientierungshilfen (Bussole, Höhenmesser, GPS, etc.); Methoden zur Orientierung im Gelände mit und ohne Hilfsmittel; Skizzen, Topos, 6. Seminar für Fachfragen Fragen zu aktuellen, spartenspezifischen Themen formulieren (B); Wissenselemente aus unterschiedlichen Lehrplangebieten anwendungsorientiert zusammenfügen (C). Zusammenführung wissensorientierter Fachinhalte diverser Lehrplangebiete; Unterstützung der weiterführenden Integration und Anwendungsorientierung der Lehrplaninhalte. 7. Skitouren Skihochourenführungen und -ausbildungen risikobewusst planen und durchführen (C); anspruchsvolle Skihochtouren mit hohem Risikobewusstsein unternehmen (B). verschiedene Sicherungstechniken und Sicherungsmittel in Schneeflanken, im Firn, am Gletscher und deren Einsatzbereich begründen. (A) adäquate Führungstechniken in steilen Schnee-und Firnflanken, sowie auf dem Gletscher risikobewusst vermitteln. (B)
12 12 von 12 Festigung und Verbesserung des Eigenkönnens; Skitechnik; Gehtechnik; Spuranlage; Geländebeurteilung; Erkennen von potentiellen Gefahrenbereichen; grundsätzlicher Sicherheitsrahmen; Organisation der Gruppe in Aufstieg und Abfahrt; Gruppenführung (pädagogisch/psychologisch) in der Praxis; Tourenplanung; Methoden der Risikoabwägung; 8. Rettungstechnik die Funktion von und die Arbeitsweise mit Verschütteten Suchgeräten erklären (A); eine Verschütteten Suche organisieren und durchführen (B); behelfsmäßige Methoden zur Sofortbergung von Verletzten anwenden (B); verschiedene Arten von Schneebiwaks errichten und den Aufenthalt der Gruppe organisieren (B); unterschiedliche Rettungstechniken auch im vergletscherten Gelände situativ zur Lösung von Notsituationen kombinieren (C). Funktion verschiedener Verschütteten Suchgeräte; Suchstrategien; Sondieren und Schaufeln; Strategien bei Mehrfach- bzw. Mehrpersonenverschüttungen; Bergung aus Gletscherspalten und Abtransport (Vorbereitung für Helikopterabtransport); Biwak Bau, Biwak Schleife;
LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN FÜR SKIHOCHTOUREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 1 von 6 Anlage C.3 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN FÜR SKIHOCHTOUREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren für Skihochtouren
1 von 6 Anlage C.3 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN FÜR SKIHOCHTOUREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren für Skihochtouren
INSTRUKTORENAUSBILDUNG FÜR SKITOUREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 Anlage C.2.1 INSTRUKTORENAUSBILDUNG FÜR SKITOUREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Skitouren hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf
Anlage C.2.1 INSTRUKTORENAUSBILDUNG FÜR SKITOUREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Skitouren hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf
LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON SPORTINSTRUKTORINNEN UND SPORTINSTRUKTOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 1 von 5 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON SPORTINSTRUKTORINNEN UND SPORTINSTRUKTOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Anlage C.1 Der Lehrgang zur Ausbildung von Sportinstruktorinnen und Sportinstruktoren hat in einem
1 von 5 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON SPORTINSTRUKTORINNEN UND SPORTINSTRUKTOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Anlage C.1 Der Lehrgang zur Ausbildung von Sportinstruktorinnen und Sportinstruktoren hat in einem
LEHRWARTEAUSBILDUNG FIT/SENIOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 Anlage C.18 LEHRWARTEAUSBILDUNG FIT/SENIOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten Fit/Senioren hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes
Anlage C.18 LEHRWARTEAUSBILDUNG FIT/SENIOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten Fit/Senioren hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes
INSTRUKTORENAUSBILDUNG FÜR KLETTERN-ALPIN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 Anlage C.7 INSTRUKTORENAUSBILDUNG FÜR KLETTERN-ALPIN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Klettern-Alpin hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme
Anlage C.7 INSTRUKTORENAUSBILDUNG FÜR KLETTERN-ALPIN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Klettern-Alpin hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme
III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE
 1 von 5 Anlage C.21 LHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN FÜR KINDER- UND JUGENDFUßBALL I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren
1 von 5 Anlage C.21 LHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN FÜR KINDER- UND JUGENDFUßBALL I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren
LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN FÜR WANDERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 1 von 5 Anlage C.9 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN FÜR WANDERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren für Wandern hat
1 von 5 Anlage C.9 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN FÜR WANDERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren für Wandern hat
LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON TENNISINSTRUKTORINNEN UND TENNISINSTRUKTOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 1 von 8 Anlage C.17 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON TENNISINSTRUKTORINNEN UND TENNISINSTRUKTOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren für Tennis hat
1 von 8 Anlage C.17 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON TENNISINSTRUKTORINNEN UND TENNISINSTRUKTOREN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren für Tennis hat
LEHRWARTAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 Anlage C.1 LEHRWARTAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes über Schulen zur
Anlage C.1 LEHRWARTAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes über Schulen zur
INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR SNOWBOARDEN. I. Allgemeines Bildungsziel. II. Stundentafel
 INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR SNOWBOARDEN I. Allgemeines Bildungsziel Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Snowboarden hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtname auf 1 des Bundesgesetzes
INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR SNOWBOARDEN I. Allgemeines Bildungsziel Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Snowboarden hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtname auf 1 des Bundesgesetzes
LEHRWARTEAUSBILDUNG FÜR SKILANGLAUF UND SKIWANDERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 LEHRWARTEAUSBILDUNG FÜR SKILANGLAUF UND SKIWANDERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten für Skilanglauf und Skiwandern hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme
LEHRWARTEAUSBILDUNG FÜR SKILANGLAUF UND SKIWANDERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten für Skilanglauf und Skiwandern hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme
Winterausbildung 2016/2017
 Winterausbildung 2016/2017 Die Bergsteigergruppen Oberndorf, Rottweil und Spaichingen bieten eine koordinierte Winterausbildungen für Skitourengeher, Freerider und Schneeschuhgeher. Termin Thema Ort 21.11.2016
Winterausbildung 2016/2017 Die Bergsteigergruppen Oberndorf, Rottweil und Spaichingen bieten eine koordinierte Winterausbildungen für Skitourengeher, Freerider und Schneeschuhgeher. Termin Thema Ort 21.11.2016
Winterausbildung 2014/2015
 Winterausbildung 2014/2015 Die Bergsteigergruppen Oberndorf, Rottweil und Spaichingen bieten eine koordinierte Winterausbildungen für Skitourengeher, Freerider und Schneeschuhgeher. Termin Thema Ort 24.11.2014
Winterausbildung 2014/2015 Die Bergsteigergruppen Oberndorf, Rottweil und Spaichingen bieten eine koordinierte Winterausbildungen für Skitourengeher, Freerider und Schneeschuhgeher. Termin Thema Ort 24.11.2014
INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR TENNIS I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 Anlage C.22 INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR TENNIS I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Tennis hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes
Anlage C.22 INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR TENNIS I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Tennis hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes
Päd. Perspektive leitend/ergänzend
 Bewegungsfeld/Sportbereich 1.1 Päd. Perspektive leitend/ergänzend Jahrg.-Stufe Dauer des UV Std. Vernetzen mit UV Laufende Nr. der UV Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen A D 5.1 5-5.1
Bewegungsfeld/Sportbereich 1.1 Päd. Perspektive leitend/ergänzend Jahrg.-Stufe Dauer des UV Std. Vernetzen mit UV Laufende Nr. der UV Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen A D 5.1 5-5.1
Der Weg zum staatlich geprüften österreichischen Skitrainer
 Leitung: Mag. Alfred Wagner Fürstenweg 185 A-6020 Innsbruck www.bspa.at InfoInnsbruck@bspa.at Österreichische Trainerausbildung Abteilungsvorstand: Mag. Wolfgang Leitenstorfer Sekretariat: Frau Höpperger
Leitung: Mag. Alfred Wagner Fürstenweg 185 A-6020 Innsbruck www.bspa.at InfoInnsbruck@bspa.at Österreichische Trainerausbildung Abteilungsvorstand: Mag. Wolfgang Leitenstorfer Sekretariat: Frau Höpperger
LEHRWARTEAUSBILDUNG FÜR DIE SPORTAUSÜBUNG VON AMPUTIERTEN, BLINDEN, ROLLSTUHLFAHRERN, SPASTIKERN ODER GEISTIG BEHINDERTEN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL
 Anlage C.12 LEHRWARTEAUSBILDUNG FÜR DIE SPORTAUSÜBUNG VON AMPUTIERTEN, BLINDEN, ROLLSTUHLFAHRERN, SPASTIKERN ODER GEISTIG BEHINDERTEN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten
Anlage C.12 LEHRWARTEAUSBILDUNG FÜR DIE SPORTAUSÜBUNG VON AMPUTIERTEN, BLINDEN, ROLLSTUHLFAHRERN, SPASTIKERN ODER GEISTIG BEHINDERTEN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Lehrwarten
AUSBILDUNG VON FUSSBALLTRAINERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 Anlage B.3 AUSBILDUNG VON FUSSBALLTRAINERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Fußballtrainern hat in einem viersemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes
Anlage B.3 AUSBILDUNG VON FUSSBALLTRAINERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Fußballtrainern hat in einem viersemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes
AUSBILDUNG ZUM/ ZUR SPORTINSTRUKTOR/IN
 AUSBILDUNG ZUM/ ZUR SPORTINSTRUKTOR/IN GRUNDAUSBILDUNG FÜR TRAINER/ INNEN 1. Allgemeines Bildungsziel Die Ausbildung zum/ zur Sportinstruktor/ In ist eine vom VSS organisierte Ausbildung und ist südtirolweit
AUSBILDUNG ZUM/ ZUR SPORTINSTRUKTOR/IN GRUNDAUSBILDUNG FÜR TRAINER/ INNEN 1. Allgemeines Bildungsziel Die Ausbildung zum/ zur Sportinstruktor/ In ist eine vom VSS organisierte Ausbildung und ist südtirolweit
AUSBIDUNG VON SPORT-JUGENDLEITERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 Anlage D.1 AUSBIDUNG VON SPORT-JUGENDLEITERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang der Ausbildung von Sport-Jugendleitern hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes
Anlage D.1 AUSBIDUNG VON SPORT-JUGENDLEITERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang der Ausbildung von Sport-Jugendleitern hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes
RAHMENRICHTLINIEN. für die Ausbildung Prüfung und Fortbildung von Schneesport - Instruktoren
 RAHMENRICHTLINIEN für die Ausbildung Prüfung und Fortbildung von Schneesport - Instruktoren Ski-Instruktoren, Snowboard-Instruktoren und Instruktoren in anderen Schneesportarten unterrichten entsprechend
RAHMENRICHTLINIEN für die Ausbildung Prüfung und Fortbildung von Schneesport - Instruktoren Ski-Instruktoren, Snowboard-Instruktoren und Instruktoren in anderen Schneesportarten unterrichten entsprechend
Stoffverteilungsplan Inline Alpin
 Stoffverteilungsplan Inline Alpin Breitensport Leistungssport B L L Lehrgänge: G I FB TC G A1 FL TC TB TB TA 02.3.1. Personen- und vereinsbezogener Bereich 40 40 40 120 40 40 40 120 60 60 90 PÄDAGOGIK
Stoffverteilungsplan Inline Alpin Breitensport Leistungssport B L L Lehrgänge: G I FB TC G A1 FL TC TB TB TA 02.3.1. Personen- und vereinsbezogener Bereich 40 40 40 120 40 40 40 120 60 60 90 PÄDAGOGIK
LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON FUßBALLTRAINERINNEN UND FUßBALLTRAINERN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 1 von 5 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON FUßBALLTRAINERINNEN UND FUßBALLTRAINERN Anlage B.3 I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Fußballtrainerinnen/Fußballtrainern hat in einem einsemestrigen
1 von 5 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON FUßBALLTRAINERINNEN UND FUßBALLTRAINERN Anlage B.3 I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Fußballtrainerinnen/Fußballtrainern hat in einem einsemestrigen
LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON DIPLOMTRAINERINNEN UND DIPLOMTRAINERN FUßBALL I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 1 von 5 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON DIPLOMTRAINERINNEN UND DIPLOMTRAINERN FUßBALL I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Anlage B.10 Der Lehrgang zur Ausbildung von Diplomtrainerinnen und Diplomtrainer für Fußball
1 von 5 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON DIPLOMTRAINERINNEN UND DIPLOMTRAINERN FUßBALL I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Anlage B.10 Der Lehrgang zur Ausbildung von Diplomtrainerinnen und Diplomtrainer für Fußball
Erlass vom II Gült. Verz. Nr. 7014
 Richtlinien für die Ausbildung und Überprüfung von Lehrkräften für die Berechtigung zum Unterrichten in Schulski- und Schulsnowboardkursen und für die Leitung dieser Kurse Erlass vom 15.10.2006 II.6 170.000.076
Richtlinien für die Ausbildung und Überprüfung von Lehrkräften für die Berechtigung zum Unterrichten in Schulski- und Schulsnowboardkursen und für die Leitung dieser Kurse Erlass vom 15.10.2006 II.6 170.000.076
Minimumstandard der Skilehrerausbildung für eine Mitgliedschaft in der ISIA
 Minimumstandard der Skilehrerausbildung für eine Mitgliedschaft in der ISIA 1. Präambel 2. Ziele der Ausbildung 3. Mindestanforderungen und Prüfungen 4. Ausbildungsdauer 5. Kontrolle 6. Fortbildung 7.
Minimumstandard der Skilehrerausbildung für eine Mitgliedschaft in der ISIA 1. Präambel 2. Ziele der Ausbildung 3. Mindestanforderungen und Prüfungen 4. Ausbildungsdauer 5. Kontrolle 6. Fortbildung 7.
(Termine, Daten, Inhalte)
 IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
Ausbildung zum Rennrad-Guide Lerninhalte und Lernziel der Pflichtgegenstände
 Ausbildung zum Rennrad-Guide Lerninhalte und Lernziel der Pflichtgegenstände I. Pflichtgegenstände Stundenausmaß Theorie Gesamtstundenausmaß 36 1. Deutsch (Kommunikation) 2 2. Organisationslehre 1 3. Betriebskunde
Ausbildung zum Rennrad-Guide Lerninhalte und Lernziel der Pflichtgegenstände I. Pflichtgegenstände Stundenausmaß Theorie Gesamtstundenausmaß 36 1. Deutsch (Kommunikation) 2 2. Organisationslehre 1 3. Betriebskunde
- Verbesserung des persönlichen Fahrkönnens (sportliche, dynamische und fließende parallele Fahrweise)
 Handout Grundstufen-Ausbildung 2009/10 Liebe Grundstufenanwärter, mit den folgenden Informationen möchten wir Dir den Einstieg in das alpine Lehrwesen (Grundstufe) erläutern. Durch Deine Ausbildung im
Handout Grundstufen-Ausbildung 2009/10 Liebe Grundstufenanwärter, mit den folgenden Informationen möchten wir Dir den Einstieg in das alpine Lehrwesen (Grundstufe) erläutern. Durch Deine Ausbildung im
Kurztitel. Kundmachungsorgan. /Artikel/Anlage. Inkrafttretensdatum. Beachte. Bundesrecht konsolidiert
 Kurztitel Lehrpläne - Ausbildung von Leibeserziehern und Sportlehrern Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 529/1992 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 362/2011 /Artikel/Anlage Anl. 2/3 Inkrafttretensdatum 01.10.2011
Kurztitel Lehrpläne - Ausbildung von Leibeserziehern und Sportlehrern Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 529/1992 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 362/2011 /Artikel/Anlage Anl. 2/3 Inkrafttretensdatum 01.10.2011
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER, MASCHINSTICKER I. STUNDENTAFEL A. GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER
 RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER, MASCHINSTICKER I. STUNDENTAFEL A. GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER Anlage A/2/3 Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 200 Unterrichtsstunden
RAHMENLEHRPLAN FÜR DIE LEHRBERUFE GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER, MASCHINSTICKER I. STUNDENTAFEL A. GOLD-, SILBER- UND PERLENSTICKER Anlage A/2/3 Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 200 Unterrichtsstunden
Modulhandbuch des Studiengangs Evangelische Religionslehre im Master of Education - Lehramt an Grundschulen
 Modulhandbuch des Studiengangs Evangelische Religionslehre im Master of Education - Lehramt an Grundschulen Inhaltsverzeichnis M(G)-TEV10 Fachdidaktik evangelische Religionslehre..............................
Modulhandbuch des Studiengangs Evangelische Religionslehre im Master of Education - Lehramt an Grundschulen Inhaltsverzeichnis M(G)-TEV10 Fachdidaktik evangelische Religionslehre..............................
TRAINERAUSBILDUNG FÜR SPORTSCHIESSEN/GEWEHR I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 TRAINERAUSBILDUNG FÜR SPORTSCHIESSEN/GEWEHR I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Trainern für Sportschießen/Gewehr hat in einem dreisemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf
TRAINERAUSBILDUNG FÜR SPORTSCHIESSEN/GEWEHR I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Trainern für Sportschießen/Gewehr hat in einem dreisemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf
LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORIINNEN UND IN- STRUKTOREN FÜR FÜR SPORTKLETTERN/BREITENSPORT I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL
 1 von 8 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORIINNEN UND IN- STRUKTOREN FÜR FÜR SPORTKLETTERN/BREITENSPORT I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Anlage C.18 Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren
1 von 8 LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON INSTRUKTORIINNEN UND IN- STRUKTOREN FÜR FÜR SPORTKLETTERN/BREITENSPORT I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Anlage C.18 Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktorinnen und Instruktoren
INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR SPORTKLETTERN/LEISTUNGSSPORT I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 Anlage C.24 INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR SPORTKLETTERN/LEISTUNGSSPORT I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Sportklettern/Leistungssport hat in einem einsemestrigen Bildungsgang
Anlage C.24 INSTRUKTORAUSBILDUNG FÜR SPORTKLETTERN/LEISTUNGSSPORT I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Sportklettern/Leistungssport hat in einem einsemestrigen Bildungsgang
REITINSTRUKTORENAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 REITINSTRUKTORENAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Reitinstruktoren hat in einem zweisemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes über Schulen
REITINSTRUKTORENAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Reitinstruktoren hat in einem zweisemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf 1 des Bundesgesetzes über Schulen
Optimales Training. Leistungsphysiologische Trainingslehre. J. Weineck, Erlangen. Unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings
 Optimales Training J. Weineck, Erlangen Leistungsphysiologische Trainingslehre Unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings Verlagsgesellschaft mbh, D-8520 Erlangen Inhalt 5 Inhalt
Optimales Training J. Weineck, Erlangen Leistungsphysiologische Trainingslehre Unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings Verlagsgesellschaft mbh, D-8520 Erlangen Inhalt 5 Inhalt
Allgemeine Anmerkungen zur Optimierung der TETVET-Weiterbildungsmodule. Prof. Dr. Niclas Schaper. TETVET (Tempus)
 Allgemeine Anmerkungen zur Optimierung der TETVET-Weiterbildungsmodule TETVET (Tempus) Allgemeine Anmerkungen zur Optimierung der Tetvet-Weiterbildungsmodule Fachliche Inhalte der Module Am Anfang der
Allgemeine Anmerkungen zur Optimierung der TETVET-Weiterbildungsmodule TETVET (Tempus) Allgemeine Anmerkungen zur Optimierung der Tetvet-Weiterbildungsmodule Fachliche Inhalte der Module Am Anfang der
LEHRPLAN DES KOLLEGS AN HANDELSAKADEMIEN FÜR BERUFSTÄTIGE
 Kurztitel Lehrpläne - Handelsakademie und Handelsschule Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 895/1994 /Artikel/Anlage Anl. 1/4 Inkrafttretensdatum 01.09.1995 Außerkrafttretensdatum 03.10.2000 Beachte weise gestaffeltes
Kurztitel Lehrpläne - Handelsakademie und Handelsschule Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 895/1994 /Artikel/Anlage Anl. 1/4 Inkrafttretensdatum 01.09.1995 Außerkrafttretensdatum 03.10.2000 Beachte weise gestaffeltes
Ernährung und Haushalt in der NMS
 Ernährung und Haushalt in der NMS Aktuelle Entwicklungen Ernährung und Haushalt ist in der NMS ein Pflichtfach 1-4 Stunden sind in der NMS Stundentafel ausgewiesen 1 Stunde EH muss in der NMS angeboten
Ernährung und Haushalt in der NMS Aktuelle Entwicklungen Ernährung und Haushalt ist in der NMS ein Pflichtfach 1-4 Stunden sind in der NMS Stundentafel ausgewiesen 1 Stunde EH muss in der NMS angeboten
Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung
 Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung Beim selbstorganisierten Lernen (SOL) sind neben Fachinhalten auch die sogenannt überfachlichen Kompetenzen wichtig, z.b. das Planen und Durchführen einer Arbeit,
Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung Beim selbstorganisierten Lernen (SOL) sind neben Fachinhalten auch die sogenannt überfachlichen Kompetenzen wichtig, z.b. das Planen und Durchführen einer Arbeit,
Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ)
 Modulbeschreibung Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ) Dieser Kurs vermittelt in drei Modulen wesentliche Elemente für einen erfolgreichen fremdsprachlichen Deutschunterricht.
Modulbeschreibung Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ) Dieser Kurs vermittelt in drei Modulen wesentliche Elemente für einen erfolgreichen fremdsprachlichen Deutschunterricht.
ECVET-konformes Curriculum der Logopädie
 ECVET-konformes Curriculum der Logopädie Entstanden im Projekt 2get1care Lebenslanges Lernen und Interprofessionalität in den Gesundheitsfachberufen (2011-2013) Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
ECVET-konformes Curriculum der Logopädie Entstanden im Projekt 2get1care Lebenslanges Lernen und Interprofessionalität in den Gesundheitsfachberufen (2011-2013) Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
1. DSV-Grundstufe: Theorielehrgang (20 LE)
 Anlagen zum Curriculum Ski Alpin Seite - 1-1. DSV-Grundstufe: Theorielehrgang (20 LE) A Theorie Bereiche LE Thema Lernziele A.1 Sport und Gesellschaft 1 Hinweise zur Ausbildung Rolle, Funktionen und Stellung
Anlagen zum Curriculum Ski Alpin Seite - 1-1. DSV-Grundstufe: Theorielehrgang (20 LE) A Theorie Bereiche LE Thema Lernziele A.1 Sport und Gesellschaft 1 Hinweise zur Ausbildung Rolle, Funktionen und Stellung
Modulbeschreibungen. Pflichtmodule. Introduction to the Study of Ancient Greek. Modulbezeichnung (englisch) Leistungspunkte und Gesamtarbeitsaufwand
 Modulbeschreibungen Pflichtmodule Einführung Gräzistik Introduction to the Study of Ancient Greek 6 180 Stunden jedes Wintersemester Die Studierenden werden mit den Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens,
Modulbeschreibungen Pflichtmodule Einführung Gräzistik Introduction to the Study of Ancient Greek 6 180 Stunden jedes Wintersemester Die Studierenden werden mit den Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens,
Konkretisierung der Ausbildungslinien im Fach Spanisch
 Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Fachdidaktische Ausbildung Ausbildungsplan Umsetzung
 Fachdidaktische Ausbildung Ausbildungsplan Umsetzung Ausbildungsplan (Mathe) Rahmencurriculum & Didaktiken der Unterrichtsfächer (hier nicht allgemein betrachtet) A. Ziele der Ausbildung B. Didaktik und
Fachdidaktische Ausbildung Ausbildungsplan Umsetzung Ausbildungsplan (Mathe) Rahmencurriculum & Didaktiken der Unterrichtsfächer (hier nicht allgemein betrachtet) A. Ziele der Ausbildung B. Didaktik und
Universität Augsburg APRIL Modulhandbuch. Schulpädagogik
 Universität Augsburg APRIL 2009 Modulhandbuch Schulpädagogik im Rahmen der Erziehungswissenschaften für die Lehrämter Grund-, Haupt-, Realschule und Gymnasium Modulbeauftragter Prof. Dr. Dr. W. Wiater
Universität Augsburg APRIL 2009 Modulhandbuch Schulpädagogik im Rahmen der Erziehungswissenschaften für die Lehrämter Grund-, Haupt-, Realschule und Gymnasium Modulbeauftragter Prof. Dr. Dr. W. Wiater
analyse:berg winter 2013/14
 analyse:berg winter 2013/14 PRESSEKONFERENZ, 2.4.2014 Referenten HR Dr. Karl Gabl Präsident des Österr. Kuratoriums für alpine Sicherheit Meteorologe, staatl. geprüfter Berg- und Skiführer Peter Veider
analyse:berg winter 2013/14 PRESSEKONFERENZ, 2.4.2014 Referenten HR Dr. Karl Gabl Präsident des Österr. Kuratoriums für alpine Sicherheit Meteorologe, staatl. geprüfter Berg- und Skiführer Peter Veider
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14
 Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Historisches Seminar. Bachelor of Arts, Nebenfach. Geschichte. Modulhandbuch. Stand:
 Historisches Seminar Bachelor of Arts, Nebenfach Geschichte Modulhandbuch Stand: 01.10.2013 1 Modul: M 1 Einführung in das Fachstudium (6 ECTS-Punkte) 1 Einführung in die V, P 6 3 4 Jedes 2. Semester Geschichtswissenschaft
Historisches Seminar Bachelor of Arts, Nebenfach Geschichte Modulhandbuch Stand: 01.10.2013 1 Modul: M 1 Einführung in das Fachstudium (6 ECTS-Punkte) 1 Einführung in die V, P 6 3 4 Jedes 2. Semester Geschichtswissenschaft
Optimales Training. 7.. Auflage. Beiträge zur Sportmedizin, Band 10
 Beiträge zur Sportmedizin, Band 10 Optimales Training 7.. Auflage Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings J. Weineck, Erlangen Duch perimed
Beiträge zur Sportmedizin, Band 10 Optimales Training 7.. Auflage Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings J. Weineck, Erlangen Duch perimed
Zertifizierter LEHRGANG Ausbildung zur/m Lehrlingsausbildner/in
 Zertifizierter LEHRGANG Ausbildung zur/m Lehrlingsausbildner/in Curriculum gemäß 29g Abs. 2 BAG (Die der Module entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen laut BAG) Inhalt 1. Grundsätzliches... 2 Ziele
Zertifizierter LEHRGANG Ausbildung zur/m Lehrlingsausbildner/in Curriculum gemäß 29g Abs. 2 BAG (Die der Module entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen laut BAG) Inhalt 1. Grundsätzliches... 2 Ziele
Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik. Modulhandbuch für den Masterstudiengang. Lehramt im Fach Mathematik
 Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik Stand: Juni 2016 Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im
Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im Fach Mathematik Stand: Juni 2016 Modulhandbuch für den Masterstudiengang Lehramt im
Vom Lehrrettungsassistenten zum Praxisanleiter für Notfallsanitäter (verkürzter Lehrgang 100 Std oder 80 Std)
 Bezirksverband Frankfurt am Main Zentrale AusbildungsStätte staatlich anerkannte Bildungsstätte Vom Lehrrettungsassistenten zum Praxisanleiter für Notfallsanitäter (verkürzter Lehrgang 100 Std oder 80
Bezirksverband Frankfurt am Main Zentrale AusbildungsStätte staatlich anerkannte Bildungsstätte Vom Lehrrettungsassistenten zum Praxisanleiter für Notfallsanitäter (verkürzter Lehrgang 100 Std oder 80
HERZLICH WILLKOMMEN BEI SNOWSPORT TIROL - TIROLER SKILEHRERVERBAND!
 HERZLICH WILLKOMMEN BEI SNOWSPORT TIROL - TIROLER SKILEHRERVERBAND! Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Ausbildung bei Snowsport Tirol - Tiroler Skilehrerverband! Die Tiroler Skischulen tragen mit ihrem
HERZLICH WILLKOMMEN BEI SNOWSPORT TIROL - TIROLER SKILEHRERVERBAND! Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Ausbildung bei Snowsport Tirol - Tiroler Skilehrerverband! Die Tiroler Skischulen tragen mit ihrem
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung)
 Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Primarbereich (Lehramt Grundschule)
 Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Primarbereich (Lehramt Grundschule) Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Sekundarbereich (Lehramt Sekundarstufe
Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Primarbereich (Lehramt Grundschule) Die Erziehungswissenschaft im Rahmen des Studiengangs Bachelor im Sekundarbereich (Lehramt Sekundarstufe
SNOWBOARDLEHRER UND SNOWBOARDFÜHRERAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 SNOWBOARDLEHRER UND SNOWBOARDFÜHRERAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Snowboardlehrern und Snowboardführern hat in einem zweisemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme
SNOWBOARDLEHRER UND SNOWBOARDFÜHRERAUSBILDUNG I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Snowboardlehrern und Snowboardführern hat in einem zweisemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme
LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON SPORT-BADEWARTEN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL II. STUNDENTAFEL
 1 von 5 Anlage D LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON SPORT-BADEWARTEN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Sport-Badewarten hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf
1 von 5 Anlage D LEHRGANG ZUR AUSBILDUNG VON SPORT-BADEWARTEN I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL Der Lehrgang zur Ausbildung von Sport-Badewarten hat in einem einsemestrigen Bildungsgang unter Bedachtnahme auf
Beschlussreifer Entwurf
 Beschlussreifer Entwurf Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, mit der die Verordnung über die Lehrpläne der allgemein bildenden höheren Schulen geändert wird Auf Grund 1.
Beschlussreifer Entwurf Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, mit der die Verordnung über die Lehrpläne der allgemein bildenden höheren Schulen geändert wird Auf Grund 1.
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Montessori Diplomlehrgänge: Standard - Lehrgangs und Prüfungsordnung
 Institut für lebendiges Lernen Dr. Wilhelm Weinhäupl Triebenbachstr. 17 5020 Salzburg Tel/Fax: +43 (0)662 830101 E-Mail: Website: office@montessori-ausbildung.at http://www.montessori-ausbildung.at Montessori
Institut für lebendiges Lernen Dr. Wilhelm Weinhäupl Triebenbachstr. 17 5020 Salzburg Tel/Fax: +43 (0)662 830101 E-Mail: Website: office@montessori-ausbildung.at http://www.montessori-ausbildung.at Montessori
INTERSKI AUSTRIA TAGUNG SCHNEESPORT- LEHRWESEN FACHTAGUNG
 6. Dezember 2012 - Salzburg INTERSKI AUSTRIA TAGUNG SCHNEESPORT- LEHRWESEN FACHTAGUNG Programm Zeit 15:00 Fachtagung Schneesport-Lehrwesen (Skilehrwesen) 15:10 15:45 Vortrag und Diskussion ALStv Mag. Günther
6. Dezember 2012 - Salzburg INTERSKI AUSTRIA TAGUNG SCHNEESPORT- LEHRWESEN FACHTAGUNG Programm Zeit 15:00 Fachtagung Schneesport-Lehrwesen (Skilehrwesen) 15:10 15:45 Vortrag und Diskussion ALStv Mag. Günther
Beschreibung des Profils Trainer C Basis Breitensport
 Beschreibung des Profils Trainer C Basis Breitensport Voraussetzungen: - Vollendung des 18.Lebensjahres - Mitgliedschaft in einem dem DSB angeschlossenen Verein - Eine abgeschlossene Schießleiterausbildung
Beschreibung des Profils Trainer C Basis Breitensport Voraussetzungen: - Vollendung des 18.Lebensjahres - Mitgliedschaft in einem dem DSB angeschlossenen Verein - Eine abgeschlossene Schießleiterausbildung
Qualität und Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung
 Qualität und Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung Warum ist Qualität so wichtig? Bewerbersituation - demographische Entwicklung Attraktivität der Berufsausbildung sichern Sicherung der Fachkräfte
Qualität und Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung Warum ist Qualität so wichtig? Bewerbersituation - demographische Entwicklung Attraktivität der Berufsausbildung sichern Sicherung der Fachkräfte
Leitfaden zum Pflichtpraktikum an kaufmännischen Schulen. Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer
 Leitfaden zum Pflichtpraktikum an kaufmännischen Schulen Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer Stand: Februar 2015 Die Schülerinnen und Schüler der mittleren und höheren kaufmännischen Schulen (Handelsakademie,
Leitfaden zum Pflichtpraktikum an kaufmännischen Schulen Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer Stand: Februar 2015 Die Schülerinnen und Schüler der mittleren und höheren kaufmännischen Schulen (Handelsakademie,
Sport. August Handreichung zum Lehrplan für die Sekundarstufe II Berufliches Gymnasium
 Sport August 2013 Handreichung zum Lehrplan für die Sekundarstufe II Berufliches Gymnasium Inhaltsverzeichnis Impressum Handreichung zum Lehrplan Sport für die Sekundarstufe II Berufliches Gymnasium Herausgeber:
Sport August 2013 Handreichung zum Lehrplan für die Sekundarstufe II Berufliches Gymnasium Inhaltsverzeichnis Impressum Handreichung zum Lehrplan Sport für die Sekundarstufe II Berufliches Gymnasium Herausgeber:
FORTBILDUNGSPROGRAMM alpin Saison 08/09
 FORTBILDUNGSPROGRAMM alpin Saison 08/09 Im Zuge der Umsetzung des Lehrplans Praxis und der Anknüpfung an die Fortbildungsprogramme der letzten Jahre, wollen wir dieses Jahr eine Einheit im Bereich Methodik
FORTBILDUNGSPROGRAMM alpin Saison 08/09 Im Zuge der Umsetzung des Lehrplans Praxis und der Anknüpfung an die Fortbildungsprogramme der letzten Jahre, wollen wir dieses Jahr eine Einheit im Bereich Methodik
Körpersignale wahrnehmen und begreifen sich selbst aufwärmen und Belastung einschätzen können
 Stufe Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen A/F/D 5 4 30,42 10 Körpersignale wahrnehmen und begreifen sich selbst aufwärmen und Belastung einschätzen können Kompetenzerwartungen: BWK
Stufe Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen A/F/D 5 4 30,42 10 Körpersignale wahrnehmen und begreifen sich selbst aufwärmen und Belastung einschätzen können Kompetenzerwartungen: BWK
Informationen zum Wahlpflichtfachangebot. der IGS Selters
 Informationen zum Wahlpflichtfachangebot der IGS Selters Bedeutung des WPF Hauptfach Begabung / Talent Wahlpflichtfach Persönliche Interessen 2. Fremdsprache möglich Neigungsdifferenzierung Wahlpflichtfachangebot
Informationen zum Wahlpflichtfachangebot der IGS Selters Bedeutung des WPF Hauptfach Begabung / Talent Wahlpflichtfach Persönliche Interessen 2. Fremdsprache möglich Neigungsdifferenzierung Wahlpflichtfachangebot
CURRICULUM AUS NATURWISSENSCHAFTEN Physik und Chemie 1. Biennium FOWI
 Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der soll den SchülerInnen eine aktive Auseinandersetzung mit physikalischen und chemischen Phänomenen ermöglichen. In aktuellen und gesellschaftsrelevanten
Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der soll den SchülerInnen eine aktive Auseinandersetzung mit physikalischen und chemischen Phänomenen ermöglichen. In aktuellen und gesellschaftsrelevanten
Freeride Camp Montafon unter Leitung von Sebastian Garhammer
 Freeride Camp Montafon unter Leitung von Sebastian Garhammer Kurnsnr. 26 / 20.01. 23.01.2017 Hotel Explorer / Gaschurn 3 Tage Guiding, 3 Ü/Frühstück DZ 719,- EZ 839- Nur Guiding 450,- Anreise Freitagabend:
Freeride Camp Montafon unter Leitung von Sebastian Garhammer Kurnsnr. 26 / 20.01. 23.01.2017 Hotel Explorer / Gaschurn 3 Tage Guiding, 3 Ü/Frühstück DZ 719,- EZ 839- Nur Guiding 450,- Anreise Freitagabend:
1. Grundlagen der Pädagogik und Didaktik... 11
 Inhaltsverzeichnis 3 Vorwort von Peter Lücke... 9 1. Grundlagen der Pädagogik und Didaktik... 11 1.1. Hauptströmungen der Pädagogik... 12 1.1.1. Geisteswissenschaftliche Pädagogik... 13 1.1.2. Kritisch-rationalistische
Inhaltsverzeichnis 3 Vorwort von Peter Lücke... 9 1. Grundlagen der Pädagogik und Didaktik... 11 1.1. Hauptströmungen der Pädagogik... 12 1.1.1. Geisteswissenschaftliche Pädagogik... 13 1.1.2. Kritisch-rationalistische
Schulleiterleitfaden
 STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG FREIBURG (GYMNASIEN UND SONDERSCHULEN) - Abteilung Sonderschulen - Schulleiterleitfaden Aufgabenfelder in der Ausbildung von Sonderschullehreranwärterinnen
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG FREIBURG (GYMNASIEN UND SONDERSCHULEN) - Abteilung Sonderschulen - Schulleiterleitfaden Aufgabenfelder in der Ausbildung von Sonderschullehreranwärterinnen
Fachschule für Mode und Bekleidungstechnik für Hörbehinderte BGBl. Nr. 664/1995, II/374/ Lehrplan\FMBH doc
 Fachschule für Mode und Bekleidungstechnik für Hörbehinderte BGBl. Nr. 664/1995, II/374/1999 1 Anlage 1B.5.7 FACHSCHULE FÜR MODE UND BEKLEIDUNGSTECHNIK FÜR HÖRBEHINDERTE I. Stundentafel (Gesamtstundenzahl
Fachschule für Mode und Bekleidungstechnik für Hörbehinderte BGBl. Nr. 664/1995, II/374/1999 1 Anlage 1B.5.7 FACHSCHULE FÜR MODE UND BEKLEIDUNGSTECHNIK FÜR HÖRBEHINDERTE I. Stundentafel (Gesamtstundenzahl
Rahmenplan. für die Ausbildung von Wanderführer/Innen. Deutscher Wanderverband
 Grundsätze: 1 Rahmenplan für die Ausbildung von Wanderführer/Innen Deutscher Wanderverband Aufgabe der Wanderführer/Innen/Wanderleiter/Innen (Natur- und Landschaftsführer) der Wandervereine ist es, selbständig
Grundsätze: 1 Rahmenplan für die Ausbildung von Wanderführer/Innen Deutscher Wanderverband Aufgabe der Wanderführer/Innen/Wanderleiter/Innen (Natur- und Landschaftsführer) der Wandervereine ist es, selbständig
BSO-Sportmanager. Die Führungskräfteausbildung im Sport CURRICULUM BASIS
 BSO-Sportmanager Die Führungskräfteausbildung im Sport CURRICULUM BASIS in Kooperation mit Unterstützt von Koordination und Zusammenstellung: Erika König-Zenz AG Sportmanager: Michael Maurer (Vorsitz),
BSO-Sportmanager Die Führungskräfteausbildung im Sport CURRICULUM BASIS in Kooperation mit Unterstützt von Koordination und Zusammenstellung: Erika König-Zenz AG Sportmanager: Michael Maurer (Vorsitz),
1. Bereich Didaktik der Arbeitslehre 2. Modulbezeichnung Basismodul: Einführung in die Didaktik und. 9. Qualifikationsziele und Kompetenzen
 1. Bereich Didaktik der Arbeitslehre 2. Modulbezeichnung Basismodul: Einführung in die Didaktik und Methodik des Lernbereichs Arbeit-Wirtschaft- Technik Arb LA M 01 3. Modulnummer 4. Verwendbarkeit Lehramt
1. Bereich Didaktik der Arbeitslehre 2. Modulbezeichnung Basismodul: Einführung in die Didaktik und Methodik des Lernbereichs Arbeit-Wirtschaft- Technik Arb LA M 01 3. Modulnummer 4. Verwendbarkeit Lehramt
A l l g e m e i n e I n f o r m a t i o n e n z u m L e h r p l a n
 Sport in der MSS Das Fach Sport ist in der Jahrgangsstufe -3 als Grund- oder Leistungsfach durchgängig zu belegen. Im Grundfach können nach Interesse Sportarten aus verschiedenen Sportartengruppen gewählt
Sport in der MSS Das Fach Sport ist in der Jahrgangsstufe -3 als Grund- oder Leistungsfach durchgängig zu belegen. Im Grundfach können nach Interesse Sportarten aus verschiedenen Sportartengruppen gewählt
Empfehlungen. Vorbereitende Gespräche mit den Personen, die als Trainer im UPTAKE-Projekt mitwirken wollen.
 Empfehlungen Die nachfolgenden Empfehlungen richten sich an Trainer, die am Projekt Uptake_ICT2life-cycle ( digitale Kompetenz und Inklusion für benachteiligte Personen) mitwirken: 1. Trainer Trainern
Empfehlungen Die nachfolgenden Empfehlungen richten sich an Trainer, die am Projekt Uptake_ICT2life-cycle ( digitale Kompetenz und Inklusion für benachteiligte Personen) mitwirken: 1. Trainer Trainern
Modulhandbuch. Studienfach Musik im Masterstudiengang mit Lehramtsoption Haupt-, Real- und Gesamtschulen
 Modulhandbuch Studienfach Musik im Masterstudiengang mit Lehramtsoption Haupt-, Real- und Gesamtschulen 1 Abkürzungen: EU Einzelunterricht GU Gruppenunterricht SE Seminar VO Vorlesung ÜB Übung WL Workload
Modulhandbuch Studienfach Musik im Masterstudiengang mit Lehramtsoption Haupt-, Real- und Gesamtschulen 1 Abkürzungen: EU Einzelunterricht GU Gruppenunterricht SE Seminar VO Vorlesung ÜB Übung WL Workload
Lehrplan - Deutsche Sprache
 Lehrplan - Deutsche Sprache Fachkompetenz Die Fähigkeit, in der deutschen Sprache zu kommunizieren, ist für Detailhandelsassistenten eine wesentliche Voraussetzung für ihre berufliche Tätigkeit und ihre
Lehrplan - Deutsche Sprache Fachkompetenz Die Fähigkeit, in der deutschen Sprache zu kommunizieren, ist für Detailhandelsassistenten eine wesentliche Voraussetzung für ihre berufliche Tätigkeit und ihre
Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik
 Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik Am Lehrstuhl Sport- und Gesundheitspädagogik sind folgende Abschlussarbeiten
Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik Am Lehrstuhl Sport- und Gesundheitspädagogik sind folgende Abschlussarbeiten
Lawinengefahrenmanagement im Alpinen Raum am Beispiel Tirol
 Lawinengefahrenmanagement im Alpinen Raum am Beispiel Tirol Lawinengefahrenmanagement im Alpinen Raum am Beispiel Tirol D Fläche von Tirol *12.640 km² Österreich * 83.879 km² Nordtirol Salzburg Bevölkerung
Lawinengefahrenmanagement im Alpinen Raum am Beispiel Tirol Lawinengefahrenmanagement im Alpinen Raum am Beispiel Tirol D Fläche von Tirol *12.640 km² Österreich * 83.879 km² Nordtirol Salzburg Bevölkerung
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Politikwissenschaft und Forschungsmethoden 4 2 S P WS 1.
 Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
VFV Wölbitsch Mario, MSc
 KINDERfußball vs ERWACHSENENfußball 12.11.2012 VFV Wölbitsch Mario, MSc 1 Kinderfußball vs Erwachsenenfußball Zwei völlig verschiedene Welten! Leider: Viele Trainer im Kinderfußball orientieren sich am
KINDERfußball vs ERWACHSENENfußball 12.11.2012 VFV Wölbitsch Mario, MSc 1 Kinderfußball vs Erwachsenenfußball Zwei völlig verschiedene Welten! Leider: Viele Trainer im Kinderfußball orientieren sich am
Profil für die Zusatzausbildungen für Ausbildende im Bereich Medienpädagogik/ICT
 4.2.2.7.1. Profil für die Zusatzausbildungen für Ausbildende im Bereich Medienpädagogik/ICT vom 10. Dezember 2004 Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), gestützt
4.2.2.7.1. Profil für die Zusatzausbildungen für Ausbildende im Bereich Medienpädagogik/ICT vom 10. Dezember 2004 Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), gestützt
Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in
 Anlage 13. Politikwissenschaft (35 ) Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in POL-BM-THEO Einführung in das Studium der Prof. Dr. Hans Vorländer politischen Theorie und Ideengeschichte Dieses
Anlage 13. Politikwissenschaft (35 ) Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in POL-BM-THEO Einführung in das Studium der Prof. Dr. Hans Vorländer politischen Theorie und Ideengeschichte Dieses
Verantwortlicher Dozent: Leiter des Instituts für musikalisches Lehren und Lernen (Prof. Dr. Wolfgang Lessing)
 Anlage 1 b Musikpädagogik 2 - IGP Orchesterinstrumente/Blockflöte Modulcode: MP 2 IGP O/B (BA MU) Lessing) Die Studierenden sind in der Lage, Instrumentalunterricht sowohl im Einzel- als auch im Gruppenunterricht
Anlage 1 b Musikpädagogik 2 - IGP Orchesterinstrumente/Blockflöte Modulcode: MP 2 IGP O/B (BA MU) Lessing) Die Studierenden sind in der Lage, Instrumentalunterricht sowohl im Einzel- als auch im Gruppenunterricht
Lernheft 5: Lernheft 6: Fachrichtungen und Anwendungsfächer. Lernheft 7: Lernheft 8: Nachbardisziplinen/ Hilfswissenschaften
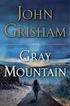 Pädagogik Inhaltsverzeichnis aller Lernhefte Lernheft 1: Ziele der Pädagogik/ Erziehungswissenschaften 1. 1 Einleitung 1. 2 Begrifflichkeiten 1. 3 Strukturmerkmale von Erziehung 1. 4 Pädagogik und Erziehungswissenschaften
Pädagogik Inhaltsverzeichnis aller Lernhefte Lernheft 1: Ziele der Pädagogik/ Erziehungswissenschaften 1. 1 Einleitung 1. 2 Begrifflichkeiten 1. 3 Strukturmerkmale von Erziehung 1. 4 Pädagogik und Erziehungswissenschaften
Übersicht: schulinterner Lehrplan im Fach Deutsch (Februar 2013)
 Übersicht: schulinterner Lehrplan im Fach Deutsch (Februar 2013) Jahrgang Thema Kompetenzen 5 1 Ein neuer Start 2 Umgang mit dem Wörterbuch Nutzen von Informationsquellen das Erzählen von Erzähltem oder
Übersicht: schulinterner Lehrplan im Fach Deutsch (Februar 2013) Jahrgang Thema Kompetenzen 5 1 Ein neuer Start 2 Umgang mit dem Wörterbuch Nutzen von Informationsquellen das Erzählen von Erzähltem oder
als Hauptfach (44 SWS), als Leitfach (24 SWS) oder als affines Fach (24 SWS)
 6. Abschnitt: Französisch als Hauptfach (44 SWS), als Leitfach (24 SWS) oder als affines Fach (24 SWS) 27 Aufbau und Inhalte Modul Beschreibung (lt. RPO I) Sprachliche Basiskompetenzen Sichere Basiskompetenzen
6. Abschnitt: Französisch als Hauptfach (44 SWS), als Leitfach (24 SWS) oder als affines Fach (24 SWS) 27 Aufbau und Inhalte Modul Beschreibung (lt. RPO I) Sprachliche Basiskompetenzen Sichere Basiskompetenzen
Bachelor of Arts Sozialwissenschaften und Philosophie (Kernfach Philosophie)
 06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
AUSBILDUNGSWESEN - LANDESLEHRTEAM SNOWBOARD. Ausbildung im NSV. - Snowboard Grundstufe - (= Trainer C-Lizenz Breitensport)
 Hallo lieber Grundstufenanwärter, Ausbildung im NSV - Snowboard Grundstufe - (= Trainer C-Lizenz Breitensport) mit den folgenden Informationen möchten wir Dir den Einstieg in das Lehrwesen (Grundstufe)
Hallo lieber Grundstufenanwärter, Ausbildung im NSV - Snowboard Grundstufe - (= Trainer C-Lizenz Breitensport) mit den folgenden Informationen möchten wir Dir den Einstieg in das Lehrwesen (Grundstufe)
Lehrplan Sport. genehmigt von der Schulkommission der Mittelschulen im Kanton Zug am 29. April 2015
 Lehrplan Sport genehmigt von der Schulkommission der Mittelschulen im Kanton Zug am 29. April 2015 Wirtschaftsmittelschule Zug Lüssiweg 24, 6302 Zug T 041 728 12 12 www.wms-zug.ch info@wms-zug.ch 29.4.2015
Lehrplan Sport genehmigt von der Schulkommission der Mittelschulen im Kanton Zug am 29. April 2015 Wirtschaftsmittelschule Zug Lüssiweg 24, 6302 Zug T 041 728 12 12 www.wms-zug.ch info@wms-zug.ch 29.4.2015
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Studiensemester. Leistungs -punkte 8 LP
 Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Hinweise. zu den Schulpraktischen Übungen im Fach Informatik und zum Verfassen von Stundenentwürfen. Lutz Hellmig
 Hinweise zu den Schulpraktischen Übungen im Fach Informatik und zum Verfassen von Stundenentwürfen Lutz Hellmig 1 Schulpraktische Übungen Die Lehrveranstaltung Schulpraktische Übungen (SPÜ) besteht aus
Hinweise zu den Schulpraktischen Übungen im Fach Informatik und zum Verfassen von Stundenentwürfen Lutz Hellmig 1 Schulpraktische Übungen Die Lehrveranstaltung Schulpraktische Übungen (SPÜ) besteht aus
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
LehrplanPLUS Gymnasium Geschichte Klasse 6. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Kompetenzorientierung
 Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
