Einfluss von Bodenwiderständen beim Hydraulischen Grundbruch
|
|
|
- Gundi Pfaff
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Einfluss von Bodenwiderständen beim Hydraulischen Grundbruch Robert-Balthasar Wudtke Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau Karl Josef Witt Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau Zusammenfassung Das Phänomen des Hydraulischen Grundbruches wird in der Geotechnik bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts untersucht. Die ersten entwickelten Berechnungsansätze bezogen sich auch aufgrund eingetretener Schadensfälle auf die Problematik im nichtbindigen Baugrund. Für bindigen Boden sind der Versagensablauf sowie die Berücksichtigung der mobilisierbaren Widerstände bisher nur in Ansätzen beschrieben. Der Grenzzustand des Hydraulischen Grundbruchs ist im bindigen Boden als Scherversagens oder als Rissentstehung modellierbar. Ein Strukturverlust des Bodenkontinuums, welcher bei nichtbindigem Boden dominant ist, wird für bindigen Boden bei realistischen Strömungsgradienten schon bei sehr geringer Kohäsion als Versagensmechanismus ausgeschlossen. Bis zum Erreichen des Grenzzustandes werden weitere Widerstände mobilisiert. Die Unterscheidung der Versagensarten hängt grundsätzlich vom vorherrschenden Spannungszustand im Boden, der Art, Stratifikation und Mächtigkeit der vorhandenen Bodenschichten und der hydraulischen Einwirkung ab. 1 Einführung Erste Ansätze zur Definition des Grenzzustandes eines Hydraulischen Grundbruches wurden durch Bligh [1] und Lane [2] aufgestellt. Hierbei wurde die durch Unterströmung verursachte Gefährdung von Deichen und Wehren auf einen im Boden verursachten Kriechvorgang zurückgeführt. Für umströmte Baugrubenwände im nichtbindigen Baugrund entwickelte Terzaghi in [3] einen Ansatz bei dem das Grenzgleichgewicht an einem definierten Kontrollvolumen ermittelt wird. Der durch Davidenkoff in [4] vorgestellte Ansatz zur Kalkulation des Grenzzustandes bezieht sich auf den größten in Abstromrichtung wirkenden mittleren hydraulischen Gradienten. Weitere Ansätze berücksichtigen zusätzlich die Schichtmächtigkeit des wasserführenden Bodenkontinuums, die Baugrubenbreite, die Einbindung der Baugrube in der wasserführenden Schicht sowie Effekte der durch Strömung verursachten Volumendehnung des Bodens [5]. Alle genannten Ansätze beziehen sich auf einen Hydraulischen Grundbruch in nichtbindigem Boden. Die Berücksichtigung kohäsiver Bodeneigenschaften ist bei der zurzeit gültigen Bemessungspraxis nicht durch einen gesonderten Bemessungsansatz vorgesehen. Speziell die Frage nach dem für unterschiedliche Spannungsverhältnisse, Arten hydraulischer Einwirkung und variierende bindige Bodeneigenschaften gültigen Grenzzustand sowie dessen Auswirkung auf das Nachweiskonzept ist damit nicht beantwortet. Weitere Einflüsse auf den Hydraulischen Grundbruch sind durch hydraulische Transportvorgänge wie Erosion, Suffosion und Kolmation gegeben. Eine durch einen Partikeltransport in oder am Bodenkontinuum verursachte Veränderung der Wasserwegsamkeiten hat durch die mögliche Steigerung der hydraulischen Einwirkung Einfluss auf den Grenzzustand im nichtbindigen und bindigen Baugrund. 2 Hydraulische Versagensformen Eine Analyse der zum Thema hydraulisch verursachter Versagensformen veröffentlichten Literatur zeigt ein mitunter unterschiedliches Verständnis vom Vorgang eines Hydraulischen Grundbruches. Dies ist vor allem der teilweise starken Kopplung des Phänomens zu speziellen Versagensfällen geschuldet und ist ein Indiz für die Notwendigkeit einer klaren Definition des Grenzzustandes in Abhängigkeit der Bodenart, der Bausituation und der hydraulischen Einwirkung. Entsprechend der aktuell gültigen Regelwerke tritt ein Hydraulischer Grundbruch dann ein, wenn bei einer lokalen Betrachtung des Grenzgleichgewichtes im nichtbindigen Boden die vorhandene Strömungskraft S, repräsentativ für die Einwirkungen, die Widerstände, gegeben durch das Bodeneigengewicht G, übersteigt. Für das Beispiel einer umströmten Baugrubenwand sind die aktivierten Kräfte exemplarisch in Abbildung
2 1 gegenübergestellt. Weitere Formen des hydraulisch verursachten Versagens an Baugrubenwänden sind die innere Erosion, der Erosionsgrundbruch (engl. Piping) und der Auftrieb. Speziell die Betrachtung des Hydraulischen Grundbruches im bindigen Boden führt zu weiteren Unterschieden im Bezug auf die genannten Versagensarten. 3 Bemessungspraxis Die Bemessung einer Baugrubensohle gegen Hydraulischen Grundbruch berücksichtigt nach der EAB [6] und der EAU 2004 [7] den Grenzzustand durch eine Gegenüberstellung von Bodeneigengewicht G k sowie zusätzlichen rückhaltenden Kräften und Strömungskraft S k. Entsprechend dem nach DIN 1054 [8] gültigen Ansatz ist der Grenzzustand wie folgt definiert: S γ G' γ (1) k H k G.stb Ein vereinfachter Berechnungsansatz definiert die Gleichgewichtsbetrachtung an einem diskreten Bodenelement, bei dem unter Berücksichtigung des maximal wirksamen hydraulischen Gradienten i die Gewichtslosigkeit im Bodenkontinuum (σ > 0) verhindert wird. ( i ) γ γ γ' γ (2) w H G.stb Abbildung 1: schematische Darstellung des Hydraulischen Grundbruches an einer Baugrubenwand Definitionsgemäß tritt ein Erosionsgrundbruch ein, wenn ein Partikeltransport, verursacht durch eine Strömung, an der freien Oberfläche einer Baugrubensohle initiiert wird. Entsprechend der Modellvorstellung tritt durch eine Verkürzung des Strömungsweges und dem einhergehenden lokalen Anstieg des hydraulischen Austrittsgradienten eine zunehmend beschleunigte Erosion entlang des Pfades der stärksten Strömung ein. Erreicht der Erosionskanal die Oberwasserseite, findet der Erosionsgrundbruch als großräumige Verflüssigung des Bodens statt und führt zum Kollaps der Konstruktion. Beim Versagen durch Auftrieb wird eine zusammenhängende Bodenschicht oder ein Bauteil, z. B. eine Baugrubensohle aus wasserundurchlässigen Beton oder eine Dichtungsschicht durch eine aufwärts gerichtete hydrostatische Einwirkung gewichtslos. Beim Nachweis ist die Berücksichtigung zusätzlicher Reibungswiderstände in den vertikalen Scherfugen zulässig. Obwohl den genannten Versagensarten der hydraulisch verursachte Stabilitätsverlust gemeinsam ist, unterscheiden sie sich deutlich in der Art des Grenzzustandes und dem Ablauf des Versagens. Hydraulischer Grundbruch und Auftrieb können vor allem durch das beim Versagen betrachtete Volumen und die Art der hydraulischen Einwirkung, hydrostatisch vs. hydrodynamisch, unterschieden werden. Erosionsgrundbruch und Hydraulischer Grundbruch werden durch eine Strömungsbelastung hervorgerufen. Sie sind im Grenzzustand jedoch an unterschiedlichen Orten definiert. Die unterschiedliche Wichtung von Einwirkungen und Widerständen wird durch die Teilsicherheitsbeiwerte γ H und γ G.stb gewährleistet. Die Parameter γ w und γ repräsentieren die Wichte des Wassers und des unter Auftrieb stehenden Bodens. Die den Gleichungen (1) und (2) zugrunde liegenden Berechnungsansätze gehen für die Berechnung des Grenzgleichgewichtes anhand von Kräften auf Erkenntnisse von Terzaghi [3] (siehe Abbildung 2) und für die Annahme der Verhinderung des Verlustes der effektiven Spannungen auf Davidenkoff [9] zurück. Bei einem Nachweis der Sicherheit nach EC 7 [10] steht neben der klassischen Gegenüberstellung der an einem Kontrollvolumen wirkenden Kräfte, die Betrachtung auf der Grundlage eines Spannungsgleichgewichtes zur Verfügung. Hierbei werden die totalen Spannungen, repräsentativ für die Widerstände den Einwirkungen als Porenwasserdrücke gegenübergestellt. Die zum Versagen führenden Strömungskräfte korrelieren mit der Empfindlichkeit des Bodens gegenüber einer Durchströmung. Bei einer Berechnung analog zu den Vorgaben der DIN 1054 [8] ist zur Berücksichtigung der Empfindlichkeit des Bodens hinsichtlich Erodibilität eine Unterscheidung des Einflusses der Strömungskräfte zwischen günstigem und ungünstigem Baugrund möglich. Hintergrund ist die Abhängigkeit der Partikelmobilisierung von der lokalen Volumendehnung und der Größe des zu transportierenden Kornes. Die in Terzaghi [3] angenommene Höhe des Kontrollvolumens ist vor dem Hintergrund der Untersuchungen zum Berechnungsansatz für nichtbindigen Baugrund
3 von Knaupe [11], welcher die Tiefe des entlang des Baugrubenverbaus hydraulisch beeinflussten Bereiches in Abhängigkeit des Strömungsnetzes darstellt, als kontrovers zu betrachten. Mit Zunahme des am Baugrubenverbau wirkenden hydraulischen Gradienten wird sich der Bereich in dem ein Verlust der effektiven Spannungen stattfindet, ausgehend vom Wandfuß richtungsunabhängig aufweiten. Die in der DIN 1054 [8] angenommene Dimension des Bruchkörpers deckt den beeinflussten Bereich damit nicht zwangsläufig ab. Bruchkörperbreite zu ermitteln. Der gleichzeitige Ansatz von Kohäsion und Zugfestigkeit ist aufgrund der zur vollen Aktivierung der Widerstände notwendigen unterschiedlichen Dehnungen nicht realistisch. Vereinfacht betrachtet wird erst nach dem Abriss in der horizontalen Fuge die volle Kohäsion in den vertikalen Scherfuge aktiviert. Der Ansatz lässt Effekte aus dem Ruhedruck und der Auflagerreaktion der Wand ebenfalls unberücksichtigt. Abbildung 2: Hydraulischen Grundbruch in nichtbindigem Boden (nach [12]) Bei keinem der in der Literatur aufgeführten Nachweise für nichtbindigen Boden werden Widerstände infolge einer Energiedissipation während der Volumendehnung oder eine Verspannung infolge einer Auflagerwirkung der Baugrubenwand berücksichtigt. Im Gegensatz zu der im nichtbindigen Baugrund festgestellten Gültigkeit des Grenzzustandes als Fluidisierung ist nach Wudtke & Witt [13] ein Versagen durch einen Partikeltransport bereits bei geringen Kohäsionen und realistischen hydraulischen Gradienten als nicht relevant einzustufen. Für die Kalkulation des Grenzzustandes im bindigen Boden wird nach DIN 1054 [8] die zusätzliche Berücksichtigung von Kohäsion und Zugfestigkeit empfohlen. Laut dem Ansatz von Davidenkoff [9] ist damit an einem Bruchkörper, der entlang der Tiefe der baugrubenseitigen Wand mit variabler Breite definiert ist, die Berücksichtigung der Kohäsion in den vertikalen Scherfugen und der Zugfestigkeit in der horizontalen Abrissebene möglich (siehe Abbildung 3). Im Zuge der Berechnung ist die kritischste Abbildung 3: Hydraulischer Grundbruch im bindigen Baugrund (nach [9]) Weitere Ansätze sind für bindigen Boden derzeit nicht verfügbar. Einige Regelwerke anderer Länder empfehlen Grundbruch- oder Verformungsberechnungen zur Analyse des Grenzzustandes. 4 Modellversuche Die Art und der Verlauf des hydraulisch verursachten Aufbruches einer Baugrubensohle im bindigen Boden sind bisher nur wenig bekannt. Der Einfluss von Kohäsion auf den Grenzzustand im bindigen Boden wurde bisher als Vergleich zum Versagen im nichtbindigen Baugrund nicht visualisiert. An der Materialforschungs- und Prüfanstalt der Bauhaus-Universität Weimar, Abteilung Geotechnik, wurden Versuche durchgeführt, um die Art des Grenzzustandes zu identifizieren und die Ergebnisse mit theoretischen Ansätzen zu vergleichen. Weitere Zielgrößen der Versuche waren der Versagensablauf, die Form des Aufbruches und die Identifikation von Indizien der Vorankündigung des Versagens.
4 3 Bildung eines Strömungskanals; Durch eine fortgesetzte aufwärts gerichtete schieferartige Zerlegung des Bodens entsteht ein Strömungskanal. Ausgehend vom Trennwandfuß erfährt der Boden einen Strukturverlust und wird in Aggregate zerlegt. Der Strömungskanal erreicht die Oberfläche. 4 Erosion des Bruchkörpers; Durch eine fortgesetzte Durchströmung wird der an der Trennwand liegende im Querschnitt parabelförmige Bruchkörper schrittweise erodiert. Abbildung 4: exemplarische Darstellung des Versuchsaufbaues Mit dem Ziel einer visuellen Dokumentation der Effekte wurden die Versuche in einem aus Plexiglas gefertigten Versuchsgerät durchgeführt (Abbildung 4). Als Versuchsboden wurde ein leichtplastischer Ton verwendet. Die in Laborversuchen ermittelten Scherparameter sind der Reibungswinkel ϕ = 35, die Kohäsion c = 12 kn/m² und die undrainierte Kohäsion c u = 79 kn/m². Im Anstrombereich war der Versuchsboden von einer hydraulisch nicht wirksamen Filterschicht überdeckt. Der Versuchsablauf kann in die Phasen der Versuchsvorbereitung (Einbau des Bodens und Installation der Messtechnik), der Sättigung, der einseitigen Drucksteigerung, dem Versagen und der Auswertung untergliedert werden. Obwohl für die Sättigung des Materials unterschiedliche Verweildauern vorgesehen waren und diverse Entlüftungstechniken getestet wurden, konnte der Boden aufgrund des großen zusammenhängenden Volumens nicht vollkommen gesättigt werden. Die Zunahme des Gradienten wurde während der einseitigen Drucksteigerungsphase an der Durchlässigkeit des Bodens orientiert. Wesentliches Ergebnis der Versuche ist die Gliederung des Versagensablaufes eines Hydraulischen Grundbruches in bindigem Boden in die folgenden vier Phasen: 1 Rissentstehung und Porenaufweitung; Ausgehend vom Trennwandfuß etabliert sich ein horizontal oder leicht geneigt verlaufender Riss. Gleichzeitig findet eine Volumendehnung des oberhalb liegenden Bodens statt. 2 Bildung der 1. Bruchscholle; Während sich der initiale Riss infolge einer Veränderung der hydraulischen Verhältnisse wieder schließt, entsteht eine erste aufwärts geneigte Bruchscholle, die jedoch mit ihrer Bruchfuge die abstromseitige Oberfläche nicht erreicht. Obwohl es durch die Versuche gelungen ist das Phänomen eines hydraulischen Grundbruchs im bindigen Boden visuell zu erfassen und die Abfolge des Versagens zu beschreiben, ist insbesondere die horizontale Ausbildung des initialen Risses bei dem während der Versuche existenten Spannungszustand untypisch für eine Baugrubensituation. Es konnte gezeigt werden, dass ein Scherbruch oder ein Rissversagen im Gegensatz zur Erosion (innere Erosion) dominant sind. Der oben beschriebene Ablauf des Versagens umfasst in einer kontinuierlichen Drucksteigerungsphase von 40 Tagen die letzten 9 Minuten. Auf der Abstromseite werden in der dem Versagen vorhergehenden Drucksteigerung nur relativ geringe gleichmäßige Hebung verursacht, die als Indiz für den bevorstehen Bruch gewertet werden können, jedoch in der Realität aufgrund ihrer einheitlichen Verteilung nur durch eine messtechnische Überwachung der Verformungen an der Baugrubensohle erfassbar sind. 5 Grenzzustand im bindigen Baugrund Bedeutendstes Ergebnis der Versuche zur Visualisierung eines Hydraulischen Grundbruches in bindigem Boden ist die Feststellung der Initiation des Versagens durch eine Rissentstehung. Die im nichtbindigen Boden zunächst lokal am Wandfuß eintretende und sich im Grenzgleichgewicht zur Baugrubensohle fortsetzende Verflüssigung des Bodens ist für bindigen Boden nicht relevant. Konform zur Definition des Grenzzustandes im nichtbindigen Boden durch den lokalen Verlust der effektiven Spannungen kann als konservativste Annahme die Grenzbedingung im bindigen Boden mit Eintritt der 1. Phase des Versagensablaufes, d. h. das Erreichen der Zugfestigkeit σ t bei einer Rissentstehung, gleichgesetzt werden. Ein Riss entsteht wenn die lokal kleinste effektive Spannung σ' 3 die Zugfestigkeit des Bodens erreicht: σ =σ ' (3) t 3 Die Kalkulation des Grenzgleichgewichtes geht im einfachsten Fall von der Modellvorstellung einer gleichmäßigen Volumendehnung an einer Pore aus (siehe [14]). Eine weitere Option besteht durch die Anwendung der Rissinitiationstheorie nach Griffith [15]. Eine fortgesetzte Aufschieferung des bindigen Bodens geht auf die Veränderung von Strömungswegen verursacht durch eine Volumendehnung in Verbindung mit
5 Sekundärrissen zurück. Im Versuch wurde während der Öffnung weiterer Risse der erste initiale Riss geschlossen. Die durch die Rissaufweitung zusätzlich kompensierte Einwirkung stellt einen weiteren bisher im Nachweis nicht berücksichtigten Effekt dar. Die Verformungsenergie kann nach den in Valkó [16] gezeigten Ansätzen erheblich sein. Die im weiteren Versagensablauf eintretende strukturelle Zerstörung des Bodenkontinuums, verursacht durch die Auflösung der Bindungskräfte zwischen den Aggregaten, und der finale Durchbruch zur Baugrubenseite markieren den Gesamtgrenzzustand der Tragfähigkeit des Bodens gegen die hydraulische Einwirkung. Während des Versagens entsteht eine zusammenhängende Bruchscholle. Die Annahme eines Starrkörperbruches mit diskreten Gleitflächen für die Berechnung des Grenzgleichgewichtes erscheint daher in erster Näherung plausibel. Die in den Trennflächen definierten Scherwiderstände und die Dimension des Bruchkörpers haben wesentlichen Einfluss auf den Gesamtwiderstand. 6 Numerische Analyse Abbildung 5: Gegenüberstellung numerische und analytische Berechnungsergebnisse Die während eines hydraulisch verursachten Versagens im bindigen Boden an einer Baugrubenwand eintretende Volumendehnung des durchströmten Bodens sowie durch die Aufschieferung verursachte Verformungseffekte werden entscheidend vom bindigen Charakter des Bodens beeinflusst. Um den Einfluss des Scherparameters Kohäsion auf die Sicherheit gegen den Hydraulischen Grundbruch darzustellen und weitere Analysen zur Bruchform durchzuführen, wurden diverse FE- Berechnungen mit dem Programm PLAXIS, Version 8.x, für eine Baugrubensituation durchgeführt. Ziel war es, für das FE-Modell die kritische Differenzdruckhöhe am Wandfuß Δh u zwischen dem inneren und dem äußeren Wasserstand in Abhängigkeit der Kohäsion zu ermitteln. Als Ergebnis der Berechnungen waren einerseits die durch Strömung verursachten Verformungen des Bodens und anderseits die Gesamtverformung inklusive der Widerlagerwirkung und der Stützung durch Konstruktionselemente auszugeben. Durch die Berechnungen konnte der Zusammenhang zwischen der Kohäsion des Bodens und der am Wandfuß möglichen kritischen Potenzialdifferenz Δh u dargestellt werden. Die Ergebnisse der FE-Simulation sind einer Kalkulation der kritischen Restdruckhöhe am Wandfuß bei Annahme eines vom Wandfuß ausgehenden Bruchkörpers mit parabolischer Bruchfläche (Abbildung 8), einer Bruchkörperbreite die der Wandeinbindung t = 2 m entspricht und bei Berücksichtigung von Kohäsion als zusätzlichen Widerstand gegen den Hydraulischen Grundbruch gegenübergestellt. Zur Berechung der analytischen Lösung wurde angenommen, dass die undrainierte Kohäsion dem Doppelten der effektiven Kohäsion entspricht. Abbildung 6: Bruchkörperanalyse bei hydraulischer Belastung des baugrubenseitigen Widerlagers; Kohäsion c = 5 kn/m² In Abbildung 5 wird deutlich, dass beim analytischen Ansatz die kritische Potenzialdifferenz am Wandfuß
6 geringer als bei der numerischen Berechnung ist und diese daher als vergleichsweise konservativ gewertet werden kann. Wesentlicher Grund für die bei der numerischen Analyse erreichte größere hydraulische Belastbarkeit ist die zusätzlich zu Eigengewicht und Scherwiderständen aktivierte Widerlagerwirkung der Wand, resultierend in einem passiven Erddruck. Diese Erkenntnis deckt sich mit den durch Perau [17] getroffenen Aussagen zur Widerlagerwirkung an Baugrubenwänden. Der Effekt hat in Abhängigkeit der Baugrubenbreite unterschiedlichen Einfluss auf den Nachweis. Die Ergebnisse konnten anhand von Spannungsund Verformungsanalysen bestätigt werden. Die Verträglichkeit von Strömungskräften bzw. Porenwasserüberdrücken nimmt mit der Kohäsion zu. Die Diskrepanz zwischen einer im Strömungsmodell lokal starken Variabilität der Einwirkungen und den in der bindigen Schicht angenommen gleichmäßigen Bodeneigenschaften führt bei zunehmender Kohäsion zu einer großflächigen Verteilung einer lokal starken Einwirkung. Mit Zunahme der Kohäsion zeigt die numerische Analyse eine Aufweitung der Scherzone. Die Form des Aufbruches deckt sich näherungsweise mit dem Verlauf der Stromlinien, die sich parabelförmig aus der Potenzialverteilung ergeben. 7 Bemessungsempfehlung Nach den oben genannten Ergebnissen kann festgestellt werden, dass der Hydraulische Grundbruch im nichtbindigen Boden durch Volumendehnung und Verflüssigung eintritt. Bei komplexen Situationen ist die Nachweisführung bei Verhinderung einer Gewichtslosigkeit entsprechend Gleichung (2) die konservativere aber in jedem Fall sichere Lösung. Auflagerreaktionen stellen Sicherheitsreserven dar, sollten aber beim Nachweis nicht berücksichtigt werden. Im bindigen Boden wird der Grenzzustand außerdem durch die zusätzlich aktivierbaren Widerständen und der Dimension des deformierten Bereiches bestimmt. Weiteren Einfluss auf die Richtung des initialen Risses hat der an der Konstruktion vorhandene Spannungszustand (siehe [18] und [19]). Bereits bei geringer Kohäsion ist eine Erosion aufgrund der Bindungskräfte zwischen den Aggregaten nicht mehr dominant. Der Grenzzustand wird als Scherbruch nach einem Rissversagen oder als zonale Deformation eintreten. Der Widerstand gegen eine Rissentstehung steigt im undrainierten Zustand mit Zunahme der Scherfestigkeit an (siehe [19]). Als Ergebnis der Analyse des Bruchphänomens, interpretiert als Starrkörperbruch an einer Baugrubenwand, kann in erster Näherung einen Bruchkörper, der im Boden durch eine parabelförmige Scherfuge begrenzt wird und am Wandfuß beginnt, betrachtet werden (Abbildung 7). Abbildung 7: Starrkörperversagen im bindigen Boden (nach [13]) Die im bindigen Boden zusätzlich vorhandenen Widerstände finden in diesem Nachweis durch die undrainierte Kohäsion in der Scherfuge Berücksichtigung. Durch die Konstruktion bedingte Widerstände, wie die Verspannung des baugrubenseitigen Widerlagers, sind im Nachweis nicht implementiert. Als Gegenüberstellung von Einwirkungen und Widerständen ist nach [19] das Grenzgleichgewicht wie folgt darstellbar: Δh t u γ ' A u γh + γg.stb γw γw t c (4) Der auf der Baugrubenseite bis zum Wandfuß wirksame mittlere hydraulische Gradient wird durch die Differenzdruckhöhe Δh u bezogen auf die Wandeinbindung t berücksichtigt. Die Bruchkörperbreite ist variabel definiert und wird durch den Faktor A berücksichtigt. Für A kann im bindigen Baugrund ein Wertebereich von 4,5 bis 6 angenommen werden. Da der volle Wert der undrainierten Kohäsion (undrainierter Reibungswinkel ϕ u = 0 ) erst bei einem Mindestüberlagerungsdruck aktiviert wird, kann alternativ als konservative Annahme die effektive Kohäsion c berücksichtigt werden. Danksagung Die vorgestellten experimentellen und analytischen Versuchsergebnisse und Untersuchungen zum Hydraulischen Grundbruch an einer Baugrubenwand im bindigen Baugrund sind Teil des aktuellen Forschungsprojektes Hydraulischer Grundbruch in bindigem Boden, das durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) gefördert wird. Wir möchten uns an dieser Stelle für die Unterstützung und die kooperative Zusammenarbeit bedanken.
7 Literatur [1] Bligh, W. G.: Dams, barrages and weirs on porous foundations. Engineering News, 64 (1910), [2] Lane, E. W.: Security from under-seepagemasonry dams on earth foundations. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 100 (1935), [3] Terzaghi, K.: Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage. Verlag F. Deutike, Leipzig und Wien, 1925 [4] Davidenkoff, R.: Deiche und Erddämme, Sickerströmung - Standsicherheit. Werner-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1964 [5] Knaupe, W.: Hydraulischer Grundbruch an Baugrubenumschließungen. Deutsche Bauenzyklopädie, Schriftenreihen der Bauforschung, Reihe Ingenieur- und Tiefbau, Heft 15, 1968 [15] Griffith, A. A.: The Phenomena of Rupture and Flow in Solids. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, containing Papers of a mathematical or physical Character, Vol. 221, , 1921 [16] Valkó, P.; Economides, M. J.: Hydraulic Fracture Mechanics. John Wiley & Sons, 1995 [17] Perau, E.: Hydraulischer Grundbruch und Versagen des Erdwiderlagers von Baugrubenwänden. Bautechnik, Vol. 82, Ernst & Sohn, , 2005 [18] Witt, K. J., Wudtke, R.-B.: Versagensmechanismen des Hydraulischen Grundbruchs an einer Baugrubenwand. 22. Christian Veder Kolloquium, Graz, 2007 [19] Wudtke, R.-B., Witt, K. J.: Phänomene des Hydraulischen Grundbruches an Baugrubenwänden. Johann-Ohde-Kolloquium, Hannover, 2007 [6] EAB Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben, 4. Auflage, Ernst & Sohn, Berlin, 2006 [7] EAU 2004 Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen Häfen und Wasserstraßen, 10. Auflage, Ernst & Sohn, Berlin, 2005 [8] DIN Baugrund Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau, Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 01/2005 [9] Davidenkoff, R.: Unterläufigkeit von Stauwerken. Werner-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1970 [10] Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik, Europäisches Komitee für Normung, 11/2004 [11] Knaupe W.: Hydraulischer Grundbruch an Baugrubenumschließungen. Deutsche Bauenzyklopädie, Schriftenreihen der Bauforschung, Reihe Ingenieur- und Tiefbau, Heft 15, 1968 [12] Terzaghi, K., Peck, R. B.: Die Bodenmechanik in der Baupraxis. Springer-Verlag, Berlin - Göttingen Heidelberg, 1961 [13] Wudtke, R.-B., Witt, K. J.: A Static Analysis of Hydraulic Heave in Cohesive Soil. 3rd International Conference on Scour and Erosion, Amsterdam, 2006 [14] Mitchell, J. K., Soga, K.: Fundamentals of Soil Behavior. John Wiley & Sons, 2005
Phänomene des Hydraulischen Grundbruches an einer Baugrubenwand
 Phänomene des Hydraulischen Grundbruches an einer Baugrubenwand Dipl.-Ing. Robert-Balthasar Wudtke, Prof. Dr.-Ing. Karl Josef Witt, Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau 1 Einführung Die Analyse
Phänomene des Hydraulischen Grundbruches an einer Baugrubenwand Dipl.-Ing. Robert-Balthasar Wudtke, Prof. Dr.-Ing. Karl Josef Witt, Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau 1 Einführung Die Analyse
Dr. R.-B. Wudtke, Prof. Dr. K. J. Witt, Universität Weimar Hydraulischer Grundbruch in bindigen Böden. 1 Problemstellung und Ziel
 Dr. R.-B. Wudtke, Prof. Dr. K. J. Witt, Universität Weimar Hydraulischer Grundbruch in bindigen Böden 1 Problemstellung und Ziel 1.1 Ingenieurwissenschaftliche Fragestellung und Stand des Wissens Die Auswirkungen
Dr. R.-B. Wudtke, Prof. Dr. K. J. Witt, Universität Weimar Hydraulischer Grundbruch in bindigen Böden 1 Problemstellung und Ziel 1.1 Ingenieurwissenschaftliche Fragestellung und Stand des Wissens Die Auswirkungen
Hydraulischer Grundbruch im bindigen Baugrund: Schadensmechanismen und Nachweisstrategie
 Hydraulischer Grundbruch im bindigen Baugrund: Schadensmechanismen und Nachweisstrategie Dipl.-Ing. Robert-Balthasar Wudtke, Prof. Dr.-Ing. Karl Josef Witt Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau,
Hydraulischer Grundbruch im bindigen Baugrund: Schadensmechanismen und Nachweisstrategie Dipl.-Ing. Robert-Balthasar Wudtke, Prof. Dr.-Ing. Karl Josef Witt Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau,
Johann-Ohde-Kolloquium
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN UND ca: "W BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU KARLSRUHE 37 _r-f q H1 HE _- Johann-Ohde-Kolloquium Praktische Probleme der Geotechnik im Verkehrswasserbau 15. November 2007 im Hannover
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN UND ca: "W BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU KARLSRUHE 37 _r-f q H1 HE _- Johann-Ohde-Kolloquium Praktische Probleme der Geotechnik im Verkehrswasserbau 15. November 2007 im Hannover
Karl J. Witt und Robert-B. Wudtke. Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau
 Witt, Wudtke 1 Versagensformen des Hydraulischen Grundbruches an einer Baugrubenwand Karl J. Witt und Robert-B. Wudtke Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau 1 Einführung Bereits seit Beginn des
Witt, Wudtke 1 Versagensformen des Hydraulischen Grundbruches an einer Baugrubenwand Karl J. Witt und Robert-B. Wudtke Bauhaus-Universität Weimar, Professur Grundbau 1 Einführung Bereits seit Beginn des
Feststofftransport Hydraulischer Grundbruch
 Feststofftransport Hydraulischer Grundbruch W. Wu 1 1 Hydraulischer Grundbruch (a) Hydraulischer Scherbruch (b) Verflüssigungsbruch (c) Erosionsbruch 2 2 Verflüssigungsbruch Bodenverflüssigung infolge
Feststofftransport Hydraulischer Grundbruch W. Wu 1 1 Hydraulischer Grundbruch (a) Hydraulischer Scherbruch (b) Verflüssigungsbruch (c) Erosionsbruch 2 2 Verflüssigungsbruch Bodenverflüssigung infolge
Nachweis des Hydraulischen Grundbruchs bei luftseitigem Auflastfilter - Grenzen der Anwendung des Nachweises
 Nachweis des Hydraulischen Grundbruchs bei luftseitigem Auflastfilter - Grenzen der Anwendung des Nachweises Dr.-Ing. Bernhard Odenwald und Dr.-Ing. Markus Herten Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Karlsruhe,
Nachweis des Hydraulischen Grundbruchs bei luftseitigem Auflastfilter - Grenzen der Anwendung des Nachweises Dr.-Ing. Bernhard Odenwald und Dr.-Ing. Markus Herten Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Karlsruhe,
Anwendung des Eurocodes 7 bei der Gründung von Brückenbauwerken. Dipl.-Ing. Holger Chamier
 Anwendung des Eurocodes 7 bei der Gründung von Brückenbauwerken Dipl.-Ing. Holger Chamier Inhalt 1. Normenübersicht 2. Änderung zur DIN 1054 : 2005 3. Bemessungssituationen 4. Grenzzustände 5. Teilsicherheitsbeiwerte
Anwendung des Eurocodes 7 bei der Gründung von Brückenbauwerken Dipl.-Ing. Holger Chamier Inhalt 1. Normenübersicht 2. Änderung zur DIN 1054 : 2005 3. Bemessungssituationen 4. Grenzzustände 5. Teilsicherheitsbeiwerte
Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN
 DIN 1054:2010-12 (D) Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1 Inhalt Seite Vorwort...6 1 Anwendungsbereich...8 2 Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1:2009-09...8
DIN 1054:2010-12 (D) Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1 Inhalt Seite Vorwort...6 1 Anwendungsbereich...8 2 Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1:2009-09...8
Vorwort zur 1. Auflage. Hinweise zum Gebrauch dieses Buches. 1 Einführung und Begriffe 1
 Vorwort zur 3. Auflage Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Hinweise zum Gebrauch dieses Buches V VI VII IX 1 Einführung und Begriffe 1 1.1 Historischer Rückblick 1 1.2 Anwendungsbereich 6 1.3
Vorwort zur 3. Auflage Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Hinweise zum Gebrauch dieses Buches V VI VII IX 1 Einführung und Begriffe 1 1.1 Historischer Rückblick 1 1.2 Anwendungsbereich 6 1.3
Vorwort zur 3. Auflage... V Vorwort zur 2. Auflage... VI Vorwort zur 1. Auflage... VII Hinweise zum Gebrauch dieses Buches... IX
 Vorwort zur 3. Auflage... V Vorwort zur 2. Auflage... VI Vorwort zur 1. Auflage... VII Hinweise zum Gebrauch dieses Buches... IX 1 Einführung und Begriffe... 1 1.1 Historischer Rückblick... 1 1.2 Anwendungsbereich...
Vorwort zur 3. Auflage... V Vorwort zur 2. Auflage... VI Vorwort zur 1. Auflage... VII Hinweise zum Gebrauch dieses Buches... IX 1 Einführung und Begriffe... 1 1.1 Historischer Rückblick... 1 1.2 Anwendungsbereich...
E 2-13 Verformungsnachweis für mineralische Abdichtungsschichten
 E 2-13 1 E 2-13 Verformungsnachweis für mineralische Abdichtungsschichten April 2010 1 Allgemeines Mineralische Abdichtungsschichten sollen sich gegenüber einwirkenden Setzungen unempfindlich verhalten
E 2-13 1 E 2-13 Verformungsnachweis für mineralische Abdichtungsschichten April 2010 1 Allgemeines Mineralische Abdichtungsschichten sollen sich gegenüber einwirkenden Setzungen unempfindlich verhalten
FuE-Projekt Deichwiderstand
 Dr.-Ing. Thomas Nuber Dipl.-Ing. Julia Sorgatz FuE-Projekt Deichwiderstand BAW-Kolloquium Dämme und Deiche Geotechnik BAW Hamburg, den 29.09.2016 Inhalt 1. Einleitung 2. Feld- und Laborversuche 3. Finite
Dr.-Ing. Thomas Nuber Dipl.-Ing. Julia Sorgatz FuE-Projekt Deichwiderstand BAW-Kolloquium Dämme und Deiche Geotechnik BAW Hamburg, den 29.09.2016 Inhalt 1. Einleitung 2. Feld- und Laborversuche 3. Finite
Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbruchs
 Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbruchs Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbruchs Dr.-Ing. Benjamin Aulbach 1 Einleitung Die Bestimmung der für die Sicherheit gegen
Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbruchs Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbruchs Dr.-Ing. Benjamin Aulbach 1 Einleitung Die Bestimmung der für die Sicherheit gegen
Dipl.-Ing. Philipp Schober, Universität der Bundeswehr München; Dr.-Ing. Bernhard Odenwald, Bundesanstalt für Wasserbau. 1 Einführung Introduction
 Der Einfluss eines Auflastfilters auf die Bruchmechanik beim hydraulischen Grundbruch Influence of a Surcharge Filter on the Failure Mechanisms during Hydraulic Heave Dipl.-Ing. Philipp Schober, Universität
Der Einfluss eines Auflastfilters auf die Bruchmechanik beim hydraulischen Grundbruch Influence of a Surcharge Filter on the Failure Mechanisms during Hydraulic Heave Dipl.-Ing. Philipp Schober, Universität
Numerische Analyse zur Sicherheit gegen den Aufbruch von Schachtsohlen unter hydraulischer Beanspruchung
 Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 50 37. Dresdner Wasserbaukolloquium 2014 Simulationsverfahren und Modelle für Wasserbau und Wasserwirtschaft 249 Numerische Analyse zur Sicherheit gegen den Aufbruch
Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 50 37. Dresdner Wasserbaukolloquium 2014 Simulationsverfahren und Modelle für Wasserbau und Wasserwirtschaft 249 Numerische Analyse zur Sicherheit gegen den Aufbruch
STUDIENANLEITUNG UNIVERSITÄRES TECHNISCHES FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN
 Bearbeitungsstand: April 2011 Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium STUDIENANLEITUNG UNIVERSITÄRES TECHNISCHES FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN - DIPLOM-PRÜFUNG / GRUNDFACHSTUDIUM - 1. Modul
Bearbeitungsstand: April 2011 Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium STUDIENANLEITUNG UNIVERSITÄRES TECHNISCHES FERNSTUDIUM BAUINGENIEURWESEN - DIPLOM-PRÜFUNG / GRUNDFACHSTUDIUM - 1. Modul
Vom DEK zur Lippe - Wasser auf Abwegen
 Vom DEK zur Lippe - Wasser auf Abwegen BDir Dr.-Ing. Markus Herten, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Referat Grundbau BORin Eva Dornecker, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Referat Grundbau 1 Einleitung
Vom DEK zur Lippe - Wasser auf Abwegen BDir Dr.-Ing. Markus Herten, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Referat Grundbau BORin Eva Dornecker, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Referat Grundbau 1 Einleitung
Einführung in die Boden- und Felsmechanik
 Jens Engel Carsten Lauer Einführung in die Boden- und Felsmechanik Grundlagen und Berechnungen Mit 212 Bildern und 85 Tabellen Fachbuchverlag Leipzig im Garl Hanser Verlag 6 --------------------------------------
Jens Engel Carsten Lauer Einführung in die Boden- und Felsmechanik Grundlagen und Berechnungen Mit 212 Bildern und 85 Tabellen Fachbuchverlag Leipzig im Garl Hanser Verlag 6 --------------------------------------
Scherfestigkeit und Steifigkeit
 Scherfestigkeit und Steifigkeit Dr.-Ing. Yahou Zou Geotechnik I, HT 017 Übung 4, 17.11.017 -- 1. Steifigkeit des Bodens 1.1 Ermittlung der Steifigkeit mittels eindimensionalen Kompressionsversuchs (DIN
Scherfestigkeit und Steifigkeit Dr.-Ing. Yahou Zou Geotechnik I, HT 017 Übung 4, 17.11.017 -- 1. Steifigkeit des Bodens 1.1 Ermittlung der Steifigkeit mittels eindimensionalen Kompressionsversuchs (DIN
Geohydraulische Nachweise zur Standsicherheit tiefer Baugruben
 Perau, Eugen (2010): Geohydraulische Nachweise zur Standsicherheit tiefer Baugruben, in: Beiträge zum RuhrGeo Tag 2010, Geotechnische Herausforderungen beim Umbau des Emscher-Systems, Ruhr-Universität
Perau, Eugen (2010): Geohydraulische Nachweise zur Standsicherheit tiefer Baugruben, in: Beiträge zum RuhrGeo Tag 2010, Geotechnische Herausforderungen beim Umbau des Emscher-Systems, Ruhr-Universität
Nachweis der Standsicherheit von Verbauwänden mittels Finite-Element-Methode bei kohäsiven Böden
 Zillmann, A.(2016): Nachweis der Standsicherheit von Verbauwänden mittels Finite-Element-Methode bei kohäsiven Böden. In: 34. Baugrundtagung, Forum für junge Geotechnik-Ingenieure, Beiträge der Spezialsitzung,
Zillmann, A.(2016): Nachweis der Standsicherheit von Verbauwänden mittels Finite-Element-Methode bei kohäsiven Böden. In: 34. Baugrundtagung, Forum für junge Geotechnik-Ingenieure, Beiträge der Spezialsitzung,
Zusammenfassung. Lehrstuhl und Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen (IWW) Mies-van-der-Rohe-Straße Aachen
 Zeichen: Au/Zie Datum: 30.03.2012 Zusammenfassung Aktenkennzeichen: P 52-5- 11.73.1-1351/09 Forschungsvorhaben: Forschende Stelle: Sicherheitsnachweise für den Hydraulischen Grundbruch - Erweiterung für
Zeichen: Au/Zie Datum: 30.03.2012 Zusammenfassung Aktenkennzeichen: P 52-5- 11.73.1-1351/09 Forschungsvorhaben: Forschende Stelle: Sicherheitsnachweise für den Hydraulischen Grundbruch - Erweiterung für
Institut für Geotechnik. Berechnung des Erddrucks nach: -DIN 4085: Baugrund-Berechnung des Erddrucks. -EAB 5.Auflage (2012)
 Prof. Dr.-Ing. Marie-Theres Steinhoff Erick Ulloa Jimenez, B.Sc. Berechnung des Erddrucks nach: -DIN 4085:2011-05 Baugrund-Berechnung des Erddrucks -EAB 5.Auflage (2012) WiSe 2014-2015 1 HOCHSCHULE BOCHUM
Prof. Dr.-Ing. Marie-Theres Steinhoff Erick Ulloa Jimenez, B.Sc. Berechnung des Erddrucks nach: -DIN 4085:2011-05 Baugrund-Berechnung des Erddrucks -EAB 5.Auflage (2012) WiSe 2014-2015 1 HOCHSCHULE BOCHUM
DIN DIN EN /NA. Ersatzvermerk. DEUTSCHE NORM Dezember Ersatzvermerk siehe unten ICS ;
 DEUTSCHE NORM Dezember 2010 DIN EN 1997-1/NA DIN ICS 91.010.30; 93.020 Ersatzvermerk siehe unten Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter- Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
DEUTSCHE NORM Dezember 2010 DIN EN 1997-1/NA DIN ICS 91.010.30; 93.020 Ersatzvermerk siehe unten Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter- Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Inhalt. DIN EN einschließlich Nationaler Anhang und DIN Nationales Vorwort DIN EN Vorwort EN Seite
 Inhalt DIN EN 1997-1 einschließlich Nationaler Anhang und DIN 1054 Nationales Vorwort DIN EN 1997-1 Vorwort EN 1997-1 il il Vorwort DIN EN 1997-1/NA 14 Vorwort DIN 1054 15 1 Allgemeines 17 1.1 Anwendungsbereich
Inhalt DIN EN 1997-1 einschließlich Nationaler Anhang und DIN 1054 Nationales Vorwort DIN EN 1997-1 Vorwort EN 1997-1 il il Vorwort DIN EN 1997-1/NA 14 Vorwort DIN 1054 15 1 Allgemeines 17 1.1 Anwendungsbereich
Die zeitabhängige Durchströmung von Dämmen
 Wechselwirkung Bauwerk Grundwasser Die zeitabhängige Durchströmung von Dämmen Einleitung Dr.-Ing. H. Montenegro, BAW Karlsruhe Dämme und Deiche stellen Erdbauwerke dar, die so dimensioniert werden müssen,
Wechselwirkung Bauwerk Grundwasser Die zeitabhängige Durchströmung von Dämmen Einleitung Dr.-Ing. H. Montenegro, BAW Karlsruhe Dämme und Deiche stellen Erdbauwerke dar, die so dimensioniert werden müssen,
Unbewehrtes Einzelfundament - Straßenbrücke Achse 80, Teil 1
 Einführung in den Grundbau Nachweise Teil 1 Übung 1.1-1, Flächengründung 2 Version: 25. Oktober 2015 Unbewehrtes Einzelfundament - Straßenbrücke Achse 80, Teil 1 Grundlagen, Aufgabenstellung Als Ergebnis
Einführung in den Grundbau Nachweise Teil 1 Übung 1.1-1, Flächengründung 2 Version: 25. Oktober 2015 Unbewehrtes Einzelfundament - Straßenbrücke Achse 80, Teil 1 Grundlagen, Aufgabenstellung Als Ergebnis
Musterbeispiele Grundwasser
 Aufgabe 1: Der Grundwasserspiegel liegt 1 m unter dem Bezugsniveau (OKT) und der gesättigte feinkörnige Boden hat ein Raumgewicht von γ g = 21 kn/m³. OKT h1 = 1 m 1) Wie gross ist die Druckhöhe, die Piezometerhöhe
Aufgabe 1: Der Grundwasserspiegel liegt 1 m unter dem Bezugsniveau (OKT) und der gesättigte feinkörnige Boden hat ein Raumgewicht von γ g = 21 kn/m³. OKT h1 = 1 m 1) Wie gross ist die Druckhöhe, die Piezometerhöhe
53U Erddruckberechnung
 Programmvertriebsgesellschaft mbh Lange Wender 1 34246 Vellmar BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 53U Erddruckberechnung Seite 1 53U Erddruckberechnung (Stand: 01.02.2008) Leistungsumfang Mit dem Programm
Programmvertriebsgesellschaft mbh Lange Wender 1 34246 Vellmar BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 53U Erddruckberechnung Seite 1 53U Erddruckberechnung (Stand: 01.02.2008) Leistungsumfang Mit dem Programm
EC 7 - Übersicht über Neuerungen und aktuelle Literatur
 EC 7 - Übersicht über Neuerungen und aktuelle Literatur H.-G. Gülzow, Fachhochschule Bielefeld, Campus Minden 1. Bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes 2. Das Normen-Handbuch 3. Übersicht über Neuerungen
EC 7 - Übersicht über Neuerungen und aktuelle Literatur H.-G. Gülzow, Fachhochschule Bielefeld, Campus Minden 1. Bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes 2. Das Normen-Handbuch 3. Übersicht über Neuerungen
Aufschwimmen und hydraulischer Grundbruch
 Dr.-Ing. B. Schuppener, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 1 Allgemeines Mit Aufschwimmen bezeichnet man das Anheben eines Bauwerks oder einer undurchlässigen Bodenschicht infolge der hydrostatischen
Dr.-Ing. B. Schuppener, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 1 Allgemeines Mit Aufschwimmen bezeichnet man das Anheben eines Bauwerks oder einer undurchlässigen Bodenschicht infolge der hydrostatischen
Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser
 Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser Questions due to Water-Soil-Interaction in unsaturated soils below water table H.-J. Köhler Bundesanstalt für Wasserbau
Fragestellungen aus der Wasser-Boden-Wechselwirkung im ungesättigten Boden unter Wasser Questions due to Water-Soil-Interaction in unsaturated soils below water table H.-J. Köhler Bundesanstalt für Wasserbau
B.Sc.-Modulprüfung Geotechnik I
 Geo- Institut und Versuchsanstalt für technik Fachbereich Bau- und Umwelt-ingenieurwissenschaften Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Franziska-Braun-Straße 7 64287 Darmstadt Tel. +49 6151 16 22810 Fax +49
Geo- Institut und Versuchsanstalt für technik Fachbereich Bau- und Umwelt-ingenieurwissenschaften Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Franziska-Braun-Straße 7 64287 Darmstadt Tel. +49 6151 16 22810 Fax +49
Statische Berechnung
 P fahlgründung Signalausleger Bauvorhaben: Objekt: Bahnhof Bitterfeld Signalausleger Diese Berechnung umfaßt 10 Seiten und gilt nur in Verbindung mit der statischen Berechnung Signalausleger, Bundesbahn-Zentralamt
P fahlgründung Signalausleger Bauvorhaben: Objekt: Bahnhof Bitterfeld Signalausleger Diese Berechnung umfaßt 10 Seiten und gilt nur in Verbindung mit der statischen Berechnung Signalausleger, Bundesbahn-Zentralamt
- 1 - Die Verwendung von Finiten Elementen bei Standsicherheitsnachweisen Berechnungsbeispiele. Dr.-Ing. Markus Herten Bundesanstalt für Wasserbau
 Die Verwendung von Finiten Elementen bei Standsicherheitsnachweisen Berechnungsbeispiele Dr.-Ing. Markus Herten Bundesanstalt für Wasserbau Gliederung 1. Definitionen und allgemeine Angaben 2. Standsicherheitsberechnung
Die Verwendung von Finiten Elementen bei Standsicherheitsnachweisen Berechnungsbeispiele Dr.-Ing. Markus Herten Bundesanstalt für Wasserbau Gliederung 1. Definitionen und allgemeine Angaben 2. Standsicherheitsberechnung
E 2-21 Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Deponiebasis
 E 2-21 1 E 2-21 Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Deponiebasis Stand: GDA 1997 1 Allgemeines Im Falle eines abgeböschten Deponiekörpers wirken entlang der Deponiebasis Schubspannungen,
E 2-21 1 E 2-21 Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Deponiebasis Stand: GDA 1997 1 Allgemeines Im Falle eines abgeböschten Deponiekörpers wirken entlang der Deponiebasis Schubspannungen,
Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbuchs Dr.-Ing. Benjamin Aulbach. Präsentation anlässlich des Spundwandseminars 2015 in Köln
 Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbuchs Dr.-Ing. Benjamin Aulbach Präsentation anlässlich des Spundwandseminars 2015 in Köln Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbruchs
Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbuchs Dr.-Ing. Benjamin Aulbach Präsentation anlässlich des Spundwandseminars 2015 in Köln Neue Formel für den Nachweis des hydraulischen Grundbruchs
Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration
 8. Juni 2006-1- Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration Für die folgende Präsentation wurden mehrere Folien aus einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing. Carsten Hauser übernommen, den er im
8. Juni 2006-1- Nachweis der Kippsicherheit nach der neuen Normengeneration Für die folgende Präsentation wurden mehrere Folien aus einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing. Carsten Hauser übernommen, den er im
Frischbetondruck bei Verwendung von Selbstverdichtendem Beton
 Frischbetondruck bei Verwendung von Selbstverdichtendem Beton Ein wirklichkeitsnahes Modell zur Bestimmung der Einwirkungen auf Schalung und Rüstung Vom Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie der Technischen
Frischbetondruck bei Verwendung von Selbstverdichtendem Beton Ein wirklichkeitsnahes Modell zur Bestimmung der Einwirkungen auf Schalung und Rüstung Vom Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie der Technischen
WANDDEFINITION (k) RECHENVERFAHREN
 Programm: Baugrubenverbau V 8.05.01 Datum: 03.11.2015 Seite 1 ANGABEN Charakteristische Werte werden in der Folge mit (k), Bemessungswerte (Design-Werte) mit (d) gekennzeichnet. Steht diese Kennzeichnung
Programm: Baugrubenverbau V 8.05.01 Datum: 03.11.2015 Seite 1 ANGABEN Charakteristische Werte werden in der Folge mit (k), Bemessungswerte (Design-Werte) mit (d) gekennzeichnet. Steht diese Kennzeichnung
Geotechnische Nachweise nach EC 7 und DIN 1054
 Geotechnische Nachweise nach EC 7 und DIN 1054 Einführung mit Beispielen Martin Ziegler Unter Mitarbeit von: Benjamin Aulbach Martin Feinendegen Marcus Fuchsschwanz Felix Jacobs Tobias Krebber Sylvia Kürten
Geotechnische Nachweise nach EC 7 und DIN 1054 Einführung mit Beispielen Martin Ziegler Unter Mitarbeit von: Benjamin Aulbach Martin Feinendegen Marcus Fuchsschwanz Felix Jacobs Tobias Krebber Sylvia Kürten
Grundfachklausur. Geotechnik. im WS 2011/2012. am
 Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Petersenstraße 13 64287 Darmstadt Tel. +49 6151 16 2149 Fax +49 6151 16 6683 E-Mail:
Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Petersenstraße 13 64287 Darmstadt Tel. +49 6151 16 2149 Fax +49 6151 16 6683 E-Mail:
Wahl der Berechnungsverfahren für Uferwände bei Ausbaumaßnahmen
 Wahl der Berechnungsverfahren für Uferwände bei Ausbaumaßnahmen am Beispiel der Berliner Wasserstraßen (UHW km 0,0 bis 4,0) Dr.-Ing. Anita Müller-Jahreis und Dipl.-Ing. Fritz Eißfeldt BAW - DH / 2004-05
Wahl der Berechnungsverfahren für Uferwände bei Ausbaumaßnahmen am Beispiel der Berliner Wasserstraßen (UHW km 0,0 bis 4,0) Dr.-Ing. Anita Müller-Jahreis und Dipl.-Ing. Fritz Eißfeldt BAW - DH / 2004-05
Neuauflage der Richtlinien Dichte Schlitzwände und Bohrpfähle
 Neuauflage der Richtlinien Dichte Schlitzwände und Bohrpfähle Einführung in die neuen Richtlinien DI Harald SCHMIDT Wien, 7.11.2013 Auf Wissen bauen 1 Anforderungsklassen Auf Wissen bauen 2 Zuordnung der
Neuauflage der Richtlinien Dichte Schlitzwände und Bohrpfähle Einführung in die neuen Richtlinien DI Harald SCHMIDT Wien, 7.11.2013 Auf Wissen bauen 1 Anforderungsklassen Auf Wissen bauen 2 Zuordnung der
Vergleichsberechnungen nach alter und neuer EAU
 Vergleichsberechnungen nach alter und neuer EAU BAW - DH / 2005-09 K1 Folie-Nr. 1 Dr.-Ing. Martin Pohl cand. ing. Ulrike Sandmann Gliederung Vergleich der Bemessungsansätze für Spundwände nach EAU 1990
Vergleichsberechnungen nach alter und neuer EAU BAW - DH / 2005-09 K1 Folie-Nr. 1 Dr.-Ing. Martin Pohl cand. ing. Ulrike Sandmann Gliederung Vergleich der Bemessungsansätze für Spundwände nach EAU 1990
B.Sc.-Modulprüfung 13-CO-M023 Geotechnik II
 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Franziska-Braun-Straße 7 64287 Darmstadt Tel. +49 6151 16 2149 Fax +49 6151
Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Franziska-Braun-Straße 7 64287 Darmstadt Tel. +49 6151 16 2149 Fax +49 6151
Schriftenreihe des Instituts fur Stahlbau der Universitat Hannover. Heft 23. Alexander Heise. Anschliisse von Stahlbauteilen an Brandwande
 Schriftenreihe des Instituts fur Stahlbau der Universitat Hannover Heft 23 Alexander Heise Anschliisse von Stahlbauteilen an Brandwande Shaker Verlag Aachen 2005 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Anschliisse
Schriftenreihe des Instituts fur Stahlbau der Universitat Hannover Heft 23 Alexander Heise Anschliisse von Stahlbauteilen an Brandwande Shaker Verlag Aachen 2005 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Anschliisse
Einleitung und Zielsetzung Europäische Normung Definition des Sicherheitsfaktors und Methoden der
 Nachweise für Böschungen und Baugruben mit numerischen Methoden, 16. und 17. OKTOBER 2003, WEIMAR Probleme bei Standsicherheitsnachweisen für Baugruben mittels FE-Methode AK 1.6 der DGGT Numerik in der
Nachweise für Böschungen und Baugruben mit numerischen Methoden, 16. und 17. OKTOBER 2003, WEIMAR Probleme bei Standsicherheitsnachweisen für Baugruben mittels FE-Methode AK 1.6 der DGGT Numerik in der
Bauen in Weichböden an Wasserstraßen Dammstandsicherheiten am Havelkanal
 Bauen in Weichböden an Wasserstraßen www.baw.de Gliederung Örtliche Situation und Baugrundverhältnisse Hochwasserstände Erdstatische Nachweise Projektspezifische Festlegungen Resultierende Sicherungsmaßnahmen
Bauen in Weichböden an Wasserstraßen www.baw.de Gliederung Örtliche Situation und Baugrundverhältnisse Hochwasserstände Erdstatische Nachweise Projektspezifische Festlegungen Resultierende Sicherungsmaßnahmen
PS Strukturgeologie II. Winter-Semester 2004/2005 Di Teil 5
 PS Strukturgeologie II Winter-Semester 2004/2005 Di 12.15 13.45 Teil 5 Klüfte Oberflächen von Klüften Federförmige Strukturen auf Kluftoberflächen Diese Strukturen zeigen, daß keine Bewegung auf den Kluftflächen
PS Strukturgeologie II Winter-Semester 2004/2005 Di 12.15 13.45 Teil 5 Klüfte Oberflächen von Klüften Federförmige Strukturen auf Kluftoberflächen Diese Strukturen zeigen, daß keine Bewegung auf den Kluftflächen
Scherfestigkeit von Böden
 Scherfestigkeit von Böden W. Wu 1 1 Scherfestigkeit von Böden Physikalische Ursachen: - Innere Reibung makroskopisches Auf- bzw. Abgleiten Umlagerungen der Bodenkörner bzw. Strukturänderungen Abrieb und
Scherfestigkeit von Böden W. Wu 1 1 Scherfestigkeit von Böden Physikalische Ursachen: - Innere Reibung makroskopisches Auf- bzw. Abgleiten Umlagerungen der Bodenkörner bzw. Strukturänderungen Abrieb und
3. Grundwasser in Baugruben 3.1 Wasserhaltung
 3.1 Wasserhaltung. 3. Grundwasser in Baugruben 3.1 Wasserhaltung Im Hinblick auf die unterschiedlichsten Erscheinungsformen des Wassers sind im Zusammenhang mit Baugruben im Wasser folgende Fälle zu unterscheiden:
3.1 Wasserhaltung. 3. Grundwasser in Baugruben 3.1 Wasserhaltung Im Hinblick auf die unterschiedlichsten Erscheinungsformen des Wassers sind im Zusammenhang mit Baugruben im Wasser folgende Fälle zu unterscheiden:
Bericht - Nr. 24 August 2002
 Bergische Universität Wuppertal Fachbereich Bauingenieurwesen Bodenmechanik und Grundbau Bericht - Nr. 24 August 2002 Bernd Bergschneider Zur Reichweite beim Düsenstrahlverfahren im Sand. Herausgegeben
Bergische Universität Wuppertal Fachbereich Bauingenieurwesen Bodenmechanik und Grundbau Bericht - Nr. 24 August 2002 Bernd Bergschneider Zur Reichweite beim Düsenstrahlverfahren im Sand. Herausgegeben
Experimentelle Hydromechanik Wehrüberfall und Ausfluss am Planschütz
 UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Wasserwesen Dr.-Ing. H. Kulisch Universitätsprofessor Dr.-Ing. Andreas Malcherek Hydromechanik und Wasserbau
UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Wasserwesen Dr.-Ing. H. Kulisch Universitätsprofessor Dr.-Ing. Andreas Malcherek Hydromechanik und Wasserbau
Bemessung von Stützbauwerken
 Bemessung von Stützbauwerken II/2.ppt 1 1 2 2 Erddruck 3 3 4 4 Aktiver Erddruck 5 5 6 6 Passiver Erddruck 7 7 8 8 Standsicherheitsnachweise für Stützmauern (a) Nachweis der äußeren Standsicherheit Grenzzustände:
Bemessung von Stützbauwerken II/2.ppt 1 1 2 2 Erddruck 3 3 4 4 Aktiver Erddruck 5 5 6 6 Passiver Erddruck 7 7 8 8 Standsicherheitsnachweise für Stützmauern (a) Nachweis der äußeren Standsicherheit Grenzzustände:
Erddruck Teil I. Dr.-Ing. Yazhou Zou. Geotechnik I, HT 2017 Übung 8,
 rddruck Teil I Dr.-Ing. Yazhou Zou Geotechnik I, HT 017 Übung 8, 11.1.017 1: rgänzung : Mindesterddruck -- Unter Berücksichtigung des influsses der ohäsion kann der aktive rddruck in Oberflächennähe sehr
rddruck Teil I Dr.-Ing. Yazhou Zou Geotechnik I, HT 017 Übung 8, 11.1.017 1: rgänzung : Mindesterddruck -- Unter Berücksichtigung des influsses der ohäsion kann der aktive rddruck in Oberflächennähe sehr
Bei Rettungsmaßnahmen im Rahmen
 Erdanker: Experimentelle Untersuchungen zum Trag- und Verformungsverhalten Teil 1 Einleitung Bei Rettungsmaßnahmen im Rahmen von Hilfeleistungseinsätzen können mit Hilfe von temporären Erdankern Festpunkte
Erdanker: Experimentelle Untersuchungen zum Trag- und Verformungsverhalten Teil 1 Einleitung Bei Rettungsmaßnahmen im Rahmen von Hilfeleistungseinsätzen können mit Hilfe von temporären Erdankern Festpunkte
Auftraggeber. Aufgestellt. Geprüft NRB Datum Dez Korrigiert MEB Datum April 2006
 Nr. OSM 4 Blatt 1 von 8 Index B Stainless Steel Valorisation Project BEMESSUNGSBEISPIEL 9 KALTVERFESTIGTES U-PROFIL UNTER BIEGUNG MIT ABGESTUFTEN, SEITLICHEN HALTERUNGEN DES DRUCKFLANSCHES, BIEGEDRILLKNICKEN
Nr. OSM 4 Blatt 1 von 8 Index B Stainless Steel Valorisation Project BEMESSUNGSBEISPIEL 9 KALTVERFESTIGTES U-PROFIL UNTER BIEGUNG MIT ABGESTUFTEN, SEITLICHEN HALTERUNGEN DES DRUCKFLANSCHES, BIEGEDRILLKNICKEN
Auftriebssicherheit, hydraulischer Grundbruch und hydraulischer Sohlbruch bei Baugruben mit natürlicher Sohldichtung
 Seite 1 Auftriebssicherheit, hydraulischer rundbruch und hydraulischer Sohlbruch bei Baugruben mit natürlicher Sohldichtung Betrachtungen zum Sicherheitsniveau Prof. Dr.-Ing. H. Harder, Bremen 1 Einleitung
Seite 1 Auftriebssicherheit, hydraulischer rundbruch und hydraulischer Sohlbruch bei Baugruben mit natürlicher Sohldichtung Betrachtungen zum Sicherheitsniveau Prof. Dr.-Ing. H. Harder, Bremen 1 Einleitung
Standsicherheitsnachweis von Dämmen und Deichen
 Standsicherheitsnachweis von Dämmen und Deichen Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley Dr.-Ing. Yazhou Zou Geotechnik im Hochwasserschutz Vorlesung 6, 8.05.018 -- Inhalt 1. Böschungsbruch, Ursachen und Verbesserungsmaßnahmen.
Standsicherheitsnachweis von Dämmen und Deichen Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley Dr.-Ing. Yazhou Zou Geotechnik im Hochwasserschutz Vorlesung 6, 8.05.018 -- Inhalt 1. Böschungsbruch, Ursachen und Verbesserungsmaßnahmen.
Ein erster Einblick in die Hypoplastizität Wolfgang Fellin, Innsbruck
 Ein erster Einblick in die Hypoplastizität Ein erster Einblick in die Hypoplastizität Wolfgang Fellin, Innsbruck Erschienen in der Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift (ÖIAZ), 44 Jg,
Ein erster Einblick in die Hypoplastizität Ein erster Einblick in die Hypoplastizität Wolfgang Fellin, Innsbruck Erschienen in der Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift (ÖIAZ), 44 Jg,
Geotechnische Wirkungsweise technischer und pflanzlicher Ufersicherungen
 Geotechnische Wirkungsweise technischer und pflanzlicher Ufersicherungen Inhalt Belastungen technischen Ufersicherungen lokale Standsicherheit Deckwerksbemessung pflanzliche Ufersicherungen 2/ Natürliche
Geotechnische Wirkungsweise technischer und pflanzlicher Ufersicherungen Inhalt Belastungen technischen Ufersicherungen lokale Standsicherheit Deckwerksbemessung pflanzliche Ufersicherungen 2/ Natürliche
Zusammenfassung für die praktische Anwendung. des. Projektes
 INSTITUT FÜR GEOTECHNIK UND GEOHYDRAULIK (IGG) Professor Dr.-Ing. H.-G. Kempfert Universität Kassel Mönchebergstraße 7 D-34125 Kassel geotech@uni-kassel.de Tel.: +49-561 804-2630 Fax: +49-561 804-2651
INSTITUT FÜR GEOTECHNIK UND GEOHYDRAULIK (IGG) Professor Dr.-Ing. H.-G. Kempfert Universität Kassel Mönchebergstraße 7 D-34125 Kassel geotech@uni-kassel.de Tel.: +49-561 804-2630 Fax: +49-561 804-2651
ANGABEN. WANDDEFINITION (k)
 Programm: Baugrubenverbau V 8.05.01 Datum: 03.11.2015 Seite 1 ANGABEN Charakteristische Werte werden in der Folge mit (k), Bemessungswerte (Design-Werte) mit (d) gekennzeichnet. Steht diese Kennzeichnung
Programm: Baugrubenverbau V 8.05.01 Datum: 03.11.2015 Seite 1 ANGABEN Charakteristische Werte werden in der Folge mit (k), Bemessungswerte (Design-Werte) mit (d) gekennzeichnet. Steht diese Kennzeichnung
Kurzfassung Großmaßstäbliche Laborversuche zum Verbundwerkstoff geogitterbewehrter Boden
 F. Jacobs u.a. Großmaßstäbliche Laborversuche Bautex 212 Chemnitz Kurzfassung Großmaßstäbliche Laborversuche zum Verbundwerkstoff geogitterbewehrter Boden Dipl.-Ing. Felix Jacobs, Dipl.-Ing. Axel Ruiken,
F. Jacobs u.a. Großmaßstäbliche Laborversuche Bautex 212 Chemnitz Kurzfassung Großmaßstäbliche Laborversuche zum Verbundwerkstoff geogitterbewehrter Boden Dipl.-Ing. Felix Jacobs, Dipl.-Ing. Axel Ruiken,
Prüfung im Fach Grundbau II
 BAUINGENIEURWESEN Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau Prof. Dr.-Ing. habil. Christos Vrettos Prüfung im Fach Grundbau II Masterstudiengang Bauingenieurwesen Wintersemester 2016/2017 17. März 2017 Name:
BAUINGENIEURWESEN Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau Prof. Dr.-Ing. habil. Christos Vrettos Prüfung im Fach Grundbau II Masterstudiengang Bauingenieurwesen Wintersemester 2016/2017 17. März 2017 Name:
Global- und Teilsicherheitskonzept bei der Ankerbemessung
 Global- und Teilsicherheitskonzept bei der Ankerbemessung Bundesanstalt für Wasserbau Dienststelle Hamburg Dr.-Ing. Martin Pohl BAW - DH / 2006-11 K1 Folie-Nr. 1 Gliederung Normen Vergleich der Bemessungsansätze
Global- und Teilsicherheitskonzept bei der Ankerbemessung Bundesanstalt für Wasserbau Dienststelle Hamburg Dr.-Ing. Martin Pohl BAW - DH / 2006-11 K1 Folie-Nr. 1 Gliederung Normen Vergleich der Bemessungsansätze
Grundbau und Bodenmechanik Übung Erddruck K.1
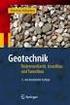 Übung Erddruck K.1 Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau K Erddruck K.1 Allgemeines Im Zusammenhang mit Setzungsberechnungen wurden bereits die im Boden wirksamen Vertikalspannungen
Übung Erddruck K.1 Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau K Erddruck K.1 Allgemeines Im Zusammenhang mit Setzungsberechnungen wurden bereits die im Boden wirksamen Vertikalspannungen
Geotechnike Bauwerke unter Erdbeben HADI DAABUL
 Geotechnike Bauwerke unter Erdbeben HADI DAABUL PRO.DR.ING.UWE DOKRA Gliederung : fundamente Pfähle Stützmauern Tunnel : Fundamente Pfähle Stützmauern Tunnel 1-Einleitung 2- Die Schäden A- Die Fundamente
Geotechnike Bauwerke unter Erdbeben HADI DAABUL PRO.DR.ING.UWE DOKRA Gliederung : fundamente Pfähle Stützmauern Tunnel : Fundamente Pfähle Stützmauern Tunnel 1-Einleitung 2- Die Schäden A- Die Fundamente
Erddruck Teil II. Dr.-Ing. Yazhou Zou. Geotechnik I, HT 2017 Übung 9,
 Erddruck Teil II Dr.-Ing. Yazhou Zou Geotechnik I, HT 2017 Übung 9, 15.12.2017 -2- Die Gewichtsstützwand dreht sich um den Wandfuß. Die Verteilung des aktiven Erddrucks hinter der Wand und des passiven
Erddruck Teil II Dr.-Ing. Yazhou Zou Geotechnik I, HT 2017 Übung 9, 15.12.2017 -2- Die Gewichtsstützwand dreht sich um den Wandfuß. Die Verteilung des aktiven Erddrucks hinter der Wand und des passiven
FE-Berechnung von Baugruben mit den Nachweisverfahren des EC7
 FE-Berechnung von Baugruben mit den Nachweisverfahren des EC7 Helmut F. Schweiger 1 Einleitung Mit Inkrafttreten des Eurocode 7 wird das Teilsicherheitskonzept in die europäische Normung eingeführt. Die
FE-Berechnung von Baugruben mit den Nachweisverfahren des EC7 Helmut F. Schweiger 1 Einleitung Mit Inkrafttreten des Eurocode 7 wird das Teilsicherheitskonzept in die europäische Normung eingeführt. Die
Inhaltsverzeichnis Band 1
 Inhaltsverzeichnis Band 1 1 Einführung 13 1.1 Entwicklung und Einordnung 13 1.2 Sachverständiger für Geotechnik 14 1.3 Baugrandinstitute und Baugrundgutachten 16 1.4 Baugrandrisiko und Verpflichtung des
Inhaltsverzeichnis Band 1 1 Einführung 13 1.1 Entwicklung und Einordnung 13 1.2 Sachverständiger für Geotechnik 14 1.3 Baugrandinstitute und Baugrundgutachten 16 1.4 Baugrandrisiko und Verpflichtung des
Sicherheitsnachweise für den Hydraulischen Grundbruch Erweiterung für den räumlichen Fall und für geschichteten sowie anisotropen
 Bauforschung Sicherheitsnachweise für den Hydraulischen Grundbruch Erweiterung für den räumlichen Fall und für geschichteten sowie anisotropen Boden T 3274 Fraunhofer IRB Verlag T 3274 Dieser Forschungsbericht
Bauforschung Sicherheitsnachweise für den Hydraulischen Grundbruch Erweiterung für den räumlichen Fall und für geschichteten sowie anisotropen Boden T 3274 Fraunhofer IRB Verlag T 3274 Dieser Forschungsbericht
DIN 1054: (D) Inhalt. Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau. Seite
 DIN 1054:2005-01 (D) Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau Inhalt Seite Vorwort...8 1 Anwendungsbereich...10 2 Normative Verweisungen...11 3 Begriffe und Formelzeichen...13 3.1 Begriffe...13
DIN 1054:2005-01 (D) Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau Inhalt Seite Vorwort...8 1 Anwendungsbereich...10 2 Normative Verweisungen...11 3 Begriffe und Formelzeichen...13 3.1 Begriffe...13
Die Umstellung auf den Eurocode 7
 Die Umstellung auf den Eurocode 7 Dr.-Ing. Michael Heibaum, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 1 Einführung Mitte des Jahres 2012 waren die Eurocodes (EC) bereit, bauaufsichtlich eingeführt zu werden.
Die Umstellung auf den Eurocode 7 Dr.-Ing. Michael Heibaum, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 1 Einführung Mitte des Jahres 2012 waren die Eurocodes (EC) bereit, bauaufsichtlich eingeführt zu werden.
Das neue BAW-Merkblatt zu Kornfiltern (MAK)
 Das neue BAW-Merkblatt zu Kornfiltern (MAK) Jan Kayser,, Karlsruhe Einführung Bereits in den 1980er Jahren wurden von der (BAW) im Merkblatt Anwendung von Kornfiltern an Bundeswasserstraßen (BAW, 1989)
Das neue BAW-Merkblatt zu Kornfiltern (MAK) Jan Kayser,, Karlsruhe Einführung Bereits in den 1980er Jahren wurden von der (BAW) im Merkblatt Anwendung von Kornfiltern an Bundeswasserstraßen (BAW, 1989)
Klausur Geotechnik II Donnerstag 6. Oktober Lösungsvorschlag. Nachname: Vorname: Matr.-Nr.
 Fachgebiet Geotechnik Prof. Dr.-Ing. W. Krajewski Prof. Dr.-Ing. O. Reul Dr. rer. nat. A. Bormann Klausur Geotechnik II Donnerstag 6. Oktober 2011 Lösungsvorschlag Nachname: Vorname: Matr.-Nr. 6 Blätter,
Fachgebiet Geotechnik Prof. Dr.-Ing. W. Krajewski Prof. Dr.-Ing. O. Reul Dr. rer. nat. A. Bormann Klausur Geotechnik II Donnerstag 6. Oktober 2011 Lösungsvorschlag Nachname: Vorname: Matr.-Nr. 6 Blätter,
Sicherheitsnachweise für axial belastete Bohrpfähle
 - 1 - Sicherheitsnachweise für axial belastete Bohrpfähle Thomas Wolff, Karl Josef Witt 1. Grundlagen und egelwerke Durch einen globalen Sicherheitsfaktor tragen die bisher gültigen Normen DIN 4014 (1990-03)
- 1 - Sicherheitsnachweise für axial belastete Bohrpfähle Thomas Wolff, Karl Josef Witt 1. Grundlagen und egelwerke Durch einen globalen Sicherheitsfaktor tragen die bisher gültigen Normen DIN 4014 (1990-03)
Gebrauchstauglichkeit. 1 Nachweiskonzept für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)
 Gebrauchstauglichkeit 1 Nachweiskonzept für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) Die Grundlage für das gesamte Sicherheitskonzept bildet der EC 0 ( Grundlagen der Tragwerksplanung ). Konkrete
Gebrauchstauglichkeit 1 Nachweiskonzept für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) Die Grundlage für das gesamte Sicherheitskonzept bildet der EC 0 ( Grundlagen der Tragwerksplanung ). Konkrete
Untersuchungsbericht über den Rissverlauf im Dachgeschoß vom Objekt
 Untersuchungsbericht über den Rissverlauf im Dachgeschoß vom Objekt Objekt- Nr.XXXXXXXXXXXXXXXXWohnung :35 1.Inhaltsverzeichnis NR. Abschnitt Seite Inhaltverzeichnis 1 Auftraggeber des Gutachtens 2 Ortsbesichtigung
Untersuchungsbericht über den Rissverlauf im Dachgeschoß vom Objekt Objekt- Nr.XXXXXXXXXXXXXXXXWohnung :35 1.Inhaltsverzeichnis NR. Abschnitt Seite Inhaltverzeichnis 1 Auftraggeber des Gutachtens 2 Ortsbesichtigung
Flachgründungen: Kippen und Gleiten
 Flachgründungen: Kippen und Gleiten Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley Dr.-Ing. Yazhou Zou Geotechni II Vorlesung am 12.04.2018 -2- Inhalt 1.1 Gleiten 1.2 Beispiele 1.3 Nachweis gegen Gleiten 1.4 Erddrucreduzierung
Flachgründungen: Kippen und Gleiten Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley Dr.-Ing. Yazhou Zou Geotechni II Vorlesung am 12.04.2018 -2- Inhalt 1.1 Gleiten 1.2 Beispiele 1.3 Nachweis gegen Gleiten 1.4 Erddrucreduzierung
Erddruckberechnung EDB. FRILO Software GmbH Stand:
 Erddruckberechnung EDB FRILO Software GmbH www.frilo.de info@frilo.eu Stand: 07.07.2015 EDB Erddruckberechnung - EDB Inhaltsverzeichnis Anwendungsmöglichkeiten 4 Berechnungsgrundlagen 4 Systemeingaben
Erddruckberechnung EDB FRILO Software GmbH www.frilo.de info@frilo.eu Stand: 07.07.2015 EDB Erddruckberechnung - EDB Inhaltsverzeichnis Anwendungsmöglichkeiten 4 Berechnungsgrundlagen 4 Systemeingaben
Innovative Bauweisen zur Sicherung von Geländesprüngen
 VSVI-Seminar Nr. 08.2013, 14.02.2013, Detmold Innovative Bauweisen zur Sicherung von Geländesprüngen Leitung: Prof. Dr.-Ing. Carsten Schlötzer Dr.-Ing. Antje Müller-Kirchenbauer 14.02.2013 VSVI-Seminar
VSVI-Seminar Nr. 08.2013, 14.02.2013, Detmold Innovative Bauweisen zur Sicherung von Geländesprüngen Leitung: Prof. Dr.-Ing. Carsten Schlötzer Dr.-Ing. Antje Müller-Kirchenbauer 14.02.2013 VSVI-Seminar
Diplomarbeit. Erarbeitung einer Aufgabensammlung Geotechnik
 Bauhaus - Universität Weimar Fakultät Bauingenieurwesen Professuren Grundbau und Bodenmechanik Diplomarbeit Erarbeitung einer Aufgabensammlung Geotechnik eingereicht von Marco Zimmermann geboren am 09.01.1977
Bauhaus - Universität Weimar Fakultät Bauingenieurwesen Professuren Grundbau und Bodenmechanik Diplomarbeit Erarbeitung einer Aufgabensammlung Geotechnik eingereicht von Marco Zimmermann geboren am 09.01.1977
Der Einfluss von Kanalbildungen auf die hydraulische
 Der Einfluss von Kanalbildungen auf die hydraulische Grundbruchsicherheit. 1 Der Einfluss von Kanalbildungen auf die hydraulische Grundbruchsicherheit. olfgang Fellin, Frank Kellermann, Theo ilhelm Erschienen
Der Einfluss von Kanalbildungen auf die hydraulische Grundbruchsicherheit. 1 Der Einfluss von Kanalbildungen auf die hydraulische Grundbruchsicherheit. olfgang Fellin, Frank Kellermann, Theo ilhelm Erschienen
Nutzen der Beobachtungsmethode nach EC 7. - DIN EN Beispiel - Zusammenfassung
 Dr.-Ing. Markus Herten www.baw.de - DIN 1054 - EN 1997-1 - Beispiel - Zusammenfassung 2 Grundlagen der geotechnischen Bemessung 2.7 Beobachtungsmethode DIN 1054 A ANMERKUNG zu (1) Die Beobachtungsmethode
Dr.-Ing. Markus Herten www.baw.de - DIN 1054 - EN 1997-1 - Beispiel - Zusammenfassung 2 Grundlagen der geotechnischen Bemessung 2.7 Beobachtungsmethode DIN 1054 A ANMERKUNG zu (1) Die Beobachtungsmethode
Grundfachklausur. Geotechnik. im SS am
 Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Petersenstraße 13 6487 Darstadt Tel. +49 6151 16 149 Fax +49 6151 16 6683 E-Mail: katzenbach@geotechnik.tu-darstadt.de
Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Institut und Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Petersenstraße 13 6487 Darstadt Tel. +49 6151 16 149 Fax +49 6151 16 6683 E-Mail: katzenbach@geotechnik.tu-darstadt.de
Fachvortrag zu Böden und Baugrund im Gebiet des Emsästuars
 Fachvortrag zu Böden und Baugrund im Gebiet des Emsästuars von Dr.-Ing. Günter Tranel Eriksen und Partner GmbH - Oldenburg von Dipl.-Ing. Ralf Schmitz Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH Oldenburg Landeskongress
Fachvortrag zu Böden und Baugrund im Gebiet des Emsästuars von Dr.-Ing. Günter Tranel Eriksen und Partner GmbH - Oldenburg von Dipl.-Ing. Ralf Schmitz Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH Oldenburg Landeskongress
Geotechnische Nachweise und Bemessung nach EC 7 und DIN 1054
 Geotechnische Nachweise und Bemessung nach EC 7 und DIN 1054 Conrad Boley (Hrsg.) Geotechnische Nachweise und Bemessung nach EC 7 und DIN 1054 Grundlagen und Beispiele Herausgeber Conrad Boley Neubiberg,
Geotechnische Nachweise und Bemessung nach EC 7 und DIN 1054 Conrad Boley (Hrsg.) Geotechnische Nachweise und Bemessung nach EC 7 und DIN 1054 Grundlagen und Beispiele Herausgeber Conrad Boley Neubiberg,
Prüfung im Modul Geotechnik III. im SS am
 Fachbereich Bauingenieurwesen un Geoäsie Institut un Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Petersenstraße 13 64287 Darmstat Tel. +49 6151 16 2149 Fax +49 6151 16 6683 E-Mail: katzenbach@geotechnik.tuarmstat.e
Fachbereich Bauingenieurwesen un Geoäsie Institut un Versuchsanstalt für Geotechnik Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach Petersenstraße 13 64287 Darmstat Tel. +49 6151 16 2149 Fax +49 6151 16 6683 E-Mail: katzenbach@geotechnik.tuarmstat.e
Klausur Geotechnik II Dienstag 16. Juli 2013
 1 Fachgebiet Geotechnik Klausur Geotechnik II Dienstag 16. Juli 2013 Nachname: Vorname: Matr.-Nr. 7 Blätter, 4 Aufgaben, insgesamt 60 Punkte. Für jede Aufgabe separates Blatt benutzen!!! Prüfungsdauer:
1 Fachgebiet Geotechnik Klausur Geotechnik II Dienstag 16. Juli 2013 Nachname: Vorname: Matr.-Nr. 7 Blätter, 4 Aufgaben, insgesamt 60 Punkte. Für jede Aufgabe separates Blatt benutzen!!! Prüfungsdauer:
E 2-19 Abfallmechanische Berechnungen für nicht bodenähnliche Abfälle
 E 2-19 1 E 2-19 Abfallmechanische Berechnungen für nicht bodenähnliche Abfälle Stand: GDA 1997 1 Allgemeines Bei abfallmechanischen Berechnungen ist gemäß E 2-6 zwischen bodenähnlichen Abfällen und nicht
E 2-19 1 E 2-19 Abfallmechanische Berechnungen für nicht bodenähnliche Abfälle Stand: GDA 1997 1 Allgemeines Bei abfallmechanischen Berechnungen ist gemäß E 2-6 zwischen bodenähnlichen Abfällen und nicht
Tipp 15/02. Schiefstellung Θi nach DIN EN : [1] in Verbindung mit DIN EN /NA: [2]
![Tipp 15/02. Schiefstellung Θi nach DIN EN : [1] in Verbindung mit DIN EN /NA: [2] Tipp 15/02. Schiefstellung Θi nach DIN EN : [1] in Verbindung mit DIN EN /NA: [2]](/thumbs/67/57212447.jpg) Tipp 15/02 Schiefstellung Θi nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 [1] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [2] Hinweis: Durch die bauaufsichtliche Einführung von [2] und die in [2] enthaltene inhaltliche
Tipp 15/02 Schiefstellung Θi nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 [1] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [2] Hinweis: Durch die bauaufsichtliche Einführung von [2] und die in [2] enthaltene inhaltliche
Diplomarbeit Pfähle mit kleinem Durchmesser - Technik, Anwendung, Tragverhalten
 Bauhaus - Universität Weimar Fakultät Bauingenieurwesen Professur Geotechnik Diplomarbeit Pfähle mit kleinem Durchmesser - Technik, Anwendung, Tragverhalten KURZFASSUNG Seite: 3 Kurzfassung Pfähle mit
Bauhaus - Universität Weimar Fakultät Bauingenieurwesen Professur Geotechnik Diplomarbeit Pfähle mit kleinem Durchmesser - Technik, Anwendung, Tragverhalten KURZFASSUNG Seite: 3 Kurzfassung Pfähle mit
Bauen im Bestand - Baugruben für den Neubau der Schleusen Münster
 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Conference Paper, Published Version Herten, Markus Bauen im Bestand - Baugruben für den Neubau der Schleusen Münster Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested Citation: Herten,
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Conference Paper, Published Version Herten, Markus Bauen im Bestand - Baugruben für den Neubau der Schleusen Münster Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested Citation: Herten,
Geotechnische Aspekte bei Schleusenbauwerken im Überblick
 Dr.-Ing. Martin Pohl Geotechnische Aspekte bei Schleusenbauwerken im Überblick BAWKolloquium Dienststelle Hamburg Hamburg, 24. September 2015 Überblick Steife Bohrpfahl Schlitzwand Unterwasserbetonsohle
Dr.-Ing. Martin Pohl Geotechnische Aspekte bei Schleusenbauwerken im Überblick BAWKolloquium Dienststelle Hamburg Hamburg, 24. September 2015 Überblick Steife Bohrpfahl Schlitzwand Unterwasserbetonsohle
