Bergahornwurzelsysteme im Auwald nach Pflanzung
|
|
|
- Achim Kohler
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bergahornwurzelsysteme im Auwald nach Pflanzung Das klassische Bergahornsortiment ist die Lohde. Als Arbeitstechnik kommt die Lochpflanzung infrage. Das hierfür eingesetzte Pflanzwerkzeug ist u. a. der Erdbohrer und in den letzten 10 Jahren die Hartmann Haue. In einem Auwald bei Freising wurde untersucht, wie sich die zwei verschiedenen auf die Wurzelentwicklung des Bergahorns (80 bis 100 ) auswirkten. Franz Binder, Johannes Langrehr, Joachim Stiegler, Bernd Stimm Im Auwald muss auf nährstoffreichen Substraten mit konkurrenzstarker krautiger Begleitvegetation gerechnet werden. Die Standorte neigen zur Verwilderung. Daher werden für die künstliche Begründung von Beständen im Auwald in der Regel die Laubholzsortimente Lohden (80 bis 150 ) und Heister (151 bis 250 ) [1] verwendet. Diesen wird nachgesagt, dass sie u. a. der Konkurrenzvegetation besser widerstehen, geringere Pflegekosten verursachen und weitere Pflanzverbände ermöglichen [1, 2]. Großpflanzen können zudem tiefer gesetzt werden als Normalpflanzen und ihre Wurzeln erhalten damit schneller Anschluss an das Grundwasser. Dies kann auch in der Aue mit ihrer kleinflächigen Variation der Standorte von Bedeutung sein. Als Nachteile dieser Sortimente werden in der Literatur u. a. ungünstigeres Wurzel/Sprossverhältnis und höhere Trocknisgefahr genannt [2]. Zudem sind sie teurer. Für die Verwendung von Großpflanzen wird eine adäquate Pflanztechnik vorausgesetzt. Dies ist im Regelfall eine Lochpflanzung mit dem Spaten oder auch mit motorgetriebenen Erdbohrern (z. B. ). Damit kann eine ausreichende Pflanzlochtiefe sichergestellt werden und eine Stauchung der Wurzel wird bei sorgfältiger Pflanzung vermieden s. [3]. Seit 1994 werden Großpflanzen auch mit der Hartmann Haue gepflanzt. Das Verfahren ist als [4, 5, 17] bekannt. Im Regelfall wird darunter ein Schrägpflanzverfahren [6] verstanden. Es wird in unterschiedlichen Varianten Abb. 1: Auen-Pararendzina (Ah-C-Profil) mit Meterstab; der Messergriff in der Profilwand charakterisiert den Übergang von Ah-Horizont zur Schicht II.C. Foto: J. Langrehr ausgeführt. Eine Variante nähert sich sehr stark der Lochpflanzung an bzw. wird auch zum Teil als solches bezeichnet [3]. Der Einfluss dieser Variante auf die Wurzelentwicklung wurde in diesem Versuch untersucht. Neben der Wahl des geeigneten s ist eine hochwertige Ausführung der Pflanzarbeiten für den Erfolg einer Bestandesbegründung entscheidend [7]. Beiden Einflüssen auf die Wurzelentwicklung ( und RhodenerVerfahren) / Pflanzqualität sollte am Beispiel des Bergahorns im Auwald bei Freising nachgegangen werden. Die unterschiedliche Pflanzqualität repräsentierte ein auf das spezialisierter Forstwirtschaftsmeister (FWM) von der ehemaligen Waldarbeitsschule Laubau und ein ausgebildeter Forstwirt. Im Jahr 2003, rund 10 Jahre nach Einführung des s in die Praxis, wurde daher von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) im Auwald eine Versuchsfläche angelegt, um die Wurzelentwicklung von Bergahorn nach Pflanzung mit der Hartmann Haue bzw. dem zu beurteilen. Beide Pflanzgeräte sollen sich für die Pflanzung von Großpflanzen (Tab. 1) eignen. In diesem Artikel werden die Ergebnisse zu den vorgestellt. In einem zweiten Artikel soll auf die Pflanzqualität eingegangen werden. Die Versuchsanlage liegt auf einer Höhe von 451 m im Auwald der Isar im Wuchsgebiet Schwäbisch-Bayerische Schotterplatten- und Altmoränenlandschaft, Wuchsbezirk Münchner Schotterebene, Teilwuchsbezirk Moose und Auen nördlich Münchens. Im Jahres- AFZ-DerWald 3/
2 Schneller Überblick Lochpfl anzung ist gängige Praxis bei der Pfl anzung von Lohden und Heistern Sie erfolgt i. d. R. mit dem Erdbohrer oder der Hartmann-Haue In einem Auwald wurde am Beispiel des Bergahorns untersucht, wie sich die beiden Verfahren auf die Wurzelentwicklung auswirken Dabei zeigte sich, dass sich die Wurzeln mit dem Erdbohrer besser entwickeln verlauf fallen durchschnittlich 750 bis 800 mm Niederschlag, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8 bis 8,5 C [8]. Als Bodentyp herrscht die Auen-Pararendzina (Ah-C-Profil) vor (Abb. 1). Der Boden wird bis zu einer Tiefe von 145 durchwurzelt [8]. Als Versuchsdesign wurde ein Blockdesign mit fünffacher Wiederholung gewählt [9]. Für einen Block wurden die erhobenen Daten im Rahmen einer Masterarbeit [8] ausgewertet. Die hier vorgestellten Ergebnisse werden derzeit durch keine Wiederholung bestätigt, da die Auswertung aus den anderen Blöcken noch nicht vorliegt. Ein Block setzt sich aus vier Parzellen zusammen. Jede Parzelle ist 2013 mit 50-jährigen Altpappeln bestockt und wurde zu Versuchsbeginn mit 110 Berg ahornen, Sortiment 1/1 (80 bis 100 ), Herkunft Süddeutsches Hügel- und Bergland der kollinen Stufe, aufgeforstet. Statistisch gesehen beinhaltet ein Block zwei Faktoren (, Pflanzqualität) mit je zwei Stufen. Im Jahr 2013 wurden 128 Wurzelsysteme ausgegraben (32 Wurzelsysteme pro Parzelle) und davon 106 für die Analyse der Wurzelsysteme herangezogen. und -geräte Lochpflanzung mit Erdbohrer Wurzellänge bis 25 bis 28 [7] bis [7] Den Wurzeln auf der Spur Die Wurzelsysteme wurden mit einem Kleinbagger ausgegraben. Diese Methode gehört zu den am häufigsten angewandten Verfahren zur Gewinnung von Wurzelsystemen [10]. Sie wird vorwiegend bei Untersuchungen eingesetzt, bei denen vor allem die Entwicklung der Grobwurzeln interessiert, da Wurzeln mit kleineren Durchmessern bei dieser Methode verloren gehen. Selbst bei vorsichtiger Vorgehensweise während der Ausgrabung Wurzeltiefe Sprosslänge Lochtiefe bis bis bis bis Tab. 1: Die Pflanzgeräte der Verfahren und ihre geeigneten Pflanzsortimente; verändert nach [8] Abb. 2: Wurzelmessschema [8]; Vertikalsektion 10--Stufen (0 bis 10, 10 bis 20 usw.), Horizontalsektion in 20--Klassen Abb. 3: Beispiele für Wurzelsystemtypen elfjähriger Bergahorne [8] kommt es jedoch auch bei der Grobwurzelmasse zu erheblichen Verlusten [10]. Das Verfahren bietet jedoch die Möglichkeit, mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand und damit noch kostengünstig viele Wurzelsysteme zu gewinnen. Von jedem Wurzelsystem wurden u. a. folgende Parameter erhoben: Wurzeldurchmesser, Wurzellänge, Grobwurzeltrockengewicht (lutro), Feinwurzeltrockengewicht (lutro), Trockengewicht nach Durchmesserklassen, Art der Wurzeldeformation und -stärke, Wurzelsystemtyp und Wurzelsystemausdehnung. Zur Erhebung dieser Wurzelparameter wurden verschiedene Verfahren angewandt [8] (Tab. 2). Mit dem Schichtebenenmodell kann das Wurzelsystem nach Quadranten, horizontalen Sektionen und vertikalen Ebenen erfasst werden (Abb. 2). Für die Ermittlung des Trockengewichtes der Einzelwurzeln nach Stärkeklassen Foto: J. Langrehr 26 AFZ-DerWald 3/2016
3 wurden die Definitionen nach [13] verwendet (beispielhaft Abb. 4). Abb. 4: Schematische Darstellung der Deformationen von Haupt- und Seitenwurzel mit realem Beispiel einer Hauptwurzeldeformation [8] Wurzeltrockengewicht (g) wurden die Wurzeln in Durchmesserklassen eingeteilt (Tab. 3). Die Analyse und Beschreibung des einzelnen Wurzelsystems erfasste den Wurzelsystemtyp, die Art der Deformation und deren Schichtebenenmodell (s. [8]) Stärke. Dazu wurde das Wurzelsystem auf eine Leine gehängt und einem der drei Grundtypen der Stockbewurzelung [12] zugeordnet. Für die Einschätzung der Deformationsart und -stärke Verfahren Voraussetzung Zweck unversehrtes, ausgegrabenes Wurzelsystem in seiner Gesamtheit ausreichend große Räumlichkeiten (abhängig von Wurzelsystemgröße) vertikale Ebenen Fotodokumentation ArcGIS Rhodener > 50 Durchmesserklassen (mm) Abb. 5: Mittlere Trockengewichte nach Durchmesserklassen in Sektion 1 (Abb. 2) in Abhängigkeit der Vorrichtung zum Fixieren der Wurzel, je nach Größe des Wurzelsystems muss ein entsprechender Abstand gegeben sein (Maßstabsverzerrung) ausreichende Bildauflösung Georeferenzierte Fotos Programmlizenz exakte, quantitative Erfassung des Wurzelsystems und dessen Bestandteile Einteilung in Quadranten, Sektionen und nachträgliche Messung Betrachtung und sonstige Ansprachen im Bild Einteilung in Quadranten, Sektionen und vertikalen Ebenen manuelle Messung der Tiefendurchwurzelung und horizontalen Ausdehnung der Wurzeln Tab. 2: Gegenüberstellung der eingesetzten Verfahren zur Erfassung der Wurzeln [8] Durchmesserfraktion Bezeichnung Funktion Ø > 50 mm Starkwurzeln Ø > 20 bis 50 mm Derbwurzeln Ø > 10 bis 20 mm Grobwurzeln im Grobwurzeln im Transport: Wasser und Nährstoffe engeren Sinn weiteren Sinn: Ø > 2 mm Verankerung Ø > 5 bis 10 mm Mittelwurzeln Ø > 2 bis 5 mm Schwachwurzeln Ø < 2 mm Feinwurzeln Feinwurzeln Aufnahme: Wasser u. Nährstoffe Tab. 3: Durchmesserklassen (nach [11]) Zustand der Wurzelsysteme Die Pflanzen wiesen im Jahr der Pflanzung über alle Parzellen hinweg keine signifikanten Höhenunterschiede auf. Die durchschnittliche Sprosslänge lag bei 100. Die durchschnittlichen Wurzelhalsdurchmesser der Pflanzen auf den Parzellen und unterschieden sich mit 1,3 bzw. 1,0 um 3 mm. Insgesamt handelt es sich jedoch um ein vergleichsweise homogenes Pflanzenmaterial. Neun Jahre nach Pflanzung liegt das durchschnittliche Grobwurzeltrockengewicht eines 11-jährigen, im Schnitt 6,70 m hohen Bergahorns, unabhängig von den und Pflanzqualitäten, mit 553 g bei etwas über einem halben Kilogramm, das Feinwurzeltrockengewicht bei rund 30 g. Der Anteil des Feinwurzeltrockengewichts am Wurzelsystem beträgt demnach rund 5 %. Dieser geringe Anteil an Feinwurzeln dürfte der vergleichsweisen groben Entnahme der Wurzelsysteme geschuldet sein. Die Wurzelsysteme der mit dem ausgebrachten Pflanzen wiegen, bezogen auf die Pflanzen des Rhodener Verfahrens, um rund 30 g mehr. Der Unterschied ist allerdings nicht signifikant. Das Trockengewicht der Wurzelsysteme konzentriert sich in der Sektion 1 (Abb. 2) in der Durchmesserklasse > 50 mm (Abb. 5). In dieser Durchmesserklasse zeigen sich auch die größten Unterschiede zwischen den. Die Wurzeln des s weisen in dieser Durchmesserklasse ein um 29 % höheres Gewicht auf als die des. Von Bedeutung ist aber vor allem auch die Verteilung der Wurzeln in der Tiefe. Beim erreichen noch 19 % der untersuchten Wurzelsysteme mindestens die Tiefenstufen 30 bis 40, beim Rhodener Verfahren sind es 13 %. Dies deutet auf eine Konzentration der Wurzeln in den ersten zwei Tiefenstufen hin. Das Trockengewicht in Abhängigkeit der Tiefenstufen (Vertikalsektionen, Abb. 2) spiegelt das zu einem gewissen Grad wider. So weisen die Bäume des s bis zu einer Tiefe AFZ-DerWald 3/
4 von 20 im Durchschnitt um 14 % höhere Wurzeltrockengewichte auf (Abb. 6). Das kehrt sich in der Tiefenstufe (20 bis 30 ) um (Abb. 6) und könnte die Folge von Deformationen sein. Wer hat die Nase vorn? Tiefe Wenn Bäume nicht in der Lage sind, ihr arteigenes Wurzelsystem halbwegs gut auszubilden, erhöht sich im Alter die Gefahr von Sturmwürfen. Je flacher sie wurzeln desto gefährdeter sind sie. Daher ist die vertikale und horizontale Ausdehnung der Wurzelsysteme von besonderer Bedeutung. Die mittlere vertikale Wurzelerstreckung ist bei den Bäumen, die mit dem gesetzt wurden, im Vergleich zum um rund 8 (16 %) größer (Abb. 7). Dieser Unterschied ist für diese Fläche statistisch abgesichert. In der horizontalen Ausdehnung unterscheiden sich die Wurzelsysteme nach nicht (Abb. 8). Die Pflanzlochwand, die bei beiden Verfahren etwa 20 vom Stammzentrum entfernt ist, stellt für das Wurzelsystem anscheinend kein Durchwurzelungshindernis dar (Abb. 8). Selbst bei sorgfältiger Pflanzung sind Wurzeldeformationen nie auszuschließen. In unserer Untersuchung wiesen 67 % aller untersuchten Wurzeln eine Deformation auf. Die dominierende Deformationsart ist die Stauchung. An den Hauptwurzeln wurde ausschließlich diese Deformationsart gefunden. Die Tiefe der Deformation liegt bei beiden im Bereich des Pflanzlochbodens (20 bis 30 ). Deformationen treten bei beiden in etwa gleich häufig auf. Allerdings zeigen sich signifikante Unterschiede bei der Häufigkeit des Auftretens von Haupt- und Seitenwurzeldeformationen (Abb. 4). Beim Rhodener Verfahren wiesen 70 % der Wurzelsysteme eine Hauptwurzeldeformation auf, dagegen waren es beim 58 %. Deformierte Seitenwurzeln seitliche Stauchung konnten nur beim beobachtet werden. Die Knollenbildung und Wurzelverdrehung traten an insgesamt drei Wurzelsystemen auf und sind damit recht selten. Sie kamen nur beim vor. Die Deformationen waren unterschiedlich stark ausgeprägt. Bei mit dem gepflanzten Bäumchen wurde an 38 % der Wurzelsysteme starke und extreme Deformationen angesprochen. Beim Rhodener Verfahren wies jedes zweite Wurzelsystem diese Deformationsstärke auf. Fazit: Bei der Stabilitätsicherung hat der wohl die Nase vorn. Wurzelsystemtyp Rhodener Verfahren N in % N in % Pfahlwurzel Flachwurzel Herzwurzel Tab. 4: Anzahl (N) Wurzelsystemtyp (Abb. 3) in Abhängigkeit des s [8] Trockengewicht (g) Abb. 6: Mittlere Wurzeltrockengewichte in den Vertikalsektionen in Sektion 1 in Abhängigkeit der [8] Tiefe () ,5 Max. Wurzeltiefe Beginn Schotter Abb. 7: Mittlere vertikale und maximale Wurzeltiefe sowie Beginn der Schotterschicht (Abb. 1) in Abhängigkeit der (die maximale Wurzeltiefe ist der Mittelwert aus der Summe der tiefsten Wurzeln pro Wurzelsystem) [8] 50,2 Auf dem Weg zum arttypischen Wurzelsystem Der Bergahorn bildet ein Herzsenkerwurzelsystem aus [14]. Das Herzsenkerwurzelsystem stellt dabei eine Mischform aus Herz- und Senkerwurzelsystem dar [13]. Es durchläuft mehrere Entwicklungsetappen und beginnt wie anfänglich bei allen Baumarten mit der Ausbildung einer Pfahlwurzel in der Jugendphase [14, 16], die nach zwei Jahren bereits bis in eine Tiefe von 50 vordringen kann. Seitenwurzeln werden erst nach vier Jahren gebildet und prägen das Wurzelbild ab dem Alter von 10 bis 15 Jahren. Die horizontale Ausdehnung reicht in diesem Alter bis 2 m. In dieser Phase stellt die Pfahlwurzel das Tiefenwachstum ein und 28 AFZ-DerWald 3/2016
5 beginnt verstärkt mit dem Dickenwachstum, sodass sie im Alter von 20 bis 25 Jahren nicht mehr als solche erkennbar ist. Das vollständige Herzsenkerwurzelsystem tritt ab dem Alter von 30 Jahren in Erscheinung. Köstler et al. [14] fanden in der Münchner Schotterebene, in der auch die Versuchsfläche liegt, auf hoch anstehendem Schotter ein eher kleines und unregelmäßiges Wurzelsystem bei Bergahornen. Innerhalb dieser 70 wurde der Boden allerdings sehr stark durchwurzelt. Die in der Literatur beschriebene Entwicklung wird bestätigt. Von den untersuchten Wurzelsystemen wurden 64 % dem in diesem Alter vorherrschenden Flachwurzel-, 26 % dem Pfahl- und 10 % dem Herzwurzeltyp (Abb. 3) zugeordnet. Das dem Bergahorn charakteristische Herzsenkersystem [14] wurde bei keinem der Wurzelsysteme gefunden. Allerdings tritt dies auch erst im Alter von ca. 30 Jahren in Erscheinung [8]. Bei beiden herrscht zwar der Flachwurzelsystemtyp vor, allerdings beim signifikant weniger oft als beim. Dies könnte darauf hinweisen, dass das eine oberflächliche Wurzelsystemausbildung fördert. Hinsichtlich der Baumstabilität wäre das eher negativ zu beurteilen. Schlussfolgerung Die hier dargestellten Ergebnisse beruhen auf der Analyse von Bergahornen eines Blocks aus einer Blockanlage mit fünf facher Wiederholung. Die Ergebnisse können also nur einen Trend aufzeigen. Literaturhinweise: [1] RÖHRIG, E.; GUSSONE, H. A. (1990): auf ökologischer Grundlage, zweiter Band Baumartenwahl, Bestandesbegründung und Bestandespflege, 6. Auflage. Verlag Paul Parey S [2] NIEDERSÄCHSISCHE LANDESFORSTEN (Hrsg.) (2005): Merkblatt Pflanzenqualität Empfehlungen für die Qualitätssicherung bei Bestellung, Abnahme und Behandlung forstlichen Pflanzgutes in den Nds. Landesforsten. [3] BAYERISCHE STAATS- FORSTEN (Hrsg.) (2012): handbuch Bayerische Staatsforsten Pflanzung im Bayerischen Staatswald Pflanzwerkzeuge und Pflanztechnik, [4] KÜNZI, C. (2003): Das Rhodener, wurzelgerechte Pflanzung, Wald und Holz 1/03 S [5] WALDARBEITSSCHULEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (Hrsg.) (1993): Der Forstwirt, 4. Auflage, Verlag Eugen Ulmer, S [6] BURSCHEL, P.; HUSS, J. (1997): Grundriß des s, 2. Auflage, Verlag Paul Parey S [7] WEINBERG, T.; DAHMER, J. (1998): und Bewurzelung von Laubholzpflanzen, Forsttechnische Informationen , [8] LANGREHR, J. (2014): Beurteilung der Wurzelentwicklung 11-jähriger Bergahorne nach Lochpflanzung in Auenwäldern, Masterarbeit, TU München, S [9] NÖRR, R. (2003a): Standardprüfverfahren und Bewurzelung (Teil B), unveröffentlicht. [10] BOLKENIUS, D. (2001): Zur Wurzelausbildung von Fichte (Picea abies L. [Karst]) und Weißtanne (Abies alba Mill.) in gleich- und ungleichaltrigen Beständen, in Forstwissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg und Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Hg.): Berichte Freiburger forstliche Forschung, Band 35, Freiburg, Eigenverlag der FVA. [11] BOLTE, A.; HERTEL, D.; AMMER, C.; SCHMID, I.; NÖRR, R.; KUHR, M.; REDDE, N. (2003): Freilandmethoden zur Untersuchung von Baumwurzeln, In: Forstarchiv 74, S [12] BIBELRIETHER, H. (1968): Die Bewurzelung einiger Baumarten in Abhängigkeit von Bodeneigenschaften, AFZ, Jg. 1968, S [13] NÖRR, R. (2003b): Wurzeldeformationen ein Risiko für die Bestandesstabilität? Entstehung, Entwicklung und Auswirkungen von Wurzeldeformationen, München, Frank (Forstliche Forschungsberichte München, 195). [14] KÖSTLER, J. N.; BRÜCKNER, E.; BIBELRIETHER, H. (1968): Die Wurzeln der Waldbäume, Untersuchungen zur Morphologie der Waldbäume in Mitteleuropa, Hamburg, Berlin, Paul Parey. [15] NORD- MANN, B. (2009): Wurzelwachstum des Bergahorns, in: Bayrische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) (Hg.): LWF Wissen, Berichte der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freising, Lerchl Druck (Beiträge zum Bergahorn, 62), S [16] KRAMER, H. (1988): Waldwachstumslehre, Hamburg, Berlin, Paul Parey, S [17] LEDER, B.; FORBRIG, A.; SCHMIDT-LANGENHORST, T. (2015): Verjüngung von Waldbeständen, AFZ-DerWald 18/2015, S Abstand von Stammachse () Mittlere horizontale Ausdehnung Maximale horizontale Ausdehnung Abb. 8: Mittlere und maximale horizontale Ausdehnung der Wurzelsysteme mit zunehmender Entfernung zur Stammachse in Abhängigkeit der [8] Um die Ergebnisse dieser Arbeit abzusichern, müssen weitere Auswertungen folgen. Der Boden, dem die Pflanzen entnommen wurden, kann insgesamt gesehen als gut durchwurzelbar charakterisiert werden. Eine vergleichsweise ungestörte Entwicklung der Wurzeln war damit möglich. Ein überprägender Einfluss des Grundwasserspiegels war nicht erkennbar (Abb. 1). Der Einfluss der auf die Wurzelentwicklung ist damit beurteilbar. Deformationen an den Wurzelsystemen kommen unabhängig vom an zwei Dritteln der untersuchten Pflanzen vor. Im Durchschnitt liegt die Tiefe der Deformation mit rund 25 bei beiden im Bereich des Pflanzlochbodens. Es kann somit festgehalten werden, dass neun Jahre nach Pflanzung die Wurzeldeformationen durch den Pflanzvorgang am Wurzelsystem noch ersichtlich sind. Allerdings ist das mit der höheren Anzahl an Wurzelsystemen mit Hauptwurzeldeformationen in dieser Hinsicht als schlechter zu bewerten, da die Entwicklung in die Tiefe eingeschränkt wird. Nach unseren Auswertungen weisen die Wurzeln der mit dem Rhodener Verfahren ausgebrachten Pflanzen bei den entscheidenden Parametern wie der Wurzeltiefe, der Wurzeldeformation und der Ausprägung des Wurzelsystemtyps schlechtere Werte auf als der, wenn auch die Unterschiede gering sind. Die Wurzel entwicklung der Pflanzen, die mit dem gepflanzt wurden, ist bei dem hier untersuchten Sortiment als besser einzuwerten als beim Rhodener Verfahren. Burschel und Huss [6] halten in ihrem Lehrbuch fest: das neue Spaltpflanzverfahren mit der Hartmann Haue erlaubt die Herstellung tiefer reichender Pflanzspalten, doch bleibt auch hier die Gefahr des Abknickens der Wurzeln bestehen. Das Verfahren hat diesbezüglich die Bewährungsprobe noch nicht bestanden [6]. Dem kann noch nicht, zumindest für das betrachtete Sortiment (80 bis 100 ), widersprochen werden. Eine Betrachtung des Wurzelzustandes bei 30 bis 40 Jahren alten Bäumen, also in 20 Jahren, erscheint sinnvoll. Dr. Franz Binder, Franz.Binder@lwf.bayern.de, ist Mitarbeiter in der Abteilung und Bergwald der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. AFZ-DerWald 3/
MERKBLATT 18. der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft November Starke Wurzeln stabile Wälder
 MERKBLATT 18 der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft November 2009 Starke Wurzeln stabile Wälder Drei Jahrhundertstürme innerhalb von 15 Jahren, immense Zwangsnutzungen durch nachfolgende
MERKBLATT 18 der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft November 2009 Starke Wurzeln stabile Wälder Drei Jahrhundertstürme innerhalb von 15 Jahren, immense Zwangsnutzungen durch nachfolgende
Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg Pflanzschulung
 Pflanzschulung Sachgerechte Pflanzung Ein guter Start für meinen Wald Programm: Pflanzung Naturverjüngung Klimawandel/Förderung Pflanzenqualität/frische Pflanzverfahren Wurzelschnitt Häufige Fehler Demonstration
Pflanzschulung Sachgerechte Pflanzung Ein guter Start für meinen Wald Programm: Pflanzung Naturverjüngung Klimawandel/Förderung Pflanzenqualität/frische Pflanzverfahren Wurzelschnitt Häufige Fehler Demonstration
Pflanzung ein Risiko für die Bestandesstabilität?
 Pflanzung ein Risiko für die Bestandesstabilität? Die Bedeutung wurzelschonender Pflanzung und ihre Umsetzung im Forstbetrieb Titelbild: Rechts: gute Wurzelentwicklung nach sachgerechter Pflanzung, links:
Pflanzung ein Risiko für die Bestandesstabilität? Die Bedeutung wurzelschonender Pflanzung und ihre Umsetzung im Forstbetrieb Titelbild: Rechts: gute Wurzelentwicklung nach sachgerechter Pflanzung, links:
Einbringung von Douglasie Regina Petersen
 Einbringung von Douglasie Regina Petersen Gliederung 1. Allgemeine Einführung 2. Ökophysilogische Grundlagen 3. Pflanzen- und Pflanzungsqualität 4. Konkurrenzvegetation 5. Containerpflanzen 6. Zusammenfassung
Einbringung von Douglasie Regina Petersen Gliederung 1. Allgemeine Einführung 2. Ökophysilogische Grundlagen 3. Pflanzen- und Pflanzungsqualität 4. Konkurrenzvegetation 5. Containerpflanzen 6. Zusammenfassung
Zur Wurzelausbildung von Fichte (Picea abies L. [Karst]) und Weißtanne (Abies alba Mill.) in gleich- und ungleichaltrigen Beständen
![Zur Wurzelausbildung von Fichte (Picea abies L. [Karst]) und Weißtanne (Abies alba Mill.) in gleich- und ungleichaltrigen Beständen Zur Wurzelausbildung von Fichte (Picea abies L. [Karst]) und Weißtanne (Abies alba Mill.) in gleich- und ungleichaltrigen Beständen](/thumbs/63/49361997.jpg) I BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 35 Zur Wurzelausbildung von Fichte (Picea abies L. [Karst]) und Weißtanne (Abies alba Mill.) in gleich- und ungleichaltrigen Beständen Bearbeitet von Dieter
I BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 35 Zur Wurzelausbildung von Fichte (Picea abies L. [Karst]) und Weißtanne (Abies alba Mill.) in gleich- und ungleichaltrigen Beständen Bearbeitet von Dieter
Leittext. für die. Berufsausbildung zum Forstwirt/zur Forstwirtin. Handpflanzung
 Leittext für die Berufsausbildung zum Forstwirt/zur Forstwirtin Handpflanzung Auszubildende/r Name Ausbildungsbetrieb Name Straße Straße PLZ, Ort PLZ, Ort Impressum Herausgegeben von der Landwirtschaftskammer
Leittext für die Berufsausbildung zum Forstwirt/zur Forstwirtin Handpflanzung Auszubildende/r Name Ausbildungsbetrieb Name Straße Straße PLZ, Ort PLZ, Ort Impressum Herausgegeben von der Landwirtschaftskammer
3 Holzvorräte in Bayerns Wäldern
 3 Holzvorräte in Bayerns Wäldern 3.1 Internationaler Vergleich Deutschland hat unter allen europäischen Ländern abgesehen von Russland die größten Holzvorräte (Abb.1). Die Voraussetzungen für die Forst-
3 Holzvorräte in Bayerns Wäldern 3.1 Internationaler Vergleich Deutschland hat unter allen europäischen Ländern abgesehen von Russland die größten Holzvorräte (Abb.1). Die Voraussetzungen für die Forst-
NATURWALDRESERVAT SCHORNMOOS
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren NATURWALDRESERVAT SCHORNMOOS Naturwaldreservat Schornmoos Am Übergang zwischen dem Wald und den offenen Moorflächen hat die Spirke den idealen Lebensraum.
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren NATURWALDRESERVAT SCHORNMOOS Naturwaldreservat Schornmoos Am Übergang zwischen dem Wald und den offenen Moorflächen hat die Spirke den idealen Lebensraum.
Einige Untersuchungen zur Selbststerilität und Inzucht bei Fichte und Lärche
 male Pflanzen. Da bis heute keinerlei Ergebnisse von Kreuzungsexperimenten vorliegen, die irgendwelche Einblicke in die Erbgänge der Lophodermium-Resistenz wie auch der Johannistriebbildung erlauben, erscheint
male Pflanzen. Da bis heute keinerlei Ergebnisse von Kreuzungsexperimenten vorliegen, die irgendwelche Einblicke in die Erbgänge der Lophodermium-Resistenz wie auch der Johannistriebbildung erlauben, erscheint
NATURWALDRESERVAT NEUKREUT
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rosenheim NATURWALDRESERVAT NEUKREUT Naturwaldreservat Neukreut An einem mit Moos bewachsenen Eschenstamm wächst auch ein Efeustämmchen empor. ALLGEMEINES
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rosenheim NATURWALDRESERVAT NEUKREUT Naturwaldreservat Neukreut An einem mit Moos bewachsenen Eschenstamm wächst auch ein Efeustämmchen empor. ALLGEMEINES
Waldbäume pflanzen das kann doch jeder!?
 Waldbäume pflanzen das kann doch jeder!? Leider ist dem nicht so. Obwohl am gleichen Tag mit der gleichen Qualität ausgeliefert, beklagen manche Waldbesitzer den kompletten Ausfall ihrer Pflanzen, während
Waldbäume pflanzen das kann doch jeder!? Leider ist dem nicht so. Obwohl am gleichen Tag mit der gleichen Qualität ausgeliefert, beklagen manche Waldbesitzer den kompletten Ausfall ihrer Pflanzen, während
Pflanzenproduktion und Versuchsdesign für Klonprüfungen der NW-FVA mit mikrovermehrten RENI-Hybriden (Juglans x intermedia)
 Pflanzenproduktion und Versuchsdesign für Klonprüfungen der NW-FVA mit mikrovermehrten RENI-Hybriden (Juglans x intermedia) Kurzvortrag Tagung der Interessengemeinschaft Nuss 19. Oktober 2017, Mosbach
Pflanzenproduktion und Versuchsdesign für Klonprüfungen der NW-FVA mit mikrovermehrten RENI-Hybriden (Juglans x intermedia) Kurzvortrag Tagung der Interessengemeinschaft Nuss 19. Oktober 2017, Mosbach
Nichtheimische Baumarten Gäste oder Invasoren? Warum stehen nichtheimische Baumarten in der Kritik? Friederike Ahlmeier
 Nichtheimische Baumarten Gäste oder Invasoren? Warum stehen nichtheimische Baumarten in der Kritik? Friederike Ahlmeier 01.07.2008 1 Gliederung Definition Invasionsprozess Geschichte Herkunft und Bedeutung
Nichtheimische Baumarten Gäste oder Invasoren? Warum stehen nichtheimische Baumarten in der Kritik? Friederike Ahlmeier 01.07.2008 1 Gliederung Definition Invasionsprozess Geschichte Herkunft und Bedeutung
Hintergrundinformationen zum Wald der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Hintergrundinformationen zum Wald der Ludwig-Maximilians-Universität München Thomas Knoke, Christoph Dimke, Stefan Friedrich Der Bayerische Kurfürst Max-Joseph gliederte per Erlass vom 8. April 1802 den
Hintergrundinformationen zum Wald der Ludwig-Maximilians-Universität München Thomas Knoke, Christoph Dimke, Stefan Friedrich Der Bayerische Kurfürst Max-Joseph gliederte per Erlass vom 8. April 1802 den
NATURWALDRESERVAT MANNSBERG
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg NATURWALDRESERVAT MANNSBERG Naturwaldreservat Mannsberg Selbst wenig Humus auf Kalkfelsen dient als Lebensgrundlage. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg NATURWALDRESERVAT MANNSBERG Naturwaldreservat Mannsberg Selbst wenig Humus auf Kalkfelsen dient als Lebensgrundlage. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
40 Jahre Bergmischwald
 40 Jahre Bergmischwald Reinhard Mosandl 40 Jahre Bergmischwald Picea abies Fagus silvatica Abies alba Acer pseudoplatanus JAHR EREIGNIS 1976 Anlage des Bergmischwaldversuches in den Chiemgauer Alpen im
40 Jahre Bergmischwald Reinhard Mosandl 40 Jahre Bergmischwald Picea abies Fagus silvatica Abies alba Acer pseudoplatanus JAHR EREIGNIS 1976 Anlage des Bergmischwaldversuches in den Chiemgauer Alpen im
NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET Naturwaldreservat Weiherbuchet Flache Terrassen und steile Wälle der Endmoräne prägen das Reservat. ALLGEMEINES
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET Naturwaldreservat Weiherbuchet Flache Terrassen und steile Wälle der Endmoräne prägen das Reservat. ALLGEMEINES
Die Stiel- und Traubeneichen
 Die Stiel- und Traubeneichen Stiel- und Traubeneichen sind im Weingartner Gemeindewald mit 11 Prozent an der Gesamtwaldfläche vertreten. Die Stieleiche stockt zumeist auf den kiesig-sandigen Böden im Rheintal.
Die Stiel- und Traubeneichen Stiel- und Traubeneichen sind im Weingartner Gemeindewald mit 11 Prozent an der Gesamtwaldfläche vertreten. Die Stieleiche stockt zumeist auf den kiesig-sandigen Böden im Rheintal.
Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz
 Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz Was versteht man unter einem Plenterwald? Bei einem Plenterwald existieren alle Entwicklungsstufen der Bäume nebeneinander. Dadurch entsteht auf kleinster Fläche eine
Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz Was versteht man unter einem Plenterwald? Bei einem Plenterwald existieren alle Entwicklungsstufen der Bäume nebeneinander. Dadurch entsteht auf kleinster Fläche eine
NATURWALDRESERVAT GÖPPELT
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weißenburg i. Bay. NATURWALDRESERVAT GÖPPELT Naturwaldreservat Göppelt Blick von Markt Berolzheim auf das Reservat. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Göppelt
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weißenburg i. Bay. NATURWALDRESERVAT GÖPPELT Naturwaldreservat Göppelt Blick von Markt Berolzheim auf das Reservat. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Göppelt
Die Einzelschutz im Wald - Erste Ergebnisse in Bulgarien
 UNIVERSITY OF FORESTRY SOFIA Die Einzelschutz im Wald - Erste Ergebnisse in Bulgarien Krasimira Petkova, Martin Sattler, Martin Borissov, Veselin Milov Ziel des Versuchs: Untersuchung über die Wirkung
UNIVERSITY OF FORESTRY SOFIA Die Einzelschutz im Wald - Erste Ergebnisse in Bulgarien Krasimira Petkova, Martin Sattler, Martin Borissov, Veselin Milov Ziel des Versuchs: Untersuchung über die Wirkung
Waldbau, Forstgeschichte, Ästhetik
 Modulkatalog Modulverantwortlich Prof. Dr. Heinsdorf Modulart Pflicht Angebotshäufigkeit Winter Regelbelegung / Empf. Semester 5. Semester Credits (ECTS) 8 Leistungsnachweis Prüfungsleistung Angeboten
Modulkatalog Modulverantwortlich Prof. Dr. Heinsdorf Modulart Pflicht Angebotshäufigkeit Winter Regelbelegung / Empf. Semester 5. Semester Credits (ECTS) 8 Leistungsnachweis Prüfungsleistung Angeboten
Bodendauerbeobachtung in Bayern Stand und Perspektiven
 Bodendauerbeobachtung in Bayern Stand und Perspektiven Das bayerische Dreigestirn Landesamt für Landesanstalt für Landwirtschaft Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Arbeitsschwerpunkte - Teilbeiträge
Bodendauerbeobachtung in Bayern Stand und Perspektiven Das bayerische Dreigestirn Landesamt für Landesanstalt für Landwirtschaft Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Arbeitsschwerpunkte - Teilbeiträge
Nährstoffverlagerung beim Harvestereinsatz
 Nährstoffverlagerung beim Harvestereinsatz 1 Referent: PD Dr. Christian Huber 1,4 Koautoren: Dr. Wendelin Weis 1, Prof. Dr. Dr. Axel Göttlein 1, Dr. Herbert Borchert 2, Dr. Johann Kremer 3, Prof. Dr. Dietmar
Nährstoffverlagerung beim Harvestereinsatz 1 Referent: PD Dr. Christian Huber 1,4 Koautoren: Dr. Wendelin Weis 1, Prof. Dr. Dr. Axel Göttlein 1, Dr. Herbert Borchert 2, Dr. Johann Kremer 3, Prof. Dr. Dietmar
Variation der Trockenstresswahrscheinlichkeit in Deutschland
 Variation der Trockenstresswahrscheinlichkeit in Deutschland Heike Puhlmann, Peter Hartmann Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Paul Schmidt-Walter Nordwestdeutsche Forstliche
Variation der Trockenstresswahrscheinlichkeit in Deutschland Heike Puhlmann, Peter Hartmann Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Paul Schmidt-Walter Nordwestdeutsche Forstliche
Ferme R. R. et Fils inc., Eric Rémillard, Saint-Michel, Québec, Kanada 2010
 Wissenschaftlicher Versuch Entwicklung von Karotten nach Saatgutbehandlung mit plocher pflanzen do Pascal Fafard, agr. Sandrine Seydoux, agr. Adrian Nufer, dipl. Natw. ETH Ferme R. R. et Fils inc., Eric
Wissenschaftlicher Versuch Entwicklung von Karotten nach Saatgutbehandlung mit plocher pflanzen do Pascal Fafard, agr. Sandrine Seydoux, agr. Adrian Nufer, dipl. Natw. ETH Ferme R. R. et Fils inc., Eric
Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme, Reihe A, Bd
 Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme, Reihe A, Bd. 67 1991 Ökologische Grundlagen für den Anbau der Großen Küstentanne (Abies grandis Lindl.) auf vernässten Böden von Yijun Xu Göttingen 1990
Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme, Reihe A, Bd. 67 1991 Ökologische Grundlagen für den Anbau der Großen Küstentanne (Abies grandis Lindl.) auf vernässten Böden von Yijun Xu Göttingen 1990
Bannwald "Zweribach"
 BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 31 Bannwald "Zweribach" Forstbezirk St. Märgen Wuchsgebiet Schwarzwald Einzelwuchsbezirk 3/09 Mittlerer Schwarzwald Erläuterungen zur Forstlichen Grundaufnahme
BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 31 Bannwald "Zweribach" Forstbezirk St. Märgen Wuchsgebiet Schwarzwald Einzelwuchsbezirk 3/09 Mittlerer Schwarzwald Erläuterungen zur Forstlichen Grundaufnahme
Erfolgsparameter in Schutzkonzepten und Abschlussberichten im Rahmen des Kooperationsmodells zum Trinkwasserschutz. Grundwasser Band 26
 Grundwasser Band 26 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Erfolgsparameter in Schutzkonzepten und Abschlussberichten im Rahmen des Kooperationsmodells zum Trinkwasserschutz
Grundwasser Band 26 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Erfolgsparameter in Schutzkonzepten und Abschlussberichten im Rahmen des Kooperationsmodells zum Trinkwasserschutz
Ist Totenasche ökologisch bedenklich für den Wald?
 Summary Ist Totenasche ökologisch bedenklich für den Wald? Bodenökologische Untersuchung der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Autoren der
Summary Ist Totenasche ökologisch bedenklich für den Wald? Bodenökologische Untersuchung der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Autoren der
Pflanzverfahren bei der Aufforstung
 Pflanzverfahren bei der Aufforstung Förster Ing. Johannes Ablinger Forstliche Ausbildungsstätte Ort / Gmunden Veranstaltungsreihe Waldwirtschaft für Einsteiger Modul F1 Gmunden 30. Juni 2016 Einleitung
Pflanzverfahren bei der Aufforstung Förster Ing. Johannes Ablinger Forstliche Ausbildungsstätte Ort / Gmunden Veranstaltungsreihe Waldwirtschaft für Einsteiger Modul F1 Gmunden 30. Juni 2016 Einleitung
Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014 N-Düngung von Winterweizen bei Trockenheit (Versuch 536) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Versuchsergebnisse aus Bayern 2008, 2011 und 2014 N-Düngung von Winterweizen bei Trockenheit (Versuch 536) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Schwermetalle in Waldböden
 Schwermetalle in Waldböden Auswertung der Bodenzustandserhebung in Thüringen Masterarbeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Studiengang Msc. Geoökologie Hannah Wächter und Michael Fleer Foto:
Schwermetalle in Waldböden Auswertung der Bodenzustandserhebung in Thüringen Masterarbeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Studiengang Msc. Geoökologie Hannah Wächter und Michael Fleer Foto:
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Versuchsergebnisse aus Bayern 2009 bis 2011
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2009 bis 2011 Einfluss von stabilisierten N-Düngern auf den und die Qualität von Winterweizen Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft
Versuchsergebnisse aus Bayern 2009 bis 2011 Einfluss von stabilisierten N-Düngern auf den und die Qualität von Winterweizen Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft
AUSZUG / AUSSCHNITTE
 AUSZUG / AUSSCHNITTE aus der KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ INSTITUT FÜR PFLANZENPHYSIOLOGIE A-8010 Graz, Schubertstraße 51 Leiter des Instituts: Ao. Univ. Prof. Dr. Guttenberger Februar 2004 Kurzfassung
AUSZUG / AUSSCHNITTE aus der KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ INSTITUT FÜR PFLANZENPHYSIOLOGIE A-8010 Graz, Schubertstraße 51 Leiter des Instituts: Ao. Univ. Prof. Dr. Guttenberger Februar 2004 Kurzfassung
DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI
 DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI Dagmar Bednárová, NLC LVÚ Zvolen Bernkastel Kues 04. 07. 6. 2013 Aus der Historie der Zulassung 1938 erste Vorschrift über die Zulassung
DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI Dagmar Bednárová, NLC LVÚ Zvolen Bernkastel Kues 04. 07. 6. 2013 Aus der Historie der Zulassung 1938 erste Vorschrift über die Zulassung
BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 23
 BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 23 Physikalische und chemische Bodeneigenschaften als prädisponierende Faktoren neuartiger Eichenschäden von Thorsten Gaertig Helmer Schack-Kirchner Jörg Volkmann
BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 23 Physikalische und chemische Bodeneigenschaften als prädisponierende Faktoren neuartiger Eichenschäden von Thorsten Gaertig Helmer Schack-Kirchner Jörg Volkmann
Klimabündnisschwerpunktregion Bruck/L Hainburg - Schwechat. Klimadaten
 Klimabündnisschwerpunktregion Bruck/L Hainburg - Schwechat Klimadaten 1. Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebietes Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich von Schwechat bis Hainburg und wird nördlich
Klimabündnisschwerpunktregion Bruck/L Hainburg - Schwechat Klimadaten 1. Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebietes Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich von Schwechat bis Hainburg und wird nördlich
Projekt Stadtgrün Wurzelentwicklung in FLL-Baumsubstraten. Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Josef V. Herrmann Susanne Böll
 Projekt Stadtgrün 2021 Wurzelentwicklung in FLL-Baumsubstraten Josef V. Herrmann Susanne Böll 2. Forum Bayerisches Netzwerk Klimabäume Veitshöchheim, 4.12.2014 Projekt Stadtgrün 2021 Entwicklung von Baumwurzeln
Projekt Stadtgrün 2021 Wurzelentwicklung in FLL-Baumsubstraten Josef V. Herrmann Susanne Böll 2. Forum Bayerisches Netzwerk Klimabäume Veitshöchheim, 4.12.2014 Projekt Stadtgrün 2021 Entwicklung von Baumwurzeln
NATURWALDRESERVAT TURMKOPF
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg NATURWALDRESERVAT TURMKOPF Naturwaldreservat Turmkopf Hänge und ebene, feuchte Flächen wechseln sich im Reservat kleinräumig ab. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg NATURWALDRESERVAT TURMKOPF Naturwaldreservat Turmkopf Hänge und ebene, feuchte Flächen wechseln sich im Reservat kleinräumig ab. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Möglichkeiten und Grenzen der waldbaulichen Anpassung an den Klimawandel
 Möglichkeiten und Grenzen der waldbaulichen Anpassung an den Klimawandel KLIMWALD-Projekt, AB1 Dr. Tina Schäfer 1.6.2016 Inhalte 1. Wald im Klimawandel - Temperaturanstieg und Extremwettereinflüsse 2.
Möglichkeiten und Grenzen der waldbaulichen Anpassung an den Klimawandel KLIMWALD-Projekt, AB1 Dr. Tina Schäfer 1.6.2016 Inhalte 1. Wald im Klimawandel - Temperaturanstieg und Extremwettereinflüsse 2.
NATURWALDRESERVAT HECKE
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster NATURWALDRESERVAT HECKE Naturwaldreservat Hecke Gräben, Totholz und junge Bäume vermitteln den Besuchern einen urwaldartigen Eindruck.
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster NATURWALDRESERVAT HECKE Naturwaldreservat Hecke Gräben, Totholz und junge Bäume vermitteln den Besuchern einen urwaldartigen Eindruck.
BÄUMCHEN WECHSELT EUCH!
 BÄUMCHEN WECHSELT EUCH! Unser Ziel ist eine gesunde Mischung. Wer heute Waldbau sagt, muss auch Waldumbau und Energiewende meinen. Standortgemäß, naturnah, stabil, leistungsfähig, erneuerbar: Anpassungsfähige
BÄUMCHEN WECHSELT EUCH! Unser Ziel ist eine gesunde Mischung. Wer heute Waldbau sagt, muss auch Waldumbau und Energiewende meinen. Standortgemäß, naturnah, stabil, leistungsfähig, erneuerbar: Anpassungsfähige
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2005
 Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2005 N-Düngungsversuch zu Winterraps (Sensortechnik) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern Herausgeber:
Versuchsergebnisse aus Bayern 2003 bis 2005 N-Düngungsversuch zu Winterraps (Sensortechnik) Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern und staatlichen Versuchsgütern Herausgeber:
NATURWALDRESERVAT SCHÖNWALD
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck NATURWALDRESERVAT SCHÖNWALD Naturwaldreservat Schönwald Aus den Feldern erhebt sich der Moränenrücken mit dem Naturwaldreservat. ALLGEMEINES
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck NATURWALDRESERVAT SCHÖNWALD Naturwaldreservat Schönwald Aus den Feldern erhebt sich der Moränenrücken mit dem Naturwaldreservat. ALLGEMEINES
Erfahrungen mit Sicherheitsberichten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Erfahrungen mit Sicherheitsberichten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von Dieter Schuster Die Erfahrung zeigt, dass bei der regelmäßigen Erstellung der Sicherheitsberichte durch die Betreiber von
Erfahrungen mit Sicherheitsberichten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von Dieter Schuster Die Erfahrung zeigt, dass bei der regelmäßigen Erstellung der Sicherheitsberichte durch die Betreiber von
1 Mio. ha Fichte Risikomanagement der Fichte im Klimawandel
 1 Mio. ha Fichte Risikomanagement der Fichte im Klimawandel Dr. Hans-Joachim Klemmt, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Fichtentagung 2017 des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums
1 Mio. ha Fichte Risikomanagement der Fichte im Klimawandel Dr. Hans-Joachim Klemmt, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Fichtentagung 2017 des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums
Eignung von Eichentrupp- und Nesterpflanzungen als Wiederaufforstungsmaßnahmen
 Eignung von Eichentrupp- und Nesterpflanzungen als Wiederaufforstungsmaßnahmen -Erste Ergebnisse im Rahmen einer Studie im FoA Heldburg- von Jacqueline Wegner, Ref. Monitoring, Klima & Forschung Kolloquium
Eignung von Eichentrupp- und Nesterpflanzungen als Wiederaufforstungsmaßnahmen -Erste Ergebnisse im Rahmen einer Studie im FoA Heldburg- von Jacqueline Wegner, Ref. Monitoring, Klima & Forschung Kolloquium
Der Impetus von Eckhard Kennel. Wegbereiter für forstliche Inventuren in Bayern und Deutschland
 Der Impetus von Eckhard Kennel Wegbereiter für forstliche Inventuren in Bayern und Deutschland 23. Oktober 2015 Franz Brosinger Referat Waldbau, Waldschutz, Bergwald Inhalt 1. Forstliche Großrauminventuren
Der Impetus von Eckhard Kennel Wegbereiter für forstliche Inventuren in Bayern und Deutschland 23. Oktober 2015 Franz Brosinger Referat Waldbau, Waldschutz, Bergwald Inhalt 1. Forstliche Großrauminventuren
Integrierter Pflanzenbau in Bayern
 Integrierter Pflanzenbau in Bayern - Ergebnisse aus Feldversuchen - Düngungsversuch zu Winterweizen, Ernte 2000-2002 Mineralische Düngung Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern
Integrierter Pflanzenbau in Bayern - Ergebnisse aus Feldversuchen - Düngungsversuch zu Winterweizen, Ernte 2000-2002 Mineralische Düngung Ergebnisse aus Versuchen in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsämtern
Tabelle 12: Zystendiagnosen im Verlauf der Laktation nach Palpation vom Rektum her
 4. Ergebnisse 4.1. Auswertung der klinischen Untersuchung 4.1.1. Rektale Untersuchung 320 Tiere wurden während des Untersuchungszeitraumes zur rektalen Palpation vorgestellt. Aufgrund von unterdurchschnittlicher
4. Ergebnisse 4.1. Auswertung der klinischen Untersuchung 4.1.1. Rektale Untersuchung 320 Tiere wurden während des Untersuchungszeitraumes zur rektalen Palpation vorgestellt. Aufgrund von unterdurchschnittlicher
Bericht. über die Entwicklung der Lufttemperatur und der Windböen an Messstellen in NÖ
 Bericht über die Entwicklung der Lufttemperatur und der Windböen an Messstellen in NÖ Impressum: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Anlagentechnik Referat Luftgüteüberwachung Landhausplatz 1 3109 St.
Bericht über die Entwicklung der Lufttemperatur und der Windböen an Messstellen in NÖ Impressum: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Anlagentechnik Referat Luftgüteüberwachung Landhausplatz 1 3109 St.
Qualität von Starkholz Erwartungen und Wirklichkeit
 Deutscher Wald, dick und alt Starkholz: Schatz oder Schleuderware? Tagung Göttingen, 16.06.2016 Qualität von Starkholz Erwartungen und Wirklichkeit Udo Hans Sauter und Franka Brüchert Qualität von Starkholz
Deutscher Wald, dick und alt Starkholz: Schatz oder Schleuderware? Tagung Göttingen, 16.06.2016 Qualität von Starkholz Erwartungen und Wirklichkeit Udo Hans Sauter und Franka Brüchert Qualität von Starkholz
Produktion in Agroforstsystemen - Lichtökologie
 neue Optionen für eine nachhaltige Landnutzung Produktion in Agroforstsystemen - Lichtökologie Mathias Brix Institut für Waldwachstum Inhalt 1. Produktionsfaktor Licht 2. Modellbeschreibung 3. Kronenbereich
neue Optionen für eine nachhaltige Landnutzung Produktion in Agroforstsystemen - Lichtökologie Mathias Brix Institut für Waldwachstum Inhalt 1. Produktionsfaktor Licht 2. Modellbeschreibung 3. Kronenbereich
Vegetationsentwicklung auf Sturmwurfflächen der Schwäbischen Alb
 Vegetationsentwicklung auf Sturmwurfflächen der Schwäbischen Alb von Gerhard Hetzel 1. Auflage Vegetationsentwicklung auf Sturmwurfflächen der Schwäbischen Alb Hetzel schnell und portofrei erhältlich bei
Vegetationsentwicklung auf Sturmwurfflächen der Schwäbischen Alb von Gerhard Hetzel 1. Auflage Vegetationsentwicklung auf Sturmwurfflächen der Schwäbischen Alb Hetzel schnell und portofrei erhältlich bei
Laubholz-Sondersortimente Statistiken für das Land Baden-Württemberg. Speierling, Foto: Rainer Lippert
 Laubholz-Sondersortimente Statistiken für das Land Baden-Württemberg Speierling, Foto: Rainer Lippert Peter Niggemeyer Dettingen, 10.07.2012 1. Eingrenzung des Arbeitstitels Inhalt der Präsentation 2.
Laubholz-Sondersortimente Statistiken für das Land Baden-Württemberg Speierling, Foto: Rainer Lippert Peter Niggemeyer Dettingen, 10.07.2012 1. Eingrenzung des Arbeitstitels Inhalt der Präsentation 2.
Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90.
 Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90. Abb. 2 Mittlere Schneedeckendauer Zeitraum 1961/90. Den Kartendarstellungen liegen ca. 550 geprüfte, vollständige 30-jährige
Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90. Abb. 2 Mittlere Schneedeckendauer Zeitraum 1961/90. Den Kartendarstellungen liegen ca. 550 geprüfte, vollständige 30-jährige
NATURWALDRESERVAT GAILENBERG
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg NATURWALDRESERVAT GAILENBERG Naturwaldreservat Gailenberg Stehendes und liegendes Totholz sind eine Bereicherung für einen Naturwald. ALLGEMEINES
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg NATURWALDRESERVAT GAILENBERG Naturwaldreservat Gailenberg Stehendes und liegendes Totholz sind eine Bereicherung für einen Naturwald. ALLGEMEINES
Wie geht man mit gefährdeten Fichtenbeständen um?
 Wie geht man mit gefährdeten Fichtenbeständen um? Thomas Ledermann und Georg Kindermann Institut für Waldwachstum und Waldbau BFW-Praxistag 2017 Wege zum klimafitten Wald Wien, Gmunden, Ossiach, Innsbruck
Wie geht man mit gefährdeten Fichtenbeständen um? Thomas Ledermann und Georg Kindermann Institut für Waldwachstum und Waldbau BFW-Praxistag 2017 Wege zum klimafitten Wald Wien, Gmunden, Ossiach, Innsbruck
Möglichkeiten und Grenzen des Robinien-Anbaus
 Seminar: Aktuelle Fragen des Waldbaus Möglichkeiten und Grenzen des Robinien-Anbaus Ines Graw 01.07.2008 Gliederung Einführung Ökologie der Robinie Vorzüge und Nachteile Wertholzerzeugung Energieholz /
Seminar: Aktuelle Fragen des Waldbaus Möglichkeiten und Grenzen des Robinien-Anbaus Ines Graw 01.07.2008 Gliederung Einführung Ökologie der Robinie Vorzüge und Nachteile Wertholzerzeugung Energieholz /
NATURWALDRESERVAT RUSLER WALD
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Deggendorf NATURWALDRESERVAT RUSLER WALD Naturwaldreservat Rusler Wald Ein Nadel-Laubmischwald, typisch für das Naturwaldreservat. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Deggendorf NATURWALDRESERVAT RUSLER WALD Naturwaldreservat Rusler Wald Ein Nadel-Laubmischwald, typisch für das Naturwaldreservat. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
NÖ Landesfeuerwehrverband Sprengdienst. Sprengen von Wurzelstöcken
 Sprengen von Wurzelstöcken Allgemein: Die Ladung wird je nach der unter dem Stock und unter den Hauptwurzeln verteilt oder nur als Einzelladung geballt eingebracht. Die Ausbildung der Wurzeln ist zum Teil
Sprengen von Wurzelstöcken Allgemein: Die Ladung wird je nach der unter dem Stock und unter den Hauptwurzeln verteilt oder nur als Einzelladung geballt eingebracht. Die Ausbildung der Wurzeln ist zum Teil
Kapitel 2. Mittelwerte
 Kapitel 2. Mittelwerte Im Zusammenhang mit dem Begriff der Verteilung, der im ersten Kapitel eingeführt wurde, taucht häufig die Frage auf, wie man die vorliegenden Daten durch eine geeignete Größe repräsentieren
Kapitel 2. Mittelwerte Im Zusammenhang mit dem Begriff der Verteilung, der im ersten Kapitel eingeführt wurde, taucht häufig die Frage auf, wie man die vorliegenden Daten durch eine geeignete Größe repräsentieren
Tanne. Ökologisch unverzichtbar, ökonomisch ein Hit! Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst. Tannenanteil in OÖ
 Tanne Ökologisch unverzichtbar, ökonomisch ein Hit! Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Tannenanteil in OÖ 20 % 2,5 % von Natur aus aktuelle Situation Trotz steigenden Gesamtholzvorräten
Tanne Ökologisch unverzichtbar, ökonomisch ein Hit! Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Tannenanteil in OÖ 20 % 2,5 % von Natur aus aktuelle Situation Trotz steigenden Gesamtholzvorräten
Wie lange bleiben Baumstöcke dem Ökosystem Wald erhalten?
 GErHarD NIESE Wie lange bleiben Baumstöcke dem Ökosystem Wald erhalten? Wie lange verbleiben die mit dem Boden verbundenen Reste der gefällten Bäume im Bestand? Welche Bedeutung haben Baumart und Seehöhe?
GErHarD NIESE Wie lange bleiben Baumstöcke dem Ökosystem Wald erhalten? Wie lange verbleiben die mit dem Boden verbundenen Reste der gefällten Bäume im Bestand? Welche Bedeutung haben Baumart und Seehöhe?
Auswertungen der Bundeswaldinventur 3
 Auswertungen der Bundeswaldinventur 3 Abteilung Biometrie und Informatik Bericht Regionale Auswertung der Bundeswaldinventur 3 Kreis Böblingen Gerald Kändler Dominik Cullmann 18. Juli 216 Forstliche Versuchs-
Auswertungen der Bundeswaldinventur 3 Abteilung Biometrie und Informatik Bericht Regionale Auswertung der Bundeswaldinventur 3 Kreis Böblingen Gerald Kändler Dominik Cullmann 18. Juli 216 Forstliche Versuchs-
NATURWALDRESERVAT BÖHLGRUND
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt NATURWALDRESERVAT BÖHLGRUND Naturwaldreservat Böhlgrund Frühling im Böhlgrund. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Böhlgrund liegt im Vogelschutz-
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt NATURWALDRESERVAT BÖHLGRUND Naturwaldreservat Böhlgrund Frühling im Böhlgrund. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Böhlgrund liegt im Vogelschutz-
Verfahren zur Skalierung. A. Die "klassische" Vorgehensweise - nach der Logik der klassischen Testtheorie
 Verfahren zur Skalierung A. Die "klassische" Vorgehensweise - nach der Logik der klassischen Testtheorie 1. Daten: z. Bsp. Rating-Skalen, sogenannte "Likert" - Skalen 2. Ziele 1. Eine Skalierung von Items
Verfahren zur Skalierung A. Die "klassische" Vorgehensweise - nach der Logik der klassischen Testtheorie 1. Daten: z. Bsp. Rating-Skalen, sogenannte "Likert" - Skalen 2. Ziele 1. Eine Skalierung von Items
Beobachtungen zum Einfluss der einheimischen Begleitvegetation auf die Entwicklung von jungen Ginkgo biloba Pflanzen
 Beobachtungen zum Einfluss der einheimischen Begleitvegetation auf die Entwicklung von jungen Ginkgo biloba Pflanzen Beobachtet auf dem Grundstück Mollesnejta(~2800m ü. NN) im Tal von Cochabamba, Bolivien
Beobachtungen zum Einfluss der einheimischen Begleitvegetation auf die Entwicklung von jungen Ginkgo biloba Pflanzen Beobachtet auf dem Grundstück Mollesnejta(~2800m ü. NN) im Tal von Cochabamba, Bolivien
silvaselect Hochwertige Vogelkirschen für die Forstwirtschaft
 silvaselect Hochwertige Vogelkirschen für die Forstwirtschaft Andreas Meier-Dinkel Beim Anbau der Vogelkirsche zur Produktion hochwertiger Sortimente für Furniere und Massivholzmöbel spielt die Wuchsform
silvaselect Hochwertige Vogelkirschen für die Forstwirtschaft Andreas Meier-Dinkel Beim Anbau der Vogelkirsche zur Produktion hochwertiger Sortimente für Furniere und Massivholzmöbel spielt die Wuchsform
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Die Esche im Staatswald der Forstdirektion Oberbayern-Schwaben
 Die Esche im Staatswald der Forstdirektion Oberbayern-Schwaben von THOMAS IMMLER 6 Baumartenanteile der Esche Die Esche ist im Staatswald der Forstdirektion mit einem Anteil von 1,9 % (Abb. 1) vertreten.
Die Esche im Staatswald der Forstdirektion Oberbayern-Schwaben von THOMAS IMMLER 6 Baumartenanteile der Esche Die Esche ist im Staatswald der Forstdirektion mit einem Anteil von 1,9 % (Abb. 1) vertreten.
Holzwirtschaft in Deutschland und Potenziale für die stoffliche und energetische Nutzung
 Holzwirtschaft in Deutschland und Potenziale für die stoffliche und energetische Nutzung Deutscher Bioraffinerie-Kongress 2007 Berlin, 12.09.2007 Dr. Jörg Schweinle Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft in Deutschland und Potenziale für die stoffliche und energetische Nutzung Deutscher Bioraffinerie-Kongress 2007 Berlin, 12.09.2007 Dr. Jörg Schweinle Bundesforschungsanstalt für Forst- und
WINALP-Typen als Befundeinheiten für Klimarisiken im Bergwald
 -Typen als Befundeinheiten für Klimarisiken im Bergwald Jörg Ewald*, Karl Mellert**, Birgit Reger* * Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ** Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Einführung:
-Typen als Befundeinheiten für Klimarisiken im Bergwald Jörg Ewald*, Karl Mellert**, Birgit Reger* * Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ** Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Einführung:
ARBEITSGRUPPE BAUM Ingenieurbüro Ges. m. b. H. Sachverständigenbüro AZ:
 ARBEITSGRUPPE BAUM Ingenieurbüro Ges. m. b. H. Sachverständigenbüro AZ: 083388 F A C H G U T A C H T E N und D O K U M E N T A T I O N zur Durchwurzelung des Naturdenkmales Nr. 756 (Platane) im Bereich
ARBEITSGRUPPE BAUM Ingenieurbüro Ges. m. b. H. Sachverständigenbüro AZ: 083388 F A C H G U T A C H T E N und D O K U M E N T A T I O N zur Durchwurzelung des Naturdenkmales Nr. 756 (Platane) im Bereich
Tab. 4.1: Altersverteilung der Gesamtstichprobe BASG SASG BAS SAS UDS SCH AVP Mittelwert Median Standardabweichung 44,36 43,00 11,84
 Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Unterscheidung von Bodentypen Bodenprofil. Grundversuch 45 min S
 Bodentypen bestimmen Kurzinformation Um was geht es? Durch das Zusammenwirken von Niederschlag, Grundwasser und Temperatur und Ausgangsgestein sind Böden mit übereinstimmenden oder ähnlichen Merkmalen
Bodentypen bestimmen Kurzinformation Um was geht es? Durch das Zusammenwirken von Niederschlag, Grundwasser und Temperatur und Ausgangsgestein sind Böden mit übereinstimmenden oder ähnlichen Merkmalen
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome
 3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
Auswirkungen mobiler Kundenbindungssysteme auf den Umsatz
 28. November 2012 Auswirkungen mobiler Kundenbindungssysteme auf den Umsatz Ein Projektstudium am Lehrstuhl für Dienstleistungs- und Technologiemarketing der Technischen Universität München Angefertigt
28. November 2012 Auswirkungen mobiler Kundenbindungssysteme auf den Umsatz Ein Projektstudium am Lehrstuhl für Dienstleistungs- und Technologiemarketing der Technischen Universität München Angefertigt
Wirtschaftlichkeit von Milchleistung, Kraftfuttermenge und Weideumfang in Öko-Betrieben 2004/05 bis 2008/2009
 Wirtschaftlichkeit von Milchleistung, Kraftfuttermenge und Weideumfang in Öko-Betrieben 2004/05 bis 2008/2009 Problematik Im ökologischen Landbau fallen die Höhe der einzelnen Leistungen (beispielsweise
Wirtschaftlichkeit von Milchleistung, Kraftfuttermenge und Weideumfang in Öko-Betrieben 2004/05 bis 2008/2009 Problematik Im ökologischen Landbau fallen die Höhe der einzelnen Leistungen (beispielsweise
Die ökonomische Zukunft der Fichte
 Technische Universität München Die ökonomische Zukunft der Fichte Thomas Knoke Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung Tel.: 08161 71 47 00 Mail: knoke@forst.wzw.tum.de Internet: www.forst.wzw.tum.de/ifm
Technische Universität München Die ökonomische Zukunft der Fichte Thomas Knoke Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung Tel.: 08161 71 47 00 Mail: knoke@forst.wzw.tum.de Internet: www.forst.wzw.tum.de/ifm
Grünlanddüngung und Gewässerschutz -
 3. Umweltökologisches Symposium: Wirkungen von Maßnahmen zum Boden- und Gewässerschutz Grünlanddüngung und Gewässerschutz - Versuchsergebnisse aus Bayern Dr. Michael Diepolder & Sven Raschbacher LfL Freising
3. Umweltökologisches Symposium: Wirkungen von Maßnahmen zum Boden- und Gewässerschutz Grünlanddüngung und Gewässerschutz - Versuchsergebnisse aus Bayern Dr. Michael Diepolder & Sven Raschbacher LfL Freising
Mögliche Auswirkungen von Hochwasserflutungen auf Forstbestände
 4 Bertoldsheim Mögliche Auswirkungen von Hochwasserflutungen auf Forstbestände Dr. Franz Binder Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Abteilung Waldbau und Bergwald Bertoldsheim 25. November
4 Bertoldsheim Mögliche Auswirkungen von Hochwasserflutungen auf Forstbestände Dr. Franz Binder Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Abteilung Waldbau und Bergwald Bertoldsheim 25. November
Zahlen und Fakten zur Rede von Dr. Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes
 Zahlen und Fakten zur Rede von Dr. Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes Gefahren durch extreme Niederschläge nehmen ab Mitte des Jahrhunderts deutlich zu Inhalt Seite Veränderung der
Zahlen und Fakten zur Rede von Dr. Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes Gefahren durch extreme Niederschläge nehmen ab Mitte des Jahrhunderts deutlich zu Inhalt Seite Veränderung der
5 Das Wurzelwerk der Hainbuche
 5 Das Wurzelwerk der Hainbuche von H.-J. Gulder FOR Hans-Jürgen Gulder ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sachgebiet Standort und Landespflege an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
5 Das Wurzelwerk der Hainbuche von H.-J. Gulder FOR Hans-Jürgen Gulder ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sachgebiet Standort und Landespflege an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Baumuntersuchungsbericht
 1 Dipl. Ing. M. Wilde Von der LWK Niedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baumpflege, Verkehrssicherheit von Bäumen, Baumwertermittlung Landschaftsarchitekt AK NW Am Feldweg
1 Dipl. Ing. M. Wilde Von der LWK Niedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baumpflege, Verkehrssicherheit von Bäumen, Baumwertermittlung Landschaftsarchitekt AK NW Am Feldweg
Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus
 45 4 Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus Alle 24 Stunden ist bei jeder Maus ein vaginaler Abstrich angefertigt worden, der auf einem Objektträger ausgestrichen und mittels Giemsa-Färbung gefärbt
45 4 Ergebnisse 4.1 Der Vaginalabstrich der Maus Alle 24 Stunden ist bei jeder Maus ein vaginaler Abstrich angefertigt worden, der auf einem Objektträger ausgestrichen und mittels Giemsa-Färbung gefärbt
S. 1. Fernerkundungsanwendungen Teil B Vorlesung Aktuelle Forstschutzprobleme Sommersemster
 Methodische Aspekte zur Vitalitätsansprache von Bäumen H. Fuchs, IWW 2004 IWW Vitalität eines Baumes Gesundheit Krankheit Folgen Zuwachsverluste Absterben Einschätzung a) Indirekt: Visuelle Beurteilung
Methodische Aspekte zur Vitalitätsansprache von Bäumen H. Fuchs, IWW 2004 IWW Vitalität eines Baumes Gesundheit Krankheit Folgen Zuwachsverluste Absterben Einschätzung a) Indirekt: Visuelle Beurteilung
Nährstoff-nachhaltige Waldwirtschaft: Wie viel Energieholznutzung können wir uns leisten?
 Nährstoff-nachhaltige Waldwirtschaft: Wie viel Energieholznutzung können wir uns leisten? Dr. Wendelin Weis und Prof. Dr. Dr. Axel Göttlein Fachgebiet Waldernährung und Wasserhaushalt, TU München Bayerisches
Nährstoff-nachhaltige Waldwirtschaft: Wie viel Energieholznutzung können wir uns leisten? Dr. Wendelin Weis und Prof. Dr. Dr. Axel Göttlein Fachgebiet Waldernährung und Wasserhaushalt, TU München Bayerisches
NATURWALDRESERVAT DREIANGEL
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben) NATURWALDRESERVAT DREIANGEL Naturwaldreservat Dreiangel Im Frühjahr wächst der Bärlauch so weit das Auge reicht. ALLGEMEINES Das NWR Dreiangel
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben) NATURWALDRESERVAT DREIANGEL Naturwaldreservat Dreiangel Im Frühjahr wächst der Bärlauch so weit das Auge reicht. ALLGEMEINES Das NWR Dreiangel
Bannwald "Wilder See - Hornisgrinde"
 BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 30 Bannwald "Wilder See - Hornisgrinde" Forstbezirk Schönmünzach Wuchsgebiet Schwarzwald Einzelwuchsbezirk 3/05 Hornisgrinde-Murg-Schwarzwald ERLÄUTERUNGEN
BERICHTE FREIBURGER FORSTLICHE FORSCHUNG HEFT 30 Bannwald "Wilder See - Hornisgrinde" Forstbezirk Schönmünzach Wuchsgebiet Schwarzwald Einzelwuchsbezirk 3/05 Hornisgrinde-Murg-Schwarzwald ERLÄUTERUNGEN
Was sind die aktuellen Forderungen nach einem Waldumbau? Für welche Standorte wird er gefordert?
 Was sind die aktuellen Forderungen nach einem Waldumbau? Für welche Standorte wird er gefordert? Seminar: Aktuelle Fragen des Waldbaus Referent: Florian Zimmer 17.06.2008 Gliederung Situation Waldumbau
Was sind die aktuellen Forderungen nach einem Waldumbau? Für welche Standorte wird er gefordert? Seminar: Aktuelle Fragen des Waldbaus Referent: Florian Zimmer 17.06.2008 Gliederung Situation Waldumbau
Neue Anforderungen der Gesellschaft an die Forstwirtschaft
 Neue Anforderungen der Gesellschaft an die Forstwirtschaft Bonus oder Malus für die Leistungen der Branche im Cluster? Josef Stratmann Ressource Holz 6.IV.2016 Gesellschaft - Forstwirtschaft - Cluster
Neue Anforderungen der Gesellschaft an die Forstwirtschaft Bonus oder Malus für die Leistungen der Branche im Cluster? Josef Stratmann Ressource Holz 6.IV.2016 Gesellschaft - Forstwirtschaft - Cluster
Untersuchung. Sicherung mit Pfahlwurzel aus Eisen Durchwurzelungsvermögen kurz nach der Pflanzung. Feldahorn
 1 Untersuchung Sicherung mit Pfahlwurzel aus Eisen Durchwurzelungsvermögen kurz nach der Pflanzung Feldahorn Leonberg Königsberger Straße 14 Wichern Kindergarten August 2012 Ingenieur und Sachverständigenbüro
1 Untersuchung Sicherung mit Pfahlwurzel aus Eisen Durchwurzelungsvermögen kurz nach der Pflanzung Feldahorn Leonberg Königsberger Straße 14 Wichern Kindergarten August 2012 Ingenieur und Sachverständigenbüro
Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung
 Spektrum Patholinguistik 7 (2014) 133 138 Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung Stefanie Düsterhöft, Maria Trüggelmann & Kerstin Richter 1
Spektrum Patholinguistik 7 (2014) 133 138 Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung Stefanie Düsterhöft, Maria Trüggelmann & Kerstin Richter 1
Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie
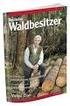 Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie Christian Ammer, Universität Göttingen Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen 1/25 Waldbau Abteilung Waldbau und Waldökologie der
Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie Christian Ammer, Universität Göttingen Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen 1/25 Waldbau Abteilung Waldbau und Waldökologie der
