DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Brutbiologie, Nahrung und Habitatnutzung des Wiedehopfs (Upupa epops) in Kärnten. Verfasserin.
|
|
|
- Frieda Klein
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Brutbiologie, Nahrung und Habitatnutzung des Wiedehopfs (Upupa epops) in Kärnten Verfasserin Isabella Rieder angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat.) Wien, März 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 444 Studienrichtung lt. Studienblatt: Diplomstudium Ökologie Betreuer: Univ.-Prof. Mag. Dr. Konrad Fiedler 1
2 DANKSAGUNG Dank ist an dieser Stelle all jenen gewidmet, die dabei geholfen haben dieses Projekt zu planen und umzusetzen. Eine tragende Rolle dabei spielten der Naturwissenschaftliche Verein in Kärnten und BirdLife Österreich (Landesgruppe Kärnten). Ganz besonderer Dank gilt den folgenden Personen: Dr. Werner Petutschnig, Dr. Josef Feldner, Mag. Andreas Kleewein, Alexander Sitte und all jenen, die mir wichtige Informationen zu besetzten Brutplätzen und vom Wiedehopf genutzte Futterflächen zukommen ließen. Ein großes Dankeschön auch an meine Freunde Heike Kern und Rupert Bogensberger, die mich so herzlich während meiner Feldarbeit bei sich aufgenommen haben. Ich möchte mich auch von ganzem Herzen bei meiner Familie bedanken, die mich mein ganzes Studium begleitet und unterstützt hat. Allen voran bei meiner Mutter Walpurga Rieder, meiner Schwester Susanne Rieder, meiner Tante Margareta Rieder, Günter Breznik, Tante Katharina und Onkel Hermann Wieczorek. Diese Arbeit konnte nur dank der fachlichen und kompetenten Betreuung von Dipl.-Biol. Dr. Christian Schulze und Univ.-Prof. Mag. Dr. Konrad Fiedler verwirklicht werden. 2
3 Inhaltsverzeichnis Zusamm enfassung... 4 Abstract Einleitung Methodik Untersuchungsgebiet und Standorte beobachteter Wiedehopf-Brutpaare Erfassung von Bruterfolg, Beutetieren, Fütterungsfrequenz, und Nahrungshab itaten Datenanaly se Ergebnisse Brutphänologie und R eproduktionserfolg Nahrungspräferenze n Fütterungsfrequenz Neststand orte und Nahrungshabitate Diskussion Brutphänologie und R eproduktionserfolg Nahrungspräferenze n Fütterungsfrequenz Neststandorte und Nahrungsha bitate Natursc hutzfachliche Relevanz Literatur Curriculum vitae
4 Zusammenfassung In der vorliegenden Studie wurden in der Brutsaison 2009 im Gail- und Rosental Beobachtungen zur Brutbiologie, Beutetiernutzung, Fütterungsfrequenz, sowie zur Wahl der Neststandorte und Nahrungshabitate Kärntner Wiedehöpfe durchgeführt. Bei insgesamt 6 von 21 festgestellten Bruten handelte es sich um Ersatz- oder Zweitgelege. Nur 9,5% der Bruten blieben erfolglos. Die meisten Bruten (66,7%) brachten mindestens zwei bis drei flügge Junge hervor. Aus später im Jahr angelegten Gelegen verließen tendenziell weniger Jungvögel die Bruthöhle. Desto höher der Brutplatz lag, desto später im Jahr konnten die ersten flüggen Jungvögel beobachtet werden. In beiden Tälern stellten Maikäfer-Engerlinge den größten Teil (83,7%) der an Jungvögel verfütterten Beutetiere. Maulwurfsgrillen waren mit 15,6% an zweiter Stelle der identifizierten Beutetiere. Die Fütterungsfrequenz blieb über den Tag hinweg relativ konstant, zeigte aber eine deutliche Abnahme mit fortschreitender Saison und korrelierte positiv mit der Anzahl ausgeflogener Jungvögel. Gelege wurden vornehmlich in anthropogen geschaffenen Bruthöhlen (v. a. Nistkästen, Gebäudenischen) anlegt, wohingegen nur 19% der Brutpaare (BP) natürliche Bruthöhlen (Bäume, Sandsteinaushöhlung) nutzten. Zur Nahrungssuche wurden meist Kurzrasen (Nutzung durch 84,2% aller BP) und Mähwiesen (63,2%) aufgesucht. Die erhobenen Daten für das Jahr 2009 deuten auf einen im europäischen Vergleich relativ niedrigen Bruterfolg (Anzahl flügge Jungvögel pro Gelege) bei Kärntner Wiedehöpfen hin. Weiterführende Studien müssen aufzeigen, ob dies auf eine niedrige Verfügbarkeit und/oder geringe Qualität geeigneter Nahrungshabitate hinweist. 4
5 Abstract During this study on Hoopoes data on reproductive biology, prey use, feeding rate and the selection of nest sites and foraging habitats were collected during the breeding season 2009 in two valleys in Carinthia, the Gailtal and Rosental. In total, 6 of 21 recorded breeding attempts represented replacement of second clutches. Only a minority of breeding attempts (9.5%) failed to produce fledglings. Most clutches (66.7%) produced a minimum of 2-3 fledglings. The number of fledglings per clutch decreased with progressing season and chicks fledged later from breeding sites located at higher altitudes. In both study valleys chicks were predominantly feed with larvae of cockchafer (83.7% of all identified prey items) and mole-crickets (15.6%). Food delivery rate remained relatively stable in the course of the day, but decreased significantly towards the end of the breeding season and was positively related to the number of fledglings. Clutches were mainly established in man-made structures (e.g. nest boxes, buildings). Only 19% of recorded clutches were found in natural nesting cavities (e.g. tree holes, cavities in rocks). Most Hoopoe pairs used short-grass areas (used by 84.2% of all breeding pairs) and hay meadows (63.2%). Compared to other European regions, breeding success (number of fledglings per clutch) of Hoopoes in Carinthia seemed to be relatively low, which may indicate a low availability and/or quality of adequate foraging habitats. This has to be proved by further studies. Schlagworte: Österreich, Kärnten, Upupa epops, Brutbiologie, Beutetiere, Fütterungsfrequenz, Neststandorte, Nahrungshabitate, Vogelschutz Keywords: Austria, Carinthia, Upupa epops, reproductive biology, prey, feeding rate, nesting sites, foraging habitats, bird conservation 5
6 1. Einleitung Landnutzungsveränderungen stellen eine wichtige Herausforderung für den Schutz bedrohter Vogelarten dar, da viele Arten, wie der Wiedehopf (Upupa epops), besonders auf traditionell genutzte Kulturlandschaften angewiesen sind. Die kausalen Zusammenhänge zwischen Landnutzungsveränderungen und damit einhergehenden Bestandsrückgängen sind allerdings häufig unzureichend bekannt. Der Wiedehopf weist zwar mit geschätzten 1,8 3,5 Millionen Individuen einen noch relativ großen Gesamtbestand in Europa auf (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2009), allerdings gibt es deutliche Hinweise auf regionale Bestandsrückgänge (DEL HOYO et al. 2001). Obwohl der Rückgang auf Ebene der Gesamtpopulation der Art (noch) nicht die Aufnahme in eine Gefährdungskategorie der Roten Liste der IUCN (Kriterium: Abnahme um >30 % in 10 Jahren oder drei Generationen) rechtfertigt, wird der Wiedehopf aufgrund seiner starken Bestandsrückgänge in vielen Regionen West- und Mitteleuropas als stark gefährdet eingestuft (HUSTINGS 1997, BERG & RANNER 1997). Die deutlich abweichende Bestandssituation des Wiedehopfs in verschiedenen Teilen seines westpaläarktischen Verbreitungsgebietes spiegelt möglicherweise Unterschiede in der Landnutzungsintensität wider (FOURNIER & ARLETTAZ 2001). Im Bundesland Kärnten wird der Wiedehopf aktuell als gefährdet ( Endangered ) eingestuft (WAGNER 2006). Das Zentrum des aktuellen Brutvorkommens liegt im Gail-, Drau- und Mölltal sowie den Randlagen des Klagenfurter Beckens. Für 2002 wird für Kärnten ein Gesamtbrutbestand von 50 Brutpaaren angenommen (JAKLITSCH 2002, PETUTSCHNIG 2006). Bestandsrückgänge und Arealverkleinerungen des Wiedehopfes in Mitteleuropa werden auf langfristige Klimaschwankungen und Habitatverluste zurückgeführt (BAUER & BER- THOLD 1997, ROBEL & RYSLAVY 1996). Neben der Vernichtung wichtiger Kleinstrukturen in der Landschaft (z.b. Brutplatzverlust infolge Gehölzrodung) werden auch der Einsatz von Herbiziden und Insektiziden in der Land- und Forstwirtschaft (Nahrungsmangel, Brutverluste) und die zunehmende Eutrophierung der Landschaft, verbunden mit einer Abnahme niedrigwüchsiger und lückenhafter Vegetationsstrukturen und der an solche frühen Sukzessionsstadien angepassten Begleit-Arthropodenfauna, als Gründe für Bestandsrückgänge angeführt (vgl. OEHLSCHLAEGER 2004). 6
7 In manchen Fällen scheint die Verfügbarkeit geeigneter Nistplätze für die in (Halb-) Höhlen brütende Art limitierend zu sein. Dadurch kann der Einsatz von künstlichen Nisthöhlen zu einer Stabilisierung und sogar gebietsweisen Zunahme der Brutpaarzahlen führen (OEHLSCHLAEGER 2004, OEHLSCHLAEGER & RYSLAVY 2002, STANGE & HAVELKA 2003). Obwohl die höchsten bekannten Brutplätze in Österreich bei m und in der Schweiz bei m liegen (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994), ist der Wiedehopf vornehmlich eine Art des Tieflandes und der kollinen Bereiche und überschreitet nur im Süden des Verbreitungsgebietes in günstigen Lagen regelmäßig deutlich m (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). Auch in Kärnten werden vornehmlich Talböden und sonnenexponierte Hanglagen der tieferen Lagen besiedelt (PETUTSCHNIG 2006). Der Wiedehopf ist eine Art der offenen bis halboffenen Landschaften, in denen sowohl geeignete Gehölzstrukturen für Bruthöhlen (oder Nistkästen) als auch eine kurzrasige und lückige Pflanzendecke zur erfolgreichen Bodenjagd vorhanden sind (DEL HOYO et al. 2001, GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). Weicher vegetationsarmer Boden wird zur Nahrungssuche bevorzugt; er kann jedoch durchaus hart und steinig sein, wenn Steinhaufen, Geröll, Bodenspalten, kleine Erdlöcher, Dung von Weidevieh und andere Kleinstrukturen den Nahrungserwerb sichern (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). Eine Untersuchung zur Habitatnutzung des Wiedehopfs in Südwest-Frankreich zeigte die wichtige Bedeutung einer kleinräumig sehr diversen Landschaft mit hoher Heterogenität auf (BARBARO et al. 2008). Der Nahrungserwerb erfolgt zum einen optisch durch Aufscheuchen der Beute und Hinterherlaufen, als auch taktil beim Bodenstochern, möglicherweise auch akustisch (Schräghalten des Kopfes dicht über dem Boden). Zudem werden Steine (oder andere Strukturen wie z. B. Laub) weggewälzt, indem der daruntergestoßene Schnabel geöffnet und der Stein mit dem Oberschnabel weggehoben wird (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). Der Wiedehopf hat eine fast ausschließlich insektivore Ernährungsweise. Obwohl auch langsam fliegende Insekten (wie Maikäfer) in der Luft erbeutet werden können (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1994, DEL HOYO et al. 2001), besteht das Beutespektrum doch vornehmlich aus Arthropoden mit einer relativ geringen Mobilität (Larven oder Puppenstadien). 7
8 Bei der Nahrungssuche scheint sich der Wiedehopf häufig opportunistisch auf besonders häufige Insektenarten zu konzentrieren. Zum Beispiel stellen in Kiefernwäldern in Südeuropa häufig Larven und Puppen des Kiefernprozessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa) eine Hauptnahrungsquelle dar (BATTISTI et al. 2000, BARBARO et al. 2008). In einer Population in Norditalien bestand die Nahrung vornehmlich aus Prozessionsspinner-Puppen, die mit dem 5 6 cm langen Schnabel aus dem Boden gezogen werden. Die geschätzte Prädationsrate von Prozessionsspinner-Puppen in Pinus-nigra- Beständen durch den Wiedehopf betrug dabei % (BATTISTI et al. 2000). In Jahren mit hohen Maikäferdichten können auch Maikäfer-Engerlinge eine wichtige Nahrungsquelle für den Wiedehopf darstellen (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). Die Studie einer kleinen Wiedehopfpopulation in den Schweizer Alpen zeigte, dass hier vor allem zwei Gruppen von Beutetieren den Großteil der an die Jungtiere verfütterten Nahrung stellten: Maulwurfsgrillen (Gryllotalpa gryllotalpa; v. a. Imagines und große Larven) und Lepidopteren. Diese beiden Beutetiergruppen stellten 93 % aller Beutetiere und 97 % der an die Jungvögel verfütterten Biomasse (FOURNIER & ARLETTAZ 2001). Obwohl Maulwurfsgrillen nur 26 % aller eingetragenen Beutetiere repräsentierten, stellten sie 68 % der Biomasse. Die Bedeutung bestimmter Beutetiere kann allerdings zwischen einzelnen Territorien und Jahren deutlich variieren (FOURNIER & ARLETTAZ 2001). Die generell wichtige Bedeutung von Maulwurfsgrillen (z. T % der Beutetiere) als Nahrung des Wiedehopfs wurde allerdings auch von anderen Autoren betont (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994; vgl. auch FOURNIER & ARLETTAZ 2001). Nach FOURNIER & ARLETTAZ (2001) könnte die Verfügbarkeit von Maulwurfsgrillen sogar entscheidend für das Überleben mitteleuropäischer Wiedehopfpopulationen sein. In dieser Studie an Kärntner Wiedehöpfen wurden unter anderen folgende Aspekte untersucht und vergleichend mit anderen Studien diskutiert: (1.) Brutphänologie und Reproduktionserfolg, (2.) genutzte Beutetiere und Fütterungsfrequenz, (3.) Brutplatzwahl und (4.) Nahrungshabitate. 8
9 2. Methodik 2.1. Untersuchungsgebiet und Standorte beobachteter Wiedehopf- Brutpaare Die vorliegende Studie wurde in zwei Tälern in Kärnten, dem Rosen- und Gailtal, durchgeführt. Ab Beginn der Brutsaison wurden im Untersuchungsgebiet so viele Wiedehopf-Brutplätze wie möglich ausfindig gemacht. Ein parallel laufendes Kartierungsprojekt für ganz Kärnten (KLEEWEIN 2010) und Informationen von BirdLife Österreich (Landesgruppe Kärnten) dienten als Basis für die Lokalisierung der Brutgebiete. Es konnten insgesamt 21 Bruten im Gail- und Rosental ausfindig gemacht und beobachtet werden. Die einzelnen Wiedehopf-Bruthöhlen wurden mittels GPS georeferenziert. Koordinaten und Höhe ü. NN, der in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigten Brutplätze, sind aus Tabelle 1 ersichtlich. Tabelle 1: Standorte der beobachteten Wiedehopf-Brutpaare (BP). BP # Tal Lokalität Koordinaten Höhe ü. NN [m] Brutplatz 1 Gailtal Dertaplatte N 46 34, Sandsteinaushöhlung O ,752 2 Gailtal Obervellach N 46 38,089 O ,568` 613 Dachgiebel (Wohnhaus) 3 Gailtal Obervellach N 46 38, Alte Eiche O ,990 4 Gailtal Raisach N 46 39, Alter Apfelbaum O 013 9,434 5 Gailtal Unterpostran N 46 37,066 O , Dachgiebel (Wohnhaus) 6 Gailtal Untervellach N 46 37,547 O , Alte Esche 7 Rosental Dornach N 46 31,705 O , Nistkasten (Birke) 9
10 8 Rosental Dornach N 46 31,826 O ,091 9 Rosental Ferlach N 46 31,840 O , Rosental Gotschuchen N 46 32,397 O , Rosental Gotschuchen N 46 32,397 O , Rosental Gupf N 46 32,525 O , Rosental Gupf N 46 32,624 O , Rosental Laak N 46 32,577 O , Rosental Laak N 46 32,560 O , Rosental Laak N 46 32,601 O ,890 17A Rosental Niederdörfl N 46 32,256 O ,244 17B Rosental Niederdörfl N 46 32,257 O , Rosental Otrouza N 46 32,674 O , Rosental Ferlach N 46 32,640 O , Rosental St. Margarethen N 46 32,756 O , Dach (Wohnhaus) 454 Meisennistkasten (alter Apfelbaum) 448 Dachgiebel (Wohnhaus) 448 Dachgiebel (Wohnhaus) 632 Nistkasten (Birnbaum) 626 Nistkasten (Apfelbaum) 393 Holzfass 427 Scheune (Zwischenboden) 419 Scheune (Mauerspalt) 686 Nistkasten (Obstbaum) 694 Nistkasten (Birnbaum) 431 Scheune (Mauerspalt) 431 Nistkasten (Weide) 592 Nistkasten (Nussbaum) 10
11 2.2. Erfassung von Bruterfolg, Beutetieren, Fütterungsfrequenz, und Nahrungshabitaten Die Freilandarbeiten zu diesem Wiedehopf-Projekt fanden vom 13. Mai bis 26. Juli 2009 statt. Da vor allem Daten über Beutetiernutzung, Fütterungsfrequenz, genutzte Nahrungshabitate (siehe unten) und Bruterfolg gesammelt werden sollten, war ein Beginn der Untersuchung Mitte Mai ausreichend, obwohl erste Gelege ausnahmsweise bereits in der letzten Aprildekade gefunden werden können (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). Für unsere Untersuchungen war eine Datenerhebung aber erst ab dem Schlupf der ersten Jungvögel zwingend notwendig, um die Fütterungsfrequenz zu bestimmen. Da sich an den Bebrütungsbeginn (in der Regel nach Ablage des ersten Eies) eine Tage dauernde Bebrütungsphase anschließt (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994), konnten somit auch für die ersten im Jahr getätigten Gelege noch entsprechende Daten erhoben werden. Für jedes Brutpaar wurde versucht, den Bruterfolg anhand der Anzahl flügger Jungvögel so genau wie möglich zu quantifizieren. Da sich die Jungvögel nach dem Ausfliegen oft in Familienverbänden aufhalten (DEL HOYO et al. 2001), noch mindestens fünf Tage von den Altvögel gefüttert werden (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994) und sich während dieser Zeit oft noch im unmittelbaren Bereich der Bruthöhle aufhalten (eigene Beobachtungen), erlaubt die maximale Anzahl zu dieser Zeit beobachteter Jungvögel zumindest einen groben Rückschluss auf den Bruterfolg. Eine Kontrolle des Bruthöhleninneren unterblieb, um das Ausmaß der Störung so gering wie möglich zu halten. Aufgrund eigener Beobachtungen und/oder Informationen von Landwirten und Anwohnern war in den meisten Fällen eine wahrscheinlich relativ genaue Rekonstruktion des Ausflugtermins der Jungvögel möglich. Die Erfassung genutzter Beutetiere erfolgte sowohl durch Beobachtung als auch durch Auswertung von Videoaufnahmen Nahrung suchender und Junge fütternder Altvögel. Die einzelnen Brutpaare wurden maximal einmal pro Tag etwa eine Stunde lang an der Bruthöhle bei der Fütterung der Jungen beobachtet. 11
12 Dabei wurde für jeden Anflug an die Bruthöhle die Uhrzeit sowie das Beutetier (soweit Bestimmung möglich) notiert. Die Fütterungsfrequenz wurde als Anzahl pro Stunde eingetragener Beutetiere quantifiziert. Im Anschluss daran wurde durchschnittlich eine weitere Stunde dafür verwendet potentielle Futterflächen ausfindig zu machen und die Nahrungssuche des Wiedehopfs zu dokumentieren. Auch hierbei wurden alle Beutetiere so genau wie möglich notiert. Beobachtungen fanden meist aus dem Inneren eines Autos statt, da sich unter diesen Bedingungen furagierende und fütternde Vögel ohne Anzeichen einer Störung beobachten ließen. War eine ungestörte Annäherung an Vögel mit dem Auto nicht möglich, erfolgten die Beobachtungen aus einem Tarnzelt. 12
13 2.3. Datenanalyse Unterschiede der Mittelwerte von zwei Gruppen wurde mit Hilfe von t-tests auf Signifikanz geprüft, falls die Daten annähernd normalverteilt waren. Konnte für nicht normalverteilte Daten auch nach einer entsprechenden Transformation keine Annäherung an eine Normalverteilung erreicht werden, wurde als eine nichtparametrische Alternative zum t-test der Mann-Whitney U-Test verwendet. Für multiple Mittelwertsvergleiche wurde eine einfaktorielle ANOVA gerechnet. Der Chi 2 -Test wurde verwendet, um Unterschiede in Häufigkeitsverteilungen zu analysieren. Zudem wurden univariate Zusammenhänge zwischen einer Ziel- und einer Prädiktorvariablen mittels Pearson-Korrelation (für normalverteilte Daten) bzw. Spearman-Rangkorrelation (für nicht normalverteilte Daten) getestet. Alle statistischen Analysen wurden mit Statistica 7.1 durchgeführt (STATSOFT 2005). 13
14 3. Ergebnisse 3.1. Brutphänologie und Reproduktionserfolg Die Phänologie beobachteter flügger Jungvögel deutet auf eine nicht unbeträchtliche Zahl an Zweitbruten hin. Jungvögel aus Erstbruten flogen zwischen dem 29. Mai und dem 20. Juni aus. Bei im Juli ausgeflogenen Jungen handelt es sich entweder um Vögel aus Ersatz- oder aus Zweitgelegen (Abb. 1). Die letzten Jungvögel verließen am 25. Juli die Bruthöhle. Während des Aufnahmezeitraums wurden zwei Bruten (eine Erst- und eine Zweitbrut) aufgegeben. Abb. 1: Phänologie ausgeflogener Jungvögel. 14
15 Von 21 Bruten ergaben die meisten (66.7 %) 2-3 flügge Jungvögel. Maximal konnten jeweils einmal 4 und 5 ausgeflogene Jungvögel festgestellt werden (Abb. 2). Im Mittel flogen 2,24 pro Gelege aus (N = 21 Bruten). Die Anzahl beobachteter flügger Jungvögel pro erfolgreicher Brut unterschied sich dabei nicht signifikant zwischen Erstgelegen und Ersatzgelegen + Zweitbruten (Mann-Whitney U-Test: U = 29.50, N Erstbruten = 13, N Esatzgelege+Zweitbruten = 6, p = 0.146). Die Anzahl flügger Jungvögel erfolgreicher Bruten nahm allerdings tendenziell mit fortschreitender Saison ab (r = -0.43, N =19; p = 0.064; Abb. 3). Abb. 2: Verteilung der Anzahl flügger Jungvögel pro Gelege; getrennt angegeben für Erst- und Zweitbruten (Ersatzgelege inkludiert). 15
16 Abb. 3: Veränderung der Anzahl flügger Jungvögel pro Gelege mit fortschreitender Saison. N = 19 Bruten. Das Datum, an dem der erste Jungvogel eines Geleges die Bruthöhle verließ (ohne Berücksichtigung von Zweitbruten), unterschied sich nicht signifikant zwischen den beiden untersuchten Talsystemen (Mann-Whitney U-Test: U = 15.00, p = 0.464), wurde aber durch die Höhe des Brutplatzes beeinflusst. Jungvögel aus Bruten in höheren Lagen verließen später im Jahr ihre Bruthöhlen (Abb. 4). Dieser Zusammenhang war noch deutlicher bei ausschließlicher Betrachtung der Bruten im Gailtal (r = 0.91, p = 0.012), wohingegen im Rosental nur ein entsprechender Trend feststellbar war (r = 0.49, p = 0.155). 16
17 Abb. 4: Verlassen der Bruthöhle durch ersten flüggen Jungvogel eines Geleges in Abhängigkeit von der Höhe (ü. NN) des Brutplatzes (N= 16 Bruten; Zweitgelege nicht berücksichtigt). 17
18 3.2. Nahrungspräferenzen Von 404 bestimmten Beutetieren waren der Großteil (83,7%) Engerlinge (N = 338). Insgesamt 15,6 % der Beutetiere repräsentierten Maulwurfsgrillen (N = 63). In drei Fällen konnte das Verfüttern von Käferpuppen beobachtet werden. Ausreichend große Anzahlen bestimmter Beutetiere liegen für den Zeitraum letzte Maidekade bis letzte Julidekade vor. Das Verhältnis der Häufigkeit der beiden wichtigsten Beutetiere (Engerlinge zu Maulwurfsgrillen) in den einzelnen Dekaden änderte sich nicht signifikant mit fortschreitender Saison (Spearman-Rangkorrelation: r = -0.04, N = 7, p = 0.939). In allen Dekaden wurden 3,2 7,3 -mal mehr Engerlinge als Maulwurfsgrillen eingetragen. Nur in der letzten Beobachtungsdekade (Ende Juli) kam es zu einem deutlichen Anstieg des relativen Anteils an erbeuteten Engerlingen (12,5 -mal mehr als Maulwurfsgrillen). Signifikante Unterschiede in der relativen Häufigkeit der beiden wichtigsten Beutetiere (Engerlinge und Maulwurfsgrillen) existierten jedoch zwischen einzelnen Brutpaaren (Chi-Quadrat-Test: χ 2 = 73.34, FG = 7, p < 0,001; nur Brutpaare mit N > 20 Beutetieren berücksichtigt; vgl. auch Abb. 5). 18
19 100% relative Häufigkeit 80% 60% 40% 20% Maulwurfsgrille Engerling 0% Gailtal # 4 Rosental # 14 Rosental # 07 Rosental # 08 Rosental # 17 Rosental # 15 Brutpaar # Rosental # 18 Rosental # 19 Abb. 5: Relative Häufigkeit der von verschiedenen Brutpaaren im Gailtal und Rosental erbeuteten Engerlinge und Maulwurfsgrillen. Berücksichtigt wurden nur Brutpaare mit >20 beobachteten Beutetieren Fütterungsfrequenz Die mittlere Fütterungsfrequenz (± Standardabweichung) der beobachteten Wiedehöpfe lag bei 5,74 (± 5,08) eingetragenen Beutetieren pro Stunde; (N = 159 Aufnahmen). Die Fütterungsfrequenz von Wiedehöpfen nahm signifikant mit fortschreitender Saison ab (r = -0.37, p < 0,001; Abb. 6). Kein Zusammenhang konnte zwischen Fütterungsfrequenz und Tageszeit festgestellt werden. 19
20 Ein signifikanter Unterschied in der Fütterungsfrequenz zeigte sich zwischen einzelnen Brutpaaren (nur Brutpaare berücksichtigt, für die Beobachtungen für mindestens 5 unterschiedliche Tage vorliegen; einfaktorielle ANOVA: F 10,121 = 5,98, p < 0,001). Dies erklärt sich zum Teil über Unterschiede in der Anzahl ausgeflogener Jungvögel. Die mittlere Fütterungsfrequenz ist positiv mit der Anzahl flügger Jungvögel korreliert (Spearman- Rangkorrelation: r s = 0,68, N = 17, p < 0,002; Abb. 7), wurde aber nicht signifikant vom Alter der Jungvögel (bzw. Tage vor Ausfliegen der Jungvögel; r = 0,07, N = 148, p = 0,376), Regen (t-test: t = 0,75, FG = 157, N kein Regen = 135, N Regen = 24, p = 0,569) oder der maximal festgestellten Furagierdistanz zur Bruthöhle beeinflusst (r = 0,07, N = 16, p = 0,788). Auch Meereshöhe zeigte keinen signifikanten Effekt, allerdings nahm die Fütterungsfrequenz tendenziell mit zunehmender Meereshöhe ab (r s = -0,42, N = 17, p = 0,089). Abb. 6: Veränderung der mittleren Fütterungsfrequenz (log (x+1) transformiert) ± Standardabweichung mit fortschreitender Saison. Zusätzlich angegeben ist die Trendlinie (lineare Regression). 20
21 Abb. 7: Zusammenhang zwischen Veränderung der Fütterungsfrequenz pro Stunde (log (x+1) transformiert) gemittelt über alle Beobachtungen pro Brutpaar und der Anzahl ausgeflogener Jungvögel. Zusätzlich angegeben ist die Trendlinie (lineare Regression). 21
22 3.4. Neststandorte und Nahrungshabitate Der überwiegende Teil, der im Gail- und Rosental nachgewiesenen Wiedehopfbruten, erfolgte in anthropogen geschaffenen Strukturen (in Nistkästen und an Gebäuden; Abb. 8). Nur 19 % der Gelege befanden sich in natürlichen Höhlen, in Bäumen (2) und Felsnischen (1). Abb. 8: Relative Bedeutung der von Wiedehöpfen (N = 21 Bruten) im Gail- und Rosental genutzten Nistplatztypen. 22
23 Die meisten Brutpaare nutzten zur Nahrungssuche Kurzrasen im Siedlungsbereich (84,2% aller BP) und Mähwiesen (63,2%). Alle anderen Habitate (Streuobstwiese, Weide, Straßenrand) waren von untergeordneter Bedeutung (Abb. 9). Abb. 9: Bedeutung unterschiedlicher Offenlandhabitate für Nahrung suchende Wiedehöpfe. Angegeben ist der Anteil an Brutpaaren, welche das jeweilige Habitat zur Nahrungssuche nutzten. Habitate: KR Kurzrasen im Siedlungsbereich, MW Mähwiese, STR Straßenrand, W Weide, SO Streuobstwiese. 23
24 4. Diskussion 4.1. Brutphänologie und Reproduktionserfolg Der Wiedehopf geht für gewöhnlich eine monogame Brutsaisonehe ein (DEL HOYO et al. 2001). Die Gelegegröße ist in den tropischen und subtropischen Breiten kleiner (4-7 Eier) als in temperaten Regionen (5-8 Eier, ausnahmsweise bis zu 12 Eier; DEL HOYO et al. 2001). In Mitteleuropa weisen Gelege von Wiedehöpfen im Mittel 6,9 Eier (N = 62 Gelege) auf (DEL HOYO et al. 2001). Der Bruterfolg scheint relativ hoch zu sein. Aus 74% von insgesamt 172 Eiern (aus 24 Gelegen aus Mitteleuropa) schlüpften Jungvögel und insgesamt 58% der Eier ergaben flügge Jungvögel. Die mittlere Anzahl pro Gelege ausgeflogener Jungvögel betrug 4,3 (DEL HOYO et al. 2001). Regional kann die Jungenmortalität allerdings höher liegen. So konnten in einer Population in Mähren nur 3,4 flügge Junge pro BP festgestellt werden (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994), aus dem Seewinkel/Neusiedler See ist ein Bruterfolg von 3,6 Jungvögel pro erfolgreicher Brut dokumentiert (STEINER et al. 2003). In der vorliegenden Untersuchung erfolgte keine Kontrolle der Bruthöhlen, um eine Störung der brütenden Altvögel zu vermeiden. Die Anzahl flügger Jungvögel pro Gelege weist aber auf einen sehr niedrigen Bruterfolg von Kärntner Wiedehöpfen hin. Mit nur 2,2 pro Nest ausgeflogenen Jungvögeln würde der Bruterfolg um fast 50% unter dem mitteleuropäischen Durchschnitt liegen. Allerdings sind diese Daten mit Vorsicht zu betrachten, da nicht auszuschließen ist, dass aufgrund des asynchronen Schlüpfens der Jungen (DEL HOYO et al. 2001) auch das Verlassen der Bruthöhle durch die flüggen Jungvögel nicht synchron erfolgt. Somit wurden eventuell einzelne noch in der Bruthöhle verbleibende Jungvögel übersehen, während andere sich möglicherweise bereits aus dem unmittelbaren Bereich der Bruthöhle entfernt hatten oder nach dem Ausfliegen bereits einem Räuber zum Opfer gefallen waren. 24
25 Da bei der vorliegenden Studie keine Kontrolle der Bruthöhlen erfolgte und die adulten Vögel nicht individuell identifizierbar waren, konnte zwischen Ersatzgelegen aufgrund von Nestprädation und echten Zweitbruten nicht mit letzter Sicherheit unterschieden werden. Werden Ersatzgelege inkludiert, repräsentierten ein Drittel der festgestellten Bruten Zweitbruten. Dieser Wert liegt zwischen dem für Spanien und Deutschland dokumentierten Anteil an Zweitbruten von 19 bzw. 57% (DEL HOYO et al. 2001). Nur zwei von insgesamt 21 in der vorliegenden Untersuchung festgestellten Bruten wurden aufgegeben. Diese Ausfallsrate von nur 9% ist bemerkenswert gering und steht möglicherweise in Zusammenhang mit der hoch entwickelten Verteidigung des Wiedehopfs gegen Nesträuber (vgl. DEL HOYO et al. 2001). Allerdings kann in anderen Regionen die Nestprädation deutlich höher liegen. Zum Beispiel konnte in Südspanien eine Nestprädationsrate von 16,4% für Erstgelege und 46,7% bzw. 50% für Zweit- bzw. Ersatzgelege gefunden werden (MARTÍN-VIVALDI et al. 1999). In der Schweiz und in Südspanien wurden keine Unterschiede in der Anzahl flügger Jungvögel pro Gelege zwischen Erst- und Zweitbruten festgestellt (MARTÍN-VIVALDI et al. 1999, FOURNIER & ARLETTAZ 2001). Auch bei Kärntner Wiedehöpfen unterschieden sich festgestellte Erst- und Zweitgelege (mögliche Ersatzgelege inkludiert) nicht signifikant hinsichtlich der Anzahl ausgeflogener Jungvögel. Allerdings zeigte sich wie bei spanischen Wiedehöpfen (MARTÍN-VIVALDI et al. 1999), dass die Anzahl pro Brut beobachteter flügger Jungvögel mit fortschreitender Saison tendenziell abnahm. Dieser Umstand könnte auf eine Verschlechterung der Nahrungsverfügbarkeit gegen Ende der Brutsaison hindeuten, wofür auch die gegen Ende der Brutzeit zurückgehende Fütterungsfrequenz spricht. Obwohl alle der bei dieser Studie beobachteten Wiedehopfbruten in einem relativ engen Höhenbereich von ca m angesiedelt waren, konnte ein deutlicher Effekt der Höhe des Brutplatzes auf die Brutphänologie nachgewiesen werden. Jungvögel verließen in höheren Lagen die Bruthöhle deutlich später. Dies ist möglicherweise eine Anpassung an die Verschiebung des Zeitfensters mit optimaler Nahrungsverfügbarkeit zur Jungenaufzucht in höheren Lagen. 25
26 4.2. Nahrungspräferenzen Der Wiedehopf ernährt sich vornehmlich von im Boden lebenden Larven und Puppen von Großinsekten, wobei einzelne Arten (z.b. Maulwurfsgrille und Maikäfer-Engerlinge) dominieren können (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994, DEL HOYO et al. 2001). Bei Schweizer Wiedehöpfen konnte eine besondere Bedeutung von Maulwurfsgrillen (Gryllotalpa gryllotalpa) und Lepidopteren-Larven als Beutetiere, welche an die Jungen verfüttert wurden, aufgezeigt werden. Diese beiden Beutetiergruppen stellten 93% aller eingetragenen Tiere (FOURNIER & ARLETTAZ 2001). Bei der vorliegenden Studie aus Kärnten stellten Käfer-Engerlinge (Maikäfer) mit mehr als 80% der identifizierten Arthropoden die bei weitem wichtigste Beutetiergruppe dar. Maulwurfsgrillen hingegen repräsentierten nur ca. 16% der Beutetiere. Die relative Häufigkeit beider Beutetiergruppen blieb erstaunlich stabil über die gesamte Brutzeit. Nur gegen Ende der Beobachtungszeit (Ende Juli) nahm der relative Anteil an Maulwurfsgrillen sehr deutlich ab. Maulwurfsgrillen haben ihren Vorkommensschwerpunkt in feuchten und warmen Habitaten (DETZEL 1998). Aufgrund ihrer grabenden Lebensweise sind sie zudem an relativ lockere Böden gebunden (DETZEL 1998). Es werden sowohl naturnahe (zum Beispiel Niedermoore, Sümpfe, Feuchtwiesen und feuchte Gräben) als auch stark anthropogen geprägte Habitate (Beete, Kompost- und Misthaufen von Gärten, verschiedene Äcker, Weinberge) besiedelt (DETZEL 1998). Es scheint, dass Wiedehöpfe gezielt die Röhren von Maulwurfsgrillen und Maikäferlarven (Melolontha spp.) suchen, um diese Insekten zu erbeuten (DEL HOYO et al. 2001). Die relative Bedeutung einzelner Beutetiere kann sich nicht nur zwischen Großregionen, sondern auch wie in dieser Studie kleinräumig zwischen einzelnen Brutpaaren deutlich unterscheiden. In einer Untersuchung an Schweizer Wiedehöpfen zeigte sich, dass an Berghängen brütende Paare hauptsächlich Schmetterlingslarven (98,4% der Beutetiere) an die Jungvögel verfütterten, wohingegen der Anteil an Maulwurfsgrillen mit 7,3% sehr gering war. Hingegen wurden von Vögeln der Tallagen vor allem Maulwurfsgrillen (92,7%) genutzt (FOURNIER & ARLETTAZ 2001). Die Autoren argumentieren, dass die Maulwurfsgrille vor allem in der Ebene vorkommt und in steinigen Böden der Hanglagen fehlt. 26
27 In der vorliegenden Studie wurde der höchste Anteil verfütterter Maulwurfsgrillen allerdings für ein Brutpaar im Gailtal gefunden, dessen Brutplatz sich eher in einer Hanglage befindet. In unmittelbarer Umgebung der Bruthöhle herrschten jedoch nicht steinige und felsige Flächen vor, sondern die Altvögel nutzten zur Nahrungssuche vornehmlich kurzrasige Gärten und Wiesen. Der bei dieser Studie festgestellte, sehr hohe Anteil an Engerlingen (wohl vor allem Maikäferlarven) zeigt, dass der Wiedehopf sehr opportunistisch zur Brutsaison häufige Großinsekten nutzt. Es bleibt abzuwarten, ob es nach dem Überschreiten, der in der Brutsaison 2009 beobachtbaren Maikäfer-Gradation, in darauf folgenden Jahren zu einer zunehmenden Bedeutung der Maulwurfsgrille als Beutetier kommt. Dieses Großinsekt repräsentiert in großen Teilen des mitteleuropäischen Verbreitungsgebietes des Wiedehopfs das wichtigste Beutetier (vgl. GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). In der Brutsaison 2009 verfütterte zumindest eines der Kärntner Brutpaare (im Gailtal) vornehmlich Maulwurfsgrillen an seine Jungvögel Fütterungsfrequenz Beim Wiedehopf brütet alleine das vom Männchen gefütterte Weibchen, welches das Gelege nur kurz zur Kotabgabe und Gefiederpflege verlässt (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). Nach ca Tagen schlüpfen die ersten Jungen. Die ersten Tage danach ist nur das Männchen für die Versorgung mit Futter verantwortlich und trägt während der Huderzeit durchschnittlich 5-8 mal pro Stunde Beutetiere heran (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). Erst wenn die Jungvögel älter als 9-14 Tage sind, tragen beide Elternteile Nahrung ein. Dabei wird die Bruthöhle bei sechs Jungvögeln im Alter von 18 Tagen im Durchschnitt 14,6 mal pro Stunde angeflogen (DEL HOYO et al. 2001). In dieser Studie wurde eine deutlich niedrigere Fütterungsfrequenz festgestellt. Im Mittel erschienen Altvögel mit Beutetieren an der Bruthöhle nur 5,74- mal pro Stunde. Dies deutet aber nicht zwingend auf eine schlechte Versorgung der Jungvögel hin, da aufgrund des hohen Anteils an Großinsekten (Engerlinge, Maulwurfsgrillen), die verfütterte Biomasse wahrscheinlich relativ hoch war. 27
28 Die Fütterungsfrequenz verändert sich mit zunehmendem Alter der Jungvögel von anfangs Fütterungen pro Tag zu Fütterungen bei mittlerem Alter der Jungvögel (DEL HOYO et al. 2001). Gegen Ende der Nestlingszeit nimmt die Fütterungsfrequenz auf Fütterungen pro Tag ab (DEL HOYO et al. 2001). Dies steht möglicherweise in Zusammenhang mit einer saisonalen Zunahme der Größe und des Gewichts verfütterter Beutetiere (DEL HOYO et al. 2001). Zumindest deutet auch die vorliegende Studie auf eine generelle Abnahme der Fütterungsfrequenz mit fortschreitender Saison hin. Ein Effekt des Alters der Jungvögel auf die Fütterungsfrequenz konnte hingegen nicht festgestellt werden. Wie bereits durch eine Studie aus den Schweizer Alpen belegt (FOURNIER & ARLETTAZ 2001), gab es auch bei Kärntner Wiedehöpfen keine deutlichen tageszeitlichen Veränderungen der Fütterungsfrequenz, wie dies bei anderen insektivoren Vögeln beobachtet werden kann (z.b. Steinschmätzer; LOW et al. 2008). Wiedehöpfe erbeuten hauptsächlich wenig mobile Insekten aus der oberen Bodenschicht, deren Verfügbarkeit im Tagesverlauf mehr oder weniger konstant bleiben dürfte. Aufgrund der fehlenden tageszeitlichen Veränderung der Beutetierverfügbarkeit sind Wiedehöpfe möglicherweise auch besser als andere insektivore Vögel in der Lage, menschliche Störungen oder Schlechtwetterbedingungen durch eine entsprechende räumlich-zeitliche Anpassung ihres Furagierverhaltens zu kompensieren. Ein deutlicher Zusammenhang zeigte sich zwischen der Fütterungsfrequenz und der Anzahl ausgeflogener Jungvögel. Unklar ist allerdings, ob dies das Ergebnis einer mit fortschreitender Saison abnehmenden Nahrungsverfügbarkeit ist, welche eine höhere Mortalität der Jungvögel bedingt, oder ob die tendenziell gegen Ende der Brutsaison abnehmende Anzahl flügger Jungvögel pro Gelege eine Verringerung der Fütterungsfrequenz erlaubt. 28
29 4.4. Neststandorte und Nahrungshabitate In traditionell bewirtschafteten Gebieten kann es aufgrund einer höheren Dichte potentieller Nistmöglichkeiten (z.b. alte Einzelbäume, Steinmauern etc.) zu einer höheren Dichte an Wiedehöpfen, vor allem im Randbereich von Dörfern, kommen (DEL HOYO et al. 2001). Generell ist der Wiedehopf in der Lage ein sehr breites Spektrum unterschiedlichster Ganz- oder Halbhöhlen als Neststand zu nutzen (vgl. z.b. GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994, DEL HOYO et al. 2001). Im untersuchten Kärntner Brutgebiet zeigte sich, dass der Wiedehopf vorwiegend in anthropogen geschaffenen Strukturen brütet und natürliche Nisthöhlen aktuell eine eher untergeordnete Bedeutung spielen. Bei einer Erfassung von Wiedehopfbruten in Kärnten im Jahr 2002 wurden elf Neststandorte gefunden, davon waren sechs in natürlichen Bruthöhlen und fünf in künstlich geschaffenen Nistmöglichkeiten (JAKLITSCH 2002). Das Anbringen von Nistkästen kann dazu führen, dass verstärkt derartige künstliche Bruthöhlen genutzt werden, ohne dass es zu einem unmittelbaren Rückgang natürlicher Höhlen im Brutgebiet kam. So zeigte eine Studie aus Südspanien, dass obwohl im Jahr 2002 noch alle Bruten (N =11) in natürlichen Nisthöhlen angelegt wurden, nach dem Anbringen von 150 Nistkästen im Winter in der darauffolgenden Brutsaison 2003 bereits 10 von 16 Bruten in den Nistkästen getätigt wurden. Im Jahr 2004 waren sogar bereits 17 Bruten in Nistkästen zu finden (MARTÍN-VIVALDI et al. 2006). Dies dokumentiert die enorme Bedeutung künstlicher Nisthilfen zum Schutz von Wiedehopfpopulationen. Flächen mit kurzrasiger, lückiger Pflanzendecke sind bevorzugte Orte für die Futtersuche, dabei werden auch durch Beweidung und Trittschäden gestörte Flächen, sowie Straßen- und Wegränder oder Stellen mit geringerer Vegetationsbedeckung aufgrund der Beschattung durch Einzelbäume genutzt (DEL HOYO et al. 2001). Auch im Brutgebiet im Gail- und Rosental stellen Kurzrasen ein besonders wichtiges Nahrungshabitat dar. Diese Flächen, die meist häufig gemäht werden und in oder im Randbereich von Siedlungen liegen, befinden sich oft in unmittelbarer Nähe zu den Bruthöhlen. 29
30 4.5. Naturschutzfachliche Relevanz Der Wiedehopf ist eine wichtige Indikatorart für nachhaltig extensiv bewirtschaftete Kulturlandschaften (vgl. z.b. PFISTER & BIRRER 1997) und damit für den Naturschutz von sehr großer Bedeutung. Extensiv bewirtschaftete Wiesen, Streuobstwiesen und Weiden repräsentieren nicht nur wichtige Nahrungshabitate für den Wiedehopf, ihr Erhalt fördert und schützt zugleich auch eine Vielzahl anderer gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Aufgrund seines ästhetisch ansprechenden Erscheinungsbilds ist der Wiedehopf ideal geeignet, um mit dieser Zielart bei zuständigen Politikern, Landwirten und der Öffentlichkeit für den Erhalt extensiv genutzter Kulturlandschaften zu werben (vgl. auch PÜH- RINGER 2008). Die enge Bindung an Siedlungen bzw. deren Randbereiche deutet darauf hin, dass der Wiedehopf relativ robust gegenüber menschlichen Störungen ist. Neben der Verfügbarkeit zur Nahrungssuche geeigneter Flächen scheint dem Nistplatzangebot eine entscheidende Bedeutung zuzukommen (DEL HOYO et al. 2001). Eine Verbesserung des Bruthöhlenangebotes durch Anbringen zusätzlicher künstlicher Nisthilfen in den bekannten Kärntner Brutgebieten ist als Maßnahme zur Stabilisierung der Population in jedem Falle zu empfehlen. Zudem ist einer Verschlechterung der Verfügbarkeit und Qualität geeigneter Nahrungshabitate, zum Beispiel durch zunehmende Intensivierung der Grünlandnutzung, entgegenzuwirken bzw. extensive Grünlandbewirtschaftung gezielt zu fördern. Auch der Erhalt von Obstgärten und der Verzicht auf Befestigung und Ausbau nicht asphaltierter Wege tragen zum Schutz wichtiger Nahrungshabitate bei (PÜHRINGER 2008). 30
31 5. Literatur BARBARO, L., L. COUZI, V. BRETAGNOLLE, J. NEZAN & F. VETILLARD (2008): Multi-scale habitat selection and foraging ecology of the Eurasian Hoopoe (Upupa epops) in pine plantations. Biodiversity and Conservation 17: BATTISTI, A., M. BERNARDI & C. GHIRALDO (2000): Predation by the Hoopoe (Upupa epops) on pupae of Thaumetopoea pityocampa and the likely influence on other natural enemies. BioControl 45: BAUER H.-G. & P. BERTHOLD (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. 2. Auflage. Aula-Verlag, Wiesbaden. BIRDLIFE INTERNATIONAL (2009): Eurasian Hoopoe BirdLife Species Factsheet. BERG, H.-M. & A. RANNER (1997): Rote Listen ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs Vögel (Aves), 1. Fassung NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Wien. DEL HOYO, J., A. ELLIOTT & J. SARGATAL (Hrsg.) (2001): Handbook of the Birds of the World. Vol. 6. Mousebirds to Hornbills. Lynx Edicions, Barcelona. DETZEL, P. (1998): Die Heuschrecken Baden-Württembergs. Ulmer, Stuttgart; 325. FOURNIER, J. & R. ARLETTAZ (2001): Food provision to nestlings in the Hoopoe Upupa epops: implications for the conservation of a small endangered population in the Swiss Alps. Ibis 143: GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9: Columbiformes Piciformes. 2., durchgesehene Auflage. AULA- Verlag, Wiesbaden. HUSTINGS, F. (1997): Upupa epops, Hoopoe , In: HAGEMEIJER, W. J. M. & M. J. BLAIR (Hrsg.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. Poyser, London. JAKLITSCH, H. (2002): Bestandserfassung des Wiedehopfs (Upupa epops) in Kärnten. Kärntner Naturschutzberichte 7: KLEEWEIN, A. (2010): Artenschutzprojekt Wiedehopf (Upupa epops) in Kärnten 2009 Brutbestand, Habitatanalyse und Schutzmaßnahmen. Carinthia II, 200./120.:
32 LOW, M., S. EGGERS, D. ARLT & T. PÄRT (2008): Daily patterns of nest visits are correlated with ambient temperature in the Northern Wheatear. Journal of Ornithology 149: MARTÍN-VIVALDI, M., J. J. PALOMINO, M. SOLER & J. J. SOLER (1999): Determinants of reproductive success in the Hoopoe Upupa epops, a hole-nesting non-passerine bird with asynchronous hatching. Bird Study 46: MARTÍN-VIVALDI, M., M. RUIZ-RODRÍGUEZ, M. MÉNDEZ & J. J. SOLER (2006): Relative importance of factors affecting nestling immune response differ between junior and senior nestlings within broods of hoopoes Upupa epops. Journal of Avian Biology 37: OEHLSCHLAEGER, S. (2004): Wiedehopf (Upupa epops) , In: Gedeon, K., A. Mitschke & C. Sudfeldt (Hrsg.): Brutvögel in Deutschland. Eigenverlag des Vereins Sächsischer Ornithologen e.v., Hohenstein-Ernstthal. OEHLSCHLAEGER, S. & T. RYSLAVY (2002): Brutbiologie des Wiedehopfes (Upupa epops) auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen bei Jüterbog, Brandenburg. Vogelwelt 123: PETUTSCHNIG, W. (2006): Der Wiedehopf , In: FELDNER, J., P. RASS, W. PETUTSCHNIG, S. WAGNER, G. MALLE, R. K. BUSCHENREITER, P. WIEDNER & R. PROBST (Hrsg.): Avifauna Kärntens. Die Brutvögel. Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt. PFISTER, H. P. & S. BIRRER (1997): Landschaftsökologische und faunistische Erfolgskontrolle für ökologische Ausgleichsmassnahmen im Schweizer Mittelland. Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Luzern 35: PÜHRINGER, N. (2008): Artenschutzprojekt Wiedehopf (Upupa epops) in Oberösterreich Aktuelle Bestandssituation und Beobachtungen zu Habitatwahl und Brutbiologie. Vogelkundliche Nachrichten Oberösterreich, Naturschutz aktuell 16: ROBEL, D. & T. RYSLAVY (1996): Zur Verbreitung und Bestandsentwicklung des Wiedehopfes (Upupa epops) in Brandenburg. Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 5:
33 STANGE, C. & P. HAVELKA (2003): Brutbestand, Höhlenkonkurrenz, Reproduktion und Nahrungsökologie des Wiedehopfes Upupa epops in Südbaden. Vogelwelt 124: STATSOFT (2005): Statistica for Windows, 7.1. StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma. STEINER, J., R. TRIEBL & A. GRÜLL (2003): Bruterfolg und Ansiedlungsentfernung beim Wiedehopf (Upupa epops) im Neusiedler See-Gebiet Egretta 46: WAGNER, S. (2006): Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Kärntens , In: FELDNER, J., P. RASS, W. PETUTSCHNIG, S. WAGNER, G. MALLE, R. K. BUSCHENREITER, P. WIEDNER & R. PROBST (Hrsg.): Avifauna Kärntens. Die Brutvögel. Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt. 33
34 6. Curriculum vitae Von Isabella Margareta Rieder Persönliche Daten: Geboren am in Klosterneuburg Staatsbürgerschaft: Österreich Familienstand: ledig Wohnhaft: In den Jochen 17, Ausbildung: A-2122 Ulrichskirchen 2001 Matura am Oberstufen-Realgymnasium De La Salle Schule Strebersdorf, Anton Böckgasse 20; 2110-Wien Beginn Diplomstudium der Biologie an der Universität Wien 2005 Beginn Diplomstudium Politikwissenschaft 2009 Abschluss des 1. Studienabschnittes Biologie und Umstieg auf den Studienzweig Ökologie Beginn Diplomarbeit am Department of Animal Biodiversity: Brutbiologie, Nahrung und Habitatnutzung des Wiedehopfs (Upupa epops) in Kärnten Wissenschaftliche Tätigkeit: 2001 Praktikum: Österreichische Akademie der Wissenschaften Dr. Ignaz Seipel Platz 2; 1010Wien 2005 Naturschutzpraktikum Meeresschildkröten 2008 Projektpraktikum Vegetation Regenwald La Gamba 2009 Projektpraktikum Pflanzliche Chemodiversität in den Paläotropen Andere Qualifikationen und Interessen: Kfz-Führerschein B Deutsch und Englisch in Wort und Schrift Französisch und Spanisch (Grundkenntnisse) Fotografieren Literatur 34
Nutznießer von Brachen Rebhuhn und Grauammer
 Nutznießer von Brachen Rebhuhn und Grauammer Vögel in der Kulturlandschaft: Was zeigen sie - was brauchen sie? LWK St.Pölten 11.8.2017, Katharina Bergmüller Rebhuhn: Verbreitung BirdLife, P.Buchner Ornitho.at
Nutznießer von Brachen Rebhuhn und Grauammer Vögel in der Kulturlandschaft: Was zeigen sie - was brauchen sie? LWK St.Pölten 11.8.2017, Katharina Bergmüller Rebhuhn: Verbreitung BirdLife, P.Buchner Ornitho.at
Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012
 Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012 (Gerfried Klammer, Landsberg) Vom Ansitz abfliegende Sumpfohreule bei Langeneichstädt (Quelle: Dr. Erich Greiner, 13.07.2012) Erfahrungen aus diesjährigen Bruten
Sumpfohreulen-Bruten im Saalekreis 2012 (Gerfried Klammer, Landsberg) Vom Ansitz abfliegende Sumpfohreule bei Langeneichstädt (Quelle: Dr. Erich Greiner, 13.07.2012) Erfahrungen aus diesjährigen Bruten
Zur biologischen Vielfalt
 Jahresbericht 2016 Zur biologischen Vielfalt Jagd und Artenschutz Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 2.14 Projekt Ursachenforschung zum Rückgang des Mäusebussards im Landesteil Schleswig Seit 2014 werden
Jahresbericht 2016 Zur biologischen Vielfalt Jagd und Artenschutz Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 2.14 Projekt Ursachenforschung zum Rückgang des Mäusebussards im Landesteil Schleswig Seit 2014 werden
Pattonville Mehlschwalbenmonitoring. Ergebnisse 2017/2018. Auftraggeber: Zweckverband Pattonville
 Pattonville Mehlschwalbenmonitoring Ergebnisse 2017/2018 Auftraggeber: Zweckverband Pattonville 1. Einleitung 2. Methodik 4. Ausblick 1. Einleitung Mehlschwalbe (Delichon urbicum) Früher sehr häufiger
Pattonville Mehlschwalbenmonitoring Ergebnisse 2017/2018 Auftraggeber: Zweckverband Pattonville 1. Einleitung 2. Methodik 4. Ausblick 1. Einleitung Mehlschwalbe (Delichon urbicum) Früher sehr häufiger
Die Brutvögel im Bereich der SWG in der Leonhard-Frank-Straße, Schwerin-Weststadt
 Die Brutvögel im Bereich der SWG in der Leonhard-Frank-Straße, Schwerin-Weststadt Stand: Juli 2013 Auftraggeber: Planung & Ökologie Platz der Freiheit 7 19053 Schwerin Auftragnehmer: Dr. Horst Zimmermann
Die Brutvögel im Bereich der SWG in der Leonhard-Frank-Straße, Schwerin-Weststadt Stand: Juli 2013 Auftraggeber: Planung & Ökologie Platz der Freiheit 7 19053 Schwerin Auftragnehmer: Dr. Horst Zimmermann
Nistkasten 01 in 2015
 Nistkasten 01 in 2015 Erste Brut In 2015 brüteten im Nistkasten 01 wieder Kohlmeisen. Aus den 6 Eiern sind 5 Jungvögel schlüpft. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Entwicklung der Jungvögel vom 18.04.2015
Nistkasten 01 in 2015 Erste Brut In 2015 brüteten im Nistkasten 01 wieder Kohlmeisen. Aus den 6 Eiern sind 5 Jungvögel schlüpft. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Entwicklung der Jungvögel vom 18.04.2015
Vogel des Monats. der Wiedehopf. Informationen und Fotos von Edith und Beni Herzog.
 Vogel des Monats der Wiedehopf Informationen und Fotos von Edith und Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Schmetterlingsvogel beeindruckt nicht nur durch seine äusserliche Erscheinung, auch die Stimme
Vogel des Monats der Wiedehopf Informationen und Fotos von Edith und Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Schmetterlingsvogel beeindruckt nicht nur durch seine äusserliche Erscheinung, auch die Stimme
Übersicht. Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen
 Übersicht Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen Mehlschwalbe als Vogel des Jahres 2010 Im Internationalen Jahr der Biodiversität wirbt die Mehlschwalbe für mehr
Übersicht Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen Mehlschwalbe als Vogel des Jahres 2010 Im Internationalen Jahr der Biodiversität wirbt die Mehlschwalbe für mehr
Windkraft Vögel Lebensräume
 Hanjo Steinborn Marc Reichenbach Hanna Timmermann Windkraft Vögel Lebensräume Ergebnisse einer siebenjährigen Studie zum Einfluss von Windkraftanlagen und Habitatparametern auf Wiesenvögel Eine Publikation
Hanjo Steinborn Marc Reichenbach Hanna Timmermann Windkraft Vögel Lebensräume Ergebnisse einer siebenjährigen Studie zum Einfluss von Windkraftanlagen und Habitatparametern auf Wiesenvögel Eine Publikation
Nisthilfe für nischenbrütende Vögel
 Nisthilfe für nischenbrütende Vögel Vorteile des Nistkastens erschwerter Zugang von Nesträubern durch vorgezogene Seitenwände und langem Dachüberstand Wahl des Aufhänge-Ortes geschützte, leicht besonnte,
Nisthilfe für nischenbrütende Vögel Vorteile des Nistkastens erschwerter Zugang von Nesträubern durch vorgezogene Seitenwände und langem Dachüberstand Wahl des Aufhänge-Ortes geschützte, leicht besonnte,
Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern
 Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern Erste Ergebnisse zu Habitatwahl, Bruterfolg und Fördermaßnahmen Frank Gottwald, Andreas + Adele Matthews, Karin Stein-Bachinger DO-G Fachgruppentreffen
Braunkehlchen auf Ökobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern Erste Ergebnisse zu Habitatwahl, Bruterfolg und Fördermaßnahmen Frank Gottwald, Andreas + Adele Matthews, Karin Stein-Bachinger DO-G Fachgruppentreffen
Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium. Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite
 Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite Der Rotmilan Der rote Drache The Red Dragon Steckbrief Rotmilan
Der Rotmilan in Ostbelgien The Red Kite in Eastern Belgium Ostbelgien ein Paradies für Rotmilane! Eastern Belgium A paradise for the Red Kite Der Rotmilan Der rote Drache The Red Dragon Steckbrief Rotmilan
Brutvogelabschätzung im Bereich Oyten-Forth im Jahr 2013
 Limosa Dipl.Phys. Werner Eikhorst Ökologische Planungen Am Rüten 106 UVS - PEP - Eingriff/Ausgleich 28357 Bremen Faunistische Kartierungen Tel.: (0421) 46 49 28 Wassermanagement im Naturschutz Email: Limosa@t-online.de
Limosa Dipl.Phys. Werner Eikhorst Ökologische Planungen Am Rüten 106 UVS - PEP - Eingriff/Ausgleich 28357 Bremen Faunistische Kartierungen Tel.: (0421) 46 49 28 Wassermanagement im Naturschutz Email: Limosa@t-online.de
Fallstudie zur Reproduktionsökologie der Gelbbauchunke in zwei Lebensräumen im nördlichen Rheinland
 Allen Unkenrufen zum Trotz Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) Tagung - 22. 23.11.2014 Fallstudie zur Reproduktionsökologie der Gelbbauchunke in zwei Lebensräumen im nördlichen Rheinland Paula Höpfner,
Allen Unkenrufen zum Trotz Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) Tagung - 22. 23.11.2014 Fallstudie zur Reproduktionsökologie der Gelbbauchunke in zwei Lebensräumen im nördlichen Rheinland Paula Höpfner,
Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege
 Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege Werner Eikhorst Bremen, Oktober 2007 Brutvögel am Unterlauf der
Brutvögel am Unterlauf der Lehrde im Jahre 2007 Kurzbericht im Auftrag des Landkreises Verden Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege Werner Eikhorst Bremen, Oktober 2007 Brutvögel am Unterlauf der
Nistkasten 01 in 2016
 Nachfolgend werden nur Bilder der Innenkamera angezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 71 GB Speicherplatz und können daher nicht in die vorliegende Datei eingebunden werden. Nistkasten 01
Nachfolgend werden nur Bilder der Innenkamera angezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 71 GB Speicherplatz und können daher nicht in die vorliegende Datei eingebunden werden. Nistkasten 01
Wiederansiedlung am östlichen Alpennordrand
 Wiederansiedlung am östlichen Alpennordrand R. Zink Fachtagung Habichtskauz 16.10.2012 Purkersdorf Historische Brutnachweise 20. Jhdt. Alpensüdrand, 19. Jhdt. Alpen nord- und Alpensüdrand 1 Vorkommen vor
Wiederansiedlung am östlichen Alpennordrand R. Zink Fachtagung Habichtskauz 16.10.2012 Purkersdorf Historische Brutnachweise 20. Jhdt. Alpensüdrand, 19. Jhdt. Alpen nord- und Alpensüdrand 1 Vorkommen vor
Vogel des Monats. der Hausrotschwanz. mit Fotos und Informationen von Beni Herzog.
 Vogel des Monats der Hausrotschwanz mit Fotos und Informationen von Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Hausrotschwanz ist ein Singvogel. Er sieht ähnlich aus wie der Haussperling, lässt sich jedoch
Vogel des Monats der Hausrotschwanz mit Fotos und Informationen von Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net Der Hausrotschwanz ist ein Singvogel. Er sieht ähnlich aus wie der Haussperling, lässt sich jedoch
DER WIEDEHOPF IN DER SÜDSTEIERMARK
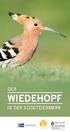 DER WIEDEHOPF IN DER SÜDSTEIERMARK «Du stinkst wie ein Wiedehopf!» - Sprichwort Wiedehopfe können ein übelriechendes Sekret absondern um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Es wird vor allem von brütenden
DER WIEDEHOPF IN DER SÜDSTEIERMARK «Du stinkst wie ein Wiedehopf!» - Sprichwort Wiedehopfe können ein übelriechendes Sekret absondern um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Es wird vor allem von brütenden
Frühe Mahdzeitpunkte zur Förderung des Heilziest-Dickkopffalters (Carcharodus flocciferus) (Zeller, 1847) im württembergischen Allgäu
 Frühe Mahdzeitpunkte zur Förderung des Heilziest-Dickkopffalters (Carcharodus flocciferus) (Zeller, 1847) im württembergischen Allgäu Tagfalterworkshop Leipzig 01.-03. März 2018 Dr. Thomas Bamann (RP Tübingen)
Frühe Mahdzeitpunkte zur Förderung des Heilziest-Dickkopffalters (Carcharodus flocciferus) (Zeller, 1847) im württembergischen Allgäu Tagfalterworkshop Leipzig 01.-03. März 2018 Dr. Thomas Bamann (RP Tübingen)
Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring
 Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring Bestandssituation im Leipziger Stadtgebiet und am Floßgraben Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping BioCart Ökologische Gutachten, Taucha 19. Stadt-Umland-Konferenz
Bedrängt oder entspannt? Ausführliches zum Eisvogel-Monitoring Bestandssituation im Leipziger Stadtgebiet und am Floßgraben Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping BioCart Ökologische Gutachten, Taucha 19. Stadt-Umland-Konferenz
ENTWURFSSTAND 20. September 2016
 20. September 2016 1 3.0 2 . EG- VSchRL: I - Anhang I. BNatSchG - - bes. geschützt, - streng geschützt. BJagdG - ganzjährige Schonzeit bzw. Jagdzeit. Rote Liste - V - Vorwarnliste, 2 - stark gefährdet,
20. September 2016 1 3.0 2 . EG- VSchRL: I - Anhang I. BNatSchG - - bes. geschützt, - streng geschützt. BJagdG - ganzjährige Schonzeit bzw. Jagdzeit. Rote Liste - V - Vorwarnliste, 2 - stark gefährdet,
Erfolgskontrolle Gartenrotschwanz
 Erfolgskontrolle Gartenrotschwanz Smaragdgebiet Oberaargau: Eine Region fördert Brütet in Baumhöhlen oder Gebäuden Nahrung: Insekten, Spinnen Benötigt Ruderalflächen www.smaragdoberaargau.ch Aufwertungsmassnahmen
Erfolgskontrolle Gartenrotschwanz Smaragdgebiet Oberaargau: Eine Region fördert Brütet in Baumhöhlen oder Gebäuden Nahrung: Insekten, Spinnen Benötigt Ruderalflächen www.smaragdoberaargau.ch Aufwertungsmassnahmen
Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013
 Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013 Beate Wendelin Lachmöwe (Larus ridibundus) 2013 wurde der Brut-Bestand der Lachmöwe im Nationalpark Neusiedler
Brutbestände von Möwen und Seeschwalben im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel im Jahr 2013 Beate Wendelin Lachmöwe (Larus ridibundus) 2013 wurde der Brut-Bestand der Lachmöwe im Nationalpark Neusiedler
Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte
 Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte Die Beringung soll AUSSCHLIESSLICH dem Gewinn wissenschaftlich relevanter Daten dienen Beringung nur der Fernfunde wegen ist nicht mehr zeitgemäß! Das AOC als
Richtlinien für die Projekte der Vogelwarte Die Beringung soll AUSSCHLIESSLICH dem Gewinn wissenschaftlich relevanter Daten dienen Beringung nur der Fernfunde wegen ist nicht mehr zeitgemäß! Das AOC als
Der Gartenrotschwanz braucht unsere Hilfe!
 Der Gartenrotschwanz braucht unsere Hilfe! Der Gartenrotschwanz - ein kleiner, Insekten fressender Singvogel, müsste dem Namen nach eigentlich in jedem Garten zu finden sein. Leider ist dies jedoch längst
Der Gartenrotschwanz braucht unsere Hilfe! Der Gartenrotschwanz - ein kleiner, Insekten fressender Singvogel, müsste dem Namen nach eigentlich in jedem Garten zu finden sein. Leider ist dies jedoch längst
Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus) (Stand November 2011)
 Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen Wertbestimmende Brutvogelarten der EU-Vogelschutzgebiete Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)
Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen Wertbestimmende Brutvogelarten der EU-Vogelschutzgebiete Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)
Auswertung des Vogelmonitoring 2012 für das Photovoltaik-Freiland-Kraftwerk in Teutschenthal OT Köchstedt im Zeitraum von April bis September 2012.
 Auswertung des Vogelmonitoring 2012 für das Photovoltaik-Freiland-Kraftwerk in Teutschenthal OT Köchstedt im Zeitraum von April bis September 2012. Dokumentation der Gesamtauswertung zum 30. September
Auswertung des Vogelmonitoring 2012 für das Photovoltaik-Freiland-Kraftwerk in Teutschenthal OT Köchstedt im Zeitraum von April bis September 2012. Dokumentation der Gesamtauswertung zum 30. September
Vogel des Monats. der Buntspecht. mit Fotos und Informationen von Beni Herzog.
 Vogel des Monats der Buntspecht mit Fotos und Informationen von Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net 1 Der Trommler im Wald. Der Buntspecht ist unsere häufigste und am weitesten verbreitete Spechtart.
Vogel des Monats der Buntspecht mit Fotos und Informationen von Beni Herzog www.lehrmittelperlen.net 1 Der Trommler im Wald. Der Buntspecht ist unsere häufigste und am weitesten verbreitete Spechtart.
Häufigkeitsverteilung von Luftmassen in Europa auf 850 hpa im Zeitraum von 1979 bis 2000
 Häufigkeitsverteilung von Luftmassen in Europa auf 850 hpa im Zeitraum von 1979 bis 2000 Lars Hattwig 1.Gutachter u. Betreuer: Univ.-Professor Dr. Manfred Geb 2.Gutachter: Univ.-Professor Dr. Horst Malberg
Häufigkeitsverteilung von Luftmassen in Europa auf 850 hpa im Zeitraum von 1979 bis 2000 Lars Hattwig 1.Gutachter u. Betreuer: Univ.-Professor Dr. Manfred Geb 2.Gutachter: Univ.-Professor Dr. Horst Malberg
TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich
 TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich Bei drei brütenden Arten ist derzeit davon auszugehen, dass sie in keiner Weise gefährdet sind: Mäusebussard, Turmfalke, Sperber. Sechs Arten sind derzeit
TAGGREIFVÖGEL Bestandessituation in Österreich Bei drei brütenden Arten ist derzeit davon auszugehen, dass sie in keiner Weise gefährdet sind: Mäusebussard, Turmfalke, Sperber. Sechs Arten sind derzeit
Brutbestand und Verteilung der Brüten bei der Flußseeschwalbe (Sterna hirundo) in den Jahren 1992 und 1993 im Seewinkel. R.
 Biologische Station Neusiedler See/Austria; download unter www.biologiezentrum.at BFB-Bericht 83, 31-36 Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland, Illmitz 1995 Brutbestand und Verteilung der Brüten
Biologische Station Neusiedler See/Austria; download unter www.biologiezentrum.at BFB-Bericht 83, 31-36 Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland, Illmitz 1995 Brutbestand und Verteilung der Brüten
FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT
 FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT IN DER SCHWEIZ UND IM KANTON BERN Weshalb verändert sich die Biodiversität? Die Biodiversität verändert sich zum einen durch langfristige und grossräumige
FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT IN DER SCHWEIZ UND IM KANTON BERN Weshalb verändert sich die Biodiversität? Die Biodiversität verändert sich zum einen durch langfristige und grossräumige
Seine Zukunft liegt an uns!
 Seine Zukunft liegt an uns! Franz Bairlein Institut für Vogelforschung Wilhelmshaven www.vogelwarte-helgoland.de http://en.wikipedia.org/wiki/red_kite Weltvorkommen Rotmilan = Europa 24-28.000 BP W. Nachtigall
Seine Zukunft liegt an uns! Franz Bairlein Institut für Vogelforschung Wilhelmshaven www.vogelwarte-helgoland.de http://en.wikipedia.org/wiki/red_kite Weltvorkommen Rotmilan = Europa 24-28.000 BP W. Nachtigall
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Vogel des Monats. Rotkehlchen. mit Fotos und Informationen von Beni und Edith Herzog.
 Vogel des Monats Rotkehlchen mit Fotos und Informationen von Beni und Edith Herzog www.lehrmittelperlen.net Das Rotkehlchen ist ein Singvogel. Es hat einen rundlichen Körper, lange, dünne Beine und ist
Vogel des Monats Rotkehlchen mit Fotos und Informationen von Beni und Edith Herzog www.lehrmittelperlen.net Das Rotkehlchen ist ein Singvogel. Es hat einen rundlichen Körper, lange, dünne Beine und ist
DER GROSSE EICHENBOCK
 Arten- und Lebensraumschutz im Nationalpark Donau-Auen und Umland DER GROSSE EICHENBOCK (Cerambyx cerdo) MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES NIEDERÖSTERREICH UND DER EUROPÄISCHEN UNION Europäischer Landwirtschaftsfonds
Arten- und Lebensraumschutz im Nationalpark Donau-Auen und Umland DER GROSSE EICHENBOCK (Cerambyx cerdo) MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES NIEDERÖSTERREICH UND DER EUROPÄISCHEN UNION Europäischer Landwirtschaftsfonds
Gartenrotschwanz-Hotspot Basel: Ökologie und laufende Förderprojekte. Hintermann & Weber AG
 Gartenrotschwanz-Hotspot Basel: Ökologie und laufende Förderprojekte Hintermann & Weber AG Schmid et al. 1998 Situation Gesamtschweiz Schweiz. Vogelwarte unpub. - Rote Liste 2010: Potenziell gefährdet
Gartenrotschwanz-Hotspot Basel: Ökologie und laufende Förderprojekte Hintermann & Weber AG Schmid et al. 1998 Situation Gesamtschweiz Schweiz. Vogelwarte unpub. - Rote Liste 2010: Potenziell gefährdet
Hansestadt Greifswald Bebauungsplan Nr. 109 Fachmarktzentrum Anklamer Landstraße
 Hansestadt Greifswald Bebauungsplan Nr. 109 Fachmarktzentrum Anklamer Landstraße Rostock, 21.03.2016 Auftraggeber: raith hertelt fuß Frankendamm 5 18439 Stralsund Auftragnehmer: Dipl. Biologe Thomas Frase
Hansestadt Greifswald Bebauungsplan Nr. 109 Fachmarktzentrum Anklamer Landstraße Rostock, 21.03.2016 Auftraggeber: raith hertelt fuß Frankendamm 5 18439 Stralsund Auftragnehmer: Dipl. Biologe Thomas Frase
Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen. Von Martin Brühne & Benedikt Gießing
 Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen Von Martin Brühne & Benedikt Gießing Es war nicht das erste Mal, dass ein Stelzenläufer (Himantopus himantopus)
Sie kommen aus dem Süden: Die Stelzenläufer Erfolgreiche Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen Von Martin Brühne & Benedikt Gießing Es war nicht das erste Mal, dass ein Stelzenläufer (Himantopus himantopus)
Der Fischadler Pandion haliaetus in Mecklenburg-Vorpommern
 Meyburg, B.-U. & R. D. Chancellor eds. 1996 Eagle Studies World Working Group on Birds of Prey (WWGBP) Berlin, London & Paris Der Fischadler Pandion haliaetus in Mecklenburg-Vorpommern Peter Hauff Innerhalb
Meyburg, B.-U. & R. D. Chancellor eds. 1996 Eagle Studies World Working Group on Birds of Prey (WWGBP) Berlin, London & Paris Der Fischadler Pandion haliaetus in Mecklenburg-Vorpommern Peter Hauff Innerhalb
Gelege- und Brutstärken von Steyregger Kohlmeisen
 Punkt ist eigentlich nichts anderes als die Bestätigung der vorhergehenden Punkte. Noch ist die Studie über Phylloscopus sibilatrix nicht abgeschlossen, doch scheint es mir, daß die wichtigsten Ergebnisse
Punkt ist eigentlich nichts anderes als die Bestätigung der vorhergehenden Punkte. Noch ist die Studie über Phylloscopus sibilatrix nicht abgeschlossen, doch scheint es mir, daß die wichtigsten Ergebnisse
Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer
 150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
Jahresbericht 2013 Zabergäu / Leintal / Kraichgau
 Liebe Mitarbeiter, Streuobstwiesenbesitzer und Steinkauz-Interessierte, der Auftakt der Brutsaison 2013 war von sonnenscheinarmen Wintermonaten und einem verspäteten Wintereinbruch im März geprägt. Fortgesetzt
Liebe Mitarbeiter, Streuobstwiesenbesitzer und Steinkauz-Interessierte, der Auftakt der Brutsaison 2013 war von sonnenscheinarmen Wintermonaten und einem verspäteten Wintereinbruch im März geprägt. Fortgesetzt
Bewerbung um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten Osnabrück WabOS e. V.
 Bewerbung um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten Wir, das heißt die Wagenburg Osnabrück (), möchten uns um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten bewerben. Obwohl
Bewerbung um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten Wir, das heißt die Wagenburg Osnabrück (), möchten uns um den Naturschutzpreis für Projekte zum Schutz von Insekten bewerben. Obwohl
Nisthilfen: Was gibt es zu beachten und wie befestigt man sie richtig?
 Nisthilfen: Was gibt es zu beachten und wie befestigt man sie richtig? Bildagentur Zoonar GmbH /Shutterstock.com Von Jahr zu Jahr werden natürliche Nisthöhlen für Vögel weniger. Löcher oder Risse in Hauswänden
Nisthilfen: Was gibt es zu beachten und wie befestigt man sie richtig? Bildagentur Zoonar GmbH /Shutterstock.com Von Jahr zu Jahr werden natürliche Nisthöhlen für Vögel weniger. Löcher oder Risse in Hauswänden
Artenschutz-Gutachten. Bauvorhaben B-Plan VI-140g/ Gleisdreieck. Pohlstraße, Pohlstraße/-Dennewitzstraße/ Kurfürstenstraße Gutachten Artenschutz
 Artenschutz-Gutachten Bauvorhaben B-Plan VI-140g/ Gleisdreieck Pohlstraße, Pohlstraße/-Dennewitzstraße/ Kurfürstenstraße Dr. Susanne Salinger Meierottostraße 5 10719 Berlin 19.12.2012 1 Inhalt Bauvorhaben
Artenschutz-Gutachten Bauvorhaben B-Plan VI-140g/ Gleisdreieck Pohlstraße, Pohlstraße/-Dennewitzstraße/ Kurfürstenstraße Dr. Susanne Salinger Meierottostraße 5 10719 Berlin 19.12.2012 1 Inhalt Bauvorhaben
Starke Bestandszunahme und hohe Siedlungsdichte des Wiedehopfes (Upupa epops) in der Vorbergzone des nördlichen Ortenaukreises
 Starke Bestandszunahme und hohe Siedlungsdichte des Wiedehopfes (Upupa epops) in der Vorbergzone des nördlichen Ortenaukreises Manfred Weber Summary: WeBer, M. (2011): Marked increase of the population
Starke Bestandszunahme und hohe Siedlungsdichte des Wiedehopfes (Upupa epops) in der Vorbergzone des nördlichen Ortenaukreises Manfred Weber Summary: WeBer, M. (2011): Marked increase of the population
Gliederung. Informationsgrundlage Probleme EOL Schätzungsmöglichkeiten Beschriebene + geschätzte Artenzahl Ausblick
 How Many Species are There on Earth? Lehrveranstaltung: Biodiversität ität und Nachhaltigkeit it Dozent: Dr. H. Schulz Referentin: Sonja Pfister Datum: 12.11.2009 11 2009 Gliederung Informationsgrundlage
How Many Species are There on Earth? Lehrveranstaltung: Biodiversität ität und Nachhaltigkeit it Dozent: Dr. H. Schulz Referentin: Sonja Pfister Datum: 12.11.2009 11 2009 Gliederung Informationsgrundlage
Proposal zur Diplomarbeit im Studiengang Agrarbiologie
 Proposal zur Diplomarbeit im Studiengang Agrarbiologie Stand: 18.01.2013 Titel: Bedeutung von Gabionen als Lebensrum für Pflanzenarten und gesellschaften im Vergleich zu traditionellen Weinbergsmauern
Proposal zur Diplomarbeit im Studiengang Agrarbiologie Stand: 18.01.2013 Titel: Bedeutung von Gabionen als Lebensrum für Pflanzenarten und gesellschaften im Vergleich zu traditionellen Weinbergsmauern
Bienenfresser im Mittleren Fuldatal Landkreis Hersfeld Rotenburg Hessen
 Bienenfresser im Mittleren Fuldatal Landkreis Hersfeld Rotenburg Hessen Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.v. Arbeitskreis Hersfeld-Rotenburg Bienenfresser im Mittleren Fuldatal
Bienenfresser im Mittleren Fuldatal Landkreis Hersfeld Rotenburg Hessen Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.v. Arbeitskreis Hersfeld-Rotenburg Bienenfresser im Mittleren Fuldatal
Kurzbericht Dipl.-Biol. Anika Lustig Faunistische Gutachten
 Kontrolle mittels Hubsteiger und Endoskopkamera von 11 Bäumen im Kester-Häusler Park, Fürstenfeldbruck im Hinblick auf ihr Quartierpotential für Fledermäuse und Vögel und Kontrolle auf aktuellen Besatz
Kontrolle mittels Hubsteiger und Endoskopkamera von 11 Bäumen im Kester-Häusler Park, Fürstenfeldbruck im Hinblick auf ihr Quartierpotential für Fledermäuse und Vögel und Kontrolle auf aktuellen Besatz
Bestandsentwicklung des Schwarzstorchs (Ciconia nigra) in Deutschland
 Bestandsentwicklung des Schwarzstorchs (Ciconia nigra) in Deutschland Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) hat von den weltweit 19 Storchenarten das größte Verbreitungsareal (Janssen, Hormann und Rohde, 2004).
Bestandsentwicklung des Schwarzstorchs (Ciconia nigra) in Deutschland Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) hat von den weltweit 19 Storchenarten das größte Verbreitungsareal (Janssen, Hormann und Rohde, 2004).
Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII. Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni
 Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni 2015 - Vor den Osterferien werden alle Meisenkästen auf dem
Blau- und Kohlmeisen auf dem Schulgelände der ERSII Projekt durchgeführt von der Klasse 5g mit Fr. Weth-Jürgens und Fr. Bender März bis Juni 2015 - Vor den Osterferien werden alle Meisenkästen auf dem
Einfluss des Klimawandels auf Brutverluste bei höhlenbrütenden Singvögeln durch Siebenschläfer (Glis glis)
 Einfluss des Klimawandels auf Brutverluste bei höhlenbrütenden Singvögeln durch Siebenschläfer (Glis glis) Dr. Carina Scherbaum-Heberer Dipl.-Biol. Bettina Koppmann-Rumpf & Dr. Karl-Heinz Schmidt Ökologische
Einfluss des Klimawandels auf Brutverluste bei höhlenbrütenden Singvögeln durch Siebenschläfer (Glis glis) Dr. Carina Scherbaum-Heberer Dipl.-Biol. Bettina Koppmann-Rumpf & Dr. Karl-Heinz Schmidt Ökologische
Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen
 Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen Wiesenbrüter sind Vögel, welche ihr Nest am Boden anlegen. Das Nest verstecken sie in einer Wiese oder Weide. In der Ausstellung Erlebnis Wiesenbrüter wird
Informationen zu Wiesenbrütern für Lehrpersonen Wiesenbrüter sind Vögel, welche ihr Nest am Boden anlegen. Das Nest verstecken sie in einer Wiese oder Weide. In der Ausstellung Erlebnis Wiesenbrüter wird
Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten?
 Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten? Die Bedeutung des Schutzes von Lebensräumen am Beispiel des Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung Maike Wilhelm, Biologische Station
Wie lässt sich der Sinkflug von Kiebitz, Feldlerche und Co aufhalten? Die Bedeutung des Schutzes von Lebensräumen am Beispiel des Vogelschutzgebietes Düsterdieker Niederung Maike Wilhelm, Biologische Station
Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge. Artenschutzrechtliche Beurteilung
 Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge Artenschutzrechtliche Beurteilung Mai 2015 Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge Artenschutzrechtliche Beurteilung
Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge Artenschutzrechtliche Beurteilung Mai 2015 Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge Artenschutzrechtliche Beurteilung
Status der Vögel Österreichs Priorisierung der Arten
 Status der Vögel Österreichs Priorisierung der Arten Dr. Remo Probst, BirdLife Österreich Seminar Netzwerk Zukunftsraum Land: Vögel in der Kulturlandschaft Ausgangslage Die finanziellen und personelle
Status der Vögel Österreichs Priorisierung der Arten Dr. Remo Probst, BirdLife Österreich Seminar Netzwerk Zukunftsraum Land: Vögel in der Kulturlandschaft Ausgangslage Die finanziellen und personelle
Bilder aus den Nistkästen in 2017
 Bilder aus den Nistkästen in 2017 Nachfolgend werden keine Videodaten, sondern nur Bilder der Innen- und Außenkameras gezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 1300 GB Speicherplatz und können
Bilder aus den Nistkästen in 2017 Nachfolgend werden keine Videodaten, sondern nur Bilder der Innen- und Außenkameras gezeigt, denn die zugehörigen Videosequenzen belegen 1300 GB Speicherplatz und können
Statistische Methoden in den Umweltwissenschaften
 Statistische Methoden in den Umweltwissenschaften Korrelationsanalysen Kreuztabellen und χ²-test Themen Korrelation oder Lineare Regression? Korrelationsanalysen - Pearson, Spearman-Rang, Kendall s Tau
Statistische Methoden in den Umweltwissenschaften Korrelationsanalysen Kreuztabellen und χ²-test Themen Korrelation oder Lineare Regression? Korrelationsanalysen - Pearson, Spearman-Rang, Kendall s Tau
Bedeutung von Flachdächern für den Bruterfolg der Haubenlerche (Galerida cristata) an ausgewählten Standorten in Wien
 Bedeutung von Flachdächern für den Bruterfolg der Haubenlerche (Galerida cristata) an ausgewählten Standorten in Wien Richard Krampl Studie im Auftrag der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 Überarbeitet
Bedeutung von Flachdächern für den Bruterfolg der Haubenlerche (Galerida cristata) an ausgewählten Standorten in Wien Richard Krampl Studie im Auftrag der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 Überarbeitet
Untersuchungen zum Einsatz von Siliermitteln zur Erhöhung der aeroben Stabilität von Pressschnitzelsilagen
 Untersuchungen zum Einsatz von Siliermitteln zur Erhöhung der aeroben Stabilität von Pressschnitzelsilagen H. Scholz,, Bernburg T. Engelhard, L. Helm, G. Andert, LLFG Iden S. Winter, N. Kuhlmann, LLFG
Untersuchungen zum Einsatz von Siliermitteln zur Erhöhung der aeroben Stabilität von Pressschnitzelsilagen H. Scholz,, Bernburg T. Engelhard, L. Helm, G. Andert, LLFG Iden S. Winter, N. Kuhlmann, LLFG
Einführung. Stefan Kilian. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. IAB 4a: Kulturlandschaft, Landschaftsentwicklung
 Einführung Stefan Kilian Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft IAB 4a: Kulturlandschaft, Landschaftsentwicklung EMail: streuobst@lfl.bayern.de Internet: www.lfl.bayern.de/streuobst Entwicklung und
Einführung Stefan Kilian Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft IAB 4a: Kulturlandschaft, Landschaftsentwicklung EMail: streuobst@lfl.bayern.de Internet: www.lfl.bayern.de/streuobst Entwicklung und
Die Rückkehr der Störche in die Wetterau. Ralf Eichelmann Wetteraukreis - Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege
 Die Rückkehr der Störche in die Wetterau Ralf Eichelmann Wetteraukreis - Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege Der Weißstorch (Ciconia ciconia) Auenlandschaften - Lebensraum der Störche Nahrung:
Die Rückkehr der Störche in die Wetterau Ralf Eichelmann Wetteraukreis - Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege Der Weißstorch (Ciconia ciconia) Auenlandschaften - Lebensraum der Störche Nahrung:
5. Lektion: Einfache Signifikanztests
 Seite 1 von 7 5. Lektion: Einfache Signifikanztests Ziel dieser Lektion: Du ordnest Deinen Fragestellungen und Hypothesen die passenden einfachen Signifikanztests zu. Inhalt: 5.1 Zwei kategoriale Variablen
Seite 1 von 7 5. Lektion: Einfache Signifikanztests Ziel dieser Lektion: Du ordnest Deinen Fragestellungen und Hypothesen die passenden einfachen Signifikanztests zu. Inhalt: 5.1 Zwei kategoriale Variablen
Wiedehopfpaar zieht Wendehalsnestlinge bis zum Ausfliegen auf
 Der Ornithologische Beobachter / Band 105 / Heft 2 / Juni 2008 153 Wiedehopfpaar zieht Wendehalsnestlinge bis zum Ausfliegen auf Murielle Mermod, Thomas S. Reichlin, Raphaël Arlettaz und Michael Schaub
Der Ornithologische Beobachter / Band 105 / Heft 2 / Juni 2008 153 Wiedehopfpaar zieht Wendehalsnestlinge bis zum Ausfliegen auf Murielle Mermod, Thomas S. Reichlin, Raphaël Arlettaz und Michael Schaub
Verteilung und Überlebensrate von L. helle im Nord Westen Rumäniens bei unterschiedlicher Waldnutzung
 Verteilung und Überlebensrate von L. helle im Nord Westen Rumäniens bei unterschiedlicher Waldnutzung Herta Dancs, László Rákosy, Cristina Craioveanu und Matthias Dolek Department of Taxonomy and Ecology,
Verteilung und Überlebensrate von L. helle im Nord Westen Rumäniens bei unterschiedlicher Waldnutzung Herta Dancs, László Rákosy, Cristina Craioveanu und Matthias Dolek Department of Taxonomy and Ecology,
Bestandsentwicklung und Brutbiologie einer Nistkastenpopulation des Halsbandschnäppers Ficedula albicollis
 Joannea Zool. 7: 7 17 (2005) Bestandsentwicklung und Brutbiologie einer Nistkastenpopulation des Halsbandschnäppers Ficedula albicollis (TEMMINCK, 1815) in der Oststeiermark, Österreich (Aves) Otto SAMWALD
Joannea Zool. 7: 7 17 (2005) Bestandsentwicklung und Brutbiologie einer Nistkastenpopulation des Halsbandschnäppers Ficedula albicollis (TEMMINCK, 1815) in der Oststeiermark, Österreich (Aves) Otto SAMWALD
Einfluss von Windkraftanlagen auf die Brutplatzwahl ausgewählter Großvögel (Kranich, Rohrweihe und Schreiadler)
 Einfluss von Windkraftanlagen auf die Brutplatzwahl ausgewählter Großvögel (Kranich, Rohrweihe und Schreiadler) Wolfgang Scheller (Teterow) Windenergie im Spannungsfeld zwischen Klima- und Naturschutz
Einfluss von Windkraftanlagen auf die Brutplatzwahl ausgewählter Großvögel (Kranich, Rohrweihe und Schreiadler) Wolfgang Scheller (Teterow) Windenergie im Spannungsfeld zwischen Klima- und Naturschutz
Kinder- und Jugend- Gesundheitsbericht 2010 für die Steiermark
 Kinder- und Jugend- Gesundheitsbericht 2010 für die Steiermark Gesundheitsziel: Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben schaffen Gesundes und selbstbestimmtes Leben mit Familie, Partnerschaft und Sexualität
Kinder- und Jugend- Gesundheitsbericht 2010 für die Steiermark Gesundheitsziel: Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben schaffen Gesundes und selbstbestimmtes Leben mit Familie, Partnerschaft und Sexualität
Betriebszweigauswertung in der Schweinehaltung in Österreich biologische Kennzahlen der Ferkelproduktion aus dem Jahr 2000
 Ländlicher Raum 5 / 21 1 Leopold Kirner Betriebszweigauswertung in der Schweinehaltung in Österreich biologische Kennzahlen der Ferkelproduktion aus dem Jahr 2 1 Arbeitskreisberatung und Betriebszweigauswertung
Ländlicher Raum 5 / 21 1 Leopold Kirner Betriebszweigauswertung in der Schweinehaltung in Österreich biologische Kennzahlen der Ferkelproduktion aus dem Jahr 2 1 Arbeitskreisberatung und Betriebszweigauswertung
Gemeinde Oberderdingen
 Gemeinde Oberderdingen Geplantes Baugebiet Industriegebiet, 7. Abschnitt (Kreuzgarten) Artenschutzrechtliche Prüfung Auftraggeber: Gemeinde Oberderdingen Amthof 13 75038 Oberderdingen Auftragnehmer: THOMAS
Gemeinde Oberderdingen Geplantes Baugebiet Industriegebiet, 7. Abschnitt (Kreuzgarten) Artenschutzrechtliche Prüfung Auftraggeber: Gemeinde Oberderdingen Amthof 13 75038 Oberderdingen Auftragnehmer: THOMAS
Ausfüllhilfe Titelblätter für wissenschaftliche Arbeiten
 Ausfüllhilfe Titelblätter für Die vorliegende wissenschaftliche dokumentiert einen wichtigen Schritt, den Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung an der Uni Wien absolviert haben. Um die Zugehörigkeit Ihrer Person
Ausfüllhilfe Titelblätter für Die vorliegende wissenschaftliche dokumentiert einen wichtigen Schritt, den Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung an der Uni Wien absolviert haben. Um die Zugehörigkeit Ihrer Person
Pilottestung der Standard-Orientierungsaufgaben ERGEBNISSE
 Pilottestung der Standard-Orientierungsaufgaben für die mathematischen Fähigkeiten der österreichischen Schülerinnen und Schüler am Ende der 8. Schulstufe ERGEBNISSE Auftraggeber Österreichisches Kompetenzzentrum
Pilottestung der Standard-Orientierungsaufgaben für die mathematischen Fähigkeiten der österreichischen Schülerinnen und Schüler am Ende der 8. Schulstufe ERGEBNISSE Auftraggeber Österreichisches Kompetenzzentrum
1. Einwendungen zum Regionalplan Main-Rhön sowie Stellungnahmen des Regionalverbands
 1. Einwendungen zum Regionalplan Main-Rhön sowie Stellungnahmen des Regionalverbands zu WK 3 (bei Hendungen) E 146 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.v. 22.02.2012 1 km-zone zu Rotmilan und Baumfalke
1. Einwendungen zum Regionalplan Main-Rhön sowie Stellungnahmen des Regionalverbands zu WK 3 (bei Hendungen) E 146 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.v. 22.02.2012 1 km-zone zu Rotmilan und Baumfalke
Infoabend Fasanenprojekte
 Information, Ergebnisse und Diskussionen Infoabend Fasanenprojekte Dipl.-Biol. Ulrich Voigt 24.10.2012 in Schwagstorf Fasanenprojekte ITAW Prädation Rückgangsursachen Krankheiten 2011-2013 U. Voigt 2011/2012
Information, Ergebnisse und Diskussionen Infoabend Fasanenprojekte Dipl.-Biol. Ulrich Voigt 24.10.2012 in Schwagstorf Fasanenprojekte ITAW Prädation Rückgangsursachen Krankheiten 2011-2013 U. Voigt 2011/2012
Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis
 Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis Einleitung Bericht zum Praktikum Räuber-Beute-Interaktionen an der Ludwig-Maximilians-Universität München SS
Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis Einleitung Bericht zum Praktikum Räuber-Beute-Interaktionen an der Ludwig-Maximilians-Universität München SS
ABStadt. Glühwürmchen Zweite Zeile. Luzern. Stichwort. Bild 9.7 x ca öko-forum. Stadt Luzern. öko-forum
 Luzern öko-forum ABStadt Stichwort Glühwürmchen Zweite Zeile Bild 9.7 x ca. 7.25 Stadt Luzern öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 6004 Luzern Telefon: 041 412 32 32 Telefax: 041 412 32 34
Luzern öko-forum ABStadt Stichwort Glühwürmchen Zweite Zeile Bild 9.7 x ca. 7.25 Stadt Luzern öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 6004 Luzern Telefon: 041 412 32 32 Telefax: 041 412 32 34
Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 4 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 4 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Gefährdete Tierarten der Wacholderheiden und ihre Berücksichtigung bei Pflegemaßnahmen. Dr. Thomas Bamann, Frühschoppen BUND Lonsee,
 Gefährdete Tierarten der Wacholderheiden und ihre Berücksichtigung bei Pflegemaßnahmen Dr. Thomas Bamann, Frühschoppen BUND Lonsee, 22.01.2017 Grundlagen Wacholderheiden als Lebensraum zahlreicher Pflanzen-
Gefährdete Tierarten der Wacholderheiden und ihre Berücksichtigung bei Pflegemaßnahmen Dr. Thomas Bamann, Frühschoppen BUND Lonsee, 22.01.2017 Grundlagen Wacholderheiden als Lebensraum zahlreicher Pflanzen-
Die Entwicklung des Weißstorchbestandes (Ciconia ciconia) im Altkreis Angermünde in den letzten 10 Jahren, *)
 UWE SCHÜNMANN UND ANSGAR VÖSSING Die Entwicklung des Weißstorchbestandes (Ciconia ciconia) im Altkreis Angermünde in den letzten 10 Jahren, 2006-2015 *) Erschienen in: Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal
UWE SCHÜNMANN UND ANSGAR VÖSSING Die Entwicklung des Weißstorchbestandes (Ciconia ciconia) im Altkreis Angermünde in den letzten 10 Jahren, 2006-2015 *) Erschienen in: Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal
Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen
 Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen Ergebnisüberblick Heiko Hinneberg heiko.hinneberg@web.de Methoden Habitatbeschaffenheit
Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen Ergebnisüberblick Heiko Hinneberg heiko.hinneberg@web.de Methoden Habitatbeschaffenheit
Abhängigkeit der Lebensraumqualität des Schreiadlers von der Landwirtschaft
 Abhängigkeit der Lebensraumqualität des Schreiadlers von der Landwirtschaft Wolfgang Scheller (Projektgruppe Großvogelschutz beim LUNG M-V ) 1. Ernst-Boll-Naturschutztag Neubrandenburg, 6. November 2010
Abhängigkeit der Lebensraumqualität des Schreiadlers von der Landwirtschaft Wolfgang Scheller (Projektgruppe Großvogelschutz beim LUNG M-V ) 1. Ernst-Boll-Naturschutztag Neubrandenburg, 6. November 2010
Genetische Untersuchungen der Bachforelle in Österreich: Was haben wir daraus gelernt?
 Genetische Untersuchungen der Bachforelle in Österreich: Was haben wir daraus gelernt? Steven Weiss Institut für Zoologie, Karl-Franzens Universität Graz Datenübersicht Region Anzahl der Pop. Anzahl Fische
Genetische Untersuchungen der Bachforelle in Österreich: Was haben wir daraus gelernt? Steven Weiss Institut für Zoologie, Karl-Franzens Universität Graz Datenübersicht Region Anzahl der Pop. Anzahl Fische
Erfolgskontrolle künstlicher Bruthilfen am Standort Sommeritz
 2011 Erfolgskontrolle künstlicher Bruthilfen am Standort Sommeritz Bearbeiter: Betreuer: Hochschule: Studiengang: Verena Schäfer Susanne Scholz Prof. Dr. Klaus Richter Hochschule Anhalt (FH) Naturschutz
2011 Erfolgskontrolle künstlicher Bruthilfen am Standort Sommeritz Bearbeiter: Betreuer: Hochschule: Studiengang: Verena Schäfer Susanne Scholz Prof. Dr. Klaus Richter Hochschule Anhalt (FH) Naturschutz
Brutnachweis des Wiedehopfes Upupa epops, L im Stromberg / Nordwürttemberg (Landkreis Ludwigsburg)
 Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.v. - www.ogbw.de Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 24: 147-151 (2008) Kurze Mitteilung Brutnachweis des Wiedehopfes Upupa epops, L. 1758 im Stromberg / Nordwürttemberg
Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e.v. - www.ogbw.de Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 24: 147-151 (2008) Kurze Mitteilung Brutnachweis des Wiedehopfes Upupa epops, L. 1758 im Stromberg / Nordwürttemberg
Bestandssituation und Entwicklung des Vertragsnaturschutzes für den Rotmilan in Niedersachsen
 Bestandssituation und Entwicklung des Vertragsnaturschutzes für den Rotmilan in Niedersachsen Knut Sandkühler NLWKN Staatliche Vogelschutzwarte Inhalt Bestand in Niedersachsen Datenlage Verbreitung Bestandsentwicklung
Bestandssituation und Entwicklung des Vertragsnaturschutzes für den Rotmilan in Niedersachsen Knut Sandkühler NLWKN Staatliche Vogelschutzwarte Inhalt Bestand in Niedersachsen Datenlage Verbreitung Bestandsentwicklung
Bezirk: Schwaz. 926_26250_13 926_26251_15 926_26252_12 Streuobstwiesen der Gemeinde Schwaz Streuobstwiesen (MSW) 8,82.
 BIOTOPINVENTAR Gemeinde: Biotopnummer: interner Key: Biotopname: Biotoptypen: Fläche (ha): Flächenanzahl: Seehöhe: Kartierung: Schwaz Bezirk: Schwaz 2625-100/13 2625-101/15 2625-102/12 926_26250_13 926_26251_15
BIOTOPINVENTAR Gemeinde: Biotopnummer: interner Key: Biotopname: Biotoptypen: Fläche (ha): Flächenanzahl: Seehöhe: Kartierung: Schwaz Bezirk: Schwaz 2625-100/13 2625-101/15 2625-102/12 926_26250_13 926_26251_15
Eule in Wohnungsnot. Die Schleiereule Jägerin auf leisen Schwingen
 Eule in Wohnungsnot Zauberhaft schön ist sie, die etwa taubengroße Schleiereule: Oberseits goldbraun, die Unterseite rostbraun bis weiß. Wie ein feines Gespinst scheint über ihr Federkleid ein "Perlenschleier"
Eule in Wohnungsnot Zauberhaft schön ist sie, die etwa taubengroße Schleiereule: Oberseits goldbraun, die Unterseite rostbraun bis weiß. Wie ein feines Gespinst scheint über ihr Federkleid ein "Perlenschleier"
Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften
 Umweltforschungsplan 2011 FKZ 3511 86 0200 Anpassungskapazität ausgewählter Arten im Hinblick auf Änderungen durch den Klimawandel Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften Elisabeth
Umweltforschungsplan 2011 FKZ 3511 86 0200 Anpassungskapazität ausgewählter Arten im Hinblick auf Änderungen durch den Klimawandel Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften Elisabeth
Skiunfälle der Saison 2000/2001
 Skiunfälle der Saison 2000/2001 H. Gläser Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG Sportversicherung (ASU Ski) Die Auswertung der Skiunfälle der Saison 2000/2001 läßt wie schon in den vergangenen Jahren
Skiunfälle der Saison 2000/2001 H. Gläser Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG Sportversicherung (ASU Ski) Die Auswertung der Skiunfälle der Saison 2000/2001 läßt wie schon in den vergangenen Jahren
Warum sind Greifvögel (& Eulen) gefährdet? eine Ursachenanalyse
 Warum sind Greifvögel (& Eulen) gefährdet? eine Ursachenanalyse Dr. Richard Zink Veterinärmedizinische Universität Wien 1.) Natürliche Todesursachen 2.) Anthropogen bedingte Gefährdung Ursachen Natürliche
Warum sind Greifvögel (& Eulen) gefährdet? eine Ursachenanalyse Dr. Richard Zink Veterinärmedizinische Universität Wien 1.) Natürliche Todesursachen 2.) Anthropogen bedingte Gefährdung Ursachen Natürliche
Pressekonferenz. Thema: Vorstellung des Geburtenbarometers - Eine neue Methode zur Messung der Geburtenentwicklung
 Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Kiebitz und Feldlerche im Flachgau
 Kiebitz und Feldlerche im Flachgau 12.01.17 Regionalseminar ÖPUL-schutz in Salzburg: Wir haben es in der Hand Dr. Susanne Stadler Land Salzburg, Abt. 5 Referat schutzgrundlagen und Sachverständigendienst
Kiebitz und Feldlerche im Flachgau 12.01.17 Regionalseminar ÖPUL-schutz in Salzburg: Wir haben es in der Hand Dr. Susanne Stadler Land Salzburg, Abt. 5 Referat schutzgrundlagen und Sachverständigendienst
Erfassung von Kranich und Rotmilan im Bereich des Spitzberges bei Rangsdorf zum Bauvorhaben Gewerbeerweiterung Theresenhof
 Erfassung von Kranich und Rotmilan im Bereich des Spitzberges bei Rangsdorf zum Bauvorhaben Gewerbeerweiterung Theresenhof Juni 2015 Auftraggeber: Auftragnehmer: Dr. Szamatolski + Partner GbR Brunnenstraße
Erfassung von Kranich und Rotmilan im Bereich des Spitzberges bei Rangsdorf zum Bauvorhaben Gewerbeerweiterung Theresenhof Juni 2015 Auftraggeber: Auftragnehmer: Dr. Szamatolski + Partner GbR Brunnenstraße
Pfiffner & Birrer Projekt «Mit Vielfalt punkten»
 «Mit Vielfalt Punkten (MVP)» Ein Forschungs- und Umsetzungsprojekt (2009 2016) Lukas Pfiffner & Simon Birrer Biodiversität Grundlage Ökosystemleistungen Natürliche Bestäubung, Schädlingsregulation, fruchtbarer
«Mit Vielfalt Punkten (MVP)» Ein Forschungs- und Umsetzungsprojekt (2009 2016) Lukas Pfiffner & Simon Birrer Biodiversität Grundlage Ökosystemleistungen Natürliche Bestäubung, Schädlingsregulation, fruchtbarer
Management von Wasservögeln an Badestränden. Gerd Bauschmann Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
 Management von Wasservögeln an Badestränden Gerd Bauschmann Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 1 Jahresbrut (oft Nachgelege) Legezeit März bis Juni 7-11 (5-15) Eier
Management von Wasservögeln an Badestränden Gerd Bauschmann Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 1 Jahresbrut (oft Nachgelege) Legezeit März bis Juni 7-11 (5-15) Eier
Artenschutzprojekt Trauerseeschwalbe Chlidonias niger Zahlreiche Haubentaucher Podiceps cristatus nisten sich in der einzigen Brutkolonie in NRW ein
 Charadrius 45, Heft 2, 29: 57-61 57 Artenschutzprojekt Trauerseeschwalbe Chlidonias niger Zahlreiche Haubentaucher Podiceps cristatus nisten sich in der einzigen Brutkolonie in NRW ein Achim Vossmeyer
Charadrius 45, Heft 2, 29: 57-61 57 Artenschutzprojekt Trauerseeschwalbe Chlidonias niger Zahlreiche Haubentaucher Podiceps cristatus nisten sich in der einzigen Brutkolonie in NRW ein Achim Vossmeyer
