Wachsen mit Weitsicht. Kulturnachwuchs und Integration durch lokale Kultur und Bildung
|
|
|
- Reinhold Baumhauer
- vor 4 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Wachsen mit Weitsicht Kulturnachwuchs und Integration durch lokale Kultur und Bildung 10. hamburger ratschlag stadtteilkultur 6. und 7. november 2009 IM KÖRBER-FORUM UND IM HAUS DREI, HOSPITALSTRASSE 107 herausgeber: landesrat für stadtteilkultur der behörde für kultur, sport und medien hamburg
2 I N H A LT S V E R Z E I C H N I S GRUSSWORT Prof. Dr. Karin v. Welck STADTTEILKULTUR-REVUE Yvonne Fietz: 30 Jahre und kein bisschen leise! EINFÜHRUNG Yvonne Fietz: Kulturnachwuchs und Integration durch lokale Kultur und Bildung ÖKONOMISCH WACHSEN Dr. Gesa Birnkraut und Bettina Trabandt: Ökonomisch wachsen aber wie? WACHSEN MIT KUNST UND KREATIVITÄT Katja Jacobsen: Die goldene Wandse Stephanie Probst: Stadtteilorientierte Audioarbeit am Beispiel der MOTTE Dr. Thomas Voß: Medienkompetenzförderung Diskussionsprotokoll WACHSEN DER INTEGRATION UND MITGESTALTUNG Dr. Jörg Ernst: Jugendliche mit Migrationshintergrund als Kulturbotschafter Ralf Henningsmeyer: Ansätze des freiwilligen Engagaments Diskussionsprotokoll QUALITATIVES WACHSTUM Werner Frömming und Prof. Dr. Dieter Haselbach: Qualität und Evaluation der er Stadtteilkultur Diskussionsprotokoll REFERENTINNEN UND REFERENTEN TEILNEHMERLISTE IMPRESSUM SCHATZKARTE HAMBURG
3 4 Prof. Dr. Karin v. Welck Senatorin der Behörde für Kultur, Sport und Medien Lieber Herr Hartig, sehr geehrte Gäste aus hamburgischer Politik und Verwaltung, liebe Akteure aus Einrichtungen und Projekten der Stadtteilkultur, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zunächst der Körber-Stiftung für ihre großzügige Gastfreundschaft bei der Unterstützung des 10. er Ratschlages Stadtteilkultur danken. Es könnte mit Blick auf das Jubiläumsjahr und die großartige Initiative»Anstiften! 50 Impulse für «aus meiner Sicht kaum einen besseren Ort geben, um dreißig Jahre Stadtteilkulturarbeit in unserer Stadt zu würdigen. Vielen Dank, dass wir das hier tun können! Die»Initiative ergreifen«und»etwas anstiften«ist eine Metapher, die auch das Kraftfeld stadtteilkultureller Initiativen von den Anfängen Ende der Siebziger-Jahre bis heute sehr gut beschreibt. Dass wir es gemeinsam geschafft haben, dieses spannende kulturpolitische Feld um Klippen und über Untiefen hinweg bis heute in der gebotenen Differenziertheit zu gestalten, ist eine Leistung, auf die wir stolz sein können und für die ich vor allem den Akteuren der Stadtteilkultur meine Anerkennung und meinen Dank ausspreche! Sie schaffen mit Ihren kulturellen Initiativen Lebensqualität in dieser Stadt, auf die keiner mehr verzichten möchte. Stadtteilkultur steht für ein ausdifferenziertes kulturelles Praxisfeld im Überschneidungsbereich von Kunst, Kultur, Bildung und Sozialem mit sozialräumlichem Fokus außerhalb der etablierten Kunst- und Kultureinrichtungen. Sie stellt die Künste in einen alltagswirksamen, gesellschaftlichen Zusammenhang und verknüpft den Zugang zu Kunst und Kultur für alle Bevölkerungsgruppierungen mit kreativer Eigentätigkeit. Darüber hinaus steht sie für die Integration verschiedener Altersgruppen, sozialer Schichten und unterschiedlicher Nationalitäten durch kulturelle Aktivitäten und trägt damit auch zum»innergesellschaftlichen Kulturaustausch«bei. Lassen Sie mich an dieser Stelle ein deutliches und frühes Bekenntnis für eine»kultur für alle von allen«einbringen: Mir ist die Erforschung des Zusammenhanges von kultureller Praxis und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung breiter Zugänge zu Kunst und Kultur immer ein zentrales Anliegen gewesen. Sie waren und sind für mich keine überholten Leerformeln, sondern absolut zeitgemäße Grundbedingungen und Zielmarken erfolgreicher Politik in einer demokratischen Gesellschaft, die als Wissensgesellschaft unter Mobilisierung all ihrer kreativen und sozialen Potenziale zukunftsfähig werden will. Kultureller Reichtum meint hier eben nicht Distinktionsgewinn elitärer Zirkel oder exklusive Verfügungsgewalt über Werte des Kunst- und Kulturmarktes. Er bezeichnet vielmehr die Chance, in einer schöpferischen und respektvollen Auseinandersetzung mit kulturellem Erbe auch die Lust an der eigenen Kreativität zu entdecken und sie als Wachstumspotenzial für persönlichen und gesellschaftlichen Reichtum zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund freue ich mich darüber, dass soziokulturelle Einrichtungen in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und so die Einschätzung der»enquetekommission Kultur«auf Bundesebene ein fester Bestandteil der kulturellen Infrastruktur in Deutschland und natürlich auch in geworden sind. Ich nenne bekannte Themenfelder, in denen wir nach politischen Perspektiven und Antworten auf Fragen nach veränderter gesellschaftlicher Praxis suchen: Die demografische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf unsere gesellschaftlichen Subsysteme insbesondere das Verhältnis der Generationen und die Perspektive einer älter werdenden Gesellschaft angesichts einer sich umkehrenden Alterspyramide. Die Erfindung neuer Lebensformen und sozialer Gemeinschaften angesichts schwindender Bindungskräfte traditioneller Familienstrukturen und angesichts fortschreitender Individualisierung. Die Sorge um Strukturen des sozialen Ausgleichs zwischen Modernisierungsgewinnern und -verlierern.
4 5 Der Umgang mit kultureller Differenz in einem wachsenden Europa, in dem die Migrationserfahrung aus der biografischen Randlage ins gesellschaftliche Zentrum rückt. Die Einlösung von»bildung«als Versprechen auf Freiheit, Glück und die Entwicklung eines selbstbestimmten Lebens abseits strukturell verankerter Defizite in formalen Bildungsprozessen und enger Orientierung auf kognitive Dimensionen. Auf diese Fragen bezogen unterstreichen Einrichtungen und Akteure der Stadtteilkultur immer wieder mit gelungenen Projekten, Impulsen und Strategien ihre Bedeutung und Anschlussfähigkeit. Stadtteilkultur stößt in den unterschiedlichen Dimensionen städtischer Politik auf gute Resonanz: mit sozialräumlich orientierten Konzepten kultureller Bildung, Impulsprojekten für die Stadtteilentwicklung, Ansätzen zum Umgang mit demografischem Wandel, mit interkultureller Arbeit, überzeugenden kinder- und jugendkulturellen Profilen und nicht zuletzt immer wieder auch durch den Bezug auf unser kulturelles Erbe, der Geschichte der Stadt bzw. die eigene Geschichte. Wir haben gestern auf dem Rathausmarkt eine selbstbewusste Präsentation der Leistungen er Geschichtswerkstätten erlebt. Das gibt mir Gelegenheit, die Bedeutung dieser Einrichtungen hervorzuheben.»der demografische Alterungsprozess der Gesellschaft verstärkt das Bedürfnis nach Orientierung in einer unübersichtlicher gewordenen Welt sowie nach Rückbesinnung auf Selbsterlebtes«. Das hat der Bundeskongress der Kulturpolitischen Gesellschaft im Sommer 2009 treffend unterstrichen. Erinnerungskultur befindet sich aber in stetem Wandel und muss sich auf veränderte Strukturen der Einwanderungsgesellschaft mit pluralisierten Geschichtsbildern und veränderten medialen Präsentationen von»geschichte«einstellen. In der»erinnerungskultur«ein Begriff, der noch vor nicht allzu langer Zeit kaum gebräuchlich war zeigt sich in besonderer Weise der tiefe Einschnitt, den die nationalsozialistischen Verbrechen und der Holocaust bewirkten. Das Gedächtnis der Stadt wach zu halten, ist ein Auftrag, der sich an alle er richtet. Denn nur wer sich dieser Vergangenheit stellt, kann couragiert für eine gemeinsame Zukunft eintreten. Ich bin den er Geschichtswerkstätten sehr dankbar, dass sie hier ihren besonderen Beitrag leisten. Stadtteilkultur ist ein Feld kultureller Initiative und bürgerschaftlichen Engagements, das die Behörde für Kultur, Sport und Medien mit ihrer Richtlinienkompetenz und die Bezirke der Freien und Hansestadt mit ihrer Zuwendungspraxis immer wieder zu produktiver Zusammenarbeit herausfordert. Das habe ich in zahlreichen konstruktiven Gesprächen mit Kommunalpolitik und Bezirksamtsleitungen im Verlauf diesen Jahres wieder deutlich wahrnehmen können. Die zurzeit laufende externe Evaluation zur Leistungsfähigkeit der Einrichtungen und Wirksamkeit von Förderstrukturen bietet uns da neuen Gesprächsstoff. Ich hoffe sehr, dass es gelingt, auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse die Bedeutung stadtteilkultureller Arbeit mit neuer Kraft ins öffentliche Bewusstsein zu heben und den Diskurs im politischen Raum neu zu beleben. Die Koalitionsfraktionen auf Bürgerschaftsebene haben dazu ihre Bereitschaft bereits bekundet. Ich freue mich darüber, dass mit dem Landesrat für Stadtteilkultur eine Form gefunden wurde, den fachlichen Austausch unter Beteiligung der Akteure des Feldes über Bezirksgrenzen hinweg zu ermöglichen und zu befördern. Der diesjährige 10. er Ratschlag Stadtteilkultur zeigt, dass die Struktur lebt und die Debatte um stadtteilkulturelle Perspektiven immer wieder bereichert. Ausdrücklich danke ich allen, die sich auf den unterschiedlichen Arbeitsebenen an der Gestaltung des Fachdiskurses beteiligt haben oder weiterhin beteiligen. Mein Dank gilt darüber hinaus ganz besonders denjenigen, die sich an der Vorbereitung des 10. er Ratschlages Stadtteilkultur beteiligt haben. Ich bin gespannt auf die weiteren Beiträge und wünsche uns noch einen anregenden Abend.
5 6 Yvonne Fietz 30 Jahre und kein bisschen leise! Anlässlich des 30. Jubiläums der Ha m b u rger Stadtteilkultur-Förderung lud der Landesrat für Stadtteilkultur am 6. November 2009 zu einer prall mit Lebendigkeit und Vielfalt gefüllten STADTTEILKULT U R - R EVUE ins Körber-Forum in der Ke h r w i e d e r s p i t ze ein und gab damit Einblicke in die Erfolgsgeschichte einer noch jungen Kultursparte mit: L i ve - Musik, Theater, Filme und viele Geschichten und Anekdoten beim POLIT-TALK und KULTUR-TALK. I n keinem anderen Bundesland wurde die Stadtteilund Soziokultur so kontinuierlich und mit einem so hoch entwickelten Förderinstrument öffentlich unterstützt, so wundert es nicht, dass die STADTTEILKULTURREVUE anlässlich des 30. Jubiläums der er Stadtteilkultur-Förderung zu einem sehr lebendigen, unterhaltsamen und vielstimmigen Abend wurde. Helga Schuchardt setzte sich von 1983 bis 87 als Den Rückblick in die er Kultursenatorin Anfänge verknüpfte die für die Stadtteilkultur ein. Revue programmatisch mit aktuellen Entwicklungen und Vorhaben. So wurde eine Brücke gebaut zwischen einer sich langsam entwickelnden»tradition«und jüngsten Entwicklungsperspektiven. Lautstark und mitreißend blies»tuten&blasen«den Auftakt zur STADTTEILKULTUR-REVUE, während sie im Hintergrund noch als Mitstreiter bei einer der ersten Hausbesetzungen der Stadtteilkultur zu sehen waren. Gert Hinnerk Behlmer (Staatsrat a.d.) begeistert sich besonders für die Geschichtswerkstätten. Zum von Dr. Gesa Birnkraut charmant moderierten POLIT-TALK wurden Podiumsgäste aus der Frühzeit eingeladen, die sich noch mit für sie völlig neuen Kulturphänomenen und gesell- schaftlichen Praktiken wie Haus- und Straßenbesetzungen konfrontiert sahen (Helga Schuchardt, Klaus Lattmann und Magrete Wulf-Slabaugh). In einer zweiten Runde diskutierten Gert HinMagrete Wulf-Slabaugh nerk Behlmer, Dr. Norbaute das Referat»Freizeit bert Sievers, Prof. Dr. und Stadtteilkultur«in der Karin v. Welck und Kulturbehörde auf. Ansgar Wimmer aktuelle Konzepte und Herausforderungen der er Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten. Anlässlich des 30. Jubiläums der Stadtteilkultur-Förderung erstellte Ulrich Raatz im Auftrag der Behörde für Kultur, Sport und Medien einen Film über die Qualitäten der Stadtteilkultur (www. hamburg.de/stadtteilkultur/ /video-stadtteilkultur.html), in dem weitere Wegbereiter und -gefährten zu Wort kommen: Christina Weiss, Dana Horakova, Uwe Voigt, Brigitta Martens und Eva Gümbel. Als langjähriger kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion war Klaus Lattmann schon immer vom Engagement der Stadtteilkultur begeistert. Außerdem wurde aus Archiven für die Revue historisches Bild- und Filmmaterial zusammengestellt, die ersten Stadtteilkultur-Werbespots wurden zum Besten gegeben und erste Medienproduktionen aus der Fatih Akinschen Talentschmiede, der Mottenschau.
6 7 Was wäre die Stadtteilkultur ohne ihre Künstler und Produktionen? Herr Momsen gab sich die Ehre und beleuchtete das Wesen der Stadtteilkultur aus der Perspektive einer Handpuppe. Die Hexen aus»shakespeare auf St. Pauli«trieben bei der STADTTEILKULTUR- REVUE allerlei Hexereien und schließlich Musikalische Nachwuchsförderung vom Feinsten entwickelte Dörte Inselmann mit der HipHop Academy und den Klangstrolchen. brachte die Masterclass der HipHop Academy des Kulturpalastes mit ihrer -Hymne spät am Abend noch einmal richtig Stimmung in das Körber-Forum. Die Frage, welche Kompetenzen in der Stadtteilkultur erwerbbar sind und wie Gelingensbedingungen gestaltet werden können, wurde beim KULTUR-TALK mit Michael Batz, Dr. Thomas Voss, Christiane Richers und Dörte Inselmann diskutiert. Die Geschichtswerkstätten- Präsentation von 150 Bildern aus 100 Jahren Alltagsgeschichte moderierte der Lichtkünstler Michael Batz auf dem Rathausmarkt im japanischen»pecha-kucha«verfahren. Die STADTTEILKULTUR- REVUE zeigte den beschwerlichen und zugleich dynamischenthusiastischen Start der Stadtteil- und Soziokultur in auf. Es war ein großes Fest der Wegbereiter und Weggefährten, ohne die diese junge Kultursparte nicht so gut hätte wachsen und gedeihen können. Die Revue zeigte auch noch einmal, welch breiten kulturpolitischen Rückhalt die Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten haben: fraktionsübergreifend wurden vor 30 Jahren die ersten Förderungen beschlossen und fraktionsübergreifend setzen sich Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker bis heute mit Herzblut und Christiane Richers kooperiert bei Stadtteilinszenierungen mit Kulturzentren und Geschichtswerkstätten. Verstand für die gemeinsame Sache ein: die er Stadtteilkultur. Sie ist mehr denn je Ausdruck des Engagements der Bürgerinnen und Bürger für das Wohlergehen ihres Stadtteils und ihrer Stadt. Als Impulsgeber für positive Stadtteilentwicklungsprozesse, Talentschmiede für den künstlerischen Nachwuchs, als Bühne und Konzerthalle jenseits des Mainstreams, als Schmelztiegel neuer sozialer und gesellschaftlicher Praktiken und Werte und als lebendiger und beliebter Treffpunkt im Stadtteil sorgen Kulturzentren für die Erneuerungsfähigkeit ihres Quartiers und der Stadt insgesamt. Insofern stand auch die STADTTEILKULTUR-RE- VUE schon unversehens unter dem gleichen Motto wie der Fachdiskurs»Wachsen mit Weitsicht Kulturnachwuchs und Integration durch lokale Kultur und Bildung«, der am folgenden Tag im Haus Drei von Fachleuten aus Theorie und Praxis vertieft wurde. Ansgar Wimmer trägt als Sprecher des Beirates im Evaluationsprojekt Stadtteilkultur zum Gelingen bei. Dr. Thomas Voss von der Medienanstalt Schleswig-Holstein setzt sich für die Medienkompetenzförderung in der Stadtteilkultur ein. Die STADTTEILKULTUR- REVUE hat auch gezeigt, dass es der er Stadtteilkultur vorzüglich gelungen ist, mit Weitsicht zu wachsen, denn nie war sie so aktuell und gesellschaftlich relevant wie heute da kann man ja auf die nächsten 30 Jahre schon sehr gespannt sein! Als Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft ist Dr. Norbert Sievers ein langjähriger Unterstützer der Soziokultur auf Bundesebene.
7 8 WACHSEN MIT WEITSICHT Kulturnachwuchs und Integration durch lokale Kultur und Bildung Wie kaum einer anderen öffentlich geförderten Kultursparte ist es der Stadtteil- und Soziokultur in den ve rg a n g e n e n Ja h ren gelungen, vor dem Hi n t e rgrund aktueller He r a u s f o rderungen ihre gesellschaftliche Re l e vanz zu unterstre i c h e n. Anlässlich des 10. RATS C H LAG STA D TT E I L K U LTUR we rden die Wi rk u n g s weisen der wichtigsten Handlungsfelder vo n Theorie und Praxis beleuchtet. Dabei gilt es, nachhaltig angelegte strategische Partnerschaften und neue Mo d e l l e eines tragfähigen Fi n a n z i e r u n g s - Mix zu entwickeln, um neben der öffentlichen auch die private Ku l t u r f ö rderung zu n u t zen. Die dynamische Entwicklung der Medien stellt spezifische A n f o rderungen an die Me d i e n k o m p e t e n ze n t w i c k l u n g insbesondere in Stadtteilen mit En t w i c k l u n g s b e d a r f. Als fest im Stadtteil verankerte Ku l t u r- und Ko m m u n i k a t i o n s o r t e s c h a ffen Ze n t ren kulturelle Zugänge zu den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, fördern den Dialog, aber auch das ehrenamtliche Engagement, das in jeder Kultur andere Bezüge aufweist. Seit 30 Ja h ren fördert die Freie und Hansestadt Ha m b u rg die Stadtteilkultur und Ge s c h i c h t s we rkstätten eine Evaluation überprüft nun das Förd e r- instrumentarium und die Qualitäten der St a d t t e i l k u l t u r l a n d s c h a f t. Fachleute aus Theorie und Praxis haben folgende Schwerpunkte beleuchtet: Möglichkeiten und Bedingungen privater Ku l t u r f ö rd e r u n g Stadtteilorientierte Me d i e n k o m p e t e n z f ö rd e r u n g Integration durch Partizipation und aktive Mi t g e s t a l t u n g Qualitätsentwicklung und Eva l u a t i o n Yvonne Fietz Wachsen mit We i t s i c h t Der 10. RATS C H LAG S TA D TT E I L K U LTUR wendet sich unter dem Motto»Wachsen mit Weitsicht«den Aspekten nachhaltiger Entwicklung zu, berät darüber, wie lokale Kultur und kulturelle Bildung den Kulturnachwuchs und die In t e g r a t i o n b e f ö rdern, und diskutiert Pe r s p e k t i ven des qualitativen Wa c h s t u m s. Der RATSCHLAG STADTTEILKULTUR jährte sich 2009 nicht nur das 10. Mal, in diesem Jahr feierte auch die öffentliche Förderung der er Stadtteilkultur ihr 30. Jubiläum. Die noch junge Kultursparte Stadtteil- und Soziokultur kann damit auf eine jahrzehntelange Praxis und Erfahrung im Bereich lokaler Kultur und kultureller Bildung zurückblicken. Auch wenn der Rückblick insbesondere bei der am 6. November 2009 im Körber-Forum gefeierten Stadtteilkultur-Revue sehr unterhaltsam und lebendig gewesen ist: so viele alte Geschichten, Anekdoten, Bilder etc. Der RATSCHLAG diente auch wieder dazu, den Blick nach vorn zu richten und in Arbeitsgruppen neue Entwicklungsperspektiven, innovative Konzepte und zukünftige Partnerschaftsmodelle in den Blick zu nehmen. Im Dialog erläuterten Dr. Gesa Birnkraut (Unternehmerperspektive) und Bettina Trabandt (Trägerperspektive), wie die Bedingungen für gelingende Partnerschaften im Rahmen einer Corporate Citizenship gestaltet werden könnten und welche Finanzierungsmöglichkeiten infrage kommen. Dabei standen die unterschiedlichen Organisationskulturen ebenso im Fokus wie praktische Hinweise zur Gestaltung erfolgreicher Partnerschaften.
8 9 Mit Kunst und Kreativität ist Wachstum im Bereich stadtteilorientierter Medienarbeit möglich das zeigen die beim RATSCHLAG STADTTEILKULTUR vorgestellten Projekte der Stadtteilkulturzentren Brakula und MOTTE. Die Medienanstalt Schleswig- Holstein zeigt auf, wie und auf welcher Finanzierungsgrundlage Medienprojekte gelingen können. Eine der größten zukünftigen Herausforderungen wird die Aktivierung der diversitätsoffenen Stadtgesellschaft zur (Mit)Gestaltung und Teilhabe sein. Freiwilliges Engagement ist in jedem kulturellen Kontext anders eingebunden, deshalb erfordert es neue Konzepte und Ansätze, um auch Menschen mit Migrationshintergrund in Freiwilligen-Projekte zu integrieren. Jedoch dürfen insbesondere bei den neuen Freiwilligen-Projekten nicht die langjährigen Erfahrungen aus erfolgreichen Projekten des bürgerschaftlichen Engagements vernachlässigt werden. Der Aufbau eines professionellen Ehrenamtsmanagements für ein neues Handlungsfeld kostet Zeit, braucht Kompetenz und öffentliche Unterstützung. Als der RATSCHLAG STADTTEILKULTUR im November 2009 stattfand, lagen erst die allerersten Ergebnisse der Evaluation der er Stadtteilkultur vor. Inzwischen ist die Evaluierung abgeschlossen und der Bericht erscheint nahezu zeitgleich mit der Dokumentation der Fachtagung, deren Fachgruppe sich schon seit Anfang des Jahres 2010 trifft, um den 11. RATSCHLAG vorzubereiten. Auch in diesem Jahr wird es eine Arbeitsgruppe geben, die sich mit dem Thema»Evaluation«beschäftigen wird. Dieses Mal jedoch gilt es, aus den vorliegenden Ergebnissen Schlüsse zu ziehen und Entwicklungsperspektiven auszuloten. Die er Stadtteilkultur nimmt schon seit vielen Jahren bundesweit eine Vorreiterrolle insbesondere in den Handlungsfeldern»Stadtteilentwicklung durch Kultur«und»Kultur und Schule«ein. Dass dies so ist, ist nicht zuletzt dem seit Beginn der er Stadtteilkulturförderung vorbildlichen Förderverfahren mit wirkungsorientierten Zielsetzungen und gesellschaftlich relevanten Förderkriterien zu verdanken. Aber auch das Steuerungsinstrument, die»globalrichtlinie und Förderrichtlinie Stadtteilkultur«mit Kennzahlenerhebung und der quantitative Die Hexen von»shakespeare in St. Pauli«bereicherten die Stadtteilkultur-Revue mit ihren Hexereien. und qualitative Methoden verbindenden Erfolgskontrolle ist bis heute bundesweit einmalig. Die Evaluationsergebnisse werden nun zeigen, wie ein so gutes Förderinstrumentarium die Entwicklung einer noch so jungen Kultursparte, wie es die Stadtteil- und Soziokultur ist, beeinflusst. Und sie werden sicher eine sehr gute Grundlage dafür bieten, das»wachsen mit Weitsicht«in weiter voranzutreiben damit der Kulturnachwuchs und die Integration durch lokale Kultur und kulturelle Bildung weiter wachsen! Beim 10. RATSCHLAG STADTTEILKULTUR wurden wieder vielfältige Impulse für die Theorie und Praxis geliefert, die mithilfe der nun vorliegenden Dokumentation weiter vertieft werden können.
9 10 Ö KO N O M I S C H WAC H S E N Möglichkeiten und Bedingungen privater Kulturförderung als Corporate Cultural Citizenship (CCC) Ö ffentlich geförderte Kunst und Kultur stehen unter einem hohen Druck, Eigenmittel zu erwirtschaften. Die Ha m b u rg e r Stadtteilkultur erzielt mittlerweile einen Eigenmittelanteil von durchschnittlich 38 Pro zent. Vor dem Hi n t e rgrund immer l e e rer we rdenden öffentlicher Kassen und des wachsenden Engagements von privaten Unternehmen als Corporate C i t i zenship stehen Ku l t u reinrichtungen vor neuen He r a u s f o rderungen: Wie müssen sie sich aufstellen, we l c h e r Ko n zepte und Methoden bedarf es, um strategische A l l i a n zen mit Wirtschaftsunternehmen aufzubauen, die sich als lokale Corporate Citizens positionieren (möchten)? Dr. Gesa Birnkraut und Bettina Trabandt Ökonomisch wachsen aber wie? Aus der Unternehmens- und In s t i t u t i o n s p e r s p e k t i ve beleuchten Dr. Gesa Birnkraut und Bettina Trabandt essenzielle Bestandteile von Corporate Citizenship bzw. Corporate Social Responsibility: Ma rkenbildung, Zielsetzungen, A l l e i n- s t e l l u n g s m e rkmale, Leistungen und Gegenleistungen, Be t reuung während der Du rchführung, Er f o l g s k o n t ro l l e. Definition Unternehmen, die verantwortungsvoll gegenüber der Gesellschaft und dem Gemeinwesen handeln, haben sich für eine sozial geprägte Unternehmensstrategie entschieden, die als»corporate Citizenship (CC)«oder als»corporate Social Responsibility (CSR)«bezeichnet wird. Beide Begriffe stehen für das nachhaltige, glaubwürdige sowie transparente gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Die genaue Begriffsdefinition, erstellt durch das ISO-Institut, lautet:»csr bezeichnet ein mit dem Kerngeschäft verknüpftes freiwilliges sozial und ökologisch verantwortliches unternehmerisches Handlungskonzept, welches die Entscheidungen eines Unternehmens im Hinblick auf die Wechselwirkungen mit den Stakeholdern über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus beeinflusst und welches sich in erster Linie auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung bezieht.«corporate Cultural Responsibility (CCR) definiert ein strategisches und auf Nachhaltigkeit konzipiertes Kulturengagement von Unternehmen. Ausgehend von der Definition von Corporate Social Responsibility (CSR) als verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln von Unternehmen in ihrem sozialen und natürlichen Umfeld, steht CCR für die unternehmerische Verantwortung im kulturellen Bereich. Beim Thema CCR geht es somit nicht nur unmittelbar um Fragen unternehmerischen Mäzenatentums oder Sponsorings, sondern letztlich um das Verhältnis von Unternehmen und Gesellschaft. CCR ist somit mehr als reine Philanthropie oder Sponsoring, sondern ein intensiver Austausch von Unternehmen mit der jeweiligen Gesellschaft, in der die unternehmerische Verantwortung in der Ermöglichung und Realisierung von Kulturprojekten konkretisiert wird und die Unternehmen somit wieder mehr Teil dieser Gesellschaft werden lässt, in denen sie agieren. Ein CCR-Programm kann nur erfolgreich sein, wenn es in eine funktionierende und glaubwürdige CSR- Strategie des Unternehmens integriert ist. Zur Einordnung des Begriffs ist es somit wichtig zu betonen, dass CCR nur einen Aspekt der Gesamtthematik CSR darstellt.
10 11 CCR umfasst das gesamte koordinierte und einer einheitlichen Strategie folgende Kulturengagement eines Unternehmens. Wesentliches Element von CCR ist die bewusste und gezielte Kommunikation des kulturellen Engagements in Richtung möglichst vieler Zielgruppen. Unternehmen treten durch CCR in einen dauerhaften Dialog mit Kulturinstitutionen im engeren Sinn sowie mit der Öffentlichkeit im Allgemeinen. Anders als bei kurzfristigen Sponsoringaktivitäten übernimmt das Unternehmen für einen längeren Zeitraum Verantwortung für bestimmte Kulturprojekte und tritt somit in der Öffentlichkeit nicht als Sponsor, sondern als Partner bzw. Bürger der gemeinsamen Gesellschaft auf. Die Unternehmen gehen durch den Einsatz von CCR eine dauerhafte und exklusive Partnerschaft mit Kulturinstitutionen ein. Aus Sicht der Institution Für die Institution bedeuten Kooperationen mit Unternehmen im Vorfeld gründliche Recherchen. Das beginnt mit den richtigen Ansprechpartnern, (deren Namen auch immer richtig geschrieben werden!). Dabei ist es unerheblich, ob es um CCR, CSR, Sponsoring oder eine Spende geht. Für das Thema CSR gibt es in großen Firmen häufig eigene Stellen; in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist das Thema in der PR-Abteilung oder im Marketing angesiedelt. Oder aber der Firmenchef kümmert sich höchstpersönlich darum. Diese Unternehmerpersönlichkeiten müssen anders angesprochen werden als eine Mitarbeiterin der PR-Abteilung. Um die Augenhöhe zu wahren, fragt am besten der Vorstand an. Im Internet finden sich auch meist Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens im Bereich CSR. Einige große Unternehmen haben CSR-Leitlinien entwickelt. Hier gilt es zu prüfen, ob ein Unternehmen als CSR-Partner geeignet ist, bzw. inwieweit die eigenen Kooperationsvorschläge mit den Zielen des Unternehmens in Einklang gebracht werden könnten. Durch einen Telefonanruf lässt sich klären, ob es Fristen für Entscheidungen über Kooperationen, Sponsoring oder Spenden gibt. Die Beiersdorf AG hat zum Beispiel einen Vorlauf von zwei Jahren. Vorab sollte auch recherchiert werden, ob es bestimmte Themen gibt, die das Unternehmen überhaupt nicht unterstützt. Die grundsätzliche Frage ist jedoch, welchen Stellenwert CSR im Unternehmen einnimmt. Ist er niedrig, dann ist es sinnvoller, nach einer Spende zu fragen. Markenbildung Aus Sicht des Unternehmens Das Unternehmen möchte einen Partner gewinnen, der sichtbar ist. Das bedeutet, die Institution benötigt eine Marke, ein Gesicht dem Unternehmen gegenüber. Gerade in der Vielfalt der Institutionen sollte sich die Institution abheben. Das Unternehmen braucht ein klar erkennbares Gegenüber, die Markenbildung der Kulturinstitution ist u.a. auch ein Indiz für die Professionalität der Institution. Dies betrifft ganzheitlich auch die Corporate Identity und das Corporate Design. Aus Sicht der Institution Eine Marke zu sein, bedeutet zuerst einmal, ein klares Profil zu haben, um sich von anderen Institutionen zu unterscheiden, bzw. sich von ihnen positiv abzuheben. Das ist besonders schwierig, wenn die Institution eine Art»Gemischtwarenladen«betreibt: Die Projekte sind bunt gemischt, die Zielgruppen auch. Ein Profil zu erarbeiten, kostet Zeit. Meist geht es einher mit einer Organisationsentwicklung, bei der Vision, Leitbild usw. erarbeitet werden und alles auf den Prüfstand kommt, und am Ende steht die»corporate Identity«, die neue unverwechselbare Identität. Darüber können Jahre vergehen. Die Wiedererkennbarkeit setzt sich im Außenauftritt fort. Das Briefpapier, die gesamte Geschäftsausstattung, die Publikationen, der Internetauftritt, einheitliche Signaturen der s... Das kostet Geld, von dem meist zu wenig da ist. Auch der Bekanntheitsgrad einer Organisation spielt eine große Rolle. Aber wie wird man bekannt, wenn man unter mangelnden Ressourcen leidet? Kein Geld, kein Personal. Und wie stellt die Institution ihren Bekanntheitsgrad fest. Wie misst sich der Bekanntheitsgrad? Das kann eine Institution sehr leicht überfordern und/oder viel Geld kosten.
11 12 Unternehmen wollen Angaben von Reichweiten der Maßnahmen, Anzahl von Kundenkontakten usw. Die Institution bereitet sich darauf vor, indem sie einige Kennzahlen vorliegen hat: Die Auflage der Publikationen; an welche Zielgruppen werden sie verschickt/ verteilt; die Zugriffszahlen auf die Website, der Pressespiegel usw. Zielsetzungen Aus Sicht des Unternehmens Das Unternehmen wünscht sich ein klares Ziel für die Kooperation. Wirtschaftsunternehmen sind ergebnisorientiert, nicht problemorientiert. Das bedeutet, dass die Unternehmen oft klare Ziele anstreben. Sie arbeiten mit Kennzahlen, die Erreichung von Zielen ist für die Unternehmen wichtig, wenn nicht sogar elementar. Das bedeutet auch, dass eingroßteil ihrer Arbeit messbar ist. Das wünschen sie sich auch von ihren Kooperationspartnern. Als gute Faustregel kann dabei gelten, dass ein Ziel SMART sein sollte diese Abkürzungen stehen für Spezifisch, Messbar, Aktiv gestaltbar, Realistisch und Terminiert. Dies sind die Grundvoraussetzungen für gegenüber Unternehmen zu nennende Ziele. Weiterhin müssen die Ziele kurz und prägnant auf den Punkt gebracht und in einer Sprache formuliert werden, die auch Unternehmensvertreter verstehen. Grundsätzlich kann in den verschiedenen Stadien der Kooperation von verschiedenen Tiefen der Ziele gesprochen werden am Anfang geht es vielleicht darum, aufzuzeigen, wie die Ziele der Institution aussehen. Wenn das Projekt vorgestellt wird, ist ein transparentes Ziel gefragt. In einem weiteren Schritt geht es dann schon um die konkrete Ausgestaltung der Kooperation. Hier sind die Ziele der Kooperation gefragt. Auch wenn die Institution gegebenenfalls nicht alles messbar gestalten kann, so muss sie doch auf dieses Ansinnen gefasst sein und erklären können, warum Dinge in ihren Bezügen nicht messbar sind oder sein können. Aus Sicht der Institutionen Für die Institution stellt sich vor dem Festlegen von Zielen die Frage, wie sie die Projektentwicklung bewerkstelligen kann. Diese wird häufig von den Un- ternehmen nicht bezahlt. Sie sehen die Projektvorschläge als Pitch, wie bei den Agenturen, die in kreative Vorleistung gehen und nur vielleicht den Zuschlag bekommen. Dabei ist vielen Unternehmen nicht klar, dass die Personaldecke bei den Institutionen sehr dünn ist und häufig nur wenig freie Kapazitäten vorhanden sind. Die Institution ist froh, wenn der Projektvorschlag gefällt und macht sich manchmal erst hinterher, wenn überhaupt, Gedanken über die Messbarkeit. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht viele Institutionen gibt, die sich sehr wohl Gedanken über die Messbarkeit ihrer Arbeit machen. Aber das Hauptaugenmerk liegt auf dem Projekt und nicht auf der Messbarkeit. Alleinstellungsmerkmale Aus Sicht des Unternehmens Unternehmen agieren marktorientiert, das bedeutet auch, dass sie sich von ihren Mitbewerbern unterscheiden wollen und müssen. Die sogenannten USP (unique selling points), auch Alleinstellungsmerkmale genannt, sind dabei von enormer Wichtigkeit. Daher möchten Unternehmen auch bei den Kooperationsprojekten am liebsten immer etwas Besonderes haben, etwas, das explizit und exklusiv für sie entwickelt worden ist. Also werden sie sich das Recht nehmen wollen, alles noch einmal zu verändern. Die Kulturinstitution sollte dabei bedenken, dass Unternehmen meist nicht aus altruistischen Gründen fördern, sondern ihren Shareholdern und Gesellschaftern erklären müssen, warum sie was fördern und welchen expliziten Nutzen sie davon haben. Die spezifischen Alleinstellungsmerkmale, die eine Institution entwickelt, können dabei ggf. nicht mit den Vorstellungen des Unternehmens übereinstimmen. Problematisch wird es immer wieder bei bereits erfolgreich bestehenden Projekten hier liegt die Schwierigkeit darin, das Unternehmen davon zu überzeugen, dass es der richtige Partner ist, auch wenn hier nichts vollkommen Neues entwickelt wird. Aus Sicht der Institution Es herrscht Verständnislosigkeit: War unsere Arbeit nicht gut? Es gibt keine Zeit/Kapazität, um noch einmal aufwendige Projektplanung ohne Kostenentschädigung zu machen. Hier ist es wichtig, das Gespräch
12 13 Die ehemalige Kultursenatorin Helga Schuchardt im Gespräch mit Magrete Wulf-Slabaugh, langjährige Referentin für Stadtteil- und Soziokultur moderiert von Dr. Gesa Birnkraut. zu suchen, darauf hinzuweisen, wie die Personaldecke aussieht (egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich) und zu einer Einigung zu kommen, dass vorher ein Vertrag geschlossen wird, bevor weitergearbeitet wird. Wenn auf beiden Seiten der Wille zur Verständigung da ist, lässt sich das klären. Auf der Seite der Institution ist auch ein gewisses Maß an Kreativität gefragt, um einem vielleicht bereits bestehenden Projekt noch einmal eine neue Wendung zu geben uns so erfolgreich»alten Wein in neuen Schläuchen«zu verkaufen. Das Problem der nachhaltigen Projektarbeit ist es eben, dass die meisten Projekte über einen längeren Zeitraum laufen müssen, damit sie ihre gesellschaftliche Wirkung erfalten können. Sollte die Institution nicht auf offene Ohren stoßen, sollte sie sehr gründlich darüber nachdenken, ob sie die Zusammenarbeit nicht beendet, bevor sie richtig angefangen hat. Leistung / Gegenleistung Aus Sicht der Unternehmen: Das Unternehmen will eine klare Leistung / Gegenleistung erhalten, egal ob es sich um Spenden oder Sponsoring handelt. Im wirtschaftlichen Markt wird vieles über Geben und Nehmen definiert, eine Leistung ohne Gegenleistung ist ungewöhnlich. Dies beziehen die Unternehmen oft auch auf Förderkooperationen. Erst einmal ist es ihnen egal, ob es sich um eine Spende oder ein Sponsoring handelt. Die Unternehmen wissen nicht immer einwandfrei, was möglich ist und was nicht. Außerdem haben die Unternehmen keine Gemeinnützigkeit zu verlieren. Sie gehen oft nach dem Motto: du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verlangst. Auch hier gilt, dass die Institution nicht auf alles eingehen muss, was das Unternehmen verlangt, aber die Institution sollte darauf gefasst sein, auf eine Gegenleistung angesprochen zu werden.
13 14 Noch einmal zur klaren Abgrenzung: Eine Spende ist eine Zuwendung, die der Förderung steuerbegünstigter Zwecke dient. Hierzu zählen auch Zuwendungen an gemeinnützige und damit steuerbegünstigte Kultureinrichtungen. Geld oder Sachmittel werden zweckgebunden ohne Gegenleistung der Institution übergeben allerdings gegen eine Spendenbescheinigung, die steuerlich geltend gemacht werden kann. Wenn die Institution also den Namen des Spenders auf einer Plakette etc. nennt, so ist das eine freiwillige Leistung der Institution. deutlich machen und erläutern, wofür sie Spendenquittungen ausstellen kann und wofür nicht. Betreuung bei der Durchführung Aus Sicht der Unternehmen Das Unternehmen will eine gute Betreuung bei der Durchführung erhalten. Es wünscht sich einen kontinuierlichen Ansprechpartner und legt Wert auf transparente Kommunikation. Dabei geht es darum zu zeigen, was man macht, und wo man im Projekt steht. Beim Sponsoring geht es um die Gewährung von Geld und geldwerten Vorteilen durch Unternehmen zur Förderung von Personen, Gruppen oder Organisationen, mit der auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung und/oder Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden. Es handelt sich um einen Vertrag auf Gegenseitigkeit zwischen dem Sponsor und der Institution es besteht also immer ein Geben und Nehmen von Leistungen. Der Sponsor muss eine sichtbare Leistung zur Produktpromotion erhalten, sonst kann er das Sponsoring nicht steuerlich absetzen. Aus Sicht der Institutionen Die Institutionen müssen vorsichtig sein, wofür sie eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen können. Viele der Dinge, die sie anbieten, können schon in den Bereich des Sponsoring fallen. Da hilft nur eine gute steuerrechtliche Beratung. Auf jeden Fall sollten sie die Möglichkeiten parat haben, die sie einem Unternehmen (sei es im Falle einer Spende oder Kooperation) bieten können: Wo wird das gemeinnützige Engagement des Unternehmens bekannt gemacht? Pressemeldungen (Wie viele gehen raus? Wie ist die Medienresonanz?) Was wird an die eigene Zielgruppe verschickt? Jahresbericht, Spenderinformationen (mit Auflagen) Veranstaltungen (Zielgruppe, Anzahl der Besucher) Rahmen der Schecküberreichung etc. Website (Zugriffszahlen) Falls das Unternehmen weitergehende Forderungen formuliert, muss die Institution ihren Standpunkt Aus Sicht der Institutionen Die Institution muss einen festen Ansprechpartner benennen, der für die Kommunikation mit dem Unternehmen zuständig ist und der auch die Informationen zurück in die eigenen Reihen trägt. Die Betreuung kann sehr viel Zeit kosten. Es ist sinnvoll, bestimmte Termine für den telefonischen Austausch und Treffen vorher festzulegen. Falls die zuständige Person in Teilzeit arbeitet, sollte auch das kommuniziert werden, damit die Unternehmensseite nicht frustriert ist, wenn sie nie die richtige Person erreicht. Natürlich sollte das Unternehmen regelmäßige Berichte erhalten und auch zu Veranstaltungen der Institution bzw. des Projektes eingeladen werden. Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Betreuung oftmals Herausforderungen bereithält. So sind die Erwartungen auf den verschiedenen Hierarchieebenen im Unternehmen oft sehr unterschiedlich. Das dringt aber nicht immer rechtzeitig zur Institution durch. Deshalb sei jeder Institution ans Herz gelegt, die gegenseitigen Erwartungen an die Zusammenarbeit so genau wie möglich festzulegen und festzustellen, ob man die Gegenseite wirklich verstanden hat. Die Sprache in der Wirtschaft unterscheidet sich von der eigenen (Jargon), und die Zusammenarbeit sollte als»interkulturelle Begegnung«verstanden werden. Auch hier gibt es viele Fälle, wo alles ganz einfach läuft und jeder alle versteht. Aber leider auch häufig gegenteilige Fälle. Beispielsweise, wenn es um die Lösung von Konflikten geht. Die Institution schlägt Supervision vor, was im sozialen Bereich nichts Besonderes ist, aber im Wirtschaftsbereich einer Bankrotterklärung des Chefs gleichkommt, weil er Hilfe von außen benötigt.
14 15 Erfolgskontrolle Aus Sicht des Unternehmens Das Unternehmen wünscht eine Erfolgskontrolle. Die Messbarkeit der Aktionen ist wichtig. Man darf nicht vergessen, dass Unternehmen oft nachweisen müssen, was sie warum gemacht haben. Die Gesellschafter der Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter selbst achten kritisch auf die Mittelvergabe. Auch Unternehmen stehen unter Druck und müssen daher Erfolgsnachweise erbringen. Als Erfolgskontrolle können dabei gelten: Pressespiegel, Zahl der erreichten Menschen, Zahl der Besucher, Fotodokumentationen, Zufriedenheit der Besucher, Belege der Materialien, in denen der Sponsor genannt wurde etc. Aus Sicht der Institution Die Institution muss für sich ebenfalls eine Erfolgskontrolle haben. Sie muss sehen, ob sie das Projektziel erreicht hat. Hat z.b. die gewünschte Anzahl von mittellosen Kindern mit Migrationshintergrund an dem Projekt teilgenommen? Haben sie durchgehalten? Zeigen sie nun bessere schulische Leistungen? Haben sich ihre Kenntnisse der deutschen Sprache verbessert? Sind die Mitarbeiter im Unternehmen motiviert worden? Hat sich der Aufwand, der mit der Unternehmenskooperation entstanden ist, gelohnt? Hat die Institution womöglich wesentlich mehr Geld oder Arbeitszeit hineingesteckt, als am Anfang vereinbart war? Wie sieht es mit der Öffentlichkeitsarbeit aus? Gab es eine gute Presse für die Institution oder wurde nur das Unternehmen erwähnt? Ist die Institution bekannter geworden? Gab es einen Zugewinn an Know-How? Die BürgerStiftung evaluiert ihre Projekte. Das geschieht durch die Hilfe Ehrenamtlicher. Es werden Fragebögen entwickelt, Teilnehmer, Projektmitarbeiter usw. interviewt und die Ergebnisse ausgewertet. Bei CSR-Projekten mit Wirtschaftsunternehmen wird professionelles Know-How eingekauft, da festgestellt wurde, dass die Berichte in einer»ganz anderen Sprache«geschrieben werden müssen, damit sie für das Unternehmen von Nutzen sind. Das externe Know-How ist teuer, deshalb das Thema bei Gesprächen lieber erst einmal außen vor lassen! Das nächste Projekt Aus Sicht der Unternehmen Das Unternehmen möchte gerne nach dem erfolgreichen Abschluss eines Projektes wieder mit einem neuen und klaren Projekt angesprochen werden. Aus der Sicht des Unternehmens ist die Kulturinstitution der Dienstleister, der Initiator neuer Projekte. Das Unternehmen versteht sich nicht als Impulsgeber für das nächste Projekt. Aus Sicht der Institution Die Institution wundert sich, dass das Unternehmen nicht von alleine auf sie zukommt. Es hat doch alles gut geklappt, das Lob war reichlich. Es kommt zu Irritationen, und man fragt sich, ob etwas falsch gelaufen sei. Keiner traut sich anzurufen und nachzufragen, und die Institution verfällt in die kommunikative Kaninchenstarre und vergibt so die Chance auf eine weitere Zusammenarbeit. Fazit Unternehmenskooperationen jeglicher Art sind nur ein Teil des Finanzierungsmixes. Die Institution muss sich genau überlegen, ob sie die personellen Kapazitäten hat, um damit zu beginnen. Also vorher genau darüber nachdenken, was die Zusammenarbeit mit Unternehmen bedeutet und was man zu bieten hat. Wesentlich wichtiger und langfristig erfolgreicher ist es, sich professionell um die eigenen Spender zu kümmern. Auch in der jetzigen Finanzkrise bleiben der Privatkonsum und die Spenden von Privatpersonen stabil. Also bitte lieber die Zeit nutzen und in der Vorweihnachtszeit zum Telefonhörer greifen und sich bei allen Spendern persönlich bedanken. Oder Anlässe suchen, zu denen die Spender eingeladen werden können. Warum nicht noch fix zum Adventskaffee in der Institution einladen? Viel Erfolg und immer lächeln!
15 16 WAC H S E N M I T K U N S T U N D K R E AT I V I T Ä T Stadtteilorientierte Medienkompetenzförderung In s b e s o n d e rein Qu a r t i e ren mit Entwicklungsbedarf nimmt die Stadtteilkultur eine wichtige Rolle bei der Me d i e n- k o m p e t e n z f ö rderung ein. Am Beispiel verschiedener stadtteilorientierter Me d i e n p rojekte der St a d t t e i l k u l t u r ze n t re n Brakula und MOTTE we rden Gelingensbedingungen für die Aktivierung von Ku l t u r p roduktion und für die Förd e r u n g von Talenten erarbeitet. Die Medienanstalt Ha m b u rg und Schleswig-Holstein gibt Einblick in ihre Me d i e n k o m p e t e n z- f ö rd e r u n g. Katja Jacobsen Wandsbeker Jugendfilmpreis: Die goldene Wandse Seit Ja h ren führt das St a d t t e i l k u l t u r zentrum Brakula in Kooperation mit Schulen Medien- und Fi l m p rojekte durch, die beim Ha m b u rger Ju g e n d f i l m f e s t i val»abgedreht«aufgrund ihrer Professionalität oft ausgezeichnet wurden. Aber auch a n d e re Fi l m p roduktionen aus dem Bez i rk Wandsbek zeichneten sich durch ein hohes Ni veau aus dies nahmen das Ku l t u r zentrum und seine Partner zum Anlass, einen neuen, bez i rk s b ezogenen Ju g e n d f i l m p reis zu installieren: die goldene Wandse. In ihrem Beitrag beschreibt Katja Jacobsen die Ko n zeptentwicklung und Ge l i n g e n s b e d i n g u n g e n. Die Idee Die Idee für den 1. Wandsbeker Jugendfilmpreis die goldene Wandse 2009 entstand im Bramfelder Kulturladen, der seit Jahren mit dem Bereich»kulturlabor«medienpädagogisch im Stadtteil Bramfeld arbeitet. Über die gute Vernetzung im Stadtteil wusste das kulturlabor, dass es zusätzlich zu den Produktionen aus dem Brakula im Bezirk Wandsbek viele Kinder und Jugendliche gibt, die selbstständig oder in Schulen und Einrichtungen Videofilme drehen. Die er Jugendmediale abgedreht zeigte jedes Jahr etliche Wandsbeker Produktionen, von denen viele einen Preis erhielten. Ein eigener, bezirklich gebundener Jugendfilmpreis sollte der lokalen Jugendfilmszene weiteres Selbstbewusstsein, Unterstützung und Öffentlichkeit geben. Kriterien Um den 1. Wandsbeker Jugendfilmpreis die goldene Wandse 2009 bereits im ersten Jahr zu einem Erfolg zu machen, arbeiteten die Organisatoren unter folgenden Prämissen: 1. Kooperationen vor Ort sind die Grundlage jeder Stadtteilarbeit Der Brakula entschied sich, die guten medienpädagogischen Kontakte im Stadtteil als Grundlage zu nutzen. Die lokalen Kooperationspartner (Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen) wurden in die Vorbereitung eingebunden. Alle Partner verpflichteten sich, sich finanziell mit einem kleinen Beitrag zu beteiligen und eine eigene Filmproduktion aus den Jahren 2008 oder 2009 einzusenden. Außerdem beteiligte sich das Jugendinformationszentrum (JIZ) an der Ausschreibung des 1. Wandsbeker Jugendfilmpreises. 2. Profis in die Jury Qualität zählt und muss erkannt werden Die Jury sollte für die jugendlichen Filmemacher ein Anreiz sein, ihre Produktionen von Profis bewerten zu lassen. Aus diesem Grund war es wichtig, qualifizierte er Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen der Filmbranche zu gewinnen. In der Jury saßen: der Schauspieler Volker Zack Michalowski, der z.b. mitgearbeitet hat an:»das Leben der Anderen«,»Inglourious Basterds«; Chris-
16 17 toph Birth, der für die Innen- und Außenrequisite zuständig war bei den Filmen»Gegen die Wand«,»Die rote Zora«; die Filmproduzentin Kathrin Lemme, die sie mit ihrer Produktionsfirma Lemme Film GmbH z.b.»eisenfresser«produzierte, und Stephanie Kunz, Theater-Regisseurin und Schauspiel-Trainerin, außerdem führte sie Regie z.b. bei»empfänger unbekannt«,»ausblick auf das Paradies«. 3. Filme gehören ins Kino Durch die Präsentation im CinemaXX Wandsbek konnte eine würdige und festliche Preisverleihung des Wettbewerbs in einem großen Kino garantiert werden. Auch für die Teilnehmer, die keinen Preis erhielten, gab es so die Gelegenheit, den eigenen Videofilm auf großer Leinwand und in rotem Plüsch zu genießen. 4. Filmemacher sind Idealisten eine schöne Trophäe statt großer Gewinne Die Trophäe wurde von einer Goldschmiedin entworfen. Durch eine Kombination aus Gold, Silber und rostigem Stahl entstand ein besonderer, schöner und kostbarer Preis, der schnell ein Erkennungszeichen des Wandsbeker Jugendfilmpreises wurde. Zusätzlich war die goldene Wandse 2009 mit einem Geldpreis dotiert. 5. Preise müssen bekannt sein Beworben wurde die goldene Wandse 2009 mit einem eigenem Filmtrailer, Logo und Grafik über eine Webseite, Plakate, Buttons und Postkarten, über die Verteiler aller Kooperationspartner, eine Vorveranstaltung im CinemaXX und durch direkte Ansprache. nur Produktionen, bei denen die Filmemacher persönlich anwesend waren. Moderiert wurde die Preisverleihung im CinemaXX Wandsbek von einem Schüler und einer Schülerin. Die goldene Wandse 2009 wurde dreimal verliehen, von den insgesamt 36 eingereichten Filme wurden drei Gewinnerfilme prämiert: Recording: eine Handyfilmproduktion vom Gymnasium Meiendorf. L.S.D.: ein SW-Kurzfilm vom Gymnasium Osterbek. Senseless: eine SciFi-Parodie der Videogruppe aus dem HdJ Steilshoop. Nachbereitung Nach der Verleihung wurde eine Dokumentations- DVD erstellt. Die abschließende Nachbereitung des 1. Wandsbeker Jugendfilmpreises die goldene Wandse 2009 ergab, dass die Kombination aus einer guten Verankerung im Stadtteil, einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit und einer fachkundigen Jury und die Präsentation im CinemaXX den Wettbewerb zu einem Erfolg machte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www. brakula.de/projekte/goldene_wandse_2009 und bei Katja Jacobsen, Umsetzung Das Konzept wurde beim»jahr der Künste«eingereicht und bekam bereits im ersten Förderdurchgang die nötigen finanziellen Mittel zugesprochen. Von Vorteil war es außerdem, dass das Jahr der Künste ebenfalls bezirklich organisiert war und über eine gut funktionierende Öffentlichkeitsarbeit den Wettbewerb im Bezirk Wandsbek bekannter machte. Alle teilnehmenden Videoproduktionen mussten entweder im Bezirk gedreht oder von Jugendlichen aus Wandsbek realisiert worden sein. Gezeigt wurden Dreharbeiten bei Regen: Medienkompetenzförderung mitten im Leben.
17 18 Stephanie Probst Stadtteilorientierte Audioarbeit am Beispiel der MOTTE Seit Ja h r zehnten betreibt das Stadtteil- und Ku l t u r zentrum MOTTE e.v. stadtteilorientierte Medienarbeit. St e p h a n i e Probst beschreibt im folgenden Beitrag die Früchte dieser Arbeit in Form unterschiedlichster Me d i e n p rojekte und insb e s o n d e re das aktuelle Projekt: die OHRLOTS E N. Das 1976 gegründete Stadtteil- und Kulturzentrum MOTTE ist heute Ideenagentur und aktiver Kooperationspartner im Stadtteil Ottensen mit dem Ziel der Gestaltung einer vielfältigen stadtteil- und soziokulturellen Praxis. Dazu gehört in der MOTTE von Beginn an auch die Medienkompetenzförderung umgesetzt in einem breiten Spektrum medienpädagogischer Angebote. So gibt es beispielsweise eine Videowerkstatt und mit der Mottenschau e.v. einen eigens gegründeten Verein, in welchem Filmproduktionen realisiert werden. Speziell der Jugendbereich der MOTTE nutzt das Medienangebot nach wie vor intensiv, was preisgekrönte Filmproduktionen und die Umsetzung verschiedener Modellprojekte, einschließlich wissenschaftlicher Begleitung, mit sich brachte. Als bedeutende Kooperationspartner sind hier vor allem das Büro für Suchtprävention und das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung zu nennen wurde der Umfang der Medienarbeit in der MOTTE durch die Einrichtung eines professionellen Tonstudios um ein weiteres Angebot bereichert. Hierdurch ergeben sich Umsetzungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Audioproduktionen wie Podcasting, Radioprojekte, aber auch die Aufzeichnung von (Live-)Musik oder die Produktion von Hörspielen. Als wichtiger Meilenstein der Entwicklung der MOTTE als Medienkompetenzzentrum im er Westen startete im Oktober 2009 das Audio-Großprojekt»Die OHRLOTSEN von Altona bis Wedel«mit drei zusätzlichen halben Stellen, einer über den Stadtteil hinausgehenden Reichweite und einer neuen inhaltlichen Vielfalt. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und basiert auf den langjährigen Erfahrungen der MOTTE-Mitarbeiter in der Audio-Arbeit mit Heranwachsenden von Podcastproduktionen über größere Hörspielprojekte bis hin zur Erstellung regelmäßiger einstündiger Live-Radiosendungen. Gerade die auditiven Medien eignen sich für die Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen besonders gut zur Medienkompetenzförderung, da Audioproduktionen viel Raum für Fantasie und Gestaltung lassen. Viele jüngere Kinder haben über Hörkassetten und CDs ohnehin bereits einen intensiven Zugang zu Hörmedien, außerdem handelt es sich um ein relativ niedrigschwelliges und gut übertragbares Medium. Neben einer umfassenden Medienkompetenz können hier vor allem auch Zuhör- und Sprachkompetenz gefördert werden sowie Kreativität und eine kreative mediale Auseinandersetzung mit Themen aus der eigenen Lebenswelt. Das Podcast-Projekt»Es macht Klick hingehört!«die ersten Audioarbeiten in der Motte waren Podcast-Produktionen: Von August 2007 bis März 2008 produzierte eine Gruppe von Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren verschiedene Podcast-Episoden zum Thema Klimawandel eine Mischung aus Reportage und Hörspiel. Professionelle Unterstützung erfuhren die Radiokinder durch den Hörfunkjournalisten Mathias Mainholz, der praktisch orientierte Fachkompetenz in das Projekt einbrachte. Gefördert wurde das Einzelprojekt über das regionale Kultursponsoring von AstraZeneca in Wedel und mit Stadtteilkulturmitteln des Bezirksamtes Altona. Ein großer Vorteil der Podcast-Produktion ist die Nutzung des Internets als Verbreitungsform. Dies schafft senderunabhängig die Möglichkeit der Veröffentlichung und bietet beteiligten Schulen und außerschulischen Einrichtungen die Möglichkeit, die Produkte auf ihrer Homepage einzubinden. MOTTE-Hörspielwerkstatt Ein fortlaufendes offenes Audioangebot entstand 2008 mit der Hörspielwerkstatt, die sich an Kinder
18 19 im Grundschulalter richtet und mit dem MOTTE- Kinderhort verbunden ist. Die Hörspielwerkstatt fördert in kontinuierlicher Arbeit Kreativität, Zuhör- und Medienkompetenz, lässt Talente sichtbar werden und trägt zur sozialen Arbeit im Stadtteil bei. Die Finanzierung erfolgt über Honorargelder des Kinderhortes. Die Audioarbeit in offenen Gruppen stellt Anleiter häufig vor das Problem einer unregelmäßigen Teilnahme der Kinder. Die MOTTE-Hörspielwerkstatt begegnet dem durch die Arbeit in verschiedenen Modulschritten, die sich beispielsweise in der frei verfügbaren interaktiven Software Auditorix (www. auditorix.de) finden. Als großer Vorteil erweist sich die Angliederung an eine bestehende pädagogische Einrichtung, in diesem Fall den MOTTE-Kinderhort, um möglichst viele Kinder möglichst regelmäßig zu erreichen. Kinderradio»Fragen und Sagen«Das MOTTE-Kinderradio»Fragen und Sagen«ein weiteres kontinuierliches Audio-Angebot besteht seit Sommer 2008 und ist ebenfalls eine offene, an den MOTTE-Kinderhort angegliederte Gruppe. Hier liegt der Schwerpunkt im Bereich der journalistischen Audio-Arbeit. Einmal pro Woche treffen sich interessierte Kinder von acht bis zwölf Jahren in der MOTTE zur Redaktionssitzung. Sie produzieren 60-minütige Sendungen mit Magazincharakter und bekommen die Möglichkeit, sich mithilfe des Mediums Radio intensiv mit allen Themen auseinanderzusetzen, die sie interessieren, und an der öffentlichen Meinungsbildung teilzunehmen. Erfahrungsgemäß brauchen die Kinder etwa sechs bis acht Termine, um eine Sendung vorzubereiten, die etwa zur Hälfte aus Wortbeiträgen, zur anderen Hälfte aus Musik besteht. Die Sendung wird über den Bürger- und Ausbildungskanal TIDE 96,0 ausgestrahlt. Geleitet wird das MOTTE-Kinderradio von Medienpädagogin Andrea Sievers. Sie bezeichnet die Möglichkeit der Ausstrahlung als zentrale Motivation ob als Vorproduktion oder besser noch live. Außerdem schätzt auch Andrea Sievers die Angliederung an den MOTTE-Kinderhort, da hierüber Kontakt zu Erziehungsberechtigten besteht, nötige Einverständniserklärungen eingeholt werden können und beispielsweise auch die Möglichkeit einer sonst sehr zeitaufwendigen Konfliktlösung außer- Profis leiten Kinder bei der Audio-Produktion an und sie staunen, wie gut sich ihr Beitrag plötzlich anhört.
19 20 halb der Redaktionssitzung besteht. Seit Oktober 2009 gehört das Kinderradio»Fragen und Sagen«nun als bestehendes offenes Angebot zum Großprojekt OHRLOTSEN und wird hierüber gefördert. Hast Du Töne aus Texten werden Hörgeschichten Als der Kinder- und Jugendbuchautor Werner Färber im Herbst 2008 seine spannenden Schulgeschichten in der Stadtbücherei Wedel vortrug, waren die Kinder der Klasse 3c der Albert Schweitzer Schule hellauf begeistert. Im Gespräch kam sehr schnell die Idee auf, mit diesen Büchern im Hinterkopf gemeinsam neue Geschichten zu entwickeln und daraus ein Hörspiel zu machen das Hörspielprojekt mit Kindern der Albert Schweitzer Schule in Wedel war geboren! Entstanden ist ein Projekt, in dem Lese-, Sprach-, Zuhör- und Medienkompetenz zusammengebracht und gemeinsam gefördert wurden: Von Juni bis Oktober 2009 bekam die heutige Klasse 4c der Albert Schweitzer Schule jeden Freitag in drei Schulstunden die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung mit auditiven Medien kreativ zu arbeiten, Geschichten selbst zu gestalten und schließlich technisch umzusetzen. Neben dem Kinderbuchautor Werner Färber wurden die Kinder dabei von der Journalistin und Diplom-Medienpädagogin Stephanie Probst und von dem Pädagogen und Tontechniker Ronny Strompf unterstützt. Die Gesamtkoordination wurde durch die MOTTE und Dipl.-Pädagogen Clemens Hoffmann- Kahre übernommen. Durch den Kooperationspartner, die Gabriele Fink Stiftung, konnte das Projekt finanziell abgesichert werden. Eine Besonderheit dieses Projektes war seine große Kontinuität durch die konkrete Arbeit mit einer Schulklasse in drei Unterrichtsstunden pro Woche über den Zeitraum von Juni bis Oktober Dies ermöglichte die Produktion mehrerer kurzer und eines längeren Hörspiels und ist ein gutes Beispiel für die Vernetzung schulischer und außerschulischer Bildung. Weiterhin bündelte das Projekt»Hast Du Töne«verschiedene Fachqualifikationen seiner Anleiter und bot durch die ausreichenden Personalressourcen die Möglichkeit, in sehr kleinen Gruppen effektiv zu Nach einer Einführung in die Tontechnik bereiten die Kinder ihre Beiträge selbst am Mischpult auf.
20 21 arbeiten. Dies ist vor allem einer guten Netzwerkbildung und -arbeit zu verdanken, die insgesamt eine wichtige Grundlage für alle Audio-Projekte der MOTTE darstellt. Die OHLOTSEN von Altona bis Wedel Idee des Pilotprojektes ist, im Westen der Metropolregion (Bezirk Altona und Stadt Wedel) mit Kindergruppen Audio-Beiträge und Hörspiele zu produzieren, um damit für die Zielgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen über die auditiven Medien eigene Darstellungsformen in den neu entstehenden Bildungslandschaften und Netzwerkstrukturen zu entwickeln. Konkret gliedern sich die Audioprojekte in zwei Schwerpunkte: Die Radio-Arbeit und die sogenannten Hör-Spielereien. In den Radiogruppen entstehen journalistische Beiträge und ganze Sendungen. Bei den Hör-Spielereien sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, hier kann vom Geräusche-Rätsel über einen Audio-Guide für den Stadtteil bis zum großen -Hörspiel alles entstehen. An den drei Kernstandorten Ottensen, Osdorfer Born und Wedel wird in Form verschiedener offener und geschlossener Gruppen jeweils beides angeboten. Die OHRLOTSEN-Projekte werden durch kompetente Medienpädagogen, Journalisten und Tontechniker betreut und finden in Stadtteilzentren, Kinderbibliotheken und im Rahmen von freiwilligen Angeboten in Kooperationen mit Schulen statt. Eine Auswahl der dabei entstehenden Audio-Produktionen wird auf der gemeinsamen Internetseite www. ohrlotsen.de veröffentlicht. Die selbst produzierten Radiosendungen sind jeden ersten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr auf TIDE 96,0 zu hören. Zusätzlich werden in den beteiligten Kinderbibliotheken Hörstationen eingerichtet, in denen die direkte Kommunikation, das gemeinsame Hörerlebnis und das aktive Gestalten im Vordergrund stehen. Wichtige Ziele des Projekts OHRLOTSEN sind die Förderung von Medien-, Sprach-, und Zuhörkompetenz, die Ermöglichung der Partizipation an der öffentlichen Meinungsbildung und an Kommunikationsformen mit den neuen Medien, sowie nicht zuletzt die Förderung von Kreativität, Sozialkompetenz und Selbstbewusstsein. Unterwegs beim Geräuschesammeln. Die OHRLOTSEN sind ein Projekt der MOTTE e.v. in Kooperation mit: den Bücherhallen Altona und Osdorfer Born, dem Kinderbuchhaus im Altonaer Museum und KL!CK Kindermuseum, dem Stadtteilzentrum»mittendrin«Wedel, der Stadtbücherei Wedel sowie Schulen im Bezirk Altona und der Stadt Wedel. Gefördert werden die OHRLOTSEN von der Aktion Mensch e.v., Gabriele Fink Stiftung, Medienstiftung / Schleswig-Holstein, dem Bezirksamt Altona und der Stadt Wedel. OHRLOTSEN-Team: Stephanie Probst, Diplom-Medienpädagogin und Jounalistin. Andrea Sievert, Diplom-Sozialpädagogin und freie Medienpädagogin. Ronny Strompf, Diplomand zum Thema»Außerschulische und kulturelle Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen«und Hörspielwerkstatt-Gründer. Weitere Informationen zu den Teammitgliedern finden Sie im Referenten-Verzeichnis, S. 42f.
21 22 Dr. Thomas Voß Medienkompetenzförderung der Medienanstalt Schleswig-Holstein Im folgenden Beitrag stellt Dr. Thomas Voß Leitbilder, Ziele, Handlungsfelder und Projekte der Me d i e n k o m p e t e n z- f ö rderung der Medienanstalt Ha m b u rg Schleswig-Holstein vo r. Für die Medienanstalt Schleswig-Holstein (MA HSH) ist die Förderung der Medienkompetenz eine wichtige gesetzliche Aufgabe. Dafür hat der Gesetzgeber die MA HSH Anfang des Jahres 2010 auch mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet. Thema dieses Beitrags ist, wie wir die Aufgabe der Medienkompetenzförderung wahrnehmen, wo wir ansetzen, was wir dabei erreichen wollen und welche Angebote wir gerade im Bereich der Stadtteilkultur und in Kooperation mit Schulen entwickeln und fördern. Begriffliches vorweg Unter Medienkompetenz wird die Fähigkeit verstanden, Medien und mediale Kommunikation 1. selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen, 2. aktiv und partizipierend zu nutzen sowie 3. reflexiv und verantwortlich zu begreifen. Da Medienkompetenz nicht angeboren ist und sich auch nicht von allein einstellt, muss sie individuell erworben und entwickelt werden. Medienkompetenz ist somit abhängig von Förderung und stellt sich der Medienpädagogik als zentrale Aufgabe. Medienpädagogik ist die pädagogische Querschnittsaufgabe bzw. wissenschaftliche Teil-Disziplin, die den Erwerb von Medienkompetenz ins Zentrum ihres Handelns und Forschens (Rezeptions- und Wirkungsforschung) stellt. Entscheidend sind hier insbesondere die für die pädagogische Praxis zentrale Altersdifferenzierung (Kind, Jugendlicher, Erwachsener) und die damit verbundene, jeweils begründungsbedürftige Angemessenheit des pädagogischen Handelns. Der größte Bedarf an Medienkompetenzförderung in besteht derzeit aufgrund der Risiken im Handlungsfeld Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen. Die Medienkompetenzförderung ist eng mit den Szenen und Aktivitäten der er Stadtteilkulturzentren verknüpft und daher in der Umsetzung vielfach regional ausgerichtet. Insofern verstehen sich viele Medienkompetenzprojekte zugleich als Angebot der Kinder- und Jugendkulturarbeit. Es ist ein Anliegen der MA HSH, neben den bereits existierenden Projekten, in denen Kinder und Jugendliche selbst zu»medienschaffenden«von Video- und Audioprodukten werden, bei möglichst vielen jungen Leuten die selbstbestimmte, eigenverantwortliche und partizipative Nutzung des Internets zu fördern. Dabei wird auf unterschiedlichste Art die erfolgreiche kinder- und jugendkulturelle Arbeit der Stadtteilkulturzentren fortgeführt. Außerschulische Jugendarbeit als Motor Insbesondere im zentralen Lernort Schule konstatiert eine von der MA HSH in Auftrag gegebene Studie (Volpers 2008) für und Schleswig-Holstein erhebliche Defizite: Die Vorgaben für die schulische Medienkompetenzförderung seien insgesamt unzureichend und zu unverbindlich. Dies gelte insbesondere im Bereich der Onlinemedien-Nutzung. Weil Medienbildung kein eigenes Unterrichtsfach sei, hielten sich die Fachlehrer häufig nicht für zuständig. Es sei unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht davon auszugehen, dass die Schulen in absehbarer Zeit ohne außerschulischen Bildungsträger eine nachhaltige Verbesserung schulischer Medienkompetenzförderung umsetzen könnten. Daher sei eine weitergehende Verzahnung der außerschulischen medienpädagogischen Initiativen mit der Unterrichtspraxis notwendig. Hierzu sei es notwendig, dass die außerschulische Medienkompetenzförderung systematischer und verlässlicher finanziell gesichert, der Transfer von außerschulischer Medienkompetenz koordiniert werde.
22 23 Für die zukünftige Entwicklung einer nachhaltigen Medienkompetenzförderung in und Schleswig-Holstein wird die Notwendigkeit betont, die vorhandenen Einrichtungen und Aktivitäten zu bündeln, zu vernetzen und unter dem Dach einer zentralen Institution zu koordinieren. Denkbar hierfür wären: eine länderübergreifende Stiftung, eine neu zu etablierende Einrichtung oder eine stärkere Ausrichtung der Landesmedienanstalt auf die Aufgabe der Medienkompetenzförderung. Durch die Vernetzung vorhandener Ressourcen und Bündnispartner entstünden Synergien für eine effektive Medienkompetenzförderung, wodurch auch der präventive Jugendmedienschutz dauerhaft gestärkt werden könnte. Leitbild: Kinder- und Jugendmedienschutz Im Zentrum der MA HSH-Aktivitäten im Bereich Medienkompetenz steht das Leitbild des Kinder- und Jugendmedienschutzes. Mit dem rechtlichen Jugendmedienschutz will die MA HSH im Rahmen ihrer Kontrollaufgabe über elektronische Medieninhalte Beeinträchtigungen von jungen Menschen verhindern. Mehr noch als bei anderen Medien ist für die Nutzung des Internets der präventive Jugendmedienschutz durch die Medienkompetenzvermittlung von entscheidender Bedeutung. Potenzielle Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen sollen durch Aufklärung und Qualifizierung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Pädagogen minimiert werden. Medienkompetenz, die»vierte Kulturtechnik«, ist nicht zuletzt eine wesentliche Voraussetzung dafür, welche Bildungschancen sich Kindern und Jugendlichen eröffnen. Die MA HSH will dazu beitragen, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche die dafür notwendigen medienbezogenen Kompetenzen erwerben. Demokratiekompetenz verlangt in unserer mediengeprägten Gesellschaft auch Medienkompetenz. Die Entstehung vieler politisch wie individuell wirksamer Meinungen und Werte wird maßgeblich durch die Mediennutzung beeinflusst. Deshalb sollen junge Leute schon früh lernen, Medien kritisch rezeptiv zu nutzen, aber auch, wie sie aktiv und partizipierend an unserer Mediengesellschaft teilhaben können. Um das skizzierte Leitbild zu erreichen, will die MA HSH mit ihren Aktivitäten die Vernetzung der medienpädagogisch engagierten Institutionen und die Koordination entsprechender Projekte unterstützen. Ziele und Handlungsfelder Angesichts der derzeit drängenden Jugendschutzprobleme durch die Online-Nutzung von Kindern und Jugendlichen konzentriert die MA HSH ihre Aktivitäten zunächst auf die Förderung der Internetkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Sie tut dies durch qualifizierte pädagogische Angebote, in denen Grundkompetenzen der Internet-Nutzung erworben werden können, die dem Jugendschutz entsprechen, und durch Eltern-, Lehrer- und Erzieherqualifizierung. Die wichtigsten Handlungsfelder sind Öffentlichkeitsarbeit und Beratung: In der Öffentlichkeit, bei Eltern und Lehrern ist das Thema zwar von herausragender Bedeutung. Gleichzeitig aber fühlen sich viele Erwachsene gegenüber dem Eintauchen ihrer Kinder in digitale Medienwelten überfordert und benötigen Information, Beratung und Unterstützung. Trägt das interaktive Potenzial des Internets tatsächlich nur zur weiteren Isolierung bei oder oder kann insbesondere das Web 2.0 auch dazu beitragen, soziale Bindungen zu erhalten und zu stärken? Forschung: Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit den Hochschulen sind erforderlich, um die Integration der Medienkompetenzvermittlung in den Unterricht vorzubereiten und die Lernerfolge zu evaluieren. Unterstützung der Infrastruktur: Da die Schulen mit ihren Lehrkräften Medienkompetenz nicht flächendeckend vermitteln können, sind außerschulische Pädagogen und Multiplikatoren medienpädagogisch weiterzubilden. Sie können dann als Referenten und Dozenten für medienpädagogische Elternabende in Schulen und Kitas sowie für Lernangebote in Projektform für Kinder und Jugendliche eingesetzt werden. Die MA HSH will eine außerschulische Infrastruktur schaffen, auf die die öffentlichen Lernorte und Kommunikationszentren (Stadtteil- und Jugendzentren, Bibliotheken, Schulen, Kitas) zur Medienkompetenzvermittlung zugreifen können. Dies schließt auch die Bereitstellung von Materialien ein. Die MA HSH entwickelt und fördert medienpädagogische Qualifikationsangebote, die in der Regel von Dritten durchgeführt werden. Sie sucht dabei die Kooperation mit medienpädagogischen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen etc. Interessant für die Kinderund Jugendkulturarbeit sind folgende Projekte:
23 24 Internetportal Mediennetz Wer macht was, und was gibt s Neues im Bereich Medienkompetenz in? Antworten auf diese Fragen bietet die Plattform mediennetz-hamburg.de. Auf dieser Internetplattform präsentieren sich die in aktiven medienpädagogischen Einrichtungen, Werkstätten, Festivals und Initiativen. Die Plattform versteht sich als Info-Agentur. Wer einen Referenten, ein Kooperationsprojekt oder ein Jugendfilmfestival etc. sucht hier wird ihm oder ihr geholfen. Zudem gibt es ein Magazin mit aktueller Berichterstattung und einen Veranstaltungskalender zu medienpädagogisch relevanten Terminen. Weitere Informationen unter: Internetprojekte und -aktionen Der netzdurchblick.de gibt Jugendlichen bis 16 Jahren spielerisch wichtige Tipps für ihre Internetnutzung und qualifiziert sie für einen reflektierten und gezielten Umgang mit dem Internet. Die Plattform soll mit anderen relevanten Internetseiten für Jugendliche ( Stadtteilund Jugendeinrichtungen etc.) vernetzt werden. Die Aktion Sicheres Internet qualifiziert Multiplikatoren wie Elternvertreter, Lehrerteams und Pädagogen in der außerschulischen Jugendbildung in den Bereichen Internet, Handy und Computerspiele. Weitere Informationen und Buchung (MA HSH, Maren Gaidies, Tel: 040 / , medienkompetenz@ma-hsh.de) Stadtteilorientierte Medienkompetenz-Projekte Bei der Kinderredaktion Radiofüchse erstellen Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren unter professioneller medienpädagogischer Betreuung eigene Radiosendungen, Interviews und Reportagen. Diese werden alle zwei Monate live im Kinderradio»Wilde Welle«im Programm von FSK 93,0 gesendet wie auch im Offenen Kanal Lübeck sowie im Offenen Kanal Westküste ausgestrahlt. Darüber hinaus soll eine ebenfalls medienpädagogisch betreute auditive Internetpräsenz entstehen, auf der die Kinderredaktion ihre Sendungen als Podcasts zur zeitunabhängigen Nutzung anbietet. Das interkulturelle Projekt wurde 2008 mit dem Dieter Baacke Preis ausgezeichnet. Weitere Informationen unter: und Der Junge Arbeitskreis Film und Video e.v. (jaf) ist Träger des Projekts KLICKERKIDS Internetzeitung von Kindern für Kinder, das im Jahr 2010 erstmals von der MA HSH gefördert wird. Inhaltlich dient das Projekt der Förderung der Internetkompetenz von Neun- bis 14-Jährigen: Internet und Computer werden in den Händen der Kinder zu kreativen Kommunikations- und Erzählwerkzeugen. Im Jahr 2010 sollen in und Schleswig-Holstein Multiplikatorenschulungen und anschließend Projektwochen mit insgesamt ca. 70 Kindern stattfinden. Die Ergebnisse der Projektwochen werden auf der Plattform www. klickerkids.de dokumentiert. Das Projekt, das im Jahr 2004 den renommierten Dieter Baacke Preis erhalten hat, soll mit vergleichbaren Medienprojekten vernetzt werden. Weitere Informationen unter: www. klickerkids.de und Schüler machen Medien Schnappfisch-Media ist das Jugend-Medien-Projekt von TIDE, dem er Bürger- und Ausbildungskanal. Schüler erarbeiten angeleitet von Medienpädagogen eigene Beiträge für Radio, Fernsehen und Internet. Sie recherchieren Themen, führen Interviews, filmen, führen Umfragen durch und schneiden am Ende das Material für einen Hörfunk- bzw. Fernseh-Beitrag, der dann ausgestrahlt wird. Das Projekt wird von der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) und der MA HSH gefördert. Das Projekt ist offen für interessierte Jugendliche und auch für Kooperationen mit Einrichtungen der Jugendarbeit. Weitere Informationen unter: Neben den für die Jugendarbeit relevanten Projekten fördert die MA HSH auch u.a. Angebote für Kinder und Eltern (Weitere Informationen unter: Veranstaltungen und Diskussionsforen greifen aktuelle Fragen der Mediennutzung und -wirkung bei Kindern und Jugendlichen auf. Gemeinsam mit der Behörde für Kultur, Sport und Medien setzt sich die MA HSH aktuell für das»rahmenkonzept Medienkompetenzförderung «ein, das im Sommer 2010 vorliegen soll. Die MA HSH ist interessiert an weiteren Kooperationen und freut sich, wenn auf Landesebene tätige Kulturund Medienverbände in und Schleswig- Holstein neue Projektideen vorschlagen.
24 25 AG-Diskussionsprotokoll»Wachsen durch Kunst und Kreativität«Die Gespräche nach den Vorträgen zur stadtteilorientierten Medienkompetenzförderung waren weniger durch eine kritische Diskussion denn durch interessierte Nachfragen zu einzelnen Aspekten bestimmt. Getragen wurde diese Gespräche durch die offenbar gemeinsame Grundüberzeugung, dass kulturpädagogische Medienarbeit bzw. medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig, zeitgemäß und nützlich ist. Insofern konzentrierten sich die Nachfragen und Anmerkungen der Teilnehmer der Arbeitsgruppe darauf, wie und mit welchen (finanziellen) Mitteln die jeweiligen Projekte umgesetzt wurden. Vorab wurden von der Leitung der Arbeitsgruppe die Erwartungen an die AG abgefragt. Dazu wurde Folgendes notiert: Anregungen für das Gelingen Medienerwartungen von Jugendlichen Praxisinput / News Informationsaustausch Überblick: Welche Praxis im Bereich Medienkompetenzförderung gibt es? Medienkompetenz-Zentren Vernetzung Was müssen Zentren bieten, um gelingende Kooperationen mit Schulen gestalten zu können? Wie kommen wir (Kulturanbieter) an geeignete Medienpädagogen? In seinem Vortrag beschrieb Dr. Thomas Voss als zentrales Problemfeld unangemessener Mediennutzung für die Medienanstalt Schleswig- Holstein (MA HSH) die Internetnutzung von acht- bis 14-jährigen Kindern und Jugendlichen. Ziel der Arbeit der MA HSH ist daher der Grundkompetenzerwerb dieser Altersgruppe für die altersangemessene Internet-Nutzung durch flächendeckende qualifizierte pädagogische Angebote. Um dieses Ziel zu erreichen, Die Band»Tuten&Blasen«damals (im Hintergrund in einem 80er-Jahre-Film) und heute live und lebendig!
25 26 fördert die MA HSH Medienprojekte und Qualifizierungsmaßnahmen für Pädagogen. Schwerpunkt der direkten Projektförderung sind handlungsorientierte Projekte. Grundsätzlich ist die MA HSH für die Kooperation mit allen pädagogischen Orten offen. Die Website der MA HSH ( gibt dazu detailliert Auskunft. Zum gemeinsamen Vortrag über die stadtteilorientierte Audioarbeit der MOTTE von Stephanie Probst und Ronny Strompf bezogen sich die Rückfragen ebenfalls hauptsächlich auf die (finanziellen) Gelingensbedingungen. Ein Podcastprojekt kostet demnach rund Euro, Hast Du Töne rund Euro. O-Ton:»Es geht auch mit weniger Geld, aber mit mehr Geld geht s besser!«. Die Fragen zum Vortrag von Katja Jacobsen über den 1. Wandsbeker Jugendfilmpreis bezogen sich hauptsächlich auf die Kostenstruktur der Angebote. Die Gesamtkosten (mit Honoraren für externe Mitarbeiter, z.b. für die Autorin) betragen Euro. Daran beteiligt sich die Schule mit 850 Euro, mit 150 Euro der Brakula. Der Rest musste durch andere Quellen finanziert werden. Die Kameras wurden vom LI entliehen. Sie sind etwas besser als normale Consumer-Kameras und würden heute im Laden ca Euro kosten. Technische Kamerakompetenz gibt es reichlich in ; zahlreiche freie Medienpädagogen stehen hier zur Verfügung. Weitere Tipps: Über die Internetseite des Mediennetzes (mediennetz-hamburg.de) lassen sich Kontakte herstellen. Die Seite wird übrigens von der Medienanstalt unterstützt. In der Diskussion stellte sich heraus, dass die Gruppengröße rund acht bis zwölf Kinder betragen sollte. Eine klare Zielorientierung, u.a. auf eine Präsentation hin, ist ein erfolgsformender Faktor. Diskutiert wurde die Frage, ob der Weg, Geld und Kompetenz in die Schule zu tragen, der richtige sei. Angesichts der Tatsache, dass freie Träger zumeist schlecht ausgestattet sind, Schule als System aber eine staatliche Vollfinanzierung genießt, wurde dies z.t. kritisch betrachtet. Andererseits besteht faktisch im Moment kaum eine andere Möglichkeit, alle Kinder und Jugendliche zu erreichen. Ein weiterer Strang des Gesprächs behandelte die Frage, wie eine Zusammenarbeit zwischen freien Trägern und Schule gelingen kann. Genannt wurden als Stichworte: soziale Hygiene (Probleme ansprechen und sich Zeit nehmen für ihre Lösung) Transparenz (auf beiden Seiten) Informationsaustausch möglichst längerfristige Planung Nach der übereinstimmenden Erfahrung vieler Anwesenden hängt die Qualität bzw. das Zustandekommen einer Zusammenarbeit mit Schulen derzeit maßgeblich von den aktiv beteiligten Personen ab. Da Lehrer bzw. Schulen nicht dazu gezwungen sind, mit außerschulischen Partnern zu arbeiten, laufen diese tendenziell Gefahr, als billige»dienstleister«wahrund ausgenommen zu werden. Klare Grenzziehungen und schriftliche Vereinbarungen helfen, diese Klippe zu umschiffen. Thomas Ricken Alles bereit zur Aufnahme?
26 27 WACHSEN DER I N T E G R AT I O N U N D M I TG E S TA LT U N G Seit Ja h ren gelingt es der St a d t t e i l k u l t u r, unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen und alle Lebensalter für ehre n a m t l i- ches Engagement und die aktive (Mi t - ) Gestaltung ihres Stadtteils zu gewinnen. Auf dem Weg in Richtung einer internationalen Stadtgesellschaft gilt es für lokale Ku l t u reinrichtungen, ein ausgereiftes Eh renamtsmanagement zu entwickeln, Verbindungen zu Potenzialen migrantischer Ne t z we rke herzustellen und Menschen jeden Alters einen Raum für bürg e r s c h a f t l i c h e s / e h renamtliches Engagement zu bieten, z.b. durch Ku l t u r b o t s c h a f t e r. Dr. Jörg Ernst Jugendliche mit Migrationshintergrund als Kulturbotschafter Eh renamtliches Engagement ist in vielen Ku l t u ren verankert, das Ne t z we rk Ru h rgebiet für bürg e r s c h a f t l i c h e s Engagement hat im Jahr 2007 das Projekt»Kulturbotschafter«initiiert, aus dem Jörg Ernst in seinem Beitrag eine Auswahl von Pr a x i s p rojekten vo r s t e l l t. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund wird bundesweit weiter steigen. Deshalb sah das Netzwerk Ruhrgebiet für bürgerschaftliches Engagement eine wichtige Aufgabe darin, Impulse und Unterstützung für ein gelingendes Zusammenleben von Migranten und Aufnahmegesellschaft zu geben. Um Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund im Alter zwischen 13 und 20 Jahren auf der Grundlage eines gemeinsamen Interesses an Kultur und für künstlerisch-kreative Aktivitäten zusammenzubringen, startete im Jahr 2007 das Projekt»Jugendliche als Kulturbotschafter«. Ziel des Projektes ist es, dass Jugendliche die vielfältige Kultur ihrer Stadt, gerade auch im Hinblick auf das Kulturhauptstadtjahr 2010, entdecken und diese zu Orten der Jugendkultur machen. Immer mit dem Hintergrund, weitere junge Menschen für die Kultur ihrer Stadt zu begeistern. Kulturstätten, entwerfen Präsentationsformen und stellen sie anderen Jugendlichen vor. Dabei erhalten die Kulturbotschafter Unterstützung von Ehrenamtlichen, Unternehmen und Institutionen. Den Kulturbotschaftern ist es freigestellt, welche Kulturstätten sie aufsuchen und vorstellen: Orte der Industriekultur, Theater, Film- und Medienorganisationen, Museen, den öffentlichen Raum, Musik- oder Tanzinstitutionen, Bibliotheken, historische Stätten oder Archive. Durch ihr ehrenamtliches Engagement können Kulturbotschafter interessante Leute aus dem Kulturbereich kennenlernen, einen Blick hinter die Kulissen erhalten, Kontakte zur Kreativwirtschaft knüpfen und damit Einblicke in verschiedene Berufsfelder bekommen, wodurch sie ihre Chancen auf erfolgreiche Bewerbungen verbessern. Zudem erhalten sie für ihr Engagement ein Zertifikat. Im Rahmen des Projektes Kulturbotschafter entdecken Jugendliche das kulturelle Angebot in ihrer Stadt und in der»mühlheim, Essen und Oberhausen«(MEO)-Region, sammeln in Teams von zwei bis drei Jugendlichen Informationen über ausgewählte Die beteiligten Kultureinrichtungen kommen durch das Projekt Kulturbotschafter in direkten Kontakt zu der Zielgruppe»Jugendliche«und erhalten ein unmittelbares Feedback auf ihr kulturelles Angebot. Der Austausch mit den Jugendlichen bereichert das
27 28 Marketing der Kultureinrichtungen durch Anregungen für Angebote und Kommunikationswege zu Jugendlichen. Zugleich fungieren Jugendliche als neue Multiplikatoren für die Kultureinrichtung und helfen dabei, weitere Ehrenamtliche zu gewinnen. Im Rahmen der PR-Aktivitäten des Kulturbotschafter-Projektes wird auch die beteiligte Kultureinrichtung genannt. Projekte der Kulturbotschafter In Zusammenarbeit mit der»camera Obscura«entwickelt ein Kulturbotschafter ein Dia-Projekt, das von Dr. Kaufhold beraten wird. An Zielgruppen orientiert wird diese Kunstaktion präsentiert und die Kulturinstitution»Camera Obscura«in ihrer besonderen Bedeutung hervorgehoben. Ergebnisse und Zwischenstand sind erstmalig im Rahmen des ARD-Aktionstages präsentiert worden.»kultruf«ist der Name der Schablonen Graffiti- Aktion in der»alten Dreherei«; hier wurden sogenannte Wallpapers angefertigt, die rund um den Bauzaun des neuen Medienhauses angebracht auf das Projekt»Kulturbotschafter«aufmerksam gemacht haben. Der»Kultruf«wurde mittlerweile zum Markenzeichen der Kulturbotschafter-Aktionen und als wiederkehrendes Logo auf diverse Flyer gedruckt, um zielgruppenadäquat auf Exkursionen und Aktionen hinzuweisen.»klassik für Kinder«ist ein weiterer Bestandteil der Palette von Projekten. Im Bereich der Offenen Ganztagsschule lernen Kinder durch jugendliche Kulturbotschafter klassische Kammermusik kennen. Darüber hinaus werden Informationen zu Musik und Instrumenten vermittelt. Gleichzeitig wird die städtische Musikschule vorgestellt und deren Angebote erläutert. Exkursionen und vertiefende Angebote sind in Planung. Die Premiere des Projektes»Klassik für Kinder«fand im Mai 2009 in einer Offenen Ganztagsschule statt. Ein weiterer Durchlauf begann im September 2009 an einer weiteren Offenen Ganztagsschule. Darüber hinaus wird»klassik für Kinder«ein Programmpunkt im Rahmen der»langen Nacht der Museen«werden. In Kooperation mit dem Stadtarchiv entwerfen zwei junge Kulturbotschafterinnen eine Präsentation zum Thema»Schule früher und heute«, um jüngeren Schülerinnen und Schülern (5. und 6. Klasse) Heimatgeschichte auf erlebnisorientierte Weise nahezubringen. Als Erstes ist eine Exkursion der 5. Klasse der Karl-Ziegler-Schule zum Stadtarchiv geplant, hier bekommen die Schülerinnen und Schüler mithilfe einer eigens gestalteten Power-Point-Präsentation einen Einblick in die Geschichte der Stadt Mülheim. Als besonderer Clou ist in die Power-Point-Präsentation ein selbst gedrehter Film eingearbeitet, der eine virtuelle Führung durch das Stadtarchiv zeigt. Dieser Film wiederum kann anderen Jugendlichen zur Verfügung gestellt und auf dem Internet-Portal des Stadtarchivs eingestellt werden. Jugendkultur fördert Kreativität und die Lust auf (Mit-) Gestaltung. Eine Gruppe von sechs Kulturbotschafterinnen hat ein Radioprojekt entwickelt. Unter Aneignung von spezifischen Techniken und Moderationsformen ha-
28 29 ben die Botschafterinnen eine Radiosendung in Eigenregie produziert. In der Radiosendung»Jugendliche unser Platz in Mülheim«, die im Juni 2009 ausgestrahlt wurde, standen die Berichterstattung zum Projekt Kulturbotschafter sowie das Interview mit der Mülheimer Band»One Way«im Vordergrund. Die Radiosendung konnte in der Volkshochschule aufgezeichnet werden und wurde unter fachlicher Begleitung des Medientrainers Rainer Flanz produziert.»auf die Plätze «ist eine Aktion junger Mülheimer Bands betitelt, die Konzerte an ungewöhnlichen Orten planen. Dabei wird ein Film entstehen, der auf Plattformen im Internet das Projekt Kulturbotschafter sowie die Stadt Mülheim an der Ruhr bewirbt. In diesem Zusammenhang wurde eine Internetplattform angelegt, die unter abrufbar ist. Die Internetseite befindet sich im Aufbau und soll nach und nach, in gemeinsamer Arbeit der Kulturbotschafter, als Infoportal genutzt werden. Als weiteres musikalisches Projekt ist ein kleiner Bandcontest angedacht, der in Eigenregie der Kulturbotschafter organisiert werden soll. Dies wiederum ist eine gute Möglichkeit, die Vernetzung der Kulturbotschafter zu verfestigen.»chinesisch in der VHS«ein junger Asiate macht durch Kalligrafie auf Chinesisch-Kurse in der Jungen Volkshochschule (Sommerakademie) aufmerksam. Mittels der künstlerisch anmutenden Schriftzeichen soll das Interesse Jugendlicher geweckt werden, Sprachkurse in der VHS zu besuchen. Eine erste Präsentation fand im Rahmen des ARD-Aktionstages, im Mai 2009, statt. In der Weiterentwicklung entstand die Idee einer Wandzeitung. Fotos in Kombination mit chinesischen Schriftzeichen sollen neugierig auf das Stadtarchiv machen. Die Wandzeitungen sollen auch ins Deutsche übersetzt an verschiedenen Orten in Mülheim ausgehängt werden.»literatur an der U-18 Haltestelle«hier sollen in Kooperation mit der Eichbaumoper junge Leute für Literatur interessiert werden. Ein 20-Jähriger aus russischer Familie, will, unter Einbeziehung der Verantwortlichen der Eichbaumoper, Workshops zum Thema Literatur anbieten. In Zusammenarbeit sollen Kurzgeschichten und Texte entstehen. Um die Ergebnisse der Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten, werden diese Texte an ungewöhnlichen Orten präsentiert. In Planung ist darüber hinaus in kooperativer Zusammenarbeit mit dem Jugendkulturfestival (Kulturbetrieb), über einen speziellen Blog Jugendliche für kreatives Schreiben zu gewinnen. Ein»Vernetzungstreffen«fand bereits in der Kultureinrichtung»Eichbaumoper«statt. Diesen Kontakt vermittelte ein jugendlicher Kulturbotschafter, der bereits an Treffen der Arbeitsgemeinschaft teilgenommen hatte. Im Rahmen einer»gesamtvernetzung«(meo: Mühlheim, Essen und Oberhausen) eignet sich dieser Ort hervorragend für Zusammenkünfte, die, insbesondere wenn sie nach der Umsetzung der jeweiligen Projekte durchgeführt werden, helfen, deren Nachhaltigkeit zu sichern. Treffen dieser Art sind im Halbjahresrhythmus geplant. Parallel zu diesem Kulturgeschehen ist der zweite Durchgang, neue Kulturbotschafter zu gewinnen, gestartet. Hierzu wurden gezielt Schulen und Freizeiteinrichtungen aufgesucht. Zum Einsatz kam ein»kulturbotschafter-koffer«mit symbolischen Gegenständen und Informationen gefüllt, der die Fantasie anregen und inspirieren soll. Über dieses Medium kommen Gespräche in Gang, die zu anregenden Ideenfindungen beitragen. Die vierwöchige Kulturbotschafter Roadshow startete im Mai Diverse Kultureinrichtungen wurden besichtigt, dabei ergaben sich interessante Einblicke auch hinter die Kulissen der Camera Obscura, des Theaters an der Ruhr, des Neuen Medienhauses, der Städtischen Musikschule, des Stadtarchivs und Bismarckturms sowie des Radios Mülheim. Die Roadshow wurde insgesamt gut angenommen. Durchschnittlich waren bei den Führungen zehn Jugendliche vor Ort. Nach jedem Roadshow-Treffen ergab sich Raum für gemeinsame Gespräche und Feedbackrunden. Deutlich wurde der Wunsch,
29 30 Führungen anders aufzubereiten, um noch stärker das Interesse der Zielgruppe zu wecken. Im Zuge der Roadshow entstanden sogenannte»ideen-runden«, die Platz boten, noch einmal zu überlegen, welche Vertiefungsangebote entwickelt werden könnten oder welche weiteren Projekte Umsetzung erfahren sollten. Besonders vielfältig wurde der Wunsch, im Rahmen des Mediums Foto tätig zu werden, geäußert. Hierzu ist angedacht, ggf. gemeinsam mit den Organisatoren des Jugendkulturfestivals den Mülheimer Fotokünstler Lubo Lacu für einen Workshop zu gewinnen. Nach den Sommerferien wurde die Umsetzung einzelner Projektideen weiter geplant. Interview mit dem Leiter des Neuen Medienhauses In Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst wurde die Idee entwickelt, den Leiter des»neuen Medienhauses«, Klaus-Peter Böttger, zu interviewen. Die jugendlichen Migranten sollten hierbei mehr über die kulturelle Infrastruktur ihrer Stadt erfahren und in einen Dialog mit Herrn Böttger treten. Im Vorfeld wurden die Interviewfragen anhand von Zeitungsartikeln ausgearbeitet sowie eine Interview- Generalprobe durchgeführt. Am erwartete Klaus-Peter Böttger die 14 beteiligten Personen zum Interview. Als kleinen Einstieg gab es eine Führung durch das Haus. Das als Video aufgezeichnete Interview wurde anlässlich der Eröffnung des Neuen Medienhauses gezeigt. Des weiteren wurde geplant, die dabei entstandenen Fotos zu einer kleinen Ausstellung aufzubereiten. Weitere gemeinsame Projekte sind in Planung. Songwriting-Workshop in der Eichbaumoper Ende Mai 2009 fand in der Eichbaumoper ein Gesangworkshop statt, an dem drei Kulturbotschafter sowie eine Gruppe Jugendlicher des Jugendzentrums Stadtmitte (im Rahmen einer Kooperation) teilnahmen. Begleitet wurde dieses Highlight von der Berliner Sängerin und Performerin Bernadette La Hengst (Weiteres zu Eichbaumoper und La Hengst siehe»kulturspiegel«6/2009). In Eigenregie und mit ein wenig Unterstützung vom Eichbaum-Team (darunter auch eine Journalis- tin) gelang es, einen Musiktext zu entwerfen. Im nächsten Schritt ging es an die Vertonung dieses Textes, der, unter fachkundiger Hilfe von Frau La Hengst, als Lied aufgezeichnet werden sollte. Gemeinsam wurden Sound und Beats festgelegt, und ohne große Scheu sang jeder Beteiligte seinen Text in das Mikro. Im kreativen Miteinander konnte eine Atmosphäre entstehen, die von allen als spannend und angenehm erlebt wurde. Anschließend sangen, unter Anleitung von Frau La Hengst, alle zusammen den Refrain des Liedes. Der Tag hatte den Beteiligten sichtlich Freude bereitet. Akua war derart begeistert, dass sie gleich nachfragte, ob so eine Aktion nächste Woche wieder stattfinden würde. Das nun leider nicht, aber Frau La Hengst erklärte sich dazu bereit, den Song abzumischen, sodass bald jeder der Beteiligten eine CD hiervon in Händen halten kann. Auch nach dem Ende der Veranstaltung konnte man den Einen oder Anderen noch vor sich hin singen hören, sodass der Platz vor der Opernhütte von einer lebendigen Atmosphäre ausgefüllt war. Fotografisch wurde das Ganze von einem jugendlichen Kulturbotschafter dokumentiert. Alle waren sich anschließend einig: Das war ein voller Erfolg und ein Beitrag dazu, den Gedanken des Kulturbotschafters weiter zu verankern. Auch hierzu soll eine kleine Fotoausstellung gestaltet werden, was einen weiteren Beleg für die Vielschichtigkeit des Mülheimer Kulturschaffens liefert. Kulturbotschafter in der MEO-Region In der MEO-Region engagieren sich inzwischen mehr als 40 Jugendliche als Kulturbotschafterinnen und -botschafter. Bei regelmäßig stattfindenden Treffen der Verantwortlichen werden Umsetzungsfragen, weitere Vorgehensweisen und Zielvorgaben besprochen. Ablaufpläne zur zeitlichen Sicherung der Projekte werden abgestimmt. In dieser Konstellation werden auch weitergehende Workshops entwickelt. Gemeinsame Aktionen und Workshops sichern den überregionalen MEO-Austausch und halten das Vernetzungsgeschehen aktuell.
30 31 Ralf Henningsmeyer Ansätze des Freiwilligen-Engagements am Beispiel kooperativer Freiwilligenprojekte Ausgehend vom Vo r l e s e r- Projekt der GWA St. Pauli beleuchtet Ralf He n n i n g s m e yer Gelingensbedingungen für e r f o l g reiche Fre i w i l l i g e n - Engagements. Dabei geht er ebenso auf Pro j e k t m a n a g e m e n t s t r u k t u ren ein wie auf persönliche Voraussetzungen und grundsätzliche Rahmenbedingungen. Die GWA St. Pauli e.v. hat als Träger von Gemeinwesenarbeit, Stadtteil- und Soziokultur, Jugendhilfe und Familienförderung eine mehr als dreißigjährige Erfahrung in St. Pauli und im Altonaer Kerngebiet. Ein Arbeitsschwerpunkt ist seit 2005 nach der Schließung der benachbarten Bücherhalle auch die Leseförderung. Im Rahmen der Senatsinitiative»Lebenswerte Stadt«hat die GWA St. Pauli e.v ihre in St. Pauli-Süd erfolgreiche Leseförderung mit dem Projekt LiA Lesen in Altona ausweiten können. Für die stadtweite Quartiersoffensive»Lebenswerte Stadt«mit ihren bildungs- und familienpolitischen Schwerpunkten wurden sechs Stadtteile mit besonderem Bedarf ausgewählt u.a. Altona-Altstadt. Ziel war es, die Identifikation der Menschen mit ihrem Quartier zu stärken und die Bildungsvoraussetzungen sowie die Alltagssituation von Familien zu verbessern. In Kooperation mit dem Verein»Seniorenbildung e.v.«wurde als ein Baustein von LiA eine Initiative zum ehrenamtlichen Vorlesen in Schulen und Kitas gestartet. Die Seniorenbildung e.v. hat ihren Sitz ebenfalls in Altona und ist Träger vielfältiger Bildungsangebote für ältere Menschen sowie von Qualifizierungen in der Freiwilligenarbeit. Das Anliegen war, ehrenamtliche Vorleser und Vorleserinnen unterschiedlichen Alters zu finden, die bereit waren, einmal wöchentlich einer Gruppe von ca. fünf Kindern vorzulesen bzw. sich gemeinsam mit Büchern und Geschichten zu beschäftigen. Es wurden insgesamt 30 regelmäßige Vorleserinnen und Vorleser gefunden, die bis heute in fünf Schulen in fast allen Grundschulklassen sowie in einigen Kitas vorlesen. Das Projekt ist überaus erfolgreich in der Wahrnehmung aller Beteiligten: der freiwilligen Vorleser, der Lehrkräfte und Erzieher, der Kinder und der beteiligten Kooperationspartner. Ein weiteres intergeneratives Freiwilligenprojekt»die Pixelmäuse«wurde hinzugefügt, bei dem es um die Vermittlung von Computerkenntnissen geht. Was sind die Voraussetzungen für das Gelingen eines Freiwilligen-Projektes? Motive: Die Gründe, sich zu engagieren, sind sicher von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Durchweg sind es aber soziale Motive, also mit anderen Menschen und für andere Menschen etwas zu tun. Neue Erfahrungen zu sammeln und neue Menschen kennenzulernen, sind die wichtigsten Beweggründe. Dies sollte im Konzept berücksichtigt werden. Einsatzkonzept: Ein möglichst klares Handlungskonzept sollte für alle Beteiligten Grundlage der Tätigkeit sein. Die interessierten Freiwilligen sollten eine übersichtliche und verständliche Struktur vorgestellt bekommen. Das darf aber nicht heißen, dass die Freiwilligen von Möglichkeiten der Einflussnahme und Mitwirkung an einer Weiterentwicklung des Konzepts ausgeschlossen sein sollen. Rolle der Freiwilligen: Aufgaben und Rolle der Ehrenamtlichen sowie der Hauptamtlichen sollten eindeutig sein das verhindert Irritationen und Konflikte. Die Mitwirkung der Freiwilligen sollte von allen Beschäftigten geschätzt und getragen werden. Für die Freiwilligen gilt auf der anderen Seite, die Kompetenz und Verantwortung der Hauptamtlichen zu akzeptieren. Zeit und Ressourcen: Bei der Planung eines Freiwilligenprojektes muss klar werden, dass die damit befassten Hauptamtlichen sich Zeit für die Betreuung
31 32 der Ehrenamtlichen nehmen müssen. Das Projekt braucht Raum und eine passende Ausstattung. Zuständigkeiten: Die Projektverantwortung muss eindeutig geregelt sein. Ansprechpartner und Mitwirkende müssen für die Ehrenamtlichen persönlich identifizierbar sein. Das Vorleseprojekt der GWA begann mit einem Informationstermin, zu dem über die örtliche Presse eingeladen wurde. Die Interessenten wurden ausführlich über das Vorhaben informiert und konnten Fragen stellen. Die tatsächlich Interessierten wurden im zweiten Schritt zu einer Einführungsschulung gebeten. Hier wurde insbesondere über altersgerechte Kinderliteratur, methodisches Vorgehen und über kulturelle Besonderheiten von Kindern mit Migrationshintergrund informiert. Auch ein Probevorlesen gehörte dazu. Die an einer Schule tätigen Vorleserinnen und Vorleser treffen sich regelmäßig unter Anleitung zu einem Austauschtreffen, um gemeinsam ihre Erfahrungen zu reflektieren. Einmal wöchentlich gibt es eine Sprechzeit der Projektbegleitung, um Probleme mit Kindern, Lehrkräften oder Urlaubsplanungen etc. zu besprechen. Ein- bis zweimal im Jahr bietet die GWA Fortbildungen und Workshops für die Ehrenamtlichen an, bei denen intensiver über Kinderbücher und ihre Bedeutung gearbeitet wird. Jeweils im Januar werden alle Vorleser zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen, an dem meist der Bezirksamtsleiter von Altona sowie Vertreter der Ko- operationspartner teilnehmen. Zusätzlich werden die Vorleser zu Veranstaltungen, Feiern und Versammlungen der beteiligten Vereine eingeladen. Geeignete Freiwillige zu finden, ist in der Hansestadt einfacher als noch vor einigen Jahren, seitdem es eine ausgebaute Infrastruktur dazu durch das Aktivoli-Netzwerk gibt. Hier arbeiten zahlreiche Verbände und Organisatoren zusammen, um das Thema Freiwilligenarbeit voranzubringen. Informationen findet man unter (Aktivoli- Netzwerk), (Freiwilligenbörse), (Anlaufstellen), (Qualifizierung). Die Auswahl und Praxisbegleitung der Ehrenamtlichen ist von besonderer Bedeutung. Die Entscheidung über die Mitwirkung im Projekt sollte fachliche und persönliche Aspekte zur Grundlage haben. Dabei müssen Interessierte manchmal auch enttäuscht werden, wenn diese sich aus verschiedenen Gründen als nicht geeignet erweisen. Diese Entscheidung zu treffen, ist im Sinne des Gelingens des Projektes, des Gruppenzusammenhalts und beim Vorleser- Projekt im Sinne der beteiligten Kinder von großer Wichtigkeit. Schwächen und Unsicherheiten sind aber im Rahmen der begleitenden Qualifizierungen und durch erlebte positive Erfahrungen abbaubar. Zentral wichtig ist es, die Ehrenamtlichen in andere Zusammenhänge einzubeziehen, ihre Arbeit zu wür- Der Kulturpolitik-Talk am Freitagabend, moderiert von Dr. Gesa Birnkraut (M.): v.l. Kultursenatorin Prof. Dr. Karin v. Welck, Gert Hinnerk Behlmer (Staatsrat a.d.), Norbert Sievers (Kulturpolitische Gesellschaft) und Ansgar Wimmer (Vorstand der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. und Sprecher des Beirates im Evaluationsprojekt Stadtteilkultur).
32 33 Der von Dr. Gesa Birnkraut (M.) moderierte Kultur-Talk mit (v.l.) Dörte Inselmann (Kulturpalast und HipHop Academy), Michael Batz (Theater, Licht, Szenografie) und Christiane Richers (Theater am Strom). digen und Formen der Anerkennung durch eine gelebte»dankeschön-kultur«zu finden. Freiwilligenprojekte: Museumsshop, Vorleser, Zeitzeugen, er Tafel etc. Grundlage für derartige Projekte ist eine ausreichende Finanzierung. Denn ein Projekt mit Ehrenamtlichen, das die beschriebenen Qualitätsmerkmale aufweist, gibt es nicht kostenlos. In unserem Fall konnten Zuschüsse des Verlagshauses Gruner & Jahr sowie von einigen Stiftungen das Gesamtprojekt»Lesen in Altona«nach dem Auslaufen der staatlichen Förderung absichern. Es gibt die unterschiedlichsten Formen von Freiwilligenarbeit, dabei hat in den letzten Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Das traditionelle Ehrenamt im Sinne einer langjährigen Verbundenheit mit einem Verein oder Wohlfahrtsverband hat sich gewandelt in eher projektbezogene, zeitlich differenzierte Engagementformen. Die heutigen freiwillig Engagierten suchen sich neben Beruf oder Interessen im Ruhestand gezielt flexible Tätigkeiten, die Sinn stiften sollen, aber gleichzeitig Spaß machen und der persönlichen Weiterentwicklung dienen. Im Sinne einer qualitativen Weiterentwicklung von Freiwilligenarbeit bieten sich regionale Kooperationen von Vereinen und anderen Organisationen an, die Ehrenamtliche beschäftigen wollen. Ein regionaler Verbund für Freiwilligenarbeit kann eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit aufbauen, über die Interessierte angesprochen und über die Möglichkeiten freiwilliger Tätigkeiten in der Region informiert werden. Eine zentrale Anlaufstelle und Informationsveranstaltungen der beteiligten Träger können es den Interessierten erleichtern, Kontakt aufzunehmen und für ein Ehrenamt motiviert werden. Ebenfalls lassen sich Qualifizierungsangebote gemeinsam kostengünstiger und vielseitiger durchführen. Wichtig ist ein regelmäßiger Austausch der beteiligten Einrichtungen, um beispielsweise über Qualitätsmerkmale des Freiwilligeneinsatzes zu sprechen und Probleme in der Arbeit zu reflektieren. Je nach Interesse und Qualifikation können für Freiwillige unterschiedliche Tätigkeitsfelder interessant sein: Formale Aufgaben: Vorstand, Rechnungsprüfer, Beirat etc. Unterstützung: Büroarbeiten, Technikpflege, Telefondienst etc. Projektarbeit: Mitwirkung bei Veranstaltungen, Projekten etc. Grundsätzlich ist abschließend festzustellen, dass freiwilliges Engagement auf die Unterstützung durch hauptamtliche Fachkräfte setzt. Diese Unterstützung kann nur dann gelingen, wenn gewährleistet ist, dass Freiwilligenarbeit nicht als Lückenfüller oder Einsparpotenzial angesehen wird.
33 34 AG-Diskussionsprotokoll»Wachsen durch Integration und Mitgestaltung«In einer kurzen Vorstellungsrunde benannten die Teilnehmenden der AG ihren Bezug zum Thema. Dabei wurden, je nach Arbeitsgebiet der jeweiligen Einrichtung, die verschiedenen Aspekte von Integration hervorgehoben: Die interkulturelle, die generationenübergreifende, die soziale in heterogenen Nachbarschaften. Aufgrund des Schwerpunkts der Impulsreferate konzentrierte sich die Diskussion dann jedoch auf das Thema Ehrenamt und»freiwilligen-management«. Jugendlichen akzeptiert zu werden. Dies ist ein heikles Feld, denn eine fehlende Authentizität könnte als Anbiederung an Jugendslang interpretiert werden und wohl eher das Gegenteil bewirken. Daher ist es umso wichtiger, die Zielgruppe schon bei der Projektentwicklung einzubeziehen. Die»Kulturbotschafter«assoziieren im Titel einen anderen Aspekt: die Ernsthaftigkeit und Wertschätzung, die in der Tätigkeit liegt bzw. durch sie erfahren wird. Ein erster Diskussionspunkt war die Frage der Erreichbarkeit derjenigen, die eine Einrichtung (ein Projekt) als Ehrenamtliche gewinnen möchte. Am Beispiel der jugendlichen»kulturbotschafter«im Ruhrgebiet wurde die Frage nach der Bedeutung des Migrations- bzw. des Bildungshintergrunds gestellt. Die Erfahrungen hier wurden in der AG bestätigt: Eine viel größere Rolle für die Teilnahme an Kulturprojekten bzw. freiwilliger Arbeit sowie für das Einlassen auf Verbindlichkeiten spielt der Bildungshintergrund; so engagieren sich beim Projekt»Kulturbotschafter«bisher überwiegend Jugendliche aus Gymnasien und Gesamtschulen, Haupt- und Realschüler sind weniger vertreten. Eine Lösung dieses Zugangsproblems sah Herr Ernst in der engen Zusammenarbeit in Netzwerken, da hier über entsprechende Multiplikatoren (z.b. Schulen) die richtige Ansprache gefunden werden kann. Ein weiterer Hinweis aus der Praxis der Schulkooperation war, mit bestimmten Projekten eher in den Regelunterricht zu gehen als ein freiwilliges Angebot zu machen denn hier stellt sich das Problem der (un)verbindlichen Teilnahme von Jugendlichen ungleich größer dar. Ob die Ansprache der Zielgruppe gelingt, verdeutlichten die Titel von Beispielprojekten: In St. Pauli bildete sich aus einer Befragung von Jugendlichen heraus eine Gruppe»Dreck Attack«, bei der es darum ging, den öffentlichen Platz vor dem Stadtteilkulturzentrum sauber zu halten. Mit der Anlehnung an Jugendsprache und der Anspielung auf Filmtitel bekam das Projekt die nötige Coolness, um von den Für das Gewinnen von Engagierten spielt auch die Dauer der Tätigkeit eine Rolle. Aus der Praxis wurde es als vorteilhaft berichtet, wenn es verschiedene Formen des Mitmachens geben kann: die Hilfe bei einer einmaligen Aktion oder die dauerhafte Zusage für Mitarbeit, die dann auch sehr unterschiedlich sein kann. So ist es ein großer Unterschied, ob die freiwillige Tätigkeit eine Hilfeleistung bzw. Unterstützung der Regelarbeiten einer Einrichtung ist oder in einem eigenständigen Projekt besteht. Dies verändert auch die Formen der Dankbarkeitsund Anerkennungs-Kultur, die beide Referenten als besonders wichtig darstellten. Wenn die Ehrenamtliche zu einer aktiven Mitgestalterin eines Projekts wird und dabei eigene Ideen verwirklicht, geht es eher um Anerkennung als um Dank für Hilfe. Zugleich deutet sich hier ein weiteres (mögliches) Problemfeld an, wenn der Wunsch nach Mitgestaltung nicht mehr mit den Zielen der Hauptamtlichen bzw. der Projektinhalte übereinstimmt, oder über das von der Einrichtung Leistbare hinausgeht. Oder wenn erkannt wird, das der/die Freiwillige nicht die für die Tätigkeit erforderlichen Kompetenzen mitbringt. Hier gilt es, auch»nein«sagen zu können, die Mitarbeit zu beenden oder, im Idealfall, nach einer Alternative zu suchen. All dies zeigt deutlich auf, dass Freiwillige betreut und individuell wahrgenommen werden müssen und neben dem Zeitaufwand auch die entsprechenden Kompetenzen der Hauptamtlichen erfordert.
34 35 Ein Projekt mit Ehrenamtlichen kann gelingen, wenn von vornherein die Rahmenbedingungen der freiwilligen Mitarbeit klar sind. Hier geht es um: genaue Vermittlung der Inhalte, Projektziele, Bedingungen und Verbindlichkeiten, Zeitvorgaben und Dauer der Tätigkeit, Rollenklärung zwischen Haupt- und Ehrenamt. Eventuell ist es auch hilfreich, schriftliche Kontrakte zu schließen. Für die Hauptamtlichen ergibt sich daraus, dass die Zusammenarbeit mit Freiwilligen als solche als ein eigenständiges Projekt anzusehen ist, das mit Ressourcen versehen werden muss. Hier schloss sich die Frage in die Runde an, welche Motivation eine Einrichtung hat, mit Freiwilligen zusammenzuarbeiten. Als Beispiele wurden genannt: Verankerung im Stadtteil Kontakt zu den Zielgruppen, die das Haus / das Projekt erreichen will Impulse von außen (den Nutzer/innen) für ein Veranstaltungsformat. Folgende Kernaussagen bildeten das Resümee der Arbeitsgruppe: Bewusstsein Die Begleitung des Ehrenamtes ist eine hauptamtliche Aufgabe. Sie braucht Zeit und Geld. Klare Konzepte Anforderungen, Rollen und Zeithorizonte Neue Kreise gewinnen durch verschiedene Formen des Mitmachens durch passende Ansprache, Titel, Label Einzelaspekte Motivation der Ehrenamtlichen beachten: - Soziale Kontakte - Anerkennungs- /Dankbarkeitskultur entwickeln - Netzwerke als Verstärkung /Unterstützung nutzen Sonja Engler Als Weggefährte der Stadtteilkultur durfte auch Herr Mommsen nicht fehlen.
35 36 QUA L I TAT I V E S WACHSEN Die durch die Be h ö rde für Ku l t u r, Sport und Medien geförderten St a d t t e i l k u l t u r ze n t ren und Ge s c h i c h t s we rkstätten we r- den im Jahr 2009 umfassend evaluiert. In der Arbeitsgruppe»Qu a l i t a t i ves Wachsen«wird der aktuelle Stand der umfassenden Evaluation der Ha m b u rger Stadtteilkultur vo rgestellt und erörtert. Werner Frömming und Prof. Dr. Dieter Haselbach Qualität und Evaluation der er Stadtteilkultur Die Re f e renten gaben Einblicke in erste Zw i s c h e n e rgebnisse der Evaluation der Ha m b u rger St a d t t e i l k u l t u r ze n t ren, in i h re besonderen Qu a l i t ä t s m e rkmale, Wi rk u n g s weisen und Aktivitäten. Dabei spielten insbesondere ihre ve r w a l t u n g s- s t r u k t u relle Einbettung in die bez i rklichen Fachämter für Sozialraummanagement und Finanzierungsfragen eine Ro l l e. 1. Referenzrahmen Stadtteilkultur Im Rahmen der Evaluation Stadtteilkultur geht es auch um die Entwicklung eines Qualitätsrahmens zur Orientierung für und Bewertung von konkreter Projektarbeit bzw. einzelnen Einrichtungen. Dabei soll die Identifikation von Wirkungsbereichen, deren Dimensionierung/Entwicklungsdynamik und deren spezifischen Qualitätsmerkmalen helfen, Stadtteilkulturarbeit in einem Referenzrahmen erkennbar, kommunizierbar und anschlussfähig zu gestalten. Das soll geschehen, ohne die jeweilige individuelle Entwicklungsbiografie von Einrichtungen zu diskreditieren (kein»musterhaus«). Dieses Modell soll sowohl im Innenverhältnis anwendbar sein (Wo stehen wir, wohin wollen wir...), als auch im Kontext kommunalpolitischer Entscheidungsfindung wirksam werden. 2. Wirkungsfelder von Stadtteilkultur Aktivierung / Ehrenamtliches Engagement Alle Stadtteilkultureinrichtungen integrieren und initiieren von Ehrenamtlichen gestützte Projektarbeit und bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Beteiligung spezifischer Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus wirken sie auch als Impulsgeber, Projektentwickler und Servicepartner für nachwachsende Initiativen. Bildung / Selbstbildung / kulturelle Bildung Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und außerschulischen, kulturellen Partnern gewinnt zunehmend an Bedeutung (Entwicklung regionaler Bildungslandschaften). In diesem Netzwerk positionieren sich Einrichtungen der Stadtteilkultur, aber auch Bücherhallen und Einrichtungen bzw. Initiativen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendkultur erfolgreich als außerschulische Lernorte und tragen zur Profilierung kultureller Arbeit an Schulen bei. Bildungsprozesse werden dabei in einem erweiterten Verständnis auch auf die jeweiligen Lebensräume von Kindern und Jugendlichen bezogen, und in der Gestaltung von Bildungslandschaften werden formale Bildungsgelegenheiten also schulische stärker mit nonformalen und informellen Bildungsgelegenheiten verknüpft. Dem liegt anders als in früheren, schulzentrierten Konzepten die Vorstellung des Lernens als»selbstlernen«in anregungsreichen Milieus zugrunde. Der Fokus richtet sich darauf, attraktive Bildungsgelegenheiten sozialräumlich zu verknüpfen, und damit breitere Zugänge zu Bildungsangeboten zu eröffnen. Dieser Selbstlerngedanke verlängert sich auch in die Erwachsenenwelt (lebenslanges Lernen).
36 37 auf der Grundlage historischen Wissens und der Überlieferung von Zeitzeugen im aktuellen gesellschaftlichen und sozialräumlichen Kontext zu orientieren. Die er Stadtteilkultur unterstützten Klaus Lattmann (früher kulturpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion) und Helga Schuchardt (Senatorin a.d.) schon vor Jahrzehnten. Integrierte Stadtteilentwicklung Einrichtungen der Stadtteilkultur sind Impulsgeber für die Integrierte Stadtteilentwicklung. In Verbindung mit einer vielfältigen kulturellen Praxis und auf der Basis entwickelter Netzwerke wirken Einrichtungen der Stadtteilkultur als Impulsgeber für Stadtteilentwicklungsprozesse. Bewohner des Stadtteils werden eingeladen, das soziale und kulturelle Gemeinwesen zu gestalten Orientierung an Stärken und Potenzialen Stadtteilkultur ist kein vorgefertigtes Produkt, sondern lädt ein, eigene Phantasien und kreative Energien in geeigneten Vorhaben zu erproben und mit Anderen zu einem lebendigen kulturellen Klima in unserer Stadt beizutragen. Teilhabe / Zugänge Einrichtungen der Stadtteilkultur und Stadtteilbibliotheken bieten stadtteilnah niedrigschwellige Zugänge zu Kunst und Kultur. Die Einrichtungen mit ihren Angeboten bzw. Ausschreibungen von Einzelprojekten sind darauf ausgerichtet, Menschen auf Teilhabe und Mitgestaltung anzusprechen. Bezug auf demografischen Wandel / Integration Einrichtungen der Stadtteilkultur bieten für unterschiedliche soziale und kulturelle Milieus bzw. Gruppierungen aber auch Altersgruppen Angebote und laden ein, den demographischen Wandel in kultureller Praxis zu gestalten (Altentheater, Performances, Diskurs). Insbesondere der interkulturelle Dialog kann stadtteilnah erfolgreich gestaltet werden. Stadtteilidentität / Stadtteilgeschichte Einrichtungen der Stadtteilkultur liefern Beiträge und Impulse für eine Stadtteilidentität (Stadtteilrundgänge»Kiek Mol«, Motiv»Wir in Bergstedt«, Stadtteilfeste»altonale«und»billeVue«) und helfen, sich Individualisierung / Wertewandel Einrichtungen der Stadtteilkultur und lokalen Bildungsarbeit sind aufgefordert, vor dem Hintergrund der schwindenden Möglichkeit des Sozialstaates, für alle individuellen Probleme und gesellschaftlichen Verwerfungen Lösungsmöglichkeiten zu offerieren und sich als Agenten und Moderatoren individueller und gesellschaftlicher Entwicklungen und Wachstum zu verstehen. 3. Aktivitäten von Stadtteilkulturzentren oder Geschichtswerkstätten Forschungsarbeit Sammlungstätigkeit / Archivierung Ausstellungen Rundgänge Veröffentlichungen Veranstaltungsprogramm Kursbereich Projektbereich Selbststeuerung / Beteiligung / Ehrenamt Verwaltung / Management ZIelgruppenarbeit Thematische Netzwerkarbeit Stadtteilentwicklung Gastronomie/ Treffpunkt Vermietung / Raumvergabe
37 38 AG-Diskussionsprotokoll»QUALITATIVES WACHSTUM«In der AG»Qualitatives Wachsen Qualitätsentwicklung und Evaluation«stellte Dieter Haselbach die schwierige Frage in den Raum, wie die Wirkung von Stadtteilkultur zu messen sei. Nach seinem Eingangsstatement und dem von Werner Frömming wurde diese Frage anschließend im Rahmen von Gruppenarbeit (drei Gruppen) behandelt. Zum Hintergrund Die Unternehmensberatung ICG culturplan hat im späten Frühjahr 2009 von der Behörde für Kultur, Sport und Medien (BKSM) den Auftrag erhalten, eine Evaluation der Leistungsfähigkeit von Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten und der Wirksamkeit von Förderstrukturen für die Stadtteilkultur durchzuführen. Herr Hempel (ICG culturplan) berichtete in seinem einleitenden Beitrag von der Vorgehensweise und dem Stand der Projektarbeit. Nach einer Auftaktveranstaltung vor den Sommerferien haben alle Einrichtungen kurz nach den Ferien einen Fragebogen erhalten, der in Kooperation mit dem Zentrum für Kulturforschung (Partnerunternehmen von ICG culturplan) entwickelt wurde. Die erhobenen Daten wurden mit den vorhandenen Kennzahlen der BKSM zusammengeführt und bilden die Grundlage für die Evaluationsgespräche in den Einrichtungen (13 Geschichtswerkstätten, 25 Stadtteilkulturzentren, ). Die Gespräche haben Ende September 2009 begonnen. Bisher haben insgesamt 23 Gespräche stattgefunden. Darüber hinaus wurden erste Workshops auf Bezirksebene mit Vertretern aus Einrichtungen, Verwaltung und Kommunalpolitik durchgeführt. Der Abschlussbericht zur Evaluation wird Anfang Mai 2010 vorliegen. Im Rahmen der laufenden Untersuchung entstand die Idee eines noch zu planenden Transfer-Workshops für die Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten, um den Wissensaustausch anzuregen. Wirkung der Arbeit von Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten Das Team ICG culturplan konnte sich aufgrund der bisher geführten Gespräche bereits ein Bild von den Arbeitsweisen der Einrichtungen machen. Dieter Haselbach beschrieb als ein Ziel, eine geeignete und für alle akzeptable Lösung für die Verteilung der finanziellen Mittel auf die Einrichtungen und Projekte durch die BKSM und die Bezirksämter zu finden. Herr Haselbach stellte Thesen vor, die das Zwischenergebnis der bisherigen Arbeit der Unternehmensberatung zusammenfassen. Diese Thesen seien hier wiedergegeben: Bisher wird in der Förderung von Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten vor allem auf den Bedarf der Einrichtung als Steuerungsparameter gesetzt. Hierin liegt ein»strukturkonservativer«bias: Es wird das gefördert und ausgestattet, was an Einrichtungen schon da ist. Neues hat es da schwer. Es gibt keine objektiven Kriterien oder Bedarfskriterien für die Versorgung des Sozialraums mit stadtteilkulturellen»leistungen«oder für stadtteilhistorische»versorgung«. Wenn dies so ist, dann gibt es auch keinen Parameter für eine»gerechte«verteilung von Mitteln zwischen den Bezirken. Einrichtungen sind sehr unterschiedlich, und auch ihr Mittelbedarf ist unterschiedlich. Dies gilt natürlich zuerst für den Unterschied zwischen Geschichtswerkstätten und Zentren, aber auch zwischen den einzelnen Einrichtungen, ihren räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Umständen. Förderung muss diese Unterschiede in Betracht ziehen. Wenn die Förderung nach Bedarf nicht zu umgehen ist, dann muss ein Innovationsinstrument außerhalb der Normalförderung organisiert werden, um den strukturkonservativen Bias zu vermeiden. Hierin liegt die Aufgabe der Kulturbehörde, die entsprechend mit eigenen Mitteln jenseits der Bezirke agieren können muss. Es bedarf einer Professionalisierung der Steuerung durch die Bezirke. Hier ist insbesondere an Vereinbarungen zwischen Bezirken und geförderten Einrichtungen zu denken, die sich auf Parameter der Wirkung beziehen (soweit Wirkungen einer Messung und Steuerung zugänglich sind). Eine solche Steuerung ist auch ein Anreiz, das Management in den
38 39 Einrichtungen durch Qualitätsmanagement (QM)-Elemente zu qualifizieren. Manche Einrichtungen arbeikommt. Es geht nun um ein Controlling über Wir- Blick, was eigentlich beim Kunden einer Leistung anten schon erfolgreich mit einem QM-Ansatz, andere kungen: Was wurde durch Ressourcen bzw. durch müssen hier erst hingeführt werden. QM muss in eine Leistung bewirkt? Controlled wird darüber, welche Wirkungen erzielt werden sollen und wie sich einer abgestuften Form verwandt werden: Es eignet sich mehr und ist strukturell tiefer angelegt für größere Strukturen. Es ist nur mit leichter Hand in klei- kann nicht standardisiert werden. Sie bezieht sich diese Wirkungen zeigen. Eine Wirkungsmessung nen oder vorwiegend ehrenamtlichen Strukturen immer auf ein spezifisches Problem. Die Arbeitsgruppe (spätere Gruppenarbeit) solle sich genau die- anwendbar. Einige Gedanken zur Wirkungsforschung: Traditionell sem Problem widmen. wurden Ressourcen geplant, und es wurde über Ressourcen gesteuert. Sobald genug Personal und Geld Es gebe in keine»objektiven«kriterien zur in ein Problem gesteckt wurden, sollte es lösbar Mittelverteilung. Die Diskussion um den Verteilungsschlüssel der Behörde für die Rahmenzuweisungen sein (Input). Ein Fortschritt war die Steuerung über Leistungen: Hier war die Leitfrage, was mit den Ressourcen tatsächlich geschieht. Es wurde darauf geken politischen Einflüssen unterliege. Perspektivisch an die Bezirke zeige, dass dessen Bewertung starschaut, was eine mit der Leistungserbringung beauftragte Person tatsächlich realisiert (Output). Erst die (Input) verwendet würden und wie man eine optima- sei zu prüfen, wie die vergebenen finanziellen Mittel jüngsten Ansätze im Controlling nehmen in den le Verwendung dieser Mittel anhand bestimmter erbrachter Leistungen (Output) mit Blick auf erwünschte und erzielte Wirkungen (Outcome) überprüfen könne. Bei Betrachtung der Einrichtungen sei deutlich geworden, dass große Unterschiede zwischen Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten bestünden und deshalb auch unterschiedliche Gesichtspunkte in die Bewertung bezüglich der Mittelaufteilung einfließen müssten. Der derzeitige Schlüssel sehe eine Mittelverteilung nach dem Bedarf der vorhandenen Einrichtungen vor. Dies sei Ann-Cristin Hausberg (Bürgerhaus in Barmbek); Otto Clemens (Haus Drei) und Ulrike Ritter seiner Meinung (Kulturhof Dulsberg) stellten die Ergebnisse der AG»Qualitatives Wachstum«vor. nach insoweit pro-
39 40 Rückbindung verloren gehe. Die spezifischen Förderblematisch, als Geförderte die zugeteilten Mittel immer auch voll ausgäben bzw. voll ausschöpften. Der darüber hinaus im bezirklichen Umfeld bestehende Bedarf sei schwer zu ermitteln. Eine weitere Problematik sei, dass seitens der Fachbehörde über die Rahmenzuweisungen an die Bezirksämter hinaus (Globalsteuerung) kaum Steuerungspotenzial (Budget) vorhanden sei. Innerhalb der Rahmenzuweisungen bestünde dann die Schwierigkeit auf Bezirksebene, eine schlüssige Aufteilung zwischen bereits Vorhandenem und Neuem (Innovation) zu realisieren. Vor diesem Hintergrund gehe es in den zu untersuchenden Einrichtungen darum, die Förderung sehr genau auf das zugrunde liegende Verhältnis von Zielen, eingesetzten Ressourcen und erreichten Ergebnissen / Leistungen zu überprüfen. Dies sei in professionell organisierten Einrichtungen einfacher als in denen, die vorwiegend mit Ehrenamtlichen arbeiten. Ein qualitatives Wachsen sei aber nur durch die Überprüfung dieser Abläufe möglich. Die Leistungsüberprüfung müsse differenziert vorgenommen werden (beispielsweise wie viele Veranstaltungen mit wie vielen Teilnehmern in welchen Bereichen stattgefunden haben). Letztlich sei die Wirkung der Leistungen zu prüfen (ob beispielsweise durch das Projekt»Jedem Kind ein Instrument«(NRW) die beteiligten Kinder auch intelligenter geworden seien und eine verbesserte Integration stattgefunden habe). Qualitatives Wachstum sei erst erreicht, wenn derartige Wirkungen belegt werden könnten. In einer angeregten Diskussion versuchten die Teilnehmer, die positiven Wirkungen von Stadtteilkulturarbeit an spezifischen Merkmalen festzumachen. Herr Frömming zitierte in diesem Zusammenhang die ehemalige Kultursenatorin Frau Schuchardt, die in einem aktuellen Statement die Wirkung und Ausstrahlung der Einrichtungen mit gesteigerter Lebensqualität gleichsetzte. Er betonte, dass die Stadtteilkulturarbeit keine Innovationsleistung der öffentlichen Verwaltung gewesen sei. Vielmehr stand und steht der Impuls»Stadtteilkultur«im Kern immer noch für bürgerschaftliches Engagement und Begeisterung für spezifische Arbeits- und Angebotsformen. Politik und Verwaltung seien diesen frühen Impulsen mit der Bereitstellung von Fördermitteln gefolgt. Die Zentren seien von ihrem Stadtteil geprägt, und ihre Individualität sei die Grundlage dafür, dass sich der Das Körber-Forum bot einen atmosphärisch schönen Rahmen für den Ausklang der Stadtteilkultur-Revue Stadtteil mit ihnen identifiziere (Beispielzitat aus Bergedorf:»Wir lieben unsere LOLA«). Finanzierung von Stadtteilkulturarbeit Im weiteren Gesprächsverlauf wurde die derzeitige Finanzierung von Stadtteilkulturarbeit thematisiert. Die Frage nach der Förderung von»innovation«im Stadtteil sei laut Werner Frömming weiterhin ungeklärt. Ein großer Anteil der Zuwächse im Doppelhaushalt 2009/2010 sei in bestehende Einrichtungen geflossen, um dort entstandene Engpässe auszugleichen. Innovationspotenzial sei aber vorhanden. Das würden auch Projekte wie die»hiphop-academy «belegen, denen es gelungen sei, im Rahmen einer innovativen Förderstrategie von»lebenswerte Stadt «im Rahmen der Integrierten Stadtteilentwicklung zu wachsen. Jetzt kümmere man sich um die Anschlussperspektiven. Aus Sicht von Werner Fröming sei auch kritisch zu bewerten, dass auf der Ebene der Bezirksverwaltungen Budgets unterschiedlicher Fachbehörden stärker zusammengeführt würden und damit die fachliche
40 41 ansätze der Stadtteilkultur drohten auf Kosten der Einrichtungen in globalisierten Haushaltsansätzen verloren zu gehen. Vonseiten der Bezirke (Herr Heymann für Harburg und Herr Capeletti für Bergedorf ) wurde unterstrichen, dass die Verteilung zwischen den Bezirken ungleichgewichtig verlaufe. Nach Meinung von Bernd Jankowski, Geschäftsführer der Begegnungsstätte Bergstedt, sollten die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf auf keinen Fall aus den Augen verloren werden. Notwendigkeit der Stadtteilkultur auf verschiedenen Ebenen Ulrike Ritter von Stadtteilbüro Dulsberg hielt es für erforderlich, die Anschlussfähigkeit von Stadtteilkultur stärker in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Davon würden alle Einrichtungen profitieren. Illustriert wurde das mit dem»jahr der Künste«und der Kooperation von Stadtteilkultur und Schule. In diesem Fall ging die Schule als Institution aktiv auf die Einrichtungen und Künstler im Stadtteil zu, um gemeinsam zu arbeiten. Thea Eschricht von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt wünschte sich, dass gerade solche Projekte unterstützt werden. Außerdem sei ein Wissensaustausch der Zentren (z.b. Weitergabe von bereits überprüften erfolgreichen Methoden) in Stadtteile hinein, in denen nur wenig auf der Grundlage bürgerschaftlichen Engagements entstanden sei, von großem Vorteil. Arbeitsgruppen zur Frage der intendierten Wirkung von Stadtteilkultur Die Arbeitsgruppe teilte sich in drei kleinere Gruppen auf, die sich mit der Beantwortung der Frage nach der Messbarkeit einer intendierten Wirkung von Stadtteilkultur beschäftigten. Die erste Arbeitsgruppe belegte die Wirkung anhand eines konkreten Beispiels. Die Louise Schröder Schule in Altona nahm am Projekt»Pilotschule Kultur«teil. Der Wirkungsnachweis erfolgte durch steigende Anmeldezahlen und eine nachweislich bessere Integrationsfähigkeit der Eltern im Stadtteil. Die Gruppe befürwortet eine Offenheit der Zentren, mit Schulen und anderen Einrichtungen im Stadtteil Partnerschaften einzugehen. Die zweite Arbeitsgruppe versuchte, Wirkung am Beispiel der Projektarbeit der Begegnungsstätte Bergstedt zu belegen. Zum einen konnten dort über die direkte Ansprache von Besuchern und den Einsatz von Fragebögen konkrete Wirkungen nachgewiesen werden. Zum anderen belegt die Kontinuität einzelner Besucher bei der Projektteilnahme sowie der persönliche Werdegang einzelner Jugendlicher eine positive Wirkung. Die Frage»Wie erreiche ich neue Zielgruppen?«konnte nicht abschließend geklärt werden. Grundsätzlich stellte sich heraus, dass sich die Messbarkeit der Wirksamkeit anhand von Zahlen schwierig gestaltet. Andere Möglichkeiten des Nachweises könnten eine fortlaufende Dokumentation der Arbeit und die subjektive Beobachtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Beides müsse über längere Zeiträume aufeinander bezogen und abgeglichen werden. Ziel der Stadtteilkulturarbeit sei, Frei-, Lebens- und Schutzräume zu schaffen. Für die dritte Arbeitsgruppe zeigt sich die Wirkung von Stadtteilkulturarbeit u.a. am persönlichen Wachstum der erreichten Menschen (genannt wurden Kinder und Jugendliche), am Image der Einrichtungen, dem Grad ihrer Vernetzung im Stadtteil und darüber hinaus und an ihrer Fähigkeit, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen, an der Sichtbarkeit der verschiedenen Kulturen im Stadtteil (z.b. Kultur der Sinti beim Sintifestival in Wilhelmsburg), an der Identifikation der Menschen mit ihrem Stadtteil und sogar am Stellenwert des Stadtteils in der Stadt. Die Gruppe diskutierte, ob Qualitäten immer auch gemessen werden können. Für die Messung der mit der Aussage»Wir lieben unsere LOLA«verbundenen Qualitäten wurden die Messgrößen»Bekanntheitsgrad der Einrichtung«,»Zufriedenheit mit ihren Angeboten«und die»fähigkeit, Künstler zu binden«(»künstlerbindungsquote«) genannt. Unterstrichen wurde, dass vor einer Wirkungsmessung die Klärung von Zielen im Kontext eines Leitbildes stehen müsse. Darin sei dann die Erarbeitung von Wirkungszielen einzubinden. Sabine Zaeske
41 42 Dr. Gesa Birnkraut Studium der Betriebswirtschaftslehre, Studium des Kulturmanagement, Doktorin der Philosophie zum Thema:»Ehrenamt in kulturellen Institutionen im Vergleich USA und Deutschland«. Geschäftsführende Gesellschafterin von Birnkraut Partner arts+ business consultants. Die Firma konzentriert sich auf die strategische Beratung von Kulturinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen. Dr. Jörg Ernst Jahrgang Politikwissenschaftler. Seit zehn Jahren freiberuflicher Fachreferent und Berater verschiedener Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen und Kommunen. Konzeption und Durchführung von Weiterbildungen zum Themenkreis»Sozialmanagement«, Schwerpunkte: Institutionelle Netzwerke, Social Marketing, Moderation. Werner Frömming Lehrerausbildung an der Universität, Geschäftsführer des Stadtteilkulturzentrums Goldbekhaus, Konzept- und Projektentwicklung für freie Träger und öffentliche Verwaltung, freiberufliche Lehrtätigkeit an der HAW und Universität (Kulturpolitik, Kulturfinanzierung), seit 2001 Fachreferent in der Behörde für Kultur, Sport und Medien (Stadtteilkultur, Stadtentwicklung, Kinderund Jugendkultur), Vorträge und Veröffentlichungen zum Themenfeld, seit 2010 Referatsleiter Kulturprojekte in der genannten Fachbehörde. Prof. Dr. Dieter Haselbach Bis 1979 Studium der Soziologie, 1984 Dissertation, 1991 Habilitation in Soziologie, 1985 bis 1995 Lehrtätigkeit u. a. in Darmstadt, Graz, Marburg; 1992 bis 1995 DAAD Associate Professor in Victoria, B.C. Kanada; 1996 bis 1999 Reader, Aston University, Birmingham; seit 2001 apl. Prof. an der Universität Marburg; seit 1999 Partner, seit 2007 Geschäftsführer der ICG culturplan; mehr als 20 Jahre Beratungserfahrung im öffentlichen Bereich Ralf Henningsmeyer Jahrgang 1952, Verlagskaufmann, Diplom-Sozialpädagoge, Kultur- und Bildungsmanager. Seit 1983 geschäftsführende Tätigkeiten in mehreren soziokulturellen Einrichtungen in. Von 1990 bis 2003 Geschäftsführer des Landesverband Soziokultur e.v., seit 2009 Geschäftsführer der GWA St. Pauli e.v. Nebenberufliche Lehrtätigkeiten in der Erwachsenenbildung zu den Themen Organisation von Non-profit-Arbeit, Projektarbeit, Fundraising sowie Projektentwicklungen in der Kinder- und Jugendarbeit
42 43 Stephanie Probst Diplom-Medienpädagogin und Journalistin, gründete und leitete während ihres Studiums an der pädagogischen Hochschule in Freiburg das Projekt»Radio für die Schule«. Nach dem Studium Produktionen für den Kinderkanal von ARD und ZDF, das Magazin»ReläXX«sowie Beiträge und ganze Sendungen. Arbeitet in Berlin für das Kinderradio RadiJoJo. Stephanie Probst ist u.a. für Arte als freie TV-Journalistin in tätig und zählt als Medienpädagogin zum festen Team des Audioprojektes OHRLOTSEN der MOTTE e.v., insbesondere Hör-Spielereien. Andrea Sievert Diplom-Sozialpädagogin, seit 2002 freie Medienpädagogin. Sie konzipiert und leitet verschiedene Kinderradioprojekte an Schulen und Einrichtungen der offenen Kinderund Jugendarbeit sowie bei nichtkommerziellen Lokalradios in Norddeutschland. Sie leitet u.a. den Kindersendeplatz»Wilde Welle«beim freien sender kombinat 93,0 in gründete sie die interkulturelle Kinderredaktion»Radiofüchse«(Dieter-Baacke-Preisträger 2008) im Haus der Familie und führt Computer- und Internetprojekte mit Kindern und mädchenspezifische Medienprojekte durch. Für das Projekt OHRLOTSEN der MOTTE e.v. leitet Andrea Sievers den Bereich Kinderradio. Ronny Strompf Ronny Strompf schreibt gerade seine Diplomarbeit mit dem Schwerpunktthema»Außerschulische und kulturelle Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen«. Während seines Studiums arbeitete er als Honorarkraft im Stadtteil- und Kulturzentrum MOTTE. Hier gründete er auch die»hörspielwerkstatt«für Kinder, mit denen er gemeinsam mehrere kleine Hörspiele produzierte. Beim Medienprojekt OHRLOTSEN ist er für die Bereiche Hörspiel(ereien) und Fragen der technischen Umsetzung zuständig. Bettina Trabandt Jahrgang 1968, Studium der Angwandten Kulturwissenschaften an der Uni Lüneburg, dann Berufseinstieg im Nonprofit-Bereich bei der Körber-Stiftung. Als Fundraiserin tätig gewesen: Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.v., Deutsches Müttergenesungswerk, Deutsche Wildtier Stiftung und derzeit bei der BürgerStiftung. Dr. Thomas Voß Dr. phil. Erziehungswissenschaft (Medienwissenschaft), langjährige Erfahrung in der medienpädagogischen Erzieherfortbildung und der Lehrerausbildung, derzeit Bereichsleiter Programm und Medienkompetenz in der Medienanstalt Schleswig-Holstein (MA HSH) Medienpädagogische Lehraufträge an der Universität, der HWP sowie den Universitäten Lüneburg und Leipzig, Vorträge und Publikationen zu Fragen des Kinder- und Jugendmedienschutzes und der Medienerziehung. Langjährige Zusammenarbeit in der Kommission für Jugendschutz (KJM), gemeinsam mit Andreas Hedrich Sprecher der Gesellschaft für Medienkompetenz und Kommunikationskultur (GMK), Landesgruppe.
43 44 Brigitte Abramowski, Stadtteilarchiv Ottensen, Gesa Alexander, Bernd Allenstein, Behörde f. Schule und Berufsbildung, Nadine Amelang, STADTKULTUR HAM- BURG Anke Amsink, Kulturhaus Dehnhaide, Bianca Basse, Michael Batz, Theater in der Speicherstadt, Ute Becker-Ewe, Gert Hinnerk Behlmer, Staatsrat a.d., Tobias Behrens, STATTBAU HAMBURG Rita Bender, Gesa Birnkraut, Birnkraut & Partner, Friedemann Boltes, Sasel Haus e.v., Roswitha Bornmann, Günter Bornmann, Michael Braun, Kulturladen Hamm, Horst Bretz, Trebel Ulrich Busch, Bernd Capeletti, C & P Capeletti & Perl, Heike Cent, Ralf Classen, Büro für Kultur und Medienprojekte, Gisela Clausen, Clausen + Co, Otto Clemens, Haus Drei e.v., Jürgen Dege-Rüger, IBA GmbH, Thomas Delissen, Behörde für Kultur, Sport und Medien, Naciye Demirbilek, Werkstatt 3, Metin Demirdere, Elbcoast Entertainment, Hannah Dietze, STADTKULTUR HAM- BURG Zinaida Dimitriouk, Papageienfischland e.v., Tina Djeyrani, Elbcoast Entertainment, Christina Dorau, Haus Drei e.v., Gisela Dressler, St. Pauli-Archiv e.v., Daniela Eck, Lüneburg Inge Ehlers, Marketta Eksymä-Winkelmann, Kulturhaus Süderelbe e.v., Dörte Ellerbrock, Kulturhaus Süderelbe e.v., Kirsten Encke, STADTKULTUR HAM- BURG Judy Engelhard, Sonja Engler, Zinnschmelze, Ellen Erdbeer, Bürgerhaus in Barmbek, Thea Eschricht, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Daniel Feldkamp, Birnkraut & Partner, Yvonne Fietz, STADTKULTUR HAMBURG Karla Fischer, Geschichtswerkstatt St. Georg, Susan Fröhlinger, Bezirksamt Wandsbek, Werner Frömming, Behörde für Kultur, Sport und Medien, Berndt Fuhrmann, Ernst Fülling, Detlef Garbe, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Ines Gärtner, Griet Gäthke, MOTTE e.v., Uwe Gaul, Behörde für Schule und Berufsbildung, Marlis Geisler, Stadtteilkulturzentrum Eidelstedter Bürgerhaus, Nadine Gemsa, Manfred Gerber, STATTBAU HAMBURG Thomas Giese, Honigfabrik, Klaas Goerges, Kunststück e.v. Hans-Hermann Groppe, er Volkshochschule Martin Grüning, Filiz Gulsular, Goldbekhaus, Ortrun Gutke, SOAL Alternativer Wohlfahrtsverband, Gerd Hardenberg, Kai-Michael Hartig, Körber-Stiftung, Dieter Haselbach, ICG culturplan Unternehmensberatung GmbH, Berlin Bernd Haß, Goldbekhaus, Ann-Christin Hausberg, Bürgerhaus in Barmbek, Heide Hauser, Kulturblatt, Jürgen Havlik, Alles wird schön, Erich Heeder, Marianne Heidebruch, GWA St. Pauli, Ulrich Hein-Wussow, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Lutz Hempel, ICG culturplan Unternehmensberatung GmbH, Lörrach Ralf Henningsmeyer, GWA St. Pauli, Günter Heymann, Bezirksamt Harburg, Wolfgang Hinsch, Kulturhaus Eppendorf, Ronald Hirte, Almut Hoffmann, Sibylle Hoffmann, Clemens Hoffmann-Kahre, MOTTE, Arno Hoffrichter, Markus Hoppe, Regine Hoppenrath, Annette Huber, literaturkontor, Regine Hüttl, Goldbekhaus, Dörte Inselmann, Kulturpalast im Wasserwerk, Katja Jacobsen, BRAKULA, Bernd Jankowski, Begegnungsstätte Bergstedt, Gerhard Janssen, Rechtsanwalt, Astrid Jawara, Goldbekhaus, Sylke Jehna, Haus Drei e.v., Michael Joho, Geschichtswerkstatt St. Georg, Marcel Kaiser, Fredesdorf Andre Kallwaß, BRAKULA, Bettina Kaßbaum, Kaßbaum Organisationsberatung, Eckhard Keller, Ulrike Keyhani, Medien & Kultur, Joerg Kilian, Petra Kochen, Gabriele Fink Stiftung, Klaus Kolb, Kulturhaus Eppendorf, Zerrin Konyalioglu-Busch, Dagmar Kossendey, Westibül, Knut Kösterke, kommunikation + konzept, Horst Kriegsmann, Jutta Krüger, Lichtwark-Forum Lurup e.v., Evelin Krüger, team.arbeit.hamburg, Christoph Krupp, Bezirksamt Bergedorf, Bernd Kunze, Offenes Atelier Mümmelmannsberg, Sebastian Kutz, ICG culturplan Unternehmensberatung GmbH, Berlin Matthias Lakämper, Lakämper, Klaus Lattmann, Karola Leenen, Stiftung Füreinander, Alexandra Leydecker, Bezirksamt Mitte, Rebecca Lohse, GWA St. Pauli, Nele Mallasch, Kulturpalast im Wasserwerk, Soukeyna Mare, Sebastian Matysek, Sabine Maurer, Rachid Messaoudi, Susanne Meuthien, er Schulmuseum Pia Meyer, Birnkraut & Partner, Kerstin Meyer, kulturundpunkt, Regina Mislinski-Stadler, Christine Moenck, BRAKULA, Corinna Mortzfeld, Dominique Nagel, Philipp Napp, Aumühle Maja Niedervolte, Birnkraut & Partner, Yvonne Nische, Bezirksamt Mitte Mike Nitsch, Kulturhaus Süderelbe e.v., Tatjana Nonn-Szily, Behörde für Kultur, Sport und Medien, Wolfgang Oehler, CONVENT Planung und Beratung GmbH i.l., Kathrin Offen-Klöckner, Stadtteilarchiv Ottensen, Christiane Orhan, Kulturladen St.
44 45 Georg, Ilse Paesler, Honigfabrik, Petra Palfi, Bezirksamt Bergedorf, Uta Percy, er Schulmuseum Andrea Pfeiffer, Behörde für Kultur, Sport und Medien, Peggy Piel, Gerd Plambeck, Seniorenbeirat, Cordula Podlasly, ella Kulturhaus Langenhorn, Arndt Prenzel, Schröderstift e.v., Christine Preuschl, Stefanie Probst, Ulrich Raatz, Peter Räcker, ARGE Arbeitsgemeinschaft für das Puppenspiel e.v., Kerstin Rasmußen, Stadtteilinitiative Hamm e.v., Elke Rathgen, Münster Peter Rautenberg, Goldbekhaus, Holger Reinberg, Bezirksamt Harburg, Christiane Richers, Theater am Strom, Thomas Ricken, Ulrike Ritter, Kulturhof Dulsberg, Heike Roegler, Kinderbuchhaus im Altonaer Museum, Anke Rohrbeck, Elena Romanov von Balsamoff, Vladimir Romanov von Balsamoff, Marcos Romao, Leonid Rossine, Papageienfischland e.v., Valentina Rudi, Westibül, Hans-Jürgen Ruthenberg, Geschichtsgruppe Dulsberg e.v., Hamb. Sielke Salomon, Galerie Morgenland e.v., Michael Sandmann, Stadtteilarchiv Ottensen, Saskia Scharlau, Jochen Schindlbeck, Kulturpalast im Wasserwerk, Bene Schmidt-Joho, Geschichtswerkstatt St. Georg, Benjamin-Patrick Schmitz, Stefanie Schreck, KulturA, Susette Schreiter, LOLA, Michael Schroeder-Piller, Cornelia Schroeder-Piller, Bezirksamt Wandsbek, Helga Schuchardt, Senatorin a.d., Hella Schwemer-Martienßen, HÖB er Öffentliche Bücherhallen Sarah Schwolow, Bienenbüttel Nico Setlev-Belajew, Norbert Sievers, Kulturpolitische Gesellschaft, Bonn Ulli Smandek, Bürgerhaus in Barmbek, Daniela Spitzar, Gemeinde Halstenbek, Renee Steenbock, Kulturladen St. Georg, Sabine Steffen, Bezirksamt Wandsbek, Thomas Steinberg, Sabine Stövesand, Cornelia Stoye, Jill Strasmann, Ronny Strompf, MOTTE, Ádám Szily, Maik Taege, Radbruch Ulrich Thiede, Bezirksamt Harburg, Bettina Trabandt, BürgerStiftung Karin Tschamper, Karin v. Welck, Behörde für Kultur, Sport und Medien, Christel Vogel, Kulturblatt für Bergedorf und Umgebung e.v., Uwe Voigt, Inge Volk, Iris von Bargen, Behörde für Kultur, Sport und Medien, Elisabeth von Dücker, Friederike von Gehren, er Volkshochschule Dirk Vorwerk, Stiftung Kinderjahre, Thomas Voss, MA HSH Medienanstalt / Schleswig Holstein, Norderstedt Mary Wagner, Helga Wallat, Bezirksamt Eimsbüttel, Nicole Wegner, Christine Weiß, Sasel Haus e.v., Lutz Wendler, Elke Westphal, Behörde für Kultur, Sport und Medien, Heiner Wiese, Bezirksamt Altona, Christine Wilms, Bezirksamt - Nord, Ansgar Wimmer, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., Anika Wohlers, Gudrun Wohlrab, Stadtteilarchiv Bramfeld, Gunnar Wulf, Kulturladen Hamm Magrete Wulf-Slabaugh, Sigrid Wussow, Sabine Zaeske, Behörde für Kultur, Sport und Medien, Kerstin Zech, Kulturladen Hamm, Verena Ziegler, Kulturhaus Eppendorf, Dokumentation des 10. er Ratschlag St a d t t e i l k u l t u r Hrsg: Landesrat für St a d t t e i l k u l t u r Be h ö rde für Ku l t u r, Sport und Medien Ha m b u rg Amt für Kultur und Medien, Ku l t u r p ro j e k t e Werner Fr ö m m i n g Hohe Bleichen 22, Ha m b u rg Telefon: 040 / Telefax: 040 / E - Mail: we r n e r. f ro e m m i n b k s m. h a m b u rg. d e Re d a k t i o n Yvonne Fi e t z Die abgedruckten Beiträge sind autorisierte und überarbeitete Fassungen der Ta g u n g s vorträge, dere n Inhalt in der Verantwortung der Au t o ren liegt. L a yout, Sa t z Yvonne Fietz, Ti t e l f o t o Die MOTTE (Radiowe rk s t a t t ) Dr u c k St. Pauli Dr u c k e re i Auflage Die Dokumentation vom Ratschlag St a d t t e i l k u l t u r kann für 5 Eu ro zzgl. Versand bestellt we rden bei: S TA D T K U LT U R H A M BU RG Neuer Kamp 25, Ha m b u rg Telefon: 040 / Telefax: 040 / E - Mail: info@stadtkultur- h h. d e Die Dokumentation des Ratschlag St a d t t e i l k u l t u r w u rde mit freundlicher Unterstützung der Ku l t u r b e- h ö rde der Freien und Hansestadt Ha m b u rg erstellt.
45
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt Juli 2011
 Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt 1 Juli 2011 Leitlinien für die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements des Bezirksamtes Treptow-Köpenick von Berlin
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt 1 Juli 2011 Leitlinien für die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements des Bezirksamtes Treptow-Köpenick von Berlin
Leitlinien für einen erfolgreichen Aufbau einer CSR Strategie in kleinen und mittelständischen Unternehmen im Rahmen der CSR Initiative Rheinland
 Leitlinien für einen erfolgreichen Aufbau einer CSR Strategie in kleinen und mittelständischen Unternehmen im Rahmen der CSR Initiative Rheinland Herausgeber: CSR Initiative Rheinland Ein Gemeinschaftsprojekt
Leitlinien für einen erfolgreichen Aufbau einer CSR Strategie in kleinen und mittelständischen Unternehmen im Rahmen der CSR Initiative Rheinland Herausgeber: CSR Initiative Rheinland Ein Gemeinschaftsprojekt
Eröffnung der Galerie der Schlumper 27. Juni 2014, Uhr, Forum für Kunst und Inklusion, Marktstraße 131
 Seite 1 von 9 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Eröffnung der Galerie der Schlumper 27. Juni 2014, 19.00 Uhr, Forum für Kunst und Inklusion, Marktstraße
Seite 1 von 9 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Eröffnung der Galerie der Schlumper 27. Juni 2014, 19.00 Uhr, Forum für Kunst und Inklusion, Marktstraße
11. DEVAP- BUNDESKONGRESS Forum I/6 Chancen nutzen im Themenfeld CSR
 11. DEVAP- BUNDESKONGRESS 2011 Forum I/6 Chancen nutzen im Themenfeld CSR Was steckt hinter dem Begriff CSR? CSR steht für Corporate Social Responsibilty Grundlagen und Begriffe Was steckt hinter den Begriffen
11. DEVAP- BUNDESKONGRESS 2011 Forum I/6 Chancen nutzen im Themenfeld CSR Was steckt hinter dem Begriff CSR? CSR steht für Corporate Social Responsibilty Grundlagen und Begriffe Was steckt hinter den Begriffen
InterkulTOUR Ausflug in die interkulturelle Zivilgesellschaft
 InterkulTOUR Ausflug in die interkulturelle Zivilgesellschaft Konzept und Ablauf einer Führung zu interkulturellen Engagementplätzen Seite 1 InterkulTOUR Ausflug in die interkulturelle Zivilgesellschaft
InterkulTOUR Ausflug in die interkulturelle Zivilgesellschaft Konzept und Ablauf einer Führung zu interkulturellen Engagementplätzen Seite 1 InterkulTOUR Ausflug in die interkulturelle Zivilgesellschaft
Eine Schöne Zeit erleben
 Eine Schöne Zeit erleben Jochen Schmauck-Langer Geschäftsführer dementia+art Kulturgeragoge, Autor und Dozent, Kunstbegleiter für Ältere und besonders für Menschen mit Demenz Qualifikation zur Alltagsbegleitung
Eine Schöne Zeit erleben Jochen Schmauck-Langer Geschäftsführer dementia+art Kulturgeragoge, Autor und Dozent, Kunstbegleiter für Ältere und besonders für Menschen mit Demenz Qualifikation zur Alltagsbegleitung
Corporate Social Responsibility als strategische Notwendigkeit für Caritas-Unternehmen: Praxisbeispiele. Rechträgertagung, 12.,13.4.
 Corporate Social Responsibility als strategische Notwendigkeit für Caritas-Unternehmen: Praxisbeispiele Rechträgertagung, 12.,13.4.11, Weimar Vom Sponsoring zu CSR Warum mit Unternehmen zusammenarbeiten?
Corporate Social Responsibility als strategische Notwendigkeit für Caritas-Unternehmen: Praxisbeispiele Rechträgertagung, 12.,13.4.11, Weimar Vom Sponsoring zu CSR Warum mit Unternehmen zusammenarbeiten?
RESSORT KULTUR FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN. Kulturleitbild. Regierungsgebäude Peter Kaiser Platz 1 Postfach Vaduz Liechtenstein T
 RESSORT KULTUR FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Kulturleitbild Regierungsgebäude Peter Kaiser Platz 1 Postfach 684 9490 Vaduz Liechtenstein T +423 236 61 11 2 1. Einführung 1.1 Definition KULTUR Wir leiten den
RESSORT KULTUR FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Kulturleitbild Regierungsgebäude Peter Kaiser Platz 1 Postfach 684 9490 Vaduz Liechtenstein T +423 236 61 11 2 1. Einführung 1.1 Definition KULTUR Wir leiten den
11 ENGAGEMENT THESEN. Prof. Dr. Jörn Dosch (Universität Rostock)
 11 ENGAGEMENT THESEN Prof. Dr. Jörn Dosch (Universität Rostock) 1. Ehrenamtliches Engagement ist kein Selbstzweck Im Vordergrund sollte nicht in erster Linie der Versuch stehen, Menschen prinzipiell für
11 ENGAGEMENT THESEN Prof. Dr. Jörn Dosch (Universität Rostock) 1. Ehrenamtliches Engagement ist kein Selbstzweck Im Vordergrund sollte nicht in erster Linie der Versuch stehen, Menschen prinzipiell für
Begrüßungsworte. Tag der Medienkompetenz, 26. November 2012, 10:30 Uhr, Plenarsaal
 Begrüßungsworte Tag der Medienkompetenz, 26. November 2012, 10:30 Uhr, Plenarsaal Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Frau Ministerin Schwall-Düren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte
Begrüßungsworte Tag der Medienkompetenz, 26. November 2012, 10:30 Uhr, Plenarsaal Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Frau Ministerin Schwall-Düren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte
Seite 1. Grußwort PSt in Marks
 Seite 1 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Herr Lehrieder, sehr geehrter Herr Corsa, ich freue
Seite 1 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Herr Lehrieder, sehr geehrter Herr Corsa, ich freue
Die Bürgerstiftung Sindelfingen gewinnt mit deutsch-türkischem Theater-Projekt vor Wiesloch und Leipzig
 Pressemeldung Ideenwettbewerb für Bürgerstiftungen: Brücken bauen zwischen Generationen Die Bürgerstiftung Sindelfingen gewinnt mit deutsch-türkischem Theater-Projekt vor Wiesloch und Leipzig Berlin, 20.
Pressemeldung Ideenwettbewerb für Bürgerstiftungen: Brücken bauen zwischen Generationen Die Bürgerstiftung Sindelfingen gewinnt mit deutsch-türkischem Theater-Projekt vor Wiesloch und Leipzig Berlin, 20.
INHALTSVER- ZEICHNIS
 INHALTSVER- ZEICHNIS 1 DIE VERANSTALTER Aktive Medienarbeit ist essenzieller Bestandteil der Jugendkultur. In der JUFINALE findet sie eine bewährte Struktur: im Zusammenspiel von bayernweiten Förderern,
INHALTSVER- ZEICHNIS 1 DIE VERANSTALTER Aktive Medienarbeit ist essenzieller Bestandteil der Jugendkultur. In der JUFINALE findet sie eine bewährte Struktur: im Zusammenspiel von bayernweiten Förderern,
Fachstelle Gemeinwesendiakonie Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost. Miteinander im Quartier
 Fachstelle Gemeinwesendiakonie Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost Miteinander im Quartier Kirche in der Stadt Fachstelle Gemeinwesendiakonie Gemeinwesendiakonie ein Arbeitsansatz, mit dem Kirche und Diakonie
Fachstelle Gemeinwesendiakonie Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost Miteinander im Quartier Kirche in der Stadt Fachstelle Gemeinwesendiakonie Gemeinwesendiakonie ein Arbeitsansatz, mit dem Kirche und Diakonie
Begrüßung durch Frau Brigitte Döcker Mitglied des Vorstands, AWO Bundesverband e.v. BAGFW-Fachtagung:
 Begrüßung durch Frau Brigitte Döcker Mitglied des Vorstands, AWO Bundesverband e.v. BAGFW-Fachtagung: Vom Betreuungsverein zum Kompetenzzentrum am 10. Oktober 2013 in Kassel Sehr geehrte Damen und Herren,
Begrüßung durch Frau Brigitte Döcker Mitglied des Vorstands, AWO Bundesverband e.v. BAGFW-Fachtagung: Vom Betreuungsverein zum Kompetenzzentrum am 10. Oktober 2013 in Kassel Sehr geehrte Damen und Herren,
Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler
 28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
15. Fachtagung: Kultur des Wandels. Wie gestalten Freiwilligenagenturen Entwicklungen im bürgerschaftlichen Engagement mit?
 15. Fachtagung: Kultur des Wandels Wie gestalten Freiwilligenagenturen Entwicklungen im bürgerschaftlichen Engagement mit? Workshop: Freiwilligenagenturen und Kommunen Impuls und Moderation Siegmar Schridde
15. Fachtagung: Kultur des Wandels Wie gestalten Freiwilligenagenturen Entwicklungen im bürgerschaftlichen Engagement mit? Workshop: Freiwilligenagenturen und Kommunen Impuls und Moderation Siegmar Schridde
Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk
 Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk März 2006 1 Sozialraumorientierung heißt Lebensweltorientierung Wir als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im
Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk März 2006 1 Sozialraumorientierung heißt Lebensweltorientierung Wir als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im
Zivilgesellschaftliche Bedeutung von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM)
 Zivilgesellschaftliche Bedeutung von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) Kirsten Bruhns Tagung Potenziale nutzen Teilhabe stärken von BMFSFJ, BAMF, DBJR, 10./11.05.2012 1 Gliederung
Zivilgesellschaftliche Bedeutung von Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) Kirsten Bruhns Tagung Potenziale nutzen Teilhabe stärken von BMFSFJ, BAMF, DBJR, 10./11.05.2012 1 Gliederung
Die Kunst der Gemeinwesenarbeit
 Die Kunst der Gemeinwesenarbeit 1 2 Schwerpunkte Wir begleiten Städte, Gemeinden und Wohnbauträger bei der Entwicklung und Umsetzung von: Stadt- und Stadtteilentwicklungsprojekten Gemeindeentwicklungsprojekten
Die Kunst der Gemeinwesenarbeit 1 2 Schwerpunkte Wir begleiten Städte, Gemeinden und Wohnbauträger bei der Entwicklung und Umsetzung von: Stadt- und Stadtteilentwicklungsprojekten Gemeindeentwicklungsprojekten
Kommune und Nachhaltigkeit. Martin Müller Fachberater Bürgerengagement
 Kommune und Nachhaltigkeit Martin Müller Fachberater Bürgerengagement 2 Teile: 1. Wie tickt Verwaltung 2. Wie kommt man zusammen..., der Sport und die Kommune Nachhaltige Entwicklung in allen drei AGENDA-Feldern
Kommune und Nachhaltigkeit Martin Müller Fachberater Bürgerengagement 2 Teile: 1. Wie tickt Verwaltung 2. Wie kommt man zusammen..., der Sport und die Kommune Nachhaltige Entwicklung in allen drei AGENDA-Feldern
Mehr als Kindertagesstätten. professionellen Kinderbetreuung.
 Mehr als 50.000 Kindertagesstätten gibt es in Deutschland. Damit Millionen Kinder gut aufwachsen können, arbeiten viele Menschen und Institutionen an der Verbesserungen der Rahmenbedingungen im Umfeld
Mehr als 50.000 Kindertagesstätten gibt es in Deutschland. Damit Millionen Kinder gut aufwachsen können, arbeiten viele Menschen und Institutionen an der Verbesserungen der Rahmenbedingungen im Umfeld
UNSER LEITBILD. Was uns ausmacht und wie wir miteinander umgehen.
 UNSER LEITBILD Was uns ausmacht und wie wir miteinander umgehen. Orientierung geben, Identität fördern, Sinn stiften. Unsere Gesellschaft wandelt sich schneller denn je, und wir stehen vor zahlreichen
UNSER LEITBILD Was uns ausmacht und wie wir miteinander umgehen. Orientierung geben, Identität fördern, Sinn stiften. Unsere Gesellschaft wandelt sich schneller denn je, und wir stehen vor zahlreichen
Mit der Deutschen unesco-kommission und kulturweit. Mehrwert für Unternehmen. Corporate Volunteering
 Mit der Deutschen unesco-kommission und kulturweit. Mehrwert für Unternehmen. Corporate Volunteering 1 Grußwort Prof. Dr. Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen UNESCO- Kommission Dass Unternehmen
Mit der Deutschen unesco-kommission und kulturweit. Mehrwert für Unternehmen. Corporate Volunteering 1 Grußwort Prof. Dr. Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen UNESCO- Kommission Dass Unternehmen
Sozialmanagement im Kontext aktueller Entwicklungen in der sozialen Arbeit. Prof. Dr. Wolfgang Stark Universität Duisburg-Essen
 Sozialmanagement im Kontext aktueller Entwicklungen in der sozialen Arbeit Prof. Dr. Wolfgang Stark Universität Duisburg-Essen Nicht die Soziale Arbeit ist zu managen, sondern soziale Organisationen! Gründe
Sozialmanagement im Kontext aktueller Entwicklungen in der sozialen Arbeit Prof. Dr. Wolfgang Stark Universität Duisburg-Essen Nicht die Soziale Arbeit ist zu managen, sondern soziale Organisationen! Gründe
Neue Verbindungen schaffen
 Neue Verbindungen schaffen Zukunft gestalten heißt auch, dass wir alle über unseren Tellerrand hinausschauen. Ein funktionsfähiges Gemeinwesen braucht neue, grenzüberschreitende Soziale Kooperationen,
Neue Verbindungen schaffen Zukunft gestalten heißt auch, dass wir alle über unseren Tellerrand hinausschauen. Ein funktionsfähiges Gemeinwesen braucht neue, grenzüberschreitende Soziale Kooperationen,
Verantwortungspartner-Regionen in Deutschland. Seite 1
 Verantwortungspartner-Regionen in Deutschland Seite 1 Vom engagierten Unternehmer zum Verantwortungspartner Die Ideenvielfalt bei Unternehmensprojekten ist enorm viele Beispiele sind übertragbar. Vernetztes
Verantwortungspartner-Regionen in Deutschland Seite 1 Vom engagierten Unternehmer zum Verantwortungspartner Die Ideenvielfalt bei Unternehmensprojekten ist enorm viele Beispiele sind übertragbar. Vernetztes
Wenn wir das Váray-Quartett so wunderbar musizieren hören, spüren wir, wie uns Kunst und Kultur berühren.
 Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
LEITBILD LANDRATSAMT GÖPPINGEN
 LEITBILD LANDRATSAMT GÖPPINGEN F I L I S A Freundlich Innovativ Lebendig Informierend Serviceorientiert Aufgeschlossen FILISA, LAT. DIE FILS FILISA 2 3 Wir haben FILISA ganz bewusst als Untertitel für
LEITBILD LANDRATSAMT GÖPPINGEN F I L I S A Freundlich Innovativ Lebendig Informierend Serviceorientiert Aufgeschlossen FILISA, LAT. DIE FILS FILISA 2 3 Wir haben FILISA ganz bewusst als Untertitel für
FAQs zum Wertebündnis Bayern
 FAQs zum Wertebündnis Bayern 1. Was ist das Wertebündnis Bayern? 2. Welche Zielsetzung hat das Wertebündnis Bayern? 3. Welche Werte sollen den Kindern und Jugendlichen schwerpunktmäßig vermittelt werden?
FAQs zum Wertebündnis Bayern 1. Was ist das Wertebündnis Bayern? 2. Welche Zielsetzung hat das Wertebündnis Bayern? 3. Welche Werte sollen den Kindern und Jugendlichen schwerpunktmäßig vermittelt werden?
Zusammenfassung und Fotodokumentation der zweiten Sitzung der Zukunftskonferenz am
 Zusammenfassung und Fotodokumentation der zweiten Sitzung der Zukunftskonferenz am 29.6.2012 Anknüpfend an die erste Zukunftskonferenz am 3.2.2012, aus dem Programm Anschwung für frühe Chancen der deutschen
Zusammenfassung und Fotodokumentation der zweiten Sitzung der Zukunftskonferenz am 29.6.2012 Anknüpfend an die erste Zukunftskonferenz am 3.2.2012, aus dem Programm Anschwung für frühe Chancen der deutschen
Wir möchten Sie einladen, sich erstmals oder erneut mit einer Veranstaltung an diesem Aktionstag zu beteiligen!
 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 11055 Berlin Projektaufruf an Städte und Gemeinden TEL +49 3018 305-6143 FAX +49 3018 305-4375 SW14@bmub.bund.de www.bmub.bund.de Aufruf:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 11055 Berlin Projektaufruf an Städte und Gemeinden TEL +49 3018 305-6143 FAX +49 3018 305-4375 SW14@bmub.bund.de www.bmub.bund.de Aufruf:
Dürfen wir für ein paar Minuten um Ihre Aufmerksamkeit bitten.
 Dürfen wir für ein paar Minuten um Ihre Aufmerksamkeit bitten. listen. zuhören. analysieren. listen. Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner, Lieferanten, Behörden oder Gemeinden haben unterschiedlichste
Dürfen wir für ein paar Minuten um Ihre Aufmerksamkeit bitten. listen. zuhören. analysieren. listen. Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner, Lieferanten, Behörden oder Gemeinden haben unterschiedlichste
Freie und Hansestadt Hamburg Erster Bürgermeister
 Freie und Hansestadt Hamburg Erster Bürgermeister Empfang Hamburg engagiert sich 30. November 2011 Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Doyen des Konsularischen
Freie und Hansestadt Hamburg Erster Bürgermeister Empfang Hamburg engagiert sich 30. November 2011 Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Doyen des Konsularischen
Erläuterung Mission-Statement: Unser Auftrag Die Mission
 Unser Auftrag Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten durch ein Wertesystem, das auf Gesetz und Versprechen der Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Unser Auftrag Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten durch ein Wertesystem, das auf Gesetz und Versprechen der Pfadfinder und Pfadfinderinnen
"Senioren mobil im Alter 2011"
 "Senioren mobil im Alter 2011" Bericht zur Tagung am 19.10.2011 im KREATIVHAUS MITTE Antragsteller: VCD Nordost Projektzeitraum: 01.04.2011 bis 31.12.2011 Ansprechpartner für Rückfragen: Thorsten Haas
"Senioren mobil im Alter 2011" Bericht zur Tagung am 19.10.2011 im KREATIVHAUS MITTE Antragsteller: VCD Nordost Projektzeitraum: 01.04.2011 bis 31.12.2011 Ansprechpartner für Rückfragen: Thorsten Haas
Wirtschaftspolitische Positionen der IHK-Organisation 2017 VERANTWORTUNG VON UNTERNEHMEN: Ehrbar handeln, erfolgreich wirtschaften
 Wirtschaftspolitische Positionen der IHK-Organisation 2017 VERANTWORTUNG VON UNTERNEHMEN: Ehrbar handeln, erfolgreich wirtschaften Die wirtschaftspolitischen Positionen der IHK-Organisation (WiPos) zeigen
Wirtschaftspolitische Positionen der IHK-Organisation 2017 VERANTWORTUNG VON UNTERNEHMEN: Ehrbar handeln, erfolgreich wirtschaften Die wirtschaftspolitischen Positionen der IHK-Organisation (WiPos) zeigen
Bewegen was uns bewegt
 Bewegen was uns bewegt www. www. Die Schmid Stiftung www. Seite 2 Anliegen der Schmid Stiftung Die Schmid Stiftung wurde 2011 als operative gemeinnützige Stiftung gegründet. Ihre Geschäftstätigkeit wird
Bewegen was uns bewegt www. www. Die Schmid Stiftung www. Seite 2 Anliegen der Schmid Stiftung Die Schmid Stiftung wurde 2011 als operative gemeinnützige Stiftung gegründet. Ihre Geschäftstätigkeit wird
Auftrag Inklusion Perspektiven für eine neue Offenheit in der Kinder- und Jugendarbeit
 Auftrag Inklusion Perspektiven für eine neue Offenheit in der Kinder- und Jugendarbeit Eine Standortbestimmung von Kinder- und Jugendarbeit im Kontext von Inklusion Handlungsempfehlungen für die Praxis
Auftrag Inklusion Perspektiven für eine neue Offenheit in der Kinder- und Jugendarbeit Eine Standortbestimmung von Kinder- und Jugendarbeit im Kontext von Inklusion Handlungsempfehlungen für die Praxis
der AWO Kreisverband Nürnberg e.v. 2. IKÖ als Auftrag zur aktiven Beteiligung im Gemeinwesen 3. IKÖ als Auftrag an Vorstand und Ortsvereine
 Leitbild zur Interkulturellen Öffnung (IKÖ) der AWO Kreisverband Nürnberg e.v. 1. Grundsätze 2. IKÖ als Auftrag zur aktiven Beteiligung im Gemeinwesen 3. IKÖ als Auftrag an Vorstand und Ortsvereine 4.
Leitbild zur Interkulturellen Öffnung (IKÖ) der AWO Kreisverband Nürnberg e.v. 1. Grundsätze 2. IKÖ als Auftrag zur aktiven Beteiligung im Gemeinwesen 3. IKÖ als Auftrag an Vorstand und Ortsvereine 4.
Corporate Responsibility Leitlinie für unser gesellschaftliches Engagement
 Leitlinie für unser gesellschaftliches Engagement Seite 1 gesellschaftliches Engagement Unternehmen haben eine zentrale Verantwortung für das gesellschaftliche Umfeld, in dem sie agieren. (CR) ist für
Leitlinie für unser gesellschaftliches Engagement Seite 1 gesellschaftliches Engagement Unternehmen haben eine zentrale Verantwortung für das gesellschaftliche Umfeld, in dem sie agieren. (CR) ist für
Demokratie leben Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit
 Demokratie leben Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit So könnte der Antrag aussehen 1. Angaben zum Antragssteller Name / Institution / Verein / Initiative Rechtsform Anschrift
Demokratie leben Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit So könnte der Antrag aussehen 1. Angaben zum Antragssteller Name / Institution / Verein / Initiative Rechtsform Anschrift
Konzept Stadtteilarbeit. Stadtteilzentren in Hamm
 Konzept Stadtteilarbeit Stadtteilzentren in Hamm Geschichte der Stadtteilarbeit in Hamm Herausfordernd war die soziale Entwicklung der 80er und 90er Jahre, in denen sich in deutschen Großstädten soziale
Konzept Stadtteilarbeit Stadtteilzentren in Hamm Geschichte der Stadtteilarbeit in Hamm Herausfordernd war die soziale Entwicklung der 80er und 90er Jahre, in denen sich in deutschen Großstädten soziale
FÖRDERPREIS VEREIN(T) FÜR GUTE SCHULE Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) & Kooperationen
 FÖRDERPREIS VEREIN(T) FÜR GUTE SCHULE 2017 Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) & Kooperationen Was ist der Förderpreis Verein(t) für gute Schule? Schulfördervereine bündeln das zivilgesellschaftliche
FÖRDERPREIS VEREIN(T) FÜR GUTE SCHULE 2017 Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) & Kooperationen Was ist der Förderpreis Verein(t) für gute Schule? Schulfördervereine bündeln das zivilgesellschaftliche
Leitbild. des Deutschen Kinderschutzbundes
 Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Die Ich kann was! -Initiative macht Kinder und Jugendliche in Deutschland stark!
 Die Ich kann was! -Initiative macht Kinder und Jugendliche in Deutschland stark! Köln, 16. November Förderkriterien der Ich kann was! -Initiative Ilona Böttger Mangelnde Bildung gefährdet das Gemeinwohl
Die Ich kann was! -Initiative macht Kinder und Jugendliche in Deutschland stark! Köln, 16. November Förderkriterien der Ich kann was! -Initiative Ilona Böttger Mangelnde Bildung gefährdet das Gemeinwohl
Leitbild Schule Teufen
 Leitbild Schule Teufen 1 wegweisend Bildung und Erziehung 2 Lehren und Lernen 3 Beziehungen im Schulalltag 4 Zusammenarbeit im Schulteam 5 Kooperation Schule und Eltern 6 Gleiche Ziele für alle 7 Schule
Leitbild Schule Teufen 1 wegweisend Bildung und Erziehung 2 Lehren und Lernen 3 Beziehungen im Schulalltag 4 Zusammenarbeit im Schulteam 5 Kooperation Schule und Eltern 6 Gleiche Ziele für alle 7 Schule
Bericht zur UBUNTU-Anti-AIDS-Kampagne. SJD Die Falken, Kreisverband Bremerhaven
 Bericht zur UBUNTU-Anti-AIDS-Kampagne SJD Die Falken, Kreisverband Bremerhaven Ausgehend von einer Gruppe von neun Bremerhavener SchülerInnen wurde die UBUNTU-Anti- AIDS-Kampagne in ihren Anfängen bereits
Bericht zur UBUNTU-Anti-AIDS-Kampagne SJD Die Falken, Kreisverband Bremerhaven Ausgehend von einer Gruppe von neun Bremerhavener SchülerInnen wurde die UBUNTU-Anti- AIDS-Kampagne in ihren Anfängen bereits
Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung
 Evaluation Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung - Kurzfassung der Ergebnisse - 1. Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung : ein Programm für alle Regionen in Deutschland Der Ansatz von Kultur macht
Evaluation Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung - Kurzfassung der Ergebnisse - 1. Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung : ein Programm für alle Regionen in Deutschland Der Ansatz von Kultur macht
4. Nürnberger Stiftertag Glück.Stiften. Das Ehrenamtsprojekt Kulturfreunde
 www.pwc-stiftung.de 4. Nürnberger Stiftertag Glück.Stiften. Das Ehrenamtsprojekt Kulturfreunde Verständnis Gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens geht über die Schaffung rein wirtschaftlichen
www.pwc-stiftung.de 4. Nürnberger Stiftertag Glück.Stiften. Das Ehrenamtsprojekt Kulturfreunde Verständnis Gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens geht über die Schaffung rein wirtschaftlichen
Warum dann nicht davon berichten?
 SERVICE-INITIATIVE...... TOP-SERVICE ist für Sie ein Thema. Warum dann nicht davon berichten? SERVICE-INITIATIVE D: +49 (0)89-660 639 79-0 Ö: +43 (0)772-210 68 Top-Service ist für Sie ein Thema. Warum
SERVICE-INITIATIVE...... TOP-SERVICE ist für Sie ein Thema. Warum dann nicht davon berichten? SERVICE-INITIATIVE D: +49 (0)89-660 639 79-0 Ö: +43 (0)772-210 68 Top-Service ist für Sie ein Thema. Warum
Crowdfunding. Workshop
 Crowdfunding Workshop 8.06.2018 Isabel Korch Was mache ich? Referentin Online-Fundraising (FA) CSR-Managerin (FA) Seit 2000 Begleitung von Internet-Startups Seit 10 Jahren Konzentration auf Online-Fundraising-Projekte
Crowdfunding Workshop 8.06.2018 Isabel Korch Was mache ich? Referentin Online-Fundraising (FA) CSR-Managerin (FA) Seit 2000 Begleitung von Internet-Startups Seit 10 Jahren Konzentration auf Online-Fundraising-Projekte
Neue Fördermittel für interkulturelle Projekte mit Kindern und Jugendlichen von März bis Dezember 2017!
 Das WIR gestalten - Teilhabe ermöglichen. Die Integrationsoffensive Baden-Württemberg fördert Projekte zur Integration junger Menschen unterschiedlicher Herkunft in der Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg
Das WIR gestalten - Teilhabe ermöglichen. Die Integrationsoffensive Baden-Württemberg fördert Projekte zur Integration junger Menschen unterschiedlicher Herkunft in der Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg
Nachhaltige Unternehmen Zukunftsfähige Unternehmen? Corporate Responsibility bei der AUDI AG
 Nachhaltige Unternehmen Zukunftsfähige Unternehmen? Corporate Responsibility bei der AUDI AG Dr. Peter F. Tropschuh 16. November 2013 1. Was ist Corporate Responsibility? Grundlagen unternehmerischer Nachhaltigkeit
Nachhaltige Unternehmen Zukunftsfähige Unternehmen? Corporate Responsibility bei der AUDI AG Dr. Peter F. Tropschuh 16. November 2013 1. Was ist Corporate Responsibility? Grundlagen unternehmerischer Nachhaltigkeit
3. Nürnberger Tage zum Asyl- und Ausländerrecht
 3. Nürnberger Tage zum Asyl- und Ausländerrecht zum Thema "60 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention" Dr. Michael Lindenbauer UNHCR-Vertreter für Deutschland und Österreich Nürnberg, 5. Oktober 2011 Sehr geehrte
3. Nürnberger Tage zum Asyl- und Ausländerrecht zum Thema "60 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention" Dr. Michael Lindenbauer UNHCR-Vertreter für Deutschland und Österreich Nürnberg, 5. Oktober 2011 Sehr geehrte
auch ich freue mich Sie im Namen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe anlässlich der heutigen Fachtagung Alkoholprävention
 Grußwort zur AWA-Fachtagung am 16.06.2015 Hans Meyer, LWL-Jugenddezernent Sehr geehrte Frau Schmidtmann, sehr geehrter Herr Hein, sehr geehrter Herr Tornau, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch
Grußwort zur AWA-Fachtagung am 16.06.2015 Hans Meyer, LWL-Jugenddezernent Sehr geehrte Frau Schmidtmann, sehr geehrter Herr Hein, sehr geehrter Herr Tornau, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch
Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern
 2. Kultur.Forscher!- Netzwerktreffen am 09. und 10. Oktober 2009 in Berlin Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern Moderation Harriet Völker und Jürgen Schulz Einführung:
2. Kultur.Forscher!- Netzwerktreffen am 09. und 10. Oktober 2009 in Berlin Arbeitsgruppe: Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern Moderation Harriet Völker und Jürgen Schulz Einführung:
Auf dem Weg zu einem Kulturpolitischen Leitbild
 Auf dem Weg zu einem Kulturpolitischen Leitbild Leitbildentwicklung in vier Schritten am Beispiel der Stadt Göttingen (Köln, Hildesheim, Minden) Schritt 1: Präambel Die Formulierungen in den Präambeln
Auf dem Weg zu einem Kulturpolitischen Leitbild Leitbildentwicklung in vier Schritten am Beispiel der Stadt Göttingen (Köln, Hildesheim, Minden) Schritt 1: Präambel Die Formulierungen in den Präambeln
Sehr geehrte Damen und Herren,
 Leitbild Sehr geehrte Damen und Herren, das Referat für Gesundheit und Umwelt mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trägt maßgeblich zum gesunden Leben, zur intakten Umwelt und zum würdevollen
Leitbild Sehr geehrte Damen und Herren, das Referat für Gesundheit und Umwelt mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trägt maßgeblich zum gesunden Leben, zur intakten Umwelt und zum würdevollen
Es gilt das gesprochene Wort!
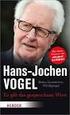 Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des gemeinsamen Treffens der StadtAGs, des Integrationsrates und des AK Kölner Frauenvereinigungen am 15. April 2016, 13:30 Uhr, Dienststelle
Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des gemeinsamen Treffens der StadtAGs, des Integrationsrates und des AK Kölner Frauenvereinigungen am 15. April 2016, 13:30 Uhr, Dienststelle
Schulische Ganztagsangebote im Jugendalter Ambivalenzen und Potenziale
 Schulische Ganztagsangebote im Jugendalter Ambivalenzen und Potenziale Tagung des Jugendministeriums des Freistaats Thüringen 20. Sept. 2017 Prof. Klaus Schäfer Das Jugendalter und auch das frühe Erwachsenenalter
Schulische Ganztagsangebote im Jugendalter Ambivalenzen und Potenziale Tagung des Jugendministeriums des Freistaats Thüringen 20. Sept. 2017 Prof. Klaus Schäfer Das Jugendalter und auch das frühe Erwachsenenalter
Richtlinien zu Spenden und Sponsoring
 Richtlinien zu Spenden und Sponsoring Die gesellschaftliche Verantwortung steht für die THIMM Gruppe neben der Kunden- und Mitarbeiterorientierung im Focus. Teil dieses sozialen Engagements sind Spenden
Richtlinien zu Spenden und Sponsoring Die gesellschaftliche Verantwortung steht für die THIMM Gruppe neben der Kunden- und Mitarbeiterorientierung im Focus. Teil dieses sozialen Engagements sind Spenden
Umwelt Agentur Kyritz
 Verb Bildung im Nordwesten Brandenburgs Dr. Stephan Lehmann 21.11.2016 Grlagen / reg. Gliederung 1. Umwelt Agentur 2. Grlagen / regionale 2. 3. 4. im LK OPR 5. Grlagen / reg. Umwelt Agentur im Februar
Verb Bildung im Nordwesten Brandenburgs Dr. Stephan Lehmann 21.11.2016 Grlagen / reg. Gliederung 1. Umwelt Agentur 2. Grlagen / regionale 2. 3. 4. im LK OPR 5. Grlagen / reg. Umwelt Agentur im Februar
Lokale Wirtschaft gewinnen: Für nachhaltige Kooperationen und Mitwirkung im Netzwerk der Engagierten Stadt
 Dokumentation zum Workshop Lokale Wirtschaft gewinnen: Für nachhaltige Kooperationen und Mitwirkung im Netzwerk der Engagierten Stadt 5. Dezember 2018, Hamburg Körber Stiftung Workshop mit Rainer Howestädt
Dokumentation zum Workshop Lokale Wirtschaft gewinnen: Für nachhaltige Kooperationen und Mitwirkung im Netzwerk der Engagierten Stadt 5. Dezember 2018, Hamburg Körber Stiftung Workshop mit Rainer Howestädt
Berufswahl-SIEGEL. Ausgezeichnete Berufs- und Studienorientierung an bayerischen Schulen. Berufswahl-SIEGEL Informationsmaterial für Juroren
 Berufswahl-SIEGEL Ausgezeichnete Berufs- und Studienorientierung an bayerischen Schulen 1 Berufswahl-SIEGEL ein zukunftsorientierter Ansatz Herausforderungen Sinkende Schülerzahlen durch den demografischen
Berufswahl-SIEGEL Ausgezeichnete Berufs- und Studienorientierung an bayerischen Schulen 1 Berufswahl-SIEGEL ein zukunftsorientierter Ansatz Herausforderungen Sinkende Schülerzahlen durch den demografischen
NEUES DENKEN DURCH NEUES ERLEBEN
 NEUES DENKEN DURCH NEUES ERLEBEN ACT FOR MANAGEMENT ACTIVE CREATIVE TRAINING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE DAS EXZELLENZPROGRAMM DES KULTURKREISES DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT ACT FOR MANAGEMENT ACTIVE CREATIVE TRAINING
NEUES DENKEN DURCH NEUES ERLEBEN ACT FOR MANAGEMENT ACTIVE CREATIVE TRAINING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE DAS EXZELLENZPROGRAMM DES KULTURKREISES DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT ACT FOR MANAGEMENT ACTIVE CREATIVE TRAINING
Deutscher Bürgerpreis
 Hintergrund Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements Jeder dritte Deutsche über 14 Jahre engagiert sich in seiner Freizeit für andere in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien, Selbsthilfegruppen
Hintergrund Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements Jeder dritte Deutsche über 14 Jahre engagiert sich in seiner Freizeit für andere in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien, Selbsthilfegruppen
Leitbild der Handwerkskammer Berlin
 Am 23. November 2009 durch die Vollversammlung beschlossene Fassung Mit diesem Leitbild formuliert die Handwerkskammer Berlin die Grundsätze für ihre Arbeit, die sowohl der Orientierung nach innen als
Am 23. November 2009 durch die Vollversammlung beschlossene Fassung Mit diesem Leitbild formuliert die Handwerkskammer Berlin die Grundsätze für ihre Arbeit, die sowohl der Orientierung nach innen als
Meine Damen und Herren,
 Starke Bibliotheken! Aspekte einer gemeinsamen Bibliotheksstrategie NRW Grußwort von Frau Ministerin Ute Schäfer zur gemeinsamen Bibliothekskonferenz des MFKJKS und des vbnw 15. Januar 2014 Sehr geehrter
Starke Bibliotheken! Aspekte einer gemeinsamen Bibliotheksstrategie NRW Grußwort von Frau Ministerin Ute Schäfer zur gemeinsamen Bibliothekskonferenz des MFKJKS und des vbnw 15. Januar 2014 Sehr geehrter
Jetzt das Morgen gestalten
 Jetzt das Morgen gestalten Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 3. März 2007 Warum braucht Baden-Württemberg eine Nachhaltigkeitsstrategie? Baden-Württemberg steht vor großen Herausforderungen, die
Jetzt das Morgen gestalten Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 3. März 2007 Warum braucht Baden-Württemberg eine Nachhaltigkeitsstrategie? Baden-Württemberg steht vor großen Herausforderungen, die
Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft
 Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft [Rede in Auszügen] Datum: 14.12.2012 Ort: axica, Berlin
Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft [Rede in Auszügen] Datum: 14.12.2012 Ort: axica, Berlin
Besser gemeinsam. Kooperationen von Unternehmen und Gemeinnützigen für ein zukunftsfähiges Brandenburg. Kein Unternehmen agiert im luftleeren Raum
 Besser gemeinsam Kooperationen von Unternehmen und Gemeinnützigen für ein zukunftsfähiges Brandenburg Kein Unternehmen agiert im luftleeren Raum Sozialer Zusammenhalt Gewalt und Intoleranz Engagement und
Besser gemeinsam Kooperationen von Unternehmen und Gemeinnützigen für ein zukunftsfähiges Brandenburg Kein Unternehmen agiert im luftleeren Raum Sozialer Zusammenhalt Gewalt und Intoleranz Engagement und
CHEMIE 3 die Nachhaltigkeitsinitiative
 CHEMIE 3 die Nachhaltigkeitsinitiative WER WIR SIND WIR SIND DIE NACHHALTIGKEITSINITIATIVE CHEMIE3 Mit der Verabschiedung der Globalen Nachhaltigkeitsziele den Sustainable Development Goals (SDGs) der
CHEMIE 3 die Nachhaltigkeitsinitiative WER WIR SIND WIR SIND DIE NACHHALTIGKEITSINITIATIVE CHEMIE3 Mit der Verabschiedung der Globalen Nachhaltigkeitsziele den Sustainable Development Goals (SDGs) der
CHEMIE 3 die Nachhaltigkeitsinitiative
 CHEMIE 3 die Nachhaltigkeitsinitiative WER WIR SIND WIR SIND DIE NACHHALTIGKEITSINITIATIVE CHEMIE3 Mit der Verabschiedung der Globalen Nachhaltigkeitsziele den Sustainable Development Goals (SDGs) der
CHEMIE 3 die Nachhaltigkeitsinitiative WER WIR SIND WIR SIND DIE NACHHALTIGKEITSINITIATIVE CHEMIE3 Mit der Verabschiedung der Globalen Nachhaltigkeitsziele den Sustainable Development Goals (SDGs) der
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Kreativ arbeiten. {Mit Erfolg!} Kompetenzzentrum Kulturund Kreativwirtschaft des Bundes
 1 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Kreativ arbeiten {Mit Erfolg!} Kompetenzzentrum Kulturund Kreativwirtschaft des Bundes Engagiert für eine bunte Branche Die Kultur- und Kreativwirtschaft
1 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Kreativ arbeiten {Mit Erfolg!} Kompetenzzentrum Kulturund Kreativwirtschaft des Bundes Engagiert für eine bunte Branche Die Kultur- und Kreativwirtschaft
Wer gibt denn hier den Ton an? Für eine neue Form der Kooperation in der Elementaren Musikerziehung
 Musikschulkongress 2015 8.-10. Mai 2015 MusikLeben Erbe.Vielfalt.Zukunft Messe und Congress Centrum Halle Münsterland Wer gibt denn hier den Ton an? Für eine neue Form der Kooperation in der Elementaren
Musikschulkongress 2015 8.-10. Mai 2015 MusikLeben Erbe.Vielfalt.Zukunft Messe und Congress Centrum Halle Münsterland Wer gibt denn hier den Ton an? Für eine neue Form der Kooperation in der Elementaren
Corporate Volunteering Netzwerk Nürnberg: Unternehmen Ehrensache
 Corporate Volunteering Netzwerk Nürnberg: Unternehmen Ehrensache Personalleiterkreis in der Metropolregion Nürnberg, Dr. Uli Glaser universa Versicherungen, 9.10.2014 Definitionen, Präzisierungen, Beispiele
Corporate Volunteering Netzwerk Nürnberg: Unternehmen Ehrensache Personalleiterkreis in der Metropolregion Nürnberg, Dr. Uli Glaser universa Versicherungen, 9.10.2014 Definitionen, Präzisierungen, Beispiele
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Verleihung von Staatsmedaillen in Silber für Verdienste in der Ländlichen Entwicklung 4. Juli 2013,
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Verleihung von Staatsmedaillen in Silber für Verdienste in der Ländlichen Entwicklung 4. Juli 2013,
Allgemeiner Sozialer Dienst Hamburg-Nord. Leitbild
 Allgemeiner Sozialer Dienst Hamburg-Nord Leitbild Präambel Die verfassungsgemäß garantierten Grundrechte verpflichten unsere Gesellschaft, Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation zu unterstützen.
Allgemeiner Sozialer Dienst Hamburg-Nord Leitbild Präambel Die verfassungsgemäß garantierten Grundrechte verpflichten unsere Gesellschaft, Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation zu unterstützen.
Integration CO2FREI.ORG-Siegel in Ihre CSR-KOMMUNIKATION.
 Integration CO2FREI.ORG-Siegel in Ihre CSR-KOMMUNIKATION. CSR-KOMMUNIKATION. Sind Sie bereit? Schön, dass Sie sich für das CO2FREI.ORG-Siegel interessieren Doch nun fragen Sie sich bestimmt, wie sie dieses
Integration CO2FREI.ORG-Siegel in Ihre CSR-KOMMUNIKATION. CSR-KOMMUNIKATION. Sind Sie bereit? Schön, dass Sie sich für das CO2FREI.ORG-Siegel interessieren Doch nun fragen Sie sich bestimmt, wie sie dieses
Sponsorenkonzept. Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2018 (JAZ)
 Sponsorenkonzept Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2018 (JAZ) 1 Stand Juli 2017 Inhaltsverzeichnis 1. Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.v. 3 2. Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 4 2.1 Zielsetzung
Sponsorenkonzept Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2018 (JAZ) 1 Stand Juli 2017 Inhaltsverzeichnis 1. Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.v. 3 2. Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 4 2.1 Zielsetzung
Wir machen die Träume unserer Kunden wahr. Komplette und intelligente Lösungen für komplexe Herausforderungen in ganz Deutschland und Europa.
 Wir machen die Träume unserer Kunden wahr. Komplette und intelligente Lösungen für komplexe Herausforderungen in ganz Deutschland und Europa. Wir, die Rücken & Partner Gruppe, sind eine Unternehmensgruppe
Wir machen die Träume unserer Kunden wahr. Komplette und intelligente Lösungen für komplexe Herausforderungen in ganz Deutschland und Europa. Wir, die Rücken & Partner Gruppe, sind eine Unternehmensgruppe
ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung zu Ihrer 55. Parlamentssitzung gefolgt sind.
 Seite 1 von 9 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung Zweite Bürgermeisterin 55. Sitzung des Hamburger Spendenparlaments 11. November 2013 Es gilt das gesprochene Wort. Sehr
Seite 1 von 9 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung Zweite Bürgermeisterin 55. Sitzung des Hamburger Spendenparlaments 11. November 2013 Es gilt das gesprochene Wort. Sehr
Cargo Climate Care unser Beitrag zum Umweltschutz.
 Cargo Climate Care unser Beitrag zum Umweltschutz. Umweltschutz ist für Lufthansa Cargo schon lange selbstverständlich. Die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, sehen wir als unsere
Cargo Climate Care unser Beitrag zum Umweltschutz. Umweltschutz ist für Lufthansa Cargo schon lange selbstverständlich. Die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, sehen wir als unsere
Dialog-Werkstatt 1 Mo, Offcut Zürich
 Dialog-Werkstatt 1 Mo, 19.11.2018 Offcut Zürich Ziele der Dialog-Werkstatt 1 à Informiert sein über den strategischen u. operativen Stand von Lapurla. à Sich vernetzen, gegenseitige Einladungen für Praxisbesuche
Dialog-Werkstatt 1 Mo, 19.11.2018 Offcut Zürich Ziele der Dialog-Werkstatt 1 à Informiert sein über den strategischen u. operativen Stand von Lapurla. à Sich vernetzen, gegenseitige Einladungen für Praxisbesuche
Akademietag der Akademie der Wissenschaften in Hamburg , 11:00 Uhr, NewLivingHome
 Seite 1 von 9 Fre ie u nd Hansestadt Hamburg B e h ö r d e f ü r W i s s e n s c h a f t u n d F o r s c h u n g DIE SENATORIN Akademietag der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 29. 11. 2014, 11:00
Seite 1 von 9 Fre ie u nd Hansestadt Hamburg B e h ö r d e f ü r W i s s e n s c h a f t u n d F o r s c h u n g DIE SENATORIN Akademietag der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 29. 11. 2014, 11:00
KINDER- JUGEND- UND BETEILIGUNG.
 KINDER- UND JUGEND- BETEILIGUNG www.jugendbeteiligung.at Was bedeutet Kinder- und Jugendbeteiligung? Was bewirkt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen? Eine funktionierende Demokratie braucht Beteiligung
KINDER- UND JUGEND- BETEILIGUNG www.jugendbeteiligung.at Was bedeutet Kinder- und Jugendbeteiligung? Was bewirkt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen? Eine funktionierende Demokratie braucht Beteiligung
Theater Marie Postfach 4105 CH Aarau T / F
 Theater Marie Postfach 4105 CH - 5001 Aarau T 062 843 05 25 / F 062 843 05 26 info@theatermarie.ch http://www.theatermarie.ch Leitbild Januar 2012 1 Von der Vision zu Leitbild und Strategie Vision "Theater
Theater Marie Postfach 4105 CH - 5001 Aarau T 062 843 05 25 / F 062 843 05 26 info@theatermarie.ch http://www.theatermarie.ch Leitbild Januar 2012 1 Von der Vision zu Leitbild und Strategie Vision "Theater
F r e i e u n d H a n s e s t a d t H a m b u r g B e h ö r d e f ü r S c h u l e u n d B e r u f s b i l d u n g
 F r e i e u n d H a n s e s t a d t H a m b u r g B e h ö r d e f ü r S c h u l e u n d B e r u f s b i l d u n g Behörde für Schule und Berufsbildung Postfach 76 10 48, D - 22060 Hamburg Amt für Weiterbildung
F r e i e u n d H a n s e s t a d t H a m b u r g B e h ö r d e f ü r S c h u l e u n d B e r u f s b i l d u n g Behörde für Schule und Berufsbildung Postfach 76 10 48, D - 22060 Hamburg Amt für Weiterbildung
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor. L e i t b i l d. Landesbetrieb Hessisches Landeslabor. Verbraucherschutz unser Auftrag
 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor L e i t b i l d Landesbetrieb Hessisches Landeslabor Verbraucherschutz unser Auftrag 1. V o r w o r t Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) wurde 2005 aus
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor L e i t b i l d Landesbetrieb Hessisches Landeslabor Verbraucherschutz unser Auftrag 1. V o r w o r t Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) wurde 2005 aus
Zentrum fir politesch Bildung
 Zentrum fir politesch Bildung Leitbild Validé par le Conseil d administration Walferdange, le 16 janvier 2018 ZpB Leitbild 1 Leitbild des Zentrums fir politesch Bildung Einleitung Das Leitbild formuliert
Zentrum fir politesch Bildung Leitbild Validé par le Conseil d administration Walferdange, le 16 janvier 2018 ZpB Leitbild 1 Leitbild des Zentrums fir politesch Bildung Einleitung Das Leitbild formuliert
KULTURVERMITTLUNG Eine Studie zur Bedeutung und zum Umfang kulturvermittelnder Initiativen in Vorarlberg
 KULTURVERMITTLUNG Eine Studie zur Bedeutung und zum Umfang kulturvermittelnder Initiativen in Vorarlberg Prof. (FH) Priv.Doz. Dr. Frederic Fredersdorf Daniela Lorünser, MA Hochschulstr.1 / 6850 Dornbirn
KULTURVERMITTLUNG Eine Studie zur Bedeutung und zum Umfang kulturvermittelnder Initiativen in Vorarlberg Prof. (FH) Priv.Doz. Dr. Frederic Fredersdorf Daniela Lorünser, MA Hochschulstr.1 / 6850 Dornbirn
Herzlich willkommen! Vortrag: CSR versus Spenden
 Herzlich willkommen! Vortrag: CSR versus Spenden Grundsätzlich gilt Organisationen und gemeinnützige Einrichtungen werden traditionell von Unternehmen unterstützt. Rund 64 % der Unternehmen in Deutschland
Herzlich willkommen! Vortrag: CSR versus Spenden Grundsätzlich gilt Organisationen und gemeinnützige Einrichtungen werden traditionell von Unternehmen unterstützt. Rund 64 % der Unternehmen in Deutschland
Was sind Ziele und Aufgaben der lokalen Arbeitsgruppe?
 Was sind Ziele und Aufgaben der lokalen Arbeitsgruppe? Die lokale Arbeitsgruppe dient als eine Austausch- und Kommunikationsplattform für erwachsene Unterstützer, die ein Interesse an den Belangen von
Was sind Ziele und Aufgaben der lokalen Arbeitsgruppe? Die lokale Arbeitsgruppe dient als eine Austausch- und Kommunikationsplattform für erwachsene Unterstützer, die ein Interesse an den Belangen von
SMA Leitbild Nachhaltigkeit
 SMA Leitbild Nachhaltigkeit Ulrich Hadding Vorstand Finanzen, Personal und Recht Liebe Leserinnen und Leser, Seit ihrer Gründung ist bei SMA Nachhaltigkeit als elementare Säule des Unternehmensleitbilds
SMA Leitbild Nachhaltigkeit Ulrich Hadding Vorstand Finanzen, Personal und Recht Liebe Leserinnen und Leser, Seit ihrer Gründung ist bei SMA Nachhaltigkeit als elementare Säule des Unternehmensleitbilds
Unternehmenskooperationen Worum geht es und wie können sie gelingen?
 Unternehmenskooperationen Worum geht es und wie können sie gelingen? Doris Voll Göttingen, den 29. und 30.05.2017 Unternehmenskooperationen... Corporate Social Responsibility... Corporate Volunteering...
Unternehmenskooperationen Worum geht es und wie können sie gelingen? Doris Voll Göttingen, den 29. und 30.05.2017 Unternehmenskooperationen... Corporate Social Responsibility... Corporate Volunteering...
SMA Leitbild Nachhaltigkeit
 SMA Leitbild Nachhaltigkeit Das SMA Leitbild Nachhaltigkeit Sustainable Development (nachhaltige Entwicklung) bezeichnet einen Entwicklungspfad, der sich dadurch auszeichnet, dass Ressourcen genutzt werden,
SMA Leitbild Nachhaltigkeit Das SMA Leitbild Nachhaltigkeit Sustainable Development (nachhaltige Entwicklung) bezeichnet einen Entwicklungspfad, der sich dadurch auszeichnet, dass Ressourcen genutzt werden,
