Handbuch Datenmanagement
|
|
|
- Ursula Koenig
- vor 4 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hein/Scheve (Hrsg.) Handbuch Datenmanagement Qualität, Verarbeitung und Prüfung von (Risiko-)Daten in Banken & Sparkassen Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
2 Zitiervorschlag: Autor in: Hein/Scheve (Hrsg.), Handbuch Datenmanagement, RdNr. XX. ISBN: Finanz Colloquium Heidelberg GmbH Im Bosseldorn 30, Heidelberg Satz: MetaLexis, Niedernhausen Druck: Strauss GmbH, Mörlenbach
3 Hein/Scheve (Hrsg.) Handbuch Datenmanagement Qualität, Verarbeitung und Prüfung von (Risiko-)Daten in Banken & Sparkassen Dr. Karsten Foos Leiter Anwendungsentwicklung, Corporate Center Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Andreas Freßmann Stabstellenleiter Volksbank Beckum-Lippstadt eg Markus Frommlet Fachberater DQM emagixx GmbH Hamburg Heiko Hackbarth Senior-Referent Data Governance Office Berliner Sparkasse Berlin Dr. Manfred Hein (Hrsg.) Leiter Projekte emagixx GmbH Hamburg
4 Carmen Heinemann Projektmanagerin und Coach ECM Agilität IT-Compliance Digitalisierung Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Sandra Holz Chief Data Officer Leitung Data Governance Office Berliner Sparkasse Hooshang Jafarpour Spezialist Modellrisiko & Validierung Postbank eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG Bonn Peter Kaminski Specialist Cyber Security (CISSP, CEH, CISA, CRISC) Abteilung Cyber Security Santander Consumer Bank AG Jürgen Krug IT-Revisor, stellv. Abteilungsleiter Zentralrevision Frankfurter Sparkasse Frankfurt/M. Dr. Stefan Scheve (Hrsg.) Sachgebietsleiter Sparkassen Hauptverwaltung Hannover Deutsche Bundesbank Hannover Dr. Joachim Selke Leiter BICC & Risiko-Datenstrategie Volkswagen Bank GmbH Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
5 INHALTSÜBERSICHT Inhaltsübersicht Abkürzungsverzeichnis 1 A. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Bank-Daten 7 B. Data Governance und Datenmanagementstrategien 29 C. Datenmanagement 41 D. Datenqualitätsmanagement 97 E. Erfahrungsberichte und Praxisbeispiele V
6
7 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 1 Vorwort 5 A. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Bank-Daten 7 I. Zunehmende Bedeutung von Datenqualität und IT-Risiken 9 II. III. Vorgaben aus Basel zu Risk Data Aggregation und Risk Reporting (BCBS 239) Neue bzw. angepasste MaRisk-Vorgaben durch die fünfte Novelle der MaRisk mit Bezug zu BCBS Grundsätze für das Datenmanagement, die Datenqualität und die Aggregation von Risikodaten mit Gültigkeit für große Institute 2. Angepasste MaRisk-Vorgaben zu Datenqualität und IDV mit Gültigkeit für alle Institute 3. Vor und mit der fünften MaRisk-Novelle gültige Vorgaben zum Datenmanagement für alle Institute IV. Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) IT-Strategie IT-Governance Informationsrisikomanagement Informationssicherheitsmanagement V. 5. Benutzerberechtigungsmanagement IT-Projekte, Anwendungsentwicklung (inklusive durch Endbenutzer in den Fachbereichen) IT-Betrieb (inklusive Datensicherung) Auslagerung und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen 21 EBA-Durchführungsstandards und EZB-Vorgaben für die Anzeigenverfahren bzw. das Meldewesen 21 VII
8 INHALTSVERZEICHNIS VI. Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis Zunehmende qualitative/quantitative Meldeanforderungen 24 Häufige Defizite bei der Verwendung interner und externer Daten 24 Häufige Defizite bei Kernanforderungen an die IT und die verwendete EDV 25 Feststellungen im Rahmen von MaRisk-Prüfungen der Aufsicht zu IT & Datenqualität 25 a) Feststellungen zu Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Vertraulichkeit 25 b) Feststellung zur Schutzbedarfsanalyse 26 c) Feststellung zur Vertraulichkeit von Daten 26 VII. Datenqualität zunehmend im Fokus der Aufsicht VIII. Literatur- bzw. Quellenverzeichnis B. Data Governance und Datenmanagementstrategien 29 I. Data Governance (Selke) 31 II. Datenmanagement-Strategie (Krug) Verstehen des Geschäftsmodells Analyse der unterschiedlich strukturierten Datenbestände Überprüfung und Anpassung der IT-Strategie Harmonisierung Bestimmung der von den Geschäftsfunktionen benötigten Daten 40 C. Datenmanagement 41 I. Überblick über das Datenmanagement (Selke) Individuelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen im Institut 2. Zentrale Fragestellungen Klares Zielbild VIII Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
9 INHALTSVERZEICHNIS II. Zusammenhang von Datenmanagement und Prozessen (Selke) Datenbeschreibung Schlussbemerkung zum allgemeinen Datenmanagement 62 III. Datenmanagement im Kreditrisikomanagement (Jafarpour) Verwendung geeigneter Daten Datenhistorien Daten aus externen Quellen Einbeziehung der Daten-Risiken in die Risikosteuerungsund -Controllingsprozesse 5. Fazit und Ausblick 81 IV. Datenmanagement im Meldewesen (Freßmann) Sicherstellung eines aussagekräftigen Meldewesens: qualitativ hochwertige Melde-Daten in neuen Formaten 83 Verzahnung von Meldewesen und Funktionsbereichen mit (risiko-)relevanten Daten 84 Erweiterte Anforderungen für die Meldung von unterjährigen Plan-, Ertrags- und Risikodaten 84 Beurteilung des Datenmanagements und der Kontrollmaßnahmen im IKS hinsichtlich gemeldeter (Risiko-)Daten 85 Umsetzung neuer meldepflichtiger Finanzinformationen und Solvabilitäts-/Kapitaladäquanzmeldungen 88 a) Liquiditätskennziffern 88 b) Verschuldungsgrad 89 c) Einlagensicherung 90 Sicherstellung der Datenverfügbarkeit und Konsistenz der nach AnaCredit zu meldenden Daten 91 a) Effizientere Prozesse 92 b) Höherer Integrationsgrad 92 c) Besseres Datenqualitätsmanagement Praxisbericht: (Daten)Fallstricke in der Meldewesenpraxis Praxistipps zur (sinnvollen) Datenbereinigung von Meldewesen-Daten IX
10 INHALTSVERZEICHNIS D. Datenqualitätsmanagement 97 I. Datenqualität (Selke) 99 II. Prüfung Datenqualität (Krug) 104 III. 1. Prüfung der Qualität von (Risiko-)Daten zur Sicherstellung einer wirksamen Risikosteuerung 104 a) Prüfungsplanung 105 b) Prüfungsdurchführung Projektbegleitung durch die Interne Revision 111 Datenqualitätsmanagement für operative Daten (Frommlet/Hein) Einleitung und Überblick Ursachen für schlechte operative Daten 118 a) Probleme bei der Dateneingabe 119 b) Zeitliche Einflüsse 120 c) Systemänderungen 121 d) Unzureichende Datenpflege Datenqualitätsmanagement für operative Daten a) Definitionsprozess 124 b) Bereinigungsprozess 126 Datenqualitätsmanagementsystem Anforderungen an die Technik Kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität Zusammenfassung und Fazit 132 E. Erfahrungsberichte und Praxisbeispiele 135 I. Aufbau eines Data Governance Offices und Implementierung einer unabhängigen Validierungseinheit (Hackbarth/Holz) Umfeld/Ausgangslage Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen Definition Data Governance Organisation der Data Governance 140 X Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
11 INHALTSVERZEICHNIS II. III. a) Data Governance Strategie 140 b) Ziele 141 c) Organisatorische Zuordnung 141 d) Rollen mit Verantwortlichkeiten und Aufgaben Etablierung Wesentliche erste Schritte 152 Integrierter Datenhaushalt in einer internationalen Spezialbank und wesentliche Aspekte und Prinzipien von BCBS 239 (Selke) Wesentliche Aspekte und Prinzipien von BCBS Praxisbeispiel: Integrierter Datenhaushalt in einer internationalen Spezialbank Herausforderungen bei Veränderung der IT-Prozesse und IT-Systemlandschaft (Foos/Heinemann) Zusammenfassung der Anforderungen 165 a) Wesentliche Anforderungen aus der BCBS b) Korrelation mit dem Datenschutz Ableiten wesentlicher IT-Handlungsfelder 187 a) Konzernsicht 188 b) Taxonomie 189 c) Datenqualitätsmanagement 192 d) Datenaktualität 193 e) Adaptability Lösungsansätze zur Umsetzung der Anforderungen 196 a) Datenbereitstellung und -haushalte 199 b) Business Intelligence 203 c) Entwickeln und Aufrechterhalten der Data Governance Fazit 210 IV. Sicherheit beim Cloud Computing (Kaminski) Cloud Computing Risiken 212 a) Rechtliche Risiken und Datenschutz 212 b) Gemeinsame Nutzung von Cloud Ressourcen 213 c) Insider XI
12 INHALTSVERZEICHNIS d) Cyber Attacken 213 e) Standardisierung 213 f) Datensicherung 214 g) Verfügbarkeit und Leistung Maßnahmen 214 a) Speicherung 214 b) Datenübertragung 215 c) Zugang 215 d) Backup 215 e) Archivierung 215 f) Datenlöschung 216 g) Cyberraum Festlegen von Maßnahmen Zusammenfassung Weitere Literatur 217 XII Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
13 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS Abkürzungsverzeichnis ACL ADV ALMM AT BA BAIT BCBS BCM BCR BDSG BGBI BI BIZ BSI BT BTO CDO CIO COREP CPV CRR CSA CSV CVAR DAMA delvo DF DGO DQ DQM DSAnpUG DSGVO Access Control List Allgemeine Datenverarbeitung Additional Liquidity Monitoring Metrics Allgemeiner Teil Bankenaufsicht Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT Basel Committee on Banking Supervision Business Continuity Management Binding Corporate Rules Bundesdatenschutzgesetz Bundesgesetzblatt Business Intelligence Bank für Internationale Zusammenarbeit Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Besonderer Teil Besonderer Teil (Organisation) Chief Data Officer Chief Information Officer Common Solvency Ratio Reporting Credit Portfolio View Capital Requirements Regulation Cloud Security Alliance Comma Separated Values Credit Value at Risk Data Management Association International delegierte Verordnung Datenfeld Data Governance Office Datenqualität Datenqualitätsmanagement Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz Datenschutzgrundverordnung 1
14 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS D-SIB DV DWH EBA EC EDV EL EZB FinaRisikoV FinaV FINREP GL GL GoBD G-SIB HQ ID IDV IFRS IKS ILM IQ IQM ISACA ISM ISO IST KI KPI KWG Domestic Systemically Important Banks Datenverarbeitung Data Warehouse European Banking Authority Economic Capital Elektronische Datenverarbeitung Expected Loss Europäische Zentralbank Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung Finanzinformationsverordnung Financial Reporting Guideline Geschäftsleitung Grundsätze ordnungsgemäßer Führung und Aufbewahrung von Büchern auch in elektronischer Form und zum Datenzugriff Global Systemically Important Banks Headquarter Identifikator Individuelle Datenverarbeitung International Financial Reporting Standards Internes Kontrollsystem Information Lifecycle Management Informationsqualität Informationsqualitätsmanagements Information Systems Audit and Control Association Informationssicherheitsmanagement International Organization for Standardization Implementing Technical Standard Künstliche Intelligenz Key Performance Indicators Kreditwesengesetz 2 Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
15 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS LCR LDAP LGD LiqV LSI MaRisk NACE NIST NP NSFR OpVAR PbD PD PKI PrüfbV RACF RPO RTF RTO SLA SQL SREP SSM TXT Tz ZVAdr Liquidity Coverage Ratio Lightweight Directory Access Protocol Loss Given Default Liquiditätsverordnung Less Significant Institutions Mindestanforderungen an das Risikomanagement Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft National Institute of Standards and Technology Natürliche Person Net Stable Funding Ratio Operational Value at Risk Privacy by Default Probability of Default Public Key Infrastructure Prüfungsberichtsverordnung Resource Access Control Facility Recovery Point Objective Risikotragfähigkeit Recovery Time Objective Service Level Agreement Structured Query Language Supervisory Review an Evaluation Process Single Supervisory Mechanism Text Textziffer Zentrale Vorverarbeitung Adressenrisiko 3
16
17 HEIN/SCHEVE Vorwort Daten und deren Nutzung liegen nicht zuletzt aufgrund des Schlagworts Digitalisierung mehr und mehr im Fokus der Aufmerksamkeit. Digital vorliegende Daten bzw. Informationen bilden verstärkt die Grundlage für unsere (geschäftlichen) Entscheidungen. Dieses gilt insbesondere für die Risiken, die jedes Unternehmen für sich einschätzt und bewertet. Ein professioneller Umgang mit Daten in Banken und Sparkassen wird zunehmend wichtiger insbesondere in den Bereichen Risikocontrolling und -reporting, Meldewesen und Revision. Der verstärkte Fokus der Aufsicht richtet sich auf Datenqualität und IT-Risiken. Dies zeigen nicht nur die Vorgaben, die unter dem Stichwort BCBS 239 bekannt geworden sind, und die seit 2017 geltenden BAIT. Das vorliegende Buch widmet sich diesen Risikodaten im Hinblick auf Qualität, Verarbeitung und Prüfung. Es richtet sich an Neueinsteiger sowie an erfahrene Spezialisten aus den Bereichen Risikomanagement/Risikocontrolling, Compliance, Revision, Organisation, Kredit und IT. Empfehlenswert ist dieses Handbuch auch für das Management von Banken und Sparkassen. Viele Beiträge lassen mit ihren konkreten Beispielen die Wichtigkeit begreifbar werden und zeigen auf, welche Fallstricke die Umsetzung einer Informations- bzw. Datenmanagementstrategie mühsam und aufwendig gestalten können. Das vorliegende Werk bietet umfangreiches Wissen, Empfehlungen und Erfahrungen auf vielen Ebenen zum Umgang mit Daten im Allgemeinen und zum Umgang mit Risikodaten innerhalb von Kreditinstituten im Speziellen. Dabei werden Themen wie regulatorische Vorgaben gängige Prüfungspraxis Data Governance Datenmanagement Datenqualitätsmanagement beleuchtet. Das Buch beginnt mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen ergänzt um Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis und steigt dann in das Thema Data Governance und Datenmanagementstrategie ein. Mit dem nachfolgenden Thema Datenmanagement werden die Herausforderungen bei der Verarbeitung von Daten betrachtet. Hierbei erfahren die Bereiche Meldewesen und 5
18 VORWORT Risikomanagement eine besondere Aufmerksamkeit. Die Qualität der Daten steht nachfolgend im Mittelpunkt. Direkt im Anschluss befinden sich die Beiträge mit Erfahrungs- und Praxisberichten sowie Beiträge zu Spezialthemen. Diese Beiträge sind in ihrer Reihenfolge von den Anforderungen über die Strategie, Management, Datenqualität bis hin zur IT angeordnet. Dieses Buch kann traditionell von vorne nach hinten gelesen werden. Der Leser erhält so einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen Themenbereiche. Zusätzlich kann es genutzt werden, um zu einem der behandelten Themen schnell einen praxisrelevanten Überblick zu erhalten. Die Gliederung des Buches ermöglicht dazu einen schnellen Einstieg in das gewünschte Thema. Abschließend möchten wir uns bei allen Autoren, die mit ihrem Engagement, ihrer Geduld und ihrer Bereitschaft, ihr Wissen und Erfahrungen mit anderen zu teilen, dieses Handbuch ermöglicht haben, ganz herzlich bedanken. Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Freude an den beim Lesen gewonnenen Gedanken. Die Herausgeber Juli Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
19 A. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Bank-Daten
20
21 SCHEVE A. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Bank-Daten 1 I. Zunehmende Bedeutung von Datenqualität und IT-Risiken Sowohl Daten, die der Deutschen Bundesbank im Rahmen des Meldewesens aufgegeben werden, als auch Daten bzw. Datenbanken, die im internen Berichtswesen eines Kreditinstituts verwendet werden, sollten zuverlässig und frei von Fehlern sein. Leider ist dies nicht immer der Fall. Zahlen und Daten sind ggf. auf Grund von persönlichen Fehlern nicht korrekt erfasst worden. Diese Betrachtung ist aber nur eine Seite der Medaille. Eine schlechte bzw. geringe Datenqualität ist neben Falscherfassungen regelmäßig auf Probleme bei falschen Schnittstellen, fehlerhaften Programmadditionen oder fehlgeleiteten Daten zurückzuführen. Systematische Fehler sind grundsätzlich bedeutender als individuelle Einzelmängel, da sie wiederholt und ggf. regelmäßig auftreten. Unzulänglichkeiten in der Datenverfügbarkeit und -sicherheit sind in den letzten Jahren in den Fokus der Aufsicht gerückt. Auch öffentlich gewordene Defizite teilweise von Presse und Fernsehen ausführlich dargestellt haben hierzu beigetragen. Die Abhängigkeit von EDV- bzw. IDV-Anwendungen hat stetig zugenommen. Somit sind Daten- bzw. IT-Risiken in den letzten Jahren weltweit stärker in den bankenaufsichtlichen Fokus gerückt. Unter dem Stichwort BCBS 239 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Banking Committee on Banking Supervision) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ, Bank for International Settlement) schon im Jahr 2013 wegweisende Vorgaben gesetzt. 2 Im Jahre 2017 wurden wesentliche BCBS 239- Vorgaben durch die fünfte MaRisk-Novelle als zwingende Vorgaben für deutsche Sparkassen und Banken eingeführt. Weitere Vorgaben setzen die 2017 eingeführten»bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT)« Die nachfolgenden Interpretationen und Meinungen sind ausschließlich persönliche Auffassungen des Verfassers und stellen keine offizielle Meinungsäußerung der Deutschen Bundesbank dar. 2 Mittlerweile hat der Basler Ausschuss eine deutsche Übersetzung der Principles/Grundsätze des BCBS 239 veröffentlicht. Diese ist auf der BIZ-website verfügbar: Vgl. Bank für Internationalen Zahlungsausgleich: Basler Ausschuss für Bankenaufsicht: Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung, Januar
22 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN BANK-DATEN II. Vorgaben aus Basel zu Risk Data Aggregation und Risk Reporting (BCBS 239) 3 4 Am hat die BIZ mit dem Standard BCBS 239 Principles für Risikodatenaggregation und das entsprechende Berichtswesen veröffentlicht. Diese Principles/Vorgaben sind zwar im Adressantenkreis an große Institute (G-SIBs und D-SIBs) gerichtet, wirken sich aber indirekt auch auf alle Sparkassen und Banken in Deutschland aus. Die BIZ hat 14 Prinzipien benannt, von denen 11 an die Kreditinstitute und die letzten 3 an die Bankenaufsicht gerichtet sind. In 4 Bereiche können die Prinzipien eingeteilt werden. Abbildung 1: Prinzipien zu Data Aggregation & Risk Reporting laut BCBS 239 (Quelle: BIZ, Basler Ausschuss für Bankenaufischt) 5 6 Unter dem Prinzip 1 (Governance) wird die Zuständigkeit des Topmanagements für die Vorgabe von klaren und konsistenten Regelungen für die Aggregation von Risikodaten und Risikoberichten betont. Die Verankerung in der IT-Strategie gehört ebenfalls hierzu. Die Datenarchitektur und die IT-Infrastruktur müssen nach Prinzip 2 die Aggregation von Risikodaten und das Risikoreporting sowohl in normalen Zeiten als auch in Krisenzeiten gewährleisten. 10 Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
23 SCHEVE Genauigkeit und Integrität werden mit Prinzip 3 angesprochen. Bei der Individuellen Datenverarbeitung (IDV) und bei manuellen Prozessen, die grundsätzlich zu reduzieren sind, müssen Kontrollen durchgeführt werden. Aggregationsprozesse sind grundsätzlich zu automatisieren. Somit ist eine passende Balance zwischen automatisierten und manuellen Prozessen zu finden. Genauigkeit und Integrität der Daten sind zu messen und zu überwachen. Abweichungstoleranzen sind festzulegen. Gemäß Prinzip 4 müssen Daten vollständig sein. Es ist zwischen wesentlichen und unwesentlichen Risikodaten zu unterscheiden. Prinzip 5 gibt vor, dass Daten aktuell sein müssen. Die Systeme müssen insbesondere in Stress- bzw. Krisenzeiten die Aktualität der Daten sicherstellen. Die Anpassbarkeit der Daten wird mit Prinzip 6 gefordert. Die Datenhaltung muss so anpassungsfähig sein, dass auch ad-hoc-anfragen schnell und flexibel erledigt werden können. Für die Risikoberichterstattung gibt Prinzip 7 vor, dass die Risikoberichte genau sein müssen. Die Qualität der Berichte hat nicht schlechter zu sein, als diejenige im Rechnungswesen. Prinzip 8 spricht den Umfang der Riskoberichterstattung an. Risikoberichte sollen umfassend sein. Sie haben alle wesentlichen Inhalte abzubilden. Handlungsempfehlungen sollen aufgezeigt werden. Über den Stand der Umsetzung beschlossener Maßnahmen ist zu berichten. Prinzip 9 fordert die Verständlichkeit. Die Inhalte der Risikoberichte müssen verständlich und klar formuliert sein. Eine schnelle Verfügbarkeit von Daten auch in Krisenzeiten wird durch Prinzip 10 mit Vorgaben zur Frequenz gefordert. Die Häufigkeit der Berichtserstellung ist zu definieren. Die Verteilung der Berichte hat zeitnah, vertraulich und adressatengerecht zu erfolgen. Somit werden mit Prinzip 11 Vorgaben zum Empfängerkreis gesetzt. Die Prinzipien 12 bis 14 richten sich an die Aufsicht. Die Aufsichtsbehörden haben die Einhaltung der zuvor genannten Prinzipien regelmäßig zu überwachen und zu bewerten; auch unter Beachtung von Stressszenarien. Defizite sind durch aufsichtliche Maßnahmen zügig zu beseitigen. Die Aufsichtsbehörden sollten zudem grenzüberschreitend kooperieren
24 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN BANK-DATEN 17 Die am veröffentlichte fünfte MaRisk-Novelle überträgt die Prinzipien der BCBS 239 proportional in deutsche Vorgaben. Somit werden die Erwartungen der deutschen Aufsicht an Sparkassen und Banken in Deutschland für die Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung konkretisiert. III. Neue bzw. angepasste MaRisk-Vorgaben durch die fünfte Novelle der MaRisk mit Bezug zu BCBS Grundsätze für das Datenmanagement, die Datenqualität und die Aggregation von Risikodaten mit Gültigkeit für große Institute Mit der fünften MaRisk-Novelle 3 ist das neue Modul AT 4.3.4»Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten«in die MaRisk aufgenommen worden. Dieses Modul gilt für systemrelevante Institute auf Gruppenebene als auch auf der Ebenen der wesentlichen gruppenangehörigen Einzelinstitute. Der AT enthält in 7 Textziffern (Tzn) umfassende Vorgaben. So sind instituts- und gruppenweit geltende Grundsätze festzulegen, die von der Geschäftsleitung zu genehmigen und in Kraft zu setzen sind (Tz 1). Datenstruktur und -hierarchie müssen eine zweifelsfreie Identifikation, Zusammenführung, Auswertung und zeitnahe Zurverfügungstellung gewährleisten (Tz 2). Die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten müssen gewährleistet werden. Die Daten müssen nach unterschiedlichen Kategorien auswertbar und automatisiert aggregierbar sein. Manuelle Prozesse und Eingriffe müssen begründet, dokumentiert und auf das inhaltliche Maß beschränkt werden. Die Qualität und Vollständigkeit der Daten muss anhand geeigneter Kriterien überwacht werden (Tz 3). Die Risikodaten müssen mit anderen Informationen (z. B. Daten aus dem Rechnungswesen und ggf. dem Meldewesen) unter Einsatz von Verfahren zur Identifizierung von Datenfehlern und Schwachstellen abgeglichen und plausibilisiert werden (Tz 4). Die Kapazitäten zur Datenaggregation müssen gewährleisten, dass aggregierte Daten sowohl unter normalen Umständen als auch in Stressphasen zeitnah zur Verfügung stehen. Ein zeitlicher Rahmen, innerhalb dessen die Daten 3 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Rundschreiben 09/2017 (BA) vom Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
25 SCHEVE vorliegen müssen, ist zu definieren. In Stressphasen müssen z. B. folgende Risikodaten vorliegen: Kreditrisiko auf Gesamtbankebene, aggregiertes Exposure gegenüber großen Schuldnern, Handelspositionen und limite, Kontrahenten- und Marktpreisrisiken, Indikatoren für Liquiditäts- und operationelle Risiken (Tz 5). Zudem müssen die Datenaggregationskapazitäten ausreichend leistungsfähig und flexibel sein, um ad-hoc-informationen nach unterschiedlichen Kriterien ausweisen und analysieren zu können (Tz 6). Für alle Prozessschritte sind Verantwortlichkeiten festzulegen und prozessabhängige Kontrollen einzurichten. Die Einhaltung der institutsinternen Regelungen, Verfahren, Methoden und Prozesse muss regelmäßig überprüft werden. Diese Überprüfung hat von einer von den operativen Einheiten unabhängigen Stelle (mit hinreichenden Kenntnissen) zu erfolgen (Tz 7) Angepasste MaRisk-Vorgaben zu Datenqualität und IDV mit Gültigkeit für alle Institute Der neue BT 3 gilt für alle Institute und Institutsgruppen; unter Berücksichtigung des allgemeinen Proportionalitätsgrundsatzes. Innerhalb dieses neu gestalteten MaRisk-Abschnitts»Anforderungen an die Risikoberichterstattung«werden die Anforderungen an die Erstellung der Berichte gebündelt dargestellt und um relevante Anforderungen aus der Vorgabe BCBS 239 erweitert. Auf vollständigen, genauen und aktuellen Daten müssen die Berichte beruhen. Die Daten müssen flexibel für die Erfordernisse des Risikomanagements aufbereitet und angepasst werden. Für die Anforderungen an die Berichterstattung der Internen Revision gibt es spezielle Vorgaben. Die für die Interne Revision relevanten Berichtspflichten sind weiterhin im BT 2.4 geregelt. Der AT 7.2»Technisch-organisatorische Ausstattung«wurde mit der fünften MaRisk-Novelle erweitert. Zu den bisherigen und weiterhin gültigen Tzn 1, 2 und 3 kommen die geänderte Tz 4 und Tz 5 neu hinzu. Laut Tz 5 sind die Anforderungen, die im AT 7.2 genannt werden, nunmehr auch beim Einsatz von durch die Fachbereiche selbst entwickelten Anwendungen (IDV) entsprechend zu beachten. Die Festlegung von Maßnahmen
26 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN BANK-DATEN 30 zur Sicherstellung der Datensicherheit hat sich am Schutzbedarf der jeweiligen Daten zu orientieren. Tz 4 fordert, dass für IT-Risiken angemessene Überwachungs- und Steuerungsprozesse einzurichten sind. Diese Prozesse haben insbesondere die Festlegung von IT-Risikokriterien, die Identifikation von IT-Risiken, die Festlegung des Schutzbedarfs, daraus abgeleitete Schutzmaßnahmen für den IT- Betrieb sowie die Festlegung entsprechender Maßnahmen zur Risikobehandlung und minderung zu umfassen. Beim Bezug von Software sind die damit verbundenen Risiken angemessen zu bewerten. 3. Vor und mit der fünften MaRisk-Novelle gültige Vorgaben zum Datenmanagement für alle Institute Unverändert haben sich nach Tz 1 des AT 7.2 Umfang und Qualität der technisch-organisatorischen Ausstattung an den betriebsinternen Erfordernissen, den Geschäftsaktivitäten und der Risikosituation zu orientieren. Tz 2, AT 7.2 schreibt vor, dass die IT-Systeme (Hardware- und Software- Komponenten) und die zugehörigen IT-Prozesse die Integrität, die Verfügbarkeit, die Authentizität und die Vertraulichkeit der Daten sicherstellen müssen. Hier werden die vier Schutzziele angesprochen. Unter Integrität ist die Sicherstellung der Unversehrtheit der Daten zu verstehen. Verfügbarkeit der Daten liegt vor, wenn diese von den Anwendern stets wie vorgesehen genutzt werden können. Authentizität heißt, dass ein Kommunikationspartner wirklich derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Vertraulichkeit bedeutet Schutz vor unbefugter Preisgabe der Daten. Gemäß Tz 2 ist weiterhin bei der Ausgestaltung der IT-Systeme und der zugehörigen IT-Prozesse grundsätzlich auf gängige Standards abzustellen. Es sind insbesondere Prozesse für eine angemessene Ist-Berechtigungsvergabe einzurichten, die sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter nur über die Rechte verfügt, die er für seine Tätigkeit benötigt. Die Eignung der IT-Systeme und der zugehörigen Prozesse ist regelmäßig von den fachlich und technisch zuständigen Mitarbeitern zu überprüfen. Tz 3 gibt vor, dass IT-Systeme vor ihrem erstmaligen Einsatz und nach wesentlichen Veränderungen zu testen und von den fachlich sowie auch von den technisch zuständigen Mitarbeitern abzunehmen sind. Hierfür ist ein Regelprozess der Entwicklung, des Testens, der Freigabe und der Implementierung 14 Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
27 SCHEVE in die Produktionsprozesse zu etablieren. Produktions- und Testumgebung sind grundsätzlich voneinander zu trennen. IV. Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) Am hat die BaFin die BAIT (=Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT) als Rundschreiben 10/2017 (BA) veröffentlicht. 4 Wie ist das Zusammenspiel MaRisk zu BAIT zu sehen? Natürlich bleiben die in den MaRisk enthaltenen Anforderungen unberührt. Sie werden wie die BaFin betont durch die BAIT IT-spezifisch konkretisiert. Somit verweisen die Leitsätze der BAIT auf die jeweiligen Textziffern der MaRisk. Die Erwartungshaltung der Aufsicht an die Institute hinsichtlich der sicheren Ausgestaltung der IT-Systeme sowie der zugehörigen IT-Prozesse und die diesbezüglichen Anforderungen an die IT-Governance wird durch die BAIT transparent gemacht. Die BAIT enthalten grundsätzlich keine neuen Anforderungen an die Institute, sondern sind als Klarstellungen schon vorhandener Anforderungen zu sehen. Die BAIT sind in acht Themenbereiche bzw. Kapitel unterteilt: 1. IT-Strategie 2. IT-Governance 3. Informationsrisikomanagement 4. Informationssicherheitsmanagement 5. Benutzerberechtigungsmanagement 6. IT-Projekte, Anwendungsentwicklung (inklusive durch Endbenutzer in den Fachbereichen) 7. IT-Betrieb (inklusive Datensicherung) 8. Auslagerung und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen In den folgenden Kapiteln wird eine Zusammenfassung der Anforderungen der oben genannten Themenbereiche gegeben. Ein wesentliches Ziel der BAIT ist die Stärkung des IT-Risikobewusstseins in den Banken und Sparkassen und insbesondere in den Führungsebenen. Die Notwendigkeit der Herstellung von Risikotransparenz und die Auseinander Die BAIT sind sowohl auf der homepage der BaFin als auch der Bundesbank einsehbar ( Das Rundschreiben 10/2017 (BA) wird durch ein erläuterndes Anschreiben der BaFin ergänzt. 15
28 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN BANK-DATEN setzung mit dem IT-Risiko auf allen Ebenen eines Instituts sind zentraler Bestandteil der IT-Anforderungen und zieht sich somit durch alle acht Themenbereiche. 5 Die folgende Abbildung stellt dieses Erfordernis für die operative Umsetzung, den Steuerungsbereich und die Ebene der Geschäftsleitung bzw. der Governance dar. 1. IT-Strategie Abbildung 2: Schärfung des IT-Risikobewusstseins durch die BAIT (Quelle: BaFin Journal Januar 2018, S. 19.) In diesem Themenbereich werden Mindestinhalte einer IT-Strategie genannt. Die Geschäftsleitung hat eine mit der Geschäftsstrategie konsistente, nachhaltige IT-Strategie festzulegen, in der die Ziele sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt werden. Als Mindestinhalte der IT-Strategie gelten: Strategische Entwicklung der IT-Aufbau- und IT-Ablauforganisation sowie der Auslagerungen von IT-Dienstleistungen Zuordnung der gängigen Standards, an denen sich das Institut orientiert, auf die Bereiche der IT Zuständigkeiten und Einbindung der Informationssicherheit in die Organisation 5 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): BaFin Journal: IT-Sicherheit: Aufsicht konkretisiert Anforderungen an die Kreditwirtschaft, Januar 2018, S. 18 f. 16 Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
29 SCHEVE Strategische Entwicklung der IT-Architektur Aussagen zum Notfallmanagement unter Berücksichtigung der IT- Belange Aussagen zu den in den Fachbereichen selbst betriebenen bzw. entwickelten IT-Systemen (Hardware- und Software-Komponenten) 2. IT-Governance Für die Umsetzung der Regelungen zur IT-Governance ist die Geschäftsleitung verantwortlich. Das Institut hat insbesondere das Informationsrisikomanagement, das Informationssicherheitsmanagement, den IT-Betrieb sowie die Anwendungsentwicklung quantitativ und qualitativ angemessen mit Personal auszustatten. Interessenkonflikte und unvereinbare Tätigkeiten innerhalb der IT-Aufbau- und IT-Ablauforganisation sind zu vermeiden. Zur Steuerung der für den Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Systeme zuständigen Bereiche durch die Geschäftsleitung sind angemessene quantitative und qualitative Kriterien festzulegen. Deren Einhaltung ist zu überwachen Informationsrisikomanagement Die Informationsverarbeitung und -weitergabe in Geschäfts- und Serviceprozessen wird durch datenverarbeitende IT-Systeme und zugehörige IT- Prozesse unterstützt. Im Themenbereich Informationsrisikomanagement wird ein stets aktueller Überblick über die Bestandteile des festgelegten Informationsverbundes sowie deren Abhängigkeiten und Schnittstellen gefordert. Ferner werden Vorgaben an die Methodik zur Ermittlung des Schutzbedarfs beschrieben. Ein Sollmaßnahmenkatalog ist zu erstellen. Im Rahmen der Erstellung dieses Katalogs sind die Anforderungen des Instituts zur Umsetzung der Schutzziele in den Schutzbedarfskategorien festzulegen und in geeigneter Form zu dokumentieren. Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind in den Prozess des Managements der operationellen Risiken zu überführen. Die Geschäftsleitung muss regelmäßig, mindestens vierteljährlich, darüber und über Veränderungen an der Risikosituation informiert werden
30 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN BANK-DATEN 4. Informationssicherheitsmanagement Zunächst hat die Geschäftsleitung eine Informationssicherheitsleitlinie zu beschließen und im Institut zu kommunizieren. Auf Basis der von der Geschäftsleitung beschlossenen Informationssicherheitsleitlinie sind dann konkretisierende und den Stand der Technik berücksichtigende Informationssicherheitsrichtlinien und Informationssicherheitsprozesse hinsichtlich der Dimensionen Identifizierung, Schutz, Entdeckung, Reaktion und Wiederherstellung zu definieren. Jedes Institut hat die Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten einzurichten. Diese Funktion umfasst die Verantwortung für die Wahrnehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb des Instituts und gegenüber Dritten. Sie stellt sicher, dass die in der IT-Strategie, der Informationssicherheitsleitlinie und den Informationssicherheitsrichtlinien des Instituts niedergelegten Ziele und Maßnahmen hinsichtlich der Informationssicherheit sowohl intern als auch gegenüber Dritten transparent gemacht und deren Einhaltung überprüft und überwacht werden. Um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden, ist die Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten organisatorisch und prozessual unabhängig auszugestalten. Zudem ist die Funktion grundsätzlich im eigenen Haus vorzuhalten. Regional tätige (insbesondere verbundangehörige) Institute sowie kleine (insbesondere gruppenangehörige) Institute ohne wesentliche eigenbetriebene IT mit einem gleichgerichteten Geschäftsmodell und gemeinsamen IT- Dienstleistern können einen gemeinsamen Informationssicherheitsbeauftragten bestellen. Allerdings ist dann in jedem Institut eine zuständige Ansprechperson für den Informationssicherheitsbeauftragten zu benennen. Der Informationssicherheitsbeauftragte hat der Geschäftsleitung regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Status der Informationssicherheit sowie anlassbezogen zu berichten. Nach einem Informationssicherheitsvorfall sind die Auswirkungen auf die Informationssicherheit zu analysieren und angemessene Nachsorgemaßnahmen zu veranlassen. 5. Benutzerberechtigungsmanagement 54 Die Nutzungsbedingungen und der Umfang von IT-Berechtigungen für die IT-Systeme sind konsistent zum ermittelten Schutzbedarf in einem Berechtigungskonzept festzulegen. Die Berechtigungskonzepte haben die Vergabe von Berechtigungen nach dem Sparsamkeitsgrundsatz (Need-to-know-Prinzip 18 Handbuch Datenmanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019
Konkretisierung der MaRisk durch ein Rundschreiben zu Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT)
 Konkretisierung der MaRisk durch ein Rundschreiben zu Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) Renate Essler, BaFin Dr. Michael Paust, Deutsche Bundesbank Inhaltsverzeichnis 1. Ausgangslage 2.
Konkretisierung der MaRisk durch ein Rundschreiben zu Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) Renate Essler, BaFin Dr. Michael Paust, Deutsche Bundesbank Inhaltsverzeichnis 1. Ausgangslage 2.
Vorlesung Gesamtbanksteuerung
 Basel II Vorlesung Gesamtbanksteuerung Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen Dr. Klaus Lukas Karsten Geiersbach Mindesteigenkapitalanforderungen Aufsichtliches Überprüfungs verfahren Marktdisziplin 1 Aufsichtsrechtliche
Basel II Vorlesung Gesamtbanksteuerung Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen Dr. Klaus Lukas Karsten Geiersbach Mindesteigenkapitalanforderungen Aufsichtliches Überprüfungs verfahren Marktdisziplin 1 Aufsichtsrechtliche
Vorwort zur vierten Auflage Abbildungsverzeichnis! XVII Die Autoren
 XI Vorwort zur vierten Auflage V Abbildungsverzeichnis! XVII Die Autoren XIX Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung 1 1 Warum ist Risikomanagement so wichtig? 2 2 MaRisk: Beweggründe und Historie 5
XI Vorwort zur vierten Auflage V Abbildungsverzeichnis! XVII Die Autoren XIX Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung 1 1 Warum ist Risikomanagement so wichtig? 2 2 MaRisk: Beweggründe und Historie 5
25 c KWG Geschäftsleiter Überprüfung vom:
 Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Beachtung der Obliegenheiten des 25 c KWG durch die Geschäftsleiter 1 : 1 Weitere Hinweise siehe letzte Seite 1 Regelung Regelung nach AT 5 der MaRisk
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Beachtung der Obliegenheiten des 25 c KWG durch die Geschäftsleiter 1 : 1 Weitere Hinweise siehe letzte Seite 1 Regelung Regelung nach AT 5 der MaRisk
Vorwort zur dritten Auflage... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XIV
 IX Inhaltsverzeichnis Vorwort zur dritten Auflage... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XIV Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung... 1 1 Warum ist Risikomanagement so wichtig?... 2 2 MaRisk:
IX Inhaltsverzeichnis Vorwort zur dritten Auflage... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XIV Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung... 1 1 Warum ist Risikomanagement so wichtig?... 2 2 MaRisk:
Geleitwort... V Vorwort... VII Autoren... IX
 XI Inhaltsverzeichnis Geleitwort... V Vorwort... VII Autoren... IX Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung... 1 1 Warum Risikomanagement?... 2 2 Beweggründe und Historie... 5 2.1 Internationale Ebene:
XI Inhaltsverzeichnis Geleitwort... V Vorwort... VII Autoren... IX Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung... 1 1 Warum Risikomanagement?... 2 2 Beweggründe und Historie... 5 2.1 Internationale Ebene:
BAIT-Anforderungen bezüglich des IDV-Einsatzes in Banken Beobachtungen aus der Prüfungspraxis
 BAIT-Anforderungen bezüglich des IDV-Einsatzes in Banken Beobachtungen aus der Prüfungspraxis Rainer Englisch, Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Bayern Definition MaRisk-Definition Die Anforderungen
BAIT-Anforderungen bezüglich des IDV-Einsatzes in Banken Beobachtungen aus der Prüfungspraxis Rainer Englisch, Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Bayern Definition MaRisk-Definition Die Anforderungen
Vorwort des betreuenden Herausgebers 1. A. Rechtliche Grundlagen und Konzeption der MaRisk (Günther/Plaumann-Ewerdwalbesloh) 7
 INHALTSÜBERSICHT Inhaltsübersicht Vorwort des betreuenden Herausgebers 1 A. Rechtliche Grundlagen und Konzeption der MaRisk (Günther/Plaumann-Ewerdwalbesloh) 7 B. Definition, Abgrenzung und Kategorisierung
INHALTSÜBERSICHT Inhaltsübersicht Vorwort des betreuenden Herausgebers 1 A. Rechtliche Grundlagen und Konzeption der MaRisk (Günther/Plaumann-Ewerdwalbesloh) 7 B. Definition, Abgrenzung und Kategorisierung
I. Einleitung Neufassung MaRisk (Siegl/Weber) Internationale Ebene EU-Ebene Nationale Ebene
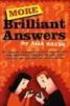 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung 1 1. Die neuen MaRisk aus aufsichtsrechtlicher Perspektive (Volk/Englisch) 1.1. Risikoinventur 4 1.2. Risikotragfähigkeit 7 1.2.1. Diversifikationsannahmen 7 1.2.2. Risikokonzentrationen
Inhaltsverzeichnis I. Einleitung 1 1. Die neuen MaRisk aus aufsichtsrechtlicher Perspektive (Volk/Englisch) 1.1. Risikoinventur 4 1.2. Risikotragfähigkeit 7 1.2.1. Diversifikationsannahmen 7 1.2.2. Risikokonzentrationen
MaRisk- Offnungsklauseln
 MaRisk- Offnungsklauseln Prüfungsvorbereitende Dokumentation Herausgegeben von Michael Berndt Mit Beiträgen von Karsten Geiersbach Margit Günther Michael Helfer Sven Müller Stefan Prasser Andreas Serafin
MaRisk- Offnungsklauseln Prüfungsvorbereitende Dokumentation Herausgegeben von Michael Berndt Mit Beiträgen von Karsten Geiersbach Margit Günther Michael Helfer Sven Müller Stefan Prasser Andreas Serafin
Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) 29. Juni 2017
 Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) 29. Juni 2017 Agenda Hintergrund, zeitlicher Rahmen, Zielsetzung und Adressaten Rechtliche Einordnung Inhalte und Handlungsfelder Prüfungsschwerpunkte Zusammenfassung
Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) 29. Juni 2017 Agenda Hintergrund, zeitlicher Rahmen, Zielsetzung und Adressaten Rechtliche Einordnung Inhalte und Handlungsfelder Prüfungsschwerpunkte Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis. Geleitwort. Autoren, IX
 XI Geleitwort V Vorwort VII Autoren, IX Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung 1 1 Warum Risikomanagement? 2 2 Beweggründe und Historie 5 2.1 Internationale Ebene: Umsetzung von Basel II 5 2.2 Nationale
XI Geleitwort V Vorwort VII Autoren, IX Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung 1 1 Warum Risikomanagement? 2 2 Beweggründe und Historie 5 2.1 Internationale Ebene: Umsetzung von Basel II 5 2.2 Nationale
Anforderungen an das Risikomanagement einer Pensionskasse. 18. November 2015
 Anforderungen an das Risikomanagement einer Pensionskasse 18. November 2015 Agenda 1. Wie sieht es mit der Umsetzung der Anforderungen an das Risikomanagement in der Branche (Versicherungen, Einrichtungen
Anforderungen an das Risikomanagement einer Pensionskasse 18. November 2015 Agenda 1. Wie sieht es mit der Umsetzung der Anforderungen an das Risikomanagement in der Branche (Versicherungen, Einrichtungen
A. Rechtliche Grundlagen und Konzeption der MaRisk (Günther/Planmann-Ewerdwalbesloh) 7
 Inhaltsübersicht Vorwort des betreuenden Herausgebers 1 A. Rechtliche Grundlagen und Konzeption der MaRisk (Günther/Planmann-Ewerdwalbesloh) 7 B. Definition, Abgrenzung und Kategorisierung von Öffnungsklauseln
Inhaltsübersicht Vorwort des betreuenden Herausgebers 1 A. Rechtliche Grundlagen und Konzeption der MaRisk (Günther/Planmann-Ewerdwalbesloh) 7 B. Definition, Abgrenzung und Kategorisierung von Öffnungsklauseln
Arbeitsschwerpunkte zur IT-Aufsicht 2016/ 2017
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Arbeitsschwerpunkte zur IT-Aufsicht 2016/ 2017 4. IT-Informationsveranstaltung der BaFin 16. März 2017 Vorstellung Kompetenzreferat IT-Sicherheit (BA 51)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Arbeitsschwerpunkte zur IT-Aufsicht 2016/ 2017 4. IT-Informationsveranstaltung der BaFin 16. März 2017 Vorstellung Kompetenzreferat IT-Sicherheit (BA 51)
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Kreditreporting und Kreditrisikostrategie: Zentrale Werkzeuge einer modernen Risikosteuerung
 Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Kreditreporting und Kreditrisikostrategie: Zentrale Werkzeuge einer modernen Risikosteuerung Prozesse prüfen * Risiken vermeiden * Fehler aufdecken > Handlungsemp fehlungen
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Kreditreporting und Kreditrisikostrategie: Zentrale Werkzeuge einer modernen Risikosteuerung Prozesse prüfen * Risiken vermeiden * Fehler aufdecken > Handlungsemp fehlungen
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
 Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) Kommentar unter Berücksichtigung der Instituts-Vergütungsverordnung (InstitutsVergV) Bearbeitet von Dr. Ralf Hannemann, Andreas Schneider 4., überarbeitete
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) Kommentar unter Berücksichtigung der Instituts-Vergütungsverordnung (InstitutsVergV) Bearbeitet von Dr. Ralf Hannemann, Andreas Schneider 4., überarbeitete
MaRisk Konsultationsentwurf Fassung vom Überblick und Kommentierung
 MaRisk Konsultationsentwurf Fassung vom 18.02.2016 Überblick und Kommentierung Februar 2016 Einführung Die BaFin hat am 18.02.2016 gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank einen Konsultationsentwurf zur
MaRisk Konsultationsentwurf Fassung vom 18.02.2016 Überblick und Kommentierung Februar 2016 Einführung Die BaFin hat am 18.02.2016 gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank einen Konsultationsentwurf zur
Checkliste zur Prüfung/Kontrolle der Einhaltung der Regelungen der BAIT
 Inhaltsverzeichnis 1.0 IT Management 1.0... 1 2.0 Dokumente der Unterlage zum IT- Management... 1 3.0 Beispielseiten Informationsrisikomanagement... 2 4.0 Beispielseiten Test und Freigabeverfahren... 3
Inhaltsverzeichnis 1.0 IT Management 1.0... 1 2.0 Dokumente der Unterlage zum IT- Management... 1 3.0 Beispielseiten Informationsrisikomanagement... 2 4.0 Beispielseiten Test und Freigabeverfahren... 3
A. Regulatorische Rahmenbedingungen und Tendenzen 5. B. Praxisfragen des Informationssicherheitsmanagements 87
 Inhaltsübersicht Vorwort 1 A. Regulatorische Rahmenbedingungen und Tendenzen 5 B. Praxisfragen des Informationssicherheitsmanagements 87 C. Wichtige IKS-Schnittstellen des Informations Sicherheitsmanagements
Inhaltsübersicht Vorwort 1 A. Regulatorische Rahmenbedingungen und Tendenzen 5 B. Praxisfragen des Informationssicherheitsmanagements 87 C. Wichtige IKS-Schnittstellen des Informations Sicherheitsmanagements
informationsdienste ITGOV SUITE Strategische und operative IT-Steuerung
 informationsdienste ITGOV SUITE Strategische und operative IT-Steuerung WWW.VOEB-SERVICE.DE/ITGOV-SUITE informationsdienste ITGOV SUITE Strategische und operative IT-Steuerung Informationsdienste zur strategischen
informationsdienste ITGOV SUITE Strategische und operative IT-Steuerung WWW.VOEB-SERVICE.DE/ITGOV-SUITE informationsdienste ITGOV SUITE Strategische und operative IT-Steuerung Informationsdienste zur strategischen
Inhalt. 2. IT-Compliance für Banken und Sparkassen (Überblick) 1. Kurze Vorstellung der Haspa
 Inhalt 1. Kurze Vorstellung der Haspa 2. IT-Compliance für Banken und Sparkassen (Überblick) 3. Wer reguliert die Banken und Sparkassen? 4. Regulatorische Anforderungen aus a. MaRisk und BAIT b. PSD 2
Inhalt 1. Kurze Vorstellung der Haspa 2. IT-Compliance für Banken und Sparkassen (Überblick) 3. Wer reguliert die Banken und Sparkassen? 4. Regulatorische Anforderungen aus a. MaRisk und BAIT b. PSD 2
Inhaltsverzeichnis. Informationssicherheits-Management nach ISACA
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung und Motivation... 1 1.1 Der Wert von Informationen... 1 1.2 Informationssicherheit und IT-Sicherheit... 3 1.3 Informationssicherheit, Daten- und Geheimschutz... 6 1.3.1
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung und Motivation... 1 1.1 Der Wert von Informationen... 1 1.2 Informationssicherheit und IT-Sicherheit... 3 1.3 Informationssicherheit, Daten- und Geheimschutz... 6 1.3.1
Data Governance: Lessons Learnt der Projektpraxis. Impulsvortrag von Karsten Ebersbach 4. Gesamtbanksteuerung 2016 Frankfurt a. M.,
 Data Governance: Lessons Learnt der Projektpraxis Impulsvortrag von Karsten Ebersbach 4. Gesamtbanksteuerung 2016 Frankfurt a. M., 24.02.2016 Der Weg zur Erfüllung der Anforderungen an Data Governance
Data Governance: Lessons Learnt der Projektpraxis Impulsvortrag von Karsten Ebersbach 4. Gesamtbanksteuerung 2016 Frankfurt a. M., 24.02.2016 Der Weg zur Erfüllung der Anforderungen an Data Governance
ICAAP Internationale Entwicklungen und nationale Umsetzung
 ICAAP Internationale Entwicklungen und nationale Umsetzung Matthias Güldner, Abteilungsleiter, BA 5 Bonn, 29. Mai 2018 Agenda 1. Internationale Vorgaben und Entwicklungen 29. Mai 2018 ICAAP Internationale
ICAAP Internationale Entwicklungen und nationale Umsetzung Matthias Güldner, Abteilungsleiter, BA 5 Bonn, 29. Mai 2018 Agenda 1. Internationale Vorgaben und Entwicklungen 29. Mai 2018 ICAAP Internationale
Basel III und mögliche Auswirkungen auf den deutschen Mittelstand
 Wirtschaft Anastasija Scheifele Basel III und mögliche Auswirkungen auf den deutschen Mittelstand Eine kritische Diskussion Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Wirtschaft Anastasija Scheifele Basel III und mögliche Auswirkungen auf den deutschen Mittelstand Eine kritische Diskussion Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Risk Governance Empirische Ergebnisse einer Studie deutscher Regionalbanken
 Risk Governance Empirische Ergebnisse einer Studie deutscher Regionalbanken Julian Quast, M.Sc. Universität Siegen 4. Jahrestagung Risk Govenance 13.10.2016, Siegen 13.10.2016 Julian Quast 1 PROBLEMSTELLUNG
Risk Governance Empirische Ergebnisse einer Studie deutscher Regionalbanken Julian Quast, M.Sc. Universität Siegen 4. Jahrestagung Risk Govenance 13.10.2016, Siegen 13.10.2016 Julian Quast 1 PROBLEMSTELLUNG
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bankenaufsicht (Referat BA 54) Graurheindorfer Straße Bonn
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bankenaufsicht (Referat BA 54) Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn Deutsche Bundesbank Postfach 10 06 02 60006 Frankfurt am Main Düsseldorf, 27.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bankenaufsicht (Referat BA 54) Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn Deutsche Bundesbank Postfach 10 06 02 60006 Frankfurt am Main Düsseldorf, 27.
Whitepaper. Rundschreiben zur 5. MaRisk-Novelle: Stärkung der Risikokultur in Banken
 Whitepaper zur 5. MaRisk-Novelle: Stärkung der Risikokultur in Banken Endfassung der 5. MaRisk-Novelle zeigt erheblichen Handlungsbedarf für betroffene Institute ORO Services GmbH, Hansa Haus, Berner Str.
Whitepaper zur 5. MaRisk-Novelle: Stärkung der Risikokultur in Banken Endfassung der 5. MaRisk-Novelle zeigt erheblichen Handlungsbedarf für betroffene Institute ORO Services GmbH, Hansa Haus, Berner Str.
Die Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT
 BAIT INFORMATIONSSICHERHEIT wird ab sofort großgeschrieben Informationssicherheit rückt mit der MaRisk-Novelle und den BAIT in den aufsichtsrechtlichen Fokus. Banken müssen einen Informationssicherheitsbeauftragten
BAIT INFORMATIONSSICHERHEIT wird ab sofort großgeschrieben Informationssicherheit rückt mit der MaRisk-Novelle und den BAIT in den aufsichtsrechtlichen Fokus. Banken müssen einen Informationssicherheitsbeauftragten
Geiersbach/Prasser (Hrsg.) Praktikerhandbuch Stresstesting. 3. Auflage
 Geiersbach/Prasser (Hrsg.) Praktikerhandbuch Stresstesting 3. Auflage Dr. Daniel Baumgarten Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapital Sparkasse KölnBonn Sascha Biber Fachprüfer Referat Bankgeschäftliche
Geiersbach/Prasser (Hrsg.) Praktikerhandbuch Stresstesting 3. Auflage Dr. Daniel Baumgarten Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapital Sparkasse KölnBonn Sascha Biber Fachprüfer Referat Bankgeschäftliche
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden. Neue MaRisk. Prozesse prüfen - Risiken vermeiden - Fehler aufdecken -> Handlungsempfehlungen ableiten
 Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Neue MaRisk Prozesse prüfen - Risiken vermeiden - Fehler aufdecken -> Handlungsempfehlungen ableiten von Axel Becker, Michael Berndt, Dr. Jochen Klein 3., überarbeitete
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Neue MaRisk Prozesse prüfen - Risiken vermeiden - Fehler aufdecken -> Handlungsempfehlungen ableiten von Axel Becker, Michael Berndt, Dr. Jochen Klein 3., überarbeitete
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden. Risikoorientierte Projektbegleitung. Interne Revision
 Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden. Risikoorientierte Projektbegleitung. Interne Revision Prozesse prüfen Risiken vermeiden Fehler aufdecken > Handlungsempfehlungen ableiten Bearbeitet von Axel Becker,
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden. Risikoorientierte Projektbegleitung. Interne Revision Prozesse prüfen Risiken vermeiden Fehler aufdecken > Handlungsempfehlungen ableiten Bearbeitet von Axel Becker,
Wer Banken kontrolliert und wie es funktioniert - eine Einführung
 Yasmin Osman Basiswissen Bankenaufsicht Wer Banken kontrolliert und wie es funktioniert - eine Einführung 2018 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart IX Vorwort V 1 Warum Banken kontrolliert werden 1 1.1 Bedeutung
Yasmin Osman Basiswissen Bankenaufsicht Wer Banken kontrolliert und wie es funktioniert - eine Einführung 2018 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart IX Vorwort V 1 Warum Banken kontrolliert werden 1 1.1 Bedeutung
DAS MODELL DER DREI VERTEIDIGUNGSLINIEN ZUR STEUERUNG DES RISIKOMANAGEMENTS IM UNTERNEHMEN
 Oktober 2016 DAS MODELL DER DREI VERTEIDIGUNGSLINIEN ZUR STEUERUNG DES RISIKOMANAGEMENTS IM UNTERNEHMEN Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser Governance Risk & Compliance auf der Grundlage des Three Lines
Oktober 2016 DAS MODELL DER DREI VERTEIDIGUNGSLINIEN ZUR STEUERUNG DES RISIKOMANAGEMENTS IM UNTERNEHMEN Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser Governance Risk & Compliance auf der Grundlage des Three Lines
AnaCredit Reporting Modul
 AnaCredit Reporting Modul Moody s Analytics AnaCredit Reporting Modul unterstützt Banken bei der Erfüllung der AnaCredit-Verordnung und stellt eine strategische Plattform zur Verfügung, um zukünftige regulatorische
AnaCredit Reporting Modul Moody s Analytics AnaCredit Reporting Modul unterstützt Banken bei der Erfüllung der AnaCredit-Verordnung und stellt eine strategische Plattform zur Verfügung, um zukünftige regulatorische
Internes Kontrollsystem und Risikobeurteilung in der IT
 IBM ISS Security Circle 7. Mai 2009, Hotel Widder, Zürich Internes Kontrollsystem und Risikobeurteilung in der IT Angelo Tosi Information Security Consultant Übersicht Was ist ab 2008 neu im Schweiz. Obligationenrecht?
IBM ISS Security Circle 7. Mai 2009, Hotel Widder, Zürich Internes Kontrollsystem und Risikobeurteilung in der IT Angelo Tosi Information Security Consultant Übersicht Was ist ab 2008 neu im Schweiz. Obligationenrecht?
Systemgestütztes Management der IT-Sicherheit mit der GRC-Suite iris
 Systemgestütztes Management der IT-Sicherheit mit der GRC-Suite iris Vorteile eines Toolgestützten Informationssicherheitsmanagements Abweichungen von den Vorgaben (Standards, Normen) werden schneller
Systemgestütztes Management der IT-Sicherheit mit der GRC-Suite iris Vorteile eines Toolgestützten Informationssicherheitsmanagements Abweichungen von den Vorgaben (Standards, Normen) werden schneller
Arbeitsschwerpunkte 2018 der Gruppe IT-Aufsicht. IT-Aufsicht bei Banken
 Arbeitsschwerpunkte 2018 der Gruppe IT-Aufsicht IT-Aufsicht bei Banken Gruppe IT-Aufsicht/ Zahlungsverkehr/ Cybersicherheit Gruppe IT- Aufsicht / Zahlungsverkehr/Cybersicherheit GL: N.N. i.v. Jens Obermöller
Arbeitsschwerpunkte 2018 der Gruppe IT-Aufsicht IT-Aufsicht bei Banken Gruppe IT-Aufsicht/ Zahlungsverkehr/ Cybersicherheit Gruppe IT- Aufsicht / Zahlungsverkehr/Cybersicherheit GL: N.N. i.v. Jens Obermöller
Checkliste ISO/IEC 27001:2013 Dokumente und Aufzeichnungen
 Checkliste ISO/IEC 27001:2013 Dokumente und Aufzeichnungen Version: 1.1 Datum: 01.06.2016 Änderungsverfolgung Version Datum Geänderte Seiten / Kapitel Autor Bemerkungen 1.0 07.01.2016 Alle F. Thater Initiale
Checkliste ISO/IEC 27001:2013 Dokumente und Aufzeichnungen Version: 1.1 Datum: 01.06.2016 Änderungsverfolgung Version Datum Geänderte Seiten / Kapitel Autor Bemerkungen 1.0 07.01.2016 Alle F. Thater Initiale
. An alle Verbände der Kreditwirtschaft GZ: BA 54-FR /0008 (Bitte stets angeben) 2016/
 BaFin Postfach 12 53 53002 Bonn E-Mail An alle Verbände der Kreditwirtschaft 18.02.2016 GZ: BA 54-FR 2210-2016/0008 (Bitte stets angeben) 2016/0056411 Konsultation 02/2016 - MaRisk-Novelle 2016; Übersendung
BaFin Postfach 12 53 53002 Bonn E-Mail An alle Verbände der Kreditwirtschaft 18.02.2016 GZ: BA 54-FR 2210-2016/0008 (Bitte stets angeben) 2016/0056411 Konsultation 02/2016 - MaRisk-Novelle 2016; Übersendung
GSK PSD 2 Konferenz. Banken & FinTechs. (Neue) Regulatorische Besonderheiten bei der Einbindung technischer Dienstleister (FinTech)
 GSK PSD 2 Konferenz Banken & FinTechs (Neue) Regulatorische Besonderheiten bei der Einbindung technischer Dienstleister (FinTech) Dr. Timo Bernau, GSK Stockmann Frankfurt a.m. 17. Mai 2017 Agenda Einführung:
GSK PSD 2 Konferenz Banken & FinTechs (Neue) Regulatorische Besonderheiten bei der Einbindung technischer Dienstleister (FinTech) Dr. Timo Bernau, GSK Stockmann Frankfurt a.m. 17. Mai 2017 Agenda Einführung:
FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbh. ForumISM. Informations- Sicherheits- Management. effizient risikoorientiert ganzheitlich
 FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbh ForumISM Informations- Sicherheits- Management effizient risikoorientiert ganzheitlich Informationssicherheitsmanagement mit ForumISM ForumISM ermöglicht
FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbh ForumISM Informations- Sicherheits- Management effizient risikoorientiert ganzheitlich Informationssicherheitsmanagement mit ForumISM ForumISM ermöglicht
Konferenz IT-Aufsicht bei Banken. Ira Steinbrecher, Referatsleiterin Referat GIT 3 Grundsatz IT-Aufsicht und Prüfungswesen
 Konferenz IT-Aufsicht bei Banken Ira Steinbrecher, Referatsleiterin Referat GIT 3 Grundsatz IT-Aufsicht und Prüfungswesen Cloud-Computing IT-Aufsicht bei Banken am 27.09.2018 Inhalt 1. Einführung 1.1 Überblick
Konferenz IT-Aufsicht bei Banken Ira Steinbrecher, Referatsleiterin Referat GIT 3 Grundsatz IT-Aufsicht und Prüfungswesen Cloud-Computing IT-Aufsicht bei Banken am 27.09.2018 Inhalt 1. Einführung 1.1 Überblick
ITS on Reporting. - Ein Überblick. von. Ludger Hanenberg, BaFin
 ITS on Reporting - Ein Überblick von Ludger Hanenberg, BaFin Agenda Konzept und Hintergrund zum europäischen Berichtswesen Weitere Entwicklung der Harmonisierungskonzepte Entwurf eines ITS on Reporting
ITS on Reporting - Ein Überblick von Ludger Hanenberg, BaFin Agenda Konzept und Hintergrund zum europäischen Berichtswesen Weitere Entwicklung der Harmonisierungskonzepte Entwurf eines ITS on Reporting
Datenschutzreform 2018
 Datenschutzreform 2018 Die bereitgestellten Informationen sollen die bayerischen öffentlichen Stellen bei der Umstellung auf die Datenschutz-Grundverordnung unterstützen. Sie wollen einen Beitrag zum Verständnis
Datenschutzreform 2018 Die bereitgestellten Informationen sollen die bayerischen öffentlichen Stellen bei der Umstellung auf die Datenschutz-Grundverordnung unterstützen. Sie wollen einen Beitrag zum Verständnis
Information Security Management System Informationssicherheitsrichtlinie
 Information Security Management System Informationssicherheitsrichtlinie I. Dokumentinformationen Version: 0.3 Datum der Version: 08.1.017 Erstellt durch: Kristin Barteis Genehmigt durch: Hannes Boekhoff,
Information Security Management System Informationssicherheitsrichtlinie I. Dokumentinformationen Version: 0.3 Datum der Version: 08.1.017 Erstellt durch: Kristin Barteis Genehmigt durch: Hannes Boekhoff,
ISIS12 als Informationssicherheitsmanagementsystem Wenn weniger manchmal mehr ist! Ralf Wildvang
 ISIS12 als Informationssicherheitsmanagementsystem Wenn weniger manchmal mehr ist! Ralf Wildvang Kurze Vorstellung...sind Wegweiser für Ihre Informationssicherheit, geben Orientierung in komplexen Themen,
ISIS12 als Informationssicherheitsmanagementsystem Wenn weniger manchmal mehr ist! Ralf Wildvang Kurze Vorstellung...sind Wegweiser für Ihre Informationssicherheit, geben Orientierung in komplexen Themen,
Datenschutzzertifizierung Datenschutzmanagementsystem
 Datenschutzzertifizierung Datenschutzmanagementsystem Senior Consultant für Datenschutz und Informationssicherheit DIN NIA 27 AK 1 & 5 ad hoc Meeting Datenschutzmanagementsystem 15. Juli 2016, Bonn 2016
Datenschutzzertifizierung Datenschutzmanagementsystem Senior Consultant für Datenschutz und Informationssicherheit DIN NIA 27 AK 1 & 5 ad hoc Meeting Datenschutzmanagementsystem 15. Juli 2016, Bonn 2016
Whitepaper. Rundschreiben zur 5. MaRisk-Novelle: Stärkung der Risikokultur in Banken
 Whitepaper zur 5. MaRisk-Novelle: Stärkung der Risikokultur in Banken Endfassung der 5. MaRisk-Novelle zeigt erheblichen Handlungsbedarf für betroffene Institute Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner
Whitepaper zur 5. MaRisk-Novelle: Stärkung der Risikokultur in Banken Endfassung der 5. MaRisk-Novelle zeigt erheblichen Handlungsbedarf für betroffene Institute Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner
Anwenderbericht Sparkasse Fulda: Effiziente Banksteuerung mit dem Management-Cockpit
 A NWENDUNG 13. Sep. 2016 Anwenderbericht Sparkasse Fulda: Effiziente Banksteuerung mit dem Management-Cockpit Angesichts der steigenden regulatorischen Vorgaben hat der Bedarf an adäquaten Management-
A NWENDUNG 13. Sep. 2016 Anwenderbericht Sparkasse Fulda: Effiziente Banksteuerung mit dem Management-Cockpit Angesichts der steigenden regulatorischen Vorgaben hat der Bedarf an adäquaten Management-
Validierungsprozess BCBS 239 Framework
 Validierungsprozess BCBS 239 Framework Thomas Landmann Mit der Veröffentlichung der 14 Grundsätze zur Risikodatenaggregation und des Reporting des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (Januar 2013) wurden
Validierungsprozess BCBS 239 Framework Thomas Landmann Mit der Veröffentlichung der 14 Grundsätze zur Risikodatenaggregation und des Reporting des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (Januar 2013) wurden
Good Corporate Governance: Compliance als Bestandteil des internen Kontrollsystems
 Monika Roth Prof. Dr. iur., Advokatin Good Corporate Governance: Compliance als Bestandteil des internen Kontrollsystems Ein Handbuch für die Praxis 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage DIKE Inhaltsverzeichnis
Monika Roth Prof. Dr. iur., Advokatin Good Corporate Governance: Compliance als Bestandteil des internen Kontrollsystems Ein Handbuch für die Praxis 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage DIKE Inhaltsverzeichnis
Prüfungspraxis der Deutschen Bundesbank Informationsveranstaltung: IT-Aufsicht bei Banken Bonn,
 Prüfungspraxis der Deutschen Bundesbank Informationsveranstaltung: IT-Aufsicht bei Banken Bonn, 16.03.2017 Jörg Bretz seit 1989 bei der Deutschen Bundesbank seit 2001 Hauptverwaltung Frankfurt - Bankgeschäftliche
Prüfungspraxis der Deutschen Bundesbank Informationsveranstaltung: IT-Aufsicht bei Banken Bonn, 16.03.2017 Jörg Bretz seit 1989 bei der Deutschen Bundesbank seit 2001 Hauptverwaltung Frankfurt - Bankgeschäftliche
Management von Risikokonzentrationen
 Management von Risikokonzentrationen Erfassung Beurteilung - Steuerung - Überwachung Stefan Kühn (Hrsg.) Leiter RisikocontrolUing Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Philip Stegner (Hrsg.) Leiter
Management von Risikokonzentrationen Erfassung Beurteilung - Steuerung - Überwachung Stefan Kühn (Hrsg.) Leiter RisikocontrolUing Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Philip Stegner (Hrsg.) Leiter
Vorlesung Gesamtbanksteuerung
 Vorlesung Gesamtbanksteuerung Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen Basel II Dr. Klaus Lukas Dr. Karsten Geiersbach Mindesteigenkapitalanforderungen Aufsichtliches Überprüfungsverfahren Marktdisziplin
Vorlesung Gesamtbanksteuerung Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen Basel II Dr. Klaus Lukas Dr. Karsten Geiersbach Mindesteigenkapitalanforderungen Aufsichtliches Überprüfungsverfahren Marktdisziplin
Inhaltsverzeichnis Vorwort... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abkürzungsverzeichnis...XV Einleitung Kapitel: Solvency II-Richtlinie...
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abkürzungsverzeichnis...XV Einleitung... 1 A. Gegenstand der Untersuchung... 1 B. Rechtfertigung der Untersuchung... 2 C. Gang der Untersuchung...
Inhaltsverzeichnis Vorwort... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abkürzungsverzeichnis...XV Einleitung... 1 A. Gegenstand der Untersuchung... 1 B. Rechtfertigung der Untersuchung... 2 C. Gang der Untersuchung...
Integration eines Application Security Management in ein ISMS nach BSI IT- Grundschutz 1. BSI IT-Grundschutztag Limburg
 Integration eines Application Security Management in ein ISMS nach BSI IT- Grundschutz 1. BSI IT-Grundschutztag Limburg 09.03.2017 Wer wir sind Beratung und Dienstleistung für anspruchsvolle Anforderungen
Integration eines Application Security Management in ein ISMS nach BSI IT- Grundschutz 1. BSI IT-Grundschutztag Limburg 09.03.2017 Wer wir sind Beratung und Dienstleistung für anspruchsvolle Anforderungen
GZ: BA 17 - K /2006 (Bitte stets angeben)
 04.06.2007 GZ: BA 17 - K 2413 1/2006 (Bitte stets angeben) Merkblatt zur Anzeige der Anwendung des Standardansatzes für das operationelle Risiko sowie zur Beantragung der Zustimmung zur Nutzung eines alternativen
04.06.2007 GZ: BA 17 - K 2413 1/2006 (Bitte stets angeben) Merkblatt zur Anzeige der Anwendung des Standardansatzes für das operationelle Risiko sowie zur Beantragung der Zustimmung zur Nutzung eines alternativen
Die Vorgaben zur ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation im Bankaufsichtsrecht
 Studien zum Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrecht 69 Nicholas Lütgerath Die Vorgaben zur ordnungsgemäßen im Bankaufsichtsrecht Entwicklung, Auswirkung und gesellschaftsrechtliche Implikation der 25a ff.
Studien zum Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrecht 69 Nicholas Lütgerath Die Vorgaben zur ordnungsgemäßen im Bankaufsichtsrecht Entwicklung, Auswirkung und gesellschaftsrechtliche Implikation der 25a ff.
MaRisk NEU Handlungsbedarf in der Banksteuerung
 MaRisk NEU Handlungsbedarf in der Banksteuerung Bearbeitet von Prof. Dr. Konrad Wimmer, Christian Batz, Robert Bruckmann, Holger Dürr, Adrian Hirsch, Günther Keller, Alexander Kopf, WP StB Dr. Stefan Kusterer,
MaRisk NEU Handlungsbedarf in der Banksteuerung Bearbeitet von Prof. Dr. Konrad Wimmer, Christian Batz, Robert Bruckmann, Holger Dürr, Adrian Hirsch, Günther Keller, Alexander Kopf, WP StB Dr. Stefan Kusterer,
MaRiskNEU- Handlungsbedarf in der Banksteuerung. Herausgeber und Autor:
 MaRiskNEU- Handlungsbedarf in der Banksteuerung Herausgeber und Autor: Prof. Dr. Konrad Wimmer Geschäftsbereichsleiter Bankinnovation msggillardon AG, München / ' Autoren:. Christian Batz Abteilungsleiter
MaRiskNEU- Handlungsbedarf in der Banksteuerung Herausgeber und Autor: Prof. Dr. Konrad Wimmer Geschäftsbereichsleiter Bankinnovation msggillardon AG, München / ' Autoren:. Christian Batz Abteilungsleiter
EFFIZIENTES KONTROLLSYSTEM ALS INTEGRIERTER BESTANDTEIL DER CORPORATE GOVERNANCE. 7. November 2017 SWISS GRC DAY Daniel Fuchs, Leiter Risk Control
 EFFIZIENTES KONTROLLSYSTEM ALS INTEGRIERTER BESTANDTEIL DER CORPORATE GOVERNANCE 7. November 2017 SWISS GRC DAY Daniel Fuchs, Leiter Risk Control DIE STARKE BANK IM THURGAU FREUNDLICH UND SYMPATHISCH Seite
EFFIZIENTES KONTROLLSYSTEM ALS INTEGRIERTER BESTANDTEIL DER CORPORATE GOVERNANCE 7. November 2017 SWISS GRC DAY Daniel Fuchs, Leiter Risk Control DIE STARKE BANK IM THURGAU FREUNDLICH UND SYMPATHISCH Seite
Neuentwurf der MaRisk Im Spannungsfeld von Risikokultur und RegulierungsGAU für mittelständische Banken
 Neuentwurf der MaRisk Im Spannungsfeld von Risikokultur und RegulierungsGAU für mittelständische Banken Norman Nehls Dipl.-Betriebswirt Partner Severn Consultancy GmbH Frankfurt am Main Glauchau, 13. Juni
Neuentwurf der MaRisk Im Spannungsfeld von Risikokultur und RegulierungsGAU für mittelständische Banken Norman Nehls Dipl.-Betriebswirt Partner Severn Consultancy GmbH Frankfurt am Main Glauchau, 13. Juni
Wissensmanagement. Thema: ITIL
 Kurs: Dozent: Wissensmanagement Friedel Völker Thema: ITIL Agenda IT Service Management & ITIL Service Strategy Service Design Service Transition Service Operation Continual Service Improvement Ziele IT
Kurs: Dozent: Wissensmanagement Friedel Völker Thema: ITIL Agenda IT Service Management & ITIL Service Strategy Service Design Service Transition Service Operation Continual Service Improvement Ziele IT
Wissensmanagement. Thema: ITIL
 Kurs: Dozent: Wissensmanagement Friedel Völker Thema: ITIL Folie 2 von 28 Agenda IT Service Management & ITIL Service Strategy Service Design Service Transition Service Operation Continual Service Improvement
Kurs: Dozent: Wissensmanagement Friedel Völker Thema: ITIL Folie 2 von 28 Agenda IT Service Management & ITIL Service Strategy Service Design Service Transition Service Operation Continual Service Improvement
Handbuch Bankaufsichtliches Meldewesen
 Handbuch Bankaufsichtliches Meldewesen Vorgaben, Datenanforderungen, Umsetzungshinweise Bearbeitet von Eric Freund, Frank Günther, Jens Hennig, Katrin Heinze, Hans W. Hüsch, Dierk Liess, Friedemann Loch,
Handbuch Bankaufsichtliches Meldewesen Vorgaben, Datenanforderungen, Umsetzungshinweise Bearbeitet von Eric Freund, Frank Günther, Jens Hennig, Katrin Heinze, Hans W. Hüsch, Dierk Liess, Friedemann Loch,
IT-Aufsicht im Bankensektor Fit für die Bafin-Sonderprüfungen
 IT-Aufsicht im Bankensektor Fit für die Bafin-Sonderprüfungen Rainer Benne Benne Consulting GmbH Audit Research Center ARC-Institute.com 2014 Audit Research Center ARC-Institute.com Referent Berufserfahrung
IT-Aufsicht im Bankensektor Fit für die Bafin-Sonderprüfungen Rainer Benne Benne Consulting GmbH Audit Research Center ARC-Institute.com 2014 Audit Research Center ARC-Institute.com Referent Berufserfahrung
Integrierte und digitale Managementsysteme
 MEET SWISS INFOSEC! 23. Juni 2016 Integrierte und digitale Managementsysteme Besfort Kuqi, Senior Consultant, Swiss Infosec AG Managementsysteme im Trendwechsel Integration Digitalisierung [Wieder]herstellung
MEET SWISS INFOSEC! 23. Juni 2016 Integrierte und digitale Managementsysteme Besfort Kuqi, Senior Consultant, Swiss Infosec AG Managementsysteme im Trendwechsel Integration Digitalisierung [Wieder]herstellung
Kreditreporting und Kreditrisikostrategie
 Kreditreporting und Kreditrisikostrategie Zentrale Werkzeuge einer modernen Risikosteuerung Herausgegeben von Axel Becker Mit Beiträgen von Hubert Barth Hubertus Genau Christian Schnabel ERICH SCHMIdtVERlAG
Kreditreporting und Kreditrisikostrategie Zentrale Werkzeuge einer modernen Risikosteuerung Herausgegeben von Axel Becker Mit Beiträgen von Hubert Barth Hubertus Genau Christian Schnabel ERICH SCHMIdtVERlAG
Mindestanforderungen an das Risikomanagement
 MaRisk 10/2012 (BA) Mindestanforderungen an das Risikomanagement Aufstellung der betroffenen Reglungsbereiche zur Umsetzung 1 1 Die Unterlage erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und enthält einzelne
MaRisk 10/2012 (BA) Mindestanforderungen an das Risikomanagement Aufstellung der betroffenen Reglungsbereiche zur Umsetzung 1 1 Die Unterlage erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und enthält einzelne
Martin Fröhlich I Kurt Glasner (Hrsg.) IT Governance. Leitfaden für eine praxisgerechte Implementierung GABLER
 Martin Fröhlich I Kurt Glasner (Hrsg.) IT Governance Leitfaden für eine praxisgerechte Implementierung GABLER Vorwort 5 Abbildungsverzeichnis 11 Abkürzungsverzeichnis 15 Einleitung 17 I. Grundlagen 23
Martin Fröhlich I Kurt Glasner (Hrsg.) IT Governance Leitfaden für eine praxisgerechte Implementierung GABLER Vorwort 5 Abbildungsverzeichnis 11 Abkürzungsverzeichnis 15 Einleitung 17 I. Grundlagen 23
Erfahrung aus SOA (SOX) Projekten. CISA 16. Februar 2005 Anuschka Küng, Partnerin Acons AG
 Erfahrung aus SOA (SOX) Projekten CISA 16. Februar 2005 Anuschka Küng, Partnerin Acons AG Inhaltsverzeichnis Schwachstellen des IKS in der finanziellen Berichterstattung Der Sarbanes Oxley Act (SOA) Die
Erfahrung aus SOA (SOX) Projekten CISA 16. Februar 2005 Anuschka Küng, Partnerin Acons AG Inhaltsverzeichnis Schwachstellen des IKS in der finanziellen Berichterstattung Der Sarbanes Oxley Act (SOA) Die
Das Konzept des Chief Information Officer (CIO). Bedeutung aus der Sicht von Wissenschaft und Praxis
 Wirtschaft Christian Bauer Das Konzept des Chief Information Officer (CIO). Bedeutung aus der Sicht von Wissenschaft und Praxis Diplomarbeit Das Konzept des Chief Information Officer (CIO) - Bedeutung
Wirtschaft Christian Bauer Das Konzept des Chief Information Officer (CIO). Bedeutung aus der Sicht von Wissenschaft und Praxis Diplomarbeit Das Konzept des Chief Information Officer (CIO) - Bedeutung
Datenmanagement als Kernfunktion in der Risikosteuerung von Kreditinstituten. Frankfurt, 30. März 2017, Michael Speth Risikovorstand DZ BANK
 Datenmanagement als Kernfunktion in der Risikosteuerung von Kreditinstituten Frankfurt, 30. März 2017, Michael Speth Risikovorstand DZ BANK Agenda 1. DZ BANK Gruppe 2. Ausgangslage 3. 4. Zusammenfassung
Datenmanagement als Kernfunktion in der Risikosteuerung von Kreditinstituten Frankfurt, 30. März 2017, Michael Speth Risikovorstand DZ BANK Agenda 1. DZ BANK Gruppe 2. Ausgangslage 3. 4. Zusammenfassung
Dirk Brechfeld Max Weber. MaSan. Leitfaden zur Erstellung von Sanierungsplänen
 Dirk Brechfeld Max Weber MaSan Leitfaden zur Erstellung von Sanierungsplänen Dirk Brechfeld / Max Weber MaSan Leitfaden zur Erstellung von Sanierungsplänen unter Mitarbeit von Francesca Parrotta 2018
Dirk Brechfeld Max Weber MaSan Leitfaden zur Erstellung von Sanierungsplänen Dirk Brechfeld / Max Weber MaSan Leitfaden zur Erstellung von Sanierungsplänen unter Mitarbeit von Francesca Parrotta 2018
3. TriSolutions Thementag
 Perspektiven aus der Gesamtbanksteuerung für Leasing-Unternehmen 3. TriSolutions Thementag Dr. Peter Bartetzky und Stefan Hoppe Frankfurt, den 29. September 2015 TriSolutions GmbH Gesamtbanksteuerung für
Perspektiven aus der Gesamtbanksteuerung für Leasing-Unternehmen 3. TriSolutions Thementag Dr. Peter Bartetzky und Stefan Hoppe Frankfurt, den 29. September 2015 TriSolutions GmbH Gesamtbanksteuerung für
Prüfungsansatz der Deutschen Bundesbank im europäischen Umfeld inkl. Cyber-Risiken
 Prüfungsansatz der Deutschen Bundesbank im europäischen Umfeld inkl. Cyber-Risiken joerg.bretz@bundesbank.de Informationsveranstaltung: IT-Aufsicht bei Banken Bonn, 07.10.2015 Jörg Bretz seit 1989 bei
Prüfungsansatz der Deutschen Bundesbank im europäischen Umfeld inkl. Cyber-Risiken joerg.bretz@bundesbank.de Informationsveranstaltung: IT-Aufsicht bei Banken Bonn, 07.10.2015 Jörg Bretz seit 1989 bei
Inhaltsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis IX XI XVII XIX XXI 1 Einleitung 1 1.1 Problemstellung 1 1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis IX XI XVII XIX XXI 1 Einleitung 1 1.1 Problemstellung 1 1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
Mit Business Process Management zur kontinuierlichen Verbesserung BPM-Suite BIC Cloud
 Mit Business Process Management zur kontinuierlichen Verbesserung BPM-Suite BIC Cloud Be better than you were yesterday. Mit Business Process Management zur kontinuierlichen Verbesserung Geschäftsprozesse
Mit Business Process Management zur kontinuierlichen Verbesserung BPM-Suite BIC Cloud Be better than you were yesterday. Mit Business Process Management zur kontinuierlichen Verbesserung Geschäftsprozesse
Einheitlicher Aufsichtsmechanismus (SSM) Wesentliche Bestandteile und Ziele. Jukka Vesala Director General, Micro-Prudential Supervision III
 Einheitlicher Aufsichtsmechanismus (SSM) Wesentliche Bestandteile und Ziele Jukka Vesala Director General, Micro-Prudential Supervision III Frankfurt, 22. Mai 2015 Aufbau des SSMs Der SSM als einheitliches,
Einheitlicher Aufsichtsmechanismus (SSM) Wesentliche Bestandteile und Ziele Jukka Vesala Director General, Micro-Prudential Supervision III Frankfurt, 22. Mai 2015 Aufbau des SSMs Der SSM als einheitliches,
Konzernsteuerungssysteme Revision IKS - Compliance
 Konzernsteuerungssysteme Revision IKS - Compliance Mag. Andrea Rockenbauer Dipl. IR CRMA Leiterin Konzernrevision Linz: 19.07.2016 Im Prüfungsausschuss Dezember 2014 berichtete Steuerungsinstrumente und
Konzernsteuerungssysteme Revision IKS - Compliance Mag. Andrea Rockenbauer Dipl. IR CRMA Leiterin Konzernrevision Linz: 19.07.2016 Im Prüfungsausschuss Dezember 2014 berichtete Steuerungsinstrumente und
Vorwort... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XV
 IX Inhaltsverzeichnis Vorwort... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XV Teil I: Einordnung und Hintergründe... 1 1 Überblick... 2 2 Internationale Regulierungsinitiativen... 5 2.1 Regulierungsinitiativen
IX Inhaltsverzeichnis Vorwort... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XV Teil I: Einordnung und Hintergründe... 1 1 Überblick... 2 2 Internationale Regulierungsinitiativen... 5 2.1 Regulierungsinitiativen
Sicherheit und Compliance in der Cloud: Regulatorische Anforderungen und Good-Practice Frameworks
 Sicherheit und Compliance in der Cloud: Regulatorische Anforderungen und Good-Practice Frameworks Birgit Eschinger, EY Österreich Mai 2019 Widerstand gegenüber Cloud Computing nimmt ab 2 von 3 Unternehmen
Sicherheit und Compliance in der Cloud: Regulatorische Anforderungen und Good-Practice Frameworks Birgit Eschinger, EY Österreich Mai 2019 Widerstand gegenüber Cloud Computing nimmt ab 2 von 3 Unternehmen
Softwarelösung für den Prozess der IT-Sicherheit. Wie sicher ist Ihre IT?
 Softwarelösung für den Prozess der IT-Sicherheit Wie sicher ist Ihre IT? Stand der IT-Sicherheit Die Möglichkeiten der IT eröffnen immer neue Chancen. Aber hält die Sicherheit den wachsenden Herausforderungen
Softwarelösung für den Prozess der IT-Sicherheit Wie sicher ist Ihre IT? Stand der IT-Sicherheit Die Möglichkeiten der IT eröffnen immer neue Chancen. Aber hält die Sicherheit den wachsenden Herausforderungen
 Rainer Faldey Datenschutzbeauftragter GDDcert. EU Rainer Faldey Dipl. Betriebswirt (FH) Datenschutzbeauftragter GDDcert. EU Datenschutzbeauftragter IHK Mitglied der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit
Rainer Faldey Datenschutzbeauftragter GDDcert. EU Rainer Faldey Dipl. Betriebswirt (FH) Datenschutzbeauftragter GDDcert. EU Datenschutzbeauftragter IHK Mitglied der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit
Mindeststandard des BSI zur Verwendung von Transport Layer Security (TLS)
 Mindeststandard des BSI zur Verwendung von Transport Layer Security (TLS) nach 8 Absatz 1 Satz 1 BSIG Version 2.0 vom 05.04.2019 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Postfach 20 03 63 53133
Mindeststandard des BSI zur Verwendung von Transport Layer Security (TLS) nach 8 Absatz 1 Satz 1 BSIG Version 2.0 vom 05.04.2019 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Postfach 20 03 63 53133
SREP bei weniger bedeutenden Instituten
 SREP bei weniger bedeutenden Instituten Neues SREP-Konzept der Aufsicht, Dr. Sandra Bourbeck, Gliederung Was sind weniger bedeutende Institute? Entwicklung von Standards für LSI im Rahmen des SSM RAS/SREP
SREP bei weniger bedeutenden Instituten Neues SREP-Konzept der Aufsicht, Dr. Sandra Bourbeck, Gliederung Was sind weniger bedeutende Institute? Entwicklung von Standards für LSI im Rahmen des SSM RAS/SREP
_isms_27001_fnd_de_sample_set01_v2, Gruppe A
 1) Wodurch zeichnet sich ein führungsstarkes Top-Management im Zusammenhang mit einem ISMS aus? a) Klares Bekenntnis zu Informationssicherheitszielen (100%) b) Beurteilung aller Informationssicherheitsrisiken
1) Wodurch zeichnet sich ein führungsstarkes Top-Management im Zusammenhang mit einem ISMS aus? a) Klares Bekenntnis zu Informationssicherheitszielen (100%) b) Beurteilung aller Informationssicherheitsrisiken
_isms_27001_fnd_de_sample_set01_v2, Gruppe A
 1) Welche Eigenschaften von Informationen sollen im Rahmen der Informationssicherheit aufrechterhalten werden? a) Vertraulichkeit (100%) b) Unverletzbarkeit (0%) c) Integrität (100%) 2) Was muss eine Organisation
1) Welche Eigenschaften von Informationen sollen im Rahmen der Informationssicherheit aufrechterhalten werden? a) Vertraulichkeit (100%) b) Unverletzbarkeit (0%) c) Integrität (100%) 2) Was muss eine Organisation
Leitlinie für die Informationssicherheit
 Informationssicherheit Flughafen Köln/Bonn GmbH Leitlinie für die Informationssicherheit ISMS Dokumentation Dokumentenname Kurzzeichen Leitlinie für die Informationssicherheit ISMS-1-1-D Revision 2.0 Autor
Informationssicherheit Flughafen Köln/Bonn GmbH Leitlinie für die Informationssicherheit ISMS Dokumentation Dokumentenname Kurzzeichen Leitlinie für die Informationssicherheit ISMS-1-1-D Revision 2.0 Autor
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan)
 Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
Die Datenschutz-Grundverordnung Auswirkungen auf die Praxis
 Auswirkungen auf die Praxis SPEAKER Steffen Niesel Fachanwalt für IT-Recht Ulf Riechen Dipl.-Ing. für Informationstechnik 2 Einleitung Wann tritt die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in Kraft? 25. Mai
Auswirkungen auf die Praxis SPEAKER Steffen Niesel Fachanwalt für IT-Recht Ulf Riechen Dipl.-Ing. für Informationstechnik 2 Einleitung Wann tritt die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in Kraft? 25. Mai
Neue Herausforderungen durch die 5. MaRisk-Novelle
 Frühbucherpreis bis zum 15. Dezember 2017 Tagung Neue Herausforderungen durch die 5. MaRisk-Novelle Erste Praxiserfahrungen mit der Umsetzung der Anforderungen 16. Januar 2018 in 7 Stunden CPE Die Themen:
Frühbucherpreis bis zum 15. Dezember 2017 Tagung Neue Herausforderungen durch die 5. MaRisk-Novelle Erste Praxiserfahrungen mit der Umsetzung der Anforderungen 16. Januar 2018 in 7 Stunden CPE Die Themen:
Management- Handbuch. Entwicklung, Produktion, Dienstleistung und Vertrieb. DIN EN ISO 9001:2015. Auflage 1.1
 Management- Handbuch Entwicklung, Produktion, Dienstleistung und Vertrieb. Auflage 1.1 Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungsbereich... 5 2 Normative Verweisungen... 5 3 Begriffe (siehe Punkt 11)... 5 4 Kontext
Management- Handbuch Entwicklung, Produktion, Dienstleistung und Vertrieb. Auflage 1.1 Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungsbereich... 5 2 Normative Verweisungen... 5 3 Begriffe (siehe Punkt 11)... 5 4 Kontext
Die neue EU-Datenschutz- Grundverordnung EU-DSGVO
 Die neue EU-Datenschutz- Grundverordnung EU-DSGVO Agenda Kurzvorstellung Verimax Einführung in die neue Datenschutzgesetzgebung Überblick über Ihre zukünftigen Aufgaben Methoden und Ansätze zur Umsetzung
Die neue EU-Datenschutz- Grundverordnung EU-DSGVO Agenda Kurzvorstellung Verimax Einführung in die neue Datenschutzgesetzgebung Überblick über Ihre zukünftigen Aufgaben Methoden und Ansätze zur Umsetzung
Einladung. Internal Capital Adequacy Assessment Process Basel II Reloaded. In Kooperation mit
 Einladung Internal Capital Adequacy Assessment Process Basel II Reloaded In Kooperation mit Datum Ort Zielgruppen Podiumsdiskussion mit Impulsreferaten Mittwoch, 27. Mai 2009, 18.00 20.00 Uhr Vienna Marriott
Einladung Internal Capital Adequacy Assessment Process Basel II Reloaded In Kooperation mit Datum Ort Zielgruppen Podiumsdiskussion mit Impulsreferaten Mittwoch, 27. Mai 2009, 18.00 20.00 Uhr Vienna Marriott
