Landwirtschaft CROSS COMPLIANCE Informationen über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen
|
|
|
- Adrian Beltz
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Landwirtschaft CROSS COMPLIANCE 2016 Informationen über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen
2 Impressum Herausgeber: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Henning-von-Tresckow- Straße 2-13, Haus S Potsdam pressestelle@mlul.brandenburg.de Fachliche Koordination: Referat EU-Zahlstelle EGFL und ELER, Bescheinigungsbehörde EMFF, Cross-Compliance- und InVeKoS-Koordinierung Stand: März 2016 Hinweis: Diese Broschüre wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft herausgegeben. Sie darf nicht während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Unabhängig davon, wann, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
3 1 Informationsbroschüre über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei Cross Compliance 2016 Redaktionsschluss: März 2016 Diese Broschüre informiert allgemein über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei Cross Compliance und ersetzt nicht eine gründliche Auseinandersetzung mit den aktuellen, für jeden Betrieb verbindlichen Rechtsvorschriften. Empfänger von Direktzahlungen (Ausnahme: Teilnehmer an der sog. Kleinerzeuger-Regelung) und von Umstrukturierungs- und Umstellungsbeihilfen im Weinbereich sind verpflichtet, sich über gegebenenfalls eintretende Rechtsänderungen nach Redaktionsschluss und damit verbundenen Änderungen der Verpflichtungen zu informieren. Entsprechende Informationen werden über die jeweilige landwirtschaftliche Fachpresse und über das Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion - ISIP ( - zur Verfügung gestellt. Im Internetportal ISIP ist auch die jeweils aktuelle Liste der für die Region Brandenburg-Berlin landwirtschaftlichen Betriebsberater/innen veröffentlicht. Auch für Begünstigte bestimmter flächenbezogener Maßnahmen des ländlichen Raums gelten die Cross-Compliance-Verpflichtungen einschließlich der Pflicht, sich über ggf. eintretende Änderungen zu informieren.
4 2 Inhalt I EINLEITUNG 5 II ERHALTUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER FLÄCHEN IN GUTEM LANDWIRTSCHAFTLICHEN UND ÖKOLOGISCHEN ZUSTAND (GLÖZ) 8 1 Einhaltung Genehmigungsverfahren für die Verwendung von Wasser zur Bewässerung (GLÖZ 2) 8 2 Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung (GLÖZ 3) 8 3 Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung (GLÖZ 4) 10 4 Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion (GLÖZ 5) 12 5 Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden (GLÖZ 6) 14 6 Keine Beseitigung von Landschaftselementen (GLÖZ 7) 14 III DAUERGRÜNLANDERHALTUNG 17 1 Definition von Dauergrünland 17 2 Regelungen zum Erhalt des Dauergrünlandes 17 IV GRUNDANFORDERUNGEN AN DIE BETRIEBSFÜHRUNG 18 1 Nitratrichtlinie (GAB 1) Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, Silage und Silagesickersäften 22 2 Vogelschutzrichtlinie (GAB 2) 23 3 FFH-Richtlinie (GAB 3) 26 4 Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit (GAB 4) Vorgaben zur Futtermittelsicherheit Produktion sicherer Futtermittel Information der Behörden, Rückruf und Rücknahme von Futtermitteln Rückverfolgbarkeit Anforderungen an die Futtermittelhygiene Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit Produktion sicherer Lebensmittel Information der Behörden, Rückruf und Rücknahme von Lebensmitteln Rückverfolgbarkeit Anforderungen an die Lebensmittelhygiene Milcherzeugung Eiererzeugung 34
5 5 Richtlinie über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe in der tierischen Erzeugung (GAB 5) Regelungen zur Tierkennzeichnung und registrierung (GAB 6, 7 und 8) Registrierung von Betrieben mit Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen Kennzeichnung und Registrierung von Tieren Rinder Ohrmarken Bestandsregister Zentrale Datenbank Schweine Ohrmarken Bestandsregister Schafe und Ziegen Kennzeichnung Bestandsregister Meldungen an die HI-Tier-Datenbank Begleitpapier 49 7 TSE-Krankheiten (GAB 9) Verfütterungsverbot Verfütterungsverbote bestimmter Futtermittel Generelle Ausnahmen vom Verfütterungsverbot Behördliche Ausnahmen vom Verfütterungsverbot TSE (BSE und Scrapie) Meldung Weitere Tierhalterpflichten 54 8 Regelungen zum Pflanzenschutz (GAB 10) Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen Anwendungsverbote und -beschränkungen Bienenschutz Aufzeichnungspflicht 58 9 Tierschutz (GAB 11, 12 und 13) Regelungen über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (GAB 13) Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern (GAB 11) Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen (GAB 12) 67 V KONTROLL- UND SANKTIONSSYSTEM 72 1 Kontrolle Systematische Kontrolle Weitere Kontrollen (Cross Checks) 72 2 Bewertung eines Verstoßes gegen die Cross-Compliance-Vorschriften 72 3 Höhe der Verwaltungssanktion 74
6 VI ANLAGEN 77 4 Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) 77 Listen der Stofffamilien und Stoffgruppen gemäß Anlage 1 der Agrarzahlungen- Verpflichtungenverordnung 79 4 Musterformular Nährstoffvergleich 81 5 Musterformular für mehrjährigen betrieblichen Nährstoffvergleich 83 6 Behörden für die Registrierung von Betrieben (mit Tierhaltung) 84 7 Regionalstellen 85 8 Zuständige Behörden für Ausnahmen gem. Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 (Verfütterungsverbot) 89 9 Anforderungen an die Rohmilch Wesen, Weiterverbreitung und das klinische Erscheinungsbild von Transmissiblen Spongioformen Enzephalopathien (TSE) Eingriffe bei Tieren - Amputationsverbot Eingriffe bei Tieren Betäubung 95 VII GLOSSAR 96 1 Begriffsbestimmungen 96 2 Relevante Rechtsvorschriften 99
7 5 I EINLEITUNG Die Gewährung von Agrarzahlungen ist gemäß der Verordnung (EU) Nr.1306/ auch an die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Umweltschutz, Klimawandel, guter landwirtschaftlicher Zustand der Flächen, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz geknüpft. Diese Verknüpfung wird als Cross Compliance bezeichnet. Die Cross- Compliance-Regelungen umfassen: Sieben Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) und, 13 Regelungen zu den Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB); diese Fachrechts-Regelungen bestehen auch unabhängig von Cross Compliance. Die Cross-Compliance-Regelungen gehen von einem gesamtbetrieblichen Ansatz aus. Dies bedeutet, dass ein Betrieb, der Cross Compliance relevante Zahlungen erhält, in allen Produktionsbereichen (z. B. Ackerbau, Viehhaltung, Gewächshäuser, Sonderkulturen) und allen seinen Betriebsstätten die Cross-Compliance-Verpflichtungen einhalten muss. Dabei ist es unerheblich, in welchem Umfang Flächen oder Betriebszweige bei der Berechnung der Zahlungen berücksichtigt wurden. Die im Rahmen von Cross Compliance zu beachtenden Verpflichtungen beziehen sich auf Maßnahmen, die im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit oder auf den landwirtschaftlichen Flächen (siehe Glossar) des Betriebes bzw. bei Beantragung bestimmter flächenbezogener Maßnahmen des ländlichen Raums auch auf forstwirtschaftlichen Flächen ausgeführt werden. Verstöße gegen diese Vorschriften führen zu einer Kürzung folgender Zahlungen (Cross Compliance relevante Zahlungen): Direktzahlungen: - Basisprämie - Greeningprämie - Umverteilungsprämie - Junglandwirteprämie - Rückerstattung Haushaltsdisziplin. Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes: - Ausgleichszahlungen für aus naturbedingten oder anderen Gründen benachteiligte Gebiete - Ökologischer/biologischer Landbau - Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und im Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) - Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen.
8 6 Die wichtigsten Durchführungsbestimmungen zu den Cross-Compliance-Verpflichtungen ergeben sich aus der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/20142 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/ Im Rahmen von Cross Compliance sind über die Fachgesetze hinaus das Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz 4 sowie die Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung 5 einschlägig. Cross Compliance ersetzt nicht das deutsche Fachrecht. Deshalb sind neben den dargestellten Cross-Compliance-Verpflichtungen die Fachrechts- Verpflichtungen auch weiterhin einzuhalten, selbst wenn sie die Cross-Compliance-Anforderungen übersteigen. Ahndungen nach dem Fachrecht (Ordnungswidrigkeiten) erfolgen unabhängig von Kürzungen und Ausschlüssen bei Verstößen im Rahmen von Cross Compliance. Verstöße gegen das deutsche Fachrecht lösen nur dann eine Kürzung der EU-Zahlungen aus, wenn gleichzeitig auch gegen die Cross-Compliance- Verpflichtungen verstoßen wird. Wichtige Änderungen bei Cross Compliance im Jahr 2016 Erhaltung von Dauergrünland Die Verpflichtung zum Erhalt des Dauergrünlandes galt bei Cross Compliance letztmalig im Jahr Danach wurde sie durch die Greening-Vorschriften abgelöst. Im Jahr 2016 müssen die Mitgliedstaaten im Rahmen von Cross Compliance allerdings noch Kontrollen im Hinblick darauf durchführen, ob die bisherigen Verpflichtungen beachtet wurden. Geräte zum Ausbringen von Düngemitteln Die Übergangsfrist für Geräte zum Ausbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln, die bis zum 14. Januar 2006 in Betrieb genommen wurden, gilt seit dem 1. Januar 2016 nicht mehr. Daher ist das Ausbringen mit nachfolgend aufgeführten Geräten verboten: Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr zum Verteiler, Güllewagen und Jauchewagen mit freiem Auslauf auf den Verteiler, zentrale Prallverteiler, mit denen nach oben abgestrahlt wird, Güllewagen mit senkrecht angeordneter, offener Schleuderscheibe als Verteiler zur Ausbringung von unverdünnter Gülle und Drehstrahlregner zur Verregnung von unverdünnter Gülle.
9 7 Frühwarnsystem Wie im Kapitel V beschrieben, kann in begründeten Einzelfällen bei Verstößen von geringer Schwere, begrenztem Ausmaß und geringer Dauer von einer Sanktionierung abgesehen und eine Verwarnung ausgesprochen werden. Es ist zu beachten, dass eine solche Verwarnung innerhalb eines Zeitraumes von drei Kalenderjahren bei einem Begünstigten nur einmal je Anforderung oder Standard zur Anwendung kommen darf.
10 8 II ERHALTUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER FLÄCHEN IN GUTEM LANDWIRTSCHAFTLICHEN UND ÖKOLOGISCHEN ZUSTAND (GLÖZ) Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung) Die Grundsätze der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand sind in der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung geregelt. Damit kommt Deutschland der Verpflichtung nach, konkrete Anforderungen zu den Standards Einhaltung der Genehmigungsverfahren für die Verwendung von Wasser zur Bewässerung, Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung, Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung, Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion, Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden sowie Keine Beseitigung von Landschaftselementen vorzuschreiben. Die entsprechenden Vorgaben zur Schaffung von Pufferzonen entlang von Wasserläufen werden bereits über die Nitratrichtlinie (GAB 1) erfüllt. Zusätzliche Verpflichtungen im Rahmen des o.g. Standards (GLÖZ 1) sind daher nicht erforderlich. Folgende Anforderungen sind in der Verordnung geregelt: 1 Einhaltung Genehmigungsverfahren für die Verwendung von Wasser zur Bewässerung (GLÖZ 2) Entnimmt der Betriebsinhaber aus Grund- oder Oberflächengewässern Wasser zur Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen, benötigt er hierfür eine wasserrechtliche Bewilligung oder Erlaubnis der zuständigen Behörden (in Brandenburg der örtlich zuständige Landkreis/die kreisfreie Stadt als Untere Wasserbehörde. In Berlin bezüglich der Erlaubnis zur Entnahme aus Gewässern 1. Ordnung (schiffbare Gewässer) sowie aus Fließgewässern 2. Ordnung von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Für die stehenden Gewässern 2. Ordnung von dem jeweiligen Bezirksamt).Diese Bewilligungen oder Erlaubnisse können auch für Gemeinschaften (z.b. Bewässerungsverband) erteilt werden. 2 Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung (GLÖZ 3) Einleiten und Einbringen gefährlicher Stoffe in das Grundwasser Das Einleiten und Einbringen von Stoffen (z.b. über Leitungen oder Sickerschächte) der Liste I oder II aus Anlage 1 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (siehe Anlage 2 dieser Bro-
11 9 schüre) ist grundsätzlich nicht erlaubt. Stoffe der Liste II können in Ausnahmefällen eingeleitet oder eingebracht werden, wenn dies wasserrechtlich erlaubt worden ist. In den Listen I und II sind Stoffe, Stofffamilien und Stoffgruppen genannt, die als schädlich für das Grundwasser gelten. Zur Vermeidung von Einleitungen und Einbringungen in das Grundwasser sind diese Stoffe auf dem landwirtschaftlichen Betrieb so zu handhaben, dass eine Grundwassergefährdung nicht zu besorgen ist. In der Regel ist eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen, wenn die Vorgaben zum Umgang mit Mineralölprodukten, Pflanzenschutzmitteln, Desinfektionsbädern, Silage und Festmist gemäß 4 Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung eingehalten werden. Im Folgenden werden allgemein die entsprechenden Vorgaben erläutert: Umgang mit Mineralölprodukten (z.b. Treibstoffe, Schmierstoffe), Pflanzenschutzmitteln und Desinfektionsbädern für landwirtschaftliche Nutztiere Im Allgemeinen sind in landwirtschaftlichen Betrieben Mineralölprodukte und bestimmte chemische Pflanzenschutzmittel sowie gegebenenfalls auch Biozide (z.b. Mittel zur Behandlung von Schafen in Desinfektionsbädern) betroffen. Die Handhabung, die Lagerung und die Beseitigung dieser Stoffe dürfen nicht dazu führen, dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit zu besorgen ist. Anlagen zum Umgang mit diesen Stoffen dürfen nur durch Fachbetriebe errichtet werden und müssen durch Sachverständige überprüft werden. Anlagen zum Lagern flüssiger wassergefährdender Stoffe benötigen in der Regel einen Auffangraum, Anlagen zum Lagern fester wassergefährdender Stoffe müssen so beschaffen sein, dass kein Niederschlagswasser an das Lagergut heran kommen kann. Im Landesrecht sind die Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im 20 Brandenburgisches Wassergesetz 6 (Anzeigepflicht der Errichtung von Anlagen) und in der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) 7 umgesetzt. Die ordnungsgemäße Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln stellt keinen Verstoß gegen die Bestimmungen des 4 Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung dar. Lagerung von Silage und Festmist in nicht-ortsfesten Anlagen Grundvoraussetzung ist, dass durch die Lagerung von Silage oder Festmist in nicht-ortsfesten Anlagen eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Ferner sind Silage oder Festmist nur auf landwirtschaftlichen Flächen zu lagern. Das sind auch Flächen, die zwar aus der Erzeugung genommen worden sind, auf denen aber eine landwirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von 2 Direktzahlungen-Durchführungsverordnung stattfindet. Gemäß 48 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz dürfen Stoffe nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Festmist enthält Stoffe, die geeignet sind, das Grundwasser nachteilig zu verändern. Diese Stoffe
12 10 können aus dem Festmist austreten bzw. bei Niederschlag ausgewaschen werden. Bei unsachgemäßer Lagerung kann es dadurch zur Verschmutzung des Grund- und Oberflächenwassers kommen. Deshalb ist die Feldrandzwischenlagerung keine Alternative zur ortsfesten Lagerung des Mistes und entbindet nicht von der Verpflichtung für alle Betriebe, in denen Festmist anfällt, wasserundurchlässig befestigte Anlagen bzw. Lagerflächen mit entsprechender Lagerkapazität und ausreichend bemessener Jauchegrube entsprechend den geltenden wasserrechtlichen Vorschriften zu errichten. Nähere Informationen enthält das Merkblatt zu den Anforderungen an die Feldrandzwischenlagerung von Festmist. 8 Festmist in nicht-ortsfesten Anlagen darf nicht länger als sechs Monate gelagert werden. Der Lagerplatz, auf dem der Festmist auf landwirtschaftlichen Flächen gelagert wird, ist jährlich zu wechseln. Sollte die Lagerfläche von wasserrechtlichen Vorgaben betroffen sein (Wasserschutzgebietsverordnungen oder besondere behördliche Anordnungen) so müssen diese bei der Lagerung eingehalten werden. Damit von Feldrandsilos keine Gewässerverunreinigung ausgeht, sollten die Hinweise des Merkblatts Anforderungen an die Errichtung und Nutzung von Feldrandsilos beachtet werden. 9 In Zweifelsfällen (ob etwa ein Standort geeignet ist), wenden Sie sich bitte an die regional zuständige Untere Wasserbehörde. 3 Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung (GLÖZ 4) Dieser Standard betrifft aus der Erzeugung genommenes Ackerland, das durch den Betriebsinhaber als im Umweltinteresse genutzte Fläche (sog. ökologische Vorrangfläche oder ÖVF) ausgewiesen ist, sowie sonstiges brachliegendes und stillgelegtes Acker- und Dauergrünland. Die Flächen sind im Agrarförderantrag 2015 im Nutzungsnachweis (Anlage 1 zum Antrag) anzugeben. Darüber hinaus werden Anforderungen an Winterkulturen, Zwischenfrüchte und Begrünungen (Gründecke) als ökologische Vorrangflächen definiert. Anforderungen an ökologische Vorrangfläche ÖVF auf Ackerland und sonstiges brachliegendes oder stillgelegtes Ackerland Brachliegendes und stillgelegtes Ackerland inkl. ÖVF sind der Selbstbegrünung zu überlassen oder durch eine gezielte Ansaat zu begrünen. Ein Umbruch mit unverzüglich folgender Ansaat ist zu Pflegezwecken oder zur Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) außerhalb des Zeitraums 1. April bis 30. Juni zulässig.
13 11 Ein Umbruch innerhalb dieses Zeitraums ist nur dann möglich, wenn der Betriebsinhaber zur Anlage von ein- oder mehrjährigen Blühflächen im Rahmen von AUKM verpflichtet ist und dieser Verpflichtung durch Neuansaat während dieses Zeitraums nachkommen muss. Pflanzenschutzmittel dürfen auf den genannten Ackerflächen nicht angewendet werden. Diese Verpflichtungen enden auf ökologischen Vorrangflächen frühestens nach dem 31. Juli des Antragjahres, wenn eine Aussaat oder Pflanzung, die nicht vor Ablauf dieses Antragsjahres zur Ernte führt, vorbereitet und durchgeführt wird. Auf sonstigem brachliegendem oder stillgelegtem Ackerland enden die Verpflichtungen mit dem Zeitpunkt, zu dem das Ackerland wieder in die Erzeugung genommen wird. Geschieht dies nach Antragstellung, ist diese Veränderung gemäß 30 Absatz 2 der InVeKoSV dem zuständigen Amt für Landwirtschaft unverzüglich, mindestens drei Tage vorher, schriftlich anzuzeigen. Hiervon abweichende Vorschriften des Bundes oder der Länder auf dem Gebiet des Naturschutzes oder des Wasserhaushalts bleiben unberührt.
14 12 Anforderungen an ökologische Vorrangfläche ÖVF auf Ackerland, sonstiges brachliegendes oder stillgelegtes Ackerland sowie Brachliegendes und stillgelegtes Dauergrünland (inkl. ÖVF) Im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni ist das Mähen oder Zerkleinern des Aufwuchses auf brachliegendem oder stillgelegtem Acker- und Dauergrünland inkl. ÖVF verboten. Eine Nutzung des Aufwuchses von stillgelegten Flächen, die nicht als ökologische Vorrangflächen ausgewiesen sind, ist nach schriftlicher Anzeige möglich. Die Nutzung des Aufwuchses ist dem zuständigen Amt für Landwirtschaft mindestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Sofern die Aufnahme der Nutzung innerhalb der Sperrfrist vom 1. April bis zum 30. Juni erfolgt, ist außerdem das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) - der zentrale technische Prüfdienst des LELF zu informieren. Anforderungen an Winterkulturen, Zwischenfrüchte und Begrünungen, die als ökologische Vorrangflächen ausgewiesen sind Zwischenfrüchte und Begrünungen (inkl. Untersaat von Gras in Hauptkultur), die gem. Artikel 46 Abs. 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 i.v.m. 18 Abs. 3 DirektZahlDurchfG als ökologische Vorrangflächen ausgewiesen sind, sowie Winterkulturen und Winterzwischenfrüchte die gem. 18 Abs. 4 DirektZahlDurchfG nach Beendigung des Anbaus stickstoffbindender Pflanzen im Rahmen von ökologischen Vorrangflächen angebaut werden, müssen ab der Ansaat bis zum 15. Februar des auf das Antragsjahr folgenden Jahres auf der Fläche belassen werden. Das Beweiden und das Walzen, Schlegeln oder Häckseln der Grasuntersaat oder der genannten Zwischenfrüchte zur Vermeidung der Samenbildung auf den betreffenden Flächen ist zulässig. 4 Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion (GLÖZ 5) Die Mindestanforderungen zur Begrenzung von Erosion richten sich nach dem Grad der Wasseroder Winderosionsgefährdung der landwirtschaftlichen Flächen. Nach der Cross-Compliance Erosionseinstufungsverordnung vom 28. Oktober 2015 (GVBl. II Nummer 53) werden die landwirtschaftlichen Flächen, in Brandenburg die Feldblöcke, bestimmten Erosionsgefährdungsklassen zugeordnet. Auch für Berlin werden ebenso die Erosionsgefährdungsklassen den Feldblöcken zugeordnet. Die Verordnung ist zum Redaktionsschluss noch nicht in Kraft gesetzt. Im Feldblockkataster GIS InVeKoS Land Brandenburg wird die Gefährdungseinstufung jedes Feldblockes verbindlich im Internet bekanntgegeben. Mittels der Antragssoftware profil inet Brandenburg können diese Daten ebenfalls heruntergeladen und zur Anzeige gebracht werden
15 13 Jeder Internetnutzer kann die Gefährdungseinstufung der Feldblöcke unter folgendem Link einsehen: Ackerflächen, die der Wassererosionsstufe CC Wasser1 zugewiesen und nicht in eine besondere Fördermaßnahme zum Erosionsschutz einbezogen sind, dürfen vom 1. Dezember bis zum Ablauf des 15. Februar nicht gepflügt werden. Das Pflügen nach der Ernte der Vorfrucht ist nur bei einer Aussaat vor dem 1. Dezember zulässig. Soweit die Bewirtschaftung quer zum Hang erfolgt, gelten diese beiden Einschränkungen des Pflugeinsatzes nicht. Ist eine Ackerfläche der Wassererosionsstufe CC Wasser2 zugewiesen und nicht in eine besondere Fördermaßnahme zum Erosionsschutz einbezogen, darf sie vom 1. Dezember bis zum 15. Februar nicht gepflügt werden. Das Pflügen zwischen dem 16. Februar und dem Ablauf des 30. November ist nur bei einer unmittelbar folgenden Aussaat zulässig. Spätester Zeitpunkt der Aussaat ist der 30. November. Vor der Aussaat von Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr ist das Pflügen verboten. Ist eine Ackerfläche der Winderosionsstufe CC Wind zugewiesen und nicht in eine besondere Fördermaßnahme zum Erosionsschutz einbezogen, darf sie nur bei Aussaat vor dem 1. März gepflügt werden. Abweichend hiervon ist das Pflügen außer bei Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr ab dem 1. März nur bei einer unmittelbar folgenden Aussaat zulässig. Das Verbot des Pflügens bei Reihenkulturen gilt nicht, soweit vor dem 1. Dezember Grünstreifen mit einer Breite von mindestens 2,5 Metern und in einem Abstand von höchstens 100 Metern quer zur Hauptwindrichtung eingesät werden, oder im Falle des Anbaus von Kulturen in Dämmen, soweit die Dämme quer zur Hauptwindrichtung angelegt werden oder falls unmittelbar nach dem Pflügen Jungpflanzen gesetzt werden. Als eingesäte Grünstreifen können auch im Vorjahr nicht umgepflügte Getreidestoppeln gelten, auf denen Ausfallgetreide aufwächst. Die Hauptwindrichtung für Brandenburg (kontrolltechnische Festlegung) ist je nach Jahreszeit die West-Ost oder die Ost-West-Richtung. Deshalb erfolgt eine Bodenbearbeitungsmaßnahme oder die Aussaat dann quer zur Hauptwindrichtung, wenn sie in Nord-Süd oder Süd-Nord-Richtung erfolgt. Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bewirtschaftungsvorgaben genehmigen. Ansprechpartner ist das Referat 42 (Vgl. auch Merkblatt zur Beantragung von Genehmigungen auf Ausnahmen von CC- Verpflichtungen (GLÖZ) im isip).
16 14 5 Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden (GLÖZ 6) Seit dem Jahr 2015 ist das Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern und von Stroh auf Stoppelfeldern die einzige Vorgabe zum Erhalt der organischen Substanz im Boden und zum Schutz der Bodenstruktur im Cross Compliance - Bereich. Die Verpflichtung zur Erstellung der Humusbilanz bzw. der Bodenhumusuntersuchung ist seit 2015 eine Vorgabe im Greeningbereich. Dies entspricht den einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe c Ziffer ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/ Keine Beseitigung von Landschaftselementen (GLÖZ 7) Landschaftselemente erfüllen wichtige Funktionen für den Umwelt- und Naturschutz. Zum Erhalt der Artenvielfalt haben sie in der Agrarlandschaft eine herausragende Bedeutung, weil sie besondere Lebensräume bieten. Gleichzeitig bereichern sie das Landschaftsbild. Folgende Landschaftselemente stehen unter Cross Compliance-Schutz, d.h. es ist daher verboten, diese ganz oder teilweise zu beseitigen: Hecken oder Knicks Definition: Lineare Strukturelemente, die überwiegend mit Gehölzen bewachsen sind und eine Mindestlänge von 10 Metern sowie eine Durchschnittsbreite von bis zu 15 Metern haben. Dabei sind kleinere unbefestigte Unterbrechungen unschädlich. Baumreihen Definition: Mindestens fünf linear angeordnete, nicht landwirtschaftlich genutzte Bäume entlang einer Strecke von mindestens 50 Metern Länge. Somit fallen Obstbäume und Schalenfrüchte nicht unter das Beseitigungsverbot. Feldgehölze mit einer Größe von mindestens 50 Quadratmetern bis höchstens Quadratmetern Definition: Überwiegend mit gehölzartigen Pflanzen bewachsene Flächen, die nicht der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen. Flächen, für die eine Beihilfe zur Aufforstung oder eine Aufforstungsprämie gewährt worden ist, gelten nicht als Feldgehölze. Feuchtgebiete (siehe Glossar) mit einer Größe von höchstens Quadratmetern; folgende Typen: -Biotope, die nach 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) oder weiter gehenden landesrechtlichen Vorschriften geschützt und über die Biotopkartierung erfasst sind.
17 15 -Tümpel, Sölle (in der Regel bestimmte kreisrunde oder ovale Kleingewässer), Dolinen (natürliche, meistens trichterförmige Einstürze oder Mulden) und andere vergleichbare Feuchtgebiete. Einzelbäume Definition: Bäume, die als Naturdenkmale im Sinne des 28 des BNatSchG geschützt sind. Feldraine Definition: überwiegend mit Gras- und krautartigen Pflanzen bewachsene, schmale, lang gestreckte Flächen mit einer Gesamtbreite von mehr als 2 Metern, auf denen keine landwirtschaftliche Erzeugung stattfindet. Sie müssen innerhalb von oder zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen oder an diese angrenzen. Trocken- und Natursteinmauern Definition: Mauern aus mit Erde oder Lehm verfugten oder nicht verfugten Feld- oder Natursteinen von mehr als 5 Metern Länge, die nicht Bestandteil einer Terrasse sind. Lesesteinwälle Definition: Historisch gewachsene Aufschüttungen von Lesesteinen von mehr als 5 Metern Länge. Fels- und Steinriegel sowie naturversteinte Flächen mit einer Größe von höchstens Quadratmetern Definition: Meist natürlich entstandene, überwiegend aus Fels oder Steinen bestehende Flächen, z.b. Felsen oder Felsvorsprünge, die in der landwirtschaftlichen Fläche enthalten sind bzw. direkt an diese angrenzen und somit unmittelbar Teil der landwirtschaftlichen Parzelle sind Terrassen Definition: Von Menschen unter Verwendung von Hilfsmaterialien angelegte, linearvertikale Strukturen in der Agrarlandschaft, die dazu bestimmt sind, die Hangneigung von Nutzflächen zu verringern. Hilfsmaterialien in diesem Sinne können z.b. Gabione und Mauern sein. Trocken- und Natursteinmauern, die zugleich Bestandteil einer Terrasse sind, dürfen nicht beseitigt werden. Derzeit sind in Brandenburg keine CC-relevanten Terrassen bekannt. Bei Feldgehölzen, Feuchtgebieten sowie Fels- und Steinriegeln gilt die Obergrenze von Quadratmetern für jedes einzelne Element, d.h. auf einem Schlag können mehrere Elemente vorkommen, die für sich jeweils die Obergrenze einhalten.
18 16 Für die Landschaftselemente gibt es keine Pflegeverpflichtung. Die ordnungsgemäße Pflege von Landschaftselementen ist keine Beseitigung. Das MLUL kann die Beseitigung eines Landschaftselementes genehmigen. Ferner ist ein Schnittverbot bei Hecken und Bäumen im Zeitraum vom 1. März bis 30. September einzuhalten. Das Schnittverbot richtet sich grundsätzlich nach den fachrechtlichen Bestimmungen des 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und Sätze 2 bis 4 des BNatSchG (ggf. in Verbindung darauf gestütztem Landesrecht) und umfasst somit den Schutzzeitraum der Brut- und Nistzeit. Betroffen sind jedoch nur die Hecken und Bäume, die bereits bei Cross Compliance nicht beseitigt werden dürfen. Damit ist das Cross-Compliance-relevante Schnittverbot bei den o.g. Hecken und Knicks, Bäumen in Baumreihen, Feldgehölzen und Einzelbäumen zu beachten.
19 17 III DAUERGRÜNLANDERHALTUNG 1 Definition von Dauergrünland Für die Anwendung der Regelung gilt folgende Definition von Dauergrünland: Dauergrünland ist eine landwirtschaftliche Fläche, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt wird und seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs war; es können dort auch andere Pflanzenarten wachsen wie Sträucher und/oder Bäume, die abgeweidet werden können, sofern Gras und andere Grünfutterpflanzen weiterhin vorherrschen. Ferner zählen zum Dauergrünland Flächen, die abgeweidet werden können und einen Teil der etablierten lokalen Praktiken darstellen, wo Gras und andere Grünfutterpflanzen traditionell nicht in Weidegebieten vorherrschen. Nach dem Urteil des Europäischer Gerichtshof vom 2.Oktober 2014 (C-47/13) betrifft dies eine Fläche die gegenwärtig und seit mindestens fünf Jahren zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt wird, auch wenn die Fläche in diesem Zeitraum umgepflügt und eine andere als die zuvor dort angebaute Grünfutterpflanzenart eingesät wird. Gras oder andere Grünfutterpflanzen sind alle Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen für Weideland oder Wiesen in dem Mitgliedstaat sind, unabhängig davon, ob die Flächen als Viehweiden genutzt werden. Nicht zur Dauergrünlandfläche gehören Flächen mit Silomais oder Flächen, auf denen Gräsersaatgut erzeugt wird. 2 Regelungen zum Erhalt des Dauergrünlandes Die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 verpflichtet die Mitgliedstaaten Dauergrünland zu erhalten. Seit dem 1. Januar 2015 wird das Dauergrünland grundsätzlich durch das Greening (siehe Glossar) geschützt. In umweltsensiblen Gebieten darf der Betriebsinhaber Dauergrünland weder umwandeln noch pflügen. In den anderen Gebieten braucht er für eine Nutzungsänderung eine Genehmigung der zuständigen Landesstelle. Der Antrag ist beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) Gutshof 7, Paulinenaue im Land Brandenburg zu stellen. Vordrucke können unter folgendem Link heruntergeladen werden: steriums
20 18 Anträge für Flächen in anderen Bundesländern sind bei den dort zuständigen Behörden zu stellen. Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Broschüre des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur Umsetzung der EU-Agrarreform in Deutschland verwiesen (Ausgabe 2015). Hinweise: Naturschutzrechtlich besonders geschützte Lebensraumtypen des Grünlandes der Fauna-Flora-Habitat (FFH-)Richtlinie 10, Lebensräume der Arten, die unter die FFHund Vogelschutz-Richtlinie 11 fallen, sowie weitere naturschutzrechtlich geschützte Flächen dürfen grundsätzlich nicht umgebrochen werden. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an das LELF! Bei der Beantragung von Agrarumweltmaßnahmen können für den jeweiligen Betrieb gesonderte Vorschriften zum Dauergrünlanderhalt gelten. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Bewilligungsbehörde! IV GRUNDANFORDERUNGEN AN DIE BETRIEBSFÜHRUNG 1 Nitratrichtlinie (GAB 1) Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung), in deren Betrieb stickstoffhaltige Düngemittel angewendet werden. Die Vorgaben der Nitratrichtlinie sind in Deutschland durch das Düngegesetz und der Düngeverordnung 12 des Bundes und in Brandenburg durch die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) sowie in Berlin durch die Verordnung über Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagenverordnung) umgesetzt worden. Hinweis: Diese Vorschriften werden derzeit überarbeitet. Da Änderungen möglicherweise noch im Jahr 2016 in Kraft treten können, wird empfohlen, diesbezüglich die Fachpresse zu verfolgen. 1.1 Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln Die Düngeverordnung in der derzeit geltenden Fassung vom 27. Februar 2007 stellt folgende Anforderungen an die Anwendung von Düngemitteln und anderen Stoffen mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff (mehr als 1,5 % Gesamtstickstoff in der Trockenmasse):
21 19 Vor der Ausbringung von organischen Düngemitteln oder organisch-mineralischen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln mit jeweils überwiegend organischen Bestandteilen einschließlich Wirtschaftsdünger ist der Gehalt an Gesamtstickstoff, bei Gülle, Jauche, sonstigen flüssigen organischen Düngemitteln oder Geflügelkot zusätzlich der Gehalt an Ammoniumstickstoff, zu ermitteln. Wenn diese Gehalte nicht aufgrund der Kennzeichnung bekannt sind, sind sie entweder auf Grundlage der Richtwerte für die Untersuchung und Beratung sowie zur fachlichen Umsetzung der Düngeverordnung (Hrg. LVLF, ) zu ermitteln oder durch wissenschaftlich anerkannte Untersuchungen festzustellen. 13 Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff dürfen nur ausgebracht werden, wenn der Boden aufnahmefähig ist. Solche Düngemittel dürfen daher nicht auf überschwemmten, wassergesättigten, durchgängig höher als 5 cm mit Schnee bedeckten oder gefrorenen und im Laufe des Tages nicht oberflächig auftauenden Böden ausgebracht werden. 14 Bei der Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichem Stickstoffgehalt ist ein direkter Eintrag in Oberflächengewässer durch Einhaltung eines ausreichenden Abstands zwischen dem Rand der durch die Streubreite bestimmten Ausbringungsfläche und der Böschungsoberkante zu vermeiden. Dieser Abstand beträgt im Allgemeinen mindestens 3 Meter. Wenn Ausbringungsgeräte verwendet werden, bei denen die Streubreite der Arbeitsbreite entspricht oder die eine Grenzstreueinrichtung haben, beträgt er mindestens 1 Meter. Ferner ist zu vermeiden, dass diese Düngemittel in oberirdische Gewässer abgeschwemmt werden 15. Ausdrücklich geregelt ist die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichem Stickstoffgehalt auf stark geneigten Ackerflächen. Stark geneigte Ackerflächen sind solche, die innerhalb eines Abstands von 20 m zu Gewässern eine durchschnittliche Hangneigung von mehr als 10 % zum Gewässer aufweisen: Innerhalb eines Abstands von 3 m bis zur Böschungsoberkante dürfen keine solchen Düngemittel aufgebracht werden; eine Injektion ist ebenfalls nicht zulässig. Innerhalb eines Bereichs von 3 m bis 10 m zur Böschungsoberkante sind diese Düngemittel durch Anwendung geeigneter Technik direkt in den Boden einzubringen (z.b. Gülleinjektion). Innerhalb des Bereichs von 10 m bis 20 m zur Böschungsoberkante gilt: Auf unbestellten Ackerflächen sind diese Düngemittel sofort einzuarbeiten. Auf bestellten Ackerflächen sind folgende Bedingungen einzuhalten: - Bei Reihenkulturen (Reihenabstand von 45 cm und mehr) sind diese Düngemittel sofort einzuarbeiten, sofern keine entwickelte Untersaat vorhanden ist.
22 20 - Bei allen anderen Kulturen muss eine hinreichende Bestandsentwicklung vorliegen oder - die Fläche muss mit Mulch- oder Direktsaat bestellt worden sein. Für die Ausbringung von Festmist - außer Geflügelkot - auf stark geneigten Flächen gelten innerhalb des Abstands von 20 m zum Gewässer folgende Vorgaben: Innerhalb eines Abstands von 3 m bis zur Böschungsoberkante keine Aufbringung. Innerhalb eines Bereichs von 3 m bis 20 m zur Böschungsoberkante ist Festmist auf unbestellten Ackerflächen sofort einzuarbeiten. Auf bestellten Ackerflächen sind in diesem Bereich folgende Bedingungen einzuhalten: - Bei Reihenkulturen (Reihenabstand von 45 cm und mehr) ist der Festmist sofort einzuarbeiten, sofern keine entwickelte Untersaat vorhanden ist. - Bei allen anderen Kulturen muss eine hinreichende Bestandsentwicklung vorliegen oder - die Fläche muss mit Mulch- oder Direktsaat bestellt worden sein. 16 Im Feldblockkataster GIS InVeKoS Land Brandenburg können die Randstreifen (Pufferzonen) an Oberflächengewässer angezeigt werden. Mittels der Antragssoftware profil inet Brandenburg können diese Daten ebenfalls heruntergeladen und zur Anzeige gebracht werden. Jeder Internetnutzer kann die betroffenen Randstreifen unter folgendem Link einsehen: Wenn auf Ackerland Gülle, Jauche und sonstige flüssige organische sowie organisch-mineralische Düngemittel mit wesentlichen Gehalten an verfügbarem Stickstoff oder Geflügelkot nach Ernte der letzten Hauptfrucht vor dem Winter aufgebracht werden, gilt Folgendes: Gedüngt werden dürfen nur im gleichen Jahr angebaute Folgekulturen, einschließlich Zwischenfrüchte, bis in Höhe des aktuellen Düngebedarfs der Kultur an Stickstoff. Zulässig ist auch eine Ausgleichsdüngung zu auf dem Feld verbliebenem Getreidestroh. Insgesamt darf jedoch nicht mehr als 80 kg Gesamtstickstoff oder 40 kg Ammoniumstickstoff je Hektar aufgebracht werden. 17 Geräte zum Ausbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Das Aufbringen von Stoffen mit nachfolgend aufgeführten Geräten ist seit dem 1. Januar 2016 verboten: Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr zum Verteiler, Güllewagen und Jauchewagen mit freiem Auslauf auf den Verteiler, zentrale Prallverteiler, mit denen nach oben abgestrahlt wird,
23 Güllewagen mit senkrecht angeordneter, offener Schleuderscheibe als Verteiler zur Ausbringung von unverdünnter Gülle und Drehstrahlregner zur Verregnung von unverdünnter Gülle. Düngemittel mit wesentlichem Stickstoffgehalt, ausgenommen Festmist ohne Geflügelkot, dürfen nicht aufgebracht werden auf Ackerland vom 1. November bis 31. Januar und auf Grünland vom 15. November bis 31. Januar. Die zuständige Behörde, das für den Betriebssitz zuständige Amt für Landwirtschaft, kann die genannten Zeiträume verschieben, aber nicht verkürzen. 18 Wer Gülle, Jauche, sonstige flüssige organische oder organisch-mineralische Düngemittel oder Geflügelkot auf unbestelltes Ackerland aufbringt, hat diese gemäß 4 Absatz 2 der Düngeverordnung unverzüglich einzuarbeiten! Unverzügliche Einarbeitung bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Als unverzüglich wird z.b. anerkannt: Direktes einbringen in den Boden oder Einarbeitung parallel zur Aufbringung (im gebrochenen Verfahren, spätestens innerhalb von vier Standen nach Beginn der Aufbringung). Die Broschüre Umsetzung der novellierten Düngeverordnung wurde entsprechend geändert. ng/infos_zu_duenger_vorschr Im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutzten Flächen des Betriebes dürfen auf Ackerund Grünlandflächen pro Hektar nicht mehr als 170 kg Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft aufgebracht werden. Der Stickstoffanfall aus der Weidehaltung ist anzurechnen. 19 Bringt ein Betrieb mehr als 50 kg Stickstoff je Hektar und Jahr auf einer Fläche aus, hat er den Düngebedarf der Kultur festzustellen. Dazu ist der Stickstoffgehalt des Bodens, außer auf Dauergrünlandflächen, mindestens jährlich auf jedem Schlag durch Bodenuntersuchungen zu ermitteln. Alternativ können auch veröffentlichte Untersuchungsergebnisse vergleichbarer Standorte oder länderspezifische Beratungsempfehlungen des LELF genutzt werden. 20 (Hinweis: Bei der Berechnung der Stickstoffobergrenze sind alle landwirtschaftlich genutzten Flächen zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für aus der Produktion genommene Flächen, denen keine Düngemittel zugeführt werden.) Der Betriebsinhaber hat spätestens bis zum 31. März in dem von ihm gewählten und im Vorjahr geendeten Düngejahr einen Nährstoffvergleich für Stickstoff und Phosphat von Zufuhr und Abfuhr (Bilanz) als Flächenbilanz oder aggregierte Einzelschlagbilanz für den Betrieb zu erstellen und aufzuzeichnen. 21 Ausgenommen hiervon sind Flächen, auf denen nur Zierpflanzen angebaut werden, Baumschul-, Rebschul- und Baumobstflächen sowie nicht im Ertrag stehende Dauerkulturflächen des Wein- und Obstbaus, 21
24 22 Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bei einem jährlichen Stickstoffanfall an Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft von bis zu 100 kg je Hektar, wenn keine zusätzliche Stickstoffdüngung erfolgt, Betriebe, die auf keinem Schlag mehr als 50 kg Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr oder 30 kg Phosphat (P 2 O 5 ) je Hektar und Jahr (auch in Form von Abfällen nach Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) düngen, Betriebe, die weniger als 10 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche bewirtschaften (abzüglich der unter den ersten beiden Spiegelstrichen genannten Flächen), höchstens bis zu einem Hektar Gemüse, Hopfen oder Erdbeeren anbauen und einen Nährstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft von nicht mehr als 500 kg Stickstoff aufweisen. Zur Inanspruchnahme dieser letztgenannten Ausnahme müssen alle der drei aufgezählten Punkte erfüllt sein. Die Bilanzen sind nach Vorgabe der Düngeverordnung zu erstellen. 22 Muster sind als Anlagen 4 und 5 dieser Broschüre beigefügt. Hinweis: Zusätzliche Anforderungen bestehen bei der Förderung von Agrarumweltmaßnahmen im Hinblick auf die Düngung mit Phosphat (z.b. Bodenuntersuchungen). Diese entsprechen den einschlägigen Mindestanforderungen für den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie sonstige einschlägige verpflichtende Anforderungen gemäß dem nationalen Recht nach Artikel 28 Abs. 3 und weiterer ELER Förderungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/ Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, Silage und Silagesickersäften Die wesentlichen Anforderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Anlagen für das Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften einschließlich deren Sammel-, Um- und Abfülleinrichtungen müssen bei den zu erwartenden Beanspruchungen dicht, standsicher und gegen die zu erwartenden mechanischen und chemischen Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sein. Ein Ab- bzw. Überlaufen des Lagergutes, dessen Eindringen in das Grundwasser, in oberirdische Gewässer und in die Kanalisation muss zuverlässig verhindert werden. Ortsfeste Anlagen zum Lagern von Festmist/Silage sind mit einer dichten und wasserundurchlässigen Bodenplatte zu versehen. Zur ordnungsgemäßen Ableitung der Jauche ist
25 23 die Bodenplatte einer Festmistlagerstätte seitlich einzufassen. Die Anlagen sind gegen das Eindringen von Oberflächenwasser aus dem umgebenden Gelände zu schützen. Sofern eine Ableitung der Jauche/des Silagesickersaftes in eine vorhandene Jaucheoder Güllegrube nicht möglich ist, ist eine gesonderte Sammeleinrichtung vorzusehen. Das Fassungsvermögen der Behälter zur Lagerung von flüssigen Wirtschaftsdüngern (z.b. Jauche und Gülle) zzgl. ggf. weiterer Einleitungen (z.b. Silagesickersäfte) muss größer sein, als die erforderliche Kapazität während des längsten Zeitraumes, in dem das Ausbringen auf landwirtschaftliche Flächen verboten ist. Es muss auf die Belange des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes und des Gewässerschutzes abgestimmt sein. Eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Verwertung oder Ausbringung des Inhaltes nach der Düngeverordnung muss gewährleistet sein. In allen Bundesländern gilt eine Mindestlagerkapazität von sechs Monaten für Neuanlagen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn eine anderweitige umweltgerechte Verwertung oder Entsorgung nachgewiesen werden kann. 2 Vogelschutzrichtlinie (GAB 2) Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung) Allgemeine Regelung Die EU-Mitgliedstaaten sind nach den Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie 23 zur Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensräumen für alle europäischen wildlebenden Vogelarten in oder außerhalb von Schutzgebieten verpflichtet. 24 Konkrete Rechtspflichten ergeben sich für landwirtschaftliche Betriebe insbesondere aus: dem Beseitigungsverbot bestimmter Landschaftselemente, 25 dem gesetzlichen Biotopschutz, 26 und den Vorgaben der Eingriffsregelung 27. Ordnungsgemäß durchgeführte Pflegemaßnahmen, durch die geschützte Lebensräume dauerhaft erhalten bleiben, sind zulässig. In der Regel ist davon auszugehen, dass für die Erhaltung der Lebensräume der europäischen wildlebenden Vogelarten Hecken oder Knicks, Baumreihen, Feldgehölze, Feuchtgebiete (siehe
26 24 Glossar) und Einzelbäume, wie sie in Kapitel II Nr. 6 definiert werden, besonders wichtig sind. Darüber hinausgehende Verbote der Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung von geschützten Biotopen ( 30 BNatSchG oder nach Landesrecht), von ausgewiesenen Naturdenkmalen ( 28 BNatSchG oder nach Landesrecht) oder geschützten Landschaftsbestandteilen ( 29 BNatSchG oder nach Landesrecht) bleiben gleichwohl zu beachten. Pläne und Projekte, die ein Vogelschutzgebiet erheblich beeinträchtigen könnten, sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung durch die Genehmigungsbehörde auf ihre Verträglichkeit 28 mit den Erhaltungszielen zu überprüfen. Weder innerhalb noch außerhalb von Vogelschutzgebieten dürfen Maßnahmen ausgeführt werden, die die für ein solches Gebiet festgelegten Erhaltungsziele erheblich beeinträchtigen könnten. Die Einhaltung ggf. erteilter Auflagen ist relevant für die Cross-Compliance-Verpflichtungen; z.b. Auflagen der Baubehörde für Baumaßnahmen, die aus einer Verträglichkeitsprüfung resultieren. Um diesen Sachverhalt zu klären, sind bei einer Vor- Ort-Kontrolle für nach dem 1. Januar 2005 realisierte Projekte die Genehmigungen vorzulegen. Ob im Rahmen einer Baugenehmigung eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, entscheidet die für die Genehmigung jeweils zuständige Behörde im Einzelfall. Nachfolgend werden Beispiele genannt für genehmigungspflichtige Pläne und Projekte, die grundsätzlich einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen: Errichtung von Bauwerken, geländeverändernde Maßnahmen (Aufschüttungen, Abtragungen, Zuschüttungen), Veränderungen des Wasserhaushaltes (Entwässerung). Auch nicht genehmigungspflichtige Vorhaben oder Maßnahmen können ein Vogelschutzgebiet und die dort geschützten Arten erheblich beeinträchtigen. Solche Vorhaben sind nach 34 Abs. 6 BNatSchG bei der zuständigen Naturschutzbehörde anzuzeigen. Diese muss innerhalb eines Monats darauf reagieren, andernfalls gilt die Maßnahme oder das Vorhaben als unerheblich für das betroffene Gebiet. Wenn der Betriebsinhaber Zweifel an der Projekteigenschaft der Maßnahme bzw. des Vorhabens hat, wird empfohlen, sich bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu informieren und dann die gegebenenfalls notwendige Anzeige vorzunehmen. Besonderheiten für Schutzgebiete 29 Zum Erhalt der durch die Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogelarten müssen die Bundesländer die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Vogelschutzgebieten erklären. In diesen sind zusätzliche Regelungen zu beachten, wenn diese beispielsweise in Form einer Schutzgebietsverordnung oder einer Einzelanordnung (siehe Glossar) erlassen wurden. Solche zusätzlichen Regelungen können beispielsweise den Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz, den Mahdzeitpunkt, das Umbruchverbot von Grünlandflächen,
27 25 die Veränderung des Wasserhaushaltes, vor allem in Feuchtgebieten, oder die Unterhaltung von Gewässern betreffen. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Naturschutzbehörde.
28 26 3 FFH-Richtlinie (GAB 3) Betroffen sind Zahlungsempfänger (außer Teilnehmer an der Kleinerzeugerregelung) Weitere Grundanforderungen an den Betrieb im Bereich des Umweltschutzes sind in der Fauna- Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie 30 ) geregelt. Die Mitgliedstaaten müssen die nötigen Erhaltungsmaßnahmen für die in den FFH-Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen und Arten festlegen und geeignete rechtliche, administrative oder vertragliche Maßnahmen ergreifen, um die Erhaltungsziele zu erreichen. 31 Die Bundesländer können ergänzende Regelungen im Landesrecht umsetzen. Die Richtlinie verlangt geeignete Maßnahmen, um in den Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und Habitate der Arten sowie Störungen der relevanten Arten zu vermeiden. 32 Soweit Flächen in einem FFH- oder in einem Vogelschutzgebiet bewirtschaftet werden, ergeben sich nur dann zusätzliche Bewirtschaftungsvorgaben oder -auflagen, wenn verbindliche Vorschriften in Form einer Schutzgebietsverordnung, einer Einzelanordnung oder in einer vertraglichen Vereinbarung 33 festgelegt wurden. Im Übrigen darf die Bewirtschaftung nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen können ( 33f. BNatSchG). Naturschutzrechtlich besonders geschützte Lebensraumtypen des Grünlandes der Fauna-Flora- Habitat (FFH-)Richtlinie, Lebensräume der Arten, die unter die FFH- und Vogelschutz-Richtlinie fallen, sowie weitere naturschutzrechtlich geschützte Flächen dürfen grundsätzlich nicht umgebrochen werden. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an das LELF-Referat 42.
Spezifische Hinweise zu den Anforderungen und Standards der Cross Compliance
 CROSS COMPLIANCE Boden Wasser Landschaft Biodiversität Kennzeichnung und Registrierung von Tieren Lebensmittelsicherheit Tierschutz Pflanzenschutzmittel AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA
CROSS COMPLIANCE Boden Wasser Landschaft Biodiversität Kennzeichnung und Registrierung von Tieren Lebensmittelsicherheit Tierschutz Pflanzenschutzmittel AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA
Cross Compliance GAP nach 2014
 GAP nach 2014 Inhaltsverzeichnis Rechtsgrundlagen Wichtigste Inhalte der Horizontalen Verordnung Weitere Änderungen Anhang II der VO (EU) Nr. 1306/2013 - Umweltschutz, Klimawandel, guter landwirtschaftlicher
GAP nach 2014 Inhaltsverzeichnis Rechtsgrundlagen Wichtigste Inhalte der Horizontalen Verordnung Weitere Änderungen Anhang II der VO (EU) Nr. 1306/2013 - Umweltschutz, Klimawandel, guter landwirtschaftlicher
Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte-Verordnung - MPV)
 Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte-Verordnung - MPV) Vom 20. Dezember 2001, BGBl. I S. 3854 geändert am 4. Dezember 2002, BGBl I S. 4456 zuletzt geändert am 13. Februar 2004, BGBl I S. 216
Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte-Verordnung - MPV) Vom 20. Dezember 2001, BGBl. I S. 3854 geändert am 4. Dezember 2002, BGBl I S. 4456 zuletzt geändert am 13. Februar 2004, BGBl I S. 216
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr.../.. DER KOMMISSION. vom 19.9.2014
 EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 19.9.2014 C(2014) 6515 final DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr..../.. DER KOMMISSION vom 19.9.2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und
EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 19.9.2014 C(2014) 6515 final DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr..../.. DER KOMMISSION vom 19.9.2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit DGUV Vorschrift (vorherige BGV A3) Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel vom 01. April 1979,
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit DGUV Vorschrift (vorherige BGV A3) Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel vom 01. April 1979,
Genehmigungsrechtliche Aspekte des Zuckerrübeneinsatzes in der Biogasanlage
 Genehmigungsrechtliche Aspekte des Zuckerrübeneinsatzes in der Biogasanlage Harald Wedemeyer Rechtsanwalt Folie 1 RA Harald Wedemeyer Einführung Was müssen Anlagenbetreiber beim Einsatz von Rüben in Biogasanlagen
Genehmigungsrechtliche Aspekte des Zuckerrübeneinsatzes in der Biogasanlage Harald Wedemeyer Rechtsanwalt Folie 1 RA Harald Wedemeyer Einführung Was müssen Anlagenbetreiber beim Einsatz von Rüben in Biogasanlagen
Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte-Verordnung - MPV)
 05.07.2005 Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte-Verordnung - MPV) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3854), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Februar 2004 (BGBl. I S. 216)
05.07.2005 Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte-Verordnung - MPV) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3854), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Februar 2004 (BGBl. I S. 216)
Corinna Böhland Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen GmbH. 39. Seminar über Versuchstiere und Tierversuche
 Corinna Böhland Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen GmbH Rechtliche Anforderungen an das Halten von Legehennen als Nutztiere unter dem Aspekt Tierschutz Europäische Union Deutschland unter
Corinna Böhland Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen GmbH Rechtliche Anforderungen an das Halten von Legehennen als Nutztiere unter dem Aspekt Tierschutz Europäische Union Deutschland unter
Abschnitt 1 Anwendungsbereich und Allgemeine Anforderungen an die Konformitätsbewertung 1 Anwendungsbereich
 13.06.2007 Verordnung über Medizinprodukte - (Medizinprodukte-Verordnung - MPV)* vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3854), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Februar 2007 (BGBl. I S.
13.06.2007 Verordnung über Medizinprodukte - (Medizinprodukte-Verordnung - MPV)* vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3854), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Februar 2007 (BGBl. I S.
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Übertragungen von Speicherkapazitäten ( Vertragsbedingungen Kapazitätsübertragung )
 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Übertragungen von Speicherkapazitäten ( Vertragsbedingungen Kapazitätsübertragung ) Stand: Januar 2016 Vertragsbedingungen Kapazitätsübertragung Seite - 2 1 Gegenstand
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Übertragungen von Speicherkapazitäten ( Vertragsbedingungen Kapazitätsübertragung ) Stand: Januar 2016 Vertragsbedingungen Kapazitätsübertragung Seite - 2 1 Gegenstand
EU-Verordnungsvorschläge zur GAP nach 2013 Sachstand und erste Analyse. (Stand 12.9.2011) 19. Fleischrindtag der LFA
 EU-Verordnungsvorschläge zur GAP nach 2013 Sachstand und erste Analyse (Stand 12.9.2011) 19. Fleischrindtag der LFA Zeitplan Noch 2 Jahre Debatte über die GAP liegen vor uns Meilensteine 2011: - Entwurf
EU-Verordnungsvorschläge zur GAP nach 2013 Sachstand und erste Analyse (Stand 12.9.2011) 19. Fleischrindtag der LFA Zeitplan Noch 2 Jahre Debatte über die GAP liegen vor uns Meilensteine 2011: - Entwurf
Entwurf. Artikel 1. 1 Erhebung von Gebühren und Auslagen
 Entwurf Stand: 22.01.2009 Verordnung zur Neuregelung gebührenrechtlicher Vorschriften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Das Bundesministerium
Entwurf Stand: 22.01.2009 Verordnung zur Neuregelung gebührenrechtlicher Vorschriften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Das Bundesministerium
Entsorgung von Küchen-, Speise- sowie Lebensmittelabfällen aus Speisegaststätten / Imbissbetrieben / Gemeinschaftsverpflegung / Einzelhandel
 Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Kronsforder Alle 2-6, 23560 Lübeck Tel.: 0451/122-3969, Fax: 0451/122-3990 E-Mail: unv@luebeck.de MERKBLATT Entsorgung von Küchen-,
Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Kronsforder Alle 2-6, 23560 Lübeck Tel.: 0451/122-3969, Fax: 0451/122-3990 E-Mail: unv@luebeck.de MERKBLATT Entsorgung von Küchen-,
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln Erfahrungen aus den Ländern
 Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln Erfahrungen aus den Ländern Untersuchung und Erfassung lebensmittelbedingter Ausbrüche Informationsveranstaltung des Bundesinstituts für Risikobewertung am 25. Januar
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln Erfahrungen aus den Ländern Untersuchung und Erfassung lebensmittelbedingter Ausbrüche Informationsveranstaltung des Bundesinstituts für Risikobewertung am 25. Januar
Die GAP nach 2013. Legislativvorschläge der EU Kommission zur Reform der. vom 12. Oktober 2011
 Die GAP nach 2013 Legislativvorschläge der EU Kommission zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union vom 12. Oktober 2011? Ilke Marschall, Erfurt, 11.11.11 Vorgeschichte Im Vorfeld
Die GAP nach 2013 Legislativvorschläge der EU Kommission zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union vom 12. Oktober 2011? Ilke Marschall, Erfurt, 11.11.11 Vorgeschichte Im Vorfeld
Hansestadt Stade Abteilung Sicherheit und Ordnung Sachgebiet Ordnung S I L V E S T E R
 Hansestadt Stade Abteilung Sicherheit und Ordnung Sachgebiet Ordnung S I L V E S T E R F E U E R WE R K Informationen zum Erwerb und Abbrand pyrotechnischer Gegenstände für Privatpersonen in Stade Stand:
Hansestadt Stade Abteilung Sicherheit und Ordnung Sachgebiet Ordnung S I L V E S T E R F E U E R WE R K Informationen zum Erwerb und Abbrand pyrotechnischer Gegenstände für Privatpersonen in Stade Stand:
Gesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen "Ingenieurin" und "Ingenieur" (Ingenieurgesetz - IngG)
 Gesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen "Ingenieurin" und "Ingenieur" (Ingenieurgesetz - IngG) vom 29. Januar 1971 (GVBl. S. 323) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 628) 1
Gesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen "Ingenieurin" und "Ingenieur" (Ingenieurgesetz - IngG) vom 29. Januar 1971 (GVBl. S. 323) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 628) 1
Befristung Inkrafttreten des TzBfG BeschFG 1996 1 Abs. 1; TzBfG 14 Abs. 2 Satz 1 und 2
 Befristung Inkrafttreten des TzBfG BeschFG 1996 1 Abs. 1; TzBfG 14 Abs. 2 Satz 1 und 2 Die Wirksamkeit der Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages richtet sich nach der bei Abschluß der Vertragsverlängerung
Befristung Inkrafttreten des TzBfG BeschFG 1996 1 Abs. 1; TzBfG 14 Abs. 2 Satz 1 und 2 Die Wirksamkeit der Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages richtet sich nach der bei Abschluß der Vertragsverlängerung
Verordnung zur Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften vom 16. Februar 2007
 26.02.2007 Verordnung zur Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften vom 16. Februar 2007 Auf Grund des 37 Abs. 1, 9, 10 und 11 Satz 1 des Medizinproduktegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
26.02.2007 Verordnung zur Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften vom 16. Februar 2007 Auf Grund des 37 Abs. 1, 9, 10 und 11 Satz 1 des Medizinproduktegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
c:\temp\temporary internet files\olk42\pct änderungen.doc
 ÄNDERUNGEN DES VERTRAGS ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) UND DER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS
ÄNDERUNGEN DES VERTRAGS ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) UND DER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS
(Text von Bedeutung für den EWR)
 L 324/38 DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2015/2301 R KOMMISSION vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Entscheidung 93/195/EWG hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Bedingungen und der Beurkundung für die
L 324/38 DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2015/2301 R KOMMISSION vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Entscheidung 93/195/EWG hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Bedingungen und der Beurkundung für die
CROSS COMPLIANCE 2015. Informationen über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen
 CROSS COMPLIANCE 2015 Informationen über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen Impressum Herausgeber: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
CROSS COMPLIANCE 2015 Informationen über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen Impressum Herausgeber: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. BG-Vorschrift. Unfallverhütungsvorschrift
 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BG-Vorschrift BGV A3 (vorherige VBG 4) Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel vom 1. April 1979,
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BG-Vorschrift BGV A3 (vorherige VBG 4) Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel vom 1. April 1979,
Definition und Abgrenzung des Biodiversitätsschadens
 Fachtagung Schöner Schaden! Biodiversitätsschäden in der Umwelthaftungsrichtlinie Definition und Abgrenzung des Biodiversitätsschadens Universität für Bodenkultur Wien Department für Raum, Landschaft und
Fachtagung Schöner Schaden! Biodiversitätsschäden in der Umwelthaftungsrichtlinie Definition und Abgrenzung des Biodiversitätsschadens Universität für Bodenkultur Wien Department für Raum, Landschaft und
InVo. Information zu Verordnungen in der GKV. Herstellung von Arzneimitteln durch Ärzte Anzeigepflicht bei Bezirksregierungen. Stand: Februar 2010
 Nr. 1 2010 InVo Information zu Verordnungen in der GKV Stand: Februar 2010 Herstellung von Arzneimitteln durch Ärzte Anzeigepflicht bei Bezirksregierungen Bisher konnten Sie als Arzt Arzneimittel (z. B.
Nr. 1 2010 InVo Information zu Verordnungen in der GKV Stand: Februar 2010 Herstellung von Arzneimitteln durch Ärzte Anzeigepflicht bei Bezirksregierungen Bisher konnten Sie als Arzt Arzneimittel (z. B.
Reglement Mediator SAV / Mediatorin SAV
 Reglement Mediator SAV / Mediatorin SAV Der Vorstand des Schweizerischen Anwaltsverbandes SAV erlässt nachfolgendes Reglement. A. Grundsatz zum Titel Mediator SAV / Mediatorin SAV 1. Der Schweizerische
Reglement Mediator SAV / Mediatorin SAV Der Vorstand des Schweizerischen Anwaltsverbandes SAV erlässt nachfolgendes Reglement. A. Grundsatz zum Titel Mediator SAV / Mediatorin SAV 1. Der Schweizerische
Erläuterungen flächenbezogene Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität 2015
 Erläuterungen flächenbezogene Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität 2015 M1: Zwischenfruchtanbau standard nicht winterharte Zwischenfrüchte z.b. Senf, Ölrettich, Phacelia Umbruch 2 Wochen vor der
Erläuterungen flächenbezogene Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität 2015 M1: Zwischenfruchtanbau standard nicht winterharte Zwischenfrüchte z.b. Senf, Ölrettich, Phacelia Umbruch 2 Wochen vor der
Muster für Ausbildungsverträge mit Auszubildenden nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG -
 Muster für Ausbildungsverträge mit Auszubildenden nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG - Zwischen vertreten durch... (Ausbildender) und Frau/Herrn...
Muster für Ausbildungsverträge mit Auszubildenden nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG - Zwischen vertreten durch... (Ausbildender) und Frau/Herrn...
Behandlung von Biogas-Gärsubstraten und Gärresten im Rahmen der Feld-Stall-Bilanz gemäß Düngeverordnung 5 mit dem Programm Düngebilanz
 8.9.2005 Behandlung von Biogas-Gärsubstraten und Gärresten im Rahmen der Feld-Stall-Bilanz gemäß Düngeverordnung 5 mit dem Programm Düngebilanz Bei in Biogasanlagen eingebrachten Substraten und den daraus
8.9.2005 Behandlung von Biogas-Gärsubstraten und Gärresten im Rahmen der Feld-Stall-Bilanz gemäß Düngeverordnung 5 mit dem Programm Düngebilanz Bei in Biogasanlagen eingebrachten Substraten und den daraus
Markenvertrag. zwischen der. Gebäudereiniger-Innung Berlin. - Innung - und. dem Innungsmitglied. - Markenmitglied - 1 Zweck der Kollektivmarke
 Markenvertrag zwischen der Gebäudereiniger-Innung Berlin und - Innung - dem Innungsmitglied - Markenmitglied - 1 Zweck der Kollektivmarke 1. Die Gebäudereiniger-Innung Berlin ist Lizenznehmerin der vom
Markenvertrag zwischen der Gebäudereiniger-Innung Berlin und - Innung - dem Innungsmitglied - Markenmitglied - 1 Zweck der Kollektivmarke 1. Die Gebäudereiniger-Innung Berlin ist Lizenznehmerin der vom
Maßnahmenprogramm Landwirtschaft
 Maßnahmenprogramm Landwirtschaft Runder Tisch zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Anhörung der Öffentlichkeit - WRRL und die Landwirtschaft Schutz der Oberflächengewässer Minderung des Phosphateintrages
Maßnahmenprogramm Landwirtschaft Runder Tisch zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Anhörung der Öffentlichkeit - WRRL und die Landwirtschaft Schutz der Oberflächengewässer Minderung des Phosphateintrages
Lehrer: Einschreibemethoden
 Lehrer: Einschreibemethoden Einschreibemethoden Für die Einschreibung in Ihren Kurs gibt es unterschiedliche Methoden. Sie können die Schüler über die Liste eingeschriebene Nutzer Ihrem Kurs zuweisen oder
Lehrer: Einschreibemethoden Einschreibemethoden Für die Einschreibung in Ihren Kurs gibt es unterschiedliche Methoden. Sie können die Schüler über die Liste eingeschriebene Nutzer Ihrem Kurs zuweisen oder
DAS NEUE GESETZ ÜBER FACTORING ( Amtsblatt der RS, Nr.62/2013)
 DAS NEUE GESETZ ÜBER FACTORING ( Amtsblatt der RS, Nr.62/2013) I Einleitung Das Parlament der Republik Serbien hat das Gesetz über Factoring verabschiedet, welches am 24. Juli 2013 in Kraft getreten ist.
DAS NEUE GESETZ ÜBER FACTORING ( Amtsblatt der RS, Nr.62/2013) I Einleitung Das Parlament der Republik Serbien hat das Gesetz über Factoring verabschiedet, welches am 24. Juli 2013 in Kraft getreten ist.
Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte- Verordnung - MPV)
 Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte- Verordnung - MPV) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I. S. 3854) Auf Grund des 37 Abs. 1, 8 und 11 des Medizinproduktegesetzes vom 2. August 1994 (BGBl. I. S.
Verordnung über Medizinprodukte (Medizinprodukte- Verordnung - MPV) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I. S. 3854) Auf Grund des 37 Abs. 1, 8 und 11 des Medizinproduktegesetzes vom 2. August 1994 (BGBl. I. S.
Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NW - SpielbG NW) Vom 19. März 1974. I.
 Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NW - SpielbG NW) Vom 19. März 1974 ( 1) I. Abschnitt Spielbanken Im Land Nordrhein-Westfalen können Spielbanken
Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NW - SpielbG NW) Vom 19. März 1974 ( 1) I. Abschnitt Spielbanken Im Land Nordrhein-Westfalen können Spielbanken
Bekanntmachung von Satzungsänderungen
 Aushang vom 11.11. 25.11.2014 Bekanntmachung von Satzungsänderungen 18. Satzungsnachtrag der atlas BKK ahlmann vom 01.01.2010 Die Satzung der atlas BKK ahlmann vom 01.01.2010 wird wie folgt geändert: Artikel
Aushang vom 11.11. 25.11.2014 Bekanntmachung von Satzungsänderungen 18. Satzungsnachtrag der atlas BKK ahlmann vom 01.01.2010 Die Satzung der atlas BKK ahlmann vom 01.01.2010 wird wie folgt geändert: Artikel
Kriterienkatalog 09001 22. Nov. 2012 Lebensmittel sowie Erzeugnisse aus biologischer Landwirtschaft
 Kriterienkatalog 09001 22. Nov. 2012 Lebensmittel sowie Erzeugnisse aus biologischer Landwirtschaft ÖkoKauf Wien Arbeitsgruppe 09 Lebensmittel Arbeitsgruppenleiter: Dr. Bernhard Kromp MA 49 - Bio Forschung
Kriterienkatalog 09001 22. Nov. 2012 Lebensmittel sowie Erzeugnisse aus biologischer Landwirtschaft ÖkoKauf Wien Arbeitsgruppe 09 Lebensmittel Arbeitsgruppenleiter: Dr. Bernhard Kromp MA 49 - Bio Forschung
Vom 7. Juli 2009. Artikel 1
 2125 Verordnung zur Änderung der Verordnungen über die Ausbildung und Prüfung von staatlich geprüften Lebensmittelchemikern sowie von Lebensmittelkontrolleuren Vom 7. Juli 2009 Auf Grund des a) 4 des Lebensmittelchemikergesetzes
2125 Verordnung zur Änderung der Verordnungen über die Ausbildung und Prüfung von staatlich geprüften Lebensmittelchemikern sowie von Lebensmittelkontrolleuren Vom 7. Juli 2009 Auf Grund des a) 4 des Lebensmittelchemikergesetzes
ENTWURF. Neue Fassung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
 ENTWURF Neue Fassung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 12. September 2007 unter Berücksichtigung der der Hauptversammlung der Drillisch AG vom 21. Mai 2014 zur Zustimmung vorgelegten
ENTWURF Neue Fassung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 12. September 2007 unter Berücksichtigung der der Hauptversammlung der Drillisch AG vom 21. Mai 2014 zur Zustimmung vorgelegten
Hinweise zur Registrierungspflicht gemäß 6 Anlagenregisterverordnung (AnlRegV) Im März 2015. Guten Tag,
 EWE NETZ GmbH Postfach 25 01 26015 Oldenburg Sie erreichen uns: * EWE NETZ GmbH Cloppenburger Straße 302 26133 Oldenburg ' Tel. 0800-393 6389 Fax 0441-4808 1195 @ info@ewe-netz.de www.ewe-netz.de Kundennummer:
EWE NETZ GmbH Postfach 25 01 26015 Oldenburg Sie erreichen uns: * EWE NETZ GmbH Cloppenburger Straße 302 26133 Oldenburg ' Tel. 0800-393 6389 Fax 0441-4808 1195 @ info@ewe-netz.de www.ewe-netz.de Kundennummer:
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes
 Breitenbachstraße 1, 60487 Frankfurt am Main Telefon: (069) 7919-0 Telefax: (069) 7919-227 bgl@bgl-ev.de www.bgl-ev.de Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes
Breitenbachstraße 1, 60487 Frankfurt am Main Telefon: (069) 7919-0 Telefax: (069) 7919-227 bgl@bgl-ev.de www.bgl-ev.de Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes
Arbeitsrechtsregelung über Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fortbildungsordnung)
 Fortbildungsordnung 4.13.7 Arbeitsrechtsregelung über Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fortbildungsordnung) Vom 13. März 1990 (ABl. EKD 1990 S. 204) Lfd. Nr. Änderndes Recht
Fortbildungsordnung 4.13.7 Arbeitsrechtsregelung über Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fortbildungsordnung) Vom 13. März 1990 (ABl. EKD 1990 S. 204) Lfd. Nr. Änderndes Recht
1. Welche rechtlichen Grundlagen regeln den Rückbau von Windkraftanlagen in Brandenburg und welche Behörden sind jeweils zuständig?
 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 64 des Abgeordneten Steeven Bretz CDU-Fraktion Landtagsdrucksache 6/149 Rückbau von Windkraftanlagen in Brandenburg Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr.
Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 64 des Abgeordneten Steeven Bretz CDU-Fraktion Landtagsdrucksache 6/149 Rückbau von Windkraftanlagen in Brandenburg Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr.
Neue Regelungen für den Gerüstbau
 Neue Regelungen für den Gerüstbau Europäische Normen Auswirkungen auf die Praxis Neue BGI 663 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten Neue Regelungen für den Gerüstbau - Was gilt?
Neue Regelungen für den Gerüstbau Europäische Normen Auswirkungen auf die Praxis Neue BGI 663 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten Neue Regelungen für den Gerüstbau - Was gilt?
Zulassung nach MID (Measurement Instruments Directive)
 Anwender - I n f o MID-Zulassung H 00.01 / 12.08 Zulassung nach MID (Measurement Instruments Directive) Inhaltsverzeichnis 1. Hinweis 2. Gesetzesgrundlage 3. Inhalte 4. Zählerkennzeichnung/Zulassungszeichen
Anwender - I n f o MID-Zulassung H 00.01 / 12.08 Zulassung nach MID (Measurement Instruments Directive) Inhaltsverzeichnis 1. Hinweis 2. Gesetzesgrundlage 3. Inhalte 4. Zählerkennzeichnung/Zulassungszeichen
Erweiterung der Gärrestlagerung
 Erweiterung der Gärrestlagerung Aus Sicht der Genehmigungsbehörde Schwerpunkt Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. (FH) Gabi Dederichs Landkreis Northeim Untere Wasserbehörde Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009
Erweiterung der Gärrestlagerung Aus Sicht der Genehmigungsbehörde Schwerpunkt Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. (FH) Gabi Dederichs Landkreis Northeim Untere Wasserbehörde Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009
Vorab per E-Mail. Oberste Finanzbehörden der Länder
 Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin Christoph Weiser Unterabteilungsleiter IV C POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Vorab per E-Mail Oberste Finanzbehörden
Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin Christoph Weiser Unterabteilungsleiter IV C POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Vorab per E-Mail Oberste Finanzbehörden
Dipl.-Ing. Herbert Schmolke, VdS Schadenverhütung
 1. Problembeschreibung a) Ein Elektromonteur versetzt in einer überwachungsbedürftigen Anlage eine Leuchte von A nach B. b) Ein Elektromonteur verlegt eine zusätzliche Steckdose in einer überwachungsbedürftigen
1. Problembeschreibung a) Ein Elektromonteur versetzt in einer überwachungsbedürftigen Anlage eine Leuchte von A nach B. b) Ein Elektromonteur verlegt eine zusätzliche Steckdose in einer überwachungsbedürftigen
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) und Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV)
 Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) und Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV) Das BKrFQG dient zur Umsetzung der Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) und Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV) Das BKrFQG dient zur Umsetzung der Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Handbuch. NAFI Online-Spezial. Kunden- / Datenverwaltung. 1. Auflage. (Stand: 24.09.2014)
 Handbuch NAFI Online-Spezial 1. Auflage (Stand: 24.09.2014) Copyright 2016 by NAFI GmbH Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt! Inhaltsangabe Einleitung... 3 Kundenauswahl... 3 Kunde hinzufügen...
Handbuch NAFI Online-Spezial 1. Auflage (Stand: 24.09.2014) Copyright 2016 by NAFI GmbH Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt! Inhaltsangabe Einleitung... 3 Kundenauswahl... 3 Kunde hinzufügen...
Stellungnahme der Bundesärztekammer
 Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des 87 der Strafprozessordnung Berlin, 21. Februar 2012 Korrespondenzadresse: Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Platz
Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des 87 der Strafprozessordnung Berlin, 21. Februar 2012 Korrespondenzadresse: Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Platz
Meldung der Waffennummern (Waffenkennzeichen) nach der Feuerwaffenverordnung der EU
 Meldung der Waffennummern (Waffenkennzeichen) nach der Feuerwaffenverordnung der EU Meldung der Waffennummern (Waffenkennzeichen) 2 Allgemeine Hinweise Wenn Sie eine Nationale Ausfuhrgenehmigung oder eine
Meldung der Waffennummern (Waffenkennzeichen) nach der Feuerwaffenverordnung der EU Meldung der Waffennummern (Waffenkennzeichen) 2 Allgemeine Hinweise Wenn Sie eine Nationale Ausfuhrgenehmigung oder eine
BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 2004 Ausgegeben am 28. Jänner 2004 Teil II
 1 von 5 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2004 Ausgegeben am 28. Jänner 2004 Teil II 57. Verordnung: Konformitätsbewertung von Medizinprodukten [CELEX-Nr.: 32000L0070, 32001L0104,
1 von 5 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2004 Ausgegeben am 28. Jänner 2004 Teil II 57. Verordnung: Konformitätsbewertung von Medizinprodukten [CELEX-Nr.: 32000L0070, 32001L0104,
Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen vom 03.02.
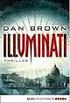 Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen vom 03.02.2015 Artikel 1 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen vom 03.02.2015 Artikel 1 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
3 Meldepflichten der Zahlstellen und der Krankenkassen
 3 Meldepflichten der Zahlstellen und der Krankenkassen 3.1 Allgemeines Die Meldepflichten der Zahlstellen und der Krankenkassen wie auch die Meldepflicht des Versorgungsempfängers sind in 202 SGB V definiert.
3 Meldepflichten der Zahlstellen und der Krankenkassen 3.1 Allgemeines Die Meldepflichten der Zahlstellen und der Krankenkassen wie auch die Meldepflicht des Versorgungsempfängers sind in 202 SGB V definiert.
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales und Gesundheit
 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Mittagsverpflegung von bedürftigen Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege bis zum Eintritt in die Schule (Richtlinie Mittagsverpflegung)
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Mittagsverpflegung von bedürftigen Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege bis zum Eintritt in die Schule (Richtlinie Mittagsverpflegung)
6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung
 Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen TK Lexikon Arbeitsrecht 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung HI2516431 (1) 1 Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen TK Lexikon Arbeitsrecht 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung HI2516431 (1) 1 Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Migration
 Häufig gestellte Fragen zum Thema Migration Was tun die EU und die Niederlande zur Bekämpfung der Fluchtursachen? Im November 2015 haben die Europäische Union und zahlreiche afrikanische Länder in der
Häufig gestellte Fragen zum Thema Migration Was tun die EU und die Niederlande zur Bekämpfung der Fluchtursachen? Im November 2015 haben die Europäische Union und zahlreiche afrikanische Länder in der
Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) TRBS 1111 TRBS 2121 TRBS 1203
 Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) TRBS 1111 TRBS 2121 TRBS 1203 Achim Eckert 1/12 Am 3. Oktober 2002 ist die Betriebssicherheitsverordnung in Kraft getreten. Auch für den Gerüstbauer und den
Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) TRBS 1111 TRBS 2121 TRBS 1203 Achim Eckert 1/12 Am 3. Oktober 2002 ist die Betriebssicherheitsverordnung in Kraft getreten. Auch für den Gerüstbauer und den
Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung
 Änderung IFRS 2 Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung Anwendungsbereich Paragraph 2 wird geändert, Paragraph 3 gestrichen und Paragraph 3A angefügt. 2 Dieser IFRS ist bei der Bilanzierung aller
Änderung IFRS 2 Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung Anwendungsbereich Paragraph 2 wird geändert, Paragraph 3 gestrichen und Paragraph 3A angefügt. 2 Dieser IFRS ist bei der Bilanzierung aller
Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen
 Zentrale Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 445/2011 umfasst das Instandhaltungssystem der ECM die a) Managementfunktion b) Instandhaltungsentwicklungsfunktion
Zentrale Erläuterungen zur Untervergabe von Instandhaltungsfunktionen Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 445/2011 umfasst das Instandhaltungssystem der ECM die a) Managementfunktion b) Instandhaltungsentwicklungsfunktion
Text und Redaktion: BMLFUW/Abt. II/3 Agrarumwelt (ÖPUL), Bergbauern und Benachteiligte Gebiete, Biologische Landwirtschaft;
 GAP-Vorschusszahlungen Herbst 2015 Medieninhaber und Herausgeber: BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WAsserWIRTSCHAFT Stubenring 1, 1010 Wien bmlfuw.gv.at Text und Redaktion: BMLFUW/Abt.
GAP-Vorschusszahlungen Herbst 2015 Medieninhaber und Herausgeber: BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WAsserWIRTSCHAFT Stubenring 1, 1010 Wien bmlfuw.gv.at Text und Redaktion: BMLFUW/Abt.
von Einstufungsprüfungen gem. 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 der Polizeilaufbahnverordnung
 Prüfungsordnung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen für die Durchführung von Einstufungsprüfungen zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife gemäß 6 Abs. 1 Nr. 2 der Polizeilaufbahnverordnung
Prüfungsordnung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen für die Durchführung von Einstufungsprüfungen zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife gemäß 6 Abs. 1 Nr. 2 der Polizeilaufbahnverordnung
Prüfungsrichtlinie für die Anerkennung von Prüfingenieuren/Prüfsachverständigen für Brandschutz
 Prüfungsrichtlinie für die Anerkennung von Prüfingenieuren/Prüfsachverständigen für Brandschutz Vom 10. April 2008 Az.: C/5B III.3.2.1 163/08 El I. Verfahren Der Prüfungsausschuss (im Folgenden: Ausschuss)
Prüfungsrichtlinie für die Anerkennung von Prüfingenieuren/Prüfsachverständigen für Brandschutz Vom 10. April 2008 Az.: C/5B III.3.2.1 163/08 El I. Verfahren Der Prüfungsausschuss (im Folgenden: Ausschuss)
Fragen und Antworten zur Prüfmöglichkeit für ausländische Investitionen (Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung)
 Fragen und Antworten zur Prüfmöglichkeit für ausländische Investitionen (Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung) 1. Welche Investitionen können geprüft werden? Einer Prüfung
Fragen und Antworten zur Prüfmöglichkeit für ausländische Investitionen (Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung) 1. Welche Investitionen können geprüft werden? Einer Prüfung
M I T T E I L U N G. an alle Pächter und Verpächter von Milchquoten
 M I T T E I L U N G an alle Pächter und Verpächter von Milchquoten Folgende Mitteilung soll dazu dienen, alle Pächter und Verpächter von Milchquoten über die in Artikel 13 des großherzoglichen Reglementes
M I T T E I L U N G an alle Pächter und Verpächter von Milchquoten Folgende Mitteilung soll dazu dienen, alle Pächter und Verpächter von Milchquoten über die in Artikel 13 des großherzoglichen Reglementes
Baustellenverordnung. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen. Bestell-Nr.: BaustellV Gültig ab 1.
 ... q Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen Baustellenverordnung Bestell-Nr.: BaustellV Gültig ab 1. Juli 1998 Achtung, diese Vorschrift kann nicht über die Süddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft
... q Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen Baustellenverordnung Bestell-Nr.: BaustellV Gültig ab 1. Juli 1998 Achtung, diese Vorschrift kann nicht über die Süddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft
18. Nachtrag zur Satzung der BKK Pfalz vom 1. Januar
 Bekanntmachung 18. Nachtrag zur Satzung der BKK Pfalz vom 1. Januar 2009 Das Bundesversicherungsamt hat den vom Verwaltungsrat der BKK Pfalz in seiner Sitzung am 21. November 2014 beschlossenen 18. Nachtrag
Bekanntmachung 18. Nachtrag zur Satzung der BKK Pfalz vom 1. Januar 2009 Das Bundesversicherungsamt hat den vom Verwaltungsrat der BKK Pfalz in seiner Sitzung am 21. November 2014 beschlossenen 18. Nachtrag
M e r k b l a t t. zur Praktischen Ausbildung in der Krankenanstalt (PJ)
 0401-02061/Nov-12 Seite 1 von 5 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern Abt. Gesundheit - Landesprüfungsamt für Heilberufe - Telefon 0381 331-59104 und -59118 Telefax: 0381 331-59044
0401-02061/Nov-12 Seite 1 von 5 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern Abt. Gesundheit - Landesprüfungsamt für Heilberufe - Telefon 0381 331-59104 und -59118 Telefax: 0381 331-59044
Punkte Flensburg System: Punktesystem - Warum gibt es das Punktesystem?
 Punkte Flensburg System: Punktesystem - Warum gibt es das Punktesystem? Durch das System der Punkte in Flensburg ist die Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer mit deutscher Fahrerlaubnis gewährleistet.
Punkte Flensburg System: Punktesystem - Warum gibt es das Punktesystem? Durch das System der Punkte in Flensburg ist die Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmer mit deutscher Fahrerlaubnis gewährleistet.
Verwaltungsgebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Nieplitz. 1 Gebührenpflichtige Amtshandlungen und sonstige Tätigkeiten
 Verwaltungsgebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Nieplitz Aufgrund der 2 und 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt
Verwaltungsgebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Nieplitz Aufgrund der 2 und 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt
9.6.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 150/71
 9.6.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 150/71 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 489/2012 DER KOMMISSION vom 8. Juni 2012 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für die Anwendung des Artikels
9.6.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 150/71 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 489/2012 DER KOMMISSION vom 8. Juni 2012 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für die Anwendung des Artikels
(ABl. Nr. L 372 S. 31) EU-Dok.-Nr. 3 1985 L 0577
 HausTWRL 3 3. Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 1) (ABl. Nr. L 372 S. 31) EU-Dok.-Nr.
HausTWRL 3 3. Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 1) (ABl. Nr. L 372 S. 31) EU-Dok.-Nr.
ratgeber Urlaub - Dein gutes Recht
 Viele Arbeitgeber wollen jetzt die Urlaubsplanung für 2011 vorgelegt bekommen. Dabei kommt es immer wieder zu Streitereien unter den Kollegen. Aber auch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern kann es
Viele Arbeitgeber wollen jetzt die Urlaubsplanung für 2011 vorgelegt bekommen. Dabei kommt es immer wieder zu Streitereien unter den Kollegen. Aber auch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern kann es
S A T Z U N G. zur Errichtung, Aufstellung, Anbringung, Änderung und zum Betrieb von Werbeanlagen im Gebiet der Kreisstadt Neunkirchen.
 30.10-1 S A T Z U N G zur Errichtung, Aufstellung, Anbringung, Änderung und zum Betrieb von Werbeanlagen im Gebiet der Kreisstadt Neunkirchen. Aufgrund des 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
30.10-1 S A T Z U N G zur Errichtung, Aufstellung, Anbringung, Änderung und zum Betrieb von Werbeanlagen im Gebiet der Kreisstadt Neunkirchen. Aufgrund des 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
ANLAUFSTELLEN-LEITLINIEN Nr. 3
 ANLAUFSTELLEN-LEITLINIEN Nr. 3 Betr.: Bescheinigung für die nachfolgende nicht vorläufige Verwertung oder Beseitigung nach Artikel 15 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbringung
ANLAUFSTELLEN-LEITLINIEN Nr. 3 Betr.: Bescheinigung für die nachfolgende nicht vorläufige Verwertung oder Beseitigung nach Artikel 15 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbringung
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Eignungsüberprüfung im Verwaltungsverfahren
 Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Eignungsüberprüfung im Verwaltungsverfahren Rotenburg a.d.f, den 15. März 2015 Basis des Verwaltungshandelns Straßenverkehrsgesetz (StVG) In Verbindung mit Fahrerlaubnis-Verordnung
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Eignungsüberprüfung im Verwaltungsverfahren Rotenburg a.d.f, den 15. März 2015 Basis des Verwaltungshandelns Straßenverkehrsgesetz (StVG) In Verbindung mit Fahrerlaubnis-Verordnung
Vorschlag für eine DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES
 EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Vorschlag für eine DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES zur Ersetzung der Listen von Insolvenzverfahren, Liquidationsverfahren
EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Vorschlag für eine DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES zur Ersetzung der Listen von Insolvenzverfahren, Liquidationsverfahren
6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb
 6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb WIEDNER Wie schon im Kapitel VI erwähnt, ist die Probenahme in Betrieben, die Produkte nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch herstellen oder in den Verkehr
6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb WIEDNER Wie schon im Kapitel VI erwähnt, ist die Probenahme in Betrieben, die Produkte nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch herstellen oder in den Verkehr
Inhalt. Einführung in das Gesellschaftsrecht
 Inhalt Einführung in das Gesellschaftsrecht Lektion 1: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 7 A. Begriff und Entstehungsvoraussetzungen 7 I. Gesellschaftsvertrag 7 II. Gemeinsamer Zweck 7 III. Förderung
Inhalt Einführung in das Gesellschaftsrecht Lektion 1: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 7 A. Begriff und Entstehungsvoraussetzungen 7 I. Gesellschaftsvertrag 7 II. Gemeinsamer Zweck 7 III. Förderung
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
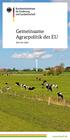 Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
STELLUNGNAHME. des. DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein, Bonn
 STELLUNGNAHME des DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein, Bonn anlässlich der Neufassung des Düngemittelgesetzes 15. Oktober 2007 Der DVGW begrüßt
STELLUNGNAHME des DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein, Bonn anlässlich der Neufassung des Düngemittelgesetzes 15. Oktober 2007 Der DVGW begrüßt
Verordnung über die Arbeitszeit bei Offshore- Tätigkeiten (Offshore-Arbeitszeitverordnung - Offshore-ArbZV)
 Verordnung über die Arbeitszeit bei Offshore- Tätigkeiten (Offshore-Arbeitszeitverordnung - Offshore-ArbZV) Offshore-ArbZV Ausfertigungsdatum: 05.07.2013 Vollzitat: "Offshore-Arbeitszeitverordnung vom
Verordnung über die Arbeitszeit bei Offshore- Tätigkeiten (Offshore-Arbeitszeitverordnung - Offshore-ArbZV) Offshore-ArbZV Ausfertigungsdatum: 05.07.2013 Vollzitat: "Offshore-Arbeitszeitverordnung vom
Zypern. Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG)
 Zypern Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG) I. GEGENSEITIGKEITSABKOMMEN Artikel 2 Absatz 2 1. Hat Ihr Land Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen? Ja, Zypern hat zwei Gegenseitigkeitsabkommen
Zypern Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG) I. GEGENSEITIGKEITSABKOMMEN Artikel 2 Absatz 2 1. Hat Ihr Land Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen? Ja, Zypern hat zwei Gegenseitigkeitsabkommen
Sächsisches Sozialanerkennungsgesetz
 Gesetz über die staatliche Anerkennung von Absolventen mit Diplom oder Bachelor in den Fachgebieten des Sozialwesens, der Kindheitspädagogik oder der Heilpädagogik im Freistaat Sachsen (Sächsisches Sozialanerkennungsgesetz
Gesetz über die staatliche Anerkennung von Absolventen mit Diplom oder Bachelor in den Fachgebieten des Sozialwesens, der Kindheitspädagogik oder der Heilpädagogik im Freistaat Sachsen (Sächsisches Sozialanerkennungsgesetz
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Nutzung dieser Internetseite
 Nutzung dieser Internetseite Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen, dann erheben wir nur statistische Daten über unsere Besucher. In einer statistischen Zusammenfassung erfahren wir lediglich, welcher
Nutzung dieser Internetseite Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen, dann erheben wir nur statistische Daten über unsere Besucher. In einer statistischen Zusammenfassung erfahren wir lediglich, welcher
1 Name und Sitz. 2 Zweck
 1 Name und Sitz Der Verein trägt den Namen Kinderbildungswerk Magdeburg. Sitz des Vereins ist Magdeburg. Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Magdeburg eingetragen werden. Geschäftsjahr ist
1 Name und Sitz Der Verein trägt den Namen Kinderbildungswerk Magdeburg. Sitz des Vereins ist Magdeburg. Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Magdeburg eingetragen werden. Geschäftsjahr ist
Elternzeit Was ist das?
 Elternzeit Was ist das? Wenn Eltern sich nach der Geburt ihres Kindes ausschließlich um ihr Kind kümmern möchten, können sie bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit beantragen. Während der Elternzeit ruht das
Elternzeit Was ist das? Wenn Eltern sich nach der Geburt ihres Kindes ausschließlich um ihr Kind kümmern möchten, können sie bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit beantragen. Während der Elternzeit ruht das
Arbeitslos Wohnen in den Niederlanden, Arbeiten in Deutschland
 Arbeitslos Wohnen in den Niederlanden, Arbeiten in Deutschland Inhalt Wer bekommt eine Arbeitslosenleistung? 2 Kündigung in gegenseitigem Einvernehmen 2 Welche Arbeitslosenleistung bekommen Sie? 2 Wie
Arbeitslos Wohnen in den Niederlanden, Arbeiten in Deutschland Inhalt Wer bekommt eine Arbeitslosenleistung? 2 Kündigung in gegenseitigem Einvernehmen 2 Welche Arbeitslosenleistung bekommen Sie? 2 Wie
Quelle: Fundstelle: BGBl I 2003, 1003 FNA: FNA 9290-13-2
 juris Das Rechtsportal Gesamtes Gesetz Amtliche Abkürzung: LKW-MautV Ausfertigungsdatum: 24.06.2003 Gültig ab: 01.07.2003 Dokumenttyp: Rechtsverordnung Quelle: Fundstelle: BGBl I 2003, 1003 FNA: FNA 9290-13-2
juris Das Rechtsportal Gesamtes Gesetz Amtliche Abkürzung: LKW-MautV Ausfertigungsdatum: 24.06.2003 Gültig ab: 01.07.2003 Dokumenttyp: Rechtsverordnung Quelle: Fundstelle: BGBl I 2003, 1003 FNA: FNA 9290-13-2
Versetzungsregeln in Bayern
 Grundschule Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 rücken ohne besondere Entscheidung vor. Das Vorrücken in den Jahrgangsstufen 3 und 4 soll nur dann versagt werden, wenn der Schüler in seiner Entwicklung
Grundschule Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 rücken ohne besondere Entscheidung vor. Das Vorrücken in den Jahrgangsstufen 3 und 4 soll nur dann versagt werden, wenn der Schüler in seiner Entwicklung
Vergabegrundlage für Umweltzeichen. Umweltfreundliche Rohrreiniger RAL-UZ 24
 Vergabegrundlage für Umweltzeichen Umweltfreundliche Rohrreiniger RAL-UZ 24 Ausgabe April 2009 RAL ggmbh Siegburger Straße 39, 53757 Sankt Augustin, Germany, Telefon: +49 (0) 22 41-2 55 16-0 Telefax: +49
Vergabegrundlage für Umweltzeichen Umweltfreundliche Rohrreiniger RAL-UZ 24 Ausgabe April 2009 RAL ggmbh Siegburger Straße 39, 53757 Sankt Augustin, Germany, Telefon: +49 (0) 22 41-2 55 16-0 Telefax: +49
Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung Ingenieur und Ingenieurin (Ingenieurgesetz - IngG)
 Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung Ingenieur und Ingenieurin (Ingenieurgesetz - IngG) Art. 1 (1) Die Berufsbezeichnung "Ingenieur und Ingenieurin" allein oder in einer Wortverbindung darf führen,
Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung Ingenieur und Ingenieurin (Ingenieurgesetz - IngG) Art. 1 (1) Die Berufsbezeichnung "Ingenieur und Ingenieurin" allein oder in einer Wortverbindung darf führen,
Vertragsnummer: Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH im folgenden "DKTIG"
 Talstraße 30 D-66119 Saarbrücken Tel.: (0681) 588161-0 Fax: (0681) 58 96 909 Internet: www.dktig.de e-mail: mail@dktig.de Vertragsnummer: TrrusttCentterr--Verrttrrag zwischen der im folgenden "DKTIG" und
Talstraße 30 D-66119 Saarbrücken Tel.: (0681) 588161-0 Fax: (0681) 58 96 909 Internet: www.dktig.de e-mail: mail@dktig.de Vertragsnummer: TrrusttCentterr--Verrttrrag zwischen der im folgenden "DKTIG" und
33 - Leistungsvoraussetzungen
 Hinweis: Ältere Fassungen Gemeinsamer Rundschreiben sind im CareHelix-PV nachzulesen. 33 - Leistungsvoraussetzungen (1) Versicherte erhalten die Leistungen der Pflegeversicherung auf Antrag. Die Leistungen
Hinweis: Ältere Fassungen Gemeinsamer Rundschreiben sind im CareHelix-PV nachzulesen. 33 - Leistungsvoraussetzungen (1) Versicherte erhalten die Leistungen der Pflegeversicherung auf Antrag. Die Leistungen
Wir, gewählter Oberster Souverän von Gottes Gnaden, Treuhänder des
 Wir, gewählter Oberster Souverän von Gottes Gnaden, Treuhänder des Reiches bestimmen und ordnen was folgt: Gesetz über die Staatsangehörigkeit des Königreiches Deutschland (Staatsangehörigkeitsgesetz)
Wir, gewählter Oberster Souverän von Gottes Gnaden, Treuhänder des Reiches bestimmen und ordnen was folgt: Gesetz über die Staatsangehörigkeit des Königreiches Deutschland (Staatsangehörigkeitsgesetz)
Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Nr. 11/2013 (28. März 2013)
 Herausgeber: Duale Hochschule Baden-Württemberg Präsidium Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Nr. 11/2013 (28. März 2013) Erste Satzung
Herausgeber: Duale Hochschule Baden-Württemberg Präsidium Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Nr. 11/2013 (28. März 2013) Erste Satzung
Zwischen. ... vertreten durch... (Ausbildender) Frau/Herrn... Anschrift:... (Auszubildende/r) geboren am:...
 Anlage 9 Muster für Ausbildungsverträge mit Auszubildenden, für die der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) gilt Zwischen vertreten
Anlage 9 Muster für Ausbildungsverträge mit Auszubildenden, für die der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) gilt Zwischen vertreten
