Verbundvorhaben SAFIRA
|
|
|
- Emma Kalb
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Zentrum für Angewandte Geowissenschaften Lehrstuhl für Angewandte Geologie Verbundvorhaben SAFIRA Teilprojekt C2.1: Erkundung der Schadstofffracht in kontaminierten Aquiferen zur Dimensionierung von in-situ-sanierungsreaktoren Abschlussbericht LAG 23-2 / 29 Projekt: BMBF 2WT9948/ Projektleiter: Bearbeiter: PD Dr.-Ing. habil. T. Ptak Sebastian Bauer Marti Bayer-Raich Eugen Martac Datum:
2 INHALTSVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER BILDER UND TABELLEN 1 EINLEITUNG Problemstellung und Zielsetzung INTEGRALES ERKUNDUNGSVERFAHREN Kurzbeschreibung zum Prinzip des integralen Erkundungsverfahrens ARBEITEN IM PROJEKTZEITRAUM Auswahl des Untersuchungsgebiets und numerisches Standortmodell Einleitende Bemerkungen und Auswahl des Untersuchungsgebiets Hydrogeologische Verhältnisse Vorerkundung mittels Flowmetermessungen und Multilevel- Probenahme Numerisches Grundwasserströmungsmodell Dimensionierung der Immissionspumpversuche am zweiten Untersuchungsstandort Kriterien zur Dimensionierung Variantenbetrachtungen Vorgehensweise und Vorstudien Variante 1 (Q = 5 l/s) Variante 2 (Q = 7.5 l/s) Arbeiten am Standort Hinter dem Bahnhof Auswahl des dritten Untersuchungsstandorts, Dimensionierung der Immissionspumpversuche und Bau von neuen Grundwassermessstellen Kriterien zur Dimensionierung Dimensionierung der Immissionspumpversuche und Bau neuer Grundwassermessstellen am dritten Untersuchungsstandort Dimensionierung von Tracerversuchen und Bau von Tracerzugabemessstellen Laborarbeiten Entwässerbare Porosität Tracerstabilität Entwicklung der Pumpbrunnen-Multilevel-Messtechnik Prinzip Bau und erster Test der Pumpbrunnen-Multilevel- Probenahmeeinrichtung Pumpbrunnen-Multilevel-Probenahmeeinrichtung und Messtechnik für den SAFIRA-Standort Weiterentwicklung des integralen Erkundungsverfahrens Dreidimensionales analytisches Auswerteverfahren Numerisches Auswerteverfahren Mathematische Formulierung Numerisches Modellszenario zur Demonstration und Erprobung der dreidimensionalen Erkundung Durchführung der Immissionspumpversuche Absenkungsganglinien und Leitparameter für die Pumpversuche Flowmetermessungen
3 3.8.3 Schadstoffkonzentrationsganglinien Tracertests Auswertung der Tracerversuche Auswertung der Immissionspumpversuche Weiterentwicklung des numerischen Strömungs- und Transportmodells für den untersuchten Standort Numerische Auswertung der Konzentrationsganglinien SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ZUSAMMENFASSUNG VORAUSSICHTLICHER NUTZEN FORTSCHRITTE BEI ANDEREN STELLEN VERÖFFENTLICHUNG DER ERGEBNISSE Publikationen Abschlussarbeiten Berichte Vorträge und Poster LITERATURVERZEICHNIS ANHANG
4 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abb. 2.1: Schadstoffverteilung im Grundwasserabstrom eines Schadensherdes (die herkömmliche Erkundung mittels Probenahme in einzelnen Messstellen hat eine hohe Unsicherheit)... 2 Abb. 2.2: Vorgehensweise beim integralen Messansatz zur Bestimmung der Gesamt- Schadstofffracht und der mittleren Immissionskonzentration als Bemessungsparameter zur Dimensionierung von In-Situ-Sanierungsreaktoren im Abstrom eines Schadensherds... 4 Abb : Umriss des Modellgebiets und des zweiten vorgesehenen Untersuchungsraumes6 Abb : Zweiter Untersuchungsstandort zur Durchführung der Immissionspumpversuche im Bereich des Chemieparks... 7 Abb : Prinzipskizze des Flowmeter-Messverfahrens (nach Molz et al., 1989)... 1 Abb : Profil der hydraulischen Durchlässigkeit an der Messstelle SafBit 38/ Abb : Horizontale Modelldiskretisierung und Grundwassergleichen im Bereich der geplanten Immissionspumpversuche Abb : Verteilung der horizontalen Durchlässigkeitsbeiwerte in der Modellschicht 4 im Bereich des Untersuchungsgebiets Abb : Simulation der Einzugsgebiete für die Variante Abb : Simulation der Einzugsgebiete für die Variante Abb : Dritter Untersuchungsstandort Sternstrasse und Lage der neuen Grundwassermessstellen Abb : Berechneter Tracerdurchbruch am Pumpbrunnen (Dimensionierung) Abb : Gemessene Uranin-Konzentration im Bitterfelder Grundwasser als Funktion der Zeit Abb : Separationsverfahren zur Multilevel-Konzentrationsbestimmung in Pumpbrunnen während des Pumpbetriebs Abb : Pumpbrunnen-Multilevel-Probenahmeeinrichtung Abb : Pumpbrunnen-Multilevel-Probenahmeeinrichtung beim Einbau in Bitterfeld Abb : Messanhänger mit faseroptischem Mehrkanal-Fluoreszenzspektrometer, Probenahmeeinrichtung, Durchflussmessung und Leitparametererfassung Abb : Anwendung des integralen Abstrom-Erkundungsverfahrens in drei Dimensionen Abb : Vergleich der mittels der erweiterten analytischen Lösung und des numerischen Auswerteverfahrens (Programm CSTREAM) invers bestimmten Konzentrationsprofile Abb : Vergleich von vorgegeben mit den mittels CSTREAM invers bestimmten Frachten für unterschiedliche mögliche Positionen der Schadstofffahne Abb : Filterstrecken und Probenahmesektionen der Immissionspumpbrunnen am Standort Sternstrasse Abb : Verlauf der Absenkungen beim Pumpversuch an der Messstelle SafBit 41/1. 4 Abb : Zeitlicher Verlauf der Standardparameter während des Immissionspumpversuchs an der Messstelle SafBit 41/ Abb a: Tiefenprofil der hydraulischen Durchlässigkeit an SafBit 38/ Abb b: Tiefenprofil der hydraulischen Durchlässigkeit an SafBit 4/ Abb c: Tiefenprofil der hydraulischen Durchlässigkeit an SafBit 41/ Abb a: Chlorbenzol an der Messstelle SafBit 41/ Abb c: Chlorbenzol an der Messstelle SafBit 38/ Abb d: Benzol an der Messstelle SafBit 41/ Abb e: Benzol an der Messstelle SafBit 4/
5 Abb f: Benzol an der Messstelle SafBit 38/ Abb : Normierte Tracerdurchbruchskurven an den Immissionspumpbrunnen Abb : Vertikale Diskretisierung im regionalen Modell... 5 Abb : Modellausschnitt für die numerische Inversion der Konzentrationsganglinien. 51 Abb : Modellausschnitt mit verfeinerter vertikaler Diskretisierung (14 Modellschichten) und Position der Pumpbrunnen Abb : Verteilung der hydraulischen Durchlässigkeitsbeiwerte in den 14 Schichten des Modellausschnitts Abb : Beispiel für berechnete und gemessene Absenkungsganglinien an der Grundwassermessstelle SafBit 38/ Abb : Positionen der Multilevel-Probenahmeabschnitte in den untersuchten Messstellen Abb : Numerisch simulierte Isochronen an der Kontrollebene in den Modellschichten 4 bis 1 und Grundwassergleichen für die ungestörte Situation Abb : Mittlere Konzentrationen in den einzelnen Multilevel-Abschnitten entlang der Kontrollebene
6 TABELLENVERZEICHNIS Tab : Geohydraulische Kenndaten für die Brunnen der Variante Tab : Geohydraulische Kenndaten für die Brunnen der Variante Tab : Ergebnisse der Grundwasseranalysen (auszugsweise) Tab : Kenndaten der Brunnen Tab : Hydraulische und Modelldaten an der Messstelle SafBit 38/ Tab : Ergebnis der Dimensionierung Tab : Parametervariation der Aquifermächtigkeit und der Porosität Tab : Pumpbrunnen und Beobachtungsmessstellen... 4 Tab : Tracertestparameter Tab : Mittlere Konzentrationen und Massenflüsse für die untersuchten Kontaminanten Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 2WT9948/ gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor. Die Autoren bedanken sich für die Finanzierung durch das BMBF sowie für die freundliche Unterstützung durch das UFZ Leipzig-Halle GmbH und durch die Firma GFE GmbH. 5
7 1 EINLEITUNG 1.1 Problemstellung und Zielsetzung Die richtige Dimensionierung und Positionierung von In-Situ-Sanierungsreaktoren (bzw. von sog. Reaktiven Wänden ) setzt die Quantifizierung der Schadstofffracht und des räumlichen Ausmaßes der Schadstoffbelastung im Aquifer voraus. Die hierzu erforderliche Erkundung ist problematisch, weil im allgemeinen eine inhomogene Schadstoffverteilung innerhalb des Schadensherdes vorliegt und damit eine räumlich variable Schadstoffverteilung im Grundwasserabstrom zu erwarten ist. Hinzu kommt, dass in heterogenen Aquiferen die räumliche Verteilung der Hydraulik- und Transportparameter eine unregelmäßige Verteilung und Freisetzung der Schadstoffmasse bewirkt. Um die dann in der Regel erforderlichen hohen Erkundungskosten (dichtes Messstellennetz) zu vermeiden, sollte im Rahmen des Forschungsvorhabens eine in ersten Ansätzen zur Verfügung stehende neue Erkundungsmethode weiterentwickelt und eingesetzt werden, die mittels Pumpversuchen und zeitlich aufgelösten Konzentrationsmessungen den gesamten Zustrombereich eines In-Situ-Sanierungsreaktors erfasst und so eine Quantifizierung der gesamten vom Reaktor zu eliminierenden Schadstofffracht sowie eine Bestimmung der räumlichen Verteilung der Schadstoffkonzentration entlang eines Kontrollquerschnitts im Zustrombereich erlaubt. Mit dem neuen, erweiterten Erkundungsverfahren soll ein Standard- Werkzeug zur Verfügung gestellt werden, das einerseits die optimale Dimensionierung eines In- Situ-Sanierungsreaktors, als auch, eingesetzt im Abstrom, die Erfolgskontrolle der Sanierungsmaßnahme ermöglicht. 1
8 2 INTEGRALES ERKUNDUNGSVERFAHREN Bisherige Ansätze zur Erkundung der Schadstoffbelastung im Untergrund basieren auf diskreten, in Grundwassermessstellen gewonnenen Messwerten (Punktwerten), die mit Interpolationsalgorithmen auf den Raum übertragen werden. Eine solche Erkundung liefert in der Regel keine hinreichend sichere Ergebnisse, weil einerseits eine inhomogene Schadstoffverteilung innerhalb der Altlast zu einer räumlich variablen Schadstoffverteilung innerhalb der Abstromfahne beitragen kann. Andererseits führt auch die hydraulische Aquiferheterogenität (bevorzugte Fließwege, geringdurchlässige Aquiferbereiche), die entsprechend den eigenen Voruntersuchungen in Bitterfeld stark ausgeprägt ist (Ptak et al., 1997), zu einer unregelmäßigen räumlichen Verteilung der Schadstoffmasse im Aquifer. Zur Charakterisierung einer solchen Abstromfahne wäre dementsprechend ein sehr dichtes und damit kostenintensives Messnetz erforderlich. Die Erkundungsproblematik ist schematisch in Abbildung 2.1 verdeutlicht. Grundwasserfließrichtung Grundwassermeßstellen Altlastenverdachtsfläche Schadstoffahne Schadstoffquelle (Position i.a. nicht genau bekannt) Abb. 2.1: Schadstoffverteilung im Grundwasserabstrom eines Schadensherdes (die herkömmliche Erkundung mittels Probenahme in einzelnen Messstellen hat eine hohe Unsicherheit) Alternativ sollte daher im Rahmen des Vorhabens eine neue, allerdings bisher nur in ersten Ansätzen zur Verfügung stehende integrale Erkundungsmethode weiterentwickelt und zur Anwendung gebracht werden, die über Pumpversuche und zeitlich aufgelöste Konzentrationsmessungen den gesamten Zustrom eines In-Situ-Sanierungsreaktors sicher erfasst und so eine zuverlässige Quantifizierung der gesamten, vom Reaktor zu eliminierenden Schadstofffracht sowie der mittleren Immissionskonzentration als wichtige Bemessungsparameter im Vorfeld der Abstrom-Sanierungsmaßnahme erlaubt. Zusätzlich bietet die neue Erkundungsmethode die Möglichkeit einer räumlichen Zuordnung von Schadstofffrachten bzw. Konzentrationswerten entlang eines definierten Kontrollquerschnitts im Zustrom eines In-Situ-Reaktors. Damit sollte im Rahmen des SAFIRA-Projektes ein Verfahren entwickelt, erprobt und zur Verfügung gestellt werden, das es später erlaubt, z.b. im Raum Bitterfeld oder auch woanders vor dem Einbau einer Reaktiven Wand routinemäßig alle benötigten Informationen über die Schadstoff- 2
9 belastung im Abstrom eines Schadensherds zuverlässig zu bestimmen und so eine richtige Dimensionierung der Sanierungsmaßnahmen sowie, eingesetzt im Abstrom, die Erfolgskontrolle der Sanierungsmaßnahme zu ermöglichen. 2.1 Kurzbeschreibung zum Prinzip des integralen Erkundungsverfahrens Bei dem neuen Erkundungsverfahren werden an einem definierten Kontrollquerschnitt innerhalb einer Schadstoffahne Pumpmaßnahmen durchgeführt (s. Abb. 2.2), bei denen die Positionen eines oder mehrerer Pumpbrunnen, die Pumpraten und die Pumpzeiten so gewählt werden, dass die Schadstoffahne komplett über ihre gesamte Breite erfasst wird (Immissionspumpversuche). In den Pumpbrunnen werden während der Pumpmaßnahmen für einen oder mehrere Schadstoffe die Konzentrationsganglinien gemessen. Unter Einsatz eines instationären Inversionsalgorithmus und eines numerischen Strömungs- und Transportmodells für den untersuchten Standort lässt sich dann aus den Konzentrationsganglinien die für die Reaktor-Dimensionierung benötigte Gesamt-Schadstofffracht bestimmen. Das Verfahren erlaubt auch die Berechnung der mittleren Immissionskonzentration. Die prinzipielle Vorgehensweise bei dem integralen Erkundungsansatz ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Detaillierte Angaben zur Vorgehensweise bei dem neuen integralen Erkundungsansatz und zu der instationären Inversion der Schadstoff-Konzentrationsganglinien sind z.b. in Schwarz et al. (1997a, b), Teutsch et al. (2), Ptak et al. (2b) sowie Schwarz (22) und Bayer-Raich et al. (21a; 22; 23) enthalten. Falls darüber hinaus die räumliche Zuordnung von Schadstofffrachten bzw. Konzentrationswerten entlang eines definierten Kontrollquerschnitts innerhalb der Abstromfahne erforderlich ist, kann das Erkundungsverfahren zu einem differentiellen Verfahren erweitert werden (Ptak et al., 2b). Dabei betreibt man hintereinander mehrere Pumpbrunnen so, dass sich ihre Einzugsgebiete zeitlich variabel überlappen. Die bei einer Überlagerung der Einzugsgebiete in den Pumpbrunnen gemessenen Konzentrationsganglinien enthalten dann Mehrfachinformation, welche über den instationären Inversionsalgorithmus schließlich die räumliche Zuordnung der Frachten bzw. Konzentrationen am Kontrollquerschnitt erlaubt. Eine infolge der Aquiferheterogenität verbleibende Erkundungsunsicherheit kann dabei über geostatistische / stochastische Ansätze quantifiziert werden. 3
10 Pumpversuche mit Messung von Konzentrations-Zeit-Serien Stoffspezifische Konzentrationsganglinie der Pumpversuche Verdachtsfläche Brunnen 1 Kontrollebene Brunnen 1 Brunnen 2 Brunnen 3 C C C Brunnen 2 Isochronen Schadstoffquellen (Exakte Lage i.a. unbekannt) Brunnen 3 t 1 t t 2 2 t t 3 1 t 2 Schadstofffracht und mittlere Konzentration an der Kontrollebene Instationärer Inversionsalgorithmus und verwendung eines numerischen Strömungs- und Transportmodells Abb. 2.2: Vorgehensweise beim integralen Messansatz zur Bestimmung der Gesamt- Schadstofffracht und der mittleren Immissionskonzentration als Bemessungsparameter zur Dimensionierung von In-Situ-Sanierungsreaktoren im Abstrom eines Schadensherds 4
11 3 ARBEITEN IM PROJEKTZEITRAUM Die Arbeiten im Projektzeitraum umfassten insbesondere Vorbereitungs- und Erkundungsarbeiten zur Festlegung der Kontrollquerschnitte, die Weiterentwicklung und das Testen der instationären Inversionsalgorithmen und der Auswerteprogramme, die Entwicklung, den Bau und das Testen der zugehörigen Pumpbrunnen-Multilevel-Messtechnik, die Weiterentwicklung und das Anpassen eines numerischen Strömungs- und Transportmodells für den Untersuchungsbereich, die Dimensionierung und Durchführung von Multilevel- Immissionspumpversuchen und schließlich die Auswertung der gewonnenen Messdaten. 3.1 Auswahl des Untersuchungsgebiets und numerisches Standortmodell Im Rahmen der Arbeiten zur Festlegung der Kontrollquerschnitte und zur Positionierung neuer Messstellen wurden weitere bereits vorliegende sowie neue Unterlagen zum SAFIRA- Standort, insbesondere die numerischen Modellierung betreffend, gesammelt, durchgesehen und vorläufig bewertet. Zwei vorhandene numerische Standortmodelle wurden näher untersucht. Die gewonnene Information (Daten zum Untergrundaufbau und Kontamination, Modellergebnisse) bestätigten die Notwendigkeit der Erweiterung des integralen Erkundungsverfahrens auf drei Dimensionen. Die beiden numerischen Standortmodelle wurden in Tübingen implementiert. Dabei bestand ein intensiver Kontakt zu den Modellentwicklern. Im Hinblick auf die Auswahl der Kontrollquerschnitte und auf die Logistik der geplanten Feldexperimente erfolgte ein intensiver Austausch mit der SAFIRA-Projektleitung. Aus nicht vorhersehbaren SAFIRA-projektorganisatorischen, wasseraufbereitungstechnischen und genehmigungstechnischen Gründen war es notwendig, von dem ursprünglich während der Erstellung des Projektantrags für die Feldexperimente vorgesehenen ersten Standort abzusehen und zweimal einen neuen zu suchen. Aus diesem Grund mussten wesentliche Arbeitsschritte der Datenerhebung und Modellierung in der Anfangsphase des Projekts zweimal von neuem begonnen werden. Die Positionierung und der Bau der endgültigen Messstellen hat sich entsprechend verzögert. Die Arbeiten zu dem aufgegebenen ersten Standort werden hier nicht dargestellt Einleitende Bemerkungen und Auswahl des Untersuchungsgebiets Im Bitterfelder Revier begann der industrielle Braunkohleabbau 1839 mit der Grube Auguste (vgl. Böhme and Falke, 1999). Ende des 19. Jahrhunderts war die kostengünstige Verfügbarkeit von Kohle als Energieträger ein wichtiger Standortfaktor als Grundlage für die Ansiedlung der chemischen Industrie. So entstand im Jahr 191 im Südteil des heutigen Bitterfelder Chemieparks eine Anlage zur Herstellung von Chlorbenzol, die nach Aussagen von Böhme 5
12 und Falke (1999) als wesentliche Schadstoffquelle für die Chlorbenzolbelastungen im Bereich des Chemieparks, unterstrom des Chemieparks sowie am Mikro-Standort zu betrachten ist. An den Grundwassermessstellen SafBit 2/97, 19/97 und 15/97 bis zum Mikro-Standort wurden Konzentrationen bis z.t. > 1 mg/l nachgewiesen. Für das großräumige Untersuchungsgebiet Bitterfeld liegen regionale hydrogeologische Untersuchungen sowie ein darauf basierendes numerisches Grundwasserströmungsmodell vor (Borkert, 1999a, b). Der Modellumriss ist in Abbildung dargestellt. Basierend auf dem regionalen Grundwasserströmungsmodell wurde für den Bereich des Mikro-Standorts ein numerisches Detailmodell erstellt (Knab und Wenske, 1999) Abb. 1: Umriß des Modellgebietes und des Untersuchungsraumes N M O D E L L G E B I E T W E S U N T E R S U C H U N G S R A U M Chemiepark#Y Vorgesehener Bereich für die Immissionspumpversuche #Y SAFIRA Mikrostandort LEGENDE Straße Bahnlinie Meters Abb : Umriss des Modellgebiets und des zweiten vorgesehenen Untersuchungsraumes Der in Zusammenarbeit mit der SAFIRA-Projektleitung ausgewählte zweite Untersuchungsstandort Hinter dem Bahnhof" zur Durchführung der Immissionspumpversuche im Bereich des Chemieparks ist in Abbildung und Abbildung dargestellt. Ziel der darauffolgend durchzuführenden Modellierung war es, im Abstrom des Chemieparks Immissionspumpversuche so zu dimensionieren, dass ein ausgewählter Kontrollquerschnitt im quartären Grundwasserleiter mit den Einzugsbereichen der Pumpversuche erfasst und nach anschließender Auswertung der Ergebnisse die Schadstofffracht und die mittlere Konzentration über den Kontrollquerschnitt tiefendifferenziert ermittelt werden kann. 6
13 N Abb. 2: Übersichtslageplan zur Dimensionierung der Immissionspumpversuche LEGENDE Straße Bahnlinie W E S Chemiepark Hinter dem Bahnhof #Y Am Kraftwerk #Y Vorgesehener Bereich für die Immissionspumpversuche SAFIRA Mikrostandort Meters Abb : Zweiter Untersuchungsstandort zur Durchführung der Immissionspumpversuche im Bereich des Chemieparks Hydrogeologische Verhältnisse Der zentrale Untersuchungsraum umfasst den südlichen Bereich des Bitterfelder Chemieparks sowie den südöstlich gelegenen Bereich des SAFIRA Mikro-Standorts (s. Abb ). Eine ausführliche Beschreibung der hydrogeologischen Gegebenheiten ist in Böhme und Falke (1999) gegeben. Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich der Muldeniederung ca. 4 m vom ehemaligen südwestlichen Uferrand als Verbreitungsgrenze der Niederterrasse entfernt. Die ursprünglich sedimentierten früh- und mittelpleistozänen Ablagerungen sind in diesem Bereich vollständig erodiert und durch weichselkaltzeitliche Niederterrassenschotter der Mulde sowie jüngere Terrassenschotter einer Lokalfazies und holozäne Flusssedimente ersetzt und bilden einen eigenständigen, hochdurchlässigen Grundwasserleiter (GWL 11). An den Verbreitungsrändern tangiert der Schotterkörper jeweils ältere, pleistozäne Sedimentfolgen (Schmelzwasserkiessande mit Geschiebemergeleinlagerungen), im Westen eine tertiäre Glimmersandrückenstruktur sowie Abraummassen ehemaliger Braunkohlentagebaue. Zum Liegenden wird der quartäre Grundwasserleiter 11 am Mikro-Standort durch das Bitterfel- 7
14 der Flöz mit Restmächtigkeiten zwischen 6 bis 8 m sowie im nordwestlichen Anstrom und im Bereich des Chemieparks direkt von den Bitterfelder Glimmersanden (GWL 5) unterlagert. Die Basis der Bitterfelder Glimmersande bildet der flächenhaft verbreitete grundwasserstauende Komplex Glaukonitschluff und Rupelton. Generell ist von einem regionalen hydraulischen Zusammenhang und einer geochemischen Verwandtschaft der erkundeten Grundwasserleiter 11 und 5 auszugehen. Das hydraulische Potential liegt im GWL 11 (weichselkaltzeitliche Niederterrassenschotter) ca..2 m über dem Potential des GWL 5 (Bitterfelder Glimmersande). Das Grundwassergefälle im GWL 11 betrug im bisherigen Untersuchungszeitraum von 1996 bis 1999 im großräumigen Bereich des Mikro-Standorts zwischen.2 und.8 und war dabei von Westen nach Osten ausgerichtet. Bei durchschnittlichen Durchlässigkeitsbeiwerten von 5.E-4 1.E-3 m/s ergeben sich Abstandsgeschwindigkeiten zwischen.4 und.28 m/d, wobei jedoch Differenzierungen sowohl in vertikaler als auch horizontaler Richtung aufgrund von unterschiedlichen Durchlässigkeiten vorhanden sind. Die Grundwasserströmungsrichtung im GWL 5 ist ebenfalls nach Osten ausgerichtet und beträgt im Bereich des Untersuchungsgebietes bis zu 3. Aufgrund der geringen Durchlässigkeiten der Bitterfelder Glimmersande sind die Abstandsgeschwindigkeiten 1 bis 2 Größenordnungen geringer als im GWL 11. Somit ist im GWL 5 trotz einer wesentlich größeren wassererfüllten Mächtigkeit mit geringeren Volumenströmen als im GWL 11 zu rechnen. Die Aufzeichnungen der Grundwasserstände im o.g. Zeitraum weisen für beide Grundwasserleiter Grundwasserspiegelschwankungen von max..7.8 m auf. Mit den Flutungsmaßnahmen des Tagebaurestlochkomplexes Goitsche ist ein regionaler Grundwasseranstieg zu erwarten, der auch die Grundwasserstände am Standort SAFIRA beeinflussen wird Vorerkundung mittels Flowmetermessungen und Multilevel-Probenahme Flowmetermessungen stellen eine effiziente Methode zur Bestimmung von vertikalen k f -Profilen in einer Grundwassermessstelle dar. Bei der Flowmetermessung wird durch Abpumpen von Grundwasser eine Strömung in der Messstelle induziert und mit einer Flowmetersonde die Strömungsgeschwindigkeit als Funktion der Tiefe gemessen. Aus dem Vertikalprofil der Strömungsgeschwindigkeit lässt sich dann der Grundwasserzufluss in die Messstelle als Funktion der Tiefe berechnen. Unter Verwendung entsprechender Auswerteansätze kann aus diesen Flowmeterprofilen anschließend die vertikale Verteilung der hydraulischen Durchlässigkeit im Bereich der Messstelle ermittelt werden. Abbildung zeigt eine Prinzipskizze des Flowmeter-Messverfahrens. 8
15 Voraussetzung für die Auswertung ist je nach Auswerteansatz die Kenntnis der Transmissivität (bzw. des mittleren Durchlässigkeitsbeiwerts) an der Messstelle oder der lokalen Absenkung an einzelnen Tiefenstufen der Messstelle während des Pumpvorgangs. Bei bekanntem tiefengemittelten k f -Wert des Aquifers lässt sich für den praxisorientierten Fall der Annahme einer horizontalen Schichtung im Bereich der Messstelle der folgende Zusammenhang zwischen dem differentiellen Zufluss in einer bestimmten Tiefe ªQ(z) und dem lokalen hydraulischen Durchlässigkeitsbeiwert k f (z) aufstellen (z.b. Molz et al., 1989): k k fi fges = Q i/ zi Q /m ges (3.1) mit: k fi [m/s] k fges [m/s] = hydraulischer Durchlässigkeitsbeiwert im Tiefenintervall i = hydraulischer Durchlässigkeitsbeiwert des Gesamtaquifers (z. B. aus Pumpversuch) ªQ i [m 3 /s] = differenzieller Zufluss im Tiefenintervall i ªz i [m] = Mächtigkeit des Tiefenintervalls i Q ges [m 3 /s] = Pumprate = 3ªQ i. Flowmetermessungen lassen sich prinzipiell auf zwei Arten durchführen. Bei der stationären Messung wird die Strömungsgeschwindigkeit in der Grundwassermessstelle in verschiedenen Tiefen nacheinander bei unbewegter Flowmetersonde gemessen. Messungen können erst ab einer Strömungsgeschwindigkeit, die größer ist als die Ansprechgeschwindigkeit der Sonde, durchgeführt werden. Bei der weniger zeitaufwendigen dynamischen Messung wird die Flowmetersonde dagegen mit einer konstanten Geschwindigkeit, die größer als die Ansprechgeschwindigkeit der Flowmetersonde ist, entgegengesetzt der in der Messstelle induzierten Strömung bewegt. Somit können Messungen über den gesamten Aquiferbereich erhalten werden. Die dynamische Messung setzt eine absolut konstante Pumprate voraus. Bei der stationären Messung kann dagegen den Schwankungen der Pumprate mittels einer Integration über einen von der Frequenz der Schwankungen abhängigen Zeitraum begegnet werden. Anhand der erhaltenen vertikalen Durchlässigkeitsprofile lassen sich z.b. Zonen hoher Durchlässigkeit (bevorzugte Fliesswege) detektieren, die Heterogenität des Aquifers beurteilen und geostatistische Strukturparameter (Korrelationslängen in vertikaler und ggf., je nach Messstellendichte, auch in horizontaler Richtung) ableiten. Diese Ergebnisse der Flowmetermessungen sind wichtig zur Modellierung der Strömung und des Transports im Grundwasser, wie sie beispielsweise im Rahmen der Dimensionierung der Reaktionswände durchgeführt werden muss. 9
16 Q P to Data-Logger Land Surface Pump Well Casing Cap Rock Well Screen Data Borehole Flowmeter Z Rubber Seal Q Abb : Prinzipskizze des Flowmeter-Messverfahrens (nach Molz et al., 1989) Im Rahmen der Vorerkundung in Bitterfeld wurde ein erstes Flowmeterprofil an der Messstelle SafBit 38/98 (S Randbereich Chemiepark) gemessen. Weil die in Bitterfeld bereitgestellte Benzinmotorpumpe Schwankungen der Pumprate aufwies, wurde für die Flowmetermessung der stationäre Messansatz gewählt. Das Flowmeterprofil wurde mit einer Impellersonde (Sondendurchmesser 9 mm, 76.5 mm Impeller) ermittelt. Für die Abstände der einzelnen Flowmeterprofil-Messpunkte wurden 5 cm gewählt. Dies entspricht bei der dann resultierenden verfilterten und wassererfüllten Mächtigkeit des Grundwasserleiters von 4.1 m an der Messstelle SafBit 38/98 einer Auflösung von 1.25%. Das aus den Flowmetermessungen und der Auswertung mittels Formel 3.1 resultierende vertikale Profil der hydraulischen Durchlässigkeit ist in Abbildung dargestellt. 1
17 Flowmetermessungen[kf in m/s] ,E-5 1,E-4 1,E-3 1,E-2 Abb : Profil der hydraulischen Durchlässigkeit an der Messstelle SafBit 38/98 Anhand der Flowmetermessungen lässt sich somit eine deutliche vertikale Differenzierung der hydraulischen Durchlässigkeit nachweisen und die Notwendigkeit der Erweiterung des integralen Erkundungsverfahrens auf drei Dimensionen bestätigen. Die Grundwassermessstelle SafBit 38/98 wurde anschließend mit einem Multilevel- Probenahmesystem (s. Ptak et al. 2a) ausgestattet. Durch die Einrichtung dieser Multilevel- Messstelle konnten die in diesem Bereich direkt übereinanderliegenden GWL 11 und 5 über 12 Horizonte bis zur Basis des GWL 5 beprobt werden. Nach einer Erstbeprobung konnten insbesondere Monochlorbenzol und Benzol über beide Grundwasserleiter nachgewiesen werden, wobei die höchsten Werte an der Quartärbasis (GWL 11) und im höher durchlässigen oberen Bereich der Bitterfelder Glimmersande (GWL 5) ermittelt wurden. Die Kontamination war über das gesamte Vertikalprofil nachweisbar, wobei Werte zwischen ca. 1 und mehr als 1 mg/l gemessen wurden. 11
18 3.1.3 Numerisches Grundwasserströmungsmodell Wie eingangs bereits erläutert wurde im Rahmen des SAFIRA-Projekts ein regionales Grundwasserströmungsmodell erstellt (Borkert, 1998, 1999a und 1999b), welches eine Fläche von 39 km 2 (6 km x 6.5 km) umfasst. Basierend auf diesem Grundwasserströmungsmodell wurde für Untersuchungen am Mikro-Standort ein Ausschnittsmodell abgeleitet, das eine Fläche von ca..56 km 2 (.75 x.75 km) abbildet (Knab und Wenske, 1999). Bei den Untersuchungen zur Dimensionierung der Immissionspumpversuche wurde auf das Regionalmodell zurückgegriffen (Borkert, 1999b), da der Modellumgriff des Ausschnittsmodells in zu geringer Entfernung zu den geplanten Immissionspumpversuchen lag und somit eine Beeinflussung der Pumpversuche durch die nahegelegenen Modellränder nicht auszuschließen war. Der Aufbau und die Fortschreibung des Regionalmodells ist in Borkert (1998, 1999a und 1999b) dokumentiert. Im folgenden werden die wesentlichen Charakteristika des Regionalmodells kurz erläutert: Das dreidimensionale Modell wurde für den numerischen Finite-Differenzen- Programmcode MODFLOW (McDonald und Harbaugh, 1988) erstellt. Das Modellgebiet erstreckt sich zwischen den Koordinaten 4519 und 4525 in West-Ost Richtung sowie 5724 bis in Nord-Süd Richtung und umfasst somit eine Fläche von 39 km 2. Das Finite-Differenzen-Gitter weist in der Ebene großräumig eine Rasterweite zwischen 25 m und 2 m auf. Die vertikale Diskretisierung umfasst 8 Schichten. Dabei bilden die Schichten 1-4 den quartären Grundwasserleiter 11 ab. Die Schichten 5-8 stellen, falls vorhanden, die stauenden Kohleschichten, ansonsten den tertiären Grundwasserleiter 5 dar. Die Verteilungen der geohydraulischen Parameter für die einzelnen Schichten und die Belegung der Randbedingungen sind den o.g. Modelldokumentationen zu entnehmen. Die durchschnittliche Grundwasserneubildung beträgt rund 3.1 l/s/km 2. Die stationäre Eichung erfolgte anhand einer Stichtagsmessung für den Mai 1999 für den quartären Grundwasserleiter 11 (Modellschicht 4) für ungespannte Grundwasserströmungsverhältnisse. Für den Untersuchungsraum wurden mittlere Gradienten von.1 ermittelt (s. Abb ). Für die Dimensionierung der Immissionspumpversuche waren weitere Modelländerungen notwendig, die u.a. eine geeignete Anpassung der horizontalen Diskretisierung im Bereich der Immissionspumpversuche beinhalteten. So wurde im direkten Bereich der Pumpbrunnen eine Netzverfeinerung bis auf eine Elementgröße von 1 x 1 m vorgenommen (s. Abb ). 12
19 Abb. 3: Horizontale Modelldiskretisierung im Bereich der Immissionspumpversuche für die Variante 1 N W E 75.7 S V1_Br4 #Y #Y V1_Br LEGENDE #Y V1_Br1 Brunnenstandort mit Bezeichnung 75.8 #Y V1_Br Druckhöhen in mnn aus der Modelleichung (Modellschicht 4) Modelldiskretisierung Straße Bahnlinie #Y V1_Br Meters 75.6 Abb : Horizontale Modelldiskretisierung und Grundwassergleichen im Bereich der geplanten Immissionspumpversuche Abbildung zeigt als Beispiel die Verteilung der hydraulischen Durchlässigkeit in der Modellschicht 4. 13
20 Abb. 5: Verteilung der horizontalen Durchlässigkeitsbeiwerte (Modellschicht 4) im Bereich des Untersuchungsgebietes N W E S LEGENDE Kf-Werte (m/s) x x x x x V1_Br4 Chemiepark #Y #Y V1_Br3 #Y #Y V1_Br V1_Br #Y V1_Br1 Brunnenstandort mit Bezeichnung Modelldiskretisierung Straße Bahnlinie Meters Abb : Verteilung der horizontalen Durchlässigkeitsbeiwerte in der Modellschicht 4 im Bereich des Untersuchungsgebiets 3.2 Dimensionierung der Immissionspumpversuche am zweiten Untersuchungsstandort Kriterien zur Dimensionierung Die wichtigsten Kriterien zur Dimensionierung der Immissionspumpversuche, d.h. zur Festlegung der Brunnenpositionen, der Pumpraten und der Pumpzeiten, sind nachfolgend zusammengefasst: Im bepumpten Abstromquerschnitt sollte sichergestellt sein, dass Schadstoffbelastungen vorliegen, die deutlich oberhalb der Nachweisgrenzen liegen. Der Abstromquerschnitt sollte unterstromig des Chemie-Parks liegen und nach Möglichkeit senkrecht zur Abstromrichtung positioniert werden, um durch die Pumpversuche eine optimale Querschnittlänge zu erfassen. Im Abstromquerschnitt sollte möglichst ein vollständiges Querprofil im quartären Grundwasserleiter (GWL 11) erfasst werden. Das bedeutet für die Dimensionierung der Immissionspumpversuche, dass sich die jeweiligen Isochronen nach der maximalen Pumpdauer (Pumpversuchsende) jedes separat durchzuführenden Pumpversuches tangieren bzw. überlappen sollten. 14
21 Die Wahl eines geeigneten Abstromquerschnitts war durch die lokalen Gegebenheiten auf den unmittelbaren Bereich Hinter dem Bahnhof und dort auf den Abschnitt zwischen den Bohrungen BVV 34, GWM 19/91 und BVV 124 beschränkt. Die Festlegung dieses Bereiches erfolgte nach telefonischer Absprache mit dem Standortbüro GFE GmbH. Weiterhin sollte die Anzahl der zu erstellenden Pumpbrunnen, die Pumpdauer je Pumpbrunnen und die Entnahmerate unter der Vorgabe eines maximal erreichbaren / bepumpbaren Abstromquerschnitts so dimensioniert werden, dass sichergestellt wird, dass ein vorgegebenes finanzielles Volumen nicht überschritten wird. Bei der Kostenkalkulation sind die folgenden Positionen zu berücksichtigen: Standortgenehmigung, Brunnenausbau mit Kurzpumpversuch, Bohrlochgeophysik vor und nach Brunnenausbau, Einmessung (Bohransatzpunkt und nach Brunnenerstellung), geologische Profilaufnahme, Siebanalytik, Entsorgungsleitungen, Durchführung Immissionspumpversuch, Abwasserentsorgung, Pumpversuchsauswertung, Schadstoffanalytik. Als weitere Vorgabe durften die maximalem Grundwasserabsenkungen im sich östlich anschließenden Gleisbereich.1 m nicht überschreiten, um die Gefährdung durch Setzungsschäden an den Gleisanlagen so gering wie möglich zu halten Variantenbetrachtungen Vorgehensweise und Vorstudien Da die durch die Pumpversuche bedingte Grundwasserabsenkung im sich östlich anschließenden Gleisbereich nicht mehr als.1 m im quartären Grundwasserleiter betragen sollte, war zu Beginn der Dimensionierung eine maximale Pumprate zu ermitteln, bei welcher nach rund 5 bis 1 Tagen Pumpdauer dieses Kriterium eingehalten wird. Bei Entnahmeraten von 1 l/s lagen die ermittelten Grundwasserabsenkungen bei mehr als.1 m und waren somit nicht tolerierbar. Erst eine Verminderung der Pumpraten auf 7.5 l/s stellte geringere Absenkungen als.1 m im Bereich der Bahntrasse sicher. Auf Grund dessen war die maximale Pumprate somit als limitierender Faktor vorgegeben. Weiterhin sollte während der Pumpversuche ein möglichst großes Einzugsgebiet bepumpt werden, so dass die untere Grenze für die Entnahmerate mit 5 l/s ermittelt wurde. Wären deutlich geringere Entnahmeraten gewählt worden, so hätte sich auch die Breite der bepumpten Einzugsgebiete verringert, so dass entsprechend mehr Bohrungen / Pumpbrunnen notwendig gewesen wären um eine vorgegebene Abstrombreite zu erfassen. Hinsichtlich der zu wählenden Pumpdauer ergab sich unter den vorliegenden hydrogeologischen und hydraulischen Verhältnissen folgender Sachverhalt: Der größte Anteil an der Gesamtbreite beim Bepumpen der Einzugsgebiete stellt sich nach den ersten 4 bis 5 Tagen Pumpbetrieb ein. Anschließend ist noch weitere 2 bis 3 Tage mit akzeptablen Zuwächsen hinsichtlich der Einzugsgebietsgrößen zu rechnen. Ab ca. 1 Woche Pumpdauer ist das Ver- 15
22 hältnis von Entnahmevolumen zu Breitenzuwachs deutlich abnehmend, so dass weiteres und somit länger andauerndes Pumpen nicht mehr als effektiv angesehen werden kann (Förderkosten, Abwasser, Reinigung etc.). Möchte man einen größeren Radius mit der Pumpmaßnahme erzielen, so sind größere Pumpraten zu wählen. In der vorliegenden Studie waren größere Entnahmemengen aus den o.g. Gründen jedoch nicht möglich. Auf Basis der Ergebnisse der Vorstudie ergaben sich zwei Optimierungsvarianten mit Entnahmeraten von 5 und 7.5 l/s Variante 1 (Q = 5 l/s) In der ersten Variante wurde die Optimierung der Brunnenstandorte für eine 7-tägige Pumpdauer und eine konstante Entnahmerate von 5 l/s durchgeführt. Modelltechnisch wurde die gesamte Entnahmemenge in Modellschicht 4 bei gleichzeitiger Erhöhung der vertikalen k f - Werte der quartären Schichten im Bereich der Brunnen-Filterstrecken angesetzt, so dass sich eine automatische Verteilung der Entnahmemengen - anteilig den Transmissivitäten der quartären Modellschichten - auf die Modellschichten 2, 3 und 4 ergab. Die Entnahmeraten der einzelnen Schichten sind in Tabelle dargestellt. Weiterhin sind in der Tabelle die hydrogeologischen Kenndaten am jeweiligen Brunnenstandort sowie die genauen Lagekoordinaten eingetragen. Unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Budgets wurde die Optimierung für 4 neu zu erstellende Brunnen durchgeführt. Bei 4 Brunnenstandorten und den o.g. Randbedingungen ergibt sich für die Variante 1 ein berechneter Abstromquerschnitt von ca. 2 m, der mit den Immissionspumpversuchen erfasst werden kann (vgl. Abb ). Tab : Geohydraulische Kenndaten für die Brunnen der Variante 1 Layer K f -Werte (m/s) S n e V1_Br1 V1_Br2 V1_Br3 K x K y K z (1/m) ( - ) M Q M Q M Q (m) (l/s) (m) (l/s) (m) (l/s) V1_Br4 M Q (m) (l/s) 1 1E-5 1E-5 1E-6 3E E-4 3E-4 4E-5 3E E-4 7E-4 7E-5 3E E-3 2E-3 5E-5 3E E-4 3E-4 4E-5 3E E-4 3E-4 4E-5 3E E-4 3E-4 4E-5 3E E-5 7E-5 9E-6 3E Lagekoordinaten der Brunnen (Gauss-Krüger) Hochwert Rechtswert
23 Abb. 6: Berechnete Einzugsgebiete für die Variante V1_Br4 Chemiepark #Y #Y #Y #Y V1_Br3 V1_Br2 LEGENDE V1_Br V1_Br1 #Y Brunnenstandort mit Bezeichnung Einzugsgebiete r N Straße W E Bahnlinie S Meters Abb : Simulation der Einzugsgebiete für die Variante Variante 2 (Q = 7.5 l/s) Die Variante 2 basiert auf einer Optimierung mit einer konstanten Entnahmerate von 7.5 l/s über den Zeitraum von einer Woche. Die geohydraulischen Parameter an den einzelnen Brunnenstandorten sowie die Lagekoordinaten sind in Tabelle eingetragen. Die Optimierung wurde unter Berücksichtigung des verfügbaren Budgets ebenfalls für 4 Brunnenstandorte durchgeführt. Unter den o.g. Randbedingungen ergibt sich ein Abstromquerschnitt von rund 24 Metern Länge in Modellschicht 4, der mit den Immissionspumpversuchen der Variante 2 erfasst werden kann (vgl. Abb ). 17
24 Tab : Geohydraulische Kenndaten für die Brunnen der Variante 2 Layer K f -Werte (m/s) K x K y K z S (1/m) n e ( - ) V2_Br1 M Q (m) (l/s) V2_Br2 M Q (m) (l/s) V2_Br3 M Q (m) (l/s) V2_Br4 M Q (m) (l/s) 1 1E-5 1E-5 1E-6 3E E-4 3E-4 4E-5 3E E-4 7E-4 7E-5 3E E-3 2E-3 5E-5 3E E-4 3E-4 4E-5 3E E-4 3E-4 4E-5 3E E-4 3E-4 4E-5 3E E-5 7E-5 9E-6 3E Lagekoordinaten der Brunnen (Gauss-Krüger) Hochwert Rechtswert Abb. 7: Berechnete Einzugsgebiete für die Variante V2_Br Chemiepark #Y #Y #Y #Y V2_Br3 V2_Br2 LEGENDE V2_Br V2_Br1 #Y Brunnenstandort mit Bezeichnung Einzugsgebiete r N Straße W E Bahnlinie S Meters Abb : Simulation der Einzugsgebiete für die Variante 2 18
25 3.3 Arbeiten am Standort Hinter dem Bahnhof Die Auswahl des Bereichs Hinter dem Bahnhof, der als zweiter Standort für die geplanten Feldversuche in Bitterfeld vorgesehen war, ist zusammen mit den hydrogeologischen Verhältnissen am SAFIRA-Standort sowie mit der Modellierung und Dimensionierung der Immissionspumpversuche oben detailliert beschrieben. Im Jahr 21 wurde mit den Bohrarbeiten im Bereich Hinter dem Bahnhof begonnen und zunächst die Bohrungen SafBit 39/1 und SafBit 39z/1 (2"-Ausbau zur Tracerzugabe) an der für die Immissionspumpversuche vorgesehenen Stelle abgeteuft und ausgebaut (s. Projekt- Zwischenbericht für das Jahr 21, Bauer et al., 22). Anschließend wurden Siebproben analysiert (k f -Werte m/s bis m/s), ein Pumpversuch mit 1.7 l/s und einer Pumpdauer von 7 min durchgeführt und ausgewertet (k f = m/s, Speicherkoeffizient ), und es wurden Grundwasserproben genommen und analysiert. Die Analyse der Grundwasserproben ergab eine sehr hohe Belastung (Tab ). Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) und die absorbierbaren organisch gebundenen Halogene (AOX) lagen weit über den zulässigen Grenzwerten für die zunächst vorgesehene Einleitung des gepumpten Grundwassers in das Reinabwassernetz. Auch die LHKW-Konzentrationen waren sehr hoch, ebenso wie die Phosphor-Konzentrationen (bis 252 mg/l). Tab : Ergebnisse der Grundwasseranalysen (auszugsweise) Grenzwert Einleitung Reinabwasser Anfang PV Anfang PV Mitte PV Ende PV CSB (mg/l) AOX (mg/l) Summe LHKW (mg/l) Auch ist zu erwähnen, dass unerwartet sehr hohe Pestizidkonzentrationen im Grundwasser festgestellt wurden, die eine Aufbereitung in der Kläranlage unmöglich machten. Der vorgesehene Versuchsstandort Hinter dem Bahnhof musste unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Projektmittel daher aufgegeben und ein neuer, dritter gesucht werden. 19
26 3.4 Auswahl des dritten Untersuchungsstandorts, Dimensionierung der Immissionspumpversuche und Bau von neuen Grundwassermessstellen Kriterien zur Dimensionierung Zur Definition des neuen, dritten Untersuchungsgebiets und zur Dimensionierung der Immissionspumpversuche wurden folgende Kriterien festgelegt: Im bepumpten Abstromquerschnitt sollte sichergestellt sein, dass Schadstoffbelastungen vorliegen, die deutlich oberhalb der Nachweisgrenzen liegen. Der Abstromquerschnitt sollte unterstrom des Chemie-Parks liegen und nach Möglichkeit senkrecht zur Abstromrichtung positioniert werden, um durch die Pumpversuche eine optimale Querschnittlänge zu erfassen. Im Abstromquerschnitt sollte möglichst ein vollständiges Querprofil im quartären Grundwasserleiter (GWL 11) erfasst werden. Das bedeutet für die Dimensionierung der Immissionspumpversuche, dass sich die jeweiligen Isochronen nach der maximalen Pumpdauer (Pumpversuchsende) jedes separat durchzuführenden Pumpversuches tangieren bzw. überlappen sollten. Die Wahl eines geeigneten Abstromquerschnitts war durch die lokalen Gegebenheiten auf den unmittelbaren Bereich Sternstrasse (s. Abb ) in der Umgebung der Messstelle SafBit 38/98 beschränkt. Die Festlegung dieses Bereiches erfolgte nach Absprache mit der Firma GFE GmbH. Als weitere Vorgabe durften die maximalem Grundwasserabsenkungen im sich östlich anschließenden Gleisbereich.1 m nicht überschreiten, um die Gefährdung durch eventuelle Setzungsschäden an den Gleisanlagen so gering wie möglich zu halten Dimensionierung der Immissionspumpversuche und Bau neuer Grundwassermessstellen am dritten Untersuchungsstandort Am dritten Untersuchungsstandort im Bereich Sternstrasse (Abb ) war es war erforderlich, neue Grundwassermessstellen für die Durchführung der Immissionspumpversuche zu erstellen, da in der Sternstrasse nur die Messstelle SafBit 38/98 zur Verfügung stand. 2
27 Abb : Dritter Untersuchungsstandort Sternstrasse und Lage der neuen Grundwassermessstellen Da die durch die Pumpversuche bedingte Grundwasserabsenkung im sich östlich anschließenden Gleisbereich nicht mehr als.1 m im quartären Grundwasserleiter betragen sollte, war zu Beginn der Dimensionierung eine maximale Pumprate zu ermitteln, bei welcher nach rund 5 bis 1 Tagen Pumpdauer dieses Kriterium eingehalten wurde. 21
28 Für die Dimensionierung und Simulation der Immissionspumpversuche stand das oben in Kapitel beschriebene numerische Standortmodell zur Verfügung, das aufgrund des weiteren Standortwechsels nochmals modifiziert werden musste. Bei Entnahmeraten von 1 l/s lagen die ermittelten Grundwasserabsenkungen bei mehr als.1 m und waren somit nicht tolerierbar. Erst eine Verminderung der Pumpraten auf 7.5 l/s stellte geringere Absenkungen als.1 m im Bereich der Bahntrasse sicher. Auf Grund dessen war die maximale Pumprate somit als limitierender Faktor vorgegeben. Werden deutlich geringere Entnahmeraten gewählt (z.b. 5. l/s), so verringert sich auch die Breite der bepumpten Einzugsgebiete deutlich, so dass entsprechend mehr Bohrungen bzw. Pumpbrunnen notwendig sind, um eine vorgegebene Abstrombreite zu erfassen. Hinsichtlich der zu wählenden Pumpdauer ergab sich unter den vorliegenden hydrogeologischen und hydraulischen Verhältnissen folgender Sachverhalt: Der Großteil an der Gesamtbreite des bepumpten Einzugsgebiets stellt sich nach den ersten 4 bis 5 Tagen Pumpbetrieb ein. Anschließend kann noch weitere 2 bis 3 Tage mit akzeptablen Zuwächsen hinsichtlich der Einzugsgebietsgrößen gerechnet werden. Ab ca. 1 Woche Pumpdauer ist das Verhältnis von Entnahmevolumen zu Breitenzuwachs deutlich abnehmend, so dass weiteres und somit länger andauerndes Pumpen nicht mehr effektiv ist (Förderkosten, Abwasser, Reinigung etc.). Größere Einzugsgebietsbreiten wären nur durch höhere Pumpraten zu erreichen, was in der vorliegenden Situation aus den o.g. Gründen jedoch nicht möglich war. Die resultierenden erforderlichen Messstellen- bzw. Pumpbrunnenabstände sind in Abbildung dargestellt. Der Ausbau der neuen Messstellen und die geologischen Profile sind im Projekt- Zwischenbericht für das Jahr 21, Bauer et al. (22), enthalten. Die Berechnungen und Optimierungen wurden für eine bis zu 7-tägige Pumpdauer und eine konstante Entnahmerate von 7.5 l/s durchgeführt. Modelltechnisch wurde die gesamte Entnahmemenge in Modellschicht 4 bei gleichzeitiger Erhöhung der k f -Werte in den Brunnenzellen der quartären Schichten angesetzt, so dass sich eine automatische Verteilung der Entnahmemengen - anteilig den Transmissivitäten der quartären Modellschichten - auf die Modellschichten 2, 3 und 4 ergab. Die Kenndaten der verwendeten Pumpbrunnen sind in Tabelle zu finden. Die endgültigen Pumpzeiten wurden aufgrund der tatsächlichen (nach dem Bau der neuen Messstellen ermittelten) Abstände der Messstellen untereinander sowie der an der Messstelle SafBit 38/98 ermittelten Werte für die hydraulische Durchlässigkeit und die Porosität (vgl. Tab ) festgelegt. Dabei galt es, an den Brunnen die jeweils minimale Pumpzeit bei vorgegebener Überlappung der Einzugsbreiten zu erhalten. Die Abstände der Messstellen wurden auf die Strömungsrichtung projiziert, die ungefähr einen Winkel von 35 mit der Sternstrasse bildet, so dass die zu überdeckenden Abstände geringer sind. Die Ergebnisse der Dimensionierung sind in Tabelle dargestellt. Die insgesamt erfasste Breite beträgt 134 m. Die 22
29 Festlegung von Versuchsdauer, Probenahmeintervallen und der Reihenfolge der Versuche erfolgte unter Verwendung einer vereinfachten analytischen Lösung, die den Einfluss der Grundströmung vernachlässigt. Der gewählte Probenahmezyklus orientiert sich dabei an der Entwicklung der Entnahmebreite des jeweiligen Pumpversuchs. Erforderlich ist eine Beprobung in räumlich äquidistanten Schritten bezogen auf die Vergrößerung der Einzugsgebietes. Von besonderem Einfluss ist hierbei die Porosität und die Aquifermächtigkeit, die die zu erreichende Entnahmebreite wesentlich beeinflussen. Da a priori weder die genaue Mächtigkeit des GWL 11 noch die Porosität bekannt war, wurde die Pumpdauer zum Erreichen der notwenigen Entnahmebreite in Abhängigkeit dieser Parameter für mehrere Parameterwerte errechnet. Das Ergebnis, dargestellt in Tabelle 3.4.4, zeigt, dass bei hoher Porosität und Aquifermächtigkeit bis zu zwei Wochen gepumpt werden müsste, um einen Querschnitt von 5 m zu beproben. Eine genauere Bestimmung der erfassten Entnahmebreite war nur nach der Durchführung der Pumpversuche möglich, nachdem die hydraulischen Verhältnisse genauer quantifiziert werden konnten. Zwischen den einzelnen Immissionspumpversuchen wurde eine mindestens 48-stündige Pause eingeplant, in der der Wiederanstieg des Wasserspiegels gemessen werden konnte. Tab : Kenndaten der Brunnen GWMS kurz Rechtswert Hochwert ROK mnn Gelände mnn SafBit 2/97 2/ SafBit 38/98 38/ Saf Bit 4/1 4/ Saf Bit 41/1 41/ Saf Bit 42/1 42/ Saf Bit 43/1 43/ Saf Bit 44/1 44/ Saf Bit 45/1 45/ Tab : Hydraulische und Modelldaten an der Messstelle SafBit 38/98 Layer KFx [m/s] KFy [m/s] KFz [m/s] S [1/m] ne [-] m [m] 1 1.E-5 1.E-5 1.E-6 3.E E-4 3.E-4 4.E-5 3.E E-4 7.E-4 7.E-5 3.E E-3 2.E-3 5.E-5 3.E E-4 3.E-4 4.E-5 3.E E-4 3.E-4 4.E-5 3.E E-4 3.E-4 4.E-5 3.E E-5 7.E-5 9.E-6 3.E
Vergleich IPV-Tool und C-SET
 Auswertung von Immissionspumpversuchen an zwei Beispielen aus dem Berner Oberland Aus Sicht des Praktikers Gliederung: Übersicht Annahmen / Grundvoraussetzungen Fallbeispiel Meiringen Fallbeispiel Thun
Auswertung von Immissionspumpversuchen an zwei Beispielen aus dem Berner Oberland Aus Sicht des Praktikers Gliederung: Übersicht Annahmen / Grundvoraussetzungen Fallbeispiel Meiringen Fallbeispiel Thun
Bestimmung vertikaler kf -Wert Verteilungen Detektierung hydraulischer Kurzschlüsse horizontierte Probenahme kombinierter Immissionspumpversuch
 Thermo-Flowmeter Bestimmung vertikaler kf -Wert Verteilungen Detektierung hydraulischer Kurzschlüsse horizontierte Probenahme kombinierter Immissionspumpversuch Peter Halla (Dipl.Geol.) Berghof Analytik
Thermo-Flowmeter Bestimmung vertikaler kf -Wert Verteilungen Detektierung hydraulischer Kurzschlüsse horizontierte Probenahme kombinierter Immissionspumpversuch Peter Halla (Dipl.Geol.) Berghof Analytik
Peter Rothschink Auswertung von Immissionspumpversuchen mit Hilfe des IPV-Tools - Abstract -
 TASK Symposium, Leipzig 30.06.-01-07.2010 Peter Rothschink Auswertung von Immissionspumpversuchen mit Hilfe des IPV-Tools - Abstract - Bei der Gefährdungsbeurteilung für das Schutzgut Grundwasser ist bei
TASK Symposium, Leipzig 30.06.-01-07.2010 Peter Rothschink Auswertung von Immissionspumpversuchen mit Hilfe des IPV-Tools - Abstract - Bei der Gefährdungsbeurteilung für das Schutzgut Grundwasser ist bei
Mathcad Berechnung hydraulischer Verluste fluidführender Systeme
 WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Mathcad Berechnung hydraulischer Verluste fluidführender Systeme Dipl.-Ing. Carsten Hüge Agenda > Beschreibung der Problemstellung Definition der Druckverluste
WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Mathcad Berechnung hydraulischer Verluste fluidführender Systeme Dipl.-Ing. Carsten Hüge Agenda > Beschreibung der Problemstellung Definition der Druckverluste
11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014
 11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014 Auswirkungen der thermischen Nutzung des Grundwassers im Stadtgebiet Biberach: Brauchen wir ein thermisches Management? Dr. Rainer Klein, boden & grundwasser
11. Biberacher Geothermietag am 23. Oktober 2014 Auswirkungen der thermischen Nutzung des Grundwassers im Stadtgebiet Biberach: Brauchen wir ein thermisches Management? Dr. Rainer Klein, boden & grundwasser
Abb. 5.20: Schematisches Prinzip eines Pumpversuches (Hölting, 1992) (Beachte: M = b im Text)
 5.6 Aquifer Pumpversuche 5.6.1 Allgemeine Betrachtungen und Übersicht Aquifer Pumpversuche dienen zur Bestimmung der hydraulischen Parameter und Transmissivität T Speicherkoeffizient S (Formationskoeffizienten)
5.6 Aquifer Pumpversuche 5.6.1 Allgemeine Betrachtungen und Übersicht Aquifer Pumpversuche dienen zur Bestimmung der hydraulischen Parameter und Transmissivität T Speicherkoeffizient S (Formationskoeffizienten)
Präsentation CDM Consult GmbH beim HLUG Fachgespräch Ermittlung von Schadstofffrachten im Grund- und Sickerwasser
 Präsentation CDM Consult GmbH beim HLUG Fachgespräch Ermittlung von Schadstofffrachten im Grund- und Sickerwasser Dipl.-Geologe Arnold Pettera 20.04.2009 20092004 CDM Consult GmbH bei HLUG - Folie 2 Gliederung
Präsentation CDM Consult GmbH beim HLUG Fachgespräch Ermittlung von Schadstofffrachten im Grund- und Sickerwasser Dipl.-Geologe Arnold Pettera 20.04.2009 20092004 CDM Consult GmbH bei HLUG - Folie 2 Gliederung
Aufgaben Hydraulik I, 11. Februar 2010, total 150 Pkt.
 Aufgaben Hydraulik I, 11. Februar 2010, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Kommunizierende Gefässe (20 Pkt.) Ein System von zwei kommunizierenden Gefässen besteht aus einem oben offenen Behälter A und einem geschlossenen
Aufgaben Hydraulik I, 11. Februar 2010, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Kommunizierende Gefässe (20 Pkt.) Ein System von zwei kommunizierenden Gefässen besteht aus einem oben offenen Behälter A und einem geschlossenen
Aufgabe 1 Kolloquium zur Klausur Innovationscontrolling Sommersemester 2014
 Aufgabe 1 Kolloquium zur Klausur Innovationscontrolling Sommersemester 2014 Dipl.-Kfm. Stephan Körner Aufgabe 1: Investitionscontrolling (40 Punkte) Die Bleier & Mine GmbH ist Herstellerin von Büroartikeln
Aufgabe 1 Kolloquium zur Klausur Innovationscontrolling Sommersemester 2014 Dipl.-Kfm. Stephan Körner Aufgabe 1: Investitionscontrolling (40 Punkte) Die Bleier & Mine GmbH ist Herstellerin von Büroartikeln
Transnational Science and Policy Panel
 Transnational Science and Policy Panel Einführung in das Projekt, Übersicht Dr. Thomas Ertel et environment and technology Stuttgart, 28./29.06.2012 Werte in µg/l Hintergrund - Mombachquelle - Parameter-Trendvergleich
Transnational Science and Policy Panel Einführung in das Projekt, Übersicht Dr. Thomas Ertel et environment and technology Stuttgart, 28./29.06.2012 Werte in µg/l Hintergrund - Mombachquelle - Parameter-Trendvergleich
Seminar Grundwasserschutz (SS 2008) Übung: Schutzgebietsberechnung / Schutzgebietsausweisung
 Institut für Geologie Lehrstuhl für Hydrogeologie (SS 2008) Übung: Schutzgebietsberechnung / Schutzgebietsausweisung Dipl.-Geoökol. M. Schipek, Dipl.-Geoökol. E. Süß, Prof. Dr. B. Merkel Quelle: BGR 2007
Institut für Geologie Lehrstuhl für Hydrogeologie (SS 2008) Übung: Schutzgebietsberechnung / Schutzgebietsausweisung Dipl.-Geoökol. M. Schipek, Dipl.-Geoökol. E. Süß, Prof. Dr. B. Merkel Quelle: BGR 2007
Dokumentation Durchführung eines Leistungspumpversuches im neu erbauten Brunnen TB 11, Wasserwerk Frankenthal
 Dokumentation Durchführung eines Leistungspumpversuches im neu erbauten Brunnen TB 11, Wasserwerk Frankenthal Auftraggeber: Sax + Klee GmbH Verfasser: André Voutta Datum: 5. September 12 I N H A L T S
Dokumentation Durchführung eines Leistungspumpversuches im neu erbauten Brunnen TB 11, Wasserwerk Frankenthal Auftraggeber: Sax + Klee GmbH Verfasser: André Voutta Datum: 5. September 12 I N H A L T S
Allgemein gilt: Die Erdbeschleunigung g kann vereinfachend mit g= 10 m/s² angenommen
 Allgemein gilt: Die Erdbeschleunigung g kann vereinfachend mit g= 10 m/s² angenommen werden. (1) Eigenschaften von Fluiden In Weimar soll ein etwa 25 m hohes Gebäude errichtet werden (siehe Anlage für
Allgemein gilt: Die Erdbeschleunigung g kann vereinfachend mit g= 10 m/s² angenommen werden. (1) Eigenschaften von Fluiden In Weimar soll ein etwa 25 m hohes Gebäude errichtet werden (siehe Anlage für
Offene Masterarbeitsthemen der AG Geothermie am LS Hydrogeologie
 Thema: Geothermie/Wärmespeicherung (1 bis 2 MA Arbeiten) Bestimmung der Matrixwärmeleitfähigkeit von Sand- und Karbonatgesteinen durch Labormessungen und Inverse Numerische Modellierung mit FeFlow Die
Thema: Geothermie/Wärmespeicherung (1 bis 2 MA Arbeiten) Bestimmung der Matrixwärmeleitfähigkeit von Sand- und Karbonatgesteinen durch Labormessungen und Inverse Numerische Modellierung mit FeFlow Die
IPV-Tool Beschreibung (IPV = Immissionspumpversuch)
 IPV-Tool Beschreibung (IPV = Immissionspumpversuch) Excel-Anwendung zur Planung / Nachberechnung von (Immissions-)Pumpversuchen und zur analytischen Auswertung gemessener Schadstoffkonzentrationen 1. Vorbemerkung
IPV-Tool Beschreibung (IPV = Immissionspumpversuch) Excel-Anwendung zur Planung / Nachberechnung von (Immissions-)Pumpversuchen und zur analytischen Auswertung gemessener Schadstoffkonzentrationen 1. Vorbemerkung
Zu Modul 9: Förderung des eigenverantwortlichen Lernens Integrierte Schülerübungen Thema Dichte. a) integrierte Schülerübung. b) gemeinsame Auswertung
 SET 2 Realschule Bayern integrierte Schülerübung / Dichte Seite 1 Zu Modul 9: Förderung des eigenverantwortlichen Lernens Integrierte Schülerübungen Thema Dichte Aktionen Inhalte / Erwartungen Erfahrungen
SET 2 Realschule Bayern integrierte Schülerübung / Dichte Seite 1 Zu Modul 9: Förderung des eigenverantwortlichen Lernens Integrierte Schülerübungen Thema Dichte Aktionen Inhalte / Erwartungen Erfahrungen
Ausrichtung einer Ebene (z.b. Hauswand) mit Hilfe der Sonne bestimmen
 Ausrichtung einer Ebene (z.b. Hauswand) mit Hilfe der Sonne bestimmen von Volker Lotze www.volker-lotze.de Stand: Dezember 2007 Wenn man z.b. eine Sonnenuhr für eine Wand oder Schräge erstellen möchte,
Ausrichtung einer Ebene (z.b. Hauswand) mit Hilfe der Sonne bestimmen von Volker Lotze www.volker-lotze.de Stand: Dezember 2007 Wenn man z.b. eine Sonnenuhr für eine Wand oder Schräge erstellen möchte,
Grundwasserhydraulik Und -erschließung
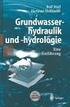 Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Ermessensleitende Kriterien bei der Bearbeitung altlastbedingter Grundwassergefahren und -schäden
 Ermessensleitende Kriterien bei der Bearbeitung altlastbedingter Grundwassergefahren und -schäden 1 Praktische Übungen Übung 2 - Vorstellung Aufgabe - Selbständige Bearbeitung - Präsentation Lösung Übung
Ermessensleitende Kriterien bei der Bearbeitung altlastbedingter Grundwassergefahren und -schäden 1 Praktische Übungen Übung 2 - Vorstellung Aufgabe - Selbständige Bearbeitung - Präsentation Lösung Übung
Grundwassersicherung /-überwachung im Bereich Insel Flotzgrün/Speyer-Süd
 Präsentation Umweltausschuss Stadt Speyer 21. Juni 2018 Herr Bender Inhalt der Präsentation Untergrundaufbau und Grundwasserströmungsverhältnisse Grundwassermonitoring und hydraulische Sicherung Ergebnisse
Präsentation Umweltausschuss Stadt Speyer 21. Juni 2018 Herr Bender Inhalt der Präsentation Untergrundaufbau und Grundwasserströmungsverhältnisse Grundwassermonitoring und hydraulische Sicherung Ergebnisse
Bestimmung von Schadstoffimmissionen und Frachten aus Pumpversuchen mit C-SET
 Bestimmung von Schadstoffimmissionen und Frachten aus Pumpversuchen mit C-SET Dr. Uwe Hekel HPC AG D-72108 Rottenburg Inhalt Einführung in das Funktionsprinzip von Immissionspumpversuchen (IPV) Entwicklung
Bestimmung von Schadstoffimmissionen und Frachten aus Pumpversuchen mit C-SET Dr. Uwe Hekel HPC AG D-72108 Rottenburg Inhalt Einführung in das Funktionsprinzip von Immissionspumpversuchen (IPV) Entwicklung
 Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s http://www.paulguckelsberger.de/wasserprojekte.htm
Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s http://www.paulguckelsberger.de/wasserprojekte.htm
D i p l o m a r b e i t
 D i p l o m a r b e i t Auswirkung von Tiefbauwerken auf die Grundwassertemperatur in Dresden Inhalt 1 Einleitung 2 Methodik 3 Auswertung 4 Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen Von Linda Wübken Betreuer:
D i p l o m a r b e i t Auswirkung von Tiefbauwerken auf die Grundwassertemperatur in Dresden Inhalt 1 Einleitung 2 Methodik 3 Auswertung 4 Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen Von Linda Wübken Betreuer:
SINBRA. 1 Konzeption zur Flächenstrukturierung
 1 Konzeption zur Flächenstrukturierung Ein Ziel im TV5 ist die vollständige Flächenstrukturierung anhand von Strukturelementen, die Bewertung der Fläche sowie die Ermittlung liegenschaftsexterner Auswirkungen.
1 Konzeption zur Flächenstrukturierung Ein Ziel im TV5 ist die vollständige Flächenstrukturierung anhand von Strukturelementen, die Bewertung der Fläche sowie die Ermittlung liegenschaftsexterner Auswirkungen.
Analytische Statistik II
 Analytische Statistik II Institut für Geographie 1 Schätz- und Teststatistik 2 Grundproblem Generell sind wir nur selten in der Geographie in der Lage, Daten über die Grundgesamtheit zur Verfügung zu haben.
Analytische Statistik II Institut für Geographie 1 Schätz- und Teststatistik 2 Grundproblem Generell sind wir nur selten in der Geographie in der Lage, Daten über die Grundgesamtheit zur Verfügung zu haben.
Wir sollen erarbeiten, wie man mit Hilfe der Mondentfernung die Entfernung zur Sonne bestimmen kann.
 Expertengruppenarbeit Sonnenentfernung Das ist unsere Aufgabe: Wir sollen erarbeiten, wie man mit Hilfe der Mondentfernung die Entfernung zur Sonne bestimmen kann. Konkret ist Folgendes zu tun: Lesen Sie
Expertengruppenarbeit Sonnenentfernung Das ist unsere Aufgabe: Wir sollen erarbeiten, wie man mit Hilfe der Mondentfernung die Entfernung zur Sonne bestimmen kann. Konkret ist Folgendes zu tun: Lesen Sie
Veranlassung Aufgabenstellung Wassergewinnung mit Brunnen
 Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s zum Skript SiWaWi-2 Eckhardt/Guckelsberger
Dipl.-Ing. P. Guckelsberger Vorrechenübung Brunnenbemessung - SiWaWi-2 Schlagworte: Brunnenfassungsvermögen Q F / Brunnenergiebigkeit Q E / optimale Absenkung s zum Skript SiWaWi-2 Eckhardt/Guckelsberger
M5 Viskosität von Flüssigkeiten
 Christian Müller Jan Philipp Dietrich M5 Viskosität von Flüssigkeiten I. Dynamische Viskosität a) Erläuterung b) Berechnung der dynamischen Viskosität c) Fehlerrechnung II. Kinematische Viskosität a) Gerätekonstanten
Christian Müller Jan Philipp Dietrich M5 Viskosität von Flüssigkeiten I. Dynamische Viskosität a) Erläuterung b) Berechnung der dynamischen Viskosität c) Fehlerrechnung II. Kinematische Viskosität a) Gerätekonstanten
Hochwasserschutz Stadt Lauenburg. Ergebnisse der hydrogeologischen Untersuchungen. Bürgerinformation. Stadt Lauenburg,
 BN1 GeoC GmbH Contor für Geologie und Umweltplanung Hochwasserschutz Stadt Lauenburg Ergebnisse der hydrogeologischen Untersuchungen Bürgerinformation Stadt Lauenburg, 09.03.2016 Referent: Hanjo Hamer
BN1 GeoC GmbH Contor für Geologie und Umweltplanung Hochwasserschutz Stadt Lauenburg Ergebnisse der hydrogeologischen Untersuchungen Bürgerinformation Stadt Lauenburg, 09.03.2016 Referent: Hanjo Hamer
Grundlagen und Hinweise zum Excel-Tool I/E-Calc
 Grundlagen und Hinweise zum Excel-Tool I/E-Calc Das Programm I/E-Calc unterstützt den Nutzer bei der Durchführung einer Immissions- und Emissionsbetrachtung. Die Anwendung des Programms I/E-Calc eignet
Grundlagen und Hinweise zum Excel-Tool I/E-Calc Das Programm I/E-Calc unterstützt den Nutzer bei der Durchführung einer Immissions- und Emissionsbetrachtung. Die Anwendung des Programms I/E-Calc eignet
Arbeitspapier. Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans
 Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans Wuppertal, 23.01.2015 Prof. Dr. Manfred Fischedick Christoph Zeiss
Arbeitspapier: Wissenschaftliche Zuarbeit zur Ausweisung von Effizienz- und Energieeinsparzielen aus den Szenarien des Klimaschutzplans Wuppertal, 23.01.2015 Prof. Dr. Manfred Fischedick Christoph Zeiss
Einsatz von Google Business Diensten bei der Anwendung von Grundwassermodellen d in der Altlastenbearbeitung am Beispiel des
 Einsatz von Google Business Diensten bei der Anwendung von Grundwassermodellen d in der Altlastenbearbeitung am Beispiel des Projektes MAGPlan Fortbildungsverbund Boden- und Altlasten Baden-Württemberg
Einsatz von Google Business Diensten bei der Anwendung von Grundwassermodellen d in der Altlastenbearbeitung am Beispiel des Projektes MAGPlan Fortbildungsverbund Boden- und Altlasten Baden-Württemberg
ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement. Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A
 ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A Dr. AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 1 Fallbeispiel A: Chemische
ChloroNet Teilprojekt Risikomanagement Beispiele zur Anwendung der Kriterien für einen Sanierungsunterbruch Fallbeispiel A Dr. AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 1 Fallbeispiel A: Chemische
v q,m Aufgabensammlung Experimentalphysik für ET
 Experimentalphysik für ET Aufgabensammlung 1. E-Felder Auf einen Plattenkondensator mit quadratischen Platten der Kantenlänge a und dem Plattenabstand d werde die Ladung Q aufgebracht, bevor er vom Netz
Experimentalphysik für ET Aufgabensammlung 1. E-Felder Auf einen Plattenkondensator mit quadratischen Platten der Kantenlänge a und dem Plattenabstand d werde die Ladung Q aufgebracht, bevor er vom Netz
Hier werden bisher vorliegende ausgewählte Ergebnisse dieses Versuches vorgestellt. Erntedauer und Wirtschaftlichkeit bei Spargel 1
 1 Erntedauer und Wirtschaftlichkeit bei Spargel 1 Carmen Feller, Jan Gräfe und Matthias Fink, Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren und Erfurt (IGZ), Kontakt: feller@igzev.de Die
1 Erntedauer und Wirtschaftlichkeit bei Spargel 1 Carmen Feller, Jan Gräfe und Matthias Fink, Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren und Erfurt (IGZ), Kontakt: feller@igzev.de Die
NIEDERSCHLAG. Hausübung 1
 Hausübung 1 NIEDERSCHLAG Abgabe: 25.10.2017 Niederschlag wird nahezu weltweit mit einem Netz von Messstationen erfasst. Dabei handelt es sich um punktuelle Messungen. Für grundlegende Fragen der Ingenieurhydrologie
Hausübung 1 NIEDERSCHLAG Abgabe: 25.10.2017 Niederschlag wird nahezu weltweit mit einem Netz von Messstationen erfasst. Dabei handelt es sich um punktuelle Messungen. Für grundlegende Fragen der Ingenieurhydrologie
Methoden zur Frachtbetrachtung
 MNA-Konzepte - Grundlagen & Vorgehensweise - Untersuchung und Charakterisierung von Schadstofffahnen Methoden zur Frachtbetrachtung Dr. Peter Martus / Dr. Adalbert Huss, HPC AG Bundesweite Fortbildung
MNA-Konzepte - Grundlagen & Vorgehensweise - Untersuchung und Charakterisierung von Schadstofffahnen Methoden zur Frachtbetrachtung Dr. Peter Martus / Dr. Adalbert Huss, HPC AG Bundesweite Fortbildung
Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Tappenbecker Moor Untergrundhydraulische Berechnung
 GGU mbh Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Herr Dipl.-Ing. Klaeden Sophienstraße 5 38304 Wolfenbüttel 10.05.2014 Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Untergrundhydraulische
GGU mbh Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Herr Dipl.-Ing. Klaeden Sophienstraße 5 38304 Wolfenbüttel 10.05.2014 Neubau der A 39, Abschnitt 7, Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Untergrundhydraulische
Vom Immissionspumpversuch zum Grundwassermanagementplan
 M A G P l a n - A b s c h l u s s k o n f e r e n z 2.- 3. J u l i 2 0 1 5 H a u s d e r W i r t s c h a f t S t u t t g a r t Vom Immissionspumpversuch zum Grundwassermanagementplan 20 Jahre integrale
M A G P l a n - A b s c h l u s s k o n f e r e n z 2.- 3. J u l i 2 0 1 5 H a u s d e r W i r t s c h a f t S t u t t g a r t Vom Immissionspumpversuch zum Grundwassermanagementplan 20 Jahre integrale
BA Arbeiten 2017 LS Hydrogeologie
 BA Arbeiten 2017 LS Hydrogeologie Hydrogeology and Biogeochemistry Group Thema: Entwicklung einer Diffusionszelle zur Beprobung von Sedimenten Entwicklung eines Aufbaus zur Beprobung von geochemischen
BA Arbeiten 2017 LS Hydrogeologie Hydrogeology and Biogeochemistry Group Thema: Entwicklung einer Diffusionszelle zur Beprobung von Sedimenten Entwicklung eines Aufbaus zur Beprobung von geochemischen
1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG 3 2 GRUNDLAGEN Modell Istzustand Deichlinie Hydrologische Daten 4. 2.
 Inhaltsverzeichnis 1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG 3 2 GRUNDLAGEN 4 2.1 Modell Istzustand 4 2.2 Deichlinie 4 2.3 Hydrologische Daten 4 2.4 Software 4 3 BERECHNUNG FLUTPOLDER SÜD MIT DEICH 5 3.1 Festlegung
Inhaltsverzeichnis 1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG 3 2 GRUNDLAGEN 4 2.1 Modell Istzustand 4 2.2 Deichlinie 4 2.3 Hydrologische Daten 4 2.4 Software 4 3 BERECHNUNG FLUTPOLDER SÜD MIT DEICH 5 3.1 Festlegung
TEIL 13: DIE EINFACHE LINEARE REGRESSION
 TEIL 13: DIE EINFACHE LINEARE REGRESSION Die einfache lineare Regression Grundlagen Die einfache lineare Regression ist ebenfalls den bivariaten Verfahren für metrische Daten zuzuordnen 1 Sie hat einen
TEIL 13: DIE EINFACHE LINEARE REGRESSION Die einfache lineare Regression Grundlagen Die einfache lineare Regression ist ebenfalls den bivariaten Verfahren für metrische Daten zuzuordnen 1 Sie hat einen
GRUNDWASSER-FLIESSMESSUNGEN. Dr. Marc Schöttler, PHREALOG
 Dr. Marc Schöttler, PHREALOG Ermittlung der Grundwasserfließbewegung Konventionell: Indirekte Messung hydrogeologisches Dreieck Alternativ/ergänzend: Direkte Messung Fließmessung in Grundwassermessstellen
Dr. Marc Schöttler, PHREALOG Ermittlung der Grundwasserfließbewegung Konventionell: Indirekte Messung hydrogeologisches Dreieck Alternativ/ergänzend: Direkte Messung Fließmessung in Grundwassermessstellen
Das geplante WLAN. Standortbericht FEC Standortbericht FEC
 Standortbericht FEC Dieser Standortbericht zeigt die Ergebnisse des geplanten WLANs der Funkwerk Enterprise Communications GmbH. Das SiteSurvey erfolgte am 24.12.2010. Im Folgenden werden die Unterschiede
Standortbericht FEC Dieser Standortbericht zeigt die Ergebnisse des geplanten WLANs der Funkwerk Enterprise Communications GmbH. Das SiteSurvey erfolgte am 24.12.2010. Im Folgenden werden die Unterschiede
Ergebnisse der landesweiten Untersuchungen zum Nitratabbau im Grundwasser
 Ergebnisse der landesweiten Untersuchungen zum Nitratabbau im Grundwasser Thorsten Hartung & Martin Hoetmer & Dr. Markus Quirin NLWKN Betriebsstelle Süd 22. Grundwasser-Workshop am 21.06.2017 in Cloppenburg
Ergebnisse der landesweiten Untersuchungen zum Nitratabbau im Grundwasser Thorsten Hartung & Martin Hoetmer & Dr. Markus Quirin NLWKN Betriebsstelle Süd 22. Grundwasser-Workshop am 21.06.2017 in Cloppenburg
Auslegung von Sondenfeldern
 Auslegung von Sondenfeldern Ermittlung des Volumenstromes: Als Grundlage dient die Formel: Q = m x c x t Damit wird die Sole-Umlaufmenge in kg berechnet. Q = Wärmemenge kwh m = Masse (Umlaufmenge) kg c
Auslegung von Sondenfeldern Ermittlung des Volumenstromes: Als Grundlage dient die Formel: Q = m x c x t Damit wird die Sole-Umlaufmenge in kg berechnet. Q = Wärmemenge kwh m = Masse (Umlaufmenge) kg c
Verteidigung der Diplomarbeit. Mathias Magdowski
 Verteidigung der Diplomarbeit Entwicklung und Validierung eines Werkzeugs zur Berechnung der elektromagnetischen Einkopplung von stochastischen Feldern in Leitungsstrukturen Mathias Magdowski Otto-von-Guericke
Verteidigung der Diplomarbeit Entwicklung und Validierung eines Werkzeugs zur Berechnung der elektromagnetischen Einkopplung von stochastischen Feldern in Leitungsstrukturen Mathias Magdowski Otto-von-Guericke
SANIERTE CHEMISCHE REINIGUNG MIT HOHER GRUNDWASSER-LHKW-BELASTUNG IM NACHSORGEMONITORING AKZ:
 SANIERTE CHEMISCHE REINIGUNG MIT HOHER GRUNDWASSER-LHKW-BELASTUNG IM NACHSORGEMONITORING AKZ: 65711208 1 18. November 2014 Rainer Fiedler (LDS) und Detlef Streit (Ing.-Büro R.W. Ashauer und Partner GmbH)
SANIERTE CHEMISCHE REINIGUNG MIT HOHER GRUNDWASSER-LHKW-BELASTUNG IM NACHSORGEMONITORING AKZ: 65711208 1 18. November 2014 Rainer Fiedler (LDS) und Detlef Streit (Ing.-Büro R.W. Ashauer und Partner GmbH)
Kapitel 2. Fehlerrechnung
 Fehlerrechnung 1 Messungen => quantitative Aussagen Messungen müssen zu jeder Zeit und an jedem Ort zu den gleichen Ergebnissen führen Messungen sind immer mit Fehler behaftet. => Angabe des Fehlers! Bespiel
Fehlerrechnung 1 Messungen => quantitative Aussagen Messungen müssen zu jeder Zeit und an jedem Ort zu den gleichen Ergebnissen führen Messungen sind immer mit Fehler behaftet. => Angabe des Fehlers! Bespiel
Kapitel 4. Reihen 4.1. Definition und Beispiele
 Kapitel 4. Reihen 4.1. Definition und Beispiele Ist (a n ) eine Folge von Zahlen, so heißt der formale Ausdruck a ν = a 0 + a 1 + a 2 +... eine Reihe; die einzelnen a ν sind die Glieder dieser Reihe. Um
Kapitel 4. Reihen 4.1. Definition und Beispiele Ist (a n ) eine Folge von Zahlen, so heißt der formale Ausdruck a ν = a 0 + a 1 + a 2 +... eine Reihe; die einzelnen a ν sind die Glieder dieser Reihe. Um
Um vorerst bei den geometrischen Aufgaben zu bleiben, stelle dir folgendes Problem vor:
 Erkläre bitte Extremwertaufgaben... Extremwertaufgaben Sobald man verstanden hat, was ein Extremwert einer Funktion ist (ein lokales Maximum oder Minimum) stellt sich die Frage Und was mach ich damit??.
Erkläre bitte Extremwertaufgaben... Extremwertaufgaben Sobald man verstanden hat, was ein Extremwert einer Funktion ist (ein lokales Maximum oder Minimum) stellt sich die Frage Und was mach ich damit??.
Definition der Entropie unter Verwendung von supp(p XY )
 Definition der Entropie unter Verwendung von supp(p XY ) Wir fassen die Ergebnisse des letzten Abschnitts nochmals kurz zusammen, wobei wir von der zweidimensionalen Zufallsgröße XY mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion
Definition der Entropie unter Verwendung von supp(p XY ) Wir fassen die Ergebnisse des letzten Abschnitts nochmals kurz zusammen, wobei wir von der zweidimensionalen Zufallsgröße XY mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur
 Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Diplomarbeit: Modellierung des Austausches zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser mit Hilfe des Umwelttracers Temperatur Von Johannes Ahrns Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek Dipl.-Ing. Kerstin
Grundwasserabstromerkundung mittels Immissionspumpversuchen - Übersicht und Anwendungsbeispiele
 mittels Immissionspumpversuchen - Übersicht und Anwendungsbeispiele Hans-Peter chitzky Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung, Universität Stuttgart, koschitzky@iws.uni-stuttgart.de.
mittels Immissionspumpversuchen - Übersicht und Anwendungsbeispiele Hans-Peter chitzky Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung, Universität Stuttgart, koschitzky@iws.uni-stuttgart.de.
Tagung der FH-DGG in Cottbus 24. Bis 28. Mai 2006 MOTIVATION GLOBAL CHANGE GLOBALE KLIMATISCHE RANDBEDINGUNGEN ATMOSPHÄRE
 Grundwassermodellierung im Kontext hydrologischer Modellierung auf unterschiedlichen Skalen Eine Fallstudie im Einzugsgebiet der Ammer. J. Wolf 1, V. Rojanschi 1, R. Barthel 1, J. Braun 1 1, jens.wolf@iws.uni-stuttgart.de
Grundwassermodellierung im Kontext hydrologischer Modellierung auf unterschiedlichen Skalen Eine Fallstudie im Einzugsgebiet der Ammer. J. Wolf 1, V. Rojanschi 1, R. Barthel 1, J. Braun 1 1, jens.wolf@iws.uni-stuttgart.de
Transportmodellierung mit nichtlinearer Sorption und stochastischer Strömung
 5 Endlagersicherheitsforschung 5.1 Transportmodellierung mit nichtlinearer Sorption und stochastischer Strömung Die Programmpakete d 3 f (distributed density-driven flow) und r 3 t (radionuclides, reaction,
5 Endlagersicherheitsforschung 5.1 Transportmodellierung mit nichtlinearer Sorption und stochastischer Strömung Die Programmpakete d 3 f (distributed density-driven flow) und r 3 t (radionuclides, reaction,
WV Stadtwerke Wiesloch
 WV Stadtwerke Wiesloch Überarbeitung Wasserschutzgebiet WW Hungerbühl - Untersuchungsprogramm - TU-Sitzung, 02.12.2015 Projektleiter: Dr. Stefan Ludwig, Dipl.-Geologe Kontaktdaten: Tel: 0721/94337-0, Mail:
WV Stadtwerke Wiesloch Überarbeitung Wasserschutzgebiet WW Hungerbühl - Untersuchungsprogramm - TU-Sitzung, 02.12.2015 Projektleiter: Dr. Stefan Ludwig, Dipl.-Geologe Kontaktdaten: Tel: 0721/94337-0, Mail:
Abschlussbericht (Kurzversion)
 Prof. Dr. Klaus Stüwe Marion Kühn M. A. Jasmin Gotschke M. Sc. Maßnahmen der deutschen (Erz-) Bistümer zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer Familienfreundlichkeit in den deutschen
Prof. Dr. Klaus Stüwe Marion Kühn M. A. Jasmin Gotschke M. Sc. Maßnahmen der deutschen (Erz-) Bistümer zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer Familienfreundlichkeit in den deutschen
Optimierung von Komponenten durch Parametervariation - die neuen Features von T*SOL Expert
 Optimierung von Komponenten durch Parametervariation - die neuen Features von T*SOL Expert Dr.-Ing. Gerhard Valentin Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH Stralauer Platz 33-34, D-10243 Berlin Tel.: +49 (0)
Optimierung von Komponenten durch Parametervariation - die neuen Features von T*SOL Expert Dr.-Ing. Gerhard Valentin Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH Stralauer Platz 33-34, D-10243 Berlin Tel.: +49 (0)
Untersuchung des Seesalzanteils an der Feinstaubbelastung auf der Insel Norderney
 Gewerbeaufsicht in Niedersachsen Staatliches Gewerbeaufsichtst Hildesheim Untersuchung des s an der Feinstaubbelastung auf der Insel Norderney Autor: Dr. Klaus-Peter Giesen Zentrale Unterstützungsstelle
Gewerbeaufsicht in Niedersachsen Staatliches Gewerbeaufsichtst Hildesheim Untersuchung des s an der Feinstaubbelastung auf der Insel Norderney Autor: Dr. Klaus-Peter Giesen Zentrale Unterstützungsstelle
Ü b u n g s b l a t t 15
 Einführung in die Stochastik Sommersemester 07 Dr. Walter Oevel 2. 7. 2007 Ü b u n g s b l a t t 15 Hier ist zusätzliches Übungsmaterial zur Klausurvorbereitung quer durch die Inhalte der Vorlesung. Eine
Einführung in die Stochastik Sommersemester 07 Dr. Walter Oevel 2. 7. 2007 Ü b u n g s b l a t t 15 Hier ist zusätzliches Übungsmaterial zur Klausurvorbereitung quer durch die Inhalte der Vorlesung. Eine
1.Projektverantwortung Einsender 1.2. Bauherr. Landratsamt Ortenaukreis Amt für Umweltschutz Postfach Offenburg
 Landratsamt Ortenaukreis Amt für Umweltschutz Postfach 1960 77609 Offenburg Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach 108 WG Baden- Württemberg zur Grundwasserbenutzung zum Betrieb einer
Landratsamt Ortenaukreis Amt für Umweltschutz Postfach 1960 77609 Offenburg Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach 108 WG Baden- Württemberg zur Grundwasserbenutzung zum Betrieb einer
Luftmengen - Dimensionierungshilfe
 Luftmengen - Dimensionierungshilfe Inhalt Komfortlüftung: Luftmengen - Dimensionierungshilfe 1.) Betriebsvolumenstrom für die Anlagendimensionierung und max. Schallpegel 2.) Abwesenheitsvolumenstrom 3.)
Luftmengen - Dimensionierungshilfe Inhalt Komfortlüftung: Luftmengen - Dimensionierungshilfe 1.) Betriebsvolumenstrom für die Anlagendimensionierung und max. Schallpegel 2.) Abwesenheitsvolumenstrom 3.)
SCHOTTERGRUBE NAME ODER ERWEITERUNG DER SCHOTTERGRUBE NAME AUF DER G.P. XX K.G. XX
 SCHOTTERGRUBE NAME ODER ERWEITERUNG DER SCHOTTERGRUBE NAME AUF DER G.P. XX K.G. XX TECHNISCHER BERICHT (Beschreibung der verwendeten Anlagen, der Lärmquellen und der technischen Maßnahmen zur Verminderung
SCHOTTERGRUBE NAME ODER ERWEITERUNG DER SCHOTTERGRUBE NAME AUF DER G.P. XX K.G. XX TECHNISCHER BERICHT (Beschreibung der verwendeten Anlagen, der Lärmquellen und der technischen Maßnahmen zur Verminderung
DAMPF UND KONDENSAT IN ROHRLEITUNGEN
 DAMPF UND KONDENSAT IN ROHRLEITUNGEN Durch Rohrleitungen strömt Dampf oder Kondensat zum Verbraucher. Die Rohrleitungen sollten nicht zu klein und nicht zu groß sein. Ist die Rohrleitung zu klein, passt
DAMPF UND KONDENSAT IN ROHRLEITUNGEN Durch Rohrleitungen strömt Dampf oder Kondensat zum Verbraucher. Die Rohrleitungen sollten nicht zu klein und nicht zu groß sein. Ist die Rohrleitung zu klein, passt
Die Keplerschen Gesetze ==================================================================
 Die Keplerschen Gesetze ================================================================== Astronomische Daten, die bei den folgenden Berechnungen verwendet werden dürfen: Große Halbachse Sonne-Erde: 1
Die Keplerschen Gesetze ================================================================== Astronomische Daten, die bei den folgenden Berechnungen verwendet werden dürfen: Große Halbachse Sonne-Erde: 1
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
MAGPlan - integrale Grundwassersanierung
 - integrale Grundwassersanierung Nachhaltige Verbesserung der Qualität von Grundwasserkörpern in Stadtgebieten Durch den langjährigen und weitverbreiteten Einsatz leichtflüchtiger chlorierter Kohlenwasserstoffe
- integrale Grundwassersanierung Nachhaltige Verbesserung der Qualität von Grundwasserkörpern in Stadtgebieten Durch den langjährigen und weitverbreiteten Einsatz leichtflüchtiger chlorierter Kohlenwasserstoffe
Studiengang Bauingenieurwesen (Master) Fachhochschule Augsburg Skriptum Abschnitt Grundwasser
 Studiengang Bauingenieurwesen (Master) Fachhochschule Augsburg Skriptum Abschnitt Grundwasser GW - J. Eberl 2010 1 Inhaltsübersicht Grundwasser 1. Wasser im Boden Definitionen Grundwasser 2. Fachbegriffe
Studiengang Bauingenieurwesen (Master) Fachhochschule Augsburg Skriptum Abschnitt Grundwasser GW - J. Eberl 2010 1 Inhaltsübersicht Grundwasser 1. Wasser im Boden Definitionen Grundwasser 2. Fachbegriffe
Hinweise zur Einschätzung der Qualität schulischer Prozesse
 Hinweise zur Einschätzung der Qualität schulischer Prozesse Stand Dezember 2014 Im weiterentwickelten Inspektionsverfahren stehen die schulischen Prozesse im Fokus. Zum Entwicklungsstand dieser Prozesse
Hinweise zur Einschätzung der Qualität schulischer Prozesse Stand Dezember 2014 Im weiterentwickelten Inspektionsverfahren stehen die schulischen Prozesse im Fokus. Zum Entwicklungsstand dieser Prozesse
Auswertung der Zufriedenheitsumfrage unter den Nutzenden des IT Centers. Zusammenfassung Hanna Tröger Stand: 21.12.2015 Version 1.
 Auswertung der Zufriedenheitsumfrage unter den Nutzenden des IT Centers Zusammenfassung Hanna Tröger Stand:..05 Version.0 Inhaltsverzeichnis Einleitung... Datensatz... Ergebnisse.... Soziodemographie....
Auswertung der Zufriedenheitsumfrage unter den Nutzenden des IT Centers Zusammenfassung Hanna Tröger Stand:..05 Version.0 Inhaltsverzeichnis Einleitung... Datensatz... Ergebnisse.... Soziodemographie....
Praktikum Werkstoffprüfung. SCT Streifenstauchwiderstand Short Span Compression Test DIN 54 518. und
 SCT Streifenstauchwiderstand Short Span Compression Test DIN 54 518 und ECT Kantenstauchwiderstand Edgewise Cruch Test DIN EN ISO 3037 1 Allgemeiner Teil Aufgabenstellung Eines der wichtigsten Packmittel
SCT Streifenstauchwiderstand Short Span Compression Test DIN 54 518 und ECT Kantenstauchwiderstand Edgewise Cruch Test DIN EN ISO 3037 1 Allgemeiner Teil Aufgabenstellung Eines der wichtigsten Packmittel
Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 2009 im Fach Mathematik. 27. Mai 2009
 Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 009 im Fach Mathematik 7. Mai 009 LÖSUNGEN UND BEWERTUNGEN Mittlerer Schulabschluss 009,
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Schriftliche Prüfungsarbeit zum mittleren Schulabschluss 009 im Fach Mathematik 7. Mai 009 LÖSUNGEN UND BEWERTUNGEN Mittlerer Schulabschluss 009,
Bearbeitung: Peter Huggenberger, Eric Zechner, Annette Affolter. Geologie: : Grundwasserleiter und - stauer. Departement Umweltwissenschaften
 Grundwassermodell Unterers Birstal-Rhein-Muttenz Evaluation der Zuströmbereiche der Trinkwasserfassungen Muttenz und Hardwasser AG Wasserzirkulation in mehreren Grundwasserstockwerken (Lockergesteins-
Grundwassermodell Unterers Birstal-Rhein-Muttenz Evaluation der Zuströmbereiche der Trinkwasserfassungen Muttenz und Hardwasser AG Wasserzirkulation in mehreren Grundwasserstockwerken (Lockergesteins-
in einem städtischen Raum
 Darmstadt 28. u. 29. November 2013 DECHEMA-Symposium Strategien zur Boden- und Grundwassersanierung Sanierungsstrategien Integrale Ansätze Managementplan für Grundwasser in einem städtischen Raum H.J.
Darmstadt 28. u. 29. November 2013 DECHEMA-Symposium Strategien zur Boden- und Grundwassersanierung Sanierungsstrategien Integrale Ansätze Managementplan für Grundwasser in einem städtischen Raum H.J.
Ziele heute. Sie kennen verschiedene Rohwasser- Ressourcen Sie können die Eignung für die Trinkwasserherstellung einschätzen
 1 Ziele heute Sie kennen verschiedene Rohwasser- Ressourcen Sie können die Eignung für die Trinkwasserherstellung einschätzen Wasservorkommen für die Trinkwassernutzung Wasserversorgung Wasservorkommen
1 Ziele heute Sie kennen verschiedene Rohwasser- Ressourcen Sie können die Eignung für die Trinkwasserherstellung einschätzen Wasservorkommen für die Trinkwassernutzung Wasserversorgung Wasservorkommen
Protokoll RiMEA-Projekt
 Datum: 08.02.2005 Ort: per Email Teilnehmer: RiMEA Initiatoren Verfasser: Tim Meyer-König Nathalie Waldau Thema: Beiträge zur Richtlinie 1.6.0 Verteiler: - RiMEA Initiatoren - RiMEA Mitglieder Besprochene
Datum: 08.02.2005 Ort: per Email Teilnehmer: RiMEA Initiatoren Verfasser: Tim Meyer-König Nathalie Waldau Thema: Beiträge zur Richtlinie 1.6.0 Verteiler: - RiMEA Initiatoren - RiMEA Mitglieder Besprochene
Bedeutung von Messstellenausbau, Pumpversuch und Probenahme für die Frachtbetrachtung
 Bedeutung von Messstellenausbau, Pumpversuch und Probenahme für die Frachtbetrachtung HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH Europastraße 11, 35394 Gießen Dipl.-Geol. Dr. Walter Lenz 1 Bau von GWM:
Bedeutung von Messstellenausbau, Pumpversuch und Probenahme für die Frachtbetrachtung HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH Europastraße 11, 35394 Gießen Dipl.-Geol. Dr. Walter Lenz 1 Bau von GWM:
Fachbeitrag Altlasten
 Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement Regionalbüro Süd-West (FRS-SW) Lammstraße 19 76133 Karlsruhe Fachbeitrag Altlasten Projekt Standort 7080 Tübingen B-Plan-Verfahren Tübingen Gbf 23. Januar 2013 Fachbeitrag
Deutsche Bahn AG Sanierungsmanagement Regionalbüro Süd-West (FRS-SW) Lammstraße 19 76133 Karlsruhe Fachbeitrag Altlasten Projekt Standort 7080 Tübingen B-Plan-Verfahren Tübingen Gbf 23. Januar 2013 Fachbeitrag
Multivariate Analysis
 Kapitel Multivariate Analysis Josef Leydold c 6 Mathematische Methoden I Multivariate Analysis / 38 Lernziele Funktionen in mehreren Variablen Graph und Niveaulinien einer Funktion in zwei Variablen Partielle
Kapitel Multivariate Analysis Josef Leydold c 6 Mathematische Methoden I Multivariate Analysis / 38 Lernziele Funktionen in mehreren Variablen Graph und Niveaulinien einer Funktion in zwei Variablen Partielle
Es gibt insgesamt 14 Grundkompetenzpunkte: Je einen für jede der 12 Teil-1-Aufgaben und jede der beiden mit A gekennzeichnete Aufgaben aus Teil 2.
 Prototypische Schularbeit 2 Klasse 8 Autor: Mag. Paul Schranz Begleittext Die vorliegende Schularbeit behandelt größtenteils Grundkompetenzen der Inhaltsbereiche Analysis und Wahrscheinlichkeitsrechnung
Prototypische Schularbeit 2 Klasse 8 Autor: Mag. Paul Schranz Begleittext Die vorliegende Schularbeit behandelt größtenteils Grundkompetenzen der Inhaltsbereiche Analysis und Wahrscheinlichkeitsrechnung
Mathematikarbeit Klasse 8 03.06.03
 Mathematikarbeit Klasse 8 0.06.0 Name: A. Aufgabe Bestimme bei der folgenden Gleichung die Definitionsmenge und die Lösungsmenge in. z z = 4 z z. Aufgabe In dieser Aufgabe geht es um ganz normale zylindrische
Mathematikarbeit Klasse 8 0.06.0 Name: A. Aufgabe Bestimme bei der folgenden Gleichung die Definitionsmenge und die Lösungsmenge in. z z = 4 z z. Aufgabe In dieser Aufgabe geht es um ganz normale zylindrische
A1.1: Einfache Filterfunktionen
 A1.1: Einfache Filterfunktionen Man bezeichnet ein Filter mit dem Frequenzgang als Tiefpass erster Ordnung. Daraus lässt sich ein Hochpass erster Ordnung nach folgender Vorschrift gestalten: In beiden
A1.1: Einfache Filterfunktionen Man bezeichnet ein Filter mit dem Frequenzgang als Tiefpass erster Ordnung. Daraus lässt sich ein Hochpass erster Ordnung nach folgender Vorschrift gestalten: In beiden
= +1. Rotverschiebung. Unterschiedliche Arten der Rotverschiebung
 Rotverschiebung In der Astronomie wird die Rotverschiebung mit dem Buchstaben z bezeichnet. Mit ihrer Hilfe lassen sich z.b. Fluchtgeschwindigkeiten, Entfernungen und Daten aus früheren Epochen des Universum
Rotverschiebung In der Astronomie wird die Rotverschiebung mit dem Buchstaben z bezeichnet. Mit ihrer Hilfe lassen sich z.b. Fluchtgeschwindigkeiten, Entfernungen und Daten aus früheren Epochen des Universum
Berechnung einer Geschwindigkeit
 InfoBrief Nr. 65 Überblick Bei der Auswertung von Messwerten interessiert neben den absoluten Größen und den Wertänderungen oft auch, wie schnell die Änderungen erfolgten. In GKS Pro kann die Geschwindigkeit
InfoBrief Nr. 65 Überblick Bei der Auswertung von Messwerten interessiert neben den absoluten Größen und den Wertänderungen oft auch, wie schnell die Änderungen erfolgten. In GKS Pro kann die Geschwindigkeit
Prof Pr. Dr . Dr Christian W lk o er lk sdorfer Abriss der Hydrogeologie Abriss der Hydr Pumpvers Pumpver uchsauswer uchsauswer ung und
 Prof. Dr. Christian Wolkersdorfer Abriss der Hydrogeologie Pumpversuchsauswertung und Grundwasserneubildung Veranstaltung im Wintersemester 2008/2009 Präsentation basiert auf Einführung Hydrogeologie Prof.
Prof. Dr. Christian Wolkersdorfer Abriss der Hydrogeologie Pumpversuchsauswertung und Grundwasserneubildung Veranstaltung im Wintersemester 2008/2009 Präsentation basiert auf Einführung Hydrogeologie Prof.
1) Parameter > Betriebsstätte
 Software Versionsnummer 11.5.3817 Kaufmann Mittelstand Thema Kurzarbeitergeld abrechnen Datum Oktober 2010 Mit Kaufmann Mittelstand 2011 rechnen Sie ab sofort auch Kurzarbeitergeld ab. Das Programm unterstützt
Software Versionsnummer 11.5.3817 Kaufmann Mittelstand Thema Kurzarbeitergeld abrechnen Datum Oktober 2010 Mit Kaufmann Mittelstand 2011 rechnen Sie ab sofort auch Kurzarbeitergeld ab. Das Programm unterstützt
Zusammenhang zwischen durchschnittlicher Geschwindigkeit und Verbrauch l/100km?
 Zusammenhang zwischen durchschnittlicher Geschwindigkeit und Verbrauch l/100km? Weil mich die Frage interessiert, ob es diesen Zusammenhang gibt und wie stark er tatsächlich ist, führe ich einigermaßen
Zusammenhang zwischen durchschnittlicher Geschwindigkeit und Verbrauch l/100km? Weil mich die Frage interessiert, ob es diesen Zusammenhang gibt und wie stark er tatsächlich ist, führe ich einigermaßen
von Fußböden (Systemböden)
 Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen
Messverfahren zur Messung des Ableitwiderstandes von Fußböden (Systemböden) GIT ReinRaumTechnik 02/2005, S. 50 55, GIT VERLAG GmbH & Co. KG, Darmstadt, www.gitverlag.com/go/reinraumtechnik In Reinräumen
Das LIFE-Projekt MAGPlan
 Das LIFE-Projekt MAGPlan Integrales Erkundungsund Sanierungskonzept für ein innerstädtisches Grundwassersystem Dipl.-Geogr. Michael Schweiker Amt für Umweltschutz Altlastensymposium 2011, Neu-Ulm Das Stuttgarter
Das LIFE-Projekt MAGPlan Integrales Erkundungsund Sanierungskonzept für ein innerstädtisches Grundwassersystem Dipl.-Geogr. Michael Schweiker Amt für Umweltschutz Altlastensymposium 2011, Neu-Ulm Das Stuttgarter
Grundwasserhochstand im März 2013
 Grundwasserhochstand im März 2013 Nachbildung mit dem Grundwassermodell Flutpolder Eltheim und Wörthhof Januar 2018 Arbeitsgemeinschaft Simultec tewag Simultec AG, Hardturmstr. 261, CH-8005 Zürich, +41
Grundwasserhochstand im März 2013 Nachbildung mit dem Grundwassermodell Flutpolder Eltheim und Wörthhof Januar 2018 Arbeitsgemeinschaft Simultec tewag Simultec AG, Hardturmstr. 261, CH-8005 Zürich, +41
1 Grundprinzipien statistischer Schlußweisen
 Grundprinzipien statistischer Schlußweisen - - Grundprinzipien statistischer Schlußweisen Für die Analyse zufallsbehafteter Eingabegrößen und Leistungsparameter in diskreten Systemen durch Computersimulation
Grundprinzipien statistischer Schlußweisen - - Grundprinzipien statistischer Schlußweisen Für die Analyse zufallsbehafteter Eingabegrößen und Leistungsparameter in diskreten Systemen durch Computersimulation
Validitätsüberprüfung der Nitratkonzentrationen des Sickerwassers im Erftverbandsgebiet
 Validitätsüberprüfung der Nitratkonzentrationen des Sickerwassers im Erftverbandsgebiet durch Vergleich der Nitratwerte des Sickerwassers (Modell) mit denen des Grundwassers (Analysen) Dr. Nils Cremer
Validitätsüberprüfung der Nitratkonzentrationen des Sickerwassers im Erftverbandsgebiet durch Vergleich der Nitratwerte des Sickerwassers (Modell) mit denen des Grundwassers (Analysen) Dr. Nils Cremer
Grundwasserabstromerkundung mittels Immissionspumpversuchen Übersicht und Anwendungsbeispiele
 Grundwasserabstromerkundung mittels Immissionspumpversuchen Übersicht und Anwendungsbeispiele Dr.-Ing. Hans-Peter Koschitzky VEGAS, Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung, Universität
Grundwasserabstromerkundung mittels Immissionspumpversuchen Übersicht und Anwendungsbeispiele Dr.-Ing. Hans-Peter Koschitzky VEGAS, Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung, Universität
Komplexer Ansatz für eine belastbare Grundwassergefährdungs- und risikobewertung von Altlasten. XXV. Sächsisches Altlastenkolloquium
 Komplexer Ansatz für eine belastbare Grundwassergefährdungs- und risikobewertung von Altlasten XXV. Sächsisches Altlastenkolloquium Autoren: M.Sc. Florian Kurzius Dipl.-Hydrol. Philipp Dost Dipl.-Chem.
Komplexer Ansatz für eine belastbare Grundwassergefährdungs- und risikobewertung von Altlasten XXV. Sächsisches Altlastenkolloquium Autoren: M.Sc. Florian Kurzius Dipl.-Hydrol. Philipp Dost Dipl.-Chem.
Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
 Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut
Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut
Entwurf zur Handlungsanleitung Kosten-Nutzen-Analyse
 Entwurf zur Handlungsanleitung Kosten-Nutzen-Analyse für Immissionspumpversuche Einführung Herkömmliche Erkundungsstrategien versagen an Standorten mit mehreren und auch unbekannten Schadstoffherden. Hier
Entwurf zur Handlungsanleitung Kosten-Nutzen-Analyse für Immissionspumpversuche Einführung Herkömmliche Erkundungsstrategien versagen an Standorten mit mehreren und auch unbekannten Schadstoffherden. Hier
GFS im Fach Mathematik. Florian Rieger Kl.12
 file:///d /Refs/_To%20Do/12_09_04/NewtonVerfahren(1).html 27.02.2003 GFS im Fach Mathematik Florian Rieger Kl.12 1. Problemstellung NewtonApproximation Schon bei Polynomen dritter Ordnung versagen alle
file:///d /Refs/_To%20Do/12_09_04/NewtonVerfahren(1).html 27.02.2003 GFS im Fach Mathematik Florian Rieger Kl.12 1. Problemstellung NewtonApproximation Schon bei Polynomen dritter Ordnung versagen alle
INHALTSVERZEICHNIS. Einleitung Allgemeines
 Einleitung Allgemeines INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung...3 1.1 Allgemeines...3 2 Arbeiten mit der Massenermittlung...4 2.1 Die Oberfläche...5 2.2 Einstellungen...6 2.3 Darstellung...6 2.3.1 Bauteile in
Einleitung Allgemeines INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung...3 1.1 Allgemeines...3 2 Arbeiten mit der Massenermittlung...4 2.1 Die Oberfläche...5 2.2 Einstellungen...6 2.3 Darstellung...6 2.3.1 Bauteile in
Skript Teil 10: Massenberechnung
 Prof. Dr. techn. Alfred Mischke Vorlesung zur Veranstaltung Vermessungskunde Skript Teil 0: Massenberechnung Ein wesentlicher Kostenfaktor bei nahezu allen Baumaßnahmen ist der Transport der Erdmassen.
Prof. Dr. techn. Alfred Mischke Vorlesung zur Veranstaltung Vermessungskunde Skript Teil 0: Massenberechnung Ein wesentlicher Kostenfaktor bei nahezu allen Baumaßnahmen ist der Transport der Erdmassen.
