Harninkontinenz der Frau Christian Dannecker, Klaus Friese, Christian Stief, Ricarda Bauer
|
|
|
- Paula Beutel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ÜBERSICHTSARBEIT Harninkontinenz der Frau Christian Dannecker, Klaus Friese, Christian Stief, Ricarda Bauer Teil 1 der Serie Inkontinenz ZUSAMMENFASSUNG Hintergrund: Harninkontinenz der Frau kann in jedem Lebensalter auftreten. Die Prävalenz liegt zwischen 10 und 40 Prozent. In der Urogynäkologie haben vor allem die Belastungsinkontinenz (Urinverlust bei körperlicher Belastung, Niesen, Husten) und das Syndrom der überaktiven Blase (Nykturie, Pollakisurie, imperativer Harndrang mit oder ohne Inkontinenz) Bedeutung. Methode: Selektive Literaturrecherche unter Berücksichtigung von Publikationen mit größeren Patientinnenpopulationen und der Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) und der Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und Beckenbodenrekonstruktion in der DGGG. Ergebnisse: Es gibt ein breites diagnostisches und therapeutisches Instrumentarium, dessen Anwendung sich am Leidensdruck und an der Therapiemotivation der Patientin orientiert. Bei der Therapie der überaktiven Blase haben anticholinerge Medikamente einen festen Stellenwert. Sie werden mit den Möglichkeiten einer Lebensstiländerung und einem Blasentraining kombiniert. Unter Umständen kann man auch eine Injektionstherapie mit Botulinumtoxin erwägen. Vor einer operativen Therapie der Belastungsinkontinenz sollten konservative Maßnahmen (Beckenbodentraining) berücksichtigt werden. Die neuen spannungsfreien Vaginalschlingen verfügen im Vergleich mit klassischen Verfahren (zum Beispiel Kolposuspension) über gleiche therapeutische Effektivität bei insgesamt geringerer Invasivität und schnellerer Rekonvaleszenz. Schlussfolgerung: Eine fachgerechte Diagnostik und eine gut fundierte Beratung kann jeder betroffenen Frau die Chance auf eine individualisierte Behandlung eröffnen. Zitierweise: Dtsch Arztebl Int 2010; 107(24): DOI: /arztebl Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Großhadern: PD Dr. med. Dannecker, Prof. Dr. med. Friese Urologische Klinik und Poliklinik Großhadern: Prof. Dr. med. Stief, Dr. med. Bauer Beckenbodenzentrum der Universität München: PD Dr. med. Dannecker, Prof. Dr. med. Friese, Prof. Dr. med. Stief, Dr. med. Ricarda Bauer Harninkontinenz meint jeglichen unfreiwilligen Urinverlust (International Continence Society, ICS). Sie kann in jedem Lebensalter auftreten, wobei die Prävalenz und das Ausmaß der Inkontinenz bei Frauen mit zunehmendem Alter ansteigen. Allein für die Belastungsinkontinenz liegt die Prävalenz bei Mädchen und Frauen von 15 bis 64 Jahren zwischen 10 % und 40 % (1). Zahlreiche Studien belegen die Reduktion der Lebensqualität (e1). Eine fachgerechte Diagnostik und eine gut fundierte Beratung sollten jeder betroffenen Frau die Chance auf eine individualisierte Behandlung eröffnen. Ziel des Artikels ist es, die aktuellen Optionen der Diagnostik und Therapie weiblicher Harninkontinenz darzustellen. Hierfür wurde eine selektive Literaturrecherche der Datenbank Pubmed der National Library of Medicine ( durchgeführt. Berücksichtigt wurden insbesondere neuere Arbeiten, die größere Patientinnenpopulationen beschreiben. Verwendung fanden zudem die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) und der Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion in der DGGG Belastungsinkontinenz der Frau (AWMF 015/005), Descensus genitalis der Frau Diagnostik und Therapie (AWMF 015/006) und Sonographie im Rahmen der urogynäkologischen Diagnostik (AWMF 015/055). Diagnostik Hinsichtlich der weiblichen Harninkontinenz sind in der Urogynäkologie vor allem die Belastungsinkontinenz und das Syndrom der überaktiven Blase ( overactive bladder syndrome, OAB [Nykturie, Pollakisurie, imperativer Harndrang, mit oder ohne Dranginkontinenz]) von Bedeutung (Tabelle 1). Bei der Diagnostik wird unterschieden, ob eine konservative Therapie oder ein operatives Vorgehen geplant ist. Vor einer konservativen Therapie gelten folgende Untersuchungen als ausreichend: Anamnese, Toiletten- und Trinkprotokoll, klinische Untersuchung mit gynäkologischem Befund, Urinuntersuchung (Harnwegsinfekt?), Restharnmessung und Hustentest. Bei Symptomen einer überaktiven Blase ist eine Urethrozystoskopie indiziert. Vor einer operativen Therapie der Belastungsinkontinenz werden zusätzlich eine Zystometrie (Beurteilung der Blasensensorik oder Objektivierung einer Detrusorüberaktivität), die Überprüfung der Blasenentleerung (Restharn, Uroflowmetrie) und die Dokumentation der Pathomorphologie (zum Beispiel durch Intro- 420 Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft Juni 2010
2 TABELLE 1 Einteilung weiblicher Inkontinenzformen nach ICS (International Continence Society) (e3) Art der Inkontinenz Belastungsinkontinenz (früher Stressinkontinenz) Dranginkontinenz bzw. Urgeinkontinenz Mischinkontinenz Sonderformen Definition/Symptome Unwillkürlicher Urinverlust bei körperlicher Anstrengung (z.b. Husten, Niesen, Sport) ohne Harndrang Unwillkürlicher Urinverlust in Kombination mit plötzlichem Drangempfinden: mit Detrusorinstabilitäten (früher motorische Dranginkontinenz) ohne Detrusorinstabilitäten (früher sensorische Dranginkontinenz) Unwillkürlicher Urinverlust assoziiert mit Harndrang, aber auch mit körperlicher Anstrengung u.a. neurogene Inkontinenz, extraurethrale Inkontinenz (z.b. bei Fisteln), Überlaufinkontinenz, Giggle-Inkontinenz itus- oder Perineal-Sonographie) empfohlen. Dabei haben bei der Bildgebung die sonographischen Techniken die radiologischen weitgehend abgelöst. Mittels Sonographie lassen sich im sagittalen Bild Urethra, Blase, Symphyse und Vagina, eventuell auch Uterus und Rektum darstellen (2). Weiterführende Untersuchungen können im Einzelfall nützlich sein (Harnröhrendruckprofil/Stressprofil, Bestimmung der Druck-Transmis - sion, Video-Urodynamik, Ausscheidungs-Urographie). Bei der urogynäkologischen Anamnese werden Miktions- und Defäkationsstörungen, Trinkgewohnheiten, Begleiterkrankungen (neurologische Erkrankungen, Diabetes mellitus), Vorlagenverbrauch (tags und nachts), Medikamentenanamnese und Voroperationen berücksichtigt. Zudem sollten Einschränkungen für die Lebensqualität und im Bereich des Sexuallebens evaluiert werden. Zur Beurteilung der Lebensqualität eignen sich standardisierte Fragebögen (zum Beispiel ICIQ- SF, International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form [3]). Der Schweregrad der Belastungsinkontinenz wird anamnestisch häufig nach Ingelman-Sundberg klassifiziert (Tabelle 2) (e2) Der Stressoder Hustentest mit gefüllter Blase dient dem klinischen Nachweis und zur Graduierung einer Belastungsinkontinenz (positiv bei hustensynchronem Urinverlust, Tabelle 3). Zur Bestimmung des Ausmaßes der Inkontinenz kann optional ein Vorlagenwiegetest (Pad-Test) durchgeführt werden. Dabei kann ein von der Deutschen Kontinenzgesellschaft empfohlener standardisierter Kurztest verwendet werden (1-Stunden-Pad-Test; Messung des Urinverlusts in eine spezielle Slipeinlage nach definierten Übungen). TABELLE 2 Einteilung des Schweregrades der Belastungsinkontinenz nach Ingelmann-Sundberg (e2) Schweregrad Belastungsinkontinenz I Belastungsinkontinenz II Belastungsinkontinenz III Definition Urinverlust beim Husten, Niesen, Pressen und Lachen Urinverlust beim Heben, Laufen und Treppensteigen Urinverlust beim Stehen ohne körperliche Betätigung Die körperliche Untersuchung beinhaltet die Inspektion des Abdomens und des äußeren Genitales, sowie eine Spekulumeinstellung (vaginale Untersuchung) zur Beurteilung eines eventuell simultan vorliegenden Descensus genitalis oder von Gewebeveränderungen infolge eines Östrogenmangels. Die vaginale Untersuchung erfolgt dabei in Ruhe und beim Pressen; dabei wird auf eine Veränderung der Vaginalwände (Deszensus, Prolaps) geachtet (Abbildung 1). In der Klassifikation des Deszensus hat sich im Bereich wissenschaftlicher Arbeiten die sogenannte POP-Q-Klassifikation (Pelvic Organ Prolapse Quantification) etabliert, allerdings konnte sich diese im klinischen Alltag nicht durchsetzten (e3, e4). Hier findet leitlinienkonform ein vierstufiger Score Verwendung (Tabelle 4) (4). Eine urodynamische Untersuchung ist bei einer unkomplizierten Inkontinenz nicht indiziert und wird in den Leitlinien erst bei Versagen eines ersten Therapieversuchs, bei rezidivierenden Infekten oder zur Abklärung vor einer Inkontinenzoperation beziehungsweise bei postoperativer Inkontinenz empfohlen (5). Eine Video-Urodynamik wird bei Verdacht auf eine neurogene Komponente der Inkontinenz und bei diskrepanten Befunden (dann auch bei Belastungs- und Dranginkontinenz) empfohlen. Bei Vorliegen einer Zystozele kann der Befund zusätzlich mittels eines Zystogramms beziehungsweise eines Miktionszystourethrogramms objektiviert werden. Zur Beurteilung der Position des Blasenhalses, von Lage und Form der Urethra und des Blasenbodens ist eine Introitus- beziehungsweise Perinealsonographie sinnvoll. Außerdem lässt sich sonographisch eine Restharnbildung gut beurteilen. Grundsätzlich sollte man im Rahmen der Abklärung einer Harninkontinenz auch auf eventuell simultan vorliegende Defekte des Beckenbodens (Rektozele, Enterozele) achten. Eine zystoskopische Abklärung wird bei komplizierter Harninkontinenz, Verdacht auf vesikovaginale Fistel oder extraurethraler Inkontinenz, bei Blasenbeschwerden mit Verdacht auf ein morphologisches Korrelat und bei (Mikro-)Hämaturie empfohlen. Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft Juni
3 TABELLE 3 Einteilung des Schweregrads der Belastungsinkontinenz nach dem klinischen Stress- oder Hustentest bei gefüllter Harnblase (circa 300 ml) (20) Schweregrad Belastungsinkontinenz 0 Belastungsinkontinenz I Belastungsinkontinenz II Belastungsinkontinenz III Definition kein Urinverlust nachweisbar Urinverlust tröpfchenweise im Stehen Urinverlust im Strahl im Stehen Urinverlust im Strahl im Liegen a Abbildung 1: a) Traktionszystozele (lateraler Fasziendefekt); b) Pulsationszystozele (medialer Fasziendefekt) b Die dynamische Funktions-Magnetresonanztomographie des kleinen Beckens ermöglicht eine genaue Darstellung der dynamischen Vorgänge beim Zusammenspiel aller Beckenorgane und des Beckenbodens. Allerdings sollte diese Untersuchung besonderen Frage stellungen (Rektumprolaps, Rezidivinkontinenz oder -Deszensus nach erfolgter Inkontinenz- oder Deszensus chirurgie) in spezialisierten Zentren vorbehalten bleiben. Therapie Es gibt ein breites therapeutisches Spektrum, was eine Individualisierung der Therapie ermöglicht. Die Datenlage hat sich aufgrund aktueller Studien gerade in den vergangen Jahren erfreulich stabilisiert. Für die meisten der im Folgenden genannten Therapien existieren Studien in guter Qualität. Therapie der überaktiven Blase (OAB) Die Therapie der OAB wird unterteilt in konservative und medikamentöse Ansätze. Grundlage der konservativen Therapie ist eine Lebensstiländerung im Sinne eines Trink- und Blasentrainings (5). Bereits im Trink- und Toilettenprotokoll kann man drangauslösende Faktoren identifizieren. Dabei ist das Protokoll Grundlage jedweder Therapie und soll für mindestens zwei aufeinanderfolgende Tage an zwei aufeinanderfolgenden Wochen von der Patientin ausgefüllt und zum Arzt mitgebracht werden. Es kann dann mit Hilfe einfacher Verhaltensänderungen eine positive Beeinflussung der Beschwerden erzielt werden: Reduktion übermäßiger Trinkmengen (circa 1,5 Liter Flüssigkeit / Tag reichen) gegebenenfalls etwa zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr Trinken Trinkmenge gleichmäßig über den Tag verteilen Reizstoffe vermeiden (Nikotin, Pfeffer, Chili, scharfe Gewürze, säurereiche Getränke) Obstipation vermeiden Unterstützend wirkt ein Blasentraining; dabei können durch das aktive Unterdrücken des Harndranges zu kurze Miktionsintervalle verlängert werden. Durch eine lokale (vaginale) Östrogenisierung können sich die OAB-Symptome signifikant verbessern (6). Entspannungsübungen des Beckenbodens mittels Beckenbodentraining mit Biofeedback können zu einer Reduktion einer Beckenbodenüberaktivität führen und damit reflektorisch die Drangbeschwerden lindern. Anticholinergika haben bei der Therapie der OAB zentrale Bedeutung (7). Sie führen über die Blockade von Muskarinrezeptoren zu einer Hemmung unwillkürlicher Detrusorkontraktionen. Reine Anticholinergika sind: Trospiumchlorid, Tolterodin, Fesoterodin, Solifenacin und Darifenacin. Eine zusätzliche lokalanästhetische Wirkung zeigen Oxybutinin und Propiverin. In prospektiven und randomisierten Studien wurden im Durchschnitt folgende Veränderungen im Vergleich zum Placebo beobachtet: Verminderung von Inkontinenzepisoden/Tag (0,4 1,1) Verminderung der Miktionen/Tag (0,5 1,3) Verminderung an Harndrangepisoden/Tag (0,64 1,56) und Steigerung des Miktionsvolumens (13 40 ml). Anticholinergika werden gut vertragen, die Nebenwirkungen sind eher gering. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählten in den Studien (Verum versus Placebo): Mundtrockenheit (30 % versus 8 %; meist nur leichte Trockenheit), Pruritus (15 % versus 5 %), Obstipation (8 % versus 4 %) (8). Das unkontrollierte Engwinkelglaukom und die Tachyarrhythmie stellen Kontraindikationen für den Einsatz von Anticholinergika dar. Um die Wirkung einer anticholinergen Therapie suffizient beurteilen zu können, ist eine Therapiedauer über vier bis sechs Wochen notwendig. Bei nicht ausreichender Wirkung empfiehlt sich gegebenenfalls eine Dosissteigerung (cave Restharnbildung) beziehungsweise ein Wechsel des Anticholinergikums. Bei unzureichendem therapeutischen Effekt der Anticholinergica oder bei einer Unverträglichkeit kann man die intravesikale Injektion von Botulinumtoxin A erwägen (9). Dabei wird an verschiedenen Stellen Botulinumtoxin direkt in den M. detrusor vesicae injiziert. Hiermit kann 422 Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft Juni 2010
4 TABELLE 4 Klinische Deszensuseinteilung (4) Schweregrad Grad I Grad II Grad III Grad IV Definition die größte distale Ausdehnung reicht mehr als 1 cm oberhalb des Hymenalsaumes die größte distale Ausdehnung erreicht den Introitus die größte distale Ausdehnung reicht bis max. 2 cm vor den Introitus (außerhalb) Totalprolaps Abbildung 2: Urethrapessar nach Arabin eine Reduktion der Inkontinenzepisoden, Steigerung der Miktionsmenge und Reduktion der Miktionsfrequenz erzielt werden. Die Nebenwirkungen sind in der Regel gering, gelegentlich kann es aber postinterventionell zu einer temporären Restharnbildung bis hin zur Harnverhaltung kommen. Die durchschnittliche Wirkdauer liegt bei neun bis zwölf Monaten (9). Wiederholte Injektionen haben keine Wirkungsabschwächung zur Folge. Aufgrund bisher fehlender Zulassung von Botulinumtoxin zur OAB-Therapie ( off-label-use ), sollte diese Option auch deshalb nur spezialisierten Zentren vorbehalten sein. Eine weitere Therapieoption ist die sogenannte EM- DA-Therapie ( electromotive drug administration ) (1). Hierbei erfolgt die gezielte Abgabe von medikamentösen Wirkstoffen (zum Beispiel eine Kombination aus Lidocain, Adrenalin, Buscopan, Dexamethason und Pentosan) über einen transurethralen Elektrodenkatheter unmittelbar in das Blasengewebe. Mittels eines elektrischen Feldes gelangen Wirkstoffe direkt in die tieferen Gewebeschichten der Blase (aktive Diffusion). Mit sakraler Neuromodulation können Sakralnerven mit schwachen elektrischen Impulsen stimuliert werden; auch dadurch lässt sich eine Reduktion von Drang- und Inkontinenzepisoden und eine Steigerung der Blasenkapazität erzielen (11). Das Verfahren findet bei therapieresistenten Patientinnen in spezialisierten Zentren Anwendung. Therapie der Belastungsinkontinenz Die folgenden Ausführungen zur Therapie der Belastungsinkontinenz orientieren sich unter anderem an der aktuellen S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) und der Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und Beckenbodenrekonstruktion in der DGGG Belastungsinkontinenz der Frau (AWMF-Leitlininen-Register Nr. 015/005). Grundsätzlich kann eine Belastungsinkontinenz konservativ oder operativ therapiert werden. Dabei sollte man in der Regel zunächst einen konservativen Therapieversuch unternehmen. Bei gleichzeitig vorliegendem ausgeprägtem Deszensus oder Prolaps kann jedoch eine sofortige operative Therapie erforderlich sein. Abbildung 3: Schaumstofftampons Konservative Therapie Die konservative Therapie der Belastungsinkontinenz erstreckt sich auf Empfehlungen zur Änderung des Lebensstils (Gewichtsreduktion), Physiotherapie, medikamentöse Therapie und Einsatz von Hilfsmitteln. Gewichtsreduktion Hinsichtlich des Lebensstils kann vor allem eine Gewichtsreduktion bei adipösen Frauen bereits den gewünschten therapeutischen Effekt nach sich ziehen. In einer randomisierten Studie war eine Gewichtsabnahme um 5 bis 10 % mit einer Abnahme der Zahl der Inkontinenzepisoden um 60 % assoziiert (12). Physiotherapie Die Physiotherapie der Belastungsinkontinenz erstreckt sich auf verschiedene Formen eines Beckenbodentrainings (mit oder ohne Biofeedback), Elektrostimulationsbehandlung, Training mit Vaginalkonen und andere Therapiekonzepte (zum Beispiel Vibrationstherapie, hochenergetische Magnetfeldbehandlung). Ziel der Physiotherapie ist die Stärkung der Beckenboden- Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft Juni
5 muskulatur (vor allem des M. levator ani) und die Optimierung der Koordination der bewussten Beckenbodenkontraktionen (Timing), damit bei drohendem Urinverlust aufgrund eines intraabdominalen Druckanstiegs die Harnröhre verschlossen werden kann. Ein Training der Beckenbodenmuskulatur ist nach einer Metaanalyse der Cochrane Library effektiv (13). Es werden Ansprechraten (Heilung/Besserung) zwischen 46 und 75 % publiziert. Ob ein zusätzliches Biofeedback die Effektivität des Trainings verbessert, ist nicht gesichert. Eine Elektrostimulationsbehandlung des Beckenbodens mit vaginalen Elektroden, die passiv eine Kontraktion des M. levator ani bewirken, kann zu einer Verbesserung der Wahrnehmung des Beckenbodens bei Frauen mit Belastungsinkontinenz führen; ob die Hinzunahme einer Elektrostimulation jedoch ein Beckenbodenmuskeltraining verbessert, ist nicht belegt. Die Datenlage für eine Empfehlung zur Therapie mit Vaginalkonen, einer perinealen Vibrationstherapie und anderen Therapieformen ist nicht ausreichend (14). Eine extrakorporale Magnetfeldbehandlung ist nicht effektiv (15, 16). Medikamentöse Therapie Duloxetin ist ein Serotonin-Noreadrenalin-Wieder - aufnahmehemmer und in Deutschland für drei Indi - kationen zugelassen: Depression, periphere diabetische neuropathische Schmerzen und Belastungsinkontinenz. In großen randomisierten und kontrollierten Studien zeigte Duloxetin in einer Dosierung von 2 40 mg pro Tag eine Ansprechrate (subjektive Besserung der Belastungsinkontinenz) von 62 % (Placebo 40 %). Unter Alltagsbedingungen zeigte Duloxetin jedoch eine deutlich schlechtere Effektivität (nur 37 %), eine hohe Rate an Nebenwirkungen (71 %, Nausea [24 %] ), was in einer hohen Rate an Therapieabbrechern (66 %) resultierte (17). Duloxetin kann zur Behandlung einer Belastungsinkontinenz eingesetzt werden, findet aber im klinischen Alltag nur eine sehr eingeschränkte Indikation. Zur Reduktion der Nebenwirkungen wurde eine einschleichende Dosierung (2 20 mg über zwei Wochen) empfohlen. Einsatz von Hilfsmitteln Spezielle Inkontinenzeinlagen (Binden) sind als supportive Maßnahme sinnvoll. Bezüglich intravaginaler Hilfsmittel sind spezielle Urethrapessare (Abbildung 2) und Tampons aus Schaumstoff (Abbildung 3) verbreitet. Das ringförmige, elastische Urethrapessar besitzt eine Kalotte, welche den Übergang zwischen Blase und Harnröhre nach oben vorne verlagern und so unter Belastungssituationen (Husten, Bewegung) ein Eröffnen der oberen Harnröhre verhindern soll. Dieses Pessar ist zum (täglichen) eigenständigen Wechsel durch die Patientin geeignet; so werden Druckulzerationen vermieden. Schaumstoffpessare sind Einmalartikel, die nur zeitweise, während bestimmter Tätigkeiten getragen werden sollten (zum Beispiel Wandern, Joggen). GRAFIK 1 GRAFIK 2 Operative Therapie der Belastungsinkontinenz Es gibt zahlreiche Verfahren der operativen Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau. Im Folgenden sollen nur die Wichtigsten genannt werden: Kolposuspensionen spannungsfreie Schlingenoperationen (Urethramittig) traditionelle, blasenhalsnahe Schlingenoperationen intraurethrale Injektionen. Eine Implantation eines artifiziellen Sphinkters ist eine Ultima ratio der Therapie der Belastungsinkontinenz, wenn alle anderen therapeutischen Maßnahmen keinen Erfolg gezeigt haben. Retropubisches TVT. Das Netzimplantat wird unter der Urethra platziert und tritt unmittelbar oberhalb des Schambeines wieder aus. (mit freundlicher Genehmigung: ETHICON Women s Health & Urology) Kolposuspension Die Kolposuspension in ihrer ursprünglichen Form wurde von Marshall, Marchhetti und Krantz 1949 publiziert und hat bis in die Gegenwart viele Modifikationen erfahren, wovon die bekannteste die sogenannte Burch-Kolpo- Transobturatorisches TVT. Das Netzimplantat wird unter der Urethra platziert und tritt in der Nähe der Oberschenkelfalte wieder aus. (mit freundlicher Genehmigung: ETHICON Women s Health & Urology) 424 Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft Juni 2010
6 suspension ist. Ziel der Operation ist, den Blasenhalsbereich anzuheben, wodurch die Harnröhre bei intraabdominalen Druckanstieg verschlossen bleibt. Während ursprünglich die Scheidenfaszie am Periost der Symphysenhinterwand befestigt wurde, wird bei der Burch-Kolposupension die Scheidenfaszie beidseits des Blasenhalses an den Ligg. pectinealiea (Cooper-Ligamente) über jeweils zwei bis drei Nähte freihängend ( Luftknoten ) eleviert. Dadurch kann zeitgleich auch ein Lateraldefekt ausgeglichen werden. Die Kolposuspension kann offen (Unterbauchquerschnitt) oder laparoskopisch erfolgen. Die Datenlage für die offene Kolposupension ist sehr gut, insbesondere liegen Langzeitdaten (bis 20 Jahre Nachuntersuchungszeitraum) vor. Die in einer Cochrane-Übersicht analysierten Erfolgsraten liegen zwischen 85 und 90 % nach einem Jahr und bei etwa 70 % nach fünf Jahren (18). Alcalay et al. berichten sogar von Erfolgsraten von 78 % nach 20 Jahren (19). An unerwünschte Folgen der Operation werden Blasenentleerungsstörungen (12,5 %; bei 3,5 % persisitierend), die Entstehung einer Dranginkontinenz (de novo 6,6 %) und ein Descensus genitalis (22 %, vor allem vor allem Rekto-/Enterozelen) genannt, wobei jedoch nur etwa 5 % zur Behebung des Descensus genitalis einen Zweiteingriff benötigten. Die unerwünschten Folgen sollten ebenso wie die Erfolgsaussichten der Operation Bestandteil der präoperativen Aufklärung sein. Es gelten derzeit folgende Indikationen zur Durchführung einer Kolposuspension (20): Inkontinenzoperation im Rahmen einer Laparotomie aufgrund anderer Indikation (zum Beispiel abdominale Hysterektomie) im Rahmen einer abdominalen Deszensusoperation (zum Beispiel paravaginale Defektkorrektur) im Rahmen einer Rezidivoperation (zum Beispiel nach erfolgloser Anlage einer spannungsfreien Schlinge). Spannungsfreie Vaginalschlingen Im Unterschied zu den traditionellen Vaginalschlingen und zur Kolposuspension wird bei den neueren Vaginalschlingen eine Elevation des Blasenhalsbereichs vermieden. Vielmehr wird ein Polypropylene-Band spannungsfrei im mittleren Harnröhrenbereich platziert und entweder retropubisch (Grafik 1) oder beidseitig durch das Foramen obturatum ausgeleitet (Grafik 2). Ein Bauchschnitt ist nicht erforderlich. Die Erfolgsraten liegen zeitabhängig zwischen 73 und 95 % und sind demnach mit denen der Kolposuspension vergleichbar, wie prospektive und randomisierte Studien belegen (21 23). Ein postoperativer Descensus genitalis im hinteren Kompartiment (Rektozele) wird im Vergleich zur Kolposuspension deutlich seltener beobachtet (18). Die im Vergleich zur Kolposuspension geringere Invasivität, die schnellere Rekonvaleszenz und die Sicherheit des Verfahrens erklären den Erfolg der modernen Schlingen. Dennoch beobachtet man auch hier unerwünschte Folgen: intraoperative Blasenperforationen (4 %), retropubische Blutungen (1 %), Blasenentleerungsstörungen (4 11 %; in 3 % der Fälle wird eine Banddurchtrennung erforderlich); Urethra-, Darm und Gefäßverletzungen und sogar Todesfälle wurden in Einzelfällen beschrieben. Zudem sollte in der Aufklärung vor Anlage einer spannungsfreien Vaginalschlinge auf das Risiko einer Dyspareunie hingewiesen werden (e6, e7). Traditionelle Schlingen Bei autologen, abdomino-vaginalen Schlingen (meist Rektusfaszie oder Fascia lata) liegt die Schlinge im Blasenhalsbereich. Die Verfahren werden jedoch nur noch selten eingesetzt. Indikationen bestehen gelegentlich noch bei sehr kurzer funktioneller Harnröhrenlänge und bei Rezidivinkontinenz. Die berichteten Erfolgsraten liegen bei 87 % bei einer Nachbeobachtungszeit von bis zu zehn Jahren (20). Langfristige Probleme können auch hier persistierende Blasenentleerungsstörungen und denovo-urgency (imperativer Harndrang) sein. Injektionstechniken (24) Ziel der periurethralen Einbringung von sogenannten bulking agents (bovines Kollagen, Silikonpartikel- Kohlenstoff-Perlen, Dextranomer/Hyaluronäure[Dx/ HA]-Kopolymer, Polyacrylamid-Hydrogel) ist die Unterfütterung der Urethralschleimhaut, so dass die Urethra bei Belastung verschlossen bleibt. Die Ansprechraten nach ein bis zwei Jahren liegen zwischen 50 und 80 %, langfristig aber deutlich niedriger (20 bis 30 %), Reinjektionen sind häufig erforderlich (25). Folgende Nebenwirkungen wurden beobachtet: Fremdkörperreaktion (Granulom), Allergie, Harnwegsinfekt, Hämaturie, Blasenentleerungsstörung (meist reversibel), Urgency, Arrosion, Abszess und paraurethrale Zystenbildung. Insgesamt haben Injektionstechniken schlechtere Langzeitergebnisse als andere Inkontinenzoperationen. Wegen der begrenzten Datenlage sollte die Operation in der Regel nicht bei Patientinnen angewendet werden, bei denen effektivere Methoden infrage kommen. KERNAUSSAGEN Harninkontinenz der Frau ist häufig und kann in jedem Lebensalter auftreten; die Prävalenz liegt zwischen 10 und 40 %. Diagnostik und Therapie orientieren sich am Leidensdruck der Patientin und ermöglichen aufgrund der zahlreichen konservativen und operativen Therapiealternativen ein individualisiertes Vorgehen. Bei der Therapie der überaktiven Blase haben anticholinerge Medikamente einen festen Stellenwert. Vor einer operativen Therapie der Belastungsinkontinenz sollten konservative Maßnahmen (Beckenbodentraining) berücksichtigt werden. Die neuen spannungsfreien Vaginalschlingen (zum Beispiel TVT) verfügen im Vergleich mit klassischen Verfahren (zum Beispiel Kolposuspension) über die gleiche therapeutische Effektivität bei insgesamt geringerer Invasivität und schnellerer Rekonvaleszenz. Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft Juni
7 Interessenkonflikt Frau Bauer erhielt Vortragshonorare von Astellas Pharma GmbH, Herr PD Dr. Danneker erhielt Honorare von der Firma Ethikon. Herr Prof. Stief und Herr Prof. Friese geben keinen Interessenkonflikt im Sinne der Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors an. Manuskriptdaten eingereicht: , revidierte Fassung angenommen: LITERATUR 1. Hunskaar S, Lose G, Sykes D, Voss S: The prevalence of urinary incontinence in women in four european countries. BJU international 2004; 93: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) gemeinsam mit der AG Urogynäkologie und Plastische Beckenbodenrekonstruktion (AGUB) dauurba, Österreich), der Österr. Ges. für Urologie, und der AG Urogynäkologie (AUG, Schweiz): Sonographie im Rahmen der urogynäkologischen Diagnostik 1996 (letzte Überarbeitung 8/2008) 3. Avery K, Donovan J, Peters TJ, Shaw C, Gotoh M, Abrams P: Iciq: A brief and robust measure for evaluating the symptoms and impact of urinary incontinence. Neurourology and urodynamics 2004; 23: Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und Plastische Beckenbodenrekonstruktion (AGUB), Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU), Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und rekonstruktive Beckenbodenchirurgie (AUB Ö, Österreichische Gesellschaft für Urologie, Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie (AUG S: Descensus genitalis der Frau Diagnositk und Therapie, 2008, AWMF 015/006 (s2k), ad/g_01_03_02_genitalis_frau_diagnostik_therapie.pdf 5. Thüroff J, Abrams P, Andersson K, Artibani W, Chartier-Kastler E, Hampel C, Van Kerrebroeck P: Guidelines on urinary incontinence, European Association of Urology, 2006, user_upload/guidelines/16%20urinary%20incontinence.pdf 6. Cardozo L, Lose G, McClish D, Versi E: A systematic review of the effects of estrogens for symptoms suggestive of overactive bladder. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2004; 83: Andersson KE: Antimuscarinics for treatment of overactive bladder. Lancet Neurol 2004; 3: Chapple CR, Khullar V, Gabriel Z, Muston D, Bitoun CE, Weinstein D: The effects of antimuscarinic treatments in overactive bladder: An update of a systematic review and meta-analysis. European urology 2008; 54: Seif C, Boy S, Wefer B, Dmochowski R, Braun P, Junemann K: Botulinumtoxin in der Therapie der überaktiven Blase ein Überlick. Urologe 2008; 47: Haferkamp A, Hohenfellner M: Intravesikale Therapie des overactivebladder-syndroms. Urologe 2008; 47: Chartier-Kastler E: Sacral neuromodulation for treating the symptoms of overactive bladder syndrome and non-obstructive urinary retention: >10 years of clinical experience. BJU international 2008; 101: Subak LL, Whitcomb E, Shen H, Saxton J, Vittinghoff E, Brown JS: Weight loss: a novel and effective treatment for urinary incontinence. J Urol 2005; 174: Hay-Smith EJ, Dumoulin C: Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane database of systematic reviews (online) 2006: CD Sonksen J, Ohl DA, Bonde B, Laessoe L, McGuire EJ: Transcutaneous mechanical nerve stimulation using perineal vibration: a novel method for the treatment of female stress urinary incontinence. J Urol 2007;178: Gilling PJ, Wilson LC, Westenberg AM, et al.: A double-blind randomized controlled trial of electromagnetic stimulation of the pelvic floor vs sham therapy in the treatment of women with stress urinary incontinence. BJU international 2009; 103: Ismail SI, Forward G, Bastin L, Wareham K, Emery SJ, Lucas M: Extracorporeal magnetic energy stimulation of pelvic floor muscles for urodynamic stress incontinence of urine in women. J Obstet Gynaecol 2009; 29: Duckett JR, Vella M, Kavalakuntla G, Basu M: Tolerability and efficacy of duloxetine in a nontrial situation. Bjog 2007; 114: Lapitan MC, Cody DJ, Grant AM: Open retropubic colposuspension for urinary incontinence in women. Cochrane database of systematic reviews (online) 2003: CD Alcalay M, Monga A, Stanton SL: Burch colposuspension: a year follow up. BJOG 1995; 102: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), DGGG AUuBid: Belastungsinkontinenz der Frau AWMF-Leitlinien-Register Nr. 015/ ad/g_01_03_01_belastungsinkontinenz_frau.pdf, 21. El-Barky E, El-Shazly A, El-Wahab OA, Kehinde EO, Al-Hunayan A, Al- Awadi KA: Tension free vaginal tape versus burch colposuspension for treatment of female stress urinary incontinence. Int Urol Nephrol 2005; 37: Jelovsek JE, Barber MD, Karram MM, Walters MD, Paraiso MF: Randomised trial of laparoscopic burch colposuspension versus tension-free vaginal tape: long-term follow up. Bjog 2008; 115: ; discussion Ward KL, Hilton P: Tension-free vaginal tape versus colposuspension for primary urodynamic stress incontinence: 5-year follow up. Bjog 2008; 115: Keegan PE, Atiemo K, Cody J, McClinton S, Pickard R: Periurethral injection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane database of systematic reviews (online) 2007: CD Dannecker C, Strauss A, Deppe C, Hepp H: Intraurethrale Injektionstechniken bei der Behandlung der Belastungsharninkontinenz. Gynäkologe 2004; 73: Anschrift für die Verfasser PD Dr. med. Christian Dannecker Klinikum der Universität München Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Großhadern Marchioninistraße 15, München christian.dannecker@med.uni-muenchen.de SUMMARY Urinary Incontinence in Women Part 1 of a Series of Articles on Incontinence Background: Urinary incontinence can arise in a woman of any age. Its prevalence is between 10% and 40%. The main clinical problems in urogynecology are stress urinary incontinence (involuntary leakage of urine on exertion, sneezing, or coughing) and the overactive bladder syndrome (nycturia, pollakisuria, and urinary urgency with or without incontinence). Method: Selective literature search, with special attention to large-scale studies and to the guidelines of the German Society of Obstetrics and Gynecology (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, DGGG) and its Task Force on Urogynecology and Pelvic Floor Reconstruction (Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und Beckenbodenrekonstruktion). Results: There are many diagnostic and therapeutic options, whose use should be based on the degree of the patient s suffering and on her motivation to be treated. Anticholinergic drugs are of established value in the treatment of overactive bladder. They are used in combination with possible lifestyle changes and bladder training. In some circumstances, botulinum toxin injections can be considered as well. Stress incontinence should be treated conservatively (with pelvic floor training) before any surgical treatment is provided. The new tension-free vaginal tapes are just as effective as classic treatments, such as colposuspension, while being less invasive and enabling a more rapid recovery. Conclusion: All women with urinary incontinence should undergo appropriate, specialized diagnostic evaluation and well-founded counseling in order to benefit from individualized treatment. Zitierweise: Dtsch Arztebl Int 2010; 107(24): DOI: Mit e gekennzeichnete Literatur: The English version of this article is available online: Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft Juni 2010
8 ÜBERSICHTSARBEIT Harninkontinenz der Frau Christian Dannecker, Klaus Friese, Christian Stief, Ricarda Bauer Teil 1 der Serie Inkontinenz eliteratur e1. Lasserre A, Pelat C, Gueroult V, Hanslik T, Chartier-Kastler E, Blanchon T, Ciofu C, Montefiore ED, Alvarez FP, Bloch J: Urinary incontinence in french women: prevalence, risk factors, and impact on quality of life. Eur Urol 2009; 56 (1): e2. Fischer W: Epidemiologie der Harninkontinenz. In: Fischer W, Kölbl H (eds): Urogynäkologie in Praxis und Klinik. Berlin: Walter de Gruyter e3. Bump RC, Mattiasson A, Bo K, Brubaker LP, DeLancey JO, Klarskov P, Shull BL, Smith AR: The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: e4. Auwad W, Freeman RM, Swift S: Is the pelvic organ prolapse quantification system (popq) being used? A survey of members of the international continence society (ics) and the american urogynecologic society (augs). Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004; 15: e5. Demirkesen O, Onal B, Tunc B, Alici B, Cetinele B: Does vaginal anti-incontinence surgery affect sexual satisfaction? A comparison of tvt and burch-colposuspension. Int Braz J Urol 2008; 34: e6. Marszalek M, Roehlich M, Racz U, Metzenbauer M, Ponholzer A, Rauchenwald M, Madersbacher S: Sexual function after tensionfree vaginal tape procedure. Urologia internationalis 2007; 78: Deutsches Ärzteblatt Jg. 107 Heft Juni 2010
Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel
 Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
Lage-und Haltungsveraenderungen der Beckenorgane. Brubel Réka
 Lage-und Haltungsveraenderungen der Beckenorgane Brubel Réka Descensus uteri Insuffiziens des Halteapperates der Gaebaermutter (Lig. Sacrouterinum, parametrium, Beckenboden) Tiefetreten des uterus in der
Lage-und Haltungsveraenderungen der Beckenorgane Brubel Réka Descensus uteri Insuffiziens des Halteapperates der Gaebaermutter (Lig. Sacrouterinum, parametrium, Beckenboden) Tiefetreten des uterus in der
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz
 Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
corina.christmann@luks.ch sabine.groeger@luks.ch Frühjahrsfortbildung Inkontinenz
 Frühjahrsfortbildung Inkontinenz Welche Inkontinenzformen gibt es? Andere Inkontinenzformen (stress 14% urinary incontinence, SUI) - Dranginkontinenz (überaktive Blase, urge UUI, OAB wet/dry) (Inkontinenz
Frühjahrsfortbildung Inkontinenz Welche Inkontinenzformen gibt es? Andere Inkontinenzformen (stress 14% urinary incontinence, SUI) - Dranginkontinenz (überaktive Blase, urge UUI, OAB wet/dry) (Inkontinenz
Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren. Dr. Nicole Lövin
 Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren Dr. Nicole Lövin Quellenangaben Guidelines der European Association of Urology (EAU, 2013) Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren Dr. Nicole Lövin Quellenangaben Guidelines der European Association of Urology (EAU, 2013) Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Diagnostik & Therapie von Senkungszuständen des weiblichen Genitale. Leiterin Urogynäkologie Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum
 Diagnostik & Therapie von Senkungszuständen des weiblichen Genitale Prof. Dr. med. René Hornung Dr. med. Tanja Hülder Chefarzt Frauenklinik Oberärztin mbf Frauenklinik Leiterin Urogynäkologie Interdisziplinäres
Diagnostik & Therapie von Senkungszuständen des weiblichen Genitale Prof. Dr. med. René Hornung Dr. med. Tanja Hülder Chefarzt Frauenklinik Oberärztin mbf Frauenklinik Leiterin Urogynäkologie Interdisziplinäres
Pessartherapie in der Praxis
 Pessartherapie in der Praxis Katharina Putora Oberärztin Frauenklinik, KSSG 1000 v. Chr Pessartherapie in der Praxis 1000 v. Chr c 1000 v. Chr c Indikationen Prolaps Belastungsinkontinenz überaktive Blase
Pessartherapie in der Praxis Katharina Putora Oberärztin Frauenklinik, KSSG 1000 v. Chr Pessartherapie in der Praxis 1000 v. Chr c 1000 v. Chr c Indikationen Prolaps Belastungsinkontinenz überaktive Blase
UMFRAGEERGEBNISSE DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN
 UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
Inkontinenz/Deszensus
 Inkontinenz/Deszensus Universitätsfrauenklinik Dresden A. Kolterer Epidemiologie der Beckebodenfunktionsstörungen Prävalenz für Genitalsenkung beträgt im Mittel 19.7% für Harninkontininenz 28.7% für Stuhlinkontinenz
Inkontinenz/Deszensus Universitätsfrauenklinik Dresden A. Kolterer Epidemiologie der Beckebodenfunktionsstörungen Prävalenz für Genitalsenkung beträgt im Mittel 19.7% für Harninkontininenz 28.7% für Stuhlinkontinenz
Wirkungsvolle Hilfe für Frauen bei Blasenschwäche
 Wirkungsvolle Hilfe für Frauen bei Blasenschwäche Sehr geehrte Patientinnen, über Blasenschwäche oder Harninkontinenz wird nicht viel gesprochen obwohl in Deutschland etwa fünf Millionen Frauen darunter
Wirkungsvolle Hilfe für Frauen bei Blasenschwäche Sehr geehrte Patientinnen, über Blasenschwäche oder Harninkontinenz wird nicht viel gesprochen obwohl in Deutschland etwa fünf Millionen Frauen darunter
Überaktive Blase State of the Art
 Überaktive Blase State of the Art Livio Mordasini, Oberarzt Klinik für Urologie, KSSG 2 Definition International Continence Society The overactive bladder syndrome (OAB) is defined as Urinary urgency,
Überaktive Blase State of the Art Livio Mordasini, Oberarzt Klinik für Urologie, KSSG 2 Definition International Continence Society The overactive bladder syndrome (OAB) is defined as Urinary urgency,
Die Harninkontinenz bei der Frau. Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien
 Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Die überaktive Blase Update
 An JEDEM Baum! Die überaktive Blase Update Wolfgang Umek Universitätsklinik für Frauenheilkunde Wien Obergurgl 2012 wolfgang.umek@meduniwien.ac.at Begriffsdefinition Harndrang überaktive Blase (OAB) Häufige
An JEDEM Baum! Die überaktive Blase Update Wolfgang Umek Universitätsklinik für Frauenheilkunde Wien Obergurgl 2012 wolfgang.umek@meduniwien.ac.at Begriffsdefinition Harndrang überaktive Blase (OAB) Häufige
Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz
 Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz Prim. Univ. Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Gynäkologie KH Barmherzige Brüder Wien Wien, am 25.06.2013 Harninkontinenz Definition Prävalenz
Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz Prim. Univ. Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Gynäkologie KH Barmherzige Brüder Wien Wien, am 25.06.2013 Harninkontinenz Definition Prävalenz
Die überaktive Blase. Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier
 Die überaktive Blase Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier Überaktive Blase 1. Definition und Ursachen Definition International Continence Society ICS 2002: Überaktive Blase ÜAB Overactive Bladder OAB
Die überaktive Blase Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier Überaktive Blase 1. Definition und Ursachen Definition International Continence Society ICS 2002: Überaktive Blase ÜAB Overactive Bladder OAB
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k
 Mein Beckenboden Beckenbodenschwäche & Inkontinenz Ursachen, Diagnostik und Therapien 3D Animation Beckenboden Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k Ursachen Beckenbodenschwäche Geburten Alter
Mein Beckenboden Beckenbodenschwäche & Inkontinenz Ursachen, Diagnostik und Therapien 3D Animation Beckenboden Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k Ursachen Beckenbodenschwäche Geburten Alter
Aktuelle Konzepte zur Konservative Therapie der Belastungsinkontinenz AGUB GK
 Aktuelle Konzepte zur Konservative Therapie der Belastungsinkontinenz Aktuelle Konzepte zur konservativen Therapie der Belastungsinkontinenz Gewichtsreduktion Physiotherapie Hilfsmittel / Pessare Medikamente
Aktuelle Konzepte zur Konservative Therapie der Belastungsinkontinenz Aktuelle Konzepte zur konservativen Therapie der Belastungsinkontinenz Gewichtsreduktion Physiotherapie Hilfsmittel / Pessare Medikamente
Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz
 12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
Sonographie im Rahmen der urogynäkologischen Diagnostik
 Sonographie im Rahmen der urogynäkologischen Diagnostik Gültig bis: 03/2017 Evidenzlevel: S2k Sonographie im Rahmen der urogynäkologischen Diagnostik http://www.dggg.de/leitlinien DGGG 2014 Sonographie
Sonographie im Rahmen der urogynäkologischen Diagnostik Gültig bis: 03/2017 Evidenzlevel: S2k Sonographie im Rahmen der urogynäkologischen Diagnostik http://www.dggg.de/leitlinien DGGG 2014 Sonographie
urivesc : Neue Option bei der 1x1-Behandlung der überaktiven Blase
 Effektive Inkontinenztherapie mit Trospiumchlorid urivesc : Neue Option bei der 1x1-Behandlung der überaktiven Blase Mannheim (14.11.2009) Das Anticholinergikum urivesc mit dem Wirkstoff Trospiumchlorid
Effektive Inkontinenztherapie mit Trospiumchlorid urivesc : Neue Option bei der 1x1-Behandlung der überaktiven Blase Mannheim (14.11.2009) Das Anticholinergikum urivesc mit dem Wirkstoff Trospiumchlorid
Inhaltsverzeichnis. Sektion I Anatomie und Pathophysiologie. Sektion II Diagnostik und Klassifikation der Harninkontinenz
 VII Sektion I Anatomie und Pathophysiologie 1 Anatomie des Beckenbodens........... 3 H. Fritsch 1.1 Supralevatorische Topographie......... 4 1.2 Hiatus levatorius.................. 6 1.3 Infralevatorische
VII Sektion I Anatomie und Pathophysiologie 1 Anatomie des Beckenbodens........... 3 H. Fritsch 1.1 Supralevatorische Topographie......... 4 1.2 Hiatus levatorius.................. 6 1.3 Infralevatorische
Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
 Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Univ.-Prof. Dr. P. Fornara Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Univ.-Prof. Dr. P. Fornara Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau
 Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Gültig bis: 07/2018 Evidenzlevel: S2e Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau http://www.dggg.de/leitlinien DGGG 2013 Diagnostik
Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Gültig bis: 07/2018 Evidenzlevel: S2e Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau http://www.dggg.de/leitlinien DGGG 2013 Diagnostik
Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis. AGUB GK Freiburg,
 Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis AGUB GK Freiburg, 28.10.2016 Überblick Harninkontinenz Belastungsinkontinenz Dranginkontinenz Nykturie Mischformen Überblick
Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis AGUB GK Freiburg, 28.10.2016 Überblick Harninkontinenz Belastungsinkontinenz Dranginkontinenz Nykturie Mischformen Überblick
Gutachten. für EPI-NO Libra hinsichtlich der Therapieoption. im Rahmen der konservativen Inkontinenztherapie. (Beckenbodentraining)
 13. Januar 2003 Gutachten für EPI-NO Libra hinsichtlich der Therapieoption im Rahmen der konservativen Inkontinenztherapie (Beckenbodentraining) Dr. Christian Dannecker Oberarzt Urogynäkologie Klinikum
13. Januar 2003 Gutachten für EPI-NO Libra hinsichtlich der Therapieoption im Rahmen der konservativen Inkontinenztherapie (Beckenbodentraining) Dr. Christian Dannecker Oberarzt Urogynäkologie Klinikum
Inhalt. Geschichtliche Anmerkungen... 1
 Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Inkontinenz. Dr. med. P. Honeck. Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen
 Therapie der männlichen Inkontinenz Dr. med. P. Honeck Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen g Formen der Inkontinenz Form Belastung (Stress) Beschreibung Unwillkürlicher Harnabgang
Therapie der männlichen Inkontinenz Dr. med. P. Honeck Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen g Formen der Inkontinenz Form Belastung (Stress) Beschreibung Unwillkürlicher Harnabgang
Urologische Probleme. bei Morbus Parkinson. W. N. Vance, Facharzt für Urologie. Patienteninformation.
 www.desitin.de Urologische Probleme bei Morbus Parkinson Praxisstempel Patienteninformation 213 075 Stand April 2009 W. N. Vance, Facharzt für Urologie Liebe Leserin, lieber Leser, das vorliegende Informationsblatt
www.desitin.de Urologische Probleme bei Morbus Parkinson Praxisstempel Patienteninformation 213 075 Stand April 2009 W. N. Vance, Facharzt für Urologie Liebe Leserin, lieber Leser, das vorliegende Informationsblatt
Weibliche Senkung und Inkontinenz: was nun? Anatomische Varianten der Senkung. Deszensus. Prädisponierende Faktoren
 Weibliche Senkung und Inkontinenz: was nun? Anatomische Varianten der Senkung AstraFocus, 3. März 2016 Prof. Carlos Villena Frauenklinik Luzerner Kantonsspital Sursee Deszensus Prävalenz Genitaldeszensus
Weibliche Senkung und Inkontinenz: was nun? Anatomische Varianten der Senkung AstraFocus, 3. März 2016 Prof. Carlos Villena Frauenklinik Luzerner Kantonsspital Sursee Deszensus Prävalenz Genitaldeszensus
Inkontinenz stoppt mich nicht mehr
 Inkontinenz stoppt mich nicht mehr Ist Inkontinenz eine eher seltene Erkrankung? Zurück ins Leben Ganz und gar nicht! Nahezu 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Inkontinenz, Junge wie Alte,
Inkontinenz stoppt mich nicht mehr Ist Inkontinenz eine eher seltene Erkrankung? Zurück ins Leben Ganz und gar nicht! Nahezu 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Inkontinenz, Junge wie Alte,
Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll
 Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Interstitielle & Chronische Cystitis. Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand?
 Interstitielle & Chronische Cystitis Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand? Was ist das Besondere an Instillamed? 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand
Interstitielle & Chronische Cystitis Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand? Was ist das Besondere an Instillamed? 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand
Workshop 18: «Zuviel im Fluss»- Urininkontinenz
 Workshop 18: «Zuviel im Fluss»- Urininkontinenz Dr. med. Corina Christmann, Leitende Ärztin, Leitung Urogynäkologie Frauenklinik Luzerner Kantonsspital Agenda Welche Inkontinenz-Formen gibt es? - Inkl.
Workshop 18: «Zuviel im Fluss»- Urininkontinenz Dr. med. Corina Christmann, Leitende Ärztin, Leitung Urogynäkologie Frauenklinik Luzerner Kantonsspital Agenda Welche Inkontinenz-Formen gibt es? - Inkl.
Die diabetische Zystopathie, eine vergessene Diabeteskomplikation Andreas Wiedemann
 Die diabetische Zystopathie, eine vergessene Diabeteskomplikation Andreas Wiedemann Urologische Abteilung, Ev. Krankenhaus Witten Lehrstuhl für Geriatrie, Universität Witten/Herdecke Und die Blase?
Die diabetische Zystopathie, eine vergessene Diabeteskomplikation Andreas Wiedemann Urologische Abteilung, Ev. Krankenhaus Witten Lehrstuhl für Geriatrie, Universität Witten/Herdecke Und die Blase?
Vorstellung neuer laparoskopischer Verfahren in der Urogynäkologie am Kepler Universitätsklinikum
 Vorstellung neuer laparoskopischer Verfahren in der Urogynäkologie am Kepler Universitätsklinikum Prof. Dr. med. H. Binder, FRANZCOG 28. OP-Forum, Linz Gliederung I. Dranginkontinenz und Datenlage zur
Vorstellung neuer laparoskopischer Verfahren in der Urogynäkologie am Kepler Universitätsklinikum Prof. Dr. med. H. Binder, FRANZCOG 28. OP-Forum, Linz Gliederung I. Dranginkontinenz und Datenlage zur
Harninkontinenz: Volkskrankheit und Tabu
 HARNINKONTINENZ 7 Harninkontinenz: Volkskrankheit und Tabu Miriam Deniz Die Belastungsinkontinenz und die Überaktive Blase gehören zu den häufigsten Krankheitsbildern unserer Zeit. Die Prävalenz scheint
HARNINKONTINENZ 7 Harninkontinenz: Volkskrankheit und Tabu Miriam Deniz Die Belastungsinkontinenz und die Überaktive Blase gehören zu den häufigsten Krankheitsbildern unserer Zeit. Die Prävalenz scheint
BECKENBODEN- ZENTRUM
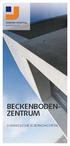 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
Frau Prof. Burkhard, wie lässt sich das Problem der Inkontinenz zuordnen? Wer ist davon betroffen?
 Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
 Zu dieser Folie: Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3
Zu dieser Folie: Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3
BECKENBODENZENTRUM TÜV WIR SORGEN FÜR SIE. Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf. geprüft
 BECKENBODENZENTRUM Behandlungspfad Zertifizierter TÜV geprüft Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf WIR SORGEN FÜR SIE Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf
BECKENBODENZENTRUM Behandlungspfad Zertifizierter TÜV geprüft Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf WIR SORGEN FÜR SIE Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf
Interstitielle & Chronische Cystitis. Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand?
 Interstitielle & Chronische Cystitis Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand? Was ist das Besondere an Instillamed? 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand
Interstitielle & Chronische Cystitis Kennen Sie schon die Instillationstherapie mit dem 2-Komponenten- Schutz für die Blasenwand? Was ist das Besondere an Instillamed? 2-Komponenten-Schutz für die Blasenwand
Instruktion zu Beckenboden-Muskeltraining nach Prostataoperation nicht effektiv
 Instruktion zu Beckenboden-Muskeltraining nach Prostataoperation nicht effektiv Zürich, Schweiz (16. August 2011) - Fragestellung der Studie: Effekt der individuellen Instruktion für Beckenbodenmuskeltraining
Instruktion zu Beckenboden-Muskeltraining nach Prostataoperation nicht effektiv Zürich, Schweiz (16. August 2011) - Fragestellung der Studie: Effekt der individuellen Instruktion für Beckenbodenmuskeltraining
Anhang. Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-Operation
 53 Anhang Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) Name, Vorname: geboren am: Größe cm Gewicht:
53 Anhang Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) Name, Vorname: geboren am: Größe cm Gewicht:
Unentspannt? Besser bestens entspannt. Fragen Sie Ihren Arzt! Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase
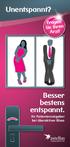 Unentspannt? Fragen Sie Ihren Arzt! Besser bestens entspannt. Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase Die überaktive Blase Liebe Leserinnen, liebe Leser, Ärzte beschäftigen sich mit einer Vielfalt
Unentspannt? Fragen Sie Ihren Arzt! Besser bestens entspannt. Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase Die überaktive Blase Liebe Leserinnen, liebe Leser, Ärzte beschäftigen sich mit einer Vielfalt
Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg
 Standorte Wels und Grieskirchen Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg www.klinikum-wegr.at Interdisziplinäres
Standorte Wels und Grieskirchen Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg www.klinikum-wegr.at Interdisziplinäres
Beckenbodentraining bei neurogenen Blasenfunktionsstörungen. Jens Wöllner Oberarzt Neuro-Urologie
 Beckenbodentraining bei neurogenen Blasenfunktionsstörungen Jens Wöllner Oberarzt Neuro-Urologie 1 Hintergrund 2 Storage Reflex Micturition Reflex Inhibition Periaquaductal Gray Pontine Micturition Center
Beckenbodentraining bei neurogenen Blasenfunktionsstörungen Jens Wöllner Oberarzt Neuro-Urologie 1 Hintergrund 2 Storage Reflex Micturition Reflex Inhibition Periaquaductal Gray Pontine Micturition Center
Birgit Bair Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
 Birgit Bair Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Prävalenz der Harninkontinenz knapp jede 4. Frau im Verlauf ihres Lebens betroffen Frauen ca. 9x häufiger als Männer im mittleren und höheren Alter
Birgit Bair Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Prävalenz der Harninkontinenz knapp jede 4. Frau im Verlauf ihres Lebens betroffen Frauen ca. 9x häufiger als Männer im mittleren und höheren Alter
Blasenschwäche. Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen
 Blasenschwäche Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen 2 TW_WH_137_Patientenb_Blasenschw_10_D_RZ_3.indd 3 02.12.13 17:54 Inhalt Blasenschwäche ist behandelbar... 4/5 Die verschiedenen
Blasenschwäche Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen 2 TW_WH_137_Patientenb_Blasenschw_10_D_RZ_3.indd 3 02.12.13 17:54 Inhalt Blasenschwäche ist behandelbar... 4/5 Die verschiedenen
Beratung Vorsorge Behandlung. Beckenboden- Zentrum. im RKK Klinikum Freiburg. Ihr Vertrauen wert
 Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Statische und funktionelle Diagnostik des weiblichen Beckens und des Beckenbodens mittels 3D/4D-Sonographie
 Kos, 24.5.2012 Statische und funktionelle Diagnostik des weiblichen Beckens und des Beckenbodens mittels 3D/4D-Sonographie E. Merz Frauenklinik - Krankenhaus Nordwest Frankfurt/Main Gynäkologischer 3D/4D-Ultraschall
Kos, 24.5.2012 Statische und funktionelle Diagnostik des weiblichen Beckens und des Beckenbodens mittels 3D/4D-Sonographie E. Merz Frauenklinik - Krankenhaus Nordwest Frankfurt/Main Gynäkologischer 3D/4D-Ultraschall
Interdisziplinäre S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Kurzfassung AWMF-Register-Nummer:015 005,Juli2013
 Interdisziplinäre S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Kurzfassung AWMF-Register-Nummer:015 005,Juli2013 Interdisciplinary S2e Guideline for the Diagnosis and Treatment
Interdisziplinäre S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Belastungsinkontinenz der Frau Kurzfassung AWMF-Register-Nummer:015 005,Juli2013 Interdisciplinary S2e Guideline for the Diagnosis and Treatment
Beckenboden- und Kontinenzzentrum Urogynäkologie. Sana Klinikum Borna. Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig
 Beckenboden- und Kontinenzzentrum Urogynäkologie Sana Klinikum Borna Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig Sehr geehrte Patientin, Inkontinenz ist eine Erkrankung, die auch als Blasen-,
Beckenboden- und Kontinenzzentrum Urogynäkologie Sana Klinikum Borna Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig Sehr geehrte Patientin, Inkontinenz ist eine Erkrankung, die auch als Blasen-,
Isolated patellofemoral osteoarthritis A systematic review of treatment options using the GRADE approach
 Isolated patellofemoral osteoarthritis A systematic review of treatment options using the GRADE approach Interpretiert von: Sophie Narath, Birgit Reihs Inhalt Hintergrund & Thema Material & Methods Results
Isolated patellofemoral osteoarthritis A systematic review of treatment options using the GRADE approach Interpretiert von: Sophie Narath, Birgit Reihs Inhalt Hintergrund & Thema Material & Methods Results
Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?-
 Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?- I.Kurze, 1.ASBH Kongress Köln, 21./22.3.2014 Zertifizierte Beratungstelle WAS IST DAS PROBLEM? Fehlende
Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?- I.Kurze, 1.ASBH Kongress Köln, 21./22.3.2014 Zertifizierte Beratungstelle WAS IST DAS PROBLEM? Fehlende
sreferentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau
 Aroserkongress 2013 Workshops sreferentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau Moderation: Claudia Zuber, Hausärztin, Othmarsingen Einführung
Aroserkongress 2013 Workshops sreferentinnen: Gabriela Meier, Gynäkologin, Praxis Wettingen Frieda Wernli, Pflegefachfrau, Kantonsspital Aarau Moderation: Claudia Zuber, Hausärztin, Othmarsingen Einführung
Belastungsinkontinenz: Gezielte Patientinnenansprache und Therapieführung fördern Behandlungserfolg
 Belastungsinkontinenz: Gezielte Patientinnenansprache und Therapieführung fördern Behandlungserfolg (Stuttgart, im November 2005 - hhp) Trotz verstärkter Aufklärung und neuer Therapiemöglichkeiten scheuen
Belastungsinkontinenz: Gezielte Patientinnenansprache und Therapieführung fördern Behandlungserfolg (Stuttgart, im November 2005 - hhp) Trotz verstärkter Aufklärung und neuer Therapiemöglichkeiten scheuen
Die Nachsorge. Dr. med. Jochem Potenberg Ev. Waldkrankenhaus Berlin. Tumorzentrum Berlin e.v. Dachverband der Berliner Tumorzentren
 Die Nachsorge Dr. med. Jochem Potenberg Ev. Waldkrankenhaus Berlin Einführung Nachsorge beginnt am Ende der Therapie Therapien hinterlassen unerwünschte Wirkungen Erfolg der Therapie ist festzustellen
Die Nachsorge Dr. med. Jochem Potenberg Ev. Waldkrankenhaus Berlin Einführung Nachsorge beginnt am Ende der Therapie Therapien hinterlassen unerwünschte Wirkungen Erfolg der Therapie ist festzustellen
Belastungsinkontinenz der Frau AWMF 015/005 (S1 + IDA)
 Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.v. Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen Stand Februar 2009 1 Allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie 1.3 Urogynäkologie Deutsche
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.v. Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen Stand Februar 2009 1 Allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie 1.3 Urogynäkologie Deutsche
Harn- und Stuhlinkontinenz. Hilfe für Frauen im Interdisziplinären Beckenbodenzentrum
 Harn- und Stuhlinkontinenz Hilfe für Frauen im Interdisziplinären Beckenbodenzentrum Inhaltsverzeichnis Harninkontinenz 4 Belastungsinkontinenz Ursachen und Therapien 4 Dranginkontinenz Ursachen und Therapien
Harn- und Stuhlinkontinenz Hilfe für Frauen im Interdisziplinären Beckenbodenzentrum Inhaltsverzeichnis Harninkontinenz 4 Belastungsinkontinenz Ursachen und Therapien 4 Dranginkontinenz Ursachen und Therapien
Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm. Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr
 Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr Liebe Patienten, in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an ständigem Harndrang,
Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr Liebe Patienten, in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an ständigem Harndrang,
Inkontinenz und Alter. H. Hertel
 Inkontinenz und Alter H. Hertel geriatrischen Probleme. Inkontinenz Intellektueller Abbau Immobilität Instabilität Urogynäkologie Press Release WHO/49, July 1998 WORLD HEALTH ORGANIZATION CALLS FIRST INTERNATIONAL
Inkontinenz und Alter H. Hertel geriatrischen Probleme. Inkontinenz Intellektueller Abbau Immobilität Instabilität Urogynäkologie Press Release WHO/49, July 1998 WORLD HEALTH ORGANIZATION CALLS FIRST INTERNATIONAL
Klinik für Rehabilitationsmedizin
 Klinik für Rehabilitationsmedizin Was tun bei Belastungsinkontinenz Definition / Epidemiologie Ungewollter Harnverlust aus der Blase durch die Harnröhre bei körperlicher Belastung ohne Harndrang. Die passive
Klinik für Rehabilitationsmedizin Was tun bei Belastungsinkontinenz Definition / Epidemiologie Ungewollter Harnverlust aus der Blase durch die Harnröhre bei körperlicher Belastung ohne Harndrang. Die passive
Update: Medikamentöse Therapie der überaktiven Blase. G. Häusler
 Update: Medikamentöse Therapie der überaktiven Blase G. Häusler Diagnose OAB Definition: Überaktive Blase Imperativer Drang mit oder ohne Inkontinenz, häufig kombiniert mit gehäufter Miktion tagsüber und/oder
Update: Medikamentöse Therapie der überaktiven Blase G. Häusler Diagnose OAB Definition: Überaktive Blase Imperativer Drang mit oder ohne Inkontinenz, häufig kombiniert mit gehäufter Miktion tagsüber und/oder
Hyperaktive Blase. Epidemiologie und Relevanz 17.03.2015. H. Binder, Uri. Anstieg im Alter (vor allem bei > 60-jährigen) 12-17% (Männer und Frauen)
 H. Binder, Uri 3. SYMPOSIUM HARNINKONTINENZ EIN UPDATE/ SPIEZ 2015 Hyperaktive Blase Epidemiologie und Relevanz USA 2000 Anstieg im Alter (vor allem bei > 60-jährigen) 12-17% (Männer und Frauen) 1 Ätiologie
H. Binder, Uri 3. SYMPOSIUM HARNINKONTINENZ EIN UPDATE/ SPIEZ 2015 Hyperaktive Blase Epidemiologie und Relevanz USA 2000 Anstieg im Alter (vor allem bei > 60-jährigen) 12-17% (Männer und Frauen) 1 Ätiologie
Inkontinenz. Was versteht man unter Harninkontinenz? Welche Untersuchungen sind notwendig?
 Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
ICS-Definition der Harninkontinenz: Die Entwicklung. Alter und Urininkontinenz
 52-jährige Patientin mit Verlust von grösseren Mengen Urin beim Spielen mit dem Enkel. Schon länger tropfenweise Urinverlust beim Husten und Niesen. Früher oft eckenbodengymnastik mit gutem Erfolg, ohne
52-jährige Patientin mit Verlust von grösseren Mengen Urin beim Spielen mit dem Enkel. Schon länger tropfenweise Urinverlust beim Husten und Niesen. Früher oft eckenbodengymnastik mit gutem Erfolg, ohne
am häufigsten. Eine überaktive Blase ist für 7 33% der Fälle verantwortlich,
 FORTBILDUNG + KONGRESS ACOG PRACTICE BULLETIN NR. 63, JUNI 2005 Harninkontinenz bei Frauen Es wurden zahlreiche Methoden beschrieben, Art und Ausmaß einer Harninkontinenz zu beurteilen. Die Behandlungsmöglichkeiten
FORTBILDUNG + KONGRESS ACOG PRACTICE BULLETIN NR. 63, JUNI 2005 Harninkontinenz bei Frauen Es wurden zahlreiche Methoden beschrieben, Art und Ausmaß einer Harninkontinenz zu beurteilen. Die Behandlungsmöglichkeiten
Das Beckenbodenzentrum. Eine Information des Evangelischen Krankenhauses Köln-Weyertal und des Malteser Krankenhauses St. Hildegardis.
 BECKENBODENZENTRUM KÖLN-LINDENTHAL Das Beckenbodenzentrum (BBZ) Köln-Lindenthal Eine Information des Evangelischen Krankenhauses Köln-Weyertal und des Malteser Krankenhauses St. Hildegardis Indikationen
BECKENBODENZENTRUM KÖLN-LINDENTHAL Das Beckenbodenzentrum (BBZ) Köln-Lindenthal Eine Information des Evangelischen Krankenhauses Köln-Weyertal und des Malteser Krankenhauses St. Hildegardis Indikationen
Evidenz in der Präventionsmedizin
 Evidenz in der Präventionsmedizin Symposium Ist Vorsorgen Immer Besser als Heilen? 20. und 21. Februar 2008 Dr. Gerald Gartlehner, MPH, Department für evidenzbasierte Medizin und klinische Epidemiologie
Evidenz in der Präventionsmedizin Symposium Ist Vorsorgen Immer Besser als Heilen? 20. und 21. Februar 2008 Dr. Gerald Gartlehner, MPH, Department für evidenzbasierte Medizin und klinische Epidemiologie
Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig?
 13. Bamberger Gespräche 2009 Thema: Harninkontinenz und Sexualität Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig? Von Hofr. Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg (5. September 2009) - Unfreiwilliger
13. Bamberger Gespräche 2009 Thema: Harninkontinenz und Sexualität Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig? Von Hofr. Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg (5. September 2009) - Unfreiwilliger
Belastungsinkontinenz. Reizblase (Overactive Bladder) Senkungsbeschwerden
 Belastungsinkontinenz Reizblase (Overactive Bladder) Senkungsbeschwerden Was versteht man unter Harninkontinenz, Reizblase oder Senkungsbeschwerden? 2 Das Verlieren von Urin (Harninkontinenz) ist ein weitverbreitetes
Belastungsinkontinenz Reizblase (Overactive Bladder) Senkungsbeschwerden Was versteht man unter Harninkontinenz, Reizblase oder Senkungsbeschwerden? 2 Das Verlieren von Urin (Harninkontinenz) ist ein weitverbreitetes
BECKENBODEN- ZENTRUM
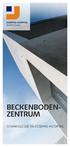 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE IM JOSEPHS-HOSPITAL KONTAKT JOSEPHS-HOSPITAL WARENDORF GYNÄKOLOGIE AGUB II-Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE IM JOSEPHS-HOSPITAL KONTAKT JOSEPHS-HOSPITAL WARENDORF GYNÄKOLOGIE AGUB II-Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
Die Harninkontinenz. Inhalt
 Die Harninkontinenz Inhalt Die Formen der Harninkontinenz Die Dranginkontinenz Die Stress- bzw. Belastungsinkontinenz Die Mischinkontinenz Die Elektrostimulation der Beckenbodenmuskulatur Die Behandlung
Die Harninkontinenz Inhalt Die Formen der Harninkontinenz Die Dranginkontinenz Die Stress- bzw. Belastungsinkontinenz Die Mischinkontinenz Die Elektrostimulation der Beckenbodenmuskulatur Die Behandlung
Varikozele Erfahrungen mit einem standardisierten Behandlungsprotokoll und Vorschlag zur Klassifizierung postoperativer Hydrozelen.
 Varikozele Erfahrungen mit einem standardisierten Behandlungsprotokoll und Vorschlag zur Klassifizierung postoperativer Hydrozelen. Dr. Sabine Zundel Oberärztin Kinderchirurgie Definition Varikose des
Varikozele Erfahrungen mit einem standardisierten Behandlungsprotokoll und Vorschlag zur Klassifizierung postoperativer Hydrozelen. Dr. Sabine Zundel Oberärztin Kinderchirurgie Definition Varikose des
Botulinumtoxin-Therapie in der Urologie. UK-SK, Campus Kiel
 Botulinumtoxin-Therapie in der Urologie PD Dr. Christoph Seif UK-SK, Campus Kiel Botulinumtoxin in der Urologie ist ein Neurotoxin, das von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert wird ist das potenteste
Botulinumtoxin-Therapie in der Urologie PD Dr. Christoph Seif UK-SK, Campus Kiel Botulinumtoxin in der Urologie ist ein Neurotoxin, das von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert wird ist das potenteste
Inkontinenz. Harninkontinenz
 Inkontinenz Unter Inkontinenz versteht man den Verlust der Kontrolle über die Abgabe von Harn (seltener auch von Stuhl). Die Ursachen einer Harninkontinenz liegen oft im Bereich der ableitenden Harnwege.
Inkontinenz Unter Inkontinenz versteht man den Verlust der Kontrolle über die Abgabe von Harn (seltener auch von Stuhl). Die Ursachen einer Harninkontinenz liegen oft im Bereich der ableitenden Harnwege.
BECKENBODEN- KONTINENZ- & ZENTRUM ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR
 ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR KONTINENZ- & BECKENBODEN- ZENTRUM WILLKOMMEN Über uns Der Beckenboden ist für die Funktion von Blase und Darm von entscheidender Bedeutung. Geburten, Bindegewebsschwäche,
ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR KONTINENZ- & BECKENBODEN- ZENTRUM WILLKOMMEN Über uns Der Beckenboden ist für die Funktion von Blase und Darm von entscheidender Bedeutung. Geburten, Bindegewebsschwäche,
Dossierbewertung A14-19 Version 1.0 Mirabegron Nutzenbewertung gemäß 35a SGB V
 2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Mirabegron gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung erfolgte auf Basis eines
2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Mirabegron gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung erfolgte auf Basis eines
Dr. med. Rebecca Keßler Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie Universitätsmedizin Greifswald. MR-Defäkographie
 Dr. med. Rebecca Keßler Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie Universitätsmedizin Greifswald MR-Defäkographie MR-Defäkographie Funktionelle Bildgebung Funktionelle MRT = Abbildung von
Dr. med. Rebecca Keßler Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie Universitätsmedizin Greifswald MR-Defäkographie MR-Defäkographie Funktionelle Bildgebung Funktionelle MRT = Abbildung von
Ganzkörpervibration und Aktivierbarkeit der Beckenbodenmuskulatur Lauper M 1, Kuhn A 2, Gerber R 1, Luginbühl H 3, Radlinger L 3
 In Kooperation mit Berner Fachhochschule Ganzkörpervibration und Aktivierbarkeit der Beckenbodenmuskulatur Lauper M 1, Kuhn A 2, Gerber R 1, Luginbühl H 3, Radlinger L 3 1 Institut für Physiotherapie,
In Kooperation mit Berner Fachhochschule Ganzkörpervibration und Aktivierbarkeit der Beckenbodenmuskulatur Lauper M 1, Kuhn A 2, Gerber R 1, Luginbühl H 3, Radlinger L 3 1 Institut für Physiotherapie,
Vorwort 11. Der Harntrakt und seine Funktion 15
 Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Patienteninformation. Nehmen Sie sich Zeit...
 Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
WISSENSChafTlIChEr fortschritt verbessert das leben unserer PATieNTeN
 WISSENSChafTlIChEr fortschritt verbessert das leben unserer PATieNTeN 3 JahrES-ErgEbNISSE DEr INSITE STUDIE SAkrAle NeurOMOdulATiON Bei überaktiver BlASe Susan nutzt die sakrale Neuromodulation mit dem
WISSENSChafTlIChEr fortschritt verbessert das leben unserer PATieNTeN 3 JahrES-ErgEbNISSE DEr INSITE STUDIE SAkrAle NeurOMOdulATiON Bei überaktiver BlASe Susan nutzt die sakrale Neuromodulation mit dem
INSITE STUDIENERGEBNISSE ZEIGEN VORTEILE FÜR WIRKSAMKEIT UND LEBENSQUALITÄT MIT DEM INTERSTIM SYSTEM
 Auskünfte Deutschland: Jennifer Disper-Wilmsen, Sabine Günther Presse und Öffentlichkeitsarbeit Tel: ++49 (0) 2159 8149 440, -277 Fax: ++49 (0) 2159 8149 252 email: presse@medtronic.de MITTEILUNG FÜR DIE
Auskünfte Deutschland: Jennifer Disper-Wilmsen, Sabine Günther Presse und Öffentlichkeitsarbeit Tel: ++49 (0) 2159 8149 440, -277 Fax: ++49 (0) 2159 8149 252 email: presse@medtronic.de MITTEILUNG FÜR DIE
Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen?
 Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen? von Priv.-Doz. Dr. med. Ingo Füsgen GOVI Govi-Verlag Einführung 9 Anatomische und physiologische Vorbemerkungen 11 Die Harnblase - Aufbau und Funktion
Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen? von Priv.-Doz. Dr. med. Ingo Füsgen GOVI Govi-Verlag Einführung 9 Anatomische und physiologische Vorbemerkungen 11 Die Harnblase - Aufbau und Funktion
1 Harninkontinenz. 2012 W. Kohlhammer, Stuttgart
 1 Harninkontinenz Ein häufiger starker Harndrang, ungewollter Harnverlust, oft unbemerkt und durch den Willen nicht beeinflussbar wird auch mit den Begriffen Blasenschwäche, Reizblase oder mit dem medizinischen
1 Harninkontinenz Ein häufiger starker Harndrang, ungewollter Harnverlust, oft unbemerkt und durch den Willen nicht beeinflussbar wird auch mit den Begriffen Blasenschwäche, Reizblase oder mit dem medizinischen
Zu dieser Folie: Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz
 Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3 Relevante Kapitel:
Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3 Relevante Kapitel:
Titanisierte Netzimplantate. Urogynäkologie Transvaginale Mehrarmnetze Inkontinenz-Schlingen Instrumente Laparoskopische Netze. Quality and Experience
 Quality and Experience Titanisierte Netzimplantate für die Urogynäkologie Transvaginale Mehrarmnetze Inkontinenz-Schlingen Instrumente Laparoskopische Netze www.pfmmedical.com 1 Titanisierte Netzimplantate
Quality and Experience Titanisierte Netzimplantate für die Urogynäkologie Transvaginale Mehrarmnetze Inkontinenz-Schlingen Instrumente Laparoskopische Netze www.pfmmedical.com 1 Titanisierte Netzimplantate
BAnz AT B3. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die utzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die utzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Diagnostik und Therapie von Blutungsstörungen
 Diagnostik und Therapie von Blutungsstörungen S. Buchholz Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg am Caritas-Krankenhaus St. Josef Direktor: Prof. Dr. Ortmann Gynäkologisches
Diagnostik und Therapie von Blutungsstörungen S. Buchholz Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg am Caritas-Krankenhaus St. Josef Direktor: Prof. Dr. Ortmann Gynäkologisches
Toilettentraining bei Kindern und Jugendlichen mit Fragilem-X Syndrom
 Toilettentraining bei Kindern und Jugendlichen mit Fragilem-X Syndrom Alexander von Gontard Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum des Saarland
Toilettentraining bei Kindern und Jugendlichen mit Fragilem-X Syndrom Alexander von Gontard Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum des Saarland
Prophylaxen. P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz
 Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Descensus und Prolaps des weiblichen Genitals. Dirk Watermann und Boris Gabriel
 Descensus und Prolaps des weiblichen Genitals Dirk Watermann und Boris Gabriel Übersicht Funktionen des Beckenbodens Anatomie des Beckenbodens Epidemiologie, Formen und klinische Auswirkungen des Descensus
Descensus und Prolaps des weiblichen Genitals Dirk Watermann und Boris Gabriel Übersicht Funktionen des Beckenbodens Anatomie des Beckenbodens Epidemiologie, Formen und klinische Auswirkungen des Descensus
Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
 Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum 2 Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Interdisziplinäres Kontinenzund Beckenbodenzentrum Harn- und Stuhlinkontinenz sowie Senkungsbeschwerden verschiedener
Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum 2 Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Interdisziplinäres Kontinenzund Beckenbodenzentrum Harn- und Stuhlinkontinenz sowie Senkungsbeschwerden verschiedener
Fiktives Projekt im Rahmen der LV Verbesserung der Pflegepraxis
 Fiktives Projekt im Rahmen der LV Verbesserung der Pflegepraxis Sarah Moser, BSc Bianca Neuhold, BSc Barbara Nußbaumer, BSc Daniela Schoberer, MSc, BSc Univ. Prof. Dr. Christa Lohrmann Graz, 27.09.2010
Fiktives Projekt im Rahmen der LV Verbesserung der Pflegepraxis Sarah Moser, BSc Bianca Neuhold, BSc Barbara Nußbaumer, BSc Daniela Schoberer, MSc, BSc Univ. Prof. Dr. Christa Lohrmann Graz, 27.09.2010
UKD Universitätsklinikum
 UKD Universitätsklinikum Düsseldorf Urinverlust und Senkungsbeschwerden Wir helfen Ihnen Informationen für Patentinnen Beckenbodenzentrum Liebe Patientin, Sie sind auf der Suche nach Hilfe auf Grund von
UKD Universitätsklinikum Düsseldorf Urinverlust und Senkungsbeschwerden Wir helfen Ihnen Informationen für Patentinnen Beckenbodenzentrum Liebe Patientin, Sie sind auf der Suche nach Hilfe auf Grund von
Harninkontinenz beim Mann: Ursachen, Diagnostik und Therapien
 Harninkontinenz beim Mann: Ursachen, Diagnostik und Therapien FA Dr. Jürgen SEWERYN, F.E.B.U. Prim. Univ.-Prof. Dr. Paul Schramek, F.E.B.U. Abteilung für Urologie und Andrologie Inkontinenz des Mannes
Harninkontinenz beim Mann: Ursachen, Diagnostik und Therapien FA Dr. Jürgen SEWERYN, F.E.B.U. Prim. Univ.-Prof. Dr. Paul Schramek, F.E.B.U. Abteilung für Urologie und Andrologie Inkontinenz des Mannes
