Harninkontinenz im Alter
|
|
|
- Franziska Geiger
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 im Alter Mark Goepel 1, Thomas Schwenzer 2, Peter May 3, Jürgen Sökeland 4, Martin C. Michel 5 Zusammenfassung ist ein bei alten Menschen weit verbreitetes medizinisches und soziales Problem. Es führt zu einer massiven Beeinträchtigung der Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen sowie zu volkswirtschaftlichen Belastungen, die mit der Veränderung der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung in den nächsten Jahren zunehmen wird. Die erfolgreiche Behandlung der Inkontinenz beim alten Menschen erfordert ein pathophysiologisches Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse sowie eine situationsgerechte Diagnostik, die sich in ihrem Umfang an den sich daraus ergebenden therapeutischen Konsequenzen orientiert. Einfache Ursachen wie Harnwegsinfektionen müssen nachgewiesen und konsequent therapiert werden. Daneben spielen beim alten Patienten mit Hirnleistungsabbau Konditionierungsmethoden wie das Toilettentraining eine große Rolle. Ist grundsätzlich Operabilität gegeben, stehen bei Stressinkontinenz minimalinvasive operative Behandlungsmethoden zur Verfügung, die auch beim alten Menschen angewendet werden können. Die Dranginkontinenz ist dagegen eine Domäne der medikamentösen Therapie. Schlüsselwörter: Geriatrie,, Stressinkontinenz, Dranginkontinenz, chirurgische Therapie, Blasenfunktionsstörung Summary Urinary Incontinence in the Elderly Urinary incontinence is a common medical and social problem in the elderly. It causes a huge reduction of quality of life and leads to enormous socio-economic burden. Successful therapy of urinary incontinence in the elderly is based on pathophysiological understanding of the underlying problem and individually tailored diagnostic procedures that must be oriented at the possible therapeutic consequences. Simple causes such as urinary tract infections must be found and treated consequently. Patients with age-associated cognitive decrease must be treated by methods of behavioural conditioning like bladder drill. If general operability in the elderly patient with stress urinary incontinence is given, minimal-invasive procedures can be used successfully. Urge-incontinence remains a domain of pharmacotherapy. Key words: geriatrics, urinary incontinence, stress urinary incontinence, urge incontinence, surgical therapy, bladder dysfunction Mit der Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung nimmt auch die Häufigkeit der zu, und über 60 Jahre alte Patienten leiden häufiger an als an kardiovaskulären Beschwerden, Rheuma, Arthritis oder Bluthochdruck (14, 15, 34, 55, 73). macht befangen, sie bindet den Menschen an sein Heim und verhindert soziale Kontakte (35, 39, 41). Bereits vor einigen Jahren kam eine englische Studie zu dem Ergebnis, dass bei älteren Menschen die Lebenserwartung reduziert. Den direkten Nachweis erhöhter Sterblichkeit infolge von erbrachte eine große japanische Studie (38). Epidemiologie, Ätiologie Nach neueren Untersuchungen wird eine in der Bevölkerung bei 20 bis 36 Prozent aller über 40-Jährigen gefunden (6, 7, 28, 31, 34, 50, 54, 62, 68). In Pflegeheimen besteht eine noch deutlich höhere Prävalenz (6, 7, 62). Hierbei hängen die ermittelten Werte von der Untersuchungsmethode, der verwendeten Definition und vom Patientenalter ab. Innerhalb der untersuchten Kollektive nimmt die Prävalenz der Inkontinenz mit dem Alter stetig zu und ist bei Frauen höher als bei Männern, was vor allem durch eine höhere Prävalenz der Stressinkontinenz erklärt wird (28). Darüber hinaus zeigen viele ältere Patienten zwar keine, weisen aber bereits andere irritative oder obstruktive Blasensymptome auf (28). Etwa 40 Prozent der Patienten in der allgemeinmedizinischen 1 Klinik für Urologie und Kinderurologie (Chefarzt: Priv.- Doz. Dr. med. Mark Goepel), Klinikum Niederberg,Velbert 2 Abteilung Gynäkologie (Direktor: Prof. Dr. med. Thomas Schwenzer), Städtische Krankenanstalten Dortmund 3 Klinik für Urologie (Direktor: Prof. Dr. med. Peter May), Klinikum Bamberg 4 Institut für Arbeitsphysiologie (Direktor: Prof. Dr. med Dr. rer.nat. Hermann Maximilian Bolt), Universität Dortmund 5 Medizinische Klinik, Abteilung für Nieren- und Hochdruckkranke (Direktor: Prof. Dr. med. Thomas Philipp), Universitätsklinikum Essen Praxis erwähnen vorhandene Symptome einer Inkontinenz nicht (28, 50). Selbst wenn Symptome einer Harnblasendysfunktion vorgetragen werden, werden sie von den behandelnden Ärzten oft nicht korrekt eingestuft (28). Eine Darstellung von Füsgen und Barth gibt einen Überblick über die bei beiden Geschlechtern in den verschiedenen Altersgruppen. Wie die Kurven zeigen, leiden Männer unter häufiger ab dem 50. Lebensjahr, während bei Frauen die Häufigkeit der zufälligen und regelmäßigen schon eher ansteigt. Bei 65- Jährigen liegt die Inkontinenzquote bei beiden Geschlechtern etwa bei 30 Prozent (Grafik 1). Eine kürzlich durchgeführte Studie des Erstautors an mehr als Patienten ergab ähnliche Befunde (28). In Deutschland leben mehr als vier Millionen Menschen mit einer Inkontinenzversorgung, die den Etat der Gesetzlichen Krankenversicherung mit über zwei Milliarden DM belasten A 2614 Deutsches Ärzteblatt Jg. 99 Heft Oktober 2002
2 Grafik 1 Überblick über die bei beiden Geschlechtern in den verschiedenen Altersgruppen. Bei Männern (blau) tritt häufiger ab dem 50. Lebensjahr auf, während bei Frauen (rot) dies bereits in jüngeren Jahren der Fall ist. Aus: Füsgen I, Barth W: Inkontinenzmanual 1987, mit freundlicher Genehmigung: Springer-Verlag, Heidelberg. (48). Im Verlauf der Verschiebung der Altersstruktur in den nächsten 50 Jahren werden bis zum Jahr 2020 etwa 25 Prozent der Gesamtbevölkerung über 60 Jahre alt sein. Hier entwickelt sich ein gravierendes soziales, medizinisches und therapeutisches Versorgungsproblem. Eine kann sowohl sekundär als auch primär auftreten. Zu den Ursachen einer sekundären Inkontinenz zählen eine reduzierte zerebrale Leistungsfähigkeit (6, 7, 34, 55) oder operative Eingriffe im Becken, die zu einer reduzierten Detrusorcompliance (Dehnfähigkeit des Blasenmuskels) und einer urethralen Dysfunktion führen können sowie eine Strahlentherapie (47, 52, 75). Bei Frauen kann es im Zusammenhang mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung zu einer Stressinkontinenz kommen (30). Bei Männern sind als Ursache eine benigne Prostatahyperplasie oder ein Prostatakarzinom und deren operative Therapie zu bedenken (4, 9). Neurologische Erkrankungen wie multiple Sklerose, Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule sowie ein M. Parkinson führen gehäuft zur Inkontinenz (36, 45). Als iatrogene Ursache ist die Einnahme von den Detrusor oder den Sphinkter beeinflussenden Medikamenten anzusehen (46). Systematische Untersuchungen bei alten Menschen zeigen, dass die und die Harnretention auch durch Erkrankungen des Detrusor vesicae selbst ausgelöst werden können. In Harnblasen alter Menschen wurde eine vollständige Durchsetzung der Submucosa sowie der Umgebung der neurovaskulären Bündel und Muskelzellen durch kollagene Fasern festgestellt, sodass diese Veränderungen der Bindegewebsstruktur einen Verlust der Elastizität des Detrusors auslösen können (18 21). Der Detrusormuskel unterliegt so einem regelrechten Alterungsprozess. Durch den Verlust normaler Zellbindungen wird die mechanische Muskelzellkoppelung, die für die Kontraktion notwendig ist, gestört. Hier hat Elbadawi urodynamische Untersuchungen von inkontinenten Personen mit ultrastrukturellen Analysen der Blase verglichen. Dabei wurden spezifische morphologische Befunde der Dranginkontinenz, der eingeschränkten Detrusorfunktion, der obstruktiven Uropathie, die mit oder ohne Detrusorinstabilitäten einhergeht, beschrieben (18 21). Der Einfluss des Alterungsprozesses auf den Miktionszyklus wird im Textkasten 1 erläutert. Anatomie und Physiologie der Blasenfunktion Die glatte Detrusormuskulatur ist dreischichtig aufgebaut, wobei sich die innere Schicht am Blasenhals direkt in die Längsmuskelschicht der Harnröhre fortsetzt. Die mittlere Zirkulärschicht endet am Blasenhals, die äußere Longitudinalschicht setzt sich ebenfalls in die Harnröhre hinein fort, wohingegen die mittlere Schicht den Meatus urethrae internus einen nach dorsal offenen Ring umgibt. Im quergestreiften Sphinktermechanismus der Harnröhre unterscheidet man den eigentlichen Schließmuskel und die umgebende Muskulatur des Beckenbodens. Die autonome Innervation des unteren Harntraktes erfolgt parasympathisch durch den N. pelvicus, der aus dem sakralen Miktionszentrum S2 4 entspringt sowie sympathisch durch den N. hypogastricus aus den Segmenten Th12 L2. Detrusor und Harnröhre haben eine sympathisch-parasympathische Doppelinnervation. Synapsen zwischen sympathischer und parasympathischer Innervation ermöglichen eine Reihe von Modulationen. Im Detrusor überwiegt die parasympathische Innervation und vermittelt über Muscarinrezeptoren die Blasenentleerung, während sympathische Neurone vor allem in Trigonum, Blasenhals und Harnröhre nachweisbar sind. Ihre Aktivierung hemmt den Detrusor über β-adrenozeptoren und tonisiert, durch β-adrenozeptoren vermittelt, den Blasenhals und glattmuskuläre Anteile der Harnröhre. Der quergestreifte Sphinkter externus wird vom somatischen N. pudendus aus S2 4 versorgt (Grafik 2). Im sakralen Miktionszentrum S2 4 existieren kurze neuronale Verschaltungen zwischen Pudendus und Pelvicus. Die eigentliche Koordinierung der neuronalen Steuerung von Textkasten 1 Einfluss des Alterungsprozesses auf den Miktionszyklus Verschlechterung der Blasenentleerung Bildung von Restharn Verkürzung der Entleerungsintervalle Verminderte Fähigkeit, Detrusorkontraktionen zu unterdrücken Verminderter Blasentonus Verminderter Sphinkter- und Beckenbodentonus Verminderte Blasenkapazität Variabilität der Signale, die zum spinalen Miktionszentrum gesandt werden Verlust von Hirnzellen Verlust von Synapsen Verlangsamung der Reaktionszeit Abnahme der Fähigkeit, Drang auszuhalten Aus: Sökeland J:, in: D. Platt: Altersmedizin 1997, mit freundlicher Genehmigung: Schattauer-Verlag. A 2616 Deutsches Ärzteblatt Jg. 99 Heft Oktober 2002
3 Blasenfüllung und -entleerung erfolgt aber durch lange spinale Bahnen in der Formatio reticularis des Hirnstammes. Übergeordnete Zentren in Hypothalamus, Stammganglien und Frontalhirn haben dabei überwiegend hemmende Funktionen. Klassifikation der Die Klassifikation einer richtet sich einem Vorschlag der International Continence Society (ICS) und unterscheidet Stressinkontinenz, Dranginkontinenz, Reflexinkontinenz und Überlaufinkontinenz. Die Häufigkeitsverteilung der im Alter wird in der Grafik 3 dargestellt. Diagnostik der Die Diagnostik einer beim älteren Menschen richtet sich nach der Schwere der Symptomatik und den möglichen therapeutischen Konsequenzen sowie nach der gesundheitlichen Gesamtsituation des Betroffenen. Dabei sollte der Untersuchungsgang schrittweise von nichtinvasiven zu invasiveren Untersuchungsmethoden aufgebaut werden. Nach nichtinvasiver Diagnostik mit klarem Ergebnis erscheint ein konservativer Therapieversuch (wie medikamentöse Therapie, Beckenbodengymnastik) gerechtfertigt, während vor der Indikationsstellung zu einem operativen Eingriff in jedem Fall eine entsprechende endoskopische, radiologische und urodynamische Abklärung erfolgen sollte. Untersuchungsziele und ein bewährter Untersuchungsgang werden von Füsgen und Barth angegeben (Textkasten 2). Basisdiagnostik Bei etwa 80 Prozent der inkontinenten älteren Menschen kann zunächst aufgrund von Anamnese, Miktionsprotokoll, klinischer Untersuchung und Grafik 2 N. hypogastricus N. pelvicus N. pudendus Restharnbestimmung nach der Miktion mit einer konservativen Therapie begonnen werden. Eine Therapie kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn zunächst in Kenntnis der Pathomorphologie und -physiologie eine eindeutige Diagnose erfolgt. Die Basisdiagnostik hat drei Ziele: Feststellung der Ursache der Blasenfunktionsstörung, Abklärung damit verbundener Harnwegspathologien, Beurteilung des Patienten (geistiger und körperlicher Zustand, Komorbidität, Komedikation). Der Umfang der Untersuchung muss auf den Patienten zugeschnitten sein. Der erste Schritt ist eine Beschreibung des Miktionsverhaltens. Bereits aus der Anamnese können sich Hinweise auf eine ungehemmte hyperaktive Blase oder eine subvesikale Obstruktion ergeben. Dabei ist zu beachten, dass imperativer Harndrang kein krankheitsspezifisches Symptom darstellt. Auch Patienten mit Stressinkontinenz, subvesikaler Obstruktion oder Überlaufblase beschreiben Drangsymptome. Die Nykturie ist ein weiteres häufiges aber unspezifisches Symptom, das genau erfasst werden muss. Th12-L2 S2-S4 Innervation des unteren Harntraktes: Der parasympathische Nervus pelvicus (Nucleus intermediolateralis, Segmente S2 S4) und der sympathische Nervus hypogastricus (Nucleus intermediolateralis, Segmente Th12 L2) innervieren den Harntrakt autonom. Der sympathische N. hypogastricus hemmt als Gegenspieler zum N. pelvicus den Detrusor über inhibitorische Rezeptoren. Gleichzeitig wird der Blasenhals und die glattmuskuläre Harnröhre über exzitatorische Rezeptoren tonisiert, sodass eine sichere Kontinenzfunktion entsteht. Aus: Sökeland J, Schulze H, Rübben H: Urologie 2001, mit freundlicher Genehmigung: Thieme-Verlag, Stuttgart. Ein Miktionsprotokoll liefert wichtige Informationen über die Trink- und Miktionsgewohnheiten des Betroffenen in seiner häuslichen Umgebung sowie die Phasen von Inkontinenz.Werden die verwendeten Windeln gewogen (so genannte Windeln-Wiegetest, pad-test), kann auch das Ausmaß der Inkontinenz quantifiziert werden. Generell sollten nach Nachweis oder Ausschluss einer Harnwegsinfektion Elektrolyte, Harnstoff und Kreatinin im Serum untersucht werden, um renale Ursachen ausschließen zu können. Erweiterte Diagnostik Lässt die Basisdiagnostik keine eindeutige Beurteilung der Erkrankung zu oder ist bereits ein konservativer Therapieversuch fehlgeschlagen, sollte die Diagnostik erweitert werden, wenn dies für den Patienten zumutbar erscheint und therapeutische Konsequenzen hat. Während eine Basisdiagnostik eventuell auch in häuslicher Umgebung erfolgen kann, erfordert die erweiterte Diagnostik in jedem Falle einen Praxisbesuch. Neben der Wiederholung der Harnanalyse (Katheterurin bei Frauen, Mittelstrahlurin bei Männern) muss der Harntrakt sonographisch beurteilt werden. Vor allem die Restharnprüfung nach einer adäquaten Blasenentleerung (Verspüren eines Harndrangs) liefert wichtige Hinweise. Ergänzt wird die Restharnmessung durch eine vorherige Uroflowmetrie (Urinflussmessung). Eine radiologische und endoskopische Beurteilung des unteren Harntraktes sowie eine gynäkologische Untersuchung bei Frauen, schließen sich gegebenenfalls an (Textkasten 2). Eine urodynamische Untersuchung ist bei der Abklärung bei älteren, inkontinenten Patienten immer dann notwendig, wenn aus dem Ergebnis eine therapeutische Konsequenz abgeleitet wird, wenn eine primäre Be- A 2618 Deutsches Ärzteblatt Jg. 99 Heft Oktober 2002
4 handlung ohne Erfolg war oder ein entsprechender operativer Eingriff geplant ist. Therapie der Stressinkontinenz Die Stressinkontinenz ist die Folge einer Insuffizienz des Sphinktermechanismus am Blasenauslass. Beweisend für die Diagnose einer Stressinkontinenz ist der Nachweis von Urinabgang bei passiver intravesikaler Druckerhöhung durch physikalische Reize (Husten, Niesen, Bauchpresse) ohne nachweisbare Detrusoraktivität. Die Diagnose stützt sich auf den zystometrischen Befund. Vor der Therapie sollte die Differenzialdiagnose möglichst exakt beurteilt werden. Auch sollten ia- Grafik 3 trogene Ursachen, wie zum Beispiel eine Behandlung mit α-blockern, abgeklärt werden (46). Beckenbodentraining, Toilettentraining Die Beckenbodengymnastik dient der Kräftigung des Blasenschließmuskels und der Beckenbodenmuskulatur. Ein Nutzen von Beckenbodengymnastik als Einzelmaßnahme ist vorwiegend bei leichten Formen der Stressinkontinenz zu erwarten, ihr Einsatz kann bei schwereren Formen aber die Wirksamkeit anderer Maßnahmen erhöhen. Eine Elektrostimulationsbehandlung (Transanal- oder Transvaginalstimulation) zeigt bei Stressinkontinenz gute Erfolge, am ehesten jedoch in Kombination mit einem Beckenbodentraining. Neben der Beckenbodengymnastik ist auch das Blasen- beziehungsweise Toilettentraining für die Inkontinenzbehandlung älterer Patienten wichtig. Hier wird im Sinne einer Konditionierung gelernt, sich zu bestimmten Zeiten auf ein WC zu setzen. Ein regelmäßiges Miktionstraining ist bei dementen Patienten, aber auch bei Patienten mit peripherer neurogener Blasendysfunktion, zum Beispiel bei Diabetes mellitus, wichtig. Demente Patienten sind oft eigentlich nicht inkontinent, sondern vom Gehirn wird die Meldung über den Füllzustand der Blase nicht mehr richtig wahrgenommen oder verarbeitet. Deshalb sollte die Blasenentleerung erfolgen, bevor die maximale Speicherkapazität der Harnblase erreicht ist. Die Miktion in bestimmten Intervallen sollte daher möglichst sorgfältig eingeübt werden. Pharmakotherapie Bei der Stressinkontinenz älterer Patienten ist die medikamentöse Therapie als nachrangig einzustufen, da ihre Häufigkeitsverteilung der im Alter, aus: Sökeland J, Schulze H, Rübben H: Urologie 2001, mit freundlicher Genehmigung: Thieme-Verlag, Stuttgart. Wirksamkeit limitiert ist. Die Pharmakotherapie zielt dabei auf eine Erhöhung des Harnröhrentonus und des Blasenauslasswiderstandes ab. α-sympathomimetika erhöhen den Tonus der glatten Muskulatur auch von Blasenhals und Urethra, was aber häufig durch Blutdrucksteigerung limitiert wird (17, 24, 69). β 2 -adrenerge Agonisten erhöhen die Kontraktion der quergestreiften Harnröhrenmuskulatur. Östrogene beeinflussen die Urethralschleimhaut und erhöhen zusätzlich die Sensitivität der α-rezeptoren. Daneben bewirkt die Östrogensubstitution in der Menopause eine vermehrte Proliferation des Harnröhrenepithels sowie eine vermehrte venöse Kongestion in der Lamina propria der Harnröhre. Östrogene werden oral, transdermal, parenteral und intravaginal angewendet (69, 72). Bei allen systemisch wirksamen Östrogengaben muss bei Frauen mit noch erhaltenem Uterus regelmäßig auch Gestagen verabreicht werden, um eine maligne Entartung der Gebärmutter zu verhindern. Operative Therapie Operationsindikationen ergeben sich auch bei älteren Menschen bei allgemeiner Operabilität und Inkompetenz des Harnröhrensphinkters oder wenn konservative Behandlungsmaßnahmen versagen. Vordere Kolpographie Die vordere Kolpographie wurde als Operationstechnik zur gleichzeitigen Behandlung von Prolaps und Inkontinenz eingesetzt. Bei vergleichenden Untersuchungen hat sich die Kolpographie gegenüber der Burch-Kolposuspension und der Operation nach Marshall, Marchetti und Krantz mit einer 5-Jahres-Erfolgsrate von nur ungefähr 20 Prozent als unzuverlässige Methode zur Therapie einer Stressinkontinenz erwiesen. Depot-Injektionen Bei älteren Patienten wurden periurethrale Kollageninjektionen untersucht. Zehn Monate postoperativ waren noch 83 Prozent der Patientinnen geheilt, während die Erfolgsrate mit zunehmendem Abstand zur Maßnahme rapide bis auf etwa 20 Prozent abnahm. Es traten zusätzlich De-novo- Detrusorinstabilitäten bei circa 40 Prozent der Patientinnen auf (22, 37). Endoskopische Blasenhalssuspension Bei älteren Patienten werden endoskopische Blasenhalssuspensions- Operationen wegen der geringen Invasivität häufig angewandt. Die objektiven Heilungsraten sind allerdings mit circa 40 Prozent nach drei Monaten (53) nach der Stamey-Methode, und 46 Prozent objektiv geheilten nach der modifizierten Pereyra-Operation (59), begrenzt. A 2620 Deutsches Ärzteblatt Jg. 99 Heft Oktober 2002
5 Textkasten 2 Diagnostik der beim älteren Menschen (nach Füsgen und Barth) Ziele der Klärung Objektivierung der und Erfassung von Faktoren, die sie verursachen oder dazu beitragen Differenzierung zwischen Stress-, Drang-, Überlauf- und Reflexinkontinenz Identifizierung jener Betroffenen, bei denen aufgrund der Ergebnisse der Basisdiagnostik eine Behandlung erfolgen sollte Identifizierung jener Betroffenen, die einer speziellen Diagnostik bedürfen Untersuchungsgang Differenzierte Inkontinenzanamnese, gegebenenfalls mit Miktionstagebuch Sensibilitätsprüfung, Prüfung des Sphinktertonus Rektale Untersuchung Laboruntersuchungen mit Urinstatus, ggf. Bakteriologie Sonographie mit Restharnbestimmung Gynäkologischer Status Röntgenbefund Urodynamik Endoskopie Checkliste zur Klärung der Inkontinenz (Angehörigen kann eine Checkliste vorgelegt werden, um anamnestisch die Inkontinenz zu klären) Ist der Betagte zeitlich und örtlich orientiert? Ist die Mobilität beeinträchtigt? Leidet der Inkontinente unter Schmerzen? Ist die geistige Reaktionsfähigkeit vorhanden? Kann der Betagte in seiner Umgebung genügend sehen? Kann der Patient sprechen oder sich verbal ausdrücken? Sind die manuellen Fähigkeiten genügend vorhanden? Kann er die Toilette zur rechten Zeit erreichen? Sind die Toiletten tags und nachts gut erreichbar und beleuchtet? Braucht der Patient Hilfsmittel, und sind diese Mittel ausreichend? Wie sind die Trinkgewohnheiten während des Tages, am Abend, in der Nacht? Seit wann besteht die Inkontinenz? Besteht die Inkontinenz dauernd? Spürt der Betroffene, wenn die Blase voll ist? Aus: Sökeland J:, in: Platt D: Altersmedizin 1997, mit freundlicher Genehmigung: Schattauer-Verlag. Offene Blasenhalssuspension Hilton und Mayne (32) führten eine Stamey-Operation bei 100 Frauen (26 waren über 65 Jahre alt) durch. Nach vier Jahren zeigten sich 76 Prozent der über 65-jährigen Patienten als subjektiv geheilt. Faszienschlingen bei intrinsischem Sphinkterdefekt erbrachten eine subjektive Heilungsrate von 89 Prozent, 10 Prozent entwickelten eine De-novo-Detrusorinstabilität. Langzeit-Miktionsschwierigkeiten oder andere Komplikationen traten bei den Patienten nicht auf (8). Kolposuspension Bei etwa 60 Prozent der älteren Patientinnen kann eine Kolposuspension aufgrund des Allgemeinzustandes empfohlen werden. Mit dieser Technik wurden etwa 75 Prozent der Patientinnen geheilt (58). Schlingensuspension der Harnröhre Das von Ulmsten beschriebene tension-free vaginal tape wird ähnlich wie die Nadelsuspensionsplastik nach Stamey zu den minimalinvasiven Therapieverfahren bei weiblicher Stressinkontinenz gerechnet, sodass hier eine Anwendung auch bei älteren Patientinnen zu diskutieren ist. Auch wenn Langzeitergebnisse bei älteren Patientinnen noch nicht ausreichend vorliegen, können die von Ulmsten vorgestellten 5-Jahres-Ergebnisse mit einer Erfolgsrate von mehr als 85 Prozent Anlass sein, die Methode auch bei Inkontinenz im Alter einzusetzen (40). Aus der Bamberger Klinik wurden unter anderem erste Ergebnisse beim alten Menschen berichtet: Bei 135 operierten Patienten zeigte sich nach 18-monatiger Nachuntersuchung eine Heilungsrate von 88 Prozent (51, 65). Dranginkontinenz Zentren im Hirnstamm steuern die Harnblase (66). Dabei wirken übergeordnete kortikale fördernde und hemmende Impulse auf das pontine Miktionszentrum und lösen im geeigneten Augenblick eine willkürliche Blasenentleerung aus.auch die übergeordnete Koordination zwischen Detrusor und Sphinkter wird in der Pons vermutet. Altersbedingte degenerative Veränderungen im Gehirn können daher Funktionsstörungen der Blase verursachen. Die verschiedenen am Miktionsvorgang beteiligten Hirnareale haben summarisch eine Hemmwirkung auf den Miktionsreflex, sodass Veränderungen zu einem Kontrolldefizit über die Harnblase und so zum Symptom einer Drang- oder Urge-Inkontinenz führen können. Urodynamisch findet man eine Detrusorhyperaktivität schon in der Füllungsphase der Blase, oft mit reduzierter Compliance. So ist die gestörte Kontrolle des Gehirns über die Harnblasenfunktion eine häufige Ursache für eine Inkontinenz in dieser Altersgruppe. Aufgrund von zystometrischen und klinischen Befunden kann eine funktionelle Unterteilung der hyperaktiven Blase erfolgen. Man unterscheidet drei Kategorien der Detrusorhyperaktivität mit unterschiedlichen Symptomen (23): Typisch für den älteren Patienten mit Dranginkontinenz ist die ungehemmt hyperaktive Blase, die durch eine gestörte Perzeption der Blasenfüllung und fehlende willkürliche Miktionshemmung charakterisiert ist. Der betroffene Patient verspürt erst dann starken Harndrang, wenn die Miktion bereits abläuft. In diesem Fall verläuft die Miktion koordiniert, das heißt der Beckenboden beziehungsweise der äußere Schließmuskel ist relaxiert. Die phasische Detrusorinstabilität ist durch imperativen Drang beziehungsweise Dranginkontinenz, normale oder verstärkte Blasenperzeption und phasische Blasenkontraktionen gekennzeichnet. Diese treten spontan während der Blasenfüllung auf und werden durch schnelle Füllung oder äußere mechanische Reize ausgelöst. Die Entleerung ist koordiniert und kann meist kurz hinausgezögert werden. Die suprapontine und supraspinale Detrusorhyperreflexie tritt bei suprasakralen Läsionen des Rückenmarks auf. Durch dauerhafte Unterbrechung pontiner Reflexbahnen kommt es zu unkoordinierten Detrusorkontraktionen mit Detrusor-Sphinkter-Dyssyn- A 2622 Deutsches Ärzteblatt Jg. 99 Heft Oktober 2002
6 ergie. Diese Funktionsstörung tritt bei bis zu 70 Prozent der älteren Patienten auf. Sie ist gekennzeichnet durch eine Reflexmiktion bei normaler oder geringer Blasenfüllung und ein Fehlen der willkürlichen Unterdrückung des Miktionsreflexes. Mögliche Therapieansätze Die Therapie der Dranginkontinenz richtet sich nach der Grundkrankheit. Ehe therapeutische Maßnahmen angewendet werden, müssen Faktoren, die eine Inkontinenz fördern, identifiziert und ausgeschlossen werden. Bei Infekten ist die Primärtherapie eine Infektbehandlung, gegebenenfalls nach Erreger-Resistenzprüfung, notwendig. Die Reduzierung oder das Absetzen von Inkontinenz fördernden Medikamenten (Sedativa, Hypnotika, Diuretika, α-rezeptorenblocker) sollte erwogen werden. Auch eine Verbesserung der Situation des Patienten (Toilette in angemessener Entfernung) kann hilfreich sein. Die weitere Therapie umfasst Kontinenztrainingsprogramme, Biofeedback und die Pharmakotherapie. Auch eine Elektrostimulation kann erwogen werden. Diese Maßnahmen sollten mit intensiver Pflege und Betreuung des alten Menschen verbunden sein, um körperliche und geistige Mobilisation zu erreichen. Bei mobilen Patienten mit ausreichender Hirnleistung kann ein Blasentraining durchgeführt werden, das auch beim älteren verwirrten Menschen noch eingesetzt werden kann. Dieser so genannte Blasendrill ist eine sehr intensive Behandlung, die stationär erfolgen sollte (25, 26, 57). Auch ambulante Schulungen erreichen gute Resultate mit Heilungsraten von 44 bis 90 Prozent (57). Trainingsprogramme sind auch in Kombination mit einer Pharmakotherapie hilfreich (61). Pharmakotherapie Textkasten 3 Altersabhängige Ursachen der Inkontinenz Dehydrierung Harnwegsinfektion Herzinsuffizienz Eingeschränkte Mobilität Zentralnervöse Störungen (apoplektischer Insult, M. Parkinson) Periphere Neuropathie (Diabetes mellitus) Verwirrung, Demenz Benigne Prostatahyperplasie Komedikation mit Nebenwirkungen am Harntrakt Die Dranginkontinenz ist eine Domäne der medikamentösen Behandlung. Die am häufigsten verwandten Medikamente zählen zur Gruppe der Parasympatholytika (Muscarinrezeptorantagonisten). Sie unterdrücken die über Muscarinrezeptoren vermittelte Kontraktion des Detrusors und erhöhen so die funktionelle Blasenkapazität. Letzteres ist bedeutsam, da bei Drangsymptomatik und Dranginkontinenz eine verringerte funktionelle Blasenkapazität vorliegen kann. Die Medikation kann zusätzlich die Blasenperzeption verbessern, wahrscheinlich durch die verstärkten Afferenzen einer vermehrt gefüllten Blase. Insgesamt kommt es zu einem Anstieg der durchschnittlichen Miktionsvolumina und damit zu einer Abnahme der Miktionsfrequenz, der Drangepisoden sowie der Dranginkontinenz. Die Erfolgsaussichten für eine komplette Unterdrückung der Dranginkontinenz sind von ihrem Schweregrad vor Behandlung sowie in geringerem Umfang vom Alter des Patienten abhängig (49). In Deutschland werden dabei vor allem die Wirkstoffe Oxybutynin (2, 74), Propiverin (43), Tolterodin (11, 13, 70) und Trospiumchlorid (27, 33, 51, 65) verabreicht. Ihre Wirksamkeit wurden in placebokontrollierten Studien belegt, wobei Oxybutynin und Tolterodin am besten untersucht wurden. Von Tolterodin steht seit kurzem eine neue Formulierung zur Verfügung, die eine einmal tägliche Gabe ermöglicht und eine verbesserte Wirksamkeit und Verträglichkeit aufweist (67). Von Oxybutynin wird ebenfalls eine neue, besser verträgliche Formulierung zur einmal täglichen Gabe in Kürze in den Handel kommen (12). Durch Unterschiede in Studiendesign und untersuchten Patientenpopulationen sind indirekte Vergleiche zwischen den Wirkstoffen schwierig (5). Es ergibt sich der Eindruck, dass sämtliche Präparate bei adäquater Dosierung ähnlich wirksam sind. Dies wird in einigen Fällen auch durch direkte Vergleichsstudien bestätigt (3, 29, 42, 44). Emeproniumbromid hat sich in der Behandlung der Dranginkontinenz zwar als wirksam erwiesen, kann aber zu oralen oder ösophagealen Ulzerationen führen, weshalb diesem Wirkstoff in einigen Ländern die Zulassung entzogen wurde (1, 40).Auch Flavoxat ist für die Behandlung der Dranginkontinenz zugelassen, im Vergleich mit anderen Muscarinrezeptorantagonisten oder mit Placebo wird seine Wirksamkeit aber nur als mäßig bewertet (10, 56, 71). Die Muscarinrezeptorantagonisten sind auch beim älteren Menschen wirksam, allerdings muss präparateabhängig eine eventuell veränderte Pharmakokinetik (Absorption, Gewebespiegel, hepatische Transformation, renale Elimination) beachtet werden. Die entsprechenden Medikamente sollten deshalb einschleichend dosiert werden (60). Für einige Präparate wurde empfohlen, dass die Dosis nur etwa 35 bis 50 Prozent der für gesunde Erwachsene üblichen Dosis betragen soll (30). In den meisten Fällen ist bei Patienten mit Dranginkontinenz eine dauerhafte Behandlung erforderlich. Die Compliance des Patienten ist aber von der Verträglichkeit der jeweiligen Präparate abhängig. Typische Nebenwirkungen der Muscarinrezeptorantagonisten bestehen in Mundtrockenheit, Obstipation, verminderter Schweißsekretion mit der Gefahr des Hitzestaus und Tachykardien. Bei Glaukompatienten sind Anticholinergika kontraindiziert. Außerdem muss durch die Abnahme der Detrusorkontraktilität mit Restharnbildung gerechnet werden. Durch unterschiedlich gestaltete Stu- Deutsches Ärzteblatt Jg. 99 Heft Oktober 2002 A 2623
7 Grafik 4 Proximale passive Drucktransmission Distale reaktive Drucktransmission S1 S2 S3 S4 über einen Selbst- oder Fremdkatheterismus erfolgen. Da dies aber bei multimorbiden, oft bettlägerigen und manuell wie zerebral eingeschränkten alten Patienten oft nicht erreichbar ist, werden auch Formen von Urindauerableitung eingesetzt. N. pelvicus (parasympathisch) Zusammenfassung cm H 2 O 200 Pves (1) 0 cm H 2 O 200 Pura (3) 0 cm H 2 O 200 Pclos 0 UP T T T T T T T T T T T T T T Uhrzeit dien ist ein indirekter Vergleich der Verträglichkeit zwischen den verschiedenen Anticholinergika schwierig. Direkte Vergleichsstudien haben aber konsistent gezeigt, dass Oxybutynin schlechter verträglich ist als Propiverin (42),Tolterodin (29) oder Trospiumchlorid (44). In der neuen Formulierung zur einmal täglichen Gabe scheint dieser Verträglichkeitsnachteil von Oxybutynin jedoch aufgehoben zu sein (3). Darüber hinaus gilt für alle Anticholinergika, dass eine reduzierte Nierenfunktion, ein reduziertes Körpergewicht oder eine Komorbidität Risikofaktoren für altersabhängige Nebenwirkungen sind. Auch Begleitmedikation wie zum Beispiel einige Antiparkinson-Mittel, Antidepressiva, Calciumantagonisten, Anticholinergika oder Sedativa hemmen die Detrusorkontraktilität und können so einem Harnverhalt oder einer Überlaufinkontinenz Vorschub leisten. Die Möglichkeit einer durch Diuretika ausgelösten motorischen Dranginkontinenz ist zu beachten. Reflexinkontinenz N. pudendus (somatisch) Typisches Urethradruckprofil (Stressprofil) einer kontinenten Frau mit Registrierung durch Drucktransmission (Differenz zwischen den Husten induzierten Druckspitzen von Vesikaldruck [blau] und Urethraldruck [rot] in der proximalen Harnröhre). Über den Kurven zeigen Schemata die physiologische Drucktransmissionsursache. Aus: Hampel C, Hohenfellner M, Melchior S, Thüroff JW: Sling procedures in the therapy of female stress incontinence. Urologe A 2001; 40: , mit freundlicher Genehmigung: Springer-Verlag, Heidelberg. Eine Reflexinkontinenz als Entleerungsform der neurogenen Blase zum Beispiel nach Querschnittlähmung ist im Alter selten. Sie kann als Folge degenerativer oder metastatischer Prozesse mit konsekutiver Einengung des Spinalkanals auftreten. Bei der Reflexinkontinenz besteht häufig eine zusätzliche Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie, sodass hohe intravesikale Drücke resultieren. Auch hier werden Anticholinergika einsetzt, um die Blasenkapazität zu erhöhen, den oberen Harntrakt zu schützen und soziale Harnkontinenz zu erreichen. Die Blasenentleerung muss dann allerdings PB ist ein bei alten Menschen, vor allem bei Frauen, weit verbreitetes Problem, das mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen sowie mit erheblichen volkswirtschaftlichen Belastungen einhergeht. Angesichts der inzwischen verfügbaren Behandlungsoptionen ist ein therapeutischer Nihilismus bei diesem Krankheitsbild nicht mehr angebracht. Die erfolgreiche Behandlung der Inkontinenz erfordert ein pathophysiologisches Verständnis des zugrunde liegenden Prozesse sowie eine adäquate Diagnostik, die sich in ihrem Umfang an den sich daraus ergebenden therapeutischen Konsequenzen orientiert. Während bei der Stressinkontinenz der Schwerpunkt auf operativen Behandlungsmethoden liegt, ist die Dranginkontinenz eine Domäne der medikamentösen Therapie. Manuskript eingereicht: ; revidierte Fassung angenommen: Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2002; 99: A [Heft 40] Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das über den Sonderdruck beim Verfasser und über das Internet ( erhältlich ist. Anschrift für die Verfasser: Priv.-Doz. Dr. med. Mark Goepel Klinikum Niederberg Robert-Koch-Straße Velbert goepel@klinikum-niederberg.de A 2624 Deutsches Ärzteblatt Jg. 99 Heft Oktober 2002
Inhalt. Geschichtliche Anmerkungen... 1
 Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Neurogene Blasenfunktionsstörung
 Neurogene Blasenfunktionsstörung Formen, Symptome, Diagnostik Harnblase - ein unscheinbares Organ Beobachter 24/99 Die Harnblase ist eigentlich ein langweiliges Organ, ein plumper Sack. Wichtger ist.?
Neurogene Blasenfunktionsstörung Formen, Symptome, Diagnostik Harnblase - ein unscheinbares Organ Beobachter 24/99 Die Harnblase ist eigentlich ein langweiliges Organ, ein plumper Sack. Wichtger ist.?
UMFRAGEERGEBNISSE DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN
 UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
Patienteninformation. Nehmen Sie sich Zeit...
 Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz
 12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll
 Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Anatomie und Physiologie Blase
 Anatomie und Physiologie Blase 1 Topographie Harnblase Liegt vorne im kleinen Becken, hinter Symphyse und Schambeinen Dach der Blase wird vom Peritoneum bedeckt Bei der Frau grenzt der hintere Teil an
Anatomie und Physiologie Blase 1 Topographie Harnblase Liegt vorne im kleinen Becken, hinter Symphyse und Schambeinen Dach der Blase wird vom Peritoneum bedeckt Bei der Frau grenzt der hintere Teil an
Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe
 Inkontinenz im Alter Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe Gedächtnisschwund und Blasenschwäche kommen sehr oft zusammen, weil Demenz die Hirnregion zerstört, die für die Blasenkontrolle zuständig
Inkontinenz im Alter Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe Gedächtnisschwund und Blasenschwäche kommen sehr oft zusammen, weil Demenz die Hirnregion zerstört, die für die Blasenkontrolle zuständig
Harn- und Stuhlinkontinenz
 Harn- und Stuhlinkontinenz Harninkontinenz, dass heißt unwillkürlicher Urinverlust, ist eine häufige Erkrankung, unter der in Deutschland etwa sechs bis acht Millionen Frauen und Männer leiden. Blasenfunktionsstörungen,
Harn- und Stuhlinkontinenz Harninkontinenz, dass heißt unwillkürlicher Urinverlust, ist eine häufige Erkrankung, unter der in Deutschland etwa sechs bis acht Millionen Frauen und Männer leiden. Blasenfunktionsstörungen,
Inkontinenz - Zukünftige Herausforderungen
 16. Bamberger Gespräche 2012 Inkontinenz - Zukünftige Herausforderungen Prof. Dr. med. Ingo Füsgen Bamberg (8. September 2012) - Der demografische Wandel mit dem massiven Anstieg Betagter und Hochbetagter
16. Bamberger Gespräche 2012 Inkontinenz - Zukünftige Herausforderungen Prof. Dr. med. Ingo Füsgen Bamberg (8. September 2012) - Der demografische Wandel mit dem massiven Anstieg Betagter und Hochbetagter
PATIENTENINFORMATION. über. Harninkontinenz
 PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz
 Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz Prim. Univ. Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Gynäkologie KH Barmherzige Brüder Wien Wien, am 25.06.2013 Harninkontinenz Definition Prävalenz
Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz Prim. Univ. Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Gynäkologie KH Barmherzige Brüder Wien Wien, am 25.06.2013 Harninkontinenz Definition Prävalenz
Prostataerkrankungen
 Wenn s s einmal nicht mehr läuft: Prostataerkrankungen Prof. Dr. med. K.D. Sievert Stellvertretender Direktor Klinik für f r Urologie Universität t T Ablauf Anatomie & Physiologie Benignes Prostatasyndrom
Wenn s s einmal nicht mehr läuft: Prostataerkrankungen Prof. Dr. med. K.D. Sievert Stellvertretender Direktor Klinik für f r Urologie Universität t T Ablauf Anatomie & Physiologie Benignes Prostatasyndrom
corina.christmann@luks.ch sabine.groeger@luks.ch Frühjahrsfortbildung Inkontinenz
 Frühjahrsfortbildung Inkontinenz Welche Inkontinenzformen gibt es? Andere Inkontinenzformen (stress 14% urinary incontinence, SUI) - Dranginkontinenz (überaktive Blase, urge UUI, OAB wet/dry) (Inkontinenz
Frühjahrsfortbildung Inkontinenz Welche Inkontinenzformen gibt es? Andere Inkontinenzformen (stress 14% urinary incontinence, SUI) - Dranginkontinenz (überaktive Blase, urge UUI, OAB wet/dry) (Inkontinenz
Beratung Vorsorge Behandlung. Beckenboden- Zentrum. im RKK Klinikum Freiburg. Ihr Vertrauen wert
 Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Kontinenzfördernde Pflege im spitalexternen Umfeld. Martha Vögeli Dipl. Pflegefachfrau HF/ Stomatherapeutin Kontinenz- & Stomaberatung Spitex Uster
 Kontinenzfördernde Pflege im spitalexternen Umfeld Martha Vögeli Dipl. Pflegefachfrau HF/ Stomatherapeutin Kontinenz- & Stomaberatung Spitex Uster Möglichkeiten der kontinenzfördenden Pflege in der Spitex
Kontinenzfördernde Pflege im spitalexternen Umfeld Martha Vögeli Dipl. Pflegefachfrau HF/ Stomatherapeutin Kontinenz- & Stomaberatung Spitex Uster Möglichkeiten der kontinenzfördenden Pflege in der Spitex
ALLES ÜBER BLASENPROBLEME. Solutions with you in mind
 ALLES ÜBER BLASENPROBLEME www.almirall.com Solutions with you in mind WAS IST DAS? Blasenprobleme sind definiert als Symptome, die von einer unzureichenden Funktion der Blase herrühren. Bei MS-Patienten
ALLES ÜBER BLASENPROBLEME www.almirall.com Solutions with you in mind WAS IST DAS? Blasenprobleme sind definiert als Symptome, die von einer unzureichenden Funktion der Blase herrühren. Bei MS-Patienten
Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
 Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Univ.-Prof. Dr. P. Fornara Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Univ.-Prof. Dr. P. Fornara Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
Prophylaxen. P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz
 Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Brigitte Sachsenmaier. Inkontinenz. Hilfen, Versorgung und Pflege. Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus. schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei
 Brigitte Sachsenmaier Inkontinenz Hilfen, Versorgung und Pflege Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1. Was ist Inkontinenz?
Brigitte Sachsenmaier Inkontinenz Hilfen, Versorgung und Pflege Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1. Was ist Inkontinenz?
Harnkontinenz. Definitionen. Formen nicht kompensierter Inkontinenz. Pflegediagnosen: Risikofaktoren
 Definitionen Harninkontinenz ist jeglicher unfreiwilliger Urinverlust. ist die Fähigkeit, willkürlich zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase zu entleeren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit,
Definitionen Harninkontinenz ist jeglicher unfreiwilliger Urinverlust. ist die Fähigkeit, willkürlich zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase zu entleeren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit,
Die Harninkontinenz bei der Frau. Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien
 Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz
 Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Besonderheiten der Harninkontinenz Diagnostik beim geriatrischen Patienten
 1 Besonderheiten der Harninkontinenz Diagnostik beim geriatrischen Patienten Characteristic Features of Urinary Incontinence Diagnostic Investigation in Geriatric Patients Autoren Institut R. Kirschner-Hermanns,
1 Besonderheiten der Harninkontinenz Diagnostik beim geriatrischen Patienten Characteristic Features of Urinary Incontinence Diagnostic Investigation in Geriatric Patients Autoren Institut R. Kirschner-Hermanns,
Zu dieser Folie: Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz
 Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3 Relevante Kapitel:
Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3 Relevante Kapitel:
Diabetes und die Harnblase
 encathopedia Volume 5 Diabetes und die Harnblase Wichtig zu beachten Die Warnsignale erkennen ISK kann helfen Diabetes (Diabetes mellitus, DM) Diabetes mellitus gehört zu der Gruppe der Stoffwechselkrankheiten,
encathopedia Volume 5 Diabetes und die Harnblase Wichtig zu beachten Die Warnsignale erkennen ISK kann helfen Diabetes (Diabetes mellitus, DM) Diabetes mellitus gehört zu der Gruppe der Stoffwechselkrankheiten,
Klinik für Urologie und Kinderurologie
 Klinik für Urologie und Kinderurologie Mehr als gute Medizin. Krankenhaus Schweinfurt D ie Klinik für Urologie und Kinderurologie ist auf die Behandlung von Erkrankungen bestimmter Organe spezialisiert.
Klinik für Urologie und Kinderurologie Mehr als gute Medizin. Krankenhaus Schweinfurt D ie Klinik für Urologie und Kinderurologie ist auf die Behandlung von Erkrankungen bestimmter Organe spezialisiert.
Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel
 Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
Parkinson und die Blase
 encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt Behandlung von Blasenproblemen ISK kann helfen Die Krankheit Parkinson Parkinson ist eine fortschreitende neurologische
encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt Behandlung von Blasenproblemen ISK kann helfen Die Krankheit Parkinson Parkinson ist eine fortschreitende neurologische
Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes
 11 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes P.M. Braun und K.-P. Jünemann.1 Anatomie des unteren Harntrakt es 1. Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) 1.3 Neurophysiologie 13 Literatur
11 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes P.M. Braun und K.-P. Jünemann.1 Anatomie des unteren Harntrakt es 1. Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) 1.3 Neurophysiologie 13 Literatur
Harninkontinenz - Kontinenzförderung. Rita Willener Pflegeexpertin MScN
 Harninkontinenz - Kontinenzförderung Rita Willener Pflegeexpertin MScN Klinik für Urologie, Inselspital Bern, 2011 Übersicht zum Referat Harninkontinenz Epidemiologie Definition Risikofaktoren Auswirkungen
Harninkontinenz - Kontinenzförderung Rita Willener Pflegeexpertin MScN Klinik für Urologie, Inselspital Bern, 2011 Übersicht zum Referat Harninkontinenz Epidemiologie Definition Risikofaktoren Auswirkungen
Aktualisierung des Expertenstandards Förderung der Harnkontinenz in der Pflege. Dr. Daniela Hayder-Beichel Pflegewissenschaftlerin
 Aktualisierung des Expertenstandards Förderung der Harnkontinenz in der Pflege Dr. Daniela Hayder-Beichel Pflegewissenschaftlerin Aktualisierung des Expertenstandards Vorgehen Literaturanalyse (Winter
Aktualisierung des Expertenstandards Förderung der Harnkontinenz in der Pflege Dr. Daniela Hayder-Beichel Pflegewissenschaftlerin Aktualisierung des Expertenstandards Vorgehen Literaturanalyse (Winter
LoFric encathopedia. Behandlung von Blasenproblemen. Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt. ISK kann helfen
 LoFric encathopedia encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wellspect HealthCare ist ein führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Urologie und Chirurgie. Wir
LoFric encathopedia encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wellspect HealthCare ist ein führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Urologie und Chirurgie. Wir
10 Welche nicht-medikamentöse Therapie ist bei Dranginkontinenz möglich?
 Kapitel 10 85 10 Welche nicht-medikamentöse Therapie ist bei Dranginkontinenz möglich? Frank Perabo Neben der pharmakologischen Therapie sind verschiedene Methoden aus der Verhaltenstherapie, aktives und
Kapitel 10 85 10 Welche nicht-medikamentöse Therapie ist bei Dranginkontinenz möglich? Frank Perabo Neben der pharmakologischen Therapie sind verschiedene Methoden aus der Verhaltenstherapie, aktives und
Reha für operierte BPS Patienten. Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar Köln
 Reha für operierte BPS Patienten Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar 17.02. 18.02.2017 Köln Prof. Dr. med. Ullrich Otto Ärztlicher Direktor Ltd. Chefarzt UKR Urologisches Kompetenzzentrum
Reha für operierte BPS Patienten Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar 17.02. 18.02.2017 Köln Prof. Dr. med. Ullrich Otto Ärztlicher Direktor Ltd. Chefarzt UKR Urologisches Kompetenzzentrum
Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz
 Harninkontinenz: Definition Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz Unter Harninkontinenz verstehen wir, wenn ungewollt Urin verloren geht. Internationale Kontinenzgesellschaft (ICS) Zustand mit jeglichem
Harninkontinenz: Definition Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz Unter Harninkontinenz verstehen wir, wenn ungewollt Urin verloren geht. Internationale Kontinenzgesellschaft (ICS) Zustand mit jeglichem
Diagnostik in der Urogynäkologie
 Diagnostik in der Urogynäkologie Urodynamik Die Urodynamik hielt 1939 Einzug in die urologische Diagnostik: Lewis: A new clinical recording cystometry in J Urol 41 (1939): 638 beschrieb die Methode als
Diagnostik in der Urogynäkologie Urodynamik Die Urodynamik hielt 1939 Einzug in die urologische Diagnostik: Lewis: A new clinical recording cystometry in J Urol 41 (1939): 638 beschrieb die Methode als
Weitere Vorstellungen erfolgen je nach Befund dann jährlich bis vierteljährlich.
 Hamburger Therapiestandard Blasenstörung bei MS Version: 12-6-12 Zielsetzung des Standards: Dieses Dokument will Konsensus von Urologen und Neurologen sein, wie idealerweise im Raum Hamburg Blasenstörung
Hamburger Therapiestandard Blasenstörung bei MS Version: 12-6-12 Zielsetzung des Standards: Dieses Dokument will Konsensus von Urologen und Neurologen sein, wie idealerweise im Raum Hamburg Blasenstörung
BECKENBODEN- ZENTRUM
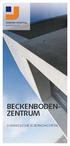 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
Ich kann nicht Wasser lösen!
 Ich kann nicht Wasser lösen! Swiss Family Docs, Basel 26.08.2011 Christoph Cina / Stephan Holliger Eine häufige und banale Männergeschichte? Eine häufige und banale Männergeschichte? Arten der Prostata
Ich kann nicht Wasser lösen! Swiss Family Docs, Basel 26.08.2011 Christoph Cina / Stephan Holliger Eine häufige und banale Männergeschichte? Eine häufige und banale Männergeschichte? Arten der Prostata
Inkontinenz. Inkontinenz. Eine Einführung zum Thema Urinund Stuhlinkontinenz. Harn- und Stuhlinkontinenz
 Inkontinenz Inkontinenz Eine Einführung zum Thema Urinund Stuhlinkontinenz Prof. Dr. med. I. Füsgen Ärztlicher Direktor der Geriatrischen Kliniken der Kliniken St. Antonius Wuppertal/Velbert-Neviges Lehrstuhl
Inkontinenz Inkontinenz Eine Einführung zum Thema Urinund Stuhlinkontinenz Prof. Dr. med. I. Füsgen Ärztlicher Direktor der Geriatrischen Kliniken der Kliniken St. Antonius Wuppertal/Velbert-Neviges Lehrstuhl
14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen Erkrankungen aus Sicht des Urologen
 Hofrat Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher: Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronale 14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen
Hofrat Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher: Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronale 14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen
Ich verliere Winde was tun?
 HERZLICH WILLKOMMEN Samstag, 29. August 2015 Ich verliere Winde was tun? Marc Hauschild Stv. Oberarzt Klinik für Chirurgie Liestal ANO-REKTALE INKONTINENZ Inhaltsverzeichnis 1. Kontinenz 2. Häufigkeit
HERZLICH WILLKOMMEN Samstag, 29. August 2015 Ich verliere Winde was tun? Marc Hauschild Stv. Oberarzt Klinik für Chirurgie Liestal ANO-REKTALE INKONTINENZ Inhaltsverzeichnis 1. Kontinenz 2. Häufigkeit
ICA Österreich St. Pölten Was ist Urotherapie? Welche Bedeutung kann sie für Patientinnen mit IC haben?
 Was ist Urotherapie? Welche Bedeutung kann sie für Patientinnen mit IC haben? Funktionsleitung: Urologische Ambulanz und Endourologischer OP Urotherapie Ist eine nicht chirurgische und nicht pharmakologische
Was ist Urotherapie? Welche Bedeutung kann sie für Patientinnen mit IC haben? Funktionsleitung: Urologische Ambulanz und Endourologischer OP Urotherapie Ist eine nicht chirurgische und nicht pharmakologische
Beckenbodentraining mit EMS
 Beckenbodentraining mit EMS Viele Menschen, insbesondere Frauen, sind von Problemen mit Inkontinenz betroffen, was die Lebensqualität nicht zuletzt aus gesellschaftlicher Sicht erheblich mindern kann.
Beckenbodentraining mit EMS Viele Menschen, insbesondere Frauen, sind von Problemen mit Inkontinenz betroffen, was die Lebensqualität nicht zuletzt aus gesellschaftlicher Sicht erheblich mindern kann.
Frau Prof. Burkhard, wie lässt sich das Problem der Inkontinenz zuordnen? Wer ist davon betroffen?
 Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Harninkontinenz. Inhaltsverzeichnis. 1 Formen der Harninkontinenz
 Harninkontinenz Inhaltsverzeichnis 1 Formen der Harninkontinenz 1.1 Überlaufinkontinenz 1.2 Syndrom der überaktiven Blase 1 Formen der Harninkontinenz Die häufigsten Formen sind die Dranginkontinenz (ICD-10:
Harninkontinenz Inhaltsverzeichnis 1 Formen der Harninkontinenz 1.1 Überlaufinkontinenz 1.2 Syndrom der überaktiven Blase 1 Formen der Harninkontinenz Die häufigsten Formen sind die Dranginkontinenz (ICD-10:
The Journal Club. Einfluss von Medikamenten auf urologische Krankheiten
 The Journal Club Einfluss von Medikamenten auf urologische Krankheiten Arzneistoffe können als Nebenwirkungen urologische Symptome verursachen z.b. Stressinkontinenz durch α-rezeptorenblocker Dranginkontinenz
The Journal Club Einfluss von Medikamenten auf urologische Krankheiten Arzneistoffe können als Nebenwirkungen urologische Symptome verursachen z.b. Stressinkontinenz durch α-rezeptorenblocker Dranginkontinenz
Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?-
 Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?- I.Kurze, 1.ASBH Kongress Köln, 21./22.3.2014 Zertifizierte Beratungstelle WAS IST DAS PROBLEM? Fehlende
Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?- I.Kurze, 1.ASBH Kongress Köln, 21./22.3.2014 Zertifizierte Beratungstelle WAS IST DAS PROBLEM? Fehlende
Klinik für Rehabilitationsmedizin
 Klinik für Rehabilitationsmedizin Was tun bei Belastungsinkontinenz Definition / Epidemiologie Ungewollter Harnverlust aus der Blase durch die Harnröhre bei körperlicher Belastung ohne Harndrang. Die passive
Klinik für Rehabilitationsmedizin Was tun bei Belastungsinkontinenz Definition / Epidemiologie Ungewollter Harnverlust aus der Blase durch die Harnröhre bei körperlicher Belastung ohne Harndrang. Die passive
Multiple Sklerose und die Harnblase
 encathopedia Volume 2 Multiple Sklerose und die Harnblase Behandlung von Blasenproblemen Wie sich MS auf die Blase auswirkt ISK kann helfen Multiple Sklerose (MS) MS ist eine entzündliche Erkrankung, die
encathopedia Volume 2 Multiple Sklerose und die Harnblase Behandlung von Blasenproblemen Wie sich MS auf die Blase auswirkt ISK kann helfen Multiple Sklerose (MS) MS ist eine entzündliche Erkrankung, die
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten. Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie
 Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP. Braunlage
 Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP Braunlage 20.4.2013 MBA, MPH W. N. Vance Facharzt für Urologie, Sexualmedizin, Sozialmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie,
Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP Braunlage 20.4.2013 MBA, MPH W. N. Vance Facharzt für Urologie, Sexualmedizin, Sozialmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie,
Inkontinenz. Dr. med. P. Honeck. Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen
 Therapie der männlichen Inkontinenz Dr. med. P. Honeck Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen g Formen der Inkontinenz Form Belastung (Stress) Beschreibung Unwillkürlicher Harnabgang
Therapie der männlichen Inkontinenz Dr. med. P. Honeck Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen g Formen der Inkontinenz Form Belastung (Stress) Beschreibung Unwillkürlicher Harnabgang
Inkontinenz. Was versteht man unter Harninkontinenz? Welche Untersuchungen sind notwendig?
 Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k
 Mein Beckenboden Beckenbodenschwäche & Inkontinenz Ursachen, Diagnostik und Therapien 3D Animation Beckenboden Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k Ursachen Beckenbodenschwäche Geburten Alter
Mein Beckenboden Beckenbodenschwäche & Inkontinenz Ursachen, Diagnostik und Therapien 3D Animation Beckenboden Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k Ursachen Beckenbodenschwäche Geburten Alter
1.1 WAS IST EINE DEMENZ?
 1.1 WAS IST EINE DEMENZ? Derzeit leiden in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen an Demenz Tendenz steigend. Demenzen treten überwiegend in der zweiten Lebenshälfte auf. Ihre Häufigkeit nimmt mit steigendem
1.1 WAS IST EINE DEMENZ? Derzeit leiden in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen an Demenz Tendenz steigend. Demenzen treten überwiegend in der zweiten Lebenshälfte auf. Ihre Häufigkeit nimmt mit steigendem
Hilfe bei plötzlichem, unwillkürlichem Harnverlust.
 Eine A Simple einfache Solution Lösung FÜR EIN TO WEIT A COMMON VERBREITETES PROBLEM PROBLEM Hilfe bei plötzlichem, unwillkürlichem Harnverlust. Ein weit verbreitetes Problem Millionen Frauen leiden an
Eine A Simple einfache Solution Lösung FÜR EIN TO WEIT A COMMON VERBREITETES PROBLEM PROBLEM Hilfe bei plötzlichem, unwillkürlichem Harnverlust. Ein weit verbreitetes Problem Millionen Frauen leiden an
Anhang. Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-Operation
 53 Anhang Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) Name, Vorname: geboren am: Größe cm Gewicht:
53 Anhang Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) Name, Vorname: geboren am: Größe cm Gewicht:
Guidelines St. Galler Geriatriekonzept. Guideline Nummer S-5, Version 2, März 2007
 Urininkontinenz Version 1, März 2007 Dr. med. Stefan Pazeller Einleitung Urininkontinenz ist ein unfreiwilliger Abgang von Urin, der für die Betroffenen und/oder die Umgebung belastend wird. Bis zu 30
Urininkontinenz Version 1, März 2007 Dr. med. Stefan Pazeller Einleitung Urininkontinenz ist ein unfreiwilliger Abgang von Urin, der für die Betroffenen und/oder die Umgebung belastend wird. Bis zu 30
Voruntersuchungen. Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
 Voruntersuchungen ASA Klassifikation Grundlagen für apparative, technische Untersuchungen entscheidende Grundlagen zur Indikation jeder präoperativen technischen Untersuchung: - Erhebung einer sorgfältigen
Voruntersuchungen ASA Klassifikation Grundlagen für apparative, technische Untersuchungen entscheidende Grundlagen zur Indikation jeder präoperativen technischen Untersuchung: - Erhebung einer sorgfältigen
Blasenschwäche. Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen
 Blasenschwäche Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen 2 TW_WH_137_Patientenb_Blasenschw_10_D_RZ_3.indd 3 02.12.13 17:54 Inhalt Blasenschwäche ist behandelbar... 4/5 Die verschiedenen
Blasenschwäche Kein Schicksal, sondern behandelbar! Information für Patientinnen 2 TW_WH_137_Patientenb_Blasenschw_10_D_RZ_3.indd 3 02.12.13 17:54 Inhalt Blasenschwäche ist behandelbar... 4/5 Die verschiedenen
Antrag an die Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.v. auf Zertifizierung als Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum
 Antrag an die Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.v. auf Zertifizierung als Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Aufnahmeantrag für: Das Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum in Koordinator: Klinik Abteilung
Antrag an die Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.v. auf Zertifizierung als Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Aufnahmeantrag für: Das Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum in Koordinator: Klinik Abteilung
Aktuelle Konzepte zur Konservative Therapie der Belastungsinkontinenz AGUB GK
 Aktuelle Konzepte zur Konservative Therapie der Belastungsinkontinenz Aktuelle Konzepte zur konservativen Therapie der Belastungsinkontinenz Gewichtsreduktion Physiotherapie Hilfsmittel / Pessare Medikamente
Aktuelle Konzepte zur Konservative Therapie der Belastungsinkontinenz Aktuelle Konzepte zur konservativen Therapie der Belastungsinkontinenz Gewichtsreduktion Physiotherapie Hilfsmittel / Pessare Medikamente
Blasenfunktionsdiagnostik
 SIGUP 211 Basel Blasenfunktionsdiagnostik Dr. med. Daniel Engeler Leitender Arzt Klinik für Urologie Kantonsspital St. Gallen daniel.engeler@kssg.ch SIGUP 211 Basel Übersicht Einleitung Basisabklärungen
SIGUP 211 Basel Blasenfunktionsdiagnostik Dr. med. Daniel Engeler Leitender Arzt Klinik für Urologie Kantonsspital St. Gallen daniel.engeler@kssg.ch SIGUP 211 Basel Übersicht Einleitung Basisabklärungen
Ein Leben lang PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE
 Ein Leben lang Schmerz und Drang? IC Interstitielle Cystitis Patienten-Information Lebenslang Schmerz und Drang? Es gibt Erkrankungen, die von den Ärztinnen und Ärzten sehr schnell erkannt werden, ein
Ein Leben lang Schmerz und Drang? IC Interstitielle Cystitis Patienten-Information Lebenslang Schmerz und Drang? Es gibt Erkrankungen, die von den Ärztinnen und Ärzten sehr schnell erkannt werden, ein
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC
 Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Urologie Von Dr. med. Ulf Bersch Eines der grössten Probleme bei einer Schädigung des Rückenmarks ist die Funktionsstörung der Harnblase mit den daraus entstehenden
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Urologie Von Dr. med. Ulf Bersch Eines der grössten Probleme bei einer Schädigung des Rückenmarks ist die Funktionsstörung der Harnblase mit den daraus entstehenden
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
 Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung der Parkinson-Erkrankung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Dazu gehört zunächst eine Aufklärung
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung der Parkinson-Erkrankung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Dazu gehört zunächst eine Aufklärung
Juni 2004. Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin
 Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin Blasenstörungen und Sexualfunktionsstörungen bei Multipler Sklerose Krankenhaus Buchholz Abteilung für Neurologie Helle
Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin Blasenstörungen und Sexualfunktionsstörungen bei Multipler Sklerose Krankenhaus Buchholz Abteilung für Neurologie Helle
Pflegekompakt. Kontinenzförderung. Ein Leitfaden. von Sylke Werner. 1. Auflage. Kohlhammer 2012
 Pflegekompakt Kontinenzförderung Ein Leitfaden von Sylke Werner 1. Auflage Kohlhammer 2012 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 17 022064 5 Zu Leseprobe schnell und portofrei erhältlich
Pflegekompakt Kontinenzförderung Ein Leitfaden von Sylke Werner 1. Auflage Kohlhammer 2012 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 17 022064 5 Zu Leseprobe schnell und portofrei erhältlich
Obstruktive Schlafapnoe: Risikofaktoren, Therapie und kardiovaskuläre Konsequenzen
 Obstruktive Schlafapnoe: Risikofaktoren, Therapie und kardiovaskuläre Konsequenzen Bernd Sanner Agaplesion Bethesda Krankenhaus Wuppertal Schlafapnoe - Epidemiologie 2-4% der erwachsenen Bevölkerung sind
Obstruktive Schlafapnoe: Risikofaktoren, Therapie und kardiovaskuläre Konsequenzen Bernd Sanner Agaplesion Bethesda Krankenhaus Wuppertal Schlafapnoe - Epidemiologie 2-4% der erwachsenen Bevölkerung sind
2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose
 2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose Botulinumtoxin und Multiple Sklerose Johann Hagenah Die Geschichte des Botulinumtoxins 1817 Justinus Kerner publiziert in den Tübinger Blättern für
2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose Botulinumtoxin und Multiple Sklerose Johann Hagenah Die Geschichte des Botulinumtoxins 1817 Justinus Kerner publiziert in den Tübinger Blättern für
Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm. Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr
 Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr Liebe Patienten, in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an ständigem Harndrang,
Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr Liebe Patienten, in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an ständigem Harndrang,
Überschrift/Titel der Folie
 Überschrift/Titel der Folie Text kleiner, Aufzählungszeichen Bearbeitungshinweise (bitte anschließend entfernen): Thema, Ort, Referent und Abteilung sind veränderbar über: Ansicht -> Master -> Folienmaster
Überschrift/Titel der Folie Text kleiner, Aufzählungszeichen Bearbeitungshinweise (bitte anschließend entfernen): Thema, Ort, Referent und Abteilung sind veränderbar über: Ansicht -> Master -> Folienmaster
Deutsche Multicenter-Studien erforschen die Wirksamkeit der Psychotherapie chronischer Depression und ihre neurobiologischen Wirkmechanismen
 UniversitätsKlinikum Heidelberg Heidelberg, den 31. Juli 2012 PRESSEMITTEILUNG Deutsche Multicenter-Studien erforschen die Wirksamkeit der Psychotherapie chronischer Depression und ihre neurobiologischen
UniversitätsKlinikum Heidelberg Heidelberg, den 31. Juli 2012 PRESSEMITTEILUNG Deutsche Multicenter-Studien erforschen die Wirksamkeit der Psychotherapie chronischer Depression und ihre neurobiologischen
Das Alter hat nichts Schönes oder doch. Depressionen im Alter Ende oder Anfang?
 Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Die Harninkontinenz. Inhalt
 Die Harninkontinenz Inhalt Die Formen der Harninkontinenz Die Dranginkontinenz Die Stress- bzw. Belastungsinkontinenz Die Mischinkontinenz Die Elektrostimulation der Beckenbodenmuskulatur Die Behandlung
Die Harninkontinenz Inhalt Die Formen der Harninkontinenz Die Dranginkontinenz Die Stress- bzw. Belastungsinkontinenz Die Mischinkontinenz Die Elektrostimulation der Beckenbodenmuskulatur Die Behandlung
Die überaktive Blase. Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier
 Die überaktive Blase Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier Überaktive Blase 1. Definition und Ursachen Definition International Continence Society ICS 2002: Überaktive Blase ÜAB Overactive Bladder OAB
Die überaktive Blase Gerald Fischerlehner Franz Roithmeier Überaktive Blase 1. Definition und Ursachen Definition International Continence Society ICS 2002: Überaktive Blase ÜAB Overactive Bladder OAB
Anatomischer Aufbau der Wirbelsäule Bandscheibenvorfall
 Anatomischer Aufbau der Wirbelsäule Bandscheibenvorfall Definition, Ursachen, Ausprägung, Häufigkeit Symptome Diagnostik Therapie Pflege bei konservativer Therapie Bandscheibenoperation Prae- und postoperative
Anatomischer Aufbau der Wirbelsäule Bandscheibenvorfall Definition, Ursachen, Ausprägung, Häufigkeit Symptome Diagnostik Therapie Pflege bei konservativer Therapie Bandscheibenoperation Prae- und postoperative
Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren. Dr. Nicole Lövin
 Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren Dr. Nicole Lövin Quellenangaben Guidelines der European Association of Urology (EAU, 2013) Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Weibliche Belastungsinkontinenz- Update Behandlungsverfahren Dr. Nicole Lövin Quellenangaben Guidelines der European Association of Urology (EAU, 2013) Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Genetische Unterschiede beeinflussen die Wirkung von Anti-Brechmitteln
 Chemotherapie: Wenn die Übelkeit nicht aufhört Genetische Unterschiede beeinflussen die Wirkung von Anti-Brechmitteln Heidelberg (4. Januar 2011) Häufige Nebenwirkungen einer Chemotherapie sind Übelkeit
Chemotherapie: Wenn die Übelkeit nicht aufhört Genetische Unterschiede beeinflussen die Wirkung von Anti-Brechmitteln Heidelberg (4. Januar 2011) Häufige Nebenwirkungen einer Chemotherapie sind Übelkeit
Wenn die Blase das Leben bestimmt Für viele ist Hilfe möglich!
 Teil 1: Interview mit Dr. Ulrike Hohenfellner Wenn die Blase das Leben bestimmt Für viele ist Hilfe möglich! Ursula K. muss sich beeilen. Der Bus steht bereits an der Haltestelle wenn sie jetzt nicht anfängt
Teil 1: Interview mit Dr. Ulrike Hohenfellner Wenn die Blase das Leben bestimmt Für viele ist Hilfe möglich! Ursula K. muss sich beeilen. Der Bus steht bereits an der Haltestelle wenn sie jetzt nicht anfängt
Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen?
 Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen? von Priv.-Doz. Dr. med. Ingo Füsgen GOVI Govi-Verlag Einführung 9 Anatomische und physiologische Vorbemerkungen 11 Die Harnblase - Aufbau und Funktion
Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen? von Priv.-Doz. Dr. med. Ingo Füsgen GOVI Govi-Verlag Einführung 9 Anatomische und physiologische Vorbemerkungen 11 Die Harnblase - Aufbau und Funktion
Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt
 Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Miktionsanamnese Begleiterkrankungen Miktionsanamnese Trink- und Essgewohnheiten
Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Miktionsanamnese Begleiterkrankungen Miktionsanamnese Trink- und Essgewohnheiten
BECKENBODEN- KONTINENZ- & ZENTRUM ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR
 ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR KONTINENZ- & BECKENBODEN- ZENTRUM WILLKOMMEN Über uns Der Beckenboden ist für die Funktion von Blase und Darm von entscheidender Bedeutung. Geburten, Bindegewebsschwäche,
ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR KONTINENZ- & BECKENBODEN- ZENTRUM WILLKOMMEN Über uns Der Beckenboden ist für die Funktion von Blase und Darm von entscheidender Bedeutung. Geburten, Bindegewebsschwäche,
Malnutrition und Indikation von enteraler Ernährung über PEG-Sonden aus Sicht der Altersmedizin (Geriatrie)
 Malnutrition und Indikation von enteraler Ernährung über PEG-Sonden aus Sicht der Altersmedizin (Geriatrie) Fachtagung Ernährung in der stationären Altenpflege - zwischen Wunschkost und Sondennahrung -
Malnutrition und Indikation von enteraler Ernährung über PEG-Sonden aus Sicht der Altersmedizin (Geriatrie) Fachtagung Ernährung in der stationären Altenpflege - zwischen Wunschkost und Sondennahrung -
Hoher Blutdruck Gut zu wissen
 CaritasKlinikum Saarbrücken Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität des Saarlandes PATIENTENINFORMATION Hoher Blutdruck Gut zu wissen 2 Verfasser Chefarzt Dr. med. Andreas Schmitt Hypertensiologe
CaritasKlinikum Saarbrücken Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität des Saarlandes PATIENTENINFORMATION Hoher Blutdruck Gut zu wissen 2 Verfasser Chefarzt Dr. med. Andreas Schmitt Hypertensiologe
BECKENBODENZENTRUM TÜV WIR SORGEN FÜR SIE. Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf. geprüft
 BECKENBODENZENTRUM Behandlungspfad Zertifizierter TÜV geprüft Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf WIR SORGEN FÜR SIE Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf
BECKENBODENZENTRUM Behandlungspfad Zertifizierter TÜV geprüft Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf WIR SORGEN FÜR SIE Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KARDIOLOGIE HERZ- UND KREISLAUFFORSCHUNG e.v. German Cardiac Society
 Die Herz-Magnet-Resonanz-Tomographie kann Kosten um 50% senken gegenüber invasiven Tests im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit: Resultate von
Die Herz-Magnet-Resonanz-Tomographie kann Kosten um 50% senken gegenüber invasiven Tests im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit: Resultate von
Krankenhauseinweisungen, Pflegeheimaufnahmen) und für die Mortalität (3) der Betroffenen. Zahlreiche neue Erkenntnisse,
 Deutsches Ärzteblatt Online vom 30.07.2010 -Publikation / täglich, Köln Rubrik Visits 865.338 Reichweite 28.845 Anzeigenäquivalenz 80 EUR Harninkontinenz im Alter: Teil 3 der Serie Inkontinenz Goepel,
Deutsches Ärzteblatt Online vom 30.07.2010 -Publikation / täglich, Köln Rubrik Visits 865.338 Reichweite 28.845 Anzeigenäquivalenz 80 EUR Harninkontinenz im Alter: Teil 3 der Serie Inkontinenz Goepel,
Frauengesundheit. Umfrage unter 150 führenden Spezialisten
 Frauengesundheit Umfrage unter 150 führenden Spezialisten Zielsetzung Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) hat das Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie
Frauengesundheit Umfrage unter 150 führenden Spezialisten Zielsetzung Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) hat das Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie
Unentspannt? Besser bestens entspannt. Fragen Sie Ihren Arzt! Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase
 Unentspannt? Fragen Sie Ihren Arzt! Besser bestens entspannt. Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase Die überaktive Blase Liebe Leserinnen, liebe Leser, Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit
Unentspannt? Fragen Sie Ihren Arzt! Besser bestens entspannt. Ihr Patientenratgeber bei überaktiver Blase Die überaktive Blase Liebe Leserinnen, liebe Leser, Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit
Die Prostata Erkrankungen und Behandlungsmoglichkeiten
 Die Prostata Erkrankungen und Behandlungsmoglichkeiten von Prof. Dr. med. Hubert Frohmuller Direktor der Urologischen Klinik und Poliklinik der Universitat Wurzburg Dr. med. Matthias Theifl Oberarzt der
Die Prostata Erkrankungen und Behandlungsmoglichkeiten von Prof. Dr. med. Hubert Frohmuller Direktor der Urologischen Klinik und Poliklinik der Universitat Wurzburg Dr. med. Matthias Theifl Oberarzt der
Inkontinenz. Marian van der Weide. Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen. Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle
 Marian van der Weide Inkontinenz Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen Aus dem Niederländischen von Martin Rometsch Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis Geleitwort 11
Marian van der Weide Inkontinenz Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen Aus dem Niederländischen von Martin Rometsch Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis Geleitwort 11
Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig?
 13. Bamberger Gespräche 2009 Thema: Harninkontinenz und Sexualität Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig? Von Hofr. Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg (5. September 2009) - Unfreiwilliger
13. Bamberger Gespräche 2009 Thema: Harninkontinenz und Sexualität Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig? Von Hofr. Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg (5. September 2009) - Unfreiwilliger
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie
 Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Parkinson und Kreislaufprobleme
 Parkinson und Kreislaufprobleme Referent: Dr. Gabor Egervari Leiter der Kardiologie, Klinik für Innere Medizin Übersicht 1. Ursachen für Kreislaufprobleme bei M. Parkinson 2. Diagnostische Maßnahmen bei
Parkinson und Kreislaufprobleme Referent: Dr. Gabor Egervari Leiter der Kardiologie, Klinik für Innere Medizin Übersicht 1. Ursachen für Kreislaufprobleme bei M. Parkinson 2. Diagnostische Maßnahmen bei
Cikatridina. Stoppt die vaginale Dürre. Zur vaginalen Anwendung bei Scheidentrockenheit. Hormonfrei! Rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhältlich.
 Hormonfrei! Zur vaginalen Anwendung bei Scheidentrockenheit. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhältlich. Viele Frauen, auch junge, leiden an vaginaler Trockenheit. In der Scheide wird nicht genügend Feuchtigkeit
Hormonfrei! Zur vaginalen Anwendung bei Scheidentrockenheit. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhältlich. Viele Frauen, auch junge, leiden an vaginaler Trockenheit. In der Scheide wird nicht genügend Feuchtigkeit
