Sportmedizin und Sporttraumatologie. Médecine et de traumatologie du sport. Medicina e traumatologia dello sport 4/03. rubmedia
|
|
|
- Fritzi Arnold
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie Revue suisse de Médecine et de traumatologie du sport Rivista svizzera di Medicina e traumatologia dello sport 4/03 Offizielles Organ rubmedia Volume 51 ISSN Redaktion: Boutellier U., Zürich Frey W. O., Zürich Ménétrey J., Genève
2 Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie» 51 (4)/ Inhalt / Sommaire Originalartikel Michael Angermann, Christoph Lehmann, Hans Hoppeler, Christoph Däpp, Oberkörperergometrie: Michael Vogt spezifische Leistungsdiagnostik für Langläufer und Nordisch-Kombinierer Beat Knechtle, Yves Marchand Schwankungen des Körpergewichts und der Hautfaltendicke bei einem Athleten während eines Extremausdauerwettkampfes Beat Knechtle, Jürgen Zapf, Daniel Zwyssig, Kurt Lippuner, Hans Hoppeler Energieumsatz und Muskelstruktur bei Langzeitbelastung: eine Fallstudie Michael Vogt, Christoph Däpp, Jürg Blatter, Reto Weisskopf, Guido Suter, Hans Hoppeler Training zur Optimierung der Dosierung exzentrischer Muskelaktivität Dopinginfo Matthias Kamber Informationen aus der Fachkommission für Dopingbekämpfung (FDB) / Informations de la Commission technique de lutte contre le dopage (CLD) Info Kongresse / Congrès Kongresskalender / Calendrier des congrès V orschau / Préavis / Preavviso / Preview Themen der nächsten Nummern Nummer Schwerpunktthema Artikel einzureichen bis Erscheinungsdatum 1/2004 Sporttraumatologie (vgl. S. 191) 1. Januar 2004 März /2004 Sportpsychologie/-soziologie 1. April 2004 Juni /2004 SGSM-Kongress 1. Juli 2004 September /2004 Sportphysiologie 1. Oktober 2004 Dezember 2004 Artikel sind einzureichen an Prof. U. Boutellier, Sportphysiologe, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich Titelfoto: Michael Vogt, Testtage im Juni 2003 auf dem Titlis Impressum: Sekretariat und Administration: Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie», Postfach 408, CH-3000 Bern 25, Telefon , Telefax , barbara.buehlmann@bbscongress.ch, und Annoncen / Produktion: Rub Media AG, Druckerei, Postfach, CH-3001 Bern, Telefon , Fax Herstellung: info@rubmedia.ch Inserate: presseverlag@rubmedia.ch
3 168 Originalartikel Angermann M. et al. Michael Angermann, Christoph Lehmann, Hans Hoppeler, Christoph Däpp, Michael Vogt Anatomisches Institut der Universität Bern Oberkörperergometrie: spezifische Leistungsdiagnostik für Langläufer und Nordisch-Kombinierer Zusammenfassung Wir entwickelten ein neues langlaufspezifisches Oberkörperergometer, um die Ausdauerleistungsfähigkeit und die auftretenden Stockkräfte während der Doppelstockbewegung zu untersuchen. Ziel der Studie war es, ein Testprotokoll zu etablieren, mit dem man genau und reproduzierbar die langlaufspezifische Oberkörperleistungsfähigkeit messen kann. 9 trainierte Probanden, die mit der Doppelstocktechnik gut vertraut waren, nahmen an der Studie teil. Sie absolvierten 2 Stufentests mit maximaler Ausbelastung innerhalb von 2 Wochen. Die Maximal- und Submaximalwerte für Herzfrequenz, Ventilation, Sauerstoffaufnahme, Blutlaktatkonzentration sowie die maximale Leistungsfähigkeit zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen Test und Retest. Der Variationskoeffizient (V ) war bei submaximalen Belastungen grösser (5,0 12,9%) als bei Ausbelastung (2,5 9,4%). Keine statistisch signifikanten Unterschiede liessen sich bei den biomechanischen Parametern der Doppelstockbewegung (Maximalkraft, Stossfrequenz, Zeit bis Kraftmaximum, Stosszeit) nachweisen. Die Reproduzierbarkeit der Kraftmessung ist aber geringer (V =7,3 14,7%) als die der physiologischen Messungen. Die Studie zeigte, dass mit dem Langlaufergometer reproduzierbare Messungen der Maximalwerte gemacht werden können. Die physiologischen Submaximalwerte scheinen von der Stosstechnik abhängig zu sein. Summary To test endurance performance and poling forces during double poling, we developed a new upper body ski ergometer. The aim of this study was to establish a reliable and valid protocol to test cross-country specific upper body power. 9 trained subjects familiar with double poling participated in the study. Within 2 weeks they did 2 graded tests to exhaustion. The maximal and submaximal values for heart rate, ventilation, oxygen consumption and blood lactate concentration did not differ significantly between test and retest. The coefficient of variation (V ) was higher during submaximal exercise ( %) than at exhaustion ( %). We did not find any statistically significant difference between the tests for the biomechanical parameters (peak force, time to peak force, poling time, and poling rate). Over all, the reproducibility of the force measurements is smaller (V = %) than that of the physiological measurements. The study showed that we are able to accurately measure peak values with the ski ergometer. However, at submaximal exercise the physiological measurements seem to depend on the poling technique. Key words: performance testing, cross-country skiing, upper body ergometry, poling force Schlüsselwörter: Leistungsdiagnostik, Skilanglauf, Oberkörperergometrie, Stockkraft Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie» 51 (4), , 2003 Einleitung Verschiedene leistungsdiagnostische Verfahren und Testprotokolle kommen im Skilanglauf zur Anwendung [4]. Man unterscheidet dabei grob zwischen Feld- und Labortests. Labortests haben den Vorteil, dass sie unter kontrollierten, standardisierten Umgebungsbedingungen durchgeführt werden können. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um gültige Aussagen über den Trainingszustand eines Athleten machen zu können. Zur Testung der Ausdauerleistungsfähigkeit von Langläufern werden im Labor in ersten Linie Laufbandtests durchgeführt. Die Langlauftechnik zeichnet sich durch einen grossen muskulären Ganzkörpereinsatz aus, resultierend in einer hohen maximalen Sauerstoffaufnahme (V O 2max ). Die technische und sportmotorische Entwicklung im Skilanglauf deutet auf eine immer wichtiger werdende Oberkörperleistungsfähigkeit (OKL) hin [8, 9, 16]. Die Vortriebsleistung durch den Oberkörpereinsatz beträgt 50% und mehr [14]. Speziell für Nordisch-Kombinierer ist es effizient, die OKL zu steigern, weil dadurch das skisprungspezifische Training der Beinmuskulatur (Explosivkraft) am wenigsten gestört wird. Verschiedene Arbeiten konnten zeigen, dass die aerobe und anaerobe OKL, gemessen im Feld oder im Labor auf spezifischen Langlaufergometern, eine sehr gute Voraussage über die Langlaufleistung ermöglicht [1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 15]. Ein hohes Verhältnis der maximalen Sauerstoffaufnahme des Oberkörpers (V O 2peak ) in Bezug auf die (Gesamtkörper-) V O 2max ist eine Leistungsvoraussetzung für den erfolgreichen Langläufer [6]. Eine ausgeprägt hohe aerobe und anaerobe OKL (Rumpf und Arme) ist deshalb für Langläufer von grösster Bedeutung. Zur Messung der OKL wurden bisher verschiedenste sportartspezifische Testgeräte und Prototypen eingesetzt [1, 3, 9, 16]. Mit dem Ziel, die langlaufspezifische OKL möglichst realistisch messen zu können, bauten wir ein spezielles Oberkörper-Langlaufergometer (OLE). Unseres Wissens ist weltweit derzeit nur ein vergleichbares Langlaufergometer im Einsatz [16]. Ziel dieser Arbeit ist es, ein reliables und valides Testprotokoll für die Bestimmung
4 Oberkörperergometrie: spezifische Leistungsdiagnostik für Langläufer und Nordisch-Kombinierer 169 der OKL zu etablieren. Anhand von physiologischen und biomechanischen Messungen wurde die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse bei maximalen und submaximalen Belastungen überprüft. Methode und Material Abbildung 1: Ergometer zur Bestimmung der langlaufspezifischen Oberkörperleistungsfähigkeit. Modifiziertes Fahrradergometer zur Belastungssteuerung (A), Kettensystem mit Führungsschienen (B) und pneumatisches Brems- und Rückstosssystem (C). A B A 1 B 2 3 C Probanden. Die Probandengruppe bestand aus 8 Männern und einer Frau (Alter 28 ± 6 Jahre, Gewicht 75 ± 6 kg). Alle Probanden waren trainiert und mit der Doppelstocktechnik gut vertraut, aber nur 6 der 9 Testpersonen bestritten regelmässig Langlaufwettkämpfe. Langlaufergometer. Die Funktionsweise des OLE besteht darin, dass der Athlet mittels Doppelstock-Stosstechnik über zwei unabhängige Schlitten ein Kettensystem antreibt. Dieses ist an ein elektromagnetisch gebremstes Schwungrad (Ergoracer, Kettler, Deutschland) gekoppelt, über welches die Belastung gesteuert wird (Abb. 1). Die Schlitten gleiten, gelagert auf zwei Führungsschienen, praktisch widerstandslos. Durch die Trägheit des Schwungrades bleibt das System Schwungrad/Antriebskette auch während der Vorschwungphase in Bewegung und simuliert so den Vortrieb auf Schnee. Zur Überwindung des mechanischen Gerätewiderstandes treibt ein elektrischer Motor zusätzlich die Antriebskette an. Da die Schlitten (Abb. 2, linkes Bild) eine gewisse Masse (~700 g) haben, ist es notwendig, diese am Ende des Stosses zu bremsen und wieder zu beschleunigen. Ohne Bremssystem würde die Muskulatur am Stossende exzentrisch belastet, und es wäre kaum möglich, eine bei hohen Belastungen erforderliche hohe Kadenz aufrecht zu erhalten. Deshalb verwenden wir am OLE ein pneumatisches Brems- und Rückstosssystem (Abb. 2, rechtes Bild). Es besteht aus 2 Bolzen, die den linken und rechten Schlitten am Ende des Stosses abfangen und wieder nach vorne beschleunigen. Das Bremssystem wird mit Druckluft (8 bar) aus einer Pressluftflasche gespeist. Über 2 Kontakte, die der Schlitten beim Nach-vorne- bzw. Nach-hinten-Gleiten auslöst, werden die Bolzen entweder entlüftet (bremsen) oder belüftet (beschleunigen). Durch die Verwendung dieses Bremssystems wirkt der Doppelstockstoss am OLE sehr realitätsnah. An den Stockenden sind eindimensionale Kraftaufnehmer (DMS U9B, Hottinger Baldwin Messtechnik, Deutschland) angebracht. Die Daten der Stockkräfte werden über einen Messwandler (Spider8, Hottinger Baldwin Messtechnik, Deutschland) direkt auf den Computer übertragen. Zu Beginn jedes Tests wurden die Messdosen mittels der Software (catman 3.1, Hottinger Baldwin Messtechnik, Deutschland) kalibriert. Untersuchung. Jeder Proband absolvierte 2 Tests innerhalb von 2 Wochen. Zu Beginn des 1. Tests durften sich die Probanden für etwa 10 min bei einer niederen Belastung an das OLE gewöhnen. Die Stocklänge wurde individuell bestimmt und entspricht in etwa derjenigen bei der klassischen Technik. Testprotokoll. Bewährt hat sich ein Stufenprotokoll bis zur Ausbelastung. Nach einer 2-minütigen Ruhephase folgte eine 3-minütige Aufwärmphase auf der ersten Belastungsstufe. 7 Männer begannen bei 50 W, die Frau und ein Mann bei 25 W. Nach der Aufwärmperiode startete der eigentliche Test. Die Stufendauer betrug 2,5 min, wobei nach jeder Belastungsstufe eine 30-sec- Messpause für die kapilläre Blutentnahme am Ohr und die Bestimmung des subjektiven Belastungsempfindens nach Borg folgte. Das Stufeninkrement lag bei 25 W. Die Probanden hatten die Aufgabe, während des ganzen Tests eine konstante Kettengeschwindigkeit zwischen 11 und 14 km/h aufrecht zu erhalten. Testabbruch erfolgte bei subjektiver Erschöpfung bzw. wenn die Kettengeschwindigkeit nicht mehr gehalten werden konnte. 2 min nach Testabbruch erfolgte eine letzte Laktatbestimmung. Messungen. Bestimmt wurden die maximalen und submaximalen Werte der Respirationsparameter (K4b 2, Cosmed, Italien), des Blutlaktats (Lactate Pro, Axon Lab, Schweiz), der Herzfrequenz (Sport-Tester und S810, Polar, Finnland), des subjektiven Belastungsempfindens nach Borg (RPE 6-20) und der Stockkraft. Die Kraftmessung erfolgte auf jeder Stufe über 30 sec, beginnend 1 min vor Stufenende. Zur Ermittlung des durchschnittlichen Kraft-Zeit-Verlaufs pro Belastungsstufe wurden alle Stösse jedes Messintervalls gemittelt. Zusätzlich wurde die maximale Stockkraft (F peak ), die Zeit bis zum Kraftmaximum (TTP), die Stosszeit (t stoss ), die Zeit für einen ganzen Bewegungszyklus (t zykl ), die Zeit für das Nach-Vorne-Holen der Arme (t relax ) und die Stossfrequenz (f) bestimmt. Statistik. Die Resultate sind als Mittelwerte (± Standardabweichung) angegeben. Als Mass für die Streuung wird der Variationskoeffizient (in Prozent) angegeben. Die Daten der Kraftmessung und die physiologischen Submaximalwerte wurden für die Belastungsstufen zwischen 50 und 175 W ausgewertet. Zum Vergleich der submaximalen Kurvenverläufe berechneten wir die Fläche unter den Kurven. Unterschiede zwischen den Tests sind mit dem gepaarten t-test auf ihre Signifikanz überprüft worden. Zusammenhänge zwischen Test und Retest berechneten wir über alle vollständig absolvierten Belastungsstufen und werden mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten dargestellt. Das Signifikanzniveau lag bei p < Für eine Testperson konnten aufgrund technischer Probleme die Respirationswerte nicht für die Auswertung verwendet werden. Die statistische Auswertung erfolgte unter Verwendung einer geeigneten Software (Statistica 6.1, StatSoft, USA). Resultate Abbildung 2: Das linke Bild zeigt den Schlitten, der den Stock mit dem Kettensystem verbindet; Kraftmessdose (A), Koppelung Stock-Kette mittels Zahnrad (B). In der rechten Abbildung ist das pneumatische Brems- und Rückstosssystem dargestellt. Kontaktstellen für Belüftung und Entlüftung (1), Bolzen (2) und Luftzuleitung mit Reduzierventil (3). Physiologische Messung. Bei den Maximalwerten gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen Test und Retest (Tab. 1). Der Variationskoeffizient (V ) für die maximale Leistungsfähigkeit (P max ), die maximale Herzfrequenz (Hf peak ) und V O 2peak ist klein (~2.5%), wohingegen die maximale Ventilation (Ve peak ) und das Maximallaktat (La peak ) eine stärkere Streuung aufweisen (V = 6.4 bzw. 9,4%).
5 170 Angermann M. et al. Test Retest Differenz (%) V r P max (W/kg) 2.61 (0.6) 2.66 (0.6) VO 2peak (ml/min/kg) 44.8 (5.3) 43.6 (4.2) Hf peak (1/min) 178 (12) 179 (9) Ve peak (l/min) 147 (26) 155 (22) La peak (mmol/l) 9.8 (2.3) 10.4 (1.5) Mittelwert ( ' SD), V (Variationskoeffizient), r (Korrelationskoeffizient), p<0.01, p<0.05, p=0.053, n=8 (VO 2peak : n=7 wegen einer fehlerhaften Kalibrierung des O 2 -Sensors) Tabelle 1: Darstellung der physiologischen Maximalwerte (Test Retest). Im submaximalen Bereich zeigen sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den Tests. Wir finden aber, dass beim Retest die O 2 -Kurve eine tendenzielle Verschiebung nach unten aufweist (p = 0.052). Bei der Auswertung aller vollständig absolvierten Belastungsstufen finden wir einen engen signifikanten Zusammenhang (p < 0.01) für V O 2 : r = 0.95, Hf: r =0.93 und La: r = 0.95 (Abb. 3), sowie für Ve: r=0.93 und RPE: r = 0.96 zwischen Test und Retest. Im Submaximalbereich streuen die Werte mehr als bei den Maximalwerten (V O 2 : V = 5.0%, Ve: V = 6.0%, La: V = 12.9%, Hf: V = 4.8%). Kraftmessung. Die biomechanische Analyse des Stockstosses zeigt im Stufentest folgendes Bild am Beispiel einer Versuchsperson (Abb. 4): F peak steigt im submaximalen Bereich linear zur Belastung an, erhöht sich aber im Bereich der Ausbelastung kaum mehr. f wird bei niederen Belastungen nur geringfügig gesteigert. Mit zunehmender Belastung ( anaerobe Schwelle) wird sie aber immer mehr erhöht und erreicht ihr Maximum bei Belastungsabbruch. t zykl und t relax nehmen im Verlauf des Tests stetig ab. Nahezu unverändert über alle Belastungsstufen bleiben TTP und t stoss. Im Mittel zeigen sich keine signifikanten Veränderungen zwischen Test und Retest (Tab. 2). Die Streuung zwischen den beiden Tests ist aber relativ gross, was sich in hohen Variationskoeffizienten (7,3 14,7%) ausdrückt. Wir finden hohe Korrelationen (p < 0.01) für F peak (r = 0.90), t zykl (r = 0.88) und t relax (r = 0.91). Schwächere Zusammenhänge (p < 0.01) findet man für TTP (r = 0.60), f (r = 0.69) und t stoss (r = 0.54). N sec Fpeak f (1/min) A Test B y = x r=0.93, p< y = x r=0.95, p< y = x r=0.95, p< Test 1 Abbildung 3: Test-Retest-Korrelationen für alle V O 2 -Werte [ml/min] (A), Hf-Werte [1/min] (B) und Laktatkonzentrationen [mmol/l] (C). Test 1 ist jeweils auf der x-achse aufgetragen, Test 2 auf der y-achse C Abbildung 4: Beispiel einer Versuchsperson für die zeitliche und dynamische Gestaltung des Stockstosses bei unterschiedlichen Belastungen ( W). Der Proband erreichte eine maximale Leistung von 248 W. Maximale Stockkraft (F peak ), Stossfrequenz (f), Zeit für einen Bewegungszyklus (t zykl ), Zeit für das Nach-vorne-Holen der Arme (t relax ). Diskussion tzykl trelax Watt Proband: S.C. Physiologische Messung Allgemein. Das OLE ermöglicht die Durchführung einer standardisierten, langlaufspezifischen Oberkörperergometrie. Die Untersuchung zeigt, dass mit dem verwendeten Testprotokoll physiologische und biomechanische Daten reproduzierbar bestimmt werden können.
6 Oberkörperergometrie: spezifische Leistungsdiagnostik für Langläufer und Nordisch-Kombinierer 171 Tabelle 2: Darstellung der Kraftwerte im Submaximalbereich (Test Retest). Reliabilität. Die Unterschiede zwischen Test und Retest sind für V O 2peak, P max und Hf peak statistisch nicht signifikant. Ein V von 2,3% für V O 2peak ist mit Werten vergleichbar, die Wisloff and Helgerund [16] gefunden haben (V ~2,5%). Grössere, statistisch aber ebenfalls nicht signifikante Test-Retest-Differenzen findet man für Ve peak und die maximale Laktatkonzentration. Dies kann auf eine unterschiedlich hohe Ausbelastung einzelner Testpersonen zurückgeführt werden. Erklären kann man diesen Umstand dadurch, dass sich einige Probanden beim 2. Test subjektiv besser fühlten und mit dem OLE besser vertraut waren. Ebenso schien die Herausforderung, das vorhergegangene Testresultat zu übertreffen, die Probanden zusätzlich zu motivieren. Die Variabilität wird bestimmt durch verschiedene nicht kontrollierbare Grössen wie z.b. die Tagesverfassung des Athleten oder die Messgenauigkeit des Gasanalysators. Unter der Berücksichtigung der biologischen und technischen Variabilität schliessen wir aus unseren Daten, dass man mit dem OLE exakt und reproduzierbar messen kann. Vergleicht man die beiden Tests über alle Belastungsstufen, findet man für alle physiologischen Parameter eine hohe Korrelation (r > 0.90, p < 0.01). Bei einer Belastung über 100 W zeigt sich aber bei Test 2 aufgrund eines geringeren V O 2 ( 5%) eine Tendenz zu einer verbesserten Effizienz. Dies kann mit einer Veränderung der Stosstechnik zusammenhängen (siehe Diskussion der Kraftdaten). Wir konnten feststellen, dass die Probanden unterschiedliche Stossstrategien wählen. Diese haben speziell bei submaximalen Belastungen direkten Einfluss auf die physiologischen Werte wie z.b. die V O 2. Es ist biomechanisch günstiger, bei F peak einen kleineren Einsteckwinkel zu haben. Dadurch wirkt ein grösserer Teil der aufgewendeten Kraft als Vor- bzw. Antrieb, und der Proband stösst somit ökonomischer. Verändert ein Proband seine Stosstechnik von Test zu Test sehr stark, muss man die physiologischen Submaximalwerte kritisch auf ihre Vergleichbarkeit hin betrachten. Andererseits ist es dadurch möglich, mit dem OLE die Stosseffizienz gezielt zu optimieren. Wisloff and Helgerund [16] führten bei ihrer Validierungsstudie für ein OLE 3 Tests durch. Sie fanden keinen signifikanten Zusammenhang für die V O 2 bei submaximalen Belastungen zwischen Test 1 und 3, aber zwischen Test 2 und 3. Daraus schlussfolgerten sie, dass es durch den 1. Test zu einem Lerneffekt kam, der speziell die Resultate des 2. Tests beeinflusste. Die Erfahrungen unserer Probanden mit dem OLE waren unterschiedlich. Wir können nicht ausschliessen, dass ein Lerneffekt (stosstechnische Anpassung) auftrat und empfehlen daher, vor dem erstmaligen Gebrauch des Gerätes eine Testgewöhnung durchzuführen. Validität. Um die Validität der Messungen am OLE zu überprüfen, müsste man korrekterweise Vergleichsmessungen im Feld auf Schnee bzw. mit Rollski durchführen. Solche Vergleiche wurden aber im Rahmen dieser Studie nicht angestellt. Wisloff and Helgerund [16] überprüften ihre Ergebnisse am OLE mittels eines Doppelstocktests auf Schnee. Sie stellten keine signifikanten Unterschiede für V O 2peak und La peak fest. Signifikante Unterschiede fanden sie aber für V e peak und Hf peak, die sie auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Temperatur) bzw. Messapparaturen für die Gasanalyse zurückführten. Andere Arbeitsgruppen fanden höhere Werte für V O 2peak (ml/kg/ min) 63.2 [16], [17], [1], [9] als wir in unserer Studie (~44). Ein Grund für die niedrigeren Werte in unserer Studie könnte sein, dass unsere Probanden im Kollektiv schlechter trainiert waren. Ein anderer Grund könnte in der Verwendung unterschiedlicher Stosstechniken liegen. In der Praxis kann man grundsätzlich 2 verschiedene Stosstechniken ausmachen: 1. niederfrequentes Stossen mit geringem Beineinsatz und vollständigem Armeinsatz (-schwung) nach hinten und 2. hochfrequentes Stossen mit deutlicher Hoch-Tief-Bewegung und unvollständigem Armeinsatz. Diese Techniken unterscheiden sich besonders in der Grösse der aktiven Muskelmasse. Je mehr Muskelmasse beim Stossen involviert ist (Technik 2), desto höher ist V O 2peak. Im weiteren vermuten wir, dass unser Testprotokoll (hohes Stufeninkrement mit relativ kurzer Stufendauer) dazu führte, dass die Probanden aufgrund vorzeitiger muskulärer Erschöpfung, kardiorespiratorisch nicht völlig ausbelastet wurden. Dies kann man an den tieferen Ve max Werten (151 l/min vs [16], 190 [17], [9]) und Hf max Werten (179 1/min vs. 189 [16], 188 [17], 177 [1], 183 [9]) im Vergleich zu anderen Studien sehen. Im Gegensatz dazu ist die maximale Laktatkonzentration (mmol/l) in unserer Studie höher (10.1 vs. 6.8 [16], 7.0 [17]), was auf eine hohe lokale Muskelbeanspruchung und eine ausgeprägte Aktivierung des anaeroben Stoffwechsels schliessen lässt. Auf der anderen Seite er-
7 172 Angermann M. et al. reicht man durch ein hohes Stufeninkrement höhere Werte für P max (W), was sich im Vergleich zu anderen Studien bestätigt (205 vs [16], [1]). Wir spekulieren, dass es dadurch zu einer langandauernden, hohen Muskelanspannung und folglich zu einer peripheren O 2 -Transportlimitierung kommt, was auch mit den Befunden von Wisloff and Helgerund [17] übereinstimmt. Im Gegensatz dazu berichten Mygind et al. [9] von P max -Werten zwischen W zugleich mit den höchsten Werten für V O 2peak Stosszeit TTP Zykluszeit Relaxationszeit Kraftmessung Allgemein. Die Messung der Stosskraft ermöglicht die biomechanische Analyse der Doppelstockbewegung. Gemäss subjektiver Einschätzung durch Athleten und Trainer kann der Doppelstockstoss auf dem OLE realitätsnah simuliert werden. Einzig das raumgreifende Einstecken der Stöcke, bei dem man versucht, den Schwerpunkt zu Beginn des Stosses vor die Füsse zu bekommen, stellte sich als koordinativ schwierig heraus. Zu Beginn der Stossbewegung entsteht durch die Trägheit des Kettensystems und der Kraftübertragung vom Rumpf auf die Arme eine exzentrische Belastung der Ellbogenstreck- und Schultergürtelmuskulatur. Deshalb verspürten einige Probanden nach erstmaliger Testdurchführung einen Muskelkater. Reliabilität. Die zu erbringende Leistung wird über ein handelsübliches, umgebautes Fahrradergometer gesteuert. Dies geschieht, indem das Schwungrad des Fahrradergometers mit dem Kettensystem des OLE verbunden ist. Da aber das gesamte Antriebssystem einen umdrehungsabhängigen Eigenwiderstand hat und sich dieser von Test zu Test theoretisch verändern kann (z.b. über die Kettenspannung), stimmt die angezeigte Belastung am Display des Fahrradergometers nicht mit der effektiven Belastung überein. Durch den Einsatz eines Elektromotors, der den mechanischen Eigenwiderstand des OLE überwindet und über ein Reglersystem kontrolliert wird, konnte dieses Problem behoben werden. Die Genauigkeit der Belastungssteuerung wurde mittels Summation aller positiven Kraftwerte pro Belastungsstufe geteilt durch die Messdauer (30 sec) ermittelt. Im Mittel veränderte sich dieser Wert praktisch nicht (Test 1: 1997, Test 2: 1981; V = 7,5%). Wir können daraus schliessen, dass die Belastungssteuerung mit dem gewählten System genau und reproduzierbar ist. Die anderen Werte der Kraftmessung (F peak, TTP, f, t stoss und t relax ) hängen von der Stosstechnik des Probanden ab und sind daher unterschiedlich genau reproduzierbar. Auch hier könnte eine Testgewöhnung die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse erhöhen. Validität. Leider stellen Wisloff and Helgerund [17] in ihrer Arbeit die Messungen der Stockkraft nicht numerisch dar. Vergleicht man qualitativ ihr Kraft-Zeit-Diagramm mit unserem (Abb. 5), kann man jedoch eine gute Übereinstimmung feststellen. Detaillierte biomechanische Daten der Doppelstockbewegung präsentieren Millet et. al [8]. Sie untersuchten an einer Gruppe männlicher Langläufer unterschiedliche Langlauftechniken bei verschiedenen Laufgeschwindigkeiten (13, 16, 19 km/h) und einer konstanten Steigung von 2,1%. Dabei fanden sie ansteigende Werte für F peak (von ~27 bis 32% des Körpergewichts) und f (von ~45 bis 80 1/min) und eine Abnahme von t relax (von 0.9 bis 0.5 sec) mit zunehmender Laufgeschwindigkeit. Mit der Einschränkung, dass unsere Werte nur bis zu submaximalen Belastungen ausgewertet wurden, stehen diese Angaben in guter Übereinstimmung mit unseren Resultaten (F peak von 18 bis 29% des Körpergewichts, f von 34 bis 51 1/min). Bei unserer Studie ist t relax länger (1.41 bis 0.71 sec), sinkt aber auch unter 0.6 sec bei Belastungen über 175 W. Stosstechnik. Die Probanden hatten keine Vorgaben bezüglich der Stosstechnik. Sie sollten nur versuchen, so ökonomisch wie möglich zu stossen. Erfahrene Langläufer tendieren schon bei tiefen Belastungen zu einer hohen Stossfrequenz. Die auffälligsten Unterschiede in der Stosstechnik zwischen den einzelnen Probanden findet man für die maximale Stosskraft (F peak ) und die Stossfrequenz (f). Gemittelt von W fanden wir für F peak Extremwerte von N/kg und für f von (1/min). Diese Differenzen haben speziell bei den niederen Belastungsstufen direkten Einfluss auf die zeitliche Gestaltung des Stosses. Obwohl N Abbildung 5: Typischer Kraft-Zeit-Verlauf des Stockstosses einer Versuchsperson bei verschiedenen Belastungen ( W). Mit dem Pfeil markiert ist die Beschleunigungskraft, die der Bolzen des Brems- und Rückstosssystems am Ende der Stossphase auf den Stock ausübt. es keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Test und Retest gibt, zeichnen sich bezüglich der stosstechnischen Anpassung beim Retest folgende Tendenzen ab: F peak wird erhöht (+7%, p=0.086), TTP ( 5%, p = 0.485) und t stoss reduziert ( 3%, p=0.547). In der Praxis würde das bedeuten, dass ein kräftiger schneller Stockstoss mehr Zeit schafft, sich während des Vorschwingens der Arme zu erholen. Die verlängerte Relaxationszeit bei Test 2 (+9%, p = 0.157) unterstützt diese Interpretation, und die geringere submaximale V O 2 bzw. verbesserte Effizienz beim Retest zeigen, dass diese Stossstrategie zumindest am OLE ökonomischer ist. Testprotokoll Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse sind wir in der Lage, das Testprotokoll an verschiedene Leistungsklassen anzupassen (Tab. 3). Wir schlagen vor, die Stufendauer um 30 sec zu verlängern, um dadurch 1. den Abbruchzeitpunkt bei Ausbelastung zuverlässiger bestimmen zu können, und 2. die Höhe von P max gegenüber der kürzeren Stufendauer zu reduzieren. Wir erwarten, dass bei niedrigeren Werten für P max die lokale Kraftausdauer der Oberkörpermuskulatur weniger leistungslimitierend wirkt und der Proband dadurch näher an seine maximale aerobe Kapazität des Oberkörpers herankommt. Unterschiedliche Einstiegsbelastungen und Stufeninkremente sollen gewährleisten, dass die Laktat-Leistungs-Kurve genügend Messpunkte enthält und zu Beginn des Tests flach verläuft. Zusätzlich wird die Aufwärmzeit von 3 auf 5 min verlängert, um in eine stabile Stoffwechsellage zu kommen. Perspektiven sec Das OLE hat sich in der Praxis über ein weites Leistungsspektrum bewährt. Das gewählte Testdesign ermöglicht die Testung der langlaufspezifischen OKL in Form eines Stufentests. Dabei können physiologische und biomechanische Daten zeitgleich von einer Person erhoben werden. Das Gerät ist aber relativ wartungsintensiv. Die Kettenspannung muss regelmässig kontrolliert und Verschleissteile (z.b. Zahnräder) ausgewechselt werden. Zusätzlich zur Anzeige der Umdrehungszahl am Fahrradergometer müsste man noch einen Frequenzzähler anbringen, damit der Proband jederzeit seine aktuelle Stossfrequenz kontrollieren kann. Mit einer höheren Kettengeschwindigkeit wäre es wahrscheinlich möglich, die Doppelstockstossbewegung noch realistischer zu simulieren. Die biomechanische Analyse könnte man noch wesentlich erweitern, indem man die Kraftmessung mit einer Videoaufzeichnung koppelt. Dadurch könnten Aussagen über die Stossstrecke
8 Oberkörperergometrie: spezifische Leistungsdiagnostik für Langläufer und Nordisch-Kombinierer 173 Leistungsfähigkeit Einstiegsbelastung Stufeninkrement Stufendauer Sehr gut 100 W 25 W 3 min 30 sec Männer Mittel 50 W 25 W 3 min 30 sec Gering 30 W 20 W 3 min 30 sec Frauen - 30 W 20 W 3 min 30 sec Die Messpause beträgt jeweils 30sec, das Aufwärmen auf der 1. Belastungsstufe 5min. Die Leistungsfähigkeit bezieht sich auf das Langlaufen ( Sehr gut = internationales Niveau, Mittel = nationales Niveau, Gering = Anfänger). Tabelle 3: Vorschlag für leistungsabhängige Testprotokolle. und den Stockwinkel beim Einstecken der Stöcke bzw. bei F peak gemacht werden. Aus der Stossstrecke liessen sich die Stossgeschwindigkeit und die Leistung errechnen. Die weiter oben erwähnten exzentrischen Belastungsspitzen zu Beginn des Stosses könnten auch als positiver Trainingsstimulus angesehen werden. Wir spekulieren, dass durch regelmässiges Training am OLE der Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus und somit die Explosivkraft des Doppelstockstosses verbessert wird. Diese Anpassung erfolgt auf neuromuskulärer Ebene und bewirkt eine Verkürzung von TTP sowie eine Verbesserung von F peak. Dadurch verbessert sich auch die Arbeitsökonomie, und es kommt zu einer Leistungssteigerung [5, 10, 13]. Der schnelleren Kontraktionsfähigkeit der Muskelfasern, die mit den oben genannten Adaptationen einhergeht, wird auch ein protektive Wirkung gegenüber exzentrischen Belastungen auf struktureller Ebene zugeschrieben [7]. Danksagung Wir danken den Probanden für ihren motivierten und flexiblen Einsatz während der Studie. Folgende Institutionen unterstützten dieses Projekt: Eidgenössische Sportkommission, Swiss Olympic und Swiss Ski. Korrespondenzadresse: Michael Angermann, Anatomisches Institut der Universität Bern, Bühlstrasse 26, CH-3012 Bern, Tel michael.angermann@uibk.ac.at Literaturverzeichnis 1 Bilodeau B., Roy B., Boulay M.R.: Upper-body testing of cross country skiers. Med. Sci. Sports Exerc. 27: , Gaskill S.E., Serfass R.C., Rundell K.W.: Upper body power comparison between groups of cross-country skiers and runners. Int. J. Sports Med. 20: , Haug R.C., Porcari J.P., Brice G., Terry L.: Development of a maximal testing protocol for the nordic track cross-country ski simulator. Med. Sci. Sports Exerc. 31: , Heitkamp H.Ch., Moll D., Niess A., Horstmann T., Mayer F., Dickhuth H.-H.: Leistungsdiagnostische Tests und Wettkampfprognose im Skilanglauf. Dtsch. Zschr. Sportmed. 49: , Hoff J., Gran A., Helgerud J.: Maximal strength training improves aerobic endurance performance. Scand. J. Med. Sci. Sports 12: , Mahood N.V., Kenefick R.W., Kertzer R., Quinn T.J.: Physiological determinants of cross-country ski racing performance. Med. Sci. Sports Exerc. 33: , McHugh M.P.: Recent advances in the understanding of repeated bout effect: the protective effect against muscle damage from a single bout of eccentric exercise. Scand. J. Med. Sci. Sports 13: 88 97, Millet G.Y., Hoffman M.D., Candau R.B., Clifford P.S.: Poling forces during roller skiing: effects of technique and speed. Med. Sci. Sports Exerc. 30: , Mygind E., Larsson B., Klausen T.: Evaluation of a specific test in cross-country skiing. J. Sport Sci. 9: , Osteras H., Helgerud J., Hoff J.: Maximal strength-training effects on force-velocity an force-power relationship explain increases in aerobic performance in humans. Eur. J. Appl. Physiol. 88: , Rundell K.W.: Differences between treadmill running and treadmill roller skiing. J. Strength Cond. Res. 10: , Rundell K.W.: Treadmill roller ski test predicts biathlon roller ski race results of elite US biathlon women. Med. Sci. Sports Exerc. 27: , Sale D.G.: Neural adaptation to strength training. In: Komi P.V. (Hrsg.) Strength and Power in Sport, 2. Auflage, Blackwell, Berlin, Smith G.A., Nelson R.C., Feldman A., Rankinen J.L.: Analysis of V1 skating technique of Olympic cross-country skiers. Int. J. Sports Biomech. 5: , Staib J.L., Im J., Caldwell Z., Rundell K.W.: Cross-country ski racing performance predicted by aerobic and anaerobic double poling power. J. Strength Cond. Res. 14: , Wisloff U., Helgerud J.: Evaluation of a new upper body ergometer for cross country skiers. Med. Sci. Sports Exerc. 30: , Wisloff U., Helgerud J.: Methods for evaluation peak oxygen uptake and anaerobic threshold in upper body of cross country skiers. Med. Sci. Sports Exerc. 30: , 1998.
9 174 Originalartikel Knechtle B. et al. Beat Knechtle 1, Yves Marchand 2 1 Institut für Sportmedizin, Schweizer Paraplegiker-Zentrum, 6207 Nottwil 2 Institut für Anästhesie, Kreisspital Männedorf, 8708 Männedorf Schwankungen des Körpergewichts und der Hautfaltendicke bei einem Athleten während eines Extremausdauerwettkampfes Zusammenfassung Anlässlich eines Ultratriathlons über 38 km Schwimmen, 1800 km Radfahren und 422 km Laufen wurden vor, während und nach dem Rennen das Körpergewicht, die Hautfaltendicken, die Extremitätenumfänge sowie der Kalorienverbrauch bei einem Athleten bestimmt, um Auskunft über einen allfälligen Abbau des Subkutanfettes zu erhalten. Körpergewicht und Hautfaltendicke zeigten im Verlauf des Wettkampfes Schwankungen, während die Extremitätenumfänge recht konstant blieben. Auffallend war, dass Körpergewicht und Hautfaltendicke am Oberschenkel am dritten Tag den höchsten Wert erreichten. Das Körpergewicht nahm in den ersten drei Tagen von 76,1 kg auf 84,2 kg zu und lag am Schluss des Wettkampfes bei 79,3 kg. Die Hautfaltendicke am Oberschenkel nahm von 5,8 mm auf maximal 15,8 mm zu und lag am Schluss des Wettkampfes bei 6,6 mm. Die möglichen Ursachen dieser Veränderungen werden diskutiert. Summary We measured before, during and after an ultratriathlon of 38 km swim, 1800 km cycling and 422 km running in one athlete body weight, skinfold thickness, circumference of extremities and energy expenditure in order to gain information about a possible reduction of adipose subcutaneous tissue during very long lasting endurance exercise. Body weight and skinfold thickness showed changes whereas circumference of extremities remained stable. Interestingly, body weight increased from 76.1 kg to 84.2 kg and the skinfold at the upper thigh increased from 5.8 mm to 15.8 mm in the first three days. At the end of the race, body weight was at 79.3 kg and skinfold thickness at the upper thigh at 6.6 mm. The possible mechanisms underlying these changes are discussed. Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie» 51 (4), , 2003 Einleitung Es ist bekannt, dass bei längeren Belastungen mittlerer Intensität am meisten körpereigenes Fett verbrannt wird [11]. Bei Intensitäten von 30 bis rund 65% V O 2 max ist der prozentuale Anteil an Fett an der totalen Energielieferung am höchsten und nimmt bei 85% V O 2 max wieder ab [1, 18, 19, 22]. Das verbrannte Fett stammt bei tiefen Intensitäten zum grössten Teil aus dem Subkutanfett und zu einem kleineren Teil aus den intramuskulären Triglyzeriden [18, 19]. Allerdings werden bei körperlicher Aktivität zuerst die intramuskulären Triglyzeride der belasteten Muskulatur zur Energielieferung verwendet, erst im weiteren Verlauf wird das Subkutanfett aus der Umgebung der arbeitenden Muskulatur und aus der Bauchwand abgebaut [2]. Bei langen bis sehr langen Belastungen wie Ultraläufen dürfte es zu einer ausgeprägten Abnahme des subkutanen Fettes kommen. In diesem Zusammenhang wurden bisher vor allem Laufbelastungen untersucht [8, 13, 14, 15, 17, 20]. Tendenziell zeigte sich, dass das Körpergewicht bei mehrtägigen Ultraläufen in den ersten Tagen zunimmt, um im Verlauf der Belastung wieder abzusinken [14, 15]. Primär wird dabei eine Abnahme der Fettmasse beobachtet, während die Muskelmasse konstant bleibt [15]. Andererseits wurde aber bei einem Extremausdauerlauf eine Abnahme des Mitochondrienvolumens in der Wadenmuskulatur beobachtet [8]. Diese Abnahme der oxidativen Kapazität in den Muskelfasern dürfte auch die Fettverbrennung beeinträchtigen und den Abbau des Subkutanfettes bzw. die Abnahme des Körpergewichts reduzieren. Um weitere Informationen über die Auswirkungen einer Extremausdauerleistung auf das Körpergewicht und den Abbau des Subkutanfettes zu erhalten, haben wir die Gelegenheit eines über 14 Tage dauernden Ultratriathlon-Wettkampfes genutzt, um bei einem Teilnehmer das Körpergewicht, die Hautfaltendicke und den Umfang der Extremitäten alle 24 h zu messen. Methode Vom 10. bis 24. November 2002 fand in Monterrey, Mexiko, die 7. Ultratriathlon-WM über 38 km Schwimmen, 1800 km Radfahren und 422 km Laufen statt, an der 18 Athleten aus 10 Nationen teilnahmen. Das Schwimmen fand in einem 50-m-Bassin, das Radfahren und Laufen auf einem 1,9 km langen, beleuchteten und abgesperrten Strassenrundkurs in einem Park statt. Die Tagesmaxima der Lufttemperatur schwankten zwischen 23 und 32 C und die Nachtminima zwischen 6 und 14 C (Tab. 1). Jeweils von Mittag bis in den frühen Morgen blies ein kräftiger Wind aus nordöstlicher Richtung. Am 7. Tag fiel in der Nacht während 3 h Regen, die übrigen Tage waren niederschlagsfrei. Der Proband (38 Jahre, 177 cm, 76 kg, V O 2 max 5100 ml/min) startete zum 2. Mal an diesem Event. Von 11 Athleten, die das Ziel innerhalb des Zeitlimits erreichten, kam er auf den 8. Schlussrang. Beim Schwimmen erlitt er einen Infekt der oberen Luftwege, der zu einer eitrigen Bronchitis und Sinusitis vom 2. bis 4. Wettkampftag führte. Gegen Ende der Radstrecke erlitt er zusätzlich noch
10 Schwankungen des Körpergewichts und der Hautfaltendicke bei einem Athleten während eines Extremausdauerwettkampfes 175 Zeit Tages-Maximum Nacht-Minimum [ Celsius] [ Celsius] Start Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tabelle 1: Lufttemperaturen am Schatten während des Wettkampfes. eine Lumbalgie durch ein Verhebetrauma beim Anheben des Fahrrades auf das Trottoir. Vor dem Start, während des Wettkampfes alle 24 h und nach dem Wettkampf bestimmte dieselbe Person immer in der gleichen Weise das Körpergewicht des Probanden auf einer mechanischen Balkenwaage, die Umfänge der Extremitäten, die Dicke der Hautfalten (GPM-Hautfaltenmessgerät) sowie indirekt den Kalorienverbrauch der vergangenen 24 h (Pulsuhr POLAR S610, Kempele, Finnland). 2 Wochen vor dem Wettkampf wurde ein Maximaltest auf dem Fahrradergometer zur Bestimmung von V O 2 max durchgeführt. Anhand dieses Maximaltests konnte die Pulsuhr POLAR S610 gemäss Gebrauchsanweisung richtig eingestellt werden, um den Kalorienverbrauch indirekt über die Messung der Herzfrequenz unter Belastung zu bestimmen. Die Einstellung wurde für alle drei Disziplinen verwendet. Da die Pulsuhr POLAR S610 gemäss Gebrauchsanweisung erst ab einer Herzfrequenz von 90 bpm und höher den Kalorienverbrauch unter Belastung berechnet, wurde nur der Energieverbrauch unter Belastung bestimmt. Der Athlet legte Ruhepausen von maximal 2 h pro Tag ein. Die Umfänge der Extremitäten wurden nur auf der rechten Seite gemessen, da bei den betreffenden Sportarten symmetrisch beide Körperseiten belastet werden. Am Unterschenkel wurde der grösste Umfang gewählt, am Oberschenkel wurde der Umfang 20 cm oberhalb der Patella gemessen. An Unter- und Oberarm wurden jeweils die grössten Umfänge bestimmt. Alle Messungen wurden 3 Mal wiederholt und der Mittelwert bestimmt. Die Dicke der Hautfalte wurde ebenfalls nur auf der rechten Seite gemessen. Messstellen waren Wange (unterhalb der Schläfe auf Höhe der Nasenlöcher), Kinn (am Halsansatz, Mitte Kinn), Brust (am Rand des Pectoralis major, in der Mitte der Höhe der Achselhöhle), Flanke (mittlere Axillarlinie, Mitte Axilla Beckenkamm), Taille (mittlere Axillarlinie, Mitte Rippenbogen Beckenkamm), Bauch (rechts vom Nabel), Trizeps (Mitte Acromion Olecranon), Scapula (unterhalb Scapulaspitze), Wade (auf der Rückseite, nahe Kniekehle) und Knie (oberhalb Patella) (Tab. 3). Alle Messungen wurden 3 Mal wiederholt und der Mittelwert bestimmt. Daraus wurde der prozentuale Anteil an Körperfett berechnet [9]. Zeit Schwimmen Radfahren Laufen Schwimmen Radfahren Laufen [km] [km] [km] [km/h] [km/h] [km/h] Tabelle 2: Distanzen und Geschwindigkeit. Start ,8 22,0 Tag ,4 Tag ,6 Tag ,6 Tag ,8 Tag ,2 Tag ,7 14,3 2,3 Tag 7 68,1 2,8 Tag 8 77,4 3,2 Tag 9 62,2 2,6 Tag 10 64,1 2,7 Tag 11 62,3 2,6 Tag 12 62,2 3,1 Zeit Wange Kinn Brust Flanke Taille Bauch Trizeps Scapula Wade Knie [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Tabelle 3: Verlauf der Hautfaltendicke. Start 4,0 2,4 4,4 4,6 5,2 7,0 4,0 6,2 5,8 5,8 Tag 1 5,0 2,6 4,2 5,4 6,0 8,0 4,0 7,4 4,8 8,2 Tag 2 5,0 3,2 4,4 5,2 11,0 10,2 3,6 7,0 7,2 11,2 Tag 3 6,8 3,0 6,4 8,2 6,4 13,0 3,6 7,6 7,4 15,8 Tag 4 4,6 3,2 5,0 5,2 8,0 8,4 3,8 7,6 5,6 14,0 Tag 5 6,0 3,3 5,6 5,8 11,2 10,8 3,4 7,4 8,4 15,2 Tag 6 7,2 3,2 6,2 6,0 10,2 12,0 3,6 7,5 6,8 14,8 Tag 7 4,8 3,2 5,4 6,2 9,6 11,0 3,4 6,8 5,8 9,8 Tag 8 6,0 3,0 4,2 7,0 7,8 9,0 3,6 7,2 8,0 11,2 Tag 9 6,2 3,2 6,0 6,8 9,4 12,8 3,4 7,6 8,4 12,2 Tag 10 5,4 3,0 5,6 7,4 7,4 10,0 3,6 8,0 6,8 7,8 Tag 11 5,4 3,0 5,0 5,6 8,4 10,8 3,6 7,4 4,4 6,6 Tag 12 4,2 3,2 4,0 6,2 7,4 8,8 3,2 6,8 6,0 5,8 Ziel 4,8 3,2 5,2 5,4 5,8 10,2 3,2 6,4 5,0 6,6
11 176 Knechtle B. et al. Abbildung 1: Kalorienverbrauch. Resultate Leistung Die zurückgelegten Distanzen pro Tag sowie die entsprechende Geschwindigkeit sind in Tabelle 2 zusammengestellt. Die Schwimmdistanz legte der Proband in 13 h 40 min zurück, die Raddistanz hatte er nach 6 d 10 h 38 min hinter sich und das Ziel erreichte er nach 12 d 20 h 26 min. Die mittlere tägliche Strecke beim Radfahren war bei 276,6 km an den Tagen, an denen nur Rad gefahren wurde. 66,8 km lief er an den Tagen, an denen nur noch Laufen angesagt war. Distanzen und Geschwindigkeiten wurden inklusive Pausen berechnet. Der Athlet legte eine Schlafpause von 2 h pro Nacht ein sowie Pausen während des Tages für Essen und Körperpflege. Insgesamt wurden pro 24 h rund 6 h Pause eingelegt. Energieverbrauch Der tägliche Kalorienverbrauch schwankte zwischen 4600 und kcal (Abb. 1). Der höchste Energieverbrauch wurde am 1. Tag erzielt, der tiefste am letzten Tag. Am 4. Tag lag ein praktisch gleich tiefer Energieverbrauch wie am letzten Tag vor. Der Energieverbrauch stieg dann gegen den 8. Tag hin wieder an, um gegen Schluss hin wieder abzunehmen. Körpermasse Bei den gemessenen Parametern Körpergewicht (Abb. 2), Umfang der Extremitäten (Abb. 3) und Hautfaltendicke (Tab. 3) wurden grosse Schwankungen im Verlauf des Wettkampfes beobachtet. Das Körpergewicht lag beim Start bei 76,1 kg, stieg am 3. Tag auf maximal 84,2 kg an und fiel im Verlauf langsam ab und betrug am Schluss 79,3 kg. Die errechnete fettfreie Masse (Trockengewicht) betrug zu Beginn 69 kg, erreichte am 9. Tag mit 66,9 kg den tiefsten Wert und lag im Ziel bei 69,8 kg. Die errechnete Fettmasse (Fettgewicht) war beim Start bei 7,1 kg, stieg am 3. Tag auf 15,5 kg und war im Ziel bei 9,5 kg. Bei den Umfängen an den Extremitäten blieben die Werte recht konstant. Der Umfang am Unterarm blieb konstant bei 29 cm und am Oberarm stieg der Wert von 33 cm beim Start auf 34 cm am 3. Tag und fiel dann wieder auf 33 cm. Am Unterschenkel war der Umfang beim Start bei 41 cm, stieg am 3. Tag auf 41,5 cm und fiel dann auf 40 cm ab. Auch am Oberschenkel war ein leichter Anstieg am 3. Tag von 56 cm auf 60 cm nachzuweisen. Anschliessend fiel der Wert auf 57 cm ab. Die Hautfaltendicke variierte vor allem an der unteren Extremität. Auf Höhe des Knies stieg der Wert von 5,8 mm beim Start auf 15,8 mm am 3. Tag an und fiel bis zum Ende des Rennens auf 6,6 mm ab. Am Abdomen nahm die Hautfaltendicke von 7,0 mm auf 13,0 mm am 3. Tag zu und erreichte am Ende des Wettkampfes 10,2 mm. Auch an Brust und Flanke wurden am 3. Tag die höchsten Werte gemessen. Diskussion Bei einer praktisch anhaltenden Ausdauerbelastung über 12 Tage haben wir wie in der Literatur [14, 15] eine Abnahme des Körpergewichts aufgrund einer Reduktion des Subkutanfettes erwartet. Unsere Einzelfallstudie zeigt aber, dass eine zwölftägige Dauerbelastung mit Schwimmen, Radfahren und Laufen weder zu einer Abnahme des Körpergewichts noch zu einer Reduktion des Subkutanfettes führte. Im Gegenteil, steigen doch Körper- und Fettgewicht in den ersten 3 Tagen deutlich an und sinken bei Abbruch der Belastung nicht wieder auf die Ausgangswerte ab (Abb. 2). Das Verhalten des Körpergewichts während Ausdauerbelastungen Bei Untersuchungen an Ultraläufen wurden sowohl Zu- als auch Abnahmen des Körpergewichts beschrieben. Bei sehr langen Belastungen wie einem Ultralauf von 1000 km in 20 Tagen wurde eine Zunahme des Körpergewichts durch eine Zunahme der fettfreien Masse in den ersten Tagen beobachtet. Dies wurde primär auf eine Zunahme der Muskelmasse in den Beinen zurückgeführt [14]. Im weiteren Verlauf der Belastung sank das Körpergewicht jedoch kontinuierlich ab [15]. Nach 20 Tagen Laufbelastung von 50 km pro Tag wurde eine Abnahme des Körpergewichts von maximal 2 kg nachgewiesen [13]. Die Fettmasse nahm dabei ab, die Muskelmasse blieb praktisch unverändert [15]. Aber auch eine Abnahme der Muskelmasse ist bei sehr langen Belastungen möglich. Dies zeigte sich bei Belastungen über 100 km [17] wie bei Ultraläufen über 1000 km [14]. Die gesamte Dauer einer anhaltenden Belastung dürfte entscheiden, ob und wie stark die Muskelmasse abgebaut wird [6, 16], und die tägliche Laufdistanz dürfte über den Grad der Muskelschädigung entscheiden [12]. Bei sehr langen und teils intensiven Belastungen von 600 Laufkilometern in 30 Tagen wurde eine signifikante Abnahme des Mitochondrienvolumens von 6,98 auf 4,89% des Faservolumens festgestellt [8]. Weiter ist bekannt, dass eine exzentrische Muskelbelastung wie das Laufen vermehrt zu ultrastrukturellen Schäden führt [7] Laufkilometer in 7 Wochen führten zu einer Reduktion der Grösse
12 Schwankungen des Körpergewichts und der Hautfaltendicke bei einem Athleten während eines Extremausdauerwettkampfes 177 Abbildung 2: Trockengewicht, Fettgewicht und Körpergewicht. Abbildung 3: Extremitätenumfänge. der Muskelfasern, einer Nekrose von Muskelfasern und einer Fibrosierung im Muskel [20]. Nach einem Lauf über 160 km waren hingegen keine ultrastrukturellen Muskelschädigungen nachweisbar. Vielmehr nahmen die Typ-I-Fasern prozentual zu, was aber auch bei noch viel längeren Läufen beobachtet wurde [19]. Die nachgewiesenen ultrastrukturellen Schädigungen von Mitochondrien und kontraktilen Elementen in der Muskelfaser bei sehr langen Belastungen könnten zu einer Hemmung des Muskelstoffwechsels mit Einschränkung der Fettoxidation führen [8, 21]. Das Subkutanfett unter Ausdauerbelastungen Während Ultraläufen wurden sowohl eine Zu- wie eine Abnahme des subkutanen Fettgewebes nachgewiesen. Allgemein wurde bei Ausdauerbelastungen eine Abnahme des Subkutanfettes nachgewiesen [15, 16]. Im Bereich des Oberschenkels wurde in den ersten Tagen eines Ultralaufes aber auch eine Zunahme der Hautfaltendicke beobachtet, bevor es dann wie an den anderen Körperstellen zu einer Abnahme kam [15]. In 20 Tagen wurden etwa 3,5 kg Fettmasse abgebaut [15]. Neben einer Zunahme der Hautfaltendicke kann auch eine Zunahme des Umfanges der Oberschenkel bei Ultraläufern nachgewiesen werden. Bei sehr langen Belastungen wie einem Ultralauf über 20 Tage wurde eine Zunahme des Umfanges des Oberschenkels gegenüber einer Abnahme der Umfänge an der oberen Extremität, Wade, Thorax sowie Abdomen festgestellt [14]. Somit dürfte bei einem Ultralauf zuerst Muskelmasse in der belasteten Region aufgebaut werden im Sinne einer Anpassung an die Belastung, bevor es dann aufgrund der chronischen Überbelastung zu einem Muskelabbau kommt. Zusammenhang von Gewicht, Hautfaltendicke und Umfang der Extremitäten im Verlauf des Wettkampfes Unsere Messungen von Körpergewicht, Fettgewicht, Hautfaltendicke und Umfang der Extremitäten zeigen deutliche Schwankungen im Verlauf des Wettkampfes. Auffallend ist aber, dass Körpergewicht (Abb. 2), Fettgewicht (Abb. 2), Oberschenkelumfang (Abb. 3) und Hautfaltendicke am Oberschenkel (Tab. 3) am 3. Tag der Belastung die höchsten Werte erreichten und im Verlauf wieder langsam abnahmen, während das Trockengewicht anstieg (Abb. 2). Mögliche Gründe für diese Schwankungen könnten die Messmethode, die unterschiedliche Energiebilanz der einzelnen Tage sowie die Flüssigkeitsbilanz im Verlauf des Wettkampfes sein. Die Messung der Hautfaltendicke ist nur eine Methode, um eine Aussage über das subkutane Fettgewebe zu erhalten. Die Bestimmung der Hautfaltendicke sowie der Umfänge der Extremitäten wurde bei der Beurteilung von Körperzusammensetzung und Energieumsatz von Ausdauerbelastungen oft angewendet [14, 15, 16]. Je nach Untersucher kann die Messregion in den täglichen Messungen nicht übereinstimmen. Die Dicke der Hautfalten sowie die Umfänge der Extremitäten wurden immer durch die gleiche Person um die gleiche Tageszeit an den gleichen Orten in gleicher Weise gemessen. So konnten in unserem Fall Schwankungen durch untersucherbedingte Fehlmessungen vermieden werden. Weitere Methoden, um die Körperkompartimente und insbesondere das Fettgewebe zu beurteilen, sind Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA) sowie Impedanzmessungen [3, 4]. Dabei können auch Aussagen über die fettfreie Masse gewonnen werden. Die verschiedenen Methoden liefern aber unterschiedliche Resultate, so dass die Resultate untereinander nicht vergleichbar sind [4]. Im Gegensatz zur DXA-Methode werden bei der Messung der Hautfaltendicke eher tiefere Werte der fettfreien Masse berechnet [2]. Die Messung der Hautfaltendicke wird aber dennoch als exaktes und einfaches Mittel zur Bestimmung der Körperfettmenge beurteilt [3, 5]. Die Energie- sowie die Flüssigkeitsbilanz könnte auch in Abhängigkeit von der Hitze einen Einfluss auf das Körpergewicht haben, denn die Umgebungstemperatur dürfte Appetit und Leistung beeinflussen. Der Energieverbrauch schwankte im Verlauf (Abb. 1) und war am 4. sowie letzten Tag am tiefsten. Die Energiezufuhr wurde nicht bestimmt. Sie dürfte ebenfalls deutliche Schwankungen aufgewiesen haben und bei rund 8000 kcal pro Tag gelegen sein [10]. Ein Zusammenhang des Energieverbrauches mit der Thermoregulation wäre möglich. Durch die Hitze in den letzten 3 Tagen (Tab. 1) könnte der Energieverbrauch reduziert worden sein. In dieser Phase des Wettkampfes war der Energieverbrauch am tiefsten und die Leistung auf der Laufstrecke im Vergleich zu den Vortagen schlechter (Tab. 2). Die Flüssigkeitszufuhr könnte das Körpergewicht ebenfalls deutlich beeinflussen. Der Flüssigkeitsumsatz wurde allerdings nicht bestimmt. Anlässlich einer früheren Teilnahme schwankte die Flüssigkeitszufuhr zwischen 6 und 15 l mit einer mittleren täglichen Aufnahme von 8,8 l [10]. Die Diurese des Athleten war nach eigenen Angaben jeweils am Tag in der Hitze reduziert, möglicherweise bedingt durch ein verstärktes Schwitzen zur Thermoregulation. Dafür trat in der Nacht jeweils eine verstärkte Diurese ein. Da das Körpergewicht jeweils am Mittag gemessen wurde, könnte durch eine vermehrte Flüssigkeitszufuhr und eine verminderte Diurese in der Hitze ein eher höheres Körpergewicht resultieren. Schlussfolgerungen Unsere Resultate zeigen, dass Körpergewicht, Fettgewicht und Hautfaltendicke auch während einer über 12 Tage dauernden Extrembelastung ansteigen können. Die höchsten Werte aller drei
Schwankungen des Körpergewichts und der Hautfaltendicke bei einem Athleten während eines Extremausdauerwettkampfes
 174 Originalartikel Beat Knechtle 1, Yves Marchand 2 1 Institut für Sportmedizin, Schweizer Paraplegiker-Zentrum, 6207 Nottwil 2 Institut für Anästhesie, Kreisspital Männedorf, 8708 Männedorf Schwankungen
174 Originalartikel Beat Knechtle 1, Yves Marchand 2 1 Institut für Sportmedizin, Schweizer Paraplegiker-Zentrum, 6207 Nottwil 2 Institut für Anästhesie, Kreisspital Männedorf, 8708 Männedorf Schwankungen
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Test über die Veränderung von Laktat und Herzfrequenz unter regelmäßiger Einnahme von fitrabbit Mag. Bernhard Schimpl
 Test über die Veränderung von Laktat und Herzfrequenz unter regelmäßiger Einnahme von fitrabbit Mag. Bernhard Schimpl Testdesign: 6 Hobbyläufer (3 Frauen / 3 Männer) wurden einer Laufbandergometrie unterzogen,
Test über die Veränderung von Laktat und Herzfrequenz unter regelmäßiger Einnahme von fitrabbit Mag. Bernhard Schimpl Testdesign: 6 Hobbyläufer (3 Frauen / 3 Männer) wurden einer Laufbandergometrie unterzogen,
ABC-one Studie 2010 Regionale Fettverbrennung
 ABC-one Studie 2010 Regionale Fettverbrennung 1. Einleitung Ziel der Studie war, es die Wirkung der Geräte Slim Belly und Slim Back&Legs auf die regionale Fettverbrennung zu testen und die Effizienz der
ABC-one Studie 2010 Regionale Fettverbrennung 1. Einleitung Ziel der Studie war, es die Wirkung der Geräte Slim Belly und Slim Back&Legs auf die regionale Fettverbrennung zu testen und die Effizienz der
Auswertungsunterlagen zur Rad-Leistungsdiagnostik
 Auswertungsunterlagen zur Rad-Leistungsdiagnostik SYNERGY ProTraining Kaiser, Knoch, Richard Geng GbR Seehofstraße 102 14167 Berlin Tel.: 030 / 74 78 1000 team@synergy-protraining.de www.synergy-protraining.de
Auswertungsunterlagen zur Rad-Leistungsdiagnostik SYNERGY ProTraining Kaiser, Knoch, Richard Geng GbR Seehofstraße 102 14167 Berlin Tel.: 030 / 74 78 1000 team@synergy-protraining.de www.synergy-protraining.de
Laktat-Leistungsdiagnostik
 Klinikum rechts der Isar Technische Universität München Zentrum für Prävention und Sportmedizin Laktat-Leistungsdiagnostik Beurteilung Ihrer Ausdauerleistungsfähigkeit Ermittlung Ihres optimalen Trainingspulsbereichs
Klinikum rechts der Isar Technische Universität München Zentrum für Prävention und Sportmedizin Laktat-Leistungsdiagnostik Beurteilung Ihrer Ausdauerleistungsfähigkeit Ermittlung Ihres optimalen Trainingspulsbereichs
Laktat-Stufentest. Laktat-Stufentest: - Eingangsstufe: 80 W - Stufenhöhe: 40 W - Stufenlänge: 4 min. (Schema: )
 Laktat-Stufentest Laktat-Stufentest: - Eingangsstufe: 80 W - Stufenhöhe: 40 W - Stufenlänge: 4 min (Schema: 80-40 - 4) Zweck: - Optimierung des Trainings - Minimierung des Zeitaufwandes - Maximierung des
Laktat-Stufentest Laktat-Stufentest: - Eingangsstufe: 80 W - Stufenhöhe: 40 W - Stufenlänge: 4 min (Schema: 80-40 - 4) Zweck: - Optimierung des Trainings - Minimierung des Zeitaufwandes - Maximierung des
Sportmedizinische Ausdauerleistungsdiagnostik in Spielsportarten
 Sportmedizinische Ausdauerleistungsdiagnostik in Spielsportarten Im Rahmen der jährlichen vom Land Vorarlberg vorgeschriebenen Sportmedizinischen Leistungsdiagnostik sind folgende Kombinationen von Untersuchungen
Sportmedizinische Ausdauerleistungsdiagnostik in Spielsportarten Im Rahmen der jährlichen vom Land Vorarlberg vorgeschriebenen Sportmedizinischen Leistungsdiagnostik sind folgende Kombinationen von Untersuchungen
Sie hatten am einen Leistungstest mit insgesamt 6 Stufen in der Testmethode Laufen bei uns durchgeführt.
 Max Mustermann Sehr geehrter Herr Mustermann, Sie hatten am 23.10.2012 einen Leistungstest mit insgesamt 6 Stufen in der Testmethode Laufen bei uns durchgeführt. Die Stufendauer betrug dabei 3 min. Ziel
Max Mustermann Sehr geehrter Herr Mustermann, Sie hatten am 23.10.2012 einen Leistungstest mit insgesamt 6 Stufen in der Testmethode Laufen bei uns durchgeführt. Die Stufendauer betrug dabei 3 min. Ziel
Laktatleistungsdiagnostik und Ihre Umsetzung in die Trainingspraxis
 Infoveranstaltung RUSH/VR-Bank Laktatleistungsdiagnostik und Ihre Umsetzung in die Trainingspraxis Wolfgang Kemmler Institut für Medizinische Physik Universität Erlangen-Nürnberg www.imp.uni-erlangen.de
Infoveranstaltung RUSH/VR-Bank Laktatleistungsdiagnostik und Ihre Umsetzung in die Trainingspraxis Wolfgang Kemmler Institut für Medizinische Physik Universität Erlangen-Nürnberg www.imp.uni-erlangen.de
5. Ergebnisse. 5.1 Demographische Daten der Patienten
 5. Ergebnisse 5.1 Demographische Daten der Patienten In die Auswertung gehen die Daten von 50 Patientinnen und Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (End Stage Renal Disease [ESRD]) ein, deren Ursache
5. Ergebnisse 5.1 Demographische Daten der Patienten In die Auswertung gehen die Daten von 50 Patientinnen und Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (End Stage Renal Disease [ESRD]) ein, deren Ursache
KRAFTLEISTUNGSDIAGNOSTIK IM DEUTSCHEN SEGLER- VERBAND
 Norbert Sibum/Matz Kunz KRAFTLEISTUNGSDIAGNOSTIK IM DEUTSCHEN SEGLER- VERBAND Auswertung der Daten der Seglerinnen und Segler am Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein für den Olympiazyklus 2012
Norbert Sibum/Matz Kunz KRAFTLEISTUNGSDIAGNOSTIK IM DEUTSCHEN SEGLER- VERBAND Auswertung der Daten der Seglerinnen und Segler am Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein für den Olympiazyklus 2012
Erfassung von Prädiktoren der individuellen Variabilität der Belastungsreaktion in Hypoxie bei Radausdauersportlern und Triathleten (AZ /07)
 11 Erfassung von Prädiktoren der individuellen Variabilität der Belastungsreaktion in Hypoxie bei Radausdauersportlern und Triathleten (AZ 070117/07) Andreas Michael Nieß (Projektleiter), Felix Schumann,
11 Erfassung von Prädiktoren der individuellen Variabilität der Belastungsreaktion in Hypoxie bei Radausdauersportlern und Triathleten (AZ 070117/07) Andreas Michael Nieß (Projektleiter), Felix Schumann,
Entwicklung eines Testverfahrens zur Beurteilung der anaeroben Kapazität und Leistungsfähigkeit
 111 Entwicklung eines Testverfahrens zur Beurteilung der anaeroben Kapazität und Leistungsfähigkeit 1 Problemstellung H. Heck (Projektleiter), S. Kurtscheidt, S. Vrebac Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl
111 Entwicklung eines Testverfahrens zur Beurteilung der anaeroben Kapazität und Leistungsfähigkeit 1 Problemstellung H. Heck (Projektleiter), S. Kurtscheidt, S. Vrebac Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl
Wirkung von Feedback-Training im Radsport auf physiologische und biomechanische Parameter
 175 Wirkung von Feedback-Training im Radsport auf physiologische und biomechanische Parameter Björn Stapelfeldt, Guillaume Mornieux & Albert Gollhofer (Projektleiter) 1 Problemstellung Universität Freiburg
175 Wirkung von Feedback-Training im Radsport auf physiologische und biomechanische Parameter Björn Stapelfeldt, Guillaume Mornieux & Albert Gollhofer (Projektleiter) 1 Problemstellung Universität Freiburg
Zusammenfassung der Daten zur Fallstudien Untersuchung des KNEEPFLEXX Geräts
 Zusammenfassung der Daten zur Fallstudien Untersuchung des KNEEPFLEXX Geräts 3. April 21 Protokoll Der Teilnehmer absolvierte zwei Runden Laufbandübungen, bei der ersten das Gerät tragend, die zweite ohne
Zusammenfassung der Daten zur Fallstudien Untersuchung des KNEEPFLEXX Geräts 3. April 21 Protokoll Der Teilnehmer absolvierte zwei Runden Laufbandübungen, bei der ersten das Gerät tragend, die zweite ohne
Wirkung einer Ganzkörperkälteapplikation (Kältekammer bei minus 110 C) auf die Ausdauerleistungsfähigkeit
 PROF. DR. WINFRIED JOCH, UNIVERSITÄT MÜNSTER DR. SANDRA ÜCKERT, UNIVERSITÄT DORTMUND Wirkung einer Ganzkörperkälteapplikation (Kältekammer bei minus 110 C) auf die Ausdauerleistungsfähigkeit In der nachfolgenden
PROF. DR. WINFRIED JOCH, UNIVERSITÄT MÜNSTER DR. SANDRA ÜCKERT, UNIVERSITÄT DORTMUND Wirkung einer Ganzkörperkälteapplikation (Kältekammer bei minus 110 C) auf die Ausdauerleistungsfähigkeit In der nachfolgenden
Wie fit ist Ihr Herz?
 Wie fit ist Ihr Herz? Fragen und Antworten für Interessierte Was ist das Ziel einer Leistungsdiagnostik? Ziel der Leistungsdiagnostik ist es, das sportliche Leistungsvermögen und/oder den durch das Training
Wie fit ist Ihr Herz? Fragen und Antworten für Interessierte Was ist das Ziel einer Leistungsdiagnostik? Ziel der Leistungsdiagnostik ist es, das sportliche Leistungsvermögen und/oder den durch das Training
TESTBERICHT BungyPump of Sweden MODO SPORTS ACADEMY
 TESTBERICHT -Gehen mit BungPump Trainingsstöcken verglichen mit Gehen mit ungedämpften Stöcken und Gehen ohne Stöcke. Ein Projekt in Zusammenarbeit von BungyPump of Sweden mit der MODO SPORTS ACADEMY 1
TESTBERICHT -Gehen mit BungPump Trainingsstöcken verglichen mit Gehen mit ungedämpften Stöcken und Gehen ohne Stöcke. Ein Projekt in Zusammenarbeit von BungyPump of Sweden mit der MODO SPORTS ACADEMY 1
3 Untersuchungsmethodisches Vorgehen
 Untersuchungsmethodisches Vorgehen 49 3 Untersuchungsmethodisches Vorgehen 3.1 Probanden An den Untersuchungen nahmen sechs männliche und acht weibliche Leistungsschwimmer des Schwimmvereins SV Halle teil.
Untersuchungsmethodisches Vorgehen 49 3 Untersuchungsmethodisches Vorgehen 3.1 Probanden An den Untersuchungen nahmen sechs männliche und acht weibliche Leistungsschwimmer des Schwimmvereins SV Halle teil.
Studie Haut und S.C. Dicke
 Studie Haut und S.C. Dicke Stärke von Haut und Subkutangewebe bei Erwachsenen mit Diabetes an Körperstellen, die zur subkutanen Injektion von Insulin verwendet werden: Auswirkung auf die Empfehlung der
Studie Haut und S.C. Dicke Stärke von Haut und Subkutangewebe bei Erwachsenen mit Diabetes an Körperstellen, die zur subkutanen Injektion von Insulin verwendet werden: Auswirkung auf die Empfehlung der
Tauchen mit Übergewicht (Adipositas)
 Tauchen mit Übergewicht (Adipositas) Dr. med. Bernd Winkler Universitätsklinikum Ulm Klinik für Anästhesiologie Sektion Notfallmedizin Adipositas - Einteilung 27.02.2012 Tauchen bei Adipositas 2 Adipositas
Tauchen mit Übergewicht (Adipositas) Dr. med. Bernd Winkler Universitätsklinikum Ulm Klinik für Anästhesiologie Sektion Notfallmedizin Adipositas - Einteilung 27.02.2012 Tauchen bei Adipositas 2 Adipositas
Validität des Polar Laufindex
 LSB (Berlin) 54(2013)2, 168-173 Max Niemeyer 1 (2. Preisträger Referate Studierende) Validität des Polar Laufindex Summary The aim of the present study was to check the validity of the Polar Running- Index
LSB (Berlin) 54(2013)2, 168-173 Max Niemeyer 1 (2. Preisträger Referate Studierende) Validität des Polar Laufindex Summary The aim of the present study was to check the validity of the Polar Running- Index
Skiunfälle der Saison 2000/2001
 Skiunfälle der Saison 2000/2001 H. Gläser Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG Sportversicherung (ASU Ski) Die Auswertung der Skiunfälle der Saison 2000/2001 läßt wie schon in den vergangenen Jahren
Skiunfälle der Saison 2000/2001 H. Gläser Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG Sportversicherung (ASU Ski) Die Auswertung der Skiunfälle der Saison 2000/2001 läßt wie schon in den vergangenen Jahren
X s ) und prüfstatistischen Ergebnisse (**p 0,01; *p 0,05)
 7 Zusammenfassung Die vorliegende Arbeit widmet sich in einer Hauptuntersuchung und drei flankierenden Untersuchungsabschnitten den Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Parameter der Belastungssteuerung
7 Zusammenfassung Die vorliegende Arbeit widmet sich in einer Hauptuntersuchung und drei flankierenden Untersuchungsabschnitten den Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Parameter der Belastungssteuerung
Ergebnisse 0,0 RR ST SK SE TT TK TE. Versuchsstufen
 4. ERGEBNISSE 4.1. Blutparameter 4.1.1. Laktat Es werden die Einzelverläufe der sieben Pferde in Ruhe und nach Belastungsende (Abb. 1) und die daraus errechneten Mediane und MAD (Abb. 1, Tab. 4) dargestellt.
4. ERGEBNISSE 4.1. Blutparameter 4.1.1. Laktat Es werden die Einzelverläufe der sieben Pferde in Ruhe und nach Belastungsende (Abb. 1) und die daraus errechneten Mediane und MAD (Abb. 1, Tab. 4) dargestellt.
Kurzbeschreibung des Projekts. Evaluation der Kraftfähigkeiten der oberen Extremität paralympischer Rollstuhlathleten
 Kurzbeschreibung des Projekts Evaluation Kraftfähigkeiten oberen Extremität paralympischer Rollstuhlathleten Die Studie hat zum Ziel die Kraftfähigkeiten von Rollstuhlathleten detailliert zu erfassen und
Kurzbeschreibung des Projekts Evaluation Kraftfähigkeiten oberen Extremität paralympischer Rollstuhlathleten Die Studie hat zum Ziel die Kraftfähigkeiten von Rollstuhlathleten detailliert zu erfassen und
Laktat-Leistungsdiagnostik. Leseprobe
 Laktat-Leistungsdiagnostik Kapitel 5 Laktat-Leistungs-Diagnostik, Schwellenkonzepte Ein Grundstein der ersten Anwendung einer LLD durch HOLLMANN (1959-1963) war die Bestimmung der Milchsäure durch BERZELIUS
Laktat-Leistungsdiagnostik Kapitel 5 Laktat-Leistungs-Diagnostik, Schwellenkonzepte Ein Grundstein der ersten Anwendung einer LLD durch HOLLMANN (1959-1963) war die Bestimmung der Milchsäure durch BERZELIUS
Verhalten der kardialen Marker BNP und Troponin nach standardisierten Belastungen bei Leistungssportlern mit und ohne Sportherz
 73 1 Problem Verhalten der kardialen Marker BNP und Troponin nach standardisierten Belastungen bei Leistungssportlern mit und ohne Sportherz Jürgen Scharhag (Projektleiter) & Wilfried Kindermann Universität
73 1 Problem Verhalten der kardialen Marker BNP und Troponin nach standardisierten Belastungen bei Leistungssportlern mit und ohne Sportherz Jürgen Scharhag (Projektleiter) & Wilfried Kindermann Universität
Das Ausdauertraining wird in mehrere Bereiche gegliedert: REKOM: Regenerations- und Kompensationstraining, Lactat unter 1,5 mmol/i
 Ausdauertraining im Fußball Von den vier konditionellen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit hat die Ausdauer im Fußball eine hohe Bedeutung. Ist die Ausdauer nicht hinreichend
Ausdauertraining im Fußball Von den vier konditionellen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit hat die Ausdauer im Fußball eine hohe Bedeutung. Ist die Ausdauer nicht hinreichend
Herzfrequenz zum Zeitpunkt des Belastungsabbruchs sind in Tabelle A1 im Anhang aufgeführt.
 29 D Ergebnisse 1 Belastungs- und Beanspruchungsmeßgrößen 1.1 Mehrstufen-Maximaltest Die in dieser Ergometrie erreichte mittlere P max der Probanden betrug 294.2 ± 43.5 W. Dies entsprach einer Leistung
29 D Ergebnisse 1 Belastungs- und Beanspruchungsmeßgrößen 1.1 Mehrstufen-Maximaltest Die in dieser Ergometrie erreichte mittlere P max der Probanden betrug 294.2 ± 43.5 W. Dies entsprach einer Leistung
Chapter 6 Measurement of Work, Power, and Energy Expenditure
 Bewegungseffizienz und Laufökonomie Bedeutung im Spitzensport Aktueller Forschungsstand Donnerstag, 15. Mai 2008, 15.15 Uhr, PVT Nächste Woche: Dr. Vogt Michael! Bereiten Sie sich bitte anhand der angeführten
Bewegungseffizienz und Laufökonomie Bedeutung im Spitzensport Aktueller Forschungsstand Donnerstag, 15. Mai 2008, 15.15 Uhr, PVT Nächste Woche: Dr. Vogt Michael! Bereiten Sie sich bitte anhand der angeführten
3.2 Auswertung der 12-Kanal-Langzeit-EKGs über 24 Stunden
 16 3 Ergebnisse 3.1 Patientenkollektiv In unserer Studie wurden insgesamt 55 Patientinnen und Patienten untersucht. Darunter fanden sich 18 Gesunde, das sogenannte Kontrollkollektiv, 12 Patienten mit koronarer
16 3 Ergebnisse 3.1 Patientenkollektiv In unserer Studie wurden insgesamt 55 Patientinnen und Patienten untersucht. Darunter fanden sich 18 Gesunde, das sogenannte Kontrollkollektiv, 12 Patienten mit koronarer
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie
 Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Energiestoffwechseldiagnostik
 HNT von 1911 e.v. Straße Cuxhavener Str. 253 Ort 21149 Hamburg fithus@hntonline.de Telefon 040-7015774 Energiestoffwechseldiagnostik 11.10.2013 Name: xxx xxx Testmethode: aeroscan Alter: 30 Trainingsgerät:
HNT von 1911 e.v. Straße Cuxhavener Str. 253 Ort 21149 Hamburg fithus@hntonline.de Telefon 040-7015774 Energiestoffwechseldiagnostik 11.10.2013 Name: xxx xxx Testmethode: aeroscan Alter: 30 Trainingsgerät:
Institut für Prävention & Sportmedizin in der Klinik am Homberg Leistungsdiagnostik
 Institut für Prävention & Sportmedizin in der Klinik am Homberg Leistungsdiagnostik 02.05.2007 vaterdrdr_ 1 Ziel der Leistungsdiagnostik: Zu untersuchen Zu dokumentieren, beschreiben und beurteilen = Ist-Zustand
Institut für Prävention & Sportmedizin in der Klinik am Homberg Leistungsdiagnostik 02.05.2007 vaterdrdr_ 1 Ziel der Leistungsdiagnostik: Zu untersuchen Zu dokumentieren, beschreiben und beurteilen = Ist-Zustand
Leistungsphysiologie beim Training Heranwachsender
 Leistungsphysiologie beim Training Heranwachsender 1 2 Gert Hillringhaus Jugendwart im Radsport Team Lübeck seit 1999 Jugendleiter des Deutschen Sportbundes (DSB) B-Lizenztrainer des Bundes Deutscher Radfahrer
Leistungsphysiologie beim Training Heranwachsender 1 2 Gert Hillringhaus Jugendwart im Radsport Team Lübeck seit 1999 Jugendleiter des Deutschen Sportbundes (DSB) B-Lizenztrainer des Bundes Deutscher Radfahrer
Wie man in einem heißen Fußball gut abschneidet
 Kurzinput Fussball Massnahmen in grosser Hitze Magglinger Trainertagung. 24.10.2017 Markus Tschopp, Leistungsphysiologe A-NM, EHSM Stephan Meyer, Physiotherapeut A-NM, EHSM Fussball: Leistung in der Hitze
Kurzinput Fussball Massnahmen in grosser Hitze Magglinger Trainertagung. 24.10.2017 Markus Tschopp, Leistungsphysiologe A-NM, EHSM Stephan Meyer, Physiotherapeut A-NM, EHSM Fussball: Leistung in der Hitze
Biomechanik im Sporttheorieunterricht
 Betrifft 1 Biomechanische Prinzipien 33 DR. MARTIN HILLEBRECHT Das biomechanische Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges 1 BIOMECHANISCHE PRINZIPIEN HOCHMUTH nennt bei der Aufzählung der Aufgaben der
Betrifft 1 Biomechanische Prinzipien 33 DR. MARTIN HILLEBRECHT Das biomechanische Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges 1 BIOMECHANISCHE PRINZIPIEN HOCHMUTH nennt bei der Aufzählung der Aufgaben der
4 Ergebnisse. Ergebnisse
 4 4.1 Entwicklung der Körpertemperatur und der Wärmeproduktion bei Enten- und Hühnerembryonen in Abhängigkeit vom Alter bei normaler Bruttemperatur Im untersuchten Abschnitt der Embryonalentwicklung stieg
4 4.1 Entwicklung der Körpertemperatur und der Wärmeproduktion bei Enten- und Hühnerembryonen in Abhängigkeit vom Alter bei normaler Bruttemperatur Im untersuchten Abschnitt der Embryonalentwicklung stieg
Disziplinspezifische Ausdauer
 Trainingslehre Disziplinspezifische Ausdauer 09-1df Begriff Aerobe Kapazität Aerobe Leistungsfähigkeit Disziplinspezifische Ausdauer Schnelligkeitsausdauer (Anaerob Leistungsfähigkeit) Anaerob laktazide
Trainingslehre Disziplinspezifische Ausdauer 09-1df Begriff Aerobe Kapazität Aerobe Leistungsfähigkeit Disziplinspezifische Ausdauer Schnelligkeitsausdauer (Anaerob Leistungsfähigkeit) Anaerob laktazide
Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint?
 Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint? Diese Untersuchung wurde an einem Kühlschrank durchgeführt, an dem ein Lüfter zur Verbesserung der Kühlwirkung eingebaut
Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint? Diese Untersuchung wurde an einem Kühlschrank durchgeführt, an dem ein Lüfter zur Verbesserung der Kühlwirkung eingebaut
Mirja Maassen, Oliver Kummer & Norbert Maassen (Projektleiter) Medizinische Hochschule Hannover AB Sportphysiologie/Sportmedizin
 109 Die Auswirkungen der Kohlenhydratgabe während eines hochintensiven, intervallartigen Trainings auf die Ausdauerleistungs-, Sprint- und Regenerationsfähigkeit 1 Einleitung Mirja Maassen, Oliver Kummer
109 Die Auswirkungen der Kohlenhydratgabe während eines hochintensiven, intervallartigen Trainings auf die Ausdauerleistungs-, Sprint- und Regenerationsfähigkeit 1 Einleitung Mirja Maassen, Oliver Kummer
4. Ergebnisbeschreibung
 4. Ergebnisbeschreibung 4.1. Charakterisierung der Stichprobe Tab.4 Charakteristik der Gruppen zum Prä-Messzeitpunkt (Basline), ie Konrollgruppe (n0 = 14), Galileo-Gruppe (n1 = 15) und Power-Plate-Gruppe
4. Ergebnisbeschreibung 4.1. Charakterisierung der Stichprobe Tab.4 Charakteristik der Gruppen zum Prä-Messzeitpunkt (Basline), ie Konrollgruppe (n0 = 14), Galileo-Gruppe (n1 = 15) und Power-Plate-Gruppe
Bei Fragen können Sie uns jeder Zeit kontaktieren, immer erreichbar via , gerne aber auch per Telefon.
 Rupprecht Lange Lehrer-Tal-Weg 4 89075 Ulm Herr Rupprecht Lange Joh.-Seb.-Bachstr. 10 89264 Weißenhorn Kundennummer: 47 Testauswertung Laufbandtest vom 01.05.2008 Der Test wurde um 10:00:00 Uhr in Ulm
Rupprecht Lange Lehrer-Tal-Weg 4 89075 Ulm Herr Rupprecht Lange Joh.-Seb.-Bachstr. 10 89264 Weißenhorn Kundennummer: 47 Testauswertung Laufbandtest vom 01.05.2008 Der Test wurde um 10:00:00 Uhr in Ulm
Energie Report +DQV 0XVWHU
 Energie Report WAS WIRD BEI DER ASSESSMENT DES LIFESTYLES GEMESSEN? Herzschlag 845ms 750ms Herzfrequenzvariabilität Die Lifestyle Assessment hilft Ihnen dabei, den Stress zu bewältigen, sich besser zu
Energie Report WAS WIRD BEI DER ASSESSMENT DES LIFESTYLES GEMESSEN? Herzschlag 845ms 750ms Herzfrequenzvariabilität Die Lifestyle Assessment hilft Ihnen dabei, den Stress zu bewältigen, sich besser zu
Direkte und indirekte Messbarkeit von Bewegung
 Direkte und indirekte Messbarkeit von Bewegung Johannes Käsebieter, Mellendorf (In diesem Referat wird nur der Aspekt des Energieverbrauchs von Bewegung angesprochen.) Was ist Bewegung? Definition Bewegung:
Direkte und indirekte Messbarkeit von Bewegung Johannes Käsebieter, Mellendorf (In diesem Referat wird nur der Aspekt des Energieverbrauchs von Bewegung angesprochen.) Was ist Bewegung? Definition Bewegung:
Herzlichen Glückwunsch
 2/2 Vergleich der Belastungsparameter beim Walking und Nordic Walking M. Wiek, A. Verdonck, E. Jakob Abteilung Sportmedizin Sportklinik Hellersen, Lüdenscheid Herzlichen Glückwunsch Mit Unterstützung der
2/2 Vergleich der Belastungsparameter beim Walking und Nordic Walking M. Wiek, A. Verdonck, E. Jakob Abteilung Sportmedizin Sportklinik Hellersen, Lüdenscheid Herzlichen Glückwunsch Mit Unterstützung der
Energiebereitstellung. Repetion/Vertiefung Trainer B Internationale Literatur
 Energiebereitstellung Repetion/Vertiefung Trainer B Internationale Literatur Jede Muskelzelle ist für die Energiebereitstellung selbst verantwortlich. Chemische Energie wird in mechanische Energie umgewandelt.
Energiebereitstellung Repetion/Vertiefung Trainer B Internationale Literatur Jede Muskelzelle ist für die Energiebereitstellung selbst verantwortlich. Chemische Energie wird in mechanische Energie umgewandelt.
Ausdauertest an Kardiogeräten im Fitnessstudio
 Ausdauertest an Kardiogeräten im Fitnessstudio Laufbandtest: Ein Schüler läuft auf dem Laufband, sein Partner erhöht alle zwei Minuten die Geschwindigkeit um 2 km/h. (immer schon 10 Sekunden vor dem Ablauf
Ausdauertest an Kardiogeräten im Fitnessstudio Laufbandtest: Ein Schüler läuft auf dem Laufband, sein Partner erhöht alle zwei Minuten die Geschwindigkeit um 2 km/h. (immer schon 10 Sekunden vor dem Ablauf
TRAININGSLEHRE Übungsaufgabe zum Thema Ausdauer
 TRAININGSLEHRE Übungsaufgabe zum Thema Ausdauer AUFGABE Der äthiopische Wunderläufer Haile Gebrselassie, der 1989 im Alter von 16 Jahren als weitgehend unbekannter Athlet sowohl über 5000 Meter als auch
TRAININGSLEHRE Übungsaufgabe zum Thema Ausdauer AUFGABE Der äthiopische Wunderläufer Haile Gebrselassie, der 1989 im Alter von 16 Jahren als weitgehend unbekannter Athlet sowohl über 5000 Meter als auch
Mittelwert, Standardabweichung, Median und Bereich für alle durchgeführten Messungen (in Prozent)
 3. Ergebnisse 3.1 Kennwerte, Boxplot Die Kennwerte der deskriptiven Statistik sind in der Tabelle 1 für alle Messungen, in der Tabelle 2 für die Messungen, bei denen mit der Referenzmethode eine festgestellt
3. Ergebnisse 3.1 Kennwerte, Boxplot Die Kennwerte der deskriptiven Statistik sind in der Tabelle 1 für alle Messungen, in der Tabelle 2 für die Messungen, bei denen mit der Referenzmethode eine festgestellt
FIRSTBEAT SPORTS BEISPIELBERICHTE
 FIRSTBEAT SPORTS BEISPIELBERICHTE Trainingsbericht Person: Datum: 11.12.215 Hintergrundinformationen Alter 27 Größe (cm) 184 Gewicht (kg) 79 Ruhe-HF 34 Maximale HF Aktivitätsklasse 8 Athlete (Example)
FIRSTBEAT SPORTS BEISPIELBERICHTE Trainingsbericht Person: Datum: 11.12.215 Hintergrundinformationen Alter 27 Größe (cm) 184 Gewicht (kg) 79 Ruhe-HF 34 Maximale HF Aktivitätsklasse 8 Athlete (Example)
Literatursuche und -studium
 621.025 Aktuelle Forschung in der Trainingswissenschaft Burtscher/Vogt VO 2 Literatursuche und -studium Wo suchen Sie? z.b. Literaturdatenbanken wie PubMed, SPOLIT,.. Ergänzungen und Einschätzungen? Evaluationskriterien
621.025 Aktuelle Forschung in der Trainingswissenschaft Burtscher/Vogt VO 2 Literatursuche und -studium Wo suchen Sie? z.b. Literaturdatenbanken wie PubMed, SPOLIT,.. Ergänzungen und Einschätzungen? Evaluationskriterien
Bewegung ist im Leben nicht alles doch ohne Bewegung ist alles nichts!
 Bewegung ist im Leben nicht alles doch ohne Bewegung ist alles nichts! Gesundheitstipps für ein bewegtes langes Leben auch bei Krankheit und Behinderung Priv.-Doz. Dr. med. habil. Dr. iur. Heiko Striegel
Bewegung ist im Leben nicht alles doch ohne Bewegung ist alles nichts! Gesundheitstipps für ein bewegtes langes Leben auch bei Krankheit und Behinderung Priv.-Doz. Dr. med. habil. Dr. iur. Heiko Striegel
AKTIVE REGENERATION DURCH SELBSTMASSAGE
 AKTIVE REGENERATION DURCH SELBSTMASSAGE Autoren: Jonathan Schmitt, Gabriel Kunzer 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Einleitung Theoretische Grundlagen Arbeitsmaterial o Massage des Rückenstreckers (1)
AKTIVE REGENERATION DURCH SELBSTMASSAGE Autoren: Jonathan Schmitt, Gabriel Kunzer 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Einleitung Theoretische Grundlagen Arbeitsmaterial o Massage des Rückenstreckers (1)
von Markus Kühn Teil I
 von Markus Kühn Teil I Kraft spielt als Basisfähigkeit für viele Bewegungen eine bedeutende Rolle. Die zunehmende Automatisation und die Technisierung geht bei vielen Menschen mit einer Abnahme der körperlichen
von Markus Kühn Teil I Kraft spielt als Basisfähigkeit für viele Bewegungen eine bedeutende Rolle. Die zunehmende Automatisation und die Technisierung geht bei vielen Menschen mit einer Abnahme der körperlichen
Wirkung des Cross-Shapers auf die Herzfrequenz, die Sauerstoffaufnahme und den Energieverbrauch beim Walking
 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Henkestrasse 91 D - 91052 Erlangen Germany Wirkung des Cross-Shapers auf die Herzfrequenz, die Sauerstoffaufnahme und den Energieverbrauch beim Hintergrund
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Henkestrasse 91 D - 91052 Erlangen Germany Wirkung des Cross-Shapers auf die Herzfrequenz, die Sauerstoffaufnahme und den Energieverbrauch beim Hintergrund
Kennen Sie Ihren echten Kalorienverbrauch? Ermitteln Sie ihn ganz einfach mit einem SenseWear Monitoring Armband!
 Kennen Sie Ihren echten Kalorienverbrauch? Ermitteln Sie ihn ganz einfach mit einem SenseWear Monitoring Armband! Zertifiziert als Medizinprodukt Welche Daten liefert das SenseWear Armband? Exakter Kalorienverbrauch
Kennen Sie Ihren echten Kalorienverbrauch? Ermitteln Sie ihn ganz einfach mit einem SenseWear Monitoring Armband! Zertifiziert als Medizinprodukt Welche Daten liefert das SenseWear Armband? Exakter Kalorienverbrauch
7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern
 Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
Spiroergometrie. Zentrum für Prävention und Sportmedizin
 Klinikum rechts der Isar Technische Universität München Zentrum für Prävention und Sportmedizin Spiroergometrie Feststellung der Leistung von Herz, Lunge und Muskulatur Trainingssteuerung und Leistungskontrolle
Klinikum rechts der Isar Technische Universität München Zentrum für Prävention und Sportmedizin Spiroergometrie Feststellung der Leistung von Herz, Lunge und Muskulatur Trainingssteuerung und Leistungskontrolle
Leistungstests Trainingssteuerung und -kontrolle in der Praxis
 1 2 Gert Hillringhaus (Dipl.-Ing.), Fachhochschule Lübeck A-Trainer Leistungssport, Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) Jugendleiter, Deutsche Sportjugend (dsj) Autor der Richtlinien für Trainerausbilung
1 2 Gert Hillringhaus (Dipl.-Ing.), Fachhochschule Lübeck A-Trainer Leistungssport, Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) Jugendleiter, Deutsche Sportjugend (dsj) Autor der Richtlinien für Trainerausbilung
Die Wirkung von AminoSkin Power und AminoSkin Endurance auf Herzfrequenz, Laktatentwicklung und Leistungsfähigkeit bei einem Profiradsportler
 Die Wirkung von AminoSkin Power und AminoSkin Endurance auf Herzfrequenz, Laktatentwicklung und Leistungsfähigkeit bei einem Profiradsportler EINLEITUNG/DURCHFÜHRUNG Untersucht wurden die Wirkung von AminoSkin
Die Wirkung von AminoSkin Power und AminoSkin Endurance auf Herzfrequenz, Laktatentwicklung und Leistungsfähigkeit bei einem Profiradsportler EINLEITUNG/DURCHFÜHRUNG Untersucht wurden die Wirkung von AminoSkin
Energieverbrauch > 5.000 kcal/woche durch Training = mind. 6 Std. intensives Training!!! Ernährung (Essen + Trinken!) der letzten Hauptmahlzeit vor
 Energieverbrauch > 5.000 kcal/woche durch Training = mind. 6 Std. intensives Training!!! Ernährung (Essen + Trinken!) der letzten Hauptmahlzeit vor der Belastung, unmittelbar vor der Belastung, während
Energieverbrauch > 5.000 kcal/woche durch Training = mind. 6 Std. intensives Training!!! Ernährung (Essen + Trinken!) der letzten Hauptmahlzeit vor der Belastung, unmittelbar vor der Belastung, während
Die aerobe Ausdauer. Beispiel: Die HF an der IAS sei 160 Schläge/min. Die Grundlagenausdauer 1 (GA 1) läge dann zwischen 112 und 136/min.
 Die aerobe Ausdauer Die Energiegewinnung erfolgt durch den Abbau von Fettsäuren und/oder Glukose unter Sauerstoffverbrauch (Oxidation). Es werden zwei Unterformen unterschieden: Die extensiv-aerobe Ausdauer
Die aerobe Ausdauer Die Energiegewinnung erfolgt durch den Abbau von Fettsäuren und/oder Glukose unter Sauerstoffverbrauch (Oxidation). Es werden zwei Unterformen unterschieden: Die extensiv-aerobe Ausdauer
Phallosan-Studie. Statistischer Bericht
 Phallosan-Studie Statistischer Bericht Verfasser: Dr. Clemens Tilke 15.04.2005 1/36 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Einleitung... 3 Alter der Patienten... 4 Körpergewicht... 6 Penisumfang...
Phallosan-Studie Statistischer Bericht Verfasser: Dr. Clemens Tilke 15.04.2005 1/36 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Einleitung... 3 Alter der Patienten... 4 Körpergewicht... 6 Penisumfang...
Biomechanik im Sporttheorieunterricht
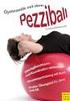 Betrifft 22 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Grafische Schwerpunktbestimmung - 1. EINLEITUNG Im ersten Teil diese Artikels (vgl. Betrifft Sport 4/ 98) wurden zwei Verfahren
Betrifft 22 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Grafische Schwerpunktbestimmung - 1. EINLEITUNG Im ersten Teil diese Artikels (vgl. Betrifft Sport 4/ 98) wurden zwei Verfahren
5 Ergebnisse. 5.1 Statistik. 5.2 Kalibrierung. Ergebnisse 49
 Ergebnisse 49 5 Ergebnisse 5.1 Statistik Der Kolmogorov-Smirnow-Test ist ein statistischer Test auf Übereinstimmung zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Das kann ein Vergleich der Verteilungen zweier
Ergebnisse 49 5 Ergebnisse 5.1 Statistik Der Kolmogorov-Smirnow-Test ist ein statistischer Test auf Übereinstimmung zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Das kann ein Vergleich der Verteilungen zweier
Teil I: Schmecken Kölsch und Alt unterschiedlich?
 Teil I: Schmecken Kölsch und Alt unterschiedlich? Der Düsseldorfer Hochschulprofessor Helmut Quack hat ein Experiment durchgeführt, um nachzuweisen, dass sich Kölsch und Alt im Geschmack nicht unterscheiden.
Teil I: Schmecken Kölsch und Alt unterschiedlich? Der Düsseldorfer Hochschulprofessor Helmut Quack hat ein Experiment durchgeführt, um nachzuweisen, dass sich Kölsch und Alt im Geschmack nicht unterscheiden.
1. Inhaltsverzeichnis. 2. Abbildungsverzeichnis
 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis... 1 2. Abbildungsverzeichnis... 1 3. Einleitung... 2 4. Beschreibung der Datenquelle...2 5. Allgemeine Auswertungen...3 6. Detaillierte Auswertungen... 7 Zusammenhang
1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis... 1 2. Abbildungsverzeichnis... 1 3. Einleitung... 2 4. Beschreibung der Datenquelle...2 5. Allgemeine Auswertungen...3 6. Detaillierte Auswertungen... 7 Zusammenhang
HERZFREQUENZ VARIABILITÄT
 Neu Möglichkeiten in der Trainingssteuerung dank HERZFREQUENZ VARIABILITÄT Grundprinzip der HVF: Im Ruhezustand schlägt das Herz langsam aber unregelmässig (hohe HRV) Während sportlicher Aktivität ist
Neu Möglichkeiten in der Trainingssteuerung dank HERZFREQUENZ VARIABILITÄT Grundprinzip der HVF: Im Ruhezustand schlägt das Herz langsam aber unregelmässig (hohe HRV) Während sportlicher Aktivität ist
Ausdauertraining Wie, Was, Warum?
 Ausdauertraining Wie, Was, Warum? Ausdauer, wie sie für Sportarten wie Laufen, Velofahren, Langlaufen etc. nötig ist, wird nur bei "richtigem" Training optimal gefördert. Es ist nicht zwangsläufig so,
Ausdauertraining Wie, Was, Warum? Ausdauer, wie sie für Sportarten wie Laufen, Velofahren, Langlaufen etc. nötig ist, wird nur bei "richtigem" Training optimal gefördert. Es ist nicht zwangsläufig so,
Trainingsmethodische Grundlagen des Ausdauertrainings
 Trainingsmethodische Grundlagen des Ausdauertrainings Was ist Ausdauer? HOLLMANN; HETTINGER, 1980: Ausdauer ist identisch mit Ermüdungswiderstandsf dungswiderstandsfähigkeit. CONZELMANN, 1994: Ausdauer
Trainingsmethodische Grundlagen des Ausdauertrainings Was ist Ausdauer? HOLLMANN; HETTINGER, 1980: Ausdauer ist identisch mit Ermüdungswiderstandsf dungswiderstandsfähigkeit. CONZELMANN, 1994: Ausdauer
in der Sportwissenschaft 2. Jahrestagung der SGS, 6. März 2010 Institut für Anatomie, Universität Bern, Baltzerstrasse 2, 3012 Bern 2
 Testen zur sportlichen Talentselektion: Sporttestdatenbank und sportmotorische Tests im Skiverband Thomas Rosser 1 & Michael Vogt 1,2,3 rosser@ana.unibe.ch Testen und Messen in der Sportwissenschaft 2.
Testen zur sportlichen Talentselektion: Sporttestdatenbank und sportmotorische Tests im Skiverband Thomas Rosser 1 & Michael Vogt 1,2,3 rosser@ana.unibe.ch Testen und Messen in der Sportwissenschaft 2.
Ringversuchsorganisation, Durchführung und Auswertung Klara Leclercq, Rosemarie Gosemärker, Shaike Landau, Yury Chernov, Claudia Caspers
 Ergebnis des Ringversuchs in der Handschriftanalyse: Ermittlung des s in vier verschiedenen Handschriften Ringversuchsorganisation, Durchführung und Auswertung Klara Leclercq, Rosemarie Gosemärker, Shaike
Ergebnis des Ringversuchs in der Handschriftanalyse: Ermittlung des s in vier verschiedenen Handschriften Ringversuchsorganisation, Durchführung und Auswertung Klara Leclercq, Rosemarie Gosemärker, Shaike
Material. Trainingsplan. Laufen
 Trainingsplan Laufen Trainingsplan Laufen Bevor es losgeht Laufen ist eine ideale Sportart für Fortgeschrittene, um Ausdauer und Figur zu verbessern. Sie brauchen keine Hochleistungsschuhe fürs Laufen,
Trainingsplan Laufen Trainingsplan Laufen Bevor es losgeht Laufen ist eine ideale Sportart für Fortgeschrittene, um Ausdauer und Figur zu verbessern. Sie brauchen keine Hochleistungsschuhe fürs Laufen,
Sportbiologische Grundlagen und Trainingslehre
 Inhalt Sportbiologische Grundlagen und Trainingslehre PD Dr. sc. nat. Claudio Perret Sportmedizin Nottwil Herz-Kreislauf-System, Atmung und Muskel Energiebereitstellung Trainingsgrundsätze / Superkompensation
Inhalt Sportbiologische Grundlagen und Trainingslehre PD Dr. sc. nat. Claudio Perret Sportmedizin Nottwil Herz-Kreislauf-System, Atmung und Muskel Energiebereitstellung Trainingsgrundsätze / Superkompensation
Trainingslehre - Ausdauer. Ausdauer. Das zentrale Thema der Trainingslehre im Pflichtfach Sport! Folie 1
 Ausdauer Das zentrale Thema der Trainingslehre im Pflichtfach Sport! Folie 1 Ausdauer 1. Lohnt sich Ausdauertraining? 2. Energiebereitstellung in der Muskelzelle und Funktion des Herz-Kreislauf-Systems
Ausdauer Das zentrale Thema der Trainingslehre im Pflichtfach Sport! Folie 1 Ausdauer 1. Lohnt sich Ausdauertraining? 2. Energiebereitstellung in der Muskelzelle und Funktion des Herz-Kreislauf-Systems
Sportmedizin. Leistungsdiagnostik: Spiroergometrie. Dr. med. Birgit Friedmann, Abteilung Innere Medizin VII: Sportmedizin
 Sportmedizin Leistungsdiagnostik: Spiroergometrie Dr. med. Birgit Friedmann, Abteilung Innere Medizin VII: Sportmedizin Spiroergometrie zur Objektivierung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit Leistungssportler
Sportmedizin Leistungsdiagnostik: Spiroergometrie Dr. med. Birgit Friedmann, Abteilung Innere Medizin VII: Sportmedizin Spiroergometrie zur Objektivierung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit Leistungssportler
Untersuchung des Einflusses von Laktat auf die maximale Sprintleistung mit Hilfe eines modifizierten Feldstufentests
 Sport Jonathan Januschke Untersuchung des Einflusses von Laktat auf die maximale Sprintleistung mit Hilfe eines modifizierten Feldstufentests Diplomarbeit Diplomarbeit im Diplomstudiengang Sportwissenschaft
Sport Jonathan Januschke Untersuchung des Einflusses von Laktat auf die maximale Sprintleistung mit Hilfe eines modifizierten Feldstufentests Diplomarbeit Diplomarbeit im Diplomstudiengang Sportwissenschaft
Institut für medizinische Physik, 2 Institut für Sportwissenschaft und Sport, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Henkestrasse 91 D - 91054 Erlangen Germany Einfluss eines 10-wöchigen Walking-rogramms mit dem Xco-Trainer auf die Ausdauerleistungsfähigkeit und weitere
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Henkestrasse 91 D - 91054 Erlangen Germany Einfluss eines 10-wöchigen Walking-rogramms mit dem Xco-Trainer auf die Ausdauerleistungsfähigkeit und weitere
Peter Spitzenpfeil (Projektleiter), Maren Goll & Michael Wiedemann. TU München, Fakultät für Sport und Gesundheitswissenschaft
 63 Entwicklung einer sportart- und behinderungsspezifischen Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung im alpinen Skirennlauf der Behinderten auf der Basis von auftretenden Belastungen und Beanspruchungen
63 Entwicklung einer sportart- und behinderungsspezifischen Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung im alpinen Skirennlauf der Behinderten auf der Basis von auftretenden Belastungen und Beanspruchungen
FIRSTBEAT SPORTS BEISPIELBERICHTE
 FIRSTBEAT SPORTS BEISPIELBERICHTE Trainingsbericht Person: Datum: Alter 24 Größe (cm) 184 Gewicht (kg) 79 Ruhe-HF 34 Maximale HF Aktivitätsklasse 8 Athlet (Beispiel) Max 11.12.212 Hintergrundinformationen
FIRSTBEAT SPORTS BEISPIELBERICHTE Trainingsbericht Person: Datum: Alter 24 Größe (cm) 184 Gewicht (kg) 79 Ruhe-HF 34 Maximale HF Aktivitätsklasse 8 Athlet (Beispiel) Max 11.12.212 Hintergrundinformationen
Ausdauertraining mit UNIQA VitalCoach Lukas Kummerer
 Ausdauertraining mit UNIQA VitalCoach Lukas Kummerer Seite 2 1. Ihre Ruheherzfrequenz ist a) Der Blutdruck in Ruhe b) Der Herzschlag, wenn man Sie in Ruhe lässt c) Die Anzahl Ihrer Herzschläge pro Minute
Ausdauertraining mit UNIQA VitalCoach Lukas Kummerer Seite 2 1. Ihre Ruheherzfrequenz ist a) Der Blutdruck in Ruhe b) Der Herzschlag, wenn man Sie in Ruhe lässt c) Die Anzahl Ihrer Herzschläge pro Minute
Konditionellen Substanz Ausdauer. Modul Physis I / / Zuchwil. Einordnung im Modell. Bundesamt für Sport Jugend+Sport
 Konditionellen Substanz Ausdauer Modul Physis I / 22.-23.4.2017/ Zuchwil Einordnung im Modell 2 22 1 Stoffwechsel: Baustoffwechsel Wachstum und Erneuerung durch Zellteilung und mit Eiweissbestandteilen
Konditionellen Substanz Ausdauer Modul Physis I / 22.-23.4.2017/ Zuchwil Einordnung im Modell 2 22 1 Stoffwechsel: Baustoffwechsel Wachstum und Erneuerung durch Zellteilung und mit Eiweissbestandteilen
Auswirkungen von Ausdauersport auf kardiovaskuläre Veränderungen
 Auswirkungen von Ausdauersport auf kardiovaskuläre Veränderungen Definition von kardiovaskulär Kardiovaskulär bedeutet Herz ( kardio ) und Gefäße ( vaskulär ) betreffend. Da Herz und Gefäße ein System
Auswirkungen von Ausdauersport auf kardiovaskuläre Veränderungen Definition von kardiovaskulär Kardiovaskulär bedeutet Herz ( kardio ) und Gefäße ( vaskulär ) betreffend. Da Herz und Gefäße ein System
3 ERGEBNISSE. 3.1 Ausschluss- und Abbruchursachen
 31 3 ERGEBNISSE 3.1 Ausschluss- und Abbruchursachen Zu Beginn der Studie wurden 187 Screening-Untersuchungen durchgeführt. 114 Probandinnen konnten nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse nicht in die
31 3 ERGEBNISSE 3.1 Ausschluss- und Abbruchursachen Zu Beginn der Studie wurden 187 Screening-Untersuchungen durchgeführt. 114 Probandinnen konnten nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse nicht in die
Erythrozyten-Verformbarkeit und Training
 Forschungskolloquium Erythrozyten-Verformbarkeit und Training Dr. Marijke Grau Verformbarkeit Fähigkeit des Erythrozyten seine Form den dynamischen Bedingungen des Blutflusses anzupassen Kapillarpassage
Forschungskolloquium Erythrozyten-Verformbarkeit und Training Dr. Marijke Grau Verformbarkeit Fähigkeit des Erythrozyten seine Form den dynamischen Bedingungen des Blutflusses anzupassen Kapillarpassage
Facts over clichés. oder. weniger Muskel- und mehr Hirnmasse?
 Sport- vs. Zahnmedizinstudenten Facts over clichés oder hat der gemeine Zahnmediziner wirklich weniger Muskel- und mehr Hirnmasse? Bauer, J.; Kemmler, W.; v. Stengel, S.; Möller, K,, ;, ; g, ;,, Pintag,
Sport- vs. Zahnmedizinstudenten Facts over clichés oder hat der gemeine Zahnmediziner wirklich weniger Muskel- und mehr Hirnmasse? Bauer, J.; Kemmler, W.; v. Stengel, S.; Möller, K,, ;, ; g, ;,, Pintag,
PersonalTraining Ronny Seeger
 PersonalTraining Ronny Seeger Krafttraining durch Elektromyostimulation? Empirische Untersuchung zu den Krafteffekten bei einem Elektromyostimulationstraining am BodyTransformermit Variation der Belastungsdichte.
PersonalTraining Ronny Seeger Krafttraining durch Elektromyostimulation? Empirische Untersuchung zu den Krafteffekten bei einem Elektromyostimulationstraining am BodyTransformermit Variation der Belastungsdichte.
Tab.3: Kontrollgruppe: Glukose- und Insulin-Serumkonzentration sowie Insulinbindung pro 1 Million Monozyten (n=3) während der Infusion von 0,9% NaCl
 4 Ergebnisse 4.1 Kontrollgruppe Bei den Untersuchungen der Kontrollgruppe wurde keine Veränderung der Insulinbindung der Monozyten festgestellt. (P>,; n.s.; t-test für verbundene Stichproben) Während der
4 Ergebnisse 4.1 Kontrollgruppe Bei den Untersuchungen der Kontrollgruppe wurde keine Veränderung der Insulinbindung der Monozyten festgestellt. (P>,; n.s.; t-test für verbundene Stichproben) Während der
Baden 04/2012 PD Dr. med. J-P Schmid 2
 Neue Erkenntnisse zum Ausdauertraining beim Herzpatienten PD Dr. med. Jean-Paul Schmid Bestimmung der Belastungsintensität Negatives Remodeling (Zunahme des Durch- messers des linken Ventrikels) Arrhythmien
Neue Erkenntnisse zum Ausdauertraining beim Herzpatienten PD Dr. med. Jean-Paul Schmid Bestimmung der Belastungsintensität Negatives Remodeling (Zunahme des Durch- messers des linken Ventrikels) Arrhythmien
Moderne sportmedizinische Leistungsdiagnostik für Profis und Amateure
 Moderne sportmedizinische Leistungsdiagnostik für Profis und Amateure Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin empfiehlt nicht nur Leistungssportlern regelmäßige sportmedizinische Untersuchungen nach
Moderne sportmedizinische Leistungsdiagnostik für Profis und Amateure Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin empfiehlt nicht nur Leistungssportlern regelmäßige sportmedizinische Untersuchungen nach
Projekt Erfassung Stockkräfte
 Projekt Erfassung Stockkräfte 2011-2015 Walter Rapp Institut für Sport und Sportwissenschaft, Universität Freiburg Veit Wank, Institut für Sportwissenschaft, Universität Tübingen Kraftmessplatten im Schnee
Projekt Erfassung Stockkräfte 2011-2015 Walter Rapp Institut für Sport und Sportwissenschaft, Universität Freiburg Veit Wank, Institut für Sportwissenschaft, Universität Tübingen Kraftmessplatten im Schnee
Ausdauerdiagnostik im Mannschaftssport
 Dekompressor AVID Cinema - JPEG benötigt. Ausdauerdiagnostik im Mannschaftssport Andreas Nieß Medizinische Universitätsklinik Tübingen Abteilung Sportmedizin http://www.medizin.uni-tuebingen.de/sportmedizin
Dekompressor AVID Cinema - JPEG benötigt. Ausdauerdiagnostik im Mannschaftssport Andreas Nieß Medizinische Universitätsklinik Tübingen Abteilung Sportmedizin http://www.medizin.uni-tuebingen.de/sportmedizin
PersonalTraining Ronny Seeger
 PersonalTraining Ronny Seeger Krafttraining durch Elektromyostimulation? Empirische Untersuchung zu den Krafteffekten bei einem Eiektromyostimuiationstraining am Body Transformer mit Variation der Trainingsdauer.
PersonalTraining Ronny Seeger Krafttraining durch Elektromyostimulation? Empirische Untersuchung zu den Krafteffekten bei einem Eiektromyostimuiationstraining am Body Transformer mit Variation der Trainingsdauer.
Trainingsherzfrequenz
 Trainingsherzfrequenz Gemeinschaftspraxis Diabetologische Schwerpunktpraxis Hausärztliche Versorgung Gelbfieberimpfstelle Dr. med. Ottmar Orth Dr. med. Silke Orth Dr. med. Patrick Kudielka Facharzt für
Trainingsherzfrequenz Gemeinschaftspraxis Diabetologische Schwerpunktpraxis Hausärztliche Versorgung Gelbfieberimpfstelle Dr. med. Ottmar Orth Dr. med. Silke Orth Dr. med. Patrick Kudielka Facharzt für
