der gesamten Brust- und Lendenwirbelsäule.
|
|
|
- Theodor Melsbach
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Unfallchirurg : DOI /s Online publiziert: 28. Januar 2009 Springer Medizin Verlag 2009 Redaktion W. Mutschler, München M. Reinhold 1 C. Knop 1 R. Beisse 2 L. Audigé 3 F. Kandziora 4 A. Pizanis 5 R. Pranzl 6 E. Gercek 7 M. Schultheiss 8 A. Weckbach 9 V. Bühren 2 M. Blauth 1 1 Universitätsklinik für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie, Medizinische Universität Innsbruck 2 Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau 3 AO Clinical Investigation and Documentation (AOCID), Dübendorf 4 Centrum für muskuloskeletale Chirurgie, Charité Berlin 5 Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Universitätsklinikum, Homburg/Saar 6 Unfallkrankenhaus Klagenfurt 7 Universitätsklinik für Unfallchirurgie Mainz 8 Universitätsklinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie, Ulm 9 Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie der Universität Würzburg Operative Behandlung traumatischer Frakturen der Brust- und Lendenwirbelsäule Teil II: Operation und röntgenologische Befunde Die Autoren berichteten im ersten Teil der Arbeit über den Aufbau und Ablauf der zweiten internetbasierten Multicenterstudie (MCS II) der Arbeitsgemeinschaft Wirbelsäule (AGWS) der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zur operativen Behandlung von frischen Verletzungen der gesamten Brust- und Lendenwirbelsäule. Folgende Gründe führten zu dem Entschluss, eine neue Sammelstudie aufzulegen. Während der vergangenen 10 Jahre haben sich Operationsmethoden drastisch weiterentwickelt. Stellvertretend für die Entwicklung seien endoskopische Operationstechniken, Wirbelkörperersatzimplantate und Wirbelkörperaugmentationsverfahren genannt. Diese standen während der ersten Multicenterstudie noch nicht zur Verfügung und es liegen bisher wenig aussagekräftige Ergebnisse zu diesen Techniken vor. Gleichzeitig sollte die Studie auf die Regionen der Brust- (BWS) und Lendenwirbelsäule (LWS) ausgedehnt werden, um spezifische Unterschiede zu den häufigen Verletzungen des thorakolumbalen Übergangs (TLÜ) erfassen zu können. Eine differenzierte Analyse der epidemiologischen Daten des Kollektivs ist im ersten Teil der Publikation zu finden. Im vorliegenden Teil II werden die Details der Behandlung geschildert. Es folgt die Analyse des röntgenologischen Verlaufs anhand bekannter Messgrößen. Ziele Im vorliegenden zweiten Teil des Berichts wird auf folgende Inhalte eingegangen: F Häufigkeit der verschiedenen operativen und nichtoperativen Behandlungskonzepte an den drei Abschnitten der Brust- und Lendenwirbelsäule, F Häufigkeit, Vor- und Nachteile verschiedener Zugangswege, Implantate und Operationstechniken, F Komplikationen der unterschiedlichen Behandlungsverfahren, F Analyse des röntgenologischen Verlaufes bis zur Entlassung. Patienten und Methoden Einschlusskriterien Eingeschlossen wurden alle Patienten mit: F frischen (<3 Wochen nach Unfall), traumatischen Verletzungen von Th1 Prospektive internetbasierte multizentrische Sammelstudie (MCS II) der Arbeitsgemeinschaft Wirbelsäule (AG WS) der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) 149
2 bis L5, die operativ behandelt wurden (Gruppe OP), F konservativ behandelten, frischen (<3 Wochen nach Unfall), traumatischen Verletzungen von Th1 bis L5, sofern ein Kneifzangenbruch (A 2.3) oder schwerer vorlag (Gruppe KONS), F einer Wirbelsäulenverletzung, die mittels Kypho- oder Vertebroplastie behandelt wurde (Gruppe PLASTIE). Ausschlusskriterien Ausgeschlossen wurden kindliche Frakturen (Patientenalter <16 Jahre). Patientendaten aus Kliniken mit einer Nachuntersuchungsrate von weniger als 50% wurden für die Ergebnisanalyse nicht berücksichtigt. Datenbank Zur Erfassung sämtlicher Daten der teilnehmenden Kliniken wurde ein Datenbanksystem des Instituts für evaluative Forschung in orthopädischer Chirurgie der Universität Bern (ehemals Maurice- E.-Müller-Stiftung, Abteilung für Dokumentation und Evaluation) genutzt, das im Rahmen dieser Studie evaluiert [66] und in Teil I dieser Arbeit ausführlich beschrieben wurde. Operationsdaten und radiologische Befunderhebung Die folgenden Parameter wurden in Zusammenhang mit Operation und radiologischer Vermessung bestimmt und ausgewertet: 150 Der Unfallchirurg GDW monoseg. GDW biseg. Abb. 1 9 Vermessung der konventionellen Röntgenbilder in der seitlichen Projektion Radiologische Parameter präoperativ F Wirbelkörper(WK)-Höhenmessung: Wirbelkörpervorderwand und -hinterwand des am schwerstverletzten WK, Hinterkantenhöhe des kranialen und kaudalen WK, F Grunddeckplattenwinkel (GDW) monosegmental (. Abb. 1), F GDW bisegmental (. Abb. 1), F Skoliosewinkel (SKW) bisegmental, F Sagittal-/Seitverschiebung (%), F Einengung des Spinalkanals (CT/ MRT; %), F Befund Myelon und Bandscheibe. Behandlungsdetails F Art der Behandlung, F Operationsdaten: Datum, Operationszeit, intraoperative Durchleuchtungszeit, Blutverlust, Einzelheiten und Angaben zu verwendeten Implantaten, Knochentransplantaten, Wirbelkörperersatz, Zugangsweg und -technik, Pedikelschraubenimplantation, Navigation, Kypho-/ Vertebroplastie, F Komplikationen. Entlassung F Entlassungsdatum, postoperative Komplikationen, Angaben zu Revisionsoperationen, neurologischer Status bei Entlassung (Frankel-/ASIA-Score). Radiologische Parameter postoperativ F Wirbelkörper(WK)-Höhenmessung: Wirbelkörpervorderwand und -hinterwand des am schwerstverletzten WK, Hinterkantenhöhe des kranialen und kaudalen WK, F GDW monosegmental, F GDW bisegmental, F SKW bisegmental, F Sagittal-/Seitverschiebung (%), F Einengung des Spinalkanals (CT/ MRT; %), F Befund Myelon und Bandscheibe. Das Wirbelsäulenprofil wurde in zwei Ebenen jeweils in der a.-p. Aufnahme anhand des bisegmentalen Skoliosewinkels (SKW) und in der seitlichen Aufnahme durch den mono- und bisegmentalen Grunddeckplattenwinkel (GDW) bestimmt. Zusätzlich wurden die Höhe der Wirbelkörperhinterwand beider angrenzender Wirbel nebst Vorder- und Hinterwandhöhe des betroffenen Wirbelkörpers dokumentiert. Aus dem Verhältnis von Vorderwand- und Hinterwandhöhe des verletzten Wirbels wurde der sagittale Index (SI) berechnet. Für die genannten Winkel bedeuten negative Vorzeichen Kyphose bzw. linkskonvexe Skoliose und positive Vorzeichen Lordose bzw. rechtskonvexe Skoliose. Statistische Auswertung Das Datenmanagement und die statistische Auswertung der Ergebnisse erfolgten mit STATA (Version 9, STATA Inc.) und SPSS (Version 13, SPSS Inc.) für Windows. Statistische Tests wurden verwendet, um die Zusammenhänge zwischen radiologischen Parametern, Behandlungsdetails und den klinischen Ergebnissen bis zur Entlassung aus der stationären Behandlung zu untersuchen. Für die statistischen Berechnungen wurden standardisierte Tests (T-, Wilcoxon-, Mann-Whitney-, χ 2 -Test und multivariate Varianzanalyse; ANOVA) verwendet. Ergebnisse Behandlungsgruppen Von 865 Patienten wurden 733 (84,7%) operiert (OP), 52 (6%) nichtoperativ (KONS) und 69 (8,0%) Patienten mit Kypho- oder Vertebroplastie ohne zusätzliche Instrumentierung (PLASTIE) behandelt. In die Behandlungsgruppe
3 Zusammenfassung Abstract Unfallchirurg : Springer Medizin Verlag 2009 DOI /s M. Reinhold C. Knop R. Beisse L. Audigé F. Kandziora A. Pizanis R. Pranzl E. Gercek M. Schultheiss A. Weckbach V. Bühren M. Blauth Operative Behandlung traumatischer Frakturen der Brust- und Lendenwirbelsäule. Teil II: Operation und röntgenologische Befunde Zusammenfassung Die Arbeitsgemeinschaft Wirbelsäule (AG WS) der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) berichtet im vorliegenden zweiten Teil ihrer internetbasierten multizentrischen Sammelstudie (MCS II) zur Behandlung von Verletzungen der gesamten Brust- und Lendenwirbelsäule über die Operation, Behandlungsdetails und radiologische Befunde von insgesamt 865 Patienten. Es handelte sich um 158 (18,3%) Verletzungen der Brustwirbelsäule (BWS), 595 (68,8%) Verletzungen des thorakolumbalen Übergangs (TLÜ) und 112 Verletzungen der Lendenwirbelsäule (LWS). 733 Patienten wurden operativ versorgt (OP). Es wurden 52 Patienten mit einem nichtoperativen Verfahren (KONS) behandelt. 69 Patienten erhielten eine Kypho- oder Vertebroplastie (PLASTIE). In der Behandlungsgruppe OP wurden 380 Patienten (51,8%) isoliert dorsal (DORSAL), 34 (4,6%) ventral (VENTRAL) und 319 (43,5%) kombiniert dorsoventral (KOMBI) stabilisiert. Im Zuge dorsaler und/oder kombinierter Verfahren wurden überwiegend auf winkelstabile Fixateursysteme (86 97%) und ventrale winkelstabile Platten (51,1%) zur Stabilisierung von ein bis zwei Segmentläsionen (72,7%) zurückgegriffen. Insgesamt 188- mal (53,3%) wurden Wirbelkörperersatzimplantate (Cages) durch einen ventralen Zugang zur BWS oder TLÜ überwiegend endoskopisch (67,4%) implantiert. Die durchschnittliche Operationsdauer bei dorsalem (152 min) und ventralem (208 min) Eingriff war kürzer als die der kombinierten Operationen (298 min; p<0,001). Der Blutverlust betrug nach kombiniertem Eingriff durchschnittlich 959 ml gegenüber 650 ml bei dorsalen und 534 ml bei ventralen Verfahren (p<0,001). Computerassistierte Systeme zur intraoperativen Navigation wurden 95-mal eingesetzt. Bei 58,7% aller Patienten lag präoperativ eine unfallbedingte Spinalkanaleinengung von durchschnittlich 36% (5 95%) vor. Die durchschnittliche relative Enge des Spinalkanals lag bei Patienten mit komplettem QS bei 70%, mit inkomplettem QS bei 50% und bei Patienten ohne neurologische Ausfälle bei 20% (p<0,001). In der Behandlungsgruppe PLASTIE lag die durchschnittliche Operationsdauer bei 50 min ( min), um jeweils einen (n=59) oder zwei (n=10) Wirbelkörper zu augmentieren. Zur nichtoperativen Behandlung wurde am häufigsten auf Drei- Punkt-Korsetts (n=36) zurückgegriffen, die für einen Zeitraum von 6 bis 12 Wochen verordnet wurden. Während der stationären Behandlung verbesserten sich 93 von insgesamt 195 (44,7%) Patienten mit initialer neurologischer Begleitverletzung um mindestens eine Frankel-/ASIA-Stufe. Demgegenüber standen zwei (0,2%) neurologische Verschlechterungen. Die höchste Rate kompletter Querschnittslähmungen (n=36; 23%) wurde als Folge von Verletzungen der Brustwirbelsäule beobachtet. Operative treatment of traumatic fractures of the thorax and lumbar spine. Part II: surgical treatment and radiological findings Abstract The Spine Study Group (AG WS) of the German Trauma Association (DGU) presents its second prospective Internet-based multicenter study (MCS II) for the treatment of thoracic and lumbar spinal injuries. This second part of the study report focuses on the surgical treatment, course of treatment, and radiological findings in a study population of 865 patients. A total of 158 (18,3%) thoracic, 595 (68,8%) thoracolumbar, and 112 (12,9%) lumbar spine injuries were treated. Of these, 733 patients received operative treatment (OP group). Fifty-two patients were treated non-operatively and 69 patients were treated with kyphoplasty/vertebroplasty without additional instrumentation (Plasty group). In the OP group, 380 (51.8%) patients were instrumented from a posterior (dorsal) position, 34 (4.6%) from an anterior (ventral) position, and 319 (43.5%) cases with a combined posteroanterior procedure. Angular stable internal spine fixator systems were used in 86 97% of the cases for posterior and/ or combined posteroanterior procedures. For anterior procedures, angular stable plate systems were used in a majority of cases (51.1%) for the instrumentation of mainly one or two segment lesions (72.7%). In 188 cases (53,3%), vertebral body replacement implants (cages) were used and were mainly implanted via endoscopic approaches (67,4%) to the thoracic spine and/or the thoracolumbar junction. The average operating time was 152 min in posterior-, 208 min in anterior-, and 298 min in combined postero-anterior procedures (p<0,001). The average blood loss was highest in combined operations, measuring 959 ml vs. 650 ml in posterior vs. 534 ml in anterior operations (p<0,001). Computer-assisted intraoperative navigation systems were used in 95 cases. At the time of hospital admission, 58,7% of the patients had spinal canal narrowing of an average of 36% (5 95%) at the level of their injury. The average spinal canal narrowing in patients with a complete spinal cord injury (Frankel/ASIA A) was calculated to be 70%, vs. 50% in patients with incomplete neurologic deficits (Frankel/ASIA B D), and 20% in patients without neurologic deficits (Frankel/ASIS E; p<0,001). The average procedure in the plasty treatment subgroup was 50 min ( min) to address one (n=59) or two (n=10) injured vertebral bodies. In patients with nonoperative treatment mainly three-point-corsets (n=36) were administered for a duration of 6 12 weeks. During their hospital stay 93 of 195 (44,7%) patients with initial neurologic deficits improved at least one Frankel/ASIA grade until the day of discharge. Two patients (0,2%) showed a neurologic deterioration. The highest rate of complete spinal cord injury (n=36, 23%) was associated with thoracic spine injuries. Neun Patienten (1%) verstarben während der Behandlung. Es wurden 105 (14,3%) Verläufe mit intra- (n=56) und/oder postoperativen (n=69) Komplikationen gezählt. Die häufigste intraoperative Komplikation waren Blutungen (n=35; 4,8%). Die relative Häufigkeit intraoperativer Komplikationen war größer nach kombinierter Behandlung (n=34; 10,7%) als nach isoliert dorsaler Operation (n=22; 5,9%; p=0,021). Postoperativ wurden Wundheilungsstörungen in 14 Fällen (1,9%) registriert. Mit Ausnahme der nichtoperativen Behandlung wurde mit allen Behandlungsmethoden eine Korrektur der unfallbedingten radiologischen Fehlstellung unterschiedlichen Ausmaßes erreicht. Unter Berücksichtigung relevanter Einflüsse, wie z. B. Frakturtyp, Patientenalter und Fehlstellung zum Unfallzeitpunkt, wurden zwischen den operativen Behandlungsgruppen (DORSAL vs. KOM- BI) keine statistisch signifikanten Unterschiede (p=0,34; ANOVA) der unmittelbar postoperativen röntgenologischen Ergebnisse beobachtet. Schlüsselwörter Arbeitsgemeinschaft Wirbelsäule der DGU Frakturbehandlung Wirbelsäule Multizentrische Sammelstudie Operative Frakturbehandlung Kypho-/Vertebroplastie Komplikationen Radiologische Ergebnisse Nine (1%) patients died during the initial course of treatment. A total of 105 (14,3%) cases with intraoperative (n=56) and/or postoperative complications (n=69) were registered. The most common intraoperative complication was bleeding (n=35, 4,8%). A higher relative frequency of intraoperative complications was noticed in combined (n=34, 10,7%) vs. isolated posterior (n=22, 5,9%; p=0,021) procedures. The most common postoperative complication was associated with wound healing problems in 14 (1,9%) patients. Except in the non-operative treatment subgroup, a correction of the posttraumatic measured radiological deformity was achieved to a different extent within every treatment subgroup. There were no statistically significant differences between the postoperative radiological results of the treatment subgroups (dorsal vs. combination), taking into consideration the influence of relevant parameters such as different fracture types, patient age, and the amount of posttraumatic deformity (p=0,34, ANOVA). Keywords Spine Study Group of the German Trauma Association Fractures treatment Spinal column Multicenter study Operative fracture treatment Kyphoplasty/vertebroplasty Complications Radiological results 151
4 Anzahl OP Subgruppenvergleich KONS Subgruppen KONS wurden alle Patienten subsumiert, die nichtoperativ behandelt wurden, d. h. konservativ nach Böhler oder konservativfunktionell mit und ohne äußere Fixierung (Mieder, Korsett). Das Durchschnittsalter der Subgruppe OP betrug 41 Jahre (16 89 Jahre), in der Gruppe KONS 53 Jahre (16 95 Jahre) und PLASTIE 66 Jahre (47 92 Jahre). Der Altersunterschied zwischen den 3 Behandlungsgruppen war signifikant (p<0,001; Kruskal-Wallis-Test). In der Gruppe OP betrug das Geschlechterverhältnis etwa 1:3 (33,6% weiblich) und in der Gruppe KONS war das Verhältnis nahezu ausgewogen (48,1% weiblich). In der Gruppe PLASTIE überwogen die weiblichen Patienten mit 71%. Die Unterschiede waren signifikant (p<0,001; χ 2 -Test). Typ-B- und Typ-C-Verletzungen fanden sich bis auf 7 Fälle ausnahmslos in der Gruppe der operierten Patienten (. Abb. 2). In den Gruppen KONS und PLASTIE wurden fast ausschließlich Typ- A-Verletzungen behandelt. Die Gruppenunterschiede in der Frakturtypverteilung waren signifikant (p<0,001; exakter Test nach Fisher). Auch zwischen den Gruppen PLAS- TIE und KONS bestanden in Hinblick auf die vorgefundenen Verletzungen Unterschiede, denn in der Gruppe PLASTIE wurden 40% (n=26) der Fälle als Impressionsfrakturen des Typs A1 klassifiziert. Im AOMagerl Typ A B C PLASTIE Gegensatz dazu kamen Typ-A1-Frakturen aufgrund der im Studienprotokoll festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien in der Subgruppe KONS nicht vor, da hier erst Frakturen ab einer Verletzungsschwere vom Typ A.2.3 berücksichtig wurden. In allen 3 Behandlungsgruppen bestand der überwiegende Anteil der Wirbelsäulenverletzung aus ein bis zwei Segmentläsionen (OP 86%; KONS 85%; PLASTIE 97%). Mehrsegment- (n= 61) und Mehretagenverletzungen (n=42) wurden in der Regel operativ versorgt. Versorgungszeiträume Abb. 2 9 Subgruppenvergleich und Verletzungsschwere (AO/ Magerl-Klassifikation) Der Median des Zeitraumes zwischen Unfall und dem Tag der stationären Aufnahme lag in der Behandlungsgruppe OP bei 0, KONS bei 0 und PLASTIE bei 3 Tagen. Der Median vom Unfalltag bis zur ersten interventionellen, therapeutischen Maßnahme/Operation lag in der Gruppe OP bei 2 und in der Gruppe PLASTIE bei 8 Tagen. Für Patienten mit nichtoperativer Therapie wurde der Aufnahmetag als Behandlungsbeginn gewertet. In der Gruppe OP verstrichen bei 9 Patienten mehr als 21 Tage zur ersten Operation. Dabei wurden 6 der 9 Fälle einmal als Typ-B-, 2 als Typ-C-, oder als A-Verletzung klassifiziert. Zwei dieser Patienten erlitten eine komplette Querschnittsläsion im Rahmen des Unfalls. Auf die vermeintliche Ursache des verzögerten Behandlungsbeginns konnte nach Durchsicht der Datenbank in Hinblick auf das gewählten Operationsverfahren oder mögliche ergänzende Hinweise auf besondere Begleitumstände in den dafür vorgesehenen Klartextfeldern nicht zurück geschlossen werden. Für 32 kombiniert einzeitig operierte Patienten betrug der Median bis zur Behandlung 3 Tage. Dagegen wurden 287 kombiniert zweizeitig operierte Patienten bereits nach einem Tag zumindest dorsal stabilisiert. Bei 270 Patienten konnte der Median des Intervalls zwischen dem ersten und zweiten Eingriff bestimmt werden. Er betrug 9 Tage. In 14 Fällen wurden Patienten vor dem zweiten Eingriff vorübergehend aus der stationären Behandlung entlassen. Der Mittelwert der stationären Behandlungsdauer betrug für operierte Patienten 19 Tage, 9 Tage für konservativ behandelte und 13 Tage in der Gruppe PLAS- TIE. Rein dorsal operierte Patienten blieben 14 Tage isoliert, ventral 18 Tage und nach kombinierter Behandlung 24 Tage in stationärer Behandlung. Zwischen Unfall und erster therapeutischer Maßnahme fanden sich für die verschiedenen Frakturtypen unterschiedliche Zeiträume mit einem Median von 3 Tagen bei Typ-A-, 2 Tagen bei Typ-B- und 1 Tag bei Typ-C-Verletzungen (p<0,001; Kruskal-Wallis-Test). Gruppe OP In der Gruppe OP (n=733) wurden die Regionen BWS (T1 T10/145 Patienten), TLÜ (T11 L2/491 Patienten) und LWS (L3 L5/97 Patienten) getrennt betrachtet. Wir unterteilten weiter nach der Art der operativen Behandlung: 380 Patienten (51,8%) wurden von dorsal, 34 (4,6%) von ventral und 319 (43,5%) kombiniert dorsoventral versorgt. Die letztgenannte Operationstechnik wurde überwiegend als zweizeitiger (n=287) und teilweise als einzeitig kombinierter (n=32) Eingriff durchgeführt. Patientenanzahlen, Verteilung der Frakturklassifikation, neurologische Ausgangsbefunde und VAS-Wirbelsäulenscore vor dem Unfall wurden anhand der verletzten WS-Region und der Behandlungssubgruppe dargestellt (. Tab. 1). 152 Der Unfallchirurg
5 Tab. 1 Häufigkeit der drei verschiedenen Operationstechniken und Angaben zu den Patientenkollektiven Parameter BWS (n=145) TLÜ (n=491) LWS (n=97) DORSAL KOMBI VENTRAL DORSAL KOMBI VENTRAL DORSAL KOMBI VENTRAL Häufigkeit [n] 94 (64,8%) 47 (32,4%) 4 (2,8%) 231 (47,0%) 232 (47,3%) 28 (5,7%) 55 (56,7%) 40 (41,2%) 2 (2,1%) Ø-Alter [Jahre] 41 (17 85) 35 (17 67) 37 (17 52) 42 (17 89) 41 (16 80) 39 (22 64) 46 (16 85) 40 (16 71) 58 (41 73) Frakturtyp A 21 (22,3%) 13 (27,7%) 2 (50%) 164 (71%) 133 (57,3%) 25 (89,3%) 27 (67,3%) 27 (67,5%) 2 (100%) Frakturtyp B 45 (47,9%) 11 (23,4%) 1 (25%) 47 (20,3%) 57 (24,6%) 2 (7,1%) 12 (21,8%) 3 (7,5%) Frakturtyp C 28 (29,8%) 23 (48,9%) 1 (25%) 20 (8,7%) 42 (18,1%) 1 (3,6%) 6 (10,9%) 10 (25,0%) Frankel/ASIA E 58 (61,7%) 27 (57,4%) 4 (100%) 187 (81%) 164 (70,7%) 27 (96,4%) 45 (81,8%) 26 (65%) 2 (100%) Frankel/ASIA B D 14 (14,9%) 7 (14,9%) 34 (14,7%) 49 (21,1%) 1 (3,6%) 9 (16,4%) 13 (32,5%) Frankel/ASIA A 22 (23,4%) 13 (27,7%) 10 (4,3%) 19 (8,2%) 1 (1,8%) 1 (2,5%) Polytrauma 29 (30,9%) 15 (31,9%) 1 (25%) 16 (6,9%) 21 (9,1%) 1 (3,6%) 5 (9,1%) 4 (10%) Median VAS vor Unfall 96 (n=67) 95 (n=37) 59 (n=2) 95 (n=173) 92 (n=181) 86 (n=22) 97 (n=40) 85 (n=32) 68 (n=2) Die Verletzungslokalisation spielte für die Wahl der operativen Methode und des Zugangswegs eine wichtige Rolle. Die Häufigkeit der gewählten Operationsverfahren (DORSAL VENTRAL KOMBI) zeigte bezüglich der anatomischen Region statistisch signifikante Unterschiede (p=0,002; χ 2 -Test) auf: isoliert dorsale Operationsverfahren wurden an der BWS in 65% der Fälle (TLÜ 47%; LWS 57%) gewählt. Dagegen wurden kombinierte und dorsale Verfahren am TLÜ in gleichem Maße (jeweils 47%) angewandt. Der Anteil des kombinierten Vorgehens betrug an der BWS lediglich 32,4%. Patienten mit Verletzungen der BWS waren häufiger von neurologischen Begleitverletzungen (Frankel/ASIA A-D) und Polytraumata betroffen. Bei 21 Patienten wurden Frakturen gleichzeitig mit Implantaten und Knochenzement (6-mal Vertebroplastie, 15- mal Kyphoplastie; PMMA) stabilisiert. Implantat und Anzahl der überbrückten Segmente Dorsales Vorgehen. Bei dorsalen Operationen wurde in allen 3 Regionen der Brust- und Lendenwirbelsäule überwiegend auf winkelstabile Fixateursysteme (n=330; 87%) zurückgegriffen. Implantate anderer Bauart spielten eine untergeordnete Rolle und wurden der Vollständigkeit halber in. Tab. 2 aufgelistet. An BWS (n=58; 61,7%), TLÜ (n=180; 77,9%) und LWS (n=43; 78,2%) wurde insgesamt 281-mal (73,9%) ein zusätzlicher Querstabilisator implantiert, der 189- mal (86,3%) zur Stabilisierung von Typ- A-Frakturen, 72-mal (69,9%) Typ-B- und 20-mal (37,7%) Typ-C-Frakturen verwendet wurde. Mit der dorsalen Instrumentierung wurden bei insgesamt 275 Patienten ein bis zwei Bewegungssegmente (BS) und bei 96 Patienten mehr als 2 BS stabilisiert. Die relative Häufigkeit der ein bis zwei instrumentierten BS war am TLÜ mit 85% (n=193) am größten und betraf die BWS lediglich zu 36,6% (n=34). Dagegen war der prozentuale Anteil von mehr als zwei dorsal instrumentierten BS im Bereich der der BWS 63,4% (n=59) am größten, gefolgt von TLÜ 13,2% (n=30) und der LWS mit 12,8% (n=7). Insgesamt wurden in 52,4% der Fälle (n=199; fehlende Angaben n=5) dorsale Spondylodesen zur Fusion eines BS (n=111; 29,2%) oder in 88 Fällen (24,4%) von 2 bis maximal 5 BS angelegt. Der Anteil dorsaler Spondylodesen über mehr als ein Bewegungssegment betrug an der BWS 41,5%, TLÜ 16,9% und LWS 18,2%. Dazu wurde am häufigsten autologe Spongiosa vom hinteren Beckenkamm (n=150; 39,5%) oder Kombination aus Knochenspänen und -spongiosa (n=99; 26,1%) verwendet. In wenigen Fällen wurde auch allogenes Material (n=1; 0,3%), Keramik (n=1; 0,3%) oder andere, nicht genauer bezeichnete Materialen (n=47; 12,4%) verwendet. Spongiosa wurde intra- (n=48; 12,6%), interkorporell (n=56; 14,7%) oder an hintere Wirbelelemente, z. B. die Lamina, Facettengelenke (n=177; 46,6%) angelagert. Das Akronym PLIF ( posterior lumbar interbody fusion ) bezeichnet ein einzeitiges dorsales Operationsverfahren mit dem z. B. ventrale Knochenspäne durch Eröffnung des Spinalkanals nach ventral, also interkorporell, eingebracht werden. Auf diese Weise wurden 36 Patienten versorgt (TLÜ n=30; LWS n=6). Kombiniertes Vorgehen. Bei kombinierter Vorgehensweise wurde zur dorsalen Stabilisierung ebenfalls überwiegend auf winkelstabile Fixateursysteme (n=312; 97,8%;) zurückgegriffen (. Tab. 2). 197-mal (61,8%) wurde ein zusätzlicher Querstabilisator implantiert. Davon 114- mal (65,9%) bei Typ-A-Frakturen, 43-mal (60,6%) bei Typ-B- und 40-mal (53,3%) bei Typ-C-Frakturen. Die relative Häufigkeit zusätzlicher Querstabilisatoren (BWS 53,2%; TLÜ 63,8%; LWS 60%) war in allen 3 Regionen geringer als bei isoliert dorsalem Vorgehen. Verglichen mit den isoliert dorsal operierten Patienten bestand kein Unterschied in Bezug auf die Anzahl der implantatüberbrückten Segmente: 258-mal (80,9%) wurden 1 oder 2 Bewegungssegmente dorsal instrumentiert, 3 bis 4 Segmente wurden 48-mal (15,1%) stabilisiert und Instrumentierungen von 5 bis maximal 6 Segmenten sind 13-mal (4,1%) vorgekommen. In der Gruppe KOMBI wurden 78- mal (24,5%) dorsale Spondylodesen angelegt, weniger oft im Vergleich zur Gruppe DORSAL (p<0,001; U-Test). Auch in dieser Subgruppe wurde hierfür am häufigsten autologe Spongiosa vom hinteren Beckenkamm transplantiert. 153
6 Tab. 2 Häufigkeiten (n) und Prozentsatz (%) verwendeter Implantate und Behandlungsgruppe Instrumentation Region Implantat/OP-Details Art der operativen Behandlung DORSAL (n=380) KOMBI (n=319) VENTRAL (n=34) DORSAL BWS n=93 (fehlend n=1) n=47 Winkelstabiles Fixateursystem 86 (92,5%) 47 (100%) n/a Winkelstabiles Plattensystem n/a Plattenfixateur 3 (3,2%) n/a Sonstige 2 (2,1%) n/a Keines 2 (2,1%) n/a QS verwendet 58 (61,7%) 25 (53,2%) n/a 1 2 BS instrumentiert 34 (36,6%) 15 (31,9%) n/a >2 BS instrumentiert 59 (63,4%9 32 (68,1%) n/a Dorsale Spondylodese angelegt 51 (54,3%) 8 (17%) n/a Dorsale Spondylodese >1 BS 39 (41,5%) 7 (14,8%) n/a TLÜ n=227 (fehlend n=4) n=232 Winkelstabiles Fixateursystem 194 (84,0%) 226 (97,4%) n/a Winkelstabiles Plattensystem 1 (0,4%) n/a Plattenfixateur 27 (11,7%) 2 (2,6%) n/a Sonstige 2 (0,9%) n/a Keines 3 (1,3%) n/a QS verwendet 180 (77,9%) 148 (63,8%) n/a 1 2 BS instrumentiert 193 (85%) 207 (89,2%) n/a >2 BS instrumentiert 30 (13,2%) 25 (10,8%) n/a Dorsale Spondylodese angelegt 123 (53,2%) 60 (25,9%) n/a Dorsale Spondylodese >1 BS 39 (16,9%) 26 (11,2%) n/a LWS n=55 n=40 Winkelstabiles Fixateursystem 50 (90,9%) 39 (97,5%) n/a Winkelstabiles Plattensystem n/a Plattenfixateur 4 (7,3%) n/a Sonstige n/a Keines 1 (1,8%) 1 (2,5%) n/a QS verwendet 53 (78,2%) 24 (60%) n/a 1 2 BS instrumentiert 48 (87,3%) 36 (90%) n/a >2 BS instrumentiert 7 (12,8%) 4 (10%) n/a Dorsale Spondylodese angelegt 25 (45,5%) 10 (25%) n/a Dorsale Spondylodese >1 BS 10 (18,2%) 8 (20%) n/a VENTRAL BWS n=47 n=4 Winkelstabile Platte n/a 27 (57,4%) 4 (100%) Winkelstabiles Stabsystem n/a 1 (2,1%) Winkelinstabile Platte n/a Sonstige n/a 1 (2,1%) Keines n/a 18 (38,3%) 1 BS instrumentiert n/a 5 (10,6%) 1 (25%) >2 BS instrumentiert n/a 26 (54,7%) 3 (75%) Ventrale Spondylodese angelegt n/a 40 (85,1%) 3 (75%) Ventrale Spondylodese >1 BS n/a 29 (61,7%) 2 (50%) TLÜ n=232 (fehlend n=5) n=28 Winkelstabile Platte n/a 117 (50,4%) 26 (92,9%) Winkelstabiles Stabsystem n/a 9 (3,9%) Winkelinstabile Platte n/a 4 (1,7%) 2 (7,1%) Sonstige n/a 17 (7,3%) Keines n/a 80 (34,5%) 1 BS instrumentiert n/a 50 (21,6%) 1 (42,9%) >2 BS instrumentiert n/a 107 (46,1%) 2 (55,5%) 154 Der Unfallchirurg
7 Tab. 2 (Fortsetzung) Instrumentation Region Implantat/OP-Details Art der operativen Behandlung DORSAL (n=380) KOMBI (n=319) VENTRAL (n=34) Ventrale Spondylodese angelegt n/a 180 (79,7%) 21 (75%) Ventrale Spondylodese > 1 BS n/a 86 (37,1%) 8 (28,6%) LWS n=40 n=2 Winkelstabile Platte n/a 9 (22,5%) 1 (50%) Winkelstabiles Stabsystem n/a Winkelinstabile Platte n/a 2 (5%) Sonstige n/a 6 (15%) Keines n/a 23 (57,5%) 1 (50%) 1 BS instrumentiert n/a 7 (17,%) 2 (100%) >2 BS instrumentiert n/a 2 (52,5%) Ventrale Spondylodese angelegt n/a 28 (70%) 1 (50%) Ventrale Spondylodese >1 BS n/a 14 (35%) WK-Ersatz Synex n/a 139 (43,6%) 16 (47,1%) X-Tenz n/a 8 (2,5%) 1 (2,9%) Obeslisc n/a 12 (3,8%) 1 (2,9%) Korbsysteme (Mesh-Cage) n/a 9 (2,8%) Sonstige n/a 2 (0,6%) Keiner n/a 149 (46,7%) 16 (47,1%) Ventrale Zugänge und Implantat Frakturen der gesamten Brust- und Lendenwirbelsäule (T1 L5) können durch ventrale Zugänge adressiert werden. Von insgesamt 353 registrierten ventralen und kombinierten Eingriffen wurden 238 (67,4%) thorakoskopisch oder offen durch Thorakotomien (n=29; 8,2%) beziehungsweise Lumbotomien (n=51; 14,4%) vorgenommen. Thorakophrenolumbotomien (n=8; 2,3%), endoskopisch, extraperitoneale (n=8; 2,3%) und sonstige (n=11; 3,1%) Zugänge spielten eine untergeordnete Rolle. Im Zusammenhang mit ventralen minimalinvasiven Zugängen wurde am häufigsten endoskopisch (n=217; 65,5%) oder videoassistiert (n=38; 10,8%) gearbeitet und dreimal in Mini-ALIF-Technik (0,8%) operiert (sonstige und fehlende Angaben n=62; 17,5%). Die häufigsten ventralen Zugänge waren die Thorakoskopie (BWS 88,2%; TLÜ 75,5%) und Lumbotomie (LWS 87,8%). In 230 (65,1%) Fällen wurden mit einer ventralen Instrumentierung ein (n=75) bis zwei (n=155) Bewegungssegmente (BS) überbrückt. Drei (n=7, 2%) oder vier (n=11; 3,1%) überbrückte BS waren die Ausnahme. In 105 (29,7%) Fällen wurden keine entsprechenden Angaben gemacht (. Tab. 2). Ventrale Spondylodesen wurden über ein (n=133; 37,7%), zwei (n=135; 38,2%), drei (n=3; 0,8% oder vier Bewegungssegmente (n=2; 0,6%) angelegt. Dabei wurde 75-mal (21,2%) keine ventrale Spondylodese angestrebt, 5-mal (1,4%) fehlten die Angaben. Winkelstabile Platten wurden am häufigsten verwendet; insgesamt 184-mal an BWS (n=31), TLÜ (n=133) und LWS (n=1). Mit winkelinstabilen Platten (n=8; 2,3%), Stabsystemen (n=10; 2,8%) oder anderen ventralen Implantaten (n=24; 6,8%) wurde weniger oft stabilisiert. In 122 Fällen (34,6%) wurde kein zusätzliches Implantat verwendet, 5-mal (1,4%) fehlten Angaben. Als Entnahmestelle autologen Knochens für ventrale Spondylodesen wurde 137-mal (38,8%) der vordere und 40-mal (11,3%) der hintere Beckenkamm angegeben. Rippen- (n=2; 0,6%) oder andere Transplantate (n=78, 22,1%) wurden ebenfalls eingesetzt. Der verwendete Knochen bestand 124-mal (35,1%) aus Spongiosa, einem Knochenspan (n=87; 24,6%) oder einer Kombination aus beidem (n=68; 19,3%; fehlende Angaben n=5; 1,4%). Kein Knochenersatz oder Transplantat wurden 69-mal (19,5%) vermerkt. Zur Rekonstruktion der ventralen Wirbelsäule wurden bei insgesamt 188 (53,3%) Patienten Wirbelkörperersatzimplantate verwendet (. Tab. 2). Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Verletzungstyp (AO/Magerl) oder Verletzungsausdehnung und dem Einsatz von Wirbelkörperersatzimplantaten konnte nicht nachgewiesen werden. In 215 Fällen wurden ventrale interkorporelle Spondylodesen mit einem Knochenspan (n=84) oder einem Wirbelkörperersatzimplantat (n=131) in Kombination mit einem ventralen Implantatsystem konzipiert. Hierbei wurden 117-mal Knochenspan (n=67) oder Cage (n=50) ohne zusätzliche ventrale Stabilisierung durch Platten oder Stabsysteme implantiert (fehlende Angaben n=21). Operative Details Die durchschnittliche Operationszeit der Gruppe KOMBI betrug 4 h 54 min (BWS 350 min; TLÜ 286 min; LWS 309 min) und war signifikant länger als die der Gruppe DORSAL von 1 h 30 min (BWS 179 min; TLÜ 139 min; LWS 157 min) und VENT- RAL mit 3 h 27 min (BWS 214 min; TLÜ 213 min; LWS 125 min; p<0,001). Zur intraoperativen Bildgebung wurde ein Bildwandler in 2 Ebenen (a.-p. und seitlich) insgesamt 543 (74,1%) verwendet (fehlende Angaben n=73). Der Bildwandler wurde 109-mal (14,9%) lediglich in der seitlichen Ebene oder 7-mal ausschließlich in der a.-p. Einstellung genutzt. 155
8 Tab. 3 Operative Details und Häufigkeiten Parameter OP (n=733) / DORSAL (n=380) KOMBI (n=319) VENTRAL (n=34) PLASTIE (n=69) Operationsdauer (min) gesamt 152 (25 650; n=360) gesamt 298 (60 768; n=316) gesamt 208 (50 325; n=34) 50 (18 145; n=65) BWS 179 (65 650; n=89) BWS 530 ( ; n=47) BWS 214 ( ; n=4) TLÜ 139 (25 510; n=218) TLÜ 286 (60 665; n=230) TLÜ 213 (75 325; n=28) LWS 157 (45 480; n=53) LWS 309 ( ; n=39) LWS 125 (50 200; n=2) Rx-Zeit (s) gesamt Median 173 (5 782; n=264) gesamt Median 264 (9 1110; n=251) gesamt Median 215 ( ; n=28) BWS 199 (22 781; n=64) BWS 311 (87 720; n=87) BWS 305 ( ; n=2) TLÜ 150 (5 757; n=163) TLÜ 255 (9 1110; n=174) TLÜ 204 ( ; n=24) LWS 222 (60 651; n=37) LWS 270 (60 510; n=69) LWS 265 ( ; n=2) CAS verwendet (n) gesamt 60 (19,5%) gesamt 35 (12%) gesamt BWS 17 (18,1%) BWS 9 (19,1%) BWS TLÜ 32 (13,9%) TLÜ 24 (10,3%) TLÜ LWS 11 (20%) LWS 2 (5%) LWS Median 200 (5 834; n=58) Blutverlust (ml) gesamt 650 ( ; n=202) gesamt 959 ( ; n=170) gesamt 534 ( ; n=23) 44 (10 200; n=27) BWS 823 ( ; n=55) BWS 895 ( ; n=25) BWS 500 ( ; n=2) TLÜ 602 ( ; n=122) TLÜ 980 ( ; n=117) TLÜ 561 ( ; n=19) LWS 500 ( ; n=25) LWS 922 ( ; n=28) LWS 310 (20 600; n=2) Patient EK gegeben (n) gesamt 81 (21,3%) gesamt 86 (27%) gesamt 4 (11,8%) Ø Anzahl EK (n) gesamt 3,3 (1 18) gesamt 4 (1 27) gesamt 2,8 (1 4) Komplikationslose Verläufe (n) Patienten mit Komplikationen (n) Operativ-revidierte Patienten (n) gesamt 327 (87,2%) gesamt 266 (83,4%) gesamt 30 (88,2%) 62 (95,4%) BWS 74 (78,7%) BWS 35 (74,5%) BWS 3 (75%) TLÜ 204 (88,3%) TLÜ 197 (84,9%) TLÜ 25 (89,3%) LWS 49 (89,1%) LWS 34 (85%) LWS 2 (100%) gesamt 48 (12,8%) gesamt 53 (16,6%) gesamt 4 (11,8%) 3 (4,6%) BWS 19 (20,2%) BWS 12 (25,5%) BWS 1 (25%) TLÜ 23 (10%) TLÜ 35 (15,1%) TLÜ 3 (10,7%) LWS 6 (10,9%) LWS 6 (15%) LWS gesamt 18 (7,7%) gesamt 20 (8,3%) gesamt 1 (3,8%) BWS 7 (7,4%) BWS 5 (10,6%) BWS 1 (25%) TLÜ 8 (3,5%) TLÜ 12 (5,2%) TLÜ LWS 3 (5,5%) LWS 3 (7,5%) LWS * Unterschiedliche Prozentangaben können durch eine differierende Anzahl fehlender Parameter in verschieden Kategorien zustande kommen. Die Röntgenstrahlenexposition und Gesamtdurchleuchtungszeit (s) betrug in der Gruppe KOMBI durchschnittlich 4 min, 24 s (BWS 311 s; TLÜ 255 s; LWS 270 s) und war statistisch signifikant länger als in den Gruppen DORSAL, wo sie 2 min, 48 s (BWS 199 s; TLÜ 150 s; LWS 222 s) betrug, und VENTRAL mit 3 min, 35 s (BWS 305 s; TLÜ 204 s; LWS 265 s; p<0,001). In allen drei Behandlungssubgruppen wurden für Instrumentierungen der BWS längere Durchleuchtungszeiten benötigt. Computerassistierte Operationsverfahren zur intraoperativen Navigation kamen 95-mal (13%) zum Einsatz. Es wurden 58- mal (6,7%) CT-basiert, 23-mal (3,1%) BVbasiert, 14-mal (1,9%) CT- und BV-basiert navigiert. In 521 Fällen (71,1%) wurde keine Computernavigation verwendet (fehlende Angaben n=117). Der Zusammenhang zwischen dem Einsatz eines computerassistierten Verfahrens und der Operationsdauer bzw. intraoperativen Röntgenzeit wurde unter Berücksichtigung von Patientenalter, Frakturtyp und der Frakturlokalisation untersucht (ANOVA). Ein statistisch signifikanter Unterschied (p=0,016) bestand zwischen der durchschnittlichen Operationsdauer von 301 min der Patienten (n=72; fehlende Angaben n=23), die mit Hilfe eines computerassistierten Verfahrens operiert wurden und der Operationsdauer von 260 min in den Fällen (n=456) ohne ein computergestütztes Navigationsverfahren (CAS). Hingegen zeigten die unterschiedlichen Röntgenzeiten (s) nur einen gerin- 156 Der Unfallchirurg
9 gen Unterschied von 244 s mit Navigation (n=59; fehlende Angaben n=36) im Gegensatz zu 238 s ohne Navigation (n=395; fehlende Angaben n=126). Zur Minimierung der Notwendigkeit von Fremdbluttransfusionen wurden zur maschinellen Autotransfusion Cellsaver in 49% (n=361) der Fälle verwendet. Der höchste durchschnittliche intraoperative Blutverlust wurde in der Gruppe KOM- BI mit 958 ml ( ml; n=170) registriert. Insgesamt wurden in 168 Fällen (22,9%) 3,6 (1 27) Erythrozytenkonzentrate substituiert, ohne statistisch signifikante Behandlungsgruppenunterschiede. Ein Übersicht der erwähnten operativen Details wird in. Tab. 3 zusammengefasst. Dekompression Einengungen des Spinalkanals wurden mit Hilfe von CT- oder MRI-Bildern beurteilt. Lag eine verletzungsbedingte Einengung vor, wurde deren Ausmaß in Prozent vom ursprünglichen Spinalkanaldurchmesser der entsprechenden Segmenthöhe angegeben. Von 865 Patienten hatten insgesamt 508 (58,7%), d. h. bei BWS 72 (45,6%), bei TLÜ 364 (61,2%) und bei LWS 72 (64,3%), eine Einengung des ursprünglichen Spinalkanaldurchmessers von durchschnittlich 35,6% (5% 95%; fehlende Angaben n=28; 3,2%), die an der BWS 36,5%, TLÜ 34,1% und LWS 42,3% betrug. Das relative Risiko (RR) für einen neurologischen Ausfall unterschiedlichen Ausmaßes (ASIA A D) war bei dem Vorhandensein einer Spinalkanaleinengung 3,5-mal höher als bei Verletzungen ohne Spinalkanaleinengung (p<0,001; χ 2 -Test). Ebenso bestand ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Spinalkanaleinengung (%) und dem neurologischen Befund bei Aufnahme (p<0,001; Kruskal- Wallis-Test). Patienten mit Verletzungen der BWS und Einengung des Spinalkanals hatten zu 51,4% neurologische Begleitverletzungen, wohingegen dieser Anteil an TLÜ (26,1%) und LWS (30,6%) geringer war. Der Median der Spinalkanaleinengung betrug 70% (n=55; BWS 60%; TLÜ 75%) bei Patienten mit einem kompletten QS, 50% (n=92; BWS 35%; TLÜ 60%; LWS 60%) bei Patienten mit inkompletten QS und 20% (n=358; BWS 10%; TLÜ 20%; LWS 30%) bei Patienten ohne neurologische Ausfälle. Es bestanden statistisch signifikante Unterschiede bezüglich der relativen Häufigkeit von Patienten mit einer Spinalkanaleinengung in den Behandlungsgruppen OP (n=461; 64,7%), KONS (n=18; 36,0%) und PLASTIE (n=26; 38,2%; p<0,001; χ 2 -Test). Das Ausmaß der Spinalkanaleinengung war in der Gruppe OP mit durchschnittlich 30% am meisten ausgeprägt (PLASTIE u. KONS jeweils bei 10% Einengung; p<0,001; Kruskal-Wallis- Test). Zur erweiterten Diagnostik bei Spinalkanalengen wurden 27-mal Myelographien und in einem Fall eine intraoperative Sonographie des Myelons durchgeführt. In 18 Fällen wurden Duraverletzungen operativ behandelt. Chirurgisch dekomprimiert wurde 171- mal von dorsal, 76-mal von ventral und in 40 Fällen sowohl von dorsal als auch ventral. Patienten mit neurologischen Ausfällen bei stationärer Aufnahme wurden öfter operativ dekomprimiert (n=169; 62,6%) im Vergleich zu Patienten ohne neurologische Ausfälle (n=88; 16,2%). Die Art der operativen Versorgung hatte in keiner der 3 Regionen (BWS, TLÜ, LWS) statistisch signifikanten Einfluss auf die postoperativ verbliebene Resteinengung und lag vor bzw. nach der Behandlung jeweils bei durchschnittlich 38,2% und 19,1% DORSAL, 16,8% und 9,6% VENTRAL und 43,1% und 19,9% KOMBI (p=0,523; ANOVA). Dagegen beeinflusste das Ausmaß der initialen präoperativen Enge das postoperative Ergebnis in Bezug auf die verbliebene Restspinalkanaleinengung statistisch signifikant (p<0,001; ANOVA). Von 40 Patienten die sowohl dorsal als auch ventral dekomprimiert wurden hatten 15 (37,5%) bei ihrer Aufnahme einen kompletten QS, 12 (30%) einen inkompletten QS oder in 13 (32,5%) Fällen keine neurologischen Ausfälle. Von den Patienten mit komplettem QS besserten sich 5 (33%) bis zur Entlassung (inkompletter QS n=4, keine Neurologie n=1). Drei (25%) Patienten mit initial inkomplettem QS blieben bei ihrer Entlassung ohne neurologischen Ausfälle. Komplikationen OP Von 865 Patienten wurden 9 (1%) Todesfälle registriert. Als Unfallursache wurden 5 Stürze aus der Höhe, ein banaler Sturz, ein Kfz-Unfall und eine unbekannte Unfallursache angegeben. Alle verstorbenen Patienten hatten bei der stationären Aufnahme eine oder mehrere Begleitverletzungen, die als schwer, lebensbedrohlich oder als kritisch mit unsicherer Überlebenswahrscheinlichkeit beurteilt wurden (AIS 4). Das Alter der verstorbenen Patienten lag dreimal in der Altersgruppe Jahre, zweimal Jahre und viermal handelte es sich um Personen, die zum Unfallzeitpunkt älter als 60 Jahre waren. Drei polytraumatisierte Patienten verstarben noch im Rahmen ihrer intensivmedizinischen Behandlung, ohne jemals die Operationsfähigkeit wiederzuerlangen. Die Wirbelsäulenverletzungen der übrigen 6 Patienten wurden dorsal mit winkelstabilen Fixateursystemen versorgt. Bei den Verletzungen handelte es sich um 3 Berstungsbrüche (Typ A3), einen Rotationsschrägbruch (Typ C3.2) und 2 Flexionsdistraktionsverletzungen mit dorsaler, überwiegend ossärer Zerreißung (Typ B2.3). Zusätzliche intraoperative Komplikationen abgesehen vom Tod des Patienten wurden nicht beschrieben. Einmal wurde wegen der schlechten Prognose auf die Anlage einer eigentlich vorgesehenen dorsalen Spanplastik verzichtet. In 2 Fällen wurden postoperative Pulmonalembolien als genauere Todesursache deklariert. Keiner der Fälle wurde operativ revidiert. Insgesamt 623 (85%) von 733 Verläufen operierter Patienten blieben komplikationslos [BWS n=112 (77,2%); TLÜ n=426 (86,8%); LWS n=85 (87,6%); fehlende Angaben n=5 (0,7%)]. Von den operierten Patienten erlitten 105 (14,3%) intraoperative [n gesamt =56 (7,7%): BWS 17 (11,7%), TLÜ 29 (5,9%), LWS 10 (10,3%)] oder postoperative [n gesamt =69 (9,4%): BWS 21 (14,5%), TLÜ 42 (8,6%), LWS 6 (6,2%)] Komplikationen. Davon erlitten 20 (2,7%) Patienten gleichzeitig mindestens eine intra- und postoperative Komplikation (. Tab. 3). Insgesamt 39 (5,3%) Patienten [BWS n=13 (8,2%); TLÜ n=20 (3,7%); LWS n=6 (5,4%); fehlende Angaben n=231] mussten operativ revidiert werden(. Tab. 3, 5). 157
10 Tab. 4 Neurologie (Frankel-/ASIA-Score) bei stationärer Aufnahme und Entlassung in Abhängigkeit der Verletzungslokalisation (BWS, TLÜ, LWS) BWS Frankel/ASIA bei Entlassung (n) Frankel/ASIA bei Aufnahme (n) Patienten der Behandlungsgruppe KOMBI hatten öfter (n=34; 10,7%) eine oder mehrere intraoperative Komplikationen als diejenigen der Gruppe DOR- SAL (n=22; 5,9%; p=0,021; χ 2 -Test). Die weitere Betrachtung der Komplikationen der OP-Gruppe bezieht sich auf den Zeitpunkt des Auftretens (intra- vs. postoperativ), Art und Revisionsbedürftigkeit der Komplikation. Intraoperative Komplikationen. Insgesamt 56 (7,6%) Patienten erlitten eine oder mehrere intraoperative Komplikationen. Davon hatten 48 je eine Komplikation, 6 gleichzeitig zwei und jeweils 1 Patient drei bzw. vier Komplikationen unterschiedlicher Art. Blutungen traten am häufigsten (n=35) auf. Sie wurden statistisch signifikant öfter in der Behandlungsgruppe KOMBI (n=25) als in der Gruppe DOR- SAL (n=10) beobachtet (p=0,002, χ 2 - Test). Schrauben wurden 18-mal (BWS n=7; TLÜ n=7; LWS n=4) fehlplaziert, 6-mal wurde eine endoskopisch begonnene Operation offen fortgesetzt und A B C D E n gesamt (%) A (23%) B (4%) C (4%) D (5%) E (64%) n gesamt (%) 33 (21%) 3 (2%) 7 (5%) 5 (3,2%) 109 (69%) 157 TLÜ Frankel/ASIA bei Entlassung [n] Frankel/ASIA bei Aufnahme (n) A B C D E n gesamt (%) A (5%) B (2%) C (3%) D (9%) E (80%) n gesamt (%) 17 (3%) 7 (1%) 13 (2%) 41 (7%) 514 (87%) 592 LWS Frankel/ASIA bei Entlassung (n) Frankel/ASIA bei Aufnahme (n) A B C D E n gesamt (%) A (2%) B (2%) C (3%) D (15%) E (79%) n gesamt (%) 2 (2%) 0 (0%) 2 (2%) 14 (13%) 94 (84%) intraoperative Komplikationen wurden unter Sonstige subsumiert. Dabei handelte sich um 6 technische Probleme mit dem Instrumentarium, den Implantaten oder dem Bildwandler. In 2 Situationen verschlechterte sich der Allgemeinzustand des Patienten intraoperativ aus nicht genauer bezeichneter Ursache. Iatrogene Dura-, Nerven- oder Rückenmarksverletzungen und Verletzungen innerer Organe wurden nicht beobachtet. Postoperative Komplikationen. Insgesamt wurden 69 (9,4%) Patienten mit einer oder mehreren postoperativen Komplikationen gezählt. Davon hatten 53 (7,2%) Patienten eine postoperative Komplikation, 12 (1,6%) gleichzeitig zwei und 4 (0,5%) gleichzeitig drei unterschiedliche Komplikationen. Auf die 6 (0,8%) postoperativ verstorbenen Patienten wurde bereits eingegangen. Des Weiteren traten 10 (1,4%) postoperative Infekte, 14 (1,9%) Wundheilungsstörungen, 7 (1%) Thrombosen/Embolien, 15 (2%) Implantatfehllagen [BWS n=5 (3,5%); TLÜ n=7 (1,4%); LWS n=2 (3,1%); Korrekturverluste oder Fehlstellungen n=8 (1,1%); sonstige Komplikationen n=24 (3,3%)] auf. Die am häufigsten in der der Kategorie Sonstige subsumierten Komplikationen betrafen die Lunge (n=13) in Form von Pleuraergüssen, Pneumonien, Pulmonalembolien und Atelektasen. Hinzu kommen Harn/Stuhlverhalt (n=2), Hämatome (n=2), MRSA-Infekt (n=1), Konversion von konservativem auf operatives Vorgehen (n=1), Ablehnen einer zweiten Operation seitens des Patienten (n=1), Nachblutung (n=1), Polytoxikomanie/nicht führbarer Patient (n=1), intraspinales Knochenfragment (n=1) und unzureichende Korrektur (n=1). Operativ-revidierte Komplikationen. Von insgesamt 39 (5,3%) Patienten mit revisionspflichtigen Komplikationen mussten 27 einmal, 7 zweimal, 1 dreimal, 2 viermal und je 1 Patient fünf- bzw. sechsmal revidiert werden. In 25 Fällen waren die Ursache bzw. der Anlass zur operativen Revision bekannt: Revisionsgründe waren 4 Infekte, 5 Wundheilungsstörungen, 1 Thrombose/Embolie, 6 Implantatfehllagen, 1 Korrekturverlust/Fehlstellung, 1 intraspinales Knochenfragment, 1 Nachblutung, 4 Pleuraergüsse, 1 neurologische Verschlechterung und 1 infiziertes Serom. Gruppe PLASTIE In 63 (89,9%) der Fälle (n=69) wurden Wirbelkörperfrakturen mit Hilfe der Ballonkyphoplastie behandelt. Sechs (8,7%) Patienten wurden im Sinne der Vertebroplastie mit einer Zementfüllung des verletzten Wirbelkörpers behandelt. Die durchschnittliche Operationsdauer in dieser Gruppe lag bei 50 min ( min; n=65; fehlend n=4). Der Median der intraoperativen Durchleuchtungszeit (s) betrug 3 min 18 s (5 834 s). Für die intraoperative Darstellung wurde ein Bildwandler in 2 Ebenen in 51 (73,9%) der Fälle genutzt (fehlende Angaben n=18; 26,1%). Der durchschnittliche Blutverlust (. Tab. 3) lag bei 44 ml (10 200ml; n=27; fehlende Angaben n=42). In 3 Fällen mussten Erythrozytenkonzentrate (EK) substituiert werden (2-mal 2 EKs; 1- mal 6 EKs). 158 Der Unfallchirurg
11 In 59 Fällen wurde jeweils ein Wirbelkörper über einen (n=4) bzw. zwei Pedikel (n=55) augmentiert. In 10 weiteren Fälle wurden jeweils zwei Wirbelkörper über einen (n=2) bzw. zwei (n=8) Pedikel befüllt. Als Füllmaterial wurde PM- MA oder andere für die Wirbelkörperaugmentation entwickelte Knochenersatzstoffe unterschiedlicher Hersteller verwendet. Komplikationen PLASTIE In dieser Gruppe hatten 3 (4,6%) Patienten perioperative Komplikationen (fehlende Angaben n=4). Intraoperativ kam es bei einer Operation zu technischen Problemen durch zwei geplatzte Kyphoplastieballons. Bei einer Operation wurde Zementaustritt entlang des Pedikelkanals oder ventral am hinteren Längsbandes beobachtet. Ein Patient klagte über starken postoperativen Schmerz, der als Komplikation beschrieben wurde. Gruppe KONS Alle angewendeten nichtoperativen Verfahren zur Wirbelbruchbehandlung wurden in der Gruppe KONS subsumiert (n=52). Konservativ mit einem Gipsmieder behandelt wurde 2-mal (3,8%). Drei-Punkt-Korsetts wurden 36- mal (69,2%) verordnet und in 14 Fällen (26,9%) auf die rein frühfunktionelle Behandlung ohne äußere Ruhigstellung zurückgegriffen. Bei 9 Patienten (1-mal Gipsmieder, 7- mal Drei-Punkt-Korsett und 1-mal funktionell) wurde auf jegliche Immobilisation verzichtet. Den übrigen Angaben zur Dauer der Immobilisation in Wochen (n=12; 23,1%; fehlende Angaben n=40) war zu entnehmen, dass der Patient jeweils einmal für 3 bzw. 12 Wochen bei konservativer Behandlung mit Drei-Punkt-Korsett und einmal im Rahmen einer funktionellen Behandlung ohne äußere Ruhigstellung für 8 Wochen immobilisiert wurde. Für weitere 20 Fällen (38,5%) konnten die Dauer der Ruhigstellung in Wochen ausgewertet werden (fehlende Angaben n=32; 61,5%). Demnach wurde 7-mal 6 Wochen, 4-mal 8 Wochen und 8-mal 12 Wochen lang mit Drei-Punkt-Korsett und einmal 12 Wochen mit Gipsmieder ruhiggestellt. Komplikationen KONS In dieser Behandlungsgruppe wurden 2 (3,8%) Komplikationen beschrieben. Beide Patienten wurden mit einem Drei- Punkt-Korsett behandelt. Ein 45-jähriger Patient mit isolierter LWK1 Fraktur vom Typ A ohne Neurologie musste aufgrund eines Leberversagens bei Hepatitis 6 Wochen lang beatmet werden. Bei einem zweiten 58-jährigen Patienten mit einem Berstungsbruch vom Typ A ohne Neurologie als Folge eines banalen Sturzes wurde als Komplikation Multimorbidität angegeben. Neurologischer Verlauf Durchschnittlich 28 Tage dauerte die stationäre Behandlung von Patienten mit komplettem QS (Frankel/ASIA A) und war signifikant länger als die der Patienten mit inkomplettem QS (ASIA B D) von 22 Tagen oder Patienten ohne neurologische Ausfälle (Frankel/ASIA E) mit 16 Tagen (p<0,001). Die Veränderungen des neurologischen Zustands des Gesamtkollektivs vor und nach der stationären Behandlung waren statistisch signifikant (p>0,001; Wilcoxon-Test). Bei der Entlassung aus der stationären Behandlung waren 717 (83,3%) Patienten ohne jegliche neurologische Ausfälle. Insgesamt 92 (10,7%) Patienten hatten inkomplette oder in 52 (6,0%) Fällen eine komplette Querschnittsläsion (fehlende Angaben n=4). Das heißt, während des stationären Aufenthaltes kam es zu einer Verbesserung initial vorgefundener motorischer und sensibler Funktionsstörungen um mindestens eine Frankel-/ ASIA-Stufe bei 32,7% (n=17) der Patienten mit anfänglich kompletter Querschnittslähmung (Frankel/ASIA A), 78,9% (n=15) mit initial Frankel/ASIA B, 60,7% (n=17) Frankel/ASIA C und 55,7% (n=44) Frankel/ASIA D. Bei 2 (0,2%) Patienten wurde eine neurologische Verschlechterung registriert. In Abhängigkeit der Frakturlokalisation Ohne neurologische Begleitsymptome waren 63% der Patienten mit Verletzungen der BWS, bei TLÜ lag der Anteil bei 80%, bei LWS hatten 79% keinerlei Symptome dieser Art. Inkomplette QS- Syndrome wurden an BWS zu 14%, TLÜ 15% und LWS 20% registriert. Es errechnete sich eine prozentuale Häufigkeit kompletter QS-Syndrome (Frankel/ASIA A) im Zusammenhang mit Verletzungen der BWS von 23% (n=36), des TLÜ 5% (n=31) und der LWS 2% (n=2; p<0,001; Kruskal- Wallis-Test). Bei der Entlassung aus der stationären Behandlung hatten sich die Anteile kompletter QS nach BWS Verletzungen auf 21% und am TLÜ auf 3% verringert. Inkomplette QS-Syndrome persisierten zur Entlassung in 10% bei Verletzungen der BWS, 10% TLÜ und 14% LWS. In. Tab. 4 wird der neurologische Zustand nach dem Unfall dem Zeitpunkt der Entlassung aus der stationären Behandlung in Abhängigkeit von der Frakturlokalisation gegenübergestellt. Das Erholungspotential, d. h. die Besserungsrate nach kompletten oder inkompletten Querschnittsläsionen war bei Verletzungen des TLÜ größer als an der BWS. In Abhängigkeit der Art der Behandlung In den Gruppen PLASTIE und KONS wurden keine neurologischen Verschlechterungen beobachtet. Von den operativ versorgten Patienten kam es zu einer Verbesserung des neurologischen Befundes um mindestens eine Frankel-/ASIA-Stufe bei insgesamt 54 (16,9%) Patienten nach kombinierter Behandlung (KOMBI n gesamt=319) gegenüber 37 Patienten (9,7%) nach dorsaler Behandlung (DORSAL n gesamt=380; p=0,009; Fisher s exact test ). Patienten mit neurologischen Begleitverletzungen (kompletter oder inkompletter QS; Median=0 Tage) wurden signifikant schneller behandelt also solche ohne neurologische Symptome (FRAN- KEL/ASIA E; Median=3 Tage; p<0,001; Kruskal-Wallis-Test). Verschlechterungen Anhand des Frankel-/ASIA-Scores wurde bei 2 Patienten (0,2%) eine neurologische Verschlechterung dokumentiert (. Tab. 4). Hierbei handelt es sich jeweils nur um eine Frankel-Stufe. Es wurden weder Angaben über mögliche Ursachen der Verschlechterung gemacht, noch konnten zusätzliche Hinweise aus denkbaren Zusammenhängen mit intra- oder postoperative Komplikationen gewonnen werden. 159
der gesamten Brust- und Lendenwirbelsäule.
 Originalien Unfallchirurg 2009 112:294 316 DOI 10.1007/s00113-008-1539-0 Springer Medizin Verlag 2009 Redaktion W. Mutschler, München M. Reinhold 1 C. Knop 1 R. Beisse 2 L. Audigé 3 F. Kandziora 4 A. Pizanis
Originalien Unfallchirurg 2009 112:294 316 DOI 10.1007/s00113-008-1539-0 Springer Medizin Verlag 2009 Redaktion W. Mutschler, München M. Reinhold 1 C. Knop 1 R. Beisse 2 L. Audigé 3 F. Kandziora 4 A. Pizanis
4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten
 4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten In der Datenauswertung ergab sich für die Basischarakteristika der Patienten gesamt und bezogen auf die beiden Gruppen folgende Ergebnisse: 19 von 40 Patienten waren
4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten In der Datenauswertung ergab sich für die Basischarakteristika der Patienten gesamt und bezogen auf die beiden Gruppen folgende Ergebnisse: 19 von 40 Patienten waren
Wiederaufweitung des Spinalkanales. Prozent der normalen Spinalkanalweite
 23 3 Ergebnisse Die ermittelten Daten bezüglich der werden anhand von Tabellen und Graphiken dargestellt und auf statistische Signifikanz geprüft. In der ersten Gruppe, in der 1 Wirbelfrakturen mit präoperativem
23 3 Ergebnisse Die ermittelten Daten bezüglich der werden anhand von Tabellen und Graphiken dargestellt und auf statistische Signifikanz geprüft. In der ersten Gruppe, in der 1 Wirbelfrakturen mit präoperativem
Operative Behandlung traumatischer Frakturen der Brust- und Lendenwirbelsäule
 Originalien Unfallchirurg 2009 112:33 45 DOI 10.1007/s00113-008-1524-7 Online publiziert: 21. Dezember 2008 Springer Medizin Verlag 2008 Redaktion W. Mutschler, München M. Reinhold 1 C. Knop 1 R. Beisse
Originalien Unfallchirurg 2009 112:33 45 DOI 10.1007/s00113-008-1524-7 Online publiziert: 21. Dezember 2008 Springer Medizin Verlag 2008 Redaktion W. Mutschler, München M. Reinhold 1 C. Knop 1 R. Beisse
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med.)
 Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. W. Otto) Nachweis einer Wiederaufweitung des Spinalkanales
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. W. Otto) Nachweis einer Wiederaufweitung des Spinalkanales
Karsten Junge. 20h Crashkurs. Chirurgie. fast. 4. Auflage
 Karsten Junge 20h Crashkurs Chirurgie fast 4. Auflage 428 Unfallchirurgie Zu Nacken- und Kopfschmerzen, Dysphagie, Dyspnoe und neurologischen Ausfällen. Ein Ventralgleiten des C2 gegenüber dem C3 von >
Karsten Junge 20h Crashkurs Chirurgie fast 4. Auflage 428 Unfallchirurgie Zu Nacken- und Kopfschmerzen, Dysphagie, Dyspnoe und neurologischen Ausfällen. Ein Ventralgleiten des C2 gegenüber dem C3 von >
Hauptvorlesung Unfallchirurgie. Wirbelsäule
 Wann muss ich mit einer nverletzung rechnen? Regionale Verteilung von nverletzungen? Übergänge zwischen Lordose und Kyphose am häufigsten verletzt 4% aller Unfälle 15% bei Polytrauma 15% mehrere Etagen
Wann muss ich mit einer nverletzung rechnen? Regionale Verteilung von nverletzungen? Übergänge zwischen Lordose und Kyphose am häufigsten verletzt 4% aller Unfälle 15% bei Polytrauma 15% mehrere Etagen
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W.
 Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Otto Behandlungsergebnisse von Tibiakopffrakturen in Abhängigkeit
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Otto Behandlungsergebnisse von Tibiakopffrakturen in Abhängigkeit
8.2 Nicht parametrische Tests Vergleich CT/2D/3D. Abb. 28 Mann-Whitney-U-Test
 41 8. Interpretationen der Studienergebnisse Im vorliegenden Kapitel werden die Studienergebnisse mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests auf signifikante Unterschiede untersucht. Hierfür wurden die vorliegenden
41 8. Interpretationen der Studienergebnisse Im vorliegenden Kapitel werden die Studienergebnisse mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests auf signifikante Unterschiede untersucht. Hierfür wurden die vorliegenden
2. Material und Methoden
 9 2. Material und Methoden 2.1. Auswahlkriterien und Untersuchungsvorgang Dieser Arbeit liegen die Daten von 107 Patienten zugrunde, die im Zeitraum vom 01.01.1993 bis 31.12.1998 an der Klinik für Orthopädie
9 2. Material und Methoden 2.1. Auswahlkriterien und Untersuchungsvorgang Dieser Arbeit liegen die Daten von 107 Patienten zugrunde, die im Zeitraum vom 01.01.1993 bis 31.12.1998 an der Klinik für Orthopädie
2 Material und Methodik
 13 2 Material und Methodik Es wird auf das Patientengut, die Messmethodik und die statistische Auswertung der erhobenen Daten eingegangen. Die Rohdaten sind in Tabelle IX auf Seite 65 zusammengestellt.
13 2 Material und Methodik Es wird auf das Patientengut, die Messmethodik und die statistische Auswertung der erhobenen Daten eingegangen. Die Rohdaten sind in Tabelle IX auf Seite 65 zusammengestellt.
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Medizin
 Aus der Universitätsklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Hein) Morbus Scheuermann: Klinische und radiologische
Aus der Universitätsklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Hein) Morbus Scheuermann: Klinische und radiologische
Moderne minimal-invasive Operationsverfahren an der Wirbelsäule
 Moderne minimal-invasive Operationsverfahren an der Wirbelsäule R. Sobottke Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinik Köln Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. P. Eysel Überblick I. Einleitung
Moderne minimal-invasive Operationsverfahren an der Wirbelsäule R. Sobottke Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinik Köln Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. P. Eysel Überblick I. Einleitung
Subaxiales HWS-Trauma
 Subaxiales HWS-Trauma T. Pitzen Wirbelsäulenchirurgie, SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach Erstmassnahmen Sicherung der Vitalfunktionen RR- und O 2 - Monitoring Immobilisation in Rückenlage auf Vakuummatratze
Subaxiales HWS-Trauma T. Pitzen Wirbelsäulenchirurgie, SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach Erstmassnahmen Sicherung der Vitalfunktionen RR- und O 2 - Monitoring Immobilisation in Rückenlage auf Vakuummatratze
S. Vogel, 2003: Ergebnisse nach ventraler Fusion bei zervikalen Bandscheibenvorfällen
 8 Vergleich von - und gruppe 8.1 Postoperative Symptomatik In beiden Patientengruppen hatte der Haupteil der Patienten unmittelbar postoperativ noch leichte ( 57,1%; 47,8% ). Postoperativ vollständig waren
8 Vergleich von - und gruppe 8.1 Postoperative Symptomatik In beiden Patientengruppen hatte der Haupteil der Patienten unmittelbar postoperativ noch leichte ( 57,1%; 47,8% ). Postoperativ vollständig waren
S. Vogel, 2003: Ergebnisse nach ventraler Fusion bei zervikalen Bandscheibenvorfällen
 5.5 Patientengruppen Von den 102 Patienten wurden 56 mittels Carboncage und 46 mit Hilfe von Titancages versorgt. Diese beiden Patientengruppen sollen nun erst getrennt voneinander betrachtet und später
5.5 Patientengruppen Von den 102 Patienten wurden 56 mittels Carboncage und 46 mit Hilfe von Titancages versorgt. Diese beiden Patientengruppen sollen nun erst getrennt voneinander betrachtet und später
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik für Unfallchirurgie
 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik für Unfallchirurgie Hauptvorlesung Chirurgie Unfallchirurgischer Abschnitt Klinik für Unfallchirurgie Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik für Unfallchirurgie Hauptvorlesung Chirurgie Unfallchirurgischer Abschnitt Klinik für Unfallchirurgie Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Operation bei Pseudospondylolisthese und degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen der Lenden und Brustwirbelsäule
 Fachabteilung für Neurochirurgie Chefarzt PD Dr. med. Jan Kaminsky Autor: Oberarzt Dr. med. Martin Merkle Komplexe Wirbelsäulenoperationen Bei der Operation der Wirbelsäule stehen verschiedene Verfahren
Fachabteilung für Neurochirurgie Chefarzt PD Dr. med. Jan Kaminsky Autor: Oberarzt Dr. med. Martin Merkle Komplexe Wirbelsäulenoperationen Bei der Operation der Wirbelsäule stehen verschiedene Verfahren
Die ventrale winkelstabile Instrumentierung von Verletzungen der thorakolumbalen Wirbelsäule Verlauf und Ergebnisse
 Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie (Chirurgische Klinik II) der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. Rainer H. Meffert Die ventrale winkelstabile
Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie (Chirurgische Klinik II) der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. Rainer H. Meffert Die ventrale winkelstabile
Sportverletzungen an der Wirbelsäule
 Sportverletzungen an der Wirbelsäule &n Oliver Gonschorek, Patrizia Merkel, Michael Maier, Stefan Hauck, Volker Bühren Zusammenfassung Einleitung Neben Verkehrsunfall und Osteoporose steht die Sportverletzung
Sportverletzungen an der Wirbelsäule &n Oliver Gonschorek, Patrizia Merkel, Michael Maier, Stefan Hauck, Volker Bühren Zusammenfassung Einleitung Neben Verkehrsunfall und Osteoporose steht die Sportverletzung
Die Analyse der Nachbarsegmente ergab lediglich eine Tendenz zur Abnahme der Bandscheibenhöhe. Vorhandene Osteophyten nahmen im Grad ihrer Ausprägung
 21 Diskussion Die vorliegende prospektive Studie der ventralen zervikalen Diskektomie mit anschließender Fusion zeigte im 7-Jahres-Verlauf gute klinische Ergebnisse. Die Schmerzen waren postoperativ signifikant
21 Diskussion Die vorliegende prospektive Studie der ventralen zervikalen Diskektomie mit anschließender Fusion zeigte im 7-Jahres-Verlauf gute klinische Ergebnisse. Die Schmerzen waren postoperativ signifikant
S. Vogel, 2003: Ergebnisse nach ventraler Fusion bei zervikalen Bandscheibenvorfällen
 7 Ergebnisse der Titangruppe Von den 46 Patienten, die ein Titancage als Distanzhalter erhielten, waren 26 männlich (56,5%) und 20 weiblich (43,5%). Auch bei diesen wurde eine Einteilung in 6 Altersgruppen
7 Ergebnisse der Titangruppe Von den 46 Patienten, die ein Titancage als Distanzhalter erhielten, waren 26 männlich (56,5%) und 20 weiblich (43,5%). Auch bei diesen wurde eine Einteilung in 6 Altersgruppen
CURRICULUM VITAE NAME:
 CURRICULUM VITAE NAME: Rudolf W. Beisse Chefarzt Klinik für operative und konservative Therapie der Wirbelsäule Krankenhaus Rummelsberg Rummelsberg 71 90592 Schwarzenbruck Adjunct Professor of Neurosurgery
CURRICULUM VITAE NAME: Rudolf W. Beisse Chefarzt Klinik für operative und konservative Therapie der Wirbelsäule Krankenhaus Rummelsberg Rummelsberg 71 90592 Schwarzenbruck Adjunct Professor of Neurosurgery
5 Nachuntersuchung und Ergebnisse
 Therapie bei ipsilateraler Hüft- u. Knie-TEP Anzahl n HTEP-Wechsel Femurtotalersatz konservative Therapie Diagramm 4: Verteilung der Therapieverfahren bei ipsilateraler HTEP und KTEP 4.7. Komplikationen
Therapie bei ipsilateraler Hüft- u. Knie-TEP Anzahl n HTEP-Wechsel Femurtotalersatz konservative Therapie Diagramm 4: Verteilung der Therapieverfahren bei ipsilateraler HTEP und KTEP 4.7. Komplikationen
Typische Ursachen. Symptomatik. Diagnostik
 Definition Die Wirbelsäule des menschlichen Körpers besteht insgesamt aus 33 bis 34 Wirbelkörpern (= Wirbel ), welche sich in 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel, 5 Kreuzwirbel und 4 bis 5 Steißwirbel
Definition Die Wirbelsäule des menschlichen Körpers besteht insgesamt aus 33 bis 34 Wirbelkörpern (= Wirbel ), welche sich in 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel, 5 Kreuzwirbel und 4 bis 5 Steißwirbel
Die Dokumentation bei Eingriffen an der Wirbelsäule aus ärztlicher Sicht T. Auhuber
 Die Dokumentation bei Eingriffen an der Wirbelsäule aus ärztlicher Sicht T. Auhuber Miljak / Weiß 1053 f&w 12/2015 2 Zeitlicher Dokumentationsaufwand nach Profession und Fachrichtung 03/2015 3 Zeitlicher
Die Dokumentation bei Eingriffen an der Wirbelsäule aus ärztlicher Sicht T. Auhuber Miljak / Weiß 1053 f&w 12/2015 2 Zeitlicher Dokumentationsaufwand nach Profession und Fachrichtung 03/2015 3 Zeitlicher
Behandlungsmethode. Krankenhausaufenthalt Komplikationen
 - -. Patientenkollektiv und Methodik Anhand einer retrospektiven Studie wurde ein primär unselektiertes Krankengut der Abteilung, später Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-
- -. Patientenkollektiv und Methodik Anhand einer retrospektiven Studie wurde ein primär unselektiertes Krankengut der Abteilung, später Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-
Verletzungen der BWS, LWS und des thorakolumbalen Übergangs
 Die meisten Verletzungen der Wirbelsäule treten im Bereich des thorakolumbalen Übergangs, dem Bereich zwischen unterer Brustwirbelsäule und oberer Lendenwirbelsäule auf, wobei mehr als die Hälfte aller
Die meisten Verletzungen der Wirbelsäule treten im Bereich des thorakolumbalen Übergangs, dem Bereich zwischen unterer Brustwirbelsäule und oberer Lendenwirbelsäule auf, wobei mehr als die Hälfte aller
Brustwirbelsäule. Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie
 Brustwirbelsäule Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie 02 Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie Degenerative Erkrankungen der Brustwirbelsäule Degenerative Erkrankungen der Brustwirbelsäule haben selten eine chirurgisch
Brustwirbelsäule Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie 02 Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie Degenerative Erkrankungen der Brustwirbelsäule Degenerative Erkrankungen der Brustwirbelsäule haben selten eine chirurgisch
Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff?
 Aus der Klinik für Thorax- Herz-Gefäßchirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg / Saar Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff? Dissertation zur Erlangung
Aus der Klinik für Thorax- Herz-Gefäßchirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg / Saar Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff? Dissertation zur Erlangung
Therapieempfehlungen zur Versorgung von Verletzungen der Brust- und Lendenwirbelsäule
 Leitthema Unfallchirurg 2011 114:9 16 DOI 10.1007/s00113-010-1934-1 Springer-Verlag 2011 Redaktion A.P. Verheyden, Lahr A.P. Verheyden 1 A. Hölzl 1 H. Ekkerlein 2 E. Gercek 3 S. Hauck 4 C. Josten 5 F.
Leitthema Unfallchirurg 2011 114:9 16 DOI 10.1007/s00113-010-1934-1 Springer-Verlag 2011 Redaktion A.P. Verheyden, Lahr A.P. Verheyden 1 A. Hölzl 1 H. Ekkerlein 2 E. Gercek 3 S. Hauck 4 C. Josten 5 F.
Auf finden Sie ein interaktives Material zu diesem Bild. Bildgebung (2-postoperativ) CT, HWS, sagittal und 3D-Rekonstruktion en
 Fallbeschreibung 20-jähriger Student. Er betreibt Downhill-Mountainbiking seit Jahren mit viel Erfahrung und trägt eine volle Schutzmontur, die Kopf und Rücken schützen soll, da es nicht selten zu Stürzen
Fallbeschreibung 20-jähriger Student. Er betreibt Downhill-Mountainbiking seit Jahren mit viel Erfahrung und trägt eine volle Schutzmontur, die Kopf und Rücken schützen soll, da es nicht selten zu Stürzen
Klausur Unfallchirurgie
 Klausur Unfallchirurgie 08.03.2010 I) Eine 42-jährige Frau stellt sich nach einem Sturz auf Eisglätte in Ihrer Notaufnahme vor. Welche Aussage zum klinischen Bild ist richtig? 1. Es handelt sich um eine
Klausur Unfallchirurgie 08.03.2010 I) Eine 42-jährige Frau stellt sich nach einem Sturz auf Eisglätte in Ihrer Notaufnahme vor. Welche Aussage zum klinischen Bild ist richtig? 1. Es handelt sich um eine
Osteosynthesen an der HWS am UKH Linz H. Haller, M. Capousek, F. Bamer, Chr. Rodemund
 Osteosynthesen an der HWS am UKH Linz 1.1.1980-31. 12. 1990 H. Haller, M. Capousek, F. Bamer, Chr. Rodemund UKH Linz, ärztlicher Leiter Prim. Dr. Georg Kukla Bereits 1955 hatte Robinson seine Arbeit über
Osteosynthesen an der HWS am UKH Linz 1.1.1980-31. 12. 1990 H. Haller, M. Capousek, F. Bamer, Chr. Rodemund UKH Linz, ärztlicher Leiter Prim. Dr. Georg Kukla Bereits 1955 hatte Robinson seine Arbeit über
Übersicht Masterfolien
 Übersicht Masterfolien Vorträge Modul 1 Grundlagen und konservative Therapie degenerativer Erkrankungen 1. Entwicklungsgeschichte / Embryologie 2. Anatomie 3. Biomechanik 4. Neurophysiologie 5. Radiologie
Übersicht Masterfolien Vorträge Modul 1 Grundlagen und konservative Therapie degenerativer Erkrankungen 1. Entwicklungsgeschichte / Embryologie 2. Anatomie 3. Biomechanik 4. Neurophysiologie 5. Radiologie
Qualitätssicherung bei Fallpauschalen und Sonderentgelten. Basisstatistik
 Qualitätssicherung bei Fallpauschalen und Sonderentgelten Basisstatistik ----------- Basisdaten ---------------------------------------------------------------------------- Angaben über Krankenhäuser und
Qualitätssicherung bei Fallpauschalen und Sonderentgelten Basisstatistik ----------- Basisdaten ---------------------------------------------------------------------------- Angaben über Krankenhäuser und
Thorakolumbale Frakturen Operative Versorgung
 Verletzungen der Wirbelsäule Trauma Berufskrankh 2008 10 [Suppl 2]:182 186 DOI 10.1007/s10039-008-1397-6 Online publiziert: 10. Mai 2008 Springer Medizin Verlag 2008 M. Beck T. Mittlmeier Abteilung für
Verletzungen der Wirbelsäule Trauma Berufskrankh 2008 10 [Suppl 2]:182 186 DOI 10.1007/s10039-008-1397-6 Online publiziert: 10. Mai 2008 Springer Medizin Verlag 2008 M. Beck T. Mittlmeier Abteilung für
Behandlungsschemata. Team Wirbelsäule. Klinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie. ZEP Zentrum für Ergo- und Physiotherapie
 CH-9007 St.Gallen Tel. 071 494 13 65 www.kantonsspital-sg.ch Klinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie ZEP Zentrum für Ergo- und Physiotherapie Behandlungsschemata Team Wirbelsäule 2/7 Inhaltsverzeichnis
CH-9007 St.Gallen Tel. 071 494 13 65 www.kantonsspital-sg.ch Klinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie ZEP Zentrum für Ergo- und Physiotherapie Behandlungsschemata Team Wirbelsäule 2/7 Inhaltsverzeichnis
Übersicht der Masterfolien Module 1 bis 6
 Übersicht der Masterfolien Module 1 bis 6 Vorträge Modul 1 Grundlagen und konservative Therapie degenerativer Erkrankungen 1. Entwicklungsgeschichte / Embryologie 2. Anatomie 3. Biomechanik 4. Neurophysiologie
Übersicht der Masterfolien Module 1 bis 6 Vorträge Modul 1 Grundlagen und konservative Therapie degenerativer Erkrankungen 1. Entwicklungsgeschichte / Embryologie 2. Anatomie 3. Biomechanik 4. Neurophysiologie
Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarkes
 Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarkes Einteilung der Wirbelsäulenverletzungen nach dem Unfallmechanismus Stauchung, Flexion, Hyperextension nach dem Typ der Fraktur Kompressionsfraktur Berstungsfraktur
Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarkes Einteilung der Wirbelsäulenverletzungen nach dem Unfallmechanismus Stauchung, Flexion, Hyperextension nach dem Typ der Fraktur Kompressionsfraktur Berstungsfraktur
Wirbelsäulenmetastasen
 Patienteninformation Wirbelsäulenchirurgie Wirbelsäulenmetastasen Ein Patientenleitfaden zur Behandlung in der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie der Asklepios Klinik Altona, Hamburg
Patienteninformation Wirbelsäulenchirurgie Wirbelsäulenmetastasen Ein Patientenleitfaden zur Behandlung in der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie der Asklepios Klinik Altona, Hamburg
ernst-moritz-arndt-universität greifswald unfall- und wiederherstellungschirurgie Polytrauma
 Polytrauma Dr. G. Matthes Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Unfallkrankenhaus Berlin Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Unter einem Polytrauma versteht
Polytrauma Dr. G. Matthes Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Unfallkrankenhaus Berlin Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Unter einem Polytrauma versteht
3. Ergebnisse Geschlechts- und Altersverteilung
 23 3. Ergebnisse 3.1. Geschlechts- und Altersverteilung In der vorliegenden Studie wurden 100 übergewichtige Patienten mittels Gastric Banding behandelt, wobei es sich um 22 männliche und 78 weibliche
23 3. Ergebnisse 3.1. Geschlechts- und Altersverteilung In der vorliegenden Studie wurden 100 übergewichtige Patienten mittels Gastric Banding behandelt, wobei es sich um 22 männliche und 78 weibliche
Das stumpfe Bauchtrauma im Kindesalter
 Das stumpfe Bauchtrauma im Kindesalter Arneitz Ch. 1, Krafka K. 1, Sinzig M. 2, Jauk B. 3, Fasching G. 1 Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie, 1 Abteilung für Kinderradiologie, 2 Abteilung für Kinder-
Das stumpfe Bauchtrauma im Kindesalter Arneitz Ch. 1, Krafka K. 1, Sinzig M. 2, Jauk B. 3, Fasching G. 1 Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie, 1 Abteilung für Kinderradiologie, 2 Abteilung für Kinder-
Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart. Notwendigkeit von abgefragten Parametern
 Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart Notwendigkeit von abgefragten Parametern Prof. Dr. Hanns-Peter-Scharf Orthopädische Universitätsklinik
Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart Notwendigkeit von abgefragten Parametern Prof. Dr. Hanns-Peter-Scharf Orthopädische Universitätsklinik
Strukturelle Pathologien der oberen HWS. Der Beitrag des Wirbelsäulenchirurgen
 Strukturelle Pathologien der oberen HWS Der Beitrag des Wirbelsäulenchirurgen Dr. med. Frank Kleinstück Leitender Arzt, Wirbelsäulenzentrum Schulthess Klinik Zürich Komplex Kombinierte Zugänge Anwendung
Strukturelle Pathologien der oberen HWS Der Beitrag des Wirbelsäulenchirurgen Dr. med. Frank Kleinstück Leitender Arzt, Wirbelsäulenzentrum Schulthess Klinik Zürich Komplex Kombinierte Zugänge Anwendung
3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17,8%) am Leben und 88 (82,2%) verstorben (Tab. 3.1.).
 18 3. Ergebnisse 3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17%) am Leben und 88 (82%) verstorben (Tab. 3.1.). Tabelle 3.1. Häufigkeit der lebenden und verstorbenen Patienten
18 3. Ergebnisse 3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17%) am Leben und 88 (82%) verstorben (Tab. 3.1.). Tabelle 3.1. Häufigkeit der lebenden und verstorbenen Patienten
Lendenwirbelsäule. Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie
 Lendenwirbelsäule Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie 02 Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie Degenerative Erkrankungen der Lendenwirbelsäule Die degenerative Erkrankung mit Wasserverlust der Bandscheibe führt
Lendenwirbelsäule Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie 02 Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie Degenerative Erkrankungen der Lendenwirbelsäule Die degenerative Erkrankung mit Wasserverlust der Bandscheibe führt
Epidemiologische Entwicklungen und altersabhängige Besonderheiten
 Epidemiologische Entwicklungen und altersabhängige Besonderheiten Eine Analyse aus dem TraumaRegister DGU Rolf Lefering Institute for Research in Operative Medicine (IFOM) University Witten/Herdecke Cologne,
Epidemiologische Entwicklungen und altersabhängige Besonderheiten Eine Analyse aus dem TraumaRegister DGU Rolf Lefering Institute for Research in Operative Medicine (IFOM) University Witten/Herdecke Cologne,
Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3
![Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3 Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3](/thumbs/98/135702962.jpg) 21 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Ergebnisse 4.1.1 Untersuchungsgruppen In einer prospektiven Studie wurden die Patienten erfasst, die im Zeitraum von 1990 bis 1994 mit ABG I- und Zweymüller SL-Hüftendoprothesen
21 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Ergebnisse 4.1.1 Untersuchungsgruppen In einer prospektiven Studie wurden die Patienten erfasst, die im Zeitraum von 1990 bis 1994 mit ABG I- und Zweymüller SL-Hüftendoprothesen
3 Ergebnisse. 3.1 Patientenkollektiv
 3 Ergebnisse 3.1 Patientenkollektiv Es wurden an der MLU in den Jahren 1995-2005 insgesamt 15 Patienten aufgrund eines Morbus Scheuermann operiert. Das Alter zum Zeitpunkt der OP lag zwischen 14,1 und
3 Ergebnisse 3.1 Patientenkollektiv Es wurden an der MLU in den Jahren 1995-2005 insgesamt 15 Patienten aufgrund eines Morbus Scheuermann operiert. Das Alter zum Zeitpunkt der OP lag zwischen 14,1 und
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Schlaganfallbehandlung Neurologische Rehabilitation
 Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung Schlaganfallbehandlung Neurologische Rehabilitation Jahresauswertung 2010 Geschäftsstelle Qualitätssicherung Hessen Frankfurter Straße 10-14 65760
Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung Schlaganfallbehandlung Neurologische Rehabilitation Jahresauswertung 2010 Geschäftsstelle Qualitätssicherung Hessen Frankfurter Straße 10-14 65760
Die Ballon-Kyphoplastie ist ein Verfahren zur Behandlung von osteoporotischen und zum Teil auch traumatischen (unfallbedingten) Wirbelkörperbrüchen.
 Die Ballon-Kyphoplastie ist ein Verfahren zur Behandlung von osteoporotischen und zum Teil auch traumatischen (unfallbedingten) Wirbelkörperbrüchen. Die Wirbelsäule besteht aus 7 Halswirbeln, 12 Brustwirbeln,
Die Ballon-Kyphoplastie ist ein Verfahren zur Behandlung von osteoporotischen und zum Teil auch traumatischen (unfallbedingten) Wirbelkörperbrüchen. Die Wirbelsäule besteht aus 7 Halswirbeln, 12 Brustwirbeln,
Thorakolumbaler Übergang der Wirbelsäule
 Wirbelsäule Trauma Berufskrankh 2007 9 [Suppl 2]:S249 S256 DOI 10.1007/s10039-006-1149-4 Online publiziert: 10. Juni 2006 Springer Medizin Verlag 2006 C. Rusu L. Herold C. Voigt H. Lill Klinik für Unfall-
Wirbelsäule Trauma Berufskrankh 2007 9 [Suppl 2]:S249 S256 DOI 10.1007/s10039-006-1149-4 Online publiziert: 10. Juni 2006 Springer Medizin Verlag 2006 C. Rusu L. Herold C. Voigt H. Lill Klinik für Unfall-
Klausur Unfallchirurgie
 Klausur Unfallchirurgie 09.03.2009 Frage 1 Welche Aussage zur Diagnostik von Brandverletzungen trifft nicht zu? 1) Eine Abschätzung der Flächenausdehnung der Verbrennung kann mit der Neunerregel nach Wallace
Klausur Unfallchirurgie 09.03.2009 Frage 1 Welche Aussage zur Diagnostik von Brandverletzungen trifft nicht zu? 1) Eine Abschätzung der Flächenausdehnung der Verbrennung kann mit der Neunerregel nach Wallace
Auswahl des operativen Zugangsweges
 47 6 Auswahl des operativen Zugangsweges 6.1 Anteriorer Zugang 48 6.2 Posteriorer Zugang 49 6.3 Kombinierter Zugang 50 Literatur 52 S. A. König, U. Spetzger, Degenerative Erkrankungen der Halswirbelsäule,
47 6 Auswahl des operativen Zugangsweges 6.1 Anteriorer Zugang 48 6.2 Posteriorer Zugang 49 6.3 Kombinierter Zugang 50 Literatur 52 S. A. König, U. Spetzger, Degenerative Erkrankungen der Halswirbelsäule,
Halswirbelsäule. Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie
 Halswirbelsäule Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie 02 Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie Degenerative Erkrankungen der Halswirbelsäule (HWS) Die Degeneration mit Wasserverlust der Bandscheibe führt zur Höhenminderung
Halswirbelsäule Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie 02 Kompetenz Wirbelsäulenchirurgie Degenerative Erkrankungen der Halswirbelsäule (HWS) Die Degeneration mit Wasserverlust der Bandscheibe führt zur Höhenminderung
Operationstechnik. TSLP Thoracolumbar Spine Locking Plate. Anteriore thorakolumbale Wirbelsäulen-Platte.
 Operationstechnik TSLP Thoracolumbar Spine Locking Plate. Anteriore thorakolumbale Wirbelsäulen-Platte. Inhaltsverzeichnis TSLP Thoracolumbar Spine Locking Plate 2 Prinzipien der AO 4 Indikationen und
Operationstechnik TSLP Thoracolumbar Spine Locking Plate. Anteriore thorakolumbale Wirbelsäulen-Platte. Inhaltsverzeichnis TSLP Thoracolumbar Spine Locking Plate 2 Prinzipien der AO 4 Indikationen und
Übersicht der Masterfolien Module 1 bis 6
 Übersicht der Masterfolien Module 1 bis 6 Vorträge Modul 1 Grundlagen und konservative Therapie degenerativer Erkrankungen 1. Entwicklungsgeschichte / Embryologie 2. Anatomie 3. Biomechanik 4. Neurophysiologie
Übersicht der Masterfolien Module 1 bis 6 Vorträge Modul 1 Grundlagen und konservative Therapie degenerativer Erkrankungen 1. Entwicklungsgeschichte / Embryologie 2. Anatomie 3. Biomechanik 4. Neurophysiologie
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Hein Vergleich der anterioren lumbalen
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Hein Vergleich der anterioren lumbalen
SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO
 SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO das Produkt und seine Geschichte Dr. med. Benoît Laurent Geschäftsführender
SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO das Produkt und seine Geschichte Dr. med. Benoît Laurent Geschäftsführender
SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO
 SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO das Produkt und seine Geschichte Dr. med. Benoît Laurent Geschäftsführender
SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO SYNCHRO: DER TLIF-CAGE ZUR FUSION DER LENDENWIRBELSÄULE SYNCHRO das Produkt und seine Geschichte Dr. med. Benoît Laurent Geschäftsführender
Endoskopische, lasergestützte Bandscheibenoperation DR. ARNO ZIFKO Facharzt für Orthopädie orthopädische Chirurgie Rheumatologie Sportarzt
 Endoskopische, lasergestützte Bandscheibenoperation DR. ARNO ZIFKO Facharzt für Orthopädie orthopädische Chirurgie Rheumatologie Sportarzt A-8650 Kindberg A-1060 Wien Kirchplatz 3 Hofmühlgasse 16/8 Austria
Endoskopische, lasergestützte Bandscheibenoperation DR. ARNO ZIFKO Facharzt für Orthopädie orthopädische Chirurgie Rheumatologie Sportarzt A-8650 Kindberg A-1060 Wien Kirchplatz 3 Hofmühlgasse 16/8 Austria
KYPHON Ballon-Kyphoplastie. Minimal-invasives Verfahren zur Behandlung von Wirbelkörperkompressionsfrakturen
 KYPHON Ballon-Kyphoplastie Minimal-invasives Verfahren zur Behandlung von Wirbelkörperkompressionsfrakturen Zu dieser Broschüre Ihr Arzt hat bei Ihnen eine Wirbelkörperkompressionsfraktur diagnostiziert.
KYPHON Ballon-Kyphoplastie Minimal-invasives Verfahren zur Behandlung von Wirbelkörperkompressionsfrakturen Zu dieser Broschüre Ihr Arzt hat bei Ihnen eine Wirbelkörperkompressionsfraktur diagnostiziert.
Operationsberichte Orthopädie und Unfallchirurgie
 Operationsberichte Operationsberichte Orthopädie und Unfallchirurgie Bearbeitet von Holger Siekmann, Lars Irlenbusch, Stefan Klima., neu bearbeitete Auflage 016. Buch. XI, 370 S. Softcover ISBN 978 3 66
Operationsberichte Operationsberichte Orthopädie und Unfallchirurgie Bearbeitet von Holger Siekmann, Lars Irlenbusch, Stefan Klima., neu bearbeitete Auflage 016. Buch. XI, 370 S. Softcover ISBN 978 3 66
sehr gut darstellbar darstellbar
 4. Ergebnisse 4.1. Untersuchungstechnische Gesichtspunkte Alle im Ergebnis unserer Untersuchungsreihe dargestellten Bilder zeichneten sich durch eine sehr gute Bildschärfe und einen optimalen Bildausschnitt
4. Ergebnisse 4.1. Untersuchungstechnische Gesichtspunkte Alle im Ergebnis unserer Untersuchungsreihe dargestellten Bilder zeichneten sich durch eine sehr gute Bildschärfe und einen optimalen Bildausschnitt
Diskussion. Abb. 17: SI -Verlauf bei 4 Patienten mit geschlossener Frakturreposition. SI nach Reposition 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
 - 49-3.3.2 Radiologische Auswertung In Abb. 17 ist das Nachsinterungsverhalten der Wirbelfrakturen anhand des SI im Behandlungsverlauf nach Reposition im Einzelnen dargestellt. SI nach Reposition SI 0,9
- 49-3.3.2 Radiologische Auswertung In Abb. 17 ist das Nachsinterungsverhalten der Wirbelfrakturen anhand des SI im Behandlungsverlauf nach Reposition im Einzelnen dargestellt. SI nach Reposition SI 0,9
Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. WS 2006/2007, 2. Februar 2007
 Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie WS 2006/2007, 2. Februar 2007 Name: Vorname: Matrikelnummer: Bitte tragen Sie die richtigen Antworten in die Tabelle ein. Die Frage X beantworten Sie direkt
Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie WS 2006/2007, 2. Februar 2007 Name: Vorname: Matrikelnummer: Bitte tragen Sie die richtigen Antworten in die Tabelle ein. Die Frage X beantworten Sie direkt
Dissertation zum Erwerb des Doktorgrades der Medizin an der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Aus der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wiederherstellungschirurgie Städtische Klinikum München GmbH, Klinikum Harlaching Chefarzt: Prof. Dr. med. H. Hertlein DIE VENTRALE STABILISIERUNG THORAKOLUMBALER
Aus der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wiederherstellungschirurgie Städtische Klinikum München GmbH, Klinikum Harlaching Chefarzt: Prof. Dr. med. H. Hertlein DIE VENTRALE STABILISIERUNG THORAKOLUMBALER
Hauptvorlesung Chirurgie Unfallchirurgischer Abschnitt Obere Extremität 1
 Hauptvorlesung Chirurgie Unfallchirurgischer Abschnitt Obere Extremität 1 Klinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus
Hauptvorlesung Chirurgie Unfallchirurgischer Abschnitt Obere Extremität 1 Klinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus
Winkelsteife Implantate an der HWS
 Winkelsteife Implantate an der HWS Bernd Vock, Stefan Matschke, Paul Alfred Grützner, Andreas Wentzensen Zusammenfassung Die ventrale Spondylodese mit einem winkelsteifen Implantat und monokortikaler Schraubenverankerung
Winkelsteife Implantate an der HWS Bernd Vock, Stefan Matschke, Paul Alfred Grützner, Andreas Wentzensen Zusammenfassung Die ventrale Spondylodese mit einem winkelsteifen Implantat und monokortikaler Schraubenverankerung
Den vorliegenden Behandlungsakten sollten die folgenden Informationen entnommen werden:
 2 Material und Methoden 2.1 Scheuermann Kyphose 2.1.1 Patientenkollektiv Von August 1995 bis Dezember 2005 wurden an der orthopädischen Klinik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg insgesamt 15
2 Material und Methoden 2.1 Scheuermann Kyphose 2.1.1 Patientenkollektiv Von August 1995 bis Dezember 2005 wurden an der orthopädischen Klinik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg insgesamt 15
Der Oberschenkelhalsbruch
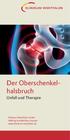 KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
Zervikale Implantate. Für jeden Hals die perfekte Lösung.
 Zervikale Implantate Für jeden Hals die perfekte Lösung. 1 Platten Stab-Schrauben- Systeme Wirbelkörperersatz Cages Für jeden Hals Zervikale Implantate ulrich medical Wirbelsäulensysteme überzeugen auf
Zervikale Implantate Für jeden Hals die perfekte Lösung. 1 Platten Stab-Schrauben- Systeme Wirbelkörperersatz Cages Für jeden Hals Zervikale Implantate ulrich medical Wirbelsäulensysteme überzeugen auf
Instabilität Lendenwirbelsäule - Informationen, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten
 Es kann aus sehr unterschiedlichen Gründen zu einer Instabilität der Lendenwirbelsäule kommen. Der weitaus häufigste Grund ist der natürliche Verschleiß der Wirbelsäule. Eine Instabilität der Wirbelsäule
Es kann aus sehr unterschiedlichen Gründen zu einer Instabilität der Lendenwirbelsäule kommen. Der weitaus häufigste Grund ist der natürliche Verschleiß der Wirbelsäule. Eine Instabilität der Wirbelsäule
Ergebnisse VitA und VitVM
 Ergebnisse VitA und VitVM 1 Basisparameter... 2 1.1 n... 2 1.2 Alter... 2 1.3 Geschlecht... 5 1.4 Beobachtungszeitraum (von 1. Datum bis letzte in situ)... 9 2 Extraktion... 11 3 Extraktionsgründe... 15
Ergebnisse VitA und VitVM 1 Basisparameter... 2 1.1 n... 2 1.2 Alter... 2 1.3 Geschlecht... 5 1.4 Beobachtungszeitraum (von 1. Datum bis letzte in situ)... 9 2 Extraktion... 11 3 Extraktionsgründe... 15
Traumatologie am Schultergürtel
 Traumatologie am Schultergürtel 54 instruktive Fälle Bearbeitet von Rainer-Peter Meyer, Fabrizio Moro, Hans-Kaspar Schwyzer, Beat René Simmen 1. Auflage 2011. Buch. xvi, 253 S. Hardcover ISBN 978 3 642
Traumatologie am Schultergürtel 54 instruktive Fälle Bearbeitet von Rainer-Peter Meyer, Fabrizio Moro, Hans-Kaspar Schwyzer, Beat René Simmen 1. Auflage 2011. Buch. xvi, 253 S. Hardcover ISBN 978 3 642
Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie (Wirbelsäule)
 Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie (Wirbelsäule) Die menschliche Wirbelsäule besteht aus den knöchernen Wirbeln und den dazwischenliegenden Bandscheiben. Die Wirbelbögen der einzelnen Wirbelkörper
Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie (Wirbelsäule) Die menschliche Wirbelsäule besteht aus den knöchernen Wirbeln und den dazwischenliegenden Bandscheiben. Die Wirbelbögen der einzelnen Wirbelkörper
Tab. 4.1: Altersverteilung der Gesamtstichprobe BASG SASG BAS SAS UDS SCH AVP Mittelwert Median Standardabweichung 44,36 43,00 11,84
 Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Lendenwirbelsäulenverletzungen im Frontalcrash
 ADAC Fahrzeugtechnik 08.03.4350 - IN 29146 STAND 07-2017 Berichte der ADAC Unfallforschung Juli 2017 Verfasser: Thomas Unger Lendenwirbelsäulenverletzungen im Frontalcrash ADAC Unfallforschung im ADAC
ADAC Fahrzeugtechnik 08.03.4350 - IN 29146 STAND 07-2017 Berichte der ADAC Unfallforschung Juli 2017 Verfasser: Thomas Unger Lendenwirbelsäulenverletzungen im Frontalcrash ADAC Unfallforschung im ADAC
Universitätsklinikum für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde Tübingen Dr. Paul-Stefan Mauz; Leitender Oberarzt Florian Daniel Nonnenmacher; cand. med.
 Bipolare Gefäßversiegelung mit den bipolaren Instrumenten marclamp /marcut und dem Hochfrequenzgenerator maxium bei Schilddrüsenoperationen, Tumoroperationen, Lappenplastiken und Halsweichteileingriffen
Bipolare Gefäßversiegelung mit den bipolaren Instrumenten marclamp /marcut und dem Hochfrequenzgenerator maxium bei Schilddrüsenoperationen, Tumoroperationen, Lappenplastiken und Halsweichteileingriffen
Klassifikation (King, Lenke) Skoliose Deformitiäten I 02
 Mit welchen Klassifikationen werden Skoliosen beurteilt? Klassifikationen dienen dazu, für unterschiedliche Untersucher einen einheitlichen Maßstab zur Beurteilung einer Erkrankung zu schaffen, um ein
Mit welchen Klassifikationen werden Skoliosen beurteilt? Klassifikationen dienen dazu, für unterschiedliche Untersucher einen einheitlichen Maßstab zur Beurteilung einer Erkrankung zu schaffen, um ein
Vorträge 2013 Poster 2013 Vorsitz 2013
 Vorträge 2013 Poster 2013 Vorsitz 2013 W. Dube Streitfall HWS-Distorsion 22. Frankfurter BG-Seminar für Sachbearbeiter und Reha-Manager, Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt am Main, 15. Mai
Vorträge 2013 Poster 2013 Vorsitz 2013 W. Dube Streitfall HWS-Distorsion 22. Frankfurter BG-Seminar für Sachbearbeiter und Reha-Manager, Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt am Main, 15. Mai
Guillain-Barré syndrome and SIADH Saifudheen K, Jose J, Gafoor VA and Musthafa M Neurology 2011;76(8):
 Guillain-Barré syndrome and SIADH Saifudheen K, Jose J, Gafoor VA and Musthafa M Neurology 2011;76(8):701-704 Ziele Aufschluss über die Inzidenz und Charakteristik des SIADH bei GBS-Patienten zu erlangen
Guillain-Barré syndrome and SIADH Saifudheen K, Jose J, Gafoor VA and Musthafa M Neurology 2011;76(8):701-704 Ziele Aufschluss über die Inzidenz und Charakteristik des SIADH bei GBS-Patienten zu erlangen
Chirurgie der verletzten Wirbelsäule
 Chirurgie der verletzten Wirbelsäule Volker Bühren Christoph Josten (Hrsg.) Chirurgie der verletzten Wirbelsäule Frakturen, Instabilitäten, Deformitäten Mit 1074 Abbildungen 123 Herausgeber Volker Bühren,
Chirurgie der verletzten Wirbelsäule Volker Bühren Christoph Josten (Hrsg.) Chirurgie der verletzten Wirbelsäule Frakturen, Instabilitäten, Deformitäten Mit 1074 Abbildungen 123 Herausgeber Volker Bühren,
In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt
 In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt N. Südkamp, M. Feucht Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Femoraler Slope...? Femoraler Slope
In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt N. Südkamp, M. Feucht Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Femoraler Slope...? Femoraler Slope
A. E. S i a m, H. A h m e d, S. W e r l e, A. E z z a t i, G. M o h a m e d, H. B ö h m
 Behandlung der lumbalen Spondylodiszitis : 1 - posteriore lumbale intersomatische Fusion (PLIF) 2 - ventrales Debridement + dorsale perkutane Stabilisierung (vd-ds) A. E. S i a m, H. A h m e d, S. W e
Behandlung der lumbalen Spondylodiszitis : 1 - posteriore lumbale intersomatische Fusion (PLIF) 2 - ventrales Debridement + dorsale perkutane Stabilisierung (vd-ds) A. E. S i a m, H. A h m e d, S. W e
3. Patienten und Methoden Patientenkollektiv
 40 3. Patienten und Methoden 3.1. Patientenkollektiv Die Knieendoprothesenoperationen wurden in der Zeit von November 1996 bis November 2003 durchgeführt. Im Zeitraum von November 1996 bis März 2000 wurden
40 3. Patienten und Methoden 3.1. Patientenkollektiv Die Knieendoprothesenoperationen wurden in der Zeit von November 1996 bis November 2003 durchgeführt. Im Zeitraum von November 1996 bis März 2000 wurden
Der Bandscheibenvorfall. von H. Meinig
 Der Bandscheibenvorfall von H. Meinig Anatomie Anatomie der Wirbelsäule: 24 Wirbel + Sakrum & Steißbein knorpelige Grund- & Deckplatten 24 Zwischenwirbelscheiben Das Rückenmark (Myleon) verläuft direkt
Der Bandscheibenvorfall von H. Meinig Anatomie Anatomie der Wirbelsäule: 24 Wirbel + Sakrum & Steißbein knorpelige Grund- & Deckplatten 24 Zwischenwirbelscheiben Das Rückenmark (Myleon) verläuft direkt
Vertebroplastie, Kyphoplastie und Lordoplastie
 Vertebroplastie, Kyphoplastie und Lordoplastie Allgemeines Mit zunehmendem Alter werden die Wirbelkörper brüchiger. Dabei kann es bereits bei geringer Krafteinwirkung wie brüskes Absitzen zum Bruch eines
Vertebroplastie, Kyphoplastie und Lordoplastie Allgemeines Mit zunehmendem Alter werden die Wirbelkörper brüchiger. Dabei kann es bereits bei geringer Krafteinwirkung wie brüskes Absitzen zum Bruch eines
PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR
 SCHULTER- UND ELLENBOGENCHIRURGIE PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR Diagnostik und Therapieentscheidung Tobias Helfen TRAUMA 2 KLINISCHE DIAGNOSTIK 3 RADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK Primär: konventionelles Röntgen in
SCHULTER- UND ELLENBOGENCHIRURGIE PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR Diagnostik und Therapieentscheidung Tobias Helfen TRAUMA 2 KLINISCHE DIAGNOSTIK 3 RADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK Primär: konventionelles Röntgen in
Lumbales Wurzelreizsyndrom. Definition:
 Lumbales Wurzelreizsyndrom Definition: Mono-, seltener bisegmentale ein-, seltener beidseitige Kompression der lumbalen Spinalnerven durch ausgetretenes Bandscheibengewebe, wobei differenzialdiagnostisch
Lumbales Wurzelreizsyndrom Definition: Mono-, seltener bisegmentale ein-, seltener beidseitige Kompression der lumbalen Spinalnerven durch ausgetretenes Bandscheibengewebe, wobei differenzialdiagnostisch
Dr. med Ralf Wagner Innovative Therapie und Operationsverfahren an der Wirbelsäule
 Dr. med Ralf Wagner Innovative Therapie und Operationsverfahren an der Wirbelsäule 15.06.2013 2013 Ligamenta www.ligamenta.de info@ligamenta.com Tel. +49 69 3700 673 0 Fax +49 69 3700 673 233 Die Wirbelsäule
Dr. med Ralf Wagner Innovative Therapie und Operationsverfahren an der Wirbelsäule 15.06.2013 2013 Ligamenta www.ligamenta.de info@ligamenta.com Tel. +49 69 3700 673 0 Fax +49 69 3700 673 233 Die Wirbelsäule
Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin. der Medizinischen Fakultät. der UNIVERSITÄT DES SAARLANDES
 Aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar Direktor Prof. Dr. med. T. Pohlemann Frühergebnisse der operativen monosegmentalen Stabilisierung
Aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar Direktor Prof. Dr. med. T. Pohlemann Frühergebnisse der operativen monosegmentalen Stabilisierung
Der alte Rücken, krumm und eng - Degenerative Skoliose. Prof. Dr. med. Paul F. Heini Orthopädie Sonnenhof, 3006 Bern Einleitung
 Der alte Rücken, krumm und eng - Degenerative Skoliose Prof. Dr. med. Paul F. Heini Orthopädie Sonnenhof, 3006 Bern Einleitung Eine Skoliose ist die Verkrümmung der Wirbelsäule zur Seite. Man assoziiert
Der alte Rücken, krumm und eng - Degenerative Skoliose Prof. Dr. med. Paul F. Heini Orthopädie Sonnenhof, 3006 Bern Einleitung Eine Skoliose ist die Verkrümmung der Wirbelsäule zur Seite. Man assoziiert
Qualitätssicherung bei Fallpauschalen und Sonderentgelten. Basisstatistik
 Qualitätssicherung bei Fallpauschalen und Sonderentgelten Basisstatistik ----------- Basisdaten ---------------------------------------------------------------------------- Angaben über Krankenhäuser und
Qualitätssicherung bei Fallpauschalen und Sonderentgelten Basisstatistik ----------- Basisdaten ---------------------------------------------------------------------------- Angaben über Krankenhäuser und
Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes
 Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes Bruch des körpernahen Oberarmes (proximale Humerusfraktur) Etwa 5% aller Knochenbrüche im Erwachsenenalter und 4% bei Kindern und Jugendlichen, betreffen den körpernahen
Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes Bruch des körpernahen Oberarmes (proximale Humerusfraktur) Etwa 5% aller Knochenbrüche im Erwachsenenalter und 4% bei Kindern und Jugendlichen, betreffen den körpernahen
