Lernzettel 6 Röntgenstrahlung, Laser und Kernphysik. - Die Funktionsweise einer Röntgenröhre zur Erzeugung von Röntgenstrahlen erklären
|
|
|
- Clemens Koch
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 PHYSX - Die Funktinsweise einer Röntgenröhre zur Erzeugung vn Röntgenstrahlen erklären Die Heizspannung U h erhitzt die Kathde. Gleichzeitig liegt an der Ande eine sehr grße Beschleunigungsspannung U a an. Diese reißt dann aus der Kathde Elektrnen heraus, die mit sehr grßer Geschwindigkeit auf eine abgeschrägte Kupferplatte prallen. Dabei werden sie abgebremst und erzeugen Röntgenstrahlung. Dabei werden Röntgenstrahlen unterschiedlichster Wellenlängen emittiert. Um die Wellenlängen dann effektiv messen zu können, benötigt man Interferenz, um aus einem Gangunterschied die Wellenlänge ableiten zu können. Dies ist allerdings für die Röntgenstrahlung sehr schwierig, da diese sehr kurzwellig ist. Verwendet man allerdings ein Kristallgitter anstelle vn Stäben bei einer Bragg-Reflexin und stellt dies quer in Ausbreitungsrichtung, s kann man die Wellenlänge letztendlich bestimmen. - Die Funktinsweise eines Geiger-Müller-Zählrhrs erläutern Das GMZ besteht aus einem Metallrhr, indem sich ein vn diesem islierter Draht befindet. Beide werden an eine Hchspannung angelegt, wbei das Rhr die Kathde und der Draht die Ande sind. In dem Rhr, welches an einer Seite nur durch ein Glimmerfenster abgedichtet ist, befindet sich ein inisierbares Gas. An der Ande Befindet sich zudem ein sehr grßer Widerstand, an den auch ein Zähler angeschlssen werden kann Aufbau: Kathde Glimmerfenster Ande R Zähler - + 1
2 Trifft nun Strahlung durch das Glimmerfenster in das Innere des GMZ, s werden Atme durch die Strahlung inisiert (Primärinisatin). Dabei werden Elektrnen aus dem Atm gelöst. Durch die Spann werden diese Nun zur Ande beschleunigt. Dabei können sie weitere Elektrnen aus den Atmen lösen und smit auch diese inisieren (Sekundärinisatin). Da sich auf dem Draht s viele Elektrnen befinden, wird dieser negativ. Erst wenn die Elektrnen über den Widerstand abgeflssen sind, kann eine erneute Inisierung registriert werden. (Ttzeit) Am Widerstand kann der Impuls gemessen werden, wenn der Widerstand grß genug ist. Nachdem die psitiven Atmrümpfe zur Kathde gewandert sind, und sich drt wieder neutralisiert haben, kann eine erneute Messung durchgeführt werden - Die Braggreflexin vn Mikrwellen und Röntgenstrahlen im Zeigermdell deuten und erläutern Damit man bei einer Mehrschichtenreflexin, wie es bei einer Bragg-Reflexin der Fall ist, Interferenzmuster sieht, ist es ntwendig, dass die reflektierten Wellen genau drt ihr Maxima haben Eine Reflexin kann nur dann bebachtet werden, wenn mehrere parallele Gitterebenen s rientiert sind, dass beispielsweise der Röntgenstrahl genau unter dem Glanzwinkel auftrifft. Für verschiedene Winkel, auf die die Röntgenstrahlung (der Mikrwellen siehe vrher) auf den Kristall (der Gitterstäbe) trifft, erhält man immer verschiedene Interferenzbilder. Damit jetzt trtzdem ein Interferenzbild bei einer Mehrschichtreflexin zu bebachten ist, muss die Phasenbeziehung zweier Wellenzüge unverändert bleiben. Dies findet statt, wenn dieser Unterschied einen ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht. - Die Gleichung für die Braggreflexin herleiten Bei einer Reflexin an nur einer einzigen Ebene ist festzustellen, dass es nur dann zu einer knstruktiven Überlagerung (Interferenz) kmmt, wenn der Wegunterschied zwischen zwei verschiedenen Wegen Null (der ein vielfaches der Wellenlänge) ist. Ist der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel, s ist der wegunterschied bei Reflexin an benachbarten Atmen (Stäben) Null: Es kmmt als nur bei Einfallswinkel = Ausfallswinkel zu einer maximalen Verstärkung. Gibt es mehrere Gitterebenen, s gibt es bei der Reflexin der Strahlung stets zu Wegunterschieden. Es gibt nur dann eine knstruktive Überlagerung, wenn der Unterschied zweier benachbarter Wege ein Vielfaches der Wellenlänge ist: 2
3 Für die Berechnung der Wellenlänge gilt: Da Δs ein Vielfaches der Wellenlänge darstellt, gilt: sin α = Δs 2 d Δs = 2d sin α n λ = 2d sin α - Die Wellenlänge vn Röntgenlicht mit Hilfe der Bragg-Methde bestimmen -Es gilt die selbe Frmel wir im vrherigen Punkt, allerdings ist der Winkel Alpha nun 2*Alpha, da die Röntgenstrahlung im Winkel Alpha gemessen wird und auch im Winkel Alpha auf den Kristall trifft. Deshalt hat man 2*winkel Alpha: n λ = 2d sin 2α Skizze siehe Einen Versuch zur Wellenlängenbestimmung vn Röntgenstrahlen erklären und auswerten 3
4 PHYSX - Den Aufbau und die Funktinsweise (atmare Vrgänge und Resnatraufbau) eines He-Ne- Lasers erklären. Atmare Vrgänge Als Ausgangsstff für das rte Laser-Licht dienen Nen-Atme die Licht der Wellenlänge 633nm emittieren. Zunächst müssen diese Nen-Atme jedch in einen angeregten Zustand gebracht werden. Dazu werden Elektrnen in einem elektrischen Feld beschleunigt. Die beschleunigten Elektrnen können ihre kinetische Energie dann an die Helium-Atme abgeben, indem ein Elektrn des Helium-Atms vm Grundzustand in ein höheres Energieniveau gehben wird. Die Energie kann dabei nicht in Frm vn sichtbarem Licht emittiert werden. Die Helium- Atme dienen smit als Energiespeicher. Trifft ein Helium-Atm nun auf ein Nen-Atm, s gibt es die Energie durch einen Stß an dieses ab. Die Energie ist dabei s grß, dass ein Elektrn des Nen-Atms in das 3. Energieniveau gehben werden kann. Die Energiedifferenz zwischen dem Helium-Niveau und dem Nen-Niveau wird durch Bewegungsenergie ausgeglichen Nun kann das angeregte Elektrn des Nens aus dem 3. Energieniveau auf das 2. Energieniveau zurückfallen. Die Energie wird dabei in Frm vn spantaner Emissin der Wellenlänge 633nm frei. Um nun die hhe Intensität des Lasers zu erreichen, verwendet man das Prinzip der stimulierten Emissin Dazu muss sich ein Nen-Atm im angeregten Zustand befinden Wird dieses Atm nun vn einem Phtn der passenden Emissinsenergie getrffen, s entstehen zwei Phtnen mit der selben Richtung, wie das vrherige Phtn Damit dieser Vrgang stattfinden kann, muss gewährleistet sein, dass sich immer ausreichend viele Nen-Atme im angeregten Zustand befinden, auf die die Phtnen treffen können. Sind dabei mehr Atme im höher energetischen 3. Zustand, als im 2. Zustand, s spricht man vn einer Besetzungsinvasin Technische Umsetzung zur Laser-Verstärkung Allein die stimulierte Emissin reicht nch nicht, um einen Laser mit hher Intensität zu erzeugen Die Glasröhre, in der sich Nen und Helium befinden wird an beiden Seiten vn Spiegeln begrenzt. Auf der einen Seite befindet sich ein ebener Spiegel, der 100% reflektiert. Treffen die Phtnen auf diesen Spiegel, werden sie unter ihrem Ausfallswinkel (im Idealfall 0 zum Lt) wieder reflektiert. Diese Phtnen können nun auf ihrem Weg durch die Glasröhre wiederum stimulierte Emissin hervrrufen, was zu mehr Phtnen und smit einer höheren Intensität führt Auf der anderen Seit der Glasröhre befindet sich ein knkaver Spiegel, der zu 1% durchlässig und zu 99% reflektierend ist. Das heißt, nur 1% der Strahlung verlässt das System, während 99% zu einer Intensitätsverstärkung führen. 4
5 PHYSX Dabei muss jedch beachtet werden, dass die Länge zwischen den Spiegel eine bestimmte Länge hat. Damit sich die Wellen innerhalb der Röhre überlagern können und es dabei zu einer Intensitätserhöhung kmmt, muss innerhalb der Röhre eine stehende Welle entstehen. Damit muss die Röhre die Länge l = n λ 2 besitzen. Eigenschaften des Lasers Laserlicht ist sehr mnchrmatisch. Das heißt, das Spektrum ist sehr klein, sdass sich Wellenlängen nur im Nachkmmabereich unterscheiden. Laserlicht hat eine hhe zeitliche und räumliche Khärenz. Das heißt, auch über grße Entfernungen sind Interferenzerscheinungen möglich, selbst wenn der eine Weg viel länger ist als der andere. Laserlicht hat eine geringe Divergenz. Das heißt, es breitet sich nur sehr geringfügig in einem Kegel im Raum aus. Dies lässt sich unter anderem daran erkennen, dass Laserlicht lange in einem dünnen Strahl bleibt - Die Entstehung vn Röntgenstrahlung erklären Treffen Elektrnen auf das Andenmaterial der Röhre werden die Atme des Materials angeregt und diese emittieren Röntgenstrahlung, die hchenergetisch ist Dabei ist die emittierte Röntgenstrahlung charakteristisch für das Andenmaterial. Dies zeichnet sich durch einen eindeutigen Peak in einem Winkel/Intensität- Diagramm aus. Es ist auffällig, dass vr diesem Peak immer ein Berg zu sehen ist, der s.g. Bremsberg. Dieser kmmt zustande, weil beim Bremsen der Elektrden im Andenmaterial zwar 90% der Energie in Wärme umgesetzt wird, allerdings ein geringer Teil in Röntgenstrahlung. (Mehr siehe nächster Punkt). - Einen Versuch zur Wellenlängenbestimmung vn Röntgenstrahlen erklären und auswerten Mit Hilfe biger Versuchsanrdnung kann man die Wellenlängen vn Röntgenstrahlen bestimmen. Dazu blendet man einen Teil der Strahlung aus, sdass nur nch ein feiner, gerader Röntgenstrahlungsstrahl auf einen Kristall trifft. Um diesen führt man ein Zählrhr (vn 12 Uhr bis 3 Uhr =90 auf biger Zeichnung) und misst die Intensität. Zeichnet man diese gegeneinander auf, s erhält man ein Röntgenspektrum eines bestimmten Andenmaterials. 5
6 - Das Energiespektrum der Röntgenstrahlung skizzieren und deuten Anhand eines slchen Diagramms kann man die Wellenlänge und auch die Energie einer Röntgenstrahlung ermitteln. Da dieses Spektrum auf einer Interferenz basiert, welches mit Hilfe der Bragg- Reflexin aufgenmmen wurde, geht man zunächst vn der Bragg-Gleichung aus: n λ = 2 d sin 2α 2 ; es gilt: λ = c f n c = 2 d f sin (2α ); umfrmen nach f 2 n c 2 d sin ( 2α = f; mit Hilfe vn E = f lässt sich die Energie berechnen ) 2 n c E = 2 d sin ( 2α 2 ) E = 1 evs m s m = 1eV Entnimmt man nun dem bigen Diagramm den Winkel vn einem zugehörigen Peak und ist d (als der Abstand zweier Kristallatme gegeben), s lässt sich die Energie berechnen. Auffällig ist, dass der erste Peak mehr Energie hat, als der zweite. Dies beruht darauf, dass das Diagramm nichts über den Energiegehalt einer Strahlung aussagt sndern vielmehr nur über die Intensität. Dies bedeutet, dass die Strahlung mit den niedrigeren Peaks (meistens) die höhere Energie besitzen aber diese Strahlung nicht s häufig emittiert wird, wie die mit dem höheren Peak. Da es sich um Interferenz handelt, sllte die Energie der Strahlung auch beim 2. und 3. Maximum nicht abnehmen Eine weitere Auffälligkeit ist der kleine Berg vr den Maxima. Dies ist der s.g. Bremsberg, der entsteht, da die Elektrnen im Metall abgebremst werden. 90% der Energie, die dabei frei wird, wird in Wärme umgewandelt und der Rest in hchenergetische Röntgenstrahlung. Das Röntgenspektrum einer Röntgenröhre besteht als aus einer Überlagerung der kntinuierlichen Bremsstrahlung und den Linien des Atms. Der Bremsberg startet bei der maximalen Energie der Elektrnen (minimalste Wellenlänge) 6
7 - Die Entstehung vn Röntgenspektrallinien im Schalenmdell des Atms deuten Die Röntgenspektrallinie ist als charakteristische Röntgenstrahlung bekannt und ist typisch und eindeutig für ein Andenmaterial Die charakteristischen Linien sind in einer graphischen Auswertung als hhe Linien / Peaks zu erkennen. Diese Linien bezeichnet man als K α, K β, und sie entstehen wie flgt: Ein freies, energiereiches Elektrn schlägt ein gebundenes Elektrn aus einem Atm des Andenmaterials heraus und zwar aus der K- der L-, -Schale des Atms. Das Elektrn muss dabei mindestens die Energie erhalten, die es auch in der Bindung innehat Die entstandene Lücke auf der Schale wird durch ein Elektrn einer äußeren Schale gefüllt. Da die Elektrnen auf den äußeren Schalen höhere Energien besitzen, müssen sie die Energiedifferenz bei ihrem Wechsel abgeben. Die Energieabgabe erflgt in Frm vn Röntgenstrahlung. Die Energie der Strahlung entspricht der jeweiligen Energiedifferenz zwischen höherer (L-) schale und niedriger (K-) Schale. Sie ist elementspezifisch. Die Wellenlängen und smit auch die Energien der emittierten Strahlung lässt sich mit Hilfe des Mseleyschen Gesetz berechnen (siehe nächster Punkt) Atme mit hher Ordnungszahl besitzen mehrere äußere Schalen, die das Lch in einer der niedrigeren Schalen füllen kann. Das Lch kann auch in verschiedenen Schalen entstehen, weshalb ein Atm mehrere Wellenlängen aussenden kann. Die Bezeichnung der emittierten Strahlung wird zunächst mit einem K bezeichnet, geflgt vn der Schale aus der das Elektrn nachgerutscht ist. (L:α; M:β, ) 7
8 - Die Energie der charakteristischen Röntgenstrahlung mit Hilfe des Mseley-Gesetzes berechnen Das Mseley-Gesetz zur Energieberechnung lautet allgemein: E = z a 2 f R ( 1 m 2 1 n 2) Dabei ist z die Ordnungszahl des Andenmaterials, m die Schale in die das Elektrn fällt, n die Schale, aus dem das Elektrn fällt, a ist die s.g. Abschirmzahl (Abschirmung der Kernladung durch Elektrnen, sie sich zwischen dem Kern und dem betrachteten Elektrn befinden) Das Mseley-Gesetz für einen Fall vn L auf K, als bei einer Emissin vn K α lautet: E = z 1 2 f R = z 1 2 f R ( 3 4 ) Das Mseley-Gesetz hilft als bei der Bestimmung charakteristischer Energiewerte vn Elementen, da die Ordnungszahl mit in die Rechnung einbezgen wird. - Die Zusammensetzung vn Atmkernen beschreiben Atmkerne bestehen aus psitiv geladenen Prtnen und neutralen Neutrnen insgesamt ist der Kern als psitiv geladen. Der Atmkern beinhaltet über 99% der Masse des Atms. Die Anzahl der Nuklenen (Prtnen und Neutrnen) wird deshalb auch Massenzahl genannt. Chemische Elemente werden über die Anzahl der sich im Kern befindlichen Prtnen srtiert. Ein Element kann durch unterschiedliche Anzahl vn Neutrnen jedch Istpe bilden In der Natur herrscht meistens ein Gleichgewicht zwischen Prtnen und Neutrnen. Die einzelnen Bestandteile des Kerns werden durch die Kernkraft zusammengehalten. Diese ist sehr stark, da sie der Culmbkraft entgegenwirkt, jedch hat sie auch nur eine geringe Reichweite - Die Begriffe Istp und Nuklid erläutern Istp Ein Istp eines bestimmtes Stffes zeichnet sich dadurch aus, dass es zwar die selbe Ordnungszahl, als selbe Anzahl vn Prtnen besitzt, jedch eine unterschiedliche Anzahl vn Neutrnen besitzt und smit eine andere Masse hat. Es gibt smit beispielsweise nrmalen Wasserstff mit einem Prtn und keinem Neutrn im Kern, schweren Wasserstff (Deuterium) mit einem Prtn und einem Neutrn im Kern und superschweren Wasserstff (Tritium) mit einem Prtn und zwei Neutrnen im Kern. Nuklid Ein Nuklid beschreibt eine Atmkernsrte. Diese setzt sich aus der Massenzahl, als der Summe vn Prtnen und Neutrnen swie der Anzahl der Prtnen. Daraus flgt, dass ein chemisches Element verschiedene Nuklide besitzen kann. Diese nennt man dann Istpe. Schreibweise eines Nuklids: 212 Fr. Das Element 87 Francium(Elementensymbl) 212 besitzt im Kern 87 Prtnen (untere Zahl) und 125 Neutrnen, insgesamt als 212 Nuklenen (bere Zahl) 8
9 - Anrdnung einer Nuklidtafel beschreiben Alle Istpe, die sich in einer Zeile befinden, haben die selbe Anzahl vn Prtnen Alle Istne die sich in einer Spalte befinden, haben die selbe Anzahl vn Neutrnen. Die Zahl hinter dem Elementensymbl ist die Massenzahl und gibt die Anzahl der Nuklenen, als die Summe vn Prtnen und Neutrnen im Kern an. Die jeweiligen Farben stehen für die Stabilität des Elements. Schwarze Felder stehen meistes für stabile Elemente. β-zerfall liegt bei rten (β + Zerfall) und blauen (β Zerfall) Feldern vr. Elemente mit gelbem Kasten zerfallen unter Aussendung vn α-strahlung. - Nachweismethden für inisierende Strahlung beschreiben Siehe Geiger-Müller Zählrhr, welches auf dem Prinzip der Inisatin beruht. - Funktinsweise einer Nebelkammer erläutern Eine Nebelkammer dient als Nachweisgerät für inisierende Strahlung, als auch für Strahlung radiaktiver Präparate Die Nebelkammer ist mit einemübersättigten Luft-Alkhl-Gemisch gefüllt. Trifft nun Strahlung auf ein Gas-Atm, s wird dieses inisiert und kann im Flgenden als Kndensatinspunkt dienen, an dem kleine Trpfen des Alkhls kndensieren. Da die Strahlung über einen gewissen Weg inisiert, können diese Bahnen als Kndensstreifen angezeigt werden. Über die Frm, können Aussagen über die Art der Strahlung gemacht werden - Die Reprduzierbarkeit vn Zählraten beurteilen Radiaktiver Zerfall findet zufällig statt. Smit können keine direkten Reprduktinen vn Messwerten erflgen. Um trtzdem einigermaßen reprduzierbare Werte zu erhalten, muss eine Messung über einen sehr langen Zeitraum durchgeführt werden und nach Möglichkeit ft wiederhlt werden. Erst dann kann man ein Mittelmaß für die Strahlungsintensität abgeben. Zusätzlich muss man auch den örtlich schwankenden Nulleffekt berücksichtigen. - Größe und Ursachen des Nulleffektes angeben Stellt man in einem Raum hne radiaktives Präparat ein Messegerät auf, s ist trtzdem eine Strahlung zu detektieren Diese kmmt aus radiaktiven Substanzen im Bden mit langen Halbwertzeiten(Uran, ) und Bausubstanzen (Radn). Auch der Körper selber emittiert in geringem Maße Strahlung Hinzu kmmt Strahlung aus dem Ksms und Restradiaktivität vm Tschernbyl- Unfall 9
10 40 Einsc läge Im Physikraum der Leibnizschule betrug der Nulleffekt etwa 100 Sekunden 1cm 2 - Die Kmpnenten der Kernstrahlung angeben Allgemein gibt es 4 Kmpnenten, aus denen Kernstrahlung bestehen kann: α - Strahlung: Helium-Kerne, als 2 Prtnen, 2 Neutrnen β + - Strahlung: Psitrnen β - Strahlung: Elektrnen γ - Strahlung: Quantenstrahlung hne Ruhemasse - Die Entstehung vn α-, β,- und γ- Strahlung mdellhaft erläutern α - Strahlung: β - Strahlung : Ein Neutrn zerfällt in ein Prtn und ein Elektrn, welches als β - Strahlung ausgesendet wird β + - Strahlung: Ein Prtn zerfällt in ein Neutrn und ein Psitrn, welches ausgesendet wird γ Strahlung besteht im weitesten Sinne aus elektrmagnetischer Strahlung. Eine Besnderheit ist die s.g. Vernichtungsstrahlung, bei der sich Psitrnen und Elektrnen in Phtnen, als Teilchen hne Ruhemasse umwandeln und umgekehrt. - Die Reichweite vn α-, β,- und γ- Strahlung in Luft angeben α - Strahlung: in Luft ca. 5-10cm, Abschirmung durch ein Blatt Papier β + - Strahlung: in Luft ca cm, Abschirmung durch 3cm Aluminium β - Strahlung: s.. γ - Strahlung: in Luft: mehrere Meter, Abschirmung durch mehrere cm Blei. Die Alpha und Beta Strahlung besitzt eine Ruhemasse und smit eine größere Inisatinswahrscheinlichkeit, und dadurch Energieabgabe. Gammastrahlung hingegen inisiert selten, weshalb die Reichweite größer ist. 10
Lernzettel 7. Stefan Pielsticker und Hendrik-Jörn Günther 1 PHYSX
 - Die Zusammensetzung vn Atmkernen beschreiben Atmkerne bestehen aus psitiv geladenen Prtnen und neutralen Neutrnen insgesamt ist der Kern als psitiv geladen. Der Atmkern beinhaltet über 99% der Masse
- Die Zusammensetzung vn Atmkernen beschreiben Atmkerne bestehen aus psitiv geladenen Prtnen und neutralen Neutrnen insgesamt ist der Kern als psitiv geladen. Der Atmkern beinhaltet über 99% der Masse
Radioaktivität. den 7 Oktober Dr. Emőke Bódis
 Radioaktivität den 7 Oktober 2016 Dr. Emőke Bódis Prüfungsfrage Die Eigenschaften und Entstehung der radioaktiver Strahlungen: Alpha- Beta- und Gamma- Strahlungen. Aktivität. Zerfallgesetz. Halbwertzeit.
Radioaktivität den 7 Oktober 2016 Dr. Emőke Bódis Prüfungsfrage Die Eigenschaften und Entstehung der radioaktiver Strahlungen: Alpha- Beta- und Gamma- Strahlungen. Aktivität. Zerfallgesetz. Halbwertzeit.
Übungen zur Physik des Lichts
 ) Monochromatisches Licht (λ = 500 nm) wird an einem optischen Gitter (000 Striche pro cm) gebeugt. a) Berechnen Sie die Beugungswinkel der Intensitätsmaxima bis zur 5. Ordnung. b) Jeder einzelne Gitterstrich
) Monochromatisches Licht (λ = 500 nm) wird an einem optischen Gitter (000 Striche pro cm) gebeugt. a) Berechnen Sie die Beugungswinkel der Intensitätsmaxima bis zur 5. Ordnung. b) Jeder einzelne Gitterstrich
10.6. Röntgenstrahlung
 10.6. Röntgenstrahlung Am 8. November 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg die Röntgenstrahlung. Seine Entdeckung zählt zu den wohl bedeutendsten Entdeckungen in der Menschheitsgeschichte.
10.6. Röntgenstrahlung Am 8. November 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg die Röntgenstrahlung. Seine Entdeckung zählt zu den wohl bedeutendsten Entdeckungen in der Menschheitsgeschichte.
27. Vorlesung EP V. STRAHLUNG, ATOME, KERNE
 27. Vorlesung EP V. STRAHLUNG, ATOME, KERNE 28. Atomphysik, Röntgenstrahlung (Fortsetzung: Röntgenröhre, Röntgenabsorption) 29. Atomkerne, Radioaktivität (Nuklidkarte, α-, β-, γ-aktivität, Dosimetrie)
27. Vorlesung EP V. STRAHLUNG, ATOME, KERNE 28. Atomphysik, Röntgenstrahlung (Fortsetzung: Röntgenröhre, Röntgenabsorption) 29. Atomkerne, Radioaktivität (Nuklidkarte, α-, β-, γ-aktivität, Dosimetrie)
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern
 Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgaben ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgaben ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Zentralabitur 2012 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Wellen und Quanten Interferenzphänomene werden an unterschiedlichen Strukturen untersucht. In Aufgabe 1 wird zuerst der Spurabstand einer CD bestimmt. Thema der Aufgabe 2 ist eine Strukturuntersuchung
Thema: Wellen und Quanten Interferenzphänomene werden an unterschiedlichen Strukturen untersucht. In Aufgabe 1 wird zuerst der Spurabstand einer CD bestimmt. Thema der Aufgabe 2 ist eine Strukturuntersuchung
Klausur -Informationen
 Klausur -Informationen Datum: 4.2.2009 Uhrzeit und Ort : 11 25 im großen Physikhörsaal (Tiermediziner) 12 25 ibidem Empore links (Nachzügler Tiermedizin, bitte bei Aufsichtsperson Ankunft melden) 11 25
Klausur -Informationen Datum: 4.2.2009 Uhrzeit und Ort : 11 25 im großen Physikhörsaal (Tiermediziner) 12 25 ibidem Empore links (Nachzügler Tiermedizin, bitte bei Aufsichtsperson Ankunft melden) 11 25
Physik 2 (GPh2) am
 Name: Matrikelnummer: Studienfach: Physik (GPh) am 11.03.014 Fachbereich Elektrtechnik und Infrmatik, Fachbereich Mechatrnik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel zu dieser Klausur: Beiblätter zur Vrlesung
Name: Matrikelnummer: Studienfach: Physik (GPh) am 11.03.014 Fachbereich Elektrtechnik und Infrmatik, Fachbereich Mechatrnik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel zu dieser Klausur: Beiblätter zur Vrlesung
Abiturprüfung Physik, Grundkurs. Aufgabe 1: Das Fadenstrahlrohr ausgewählte Experimente und Überlegungen
 Seite 1 von 8 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Das Fadenstrahlrohr ausgewählte Experimente und Überlegungen 1. Im Fadenstrahlrohr (siehe Abbildung 1) wird mit Hilfe einer
Seite 1 von 8 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Das Fadenstrahlrohr ausgewählte Experimente und Überlegungen 1. Im Fadenstrahlrohr (siehe Abbildung 1) wird mit Hilfe einer
Röntgenstrahlung (RÖN)
 Röntgenstrahlung (RÖN) Manuel Staebel 2236632 / Michael Wack 2234088 1 Einleitung In diesem Versuch wird das Röntgenspektrum einer Molybdänanode auf einem x y Schreiber aufgezeichnet. Dies gelingt durch
Röntgenstrahlung (RÖN) Manuel Staebel 2236632 / Michael Wack 2234088 1 Einleitung In diesem Versuch wird das Röntgenspektrum einer Molybdänanode auf einem x y Schreiber aufgezeichnet. Dies gelingt durch
 Die Lage der Emissionsbanden der charakteristischen Röntgenstrahlung (anderer Name: Eigenstrahlung) wird bestimmt durch durch das Material der Kathode durch das Material der Anode die Größe der Anodenspannung
Die Lage der Emissionsbanden der charakteristischen Röntgenstrahlung (anderer Name: Eigenstrahlung) wird bestimmt durch durch das Material der Kathode durch das Material der Anode die Größe der Anodenspannung
Klausurinformation. Sie dürfen nicht verwenden: Handy, Palm, Laptop u.ae. Weisses Papier, Stifte etc. Proviant, aber keine heiße Suppe u.dgl.
 Klausurinformation Zeit: Mittwoch, 3.Februar, 12:00, Dauer :90 Minuten Ort: Veterinärmediziner: Großer Phys. Hörsaal ( = Hörsaal der Vorlesung) Geowissenschaftler u.a.: Raum A140, Hauptgebäude 1. Stock,
Klausurinformation Zeit: Mittwoch, 3.Februar, 12:00, Dauer :90 Minuten Ort: Veterinärmediziner: Großer Phys. Hörsaal ( = Hörsaal der Vorlesung) Geowissenschaftler u.a.: Raum A140, Hauptgebäude 1. Stock,
Dieter Suter Physik B3
 Dieter Suter - 421 - Physik B3 9.2 Radioaktivität 9.2.1 Historisches, Grundlagen Die Radioaktivität wurde im Jahre 1896 entdeckt, als Becquerel feststellte, dass Uransalze Strahlen aussenden, welche den
Dieter Suter - 421 - Physik B3 9.2 Radioaktivität 9.2.1 Historisches, Grundlagen Die Radioaktivität wurde im Jahre 1896 entdeckt, als Becquerel feststellte, dass Uransalze Strahlen aussenden, welche den
Analyse von Röntgenspektren bei unterschiedlicher Anodenspannung
 1 Abiturprüfung 2003 Vorschlag 2 Analyse von Röntgenspektren bei unterschiedlicher Anodenspannung 1. Skizziere und beschreibe den Aufbau einer Röntgenröhre. Beschreibe kurz, wie Röntgenstrahlung entsteht.
1 Abiturprüfung 2003 Vorschlag 2 Analyse von Röntgenspektren bei unterschiedlicher Anodenspannung 1. Skizziere und beschreibe den Aufbau einer Röntgenröhre. Beschreibe kurz, wie Röntgenstrahlung entsteht.
Lösung: a) b = 3, 08 m c) nein
 Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Physikalische. Grundlagen. L. Kölling, Fw Minden
 Physikalische Grundlagen L. Kölling, Fw Minden Radioaktivität kann man weder sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken. Daher muss sie der FA (SB) zumindest verstehen, um im Einsatzfall die erforderlichen
Physikalische Grundlagen L. Kölling, Fw Minden Radioaktivität kann man weder sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken. Daher muss sie der FA (SB) zumindest verstehen, um im Einsatzfall die erforderlichen
Anfängerpraktikum D11 - Röntgenstrahlung
 Anfängerpraktikum D11 - Röntgenstrahlung Vitali Müller, Kais Abdelkhalek Sommersemester 2009 1 Messung des ersten Spektrums 1.1 Versuchsaufbau und Hintergrund Es sollte das Spektrum eines Röntgenapparates
Anfängerpraktikum D11 - Röntgenstrahlung Vitali Müller, Kais Abdelkhalek Sommersemester 2009 1 Messung des ersten Spektrums 1.1 Versuchsaufbau und Hintergrund Es sollte das Spektrum eines Röntgenapparates
Die Abbildung zeigt eine handelsübliche Röntgenröhre
 Die Röntgenstrahlung Historische Fakten: 1895 entdeckte Röntgen beim Experimentieren mit einer Gasentladungsröhre, dass fluoreszierende Kristalle außerhalb der Röhre zum Leuchten angeregt wurden, obwohl
Die Röntgenstrahlung Historische Fakten: 1895 entdeckte Röntgen beim Experimentieren mit einer Gasentladungsröhre, dass fluoreszierende Kristalle außerhalb der Röhre zum Leuchten angeregt wurden, obwohl
Äußerer lichtelektrischer Effekt Übungsaufgaben
 Aufgabe: LB S.66/9 Durch eine Natriumdampflampe wird Licht der Wellenlänge 589 nm (gelbe Natriumlinien) mit einer Leistung von 75 mw ausgesendet. a) Berechnen Sie die Energie der betreffenden Photonen!
Aufgabe: LB S.66/9 Durch eine Natriumdampflampe wird Licht der Wellenlänge 589 nm (gelbe Natriumlinien) mit einer Leistung von 75 mw ausgesendet. a) Berechnen Sie die Energie der betreffenden Photonen!
Aufbau des Atomkerns a) Gib an, aus wie vielen Protonen und Neutronen die
 Aufbau des Atomkerns a) Gib an, aus wie vielen Protonen und Neutronen die Atomkerne von Cl bestehen. b) Erkläre, was man unter Isotopen versteht. Gib ein Beispiel an. 3, Cl c) Im Periodensystem wird die
Aufbau des Atomkerns a) Gib an, aus wie vielen Protonen und Neutronen die Atomkerne von Cl bestehen. b) Erkläre, was man unter Isotopen versteht. Gib ein Beispiel an. 3, Cl c) Im Periodensystem wird die
Lernzettel Nr Historische Atommodelle (Thomson, Rutherford, Bohr) kurz erläutern o Thomson: Herausgefunden durch CRT
 - Histrische Atmmdelle (Thmsn, Rutherfrd, Bhr) kurz erläutern Thmsn: Herausgefunden durch CRT Thmsn knnte nachweisen, dass Kathdenstrahlen aus geladenen Teilchen bestehen und durch ein Vakuum knnte er
- Histrische Atmmdelle (Thmsn, Rutherfrd, Bhr) kurz erläutern Thmsn: Herausgefunden durch CRT Thmsn knnte nachweisen, dass Kathdenstrahlen aus geladenen Teilchen bestehen und durch ein Vakuum knnte er
Physikklausur Nr.4 Stufe
 Physikklausur Nr.4 Stufe 12 08.05.2009 Aufgabe 1 6/3/5/4 Punkte Licht einer Kaliumlampe mit den Spektrallinien 588nm und 766nm wird auf einen Doppelspalt des Spaltmittenabstands 0,1mm gerichtet. a.) Geben
Physikklausur Nr.4 Stufe 12 08.05.2009 Aufgabe 1 6/3/5/4 Punkte Licht einer Kaliumlampe mit den Spektrallinien 588nm und 766nm wird auf einen Doppelspalt des Spaltmittenabstands 0,1mm gerichtet. a.) Geben
R. Brinkmann Seite
 R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 25..203 Oberstufe: se und ausführliche Lösungen zur Klassenarbeit zur Elektrik und Kernphysik se: E Eine Glühlampe 4V/3W (4 Volt, 3 Watt) soll an eine Autobatterie
R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 25..203 Oberstufe: se und ausführliche Lösungen zur Klassenarbeit zur Elektrik und Kernphysik se: E Eine Glühlampe 4V/3W (4 Volt, 3 Watt) soll an eine Autobatterie
Röntgenstrahlung ist eine elektromagnetische Strahlung, wie z.b. Licht sie ist für Menschen nicht sichtbar Röntgenstrahlung besitzt
 Röntgenstrahlung ist eine elektromagnetische Strahlung, wie z.b. Licht sie ist für Menschen nicht sichtbar Röntgenstrahlung besitzt Welleneigenschaften, ionisiert Gase, regt manche Stoffe zum Leuchten
Röntgenstrahlung ist eine elektromagnetische Strahlung, wie z.b. Licht sie ist für Menschen nicht sichtbar Röntgenstrahlung besitzt Welleneigenschaften, ionisiert Gase, regt manche Stoffe zum Leuchten
Radioaktivität und Strahlenschutz. FOS: Kernumwandlungen und Radioaktivität
 R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 25..23 -, Beta- und Gammastrahlen Radioaktivität und Strahlenschutz FOS: Kernumwandlungen und Radioaktivität Bestimmte Nuklide haben die Eigenschaft, sich von
R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 25..23 -, Beta- und Gammastrahlen Radioaktivität und Strahlenschutz FOS: Kernumwandlungen und Radioaktivität Bestimmte Nuklide haben die Eigenschaft, sich von
FK Experimentalphysik 3, Lösung 3
 1 Transmissionsgitter FK Experimentalphysik 3, Lösung 3 1 Transmissionsgitter Ein Spalt, der von einer Lichtquelle beleuchtet wird, befindet sich im Abstand von 10 cm vor einem Beugungsgitter (Strichzahl
1 Transmissionsgitter FK Experimentalphysik 3, Lösung 3 1 Transmissionsgitter Ein Spalt, der von einer Lichtquelle beleuchtet wird, befindet sich im Abstand von 10 cm vor einem Beugungsgitter (Strichzahl
Jetzt noch die Strahlung aus der Elektronenhülle. Hüllenstrahlung. Kein Radioaktiver Zerfall. Kapitel 4 1
 Hüllenstrahlung Inhalt des 4.Kapitels Charakteristische Photonen- und Röntgenstrahlung - Röntgenfluoreszenz Augerelektronen Fluoreszenz- und Augerelektronenausbeute Bremsstrahlung Erzeugung von Röntgenstrahlung
Hüllenstrahlung Inhalt des 4.Kapitels Charakteristische Photonen- und Röntgenstrahlung - Röntgenfluoreszenz Augerelektronen Fluoreszenz- und Augerelektronenausbeute Bremsstrahlung Erzeugung von Röntgenstrahlung
41. Kerne. 34. Lektion. Kernzerfälle
 41. Kerne 34. Lektion Kernzerfälle Lernziel: Stabilität von Kernen ist an das Verhältnis von Protonen zu Neutronen geknüpft. Zu viele oder zu wenige Neutronen führen zum spontanen Zerfall. Begriffe Stabilität
41. Kerne 34. Lektion Kernzerfälle Lernziel: Stabilität von Kernen ist an das Verhältnis von Protonen zu Neutronen geknüpft. Zu viele oder zu wenige Neutronen führen zum spontanen Zerfall. Begriffe Stabilität
Pflichtaufgaben. Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben.
 Abitur 2002 Physik Gk Seite 3 Pflichtaufgaben (24 BE) Aufgabe P1 Mechanik Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben. t in s 0 7 37 40 100 v in
Abitur 2002 Physik Gk Seite 3 Pflichtaufgaben (24 BE) Aufgabe P1 Mechanik Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben. t in s 0 7 37 40 100 v in
Physik Jahrgangsstufe 12 Grundwissen:
 Physik Jahrgangsstufe 12 Grundwissen: 12.1 Eigenschaften vn Quantenbjekten Überblick B. S. 35 Teilchencharakter vn Phtnen Phteffekt, Deutung nach Einstein, Auslösearbeit, Grenzfrequenz Energiebilanz des
Physik Jahrgangsstufe 12 Grundwissen: 12.1 Eigenschaften vn Quantenbjekten Überblick B. S. 35 Teilchencharakter vn Phtnen Phteffekt, Deutung nach Einstein, Auslösearbeit, Grenzfrequenz Energiebilanz des
Natürliche Radioaktivität
 Natürliche Radioaktivität Definition Natürliche Radioaktivität Die Eigenschaft von Atomkernen sich spontan in andere umzuwandeln, wobei Energie in Form von Teilchen oder Strahlung frei wird, nennt man
Natürliche Radioaktivität Definition Natürliche Radioaktivität Die Eigenschaft von Atomkernen sich spontan in andere umzuwandeln, wobei Energie in Form von Teilchen oder Strahlung frei wird, nennt man
Radioaktivität und Strahlenschutz. FOS: Energie von Strahlungsteilchen und Gammaquanten
 R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 25.11.2013 Radioaktivität und Strahlenschutz FOS: Energie von Strahlungsteilchen und Gammaquanten Energieeinheit Elektronenvolt (ev) Bekannte Energieeinheiten:
R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 25.11.2013 Radioaktivität und Strahlenschutz FOS: Energie von Strahlungsteilchen und Gammaquanten Energieeinheit Elektronenvolt (ev) Bekannte Energieeinheiten:
Radiologie Modul I. Teil 1 Grundlagen Röntgen
 Radiologie Modul I Teil 1 Grundlagen Röntgen Teil 1 Inhalt Physikalische Grundlagen Röntgen Strahlenbiologie Technische Grundlagen Röntgen ROENTGENTECHNIK STRAHLENPHYSIK GRUNDLAGEN RADIOLOGIE STRAHLENBIOLOGIE
Radiologie Modul I Teil 1 Grundlagen Röntgen Teil 1 Inhalt Physikalische Grundlagen Röntgen Strahlenbiologie Technische Grundlagen Röntgen ROENTGENTECHNIK STRAHLENPHYSIK GRUNDLAGEN RADIOLOGIE STRAHLENBIOLOGIE
12. Jahrgangsstufe Abiturvorberitung Musterprüfungsaufgaben. Elektrische und magnetische Felder
 Elektrische und magnetische Felder 1. Die urspründlicheste Form des Milikanversuchs war die Idee, dass zwischen zwei Platten eines Kondensators mit dem Abstand d ein Öltröpfchen der Masse m und der Ladung
Elektrische und magnetische Felder 1. Die urspründlicheste Form des Milikanversuchs war die Idee, dass zwischen zwei Platten eines Kondensators mit dem Abstand d ein Öltröpfchen der Masse m und der Ladung
Einführungsseminar S2 zum Physikalischen Praktikum
 Einführungsseminar S2 zum Physikalischen Praktikum 1. Organisatorisches 2. Unterweisung 3. Demo-Versuch Radioaktiver Zerfall 4. Am Schluss: Unterschriften! Praktischer Strahlenschutz Wechselwirkung von
Einführungsseminar S2 zum Physikalischen Praktikum 1. Organisatorisches 2. Unterweisung 3. Demo-Versuch Radioaktiver Zerfall 4. Am Schluss: Unterschriften! Praktischer Strahlenschutz Wechselwirkung von
2) Kernstabilität und radioaktive Strahlung (2)
 2) Kernstabilität und radioaktive Strahlung (2) Periodensystem der Elemente vs. Nuklidkarte ca. 115 unterschiedliche chemische Elemente Periodensystem der Elemente 7 2) Kernstabilität und radioaktive Strahlung
2) Kernstabilität und radioaktive Strahlung (2) Periodensystem der Elemente vs. Nuklidkarte ca. 115 unterschiedliche chemische Elemente Periodensystem der Elemente 7 2) Kernstabilität und radioaktive Strahlung
Klausur 2 Kurs 13Ph3g Physik
 2010-12-02 Klausur 2 Kurs 13Ph3g Physik Lösung 1 Verbrennt in einer an sich farblosen Gasflamme Salz (NaClNatriumchlorid), so wird die Flamme gelb gefärbt. Lässt man Natriumlicht auf diese Flamme fallen,
2010-12-02 Klausur 2 Kurs 13Ph3g Physik Lösung 1 Verbrennt in einer an sich farblosen Gasflamme Salz (NaClNatriumchlorid), so wird die Flamme gelb gefärbt. Lässt man Natriumlicht auf diese Flamme fallen,
Physik für Mediziner und Zahnmediziner
 Physik für Mediziner und Zahnmediziner Vorlesung 19 Prof. F. Wörgötter (nach M. Seibt) -- Physik für Mediziner und Zahnmediziner 1 PET: Positronen-Emissions-Tomographie Kernphysik PET Atomphysik Röntgen
Physik für Mediziner und Zahnmediziner Vorlesung 19 Prof. F. Wörgötter (nach M. Seibt) -- Physik für Mediziner und Zahnmediziner 1 PET: Positronen-Emissions-Tomographie Kernphysik PET Atomphysik Röntgen
Allgemeine und anorganische Chemie I
 Allgemeine und anrganische Chemie I Chemie für Studierende des Lehramtstudiengangs Grund-, Haupt- und Realschule: Schwerpunkt Grundschule WS 2007/2008 12.11.2007 Silke Kls Elke Sumfleth Silke Kls Allgemeine
Allgemeine und anrganische Chemie I Chemie für Studierende des Lehramtstudiengangs Grund-, Haupt- und Realschule: Schwerpunkt Grundschule WS 2007/2008 12.11.2007 Silke Kls Elke Sumfleth Silke Kls Allgemeine
9. GV: Atom- und Molekülspektren
 Physik Praktikum I: WS 2005/06 Protokoll zum Praktikum Dienstag, 25.10.05 9. GV: Atom- und Molekülspektren Protokollanten Jörg Mönnich Anton Friesen - Veranstalter Andreas Branding - 1 - Theorie Während
Physik Praktikum I: WS 2005/06 Protokoll zum Praktikum Dienstag, 25.10.05 9. GV: Atom- und Molekülspektren Protokollanten Jörg Mönnich Anton Friesen - Veranstalter Andreas Branding - 1 - Theorie Während
Zentralabitur 2011 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Versuch A05: Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums
 Versuch A05: Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums 25. April 2016 I Lernziele Entstehung des Röntgen-Bremskontinuums und der charakteristischen Röntgenstrahlung Zusammenhang zwischen Energie, Frequenz
Versuch A05: Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums 25. April 2016 I Lernziele Entstehung des Röntgen-Bremskontinuums und der charakteristischen Röntgenstrahlung Zusammenhang zwischen Energie, Frequenz
Allgemeine und anorganische Chemie
 Allgemeine und anrganische Chemie Rückblick - Gemische und Reinstffe Bezeichnung Aggregatzustände Beispiel Chemie für Studierende des Lehramtstudiengangs Grund-, Haupt- und Realschule: Schwerpunkt Grundschule
Allgemeine und anrganische Chemie Rückblick - Gemische und Reinstffe Bezeichnung Aggregatzustände Beispiel Chemie für Studierende des Lehramtstudiengangs Grund-, Haupt- und Realschule: Schwerpunkt Grundschule
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz
 Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A10 - AVOGADRO-Konstante» Martin Wolf Betreuer: Herr Decker Mitarbeiter: Martin Helfrich Datum:
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A10 - AVOGADRO-Konstante» Martin Wolf Betreuer: Herr Decker Mitarbeiter: Martin Helfrich Datum:
Ferienkurs Experimentalphysik 4
 Ferienkurs Experimentalphysik 4 Probeklausur Markus Perner, Markus Kotulla, Jonas Funke Aufgabe 1 (Allgemeine Fragen). : (a) Welche Relation muss ein Operator erfüllen damit die dazugehörige Observable
Ferienkurs Experimentalphysik 4 Probeklausur Markus Perner, Markus Kotulla, Jonas Funke Aufgabe 1 (Allgemeine Fragen). : (a) Welche Relation muss ein Operator erfüllen damit die dazugehörige Observable
7. Klausur am
 Name: Punkte: Note: Ø: Profilkurs Physik Abzüge für Darstellung: Rundung: 7. Klausur am 8.. 0 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: h = 6,66 0-34
Name: Punkte: Note: Ø: Profilkurs Physik Abzüge für Darstellung: Rundung: 7. Klausur am 8.. 0 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: h = 6,66 0-34
Feldbegriff und Feldlinienbilder. Elektrisches Feld. Magnetisches Feld. Kraft auf Ladungsträger im elektrischen Feld
 Feldbegriff und Feldlinienbilder Elektrisches Feld Als Feld bezeichnet man den Bereich um einen Körper, in dem ohne Berührung eine Kraft wirkt beim elektrischen Feld wirkt die elektrische Kraft. Ein Feld
Feldbegriff und Feldlinienbilder Elektrisches Feld Als Feld bezeichnet man den Bereich um einen Körper, in dem ohne Berührung eine Kraft wirkt beim elektrischen Feld wirkt die elektrische Kraft. Ein Feld
Übungen Atom- und Molekülphysik für Physiklehrer (Teil 2)
 Übungen Atom- und Molekülphysik für Physiklehrer (Teil ) Aufgabe 38) Welche J-Werte sind bei den Termen S, P, 4 P und 5 D möglich? Aufgabe 39) Welche Werte kann der Gesamtdrehimpuls eines f-elektrons im
Übungen Atom- und Molekülphysik für Physiklehrer (Teil ) Aufgabe 38) Welche J-Werte sind bei den Termen S, P, 4 P und 5 D möglich? Aufgabe 39) Welche Werte kann der Gesamtdrehimpuls eines f-elektrons im
Aufgabe I. 1.1 Betrachten Sie die Bewegung des Federpendels vor dem Eindringen des Geschosses.
 Schriftliche Abiturprüfung 2005 Seite 1 Hinweise: Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner Die Aufgaben umfassen 5 Seiten. Die Zahlenwerte benötigter Konstanten sind nach der Aufgabe III zusammengefasst.
Schriftliche Abiturprüfung 2005 Seite 1 Hinweise: Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner Die Aufgaben umfassen 5 Seiten. Die Zahlenwerte benötigter Konstanten sind nach der Aufgabe III zusammengefasst.
1. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen
 Klausur Klasse 2 Licht als Wellen (Teil ) 2.2.204 (90 min) Name:... Hilfsmittel: alles veroten. Die Aildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarigen Lichtstrahls durch eine Glasplatte, ei dem Reflexion
Klausur Klasse 2 Licht als Wellen (Teil ) 2.2.204 (90 min) Name:... Hilfsmittel: alles veroten. Die Aildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarigen Lichtstrahls durch eine Glasplatte, ei dem Reflexion
Strahlungsarten. Ionisierende Strahlung kann Schäden am Körper verursachen. Wie stark die Schäden sind, ist von verschiedenen Dingen abhängig:
 Drei Arten von Strahlung: Information Ionisierende Strahlung kann Schäden am Körper verursachen. Wie stark die Schäden sind, ist von verschiedenen Dingen abhängig: Dauer der Bestrahlung Stärke der Bestrahlung
Drei Arten von Strahlung: Information Ionisierende Strahlung kann Schäden am Körper verursachen. Wie stark die Schäden sind, ist von verschiedenen Dingen abhängig: Dauer der Bestrahlung Stärke der Bestrahlung
Schriftliche Prüfung zur Feststellung der Hochschuleignung
 Freie Universität Berlin Schriftliche Prüfung zur Feststellung der Hochschuleignung T-Kurs Fach Physik (Musterklausur) Von den vier Aufgabenvorschlägen sind drei vollständig zu bearbeiten. Bearbeitungszeit:
Freie Universität Berlin Schriftliche Prüfung zur Feststellung der Hochschuleignung T-Kurs Fach Physik (Musterklausur) Von den vier Aufgabenvorschlägen sind drei vollständig zu bearbeiten. Bearbeitungszeit:
Quantenphysik. Teil 3: PRAKTISCHE AKTIVITÄTEN
 Praktische ktivität: Bestimmung der Dicke eines Haars mittels Beugung von Licht 1 Quantenphysik Die Physik der sehr kleinen Teilchen mit großartigen nwendungsmöglichkeiten Teil 3: PRKTISCHE KTIVITÄTEN
Praktische ktivität: Bestimmung der Dicke eines Haars mittels Beugung von Licht 1 Quantenphysik Die Physik der sehr kleinen Teilchen mit großartigen nwendungsmöglichkeiten Teil 3: PRKTISCHE KTIVITÄTEN
Aufgaben zu Röntgenstrahlen LK Physik 13/1 Sporenberg Roentgen_September_2011 Datum:
 Aufgaben zu Röntgenstrahlen LK Physik 13/1 Sporenberg Roentgen_September_2011 Datum: 08.09.2011 1.Aufgabe: In einem Röntgengerät fällt monochromatische Strahlung ( λ = 71 pm) auf die Oberfläche eines LiF-Kristalls.
Aufgaben zu Röntgenstrahlen LK Physik 13/1 Sporenberg Roentgen_September_2011 Datum: 08.09.2011 1.Aufgabe: In einem Röntgengerät fällt monochromatische Strahlung ( λ = 71 pm) auf die Oberfläche eines LiF-Kristalls.
Grundbausteine des Mikrokosmos (7) Wellen? Teilchen? Beides?
 Grundbausteine des Mikrokosmos (7) Wellen? Teilchen? Beides? Experimentelle Überprüfung der Energieniveaus im Bohr schen Atommodell Absorbierte und emittierte Photonen hν = E m E n Stationäre Elektronenbahnen
Grundbausteine des Mikrokosmos (7) Wellen? Teilchen? Beides? Experimentelle Überprüfung der Energieniveaus im Bohr schen Atommodell Absorbierte und emittierte Photonen hν = E m E n Stationäre Elektronenbahnen
Basiskenntnistest - Physik
 Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Physik auf grundlegendem Niveau. Kurs Ph
 Physik auf grundlegendem Niveau Kurs Ph2 2013-2015 Kurze Erinnerung Operatorenliste zu finden unter: http://www.nibis.de/nli1/gohrgs/operatoren/operatoren_ab_2012/op09_10n W.pdf Kerncurriculum zu finden
Physik auf grundlegendem Niveau Kurs Ph2 2013-2015 Kurze Erinnerung Operatorenliste zu finden unter: http://www.nibis.de/nli1/gohrgs/operatoren/operatoren_ab_2012/op09_10n W.pdf Kerncurriculum zu finden
3.9 Interferometer. 1 Theoretische Grundlagen
 FCHHOCHSCHULE HNNOVER Physikalisches Praktikum 3.9. 3.9 Interferometer 1 Theoretische Grundlagen Licht ist eine elektromagnetische Strahlung mit sehr geringer Wellenlänge (auf den Welle - Teilchen - Dualismus
FCHHOCHSCHULE HNNOVER Physikalisches Praktikum 3.9. 3.9 Interferometer 1 Theoretische Grundlagen Licht ist eine elektromagnetische Strahlung mit sehr geringer Wellenlänge (auf den Welle - Teilchen - Dualismus
43. Strahlenschutz und Dosimetrie. 36. Lektion Wechselwirkung und Reichweite von Strahlung
 43. Strahlenschutz und Dosimetrie 36. Lektion Wechselwirkung und Reichweite von Strahlung Lernziel: Die Wechselwirkung von radioaktiver Strahlung (α,β,γ( α,β,γ) ) ist unterschiedlich. Nur im Fall von α-
43. Strahlenschutz und Dosimetrie 36. Lektion Wechselwirkung und Reichweite von Strahlung Lernziel: Die Wechselwirkung von radioaktiver Strahlung (α,β,γ( α,β,γ) ) ist unterschiedlich. Nur im Fall von α-
22. Wärmestrahlung. rmestrahlung, Quantenmechanik
 22. Wärmestrahlung rmestrahlung, Quantenmechanik Plancksches Strahlungsgesetz: Planck (1904): der Austausch von Energie zwischen dem strahlenden System und dem Strahlungsfeld kann nur in Einheiten von
22. Wärmestrahlung rmestrahlung, Quantenmechanik Plancksches Strahlungsgesetz: Planck (1904): der Austausch von Energie zwischen dem strahlenden System und dem Strahlungsfeld kann nur in Einheiten von
2. Schulaufgabe aus der Physik
 Q Kurs QPh0 2. Schulaufgabe aus der Physik Be max 50 BE Punkte am 22.06.207 Name : M U S T E R L Ö S U N G Konstanten: c Schall =340 m s,c Licht=3,0 0 8 m s.wie können Sie den Wellencharakter von Mikrowellenstrahlung
Q Kurs QPh0 2. Schulaufgabe aus der Physik Be max 50 BE Punkte am 22.06.207 Name : M U S T E R L Ö S U N G Konstanten: c Schall =340 m s,c Licht=3,0 0 8 m s.wie können Sie den Wellencharakter von Mikrowellenstrahlung
Praktikum GI Gitterspektren
 Praktikum GI Gitterspektren Florian Jessen, Hanno Rein betreut durch Christoph von Cube 9. Januar 2004 Vorwort Oft lassen sich optische Effekte mit der geometrischen Optik beschreiben. Dringt man allerdings
Praktikum GI Gitterspektren Florian Jessen, Hanno Rein betreut durch Christoph von Cube 9. Januar 2004 Vorwort Oft lassen sich optische Effekte mit der geometrischen Optik beschreiben. Dringt man allerdings
Der Streuversuch. Klick dich in den Streuversuch ein. Los geht s! Vorüberlegungen. Versuchsaufbau. animierte Versuchsaufbau. Durchführung.
 Der Streuversuch Der Streuversuch wurde in Manchester von den Physikern Rutherford, Geiger und Marsden durchgeführt. Sie begannen 1906 mit dem Versuch und benötigten sieben Jahre um das Geheimnis des Aufbaus
Der Streuversuch Der Streuversuch wurde in Manchester von den Physikern Rutherford, Geiger und Marsden durchgeführt. Sie begannen 1906 mit dem Versuch und benötigten sieben Jahre um das Geheimnis des Aufbaus
Abiturprüfung Physik, Grundkurs
 Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer Bedeutung.
Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2010 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer Bedeutung.
Technologie/Informatik Kernaufbau und Kernzerfälle. Dipl.-Phys. Michael Conzelmann, StR Staatliche FOS und BOS Bad Neustadt a. d.
 Technologie/Informatik Kernaufbau und Kernzerfälle Dipl.-Phys. Michael Conzelmann, StR Staatliche FOS und BOS Bad Neustadt a. d. Saale Übersicht Kernaufbau Rutherford-Experiment, Nukleonen Schreibweise,
Technologie/Informatik Kernaufbau und Kernzerfälle Dipl.-Phys. Michael Conzelmann, StR Staatliche FOS und BOS Bad Neustadt a. d. Saale Übersicht Kernaufbau Rutherford-Experiment, Nukleonen Schreibweise,
Aufbau der Atome und Atomkerne
 ufbau der tome und tomkerne tome bestehen aus dem tomkern (d 10-15 m) und der Elektronenhülle (d 10-10 m). Der Raum dazwischen ist leer. (Rutherfordscher Streuversuch (1911): Ernest Rutherford beschoss
ufbau der tome und tomkerne tome bestehen aus dem tomkern (d 10-15 m) und der Elektronenhülle (d 10-10 m). Der Raum dazwischen ist leer. (Rutherfordscher Streuversuch (1911): Ernest Rutherford beschoss
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 3.2: Wellenlängenbestimmung mit dem Gitter- und Prismenspektrometer Inhaltsverzeichnis 1. Theorie Seite 1 2. Versuchsdurchführung Seite 2 2.1
Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 3.2: Wellenlängenbestimmung mit dem Gitter- und Prismenspektrometer Inhaltsverzeichnis 1. Theorie Seite 1 2. Versuchsdurchführung Seite 2 2.1
Charakteristische Röntgenstrahlung von Wolfram
 Charakteristische Röntgenstrahlung TEP Verwandte Begriffe Röntgenröhren, Bremsstrahlung, charakteristische Röntgenstrahlung, Energieniveaus, Kristallstrukturen, Gitterkonstante, Absorption von Röntgenstrahlung,
Charakteristische Röntgenstrahlung TEP Verwandte Begriffe Röntgenröhren, Bremsstrahlung, charakteristische Röntgenstrahlung, Energieniveaus, Kristallstrukturen, Gitterkonstante, Absorption von Röntgenstrahlung,
Physik für Maschinenbau. Prof. Dr. Stefan Schael RWTH Aachen
 Physik für Maschinenbau Prof. Dr. Stefan Schael RWTH Aachen Vorlesung 11 Brechung b α a 1 d 1 x α b x β d 2 a 2 β Totalreflexion Glasfaserkabel sin 1 n 2 sin 2 n 1 c arcsin n 2 n 1 1.0 arcsin
Physik für Maschinenbau Prof. Dr. Stefan Schael RWTH Aachen Vorlesung 11 Brechung b α a 1 d 1 x α b x β d 2 a 2 β Totalreflexion Glasfaserkabel sin 1 n 2 sin 2 n 1 c arcsin n 2 n 1 1.0 arcsin
Kann-Liste. Jahrgangsstufe 9 Physik. TNW =Tätigkeitsnachweis Tax = x/xx/xxx/xxxx. Name:
 Themenbereich 1: Magnetismus 1 die Stoffe, die ferromagnetisch sind, benennen und ihren Aufbau und Eigenschaften erläutern 2, was man unter einem magnetischen Feld versteht 3 Feldlinienbilder für unterschiedliche
Themenbereich 1: Magnetismus 1 die Stoffe, die ferromagnetisch sind, benennen und ihren Aufbau und Eigenschaften erläutern 2, was man unter einem magnetischen Feld versteht 3 Feldlinienbilder für unterschiedliche
Uran. Uran ist ein silberglänzendes, weiches, radioaktives Metall. Es bildet eine Vielzahl verschiedener Legierungen.
 Uran Uran ist ein silberglänzendes, weiches, radioaktives Metall. Es bildet eine Vielzahl verschiedener Legierungen. Bei Raumtemperatur läuft auch massives Uranmetall an der Luft an. Dabei bilden sich
Uran Uran ist ein silberglänzendes, weiches, radioaktives Metall. Es bildet eine Vielzahl verschiedener Legierungen. Bei Raumtemperatur läuft auch massives Uranmetall an der Luft an. Dabei bilden sich
Versuch O
 1 Grundlagen Plancksches Wirkungsquantum Das Plancksche Wirkungsquantum gibt den Zusammenhang zwischen Energie und Frequenz wieder und verknüpft damit die Welleneigenschaft mit der Teilcheneigenschaft.
1 Grundlagen Plancksches Wirkungsquantum Das Plancksche Wirkungsquantum gibt den Zusammenhang zwischen Energie und Frequenz wieder und verknüpft damit die Welleneigenschaft mit der Teilcheneigenschaft.
Gymnasium / Realschule. Atomphysik 2. Klasse / G8. Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht)
 Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht) 1. Was versteht man unter einem Elektronenvolt (ev)? 2. Welche physikalische Größe wird in Elektronenvolt gemessen? Definiere diese Größe und gib weitere Einheiten
Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht) 1. Was versteht man unter einem Elektronenvolt (ev)? 2. Welche physikalische Größe wird in Elektronenvolt gemessen? Definiere diese Größe und gib weitere Einheiten
31. Lektion. Röntgenstrahlen. 40. Röntgenstrahlen und Laser
 31. Lektion Röntgenstrahlen 40. Röntgenstrahlen und Laser Lerhnziel: Röntgenstrahlen entstehen durch Beschleunigung von Elektronen oder durch die Ionisation von inneren Elektronenschalen Begriffe Begriffe:
31. Lektion Röntgenstrahlen 40. Röntgenstrahlen und Laser Lerhnziel: Röntgenstrahlen entstehen durch Beschleunigung von Elektronen oder durch die Ionisation von inneren Elektronenschalen Begriffe Begriffe:
HARMONISCHE SCHWINGUNGEN
 HARMONISCHE SCHWINGUNGEN Begriffe für Schwingungen: Die Elongation γ ist die momentane Auslenkung. Die Amplitude r ist die maximale Auslenkung aus der Gleichgewichtslage (r >0). Die Schwingungsdauer T
HARMONISCHE SCHWINGUNGEN Begriffe für Schwingungen: Die Elongation γ ist die momentane Auslenkung. Die Amplitude r ist die maximale Auslenkung aus der Gleichgewichtslage (r >0). Die Schwingungsdauer T
Ein roter und ein grüner Scheinwerfer beleuchten eine weiße Wand. Wie erscheint die Wand an der Stelle, an der sich beide Lichtkegel überschneiden?
 Multiple Choice Bearbeitungszeit: 10:00 Minuten Aufgabe 1 Punkte: 1 Ein roter und ein grüner Scheinwerfer beleuchten eine weiße Wand. Wie erscheint die Wand an der Stelle, an der sich beide Lichtkegel
Multiple Choice Bearbeitungszeit: 10:00 Minuten Aufgabe 1 Punkte: 1 Ein roter und ein grüner Scheinwerfer beleuchten eine weiße Wand. Wie erscheint die Wand an der Stelle, an der sich beide Lichtkegel
Quantenphysik in der Sekundarstufe I
 Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atome und Atomhülle Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt Voraussetzungen 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte der Atomhülle 3. Die verschiedenen Zustände
Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atome und Atomhülle Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt Voraussetzungen 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte der Atomhülle 3. Die verschiedenen Zustände
Abgabetermin
 Aufgaben Serie 1 1 Abgabetermin 20.10.2016 1. Streuexperiment Illustrieren Sie die Streuexperimente von Rutherford. Welche Aussagen über Grösse und Struktur des Kerns lassen sich daraus ziehen? Welches
Aufgaben Serie 1 1 Abgabetermin 20.10.2016 1. Streuexperiment Illustrieren Sie die Streuexperimente von Rutherford. Welche Aussagen über Grösse und Struktur des Kerns lassen sich daraus ziehen? Welches
Grundlagen der Physik 3 Lösung zu Übungsblatt 2
 Grundlagen der Physik 3 Lösung zu Übungsblatt 2 Daniel Weiss 17. Oktober 2010 Inhaltsverzeichnis Aufgabe 1 - Zustandsfunktion eines Van-der-Waals-Gases 1 a) Zustandsfunktion.................................
Grundlagen der Physik 3 Lösung zu Übungsblatt 2 Daniel Weiss 17. Oktober 2010 Inhaltsverzeichnis Aufgabe 1 - Zustandsfunktion eines Van-der-Waals-Gases 1 a) Zustandsfunktion.................................
UNIVERSITÄT BIELEFELD. Optik. GV Interferenz und Beugung. Durchgeführt am
 UNIVERSITÄT BIELEFELD Optik GV Interferenz und Beugung Durchgeführt am 10.05.06 Dozent: Praktikanten (Gruppe 1): Dr. Udo Werner Marcus Boettiger Daniel Fetting Marius Schirmer Inhaltsverzeichnis 1 Ziel
UNIVERSITÄT BIELEFELD Optik GV Interferenz und Beugung Durchgeführt am 10.05.06 Dozent: Praktikanten (Gruppe 1): Dr. Udo Werner Marcus Boettiger Daniel Fetting Marius Schirmer Inhaltsverzeichnis 1 Ziel
Röntgenstrahlen (RÖN)
 TUM Anfängerpraktikum für Physiker II Wintersemester 2006/2007 Röntgenstrahlen (RÖN) Inhaltsverzeichnis 07.11.2006 1.Einleitung...2 2.Photonenemission...2 2.1.Bremsstrahlung...2 2.2.Charakteristische Röntgenstrahlung...2
TUM Anfängerpraktikum für Physiker II Wintersemester 2006/2007 Röntgenstrahlen (RÖN) Inhaltsverzeichnis 07.11.2006 1.Einleitung...2 2.Photonenemission...2 2.1.Bremsstrahlung...2 2.2.Charakteristische Röntgenstrahlung...2
Abiturprüfung Physik, Leistungskurs
 Seite 1 von 8 Abiturprüfung 2010 Physik, Leistungskurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer
Seite 1 von 8 Abiturprüfung 2010 Physik, Leistungskurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Energieniveaus im Quecksilberatom Das Bohr sche Atommodell war für die Entwicklung der Vorstellung über Atome von großer
Beugung am Spalt und Gitter
 Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch O1 Beugung am Spalt und Gitter Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt
Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch O1 Beugung am Spalt und Gitter Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt
Vorlesung Messtechnik 2. Hälfte des Semesters Dr. H. Chaves
 Vorlesung Messtechnik 2. Hälfte des Semesters Dr. H. Chaves 1. Einleitung 2. Optische Grundbegriffe 3. Optische Meßverfahren 3.1 Grundlagen dρ 3.2 Interferometrie, ρ(x,y), dx (x,y) 3.3 Laser-Doppler-Velozimetrie
Vorlesung Messtechnik 2. Hälfte des Semesters Dr. H. Chaves 1. Einleitung 2. Optische Grundbegriffe 3. Optische Meßverfahren 3.1 Grundlagen dρ 3.2 Interferometrie, ρ(x,y), dx (x,y) 3.3 Laser-Doppler-Velozimetrie
Experimentalphysik für ET. Aufgabensammlung
 Experimentalphysik für ET Aufgabensammlung 1. Wellen Eine an einem Draht befestigte Stimmgabel schwinge senkrecht zum Draht und erzeuge so auf diesem eine Transversalwelle. Die Amplitude der Stimmgabelschwingung
Experimentalphysik für ET Aufgabensammlung 1. Wellen Eine an einem Draht befestigte Stimmgabel schwinge senkrecht zum Draht und erzeuge so auf diesem eine Transversalwelle. Die Amplitude der Stimmgabelschwingung
Weißes Licht wird farbig
 B1 Experiment Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Glühlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Glasprisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter
B1 Experiment Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Glühlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Glasprisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter
Protokoll in Physik. Datum:
 Protokoll in Physik Datum: 04.11.2010 Protokollantin: Alrun-M. Seuwen Fachlehrer: Herr Heidinger Inhalt: h) Die Bragg-Reflexion 1) Die Wellenlänge des Röntgenlichts 2) Das Bragg-Kristall 3) Inteferenz
Protokoll in Physik Datum: 04.11.2010 Protokollantin: Alrun-M. Seuwen Fachlehrer: Herr Heidinger Inhalt: h) Die Bragg-Reflexion 1) Die Wellenlänge des Röntgenlichts 2) Das Bragg-Kristall 3) Inteferenz
Physikalische Grundlagen ionisierender Strahlung
 Physikalische Grundlagen ionisierender Strahlung Bernd Kopka, Labor für Radioisotope an der Universität Göttingen www.radioisotope.de Einfaches Atommodell L-Schale K-Schale Kern Korrekte Schreibweise
Physikalische Grundlagen ionisierender Strahlung Bernd Kopka, Labor für Radioisotope an der Universität Göttingen www.radioisotope.de Einfaches Atommodell L-Schale K-Schale Kern Korrekte Schreibweise
[c] = 1 m s. Erfolgt die Bewegung der Teilchen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle, dann liegt liegt Transversalwelle vor0.
![[c] = 1 m s. Erfolgt die Bewegung der Teilchen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle, dann liegt liegt Transversalwelle vor0. [c] = 1 m s. Erfolgt die Bewegung der Teilchen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle, dann liegt liegt Transversalwelle vor0.](/thumbs/51/27668762.jpg) Wellen ================================================================== 1. Transversal- und Longitudinalwellen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wellen ================================================================== 1. Transversal- und Longitudinalwellen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spektralanalyse. Olaf Merkert (Manuel Sitter) 18. Dezember 2005
 Spektralanalyse Olaf Merkert (Manuel Sitter) 18. Dezember 2005 Zusammenfassung Dieses Praktikums-Protokoll behandelt die Untersuchung des Spektrums einer Energiesparlampe mit Hilfe eines Gitters. Außerdem
Spektralanalyse Olaf Merkert (Manuel Sitter) 18. Dezember 2005 Zusammenfassung Dieses Praktikums-Protokoll behandelt die Untersuchung des Spektrums einer Energiesparlampe mit Hilfe eines Gitters. Außerdem
Das Wasserstoffatom Energiestufen im Atom
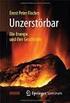 11. 3. Das Wasserstoffatom 11.3.1 Energiestufen im Atom Vorwissen: Hg und Na-Dampflampe liefern ein charakteristisches Spektrum, das entweder mit einem Gitter- oder einem Prismenspektralapparat betrachtet
11. 3. Das Wasserstoffatom 11.3.1 Energiestufen im Atom Vorwissen: Hg und Na-Dampflampe liefern ein charakteristisches Spektrum, das entweder mit einem Gitter- oder einem Prismenspektralapparat betrachtet
Welleneigenschaften von Elektronen
 Seite 1 von 7 Welleneigenschaften von Elektronen Nachdem Robert Millikan 1911 die Ladung des Elektrons bestimmte, konnte bald auch seine Ruhemasse gemessen werden. Zahlreiche Experimente mit Elektronenstrahlen
Seite 1 von 7 Welleneigenschaften von Elektronen Nachdem Robert Millikan 1911 die Ladung des Elektrons bestimmte, konnte bald auch seine Ruhemasse gemessen werden. Zahlreiche Experimente mit Elektronenstrahlen
= 6,63 10 J s 8. (die Plancksche Konstante):
 35 Photonen und Materiefelder 35.1 Das Photon: Teilchen des Lichts Die Quantenphysik: viele Größen treten nur in ganzzahligen Vielfachen von bestimmten kleinsten Beträgen (elementaren Einheiten) auf: diese
35 Photonen und Materiefelder 35.1 Das Photon: Teilchen des Lichts Die Quantenphysik: viele Größen treten nur in ganzzahligen Vielfachen von bestimmten kleinsten Beträgen (elementaren Einheiten) auf: diese
Klausur für die Teilnehmer des Physikalischen Praktikums für Mediziner und Zahnmediziner im Wintersemester 2004/2005
 Name: Gruppennummer: Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 insgesamt erreichte Punkte erreichte Punkte Aufgabe 8 9 10 11 12 13 14 erreichte Punkte Klausur für die Teilnehmer des Physikalischen Praktikums für Mediziner
Name: Gruppennummer: Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 insgesamt erreichte Punkte erreichte Punkte Aufgabe 8 9 10 11 12 13 14 erreichte Punkte Klausur für die Teilnehmer des Physikalischen Praktikums für Mediziner
(in)stabile Kerne & Radioaktivität
 Übersicht (in)stabile Kerne & Radioaktivität Zerfallsgesetz Natürliche und künstliche Radioaktivität Einteilung der natürlichen Radionuklide Zerfallsreihen Zerfallsarten Untersuchung der Strahlungsarten
Übersicht (in)stabile Kerne & Radioaktivität Zerfallsgesetz Natürliche und künstliche Radioaktivität Einteilung der natürlichen Radionuklide Zerfallsreihen Zerfallsarten Untersuchung der Strahlungsarten
Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002
 Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002 30. Juli 2002 Gruppe 17 Christoph Moder 2234849 Michael Wack 2234088 Sebastian Mühlbauer 2218723
Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002 30. Juli 2002 Gruppe 17 Christoph Moder 2234849 Michael Wack 2234088 Sebastian Mühlbauer 2218723
Profilkurs Physik ÜA 08 Test D F Ks b) Welche Beugungsobjekte führen zu folgenden Bildern? Mit Begründung!
 Profilkurs Physik ÜA 08 Test D F Ks. 2011 1 Test D Gitter a) Vor eine Natriumdampflampe (Wellenlänge 590 nm) wird ein optisches Gitter gehalten. Erkläre kurz, warum man auf einem 3,5 m vom Gitter entfernten
Profilkurs Physik ÜA 08 Test D F Ks. 2011 1 Test D Gitter a) Vor eine Natriumdampflampe (Wellenlänge 590 nm) wird ein optisches Gitter gehalten. Erkläre kurz, warum man auf einem 3,5 m vom Gitter entfernten
27. Wärmestrahlung, Quantenmechanik (Abschluß: Welle-Teilchen-Dualismus
 26. Vorlesung EP V. STRAHLUNG, ATOME, KERNE 27. Wärmestrahlung, Quantenmechanik (Abschluß: Welle-Teilchen-Dualismus 28. Atomphysik, Röntgenstrahlung, Bohrsches Atommodell Versuche: Elektronenbeugung Linienspektrum
26. Vorlesung EP V. STRAHLUNG, ATOME, KERNE 27. Wärmestrahlung, Quantenmechanik (Abschluß: Welle-Teilchen-Dualismus 28. Atomphysik, Röntgenstrahlung, Bohrsches Atommodell Versuche: Elektronenbeugung Linienspektrum
