In der jetzt geöffneten PDF-Datei finden Sie. eine Übersicht über den Inhalt von Bd. 2/2 und. Musterseiten von Übungsblättern.
|
|
|
- Manfred Steinmann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 In der jetzt geöffneten PDF-Datei finden Sie eine Übersicht über den Inhalt von Bd. 2/2 und Musterseiten von Übungsblättern. Blättern Sie in der Datei mit den Pfeiltasten des Ziffernblocks oder den Pfeilen in der Navigationsleiste. Vergrößern und verkleinern Sie die Seiten mit den Seitensymbolen in der Navigationsleiste.
2 Inhaltsübersicht Elementartraining Phonemstufe 2 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining. Fortsetzung des Trainings der erweiterten phonemischen Strategie Seite 3-12 im beiliegenden Heft Handanweisungen, Phonemstufe 2, Teil I-III Seite im beiliegenden Heft Teil 1: Teil II: Teil III: Integration der schwierigen Dauerkonsonanten h z j ch in das Wortmaterial der Phonemstufe 1 Wort-, Bild- und Textmaterial: Wortlisten, Übungsblätter, Lernspiele, Lese- und Schreibtexte und Hausaufgaben Blatt I-1 bis Blatt I-98 Integration der weichen Stoppkonsonanten d b g in das Wortmaterial der Phonemstufe 1 und der Phonemstufe 2, Teil I Wort-, Bild- und Textmaterial: Wortlisten, Übungsblätter, Lernspiele, Lese- und Schreibtexte und Hausaufgaben Blatt II-1 bis Blatt II-102 Integration der harten Stoppkonsonanten t p k (ck) in das Wortmaterial der Phonemstufe 1 und der Phonemstufe 2, Teil II Wort-, Bild- und Textmaterial: Wortlisten, Übungsblätter, Lernspiele, Lese- und Schreibtexte und Hausaufgaben Blatt III-1 bis Blatt III-138 Lauttreuer Bildertest der Phonemstufe 2 (LBT 2) Blatt III-139 bis Blatt III-144
3 Inhaltsverzeichnis Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining Fortsetzung des Trainings der erweiterten phonemischen Strategie 4 Teil I umfasst die Integration der schwierigen Dauerkonsonanten h, z, j, ch... 6 Teil II umfasst die Integration der weichen Stoppkonsonanten d, b, g... 6 Teil III umfasst die Integration der harten Stoppkonsonanten t, p, k... 7 Bedeutung des Einsatzes der integrierten senso-motorisch orientierten Methoden: Lautgebärden und Rhytmisches Syllabieren... 7 Lautgebärdeneinsatz... 8 Rhythmisches Syllabieren... 9 Erfolgskontrollen nach Abschluss der Phonemstufe Evaluation Literatur zu Band 2/ Handanweisungen, Phonemstufe 2 Teil I-III Training der Mitsprechstrategie in der Phonemstufe Punkte-Urkunde Stundenaufbau Alphabetische Wortlisten Erklärungen zur Lautbildung und den Lautgebärden Lautgebärdenhaus 2 / Lautgetreues Buchstabenhaus Lautgebärdenkarten mit Buchstaben, Lautgebärdenkarten ohne Buchstaben Schnippelbögen Bilder als Tanz-/Schreibkarten Spiel- und Trainingsideen mit Tanz-/Schreibkarten Tanzen auf dem Brett mit Wortkarten Wortlisten Bilddiktate Lese- und Schreibsätze / Sätze / Satzsequenzen Lese- und Schreibtexte Differenzierungsübungen Lesen und Verstehen Vokaltraining als Strukturhilfe für das Silbenbögenlesen Einführung des Kreuzbogens beim ch Lernplakat zum ck (Dopplung des k-lautes) Rätseldiktate Hausaufgaben LBT 2 Erfolgskontrolle zum Elementartraining... 31
4 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining Fortsetzung des Trainings der erweiterten phonemischen Strategie Um die Entwicklung der lautorientiert/phonemischen Strategie bei von Legasthenie Betroffenen zu unterstützen bzw. in schweren Fällen mit drohendem Analphabetismus gänzlich aufzubauen, hat das Elementartraining der Phonemstufe 1 (REUTER-LIEHR 2006, Band 2/1) eine entscheidende Hilfe geleistet. Nach Abschluss des Trainings dieser Phonemstufe wird bereits mittels einer ganzen Reihe von Wörtern die erweiterte phonemische Strategie korrigiert durch erste strukturelle Regelmäßigkeiten wie beispielsweise häufi ge Wortendungen umgesetzt (s. Tabelle 1 fett gedruckt). 1. Vorstufen des Schreibens Kritzelschrift / willkürliche Buchstabenfolgen / Wörter werden an bestimmten Merkmalen erkannt 2. lautorientiert/phonemische Strategie Orientierung an den Lauten und ihren wesentlichen Unterschieden Erkennen von strukturellen Regelmäßigkeiten Grundlage: Silbensegmentierung beginnende phonemische Strategie MS statt Maus entfaltete phonemische Strategie but statt bunt voll entfaltete phonemische Strategie lesn statt lesen erweiterte phonemische Strategie korrigiert durch strukturelle Regelmäßigkeiten a) Einbeziehen der pilotsprachlichen Sprechweise lesen/schaufel/mutter b) Phase der Übergeneralisierung der pilotsprachlichen Sofer statt Sofa Sprechweise bei Abweichungen von Regelhaftigkeiten 3. orthographisch/morphemische Strategie Erweitertes Erkennen und Anwenden von orthographischen Strukturen Grundlage: Morphemsegmentierung Anfangs- und Endmorpheme Ableitung des doppelten Konsonanten Auslautverhärtung, Auslautverlängerung weitere Ableitungen im Hauptmorphem Dehnung des Vokals erweitertes Lernen von Speicherwörtern, die Abweichungen vom Regelhaften enthalten ab-, miss-, ver-, vor- / -ung, -ling, -ig ll, mm, ss etc. g/d/b z ß h ie / ä/äu ah/eh/oh/uh aa/ee/oo v, i, chs etc. Tabelle 1: Entwicklungsstufen beim Schriftspracherwerb Grundlage des sprachsystematischen Aufbaus in der Legasthenietherapie Das Elementartraining der Phonemstufe 1 umfasst das Erlernen aller lautgetreuen bzw. mitsprechbaren Vokale (a / e / i / o / u), Diphthonge (au / ei / eu) und Umlaute (ö / ü). Silben und Wörter werden ausschließlich mit Dauerkonsonanten (m / l / s / n / f / r / w / sch) gebildet. Mit diesem kleinschrittigen Training hat das legasthene Kind sowie der Analphabet ein gutes Fundament zum Erfassen einfacher Wortstrukturen welche zunächst nur offene Silben enthalten (Beispiele: Na-se, Sa-la-mi, Me-lo-ne) und komplexere welche geschlossene Silben integrieren (Beispiele: lau-fen, Men-schen, Amsel) erlangt. Es gibt keine Konsonantenhäufung innerhalb einer Silbe. Die Laut/Buchstabenzuordnung dieser Phonemstufe 4
5 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining muss gesichert sein, die Synthese und die Unterscheidung offene/geschlossene Silbe beim Lesen in diesem vom Buchstabenmaterial noch überschaubaren Rahmen sollten gelingen, bevor der Prozess der Festigung und des Ausbaus der erweiterten phonemischen Strategie fortgesetzt wird. Jetzt gilt es, in das bisherige System, welches bereits den überwiegenden Anteil struktureller Regelmäßigkeiten der deutschen Orthographie beinhaltet, die restlichen Konsonanten einzubeziehen. Weitere Dauerkonsonanten (h / z / j / ch) sowie die Stoppkonsonanten (d / b / g t / p / k), welche nach unserer Defi nition je nach Position innerhalb des Wortes ebenfalls als mitsprechbar und insofern als lautgetreu gelten, werden nacheinander integriert. Dieses schrittweise Vorgehen ermöglicht es, die schwierigeren bzw. selteneren Laut/Buchstabenverbindungen intensiv zu behandeln. Das individuelle Lerntempo wird berücksichtigt. Dabei kann die Wahrnehmungsdifferenzierung dieser Laute bzw. Buchstaben vielfältig geschärft werden. Die erlernten Lesegesetze 1-5 (REUTER-LIEHR 2008, Bd. 1 sowie 2006 Bd. 2/1) zum Erkennen bisheriger Wortstrukturen werden zudem weiterhin gefestigt und ermöglichen eine Vertiefung durch neues, stetig wachsendes Wortmaterial. Bereits an dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass in diesem Band ausgewähltes Wortmaterial sowohl für Lese- und Schreibanfänger, als auch für schwer betroffene ältere Schüler und auch für jugendliche bzw. erwachsene Analphabeten geeignet ist. Der Einsatz richtet sich dabei nicht nach Alter oder Klassenstufe, sondern nach dem förderdiagnostisch ermittelten Stand der Lernentwicklung beim Schriftspracherwerb. Die passende Auswahl des jeweiligen Trainingsmaterials orientiert sich dann am sprachlichen Entwicklungsniveau des Betroffenen. Ein ausschließlicher Umgang mit dem auf den alltäglichen Sprachgebrauch begrenzten Wortmaterial ist jedoch nicht ausreichend hilfreich. Dem Kind, aber auch dem Erwachsenen sollten weniger gebräuchliche Begriffe nicht vorenthalten werden. Meist wird jedoch dem häufi g vertretenen Verständnis gefolgt, diese Wörter würden der Alltagssprache der Betroffenen nicht entsprechen und insofern sowieso nicht benutzt. Für uns ist es gerade in diesen Fällen wichtig, auch mit bisher unbekannten, wenig gebräuchlichen Wörtern umzugehen und ein erweitertes Wortverständnis aufzubauen. Diese Erweiterung des Wortschatzes erhöht die Lesesicherheit und das Leseverständnis auch unbekannter Texte, was letztlich das Ziel der Behandlung sein sollte. Eine Reduzierung auf den alltäglichen Sprachgebrauch ist insofern keine langfristige Hilfe, sondern eine Einengung der schulischen bzw. berufl ichen Möglichkeiten und somit der persönlichen Entwicklung. Mit dem sich erweiternden Wortmaterial lassen sich zunehmend Texte formulieren. Einige Texte sind inhaltlich ähnlich, dies ist durchaus Absicht. Bei Lese- und Schreibanfängern, aber auch in analphabetischen Fällen ist zu beobachten, dass es dem Lernenden eine emotionale Sicherheit verleiht, etwas Bekanntes zu lesen, einen Großteil der Wörter sicher erfassen zu können, sich daran zu erfreuen und neue Wörter mit neuen Buchstaben Stück für Stück hinzuzunehmen. Die Tatsache, dass der Text immer länger und komplexer wird, erhöht das Selbstvertrauen und führt zu Kognitionen wie: Das war schon schwerer als vorher, und ich habe es auch geschafft. Beachtenswert ist, dass der gesamte Bereich des Elementartrainings bereits ca. 72% der lautgetreuen Wörter der deutschen Orthographie umfasst (REUTER-LIEHR 2008, Bd. 1, S. 85). Ein intensives Training der Phonemstufen 1 und 2 also keinen Zeitverlust im gesamten Lernprozess bedeuten muss. Der Aufbau der Phonemstufe 2 ist im Elementartraining in drei größere Lernabschnitte eingeteilt. 5
6 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining Teil I umfasst die Integration der schwierigen Dauerkonsonanten h, z, j, ch. Das h ist ein schwer wahrzunehmender Konsonant und geht umgangssprachlich leicht verloren (Unrue statt Unruhe). Er muss dementsprechend verstärkt mit deutlicher Artikulation als gehauchter Ansatz des folgenden Vokals pilotsprachlich hervorgeholt werden. Das z ist leicht verwechselbar mit dem scharfen bzw. stimmlosen s. Das stimmhafte j ist selten und hat aufgrund der gleichen Artikulationsstelle eine hohe Ähnlichkeit mit ch 1. Das ch wird je nach Verbindung mit einem vorangegangenen Vokal hell ch 1 wie in ich, euch, Verwechslungsgefahr beim Schreiben mit sch oder dunkel ch 2 wie in ach, och, Bach, Verwechslungsgefahr mit r ausgesprochen. Der Vorteil dieser Laut/ Buchstabenverbindungen ist, dass sie den Aufbau der Mitsprechstrategie nicht behindern, da sie beim synchronen Sprechschreiben weiterhin anhaltend mitsprechend das Schreiben begleiten können. Wichtig zu berücksichtigen ist, dass die Buchstaben h und z nur zu Beginn des Wortes bzw. einer Silbe mitsprechbar sind. Geraten diese Buchstaben ans Ende der Silbe oder in den Auslautbereich (Reh, er geht) können sie akustisch oder sprechmotorisch nicht mehr erfasst werden bzw. ist eine Differenzierung zum stimmlosen s (Salz, ganz, glanzlos, er hetzt) nicht oder nur sehr erschwert (Herz, Geiz) möglich. Die Rückführung dieser Wörter in ihre abgeleitete Form würde dann zur sicheren Unterscheidung verhelfen. Dabei werden die kritischen Buchstaben im Auslautbereich des Wortes durch Verlängern an den Silbenanfang gesetzt, so dass die Buchstaben wiederum mitsprechbar sind. Die Integration des Ableitens in das bisher gelernte System erfolgt jedoch erst in der Lernphase des Trainings der morphemisch/orthographischen Strategie (s. Tabelle 1), wenn die Mitsprechstellen in Wörtern eindeutig gesichert und automatisiert sind. Teil II umfasst die Integration der weichen Stoppkonsonanten d, b, g. Stoppkonsonanten sind wie der Name schon verrät nicht dauerhaft mitsprechbar. Das differenzierte Mitsprechen dieser Laute wird am ehesten in der Synthese mit einem nachfolgenden Vokal deutlich. Die weichen bzw. stimmhaften Stoppkonsonanten d/b/g, welche nur mit geringem Luftstrom gesprochen werden, gelingen in der Differenzierung leichter als die harten bzw. stimmlosen Stoppkonsonanten. Dies konnte in vielen Behandlungen ausgeprägter legasthener Störungen immer wieder beobachtet werden, insofern werden die weichen Stoppkonsonanten im Training als erstes gesichert, damit später auch Gegenüberstellungen der Stoppkonsonantenpaare (d/t b/p g/k) unter Vermeidung des Phänomens der Interferenz besser gelingen können. Wiederum ist für den Anwender zu berücksichtigen, dass die weichen Stoppkonsonanten d/b/g nur zu Beginn einer Silbe vorkommen dürfen, da sie am Ende einer Silbe bzw. im Auslautbereich auf Grund der Auslautverhärtung akustisch sowie sprechmotorisch nicht unterscheidbar sind von den harten Stoppkonsonanten t/p/k (Hund, Erlebnis, singt). Auch hier wäre die Mitsprechbarkeit erst wieder hergestellt, wenn die Wörter durch Ableiten verlängert würden, was jedoch der Anwendung übergeordneter Ableitungsstrategien bedarf, die erst zu einem späteren Zeitpunkt wenn kognitive Zusätze die automatisierte Mitsprechstrategie ergänzen können hinzugenommen werden. Die in deutschen Wörtern seltene Doppelung der weichen Stoppkonsonanten zwischen Vokalen (Widder, Robbe, Bagger) ist durch das rhythmisch-silbierende Mitsprechen mit 6
7 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining bewusstem Einhalten der Silbenpause pilotsprachlich erfahrbar zu machen. Einsatz von Pilotsprache bedeutet, dass die Wörter möglichst eng an die Schriftsprache angeglichen wohl artikuliert im Silbenrhythmus mitgesprochen werden. Teil III umfasst die Integration der harten Stoppkonsonanten t, p, k. Am schwierigsten akustisch und sprechmotorisch erfassbar sind die harten bzw. stimmlosen Stoppkonsonanten t / p / k. Hier ist der starke, herausspringende Luftstrom das entscheidende Differenzierungsmerkmal. Immer häufi ger ist bei Betroffenen zu beobachten, dass sie den weichen Stoppkonsonanten (Geschichden, Osdern) sprechmotorisch bevorzugen, was durch eine regional bedingte Aussprache gestützt werden kann (Beispiele aus Thüringen: Dikdat, Bause) und dementsprechend verschriften. In dieser Lernphase hat die bewusste Aussprache mit deutlicher Artikulation der Problemstellen einen hohen sprecherzieherischen Charakter. Der erhöhte Einsatz der Mundmotorik beim Bilden der harten Stoppkonsonanten erfordert in einigen Fällen ein vertiefendes Training, bevor eigenständig Unterscheidungen zwischen den Stoppkonsonantenpaaren d/t, b/p und g/k vorgenommen werden können. Das nun einzusetzende Wortmaterial ist in dieser Lernphase stark erweitert, so dass bereits ein sprachlich anspruchsvolles Niveau von Sätzen und Texten möglich ist. Eine Auswahl des Trainingsmaterials ist insofern gemessen an der Eingangsdiagnose und dem sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes bzw. Jugendlichen oder Erwachsenen notwendig. Den Abschluss der Phonemstufe 2 bildet die Integration der Konsonantendoppelung von kk verschriftet als ck. Hierbei setzen wir uns über die nach der Rechtschreibreform nicht mehr zu trennende Doppelung (früher: bak-ken) hinweg; denn wir arbeiten nicht mit der Trennsilbe, sondern mit der Sprechsilbe, die durch das Setzen der Silbenbögen visualisiert wird. Von einer Trennung bei ck (ba-cken) raten wir dem Kind schlichtweg ab. Vertiefende Informationen über den kleinschrittigen Aufbau der Phonemstufe 2 fi ndet der Anwender in REUTER-LIEHR, Band 1 (2008), S Ferner enthält das hier in Band 2/2 vorliegende Material zu jeder einzuführenden Laut/Buchstabenverbindung ausführliche Hinweise. Bedeutung des Einsatzes der integrierten senso-motorisch orientierten Methoden: Lautgebärden und Rhythmisches Syllabieren Das Training in der Abfolge dieser Sprachsystematik mit seinem steigenden Schwierigkeitsgrad analog zum Schriftspracherwerb (s. Tabelle 1) bliebe ein rein kognitiver Vorgang mit fraglichem Erfolg, würde es sich vorrangig auf das Üben und Memorieren entsprechender Wörter beschränken. Lese- und Schreibstrategien, welche es ermöglichen, auch ungeübte Wörter gleichen Schwierigkeitsgrades zu bewältigen, blieben dem Betroffenen unklar oder gar verborgen. Denn wir wissen, dass legasthene Kinder die Strukturen der Schriftsprache nicht intuitiv erfassen, sie insofern eine logisch nachvollziehbare Struktur beim Schriftsprachaufbau benötigen, die für sie klar erkennbar und nachvollziehbar sein muss. Da ist die Vorgabe gut aufeinander aufbauenden Wortmaterials sicherlich eine wichtige Grundlage, reicht aber noch nicht aus. Des Weiteren gibt es Hinweise aus der Neurobiologie, dass gerade bei Legasthenikern eine spezifi sche Gedächtnisschwäche für schriftsprachliches Material vorliegt. Ein Üben von Wortbildern setzt folglich genau an der Schwäche der Kinder an, überfordert den Speicher und erschwert nachhaltige Kompensationsmöglichkeiten. 7
8 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining (REUTER-LIEHR 2008, Bd. 1, S ) Im Elementartraining (Phonemstufen 1 und 2) geht es stattdessen um den Aufbau einer gesicherten Mitsprechstrategie im Silbenrhythmus von Wörtern mit überschaubaren Wortstrukturen. Um die Gedächtnisleistung für im Wort mitsprechbare Laut/Buchstabenverbindungen zu stärken und die Verknüpfung von gesprochener Sprache und Schriftsprache zu erleichtern, bedarf es handlungsorientierter Methoden zur Unterstützung einer hilfreichen Strategiebildung. Nun bestätigt inzwischen die Neurodidaktik, dass Lernen in Verbund mit Bewegung die effektivste Form darstellt; denn Bewegung ist für die Entwicklung des Gehirns wichtig, beschleunigt die Lernprozesse, Muskeln und Gehirn werden durch Einbeziehen der Motorik besser durchblutet (KORTE 2009). Insofern können wir in keinem Fall darauf verzichten, den Stellenwert der Motorik bei diesem aufbauenden Training mit hohen Gedächtnisanteilen und dem Ziel einer Automatisierung des Gelernten unbeachtet zu lassen. Die Einbindung von Grobmotorik, Feinmotorik und Koordination ist dementsprechend in jeder Therapiestunde dieser Lernphase ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg. Folgende senso-motorisch orientierte Methoden sind unverzichtbare Bestandteile des Behandlungskonzeptes. Um ihre Wichtigkeit zu unterstreichen, werden sie im Folgenden nochmals kurz erläutert. Lautgebärdeneinsatz Auch die Laut/Buchstabenverbindungen der Phonemstufe 2 werden mit Hilfe der Handmotorik in Form von Lautgebärden trainiert. Die dynamischen Handbewegungen, die den Sprechbewegungsablauf einzelner Laute durch eine gezielte Bewegung begleiten und somit eine Verknüpfung vom Laut zum Buchstaben erleichtern, orientieren sich in der Handhabung überwiegend an der Mundstellung, der Artikulationsstelle sowie dem notwendigen Luftstrom zum Bilden des Lautes und weniger am Buchstabenbild. Der wiederholte Einsatz schafft Sicherheit, auch die neuen Laute präzise zu bilden und mit dem jeweils richtigen Buchstaben zu verbinden. Die fl ießende Handbewegung bei der Verbindung einzelner Lautgebärden hilft dem Kind, beim Lesen die Synthese vom Laut zur Silbe herzustellen und schließlich das Wort zu erfassen. Das Lesen von ausgewählten Wörtern mit Lautgebärden ist ebenso wie in der Phonemstufe 1 eine intensive Form, die Lautfolge und somit auch die Buchstabenabfolge im Wort zu trainieren. Dabei sollte die Silbenpause durch das Aufl e- gen der Hand auf die Brust betont werden. Da die Gebärden mit einer Hand gebildet werden und somit auch den Schreibvorgang begleiten können, helfen sie, die teilweise recht ähnlich klingenden Laute dieser Phonemstufe besser zu differenzieren. Jede Lautgebärde wird mit einem Anlautbild aus der Phonemstufe 2 verknüpft. Der motorische Einsatz der Hand als Begleitung zur Sprechbewegung vertieft die notwendige Gedächtnisleistung. Der Bedarf und die Intensität der Lautgebärdenarbeit können jedoch von Fall zu Fall variieren. Dementsprechend unterschiedlich sind die Einsatzmöglichkeiten. (REUTER-LIEHR 2008, Bd. 1, S. 86 ff und Bd. 2/2 Handanweisungen) Bei den harten Stoppkonsonanten t/p/k ist wie bereits erwähnt bei deutlicher Artikulation ein starker Luftstrom zu spüren. Beim Einsatz der Lautgebärde wird diese Erfahrung durch die stoßartige Bewegung der Hand (Springer-T, Puste-Platzer-P) oder dem auf dem Handrücken deutlich zu spürenden Luftstrom wie beim k verstärkt und unterstreicht somit die Lautbildung und damit auch die Buchstabenanbindung. Der Einsatz dient also einer bewussten Lautwahrnehmung und Lautwiedergabe. Er bietet somit einen Ansatzpunkt zur 8
9 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining Sprecherziehung und hilft Kindern mit undeutlicher Artikulation, dialektalem Einfl uss oder auch anderer Muttersprache die deutsche Sprache präzise zu erfassen und zu benutzen. Eine derart präzisierte Aussprache hilft beim Aufbau der Mitsprechstrategie und stützt ebenso das Erlernen orthographisch richtiger Verschriftungen. Rhythmisches Syllabieren Das Rhythmische Syllabieren ist auch in dieser Lernphase die grundlegende Methode zum Training der Mitsprechstrategie, auf die in keinem Fall verzichtet werden kann. Grundlegende Zielsetzung ist die Rhythmusvertiefung unter Einsatz der gesamten Körpermotorik, um ein sicheres Gefühl für die Silbengliederung zu entwickeln. Mit dem Rhythmischen Syllabieren erhält das legasthene Kind eine Methode an die Hand, seine Artikulation zu präzisieren, damit seine Wortdurchgliederungsprobleme abzubauen und speziell seine Schwierigkeiten bei der Vokallängendifferenzierung zu kompensieren. a) Seitwärts-Tanzen im Silbenrhythmus in Schreibrichtung Der Ablauf beim Tanzen von Wörtern in Silben beginnt bei gleichzeitigem Sprechen mit dem Armschwung der Schreibhand in Augenhöhe über der linken Schulter (1) und endet über der rechten Schulter wiederum in Augenhöhe (3). Die Armbewegung schwingt dabei bis unter das Zwerchfell, die Körpermitte wird überkreuzt (2). Die Silbenpause wird beim Sprechen und Tanzen bewusst eingehalten. Parallel zum Armschwung werden die Füße seitwärts ebenfalls in Schreibrichtung gesetzt und in der Silbenpause geschlossen (3). Die nächste zu sprechende Silbe wird nach bewusstem Innehalten der Schreibhand in Augenhöhe direkt angeschlossen, dies in einem fl ießenden Ablauf ohne Zwischenbewegung. Der Arm der Schreibhand geht dabei mit neuem Schwung im leichten Bogen über den Kopf (4) wieder zur linken Schulter (5) und überkreuzt danach die Körpermitte erneut (6). Der Schwung endet wieder in Augenhöhe über der rechten Schulter (7). Jede weitere Silbe überkreuzt ebenfalls die Körpermitte Silben pause Zeichnerische Darstellung des Bewegungsablaufes für zwei Silbenschwünge Linkshänder benutzen zum Schwingen ihre linke Hand. Sie beginnen mit ihrer Schreibhand ebenfalls über der linken Schulter und schwingen ebenso nach rechts in Schreibrichtung weiter. Auch bei ihnen endet der Armschwung über der rechten Schulter. Der Bewegungsablauf vollzieht sich seitwärts auf einer gedachten, geraden Linie. Der Armschwung sollte bei jedem Silbenschwung erneut raumgreifend und tief die Körpermitte überkreuzen, um den regulierenden Einfl uss auf Atmung und Stimmgebung auszunutzen. Die aufrechte Körperhaltung begünstigt die zum Sprechen nötige Spannung der Artikulationsorgane sowie der Zungenmuskulatur. Die Armbewegung darf im Ablauf keineswegs kleiner oder zum Oberkörper seitlich versetzt ausgeführt werden, damit der regulierende Einfl uss nicht verloren geht. Bei regelmäßigem Training kann beobachtet werden, dass die Artikulation deutlicher wird und auch dialektale Einfl üsse an Gewicht verlieren. 9
10 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining b) Synchrones Sprechschreiben Durch den Einsatz des rhythmisch-silbierenden Schwingens ist die Sprachwahrnehmung bereits präzisiert. Der ganzheitlich erfahrene, gesprochene und gehörte Sprachrhythmus wird beim synchronen Sprechschreiben möglichst unmittelbar übertragen. Der Vorgang des synchronen Sprechschreibens lässt sich folgendermaßen beschreiben: Das Wort wird laut mitsprechend silbengegliedert aufgeschrieben. Eine bewusste Silbenpause wird eingehalten und hilft die Wortdurchgliederung korrekt zu erfassen. Die einzelnen Laute werden gleichzeitig zum Schreibvorgang des jeweiligen Buchstabens anhaltend ausgesprochen. Dabei hört und sieht der Schreibende, was er gerade schreibt, eine unmittelbare Korrektur ist möglich. Verglichen zur Spontansprache verlangsamt sich die Artikulation. Die Sicherheit in der Laut/Buchstabenzuordnung wird durch das deutliche Mitsprechen gestützt. Somit wird eine Steuerungshilfe gelernt, die den Schreibbewegungsablauf begleitet und ordnet. Beim synchronen Sprechschreiben wird sowohl eine auditive als auch sprechmotorische Analyse integriert und dieser gesamte Vorgang durch visuellen Check mittels Auge-Handkoordination beim Schreibbewegungsablauf unterstützt. Das Gelingen dieser Gleichzeitigkeit der verschiedenen Funktionen, die beim Schreiben beteiligt sind, ist das erklärte Trainingsziel. Langjährige Beobachtungen in der Praxis haben immer wieder bestätigt, dass genau an dieser Stelle Handlungsbedarf in der LRS-Therapie besteht; denn in der mangelnden Synchronisierung zeigen legasthene Kinder ihre besonderen Schwierigkeiten. Zentrale Aufgabe ist es demnach, Sprache und Schreibmotorik optimal zu synchronisieren und eine Selbstkontrolle des eigenen Schreibvorganges zu lernen. c) Silbenbögenlesen Da nur Mitsprechwörter mit Silbenbögen versehen werden, visualisieren sie ausschließlich die Mitsprechbarkeit. Es wird laut in Silben gegliedert gelesen und dabei werden parallel Silbenbögen unter die Wörter gemalt. Diese sollten möglichst gleichmäßig und gerundet aussehen. Innerhalb des Wortes werden sie, wie eine Girlande fortgeführt, wobei Ende bzw. Anfang des Bogens die Silbe klar trennt jedoch ohne den Stift abzusetzen. Um Wortgrenzen deutlich zu machen, wird eine Silbenbögen-Lücke zwischen den Wörtern eingehalten. Nach dem rhythmisch-silbierenden Tanzen von Wörtern mit anschließendem synchronem Sprechschreiben wird beim Silbenbögenlesen die Silbengliederung nochmals nachvollzogen und der vorab erlebte Sprachrhythmus erneut erfahren. Analog zum Sprechschreiben wird die Silbenpause durch ein kurzes, bewusstes Innehalten der Hand betont. Zur Kontrolle kann der Lesende noch einmal darauf achten, dass kein Buchstabe, den er beim Schreiben mitgesprochen hat, ausgelassen wurde. Das Unterlegen mit Silbenbögen nach dem Schreiben eines Wortes bzw. Textes wird in der Regel als eine stressfreie Leseübung empfunden, da der Text dem Leser bekannt ist. So sollte schon aus diesem Grund auf diesen dritten Teil des Rhythmischen Syllabierens nicht verzichtet werden, selbst wenn keine oder nur sehr wenige Schreibfehler vorgekommen sind. Grundlegende Lesetechniken, wie die Unterscheidung offener von geschlossener Silbe, werden zudem auch bei diesem Vorgang trainiert (s. dazu auch Vokaltraining, Handanweisung, S. 26 f). So ergibt sich eine erhöhte Sicherheit in der visuellen Wortdurchgliederung und die Lesegenauigkeit wird auf Dauer geschult. 10
11 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining Erfolgskontrollen nach Abschluss der Phonemstufe 2 Nach Abschluss des kleinschrittigen Aufbaus der Phonemstufe 2 ist es in jedem Fall ratsam, den im Material dieses Bandes enthaltenen Lauttreuen Bildertest der Phonemstufe 2 (LBT 2) als Erfolgskontrolle einzusetzen. Die 24 Testwörter entsprechen ausschließlich den trainierten Wortstrukturen offene und geschlossene Silben ohne Konsonantenhäufungen innerhalb einer Silbe und enthalten sämtliche Laut/Buchstabenverbindungen der Phonemstufen 1 und 2. Das Verschriften dieser Wörter erfolgt anhand von Bildern, insofern nach dem eigenen inneren Sprechmuster des Schreibers. Eine Vorab-Artikulation des Untersuchers als Sprechmodell entfällt demnach (s. Testanweisungen, Blatt III-140f). Es ist nicht selten, dass der LBT 2 nach diesem intensiven Aufbau fehlerlos geschrieben wird, was auch beabsichtigt ist; denn das Erfolgserlebnis ist sehr motivierend für eine Weiterarbeit. Kommt es jedoch noch zu mehr als ca. 4-5 Fehlentscheidungen, dies insbesondere bei der Unterscheidung der Stoppkonsonantenpaare d/t, b/p, g/k, so war das Training nicht intensiv genug. Es kann sein, dass der Lautgebärdeneinsatz in der Trainingssituation zu selten erfolgte, da vielleicht durch das exakte Sprechmodell des Trainers keine Differenzierungsprobleme auffi elen. Es mag aber auch sein, dass der Lautgebärdeneinsatz nicht eigenständig zur Überprüfung der unsicheren Laut/Buchstabenverbindungen übernommen wurde. Letzteres ist am ehesten bei älteren Kindern und Jugendlichen zu beobachten, die schon lange Zeit eine andere Herangehensweise, beispielsweise das visuelle Vorstellen eines Wortbildes, eingeschliffen hatten und diese wenn auch immer wieder für sie fehlerträchtige Form noch nicht ablegen konnten. Dann sollte das Ergebnis zum Anlass genommen werden, die mangelnde oder nicht durchgängige Übernahme der Kontrollmöglichkeit durch präzise Artikulation mit Hilfe der Lautgebärden zu thematisieren und gemeinsam Überlegungen anzustellen, mit welchen Übungseinheiten und mit welchem Einsatz hier Sicherheit erlangt werden kann. Denn ein weiteres Transportieren der Unsicherheit ohne Bearbeitung des Problems birgt die Gefahr, dass bei Wörtern mit komplexeren Wortstrukturen, so wie auf der Phonemstufe 4 mit Konsonantenhäufungen (Trillerpfeife, Kletterstange, Problem) die Differenzierung gerade der Stoppkonsonanten nicht gelingt. Ein Zurückgehen auf die Phonemstufe 2 mit erneutem Einsatz der Lautgebärden ist dann wenig motivierend und wird als Rückschritt empfunden. Erfahrungsgemäß ist der Erfolg dann weniger gegeben. Für eine weitergehende Planung ist außerdem die Durchführung eines normierten und klassenentsprechenden Rechtschreib- sowie Lesetests wichtig. Beides gibt Aufschluss über den erreichten Entwicklungsstand in der Schriftsprache im Vergleich zur Altersgruppe. Die fehleranalytischen Auswertungen sollten eindeutige Fortschritte in der Phonem-Graphemzuordnung bei Wörtern ohne Konsonantenhäufungen sowie in der basalen Wortdurchgliederung dokumentieren. Auch sollte die Konsonantendoppelung zwischen Vokalen als Problem deutlich verringert sein. Die Abnahme umgangssprachlich bedingter Fehlentscheidungen (mangelnde Pilotsprache) steht in einem direkten Zusammenhang zur Lesemotivation, Lesehäufi gkeit und Lesegenauigkeit. Liest das Kind, der Jugendliche bzw. der Erwachsene bisher wenig oder gar nicht, ist hier der Erfolg noch sehr abhängig von dem vorhandenen inneren Sprechmuster. Eine weitergehende Korrektur ist erst durch die Bereitschaft möglich, eine bewusst analytische Lesestrategie zielgerichtet beispielsweise bei grammatischen Endungen (spannden statt spannenden) anzuwenden. Hier müssen wiederholt Gesprächsanlässe gesucht werden, um prozesshaft das Bewusstsein für diese Schnittstelle zu verändern. 11
12 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining Es ist jedoch auch feststellbar, dass die Therapie nach dem Elementartraining beendet werden kann. Diese Erfahrung konnte gemacht werden, wenn die Kinder frühzeitig (Ende 1. Klasse bis Mitte 2. Klasse) zur Behandlung kamen. Sie hatten dann den Anschluss an die Altersgruppe erreicht und profi tierten wieder vom Regelunterricht in der Schule. Eine Nachuntersuchung nach einem Jahr nach Abschluss der Therapie hat dann meist ein gleich bleibend gutes Ergebnis gezeigt. Die Therapie musste nicht wieder aufgenommen werden. Bei älteren Schulkindern (ab Mitte 3. Klasse) ist in der Regel eine Fortsetzung des Trainings mit den Materialien der Lerngruppen I oder II (REUTER-LIEHR 2006, Bd. 3 oder 4) notwendig und möglich. Bei schwer ausgeprägten Störungen sind vertiefende Zusatzmaterialien auf den Phonemstufen 3 und 4 sinnvoll. Allerdings sollte das Wort- und Textmaterial der jeweiligen Phonemstufe entsprechen. Evaluation Das Elementartraining also der kleinschrittige Aufbau der Phonemstufen 1 und 2 wurde seit 1992 in unserer legasthenietherapeutischen Praxis bei Lese- und Schreibanfängern der 1. und 2. Klasse, schwer betroffenen Legasthenikern und jugendlichen bzw. erwachsenen Analphabeten eingesetzt und bis heute weiterentwickelt. Den Erfolg dieses kleinschrittigen Vorgehens konnte eine Studie am Psychologischen Institut der Universität Göttingen (UNTER- BERG 2005) belegen. Das Elementartraining war immer dann Bestandteil des Behandlungsvorgehens der untersuchten Probanden, wenn es die Diagnose des Entwicklungsstandes im Aufbau der phonemischen Strategie beim Lesen sowie beim Schreiben als Start an der Nullfehlergrenze erforderte. Die Therapien wurden von Therapeuten, die sich noch in der Weiterbildung befanden und unter Supervision arbeiteten, in Einzelsitzungen durchgeführt. So konnte die hohe Effektivität des gesamten Behandlungskonzeptes bei einer Stichprobe von 164 Probanden mit einer TW*-Differenz von 18,57 im Vergleich zwischen Vor- und Nachtest (Vortest TW 33,64:Nachtest TW 52,21) nach durchschnittlich 78,61 Std. belegt werden. Dies mit einer sehr hohen Effektstärke von d=2.62. Die behandelten Kinder hatten die durchschnittlichen Leistungen ihrer Altersgruppe erreicht. Ebenso bestätigt eine Follow-Up-Untersuchung bei einem Teil dieser behandelten legasthenen Kinder, Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (n=46, Anzahl der Therapiestunden Ø 82,65) durchschnittlich drei Jahre nach Abschluss der Behandlung die nachhaltige Wirkung des Behandlungskonzeptes. Die Differenz zwischen dem Vortest zu Beginn der Therapie und dem altersentsprechenden Follow-up-Test betrug ca TW-Punkte. So konnte belegt werden, dass die durchschnittliche Leistung im Vergleich zur Altersgruppe auch nach drei Jahren nach Abschluss der Therapie erhalten bleibt. (UNTERBERG 2005; REUTER-LIEHR 2008, Bd. 1, S ). * TW bedeutet Transformationswert; dieser Wert ermöglicht, Ergebnisse unterschiedlicher Testverfahren miteinander zu vergleichen. 12
13 Aufbau der Phonemstufe 2 Elementartraining Literatur zu Band 2/2 KORTE, M (2009) Lernen lernen Lehren lernen Lernen fördern: Anmerkungen aus Sicht der Forschung. Vortrag auf der 19. Fachtagung des Fachverbandes für integrative Lerntherapie, e.v. FiL, Erkner 8. Mai 2009 KOSSOW, H-J (1985) Leitfaden zur Bekämpfung der Lese-Rechtschreibschwäche. Einführung und Kommentare MARBURGER FORSCHUNGSGRUPPE (2006/7) Legasthenie Häufige Fragen. Klinik für Kinderund Jugendpsychiatrie Philipps-Universität Marburg, www-legasthenie.de MAY, P; MALITZKY, V; VIELUF, U (2001) Rechtschreibtests im Vergleich: Wie stellt man deren Güte fest und wie besser nicht? Anmerkungen zur Kritik von Tacke, Völker und Lohmüller an der HSP. Psychologie in Erziehung und Unterricht 48 (2), REUTER-LIEHR, C (2008), Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung, Bd. 1 Eine Einführung in das Training der phonemischen Strategie auf der Basis des rhythmischen Syllabierens mit einer Darstellung des Übergangs zur morphemischen Strategie, 3. vollständig überarbeitet und erweiterte Aufl age REUTER-LIEHR, C (2006) Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung, Bd. 2/1 REUTER-LIEHR, C (2006) Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung, Bd. 5 SpielSpirale SUCHODOLETZ, W v. (Hrsg.) (2010) Therapie von Entwicklungsstörungen. Was wirkt wirklich? UNTERBERG, D (2005) Die Entwicklung von Kindern mit LRS nach Therapie durch ein sprachsystematisches Förderkonzept. Kurz- und langfristige Wirksamkeit des Förderkonzepts nach Reuter-Liehr 13
14 Handanweisungen Phonemstufe 2 Teil I-III Training der Mitsprechstrategie in der Phonemstufe 2 Die grundlegende Strategie beim Aufbau des lauttreuen Lesens und Schreibens ist auch im Training der Phonemstufe 2 die Mitsprechstrategie. Sie ist mit dem dauerhaft mitsprechbaren Wortmaterial des Elementartrainings der Phonemstufe 1 (REUTER-LIEHR 2006, Bd. 2/1) eingeführt worden und leicht nachvollziehbar, da alle Laut/Buchstabenverbindungen dieser Phonemstufe anhaltend ausgesprochen werden können. Beim Training der Phonemstufe 2, Teil I der Integration der Laut/Buchstabenverbindungen h, z, j, ch in das bisherige Wortmaterial der Phonemstufe 1 wird diese Herangehensweise beibehalten; denn auch diese Laute sind anhaltend mitsprechbar. Das rhythmisch silbierende und gleichzeitige synchrone Mitsprechen beim Schreiben kann als wichtigste Kontrollstrategie des Schreibvorganges auch hier gut gelingen. Dabei ist in der Trainingssequenz des Rhythmischen Syllabierens* ein bestimmter Ablauf einzuhalten, der am häufi gsten das genaue Sprechen abverlangt. Rhythmisches Syllabieren Ich höre, dann spreche und schwinge ich in Silben. Danach schreibe ich auf, was ich gehört und gesprochen habe, dabei spreche ich laut mit. Zum Schluss lese ich mit Silbenbögen und spreche wieder laut mit! Lernplakat aus: REUTER-LIEHR 2006, Bd. 2/1, Blatt I-2 Die Übertragung des synchronen Mitsprechens auf Wörter mit Stoppkonsonanten (Teil II und Teil III dieses Bandes) erfordert dagegen eine Veränderung des Mitsprechvorganges, da diese nicht mehr langanhaltend mitsprechbar sind. Die Stoppkonsonanten werden zu Beginn einer Silbe mundmotorisch vorgeformt, aber erst in Verbindung mit dem nachfolgenden Vokal ausgesprochen. Das Vorformen mit dem Mund erleichtert die Laut/ Buchstabenzuordnung, die sprachliche Synthese von Konsonant und Vokal hält den nicht verzichtbaren Silbenrhythmus aufrecht. * Dieser Begriff umschreibt den gesamten Prozess des gleichzeitigen Sprechens und Schwingens mit dem Körper in Schreibrichtung, des synchronen Sprechschreibens und des Silbenbögenlesens. 14
15 Phonemstufe 2 Handanweisungen Teil I-III Nun kann es jedoch sein, dass bei Vorliegen einer starken akusto-motorischen Differenzierungsproblematik vorübergehend ein Anlautieren des Stoppkonsonanten vom Kind vorgenommen wird, um sich über die Laut/Buchstabenzuordnung zu vergewissern. Dann sollte diese lautlich hörbare Unterstützung eine zeitlang beibehalten werden, bis das Kind die nötige Sicherheit erlangt hat. Ein vorheriges silbengliederndes Tanzen und Schwingen des Wortes hat in diesen Fällen einen besonderen Stellenwert, es unterstützt die Übertragung des Silbenrhythmus aufs Schreiben, der beim Anlautieren leicht verloren gehen kann. Denn die langfristig den Erfolg sichernde Basis des lautgetreuen Lese-Rechtschreibtrainings ist eine gelingende Silbensegmentierung. Diese zu erlangen, erfordert beim legasthenen Kind eine längere Entwicklung. So bleibt das Rhythmische Syllabieren während der gesamten Phonemstufen 1-6 methodische Grundlage, während der Lautgebärdeneinsatz nach Sicherung der Laut/Buchstabenzuordnung beim Lesen und Schreiben schon nach der Phonemstufe 2 wegfallen kann. Punkte-Urkunde Die Punkte-Urkunde zur Verstärkung eingehaltener Abmachungen und zum Durchhalten bei Anstrengungen sollte auch in der Phonemstufe 2 eingesetzt werden. Das Blatt (I-29) befi ndet sich als farbige Kopiervorlage in REUTER-LIEHR 2006, Bd. 2/1. Da die Handhabung wohl überlegt und konsequent erfolgen muss, wird auch an dieser Stelle nochmals ausführlich darauf eingegangen. Eine eingehaltene Abmachung ist beispielsweise, das Klassendiktat oder das Zeugnis unaufgefordert in die Therapiestunde mitzubringen, auch wenn es nicht gut ausgefallen ist. Bei Durchführung einer außerschulischen Therapie ist es zudem nicht selbstverständlich, dass das Kind zusätzlich zu seinen schulischen Hausaufgaben weitere tägliche Trainingsaufgaben durchführt, auch hier ist eine verhaltenstherapeutische Verstärkung durch eine Punkte-Urkunde notwendig. Wichtige Abmachungen bezüglich der Hausaufgaben sind beispielsweise: Ich mache meine Hausaufgaben immer allein. Ich mache sie vollständig. Ich halte die vereinbarten Tage ein. Das Kind klebt sich einen farbigen Punkt oder Ähnliches in seine Punkte-Urkunde, der Therapeut quittiert mit einem Eintrag die eingehaltene Abmachung, setzt das Datum und seine Unterschrift dazu. Fehler dürfen dabei keine Rolle spielen. Die Vereinbarung über die Punkte-Vergabe muss vorher genau besprochen sein. Es gibt keine halben Punkte, es gibt keinen Punkte-Abzug, es gibt auch keine Vielzahl von Punkten, es gibt jeweils einen Punkt für eine vollständige Hausaufgabe. Vollständig ist beispielsweise eine Hausaufgabe erst, wenn auch sämtliche Silbenbögen vorhanden sind. Sind acht Punkte zusammengekommen, so wird die Urkunde vom Therapeuten mit einer Mitteilung an die Eltern unterschrieben. Das Kind löst diese dann zu Hause gegen eine kleine Belohnung ein. Dazu ist es notwendig, vorab am besten gleich zu Beginn der Therapie mit den Eltern über Sinn, Zweck und Handhabung der Urkunde zu sprechen. Belohnungen müssen so beschaffen sein, dass sie jeder Zeit von den Eltern erbracht werden können. Versprechen zu gemeinsamen Aktivitäten was sicherlich materiellen Zuwendungen vorzuziehen ist müssen innerhalb einer angemessenen Zeit einhaltbar sein. Teure Belohnungen sollten ausscheiden. An dieser Stelle ist es sehr wichtig, genau mit den Eltern über die Belohnungspraktiken zu sprechen und sie zu beraten. 15
16 Handanweisungen Teil I-III Phonemstufe 2 Die Einbeziehung der Eltern als emotionale Verstärker hat sich sehr bewährt. Sie sind die wichtigsten emotionalen Bezugspersonen des Kindes, somit haben sie natürlich eine hohe Bedeutung beim Motivationsaufbau für Lernen, für selbständiges Arbeiten, für Durchhalten etc. Darauf sollte nicht verzichtet werden. (s. ebd. 2008, Bd. 1, 277f) Stundenaufbau Der Aufbau einer Therapiestunde im Elementarbereich der Phonemstufe 2 entspricht im Wesentlichen dem Ablauf einer Stunde (à 50 Min.) des Elementartrainings der Phonemstufe 1 (s. ebd. 2006, Bd. 2/1, Blatt I-3 und Blatt II-2). Die Anteile des Rhythmischen Syllabierens mit Integration des Lautgebärdeneinsatzes sofern notwendig umfassen auch in dieser Lernphase mindestens Min. Von der Schriftsprache unabhängige Aktivitäten sind in der Regel verlorene Zeit für den Lernerfolg. Denn der Erfolg an der Sache selbst ist der Hauptmotor zum Erhalt der Motivation des Kindes, und dieser Erfolg setzt nachweislich am ehesten ein, wenn regelmäßig, konsequent und vielfältig dazu aber zielgerichtet und wohlüberlegt aufbauend trainiert wird. Die nachfolgende Beispielstunde soll Anregungen geben, eine Stunde für Zweit- bis Viertklässler zu gestalten, deren diagnostische Einschätzung ihres Entwicklungsstandes im Bereich Schriftsprache ergaben, dass ein kleinschrittiges Vorgehen im Elementarbereich erforderlich ist. Integration der Laut/Buchstabenverbindung t in das bisher trainierte Wortmaterial der Phonemstufen 1 und 2 05 Min. Begrüßung und Gespräch (Warming-up) 03 Min. Durchsicht der häuslichen Trainingsaufgabe und -bestätigung Überprüfung und Honorierung eingehaltener Abmachungen (Punkte-Urkunde, s. ebd. 2006, Bd. 2/1, Blatt I-29 und ebd. 2008, Bd. 1, 277ff) 06 Min. Lautgebärdeneinsatz Einführen der Laut/Buchstabenverbindung t Vorlegen des Wortes Tiger in unsortierter Abfolge mit Lautgebärdenkarten einschließlich Anbindungswörtern ohne Buchstabenangaben Alternative: Die Kärtchen in korrekter Reihenfolge des Wortes vorlegen, sofern das Herausfi nden unsortierter Wörter noch eine Überforderung darstellt. Frage 1: Wie heißt das Wort? Aufgaben: a) Lege die Buchstaben in die richtige Reihenfolge. b) Kennzeichne die Silbenpause durch eine Lücke. Frage 2: Welches ist der neue Buchstabe? Lautgebärde t genau besprechen (Handmotorik wie Mundmotorik), dabei den starken Luftstrom im Gegensatz zum schwachen Luftstrom beim d in der 16
17 Phonemstufe 2 Handanweisungen Teil I-III Lautbildung differenzieren. Evtl. zur Verdeutlichung des unterschiedlichen Luftstroms die Wattebauschprobe einsetzen (s. Blatt III-21/22) Abschließende Aufgaben: a) Tanze das Wort in Silben. b) Schreibe es synchron mitsprechend an die Tafel. c) Male die Silbenbögen. Zur Verstärkung des Gelernten wird das t in Groß- und Kleinbuchstaben in das Lautgetreue Buchstabenhaus 2 (Blatt I-11) eingetragen. 10 Min. Einsatz des Rhythmischen Syllabierens Lernspiel: Bildpaare aufdecken Satz 1 und 2 der Tanz-/Schreibkarten zum t (Blatt III-29 und III-30) mischen und in Reihen verdeckt auf den Tisch legen. Jeweils zwei Karten aufdecken und das entsprechende Wort benennen. Sind zwei Karten übereinstimmend, so wird das Wort getanzt, in eine vorbereitete Tabelle synchron mitsprechend an die Tafel geschrieben und mit Silbenbögen versehen. Dabei stets laut mitsprechen und die Silbenpause einhalten. Bei Notwendigkeit Lautgebärdeneinsatz vor dem synchronen Sprechschreiben einschieben, was auch partiell also beschränkt auf den neuen Buchstaben t erfolgen kann. Tafeltabelle (Kind richtet ein) Name des Kindes Name des Therapeuten Wer als erster 3-4 Bildpaare aufdecken konnte und die Wörter in die Tabelle geschrieben hat, ist Sieger. Natürlich kann das Spiel dann noch zu Ende gespielt werden. 14 Min. Strategietraining am Text Schreiben von Sätzen: Alle haben etwas anderes (Blatt III-34) Diktat mit wohl artikulierter Sprechweise, dabei Wort für Wort ansagen. Das Kind schreibt zweizeilig in Schreibschrift (s. dazu ebd. 2006, Bd. 2/1 Handanweisung 1), spricht dabei laut synchron mit, hält bewusst die Silbenpausen ein, setzt die Oberzeichen in der Silbenpause. Der Therapeut achtet darauf, dass diese Herangehensweise eingehalten wird, hilft steuernd mit, sobald es nicht gelingt. Falschschreibungen, die eine Verwirrung mit Regeln oder Ausnahmeschreibungen zeigen, werden mit dem Hinweis auf die Nicht-Mitsprechbarkeit vermieden. Großschreibungen bzw. Kleinschreibungen werden angesagt, sobald es zu Falschschreibungen kommt. (vgl. ebd. 2008, Bd. 1, 123ff) Anschließend malt das Kind begleitet durch lautes Mitsprechen Silbenbögen unter sein Geschriebenes und korrigiert, wenn es Buchstabenauslassungen oder eine falsche Laut/Buchstabenzuordnung entdeckt. Zum Abschluss kontrolliert das Kind sein Geschriebenes selbständig anhand der Vorlage. Es hakt jedes richtige Wort ab. Falsche Wörter werden nochmals korrekt unter den Text geschrieben. Zur Verstärkung wird vom Kind die Anzahl der richtig geschriebenen Wörter notiert. 02 Min. Besprechung der neuen häuslichen Trainingsaufgabe Bilddiktat (Blatt III-50/51) mit T-Wörtern 08 Min. Silbengliederndes Lesetraining Lernspiel: Tanzen auf dem Brett mit der SpielSpirale 17
18 Handanweisungen Teil I-III Phonemstufe 2 Vorbereitung: Zusammenstellung der Wortkarten zu h, z, j, ch d, b, g und t. Spielregeln einschließlich zeitsparender Variante s. Tanzen auf dem Brett mit Wortkarten 02 Min. Verabschiedung 50 Min. Alphabetische Wortlisten Zu den Buchstaben von Teil I: h z j ch; Teil II: d b g; Teil III: t p k ck Die alphabetisch angeordneten Wortlisten geben einen Überblick über das mögliche Wortmaterial ohne Konsonantenhäufungen innerhalb einer Silbe, dem jeweiligen Lernstand auf der Phonemstufe 2 entsprechend. Sie integrieren in einer festgelegten Abfolge die noch fehlenden Mitsprechbuchstaben in das bisher eingesetzte Wortmaterial. Die Wortlisten erfüllen nicht den Anspruch vollständig zu sein. Besonders in Teil III wurde eine Auswahl getroffen, da hier bereits eine Fülle von Wortmaterial einsetzbar wäre. Die Wortlisten dienen dazu, in der Therapiesituation spontan lautanalytisch korrektes Wortmaterial des jeweiligen Lernschrittes für besondere Übungen parat zu haben. Bei der Auswahl sollte berücksichtigt werden, ob das Wort dem Lernentwicklungsstand des Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen entspricht. Die Wörter, welche mit einem Sternchen* gekennzeichnet sind, erfordern bereits Kenntnisse über strukturelle Regelmäßigkeiten der deutschen Orthographie, also den sicheren Einsatz der erweiterten phonemischen Strategie. Eine genaue silbengliedernde Artikulation also eine pilotsprachliche Sprechweise (REUTER-LIEHR 2008, Bd. 1, 115ff) ist Voraussetzung für das korrekte Schreiben. Diese bewusst wohl artikulierte Sprechweise sollte entweder vom Therapeuten in Form eines Sprechmodells vorgegeben werden oder durch exaktes Silbenbögenlesen vorbereitet sein. Erklärungen zur Lautbildung und den Lautgebärden Hier wird für jeden neuen Laut die jeweilige Lautbildung durch Beschreibung der Sprechorgane, des Sprechbewegungsablaufs und des Luftstroms zur Unterstützung der kinästhetischen Wahrnehmung in Verbund mit der Lautgebärde (Handmotorik) ausführlich erläutert (Blatt I-12/13/14/15; Blatt II-14/15/16; Blatt III-21/22/23/24). Lautgebärdenhaus 2 / Lautgetreues Buchstabenhaus 2 Lautgebärdenhaus 1 (ebd. 2006, Bd. 2/1, Blatt I-12) wird nun ergänzt durch Lautgebärdenhaus 2 (Blatt I-10). In vergrößerter Form (DIN A 3) kann das Plakat auch im Therapieraum aufgehängt werden, jedoch ohne Buchstabeneintragungen. So kann sich das Kind bei Unsicherheit anhand der Abbildungen vergewissern, muss aber die Laut/ Buchstabenverbindung selbständig herstellen. Eigenes Herausfi nden motiviert und trainiert letztlich intensiver das Gedächtnis als bequeme Vorgaben. Zur Visualisierung gesicherter Laut/Buchstabenverbindungen der Phonemstufe 2 gibt es das Lautgetreue Buchstabenhaus 2 (Blatt I-11), welches unausgefüllt lediglich Abbildungen der lautgetreuen Anbindungswörter enthält. In diese Felder sollten vom Kind jeweils nach Einführung der große und kleine Druckbuchstabe sowie der große und kleine Schreibschriftbuchstabe eingetragen werden. So wird visualisiert, was bereits geschafft ist. 18
19 Inhaltsverzeichnis Lautgetreues Material der Phonemstufe 2 Teil I schwierige Dauerkonsonanten: h, z, j, ch Alphabetische Wortliste 1: h... Blatt 1-3 Alphabetische Wortliste 2: z... Blatt 4-5 Alphabetische Wortliste 3: j... Blatt 6 Alphabetische Wortliste 4: ch... Blatt 7-9 Lautgebärdenhaus 2... Blatt 10 Lautgetreues Buchstabenhaus 2... Blatt 11 Erklärungen zu den Lautgebärden der Phonemstufe 2 Teil I... Blatt Lautgebärdenkarten h/z/j/ch... Blatt 16 Lautgebärdenkarten h/z/j/ch ohne Angaben von Buchstaben... Blatt Übersicht: Lautgebärden der Phonemstufen 1 und 2... Blatt 19 Bild-, Wort- und Textmaterial zum Buchstaben h Schnippelbogen 1... Blatt 20 Tanz-/Schreibkarten (1. und 2. Satz) zu h-wörtern... Blatt Wortliste 1: Kurze Wörter mit H/h... Blatt 23 Wortliste 2: Lange Wörter mit H/h... Blatt 24 Lesen und Verstehen 1: Tiere zuordnen... Blatt 25 Lese- und Schreibsätze 1: Was wir alles sehen; Was wir alles hören... Blatt 26 Lese- und Schreibsätze 2: Was wir alles holen; Was wir alles hoffen... Blatt 27 Lesen und Verstehen 2: Lese und male... Blatt 28 Vokaltraining 1: Unsere Hasen laufen hin und her Blatt 29 Lese- und Schreibsätze 3: Unsere Hasen laufen hin und her Blatt 30 Wortkarten zu Tanzen auf dem Brett (SpielSpirale): h-wörter... Blatt 31 Rätseldiktat h... Blatt Hausaufgabe 1: Bilddiktat zum Anmalen... Blatt 35 Hausaufgabe 2: Eigendiktat... Blatt Bild-, Wort- und Textmaterial zu den Buchstaben h/z Schnippelbogen 2... Blatt 38 Tanz-/Schreibkarten (1. und 2. Satz) zu z-wörtern... Blatt Wortliste 3: Kurze Wörter mit Z/z... Blatt 41 Wortliste 4: Lange Wörter mit Z/z... Blatt 42 Lesen und Verstehen 3: Was essen wir zu was?... Blatt 43 Vokaltraining 2: Zusammen sein... Blatt 44 Text 1: Zusammen in einem Haus... Blatt 45 Vokaltraining 3: Unsere Sommerreise auf eine ferne Insel im Ozean... Blatt 46 Text 2: Unsere Sommerreise auf eine ferne Insel im Ozean... Blatt 47 Silbenrätsel 1: Welche Silbe fehlt?... Blatt 48 Wortkarten zu Tanzen auf dem Brett (SpielSpirale): z-wörter... Blatt 49 Rätseldiktat z... Blatt Hausaufgabe 3: Bilddiktat zum Anmalen... Blatt Hausaufgabe 4: Welche Silbe fehlt?... Blatt Hausaufgabe 5: Silbensalat... Blatt Hausaufgabe 6: Silbenbögenlesen... Blatt 59-60
In der jetzt geöffneten PDF-Datei finden Sie. eine Übersicht über den Inhalt von Bd. 2/1 und. Musterseiten von Übungsblättern.
 In der jetzt geöffneten PDF-Datei finden Sie eine Übersicht über den Inhalt von Bd. 2/1 und Musterseiten von Übungsblättern. Blättern Sie in der Datei mit den Pfeiltasten des Ziffernblockes oder den Pfeilen
In der jetzt geöffneten PDF-Datei finden Sie eine Übersicht über den Inhalt von Bd. 2/1 und Musterseiten von Übungsblättern. Blättern Sie in der Datei mit den Pfeiltasten des Ziffernblockes oder den Pfeilen
Blatt 14 Lerngruppe II Stunde 2
 Blatt 14 Lerngruppe II Stunde 2 Material: Schwerpunkte: Tanz - und Schreibkarten der Phonemstufe 1 (Blatt Aufmerksamkeit (visuell) 17) Strategietraining: rhythmische Silbengliederung, Textvorlage Quatschsätze
Blatt 14 Lerngruppe II Stunde 2 Material: Schwerpunkte: Tanz - und Schreibkarten der Phonemstufe 1 (Blatt Aufmerksamkeit (visuell) 17) Strategietraining: rhythmische Silbengliederung, Textvorlage Quatschsätze
Inhaltsverzeichnis. EL Prolog 19 Überlegungen zum aktuellen Stand der Dinge in Schule und Gesellschaft 19 Literatur 21
 Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 1. Auflage 13 I. Einleitung 15 EL Prolog 19 Überlegungen zum aktuellen Stand der Dinge in Schule und Gesellschaft 19 Literatur 21 HL Lese-Rechtschreibstörung - Stand der
Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 1. Auflage 13 I. Einleitung 15 EL Prolog 19 Überlegungen zum aktuellen Stand der Dinge in Schule und Gesellschaft 19 Literatur 21 HL Lese-Rechtschreibstörung - Stand der
Die Rechtschreibleiter
 Die Rechtschreibleiter Heutige Planung: Kurzes Vorstellen - Ziele heute: Ziel 1: Überblick über die Einsatzmöglichkeiten RSL Ziel 2: Wissen über die grundlegenden Rechtschreibstrategien festigen und erweitern.
Die Rechtschreibleiter Heutige Planung: Kurzes Vorstellen - Ziele heute: Ziel 1: Überblick über die Einsatzmöglichkeiten RSL Ziel 2: Wissen über die grundlegenden Rechtschreibstrategien festigen und erweitern.
Rechtschreiben mit der FRESCH Methode
 Rechtschreiben mit der FRESCH Methode 1. Sprechschreiben und Schwingen Bild 1: Besieht man sich den deutschen Grundwortschatz, so erkennt man, dass die Hälfte der Wörter lautgetreu geschrieben werden (Bild
Rechtschreiben mit der FRESCH Methode 1. Sprechschreiben und Schwingen Bild 1: Besieht man sich den deutschen Grundwortschatz, so erkennt man, dass die Hälfte der Wörter lautgetreu geschrieben werden (Bild
- Vorschau LehrerSelbstVerlag Lauttreues Schreiben mit Konsonantenhäufung SELBST LEHRER VERLAG
 LEHRER SELBST VERLAG 1 Ich 2 Ich 3 Ich 4 Ich 5 Ich Lauttreue Wörter schreiben Mein Plan für das Schreiben von Wörtern mit zwei Mitlauten im Wortinneren spreche das Wort in Silben und male dabei Silbenbögen.
LEHRER SELBST VERLAG 1 Ich 2 Ich 3 Ich 4 Ich 5 Ich Lauttreue Wörter schreiben Mein Plan für das Schreiben von Wörtern mit zwei Mitlauten im Wortinneren spreche das Wort in Silben und male dabei Silbenbögen.
Schreiben. lea. Diagnostik. Lukas allein im Restaurant. Kann-Beschreibungen. Deckblatt. Alpha-Level 2 ( 40)
 Schreiben Alpha-Level 2 ( 40) Deckblatt Kann-Beschreibungen 2.1.01 Kann buchstabierte einzelne Laute verschriftlichen 2.1.07 Kann kurze und geläufige Funktionswörter aufschreiben I (ist, ein, in, die)
Schreiben Alpha-Level 2 ( 40) Deckblatt Kann-Beschreibungen 2.1.01 Kann buchstabierte einzelne Laute verschriftlichen 2.1.07 Kann kurze und geläufige Funktionswörter aufschreiben I (ist, ein, in, die)
Lese- & Rechtschreibschwäche. Ursachen & Lösungen
 Lese- & Rechtschreibschwäche Ursachen & Lösungen Legasthenie & Lese-Rechtschreibschwäche Legasthenie & Lese-Rechtschreibschwäche Was ist das? LRS wird als Beeinträchtigung der Lese- und Schreibfähigkeiten
Lese- & Rechtschreibschwäche Ursachen & Lösungen Legasthenie & Lese-Rechtschreibschwäche Legasthenie & Lese-Rechtschreibschwäche Was ist das? LRS wird als Beeinträchtigung der Lese- und Schreibfähigkeiten
Richtig schreiben. Rechtschreibleiter. In 16 Lernstufen zum Erfolg Angebote, die sich ideal ergänzen! in 16 Lernstufen. nach dem Konzept der
 In 16 Lernst zum Erfolg Angebote, die sich ideal ergänzen! LOGICO PICCOLO Orthografische St 7 11 St 12 16 Best.-Nr. 3348 Best.-Nr. 3349 Die Ein umfassendes Lern- und Förderprogramm zur Rechtschreibung
In 16 Lernst zum Erfolg Angebote, die sich ideal ergänzen! LOGICO PICCOLO Orthografische St 7 11 St 12 16 Best.-Nr. 3348 Best.-Nr. 3349 Die Ein umfassendes Lern- und Förderprogramm zur Rechtschreibung
Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung
 Carola Reuter-Liehr Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung Band 1 Eine Einführung in das Training der phonemischen Strategie auf der Basis des rhythmischen Syllabierens mit einer Darstellung des Übergangs
Carola Reuter-Liehr Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung Band 1 Eine Einführung in das Training der phonemischen Strategie auf der Basis des rhythmischen Syllabierens mit einer Darstellung des Übergangs
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richtig schreiben - Rechtschreibprogramm für Freiarbeit und zum häuslichen Üben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richtig schreiben - Rechtschreibprogramm für Freiarbeit und zum häuslichen Üben Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Entwicklung der alphabetischen Strategie Mit Übungsaufgaben Die Lösungen finden Sie auf Seite 5
 Entwicklung der alphabetischen Strategie Mit Übungsaufgaben Die Lösungen finden Sie auf Seite 5 Indem Kinder versuchen, eigenständig Wörter zu schreiben, nähern sie sich der zentralen Grundfertigkeit:
Entwicklung der alphabetischen Strategie Mit Übungsaufgaben Die Lösungen finden Sie auf Seite 5 Indem Kinder versuchen, eigenständig Wörter zu schreiben, nähern sie sich der zentralen Grundfertigkeit:
Blättern Sie in der Datei mit den Pfeiltasten des Ziffernblockes oder den Pfeilen in der Navigationsleiste.
 Hier finden Sie zu Band 3: eine Einführung in das Lehrmaterial, die Gliederung der Phonemstufen. das vollständige Inhaltsverzeichnis des Bandes und Musterseiten der Stunden 1 und 31. Blättern Sie in der
Hier finden Sie zu Band 3: eine Einführung in das Lehrmaterial, die Gliederung der Phonemstufen. das vollständige Inhaltsverzeichnis des Bandes und Musterseiten der Stunden 1 und 31. Blättern Sie in der
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Wörter mit Doppelkonsonanz richtig schreiben Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Passendes Wortmaterial (Minimalpaare, wie z. B. Riese Risse, siehe Arbeitsauftrag) Kompetenzerwartungen
Wörter mit Doppelkonsonanz richtig schreiben Jahrgangsstufen 3/4 Fach Benötigtes Material Deutsch Passendes Wortmaterial (Minimalpaare, wie z. B. Riese Risse, siehe Arbeitsauftrag) Kompetenzerwartungen
Teilvorabdruck. Bayern.
 Handreichungen Teilvorabdruck Bayern www.westermann.de Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Kari und Bu landen passend zum neuen Lehrplan und präsentieren die neue Fibel für Bayern: Karibu. Karibu arbeitet methodenintegrativ
Handreichungen Teilvorabdruck Bayern www.westermann.de Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Kari und Bu landen passend zum neuen Lehrplan und präsentieren die neue Fibel für Bayern: Karibu. Karibu arbeitet methodenintegrativ
Die Rechtschreibleiter
 Die Rechtschreibleiter - ein Script vom Autor Thomas Hawellek Die Rechtschreibleiter Heute: A) Überblick über die Struktur und den Aufbau B) Einblick in die Details C) Methodische Überlegungen zum Einsatz
Die Rechtschreibleiter - ein Script vom Autor Thomas Hawellek Die Rechtschreibleiter Heute: A) Überblick über die Struktur und den Aufbau B) Einblick in die Details C) Methodische Überlegungen zum Einsatz
Schreiben. lea. Diagnostik. Morgens auf der Baustelle. Kann-Beschreibungen. Deckblatt. Alpha-Level 2 (ı 41)
 Morgens auf der Baustelle Alpha-Level 2 (ı 41) Deckblatt Kann-Beschreibungen 2.1.07 Kann kurze und geläufige Funktionswörter schreiben I (ist, ein, in, und) 2.1.08 Kann Wörter mit dem kurzen Vokal e" in
Morgens auf der Baustelle Alpha-Level 2 (ı 41) Deckblatt Kann-Beschreibungen 2.1.07 Kann kurze und geläufige Funktionswörter schreiben I (ist, ein, in, und) 2.1.08 Kann Wörter mit dem kurzen Vokal e" in
Deutsch Jahrgangsstufe 1
 Grundschule Bad Münder Stand: 25.01.2016 Schuleigener Arbeitsplan Deutsch Jahrgangsstufe 1 Zeitraum bis Herbstferien schreiben die eingeführten Buchstaben formklar und halten die Schreibrichtung ein. kennen
Grundschule Bad Münder Stand: 25.01.2016 Schuleigener Arbeitsplan Deutsch Jahrgangsstufe 1 Zeitraum bis Herbstferien schreiben die eingeführten Buchstaben formklar und halten die Schreibrichtung ein. kennen
Rechtschreiben mit der FRESCH Methode
 Rechtschreiben mit der FRESCH Methode 1. Sprechschreiben und Schwingen Bild 1: Besieht man sich den deutschen Grundwortschatz, so erkennt man, dass die Hälfte der Wörter lautgetreu geschrieben werden (Bild
Rechtschreiben mit der FRESCH Methode 1. Sprechschreiben und Schwingen Bild 1: Besieht man sich den deutschen Grundwortschatz, so erkennt man, dass die Hälfte der Wörter lautgetreu geschrieben werden (Bild
Inhaltsverzeichnis. Phonologische Bewusstheit. Reimen + Lautanalyse + Silbensegmentierung. Konsonant + langer Vokal + Konsonant
 Inhaltsverzeichnis Inhalt Seite Einleitung 5-8 Verstärkerpläne 9-13 Detailliertes Inhaltsverzeichnis 15-25 Phonologische Bewusstheit Reimen + Lautanalyse + Silbensegmentierung 27-74 Wortstruktur Mofa Konsonant
Inhaltsverzeichnis Inhalt Seite Einleitung 5-8 Verstärkerpläne 9-13 Detailliertes Inhaltsverzeichnis 15-25 Phonologische Bewusstheit Reimen + Lautanalyse + Silbensegmentierung 27-74 Wortstruktur Mofa Konsonant
Selbstvertrauen der Betroffenen durch Erfolgserlebnisse stärken
 Lese-Rechtschreib-Förderung (LRF) am Nepomucenum Allgemeine Zielsetzungen Selbstvertrauen der Betroffenen durch Erfolgserlebnisse stärken Minderwertigkeitsgefühle, Schulunlust, Lernblockaden und andere
Lese-Rechtschreib-Förderung (LRF) am Nepomucenum Allgemeine Zielsetzungen Selbstvertrauen der Betroffenen durch Erfolgserlebnisse stärken Minderwertigkeitsgefühle, Schulunlust, Lernblockaden und andere
Inhaltsverzeichnis. Arbeitshinweise für Eltern, Lehrer, Therapeuten 4. Empfehlung/Fehlertabelle/Lernwörter üben 7
 Inhaltsverzeichnis Arbeitshinweise für Eltern, Lehrer, Therapeuten 4 Empfehlungen 5-6 Empfehlung/Fehlertabelle/Lernwörter üben 7 ABC, Selbstlaute, Mitlaute, Umlaute 8 ABC-Kärtchen zum Ausschneiden 9-12
Inhaltsverzeichnis Arbeitshinweise für Eltern, Lehrer, Therapeuten 4 Empfehlungen 5-6 Empfehlung/Fehlertabelle/Lernwörter üben 7 ABC, Selbstlaute, Mitlaute, Umlaute 8 ABC-Kärtchen zum Ausschneiden 9-12
heißt alle Kinder wıllk mmen Mit der Silbe im Gepäck
 heißt alle Kinder wıllk mmen Mit der Silbe im Gepäck Die Fibel mit Silben heißt auf Kiswahili Willkommen. Kari und Bu, zwei Außerirdische, sind auf die Erde gereist, um mit den Kindern zu lernen Oder anders
heißt alle Kinder wıllk mmen Mit der Silbe im Gepäck Die Fibel mit Silben heißt auf Kiswahili Willkommen. Kari und Bu, zwei Außerirdische, sind auf die Erde gereist, um mit den Kindern zu lernen Oder anders
Morphemunterstütztes Grundwortschatz- Segmentierungstraining (MORPHEUS)
 Morphemunterstütztes Grundwortschatz- Segmentierungstraining (MORPHEUS) von R. Kargl & C. Purgstaller MORPHEUS Rechtschreibtraining 4. bis 8. Klassenstufe Einsatz im Förder- und Regelunterricht, Förderung
Morphemunterstütztes Grundwortschatz- Segmentierungstraining (MORPHEUS) von R. Kargl & C. Purgstaller MORPHEUS Rechtschreibtraining 4. bis 8. Klassenstufe Einsatz im Förder- und Regelunterricht, Förderung
Inhalt. Vorwort 11. Wie erkenne ich, ob ein Kind eine Legasthenie hat?.. 13 Die Begriffe Lese-Rechtschreib-Störung und Legasthenie 25
 Inhalt Vorwort 11 Wie erkenne ich, ob ein Kind eine Legasthenie hat?.. 13 Die Begriffe Lese-Rechtschreib-Störung und Legasthenie 25 Faktoren, die den Lese-Rechtschreib-Erwerb fördern. 31 Entwicklung im
Inhalt Vorwort 11 Wie erkenne ich, ob ein Kind eine Legasthenie hat?.. 13 Die Begriffe Lese-Rechtschreib-Störung und Legasthenie 25 Faktoren, die den Lese-Rechtschreib-Erwerb fördern. 31 Entwicklung im
Wirkt es wirklich?? Programmcheck am Beispiel des Online-LRS-Trainings delfino
 Wirkt es wirklich?? Programmcheck am Beispiel des Online-LRS-Trainings delfino Dipl.Päd. Angelika Pointner Akadem.LRS-Therapeutin Diplomierte Didaktikerin www.schulpsychologie.at Im Auftrag des österreichischen
Wirkt es wirklich?? Programmcheck am Beispiel des Online-LRS-Trainings delfino Dipl.Päd. Angelika Pointner Akadem.LRS-Therapeutin Diplomierte Didaktikerin www.schulpsychologie.at Im Auftrag des österreichischen
Themen des Rechtschreibunterrichts geordnet nach Jahrgängen (SchiLf Ludgerusschule ) 1. Wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse im Rechtschreiben
 FACHBEREICH: DEUTSCH RECHTSCHREIBUNTERRICHT BESCHLUSS WEITERE HINWEISE: Kollegium der Ludgerusschule 24.02.2015 KONZEPTE UND VEREINBARUNGEN Themen des Rechtschreibunterrichts geordnet nach Jahrgängen (SchiLf
FACHBEREICH: DEUTSCH RECHTSCHREIBUNTERRICHT BESCHLUSS WEITERE HINWEISE: Kollegium der Ludgerusschule 24.02.2015 KONZEPTE UND VEREINBARUNGEN Themen des Rechtschreibunterrichts geordnet nach Jahrgängen (SchiLf
Schreib-Lese-Dosen 1-4 nach Maria Montessori
 Schreib-Lese-Dosen 1-4 nach Maria Montessori Die Vorbereitung auf das Lesen ist auch in der Montessoripädagogik das Schreiben, da dies ein aktiver, ein motorischer Vorgang ist. Es ist die motorische Übersetzung
Schreib-Lese-Dosen 1-4 nach Maria Montessori Die Vorbereitung auf das Lesen ist auch in der Montessoripädagogik das Schreiben, da dies ein aktiver, ein motorischer Vorgang ist. Es ist die motorische Übersetzung
Hinweise für den Lehrer
 Hinweise für den Lehrer Leseverstehen trainieren enthält Geschichten und Arbeitsblätter, die in vielfältiger Weise verwendet werden können. Der Hauptzweck besteht darin, das Leseverstehen (vor allem leseschwacher
Hinweise für den Lehrer Leseverstehen trainieren enthält Geschichten und Arbeitsblätter, die in vielfältiger Weise verwendet werden können. Der Hauptzweck besteht darin, das Leseverstehen (vor allem leseschwacher
Phänomene der deutschen Rechtschreibung
 Phänomene der deutschen Rechtschreibung Systematische Auflistung aller betroffenen deutschen Wörter in Verbindung mit Fremdwörtern von Renate und Michael Andreas aa - ee - ii - oo - uu ie - i ä ei / ai
Phänomene der deutschen Rechtschreibung Systematische Auflistung aller betroffenen deutschen Wörter in Verbindung mit Fremdwörtern von Renate und Michael Andreas aa - ee - ii - oo - uu ie - i ä ei / ai
1. Schuleingangsphase
 Selbständiges Lernen in der Schuleingangsphase und in den 3./4. Klassen 1. Schuleingangsphase Wochenplanarbeit Laut Lehrplan ist es Aufgabe der Lehrkräfte, in der Schuleingangsphase (1./2.) alle Kinder
Selbständiges Lernen in der Schuleingangsphase und in den 3./4. Klassen 1. Schuleingangsphase Wochenplanarbeit Laut Lehrplan ist es Aufgabe der Lehrkräfte, in der Schuleingangsphase (1./2.) alle Kinder
KV I a. Dokumentation der Lernausgangslage. Lernausgangslage nach Schulanmeldung. Lernausgangslage nach Schulanmeldung. Geburtsdatum: Klasse:
 Dokumentation der Lernausgangslage KV I a Geburtsdatum: Kindergarten: Lernausgangslage nach Schulanmeldung Notizen Auffälligkeiten bei der Sprachentwicklung, nach Angabe der Eltern Bei Nicht-Muttersprachlern:
Dokumentation der Lernausgangslage KV I a Geburtsdatum: Kindergarten: Lernausgangslage nach Schulanmeldung Notizen Auffälligkeiten bei der Sprachentwicklung, nach Angabe der Eltern Bei Nicht-Muttersprachlern:
Stellungnahme der Schule - LRS (Beantragung Eingliederungshilfe nach 35a SGB beim zuständigen Beratungszentrum durch Erziehungsberechtigte)
 Stellungnahme der Schule - LRS (Beantragung Eingliederungshilfe nach 35a SGB beim zuständigen Beratungszentrum durch Erziehungsberechtigte) Schüler/ Schülerin Name: Vorname: männlich. weiblich Geburtsdatum
Stellungnahme der Schule - LRS (Beantragung Eingliederungshilfe nach 35a SGB beim zuständigen Beratungszentrum durch Erziehungsberechtigte) Schüler/ Schülerin Name: Vorname: männlich. weiblich Geburtsdatum
schwingen hören richtig schreiben
 schwingen hören richtig schreiben Schreibkarten Stufe 1 Sicheres Schreiben mit der Anlauttabelle von Anfang an! - mit tollen Illustrationen von Kerstin Eidenberger - kompatibel mit den meisten Anlauttabellen
schwingen hören richtig schreiben Schreibkarten Stufe 1 Sicheres Schreiben mit der Anlauttabelle von Anfang an! - mit tollen Illustrationen von Kerstin Eidenberger - kompatibel mit den meisten Anlauttabellen
Leitfaden (Recht-) Schreiberwerb Klasse
 Leitfaden (Recht-) Schreiberwerb 1. - 3. Klasse In welchem Alter dürfen wir was von einer Schülerin/einem Schüler erwarten? Mit unserem Leitfaden wollen wir eine Antwort auf diese Frage geben. Die folgenden
Leitfaden (Recht-) Schreiberwerb 1. - 3. Klasse In welchem Alter dürfen wir was von einer Schülerin/einem Schüler erwarten? Mit unserem Leitfaden wollen wir eine Antwort auf diese Frage geben. Die folgenden
Förder-CD Karibu 1 Übersicht der Kopiervorlagen
 Allgemeines Übersicht der Kopiervorlagen 5 Schreib-Ufo 1 1 Schreib-Ufo 2 1 Symbole für die Klasse 1 1 Symbole für die Klasse 2 1 Symbole für die Klasse 3 1 Silbenschieber 1 1 Silbenschieber 2 1 Silbenschieber
Allgemeines Übersicht der Kopiervorlagen 5 Schreib-Ufo 1 1 Schreib-Ufo 2 1 Symbole für die Klasse 1 1 Symbole für die Klasse 2 1 Symbole für die Klasse 3 1 Silbenschieber 1 1 Silbenschieber 2 1 Silbenschieber
Frohes Lernen. Die Fibel mit dem Lernwortschatz
 Frohes Lernen Die Fibel mit dem Lernwortschatz Frohes Lernen schafft die Grundlagen zum Erreichen der Bildungsstandards Die Frohes-Lernen-Fibel passt genau zum bayerischen Lehrplan: viele Sprechanlässe
Frohes Lernen Die Fibel mit dem Lernwortschatz Frohes Lernen schafft die Grundlagen zum Erreichen der Bildungsstandards Die Frohes-Lernen-Fibel passt genau zum bayerischen Lehrplan: viele Sprechanlässe
SCHREIBHEFT: DRUCKSCHRIFT
 SCHREIBHEFT: DRUCKSCHRIFT Auf den folgenden Seiten finden Sie das Alphabet in der Druckschrift. Dieses Heft ist als Übungsheft für Erstklässler gedacht, aber auch für ältere Schüler, die, aus welchem Grund
SCHREIBHEFT: DRUCKSCHRIFT Auf den folgenden Seiten finden Sie das Alphabet in der Druckschrift. Dieses Heft ist als Übungsheft für Erstklässler gedacht, aber auch für ältere Schüler, die, aus welchem Grund
Werde Sil - ben - kö - nig!
 Heike Kuhn-Bamberger Werde Sil - ben - kö - nig! Lesen und Schreiben lernen trotz Lese-/Rechtschreibschwäche? Na klar! Werde Sil-ben-kö-nig! Lesen und Schreiben lernen trotz Lese-/Rechtschreibschwäche?
Heike Kuhn-Bamberger Werde Sil - ben - kö - nig! Lesen und Schreiben lernen trotz Lese-/Rechtschreibschwäche? Na klar! Werde Sil-ben-kö-nig! Lesen und Schreiben lernen trotz Lese-/Rechtschreibschwäche?
RECHTSCHREIBTRAINING
 Grundschule Gero Tacke RECHTSCHREIBTRAINING MIT DIKTATEN EFFEKTIV ÜBEN 3 FÜR ZU HAUSE Rechtschreibprobleme mit hilfreichen Lerntipps zeitsparend bewältigen 2014 Auer Verlag, Donauwörth AAP Lehrerfachverlage
Grundschule Gero Tacke RECHTSCHREIBTRAINING MIT DIKTATEN EFFEKTIV ÜBEN 3 FÜR ZU HAUSE Rechtschreibprobleme mit hilfreichen Lerntipps zeitsparend bewältigen 2014 Auer Verlag, Donauwörth AAP Lehrerfachverlage
Individuelles Förderplanheft
 Zeitraum: Individuelles Förderplanheft Zeitraum: Förderschwerpunkte Motorik kein Förderbedarf geringer Förderbedarf hoher Förderbedarf Grobmotorik Feinmotorik Graphomotorik Wahrnehmung visuell auditiv
Zeitraum: Individuelles Förderplanheft Zeitraum: Förderschwerpunkte Motorik kein Förderbedarf geringer Förderbedarf hoher Förderbedarf Grobmotorik Feinmotorik Graphomotorik Wahrnehmung visuell auditiv
Das Online-Computerprogramm Graf Orthos Lesestart plus
 Kurzanleitung Das Online-Computerprogramm Lesestart plus Dieses Computerprogramm hat den Vorteil, dass das Kind die Übungen zum Lesestart mit zusätzlichem Wortmaterial vertiefen kann, n die gelesenen Wörter
Kurzanleitung Das Online-Computerprogramm Lesestart plus Dieses Computerprogramm hat den Vorteil, dass das Kind die Übungen zum Lesestart mit zusätzlichem Wortmaterial vertiefen kann, n die gelesenen Wörter
LEGASTHENIETHERAPIE beim Verein SCHLAUER e.v.
 LEGASTHENIETHERAPIE beim Verein SCHLAUER e.v. Dr. phil. Lucia Bolzoni Sprachwissenschaftlerin Zertifizierte Legasthenietherapeutin KONTAKT Dr. phil. Lucia Bolzoni Sprachwissenschaftlerin Zertifizierte
LEGASTHENIETHERAPIE beim Verein SCHLAUER e.v. Dr. phil. Lucia Bolzoni Sprachwissenschaftlerin Zertifizierte Legasthenietherapeutin KONTAKT Dr. phil. Lucia Bolzoni Sprachwissenschaftlerin Zertifizierte
Inhaltsverzeichnis: ABC-Wörter mit Bild am MONITOR
 ABC-Wörter mit Bild zur Erarbeitung am Monitor Diese Arbeitsdatei enthält zu sprachlich relevanten Lauten und Lautverbindungen Aufbauübungen. Kopiervorlagen zum Ausdruck von Arbeitsblättern oder Karteikarten
ABC-Wörter mit Bild zur Erarbeitung am Monitor Diese Arbeitsdatei enthält zu sprachlich relevanten Lauten und Lautverbindungen Aufbauübungen. Kopiervorlagen zum Ausdruck von Arbeitsblättern oder Karteikarten
Übungen, die stark machen
 Heike Kuhn-Bamberger Übungen, die stark machen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Vorwort der Autorin 2 Wie motiviere ich mein Kind zum Üben? 3 Drei wichtige Übungsbereiche
Heike Kuhn-Bamberger Übungen, die stark machen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Vorwort der Autorin 2 Wie motiviere ich mein Kind zum Üben? 3 Drei wichtige Übungsbereiche
Arbeitsblatt zur Schreibung von das und dass. Ca. 3 Seiten, Größe ca. 215 KB
 Arbeitsblatt zur Schreibung von das und dass TMD 200 Arbeitsblatt mit Übungen zu das und dass Das Material eignet sich besonders für Schüler der Klasse 6-7 Im ersten Abschnitt wird der Unterschied zwischen
Arbeitsblatt zur Schreibung von das und dass TMD 200 Arbeitsblatt mit Übungen zu das und dass Das Material eignet sich besonders für Schüler der Klasse 6-7 Im ersten Abschnitt wird der Unterschied zwischen
Schreiben. lea. Diagnostik. Lara ist krank. Kann-Beschreibungen. Deckblatt. Alpha-Level 2 ( 36)
 Schreiben Lara ist krank Alpha-Level 2 ( 36) Kann-Beschreibungen Deckblatt 2.1.06 Kann in einem logographischen Zugriff Standardanreden wie,liebe' oder,hallo' (im Brief) schreiben 2.1.07 Kann kurze und
Schreiben Lara ist krank Alpha-Level 2 ( 36) Kann-Beschreibungen Deckblatt 2.1.06 Kann in einem logographischen Zugriff Standardanreden wie,liebe' oder,hallo' (im Brief) schreiben 2.1.07 Kann kurze und
LS 02. LS 02 Nomen sind Namen für Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge. Wortarten 8. Erläuterungen zur Lernspirale
 LS 02 Wortarten 8 LS 02 Nomen sind Namen für Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen 1 PL 5 L gibt einen Überblick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.
LS 02 Wortarten 8 LS 02 Nomen sind Namen für Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen 1 PL 5 L gibt einen Überblick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.
Übersicht über den Inhalt von Bd. 1 des Regelaufbaus und Musterseiten von Übungsblättern:
 Übersicht über den Inhalt von Bd. 1 des Regelaufbaus und Musterseiten von Übungsblättern: Einleitende Worte Vom Häufigen zum Seltenen von den Mitsprechwörtern über die Mitsprechstellen zu den regelhaften
Übersicht über den Inhalt von Bd. 1 des Regelaufbaus und Musterseiten von Übungsblättern: Einleitende Worte Vom Häufigen zum Seltenen von den Mitsprechwörtern über die Mitsprechstellen zu den regelhaften
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Wortarten-Lapbook für die Klassen 2-4. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wortarten-Lapbook für die Klassen 2-4 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Wortarten-Lapbook für die Klassen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wortarten-Lapbook für die Klassen 2-4 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Wortarten-Lapbook für die Klassen
Inhalt. Vorwort zur dritten Auflage 13 Vorwort zur ersten Auflage 17 Einleitung 20. Erster Abschnitt - Der geübte Leser und der geübte Schreiber
 Inhalt Vorwort zur dritten Auflage 13 Vorwort zur ersten Auflage 17 Einleitung 20 Erster Abschnitt - Der geübte Leser und der geübte Schreiber 1 Die Entwicklung des Lesens und Rechtschreibens... 23 1.1
Inhalt Vorwort zur dritten Auflage 13 Vorwort zur ersten Auflage 17 Einleitung 20 Erster Abschnitt - Der geübte Leser und der geübte Schreiber 1 Die Entwicklung des Lesens und Rechtschreibens... 23 1.1
In der jetzt geöffneten PDF-Datei finden Sie. eine Einführung in das Lernspiel und Musterkartensätze der Phonemstufen 1 und 6.
 In der jetzt geöffneten PDF-Datei finden Sie eine Einführung in das Lernspiel und Musterkartensätze der Phonemstufen 1 und 6. Blättern Sie in der Datei mit den Pfeiltasten des Ziffernblockes oder den Pfeilen
In der jetzt geöffneten PDF-Datei finden Sie eine Einführung in das Lernspiel und Musterkartensätze der Phonemstufen 1 und 6. Blättern Sie in der Datei mit den Pfeiltasten des Ziffernblockes oder den Pfeilen
Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept
 Pilotstudie Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept Theoretischer Hintergrund: Hören, Sehen, richtiges Sprechen, aber auch gute fein- und grobmotorische Fertigkeiten sind grundlegende Voraussetzungen
Pilotstudie Wahrnehmungsförderung mit dem FRODI-Frühförderkonzept Theoretischer Hintergrund: Hören, Sehen, richtiges Sprechen, aber auch gute fein- und grobmotorische Fertigkeiten sind grundlegende Voraussetzungen
Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs
 Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Staatliches Schulamt Offenburg
 1/9 1. LRS-Verständnis a) Ursachen In der Diskussion um Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten kursieren zahlreiche, teils differente Vorstellungen. Einige Autoren definieren LRS als besondere Schwäche mit
1/9 1. LRS-Verständnis a) Ursachen In der Diskussion um Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten kursieren zahlreiche, teils differente Vorstellungen. Einige Autoren definieren LRS als besondere Schwäche mit
1. Klasse Volksschule
 Ö ST E R R E I C H I S C H E R L E H R P L A N Legasthenie leichter meistern 1. Klasse Volksschule Hörve mit CD Hörverständnis-Übungen ve v rständni h eiben Sicher s Leichter lesen R ichtig schreiben Sicher
Ö ST E R R E I C H I S C H E R L E H R P L A N Legasthenie leichter meistern 1. Klasse Volksschule Hörve mit CD Hörverständnis-Übungen ve v rständni h eiben Sicher s Leichter lesen R ichtig schreiben Sicher
Modulbeschreibung. Sprachspiel-Lieder. Schularten: Fächer:
 Modulbeschreibung Schularten: Fächer: Zielgruppen: Autorin: Zeitumfang: Grundschule; Förderschule Deutsch (GS); Sprache - Deutsch / Moderne Fremdsprachen (FS) 2 (GS), Grundstufe (FS) Michaela Kratz Vier
Modulbeschreibung Schularten: Fächer: Zielgruppen: Autorin: Zeitumfang: Grundschule; Förderschule Deutsch (GS); Sprache - Deutsch / Moderne Fremdsprachen (FS) 2 (GS), Grundstufe (FS) Michaela Kratz Vier
Legasthenie - LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung. Christian Klicpera, Alfred Schabmann, Barbara Gasteiger-Klicpera
 Christian Klicpera, Alfred Schabmann, Barbara Gasteiger-Klicpera Legasthenie - LRS Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung Unter Mitarbeit von Barbara Schmidt 4., aktualisierte Auflage Mit 22 Abbildungen
Christian Klicpera, Alfred Schabmann, Barbara Gasteiger-Klicpera Legasthenie - LRS Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung Unter Mitarbeit von Barbara Schmidt 4., aktualisierte Auflage Mit 22 Abbildungen
Hausaufgaben- konzept
 Dalumer Straße 7 49626 Bippen 05435-12 71 05435-95 48 11 @ gs.bippen@t-online.de Hausaufgaben- konzept Stand Juni 2012 1. Grundlagen des Konzeptes 1.1 Definition Hausaufgaben sind Aufgaben, die von den
Dalumer Straße 7 49626 Bippen 05435-12 71 05435-95 48 11 @ gs.bippen@t-online.de Hausaufgaben- konzept Stand Juni 2012 1. Grundlagen des Konzeptes 1.1 Definition Hausaufgaben sind Aufgaben, die von den
Weitere Downloadprodukte aus der Schreib- und Lernwerkstatt sowie dem Fern-Coaching: Übungen zu b oder d
 Weitere Downloadprodukte aus der Schreib- und Lernwerkstatt sowie dem Fern-Coaching: Übungen zu Aktiv und Passiv Wissens-Check: Wortarten Rechtschreibung & Verben mit dem Wortstamm üben Wortspiel: Wer
Weitere Downloadprodukte aus der Schreib- und Lernwerkstatt sowie dem Fern-Coaching: Übungen zu Aktiv und Passiv Wissens-Check: Wortarten Rechtschreibung & Verben mit dem Wortstamm üben Wortspiel: Wer
Dr. Christiane Ritter 1
 Willkommen PotsBlitz-Das Potsdamer Lesetraining Fachtag LZ Dr. Christiane Ritter 22.11. 2013 Einleitung Theoretischer Hintergrund LRS als Entwicklungsverzögerung Ursache: phonologische Informationsverarbeitung
Willkommen PotsBlitz-Das Potsdamer Lesetraining Fachtag LZ Dr. Christiane Ritter 22.11. 2013 Einleitung Theoretischer Hintergrund LRS als Entwicklungsverzögerung Ursache: phonologische Informationsverarbeitung
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Jahrgangsstufen 3/4 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Themengebiet E 3/4 4.4 Einkaufen Kompetenzerwartungen Language Awareness: Der lange i-laut: [i:] Englisch Stand: 25.02.2016 1-2 Unterrichtseinheiten
Jahrgangsstufen 3/4 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Themengebiet E 3/4 4.4 Einkaufen Kompetenzerwartungen Language Awareness: Der lange i-laut: [i:] Englisch Stand: 25.02.2016 1-2 Unterrichtseinheiten
Knackpunkte der Rechtschreibung
 Karin Hohmann Knackpunkte der Rechtschreibung Dehnung, Schärfung, Auslautverhärtung Bergedorfer Kopiervorlagen Zu diesem Material: Die Arbeitsblätter dieser Mappe ermöglichen eine strukturierte Auseinandersetzung
Karin Hohmann Knackpunkte der Rechtschreibung Dehnung, Schärfung, Auslautverhärtung Bergedorfer Kopiervorlagen Zu diesem Material: Die Arbeitsblätter dieser Mappe ermöglichen eine strukturierte Auseinandersetzung
Lauttreues Schreiben ohne Konsonantenhäufung Kopiervorlagen
 Fördermaterialien Rechtschreibung Lauttreues Schreiben ohne Konsonantenhäufung Kopiervorlagen Bestellnummer 20-029 Herausgegeben von: Doz. Dr. habil. Borhild Rehak (Jahrgang 1943) Grundschullehrerin, Diplompädagogin,
Fördermaterialien Rechtschreibung Lauttreues Schreiben ohne Konsonantenhäufung Kopiervorlagen Bestellnummer 20-029 Herausgegeben von: Doz. Dr. habil. Borhild Rehak (Jahrgang 1943) Grundschullehrerin, Diplompädagogin,
Musterseite. Lernstandsbeobachtungen zu den Schwingschreibblättern K2 und K4 und der Schwingkartei
 Lernstandsbeobachtungen Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache sind schon sehr frühzeitig in Klasse 1 zu erkennen. In der LRS-Förderung gewinnen deshalb präventive Ansätze zunehmend an Bedeutung.
Lernstandsbeobachtungen Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache sind schon sehr frühzeitig in Klasse 1 zu erkennen. In der LRS-Förderung gewinnen deshalb präventive Ansätze zunehmend an Bedeutung.
Leseübungen. Wer nicht sicher lesen kann, wird auch nicht gern lesen.
 Leseübungen Die Leseübungen zielen vor allem darauf ab, die Dekodierfähigkeit der Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter zu stärken. Aber auch im Bereich der Sekundarstufe I ist in der Regel noch
Leseübungen Die Leseübungen zielen vor allem darauf ab, die Dekodierfähigkeit der Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter zu stärken. Aber auch im Bereich der Sekundarstufe I ist in der Regel noch
Migo, der Pirat, ist während der langjährigen und intensiven Arbeit mit legasthenen und rechtschreib-
 1 Migo, der Pirat, ist während der langjährigen und intensiven Arbeit mit legasthenen und rechtschreib- Rechtschreib-Lernspiel-Programm ist das Resultat, das sich aus dem Bedürfnis, den Kindern best- nehmung
1 Migo, der Pirat, ist während der langjährigen und intensiven Arbeit mit legasthenen und rechtschreib- Rechtschreib-Lernspiel-Programm ist das Resultat, das sich aus dem Bedürfnis, den Kindern best- nehmung
KV 1: Gleiche Anfangslaute hören (Bitte vorher immer die Hinweise lesen!) KV 2 Leuchtbuchstaben KV 3: A, E, I, O, U
 Lehr und Lernmittel Steinleitner, Ifenstr. 11, 87471 Durach Tel: 0831 / 65207 Fax: 0831 / 5655186 email Vorschlag für einen Stoffverteilungsplan für die 1. Jgst. - neu Dieser
Lehr und Lernmittel Steinleitner, Ifenstr. 11, 87471 Durach Tel: 0831 / 65207 Fax: 0831 / 5655186 email Vorschlag für einen Stoffverteilungsplan für die 1. Jgst. - neu Dieser
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Dehnung (Doppelvokal, Dehnungs h, einfacher Vokal) S. 283, 286 ff., Groß und Kleinschreibung S
 Fördermaterialien zum Rechtschreibtest 5 Hier finden Sie Übungsempfehlungen zu Materialien aus dem Lehrwerksverbund: zum Schülerbuch, zu den Handreichungen zum Unterricht, zum Arbeitsheft mit Übungs CD
Fördermaterialien zum Rechtschreibtest 5 Hier finden Sie Übungsempfehlungen zu Materialien aus dem Lehrwerksverbund: zum Schülerbuch, zu den Handreichungen zum Unterricht, zum Arbeitsheft mit Übungs CD
Fördermaterialien Rechtschreibung. Lauttreues Schreiben ohne Konsonantenhäufung. Kopiervorlagen. Reihe Deutsch Bestellnummer LEHRER SELBST
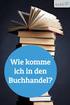 Fördermaterialien Rechtschreibung Lauttreues Schreiben ohne Konsonantenhäufung Kopiervorlagen Reihe Deutsch Bestellnummer 01 005 033 LEHRER SELBST VERLAG )%$*'&+%+%,%-./0-(. Y*8/$Y+/$'-,0"/$O*+1'0"3$%#'-6$U]-'+1-.1$^X=
Fördermaterialien Rechtschreibung Lauttreues Schreiben ohne Konsonantenhäufung Kopiervorlagen Reihe Deutsch Bestellnummer 01 005 033 LEHRER SELBST VERLAG )%$*'&+%+%,%-./0-(. Y*8/$Y+/$'-,0"/$O*+1'0"3$%#'-6$U]-'+1-.1$^X=
2. Woran erkenne ich Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten?
 Inhalt 1. Kennen Sie das?......................................... 7 2. Woran erkenne ich Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten?.. 9 3. In welchem Alter werden Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sichtbar?..............................................
Inhalt 1. Kennen Sie das?......................................... 7 2. Woran erkenne ich Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten?.. 9 3. In welchem Alter werden Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sichtbar?..............................................
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Dosendiktate: Wörter mit B/b, T/t Sp/sp und St/st - Zusätzliche Arbeitsblätter inklusive! Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Dosendiktate: Wörter mit B/b, T/t Sp/sp und St/st - Zusätzliche Arbeitsblätter inklusive! Das komplette Material finden Sie hier:
8. Einheit: Wie kann ich weiter lernen?
 8. Einheit: Wie kann ich weiter lernen? Schuljahr 2 (auch im 3. und 4.Schuljahr möglich) ZIELE Die Kinder machen sich Gedanken über ihren Kompetenzstand, indem sie überlegen und aufschreiben, was sie in
8. Einheit: Wie kann ich weiter lernen? Schuljahr 2 (auch im 3. und 4.Schuljahr möglich) ZIELE Die Kinder machen sich Gedanken über ihren Kompetenzstand, indem sie überlegen und aufschreiben, was sie in
Anhang. Schulprogramm der Grundschule Süd Radeberg. 1. Die analytisch- synthetische Leselehrmethode:
 1. Die analytisch- synthetische Leselehrmethode: Die Schüler Lesen das ganze Wort. Sie erkennen zunächst die Folge der einzelnen Laute eines gesprochenen Wortes (analysieren), dann werden den analysierten
1. Die analytisch- synthetische Leselehrmethode: Die Schüler Lesen das ganze Wort. Sie erkennen zunächst die Folge der einzelnen Laute eines gesprochenen Wortes (analysieren), dann werden den analysierten
Wie motiviert man zum Lernen? Seite 10
 Wie motiviert man zum Lernen? Seite 10 Wie lässt sich der Lernprozess wirksam unterstützen? Seite 11 Welche Lernprinzipien gibt es? Seite 15 1. Lernen erleichtern Es steht außer Frage, dass der Teilnehmer
Wie motiviert man zum Lernen? Seite 10 Wie lässt sich der Lernprozess wirksam unterstützen? Seite 11 Welche Lernprinzipien gibt es? Seite 15 1. Lernen erleichtern Es steht außer Frage, dass der Teilnehmer
Pädagogischer Bericht
 Absender (Schulstempel): Eingangsstempel Albert Julius Sievert Schule Goethestr. 18 24 79379 Müllheim Telefon: 07631/179957 0 Fax: 98 mailto:poststelle@ajsievertmuellheim.fr.schule.bwl.de. Pädagogischer
Absender (Schulstempel): Eingangsstempel Albert Julius Sievert Schule Goethestr. 18 24 79379 Müllheim Telefon: 07631/179957 0 Fax: 98 mailto:poststelle@ajsievertmuellheim.fr.schule.bwl.de. Pädagogischer
Lernen in der Landschaft Hören und Schreiben Klasse 1
 Lernen in der Landschaft Hören und Schreiben Klasse 1 Zentrales Ziel des Anfangsunterrichts im ersten Schuljahr ist die Ausbildung der phonologischen Bewusstheit der Kinder. Bevor sie zu Lesern und Schreibern
Lernen in der Landschaft Hören und Schreiben Klasse 1 Zentrales Ziel des Anfangsunterrichts im ersten Schuljahr ist die Ausbildung der phonologischen Bewusstheit der Kinder. Bevor sie zu Lesern und Schreibern
Gegenstände (Karte 1), Tiere (Karte 2), Berufe (Karte 3), Gefühle und Zustände (Sternchenkarte 4 für starke Lerner) sind.
 Lernen in der Landschaft - Nomen ab Klasse 2 Angeboten wird eine Lernlandschaft zum Themenfeld Nomen für die Klasse 2. Die Lernlandschaft besteht aus vier Lerneinheiten mit jeweils drei bis fünf aufeinander
Lernen in der Landschaft - Nomen ab Klasse 2 Angeboten wird eine Lernlandschaft zum Themenfeld Nomen für die Klasse 2. Die Lernlandschaft besteht aus vier Lerneinheiten mit jeweils drei bis fünf aufeinander
LRS-Übungen zu g und k von Ruth Alef mit Illustrationen von Annukka Gruschwitz
 LRS-Übungen zu g und k von Ruth Alef mit Illustrationen von Annukka Gruschwitz Zeigt ein Kind auditive Differenzierungsstörungen, so besteht häufig die Problematik, Lautunterschiede zu erkennen und sprechmotorisch
LRS-Übungen zu g und k von Ruth Alef mit Illustrationen von Annukka Gruschwitz Zeigt ein Kind auditive Differenzierungsstörungen, so besteht häufig die Problematik, Lautunterschiede zu erkennen und sprechmotorisch
Leichter lesen R ichtig schreiben Sicher sprechen Ö ST E R R E I C H I S C H E R L E H R P L A N. Legasthenie. Vorschule.
 CD mit Hörverständnis-Übungen I S C H E R L E H R P L A N Ö ST E R R E I C H Legasthenie leichter meistern Vorschule Leichter lesen R ichtig schreiben Sicher sprechen Claudia Haider Diesem Buch liegt eine
CD mit Hörverständnis-Übungen I S C H E R L E H R P L A N Ö ST E R R E I C H Legasthenie leichter meistern Vorschule Leichter lesen R ichtig schreiben Sicher sprechen Claudia Haider Diesem Buch liegt eine
Hausaufgabenkonzept. Schule und Hort ElisabethenHeim. Stand Juli ElisabethenHeim l Bohnesmühlgasse 16 l Würzburg l
 Schule und Hort ElisabethenHeim Stand Juli 2014 1. VORWORT... 1 2. ZIELE UND GRUNDSÄTZE... 1 3. STRUKTUR... 2 4. FESTLEGUNG DER AUFGABEN DER BETEILIGTEN... 2 4.1 Schulkind... 2 4.2 Lehrkraft... 3 4.3 Hort...
Schule und Hort ElisabethenHeim Stand Juli 2014 1. VORWORT... 1 2. ZIELE UND GRUNDSÄTZE... 1 3. STRUKTUR... 2 4. FESTLEGUNG DER AUFGABEN DER BETEILIGTEN... 2 4.1 Schulkind... 2 4.2 Lehrkraft... 3 4.3 Hort...
geeignet für: Eltern Regelschulen Sonderschulen
 Sie erhalten eine gut durchdachte und praxiserprobte Materialsammlung. Sie dient der systematischen und freudvollen Arbeit mit Kindern, die sich bereits in den ersten Schulwochen mit dem Lernen schwer
Sie erhalten eine gut durchdachte und praxiserprobte Materialsammlung. Sie dient der systematischen und freudvollen Arbeit mit Kindern, die sich bereits in den ersten Schulwochen mit dem Lernen schwer
Vorwort In dem vorliegenden Bereich befindet sich ein exemplarisches Zeugnis mit Erläuterungen zum Ausfüllen, damit die verschiedenen Schulen
 Vorwort In dem vorliegenden Bereich befindet sich ein exemplarisches Zeugnis mit Erläuterungen zum Ausfüllen, damit die verschiedenen Schulen vergleichbare Kriterien vorliegen haben. Für einzelne Kategorien
Vorwort In dem vorliegenden Bereich befindet sich ein exemplarisches Zeugnis mit Erläuterungen zum Ausfüllen, damit die verschiedenen Schulen vergleichbare Kriterien vorliegen haben. Für einzelne Kategorien
Kompetenzorientierte Jahresplanung Ele und Leo
 Kompetenzorientierte Jahresplanung Ele und Leo Zeit / Thema Woche 1, 2 Kapitel 1: Die Schule beginnt Ll, Oo S. 19-27 Bildbeschreibung In der Klasse Wortbilder Leo, Lea ganzheitlich erfassen Buchstabenerarbeitung
Kompetenzorientierte Jahresplanung Ele und Leo Zeit / Thema Woche 1, 2 Kapitel 1: Die Schule beginnt Ll, Oo S. 19-27 Bildbeschreibung In der Klasse Wortbilder Leo, Lea ganzheitlich erfassen Buchstabenerarbeitung
Lehrplan Deutsch 2. Jahrgangsstufe
 Lehrplan Deutsch 2. Jahrgangsstufe Die Spracherziehung entwickelt die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes und hat damit grundlegende Bedeutung für dessen geistige und soziale Entwicklung sowie den schulischen
Lehrplan Deutsch 2. Jahrgangsstufe Die Spracherziehung entwickelt die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes und hat damit grundlegende Bedeutung für dessen geistige und soziale Entwicklung sowie den schulischen
Weberstrasse 2, 8400 Winterthur, , Elterninformation Unterstufe. 1. Klasse 2. Klasse 3.
 Elterninformation Unterstufe Sprache Wörter mit geeigneter Lesetechnik erlesen und akustische Gestalt des Wortes erfassen Kleine Texte lesen Einfache Lesestrategien aufbauen (z.b. Geschichten zeichnerisch
Elterninformation Unterstufe Sprache Wörter mit geeigneter Lesetechnik erlesen und akustische Gestalt des Wortes erfassen Kleine Texte lesen Einfache Lesestrategien aufbauen (z.b. Geschichten zeichnerisch
A. Grotlüschen; Y. Dessinger; A.M.B. Heinemann; C. Schepers Stand 23.07.2010
 ID 1 MW 2 Kann-Beschreibung Alpha-Level 1 2.1.01 n.g. 3 Kann buchstabierte einzelne Laute verschriftlichen 2.1.02 n.g. Kann lautierte einzelne Laute verschriftlichen 2.1.03 s.n. 3 Kann Groß- und Kleinbuchstaben
ID 1 MW 2 Kann-Beschreibung Alpha-Level 1 2.1.01 n.g. 3 Kann buchstabierte einzelne Laute verschriftlichen 2.1.02 n.g. Kann lautierte einzelne Laute verschriftlichen 2.1.03 s.n. 3 Kann Groß- und Kleinbuchstaben
Das Kind weist ausreichende Fertigkeiten in der Addition und Subtraktion auf, kann also in der Regel Aufgaben wie und 70-7 richtig lösen.
 Einführung Das Einmaleins wird häufig in der dritten Klasse eingeführt und entsprechend gute Kenntnisse in diesem Bereich erleichtern das Lösen vieler Aufgaben. Weiterhin wird ab der vierten Klasse das
Einführung Das Einmaleins wird häufig in der dritten Klasse eingeführt und entsprechend gute Kenntnisse in diesem Bereich erleichtern das Lösen vieler Aufgaben. Weiterhin wird ab der vierten Klasse das
2014 Auer Verlag, Donauwörth AAP Lehrerfachverlage GmbH Alle Rechte vorbehalten.
 2014 Auer Verlag, Donauwörth AAP Lehrerfachverlage GmbH Alle Rechte vorbehalten. Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt,
2014 Auer Verlag, Donauwörth AAP Lehrerfachverlage GmbH Alle Rechte vorbehalten. Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt,
Lerntherapie Lesen Schreiben - Rechnen
 Lerntherapie 2018 Lesen Schreiben - Rechnen Lerntherapie - entwicklungsorientiert und integrativ Lesen - Schreiben - Rechnen Aufbaumodul Wollen Sie als LerntherapeutIn / FörderlehrererIn arbeiten, Ihr
Lerntherapie 2018 Lesen Schreiben - Rechnen Lerntherapie - entwicklungsorientiert und integrativ Lesen - Schreiben - Rechnen Aufbaumodul Wollen Sie als LerntherapeutIn / FörderlehrererIn arbeiten, Ihr
Psychologisch - Psychotherapeutische Ambulanz Poliklinische Ambulanz des psychologischen Instituts der Universität Potsdam
 Psychologisch - Psychotherapeutische Ambulanz Poliklinische Ambulanz des psychologischen Instituts der Universität Potsdam Gutenbergstr. 67 14467 Potsdam Sekretariat / Fax: (0331) 9774759 E-Mail: randi.ehlert@uni-potsdam.de
Psychologisch - Psychotherapeutische Ambulanz Poliklinische Ambulanz des psychologischen Instituts der Universität Potsdam Gutenbergstr. 67 14467 Potsdam Sekretariat / Fax: (0331) 9774759 E-Mail: randi.ehlert@uni-potsdam.de
Strategien reflektieren und anwenden
 Strategien reflektieren und anwenden Jahrgangsstufe 5 Stand: 19.08.2017 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material Deutsch Sprachliche Bildung 1 Unterrichtszeiteinheit
Strategien reflektieren und anwenden Jahrgangsstufe 5 Stand: 19.08.2017 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material Deutsch Sprachliche Bildung 1 Unterrichtszeiteinheit
bis GER B1; Wörter mit höherem Abstraktionsgrad (Versetzung, Höflichkeit) alphabetisch, orthographisch und morphematisch
 lea Schreiben Lottes schwierige Azubi Alpha-Level 4 ( 56) Kann-Beschreibungen Deckblatt 2.2.04 Kann Satzschlusszeichen anwenden I (Punkt) 2.3.04 Kann Satzschlusszeichen anwenden II (Fragezeichen) 2.3.05
lea Schreiben Lottes schwierige Azubi Alpha-Level 4 ( 56) Kann-Beschreibungen Deckblatt 2.2.04 Kann Satzschlusszeichen anwenden I (Punkt) 2.3.04 Kann Satzschlusszeichen anwenden II (Fragezeichen) 2.3.05
Leistungsbewertung im Fach Deutsch:
 Leistungsbewertung im Fach Deutsch: Leistungsbewertung Klasse 1.2 Leistungsbewertung Klasse 3.4 Die Rechtschreibwerkstatt ist so aufgebaut, dass : die Kinder methodisch sinnvoll und korrekt abschreiben.
Leistungsbewertung im Fach Deutsch: Leistungsbewertung Klasse 1.2 Leistungsbewertung Klasse 3.4 Die Rechtschreibwerkstatt ist so aufgebaut, dass : die Kinder methodisch sinnvoll und korrekt abschreiben.
Wie heißen die Tiere? Buchstabenhäuser. Förderbereich Lautierverfahren trainieren Laute analysieren Lautgetreue Wörter erlesen
 Vorwort Als kulturelle Grundfertigkeit ist die Lesekompetenz unabdingbare Voraussetzung für lebenslanges selbstständiges Lernen in allen schulischen und außerschulischen Bereichen. Sie gewinnt in unserer
Vorwort Als kulturelle Grundfertigkeit ist die Lesekompetenz unabdingbare Voraussetzung für lebenslanges selbstständiges Lernen in allen schulischen und außerschulischen Bereichen. Sie gewinnt in unserer
Das Online-Computerprogramm Graf Orthos Lesestart plus
 Kurzanleitung Das Online-Computerprogramm Lesestart plus LESESTART Dieses Computerprogramm hat den Vorteil, dass das Kind ndie Übungen zum Lesestart mit zusätzlichem Wortmaterial vertiefen kann, ndie gelesenen
Kurzanleitung Das Online-Computerprogramm Lesestart plus LESESTART Dieses Computerprogramm hat den Vorteil, dass das Kind ndie Übungen zum Lesestart mit zusätzlichem Wortmaterial vertiefen kann, ndie gelesenen
Stundenentwurf für den zweiten Unterrichtbesuch im Fach Sport
 Stundenentwurf für den zweiten Unterrichtbesuch im Fach Sport Name: Schule: Klasse: Ort: Datum: Zeit: Fachleiter: Ausbildungslehrerin: 5a 3-Fach Halle 08.00 9.35 Uhr Stundenthema Kennen lernen des Geräts
Stundenentwurf für den zweiten Unterrichtbesuch im Fach Sport Name: Schule: Klasse: Ort: Datum: Zeit: Fachleiter: Ausbildungslehrerin: 5a 3-Fach Halle 08.00 9.35 Uhr Stundenthema Kennen lernen des Geräts
Der zweite entscheidende und kritische Entwicklungsschritt ist die Entwicklung orthografischer Strategien (May 1995). Unsere Schrift ist keine
 Ich vertrete an der Universität Hamburg die Deutschdidaktik mit dem Schwerpunkt Sprachlicher Anfangsunterricht und möchte deshalb mit dem Schulanfang in das Thema einsteigen. Wie lernen Schulanfänger Schreiben?
Ich vertrete an der Universität Hamburg die Deutschdidaktik mit dem Schwerpunkt Sprachlicher Anfangsunterricht und möchte deshalb mit dem Schulanfang in das Thema einsteigen. Wie lernen Schulanfänger Schreiben?
