Musterlösung K L A U S U R HYDROMECHANIK
|
|
|
- Julia Schäfer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Technische Universität Braunschweig Leichtweiß-Institut für Wasserbau Abteilung Hydroechanik und Küsteningenieurwesen Prof. Dr.-Ing. Hocine Oueraci WS 014/015 Prüfungsterin: 18. März 015 Musterlösung K L A U S U R HYDROMECHANIK - ohne Unterlagen, keine prograierbaren Taschenrechner, Dauer: 10 Minuten - N A M E: V O R N A M E: Matrikel-Nr.: Zur Mitteilung/Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse dieser Klausur werden zwei Möglichkeiten angeboten: 1) Ich bin it der Veröffentlichung eines Prüfungsergebnisses i Internet und auf eine Aushang unter Nennung einer Matrikelnuer, der Note und der Anzahl der erreichten Punkte einverstanden. Mir ist bewusst, dass bei dieser Art der Veröffentlichung ein Prüfungsergebnis von jede Teilneher, jeder Teilneherin dieser Prüfung gelesen werden kann. Unterschrift ) Ich öchte ein Prüfungsergebnis während der Einsicht erfahren. Aufgabe Sue Zeitbedarf erreichte Punkte Die vollständige Bearbeitung der Aufgaben ufasst Erläuterungen zu Ansätzen, Einheiten und ggf. Antwortsätze.
2 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 Aufgabe 1: Zeit: 14 Min. Als planender Ingenieur führen Sie Untersuchungen zu Wellenüberlauf an Deckwerksodellen der Insel Wangerooge an eine Modell in der Versuchshalle des Leichtweiß-Institutes für Wasserbau durch. Es stellt sich die Frage, ob das Material für das Modell richtig ausgesucht wurde. Dafür uss untersucht werden, welche Kräfte auf die einzelnen Modellabschnitte wirken. In Abbildung 1.1 ist die scheatische Darstellung eines der Deckwerke in Wangerooge gegeben. Die Sohle des Modells ist koplett it einer Dichtung abgedichtet. Gegeben: ρw = 1000 kg/³ g = 9,81 /s² l1 = 0,1 l = 0,3 l3 = 0,6 l4 = 0, h0 = 0,3 h1 = 0,4 h = 0,1 RWS A h 1 = 0,4 h 0 = 0,3 D C h = 0,1 B Modell h 0 Abdichtung l 4 = 0, l 3 = 0,6 l = 0,3 l 1 = 0,1 Boden Abb. 1.1: Scheatische Darstellung eines Deckwerksodell auf Wangerooge (nicht aßstabsgerecht) a) Zeichnen Sie qualitativ die resultierende hydrostatische Druckverteilung an der gesaten Oberfläche des Modells in Abb. 1.1 ein. b) Berechnen Sie die Drücke an den Punkten B, C und D. c) Wie groß sind die resultierenden Druckkräfte pro laufende Meter auf die einzelnen Abschnitte A-B, B-C und C-D? Muss ein Abschnitt nachgebessert werden, wenn auf das Modell nur eine axiale Kraft von 1 kn/ wirken darf?
3 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 3 Sie stellen fest, dass der kreisförige Abfluss i Boden der Versuchseinrichtung nicht dicht verschlossen ist. Aus der Produktinforation entnehen Sie, dass der Abfluss a besten abgedichtet ist, wenn eine Kraft von 0,3 kn auf den Guipfropfen wirkt (Abb. 1.). Gegeben: ρw = 1000 kg/³ g = 9,81 /s² h = 0,1 D = 0,4 l3 = 0,6 l4 = 0, h0 = 0,3 RWS h 0 = 0,3 F D C B D = 0,4 D Modell h = 0,1 Guipfropfen Abfluss Boden l 4 = 0, Abdichtung l 3 = 0,6 Abb. 1.: Scheatische Darstellung des Abflusses der Versuchseinrichtung (nicht aßstabsgerecht) d) Wie groß ist die Kraft FD, die auf den Pfropfen (Abb. 1.) wirkt? Liegt eine optiale Dichtung durch eine wirkende Kraft it 0,3 kn vor und wenn nicht, wie viel c Wasser üsste aus der Versuchseinrichtung abgeschöpft oder hinzugegeben werden, dait dies erreicht wird.?
4 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 4 Aufgabe : Zeit: 11 Min. Der in Abb..1 dargestellte Schwiponton trägt ein Offshore-Baugerät. Der syetrische Ponton verfügt über vier zylindrische Schwikörper (Durchesser D = 0 ). Die Gesatasse des Pontons beträgt t und das Flächenträgheitsoent beträgt I0 =, Die vier Schwikörper weisen eine Höhe von hschwi = 60 auf (siehe Abb..1). Gegeben: = t I0 =, b = 115 D = 0 ρw = 1000 kg/³ a = 10 L = 75 g = 9,81 /s² hschwi = 60 a) Querschnitt b) Draufsicht b D a b L b t L h schwi L D Abb..1: Syetrischer Ponton auf vier kreiszylindrischen Schwikörpern (nicht aßstabsgerecht): a) Querschnitt, b) Draufsicht a) Wie groß ist die Eintauchtiefe t der Schwikörper? b) Berechnen Sie den Körperschwerpunkt des Pontons. Dabei können die Aufbauten auf der Plattfor vernachlässigt werden. Bestien Sie anschließend die etazentrische Höhe hm. Sollte Aufgabenteil a) nicht berechnet worden sein, nehen Sie bitte eine Eintauchtiefe t von 40 an. c) Wie beurteilen Sie die Schwilage des Pontons?
5 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 5 Aufgabe 3: Zeit: 10 Min. Ein Wagen fährt it der Beschleunigung a, parallel zur Rape, einen gefüllten Wassertank auf einer u α= 30 geneigten Rape hinab (siehe Abb.3.1). Der Wassertank ist bis zu einer Wasserhöhe von h = 1,7 gefüllt. Gegeben: ρw = 1000 kg/³ g = 9,81 /s² L = 10,0 α = 30 H = 0,3 h = 1,7 a = 0,54 /s² L = 10,0 Druckessdose (DMD) ρ w = 1000 kg/ 3 H = 0,3 h = 1,7 a Rape α=30 Abb. 3.1: Wagen it Wassertank auf einer Rape herunter (nicht aßstabsgerecht) a) Wie groß ist die vertikale und horizontale Beschleunigung des Wassers, wenn der Wagen aus de Ruhezustand it der Beschleunigung a die Rape herunterrollt? Wie hoch ist die zu erwartende Auslenkung e des Wasserspiegels an der Behälterwand? Schwappt Wasser aus de Tank? b) Berechnen Sie den Druck an der Position der Druckessdose (DMD) in der linken Ecke des beschleunigten Behälters. Falls Sie Aufgabenteil a) nicht gelöst haben sollten, nehen Sie eine Auslenkung e von c und eine vertikale Beschleunigung ay = 0,7 /s² an.
6 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 6 Aufgabe 4: Zeit: 5 Min. Aus eine sehr großen Wasserbehälter it freier Oberfläche und konstante Wasserspiegel (v0 = 0) wird durch eine Rohrleitung (Durchesser D1) Wasser entnoen. Der Ausfluss a unteren Ende der Rohrleitung kann durch den Anbau eines Diffusors reguliert werden. Ein Diffusor ist ein Bauteil, das in Fließrichtung den Querschnitt vergrößert (von D1 auf D3). (siehe Abb. 4.1) Für diese Aufgabe kann die Ströung als reibungs- und verlustfrei betrachtet werden. Gegeben: v0 = 0 /s ρw = 1000 kg/³ g = 9,81 /s² H = 7,50 h1 = 3,00 h = 0,80 D1 = 0,5 D3 = 0,30 RWS v 0 =0 sehr großer Wasserbehälter h 1 = 3,00 Punkt 1 1 h = 0,80 H = 7,50 D 1 Punkt Diffusor 3 D 3 D 1 Punkt 3 Abb. 4.1: Wasserbehälter it Rohrleitung und optiale Diffusor (nicht aßstabsgerecht) a) Berechnen Sie die Geschwindigkeiten v und die Drücke p in den Punkten 1 und sowie den Ausfluss Q vor Anbau des Diffusors. b) Berechnen Sie die Geschwindigkeiten v und die Drücke p in den Punkten und 3 nach Anbau des Diffusors.
7 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 7 c) Ist die Anordnung in Aufgabenteil b) öglich, ohne dass es in der Rohrleitung zu Kavitation kot? Beantworten Sie diese Frage bitte zunächst anhand der von Ihnen bereits durchgeführten Berechnungen und begründen Sie Ihre Antwort. Kennzeichnen Sie die Stelle in der Rohrleitung in Abb. 4.1, an der die Gefahr für das Auftreten von Kavitation a größten ist. Begründen Sie Ihre Antwort stichwortartig. Sollte Kavitation auftreten, dann schlagen Sie eine Änderung an de Syste vor, so dass Kavitation verieden wird. An die Wasserleitung an Punkt wird statt eines Diffusors ein düsenföriges Endstück it sechs Schrauben angeflanscht, das den Rohrdurchesser von D1 auf DD verkleinert (siehe Abb. 4.). Die wirkenden Kräfte sind gleichäßig auf die Schrauben verteilt. Nehen Sie an, dass der Ausfluss ins Freie Q = 5 l/s beträgt. d) Berechnen Sie die auf die Flanschverbindung wirkende Kraft, die durch eine einzelne Schraube aufgenoen wird. Reibungsverluste und Gewichtskräfte sind zu vernachlässigen. Gegeben: D1 = 50 ρw = 1000 kg/³ DD = 40 g = 9,81 /s² = 400 kg Q = 5 l/s e = 0,8 L = 1 A Flansch it Schraubverbindung (6 Schrauben) e L D 1 D D Q Punkt Punkt D Abb. 4.: Rohr it angeflanschte, düsenförige Auslassrohr und drehbar gelagerte Platte (nicht aßstabsgerecht)
8 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 8 Nach de Austritt aus der Düse trifft der Wasserstrahl auf eine an der Oberkante A drehbar gelagerte Platte. Die Platte hat eine Länge von L = 1, eine gleichäßig verteilte Masse von = 400 kg und wird in einer vertikalen Entfernung vo Drehpunkt A von e = 0,8 vo Wasserstrahl getroffen. e) Berechnen Sie den Auslenkwinkel, u den die Platte durch den Wasserstrahl ausgelenkt wird. Sollte die Stützkraft SD aus Aufgabenteil d) nicht errechnet worden sein, nehen Sie hierfür ein SD von 500 N an.
9 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 9 Aufgabe 5: Zeit: 19 Min. An eine kleinen Hafen soll eine Anlage zur Befüllung der Schiffe it Frischwasser installiert werden. Dabei soll das Wasser ittels einer Pupe durch ein Druckrohrsyste it freie vertikalen Auslauf aus eine sehr großen Wassertank bei freier Wasseroberfläche (v0 = 0) auf das angelegte Schiff gefördert werden (siehe Abb. 5.1). Sie werden als planender Ingenieur it der Diensionierung der Anlage beauftragt. Gegeben: w = 1000 kg/³ g = 9,81 /s² = 10-6 ²/s E = 0,5 K = 0,3 VTank = 300 ³ k1=k3 = 0,10 k = 0,0 = 0,8 D1 = 0,50 D = 0,40 D3 = 0,0 4,00 5,00 K k 1 p p Pupe k K D 1 D,00 k 3 Q D 3 A =0 4,00 D 1 k 1 Sehr großer Wassertank (it freier Wasseroberfläche) p 0 =0 9,00 K k 1 D 1,00 E v 0 =0 6,00 Frischwassertank Schiff Abb. 5.1: Anlage zur Befüllung der Frischwassertanks von Schiffen (nicht aßstabsgerecht)
10 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Die Anlage soll so beessen werden, dass ein Frischwassertank it eine Voluen von 300 ³ innerhalb von 5 Minuten befüllt werden kann. a) Berechnen Sie den erforderlichen Durchfluss Q in de Syste (siehe Abb. 5.1). b) Berechnen Sie die erforderliche anoetrische Förderhöhe han. c) Berechnen Sie die erforderliche Bruttoleistung der Pupe. Der Wirkungsgrad der Pupe beträgt = 80 %. d) Welcher Druck pp in [Pa] ergibt sich direkt hinter der eingebauten Pupe (siehe Abb. 5.1)? Hinweis: Es ist auch eine Lösung ohne Teilaufgabe b) öglich!
11 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Abb. 5.: Moody-Noogra
12 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 1 Aufgabe 6: Zeit: Min. Der in Abbildung 6.1 dargestellte Fließgewässerquerschnitt hat eine Wassertiefe von h = 1,80. A rechten Ufe schließt eine senkrechte Wand an, die eine Straße begrenzt. Die Neigung des linken Ufers beträgt 1:. Oberhalb dieser Böschung befindet sich eine Bluenwiese. Der Abflussbeiwert von Strickler über den gesaten benetzten Ufang des Fließquerschnitts beträgt kst = 0 1/3 /s und die Sohlneigung beträgt 37. Gegeben: h = 1,80 b = 5,00 g = 9,81 /s² kst = 0 1/3 /s I = 37 1: h1, 80 b 5, 00 Abb. 6.1: Fließquerschnitt A it Bluenwiese (nicht aßstabsgerecht) a) Berechnen Sie den Abfluss Q und die dazugehörige ittlere Fließgeschwindigkeit v für die vorliegende Wassertiefe h = 1,80. b) Bestien Sie den spezifischen Durchfluss q des Flussquerschnittes A unter Verwendung der ittleren Gewässerbreite. Sollte Qges aus Aufgabenteil a) nicht berechnet worden sein, nehen Sie hierfür 50 ³/s an. c) Der Fließzustand in Fließquerschnitt A befindet sich i Grenzzustand. Berechnen Sie hgr und vgr und tragen Sie die Werte hgr und vgr²/g in das Diagra der Energiehöhe für konstanten Abfluss q (Abb. 6.) ein. Sollte q in Aufgabenteil b) nicht berechnet worden sein, kann q = 7,5 ³/(s) angenoen werden.
13 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ h E [] 4,0 q=konst. 3,0,0 1,0 0 1,0,0 3,0 4,0 h [] Abb. 6.: Diagra der Energiehöhen he=f(h) für konstanten Abfluss q d) Wie groß ist die Fließgeschwindigkeit bei einer Wassertiefe h = 1 nach de Diagra in Abb. 6. und wie groß ist die Gesatenergie in de Syste? Welcher Fließzustand liegt vor? Nutzen Sie das Diagra in Abb. 6. und zeichnen Sie die Werte ein. e) Wie groß ist die Wassertiefe des Flusses bei einer Gesatenergie von 3,3 i ströenden Zustand? Nutzen Sie auch hier Abb. 6. und zeichnen Sie den Fall in das Diagra it ein. f) Wie werden die beiden Wassertiefen genannt, die bei der Energiehöhe von 3,3 abgelesen werden?
14 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Untersuchungen haben ergeben, dass in Zukunft deutlich höhere Abflüsse Q zu erwarten sind, da Kühlwasser aus eine Kraftwerk zugeführt werden soll. Wegen der vorhandenen Straße oberhalb des rechten Ufers kann lediglich an der linken Uferseite der Fließquerschnitt erweitert werden. Die axial ögliche Wassertiefe auf de neu geschaffenen Vorland (siehe Abb. 6.3) darf den Wert hv = 1,00 nicht überschreiten, da es ansonsten zur Überschweung der Straße koen könnte. Gegeben: h = 1,80 hv = 1,00 g = 9,81 /s² kst = 0 1/3 /s kst,v = 1 1/3 /s I =37 b = 5,00 Qax = 10,00 ³/s Vorland Hauptgerinne 1:3 bv hv 1, 00??? 1: h1,80 b 5, 00 Abb. 6.3: Fließquerschnitt B it Vorland (nicht aßstabsgerecht) g) Welche Breite bv uss das Vorland haben, dait ein Abfluss von Qax = 10,00 ³/s it hv = 1,00 abgeführt werden kann. Der Stricklerbeiwert kst,v i Vorland kann it 1 1/3 /s angesetzt werden. Welche Fließgeschwindigkeiten treten jeweils i Hauptgerinne (it kst = 0 1/3 /s) und i Vorland auf? (Sollte bei Ihren Berechnungen eine Iteration erforderlich sein, brechen Sie diese nach drei Berechnungsschritten ab!)
15 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Aufgabe 7: Zeit: 19 Min. An eine Stausee wird der Wasserstand auf h1 = 4,8 aufgestaut, während sich ein Wasserstand des Gewässers unterhalb bei h = 1, einstellt. Die Bodenschichten an der Stauauer werden durch den Potentialunterschied zwischen Ober- und Unterwasser durchströt. In der Systeskizze in Abb sind das Bauwerk und die Bodenschichten dargestellt. Gegeben: h1 = 4,8 h = 1, ρwasser = 1000 kg/³ d50,a = 4,0 kf,a = /s kf,b =, /s h 1 = 4,8 1,5 S B = 0,5 S A = 6,0 Boden B Boden A k f,b =, /s k f,a = /s,5 1,5 5,0 5,0 h = 1, Boden B Boden A undurchlässig Abb. 7.1: Systeskizze der Stauauer it Bodenschichtung der Gründung (nicht aßstabsgerecht) a) Welchen Annahen unterliegt die Darcy-Gleichung? Nennen Sie drei Stichpunkte. b) Erläutern Sie die Begriffe lainare Ströung und turbulente Ströung. c) In welche Anordnungen der Bodenschichten zueinander kann in Bezug auf die Ströungsrichtung unterschieden werden? Nennen Sie die Fachbegriffe und erklären Sie diese kurz. d) Eritteln Sie den kürzesten Sickerweg L, zeichnen Sie diesen in Abb. 7.1 it der Fließrichtung ein und beaßen Sie die Skizze.
16 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ e) Bestien Sie den äquivalenten Durchlässigkeitsbeiwert kf,äq der beiden Bodenschichten A und B it den Durchlässigkeitsbeiwerten kf,a und kf,b für den Sickerweg aus Aufgabe d). Sollte Aufgabenteil d) nicht gelöst werden, können folgende Werte angenoen werden: Lges = kürzester Sickerweg = 1,0 it LA = 10 und LB = f) Eritteln Sie die Sickerwasserenge Q pro laufende Meter unter der Stauauer nach Darcy unter der Annahe, dass die Wasserstände h1 und h sowie die Durchströung der Bodenschichten stationär sind. Sollte der Aufgabenteil e) nicht gelöst werden können, kann eine äquivalenter Durchlässigkeitsbeiwert von kf,äq = 3, /s angenoen werden. g) Schlagen Sie zwei Maßnahen zur Vereidung des hydraulischen Grundbruchs vor. h) Wie verhalten sich der hydraulische Gradient, der Durchlässigkeitsbeiwert kf und die Filtergeschwindigkeit vf zueinander? Kreuzen Sie in der Tabelle an (fünf Kreuze!). Veränderung größer gleich geringer Wie verhält sich der hydraulische Gradient i, wenn sich der Ströungszustand von lainar auf turbulent ändert? Wie verhält sich der Durchlässigkeitsbeiwerts eines Bodens, wenn die Schichtdicke zunit? Wie verhält sich der Durchlässigkeitsbeiwert kf,a, wenn der charakteristische Korndurchesser d10 durch Materialulagerung kleiner wird? Wie verhält sich die Filtergeschwindigkeit vf it steigender Teperatur? Wie verhält sich der kritische hydraulische Gradient ikrit, wenn die Lagerungsdichte des Bodens zunit?
17 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Musterlösung Aufgabe 1 1a) Hydrostatische Druckverteilung an der Oberfläche des Modells: RWS A h 1 = 0,4 h 0 = 0,3 C B Modell D h = 0,1 l 4 = 0, l 3 = 0,6 l = 0,3 l 1 = 0,1 Boden 1b) Berechnung der Drücke in den Punkten B, C und D. Berechnung des hydrostatischen Drucks: p g h w Druck i Punkt B und C: h 0,30,1 0, B h h 0, C p B kg N ,81 0, 196 bzw. Pa s BC, Druck i Punkt D: hd 0,3 kg N pd ,81 0,3 943 bzw. Pa s
18 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ c) Bestiung der resultierenden Kräfte. Abschnitt A-B: lab (0, ) (0, ) 0,83 kn kn FAB0,5 pblab0,5 1,96 0,83 0,77 Abschnitt B-C: l BC 0,6 kn kn FBC pblbc1,96 0,6 1,177 Abschnitt C-D: lcd (0, ) (0,1 ) 0,4 kn kn FC D, Rechteck pc lc D 1,96 0,4 0,44 kn kn kn FC D, Dreieck 0,5 ( pd pc ) lc D 0,5,943 1,96 0,4 0,11 Nur Abschnitt B-C uss nachgebessert werden, da dort die axiale Kraft von 1 kn/ überschritten wird. 1d) Berechnung der Kraft i Punkt D: FD p A Berechnung der Fläche: D (0,4 ) A 0,16 4 4
19 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Berechnung des Druckes i Punkt D: kg N p pd gh ,81 0,3 943 s 0 N FD 943 0,16 370,8 N 0,37kN Berechnung der Wasserhöhe: D 0,3kN A p g h 4 kg N h s 300 0, ,81 h 0,4 Berechnung der Differenz der Wasserhöhen: 0,30,4 0,06 Es üssen 0,06 Wasser abgeschöpft werden u eine optiale Abdichtung zu gewährleisten.
20 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 0 Musterlösung Aufgabe a) Berechnung der Eintauchtiefe t. Gewichtskraft: 6 FG g [ kg] 9,81[ / s²] N 490,5 10 N Auftriebskraft: F V V V D g 4 4 t g FG F V 6 (0 ) 490,510 N 4 t1000 kg / ³ 9,81 / s² ,510 N t kg s (0 ) 1000 / ³ 9,81 / ² 39,789 b) Berechnung der etazentrische Höhe hm. Berechnung des Körperschwerpunkts hs: D² 1 4 ² ( /) V Schwi Schwi Schwi i S h h a b h a y, i h 4 s V D² i 4 hschwi ab² 4 (0 )² (115 )² 65 5, 91 (0 )² 6010 (115 )² Verdrängtes Wasservoluen VA: D (0) VV 4 t 4 39, ,956³ ³ 4 4 Abstand zwischen Körper- und Verdrängungsschwerpunkt hk: t hk hs hv hs 5, 9119,8943,397
21 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 1 Metazentrische Höhe hm: 6 I0, 410 hm hk 3,39715, 60 V ,956 ³ V c) Schwilage hm > 0 stabile Schwilage
22 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 Musterlösung Aufgabe 3 3a) Vertikale und horizontale Beschleunigung des Wassers, wenn der Wagen die Rape herunterfährt. L = 10,0 Druckessdose (DMD) ρ w = 1000 kg/ 3 H = 0,3 h = 1,7 30 Rape α=30 Aus der gesaten Beschleunigung kann nun der Anteil der horizontalen und vertikalen Beschleunigung errechnet werden. a a cos( ) 0,54 cos(30 ) 0, 47 / s² a x a asin( ) 0,54 sin(30 ) 0, 7 / s² a y horizontal vertikal Aus den Beschleunigungsanteilen, der Länge des Tanks und der Erdbeschleunigung lässt sich die zu erwartende Auslenkung e des Wassers berechnen.
23 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 3 L = 10,0 e ax ay H = 0,3 g h = 1,7 30 a ax e ax ( L /) e gay L/ gay 0,47 / s² (10 / ) e 0,46 4,6c 9,81 / s² 0, 7 / s² 4,6 c < 30 c Es schwappt kein Wasser aus de Behälter. 3b) Druck an der Druckessdose in der linken Ecke. p ( ga ) ( he) DMD y p 1000 kg / ³ (9,81 / s² 0, 7 / s²) (1, 70, 46 ) 18564,84 Pa DMD
24 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 4 Musterlösung Aufgabe 4 4a) Berechnung der Geschwindigkeiten v1 und v sowie der Drücke p1 und p ohne Diffusor: RWS Schnitt 0 v 0 =0 sehr großer Wasserbehälter h 1 = 3,00 Schnitt 1 1 h = 0,80 H = 7,50 Punkt 1 D 1 Bezugshorizont Punkt D 1 Schnitt Bernoulli-Gleichung für die Schnitte 0, 1 und und Berechnung von v: Freie Oberfläche und freier Ausfluss: p0=0, p=0, Bezugshöhe h=0 auf Höhe der Rohrachse i Ausfluss: z= 0, z0=7,5, z1=3,7 0 0 v0 p 7,5 0 v1 p 3,7 1 v p z 0 z1 z 0 he konst. 7,5 g g g g g g v 7,5 v g7,5 1,131 (entspricht Forel nach Toricelli) g s Berechnung des Durchflusses it v: (0,5 ) QvA1,131 / s 0,595 s 3 Laut Konti-Gleichung sind die Geschwindigkeiten in den Punkten 1 und konstant, da gleiche Rohrdurchesser vorliegen, Berechnung von v1 und p1 bzw. v und p: 0
25 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ ,131 ² p s p v1 v konst s g g g p Pa, p ,13 7,5 3,7 3,7, 4b) Berechnung der Geschwindigkeiten v und v3 sowie der Drücke p und p3 it Diffusor: RWS Schnitt 0 v 0 =0 sehr großer Wasserbehälter h 1 = 3,00 Punkt 1 1 h = 0,80 H = 7,50 D 1 Bezugshorizont Diffusor Punkt 3 D 3 D 1 Punkt Schnitt Schnitt 3 Bernoulli-Gleichung für die Schnitte 0, und 3 und Berechnung von v3: Freie Oberfläche und freier Ausfluss: p0=0, p3=0. Der Bezugshorizont für die Energiehöhen wird bei z=z3=0, d.h. auf Höhe der Rohrachse i Ausfluss: z0=7, v0 p 7,5 0 v p 0 v3 p3 z 0 z z 0 3 he konst. 7,5 g g g g g g v3 7,5 v3 g7,5 1,131 (entspricht Forel nach Toricelli) g s (trotz der größeren Austrittsöffnung ist die Austrittsgeschwindigkeit identisch it der aus Aufgabenteil a). Aufgrund des größeren Querschnitts ist jedoch der Durchfluss größer.) Berechnung des Durchflusses it v3: (0,3 ) QvA1,131 / s 0,857 s 3. Die Geschwindigkeit i Punkt uss it der Konti-Gleichung berechnet werden, da in den Punkten 1 und verschiedene Rohrdurchesser vorliegen, Berechnung von v und p:
26 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 6 A 3 (0,3 ) / Q konst. v A v A v v 1,131 / s 17, 469 A (0,5 ) /4 s v p p 15,55 15,55 0 7,5 8, 05, p 78970,5Pa g g g 4c) Auftreten von Kavitation? Die Druckhöhe in Punkt beträgt p/ρg=-8,05 und unterschreitet dait den zulässigen Unterdruck von -7,0. Die Anordnung aus Aufgabenteil b) ist soit nicht öglich, ohne dass Kavitation auftritt. Vo Ausfluss in Punkt 3 aus betrachtet beginnt der Bereich des Unterdrucks i Diffusor it zunehender Querschnittseinengung bis an Punkt. Durch die Verringerung des Querschnitts steigt die Geschwindigkeit und der Druck sinkt auf den in b) berechneten Wert. Der Unterdruck entsteht erst i Rohr durch die große Geschwindigkeitshöhe. Es gibt also einen Bereich in den Kavitation auftreten kann. Dieser Bereich ist die koplette Verengung durch den Diffusor. 4d) Kraft auf die Schrauben i Flansch. A Flansch it Schraubverbindung (6 Schrauben) e L Bezugshorizont D 1 D D Q Schnitt Punkt Schnitt D Punkt D In den Schnitten und D herrschen unterschiedliche Druck- und Geschwindigkeitsverhältnisse, wodurch auch unterschiedliche Stützkräfte in diesen Schnitten wirken. Die Differenz dieser Kräfte uss durch die Schrauben der Flanschverbindung aufgenoen werden. I Schnitt D liegt freier Ausfluss it pd = 0 vor. Die Stützkraft reduziert sich daher auf den Ipuls:
27 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ kg ³ SD Qv pa ,05 19,89 497,5N ³ s s Q 0,05³ / s v Die Ausflussgeschwindigkeit vd beträgt: D 19,89 A D (0,04) s 4 Für die Berechnung der Stützkraft i Schnitt uss zunächst der Rohrinnendruck in Schnitt berechnet werden (it der Bernoulli-Gleichung). Es gilt pd = 0 (freier Ausfluss) und z = zd = 0 (da beide Schnitte auf gleicher Höhe). Q 0,05³ / s Die Geschwindigkeit i Schnitt beträgt: v 0,51 A (0,5) s 4 D D D e v p v p z z h konst. g g g g (0,51 / s) p (19,89 / s) 0 00 g g g p (19,89 / s) (0,51 / s) 0,15 g g g p Pa Dait kann die Stützkraft in Schnitt berechnet werden: kg ³ (0,5) S Qv pa ,05 0, Pa 9716N ³ s s 4 Die Differenz von S SD = 918,75 N uss durch die 6 Schrauben aufgenoen werden. Jede Schraube uss daher eine Kraft von 1536,46 N aufnehen. 4e) Auslenkungswinkel der vo Wasserstrahl getroffenen Platte Die Platte wird vo austretenden Wasserstrahl getroffen. Die Aufprallkraft entspricht de Ipuls des austretenden Wasser, der bereits in d) zu SD = 497,5 N berechnet wurde. Das durch den Wasserstrahl auf die Platte entstehende Moent u den Drehpunkt A beträgt Sse. Die Platte hat eine Masse von = 400 kg, die i Flächenschwerpunkt bei L/ angenoen werden kann. Durch die Auslenkung der Klappe entsteht durch diese Masse ein Moent, dass it zunehender Auslenkung größer wird. Das Moentengleichgewicht u A führt zur Lösung der Aufgabe:
28 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 8 A L M 0SD eg sin SD e 497,5N 0,8 sin 0,03 g L / 400kg 9,81 / s² 1,0 / 11,70 A L/ e g sinl/ S D
29 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 9 Musterlösung Aufgabe 5 5a) Berechnung des erforderlichen Durchflusses: Vorgabe: 300 ³ in 5 Minuten 300 Q 0, ³ / s 560 5b) Bernoulli-Gleichung zwischen de konstanten freien Wasserspiegel i Tank und de freien Ausfluss v p v p g g g g z 0 h an z 3 h i hr Berechnung der Fließgeschwindigkeiten it Q = 0, ³/s Q 40, ³/ s v1 1, 0 / s A (0,5 ) v v Q 40, ³/ s 1, 59 / s A (0,4 ) Q 40, ³/ s 6,37 / s A (0, ) 3 Einzelverluste v v v v v g g g g g i i i E K K K h hi (1, 0 / s) (1, 59 / s) (6, 37 / s) (0,5 0,3) 0,3 0,3 0, 70 9,81 / s² 9,81 / s² 9,81 / s² Streckenverluste Rohr 1: vd 1, 0 / s 0,5 Re 5, ² / s k 0,1 10 D Moody-Diagra = 0,0155 5
30 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Rohr : vd 1,59 / s0, 4 Re 6, ² / s k 0,0 510 D Moody-Diagra = 0,013 5 Rohr 3: vd 6,37 / s0, Re 1, ² / s k 0,1 510 D 00 4 Moody-Diagra = 0,017 6 v L i g D h i i r i (1, 0 / s) 44 (1,59 / s) 5 (6,37 / s) 0, , 013 0, 017 0,389 9,81 / s² 0,5 9,81 / s² 0,4 9,81 / s² 0, Berechnung der anoetrischen Förderhöhe (z = 0 i Wasserspiegel des Tanks): v0 g p 0 g z 0 v3 p3 han g g z h h 3 i r (6,37 / s) han 1, 00, 700,3894,155 9,81 / s² 5c) Erforderliche Pupenleistung PB 1 1 PB gqhan 1 t / ³ 9,81 / s ² 0, ³ / s 4,155 10,19 kw 0,8 5d) Bernoulli-Gleichung zwischen den Schnitten 3 und p direkt hinter der Pupe v p v p 1 g g g g p 3 3 zp z3 hi hr
31 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ p p 0, 053 3, 0, , 0 hi hr g Einzelverluste hinter der Pupe: (6,37 / s) hi 0,3 0,6 9,81/s² Streckenverluste hinter der Pupe: vi L (1,0/s) 4 (6,37/s) h 0, , 017 0,36 g D 9,81 / s² 0,5 9,81 / s² 0, r i p p, , 0 0, 6 0,36 3, 0 0, 053 0,995 g pp 0,995 g p 9760,95Pa p
32 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/015 3 Musterlösung Aufgabe 6 6a) Die Fließforel nach Gaukler/Manning/Strickler lautet: QAk R I st /3 1/ Der Fließquerschnitt besteht aus zwei Teilen: 1: 1 h1, 80 b 5, 00 A 1 1 1,8 3, 6 3,4² U 1,8² 3,6² 4,03 A 5,01,89² U 5 1,8 6,8 A gesat gesat 1,4² U 10,83 Der kst-wert ist gegeben und beträgt 1/3 0 / s. Der hydraulische Radius ergibt sich aus de gesaten benetzten Ufang U und de gesaten Fließquerschnitt A: Ages R U ges 1,4² R 1,13 10,83
33 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Die Sohlneigung I = 37 Dait ergibt sich die Durchflussenge Q zu: 1/3 /3 Q 1,4 ² 0 / s 1,13 0,037 51,09 ³ / s Und die ittlere Fließgeschwindigkeit v über den Fließquerschnitt A: Q 51,09³/s v 4,17/s A 1,4² ges 6b) Spezifischer Durchfluss. Gewässerbreite bei h/: 1,8 b 5, 0 6,8 Q 51,09 ³ / saus a) ³ qq/ b 51, 09 / 6,8 7,51 ³ / s s 6c) I Querschnitt wird Grenzzustand angenoen. h gr q g 7,51 9, , 8 Bestiung der kritischen Fließgeschwindigkeit, die bei der Grenzwassertiefe hgr auftritt. v h g 1,8 9,81 4, / s gr vgr gr ² (4, / s)² 0,9 g 9,81 / s²
34 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ h E [] 4,0 q=konst. 3,0 h E,in,0 v gr ² 0,9 g h gr = 1,8 1,0 0 1,0,0 3,0 4,0 1,8 h [] 6d) Wie groß ist die Fließgeschwindigkeit bei h = 1? Es werden die Wassertiefe und die Geschwindigkeitshöhe eingetragen. h E [] 4,0 3,3 q=konst. h E = 3,3 3,0,0 v ² 1 g 1,0 h 1 0 1,0,0 3,0 4,0 h []
35 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ v ² h h 3,3 1,3 1 E 1 g v1,3g,39,81 / s² 6, 7 / s Die Energiehöhe beträgt he = 3,3. Es herrscht schießender Abfluss. 6e) Die Energiehöhe beträgt he = 3,3. h E [] 4,0 q=konst. 3,3 3,0 v ² g,0 h 1,0 0 1,0,0 3,0 4,0 h [] Die Wassertiefe i ströenden Zustand beträgt bei einer Energiehöhe von 3,3,85. 6f) Konjugierte Wassertiefen
36 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ g) Fließquerschnitt des Hauptgerinnes lässt sich problelos berechnen: Vorland Hauptgerinne 1:3 bv hv 1, 00??? 1: h 1, 80 b 5, 00 AHaupt Ages h v (hb) 1,4² 1 (3,65) 0,84² U U h 10,83 1, 0 1,83 Haupt ges v 0,84 ² R 1,6 1,83 1/3 /3 ³ Q 0,84 ² 0 1, 6 0, ,59 s Mit einer Fließgeschwindigkeit von Q 110,59 ³ / s v 5,31/s A 0,84² s Daraus folgt, dass auf de Vorland noch werden üssen. 31 AVorl 1bv bv 1,5 U b (3)² 1 ² b 3,16 Vorl v v ³ ³ ³ Q ,59 9,41 abgeführt s s s 31 1/3 1bv ³ 3 1 Q 9,41 1 bv 1 0,037 s s b v (3)² 1 ² b 3, 44 v Mit einer Fließgeschwindigkeit von Q 9,41³/s v 1,9/s A 3 1 3, 44 1 /3
37 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ Musterlösung Aufgabe 7 7a) Darcy-Gleichung Lainare Ströung Re 4-5 Stationäre Ströung hoogenes poröses Mediu isotropes poröses Mediu 7b) Lainare Ströung: Turbulente Ströung: Die Strolinien verlaufen parallel, die Reynoldszahl liegt i Bereich Re < 4-5 Es treten Verwirbelungen auf, die Reynoldszahl liegt i Bereich von Re > 4-5 7c) Bei der Anordnungen von Bodenschichten zueinander kann in Bezug auf die Ströungsrichtung wie folgt unterschieden werden: Reihenschaltung: Die Materialien werden hintereinander in Ströungsrichtung durchströt Parallelschaltung: Die Materialien werden parallel in Ströungsrichtung durchströt 7d) Der kürzeste Sickerweg L ergibt sich wie folgt: Sickerweg L: L = 5,0 +,5 + 5,0 = 1,5
38 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ h 1 = 4,8 1,5 S B = 0,5 S A = 6,0 Boden B Boden A k f,b =, /s k f,a = /s 5,0,5 1,5 5,0 5,0 h = 1, Boden B Boden A undurchlässig 7e) Äquivalenter Durchlässigkeitsbeiwert (Reihenschaltung) k f, äq Lges 1,50 L1 L 5,00,5,5 0,50 k 4 f1 kf 310 / s,510 / s 3,85 10 / Der äquivalente Durchlässigkeitsbeiwert beträgt kf,äq =, /s. s 7f) Berechnung der Sickerwasserenge Q pro Meter unter der Stauauer. k f.äq L vf h ges Δh = 4,8-1, = 3,6 v h 3 3, 6 4 k,8510 8,110 L s 1,5 s f,1 f, äq 4 3 Q vf A8,110 / s1,5 ² 1,310 ³ / s Die Sickerwasserenge beträgt Q = 1, ³/s pro Meter des Bauwerks.
39 Bachelorklausur Hydroechanik WS 014/ g) Der hydraulische Grundbruch kann durch folgende Maßnahen verhindert werden: Änderung der Auflast auf der Unterwasserseite Änderung der Durchlässigkeit durch Austausch des Bodens Verlängerung des Sickerwegs durch eine größere Einbindetiefe des Bauwerks Abdichtung unterhalb des Bauwerks bis zur undurchlässigen Bodenschicht 7h) Veränderung größer gleich geringer Wie verhält sich der hydraulische Gradient i, wenn sich der Ströungszustand von lainar auf turbulent ändert? x Wie verhält sich der Durchlässigkeitsbeiwerts eines Bodens, wenn die Schichtdicke zunit? x Wie verhält sich der Durchlässigkeitsbeiwert kf,a, wenn der charakteristische Korndurchesser d10 durch Materialulagerung kleiner wird? x Wie verhält sich die Filtergeschwindigkeit vf it steigender Teperatur? x Wie verhält sich der kritische hydraulische Gradient ikrit, wenn die Lagerungsdichte des Bodens zunit? x
WS 2009/2010. Prüfungstermin: 20. Februar 2010 MUSTERLÖSUNG K L A U S U R HYDROMECHANIK I+II
 Technische Universität Braunschweig Leichtweiß-Institut für Wasserbau Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci WS 009/010 Prüfungstermin: 0. Februar 010 MUSTERLÖSUNG
Technische Universität Braunschweig Leichtweiß-Institut für Wasserbau Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci WS 009/010 Prüfungstermin: 0. Februar 010 MUSTERLÖSUNG
Hydromechanik Teilaufgabe 1 (Pflicht)
 Teilaufgabe 1 (Pflicht) Für die Bemessung eines Sielbauwerkes sollen zwei verschiedene Varianten für einen selbsttätigen Verschluss der Breite t untersucht werden. Beide sind im Punkt A drehbar gelagert:
Teilaufgabe 1 (Pflicht) Für die Bemessung eines Sielbauwerkes sollen zwei verschiedene Varianten für einen selbsttätigen Verschluss der Breite t untersucht werden. Beide sind im Punkt A drehbar gelagert:
Aufgaben Hydraulik I, 21. August 2009, total 150 Pkt.
 Aufgaben Hydraulik I, 21. August 2009, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Klappe (13 Pkt.) Ein Wasserbehälter ist mit einer rechteckigen Klappe verschlossen, die sich um die Achse A-A drehen kann. Die Rotation
Aufgaben Hydraulik I, 21. August 2009, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Klappe (13 Pkt.) Ein Wasserbehälter ist mit einer rechteckigen Klappe verschlossen, die sich um die Achse A-A drehen kann. Die Rotation
Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt.
 Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Hydrostatik (13 Pkt.) Eine senkrechte Wand trennt zwei mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllte Behälter der selben Grundfläche (Breite
Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Hydrostatik (13 Pkt.) Eine senkrechte Wand trennt zwei mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllte Behälter der selben Grundfläche (Breite
Klausur Strömungsmechanik 1 WS 2009/2010
 Klausur Strömungsmechanik 1 WS 2009/2010 03. März 2010, Beginn 15:00 Uhr Prüfungszeit: 90 Minuten Zugelassene Hilfsmittel sind: Taschenrechner (nicht programmierbar) TFD-Formelsammlung (ohne handschriftliche
Klausur Strömungsmechanik 1 WS 2009/2010 03. März 2010, Beginn 15:00 Uhr Prüfungszeit: 90 Minuten Zugelassene Hilfsmittel sind: Taschenrechner (nicht programmierbar) TFD-Formelsammlung (ohne handschriftliche
Zusammenfassung 23.10.2006, 0. Einführung
 Zusammenfassung 23.10.2006, 0. Einführung - Umrechnung der gebräuchlichen Einheiten - Teilung/Vervielfachung von Einheiten - Kenngrößen des reinen Wassers (z.b. Dichte 1000 kg/m 3 ) Zusammenfassung 30.10.2006,
Zusammenfassung 23.10.2006, 0. Einführung - Umrechnung der gebräuchlichen Einheiten - Teilung/Vervielfachung von Einheiten - Kenngrößen des reinen Wassers (z.b. Dichte 1000 kg/m 3 ) Zusammenfassung 30.10.2006,
Kraft- und Arbeitsmaschinen Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 26. Juli 2006
 Kraft- und Arbeitsmaschinen Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 26. Juli 2006 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 7 nummerierte Seiten; Die Foliensammlung, Ihre Mitschrift der Vorlesung
Kraft- und Arbeitsmaschinen Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 26. Juli 2006 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 7 nummerierte Seiten; Die Foliensammlung, Ihre Mitschrift der Vorlesung
Hydrostatik Mechanik von Fluiden im statischen Gleichgewicht. Fluide: Stoffe, die sich unter Einwirkung von Schubspannungen fortlaufend deformieren
 Hydrostatik Mechanik von Fluiden im statischen Gleichgewicht Fluide: Stoffe, die sich unter Einwirkung von Schubspannungen fortlaufend deformieren in ruhendem Fluid können keine tangentialen Spannungen
Hydrostatik Mechanik von Fluiden im statischen Gleichgewicht Fluide: Stoffe, die sich unter Einwirkung von Schubspannungen fortlaufend deformieren in ruhendem Fluid können keine tangentialen Spannungen
Physik 1 MW, WS 2014/15 Aufgaben mit Lösung 7. Übung (KW 05/06)
 7. Übung KW 05/06) Aufgabe 1 M 14.1 Venturidüse ) Durch eine Düse strömt Luft der Stromstärke I. Man berechne die Differenz der statischen Drücke p zwischen dem weiten und dem engen Querschnitt Durchmesser
7. Übung KW 05/06) Aufgabe 1 M 14.1 Venturidüse ) Durch eine Düse strömt Luft der Stromstärke I. Man berechne die Differenz der statischen Drücke p zwischen dem weiten und dem engen Querschnitt Durchmesser
Aufgabensammlung. Kurzbeschreibung. Aufgabe. x ) ax 4 + b und a,b IR beschrieben werden, die Form der Oberseite durch eine quadratische Funktion g.
 Geeinsae Abituraufgabenpools der Länder Aufgabensalung Aufgabe für das Fach Matheatik Die Aufgabe zeigt exeplarisch die Anforderungen einer Aufgabe in einer eigenständigen Abiturprüfung zur Fachrichtung
Geeinsae Abituraufgabenpools der Länder Aufgabensalung Aufgabe für das Fach Matheatik Die Aufgabe zeigt exeplarisch die Anforderungen einer Aufgabe in einer eigenständigen Abiturprüfung zur Fachrichtung
Physikalisch-Chemisches Grundpraktikum
 Physikalisch-Cheisches Grundpraktiku Versuch Nuer G3: Bestiung der Oberflächen- spannung it der Blasenethode Gliederung: I. Aufgabenbeschreibung II. Theoretischer Hintergrund III. Versuchsanordnung IV.
Physikalisch-Cheisches Grundpraktiku Versuch Nuer G3: Bestiung der Oberflächen- spannung it der Blasenethode Gliederung: I. Aufgabenbeschreibung II. Theoretischer Hintergrund III. Versuchsanordnung IV.
STRÖMUNG KOMPRESSIBLER MEDIEN
 STRÖMUNG OMPRESSIBLER MEDIEN Bei den bisher durchgeführten Exerienten hat an ier die Dichte des ströenden Medius als konstant angesehen. Dies ist jedoch nur bei Flüssigkeiten ohne Risiko öglich. Bei der
STRÖMUNG OMPRESSIBLER MEDIEN Bei den bisher durchgeführten Exerienten hat an ier die Dichte des ströenden Medius als konstant angesehen. Dies ist jedoch nur bei Flüssigkeiten ohne Risiko öglich. Bei der
Lernziele zu SoL: Druck, Auftrieb
 Lernziele zu SoL: Druck, Auftrieb Theoriefragen: Diese Begriffe müssen Sie auswendig in ein bis zwei Sätzen erklären können. a) Teilchenmodell b) Wie erklärt man die Aggregatzustände im Teilchenmodell?
Lernziele zu SoL: Druck, Auftrieb Theoriefragen: Diese Begriffe müssen Sie auswendig in ein bis zwei Sätzen erklären können. a) Teilchenmodell b) Wie erklärt man die Aggregatzustände im Teilchenmodell?
Behörde für Bildung und Sport Abitur 2008 Lehrermaterialien zum Grundkurs Mathematik
 Abitur 008 LA / AG II. Abenteuerspielplatz Der Gemeinderat beschlie t, einen eher langweiligen Spielplatz zu einem Abenteuerspielplatz umzugestalten. Das Motto lautet Auf hoher See. Daher soll ein Piratenschiff
Abitur 008 LA / AG II. Abenteuerspielplatz Der Gemeinderat beschlie t, einen eher langweiligen Spielplatz zu einem Abenteuerspielplatz umzugestalten. Das Motto lautet Auf hoher See. Daher soll ein Piratenschiff
Aufgaben. zu Inhalten der 5. Klasse
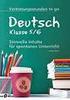 Aufgaben zu Inhalten der 5. Klasse Universität Klagenfurt, Institut für Didaktik der Mathematik (AECC-M) September 2010 Zahlbereiche Es gibt Gleichungen, die (1) in Z, nicht aber in N, (2) in Q, nicht
Aufgaben zu Inhalten der 5. Klasse Universität Klagenfurt, Institut für Didaktik der Mathematik (AECC-M) September 2010 Zahlbereiche Es gibt Gleichungen, die (1) in Z, nicht aber in N, (2) in Q, nicht
Zentralabitur 2011 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung
 Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten, quadratischen
Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten, quadratischen
Füllstand eines Behälters
 Füllstand eines Behälters Der Behälter ist eines der häufigsten Apparate in der chemischen Industrie zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten. Dabei ist die Kenntnis das Gesamtvolumens als auch des Füllvolumens
Füllstand eines Behälters Der Behälter ist eines der häufigsten Apparate in der chemischen Industrie zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten. Dabei ist die Kenntnis das Gesamtvolumens als auch des Füllvolumens
Einführung in die Modellierung: Statische und dynamische Bilanzgleichungen
 Einführung in die Modellierung: Statische und dynamische Bilanzgleichungen Mengenbilanzen: Beispiel 1: Kessel Wirkungsgraph Flussdiagramm Modellgleichungen Statische Mengenbilanz Deispiel 2: Chemische
Einführung in die Modellierung: Statische und dynamische Bilanzgleichungen Mengenbilanzen: Beispiel 1: Kessel Wirkungsgraph Flussdiagramm Modellgleichungen Statische Mengenbilanz Deispiel 2: Chemische
Grundfachklausur Teil 2 / Statik II
 Technische Universität Darmstadt Institut für Werkstoffe und Mechanik im Bauwesen Fachgebiet Statik Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider Grundfachklausur Teil 2 / Statik II im Sommersemester 204, am 08.09.204
Technische Universität Darmstadt Institut für Werkstoffe und Mechanik im Bauwesen Fachgebiet Statik Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider Grundfachklausur Teil 2 / Statik II im Sommersemester 204, am 08.09.204
Druck. Aufgaben. 1. Wie groß ist der Auflagedruck eines Würfels mit der Kantenlänge von 8 cm, der aus Holz gefertigt wurde ( ρ= 0,8 g/cm³)?
 Druck ufgaben. Wie groß ist der uflagedruck eines Würfels it der Kantenlänge von 8 c, der aus Holz gefertigt wurde ( ρ 0,8 g/c³)?. Ein frisches Ei wird it einer Kraft von 0 N auf die Nadelspitze eines
Druck ufgaben. Wie groß ist der uflagedruck eines Würfels it der Kantenlänge von 8 c, der aus Holz gefertigt wurde ( ρ 0,8 g/c³)?. Ein frisches Ei wird it einer Kraft von 0 N auf die Nadelspitze eines
Die Heizungsanlage eines Hauses wird auf Ölfeuerung umgestellt. Gleichzeitig wird mit dieser Anlage Warmwasser aufbereitet.
 Übungsaufgaben zur Wärmelehre mit Lösungen 1) Die Heizungsanlage eines Hauses wird auf Ölfeuerung umgestellt. Gleichzeitig wird mit dieser Anlage Warmwasser aufbereitet. Berechnen Sie die Wärme, die erforderlich
Übungsaufgaben zur Wärmelehre mit Lösungen 1) Die Heizungsanlage eines Hauses wird auf Ölfeuerung umgestellt. Gleichzeitig wird mit dieser Anlage Warmwasser aufbereitet. Berechnen Sie die Wärme, die erforderlich
Klausur 2 Kurs 11Ph1e Physik. 2 Q U B m
 2010-11-24 Klausur 2 Kurs 11Ph1e Physik Lösung 1 α-teilchen (=2-fach geladene Heliumkerne) werden mit der Spannung U B beschleunigt und durchfliegen dann einen mit der Ladung geladenen Kondensator (siehe
2010-11-24 Klausur 2 Kurs 11Ph1e Physik Lösung 1 α-teilchen (=2-fach geladene Heliumkerne) werden mit der Spannung U B beschleunigt und durchfliegen dann einen mit der Ladung geladenen Kondensator (siehe
10.3.1 Druckverlust in Rohrleitungen bei laminarer Strömung (Re < 2320)
 0.3-0.3 Rohrströmung 0.3. Druckverlust in Rohrleitungen bei laminarer Strömung (Re < 30) Bei laminarer Rohrströmung läßt sich der Reibungsverlust theoretisch berechnen, as bei der turbulenten Strömung
0.3-0.3 Rohrströmung 0.3. Druckverlust in Rohrleitungen bei laminarer Strömung (Re < 30) Bei laminarer Rohrströmung läßt sich der Reibungsverlust theoretisch berechnen, as bei der turbulenten Strömung
= 6V 5 A =1,2 ; U V=U ges. =18V 5 A=90W Der Widerstand liegt also in
 Übungsaufgaben Ohsches Gesetz, elektrische Leistung 1) Eine Glühlape für eine Betriebsspannung von 6 Volt und einer Leistung von 30 W soll an eine Spannungsquelle it 4 Volt angeschlossen werden. Zeichne
Übungsaufgaben Ohsches Gesetz, elektrische Leistung 1) Eine Glühlape für eine Betriebsspannung von 6 Volt und einer Leistung von 30 W soll an eine Spannungsquelle it 4 Volt angeschlossen werden. Zeichne
Physik 1 VNT Aufgabenblatt 8 5. Übung (50. KW)
 Physik 1 VNT Aufgabenblatt 8 5. Übung (5. KW) 5. Übung (5. KW) Aufgabe 1 (Achterbahn) Start v h 1 25 m h 2 2 m Ziel v 2? v 1 Welche Geschwindigkeit erreicht die Achterbahn in der Abbildung, wenn deren
Physik 1 VNT Aufgabenblatt 8 5. Übung (5. KW) 5. Übung (5. KW) Aufgabe 1 (Achterbahn) Start v h 1 25 m h 2 2 m Ziel v 2? v 1 Welche Geschwindigkeit erreicht die Achterbahn in der Abbildung, wenn deren
Allgemein gilt: Die Erdbeschleunigung g kann vereinfachend mit g= 10 m/s² angenommen
 Allgemein gilt: Die Erdbeschleunigung g kann vereinfachend mit g= 10 m/s² angenommen werden. (1) Eigenschaften von Fluiden In Weimar soll ein etwa 25 m hohes Gebäude errichtet werden (siehe Anlage für
Allgemein gilt: Die Erdbeschleunigung g kann vereinfachend mit g= 10 m/s² angenommen werden. (1) Eigenschaften von Fluiden In Weimar soll ein etwa 25 m hohes Gebäude errichtet werden (siehe Anlage für
7. Schichtenströmung 7-1. Aufgabe 7.1 [3]
![7. Schichtenströmung 7-1. Aufgabe 7.1 [3] 7. Schichtenströmung 7-1. Aufgabe 7.1 [3]](/thumbs/39/19371085.jpg) 7-1 7. Schichtenströmung Aufgabe 7.1 [3] Auf einer Unterlage befindet sich eine Ölschicht der Dicke h = 2 mm, auf der eine Platte mit der Geschwindigkeit v 0 gleitet. Ein Druckanstieg in Bewegungsrichtung
7-1 7. Schichtenströmung Aufgabe 7.1 [3] Auf einer Unterlage befindet sich eine Ölschicht der Dicke h = 2 mm, auf der eine Platte mit der Geschwindigkeit v 0 gleitet. Ein Druckanstieg in Bewegungsrichtung
Abschlussprüfung an Fachoberschulen im Schuljahr 2000/2001
 Abschlussprüfung an Fachoberschulen im Schuljahr 2000/2001 Haupttermin: Nach- bzw. Wiederholtermin: 2.0.2001 Fachrichtung: Technik Fach: Physik Prüfungsdauer: 210 Minuten Hilfsmittel: Formelsammlung/Tafelwerk
Abschlussprüfung an Fachoberschulen im Schuljahr 2000/2001 Haupttermin: Nach- bzw. Wiederholtermin: 2.0.2001 Fachrichtung: Technik Fach: Physik Prüfungsdauer: 210 Minuten Hilfsmittel: Formelsammlung/Tafelwerk
Hochschule Karlsruhe Technische Mechanik Statik. Aufgaben zur Statik
 Aufgaben zur Statik S 1. Seilkräfte 28 0 F 1 = 40 kn 25 0 F 2 = 32 kn Am Mast einer Überlandleitung greifen in der angegebenen Weise zwei Seilkräfte an. Bestimmen Sie die resultierende Kraft. Addition
Aufgaben zur Statik S 1. Seilkräfte 28 0 F 1 = 40 kn 25 0 F 2 = 32 kn Am Mast einer Überlandleitung greifen in der angegebenen Weise zwei Seilkräfte an. Bestimmen Sie die resultierende Kraft. Addition
Klausur Technische Strömungslehre
 ...... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Technische Strömunslehre 2. 8. 25. Aufabe ( Punkte) Die Ausflussöffnun (Spalthöhe h, Tiefe T ) eines Wasserbehälters wird, wie in der Zeichnun darestellt,
...... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Technische Strömunslehre 2. 8. 25. Aufabe ( Punkte) Die Ausflussöffnun (Spalthöhe h, Tiefe T ) eines Wasserbehälters wird, wie in der Zeichnun darestellt,
Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum
 Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Die Raketengleichung (eine Anwendungzum Impulssatz)
 Die Raketengleichung (eine Anwendungzu Ipulssatz) Ipuls vor de Ausstoß: p Ipuls nach de Ausstoß: p R v R + Δ v R Ipulserhaltungssatz: p p Ipulse einsetzen ergibt: R v R + Δ + v R Für die Massenänderung
Die Raketengleichung (eine Anwendungzu Ipulssatz) Ipuls vor de Ausstoß: p Ipuls nach de Ausstoß: p R v R + Δ v R Ipulserhaltungssatz: p p Ipulse einsetzen ergibt: R v R + Δ + v R Für die Massenänderung
MUSTERLÖSUNG K L A U S U R KÜSTENINGENIEURWESEN I
 Technische Universität Braunschweig Leichtweiß-Institut für Wasserbau Abteilung Hydroechanik und Küsteningenieurwesen Prof. Dr.-Ing. Hocine Oueraci N A M E: WS 2014/2015 Prüfungsterin: 16. Februar 2015
Technische Universität Braunschweig Leichtweiß-Institut für Wasserbau Abteilung Hydroechanik und Küsteningenieurwesen Prof. Dr.-Ing. Hocine Oueraci N A M E: WS 2014/2015 Prüfungsterin: 16. Februar 2015
10. Arbeit, Energie, Leistung
 0. Arbeit, Energie, Leistung Peter Riegler, FH Wolfenbüttel 0.0 Matheatische Grundlagen à Skalarprodukt Das Skalarprodukt a ÿ b = a x b x + a b + a b =» a»»b» coshgl ist das Produkt der Länge des Vektors
0. Arbeit, Energie, Leistung Peter Riegler, FH Wolfenbüttel 0.0 Matheatische Grundlagen à Skalarprodukt Das Skalarprodukt a ÿ b = a x b x + a b + a b =» a»»b» coshgl ist das Produkt der Länge des Vektors
3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome
 Übungen zur T1: Theoretische Mechanik, SoSe13 Prof. Dr. Dieter Lüst Theresienstr. 37, Zi. 45 Dr. James Gray James.Gray@physik.uni-muenchen.de 3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome Übung 3.1:
Übungen zur T1: Theoretische Mechanik, SoSe13 Prof. Dr. Dieter Lüst Theresienstr. 37, Zi. 45 Dr. James Gray James.Gray@physik.uni-muenchen.de 3. Erhaltungsgrößen und die Newton schen Axiome Übung 3.1:
Lösungen. S. 167 Nr. 6. S. 167 Nr. 8. S.167 Nr.9
 Lösungen S. 167 Nr. 6 Schätzung: Es können ca. 5000 Haushaltstanks gefüllt werden. Man beachte die Dimensionen der Tanks: Der Haushaltstank passt in ein kleines Zimmer, der große Öltank besitzt jedoch
Lösungen S. 167 Nr. 6 Schätzung: Es können ca. 5000 Haushaltstanks gefüllt werden. Man beachte die Dimensionen der Tanks: Der Haushaltstank passt in ein kleines Zimmer, der große Öltank besitzt jedoch
Spezifische Erstarrungs- und Verdampfungsenthalpie des Wassers (Latente Wärme)
 Spezifische Erstarrungs- und Verdapfungsenthalpie des Wassers (Latente Wäre) Stichworte: Erster Hauptsatz der Therodynaik, Kalorieter, Phasenuwandlung, Latente Wäre 1 Grundlagen Solange ein cheisch einheitlicher
Spezifische Erstarrungs- und Verdapfungsenthalpie des Wassers (Latente Wäre) Stichworte: Erster Hauptsatz der Therodynaik, Kalorieter, Phasenuwandlung, Latente Wäre 1 Grundlagen Solange ein cheisch einheitlicher
Hydraulik für Bauingenieure
 Hydraulik für Bauingenieure Grundlagen und Anwendungen von Robert Freimann 1. Auflage Hydraulik für Bauingenieure Freimann schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Hanser
Hydraulik für Bauingenieure Grundlagen und Anwendungen von Robert Freimann 1. Auflage Hydraulik für Bauingenieure Freimann schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Hanser
5) Nennen Sie zwei Beispiele für Scheinkräfte! (2 Punkte)
 1) a) Wie ist Dichte definiert? (2 Punkte) b) In welcher Einheit wird sie gemessen? (2 Punkte) c) Von welchen Parametern hängt die Dichte eines idealen Gases ab? Leiten sie dazu die Dichte aus dem idealen
1) a) Wie ist Dichte definiert? (2 Punkte) b) In welcher Einheit wird sie gemessen? (2 Punkte) c) Von welchen Parametern hängt die Dichte eines idealen Gases ab? Leiten sie dazu die Dichte aus dem idealen
Ergänzungsübungen zur Physik für Ingenieure (Maschinenbau) (WS 13/14)
 Ergänzungsübungen zur Physik für Ingenieure (Maschinenbau) (WS 13/14) Prof. W. Meyer Übungsgruppenleiter: A. Berlin & J. Herick (NB 2/28) Ergänzung J Hydrodynamik In der Hydrodynamik beschreibt man die
Ergänzungsübungen zur Physik für Ingenieure (Maschinenbau) (WS 13/14) Prof. W. Meyer Übungsgruppenleiter: A. Berlin & J. Herick (NB 2/28) Ergänzung J Hydrodynamik In der Hydrodynamik beschreibt man die
Unter dem hydraulischen Druck p versteht man den Quotienten aus Normalkraft und gedrückter Fläche: Kraft F Fläche A
 2. Hydrostatik Die Hydrostatik ist die Lehre von den ruhenden Flüssigkeiten und den sich in ihnen ausbildenden Kräften unter der Wirkung äußerer Kräfte. Aufgabe der Hydrostatik ist es, die infolge des
2. Hydrostatik Die Hydrostatik ist die Lehre von den ruhenden Flüssigkeiten und den sich in ihnen ausbildenden Kräften unter der Wirkung äußerer Kräfte. Aufgabe der Hydrostatik ist es, die infolge des
Physik-Aufgaben 1 Physik und Medizin
 A1 Physikalische Grössen, SI-Einheiten Hinweis: Die Nuerierung stit nicht überein! Aufgabe 1.1 Welche Angaben braucht es, dait eine (skalare) physikalische Grösse eindeutig definiert ist? Zahlenwert und
A1 Physikalische Grössen, SI-Einheiten Hinweis: Die Nuerierung stit nicht überein! Aufgabe 1.1 Welche Angaben braucht es, dait eine (skalare) physikalische Grösse eindeutig definiert ist? Zahlenwert und
Musterlösung zu Übungen der Physik PHY 117, Serie 6, HS 2009
 Musterlösung zu Übungen der Physik PHY 117, Serie 6, HS 2009 Abgabe: Gruppen 4-6: 07.12.09, Gruppen 1-3: 14.12.09 Lösungen zu den Aufgaben 1. [1P] Kind und Luftballons Ein Kind (m = 30 kg) will so viele
Musterlösung zu Übungen der Physik PHY 117, Serie 6, HS 2009 Abgabe: Gruppen 4-6: 07.12.09, Gruppen 1-3: 14.12.09 Lösungen zu den Aufgaben 1. [1P] Kind und Luftballons Ein Kind (m = 30 kg) will so viele
Formel X Leistungskurs Physik 2005/2006
 System: Wir betrachten ein Fluid (Bild, Gas oder Flüssigkeit), das sich in einem Zylinder befindet, der durch einen Kolben verschlossen ist. In der Thermodynamik bezeichnet man den Gegenstand der Betrachtung
System: Wir betrachten ein Fluid (Bild, Gas oder Flüssigkeit), das sich in einem Zylinder befindet, der durch einen Kolben verschlossen ist. In der Thermodynamik bezeichnet man den Gegenstand der Betrachtung
Lösungen zu den Aufgaben zur Klausur zur Vorlesung Einführung in die Physik für Natur- und Umweltwissenschaftler v. Issendorff, WS2013/
 Lösungen zu den Aufgaben zur Klausur zur Vorlesung Einführung in die Physik für Natur- und Umweltwissenschaftler v. Issendorff, WS013/14 18.0.014 1) Welche der folgenden Formeln für die Geschwindigkeit
Lösungen zu den Aufgaben zur Klausur zur Vorlesung Einführung in die Physik für Natur- und Umweltwissenschaftler v. Issendorff, WS013/14 18.0.014 1) Welche der folgenden Formeln für die Geschwindigkeit
Klausur Strömungsmechanik I (Bachelor) 11. 03. 2015
 ...... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Strömunsmechanik I (Bachelor) 11. 03. 25 1. Aufabe (9 Punkte) Ein autonomes Unterseeboot erzeut Auftrieb durch einen externen Ballon. Der Hauptkörper des U-Boots
...... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Strömunsmechanik I (Bachelor) 11. 03. 25 1. Aufabe (9 Punkte) Ein autonomes Unterseeboot erzeut Auftrieb durch einen externen Ballon. Der Hauptkörper des U-Boots
Kursstufe Physik / Aufgaben / 04 Teilchenbahnen im E Feld Kopetschke 2011 Teilchenbahnen im elektrischen Querfeld
 Kursstufe Physik / Aufgaben / 04 Teilchenbahnen im E Feld Kopetschke 011 Teilchenbahnen im elektrischen Querfeld 1) Elektronen starten an der negativen Platte eines Kondensators (d = 5 mm, U = 300 V) und
Kursstufe Physik / Aufgaben / 04 Teilchenbahnen im E Feld Kopetschke 011 Teilchenbahnen im elektrischen Querfeld 1) Elektronen starten an der negativen Platte eines Kondensators (d = 5 mm, U = 300 V) und
K2 MATHEMATIK KLAUSUR 1. Aufgabe PT WTA WTGS Gesamtpunktzahl Punkte (max) Punkte Notenpunkte
 K2 MATHEMATIK KLAUSUR 1 14.03.2016 Aufgabe PT WTA WTGS Gesamtpunktzahl (max) 30 15 15 60 Notenpunkte PT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P. (max) 2 2 3 4 5 3 4 4 3 WT Ana A.1a) b) c) Summe P. (max) 7 5 3 15 WT Geo G.a)
K2 MATHEMATIK KLAUSUR 1 14.03.2016 Aufgabe PT WTA WTGS Gesamtpunktzahl (max) 30 15 15 60 Notenpunkte PT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P. (max) 2 2 3 4 5 3 4 4 3 WT Ana A.1a) b) c) Summe P. (max) 7 5 3 15 WT Geo G.a)
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt. Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
 Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement Leitung: Ao.Univ.Prof. DI Dr. Stefan Schmutz Wirkungsgradanalyse und hydromorphologische Vermessung an der Wasserkraftschnecke
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement Leitung: Ao.Univ.Prof. DI Dr. Stefan Schmutz Wirkungsgradanalyse und hydromorphologische Vermessung an der Wasserkraftschnecke
Gase. Der Druck in Gasen. Auftrieb in Gasen. inkl. Exkurs: Ideale Gase
 Physik L17 (16.11.212) Der Druck in n inkl. Exkurs: Ideale uftrieb in n 1 Wiederholung: Der Druck in Flüssigkeiten Der Druck in Flüssigkeiten nit it zunehender Tiefe zu: Schweredruck Die oberen Wasserschichten
Physik L17 (16.11.212) Der Druck in n inkl. Exkurs: Ideale uftrieb in n 1 Wiederholung: Der Druck in Flüssigkeiten Der Druck in Flüssigkeiten nit it zunehender Tiefe zu: Schweredruck Die oberen Wasserschichten
Übungsaufgaben z. Th. Plattenkondensator
 Übungsaufgaben z. Th. Plattenkondensator Aufgabe 1 Die Platten eines Kondensators haben den Radius r 18 cm. Der Abstand zwischen den Platten beträgt d 1,5 cm. An den Kondensator wird die Spannung U 8,
Übungsaufgaben z. Th. Plattenkondensator Aufgabe 1 Die Platten eines Kondensators haben den Radius r 18 cm. Der Abstand zwischen den Platten beträgt d 1,5 cm. An den Kondensator wird die Spannung U 8,
Weche Größen beeinflussen die Schwingungsdauer eines Federpendels?
 1.1.5.1 Weche Größen beeinflussen die S In diese Versuch wird ein Federpendel betrachtet, welches aus einer Schraubenfeder it der Federkonstanten D und einer daran angehängten Masse besteht. Wird das Pendel
1.1.5.1 Weche Größen beeinflussen die S In diese Versuch wird ein Federpendel betrachtet, welches aus einer Schraubenfeder it der Federkonstanten D und einer daran angehängten Masse besteht. Wird das Pendel
I. Mechanik. I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen. Physik für Mediziner 1
 I. Mechanik I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen Physik für Mediziner Stromdichte Stromstärke = durch einen Querschnitt (senkrecht zur Flussrichtung) fließende Menge pro Zeit ( Menge
I. Mechanik I.4 Fluid-Dynamik: Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen Physik für Mediziner Stromdichte Stromstärke = durch einen Querschnitt (senkrecht zur Flussrichtung) fließende Menge pro Zeit ( Menge
Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung. Massenerhaltung: ρ. Massenfluss. inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms : v
 Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung A2, rho2, v2 A1, rho1, v1 Stromröhre Massenerhaltung: ρ } 1 v {{ 1 A } 1 = ρ } 2 v {{ 2 A } 2 m 1 inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms
Hydrodynamik Kontinuitätsgleichung A2, rho2, v2 A1, rho1, v1 Stromröhre Massenerhaltung: ρ } 1 v {{ 1 A } 1 = ρ } 2 v {{ 2 A } 2 m 1 inkompressibles Fluid: (ρ 1 = ρ 2 = konst) Erhaltung des Volumenstroms
Wasserkraftwerk selbst gebaut
 6 Kraftwerk mit Peltonturbine Wohl am einfachsten ist ein Picokraftwerk mit einer Peltonturbine zu realisieren. Vor allem wenn schon eine ausgiebige Quelle in angemessener Fallhöhe zur Verfügung steht
6 Kraftwerk mit Peltonturbine Wohl am einfachsten ist ein Picokraftwerk mit einer Peltonturbine zu realisieren. Vor allem wenn schon eine ausgiebige Quelle in angemessener Fallhöhe zur Verfügung steht
Physikalische Chemie Praktikum. Reale Gase, Kritischer Punkt
 Hochschule Eden / Leer Physikalische Cheie Praktiku Reale Gase, Kritischer Punkt Vers.Nr. 1 April 015 Allgeeine Grundlagen Reale Gase, Kopressionsfaktor (Realgasfaktor), Van der Waals Gleichung, Kritischer
Hochschule Eden / Leer Physikalische Cheie Praktiku Reale Gase, Kritischer Punkt Vers.Nr. 1 April 015 Allgeeine Grundlagen Reale Gase, Kopressionsfaktor (Realgasfaktor), Van der Waals Gleichung, Kritischer
Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte
 Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte 1.1 Bestimmung der Viskosität Grundlagen Die Viskosität eines Fluids ist eine Stoffeigenschaft, die durch den molekularen Impulsaustausch der einzelnen Fluidpartikel
Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte 1.1 Bestimmung der Viskosität Grundlagen Die Viskosität eines Fluids ist eine Stoffeigenschaft, die durch den molekularen Impulsaustausch der einzelnen Fluidpartikel
Klausur Physik 1 (GPH1) am 8.7.02
 Name, Matrikelnummer: Klausur Physik 1 (GPH1) am 8.7.02 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel: Beiblätter zur Vorlesung Physik 1 im
Name, Matrikelnummer: Klausur Physik 1 (GPH1) am 8.7.02 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel: Beiblätter zur Vorlesung Physik 1 im
In der Physik definiert man Arbeit durch das Produkt aus Kraft und Weg:
 Werkstatt: Arbeit = Kraft Weg Viel Kraft für nichts? In der Physik definiert man Arbeit durch das Produkt aus Kraft und Weg: W = * = F * s FII bezeichnet dabei die Kraftkomponente in Wegrichtung s. Die
Werkstatt: Arbeit = Kraft Weg Viel Kraft für nichts? In der Physik definiert man Arbeit durch das Produkt aus Kraft und Weg: W = * = F * s FII bezeichnet dabei die Kraftkomponente in Wegrichtung s. Die
Klausur zu Physik1 für B_WIng(v201)
 M. Anders Wedel, den 13.08.07 Klausur zu Physik1 ür B_WIng(v201) Klausurdatum: 16.2.07, 14:00, Bearbeitungszeit: 90 Minuten Achtung! Es ird nur geertet, as Sie au diesen Blättern oder angeheteten Leerseiten
M. Anders Wedel, den 13.08.07 Klausur zu Physik1 ür B_WIng(v201) Klausurdatum: 16.2.07, 14:00, Bearbeitungszeit: 90 Minuten Achtung! Es ird nur geertet, as Sie au diesen Blättern oder angeheteten Leerseiten
Der atmosphärische Luftdruck
 Gasdruck Der Druck in einem eingeschlossenen Gas entsteht durch Stöße der Gasteilchen (Moleküle) untereinander und gegen die Gefäßwände. In einem Gefäß ist der Gasdruck an allen Stellen gleich groß und
Gasdruck Der Druck in einem eingeschlossenen Gas entsteht durch Stöße der Gasteilchen (Moleküle) untereinander und gegen die Gefäßwände. In einem Gefäß ist der Gasdruck an allen Stellen gleich groß und
Aufgaben Hydraulik I, 11. Februar 2010, total 150 Pkt.
 Aufgaben Hydraulik I, 11. Februar 2010, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Kommunizierende Gefässe (20 Pkt.) Ein System von zwei kommunizierenden Gefässen besteht aus einem oben offenen Behälter A und einem geschlossenen
Aufgaben Hydraulik I, 11. Februar 2010, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Kommunizierende Gefässe (20 Pkt.) Ein System von zwei kommunizierenden Gefässen besteht aus einem oben offenen Behälter A und einem geschlossenen
Grundlagenfach NATURWISSENSCHAFTEN
 Schweizerische Maturitätsprüfung Kandidat(in) Nr.... Sommer 2010, Universität Bern Name / Vorname:... Grundlagenfach Bereich: Teil: Verfasser: Zeit: Hilfsmittel: NATURWISSENSCHAFTEN Physik R. Weiss 80
Schweizerische Maturitätsprüfung Kandidat(in) Nr.... Sommer 2010, Universität Bern Name / Vorname:... Grundlagenfach Bereich: Teil: Verfasser: Zeit: Hilfsmittel: NATURWISSENSCHAFTEN Physik R. Weiss 80
1. Klausur in K1 am
 Name: Punkte: Note: Ø: Kernfach Physik Abzüge für Darstellung: Rundung: 1. Klausur in K1 am 19. 10. 010 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben:
Name: Punkte: Note: Ø: Kernfach Physik Abzüge für Darstellung: Rundung: 1. Klausur in K1 am 19. 10. 010 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben:
Orientierungshilfen für die Zugangsprüfung Physik
 Orientierungshilfen für die Zugangsprüfung Physik Anliegen der Prüfung Die Zugangsprüfung dient dem Herausstellen der Fähigkeiten des Prüflings, physikalische Zusammenhänge zu erkennen. Das physikalische
Orientierungshilfen für die Zugangsprüfung Physik Anliegen der Prüfung Die Zugangsprüfung dient dem Herausstellen der Fähigkeiten des Prüflings, physikalische Zusammenhänge zu erkennen. Das physikalische
Abschlussprüfung an Fachoberschulen im Schuljahr 2004/2005
 Abschlussprüfung an Fachoberschulen im Schuljahr 200/200 Haupttermin: Nach- bzw Wiederholtermin: 0909200 Fachrichtung: Technik Fach: Physik Prüfungsdauer: 210 Minuten Hilfsmittel: - Formelsammlung/Tafelwerk
Abschlussprüfung an Fachoberschulen im Schuljahr 200/200 Haupttermin: Nach- bzw Wiederholtermin: 0909200 Fachrichtung: Technik Fach: Physik Prüfungsdauer: 210 Minuten Hilfsmittel: - Formelsammlung/Tafelwerk
Oberstufe (11, 12, 13)
 Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Mathematik Klasse 9b, AB 03 Lineare Funktionen 02 - Lösung
 Allgemeiner Hinweis: An einigen Stellen fehlen aus Platzgründen bei Gleichungsumformungen die Anzeige der Äquivalenzumformungen, wenn sie eindeutig sind. Also 2 x=10 x=5 statt 2x=10 :2 x=5. In der Arbeit
Allgemeiner Hinweis: An einigen Stellen fehlen aus Platzgründen bei Gleichungsumformungen die Anzeige der Äquivalenzumformungen, wenn sie eindeutig sind. Also 2 x=10 x=5 statt 2x=10 :2 x=5. In der Arbeit
Station A * * 1-4 ca. 16 min
 Station A * * 1-4 ca. 16 min Mit einem 80 m langen Zaun soll an einer Hauswand ein Rechteck eingezäunt werden. Wie lang müssen die Seiten des Rechtecks gewählt werden, damit es einen möglichst großen Flächeninhalt
Station A * * 1-4 ca. 16 min Mit einem 80 m langen Zaun soll an einer Hauswand ein Rechteck eingezäunt werden. Wie lang müssen die Seiten des Rechtecks gewählt werden, damit es einen möglichst großen Flächeninhalt
405. Ein Strommesser hat einen Messwiderstand von 200 Ohm und einen Endausschlag. Aufgaben zur E-Lehre (Widerstand)
 ufgaben zur E-Lehre (Widerstand) 6. In eine aten Haus wurden die uiniueitungen durch Kupfereitungen ersetzt; insgesat wurden 50 Kabe veregt. Jedes Kabe besteht aus einer Hin- und einer ückeitung und hat
ufgaben zur E-Lehre (Widerstand) 6. In eine aten Haus wurden die uiniueitungen durch Kupfereitungen ersetzt; insgesat wurden 50 Kabe veregt. Jedes Kabe besteht aus einer Hin- und einer ückeitung und hat
Einführungsphase. Viel Erfolg! Aufgabe 1: Quadratische Funktion Flugbahn (29 Punkte)
 Name: Klasse: 2. Klausur Mathematik Einführungsphase 22.12.2011 Bitte benutze für jede Aufgabe einen neuen Bogen/ein neues Blatt!!! Die Ausführungen müssen in puncto Sauberkeit und Rechtschreibung den
Name: Klasse: 2. Klausur Mathematik Einführungsphase 22.12.2011 Bitte benutze für jede Aufgabe einen neuen Bogen/ein neues Blatt!!! Die Ausführungen müssen in puncto Sauberkeit und Rechtschreibung den
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW M LK HT 4 Seite 1 von 11. Unterlagen für die Lehrkraft. Abiturprüfung Mathematik, Leistungskurs
 Seite von Unterlagen für die Lehrkraft Abiturprüfung 0 Mathematik, Leistungskurs. Aufgabenart Lineare Algebra/Geometrie ohne Alternative. Aufgabenstellung siehe Prüfungsaufgabe 3. Materialgrundlage entfällt
Seite von Unterlagen für die Lehrkraft Abiturprüfung 0 Mathematik, Leistungskurs. Aufgabenart Lineare Algebra/Geometrie ohne Alternative. Aufgabenstellung siehe Prüfungsaufgabe 3. Materialgrundlage entfällt
Stickstoff kann als ideales Gas betrachtet werden mit einer spezifischen Gaskonstante von R N2 = 0,297 kj
 Aufgabe 4 Zylinder nach oben offen Der dargestellte Zylinder A und der zugehörige bis zum Ventil reichende Leitungsabschnitt enthalten Stickstoff. Dieser nimmt im Ausgangszustand ein Volumen V 5,0 dm 3
Aufgabe 4 Zylinder nach oben offen Der dargestellte Zylinder A und der zugehörige bis zum Ventil reichende Leitungsabschnitt enthalten Stickstoff. Dieser nimmt im Ausgangszustand ein Volumen V 5,0 dm 3
= 1 und der Ladung Q aufgefasst. Die elektrische Feldstärke beträgt 1, N/C, so dass die Entladung durch einen Blitz unmittelbar bevorsteht.
 Aufgaben Konensator 57. Zwei kreisförmige Metallplatten mit em Raius 0 cm, ie parallel im Abstan von 0 cm angeornet sin, bilen einen Plattenkonensator. In er Mitte zwischen en Platten hängt an einem ünnen
Aufgaben Konensator 57. Zwei kreisförmige Metallplatten mit em Raius 0 cm, ie parallel im Abstan von 0 cm angeornet sin, bilen einen Plattenkonensator. In er Mitte zwischen en Platten hängt an einem ünnen
Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten)
 Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten) Aufgabe Z-01/ 1 Welche zwei verschiedenen physikalische Bedeutungen kann eine Größe haben, wenn nur bekannt ist, dass sie in der Einheit Nm gemessen
Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten) Aufgabe Z-01/ 1 Welche zwei verschiedenen physikalische Bedeutungen kann eine Größe haben, wenn nur bekannt ist, dass sie in der Einheit Nm gemessen
! "#$% &' (#$ (#$ )* #$ +,' $-. / 01#$#$ '.2
 % Note: mit P.! "#$% &' (#$ (#$ )* #$ +,' $-. / 01#$#$ '. 4+ Körperberechnung: Die Übungsarbeit dient der gezielten Vorbereitung auf die Arbeit. Die Übungsarbeit hat insgesamt 8 Aufgaben mit einigen Teilaufgaben.
% Note: mit P.! "#$% &' (#$ (#$ )* #$ +,' $-. / 01#$#$ '. 4+ Körperberechnung: Die Übungsarbeit dient der gezielten Vorbereitung auf die Arbeit. Die Übungsarbeit hat insgesamt 8 Aufgaben mit einigen Teilaufgaben.
Physik 2 (GPh2) am
 Name: Matrikelnummer: Studienfach: Physik (GPh) am 8.0.013 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel zu dieser Klausur: Beiblätter zur
Name: Matrikelnummer: Studienfach: Physik (GPh) am 8.0.013 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel zu dieser Klausur: Beiblätter zur
2 (Druck auf die Rohrwand), e v1. den Staudruck.
 Bernoulli Gleichung Strömt Gas oder eine Flüssigkeit durch ein Rohr mit einer Verengung, dann beobachtet man, daβ der Druck p des strömenden Mediums auf die Wand des Rohres im Bereich der Verengung kleiner
Bernoulli Gleichung Strömt Gas oder eine Flüssigkeit durch ein Rohr mit einer Verengung, dann beobachtet man, daβ der Druck p des strömenden Mediums auf die Wand des Rohres im Bereich der Verengung kleiner
Versuch: Mohrsche Waage
 Versuch M1 MOHRSCHE WAAGE Seite 1 von 5 Versuch: Mohrsche Waage Anleitung für folgende Studiengänge: Physik, L3 Physik, Biophysik, Meteorologie, Cheie, Biocheie, Geowissenschaften, Inforatik Rau: Physik.206
Versuch M1 MOHRSCHE WAAGE Seite 1 von 5 Versuch: Mohrsche Waage Anleitung für folgende Studiengänge: Physik, L3 Physik, Biophysik, Meteorologie, Cheie, Biocheie, Geowissenschaften, Inforatik Rau: Physik.206
PN 1 Klausur Physik für Chemiker
 PN 1 Klausur Physik für Chemiker Prof. T. Liedl Ihr Name in leserlichen Druckbuchstaben München 2011 Martrikelnr.: Semester: Klausur zur Vorlesung PN I Einführung in die Physik für Chemiker Prof. Dr. T.
PN 1 Klausur Physik für Chemiker Prof. T. Liedl Ihr Name in leserlichen Druckbuchstaben München 2011 Martrikelnr.: Semester: Klausur zur Vorlesung PN I Einführung in die Physik für Chemiker Prof. Dr. T.
Stabwerkslehre - WS 11/12 Prof. Dr. Colling
 Fachhochschule Augsburg Studiengang Bauingenieurwesen Stabwerkslehre - WS 11/12 Name: Prof. Dr. Colling Arbeitszeit: Hilfsmittel: 90 min. alle, außer Rechenprogrammen 1. Aufgabe (ca. 5 min) Gegeben: Statisches
Fachhochschule Augsburg Studiengang Bauingenieurwesen Stabwerkslehre - WS 11/12 Name: Prof. Dr. Colling Arbeitszeit: Hilfsmittel: 90 min. alle, außer Rechenprogrammen 1. Aufgabe (ca. 5 min) Gegeben: Statisches
Physik 2 (B.Sc. EIT) 7. Übungsblatt
 Institut für Physik Werner-Heisenberg-Weg 9 Fakultät für Elektrotechnik 85577 München / Neubiberg Universität der Bundeswehr München / Neubiberg Prof. Dr. H. Baugärtner Übungen: Dr.-Ing. Tanja Stipel-Lindner,
Institut für Physik Werner-Heisenberg-Weg 9 Fakultät für Elektrotechnik 85577 München / Neubiberg Universität der Bundeswehr München / Neubiberg Prof. Dr. H. Baugärtner Übungen: Dr.-Ing. Tanja Stipel-Lindner,
Übungsaufgabe. Bestimmen Sie das molare Volumen für Ammoniak bei einem Druck von 1 MPa und einer Temperatur von 100 C nach
 Übungsaufgabe Bestien Sie das olare Voluen für Aoniak bei eine Druck von 1 MPa und einer Teperatur von 100 C nach a) de idealen Gasgesetz b) der Van der Waals-Gleichung c) der Redlich-Kwong- Gleichung
Übungsaufgabe Bestien Sie das olare Voluen für Aoniak bei eine Druck von 1 MPa und einer Teperatur von 100 C nach a) de idealen Gasgesetz b) der Van der Waals-Gleichung c) der Redlich-Kwong- Gleichung
Klausur Experimentalphysik (1. Termin)
 Helmut-Schmidt-Universität Universität der Bundeswehr Hamburg Fachbereich Elektrotechnik Univ.-Prof. Dr. D. Kip Experimentalphysik und Materialwissenschaften Telefon: 6541 2457 Klausur Experimentalphysik
Helmut-Schmidt-Universität Universität der Bundeswehr Hamburg Fachbereich Elektrotechnik Univ.-Prof. Dr. D. Kip Experimentalphysik und Materialwissenschaften Telefon: 6541 2457 Klausur Experimentalphysik
PARS. Kategorie C: Lösungen. Grundlagen. Aufgabe 1. s = 1 2 a t2 (t 0, umstellen nach a) s = 1 2 a t2 2 (1) 2 s = a t 2 : t 2 (2) 2 s. t 2.
 Kategorie C: Lösungen PARS Grundlagen Aufgabe s = 2 a t2 (t 0, ustellen nach a) s = 2 a t2 2 () 2 s = a t 2 : t 2 (2) 2 s t 2 = a (3) a = 2 s t 2 Zu Zeile (): Es ist nicht nötig, die gesuchte Größe nach
Kategorie C: Lösungen PARS Grundlagen Aufgabe s = 2 a t2 (t 0, ustellen nach a) s = 2 a t2 2 () 2 s = a t 2 : t 2 (2) 2 s t 2 = a (3) a = 2 s t 2 Zu Zeile (): Es ist nicht nötig, die gesuchte Größe nach
Pflichtaufgaben. Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben.
 Abitur 2002 Physik Gk Seite 3 Pflichtaufgaben (24 BE) Aufgabe P1 Mechanik Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben. t in s 0 7 37 40 100 v in
Abitur 2002 Physik Gk Seite 3 Pflichtaufgaben (24 BE) Aufgabe P1 Mechanik Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben. t in s 0 7 37 40 100 v in
Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung
 Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung Christoph Rosinski, Franz Josef Zapp GEFGA mbh, Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung von Geothermen
Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung Christoph Rosinski, Franz Josef Zapp GEFGA mbh, Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung von Geothermen
Ergänzungsprüfung Physik 2015: Lösungen
 Ergänzungsprüfung Physik 05: Lösungen Aufgabe (9 Punkte) Eine Standseilbahn steht in Ruhe auf einem schiefen Hang und wird on einem Prellbock gehalten. ie Gesamtmasse der Bahn beträgt m 800kg, der inkel
Ergänzungsprüfung Physik 05: Lösungen Aufgabe (9 Punkte) Eine Standseilbahn steht in Ruhe auf einem schiefen Hang und wird on einem Prellbock gehalten. ie Gesamtmasse der Bahn beträgt m 800kg, der inkel
Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I. Übung
 Institut für Fahrzeugsystemtechnik Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Gauterin Rintheimer Querallee 2 76131 Karlsruhe Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I Übung
Institut für Fahrzeugsystemtechnik Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik Leiter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Gauterin Rintheimer Querallee 2 76131 Karlsruhe Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I Übung
zu 2.1 / I. Wiederholungsaufgaben zur beschleunigten Bewegung
 Fach: Physik/ L. Wenzl Datum: zu 2.1 / I. Wiederholungsaufgaben zur beschleunigten Bewegung Aufgabe 1: Ein Auto beschleunigt gleichmäßig in 12,0 s von 0 auf 100 kmh -1. Welchen Weg hat es in dieser Zeit
Fach: Physik/ L. Wenzl Datum: zu 2.1 / I. Wiederholungsaufgaben zur beschleunigten Bewegung Aufgabe 1: Ein Auto beschleunigt gleichmäßig in 12,0 s von 0 auf 100 kmh -1. Welchen Weg hat es in dieser Zeit
gerader Zylinder 1. Ein gerader Kreiszylinder hat die Höhe h und den Radius r.
 gerader Zylinder 1 Ein gerader Kreiszylinder hat die Höhe h und den Radius r (a) Erklären Sie, wie man die Formel M = rh2π für den Inhalt der Mantelfläche des Zylinders herleiten kann (b) Für den Inhalt
gerader Zylinder 1 Ein gerader Kreiszylinder hat die Höhe h und den Radius r (a) Erklären Sie, wie man die Formel M = rh2π für den Inhalt der Mantelfläche des Zylinders herleiten kann (b) Für den Inhalt
2010-03-08 Klausur 3 Kurs 12Ph3g Physik
 00-03-08 Klausur 3 Kurs Ph3g Physik Lösung Ein Federpendel mit der Federkonstante D=50 N schwingt mit derselben Frequenz wie ein m Fadenpendel der Länge 30 cm. Die Feder sei masselos. Die Auslenkung des
00-03-08 Klausur 3 Kurs Ph3g Physik Lösung Ein Federpendel mit der Federkonstante D=50 N schwingt mit derselben Frequenz wie ein m Fadenpendel der Länge 30 cm. Die Feder sei masselos. Die Auslenkung des
Posten 2: Experiment Wasserkraft Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die Sch lösen in Gruppen den vorliegenden Posten unter Einbezug der vorhandenen Unterlagen und Materialien. Ziel Material Sozialform Die Sch sind in der Lage, die beschriebene
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die Sch lösen in Gruppen den vorliegenden Posten unter Einbezug der vorhandenen Unterlagen und Materialien. Ziel Material Sozialform Die Sch sind in der Lage, die beschriebene
1. Welche Zahlenpaare sind Lösungen der Gleichung 7x 4y = 3? a) (1/1) b) (3/4) c) ( 2/ 4) d) (0/ 0.75)
 Lineare Gleichungs und Ungleichungssysteme 1 1. Welche Zahlenpaare sind Lösungen der Gleichung 7x 4y = 3? a) (1/1) b) (3/4) c) ( 2/ 4) d) (0/ 0.75) 2. Ergänzen Sie die fehlende Zahl, sodass sich eine Lösung
Lineare Gleichungs und Ungleichungssysteme 1 1. Welche Zahlenpaare sind Lösungen der Gleichung 7x 4y = 3? a) (1/1) b) (3/4) c) ( 2/ 4) d) (0/ 0.75) 2. Ergänzen Sie die fehlende Zahl, sodass sich eine Lösung
2. Klausur in K1 am
 Name: Punkte: Note: Ø: Physik Kursstufe Abzüge für Darstellung: Rundung:. Klausur in K am 7.. 00 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: e =,60
Name: Punkte: Note: Ø: Physik Kursstufe Abzüge für Darstellung: Rundung:. Klausur in K am 7.. 00 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: e =,60
entspricht der Länge des Vektorpfeils. Im R 2 : x =
 Norm (oder Betrag) eines Vektors im R n entspricht der Länge des Vektorpfeils. ( ) Im R : x = x = x + x nach Pythagoras. Allgemein im R n : x x = x + x +... + x n. Beispiele ( ) =, ( 4 ) = 5, =, 4 = 0.
Norm (oder Betrag) eines Vektors im R n entspricht der Länge des Vektorpfeils. ( ) Im R : x = x = x + x nach Pythagoras. Allgemein im R n : x x = x + x +... + x n. Beispiele ( ) =, ( 4 ) = 5, =, 4 = 0.
5. Impulssatz 5-1. Aufgabe 5.1 [8]
![5. Impulssatz 5-1. Aufgabe 5.1 [8] 5. Impulssatz 5-1. Aufgabe 5.1 [8]](/thumbs/39/18773895.jpg) 5-1 5. Impulssatz Aufgabe 5.1 [8] In einem horizontal liegenden 60 -Rohrkrümmer verjüngt sich in Fließrichtung der Rohrinnendurchmesser von D 1 = 0,4 m auf D = 0, m. Am Krümmerausgang (Schnitt -) herrscht
5-1 5. Impulssatz Aufgabe 5.1 [8] In einem horizontal liegenden 60 -Rohrkrümmer verjüngt sich in Fließrichtung der Rohrinnendurchmesser von D 1 = 0,4 m auf D = 0, m. Am Krümmerausgang (Schnitt -) herrscht
Name: Punkte: Note Ø: Achtung! Es gibt Abzüge für schlechte Darstellung: Klasse 7b Klassenarbeit in Physik
 Name: Punkte: Note Ø: Achtung! Es gibt Abzüge für schlechte Darstellung: Klasse 7b 16. 1. 01 1. Klassenarbeit in Physik Bitte auf gute Darstellung und lesbare Schrift achten. Aufgabe 1) (4 Punkte) Bei
Name: Punkte: Note Ø: Achtung! Es gibt Abzüge für schlechte Darstellung: Klasse 7b 16. 1. 01 1. Klassenarbeit in Physik Bitte auf gute Darstellung und lesbare Schrift achten. Aufgabe 1) (4 Punkte) Bei
