Konzeptuelle Erörterungen zu Emotionen
|
|
|
- Leopold Ackermann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Konzeptuelle Erörterungen zu Emotionen Eva-Maria Engelen Lassen Sie mich zunächst zwei Fragen aufwerfen, die auch Ausgangspunkt für die konzeptuelle Grundlegung des Bandes, der heute vorgestellt wird, sind: 1. Was sind Emotionen? 2. Wie lassen sich die biologischen, physiologischen und die kulturellen Aspekte von Emotionen in Verbindung setzen? Zu 1. Was sind Emotionen? Sind sie Gedanken?, Urteile?, Wünsche? oder Wahrnehmungen? Oder sind sie analog zu Wahrnehmungen, Urteilen oder Wünschen zu verstehen? Oder handelt es sich um eine eigene Gruppe von Zuständen? Wir haben uns für die letztere Option entschieden und das bedeutet auch, dass Emotionen nicht auf andere Zustände wie etwa Wünsche oder Urteile reduziert werden. Ausführlich haben wir uns dann mit Frage 2 beschäftigt: Wie lassen sich biologisch, physiologische Aspekte und kulturelle Aspekte bei Emotionen in Verbindung bringen. Dazu haben wir zwei Ansätze diskutiert, die in der Emotionsforschung eine herausragende Rolle spielen: - Einen physiologischen Ansatz, der von so genannten Basisemotionen ausgeht. Hier stehen die kommunikative Funktion von Emotionen und der handlungsleitende Aspekt von Emotionen im Vordergrund der Theoriebildung. - Einen Ansatz, der eher von unserem Alltagsverständnis von Emotionen ausgeht, die so genannten Einschätzungs- oder Appraisaltheorien.. Einschätzungstheorien stellen für die Theoriebildung den Bewertungscharakter, also einen kognitiven Aspekt in den Vordergrund ihrer Überlegungen. Zunächst zu den so genannten Basisemotionen. Die dazugehörigen Grundannahmen stellen Antworten auf die ontologische Frage: Was sind Emotionen? dar. Wir haben eine Liste mit Kriterien für Basisemotionen erarbeitet, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte: Wir haben zunächst eine Liste mit Kriterien aufgestellt, nach welchen eine Emotion (ein emotionaler Prozess) dann basal zu nennen, wenn sie (er)
2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) irreduzibel oder rein ist, d.h. hier: wenn keine andere Emotion beteiligt ist. universell ist, d.h., wenn keine soziale Gruppierung bekannt ist, die die entsprechende Emotion nicht zeigt einen distinkten mimischen und gestischen Ausdruck hat, der von anderen mühelos gedeutet werden kann ein angeborenes Affektprogramm zugrunde liegt mit unmittelbaren und signifikanten körperliche Veränderungen einhergeht, von denen angenommen wird, dass sie universal auftreten; in der Ontogenese sehr früh auftritt und im Falle der Degeneration des Gehirns sehr spät verschwindet induziert werden können, ohne dass bewusste, etwa propositionale Prozesse beteiligt sind, und ohne dass ein Selbstbild vorhanden ist für ihr Vorkommen keine Gedanken erforderlich sind eine geringe Erregungsdauer gegeben ist. Diesen Kriterien liegt letztlich ein Verständnis von basalen emotionalen Prozessen als (noch) nicht semantisierten (kognitiven) grundlegenden emotionalen Fähigkeiten zu Grunde. Im Folgenden sollen diese acht Kriterien noch etwas ausführlicher diskutiert werden: (i) Mit dem Postulat der Irreduzierbarkeit (irreducible) ist gemeint, dass keine anderen Emotionen an/in der irreduziblen Emotion erkennbar sind. So scheint Freude immer nur Freude zu sein, während die Emotion der Liebe beispielsweise die der Freude durchaus enthält. (ii) Universalität (universal); mit universal werden diejenigen Emotionen bezeichnet, bei denen keine soziale Gruppierung bekannt ist, die dieses emotionale Grundmuster nicht aufweist. Das universale Grundmuster ist wiederum kulturspezifisch ausgeformt, also nicht in allen Kulturen in gleicher Weise und in gleicher Ausprägung und Intensität entwickelt. (iii) Distinkter Gesichts- und Körperausdruck, der von allen anderen mühelos gedeutet wird (distinctive (facial) expression readable by others). Die Forschung von Paul Ekman und seiner Forschergruppe beschäftigt sich insbesondere mit diesem
3 Kriterium. Allerdings sagt Ekman selbst, dass es keinerlei Daten darüber gibt, wie viele Ausdrucksformen für eine Emotion universal sind. Auch gibt es keine 1:1 Relation, d.h. nur eine spezifische Gesichtsausdrucksform pro Emotion. (iv) Angeborenes Affektprogramm (innate affect program): Ein solches angeborenes Affektprogramm wollen beispielsweise Joseph LeDoux (1996/200) und Jaak Panksepp (1998/2004) entdeckt haben. Sie verweisen darauf, dass der Mensch diese angeborenen Affektprogramme mit anderen Säugetieren teilt und postulieren, dass diese Programme, d. h. die dazugehörigen (diskreten) Emotionen phylogenetisch bestimmt sind. Mit dieser Auffassung stellen die Fürsprecher der Affektprogramme ein zentrales Konzept biologisch bedingter Basisemotionen zur Verfügung. (v) Unmittelbare und signifikante körperliche Veränderungen (immediate and significant, automatic bodily change), von denen angenommen wird, dass sie universal auftreten. Diese Veränderungen werden solchen Emotionen zugeschrieben, von denen man annimmt, dass sie universal sind oder aber Ergebnis eines angeborenen Affektprogramms. Ein Beispiel wäre etwa auftretender Angstschweiß. (vi) Basisemotionen treten in der Ontogenese sehr früh auf und verschwinden im Falle der Degeneration des Gehirns sehr spät. Zusätzlich zu diesen in der Literatur häufig genannten Kriterien sind aus der Arbeit der Forschergruppe zwei weitere Kriterien hervorgegangen: (vii) Übereinstimmend mit der Argumentation, der zufolge universale, basale Emotionen oder Affektprogramme induziert werden können, ohne dass bewusste, etwa propositionale Prozesse beteiligt sind, gehen wir davon aus, dass sich Affektprogramme aktivieren lassen, ohne dass ein Selbstbild vorhanden ist. Dieses Kriterium ist streng genommen kein zusätzliches Kriterium, um Basisemotionen zu bestimmen. Eine Emotion, die ein Selbstbild voraussetzt, kann allerdings keine Basisemotion sein. Das ist bei komplexen Emotionen anders: Subjekte müssen über ein Selbstbild verfügen, das sie in Bezug setzen können zu den Bildern anderer Subjekte, um komplexe Emotionen haben zu können. Das Selbstbild lokalisiert Subjekte dabei in einem (eventuell sogar imaginären) sozialen Raum oder Beziehungsgeflecht. (viii) Für basale emotionale Prozesse sind zudem keine Gedanken erforderlich. Genau genommen verweist dieses Kriterium darauf, dass zwar keine höheren
4 Kognitionen wie etwa Schlussfolgern, Planen, Entscheiden oder Werten notwendig sind. Dieses Kriterium ergibt sich wie andere auch - aus den Überlegungen zu Emotionsvorkommnissen bei Säuglingen, Säugetieren und Altersdementen. (ix) Ein weiteres, allgemeines Kriterium für eine Basisemotion ist die geringe Erregungsdauer. Zumeist nicht sehr viel länger als einige Minuten, selten sind es Stunden. Ob es auch Tage oder gar Wochen sein können, ist schon wieder diskutabel, denn dann handelt es sich nicht mehr um die unmittelbare erste Reaktion wie sie etwa typisch ist, wenn wir einen sehr guten Freund zufällig auf der Strasse treffen. Die Frage, ob man davon ausgehen sollte, dass es so etwas wie Basisemotionen gibt, hängt mit derjenigen zusammen, wie man Emotionen kategorisieren sollte. Dabei ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Rede von Basisemotionen immer unter einer gewissen Einschränkung stehen muss. Denn selbst Emotionen wie Freude oder Angst, die universal zugeschrieben werden, sind kulturell geformt und gehen, sobald sie auch sprachlich geformt sind, mit höheren kognitiven Prozessen einher. Zu bedenken ist auch, dass eine Emotion bei einem gesunden, erwachsenen Menschen in der Komplexität des alltäglichen Lebens selten wenn überhaupt in basaler und reiner Form auftritt, sondern, bedingt durch die Gegebenheiten des jeweiligen sozialen Kontextes, meist Anteile anderer emotionaler Dimensionen enthält. Dennoch ist diese Kategorie sinnvoll, da sie es erlaubt, universell auftretende Emotionen von so genannten komplexen zu unterscheiden, die nur in bestimmten Kulturen auftreten und häufig länger anhaltend sind als Basisemotionen. Ein Beispiel wäre etwa der Weltschmerz. Die Frage, wie man Emotionen kategorisieren soll, ist eng mit der Frage verbunden, wie sinnvoll oder nützlich Einteilungen in Basisemotionen und komplexe Emotionen sind, und damit zusammenhängend, ob von so genannten angeborenen, physiologisch angelegten Basisemotionen ausgegangen werden sollte, oder eine Appraisal-Theorie ins Zentrum der Überlegungen gestellt werden sollte, der meist ein kognitives Modell der Emotionen zu Grunde liegt. Hier ist es wichtig die Ebenen der Betrachtung zunächst klar auseinander zu halten. Während Appraisal-Theorien von unserem so genannten Alltagsverständnis von Emotionen ausgehen, also (alltags)psychologisch
5 angesiedelt sind, beschäftigen sich physiologische Theorien der Emotionen mit den physiologischen Vorgängen emotionaler Prozesse. Die Frage ist aber zum einen, ob sich diese Ebenen wirklich vollständig separieren lassen. Denn nach welchen physiologischen Mechanismen sucht der Physiologe, wenn er kein Vorverständnis (Alltagswissen) des zu untersuchenden Gegenstandes hat? Appraisal-Theorien konturieren zudem die kulturelle Emotionsmodellierung schärfer. Denn eine ausschließliche Sicht auf so genannte Basisemotionen erlaubt es nicht, die gesamte kulturelle Bandbreite emotionaler Prozesse zu erfassen und die jeweiligen kulturellen Spezifika erklären zu können. Einschätzungstheorien ( appraisal theories ) der Emotionen untersuchen weniger den ontologischen Status bestimmter Emotionen als vielmehr die Frage, wie Emotionen entstehen. Die zentrale Annahme der Einschätzungstheorien ist, dass Emotionen durch die subjektive Einschätzung oder Bewertung von Situationen und Ereignissen hinsichtlich der Bedeutung des Wahrgenommenen für den Organismus ausgelöst werden. Eine weitere Annahme dieser theoretischen Ansätze ist, dass die unterschiedlichen Emotionen mit unterschiedlichen Einschätzungsmustern einhergehen, d.h. dass jede diskrete Emotion von einem entsprechenden diskreten Einschätzungsmuster ausgelöst wird. Der Charakter einer Emotion, d.h. wie sie empfunden oder gefühlt wird, wird also vom jeweiligen Einschätzungsmuster bestimmt, Daraus lässt sich eine weitere Annahme ableiten: Einschätzungen gehen einer Emotion voraus und lösen Emotionen aus, sie sind nicht etwa der eigentlichen Emotion nach gelagerte Begleiterscheinung oder Anhängsel physiologischer Reaktionen. Sie können Teil einer Emotion sein, müssen es aber nicht, da nicht auf jede Einschätzung auch eine Emotion folgt. Vor allem in der Rezeption der Appraisal-Theorien durch ihre Kritiker sind Einschätzungen ausschließlich mit kognitiven und großenteils bewussten Einschätzungsprozessen gleichgesetzt worden Ansichten, Absichten, Wünsche, Ziele und Überzeugungen werden dabei zur Matrize, vor der Situationen und Ereignisse abgebildet und eingeschätzt werden. Ungeachtet der Tatsache, dass die meisten Einschätzungstheorien auch automatische und unbewusst verlaufende Einschätzungsprozesse berücksichtigen, entwickeln sie doch ein dezidiertes Konzept für die Beteiligung von (höheren) Kognitionen an der
6 Emotionsgenese. Dabei spielen oftmals propositionale Einstellungen eine bedeutende Rolle, was das Vorhandensein sprachlicher Strukturen voraussetzt. Die Differenzierung in die unbewusst ablaufenden Vorgänge und die bewusst ablaufenden galt daher auch das besondere Augenmerk der Forschergruppe: Das folgende Schema umfasst die mentalen und nicht-mentalen Zustände, Ereignisse und Prozesse, die an emotionalen Vorgängen (processing) beteiligt sind. Es ist in erster Linie das Ergebnis einer analytischen Aufarbeitung. (Die Farbe Rot in den Eintragungen des Schemas weist darauf hin, dass es sich um bewusste Prozesse handelt): Sinnesreizverarbeitung (sensation) unbewusst, automatisch, physiologisch Sinnesempfindung (sensational phenomenal experience) Wahrnehmung (perception) Interpretation der Sinnesreizverarbeitung in Bezug auf ein Faktum/Mustererkennung 1 : (i) dieser Prozess ist nicht bewusst, oder (ii) das Wahrgenommene wird bewusst ( wahrgenommen als ), oder (iii) bewusste Reflexion auf das, was als etwas wahrgenommen wurde Bewusste Wahrnehmung (perceptual phenomenal experience) Einschätzung (appraisal) Interpretation des Wahrgenommenen in Bezug auf seine Bedeutung für den Organismus / für das Selbst: (i) der gesamte Prozess ist unbewusst, oder (ii) das Ergebnis des Einschätzungsprozesses wird in unterschiedlichen Graden bewusst Emotionsempfindung (sensational experience of an emotional state) Emotionswahrnehmung (conceptualized emotional experience) Bewertung (evaluation / re-appraisal) Bewusste bewertende Gedanken (reflections) über das Wahrgenommene oder 1 Der Terminus Interpretation wird hier nicht in kultur- oder geisteswissenschaftlicher Tradition verwendet, sondern im Sinne kategorialer Interpretation. Ein Beispiel wäre die Wahrnehmung einer anderen Person und deren Einordnung als männlich oder weiblich. Es geht also nicht um die Bedeutung der Wahrnehmung für den Wahrnehmenden.
7 das Bewertete (oder andere Inhalte unseres Bewusstseins) in Verbindung mit seiner Bedeutung für das Selbst. Eine Bewertung muss nicht erfolgen. Erläuterung mittels eines Beispiels: Sie sehen in der Dunkelheit auf der Straße einen Mann mit Baseball-Schläger auf sich zukommen und reagieren angstvoll. Wie können wir diese Abläufe im Detail beschreiben? Zu Beginn der Episode steht eine Sinnesreizverarbeitung, die zunächst unbewusst bleibt und automatisch auf physiologischer Ebene abläuft. Das bedeutet, dass Sie die Gestalt im Dunkeln weder als Mann noch überhaupt als Gestalt wahrnehmen. Ihre Sinne werden zunächst einmal unspezifisch gereizt. Es handelt sich hier um die rein physiologische oder neurophysiologische Beschreibungsebene. In der philosophischen Wiedergabe ist diese Ebene die der Sinnesempfindung, die im Gegensatz zu der rein physiologischen mit Bewusstsein einhergeht. Die weitere Stufe der Wahrnehmung, nämlich die bewusste Reflexion, auf das, was als etwas wahrgenommen wurde, ist etwa für philosophisches Nachdenken über Bewusstsein von besonderem Interesse. Sie betrifft auch den Begriff der Intentionalität. Ich beziehe mich auf etwas als etwas, zum Beispiel auf den Mann als Mann mit dem Baseball-Schläger und frage mich als nächstes, ob er mich angreifen will. Bei dieser Stufe der Wahrnehmung kann man sagen, dass es sich bereits um semantisierte Wahrnehmung handelt, das bedeutet, dass die Bedeutung des Begriffes Mann bereits mit der Wahrnehmung verbunden ist. Dabei handelt es sich selbstverständlich um eine bewusste Wahrnehmung. Das Ergebnis des Prozesses der Einschätzung wird in verschiedenen Stufen bewusst (dafür wäre der Mann mit dem Baseball-Schläger, der auf der Straße auf Sie zukommt, ein Beispiel. Sie sehen den Mann mit seinem Baseball-Schläger und interpretieren das Wahrgenommene als Gefahr für ihre eigene Person). Die bewusste Einschätzung geht mit einer bloßen Emotionsempfindung (sensational experience of an emotional state) einher, wenn sie nicht konzeptualisiert oder semantisiert ist, das heißt, wenn die Empfindung nicht unter das Konzept Angst oder andere wie Freude und dergleichen fällt. Wenn es sich, wie das beim Menschen meist der Fall ist, aber um eine konzeptualisierte Empfindung handelt, nennen wir sie
8 eine Emotionswahrnehmung (conceptualized emotional experience), da eine Empfindung dann als eine bestimmte Emotion, Angst etwa, wahrgenommen wird. An die Emotionswahrnehmung kann sich auch eine bewusste Bewertung (evaluation / reappraisal) anschließen. Solche bewusste bewertende Gedanken (reflections) über das Wahrgenommene oder das Bewertete (oder andere Inhalte unseres Bewusstseins) werden in Verbindung mit seiner Bedeutung für das Selbst angestellt. Zusammenhang von Basisemotionen und Einschätzungsprozessen Wir gehen davon aus, dass es Basisemotionen im Sinne von basalen emotionalen Fähigkeiten gibt, die sich adaptiv für das Überleben herausgebildet haben. Diese spezifischen basalen emotionalen Dimensionen (Trauer, Ekel, Freude, Angst etc.) sind bis zu einem bestimmten Grad angeboren und treten sehr früh in der Phylogenese in allen uns bekannten Kulturen und bei einigen höheren Säugetieren/Primaten auf. Ausgelöst werden diese Emotionen durch Einschätzungsprozesse, die in ihrem Verlauf dann auch in ihrer rudimentären Form angeboren sein müssen, d.h. es handelt sich hier um bestimmte basale Einschätzungsprozesse. Diese Einschätzungsprozesse stehen uns in geringerem Umfang zur Modifikation zur Verfügung als das bei anderen Emotionen der Fall ist, d.h. dass sie kulturellen Einflüssen und Prägungen, aber auch der Formung durch persönliche Erfahrungen weniger stark unterliegen. Zusammenhang Basisemotionen und komplexen emotionalen Zuständen Das Verhältnis von Emotionen (Verliebtheit, Scham, Stolz) und lang andauernden (dispositionalen) Zuständen (Liebe, Schande, Ehre), die aufeinander bezogen sind, lässt sich folgendermaßen analysieren und konzeptualisieren: die lang andauernden Zustände sind eine Art des Hintergrundgefühls, der Hintergrunddisposition (Liebe) oder in manchen Fällen des Hintergrundwissens (Ehre, Schande), in deren Rahmen Emotionen wie akutes Liebesgefühl, Stolz oder Scham aktualisiert werden. Diese Hintergrundzustände sind stark durch soziale und symbolische Kategorien geprägt, haben aber durchaus natürliche, biologische Grundlagen wie im Falle der Liebe das phylogenetisch angelegte Bindungsverhalten.
Physiologische Komponente. Erlebenskomponente
 Emotion Physiologische Komponente Kognitive Komponente Konative Komponente Vegetative Reaktionen (z.b. EDA; Puls) Zentral nervöse Prozesse (z.b. Aktivierung d. Amygdala) Bewertung der Situation (z.b. gut
Emotion Physiologische Komponente Kognitive Komponente Konative Komponente Vegetative Reaktionen (z.b. EDA; Puls) Zentral nervöse Prozesse (z.b. Aktivierung d. Amygdala) Bewertung der Situation (z.b. gut
Emotionale Entwicklung. Gabriela Römer
 Emotionale Entwicklung Gabriela Römer 22.11.2010 1. Definition Gefühl Vier Komponenten: - motivational (Wunsch, etwas zu tun) - physiologisch (z.b. Pulsfrequenz) - subjektive Gefühle - Kognitionen Beispiel:
Emotionale Entwicklung Gabriela Römer 22.11.2010 1. Definition Gefühl Vier Komponenten: - motivational (Wunsch, etwas zu tun) - physiologisch (z.b. Pulsfrequenz) - subjektive Gefühle - Kognitionen Beispiel:
Inhalt 1 Einleitung Das kleine Einmaleins der Emotionen 3 Grundemotionen: Wie wir sie erkennen und wie wir mit ihnen umgehen
 7 Inhalt 1 Einleitung............................... 11 2 Das kleine Einmaleins der Emotionen.......................... 19 2.1 Emotionale Komponenten................. 19 2.2 Wann reagieren wir überhaupt
7 Inhalt 1 Einleitung............................... 11 2 Das kleine Einmaleins der Emotionen.......................... 19 2.1 Emotionale Komponenten................. 19 2.2 Wann reagieren wir überhaupt
 I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Einführung in die Emotionspsychologie
 'Jörg Merten Einführung in die Emotionspsychologie Mit beiliegender CD-ROM Verlag W. Kohlhammer 1 Einleitung und Überblick 9 1.1 Was ist eine Emotion? 10 1.1.1 Definitionen 12 1.1.2 Komponenten einer Emotion
'Jörg Merten Einführung in die Emotionspsychologie Mit beiliegender CD-ROM Verlag W. Kohlhammer 1 Einleitung und Überblick 9 1.1 Was ist eine Emotion? 10 1.1.1 Definitionen 12 1.1.2 Komponenten einer Emotion
Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen
 Medien Marius Donadello Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen Können bewusste mentale Prozesse kausal wirksam sein? Magisterarbeit Schriftliche Hausarbeit für die Prüfung zur Erlangung
Medien Marius Donadello Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen Können bewusste mentale Prozesse kausal wirksam sein? Magisterarbeit Schriftliche Hausarbeit für die Prüfung zur Erlangung
Erinnerungsprotoll Entwicklungspsychologie 21.Juli 2014 von Clara Mildenberger Prof. Träuble, erster Termin SS2014
 Erinnerungsprotoll Entwicklungspsychologie 21.Juli 2014 von Clara Mildenberger Prof. Träuble, erster Termin SS2014 Ich fand die Klausur relativ fair und man kam mit der Zeit wirklich gut zurecht (viele
Erinnerungsprotoll Entwicklungspsychologie 21.Juli 2014 von Clara Mildenberger Prof. Träuble, erster Termin SS2014 Ich fand die Klausur relativ fair und man kam mit der Zeit wirklich gut zurecht (viele
Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis. Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14.
 Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14. September 2010 Das Wissen Beim Sprechen, Hören, Schreiben und Verstehen finden
Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14. September 2010 Das Wissen Beim Sprechen, Hören, Schreiben und Verstehen finden
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
 Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache
 WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache Verständigung gelingt- manchmal Dr. Mario Fox, 2016 0 Grundsätzliches Menschliche Kommunikation dient dem Austausch von Information und entspringt
WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache Verständigung gelingt- manchmal Dr. Mario Fox, 2016 0 Grundsätzliches Menschliche Kommunikation dient dem Austausch von Information und entspringt
Negative somatische Marker Solche Marker sind als Alarmsignale zu verstehen und mahnen zur Vorsicht.
 Wahrnehmung, Achtsamkeit, Bewusstsein Somatische Marker Damasio nennt die Körpersignale somatische Marker, die das emotionale Erfahrungsgedächtnis liefert. Soma kommt aus dem Griechischen und heißt Körper.
Wahrnehmung, Achtsamkeit, Bewusstsein Somatische Marker Damasio nennt die Körpersignale somatische Marker, die das emotionale Erfahrungsgedächtnis liefert. Soma kommt aus dem Griechischen und heißt Körper.
- wesentlich länger und weniger intensiv - nicht zwangsläufig objektbezogen. - Lazarus: 15 Basisemotionen - Mowrer: Lust & Schmerz als Basisemotion
 1 Emotion 1.2 Definition --> Personenzustände 1.2.1 Begriffsbestimmung Gefühl Emotion Stimmung - spezifische Erlebnisqualität - Objektbezogen - zeitlich datierbare konkrete Episode - aktuelle psychische
1 Emotion 1.2 Definition --> Personenzustände 1.2.1 Begriffsbestimmung Gefühl Emotion Stimmung - spezifische Erlebnisqualität - Objektbezogen - zeitlich datierbare konkrete Episode - aktuelle psychische
!"# # # $% # & '() '* ) ) '()
 !"# # # $% # & '() '* ) ) '() ' &+,+%$,+ +#!"# $% &%!' (!$ ) $ *+ $' +", #" --./"0 " % ' 1"#./234 5 6 4$7308090. 48- Wenn ich jetzt irgendetwas mit Freunden klären muss, zum Beispiel wenn wir Streit oder
!"# # # $% # & '() '* ) ) '() ' &+,+%$,+ +#!"# $% &%!' (!$ ) $ *+ $' +", #" --./"0 " % ' 1"#./234 5 6 4$7308090. 48- Wenn ich jetzt irgendetwas mit Freunden klären muss, zum Beispiel wenn wir Streit oder
Bewusstsein und Willensfreiheit im menschlichen Entscheiden und Tun
 Bewusstsein und Willensfreiheit im menschlichen Entscheiden und Tun (3. Kernthema, Nachbardisziplinen ) Dr. Bettina Walde Philosophisches Seminar Johannes Gutenberg-Universität 55099 Mainz walde@uni-mainz.de
Bewusstsein und Willensfreiheit im menschlichen Entscheiden und Tun (3. Kernthema, Nachbardisziplinen ) Dr. Bettina Walde Philosophisches Seminar Johannes Gutenberg-Universität 55099 Mainz walde@uni-mainz.de
Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten
 !"#$%"&&&'(%!()#*$*+" #",%(*-.)*#) Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten Peter J. Uhlhaas Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit Arbeitsgemeinschaft
!"#$%"&&&'(%!()#*$*+" #",%(*-.)*#) Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten Peter J. Uhlhaas Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit Arbeitsgemeinschaft
Persönlichkeitspsychologie. Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Menschen
 Persönlichkeitspsychologie Every individual is in certain respects Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Menschen Ziele > like all other persons > like some other persons > like no other
Persönlichkeitspsychologie Every individual is in certain respects Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Menschen Ziele > like all other persons > like some other persons > like no other
Inhaltsverzeichnis. I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie
 Inhaltsverzeichnis Vorwort des Herausgebers 13 Einleitung 15 I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie I. KAPITEL. Der Entwkklungsdiarakter der klient-bezogenen Gesprädistherapie
Inhaltsverzeichnis Vorwort des Herausgebers 13 Einleitung 15 I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie I. KAPITEL. Der Entwkklungsdiarakter der klient-bezogenen Gesprädistherapie
KAPITEL I.1 Historische und evolutionsbiologische Wurzeln der Bindungsforschung
 KAPITEL I.1 Historische und evolutionsbiologische Wurzeln der Bindungsforschung I.1.1 Bindung und Bindungstheorie Bindung (attachment) ist die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen,
KAPITEL I.1 Historische und evolutionsbiologische Wurzeln der Bindungsforschung I.1.1 Bindung und Bindungstheorie Bindung (attachment) ist die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen,
Coming out - Ich bin schwul!
 Ratgeber Renate Wedel Coming out - Ich bin schwul! Situation und Beratung der Eltern Coming out - Ich bin schwul! Situation und Beratung der Eltern Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Seite 2 2. Coming out
Ratgeber Renate Wedel Coming out - Ich bin schwul! Situation und Beratung der Eltern Coming out - Ich bin schwul! Situation und Beratung der Eltern Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Seite 2 2. Coming out
Phänomenales Bewußtsein als Problem für den Materialismus. von Alexander Staudacher
 Phänomenales Bewußtsein als Problem für den Materialismus von Alexander Staudacher Walter de Gruyter Berlin New York 2002 Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis V VII Einleitung 1 1. Phänomenales
Phänomenales Bewußtsein als Problem für den Materialismus von Alexander Staudacher Walter de Gruyter Berlin New York 2002 Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis V VII Einleitung 1 1. Phänomenales
Emotionale Entwicklung I
 Emotionale Entwicklung I Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozenten: Maria Vuori, Sabrina Krimmel Sophia Attenberger Isabelle Garzorz Babette Geiger 23.11.10 WS 10/11 Emotionale Entwicklung
Emotionale Entwicklung I Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozenten: Maria Vuori, Sabrina Krimmel Sophia Attenberger Isabelle Garzorz Babette Geiger 23.11.10 WS 10/11 Emotionale Entwicklung
Psychologische Stress-Modelle für Bearbeitung des Stromausfalls
 Psychologische Stress-Modelle für Bearbeitung des Stromausfalls Lazarus und Hobfoll Richard Lazarus (1922-2002) Transaktionale Stressmodell Ereignis Wahrnehmung Nein Erste Einschätzung: Ja Ist das, was
Psychologische Stress-Modelle für Bearbeitung des Stromausfalls Lazarus und Hobfoll Richard Lazarus (1922-2002) Transaktionale Stressmodell Ereignis Wahrnehmung Nein Erste Einschätzung: Ja Ist das, was
Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport. Dr. Peter Kovar
 Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport Dr. Peter Kovar Emotionen Sind komplexe Muster von Veränderungen, welche physiologische Erregung Gefühle kognitive
Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport Dr. Peter Kovar Emotionen Sind komplexe Muster von Veränderungen, welche physiologische Erregung Gefühle kognitive
Tag einundzwanzig Arbeitsblatt 1
 Arbeitsblatt 1 1 Was denkst du über diese Geschichte? Fragen zum Text Erinnere dich: Was ist bisher geschehen? Inwiefern verhält sich Ernest am Weg zur Schule anders als sonst? Hast du eine Idee, warum
Arbeitsblatt 1 1 Was denkst du über diese Geschichte? Fragen zum Text Erinnere dich: Was ist bisher geschehen? Inwiefern verhält sich Ernest am Weg zur Schule anders als sonst? Hast du eine Idee, warum
Theorien der Persönlichkeit. Wintersemester 2008/2009 Gabriele Helga Franke
 Theorien der Persönlichkeit Wintersemester 2008/2009 Gabriele Helga Franke 10. Theorien der Persönlichkeit GHF im WiSe 2008 / 2009 an der HS MD- SDL(FH) im Studiengang Rehabilitationspsychologie, B.Sc.,
Theorien der Persönlichkeit Wintersemester 2008/2009 Gabriele Helga Franke 10. Theorien der Persönlichkeit GHF im WiSe 2008 / 2009 an der HS MD- SDL(FH) im Studiengang Rehabilitationspsychologie, B.Sc.,
Kritik der Urteilskraft
 IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Anaconda INHALT Vorrede...................................... 13 Einleitung..................................... 19 I. Von der Einteilung der Philosophie..............
IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Anaconda INHALT Vorrede...................................... 13 Einleitung..................................... 19 I. Von der Einteilung der Philosophie..............
Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters
 Horst Nickel o.pfofessor an der Universität Düsseldorf Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Band i Allgemeine Grundlagen Die Entwicklung bis zum Schuleintritt Dritte, durchgesehene und
Horst Nickel o.pfofessor an der Universität Düsseldorf Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Band i Allgemeine Grundlagen Die Entwicklung bis zum Schuleintritt Dritte, durchgesehene und
Affektive Verarbeitung
 Affektive Verarbeitung IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 1 Kognitive Schemata Die relevanten, problematischen Schemata, die es zu bearbeiten gibt, können kognitive Schemata sein, wie Überzeugungen, Konstruktionen
Affektive Verarbeitung IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 1 Kognitive Schemata Die relevanten, problematischen Schemata, die es zu bearbeiten gibt, können kognitive Schemata sein, wie Überzeugungen, Konstruktionen
Functional consequences of perceiving facial expressions of emotion without awareness
 Functional consequences of perceiving facial expressions of emotion without awareness Artikel von John D. Eastwood und Daniel Smilek Referent(Inn)en: Sarah Dittel, Carina Heeke, Julian Berwald, Moritz
Functional consequences of perceiving facial expressions of emotion without awareness Artikel von John D. Eastwood und Daniel Smilek Referent(Inn)en: Sarah Dittel, Carina Heeke, Julian Berwald, Moritz
3.1 Das kognitive Modell 45 3.2 Annahmen 47 3.3 Der Zusammenhang zwischen Verhalten und automatischen Gedanken 51
 http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-27955-0 Inhaltsverzeichnis Vorwort 12 1 Einführung in die Kognitive Verhaltenstherapie 15 1.1 Was ist Kognitive Verhaltenstherapie?
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-27955-0 Inhaltsverzeichnis Vorwort 12 1 Einführung in die Kognitive Verhaltenstherapie 15 1.1 Was ist Kognitive Verhaltenstherapie?
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Motivationale und Emotionale Aspekte der Psychologie interkulturellen Handelns
 Motivationale und Emotionale Aspekte der Psychologie interkulturellen Handelns Blockseminar: Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenz an der HHU 04.-05.05.2007 bei PD Dr. Petra Buchwald Referentin:
Motivationale und Emotionale Aspekte der Psychologie interkulturellen Handelns Blockseminar: Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenz an der HHU 04.-05.05.2007 bei PD Dr. Petra Buchwald Referentin:
Spinoza: Philosophische Therapeutik der Emotionen
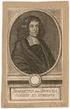 Fragmente aus: Spinoza: Philosophische Therapeutik der Emotionen Ursula Renz (...) Viele der von Spinoza erörterten Sekundäraffekte basieren auf einem Mechanismus, der in 3p14 wie folgt umschrieben wird:
Fragmente aus: Spinoza: Philosophische Therapeutik der Emotionen Ursula Renz (...) Viele der von Spinoza erörterten Sekundäraffekte basieren auf einem Mechanismus, der in 3p14 wie folgt umschrieben wird:
Bernd Prien. Kants Logik der Begrie
 Bernd Prien Kants Logik der Begrie Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Die Struktur der Erkenntnis 8 2.1 Erkenntnis im eigentlichen Sinne........................ 8 2.2 Die objektive Realität von Begrien......................
Bernd Prien Kants Logik der Begrie Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Die Struktur der Erkenntnis 8 2.1 Erkenntnis im eigentlichen Sinne........................ 8 2.2 Die objektive Realität von Begrien......................
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen
 Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte
 Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte Das grundlegende Kennzeichen des menschlichen Konflikts ist das Bewußtsein von ihm bei den Teilnehmern. S. 222 Erste Klassifikation Teilnehmer Streitpunkte Mittel
Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte Das grundlegende Kennzeichen des menschlichen Konflikts ist das Bewußtsein von ihm bei den Teilnehmern. S. 222 Erste Klassifikation Teilnehmer Streitpunkte Mittel
Prolog - I- - II- Über Sammlung und ihre Gegenstände: Erstellung eines Idealzustandes
 Exposition Text Prolog Über Reflexion Es ist schwierig zu analysieren, strukturieren und systematisieren. Bezeichnung und Bezeichnetes beginnen (ineinander) zu fluktuieren. Bezeichnungen changieren noch
Exposition Text Prolog Über Reflexion Es ist schwierig zu analysieren, strukturieren und systematisieren. Bezeichnung und Bezeichnetes beginnen (ineinander) zu fluktuieren. Bezeichnungen changieren noch
Emotionale Entwicklung I: Emotionsverständnis. Die Entwicklung von Emotionsverständnis und sein Einfluss auf die soziale Kompetenz
 Emotionale Entwicklung I: Emotionsverständnis Die Entwicklung von Emotionsverständnis und sein Einfluss auf die soziale Kompetenz Emotionsverständnis: Definition das Verständnis davon, wie man Emotionen
Emotionale Entwicklung I: Emotionsverständnis Die Entwicklung von Emotionsverständnis und sein Einfluss auf die soziale Kompetenz Emotionsverständnis: Definition das Verständnis davon, wie man Emotionen
Frieder Nake: Information und Daten
 Frieder Nake: Information und Daten Mit Grundlagen der Zeichentheorie nach Morris Seminar 31120: Information Philosophische und informationswissenschaftliche Perspektiven, SS 2004 Frieder Nake: Information
Frieder Nake: Information und Daten Mit Grundlagen der Zeichentheorie nach Morris Seminar 31120: Information Philosophische und informationswissenschaftliche Perspektiven, SS 2004 Frieder Nake: Information
Sprachlich-kulturelle
 Sprachlich-kulturelle Auslösung von Konflikten Tobias Schröder, FU Berlin Interdisziplinäres Wolfgang-Köhler-Zentrum zur Erforschung von Konflikten in intelligenten Systemen - Workshop Soziale Konflikte
Sprachlich-kulturelle Auslösung von Konflikten Tobias Schröder, FU Berlin Interdisziplinäres Wolfgang-Köhler-Zentrum zur Erforschung von Konflikten in intelligenten Systemen - Workshop Soziale Konflikte
Seminar Kognitive Entwicklung G H R D ab 2 HSe/se 2stg. Di IV 206
 Seminar Kognitive Entwicklung G H R D ab 2 HSe/se 2stg. Di 10 12 IV 206 Prof. Dr. C. Mischo Folien unter http://home.ph-freiburg.de/mischofr/lehre/entkss06/ Benutzername: Teilnehmer Kennwort: entkss06
Seminar Kognitive Entwicklung G H R D ab 2 HSe/se 2stg. Di 10 12 IV 206 Prof. Dr. C. Mischo Folien unter http://home.ph-freiburg.de/mischofr/lehre/entkss06/ Benutzername: Teilnehmer Kennwort: entkss06
Die Energie ist unergründlich, unermesslich und, als eine universelle Lebenskraft unbegreiflich für die Menschen.
 Der Begriff Heilung in diesem Dokument ist jeweils zu verstehen als geistige/spirituelle Heilung durch das Auflegen der Hände einer in Reiki eingeweihten Person. Die weibliche Form des grammatischen Genus
Der Begriff Heilung in diesem Dokument ist jeweils zu verstehen als geistige/spirituelle Heilung durch das Auflegen der Hände einer in Reiki eingeweihten Person. Die weibliche Form des grammatischen Genus
Stress entsteht im Kopf Die Schlüsselrolle von Denkmustern im Umgang mit Stress und Belastungen
 Stress entsteht im Kopf Die Schlüsselrolle von Denkmustern im Umgang mit Stress und Belastungen Betriebliches Eingliederungsmanagement in Schleswig-Holstein 2016 Fachtag und Auszeichnung Büdelsdorf, 7.
Stress entsteht im Kopf Die Schlüsselrolle von Denkmustern im Umgang mit Stress und Belastungen Betriebliches Eingliederungsmanagement in Schleswig-Holstein 2016 Fachtag und Auszeichnung Büdelsdorf, 7.
Selbstkommunikation und Selbstbewertung
 Dipl.-Psych. Michael Schellberg Kurs: Die Rechte Rede eine Sprache zum Glück Samten Dargye Ling, Tibet-Zentrum Hannover Selbstkommunikation und Selbstbewertung Der Gedanke geht dem Gefühl voraus 1 Wir
Dipl.-Psych. Michael Schellberg Kurs: Die Rechte Rede eine Sprache zum Glück Samten Dargye Ling, Tibet-Zentrum Hannover Selbstkommunikation und Selbstbewertung Der Gedanke geht dem Gefühl voraus 1 Wir
Emotionen in der Mensch-Technik-Interaktion: Implikation für zukünftige Anwendungen
 Emotionen in der Mensch-Technik-Interaktion: Implikation für zukünftige Anwendungen Sascha Mahlke Technische Universität Berlin Zentrum Mensch-Maschine-Systeme Perspektiven auf Emotionen in der MTI Nutzungserleben
Emotionen in der Mensch-Technik-Interaktion: Implikation für zukünftige Anwendungen Sascha Mahlke Technische Universität Berlin Zentrum Mensch-Maschine-Systeme Perspektiven auf Emotionen in der MTI Nutzungserleben
Die Quantitative und Qualitative Sozialforschung unterscheiden sich bei signifikanten Punkten wie das Forschungsverständnis, der Ausgangspunkt oder
 1 2 3 Die Quantitative und Qualitative Sozialforschung unterscheiden sich bei signifikanten Punkten wie das Forschungsverständnis, der Ausgangspunkt oder die Forschungsziele. Ein erstes Unterscheidungsmerkmal
1 2 3 Die Quantitative und Qualitative Sozialforschung unterscheiden sich bei signifikanten Punkten wie das Forschungsverständnis, der Ausgangspunkt oder die Forschungsziele. Ein erstes Unterscheidungsmerkmal
Anmerkung: Mit «(T)» sind die stärker theoriehaltigen Kapitel markiert.
 Anmerkung: Mit «(T)» sind die stärker theoriehaltigen Kapitel markiert. Vorwort 10 1. Einleitung 12 1.1 Das Verhältnis von Figur und Handlung 15 1.2 Wozu Figurenanalyse? 21 1.3 Auf der Suche nach einer
Anmerkung: Mit «(T)» sind die stärker theoriehaltigen Kapitel markiert. Vorwort 10 1. Einleitung 12 1.1 Das Verhältnis von Figur und Handlung 15 1.2 Wozu Figurenanalyse? 21 1.3 Auf der Suche nach einer
Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden und heilpädagogisch praktiziert
 8 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ingeborg Milz Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden
8 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ingeborg Milz Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden
Einführung in die pädagogisch-psychologische Forschung zum leistungsbezogenen Denken und Fühlen
 Geisteswissenschaft Udo Schultheis Einführung in die pädagogisch-psychologische Forschung zum leistungsbezogenen Denken und Fühlen Essay Einführung in die pädagogischpsychologische Forschung zum leistungsbezogenen
Geisteswissenschaft Udo Schultheis Einführung in die pädagogisch-psychologische Forschung zum leistungsbezogenen Denken und Fühlen Essay Einführung in die pädagogischpsychologische Forschung zum leistungsbezogenen
Einführung in die Logik
 Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Rationalismus in der praktischen Theorie
 Matthias Mahlmann Rationalismus in der praktischen Theorie Normentheorie und praktische Kompetenz 2. Auflage Nomos Inhaltsverzeichnis Einleitung 13 TEIL 1 : DIE WIEDERENTDECKUNG DER PRAKTISCHEN KOMPETENZ
Matthias Mahlmann Rationalismus in der praktischen Theorie Normentheorie und praktische Kompetenz 2. Auflage Nomos Inhaltsverzeichnis Einleitung 13 TEIL 1 : DIE WIEDERENTDECKUNG DER PRAKTISCHEN KOMPETENZ
SCIT Social Cognition & Interaction Training
 SCIT Social Cognition & Interaction Training Roberts, D.L., Penn, D.L. & Combs, D.R., 2006 Schizophrenie, FS 2008, 18. März 2008 annakatharina.heuberger@unifr.ch Einleitung Theoretischer Hintergrund Anwendung
SCIT Social Cognition & Interaction Training Roberts, D.L., Penn, D.L. & Combs, D.R., 2006 Schizophrenie, FS 2008, 18. März 2008 annakatharina.heuberger@unifr.ch Einleitung Theoretischer Hintergrund Anwendung
Genuine ästhetische: Erlebnisse, Eigenschaften, Einstellungen. In der Diskussion werden 1 oder 2 abgelehnt, aber nicht...
 Genuine ästhetische: Erlebnisse, Eigenschaften, Einstellungen 1 genuin ästhetische Eigenschaften: In manchen Kontexten lassen sich ästhetische Prädikate nicht ohne Sinnänderung durch lauter nicht-ästhetische
Genuine ästhetische: Erlebnisse, Eigenschaften, Einstellungen 1 genuin ästhetische Eigenschaften: In manchen Kontexten lassen sich ästhetische Prädikate nicht ohne Sinnänderung durch lauter nicht-ästhetische
Beschreibung der Sozialphobie
 Beschreibung der Sozialphobie Sozialphobie Angst, die in Situationen auftritt, in denen eine Person im Mittelpunkt steht, wenn sie bestimmte Tätigkeiten ausführt. Situationen dieser Art sind z.b.: Öffentliches
Beschreibung der Sozialphobie Sozialphobie Angst, die in Situationen auftritt, in denen eine Person im Mittelpunkt steht, wenn sie bestimmte Tätigkeiten ausführt. Situationen dieser Art sind z.b.: Öffentliches
Bestimmungsfaktoren des Konsumentenverhaltens
 Der,,denkfaule Konsument Welche Aspekte bestimmen das Käuferverhalten? Ein Ausblick auf passives Informationsverhalten, Involvement und Auswirkungen auf Werbemaßnahmen Bestimmungsfaktoren des Konsumentenverhaltens
Der,,denkfaule Konsument Welche Aspekte bestimmen das Käuferverhalten? Ein Ausblick auf passives Informationsverhalten, Involvement und Auswirkungen auf Werbemaßnahmen Bestimmungsfaktoren des Konsumentenverhaltens
DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART
 MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
D.h.: Das Spielmodel ist eine Richtlinie bzw. ein Führungsbuch der ganzen Entwicklungsprozess. Dadurch kann die Rolle des Trainers definiert werden:
 Tatsuro Suzuki Was ist taktische Periodisierung? - Extra. S. 35. Die Theorie (= Spielmodel) ist nicht ein Erkenntnis sondern ein Wissen, dieses Erkenntnis zu ermöglichen. Die Theorie an sich ist nicht
Tatsuro Suzuki Was ist taktische Periodisierung? - Extra. S. 35. Die Theorie (= Spielmodel) ist nicht ein Erkenntnis sondern ein Wissen, dieses Erkenntnis zu ermöglichen. Die Theorie an sich ist nicht
Companion Technologie
 Companion Technologie Emotionen erkennen, verstehen und kai.bielenberg@haw-hamburg.de Agenda 1. Einleitung a. Was war nochmal Companion Technologie? b. Teilbereiche c. Warum Emotionen? 2. Ansätze a. Facial
Companion Technologie Emotionen erkennen, verstehen und kai.bielenberg@haw-hamburg.de Agenda 1. Einleitung a. Was war nochmal Companion Technologie? b. Teilbereiche c. Warum Emotionen? 2. Ansätze a. Facial
Ich bin ein Held. Ziel: Kinder mit Angst(-zuständen) zu (mehr) Selbstbewusstsein zu verhelfen. Erik Grieger Masterarbeit Januar
 Ich bin ein Held Ziel: Kinder mit Angst(-zuständen) zu (mehr) Selbstbewusstsein zu verhelfen Erik Grieger Masterarbeit Januar 2014 1 Hintergrund: Nach einem Brand unter unserem Haus, der mit starker Rauchentwicklung
Ich bin ein Held Ziel: Kinder mit Angst(-zuständen) zu (mehr) Selbstbewusstsein zu verhelfen Erik Grieger Masterarbeit Januar 2014 1 Hintergrund: Nach einem Brand unter unserem Haus, der mit starker Rauchentwicklung
FOSUMOS Persönlichkeitsstörungen: Ein alternativer Blick. Felix Altorfer 1
 FOSUMOS 11.06.08 Persönlichkeitsstörungen: Ein alternativer Blick Felix Altorfer 1 Persönlichkeitsstörungen Synonyma/Historische Begriffe Psychopathische Persönlichkeit (Kraeppelin 1903, K. Schneider 1923)
FOSUMOS 11.06.08 Persönlichkeitsstörungen: Ein alternativer Blick Felix Altorfer 1 Persönlichkeitsstörungen Synonyma/Historische Begriffe Psychopathische Persönlichkeit (Kraeppelin 1903, K. Schneider 1923)
Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an»
 Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an» Meine Ziele oder meine Absicht für Heute Abend: Sie erhalten ein Wissen über die Zusammensetzung der KS Sie erhalten Tipps
Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an» Meine Ziele oder meine Absicht für Heute Abend: Sie erhalten ein Wissen über die Zusammensetzung der KS Sie erhalten Tipps
Umgang mit Veränderungen Prof. Dr. Christian Willems Fachhochschule Gelsenkirchen Abteilung Recklinghausen
 Umgang mit en Prof. Dr. Christian Willems Fachhochschule Gelsenkirchen Abteilung Recklinghausen Umgang mit en Christian Willems - 30.06.2003 Seite 1 Nichts ist so beständig wie der Wandel......oder über
Umgang mit en Prof. Dr. Christian Willems Fachhochschule Gelsenkirchen Abteilung Recklinghausen Umgang mit en Christian Willems - 30.06.2003 Seite 1 Nichts ist so beständig wie der Wandel......oder über
Wahrnehmung von Personen als Gruppenmitglieder
 Mathias Blanz Wahrnehmung von Personen als Gruppenmitglieder Untersuchungen zur Salienz sozialer Kategorien Waxmann Münster / New York München / Berlin Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung XI 1 Einleitung:
Mathias Blanz Wahrnehmung von Personen als Gruppenmitglieder Untersuchungen zur Salienz sozialer Kategorien Waxmann Münster / New York München / Berlin Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung XI 1 Einleitung:
Items Einstellungen sportliches Engagement der Freundinnen und Freunde Frauen keinen Wenige / niemand meiner Freundinnen und Freunde sind der Meinung,
 9 Ergebnisse: Soziales Umfeld Freundinnen und Freunde 117 9 Freundinnen und Freunde Im folgenden Kapitel wird herausgearbeitet, wie die Schülerinnen und Studentinnen die Einstellungen und das Sportverhalten
9 Ergebnisse: Soziales Umfeld Freundinnen und Freunde 117 9 Freundinnen und Freunde Im folgenden Kapitel wird herausgearbeitet, wie die Schülerinnen und Studentinnen die Einstellungen und das Sportverhalten
THEORY OF MIND. Sozial-kognitive Entwicklung
 06.12.2010 THEORY OF MIND Sozial-kognitive Entwicklung Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozent: Dipl.-Psych. Susanne Kristen Referentin: Sabine Beil Gliederung 1. Definition und Testparadigma
06.12.2010 THEORY OF MIND Sozial-kognitive Entwicklung Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozent: Dipl.-Psych. Susanne Kristen Referentin: Sabine Beil Gliederung 1. Definition und Testparadigma
Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein
 2 Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein 1. Der logische Behaviourismus Hauptvertreter: Gilbert Ryle, Carl Gustav Hempel Blütezeit:
2 Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein 1. Der logische Behaviourismus Hauptvertreter: Gilbert Ryle, Carl Gustav Hempel Blütezeit:
Zeitgenössische Kunst verstehen. Wir machen Programm Museumsdienst Köln
 Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.
Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.
Entwicklungspsychologie: Einführung und die Theorie von Piaget (19.6.) Einführung und Theorienüberblick Die Entwicklungspsychologie von Jean Piaget
 Entwicklungspsychologie: Einführung und die Theorie von Piaget (19.6.) Einführung und Theorienüberblick Die Entwicklungspsychologie von Jean Piaget Literatur für den Bereich Entwicklungspsychologie Zimbardo,
Entwicklungspsychologie: Einführung und die Theorie von Piaget (19.6.) Einführung und Theorienüberblick Die Entwicklungspsychologie von Jean Piaget Literatur für den Bereich Entwicklungspsychologie Zimbardo,
Die Theorie von Jean Piaget (2.5.) 1. Phasen der kognitiven Entwicklung 2. Annahmen zum Prozess der Entwicklung 3. Pädagogische Anwendung
 Die Theorie von Jean Piaget (2.5.) 1. Phasen der kognitiven Entwicklung 2. Annahmen zum Prozess der Entwicklung 3. Pädagogische Anwendung Piagets Phasentheorie: Grundlegendes Strukturalistische Annahmen
Die Theorie von Jean Piaget (2.5.) 1. Phasen der kognitiven Entwicklung 2. Annahmen zum Prozess der Entwicklung 3. Pädagogische Anwendung Piagets Phasentheorie: Grundlegendes Strukturalistische Annahmen
Datengewinnung durch Introspektion Beobachtung/Beschreibung eigenen Erlebens wie Gedanken, Wünsche, Motive, Träume, Erinnerungen.
 ERLEBNISPSYCHOLOGIE Datengewinnung durch Introspektion Beobachtung/Beschreibung eigenen Erlebens wie Gedanken, Wünsche, Motive, Träume, Erinnerungen. Hauptvertreter Wiener Schule (Karl Bühler, Hubert Rohracher,
ERLEBNISPSYCHOLOGIE Datengewinnung durch Introspektion Beobachtung/Beschreibung eigenen Erlebens wie Gedanken, Wünsche, Motive, Träume, Erinnerungen. Hauptvertreter Wiener Schule (Karl Bühler, Hubert Rohracher,
Überblick. Emotionstheorien, die sich direkt auf Darwin beziehen: McDougall (1908) Plutchik (1958) Projekt einer Evolutionären Psychologie
 Überblick Emotionstheorien,diesichdirektaufDarwinbeziehen: McDougall(1908) Plutchik(1958) Projekteiner EvolutionärenPsychologie KritisierenSiedieTheorievonEkmanausSichtder Verhaltensökologie. WiewürdeEkmandaraufantworten?
Überblick Emotionstheorien,diesichdirektaufDarwinbeziehen: McDougall(1908) Plutchik(1958) Projekteiner EvolutionärenPsychologie KritisierenSiedieTheorievonEkmanausSichtder Verhaltensökologie. WiewürdeEkmandaraufantworten?
Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach
 Kantonsschule Zug l Gymnasium Pädagogik/Psychologie Ergänzungsfach Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 0 0 0 5 B. Didaktische
Kantonsschule Zug l Gymnasium Pädagogik/Psychologie Ergänzungsfach Pädagogik/Psychologie Lehrplan für das Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 0 0 0 5 B. Didaktische
Soziale Vorstellungen über Steuern und EU-Steuern in Österreich
 Soziale Vorstellungen über n und -n in Österreich Gliederung Theorie compliance Soziale Repräsentationen (Vorstellungen) Soziale Identität Soziale Vorstellungen über n Studie Forschungsfragen Datenerhebung
Soziale Vorstellungen über n und -n in Österreich Gliederung Theorie compliance Soziale Repräsentationen (Vorstellungen) Soziale Identität Soziale Vorstellungen über n Studie Forschungsfragen Datenerhebung
Erfahrungswissenschaft und die Theorie. * Marc Hassenzahl // Erlebnis und Interaktion // Folkwang Universität der Künste
 Erfahrungswissenschaft und die Theorie. * Marc Hassenzahl // Erlebnis und Interaktion // Folkwang Universität der Künste Wissen gewinnen. Wandmacher 2002. Was ist Wissen? _ "Gesamtheit der Kenntnisse und
Erfahrungswissenschaft und die Theorie. * Marc Hassenzahl // Erlebnis und Interaktion // Folkwang Universität der Künste Wissen gewinnen. Wandmacher 2002. Was ist Wissen? _ "Gesamtheit der Kenntnisse und
Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb
 Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb 13-SQM-04 (Naturwissenschaft für Querdenker) 09.07.2015 Simeon Schüz Gliederung 1. Einleitung 2. Die Behavioristische Hypothese 2.1 Grundlegende Annahmen
Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb 13-SQM-04 (Naturwissenschaft für Querdenker) 09.07.2015 Simeon Schüz Gliederung 1. Einleitung 2. Die Behavioristische Hypothese 2.1 Grundlegende Annahmen
Bewusstsein entwickeln für das ALL-EINS!
 Spezial-Report 08 Bewusstsein entwickeln für das ALL-EINS! Einleitung Willkommen zum Spezial-Report Bewusstsein entwickeln für das ALL-EINS!... Ich habe bewusst den Titel dieses Reports so ausgesucht...
Spezial-Report 08 Bewusstsein entwickeln für das ALL-EINS! Einleitung Willkommen zum Spezial-Report Bewusstsein entwickeln für das ALL-EINS!... Ich habe bewusst den Titel dieses Reports so ausgesucht...
Kognitive Emotionstheorien. Arnold & Lazarus. Überblick. Überblick. Uni Gießen. Behaviorismus: Situation Reaktion
 Behaviorismus Kognitivismus Kognitive Emotionstheorien Behaviorismus: Situation Reaktion Arnold & Lazarus - bestenfalls Annahmen über Assoziation Kognitivismus: Knut Drewing Situation interne Verarbeitung
Behaviorismus Kognitivismus Kognitive Emotionstheorien Behaviorismus: Situation Reaktion Arnold & Lazarus - bestenfalls Annahmen über Assoziation Kognitivismus: Knut Drewing Situation interne Verarbeitung
Geisteswissenschaft. Robin Materne. Utilitarismus. Essay
 Geisteswissenschaft Robin Materne Utilitarismus Essay Essay IV Utilitarismus Von Robin Materne Einführung in die praktische Philosophie 24. Juni 2011 1 Essay IV Utilitarismus Iphigenie: Um Guts zu tun,
Geisteswissenschaft Robin Materne Utilitarismus Essay Essay IV Utilitarismus Von Robin Materne Einführung in die praktische Philosophie 24. Juni 2011 1 Essay IV Utilitarismus Iphigenie: Um Guts zu tun,
Einführung in die Bewegungswissenschaft SS 2007
 Einführung in die SS 2007 Fragen zum Mentalen Was ist? Lässt sich die behauptete Wirkung von Mentalem empirisch nachweisen? Wie lässt sich die Wirkung von Mentalem erklären? Definitionen von Mentalem I...
Einführung in die SS 2007 Fragen zum Mentalen Was ist? Lässt sich die behauptete Wirkung von Mentalem empirisch nachweisen? Wie lässt sich die Wirkung von Mentalem erklären? Definitionen von Mentalem I...
Wahrnehmung in der Mediation
 Bearbeitungsstand:31.12.2006 15:22, Seite 1 von 6 Wahrnehmung in der Mediation Das Lexikon 1 formuliert es einmal so: Wahrnehmung ist ein geistig-körperlicher Prozess: Ein Individuum stellt eine Anschauung
Bearbeitungsstand:31.12.2006 15:22, Seite 1 von 6 Wahrnehmung in der Mediation Das Lexikon 1 formuliert es einmal so: Wahrnehmung ist ein geistig-körperlicher Prozess: Ein Individuum stellt eine Anschauung
Anhang: Modulbeschreibung
 Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Fragen der Ethik, Moritz Schlick Kapitel II: Warum handelt der Mensch?
 Fragen der Ethik, Moritz Schlick Kapitel II: Warum handelt der Mensch? 1. Tätigkeit und Handlung Wie die Erfahrung lehrt, gibt nicht jedes beliebige menschliche Tun Anlaß zu sittlicher Beurteilung; vielmehr
Fragen der Ethik, Moritz Schlick Kapitel II: Warum handelt der Mensch? 1. Tätigkeit und Handlung Wie die Erfahrung lehrt, gibt nicht jedes beliebige menschliche Tun Anlaß zu sittlicher Beurteilung; vielmehr
Der Begriff Lesen in der PISA-Studie
 Der Begriff Lesen in der PISA-Studie Ziel der PISA-Studie war, Leseleistungen in unterschiedlichen Ländern empirisch überprüfen und vergleichen zu können. Dieser Ansatz bedeutet, dass im Vergleich zum
Der Begriff Lesen in der PISA-Studie Ziel der PISA-Studie war, Leseleistungen in unterschiedlichen Ländern empirisch überprüfen und vergleichen zu können. Dieser Ansatz bedeutet, dass im Vergleich zum
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Ist Mimik kulturübergreifend gleich? Seite 10. Was sind Mikroexpressionen? Seite 15. Was bedeutet Facial Feedback? Seite 18
 Ist Mimik kulturübergreifend gleich? Seite 10 Was sind Mikroexpressionen? Seite 15 Was bedeutet Facial Feedback? Seite 18 1. Mimik die Bühne unserer Emotionen Stellen Sie sich bitte die folgende Situation
Ist Mimik kulturübergreifend gleich? Seite 10 Was sind Mikroexpressionen? Seite 15 Was bedeutet Facial Feedback? Seite 18 1. Mimik die Bühne unserer Emotionen Stellen Sie sich bitte die folgende Situation
Einheit 2. Wahrnehmung
 Einheit 2 Wahrnehmung Wahrnehmung bezeichnet in der Psychologie und Physiologie die Summe der Schritte Aufnahme, Interpretation, Auswahl und Organisation von sensorischen Informationen. Es sind demnach
Einheit 2 Wahrnehmung Wahrnehmung bezeichnet in der Psychologie und Physiologie die Summe der Schritte Aufnahme, Interpretation, Auswahl und Organisation von sensorischen Informationen. Es sind demnach
Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten
 1 Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten unterscheiden zu können. Beschwerden werden zu depressiven
1 Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten unterscheiden zu können. Beschwerden werden zu depressiven
Aufbau reflexiver Kompetenzen durch die Theorie-Praxis-Verzahnung in Unterricht, Praktika und Praxisbegleitung. Tobias Kämper, Ute Weber
 Aufbau reflexiver Kompetenzen durch die Theorie-Praxis-Verzahnung in Unterricht, Praktika und Praxisbegleitung 2 Wortbedeutung Reflexion Das Zurückgeworfen werden von Strahlen Das Nachdenken, Überlegung,
Aufbau reflexiver Kompetenzen durch die Theorie-Praxis-Verzahnung in Unterricht, Praktika und Praxisbegleitung 2 Wortbedeutung Reflexion Das Zurückgeworfen werden von Strahlen Das Nachdenken, Überlegung,
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Wirtschaftspsychologie untersucht Verhalten und Erleben im ökonomischen Umfeld sowie den sozialen Zusammenhängen.
 Wirtschaftspsychologie - Einführung Wirtschaftspsychologie untersucht Verhalten und Erleben im ökonomischen Umfeld sowie den sozialen Zusammenhängen. Ziel: Erklären und Vorhersagen von wirtschaftlichem
Wirtschaftspsychologie - Einführung Wirtschaftspsychologie untersucht Verhalten und Erleben im ökonomischen Umfeld sowie den sozialen Zusammenhängen. Ziel: Erklären und Vorhersagen von wirtschaftlichem
Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori
 Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund?
 Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund? 22. Treffen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen im Landkreis Esslingen 13. November 2010, Esslingen Andreas Knuf www.gesundungswege.de
Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund? 22. Treffen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen im Landkreis Esslingen 13. November 2010, Esslingen Andreas Knuf www.gesundungswege.de
5 Entwicklungspsychologie
 5 Entwicklungspsychologie 5.1 Grundlagen Entwicklungspsychologie ist eine Grundlagendisziplin der Psychologie (vgl. Kap. 1). Sie kann auf eine etwa hundertjährige Geschichte zurückblicken. 5.1.1 Begriffsklärung
5 Entwicklungspsychologie 5.1 Grundlagen Entwicklungspsychologie ist eine Grundlagendisziplin der Psychologie (vgl. Kap. 1). Sie kann auf eine etwa hundertjährige Geschichte zurückblicken. 5.1.1 Begriffsklärung
Piaget II. Wintersemester 2012/2013. Mo Uhr. Alexander Renkl
 Piaget II Wintersemester 2012/2013 Mo 16-18 Uhr Alexander Renkl Wiederholung: Phasen 1 Sensumotorische Phase (1-2 Jahre) 2 Präoperationale Phase (2-7 Jahre) 3 Phase der konkreten Operationen (7-11 Jahre)
Piaget II Wintersemester 2012/2013 Mo 16-18 Uhr Alexander Renkl Wiederholung: Phasen 1 Sensumotorische Phase (1-2 Jahre) 2 Präoperationale Phase (2-7 Jahre) 3 Phase der konkreten Operationen (7-11 Jahre)
Checkliste: Die 5 Lebensbereiche
 Checkliste: Die 5 Lebensbereiche Sie halten grade den ersten Teil einer Checkliste in den Händen, die Ihr Leben in positiver Weise verändern kann. Ein erfolgreiches Leben spiegelt sich insbesondere in
Checkliste: Die 5 Lebensbereiche Sie halten grade den ersten Teil einer Checkliste in den Händen, die Ihr Leben in positiver Weise verändern kann. Ein erfolgreiches Leben spiegelt sich insbesondere in
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE. Markus Paulus. Radboud University Nijmegen DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A.
 GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen V, EXKURS: DIE THEORETISCHE PERSPEKTIVE DES SYMBOLISCHEN INTERAKTIONISMUS 1, GRUNDLAGEN Kritik: Normen
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen V, EXKURS: DIE THEORETISCHE PERSPEKTIVE DES SYMBOLISCHEN INTERAKTIONISMUS 1, GRUNDLAGEN Kritik: Normen
Teil A: Zentrale Ziele des Pragmatischen Pädagogikunterrichts
 III Vorwort der Reihenherausgeber IX Vorwort 1 Einleitung Bezeichnung, Form und Anliegen der Didaktik 5 1. Die Bezeichnung Pragmatische Fachdidaktik Pädagogik" 5 2. Die Präsentation der Fachdidaktik in
III Vorwort der Reihenherausgeber IX Vorwort 1 Einleitung Bezeichnung, Form und Anliegen der Didaktik 5 1. Die Bezeichnung Pragmatische Fachdidaktik Pädagogik" 5 2. Die Präsentation der Fachdidaktik in
Krank gesund; glücklich unglücklich; niedergeschlagen froh?
 Krank gesund; glücklich unglücklich; niedergeschlagen froh? Stimmungen schwanken Seit Jahren macht sich im Gesundheitsbereich ein interessantes Phänomen bemerkbar es werden immer neue Krankheitsbilder
Krank gesund; glücklich unglücklich; niedergeschlagen froh? Stimmungen schwanken Seit Jahren macht sich im Gesundheitsbereich ein interessantes Phänomen bemerkbar es werden immer neue Krankheitsbilder
sich die Schuhe zubinden können den Weg zum Bahnhof kennen die Quadratwurzel aus 169 kennen
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
