Grenzflächen und kolloid-disperse Systeme
|
|
|
- Heiko Schuler
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hans-Dieter Dörfler Grenzflächen und kolloid-disperse Systeme Physik und Chemie Mit 579, zum Teil farbigen Abbildungen und 88 Tabellen Springer
2 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung: Herkunft und Gegenstand der Kolloidwissenschaft Historischer Hintergrund Definition kolloider Systeme Einteilung kolloider Systeme Grenzfläche und Grenzphase Arbeitsmethoden und Bearbeitungsgebiete 13 Zusammenfassung 17 Fragen 18 Literatur 18 2 Grenzflächenthermodynamik Grundlagen: Grenzphase, Grenzflächenkonzentration, Zustandsfunktionen Adsorption in flüssigen Grenzphasen Thermodynamik der Spreitung Thermodynamik der Adsorption an festen Oberflächen GAUB-LAPLACE-Gleichung und THOMSON-Gleichung 34 Zusammenfassung 37 Fragen 38 Literatur 38 3 Ober- und Grenzflächenspannungen von Flüssigkeiten Ausgewählte Grenzflächenphänomene Thermodynamische Definition der Ober- und Grenzflächenspannung Messung der statischen Ober- und Grenzflächenspannungen von Flüssigkeiten Drahtbügelmethode nach LENARD Kapillaranstiegmethode Blasendruckmethode Ringmethode nach DUNOÜY Vertikalplattenmethode nach WILHELMY Tropfengewichtsmethode bzw. Tropfenvolumenmethode Stalagmometermethode Methode des liegenden Tropfens Methode des hängenden Tropfens Spinning-Drop-Methode 61
3 VIII Inhaltsverzeichnis 3.4 Messung der dynamischen Grenzflächenspannungen und des Kontaktwinkels Ober- und Grenzflächenspannungen flüssigkondensierter Phasen EöTVös-Regel, Parachor 68 Zusammenfassung 71 Fragen 73 Literatur 73 4 Benetzung und Spreitung Kontaktwinkel und Benetzungsspannung Methoden zur Bestimmung des Kontaktwinkels und der Benetzungsenthalpien Immersions-, Adhäsions-und Spreitungsbenetzung Benetzungshysterese Einfluß von Adsorptionsschichten und von Wechselwirkungskräften Umnetzungsprozesse 93 Zusammenfassung 96 Fragen 97 Literatur 98 5 Schwerlösliche Monoschichten und polymolekulare Aufbauschichten Die Bildung von Monoschichten erfolgt durch Spreitung Messung der Kompressionsisothermen von Monoschichten mittels Filmwaage Messung der Oberflächenviskosität von Monoschichten Messung der Filmpotentiale von Monoschichten Herkunft der Oberflächendipolmomente von Monoschichten Filmpolymorphie monomolekularer Schichten Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen an Monoschichten Brewsterwinkel-Mikroskopie (BAM) an Monoschichten Meßprinzip Kompressionsisothermen, Hystereseerscheinungen und Domänenstruktur von Monoschichten Innere Domänenstruktur in Monoschichten Relaxationserscheinungen und Domänenstruktur monomolekularer Schichten Chiralität und Domänenstruktur von Monoschichten Strukturuntersuchungen an Lipidmonoschichten Quantitative Beschreibung des Kompressionsverhaltens von Monoschichten Berechnung der Avogadrozahl und die Querschnittsfläche der Lipidmoleküle Mischfilmbildung durch Tensidpenetration in gespreitete Monoschichten Maßgeschneiderte" polymolekulare Aufbauschichten Mischungsverhalten von Phospholipiden in binären Monoschichten Spezifik der Mischbarkeitsanalyse in Monoschichten 156
4 Inhaltsverzeichnis IX Mischfilmstrukturen monomolekularer Schichten Phänomenologische Mischbarkeitskriterien für binäre Monoschichten Entwicklung von verschiedenen Oberflächentechniken zur Mischbarkeitsanalyse Anwendung der Oberflächenphasenregel zur Mischbarkeitsanalyse Spezielle Anwendungen der Oberflächenphasenregel auf das Spreitungsgleichgewicht Volumenphase/Monoschicht Vollständige sowie partielle Mischbarkeit und vollständige Unmischbarkeit in binären Monoschichten 166 Zusammenfassung Fragen 170 Literatur Adsorption und Chemisorption an Festkörpergrenzflächen Mechanismen derphysi- und Chemisorption Adsorptionstechniken dienen der Aufnahme von Adsorptionsisothermen Physisorption und Chemisorption Grundlagen und Auswertung von Adsorptionsisothermen HENRY-Isotherme LANGMUIR-Isotherme FREUNDLICH-Isotherme VoLMER-Isotherme BET-Isotherme Bestimmung spezifischer Oberflächen von Adsorbentien Molekularsiebe mit käfigartigen und tunnelförmigen Hohlräumen Kapillarkondensation: Adsorption in porösen Festkörperoberflächen Tensidadsorption an der Grenzfläche Festkörper/Flüssigkeit Polymeradsorption an der Grenzfläche Festkörper/Flüssigkeit 210 Zusammenfassung 213 Fragen 214 Literatur Elektrochemische Doppelschichten und Tensidadsorptionsschichten Ursache und Bedeutung der elektrochemischen Doppelschicht Modellvorstellungen zur Struktur elektrochemischer Doppelschichten Der Molekularkondensator nach HELMHOLTZ beruht auf dem Modell der starren Doppelschicht Der Molekularkondensator nach GOUY-CHAPMAN beinhaltet das Raumladungsmodell der diffusen Doppelschicht Der Molekularkondensator nach STERN kombiniert die Vorstellungen von Helmholtz und Gouy-Chapman Der Molekularkondensator nach GRAHAME geht von spezifischen Ionenadsorptionen aus 226
5 X Inhaltsverzeichnis Der Molekularkondensator nach BOCKRJS berücksichtigt die Existenz von Wasserschichten in der inneren HELMHOLTZschicht Zusammenhänge zwischen thermodynamischen und elektrochemischen Parametern Ableitung der LlPPMANN-HELMHOLTZ-Beziehung Ableitung der Parabelgleichung für die idealisierte Elektrokapillarkurve Verlauf und Messung der Elektrokapillarkurven Berechnung von Ladungsdichten und Differentialkapazitäten Elektrochemische Messung der Potentialabhängigkeit der Differentialkapazität Die Elektrosorption von Tensiden beruht auf Verdrängungsadsorption Messung der Adsorptionsisothermen von Tensiden Berechnung von Adsorptionsparametern von Tensiden Übersicht zu den in der Literatur häufig verwendeten Adsorptionsgleichungen für die Beschreibung der Tensidadsorption Auswertung der FRUMKiN-Isotherme Zusammenhänge zwischen der Wechselwirkungskonstante nach FRUMKIN und den Wechselwirkungskräften in der Adsorptionsschicht Ermittlung der GiBBS-Isotherme aus Elektrokapillarkurven Vergleich der Elektrosorptionseigenschaften elektrolythaltiger Tensidlösungen Potential- und zeitabhängige Filmkondensationserscheinungen Kinetische Ansätze zur Interpretation der Differentialkapazitäts/Zeit- Kurven Modell der Diffusionshemmung Modell der Adsorptionshemmung ; Modell der autokatalytischen Grenzflächenreaktion Modell der zweidimensionalen Keimbildung Auswertung ausgewählter Filmkondensationserscheinungen 274 Zusammenfassung 283 Fragen 286 Literatur Struktur, Funktion, Eigenschaften und Anwendungen von Membransystemen Definition und Einteilung von Membranen Semipermeable Membranen sind Einkomponentenschleusen VAN'THoFF-Beziehung des osmotischen Druckes Osmometrie - eine Methode zur Molmassebestimmung Reversosmose als Umkehrung der Osmose Permselektive Membranen sind Mehrkomponentenschleusen DoNNAN-Membrangleichgewichte durch von Ladungsverteilungen in Membrannähe 307
6 Inhaltsverzeichnis XI 8.8 Herstellung und Anwendungen von technischen Polymermembranen Struktur von Biomembranen Modellmembranen als Teilaspekte der Biomembraneigenschaften 316 Zusammenfassung 325 Fragen 326 Literatur Chemischer Aufbau, Eigenschaften und spezielle Anwendungen von Tensiden Ökonomische und anwendungstechnische Gesichtspunkte Klassifizierung von Tensiden nach dem Ladungszustand der Kopfgruppe Physikalische Eigenschaften und Wirkungen der Tenside Einfluß der Tenside in Waschmitteln auf das Benetzungsgleichgewicht Der Waschprozeß ist ein Mehrschrittprozeß Schaumbildungsvermögen der Tenside in wäßrigen Lösungen Wirkung von Tensiden als Sammler im Prozeß der Flotation Tenside bei der Bildung und Stabilisierung von Makro- und Mikroemulsionen 368 Zusammenfassung 370 Fragen 371 Literatur Mizellkolloide Eigenschaften von Mizellkolloiden sowie thermotropen und lyotropen Flüssigkristallen Die Bildung von Mizellkolloiden ist ein Aggregationsprozeß Phasendiagramm im Bereich der Mizellbildung Tensidstruktur und Lösungsmedium beeinflussen kritische Mizellbildungskonzentration Wirkung der hydrophoben Molekülanteile Wirkung der hydrophilen Molekülanteile Thermodynamik der Mizellbildung Kinetik der Mizellbildung Mizellstrukturen Solubilisierung in Mizellen 399 Zusammenfassung 401 Fragen 402 Literatur Thermotrope Flüssigkristalle Geschichtliches zur Flüssigkristallforschung Wichtige Strukturen kalamitischer Flüssigkristalle mit Stäbchenform Polarisationsmikroskopische Texturen ausgewählter flüssigkristalliner Phasen Thermodynamische Eigenschaften und Polymorphievarianten 420
7 XII Inhaltsverzeichnis 11.5 Diskotische Flüssigkristalle, flüssigkristalline Polymere Chirale thermotrope Flüssigkristalle Blaue Phasen" mit kubischer Struktur Flüssigkristalle in binären Mischungen Identifizierung thermotroper Flüssigkristalle mittels Mischbarkeitsauswahlregel Kaiamitische kristallin-flüssige Phasen in binären Mischungen Re-entrant-Phasenumwandlungen in binären Mischungen Eigenschaften Blauer Phasen" in Mischungen Theoretische Aspekte Optische und dielektrische Eigenschaften Anwendungen von Flüssigkristallen Neue Trends: Flüssigkristalle aus bananenförmigen Molekülen 461 Zusammenfassung 465 Fragen 466 Literatur Lyotrope Flüssigkristalle Phasenverhalten und Strukturen von wasserfreien Seifen Lyotrope Flüssigkristalle in binären Tensid/Wasser-Systemen Verhalten lyotroper Flüssigkristalle im Magnetfeld Zustandsdiagramme und Texturen lyotroper Flüssigkristalle Lyotrop-nematische Flüssigkristalle internären Systemen Lyotrop-cholesterische Phasen in quaternären Systemen Strukturelles Gesamtkonzept thermotroper und lyotroper Flüssigkristalle Phasenverhalten von lyotropen Flüssigkristallen amphiphiler Phospholipidsysteme Lyotrope Polymerflüssigkristalle Anwendungen lyotroper Flüssigkristalle 501 Zusammenfassung 503 Fragen 504 Literatur Makro- und Mikroemulsionen Einteilung und Charakterisierung von Makroemulsionen Herstellung und Zerstörung von ungeschützten Makroemulsionen Stabilisierung von Makroemulsionen durch Emulgatoren Theorie der Stabilität von Makroemulsionen Emulsionsstabilisierung durch Feststoffe Thermodynamisch stabile Mikroemulsionen Mischungsverhalten von Mehrstoffsystemen und Bildung von Mikroemulsionen Strukturen von Mikroemulsionen Anwendungen von Makro- und Mikroemulsionen 542 Zusammenfassung 553
8 Inhaltsverzeichnis XIII Fragen 554 Literatur, Dispersionskolloide Herstellung und Reinigung von Dispersionskolloiden Alterung und Koagulation Elektrolytkoagulation Grundlagen der Kinetik der schnellen Koagulation Elektrokinetische Erscheinungen Elektrophorese Sedimentationspotential Elektroosmose Strömungspotential Technische Anwendungen Die DLVO-Theorie der Stabilität von Dispersionskolloiden Grundlagen und Voraussetzungen Prinzipielles Vorgehen bei der Berechnung der elektrostatischen Abstoßungs- und der Anziehungsenergie zwischen zwei Kolloidteilchen Leistungsfähigkeit der DLVO-Theorie und experimentelle Überprüfung : Stabilisierung und Flockung von polymergeschützten Dispersionen Zusammenfassung 599 Fragen 601 Literatur Hydrogele und Aerogele Einordnung und Merkmale von Gelen Herstellung und struktureller Aufbau von Hydrogelen Eigenschaften von Haupt- und Nebenvalenzhydrogelen Struktur und Eigenschaften von Gelatinegelen Hydrogele - gebildet von amphiphilen Mehrstoffsystemen Gelstrukturen durch verschlaufte Stäbchenmizellen Kohlenwasserstoffgele Brummgele Scherinduzierte Gelstrukturen Gelstrukturen in nichtwäßrigen Systemen vom Typ K-Seife/ Glycerol Gelphasen in binären Tensid/Wasser-Systemen Tensidhaltige Gele bestehend aus dichtgepackten multilamellaren Vesikeln Aerogele mit neuen Materialeigenschaften Ausgewählte Anwendungen von Hydrogeleigenschaften Ionenaustauscher Gelchromatographie Herstellung semipermeabler Membranen 638
9 XIV Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung 639 Fragen 640 Literatur Diffusion kolloider Teilchen BROWN-Bewegung Das erste FicKsche Gesetz Das zweite FicKsche Gesetz Numerische Bestimmung von Diffusionskoeffizienten HARNED-Methode Die Korrelation zwischen Diffusionskoeffizient und Reibungswiderstand Diffusionskoeffizienten von Tensiden bei der Bildung von Adsorptionsschichten 658 Zusammenfassung 662 Fragen 663 Literatur Sedimentation kolloider Teilchen Sedimentation im Schwerefeld Sedimentationsgeschwindigkeit, Reibungskraft und Diffusion Einfluß des verstärkten Schwerefelds auf die Sedimentation Zusammenhänge zwischen Sedimentationsgeschwindigkeit und Molmasse Aufbau der Ultrazentrifuge Anwendungen in der Kolloidchemie Auswertung von Sedimentationsuntersuchungen 683 Zusammenfassung 684 Fragen 685 Literatur Statische und dynamische Lichtstreuung Wechselwirkung von Licht mit kolloiden Partikeln Kontinuumstheorie der RAYLEIGH-Streuung an kleinen Molekülen Kontinuumstheorie idealverdünnter Lösungen Winkelabhängigkeit der Lichtstreuintensität Schwankungstheorie Die Interferenztheorie Messung und Kalibrierung von Lichtstreuintensitäten Bestimmung der Streufunktion, der Molmasse und der Molekülgeometrie Streufaktor und Strukturfaktor Dynamische Lichtstreuung Theoretische Grundlagen Meßmethodik Auswertung der Messung 730
10 Inhaltsverzeichnis XV Messung der Grenzflächenladung von Kolloidteilchen (Zetapotentialmessung) 734 Zusammenfassung 737 Fragen 739 Literatur Röntgenkleinwinkel- und Neutronenstreuung Theoretische Grundlagen der Röntgenkleinwinkelstreuung (RKS, SAXS) Ursachen der Partikelstreuung Zustandekommen der Röntgenkleinwinkelstreuung Autokorrelationsfunktion, Abstandsverteilungsfunktion und Streuinvariante Innerer und äußerer Teil der Streukurve Streuverhalten inhomogener Partikel: Kugel- und Stäbchenmizellen, lamellare Systeme Interpartikuläre Interferenzen Auswertung von RKS-Messungen an kolloiden Systemen Röntgenkleinwinkelinstrumentation Strahlungsquellen Aufbau und Anwendungsmöglichkeiten der Kleinwinkelkamera nachkratky Entschmierung der Streukurven Neutronenstreuung 763 Zusammenfassung 768 Fragen 768 Literatur Strukturuntersuchungen an amphiphilen und makromolekularen Systemen Grundlagen der Strukturuntersuchungen Strukturaufklärung von amphiphilen Langkettenverbindungen Strukturbildung amphiphiler Langkettenverbindungen Beispiele der Anwendungen von Röntgenstrukturuntersuchungen Studium der Kinetik von Phasen Umwandlungen in lyotropen Phospholipidystemen mittels Synchrotronstrahlung Polymerstrukturen und Materialeigenschaften 789 Zusammenfassung 793 Fragen 794 Literatur Licht- und Elektronenmikroskopie an Kolloiden und Modellmembranen Ultramikroskopie Polarisationsmikroskopie Elektronenmikroskopie Durchstrahlelektronenmikroskopie 806
11 XVI Inhaltsverzeichnis Rasterelektronenmikroskopie Emissionselektronenmikroskopie Feldelektronenmikroskop Elektronenmikroskopische Präparationstechniken für kolloiddisperse Systeme Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Bio- und Modellmembranen 819 Zusammenfassung 825 Fragen 825 Literatur Methoden zur Charakterisierung von Festkörperoberflächen Grundlagen AuGER-Elektronenspektroskopie(AES) Low Energy Electron Diffraction (LEED) Rastertunnelmikroskopie Atomkraftmikroskop (AFM) Elektronenmikrosonde Ausgewählte Anwendungen in der Oberflächenchemie und Katalyse Statische und dynamische Prozesse in der Festkörperoberfläche Oberflächenchemie und heterogene Katalyse Untersuchungen an speziellen Systemen von Modellträgermaterialien 848 Zusammenfassung 861 Fragen 862 Literatur Rheologie kolloider Systeme Grundlagen: Definitionen, Begriffe und Phänomene Stationäres Scherfließen, NEWTON-Viskositätsgesetz NEWTON-Fließverhalten Nicht-NEWTON-Fließverhalten Scherzeitabhängiges Fließverhalten Normalspannung Instationäre Scherströmung Ausgewählte experimentelle Methoden der Rheometrie Kugelfallviskosimeter Kapillarviskosimeter Rotationsviskosimeter nach COUETTE und SEARLE Rotationsviskosimeter in Kegel-Platte-Anordnung Mechanische Schwingungsmessungen mit der Kegel-Platte- Anordnung Beispiele Theologischer Untersuchungen in der Kolloidchemie Kaolin-und Bentonitdispersionen ; Viskositätsverhalten von Kugel- und Stäbchenmizellen Rheologisches Verhalten von Tensidlösungen in unterschiedlichen
12 Inhaltsverzeichnis XVII Konzentrationsbereichen Fließverhalten viskoelastischer Tensidlösungen mit Netzwerkstrukturen Rheologisches Verhalten von Mikroemulsionen 912 Zusammenfassung 913 Fragen 914 Literatur Kalorimetrie an amphiphilen Systemen Grundlagen Flüssigkeitskalorimeter Differential-Scanning-Kalorimetrie Dynamische Differentialkalorimetrie (DSC) Auswertung von DSC-Kurven Beispiele kalorimetrischer Untersuchungen in der Tensidchemie Lösungsenthalpien zur Ermittlung von Mizellbildungsenthalpien Verdünnungsenthalpien zur Bestimmung der Mizellbildungsenthalpien Aufnahme von binären Zustandsdiagrammen Tensid/Wasser Aufnahme von binären Zustandsdiagrammen Phospholipid/Wasser Kalorimetrische Untersuchungen zum Mischungsverhalten von Phospholipiden 937 Zusammenfassung 944 Fragen 945 Literatur Elektro- und Strömungsdoppelbrechung an Mizellen und Makromolekülen Elektrodoppelbrechung Grundlagen Meßmethodik Experimentelle Details Ausgewählte Anwendungsbeispiele Strömungsdoppelbrechung 963 Zusammenfassung 965 Fragen 966 Literatur 966 Sachverzeichnis 967 Personenverzeichnis 983
Grenzflächen- und Kolloidchemie
 Grenzflächen- und Kolloidchemie Dr. Rudolf Tuckermann Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fachbereich 6.12 (Umweltradioaktivität) Bundesallee 100 D-38108 Braunschweig Tel.: 0531-592-6107 rudolf.tuckermann@ptb.de
Grenzflächen- und Kolloidchemie Dr. Rudolf Tuckermann Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Fachbereich 6.12 (Umweltradioaktivität) Bundesallee 100 D-38108 Braunschweig Tel.: 0531-592-6107 rudolf.tuckermann@ptb.de
Lehrbuch der Kolloidwissenschaft Hans Sonntag
 Lehrbuch der Kolloidwissenschaft Hans Sonntag Mit 165 Abbildungen und 25Tabellen D W VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1977 Inhalt Symbolyerzeichnis 11 1. Gegenstand und Abgrenzung der Kolloidwissenschaft
Lehrbuch der Kolloidwissenschaft Hans Sonntag Mit 165 Abbildungen und 25Tabellen D W VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1977 Inhalt Symbolyerzeichnis 11 1. Gegenstand und Abgrenzung der Kolloidwissenschaft
Inhalt der Vorlesung. 1. Eigenschaften der Gase. 0. Einführung
 Inhalt der Vorlesung 0. Einführung 0.1 Themen der Physikal. Chemie 0.2 Grundbegriffe/ Zentrale Größe: Energie 0.3 Molekulare Deutung der inneren Energie U Molekülstruktur, Energieniveaus und elektromagn.
Inhalt der Vorlesung 0. Einführung 0.1 Themen der Physikal. Chemie 0.2 Grundbegriffe/ Zentrale Größe: Energie 0.3 Molekulare Deutung der inneren Energie U Molekülstruktur, Energieniveaus und elektromagn.
Lehrbuch der Thermodynamik
 Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung Ж HANSER Carl Hanser Verlag München Wien VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDBEGRIFFE DER THERMODYNAMIK 1 Einführung 1 Systeme 3 offene
Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung Ж HANSER Carl Hanser Verlag München Wien VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDBEGRIFFE DER THERMODYNAMIK 1 Einführung 1 Systeme 3 offene
Bernd Tieke. Makromolekulare Chemie. Eine Einführung. Dritte Auflage. 0 0 l-u: U. WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
 Bernd Tieke Makromolekulare Chemie Eine Einführung Dritte Auflage 0 0 l-u: U WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage Vorwort zur dritten
Bernd Tieke Makromolekulare Chemie Eine Einführung Dritte Auflage 0 0 l-u: U WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage Vorwort zur dritten
Grenzflächenphänomene. Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie. J m. N m. 1. Oberflächenspannung
 Grenzflächenphänomene 1. Oberflächenspannung Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie Grenzflächenphänomene Phase/Phasendiagramm/Phasenübergang Schwerpunkte: Oberflächenspannung
Grenzflächenphänomene 1. Oberflächenspannung Physikalische Grundlagen der zahnärztlichen Materialkunde 3. Struktur der Materie Grenzflächenphänomene Phase/Phasendiagramm/Phasenübergang Schwerpunkte: Oberflächenspannung
Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik
 Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Entwicklung und Charakterisierang von Mikroemulsionen mit fettlöslichen Vitaminen zur Anwendung in Pharmaka und Lebensmitteln
 Entwicklung und Charakterisierang von Mikroemulsionen mit fettlöslichen Vitaminen zur Anwendung in Pharmaka und Lebensmitteln Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät für Chemie
Entwicklung und Charakterisierang von Mikroemulsionen mit fettlöslichen Vitaminen zur Anwendung in Pharmaka und Lebensmitteln Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät für Chemie
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik
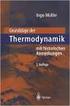 Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Grundlagen der Strömungsmechanik
 Franz Durst Grundlagen der Strömungsmechanik Eine Einführung in die Theorie der Strömungen von Fluiden Mit 349 Abbildungen, davon 8 farbig QA Springer Inhaltsverzeichnis Bedeutung und Entwicklung der Strömungsmechanik
Franz Durst Grundlagen der Strömungsmechanik Eine Einführung in die Theorie der Strömungen von Fluiden Mit 349 Abbildungen, davon 8 farbig QA Springer Inhaltsverzeichnis Bedeutung und Entwicklung der Strömungsmechanik
Technische Universität München Lehrstuhl I für Technische Chemie
 Technische Universität München Lehrstuhl I für Technische Chemie Klausur WS 2012/2013 zur Vorlesung Grenzflächenprozesse Prof. Dr.-Ing. K.-O. Hinrichsen, Dr. T. Michel Frage 1: Es ist stets nur eine Antwort
Technische Universität München Lehrstuhl I für Technische Chemie Klausur WS 2012/2013 zur Vorlesung Grenzflächenprozesse Prof. Dr.-Ing. K.-O. Hinrichsen, Dr. T. Michel Frage 1: Es ist stets nur eine Antwort
Universität Kassel, Grundpraktikum Physikalische Chemie im Studiengang Lehramt Chemie
 Versuch 8 Bestimmung der kritischen Mizellbildungskonzentration mit der Blasendruckmethode Themenbereiche: Mizellbildung, kritische Mizellbildungskonzentration, Krafft-Temperatur Oberflächenspannung, Laplace-Gleichung
Versuch 8 Bestimmung der kritischen Mizellbildungskonzentration mit der Blasendruckmethode Themenbereiche: Mizellbildung, kritische Mizellbildungskonzentration, Krafft-Temperatur Oberflächenspannung, Laplace-Gleichung
Methoden. Spektroskopische Verfahren. Mikroskopische Verfahren. Streuverfahren. Kalorimetrische Verfahren
 Methoden Spektroskopische Verfahren Mikroskopische Verfahren Streuverfahren Kalorimetrische Verfahren Literatur D. Haarer, H.W. Spiess (Hrsg.): Spektroskopie amorpher und kristalliner Festkörper Steinkopf
Methoden Spektroskopische Verfahren Mikroskopische Verfahren Streuverfahren Kalorimetrische Verfahren Literatur D. Haarer, H.W. Spiess (Hrsg.): Spektroskopie amorpher und kristalliner Festkörper Steinkopf
Vorlesung Anorganische Chemie. Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie
 Vorlesung Anorganische Chemie Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie Oktettregel und rationelle Schreibweise Im Einklang mit EN-Differenzen! 4 x 153 pm [SO 4 ] 2- : 147 pm E=O: Zwei Bindungen a) E-O
Vorlesung Anorganische Chemie Prof. Ingo Krossing WS 2007/08 B.Sc. Chemie Oktettregel und rationelle Schreibweise Im Einklang mit EN-Differenzen! 4 x 153 pm [SO 4 ] 2- : 147 pm E=O: Zwei Bindungen a) E-O
Lehrbuch Chemische Technologie
 C. Herbert Vogel Lehrbuch Chemische Technologie Grundlagen Verfahrenstechnischer Anlagen WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA IX Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1 Das Ziel industrieller Forschung
C. Herbert Vogel Lehrbuch Chemische Technologie Grundlagen Verfahrenstechnischer Anlagen WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA IX Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1 Das Ziel industrieller Forschung
Elektrochemie fester Stoffe
 H. Rickert Einführung in die Elektrochemie fester Stoffe Bibliothek^5 d. Instituts f. anorgan. u. physikal. Chemie (er Technischen Hochschale Darmstödt Ä Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1973
H. Rickert Einführung in die Elektrochemie fester Stoffe Bibliothek^5 d. Instituts f. anorgan. u. physikal. Chemie (er Technischen Hochschale Darmstödt Ä Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1973
Grenzflächenchemie SS 2006 Dr. R. Tuckermann. Tenside
 Tenside Tenside (lat. tendere = spannen) sind grenzflächenaktive Substanzen. In der Regel sind Tenside amphiphile Verbindungen, d. h. sie tragen sowohl polare (hydrophile bzw. lipophobe) als auch unpolare
Tenside Tenside (lat. tendere = spannen) sind grenzflächenaktive Substanzen. In der Regel sind Tenside amphiphile Verbindungen, d. h. sie tragen sowohl polare (hydrophile bzw. lipophobe) als auch unpolare
Stofftransport durch pharmazeutisch relevante Membranen
 Stofftransport durch pharmazeutisch relevante Membranen Inaugural-Dissertation zur Erlangung, der Doktorwürde der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br. vorgelegt
Stofftransport durch pharmazeutisch relevante Membranen Inaugural-Dissertation zur Erlangung, der Doktorwürde der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br. vorgelegt
Inhaltsverzeichnis. Formelzeichen, Indizes, Abkürzungen und Definitionen. 1 Einleitung 1. 2 Grundlagen 3. Inhaltsverzeichnis
 XI Abstract Formelzeichen, Indizes, Abkürzungen und Definitionen VII XI XVI 1 Einleitung 1 2 Grundlagen 3 2.1 Nahe- und überkritische Fluide Begriffsbestimmung und besondere Eigenschaften...3 2.2 Einsatzmöglichkeiten
XI Abstract Formelzeichen, Indizes, Abkürzungen und Definitionen VII XI XVI 1 Einleitung 1 2 Grundlagen 3 2.1 Nahe- und überkritische Fluide Begriffsbestimmung und besondere Eigenschaften...3 2.2 Einsatzmöglichkeiten
Karl Stephan Franz Mayinger. Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen. Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage
 Karl Stephan Franz Mayinger Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage Band 2 Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Mit 135 Abbildungen Springer-Verlag
Karl Stephan Franz Mayinger Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage Band 2 Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Mit 135 Abbildungen Springer-Verlag
Physikalische Chemie II (PCII) Thermodynamik/Elektrochemie Vorlesung und Übung (LSF# & LSF#101277) - SWS: SoSe 2013
 Physikalische Chemie II (PCII) Thermodynamik/Elektrochemie Vorlesung und Übung (LSF#105129 & LSF#101277) - SWS: 4 + 2 SoSe 2013 Prof. Dr. Petra Tegeder Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Fachbereich
Physikalische Chemie II (PCII) Thermodynamik/Elektrochemie Vorlesung und Übung (LSF#105129 & LSF#101277) - SWS: 4 + 2 SoSe 2013 Prof. Dr. Petra Tegeder Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Fachbereich
MA-CH-MRBO 04. Biophysikalische Chemie A: Methoden
 MA-CH-MRBO 04 Biophysikalische Chemie A: Methoden Prof. M. Stamm (IPF)/Prof. Arndt (PC) 5 CP, 3 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar/Praktikum Modulbeschreibung Das Modul vermittelt Kenntnisse zum Stand der biophysikalischchemischen
MA-CH-MRBO 04 Biophysikalische Chemie A: Methoden Prof. M. Stamm (IPF)/Prof. Arndt (PC) 5 CP, 3 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar/Praktikum Modulbeschreibung Das Modul vermittelt Kenntnisse zum Stand der biophysikalischchemischen
Die Modellierung einer Lithium-Batterie Zwischenpräsentation zum Praktikum Nichtlineare Modellierung in den Naturwissenschaften
 MÜNSTER Die Modellierung einer Lithium-Batterie Zwischenpräsentation zum Praktikum Nichtlineare Modellierung in den Naturwissenschaften Christoph Fricke, Natascha von Aspern, Carla Tameling 12.06.2012
MÜNSTER Die Modellierung einer Lithium-Batterie Zwischenpräsentation zum Praktikum Nichtlineare Modellierung in den Naturwissenschaften Christoph Fricke, Natascha von Aspern, Carla Tameling 12.06.2012
Inhalt. Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii
 Inhalt Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii 1 Phänomenologische Thermodynamik 1 1.1 Die grundlegenden Größen und Konzepte 1 1.1.1 Reduktion des Systems auf wenige ausgewählte Zustandsgrößen
Inhalt Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii 1 Phänomenologische Thermodynamik 1 1.1 Die grundlegenden Größen und Konzepte 1 1.1.1 Reduktion des Systems auf wenige ausgewählte Zustandsgrößen
Die chemische Zusammensetzung natiirlicher Gewasser
 Inhaltsverzeichnis Vorwort XI KAPITEL 1 KAPITEL 2 Die chemische Zusammensetzung natiirlicher Gewasser 1.1 Einleitung 1.2 Verwitterungsprozesse 1.3 Wechselwirkungen zwischen Organismen und Wasser 1.4 Das
Inhaltsverzeichnis Vorwort XI KAPITEL 1 KAPITEL 2 Die chemische Zusammensetzung natiirlicher Gewasser 1.1 Einleitung 1.2 Verwitterungsprozesse 1.3 Wechselwirkungen zwischen Organismen und Wasser 1.4 Das
Lehrbuch der Thermodynamik
 Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung PhysChem Verlag Erlangen U. Nickel VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK 1 1.1 Einführung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie
Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung PhysChem Verlag Erlangen U. Nickel VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK 1 1.1 Einführung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie
Liste der Formelzeichen. A. Thermodynamik der Gemische 1
 Inhaltsverzeichnis Liste der Formelzeichen XV A. Thermodynamik der Gemische 1 1. Grundbegriffe 3 1.1 Anmerkungen zur Nomenklatur von Mischphasen.... 4 1.2 Maße für die Zusammensetzung von Mischphasen....
Inhaltsverzeichnis Liste der Formelzeichen XV A. Thermodynamik der Gemische 1 1. Grundbegriffe 3 1.1 Anmerkungen zur Nomenklatur von Mischphasen.... 4 1.2 Maße für die Zusammensetzung von Mischphasen....
von Unternehmensanleihen
 Simon Schiffet Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven Mit einem Geleitwort von Prof. Dr.
Simon Schiffet Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven Mit einem Geleitwort von Prof. Dr.
1 EINLEITUNG 1.1 SELBSTORGANISATION IN BINÄREN SYSTEMEN. Einleitung 1
 Einleitung 1 1 EINLEITUNG 1.1 SELBSTORGANISATION IN BINÄREN SYSTEMEN Die Nanostrukturierung von Flüssigkeiten ist sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die Anwendung, beispielsweise im Bereich
Einleitung 1 1 EINLEITUNG 1.1 SELBSTORGANISATION IN BINÄREN SYSTEMEN Die Nanostrukturierung von Flüssigkeiten ist sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die Anwendung, beispielsweise im Bereich
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte
 1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
Grenzflächenchemie SS 2006 Dr. R. Tuckermann. Kolloide
 Kolloide Kolloide - zu griechisch kólla 'Leim' - sind Teilchen in einer Suspension, die groß genug sind, um keine Quanteneigenschaften mehr aufzuweisen, aber klein genug, damit ihre Bewegung von der Thermodynamik
Kolloide Kolloide - zu griechisch kólla 'Leim' - sind Teilchen in einer Suspension, die groß genug sind, um keine Quanteneigenschaften mehr aufzuweisen, aber klein genug, damit ihre Bewegung von der Thermodynamik
Inhaltsverzeichnis. Allgemeiner Teil. Individualrezeptur Systematik und Herstellung. Vorwortzur ersten Auflage...
 IX Vorwortzur dritten Auflage... Vorwortzur ersten Auflage... Abkürzungen... Wichtige Begriffe... VII VIII XV XVI I Allgemeiner Teil 1 Therapeutische und wirtschaftliche Aspekte der Individualrezeptur...
IX Vorwortzur dritten Auflage... Vorwortzur ersten Auflage... Abkürzungen... Wichtige Begriffe... VII VIII XV XVI I Allgemeiner Teil 1 Therapeutische und wirtschaftliche Aspekte der Individualrezeptur...
Thermodynamik für Werkstoffingenieure und Metallurgen
 Thermodynamik für Werkstoffingenieure und Metallurgen Eine Einführung 2., stark überarbeitete Auflage Von Prof. Dr.-Ing. Martin G. Frohberg Technische Universität Berlin Mit 99 Abbildungen und 14 Tabellen
Thermodynamik für Werkstoffingenieure und Metallurgen Eine Einführung 2., stark überarbeitete Auflage Von Prof. Dr.-Ing. Martin G. Frohberg Technische Universität Berlin Mit 99 Abbildungen und 14 Tabellen
Poröse Materialien. Porösität - Porentypen. a) geschlossene Poren. b-f) offene Poren
 Inhalt: Allgemeines Porösität - Porentypen a) geschlossene Poren b-f) offene Poren b) blind ink-bottle-shaped c) open cylindrical pores d) slit-shaped e) through pores f) blind cylindrical pores Inhalt:
Inhalt: Allgemeines Porösität - Porentypen a) geschlossene Poren b-f) offene Poren b) blind ink-bottle-shaped c) open cylindrical pores d) slit-shaped e) through pores f) blind cylindrical pores Inhalt:
Physik für Ingenieure
 Physik für Ingenieure von Prof. Dr. Ulrich Hahn OldenbourgVerlag München Wien 1 Einführung 1 1.1 Wie wird das Wissen gewonnen? 2 1.1.1 Gültigkeitsbereiche physikalischer Gesetze 4 1.1.2 Prinzipien der
Physik für Ingenieure von Prof. Dr. Ulrich Hahn OldenbourgVerlag München Wien 1 Einführung 1 1.1 Wie wird das Wissen gewonnen? 2 1.1.1 Gültigkeitsbereiche physikalischer Gesetze 4 1.1.2 Prinzipien der
Einführung in die Technische Thermodynamik
 Arnold Frohn Einführung in die Technische Thermodynamik 2., überarbeitete Auflage Mit 139 Abbildungen und Übungen AULA-Verlag Wiesbaden INHALT 1. Grundlagen 1 1.1 Aufgabe und Methoden der Thermodynamik
Arnold Frohn Einführung in die Technische Thermodynamik 2., überarbeitete Auflage Mit 139 Abbildungen und Übungen AULA-Verlag Wiesbaden INHALT 1. Grundlagen 1 1.1 Aufgabe und Methoden der Thermodynamik
Physikalisch Chemisches Praktikum
 27.06.13 Versuch Nr. 12 Physikalisch Chemisches Praktikum Oberflächenspannung & Kritische Mizellbildungskonzentration (CMC) Aufgabenstellung: 1) Bestimmung des Kapillarradius 2) Bestimmung der Oberflächenspannung
27.06.13 Versuch Nr. 12 Physikalisch Chemisches Praktikum Oberflächenspannung & Kritische Mizellbildungskonzentration (CMC) Aufgabenstellung: 1) Bestimmung des Kapillarradius 2) Bestimmung der Oberflächenspannung
Physik. Oldenbourg Verlag München Wien 5 '
 Physik Mechanik und Wärme von Klaus Dransfeld Paul Kienle und Georg Michael Kalvius 10., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit fast 300 Bildern und Tabellen 5 ' Oldenbourg Verlag München Wien Inhalt
Physik Mechanik und Wärme von Klaus Dransfeld Paul Kienle und Georg Michael Kalvius 10., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit fast 300 Bildern und Tabellen 5 ' Oldenbourg Verlag München Wien Inhalt
4. Grenzflächenspannung 1
 4. Grenzflächenspannung 1 4. GRENZFLÄCHENSPANNUNG 1. Aufgabe Mit Hilfe der Ringmethode soll die Grenzflächenspannung als Funktion der Konzentration einer grenzflächenaktiven Substanz gemessen werden. Für
4. Grenzflächenspannung 1 4. GRENZFLÄCHENSPANNUNG 1. Aufgabe Mit Hilfe der Ringmethode soll die Grenzflächenspannung als Funktion der Konzentration einer grenzflächenaktiven Substanz gemessen werden. Für
Physikalisch-chemische Untersuchungsmethoden in den Geowissenschaften, Band 2
 Physikalisch-chemische Untersuchungsmethoden in den Geowissenschaften, Band 2 Beugungsmethoden, Spektroskopie, Physiko-chemische Untersuchungsmethoden Bearbeitet von Georg Amthauer, Miodrag K. Pavicevic
Physikalisch-chemische Untersuchungsmethoden in den Geowissenschaften, Band 2 Beugungsmethoden, Spektroskopie, Physiko-chemische Untersuchungsmethoden Bearbeitet von Georg Amthauer, Miodrag K. Pavicevic
Strukturen und osmotischer Druck geordneter Latex-Suspensionen - Eine Untersuchung mit Licht-, Röntgen- und Neutronenstreuung
 Strukturen und osmotischer Druck geordneter Latex-Suspensionen - Eine Untersuchung mit Licht-, Röntgen- und Neutronenstreuung Von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen
Strukturen und osmotischer Druck geordneter Latex-Suspensionen - Eine Untersuchung mit Licht-, Röntgen- und Neutronenstreuung Von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen
Einführung 19. Teil I Kräfte und Substanzen 25. Kapitel 1 Gase unter Druck: Die Gasgesetze 27
 Inhaltsverzeichnis Einführung 19 Über dieses Buch 20 Konventionen in diesem Buch 20 Törichte Annahmen über den Leser 21 Wie dieses Buch aufgebaut ist 21 Teil I: Kräfte und Substanzen 22 Teil II: Reinstoffe
Inhaltsverzeichnis Einführung 19 Über dieses Buch 20 Konventionen in diesem Buch 20 Törichte Annahmen über den Leser 21 Wie dieses Buch aufgebaut ist 21 Teil I: Kräfte und Substanzen 22 Teil II: Reinstoffe
Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen
 Springer-Lehrbuch Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Bearbeitet von Peter Stephan, Karlheinz Schaber, Karl Stephan, Franz Mayinger Neuausgabe
Springer-Lehrbuch Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Bearbeitet von Peter Stephan, Karlheinz Schaber, Karl Stephan, Franz Mayinger Neuausgabe
Inhaltsverzeichnis. 1 Grundlagen der Thermodynamik l VII
 VII Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Thermodynamik l 1.1 Einfahrung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie 2 1.3.1 Vorbemerkungen 2 1.3.2 Kinetische und potentielle Energie 3 1.3.3 Äußere und Innere Energie 4
VII Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Thermodynamik l 1.1 Einfahrung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie 2 1.3.1 Vorbemerkungen 2 1.3.2 Kinetische und potentielle Energie 3 1.3.3 Äußere und Innere Energie 4
12. Biopolymere. Anwendungen: Sensoren, Detektoren, Displays, Komponenten in elektrischen Schlatkreisen Modellsysteme
 12. Biopolymere 12.1 Organische dünne Filme Langmuir Filme = organische Polymere auf flüssigen Oberflächen Langmuir-Blodgett Filme = organische Polymere auf festen Oberflächen Anwendungen: Sensoren, Detektoren,
12. Biopolymere 12.1 Organische dünne Filme Langmuir Filme = organische Polymere auf flüssigen Oberflächen Langmuir-Blodgett Filme = organische Polymere auf festen Oberflächen Anwendungen: Sensoren, Detektoren,
Springer-Lehrbuch. Thermodynamik. Von der Mikrophysik zur Makrophysik. Bearbeitet von Klaus Stierstadt
 Springer-Lehrbuch Thermodynamik Von der Mikrophysik zur Makrophysik Bearbeitet von Klaus Stierstadt 1st Edition. 2010. Taschenbuch. xvi, 627 S. Paperback ISBN 978 3 642 05097 8 Format (B x L): 15,5 x 23,5
Springer-Lehrbuch Thermodynamik Von der Mikrophysik zur Makrophysik Bearbeitet von Klaus Stierstadt 1st Edition. 2010. Taschenbuch. xvi, 627 S. Paperback ISBN 978 3 642 05097 8 Format (B x L): 15,5 x 23,5
Grundlagen der Physik II
 Grundlagen der Physik II Othmar Marti 12. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 12. 07. 2007 Klausur Die Klausur
Grundlagen der Physik II Othmar Marti 12. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 12. 07. 2007 Klausur Die Klausur
Tropfenkonturanalyse
 Phasen und Grenzflächen Tropfenkonturanalyse Abstract Mit Hilfe der Tropfenkonturanalyse kann die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ermittelt werden. Wird die Oberflächenspannung von Tensidlösungen
Phasen und Grenzflächen Tropfenkonturanalyse Abstract Mit Hilfe der Tropfenkonturanalyse kann die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ermittelt werden. Wird die Oberflächenspannung von Tensidlösungen
Physikalische Chemie und Biophysik
 Physikalische Chemie und Biophysik erweitert, überarbeitet 2006. Taschenbuch. XIII, 617 S. Paperback ISBN 978 3 540 00066 2 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Weitere Fachgebiete > Chemie, Biowissenschaften,
Physikalische Chemie und Biophysik erweitert, überarbeitet 2006. Taschenbuch. XIII, 617 S. Paperback ISBN 978 3 540 00066 2 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Weitere Fachgebiete > Chemie, Biowissenschaften,
Thermodynamik der Gemische
 Thermodynamik der Gemische Bearbeitet von Andreas Pfennig 1. Auflage 2003. Buch. x, 394 S. Hardcover ISBN 978 3 540 02776 8 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 771 g Weitere Fachgebiete > Chemie, Biowissenschaften,
Thermodynamik der Gemische Bearbeitet von Andreas Pfennig 1. Auflage 2003. Buch. x, 394 S. Hardcover ISBN 978 3 540 02776 8 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 771 g Weitere Fachgebiete > Chemie, Biowissenschaften,
CHARAKTERISIERUNG VON HALBLEITERN FÜR PHOTOVOLTAISCHE ANWENDUNGEN MIT HILFE DER BREWSTER-WINKEL-SPEKTROSKOPIE
 CHARAKTERISIERUNG VON HALBLEITERN FÜR PHOTOVOLTAISCHE ANWENDUNGEN MIT HILFE DER BREWSTER-WINKEL-SPEKTROSKOPIE von Diplom-Physiker Nikolaus Dietz aus Friedenfels Vom Fachbereich 04 Physik der Technischen
CHARAKTERISIERUNG VON HALBLEITERN FÜR PHOTOVOLTAISCHE ANWENDUNGEN MIT HILFE DER BREWSTER-WINKEL-SPEKTROSKOPIE von Diplom-Physiker Nikolaus Dietz aus Friedenfels Vom Fachbereich 04 Physik der Technischen
Unternehmenskultur und radikale Innovation
 Corporate Life Cycle Management Band 1 Herausgegeben von Prof. Dr. Klaus Nathusius Dr. Norbert Fischl Unternehmenskultur und radikale Innovation Eine Analyse von jungen und mittelständischen Unternehmen
Corporate Life Cycle Management Band 1 Herausgegeben von Prof. Dr. Klaus Nathusius Dr. Norbert Fischl Unternehmenskultur und radikale Innovation Eine Analyse von jungen und mittelständischen Unternehmen
Peter Gründler. Chemische Sensoren. Eine Einführung für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Mit 184 Abbildungen und 27 Tabellen.
 Peter Gründler Chemische Sensoren Eine Einführung für Naturwissenschaftler und Ingenieure Mit 184 Abbildungen und 27 Tabellen «Q» Springer Inhalt 1 Einleitung 1 1.1 Sensoren und Sensorik 1 1.1.1 Sensoren
Peter Gründler Chemische Sensoren Eine Einführung für Naturwissenschaftler und Ingenieure Mit 184 Abbildungen und 27 Tabellen «Q» Springer Inhalt 1 Einleitung 1 1.1 Sensoren und Sensorik 1 1.1.1 Sensoren
Wahrnehmung von Personen als Gruppenmitglieder
 Mathias Blanz Wahrnehmung von Personen als Gruppenmitglieder Untersuchungen zur Salienz sozialer Kategorien Waxmann Münster / New York München / Berlin Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung XI 1 Einleitung:
Mathias Blanz Wahrnehmung von Personen als Gruppenmitglieder Untersuchungen zur Salienz sozialer Kategorien Waxmann Münster / New York München / Berlin Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung XI 1 Einleitung:
Stabilisierung von Kolloiden durch Polymere
 Stabilisierung von Kolloiden durch Polymere Saarbrücken, den 02.07.2013 Nanostrukturphysik 2 Marc-Dominik Kraß Stabilisierung von Kolloiden Sterische Stabilisation Enthalpische Stabilisation Elektrostatische
Stabilisierung von Kolloiden durch Polymere Saarbrücken, den 02.07.2013 Nanostrukturphysik 2 Marc-Dominik Kraß Stabilisierung von Kolloiden Sterische Stabilisation Enthalpische Stabilisation Elektrostatische
Intelligente Polymere. Anne Oestreicher
 Intelligente Polymere Anne Oestreicher 09.12.2014 2 Intelligente Polymere 1. Einleitung 2. Stimuli-responsive Polymere 3. Thermoresponsive Polymere a. Kritische Entmischungstemperaturen b. Thermodynamik
Intelligente Polymere Anne Oestreicher 09.12.2014 2 Intelligente Polymere 1. Einleitung 2. Stimuli-responsive Polymere 3. Thermoresponsive Polymere a. Kritische Entmischungstemperaturen b. Thermodynamik
Metalle. Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen. Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont
 Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont überarbeitet 2006. Buch. xi, 383 S. Hardcover ISBN 978 3 540 34010 2 Format (B x L): 15,5
Metalle Struktur und Eigenschaften der Metalle und Legierungen Bearbeitet von Erhard Hornbogen, Hans Warlimont überarbeitet 2006. Buch. xi, 383 S. Hardcover ISBN 978 3 540 34010 2 Format (B x L): 15,5
Struktur, Dynamik und Ordnung ultradünner Schichten aus Goldnanoclustern A. Vasiliev, H. Rehage, G. Schmid Folie 1-1-
 Struktur, Dynamik und Ordnung ultradünner Schichten aus Goldnanoclustern A. Vasiliev, H. Rehage, G. Schmid 17.03.2005 Folie 1-1- Zukünftiger exponentieller Anstieg der Rechenkapazität Die Leistung von
Struktur, Dynamik und Ordnung ultradünner Schichten aus Goldnanoclustern A. Vasiliev, H. Rehage, G. Schmid 17.03.2005 Folie 1-1- Zukünftiger exponentieller Anstieg der Rechenkapazität Die Leistung von
Roland Reich. Thermodynamik. Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie. Zweite, verbesserte Auflage VCH. Weinheim New York Basel Cambridge
 Roland Reich Thermodynamik Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie Zweite, verbesserte Auflage VCH Weinheim New York Basel Cambridge Inhaltsverzeichnis Formelzeichen Maßeinheiten XV XX 1.
Roland Reich Thermodynamik Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie Zweite, verbesserte Auflage VCH Weinheim New York Basel Cambridge Inhaltsverzeichnis Formelzeichen Maßeinheiten XV XX 1.
Die elastischen Eigenschaften von Flüssigkeits-Gas-Gemischen Die Ausbreitungsgeschwindigkeit elastischer Wellen in Gesteinen ex-
 Inhaltsverzeichnis Symbolverzeichnis 12 1. Petrophysik Aufgaben, Gegenstand und Methoden 15 1.1. Petrophysikalische Untersuchungen Bestandteil geowissenschaftlicher Arbeiten 15 1.2. Klassifizierung und
Inhaltsverzeichnis Symbolverzeichnis 12 1. Petrophysik Aufgaben, Gegenstand und Methoden 15 1.1. Petrophysikalische Untersuchungen Bestandteil geowissenschaftlicher Arbeiten 15 1.2. Klassifizierung und
Emulsionen (Norbert Stock) 1. Emulsionen
 Emulsionen (Norbert Stock) 1 Versuch K3 Emulsionen 1. Einleitung 1.1. Eigenschaften Emulsionen sind disperse Systeme, bei denen eine flüssige Phase (dispergierte Phase, innere Phase) in einer anderen flüssigen
Emulsionen (Norbert Stock) 1 Versuch K3 Emulsionen 1. Einleitung 1.1. Eigenschaften Emulsionen sind disperse Systeme, bei denen eine flüssige Phase (dispergierte Phase, innere Phase) in einer anderen flüssigen
Xanthan und Carubin als Hilfsstoffe zur Darstellung fester Arzneiformkörper Möglichkeiten zur Beeinflussung des Freisetzungsverhaltens von Wirkstoffen
 A Xanthan und Carubin als Hilfsstoffe zur Darstellung fester Arzneiformkörper Möglichkeiten zur Beeinflussung des Freisetzungsverhaltens von Wirkstoffen Den Naturwissenschaftlichen Fakultäten der Friedrich-Alexander-Universität
A Xanthan und Carubin als Hilfsstoffe zur Darstellung fester Arzneiformkörper Möglichkeiten zur Beeinflussung des Freisetzungsverhaltens von Wirkstoffen Den Naturwissenschaftlichen Fakultäten der Friedrich-Alexander-Universität
Physikalische Chemie
 Physikalische Chemie für Techniker und Ingenieure Karl-Heinz Näser Dozent an der Ingenieurschule für Chemie, Leipzig 92 Bilder Fachbuchverlag Leipzig,1958 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung........................................
Physikalische Chemie für Techniker und Ingenieure Karl-Heinz Näser Dozent an der Ingenieurschule für Chemie, Leipzig 92 Bilder Fachbuchverlag Leipzig,1958 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung........................................
Elektrische und ^magnetische Felder
 Marlene Marinescu Elektrische und ^magnetische Felder Eine praxisorientierte Einführung Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage * j Springer I nhaltsverzeichnis 1 Elektrostatische Felder 1 1.1 Wesen
Marlene Marinescu Elektrische und ^magnetische Felder Eine praxisorientierte Einführung Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage * j Springer I nhaltsverzeichnis 1 Elektrostatische Felder 1 1.1 Wesen
Abb.1 Zur Veranschaulichung: Scherung eines Fluids zwischen zwei Platten
 Viskosität Die innere Reibung von Fluiden wird durch ihre dynamische Viskosität η beschrieben. Die dynamische Viskosität η eines Fluids stellt dessen Widerstand gegen einen erzwungenen, irreversiblen Ortswechsel
Viskosität Die innere Reibung von Fluiden wird durch ihre dynamische Viskosität η beschrieben. Die dynamische Viskosität η eines Fluids stellt dessen Widerstand gegen einen erzwungenen, irreversiblen Ortswechsel
Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen. Grundlagen und technische Anwendungen
 Karl Stephan Franz Mayinger n 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. or Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische
Karl Stephan Franz Mayinger n 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. or Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische
Synthese und Charakterisierung von Zeolithen: Zeolith A (Norbert Stock) 1. Synthese und Charakterisierung von Zeolithen. Zeolith A
 Synthese und Charakterisierung von Zeolithen: Zeolith A (Norbert Stock) 1 Versuch P1 Synthese und Charakterisierung von Zeolithen Zeolith A Motivation Dieser Versuch soll Sie in das Gebiet der Zeolithe
Synthese und Charakterisierung von Zeolithen: Zeolith A (Norbert Stock) 1 Versuch P1 Synthese und Charakterisierung von Zeolithen Zeolith A Motivation Dieser Versuch soll Sie in das Gebiet der Zeolithe
Abkürzungsverzeichnis Formelverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis. 1 Einleitung 1
 Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Formelverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Seite VI VIII XIV XXIV 1 Einleitung 1 1.1 Einführung in die Problematik 1 1.2 Aktuelle Ausgangssituation
Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Formelverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Seite VI VIII XIV XXIV 1 Einleitung 1 1.1 Einführung in die Problematik 1 1.2 Aktuelle Ausgangssituation
Kreiselpumpen. Berechnung und Konstruktion. Adam T. Troskolaiiski und Stephan Lazarkiewicz. Geleitwort von Dr. Ing. h. c.
 Kreiselpumpen Berechnung und Konstruktion Adam T. Troskolaiiski und Stephan Lazarkiewicz Professor an der Technischen Vormals Leiter des Konstruktions- Universität Wroclaw büros der Pumpenfabrik Warszawa
Kreiselpumpen Berechnung und Konstruktion Adam T. Troskolaiiski und Stephan Lazarkiewicz Professor an der Technischen Vormals Leiter des Konstruktions- Universität Wroclaw büros der Pumpenfabrik Warszawa
4. Grenzflächenspannung 1
 4. Grenzflächenspannung 1 4. GRENZFLÄCHENSPANNUNG 1. Aufgabe Mit Hilfe der Ringmethode soll die Grenzflächenspannung als Funktion der Konzentration einer grenzflächenaktiven Substanz gemessen werden. Für
4. Grenzflächenspannung 1 4. GRENZFLÄCHENSPANNUNG 1. Aufgabe Mit Hilfe der Ringmethode soll die Grenzflächenspannung als Funktion der Konzentration einer grenzflächenaktiven Substanz gemessen werden. Für
Nanostrukturierte Materialien
 Nanostrukturierte Materialien Prof. Dr. Johann Plank Department Chemie Prof. Dr. Anton Lerf Department Physik Nanostrukturierte Materialien Die Vorlesung ist gedacht für: Chemiker: VT Chemie und Technologie
Nanostrukturierte Materialien Prof. Dr. Johann Plank Department Chemie Prof. Dr. Anton Lerf Department Physik Nanostrukturierte Materialien Die Vorlesung ist gedacht für: Chemiker: VT Chemie und Technologie
Inhaltsverzeichnis. Kurz, G�nther Strà mungslehre, Optik, Elektrizit�tslehre, Magnetismus digitalisiert durch: IDS Basel Bern
 Inhaltsverzeichnis I Strömungslehre 11 1 Ruhende Flüssigkeiten (und Gase) - Hydrostatik 11 1.1 Charakterisierung von Flüssigkeiten 11 1.2 Druck - Definition und abgeleitete 11 1.3 Druckänderungen in ruhenden
Inhaltsverzeichnis I Strömungslehre 11 1 Ruhende Flüssigkeiten (und Gase) - Hydrostatik 11 1.1 Charakterisierung von Flüssigkeiten 11 1.2 Druck - Definition und abgeleitete 11 1.3 Druckänderungen in ruhenden
Elektrische und magnetische Felder
 Marlene Marinescu Elektrische und magnetische Felder Eine praxisorientierte Einführung Mit 260 Abbildungen @Nj) Springer Inhaltsverzeichnis I Elektrostatische Felder 1 Wesen des elektrostatischen Feldes
Marlene Marinescu Elektrische und magnetische Felder Eine praxisorientierte Einführung Mit 260 Abbildungen @Nj) Springer Inhaltsverzeichnis I Elektrostatische Felder 1 Wesen des elektrostatischen Feldes
2 1 Einleitung. Luft. Lösung
 1 1 Einleitung "I do not suppose, that there is any one in this room who has not occasionally blown a common soap bubble, and while admiring the perfection of its form and the marvellous brilliancy of
1 1 Einleitung "I do not suppose, that there is any one in this room who has not occasionally blown a common soap bubble, and while admiring the perfection of its form and the marvellous brilliancy of
Die Zelle. Membranen: Struktur und Funktion
 Die Zelle Membranen: Struktur und Funktion 8.4 Die Fluidität von Membranen. 8.6 Die Feinstruktur der Plasmamembran einer Tierzelle (Querschnitt). (Zum Aufbau der extrazellulären Matrix siehe auch Abbildung
Die Zelle Membranen: Struktur und Funktion 8.4 Die Fluidität von Membranen. 8.6 Die Feinstruktur der Plasmamembran einer Tierzelle (Querschnitt). (Zum Aufbau der extrazellulären Matrix siehe auch Abbildung
Versuch Nr.53. Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen)
 Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
3. Mikrostruktur und Phasenübergänge
 3. Mikrostruktur und Phasenübergänge Definition von Mikrostruktur und Gefüge Gefüge bezeichnet die Beschaffenheit der Gesamtheit jener Teilvolumina eines Werkstoffs, von denen jedes hinsichtlich seiner
3. Mikrostruktur und Phasenübergänge Definition von Mikrostruktur und Gefüge Gefüge bezeichnet die Beschaffenheit der Gesamtheit jener Teilvolumina eines Werkstoffs, von denen jedes hinsichtlich seiner
STATISTISCHE PHYSIK L. D. LANDAU E. M. LIFSCHITZ. Teil 1. In deutscher Sprache herausgegeben
 L. D. LANDAU E. M. LIFSCHITZ STATISTISCHE PHYSIK Teil 1 In deutscher Sprache herausgegeben von Prof. Dr. habil. RICHARD LENK Sektion Physik der Technischen Universität Chemnitz 8., berichtigte, von E.
L. D. LANDAU E. M. LIFSCHITZ STATISTISCHE PHYSIK Teil 1 In deutscher Sprache herausgegeben von Prof. Dr. habil. RICHARD LENK Sektion Physik der Technischen Universität Chemnitz 8., berichtigte, von E.
1. Einführung Das physikalische Phänomen Historische Bemerkungen Osmose und Osmometrie 15
 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 11 1.1 Das physikalische Phänomen 13 1.2 Historische Bemerkungen 14 1.3 Osmose und Osmometrie 15 1.4 Der kolloidosmotische Druck und die Onkometrie 17 1.5 Der kolloidosmotische
Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 11 1.1 Das physikalische Phänomen 13 1.2 Historische Bemerkungen 14 1.3 Osmose und Osmometrie 15 1.4 Der kolloidosmotische Druck und die Onkometrie 17 1.5 Der kolloidosmotische
Rolf Mull Hartmut Holländer. Grundwasserhydraulik. und -hydrologie. Eine Einführung. Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen. Springer
 Rolf Mull Hartmut Holländer Grundwasserhydraulik und -hydrologie Eine Einführung Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen Springer VI 1 Bedeutung des Grundwassers 1 2 Strukturen der Grundwassersysteme 4 2.1
Rolf Mull Hartmut Holländer Grundwasserhydraulik und -hydrologie Eine Einführung Mit 157 Abbildungen und 20 Tabellen Springer VI 1 Bedeutung des Grundwassers 1 2 Strukturen der Grundwassersysteme 4 2.1
deren Implementierung im Finanzdienstleistungssektor
 Tobias Kleiner Ansätze zur Kundensegmentierung und zu deren Implementierung im Finanzdienstleistungssektor Eine empirische Analyse im Privatkundensegment von Banken Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Alfred
Tobias Kleiner Ansätze zur Kundensegmentierung und zu deren Implementierung im Finanzdienstleistungssektor Eine empirische Analyse im Privatkundensegment von Banken Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Alfred
ein eindrückliches Hilfsmittel zur Visualisierung im naturwissenschaftlichen Unterricht
 Atomarium ein eindrückliches Hilfsmittel zur Visualisierung im naturwissenschaftlichen Unterricht Das Atomarium ist ein Computerprogramm, das chemische und physikalische Phänomene auf atomarer Ebene simuliert
Atomarium ein eindrückliches Hilfsmittel zur Visualisierung im naturwissenschaftlichen Unterricht Das Atomarium ist ein Computerprogramm, das chemische und physikalische Phänomene auf atomarer Ebene simuliert
Theoretische Physik. Klassische. Römer. Eine Einführung. Dritte, durchgesehene und erweiterte Auflage mit 139 Abbildungen und 39 Übungen
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Römer Klassische Theoretische Physik Eine Einführung Dritte, durchgesehene
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Römer Klassische Theoretische Physik Eine Einführung Dritte, durchgesehene
Vorwort. 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3. 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4. 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8
 Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung V XXIII 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8 1.3 Kupferdruckgusslegierungen
Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung V XXIII 1 Druckgusslegierungen und ihre Eigenschaften 3 1.1 Aluminiumdruckgusslegierungen 4 1.2 Magnesiumdruckgusslegierungen 8 1.3 Kupferdruckgusslegierungen
Katharina Lilienthal. Nanostrukturierte SiC>2-Gläser für die Mikrotechnik und Biosensorik
 Katharina Lilienthal Nanostrukturierte SiC>2-Gläser für die Mikrotechnik und Biosensorik IS fi 2014 I Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis V IX 1. Einführung, Motivation und Ziele
Katharina Lilienthal Nanostrukturierte SiC>2-Gläser für die Mikrotechnik und Biosensorik IS fi 2014 I Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis V IX 1. Einführung, Motivation und Ziele
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)
 Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... interpretieren den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (u.a. Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen
 4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen 1. Eigenschaften der Materie in der Gasphase 2. Erster Hauptsatz: Arbeit und Wärme 3. Entropie und Zweiter Hauptsatz der hermodynamik 4. Freie Enthalpie G,
4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen 1. Eigenschaften der Materie in der Gasphase 2. Erster Hauptsatz: Arbeit und Wärme 3. Entropie und Zweiter Hauptsatz der hermodynamik 4. Freie Enthalpie G,
Beurteilung von Dienstleistungsqualität
 Sabine Haller 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Beurteilung von Dienstleistungsqualität Dynamische
Sabine Haller 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Beurteilung von Dienstleistungsqualität Dynamische
Solubilisierung in Mizellen. hydrophobe Kette. hydrophile Kopfgruppe. -nicht-ionische. -anionische. -kationische. -zwitterionische Tenside.
 Solubilisierung in Mizellen Abstract 1 Theoretische Grundlagen Tenside sind Moleküle, die aus einem hydrophilen (polaren) und einem hydrophoben (unpolaren) Molekülteil bestehen(abbildung 1). hydrophile
Solubilisierung in Mizellen Abstract 1 Theoretische Grundlagen Tenside sind Moleküle, die aus einem hydrophilen (polaren) und einem hydrophoben (unpolaren) Molekülteil bestehen(abbildung 1). hydrophile
Physikalische Chemie der Silicate
 Physikalische Chemie der Silicate und nichtoxidischen Siliciumverbindungen Mit 162 Bildern und 30 Tabellen Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig Inhaltsverzeichnis 1. Oxidische und nichtoxidische
Physikalische Chemie der Silicate und nichtoxidischen Siliciumverbindungen Mit 162 Bildern und 30 Tabellen Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig Inhaltsverzeichnis 1. Oxidische und nichtoxidische
Delsa Nano-Serie Doppler Electrophoretic Light Scattering Analyzer
 Delsa Nano-Serie Doppler Electrophoretic Light Scattering Analyzer Partikelgrößen ab 0.6 Nanometer Konzentrationsbereich 0.001 bis 40%* für Größe und Zetapotential FST-Technologie Autotitrator für ph-profile
Delsa Nano-Serie Doppler Electrophoretic Light Scattering Analyzer Partikelgrößen ab 0.6 Nanometer Konzentrationsbereich 0.001 bis 40%* für Größe und Zetapotential FST-Technologie Autotitrator für ph-profile
Chemie für Mediziner. Norbert Sträter
 Chemie für Mediziner Norbert Sträter Verlag Wissenschaftliche Scripten 2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine und Anorganische Chemie... 1 1 Atombau... 1 1.1 Fundamentale Begriffe... 1 1.2 Atome und Elemente...
Chemie für Mediziner Norbert Sträter Verlag Wissenschaftliche Scripten 2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine und Anorganische Chemie... 1 1 Atombau... 1 1.1 Fundamentale Begriffe... 1 1.2 Atome und Elemente...
1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen!
 1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen! Aggregatzustände Fest, flüssig, gasförmig Schmelz -wärme Kondensations -wärme Die Umwandlung von Aggregatzuständen
1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen! Aggregatzustände Fest, flüssig, gasförmig Schmelz -wärme Kondensations -wärme Die Umwandlung von Aggregatzuständen
Ultradünne Filme: Dissertation. zur Erlangung des akademischen Grades Dr. rer. nat. des Fachbereiches Chemie der Technischen Universität Dortmund
 Ultradünne Filme: Molekulare Rezeptoren und magnetisch schaltbare Polymere an flüssigen und festen Grenzflächen Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. rer. nat. des Fachbereiches Chemie
Ultradünne Filme: Molekulare Rezeptoren und magnetisch schaltbare Polymere an flüssigen und festen Grenzflächen Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. rer. nat. des Fachbereiches Chemie
DÜNNE SCHICHTEN FÜR DIE OPTIK
 DÜNNE SCHICHTEN FÜR DIE OPTIK von DR. HUGO ANDERS Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Firma Carl Zeiss, Oberkochen Mit 94 Abbildungen und 3 Farbtafeln YOOCA WISSENSCHAFTLICHE VERLAGS GESELLSCHAFT MBH. STUTTGART
DÜNNE SCHICHTEN FÜR DIE OPTIK von DR. HUGO ANDERS Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Firma Carl Zeiss, Oberkochen Mit 94 Abbildungen und 3 Farbtafeln YOOCA WISSENSCHAFTLICHE VERLAGS GESELLSCHAFT MBH. STUTTGART
Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches
 Praktikum Physikalische Chemie I 30. Oktober 2015 Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11 1. Theorie hinter dem Versuch Ein Schmelzdiagramm zeigt
Praktikum Physikalische Chemie I 30. Oktober 2015 Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11 1. Theorie hinter dem Versuch Ein Schmelzdiagramm zeigt
Katja Bender (Autor) Entwicklung und Charakterisierung verschiedener biomimetischer Lipidmembransysteme zur Untersuchung von Membranproteinen
 Katja Bender (Autor) Entwicklung und Charakterisierung verschiedener biomimetischer Lipidmembransysteme zur Untersuchung von Membranproteinen https://cuvillier.de/de/shop/publications/2471 Copyright: Cuvillier
Katja Bender (Autor) Entwicklung und Charakterisierung verschiedener biomimetischer Lipidmembransysteme zur Untersuchung von Membranproteinen https://cuvillier.de/de/shop/publications/2471 Copyright: Cuvillier
Selbstorganisation und supramolekulare Chemie
 Selbstorganisation und supramolekulare Chemie LEIBIZ-KLLEG PTSDAM 12.05.2004 Selbstorganisation und supramolekulare Chemie LEIBIZ-KLLEG PTSDAM 12.05.2004 Bauen mit molekularen Bausteinen Materialien aus
Selbstorganisation und supramolekulare Chemie LEIBIZ-KLLEG PTSDAM 12.05.2004 Selbstorganisation und supramolekulare Chemie LEIBIZ-KLLEG PTSDAM 12.05.2004 Bauen mit molekularen Bausteinen Materialien aus
Hans Dieter Baehr. Thermodynamik. Eine Einführung in die Grundlagen und ihre technischen Anwendungen. Vierte, berichtigte Auflage
 Hans Dieter Baehr Thermodynamik Eine Einführung in die Grundlagen und ihre technischen Anwendungen Vierte, berichtigte Auflage Mit 271 Abbildungen und zahlreichen Tabellen sowie 80 Beispielen Springer-Verlag
Hans Dieter Baehr Thermodynamik Eine Einführung in die Grundlagen und ihre technischen Anwendungen Vierte, berichtigte Auflage Mit 271 Abbildungen und zahlreichen Tabellen sowie 80 Beispielen Springer-Verlag
5. Die Thermodynamischen Potentiale
 5. Die hermodynamischen Potentiale 5.1. Einführung der Potentiale Gibbs'sche Fundamentalgleichung. d = du + d, du + d δ Q d = = Ist die Entroie als Funktion von U und bekannt, = ( U, ) dann lassen sich
5. Die hermodynamischen Potentiale 5.1. Einführung der Potentiale Gibbs'sche Fundamentalgleichung. d = du + d, du + d δ Q d = = Ist die Entroie als Funktion von U und bekannt, = ( U, ) dann lassen sich
