Beurteilung des Langzeittherapieerfolges nach Durchführung einer passageren Sakralnervenblockade
|
|
|
- Meta Biermann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus der Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg/Saar Direktor: Prof. Dr. med. M. Stöckle Beurteilung des Langzeittherapieerfolges nach Durchführung einer passageren Sakralnervenblockade Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin der medizinischen Fakultät der UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 2011 vorgelegt von: Nikola Rotering geb. Herwerth geboren am in Tübingen
2 - II - 1. Berichterstatter: 2. Berichterstatter: Tag der mündlichen Prüfung Zum Druck genehmigt, Homburg den
3 - III - Abkürzungsverzeichnis ACh BPS cm EMG H 2 O ICS IVP L M ml MS N NIH OAB P Pabd PD Pdet PSNB Pves S Th UD UHT V Vinf Qura ZNS z.b. Acetylcholin Benignes Prostata Syndrom Zentimeter Elektromyogramm Wasser International Continence Society Infusionsurogramm Lumbal Musculus Milliliter Multiple Sklerose Nervus National Institute of Health Overactive Bladder Druck Rektaldruck Differenzdruck Detrusordruck Passagere Sakralnevenblockade Blasendruck Sacral Thorakal Urodynamische Untersuchung Unterer Harntrakt Volumen Füllungsvolumen Harnfluss Zentrales Nervensystem zum Beispiel
4 - IV - Inhaltsverzeichnis Seite 1 Zusammenfassung 1 Summary 3 2 Einleitung und Fragestellung Einleitung Definition und Prävalenz der Inkontinenz Definition Prävalenz Inzidenz Anatomie der Harnblase Musculus detrusor vesicae Musculus sphincter vesicae Funktionen des unteren Harntraktes Neurophysiologie des unteren Harntraktes Das spinale Miktionszentrum Der Parasympathicus Der Sympathikus Der N. pudendus (Somatische Efferenzen) Die supraspinalen Miktionszentren Das pontine Miktionszentrum Die suprapontinen Miktionszentren Formen der Inkontinenz Blasenspeicherstörungen Belastungsinkontinenz Dranginkontinenz Motorische Dranginkontinenz Sensorische Urgency Mischinkontinenz Neurogene Dranginkontinenz Extraurethrale Harninkontinenz 17
5 - V Giggle-Inkontinenz (Kicher-Inkontinenz) Harninkontinenz bei Harnröhrenrelaxierung Blasenentleerungsstörungen Die interstitielle Cystitis Syndrom der überaktiven Blase Therapieoptionen bei Vorliegen einer Drangsymptomatik Blasentraining Pharmakotherapie Anticholinerge/antimuskarinerge Therapie Antidepressiva Botulinumtoxin A Elektrostimulation Blasendenervierung Blasenaugmentation Supravesikale Harnableitung Untersuchungstechniken Die simultane kombinierte urodynamische Untersuchung Urodynamische Parameter Blasendruck Pves (in cm H2O) Abdomendruck Pabd (cm H2O) Detrusordruck Pdet (cm H2O) Harnfluss Qura (ml/sec) Füllungsvolumen V (ml) Detrusorkoeffizient (Compliance=Blasendehnbarkeit) Elektromyographie der quergestreiften Beckenbodenmuskulatur (EMG) Die Röntgen-Videourographie Methode der passageren peripheren bilateralen Sakralnervenblockade des Segmentes S3 (PSNB) Fragestellung 30
6 - VI - 3 Material und Methoden Patientenkollektiv Fragebogen 33 4 Ergebnisse Allgemeine Daten Geschlechtsverteilung Alter zum Zeitpunkt der Untersuchung Diagnosen Ergebnisse der passageren Sakralnervenblockade des Gesamtkollektives Subjektiver Erfolg der passageren Sakralnervenblockade Würden Sie die Therapie wiederholen? Wie lange dauerte der Erfolg der Therapie an? Komplikationen Verspürten Sie direkt nach der Spritze eine Besserung der Beschwerden? Ergebnisse der passageren Sakralnervenblockade der Untergruppen Ergebnisse der passageren Sakralnervenblockade bei Patienten mit motorischer Urgency/Dranginkontinenz Subjektiver Erfolg der passageren Sakralnervenblockade bei Patienten mit motorischer Urgency/Dranginkontinenz Würden Sie die Therapie wiederholen? Wie lange hielt der Erfolg der Therapie an? Empfanden Sie die Untersuchung als schmerzhaft? Verspürten Sie direkt nach der Spritze eine Besserung der Beschwerden? 47
7 - VII Sensorische Urgency Subjektiver Erfolg der passageren Sakralnervenblockade bei Patienten mit sensorischer Urgency Würden Sie die Therapie wiederholen? Wie lange dauerte der Erfolg der Therapie an? Empfanden Sie die Untersuchung als schmerzhaft? Verspürten Sie direkt nach der Spritze eine Besserung der Beschwerden? Patienten mit interstitieller Cystitis Subjektiver Erfolg der passageren Sakralnervenblockade bei Patienten mit interstitieller Cystitis Würden Sie die Therapie noch einmal wiederholen? Wie lange dauerte der Erfolg der Therapie? Empfanden Sie die Therapie als schmerzhaft? Empfanden Sie direkt nach der Spritze eine Besserung der Beschwerden? Patienten mit neurogener Blasenspeicherstörung Subjektiver Erfolg der passageren Sakralnervenblockade bei Patienten mit neurogener Blasenspeicherstörung Würden Sie die Therapie wiederholen? Wie lange dauerte der Erfolg der Therapie an? Empfanden Sie die Therapie als schmerzhaft? Verspürten Sie direkt nach der Spritze eine Besserung der Beschwerden? Veränderungen der Blasenfüllungskapazität 58
8 - VIII - 5 Diskussion Patienten mit motorischer Dranginkontinenz Patienten mit sensorischer Dranginkontinenz Patienten mit interstitieller Cystitis Patienten mit neurogenen Blasenspeicherstörung Gesamtbeurteilung Fazit 68 6 Literaturverzeichnis 69 7 Danksagungen 80 8 Lebenslauf 81
9 - 1-1 Zusammenfassung Die der Dranginkontinenz zugrunde liegende erhöhte Kontraktionsbereitschaft des Harnblasendetrusors ist ein bis heute nicht genau definiertes Krankheitsbild, unter welchem ätiologisch unterschiedliche Formen der Blasenentleerungsstörungen zusammengefasst werden. Die allen Formen gemeinsamen Symptome sind Pollakisurie, Nykturie, Harndrang gegebenenfalls mit Inkontinenz und ein hyperkontraktiler Detrusor vesicae. Als Ursache für diese Dysfunktion des Miktionsvorgangs kommen neurogene, myogene und psychogene Komponenten sowie Veränderungen der Blasenschleimhaut in Frage. In der Mehrzahl der Fälle bleibt die zu Grunde liegende Ursache jedoch unklar. Eine Möglichkeit zur Diagnostik und Therapie bei diesen Formen der Blasenentleerungsstörungen ist die an unserer Klinik seit 1980 angewandte passagere Sakralnervenblockade des Segments S3. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Beurteilung der Therapie und des Langzeiterfolges aus subjektiver Sicht der Patienten untersucht. Insgesamt wurden die Daten von 211 Patienten ausgewertet, die in der Zeit von 1993 bis 2001 in unserer Klinik behandelt wurden. Die Rücklaufquote der von uns verschickten Fragebögen betrug 72,2%. Im Gesamtkollektiv zeigte sich eine hohe Akzeptanz der Untersuchung und sehr niedrige Komplikationsraten. Insgesamt gab gut die Hälfte der Patienten eine Therapieerfolgsdauer von mindestens 1 Monat sowie fast 21% eine Erfolgsdauer von mindestens 6 Monaten an. Erfreulicher Weise zeigte sich in ca. 15% der Patienten ein Langzeiterfolg von über einem Jahr. Andererseits erwiesen sich aber über 40% der Patienten als Therapieversager, bei denen die Sakralnervenblockade erfolglos blieb.
10 - 2 - Nach unserer Auswertung stellt die passagere Sakralnervenblockade bei vielen Patienten eine einfache, nahezu risikolose und in etwa der Hälfte der Fälle erfolgreiche Therapieoption dar, bei der sich in manchen Fällen sogar teilweise unerwartet gute Langzeiterfolge zeigen. Eine Vorhersage darüber, welche Patienten von der Therapie profitieren werden, lässt sich nach der Auswertung unserer Daten nicht treffen.
11 - 3 - Summary Different forms of disturbances of the micturition are combined as a diagnosis called urge syndrome. The reason of hyperreflexia of the detrusor of the bladder which results in an urge syndrome is not clearly known yet. All the disturbances have common symptoms which are frequency, nocturia and urgency with or without urge incontinence. The reasons of this dysfunction of micturition could be neurogenic disturbances, myogenic and psychogenic components also as alterations of the bladder mucosa. In most cases the exact reason stays ambiguous. A possibility in diagnosis and treatment of urge syndrome is a selective reversible bilateral sacral nerve blockade (PSNB) which is performed since 1980 in our institution. In this examination we evaluated the subjective long time outcome after selective reversible bilateral sacral nerve blockade. All together we could analyse the data of 211 patients which have undergone this procedure between 1993 an 2001 in our clinic. The rate of return of the questionnaires was 72.2%. In the total community of the respondents there was a high acceptance with very poor rates of complications Altogether about half of the patients specified a benefit from date of treatment of at least one month and 21% specified a benefit up to six month. Fortunately about 15% of the patients had a benefit of more than a year. Contrariwise there was a rate of more than 40% of the patients in whom the selective reversible bilateral sacral nerve blockade was unsuccessful. Out of our analysis of the data the selective reversible bilateral sacral nerve blockade in many patients is a treatment option which is easy to perform, which has a low risk of adverse effects and in about 50% is effective with an unexpected long-standing success in some cases. A prognosis which patients are going to benefit of this therapy out of our evaluation is not possible.
12 - 4-2 Einleitung und Fragestellung 2.1 Einleitung Schon die alten Ägypter beschäftigten sich 1600 vor Christus mit einem ununterbrochenen Urinfluss. Pignon, Binsennuß und Bier werden gekocht, gefiltert und einen Tag lang eingenommen. Dies war nur eine von vielen Mixturen, welche damals bei Miktionsstörungen eingesetzt wurden. Sie sind niedergeschrieben auf einer 20m langen Papyrusrolle in hieratischer Schrift, dem so genannten Ebers-Papyrus, einem der ältesten noch erhaltenen Texten überhaupt und wohl dem ältesten erhaltenem Text mit medizinischen Inhalt. Auch heute noch stellt die Urininkontinenz und deren Behandlung, auch wegen der sich verändernden Altersstruktur der Bevölkerung und dem gestiegenen Aktivitätsbedürfnis der älter werdenden Menschen, ein nicht zu unterschätzendes Problem dar (WINKLER 2002, WELZ-BARTH 2007). Nicht zuletzt wegen dieser sich verschiebenden Alterspyramide gewinnt auch die Betrachtung der ökonomischen Dimension immer mehr an Bedeutung (VON DER SCHULENBURG 2007, WULFF 2009). 2.2 Definition und Prävalenz der Inkontinenz Definition Als Inkontinenz bezeichnet man das Unvermögen, Harn willkürlich zurückzuhalten bzw. den unfreiwilligen Abgang von Harn (PSCHYREMBEL 1993). Die ICS (International Continence Society) definiert die Harninkontinenz als jeden unwillkürlichen Harnabgang (ABRAMS 2002).
13 Prävalenz Die unterschiedlichen Definitionen und Maße sind eine wesentliche Ursache für die sehr unterschiedlichen Einschätzungen der Prävalenz. Abhängig von Alter, Geschlecht und Ein/Ausschlusskriterien variiert die Prävalenz der Inkontinenz in verschiedenen Studien sehr stark. Bei Frauen bewegen sich die Angaben zwischen 4,5% und 53% (HAMPEL 1997) wurde in England bei 14% der Frauen und 7% der Männer von 4007 über 30-Jährigen eine Inkontinenz diagnostiziert (JARVIS 1993). Die Prävalenz in Frankreich wurde je nach Alter bei Frauen auf 4-57%, bei Männern auf 1,4-2,9% und bei den über 65-Jährigen auf 14-55% geschätzt (SENGLER 1995). In den USA wurde die Anzahl der inkontinenten Erwachsenen auf 10 Millionen, die Prävalenz bei gesunden Frauen mittleren Alters auf 30% geschätzt (WEINBERGER 1995). Unstrittig ist ein geschlechtsspezifischer Unterschied. Unter 1955 befragten über 60-Jährigen lag die Prävalenz der Harninkontinenz bei 30%, wobei die Prävalenz in der weiblichen Bevölkerung mit 37,3% nahezu doppelt so hoch wie in der männlichen Bevölkerung war (18,9%) (DIOKNO 1986). Von 3806 über 65-jährigen Personen in Massachusetts berichteten 53% der Frauen und 40% der Männer über Schwierigkeiten, den Urin zu halten. Winkler geht sogar davon aus, dass 6% aller Menschen an einer Harninkontinenz leiden (WINKLER 2002). Die Häufigkeit unterschiedlicher Formen der Inkontinenz ist altersabhängig. Mit dem Alter nimmt die Häufigkeit der Belastungsinkontinenz eher ab, während sie für die Dranginkontinenz steigt (HÖFNER 2000) Inzidenz Für die Inzidenz der Inkontinenz liegen nur sehr spärliche Daten vor. In den USA scheint nach Erhebungen des National Health Institutes (NIH) eine Inzidenz von weniger als 2% im Lebensalter unter 45 Jahre und um 8% für ein
14 - 6 - Lebensalter von 80 Jahren und älter zu bestehen. Die Gesamtinzidenz beträgt 6% (LANDEFELD 2008). Die Harninkontinenz stellt für die Betroffenen häufig eine sehr starke psychische Belastung dar und bringt Einschränkungen in sämtlichen Alltagsaktivitäten mit sich. Um den Patienten gerecht zu werden und eine wirkungsvolle Therapiemöglichkeit zu finden, ist das Wissen über mögliche Ursachen und Formen der Urininkontinenz sowie eine differenzierte Diagnostik, um die zu Grunde liegende funktionelle Störung zu erkennen, notwendig. 2.3 Anatomie der Harnblase Die Harnblase ist ein mit Übergangsepithel ausgekleidetes muskuläres Hohlorgan. Man kann sie mit einer dreiseitigen Pyramide vergleichen (SCHIEBLER 1991). An den Seitenkanten der hinteren Seite münden die Ureteren in die Harnblase ein, die Urethra führt an der nach unten gerichteten Ecke der Basis aus der Harnblase heraus. Der Bereich zwischen diesen drei Mündungen wird als Trigonum bezeichnet. Die Blasenmuskulatur besteht aus drei glatten Muskelschichten, deren Differenzierung jedoch erst im kaudalen Anteil erkennbar wird Musculus detrusor vesicae Die innere, longitudinal verlaufende Muskelschicht nimmt von cranial nach caudal ab und endet als Bindegewebe am Trigonum vesicae (DORSCHNER 1994). Sie erstreckt sich nicht, wie früher angenommen, bis in die Muskulatur der Harnröhre (TANAGHO 1966, TANAGHO 1968, TANAGHO 1992).
15 - 7 - Die mittlere Schicht ist zirkulär angeordnet und ummauert das Trigonum in seiner gesamten Ausdehnung. Die caudalen Muskelanteile bilden einen Ring um die Urethralöffnung (TANAGHO 1966, TANAGHO 1996, DORSCHNER 1994). Dies ist die stärkste muskuläre Struktur der Harnblase. Die Muskelstränge der äußeren, longitudinalen Schicht konvergieren am Blasenhals zu einem Muskelbündel und halten somit das gesamte System der Blasenmuskulatur zusammen (DORSCHNER 1994). Der Musculus detrusor vesicae ist somit nicht, wie TANAGHO und SMITH 1966 postulierten, an der Bildung der Urethralmuskulatur beteiligt. Nach DORSCHNER hat der Detrusor lediglich eine Reservoir- und Entleerungsfunktion und beteiligt sich nicht am Verschluss des Blasenausganges Musculus sphincter vesicae Nach bisherigen Vorstellungen stellte der M. sphincter vesicae keine selbstständige Muskulatur dar. Es wurde von einem Wulst bzw. einer Verdickung des Detrusors ausgegangen (TANAGHO 1966, TANAGHO 1996). Des Weiteren wurde eine Beteiligung des Musculus puborectalis postuliert (KAHLE 1986) oder ein Modell der Basalplatte beschrieben (HUTCH 1966). Nach der Theorie von DORSCHNER stellt diese von ihm auch als Musculus sphincter trigonalis bezeichnete Struktur einen eigenständigen Muskel dar. Sie nimmt eine elliptische, ringartige Form ein, die dorsal an die Interureterenleiste grenzt und sich nach vorne caudal neigt. Beim Mann endet dieser Muskel distal und oberhalb des Colliculums, bei der Frau an der Grenze zwischen mittlerem und distalem Harnröhrendrittel (DORSCHNER 1994).
16 Funktionen des unteren Harntraktes Die Aufgaben des unteren Harntraktes bestehen im Wesentlichen aus drei Teilbereichen. Zum einen ist dies eine spannungsfreien Urinaufnahme bis zu einer im Erwachsenenalter maximalen Blasenkapazität von ca ml. Diese Phase wird auch als Füllungsphase bezeichnet. Zum zweiten ist die Reservoirfunktion zu nennen. Sie dient der kontinenten Urinspeicherung, bis die äußeren Umstände, zentral vermittelt, eine Miktion zulassen (=Speicherphase). Und schließlich folgt eine vollständige und restharnfreie Blasenentleerung über einen zuvor relaxierten Sphinkter (=Miktion). 2.5 Neurophysiologie des unteren Harntraktes Die Steuerung dieser Funktionen ist ein komplexes sensoviszeromotorisches und somatomotorisches Reflexgeschehen (HANNAPPEL 1991). Für die Koordination und das Zusammenspiel aller Strukturen des unteren Harntraktes ist die Intaktheit sowohl des peripher-autonomen als auch des somatischen sowie des zentralen Nervensystems unentbehrlich. Im Gegensatz zu vielen anderen viszeralen Systemen, wie dem Gastrointestinaltrakt oder dem kardiovaskulären System, ist der untere Harntrakt von zentraler Kontrolle abhängig (DE GROAT 1993). Die Miktion ist willkürlich kontrollierbar und abhängig von einem Lern- und Reifungsprozess, der in der Kindheit beginnt und unter Umständen im Alter wieder verloren geht. Hierbei ist anzumerken, dass der Beginn der Miktion zentral gesteuert ist, der eigentliche Miktionsvorgang jedoch autonom abläuft. Das ZNS übernimmt hierbei im Sinne eines On-Off-Prinzipes die Rolle eines Lichtschalters (DE GROAT 1993, ELBADAWI 1996).
17 - 9 - Diese überaus komplexe nervale Innervation erklärt die sehr häufige Beteiligung des unteren Harntraktes bei unterschiedlichsten metabolischen oder neurologischen Erkrankungen. So treten Blasenfunktionsstörungen unter anderem auf bei Patienten mit Diabetes mellitus (ALLOUSSI 1985), bei Lyme- Borrelliose (WIESE 1999) oder auch bei Patienten mit MS oder Morbus Parkinson. Füllungsphase Entleerungsphase stimulierend Detrusor - + Blasenhals/Urethra + - Sphinkter/Beckenboden + - hemmend Detrusor + - Blasenhals/Urethra - + Sphinkter/Beckenboden - + Tabelle 1: Steuerung der Harnblasenfunktion durch stimulierende und hemmende Impulse während der Füllungs- und Entleerungsphase Das spinale Miktionszentrum Innerhalb des spinalen Systems spielen der sakrale Parasympathikus über den N. pelvicus, der Sympathikus über den N. hypogastricus und der somatische N. pudendus eine Rolle Der Parasympathicus Der Parasympathikus hat seinen Ursprung im Mittelhirn, in der Medulla oblongata und im sakralen Abschnitt des Rückenmarkes (MOLL 1993). Aus den Seitenhörnern, Nuclei intermediolaterales, der Columna lateralis und über die Vorderwurzeln des Spinalnerves der Sakralsegmente (S2-S4) entspringen die efferenten parasympathischen Fasern für die Harnblase und bilden den N. pelvicus (DE GROAT 1993, ELBADAWI 1996, CHAI 1996).
18 Im Plexus pelvicus nahe der Harnblase oder im Plexus vesicalis (intramurale Ganglien innerhalb der Blasenwand) erfolgt die Umschaltung auf postganglionäre Fasern (HANNAPPEL 1991, DE GROAT 1993). Modulierend auf die ganglionäre Transmission wirken synaptische Übertragungen, die sowohl muskarinerg als auch purinerg, adrenerg und vom Enkephalin-Typ sein können (DE GROAT 1993). Für eine seitengetrennte Innervation des Detrusors über den N. pelvicus sprechen die Ergebnisse der peripheren Sacralnervenblockade. Eine komplette Lähmung des Detrusors trat nur bei bilateraler Blockade auf (ALLOUSSI 1986) Der Sympathikus Die Kerngebiete des für den unteren Harntraktes zuständigen Anteils des sympathischen Nervensystems liegen in den Seitenhörnern der thorakolumbalen Segmente Th11-L 2 (ALLOUSSI 1986, HANNAPPEL 1991, DE GROAT 1993, CHAI 1996). Andere Autoren beschreiben die Grenzen von Th10-L2 (ELBADAWI 1996). Ein Teil der präganglionären Efferenzen wird in den paravertebralen Ganglien des Grenzstranges, ein anderer Teil im paraaortal liegenden Plexus hypogastricus superior umgeschaltet. Von dort ziehen die Fasern als N. hypogastricus zu dem weiter caudal liegenden Plexus pelvicus. Dort trifft der Sympathikus auf die parasympathischen Fasern. Von hieraus ziehen die Fasern zu den intramuralen Ganglien der Harnblase, des distalen Ureters und der Urethra. Gleichzeitig findet hier eine letzte Umschaltung auf postganglionäre Neurone statt (HANNAPPEL 1991, DE GROAT 1993, CHAI 1996, ELBADAWI 1996). Aus dem Grenzstrang ziehende, efferente sympathische Fasern sind hauptsächlich für die Innervation der Blutgefäße des unteren Harntraktes zuständig (ELBADAWI 1996).
19 Welche Rolle der Sympathikus für die Innervation des unteren Harntraktes genau spielt, ist derzeit noch Gegenstand der Forschung. Eine These besteht darin, dass sympathische Impulse allgemein modulierend wirken (DE GROAT 1993, ELBADAWI 1996, CHAI 1996) Bei Ratten wurde eine modulierende Rolle der alpha-2-adrenergen Rezeptoren auf den unteren Harntrakt bereits nachgewiesen (ISCHIZUKA 1996) Der N. pudendus (Somatische Efferenzen) Ihren Ursprung nehmen die somatischen Efferenzen aus den Vorderhornzellen der Sakralsegmente S2-S4 in direkter Nachbarschaft zu den Ursprungsgebieten des Parasympathikus (PETERS 1991, DE GROAT 1993, ELBADAWI 1996, CHAI 1996). Der N. pudendus teilt sich im Alcockschen Kanal in den dorsal gelegenen N. dorsalis penis bzw. N. dorsalis clitoridis und den eigentlichen Stammnerv, welcher den M. sphincter urethrae, den M. Levator ani, den M. sphincter ani sowie Mm. ischio- und bulbocavernosus motorisch innerviert (PETERS 1991) Die supraspinalen Miktionszentren Die Koordination des Miktionsvorganges wird vom Hirnstamm im Bereich der Pons und der Medulla oblongata übernommen. Absteigende motorische Efferenzen laufen im Tractus reticulospinalis und verbinden das pontine Miktionszentrum mit der spinalen Ebene. Durch diese direkte Verbindung zu den somatomotorischen und parasympathischen Kerngebieten wird das Zusammenspiel zwischen Detrusor und Sphincter gewährleistet (ALLOUSSI 1986, PETERS 1991, DE GROAT 1993, CHAI 1996, BLOCK 1997).
20 Das pontine Miktionszentrum Die Formatio reticularis ist ein locker gebautes, unscharf begrenztes Neuronensystem, welches vom Rückenmark über das Mittelhirn bis zum Thalamus reicht. Ein dorsomedial gelegener Kern ist für die Kontraktion des Detrusors verantwortlich. Wird ein mehr dorsolateral gelegener Kern stimuliert, so kann es sowohl zu einer Relaxation als auch zu einer Kontraktion des äußeren Sphinkters kommen. Wird dieser Kern zerstört, so kommt es zur Harninkontinenz. Dieser dorsolaterale Kern wird als pontines Speicherzentrum erachtet, der dorsomediale Kern als pontines Miktionszentrum (CHAI 1996). Eine Verletzung des Spinalmarkes rostral der lumbosacralen Segmente führt zur Entstehung einer arreflexiven Blase mit kompletter Harnretention. Diese Phase bezeichnet man auch als Schockphase, der spinale Reflexbogen ist noch nicht in der Lage die Blase zu entleeren. Häufig kommt es einige Wochen nach der Verletzung zu einem Rückgang der Symptomatik, allerdings treten nun häufig simultan Detrusor- und Sphinkterkontraktionen auf. Dies bezeichnet man als Detrusor-Sphinkter- Dyssynergie. Als Folge tritt ein funktionelles Miktionshindernis und damit verbunden eine große Restharnmenge auf (DE GROAT 1993) Die suprapontinen Miktionszentren Patienten mit Läsionen rostral der Pons können zwar die Miktion durch willkürliche Sphinkterkontraktion zunächst aufhalten, klagen aber über eine ausgeprägte Urge-Inkontinenz (BLAIVAS 1982). Nach Ermüdung des Sphinkters kann eine beginnende Detrusorkontraktion nicht aufgehalten werden. Besonders betroffen hiervon sind Patienten mit MS oder nach cerebrovasculärem Insult.
21 Dies unterstützt die Theorie einer separaten Kontrolle von Blase und Schließmuskel. 2.6 Formen der Inkontinenz In der Literatur findet man zahlreiche Einteilungen der Harninkontinenz, die sich teilweise erheblich voneinander unterscheiden. Die neueste und aktuell gültige Einteilung wurde 2002 von der ICS (international continence society) eingeführt (ABRAMS 2002). Nach dieser Nomenklatur der ICS wird Harninkontinenz zunächst allgemein nach symptomatischen, klinischen und urodynamischen Kriterien unterteilt. Prinzipiell wird zwischen Blasenspeicherstörungen und Blasenentleerungsstörungen unterschieden. Die bis dahin gängigen Einteilungen der Harninkontinenz waren ebenfalls von der ICS und stammten aus den Jahren 1976 und 1988 (BATES 1976, ABRAMS 1988). In der vorliegenden Arbeit wurden die Ergebnisse nach der zur Zeit der Datenerhebung gültigen Terminologie der ICS aufgeschlüsselt. Im klinischen Alltag finden zudem häufig noch ältere Einteilungen Verwendung. Alte Terminologie Stressinkontinenz Motorische Dranginkontinenz Sensorische Dranginkontinenz Kombinierte Stress- und Dranginkontinenz Reflexinkontinenz (Neurogene Dranginkontinenz) Überlaufinkontinenz Extraurethrale Inkontinenz Neue Terminologie Belastungsinkontinenz Nicht neurogene Detrusorhyperaktivität mit Inkontinenz Nicht mehr definiert Mischinkontinenz Neurogene Detrusorhyperaktivität mit Inkontinenz Chronische Harnretention mit Inkontinenz Extraurethrale Inkontinenz Tabelle 2: Gegenüberstellung der ehemaligen und der aktuellen Terminologie der Harninkontinenz entsprechend den Richtlinien der International Continence Society (SCHUMACHER 2004)
22 Blasenspeicherstörungen Bei der Blasenspeicherstörung liegt als übergeordneter Pathomechanismus das Unvermögen der Blase, ein bestimmtes Urinvolumen über eine bestimmte Zeitspanne speichern zu können, zu Grunde. Speicherstörungen sind in der Regel myogen (Detrusormuskel) oder neurogen bedingt. Das Kardinalsymptom der Blasenspeicherstörung ist die Inkontinenz. Die Blasenspeicherstörungen umfassen die Belastungsinkontinenz, welche bisher als Stressinkontinenz bezeichnet wurde, die Dranginkontinenz (bisher Urge-Inkontinenz), die Mischinkontinenz, die extraurethrale Inkontinenz und seltene Sonderformen der Harninkontinenz. Die verschiedenen Formen zeigen unterschiedliche klinische Symptome und Ursachen sowie unterschiedliche urodynamische Befunde. Dies ist von besonderem Belang, da für die verschiedenen Krankheitsformen vollkommen unterschiedliche Behandlungsansätze existieren. Trotzdem ist zu beachten, dass häufig eine Kombination aus den verschiedenen Inkontinenzformen vorliegt. Im Folgenden soll nun auf die verschiedenen Formen der Inkontinenz eingegangen werden Belastungsinkontinenz Die Belastungsinkontinenz ist die mit Abstand häufigste Form der Inkontinenz. Sie beschreibt einen Harnverlust während körperlicher Anstrengung (z.b. Husten, Niesen, Heben etc.) ohne dass Harndrang empfunden wird. Hierdurch kommt es durch die Erhöhung des intraabdominellen Druckes zu einer passiven intravesikalen Druckerhöhung ohne Detrusorkontraktion und daraus folgend zum Harnverlust (ALLOUSSI 1985). Somit ist die Belastungsinkontinenz durch einen inkompetenten=insuffizienten Verschlussmechanismus der Harnröhre bedingt (HÖFNER 2000). Es besteht
23 zum Zeitpunkt der Inkontinenz ein Druckgefälle zwischen Harnblasendruck und urethralem Verschlussdruck. Als Ursachen für eine Belastungsinkontinenz werden im Wesentlichen zwei Dinge angesehen. a) Eine sogenannte hypotone Urethra, welche unter Belastungsbedingungen (Erhöhung des intraabdominalen Drucks) keinen positiven Verschlussdruck garantieren kann. b) Eine Beckenbodeninsuffizienz bzw. ein defekter Aufhängeapparat von Blasenhals, Urethra und Vagina. Dies führt zu einem Deszensus der Organe und somit zu einer verminderten passiven Drucktransmission. Die Beckenbodeninsuffizienz tritt häufig nach mehreren Geburten, nach Bestrahlungen, Operationen oder auch bei starkem Übergewicht auf. Der zunehmende Östrogenmangel im Klimakterium führt über eine Atrophie und Involution zu einer Verstärkung der Symptome. Die Belastungsinkontinenz wird zumeist zum einen durch konservative Maßnahmen wie zum Beispiel Beckenbodentraining, zum anderen durch operative Eingriffe behandelt Dranginkontinenz Die Dranginkontinenz ist gekennzeichnet durch einen unwillkürlichen Harnverlust, der von imperativem Harndrang begleitet wird oder dem imperativer Harndrang vorausgeht. Verursacht wird dies durch spontane oder provozierte unwillkürliche Detrusorkontraktionen. Die Dranginkontinenz entsteht bei der Detrusorhyperaktivität vermutlich als Folge eines Missverhältnisses zwischen der Stärke der afferenten Impulse und der zentralen Hemmung des Miktionsreflexes. Man kann die Dranginkontinenz noch in weitere Untergruppen einteilen, die im folgenden vorgestellt werden.
24 Motorische Dranginkontinenz Hierbei treten unwillkürliche Detrusorkontraktionen mit imperativem Harndrang auf. Die Patienten sind nicht oder nur für kurze Zeit in der Lage mit Hilfe des willkürlichen M. sphincter vesicae den ungehemmten Detrusorkontraktionen zu widerstehen, es kommt somit zum unwillkürlichen Harnverlust Sensorische Urgency Bei der sensorischen Urgency besteht ein imperativer Harndrang ohne Detrusorkontraktion. Pathophysiologisch ist dies begründet durch eine vermehrte Anflutung sensorischer Reize (Hypersensitivität der Blase). Dies führt zu verstärktem und verfrühten Harndrang und somit zu einer funktionell verminderten Blasenkapazität. Nach der Blasenentleerung entsteht vorübergehende Besserung der Symptomatik bzw. Beschwerdefreiheit. Eine sensorische Urge-Inkontinenz gibt es nicht Mischinkontinenz Hierbei handelt es sich um einen unwillkürlichen Harnverlust, der einerseits mit imperativem Harndrang und andererseits bei körperlicher Belastung auftritt. Diese Form kann unterschiedliche Ausprägungen der entsprechenden Belastungs- oder Drangkomponente haben und tritt insbesondere in höherem Alter auf Neurogene Dranginkontinenz (Reflexinkontinenz) Eine Ausschaltung der zerebralen Kontrolle über den erhaltenen spinalen Miktionsreflexbogen führt zu einer Reflexinkontinenz. Der Patient kann die Miktion willkürlich weder einleiten noch unterbrechen.
25 Dies ist somit der Fall bei Verletzungen oder Erkrankungen des zentralen Nervensystems Extraurethrale Harninkontinenz Unter diesem Begriff werden jene Inkontinenzformen subsumiert, die durch unwillkürlichen Harnabgang durch Strukturen außerhalb der Harnblase verursacht werden. Zum einen sind dies angeborene Fehlbildungen, zum anderen sekundäre Fisteln, verursacht zum Beispiel durch Tumoren, Operationen oder Bestrahlungstherapie. Charakterisiert ist diese Form der Inkontinenz zumeist durch einen andauernden, persistierenden Harnverlust Giggle-Inkontinenz (Kicher-Inkontinenz) As Giggle-Inkontinenz bezeichnet man eine Sonderform der Dranginkontinenz. Hierbei werden die unwillkürlichen Detrusorkontraktionen ausgelöst durch bestimmte Situationen wie zum Beispiel starkes Lachen. Verursacht wird dies durch ein Defizit an zentralnervöser Hemmung (PERABO 2009) Harninkontinenz bei Harnröhrenrelaxierung Diese Form der Harninkontinenz ist definiert als Harnröhrenrelaxierung, die während der Füllphase ohne Anstieg des Abdominaldruckes oder Nachweis einer Detrusorhyperaktivität auftritt. Früher wurde dies als instabile Harnröhre bezeichnet.
26 Blasenentleerungsstörungen Die Blasenentleerungsstörungen sollen hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Auch hier könnte man eine Einteilung nach verschiedenen Ursachen vornehmen, worauf jedoch verzichtet wird, da die Blasenentleerungsstörungen für die vorliegende Fragestellung von untergeordneter Bedeutung sind. Zu den Blasenentleerungsstörungen zählt unter anderem die große Gruppe der Erkrankungen mit einer subvesikalen Obstruktion wie z.b. das benigne Prostata Syndrom (BPS). Eine sich hieraus ergebene Inkontinenzform ist die Überlaufinkontinenz bei chronischer Harnretention im Sinne eines drohenden oder bereits eingetretenen Harnverhaltes. 2.7 Die interstitielle Cystitis Die typischen cystitischen Beschwerden wie Pollakisurie und Dysurie verbunden mit schmerzhaftem, imperativen Harndrang sowie retrosymphysären Schmerzen prägen das Krankheitsbild der interstitiellen Cystitis. Betroffen sind zumeist Frauen mittleren Alters. Die Ursache der Erkrankung ist letztendlich noch unklar. Eine zunehmende Fibrose der Blasenwand führt zur Reduktion der Blasenkapazität. Histologisch kann häufig eine vermehrte Mastzellinfiltration nachgewiesen werden. Die Diagnose stützt sich auf Anamnese, Zystoskopie und Histologie, wobei diese meist unspezifisch ist. Entscheidend sind Hunnersche Ulcera, Schleimhauteinrisse mit Blutungen und eine verminderte Blasenkapazität. Eine medikamentöse Therapie führt bei der interstitiellen Cystitis leider selten zu dauerhaftem Erfolg (MERKLE 1997). An dieser Stelle hat sich die passagere Sakralnervenbockade auch als probates Diagnostikum erwiesen (HERZEL 1999). Unter der PSNB lässt sich die Blase bei einer interstitiellen Cystitis deutlich geringer auffüllen als bei den anderen
27 Dranginkontinenzformen. Zusätzlich kommt es bereits bei mäßigem Füllungsvolumen zu diffusen Schleimhauteinrissen mit Schleimhautblutungen. 2.8 Syndrom der überaktiven Blase Der Symptomkomplex aus imperativem Harndrang (Urge), Pollakisurie (Frequency) und Nykturie mit oder ohne Urinverlust wird auch als Syndrom der überaktiven Blase bezeichnet (OAB, overactive bladder). Das OAB-Syndrom umschreibt eine Harnspeicherstörung, die entweder durch eine hypersensitive Blase, einen wenig dehnbaren Blasenmuskel (Low compliance) oder durch ungehemmte motorische Aktivitäten des Blasenmuskels (überaktiver Detrusor) ausgelöst wird. Die schwerste Form mit einhergehender Dranginkontinenz wird als OAB wet bezeichnet. Viele der unter Punkt 1.6 aufgeführten Formen der Harninkontinenz fallen unter den Symptomkomplex der überaktiven Blase. 2.9 Therapieoptionen bei Vorliegen einer Drangsymptomatik Blasentraining Den Patienten wird die dem Leiden zu Grunde liegende Pathophysiologie erklärt (MADERSBACHER 1991). Ein Miktionsprotokoll macht den Patienten den normalerweise nicht bewussten Prozess der Blasensteuerung im Sinne eines Biofeedbacks bewusst und dient gleichzeitig als positive Verstärkung. Nach Madersbacher liegt die Erfolgsrate bei Patientinnen mit Detrusorhyperreflexie hier initial bei 90%. Bei 40% der Betroffenen kommt es jedoch innerhalb von 3 Jahren zu einem Rückfall. In jedem Falle muss zunächst eine symptomatische Detrusorinstabilität ausgeschlossen sein (MADERSBACHER 1991).
28 Pharmakotherapie Prinzipielle Angriffspunkte der Pharmakotherapie sind in der Regel die Rezeptoren am Endorgan, der Blase. Das Ziel der medikamentösen Therapie ist die Wiederherstellung einer pathologisch veränderten Blasenspeicher- oder auch Blasenentleerungsfunktion Anticholinerge/antimuskarinerge Therapie Der primäre Angriffspunkt ist hierbei der postsynaptische Rezeptor der neuromuskulären Endplatte am Detrusor. Da cholinerge Rezeptoren im Organismus fast ubiquitär vertreten sind, kommt es neben dem erwünschten Effekt zu zahlreichen Nebeneffekten, die sich durch die kompetitive Hemmung des ACh an anderen Organen und Systemen ergeben. Verwendete Wirkstoffe sind beispielsweise Trospiumchlorid, Propiverin, Oxybutinin, Tolterodin oder Darifenacin Antidepressiva In selteneren Fällen kann bei älteren Patienten, wenn Anticholinergika nicht vertragen werden, eine Therapie mit trizyklischen Antidepressiva probiert werden (z.b. Imipramin). Hierbei ist es durchaus möglich, dass verschiedene Patienten recht unterschiedlich auf ein gleiches Medikament reagieren (MADERSBACHER 1991) Botulinumtoxin A Eine besondere Form der medikamentösen Therapie, welche derzeit mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, stellt die Behandlung mit Botulinumtoxin A dar, welches bereits 1897 erstmals durch den Belgier ERMMENGEN aus dem Stuhl
29 von an Botulismus erkrankten Personen isoliert wurde. Die Rohform des Botulinumtoxin A wurde 1920 isoliert und dadurch auch die weitere Forschung ermöglicht. Erst 1981 wurde es erstmals therapeutisch in der Augenheilkunde durch A. SCOTT zur Therapie des Strabismus beim Menschen eingesetzt. Bei der Harnblase führt die Injektion von Botulinumtoxin A in den Detrusor vesicae durch Blockade der präsynaptischen Acetylcholinfreisetzung zu einer Relaxation des Detrusors (BROSS 2002, SCHULTE-BAUKLOH 2005, NEUGART 2006, STÖHRER 2007, SIEVERT 2007, FAUST 2007, SEIF 2008, WEFER 2009, PANNEK 2009). Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass es in Deutschland bisher noch keine offizielle Zulassung für diese Indikation gibt und die Therapie deshalb als individueller Heilversuch durchgeführt wird Elektrostimulation Die Stimulation der afferenten Bahnen im Versorgungsgebiet des N. pudendus kann eine Verstärkung der hemmenden Impulse auf den Detrusor erreichen (MADERSBACHER 1991, SCHMIDT 1990, GROEN 2001, TANAGHO 1990) Blasendenervierung Die Denervierungsoperationen zielen auf eine Verminderung der motorischen Impulse vom Detrusor ab. Eine Möglichkeit hierfür ist die 1986 von ALLOUSSI erstmals beschriebene passagere Sakralnervenblockade (PSNB). Eine andere Möglichkeit ist die selektive sakrale Rhizotomie, bei der mikrochirurgisch intradural selektiv die dorsalen Sakralwurzeln S2 S4/5 durchtrennt werden (HOHENFELLNER 2001).
30 Blasenaugmentation Hierbei übernimmt ein aufgesetztes detubularisiertes Darmsegment eine Windkesselfunktion, der Druckanstieg über die ungehemmte Detrusorkontraktion bleibt aus (MADERSBACHER 1990) Supravesikale Harnableitung Als ultima ratio bei persistierenden, konservativ nicht beherrschbaren Beschwerden ist eine supravesikale Harnableitung mit oder ohne Zystektomie. Hier besteht die Möglichkeit einer inkontinenten Form, bei der meistens der Urin über ein Illeum-Conduit als nasses Stoma abgeleitet wird, oder in Form einer kontinenten Harnableitung mit Bildung einer Ersatzblase, die ebenfalls aus einem ausgeschalteten Darmsegment gebildet wird, oder über die Einleitung des Urins in das Rektum als Pouch, was allerdings eine gute Stuhlkontinenz voraussetzt Untersuchungstechniken Die simultane kombinierte urodynamische Untersuchung Bei sämtlichen Patienten wurde die urodynamische Untersuchung mit der nachfolgend dargestellten Technik durchgeführt. Der benutzte Messplatz ist in Abbildung 1 dargestellt.
31 Abbildung 1: Darstellung der kombinierten urodynamischen Untersuchung mit videourographischer Aufzeichnung. Die Untersuchung der Patienten erfolgte im Sitzen. Zunächst wurde den Patienten zur Auffüllung der Harnblase sowie für die intrakavitäre Druckmessung ein doppelläufiger transurethraler oder suprapubischer Blasenkatheter (Charriere 10) in der üblichen Weise gelegt. Anschließend wurde den Patienten eine mit Flüssigkeit gefüllte Ballonsonde in das Rektum eingeführt. Über das eine Lumen des doppelläufigen Blasenkatheters wurde nun zunächst die Harnblase mit einem auf 37 C erwärmten Kontrastmittel (Peritrast ) mit einer Füllungsgeschwindigkeit von 30ml/min. aufgefüllt. Simultan wurde über das zweite Lumen des Katheters kontinuierlich der intrakavitäre Druck (Pves) der Blase gemessen. Gleichzeitig registrierten wir ebenfalls kontinuierlich das Miktionsvolumen (V), das Blasenfüllungsvolumen (Vinf), den Harnfluss (Qura) sowie das Elektromyogramm des Beckenbodens (EMG).
32 Über die Sonde im Rektum wurde der intraabdominale Druck (Pabd) gemessen. Der Detrusordruck ist definiert als Differenzdruck zwischen dem intravesikalen Druck und dem Abdominaldruck (über die Rektalsonde gemessen). Dieser wurde in unserer Messanordnung mit einem Subtraktionsverstärker elektronisch errechnet und ebenfalls fortlaufend aufgezeichnet. Die Messung und Registrierung der einzelnen Parameter erfolgte mit einem urodynamischen Messplatz der Firma Siemens (Urodynamischer Messplatz Typ III) Urodynamische Parameter Die bei der urodynamischen Untersuchung erhobenen Parameter sollen nun im Folgenden näher erläutert werden (siehe Abbildung 2) Blasendruck Pves [cm H 2 O] Als Blasendruckmessung (Zystomanometrie) bezeichnet man die Messung des intravesikalen Druckes bei kontinuierlicher Blasenfüllung (Blasenfüllungsdruck) und während der Miktion (Miktionsdruck). Dieser Blasendruck wird nach Empfehlung der International Continence Society in cm Wassersäule [cm H 2 O] angegeben. Der intravesikale Druck steigt während der Füllungsphase auf Grund der elastischen Eigenschaften der Blasenwand nur geringfügig an. Als normal gilt ein Druckanstieg von 2,5-4,0 cm H 2 O/100 ml Blasenfüllung. Da erfahrungsgemäß während der Miktion individuell sehr verschiedene Druckwerte auftreten, ist eine exakte Festlegung auf Normwerte hier nicht möglich. In der Regel beträgt der Miktionsdruck cm H 2 O.
33 Abdomendruck Pabd [cm H 2 O] Da der rektale Druck annähernd dem intraabdominalen Druck entspricht, wird dieser hierfür als Korrelat verwendet. Er wird simultan zum intravesikalen Druck gemessen und registriert. Hierdurch lässt sich eine intrinsische Blasendrucksteigerung (Detrusorkontraktion) sehr gut von einer extrinsischen Druckerhöhung des intravesikalen Druckes z.b. infolge Erhöhung des intraabdominalen Druckes durch Husten, Niesen, Pressen etc. unterscheiden Detrusordruck Pdet [cm H 2 O] Da sich Drucksteigerungen im Abdomen auf die Harnblase übertragen können, gibt der intravesikale Druck nicht den tatsächlichen, vom Detrusor entwickelten Druck an (ALLOUSSI 1985). Vielmehr ergibt sich der Detrusordruck aus der Differenz (Differenzdruck PD) von intravesikalem und abdominalem Druck (Rektumdruck). Er ist abhängig sowohl von den kontraktilen Eigenschaften des Detrusors, der Blasenfüllung und dem Fließwiderstand in der Harnröhre als auch von Alter und Geschlecht des Patienten Harnfluss Qura [ml/sec] Als Harnflussmessung (Uroflowmetrie) bezeichnet man die Ermittlung der Urinmenge, die die Urethra in einer bestimmten Zeiteinheit durchfließt. Hierbei sind die maximale und die mittlere Flussrate von besonderem Interesse. Die Stärke des Harnflusses ist vom intravesikalen Druck während der Miktion und vom Fließwiderstand in der Harnröhre abhängig (ALLOUSSI 1985). Bedingt durch die weitlumigere und kürzere Harnröhre ist der Harnfluss bei der Frau größer als beim Mann und beim Erwachsenen größer als beim Kind. Daher ist es sehr schwer für den Harnfluss allgemeingültige Normwerte anzugeben.
34 Beim erwachsenen Mann sollte der Harnfluss beispielsweise mindestens 15 ml/sec betragen Füllungsvolumen Vinf [ml] Beim gesunden erwachsenen Menschen beträgt das durchschnittliche Füllungsvolumen der Harnblase zwischen 300 und 500 ml. Allerdings unterliegt auch das Blasenvolumen einer großen physiologischen Schwankungsbreite und ist wiederum abhängig von Alter und Geschlecht Detrusorkoeffizient V/P (Compliance=Blasendehnbarkeit ) Unter dem Detrusorkoeffizient versteht man die Volumenzunahme pro Druckeinheit. Synonym hierzu werden die Begriffe Compliance und Dehnbarkeit verwendet Elektromyographie der quergestreiften Beckenbodenmuskulatur (EMG) Die motorische Aktivität der Beckenbodenmuskulatur nimmt bei intakter Blaseninnervation parallel zur Blasenfüllung zu und erreicht ihr Intensitätsmaximum entsprechend bei maximaler Blasenfüllung. Mit Beginn der Entleerungsphase bricht die Sphinkteraktivität abrupt ab. Aus diesem Grunde ergeben sich aus dem Beckenboden-EMG in Kombination mit der Cystometrie wichtige Hinweise, um neurogene Blasenentleerungsstörungen von funktionellen Störungen zu unterscheiden. Nur die gleichzeitige Analyse all dieser funktionellen Parameter lässt eine zuverlässige Beurteilung der Funktionsabläufe und gegebenenfalls Funktionsstörungen bei der Blasenfüllung und Blasenentleerung zu. Eine sorgfältige Auswertung und Beurteilung der Untersuchungsergebnisse ist somit von großer Bedeutung.
35 Abb. 2: Originalregistrierung eines urodynamischen Befundes einer Belastungsinkontinenz 2.12 Die Röntgen-Videourographie Um eine noch bessere Aussagekraft der urodynamischen Untersuchung zu erhalten, ist es mit Hilfe der Röntgen-Videourographie möglich, die dynamischen Messgrößen der urodynamischen Untersuchung mit der Konfiguration der Harnblase in diesem Moment zu korrelieren. Bei entsprechender vorhandener apparativer Ausstattung und Verwendung eines Röntgenkontrastmittels zur Blasenfüllung kann die Konfiguration der Harnblase
36 und der Urethra zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Füllung und Miktion beobachtet und mit den urodynamischen Parametern korreliert werden. Hiermit sind morphologische Veränderungen des unteren Harntraktes mit funktioneller Bedeutung wie Lageanomalien der Harnblase, partielle Akinesien der Blasenwand, Blasendivertikel, Refluxe, Detrusor-Beckenbodendyssynergien etc. optisch erkennbar und auch direkt mit den urodynamischen Parametern korrelierbar. Hierdurch wird die Beurteilbarkeit der urodynamischen Parameter erleichtert und die diagnostische Wertigkeit der Untersuchung noch deutlich erhöht Methode der passageren peripheren bilateralen Sakralnervenblockade des Segmentes S3 (PSNB) Nach Beendigung der kompletten urodynamischen Untersuchung wurde nun die temporäre bilaterale Sakralnervenblockade durchgeführt. Hierfür wurden die Patienten zunächst in Bauchlage gelagert. Wir führten zunächst in üblicher Weise die Lokalanästhesie der Haut mit einigen ml Xylocain 0,5% durch. Nun wurde beidseitig in Höhe des 3. Foramen sacrale dorsale eine Spinalanästhesiekanüle bis an das Periost vorgeschoben und unter Röntgenkontrolle in die richtige Position gebracht. Um die korrekte Lage der Kanülen sicherzustellen, wurde nun zunächst noch jeweils ein Milliliter eines Kontrastmittels injiziert. Bei Fehllage der Kanüle verteilt sich das Kontrastmittel diffus, die Lage der Nadel muss korrigiert werden. Befindet sich die Kanüle in der richtigen Position, so lässt sich der Verlauf des Spinalnerven sehr gut nachvollziehen. Bei gesichert korrekter Lage der Kanüle wurden nun 3 ml einer 0,5% Bupivacainlösung (Carbostesin ) injiziert, um eine temporäre Blockade der Nervenwurzel zu erreichen.
37 Im Anschluss an die temporäre Sakralnervenblockade wurde nun erneut eine videourodynamische Untersuchung oder alternativ eine Miktionscysturethrographie durchgeführt. Hierdurch ließ sich der direkte Effekt der Sakralnervenblockade auf die Harnblasenkonfiguration und die Urodynamik nachweisen. Die Zunehmende Blasendehnbarkeit wurde als dynamischer Prozeß beobachtet und die Blasenkapazität nach erfolgter passagerer bilateraler Sakralnervenblockade erneut bestimmt.
38 Fragestellung Wie bereits erwähnt ist die passagere Sakralnervenblockade (PSNB) eine der Therapiemöglichkeiten einer Inkontinenz oder Drangsymptomatik. Diese Therapieform ist mit einem relativ geringen Aufwand und wenigen Risiken für die Patienten verbunden. Die passagere Sakralnervenblockade wurde an der urologischen Universitätsklinik in Homburg entwickelt und seit 1986 durchgeführt. In der vorliegenden Arbeit wurden nach Durchführung einer beträchtlichen Anzahl von Untersuchungen die Daten unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet. Zunächst befragten wir die Patienten bezüglich Schmerzhaftigkeit der passageren Sakralnervenblockade und subjektiven Besserung der Symptomatik direkt nach der Therapie. Des Weiteren wurde der subjektive Langzeiterfolg der Therapie überprüft. Schließlich stellten wir die Frage, ob die Patienten die Therapie noch einmal wiederholen würden. Zusätzlich wurden die Veränderungen der Blasenkapazität durch die Sakralnervenblockade untersucht. Anhand dieser Daten sollte überprüft werden, ob bestimmte Patientengruppen besonders von dieser Therapie profitieren.
39 Material und Methoden 3.1 Patientenkollektiv Es wurden retrospektiv die Daten von insgesamt 324 Patienten aufgearbeitet, bei denen im Zeitraum zwischen Januar 1993 und Dezember 2001 an der urologischen Universitätsklinik Homburg-Saar eine passagere bilaterale Sakralnervenblockade (PSNB) durchgeführt worden war. Dieser Zeitraum wurde gewählt, da in dieser Zeit sämtliche Untersuchungen ausschließlich von zwei Ärzten durchgeführt wurden. Sämtliche Patienten litten unter den Symptomen einer Blasenspeicherstörung unterschiedlicher Genese und waren zur Abklärung dieser Beschwerden an die urologische Universitätsklinik überwiesen worden. Bei Aufnahme der Patienten in der Klinik wurde eine ausführliche Routineuntersuchung durchgeführt. Diese beinhaltete eine sorgfältige Anamnese mit besonderem Augenmerk auf dem Miktionsverhalten, eine klinische Untersuchung, einen Urinstatus mit anschließender Anlage einer Urinkultur zum Ausschluss eines bakteriellen Harnwegsinfektes, eine Sonographie des Urogenitaltraktes, ein Infusions-Urogramm (IVP) sowie eine subvesikale Abklärung mit Zystoskopie zum Ausschluss einer subvesikalen Obstruktion. Anschließend wurde die Blasenentleerungsstörung mit Hilfe einer urodynamischen Untersuchung bestätigt und näher klassifiziert. Nach Abschluss dieser Diagnostik wurde nun eine video-urodynamische Untersuchung mit passagerer bilateraler Sakralnervenblockade (PSNB) durchgeführt. Hierbei wurden die Blasenkapazitäten vor und nach der passageren bilateraler Sakralnervenblockade gemessen.
40 In Abhängigkeit von der in der urodynamischen Untersuchung festgelegten Klassifizierung der Blasenspeicherstörung wurden die Patienten in die in Tabelle 3 dargestellten Untergruppen unterteilt. Gruppe Klassifizierung der Blasenentleerungsstörung 1 Motorische Urgency bzw. Dranginkontinenz 2 Sensorische Urgency 3 Interstitielle Cystitis 4 Neurogene Dranginkontinenz (Reflexinkontinenz) 5 Andere Diagnose Tabelle 3: Klassifizierung der von uns untersuchten Patienten Sämtlichen 324 Patienten wurde im Juli 2002 ein Fragebogen zugeschickt, der 27 Fragen umfasste (Abbildung 3). Um den Anforderungen an den Datenschutz gerecht zu werden wurden die Fragebögen in anonymisierter und lediglich nummerierter Form versendet. Die Zuordnung der Fragebögen zu den einzelnen Patienten war somit nur mir als Auswertender möglich. Beim Versand der Fragebögen wurde explizit auf die Freiwilligkeit der Befragung hingewiesen. Im Rahmen der Auswertung der Fragebögen zeigte sich, dass teilweise mehrere Fragen von den Patienten nicht beantwortet worden waren. Analysiert wurden deshalb nur jene Fragen, die von mehr als 90% der Patienten beantwortet worden waren.
Anatomie und Physiologie Blase
 Anatomie und Physiologie Blase 1 Topographie Harnblase Liegt vorne im kleinen Becken, hinter Symphyse und Schambeinen Dach der Blase wird vom Peritoneum bedeckt Bei der Frau grenzt der hintere Teil an
Anatomie und Physiologie Blase 1 Topographie Harnblase Liegt vorne im kleinen Becken, hinter Symphyse und Schambeinen Dach der Blase wird vom Peritoneum bedeckt Bei der Frau grenzt der hintere Teil an
Neurogene Blasenfunktionsstörung
 Neurogene Blasenfunktionsstörung Formen, Symptome, Diagnostik Harnblase - ein unscheinbares Organ Beobachter 24/99 Die Harnblase ist eigentlich ein langweiliges Organ, ein plumper Sack. Wichtger ist.?
Neurogene Blasenfunktionsstörung Formen, Symptome, Diagnostik Harnblase - ein unscheinbares Organ Beobachter 24/99 Die Harnblase ist eigentlich ein langweiliges Organ, ein plumper Sack. Wichtger ist.?
Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz
 12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
Patienteninformation. Nehmen Sie sich Zeit...
 Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Harn- und Stuhlinkontinenz
 Harn- und Stuhlinkontinenz Harninkontinenz, dass heißt unwillkürlicher Urinverlust, ist eine häufige Erkrankung, unter der in Deutschland etwa sechs bis acht Millionen Frauen und Männer leiden. Blasenfunktionsstörungen,
Harn- und Stuhlinkontinenz Harninkontinenz, dass heißt unwillkürlicher Urinverlust, ist eine häufige Erkrankung, unter der in Deutschland etwa sechs bis acht Millionen Frauen und Männer leiden. Blasenfunktionsstörungen,
Inhalt. Geschichtliche Anmerkungen... 1
 Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes
 11 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes P.M. Braun und K.-P. Jünemann.1 Anatomie des unteren Harntrakt es 1. Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) 1.3 Neurophysiologie 13 Literatur
11 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes P.M. Braun und K.-P. Jünemann.1 Anatomie des unteren Harntrakt es 1. Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) 1.3 Neurophysiologie 13 Literatur
PATIENTENINFORMATION. über. Harninkontinenz
 PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt
 Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Miktionsanamnese Begleiterkrankungen Miktionsanamnese Trink- und Essgewohnheiten
Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Miktionsanamnese Begleiterkrankungen Miktionsanamnese Trink- und Essgewohnheiten
UMFRAGEERGEBNISSE DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN
 UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
Beratung Vorsorge Behandlung. Beckenboden- Zentrum. im RKK Klinikum Freiburg. Ihr Vertrauen wert
 Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll
 Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz
 Harninkontinenz: Definition Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz Unter Harninkontinenz verstehen wir, wenn ungewollt Urin verloren geht. Internationale Kontinenzgesellschaft (ICS) Zustand mit jeglichem
Harninkontinenz: Definition Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz Unter Harninkontinenz verstehen wir, wenn ungewollt Urin verloren geht. Internationale Kontinenzgesellschaft (ICS) Zustand mit jeglichem
Inkontinenz. Dr. med. P. Honeck. Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen
 Therapie der männlichen Inkontinenz Dr. med. P. Honeck Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen g Formen der Inkontinenz Form Belastung (Stress) Beschreibung Unwillkürlicher Harnabgang
Therapie der männlichen Inkontinenz Dr. med. P. Honeck Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen g Formen der Inkontinenz Form Belastung (Stress) Beschreibung Unwillkürlicher Harnabgang
Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel
 Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
Integrierte Versorgung bei Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Konzepte für Prävention, Diagnostik und Therapie am Beckenbodenzentrum der Frauenklinik der MHH Peter Hillemanns, OA Dr. H. Hertel Klinik
Frau Prof. Burkhard, wie lässt sich das Problem der Inkontinenz zuordnen? Wer ist davon betroffen?
 Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Die Harninkontinenz bei der Frau. Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien
 Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Die Harninkontinenz bei der Frau Gründe, Physiologie, Diagnostik und neue Therapien Definition der Harninkontinenz! Die Harninkontinenz ist ein Zustand, in dem unfreiwilliges Urinieren ein soziales oder
Inkontinenz. Marian van der Weide. Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen. Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle
 Marian van der Weide Inkontinenz Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen Aus dem Niederländischen von Martin Rometsch Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis Geleitwort 11
Marian van der Weide Inkontinenz Pflegediagnosen und Pflegeinterventionen Aus dem Niederländischen von Martin Rometsch Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis Geleitwort 11
Ich kann nicht Wasser lösen!
 Ich kann nicht Wasser lösen! Swiss Family Docs, Basel 26.08.2011 Christoph Cina / Stephan Holliger Eine häufige und banale Männergeschichte? Eine häufige und banale Männergeschichte? Arten der Prostata
Ich kann nicht Wasser lösen! Swiss Family Docs, Basel 26.08.2011 Christoph Cina / Stephan Holliger Eine häufige und banale Männergeschichte? Eine häufige und banale Männergeschichte? Arten der Prostata
Harnkontinenz. Definitionen. Formen nicht kompensierter Inkontinenz. Pflegediagnosen: Risikofaktoren
 Definitionen Harninkontinenz ist jeglicher unfreiwilliger Urinverlust. ist die Fähigkeit, willkürlich zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase zu entleeren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit,
Definitionen Harninkontinenz ist jeglicher unfreiwilliger Urinverlust. ist die Fähigkeit, willkürlich zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase zu entleeren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit,
Wasser löse Wasser häbe
 Wasser löse Wasser häbe Individuelle Lösungen bei Miktionsproblemen im Alter Dr. med. Michael Thoms Oberarzt Urologie LUKS Luzern Wolhusen, 29.09.2016 Kein Tabuthema!!! Miktionsprobleme Ungewollter Urinverlust
Wasser löse Wasser häbe Individuelle Lösungen bei Miktionsproblemen im Alter Dr. med. Michael Thoms Oberarzt Urologie LUKS Luzern Wolhusen, 29.09.2016 Kein Tabuthema!!! Miktionsprobleme Ungewollter Urinverlust
Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe
 Inkontinenz im Alter Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe Gedächtnisschwund und Blasenschwäche kommen sehr oft zusammen, weil Demenz die Hirnregion zerstört, die für die Blasenkontrolle zuständig
Inkontinenz im Alter Menschen mit Demenz brauchen besondere Hilfe Gedächtnisschwund und Blasenschwäche kommen sehr oft zusammen, weil Demenz die Hirnregion zerstört, die für die Blasenkontrolle zuständig
Inkontinenz stoppt mich nicht mehr
 Inkontinenz stoppt mich nicht mehr Ist Inkontinenz eine eher seltene Erkrankung? Zurück ins Leben Ganz und gar nicht! Nahezu 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Inkontinenz, Junge wie Alte,
Inkontinenz stoppt mich nicht mehr Ist Inkontinenz eine eher seltene Erkrankung? Zurück ins Leben Ganz und gar nicht! Nahezu 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Inkontinenz, Junge wie Alte,
Zu dieser Folie: Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz
 Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3 Relevante Kapitel:
Schulungsziel: TN kennen wesentliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen bei Harnund Stuhlinkontinenz Zielgruppe: Pflegefachkräfte Zeitrahmen: 90 Minuten Dokumente: Foliensatz 3 Relevante Kapitel:
Störung der Blasenfunktion und ihre Auswirkungen
 Unfreiwilliger Harnverlust oder Harninkontinenz In den ersten Lebensjahren können Babys und später Kleinkinder die Harnblase nicht kontrollieren. Der von den Nieren ausgeschiedene Harn wird in der Blase
Unfreiwilliger Harnverlust oder Harninkontinenz In den ersten Lebensjahren können Babys und später Kleinkinder die Harnblase nicht kontrollieren. Der von den Nieren ausgeschiedene Harn wird in der Blase
ALLES ÜBER BLASENPROBLEME. Solutions with you in mind
 ALLES ÜBER BLASENPROBLEME www.almirall.com Solutions with you in mind WAS IST DAS? Blasenprobleme sind definiert als Symptome, die von einer unzureichenden Funktion der Blase herrühren. Bei MS-Patienten
ALLES ÜBER BLASENPROBLEME www.almirall.com Solutions with you in mind WAS IST DAS? Blasenprobleme sind definiert als Symptome, die von einer unzureichenden Funktion der Blase herrühren. Bei MS-Patienten
Diagnostik in der Urogynäkologie
 Diagnostik in der Urogynäkologie Urodynamik Die Urodynamik hielt 1939 Einzug in die urologische Diagnostik: Lewis: A new clinical recording cystometry in J Urol 41 (1939): 638 beschrieb die Methode als
Diagnostik in der Urogynäkologie Urodynamik Die Urodynamik hielt 1939 Einzug in die urologische Diagnostik: Lewis: A new clinical recording cystometry in J Urol 41 (1939): 638 beschrieb die Methode als
BECKENBODEN- ZENTRUM
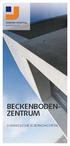 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
Blasenfunktionsdiagnostik
 SIGUP 211 Basel Blasenfunktionsdiagnostik Dr. med. Daniel Engeler Leitender Arzt Klinik für Urologie Kantonsspital St. Gallen daniel.engeler@kssg.ch SIGUP 211 Basel Übersicht Einleitung Basisabklärungen
SIGUP 211 Basel Blasenfunktionsdiagnostik Dr. med. Daniel Engeler Leitender Arzt Klinik für Urologie Kantonsspital St. Gallen daniel.engeler@kssg.ch SIGUP 211 Basel Übersicht Einleitung Basisabklärungen
Klinik für Urologie und Kinderurologie
 Klinik für Urologie und Kinderurologie Mehr als gute Medizin. Krankenhaus Schweinfurt D ie Klinik für Urologie und Kinderurologie ist auf die Behandlung von Erkrankungen bestimmter Organe spezialisiert.
Klinik für Urologie und Kinderurologie Mehr als gute Medizin. Krankenhaus Schweinfurt D ie Klinik für Urologie und Kinderurologie ist auf die Behandlung von Erkrankungen bestimmter Organe spezialisiert.
corina.christmann@luks.ch sabine.groeger@luks.ch Frühjahrsfortbildung Inkontinenz
 Frühjahrsfortbildung Inkontinenz Welche Inkontinenzformen gibt es? Andere Inkontinenzformen (stress 14% urinary incontinence, SUI) - Dranginkontinenz (überaktive Blase, urge UUI, OAB wet/dry) (Inkontinenz
Frühjahrsfortbildung Inkontinenz Welche Inkontinenzformen gibt es? Andere Inkontinenzformen (stress 14% urinary incontinence, SUI) - Dranginkontinenz (überaktive Blase, urge UUI, OAB wet/dry) (Inkontinenz
Brigitte Sachsenmaier. Inkontinenz. Hilfen, Versorgung und Pflege. Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus. schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei
 Brigitte Sachsenmaier Inkontinenz Hilfen, Versorgung und Pflege Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1. Was ist Inkontinenz?
Brigitte Sachsenmaier Inkontinenz Hilfen, Versorgung und Pflege Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1. Was ist Inkontinenz?
Die Harninkontinenz. Inhalt
 Die Harninkontinenz Inhalt Die Formen der Harninkontinenz Die Dranginkontinenz Die Stress- bzw. Belastungsinkontinenz Die Mischinkontinenz Die Elektrostimulation der Beckenbodenmuskulatur Die Behandlung
Die Harninkontinenz Inhalt Die Formen der Harninkontinenz Die Dranginkontinenz Die Stress- bzw. Belastungsinkontinenz Die Mischinkontinenz Die Elektrostimulation der Beckenbodenmuskulatur Die Behandlung
Anatomie der Harnwege
 Anatomie der Harnwege Quellen: Innere Medizin, Weiße Reihe, Urban & Fischer, Band 4, 7. Auflage, 2oo2 Der Mensch Anatomie und Physiologie Thieme Verlag, 3. Auflage, 2oo2 HNO-Augenheilkunde, Dermatologie
Anatomie der Harnwege Quellen: Innere Medizin, Weiße Reihe, Urban & Fischer, Band 4, 7. Auflage, 2oo2 Der Mensch Anatomie und Physiologie Thieme Verlag, 3. Auflage, 2oo2 HNO-Augenheilkunde, Dermatologie
Juni 2004. Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin
 Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin Blasenstörungen und Sexualfunktionsstörungen bei Multipler Sklerose Krankenhaus Buchholz Abteilung für Neurologie Helle
Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin Blasenstörungen und Sexualfunktionsstörungen bei Multipler Sklerose Krankenhaus Buchholz Abteilung für Neurologie Helle
Prophylaxen. P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz
 Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Ich verliere Winde was tun?
 HERZLICH WILLKOMMEN Samstag, 29. August 2015 Ich verliere Winde was tun? Marc Hauschild Stv. Oberarzt Klinik für Chirurgie Liestal ANO-REKTALE INKONTINENZ Inhaltsverzeichnis 1. Kontinenz 2. Häufigkeit
HERZLICH WILLKOMMEN Samstag, 29. August 2015 Ich verliere Winde was tun? Marc Hauschild Stv. Oberarzt Klinik für Chirurgie Liestal ANO-REKTALE INKONTINENZ Inhaltsverzeichnis 1. Kontinenz 2. Häufigkeit
2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose
 2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose Botulinumtoxin und Multiple Sklerose Johann Hagenah Die Geschichte des Botulinumtoxins 1817 Justinus Kerner publiziert in den Tübinger Blättern für
2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose Botulinumtoxin und Multiple Sklerose Johann Hagenah Die Geschichte des Botulinumtoxins 1817 Justinus Kerner publiziert in den Tübinger Blättern für
Inkontinenz. Was versteht man unter Harninkontinenz? Welche Untersuchungen sind notwendig?
 Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten. Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie
 Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Inhalt. Vorwort 11. Der Harntrakt und seine Funktion 15. Störung der Blasenfunktion und ihre Auswirkungen 29
 Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k
 Mein Beckenboden Beckenbodenschwäche & Inkontinenz Ursachen, Diagnostik und Therapien 3D Animation Beckenboden Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k Ursachen Beckenbodenschwäche Geburten Alter
Mein Beckenboden Beckenbodenschwäche & Inkontinenz Ursachen, Diagnostik und Therapien 3D Animation Beckenboden Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bxujfkehd4k Ursachen Beckenbodenschwäche Geburten Alter
Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig?
 13. Bamberger Gespräche 2009 Thema: Harninkontinenz und Sexualität Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig? Von Hofr. Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg (5. September 2009) - Unfreiwilliger
13. Bamberger Gespräche 2009 Thema: Harninkontinenz und Sexualität Was ist aus urologischer Sicht an Diagnostik notwendig? Von Hofr. Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg (5. September 2009) - Unfreiwilliger
Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz
 Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz Prim. Univ. Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Gynäkologie KH Barmherzige Brüder Wien Wien, am 25.06.2013 Harninkontinenz Definition Prävalenz
Abklärung und Therapie der weiblichen Harninkontinenz Prim. Univ. Doz. Dr. Barbara Bodner-Adler, Abteilung für Gynäkologie KH Barmherzige Brüder Wien Wien, am 25.06.2013 Harninkontinenz Definition Prävalenz
BECKENBODEN- ZENTRUM
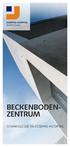 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE IM JOSEPHS-HOSPITAL KONTAKT JOSEPHS-HOSPITAL WARENDORF GYNÄKOLOGIE AGUB II-Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE IM JOSEPHS-HOSPITAL KONTAKT JOSEPHS-HOSPITAL WARENDORF GYNÄKOLOGIE AGUB II-Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC
 Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Urologie Von Dr. med. Ulf Bersch Eines der grössten Probleme bei einer Schädigung des Rückenmarks ist die Funktionsstörung der Harnblase mit den daraus entstehenden
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Urologie Von Dr. med. Ulf Bersch Eines der grössten Probleme bei einer Schädigung des Rückenmarks ist die Funktionsstörung der Harnblase mit den daraus entstehenden
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz
 Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Botulinumtoxin in den Detrusor vesicae als simultane Maßnahme bei TUR-Prostata PD Dr. med. Vahudin Zugor
 Botulinumtoxin in den Detrusor vesicae als simultane Maßnahme bei TUR-Prostata .... Botox - ein Gift macht Karriere Das starke Gift als Medikament und Faltenkiller Zervikale Dystonie Blepharospasmen Chronische
Botulinumtoxin in den Detrusor vesicae als simultane Maßnahme bei TUR-Prostata .... Botox - ein Gift macht Karriere Das starke Gift als Medikament und Faltenkiller Zervikale Dystonie Blepharospasmen Chronische
Harninkontinenz. Inhaltsverzeichnis. 1 Formen der Harninkontinenz
 Harninkontinenz Inhaltsverzeichnis 1 Formen der Harninkontinenz 1.1 Überlaufinkontinenz 1.2 Syndrom der überaktiven Blase 1 Formen der Harninkontinenz Die häufigsten Formen sind die Dranginkontinenz (ICD-10:
Harninkontinenz Inhaltsverzeichnis 1 Formen der Harninkontinenz 1.1 Überlaufinkontinenz 1.2 Syndrom der überaktiven Blase 1 Formen der Harninkontinenz Die häufigsten Formen sind die Dranginkontinenz (ICD-10:
Und wie kommt es dann zur Blasenschwäche
 Und wie kommt es dann zur Blasenschwäche Formen der Harninkontinenz - Wie kommt es zur Blasenschwäche? Bei Blasenschwäche ist das komplexe Zusammenspiel der Organe gestört (8 Seiten) Dranginkontinenz (8
Und wie kommt es dann zur Blasenschwäche Formen der Harninkontinenz - Wie kommt es zur Blasenschwäche? Bei Blasenschwäche ist das komplexe Zusammenspiel der Organe gestört (8 Seiten) Dranginkontinenz (8
BHS Linz, Kinderurologie. e bei MMC Linz, Seilerstätte 4. und in. Ausmaß. zu sein. Familie. dlich sein. Von. störung. werden.
 Elterninformation NeurogeneN e Neurogene Blase bei MMC Was versteht man unter MMC? MMC ist die Abkürzung für Meningomyelocele. Man versteht darunter eine Fehlbildung des Neuralrohrs. Das Neuralrohr ist
Elterninformation NeurogeneN e Neurogene Blase bei MMC Was versteht man unter MMC? MMC ist die Abkürzung für Meningomyelocele. Man versteht darunter eine Fehlbildung des Neuralrohrs. Das Neuralrohr ist
Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis. AGUB GK Freiburg,
 Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis AGUB GK Freiburg, 28.10.2016 Überblick Harninkontinenz Belastungsinkontinenz Dranginkontinenz Nykturie Mischformen Überblick
Formen und Differenzialdiagnosen der Harninkontinenz und des Descensus genitalis AGUB GK Freiburg, 28.10.2016 Überblick Harninkontinenz Belastungsinkontinenz Dranginkontinenz Nykturie Mischformen Überblick
Parkinson und die Blase
 encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt Behandlung von Blasenproblemen ISK kann helfen Die Krankheit Parkinson Parkinson ist eine fortschreitende neurologische
encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt Behandlung von Blasenproblemen ISK kann helfen Die Krankheit Parkinson Parkinson ist eine fortschreitende neurologische
Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP. Braunlage
 Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP Braunlage 20.4.2013 MBA, MPH W. N. Vance Facharzt für Urologie, Sexualmedizin, Sozialmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie,
Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP Braunlage 20.4.2013 MBA, MPH W. N. Vance Facharzt für Urologie, Sexualmedizin, Sozialmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie,
Inkontinenz - Zukünftige Herausforderungen
 16. Bamberger Gespräche 2012 Inkontinenz - Zukünftige Herausforderungen Prof. Dr. med. Ingo Füsgen Bamberg (8. September 2012) - Der demografische Wandel mit dem massiven Anstieg Betagter und Hochbetagter
16. Bamberger Gespräche 2012 Inkontinenz - Zukünftige Herausforderungen Prof. Dr. med. Ingo Füsgen Bamberg (8. September 2012) - Der demografische Wandel mit dem massiven Anstieg Betagter und Hochbetagter
DR. ANDREA FLEMMER. Blasenprobleme. natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung
 DR. ANDREA FLEMMER Blasenprobleme natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung it se m ln a l B Die Mitte n e h c n einfa trainiere aktiv 18 Ihre Harnblase das sollten
DR. ANDREA FLEMMER Blasenprobleme natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung it se m ln a l B Die Mitte n e h c n einfa trainiere aktiv 18 Ihre Harnblase das sollten
Inkontinenztherapie in der Facharztpraxis
 Weiterbildung für Arzthelferinnen Inkontinenztherapie in der Facharztpraxis Die Weiterbildung beinhaltet 3 Module verteilt über 3 Monate Theorie: die Teilnehmer erhalten ein fundiertes Basiswissen über
Weiterbildung für Arzthelferinnen Inkontinenztherapie in der Facharztpraxis Die Weiterbildung beinhaltet 3 Module verteilt über 3 Monate Theorie: die Teilnehmer erhalten ein fundiertes Basiswissen über
LoFric encathopedia. Behandlung von Blasenproblemen. Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt. ISK kann helfen
 LoFric encathopedia encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wellspect HealthCare ist ein führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Urologie und Chirurgie. Wir
LoFric encathopedia encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wellspect HealthCare ist ein führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Urologie und Chirurgie. Wir
Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H.
 Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H. Dralle Gastric-banding als Operationsmethode bei morbider Adipositas
Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H. Dralle Gastric-banding als Operationsmethode bei morbider Adipositas
Prostataerkrankungen
 Wenn s s einmal nicht mehr läuft: Prostataerkrankungen Prof. Dr. med. K.D. Sievert Stellvertretender Direktor Klinik für f r Urologie Universität t T Ablauf Anatomie & Physiologie Benignes Prostatasyndrom
Wenn s s einmal nicht mehr läuft: Prostataerkrankungen Prof. Dr. med. K.D. Sievert Stellvertretender Direktor Klinik für f r Urologie Universität t T Ablauf Anatomie & Physiologie Benignes Prostatasyndrom
Kontinente Harnableitung nach Blasenvergrößerung oder Blasenersatz
 encathopedia Volume 6 Kontinente Harnableitung nach Blasenvergrößerung oder Blasenersatz Indikationen für Harnableitungen Formen der kontinenten Blasenersatzanlagen ISK kann helfen Indikationen für Harnableitungen
encathopedia Volume 6 Kontinente Harnableitung nach Blasenvergrößerung oder Blasenersatz Indikationen für Harnableitungen Formen der kontinenten Blasenersatzanlagen ISK kann helfen Indikationen für Harnableitungen
Urodynamik. Fort- und Weiterbildungskommission der Deutschen Urologen Arbeitskreis Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau
 Urodynamik Fort- und Weiterbildungskommission der Deutschen Urologen Arbeitskreis Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau von Hans Palmtag, Mark Goepel, H Heidler überarbeitet Urodynamik
Urodynamik Fort- und Weiterbildungskommission der Deutschen Urologen Arbeitskreis Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau von Hans Palmtag, Mark Goepel, H Heidler überarbeitet Urodynamik
Vorwort 11. Der Harntrakt und seine Funktion 15
 Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Vorwort 11 Der Harntrakt und seine Funktion 15 Weiblicher und männlicher Harntrakt Aufbau und Funktion 17 Die Blasenfunktion ein Zyklus aus Speicherung und Entleerung 21 Phänomen»Primanerblase«24 Flüssigkeitszufuhr
Anhang. Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-Operation
 53 Anhang Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) Name, Vorname: geboren am: Größe cm Gewicht:
53 Anhang Anhang Abb. 1 : Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration Fragebogen zur Beurteilung der TVT-eration (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) Name, Vorname: geboren am: Größe cm Gewicht:
14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen Erkrankungen aus Sicht des Urologen
 Hofrat Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher: Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronale 14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen
Hofrat Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher: Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronale 14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen
Reha für operierte BPS Patienten. Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar Köln
 Reha für operierte BPS Patienten Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar 17.02. 18.02.2017 Köln Prof. Dr. med. Ullrich Otto Ärztlicher Direktor Ltd. Chefarzt UKR Urologisches Kompetenzzentrum
Reha für operierte BPS Patienten Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar 17.02. 18.02.2017 Köln Prof. Dr. med. Ullrich Otto Ärztlicher Direktor Ltd. Chefarzt UKR Urologisches Kompetenzzentrum
Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen?
 Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen? von Priv.-Doz. Dr. med. Ingo Füsgen GOVI Govi-Verlag Einführung 9 Anatomische und physiologische Vorbemerkungen 11 Die Harnblase - Aufbau und Funktion
Inkontinenz Was muß der Apotheker darüber wissen? von Priv.-Doz. Dr. med. Ingo Füsgen GOVI Govi-Verlag Einführung 9 Anatomische und physiologische Vorbemerkungen 11 Die Harnblase - Aufbau und Funktion
Harninkontinenz - Kontinenzförderung. Rita Willener Pflegeexpertin MScN
 Harninkontinenz - Kontinenzförderung Rita Willener Pflegeexpertin MScN Klinik für Urologie, Inselspital Bern, 2011 Übersicht zum Referat Harninkontinenz Epidemiologie Definition Risikofaktoren Auswirkungen
Harninkontinenz - Kontinenzförderung Rita Willener Pflegeexpertin MScN Klinik für Urologie, Inselspital Bern, 2011 Übersicht zum Referat Harninkontinenz Epidemiologie Definition Risikofaktoren Auswirkungen
Grundlagen Aufbau des vegetativen Nervensystems
 Grundlagen Aufbau des vegetativen Nervensystems David P. Wolfer Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität Zürich -00-00
Grundlagen Aufbau des vegetativen Nervensystems David P. Wolfer Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität Zürich -00-00
Multiple Sklerose (MS)
 Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Klinischer Fall..\3) Sammlung\Klinischer
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Klinischer Fall..\3) Sammlung\Klinischer
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie
 Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer. 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck
 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer 9 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck A Grundsätzlich muss zwischen den dauerhaften und den temporären Blutdrucksteigerungen unterschieden
3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer 9 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck A Grundsätzlich muss zwischen den dauerhaften und den temporären Blutdrucksteigerungen unterschieden
Botulinumtoxin-Therapie in der Urologie. UK-SK, Campus Kiel
 Botulinumtoxin-Therapie in der Urologie PD Dr. Christoph Seif UK-SK, Campus Kiel Botulinumtoxin in der Urologie ist ein Neurotoxin, das von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert wird ist das potenteste
Botulinumtoxin-Therapie in der Urologie PD Dr. Christoph Seif UK-SK, Campus Kiel Botulinumtoxin in der Urologie ist ein Neurotoxin, das von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert wird ist das potenteste
Kontinenzförderung Alles unter Kontrolle Inkontinenzversorgung von ambulante PatientInnen
 Kontinenzförderung Alles unter Kontrolle Inkontinenzversorgung von ambulante PatientInnen DGKS Christa Hosak Universitätsklinik für Urologie 04. April 2016 Inkontinenz, ein Thema, das alle betreffen kann!
Kontinenzförderung Alles unter Kontrolle Inkontinenzversorgung von ambulante PatientInnen DGKS Christa Hosak Universitätsklinik für Urologie 04. April 2016 Inkontinenz, ein Thema, das alle betreffen kann!
DR. ARZT MUSTER MEIN TEAM MEIN TEAM. Herzlich willkommen in meiner Ordination! Frau Muster Assistentin. Frau Muster Assistentin. Dr.
 1 DR. ARZT MUSTER Facharzt für Urologie und Andrologie 2 Herzlich willkommen in meiner Ordination! MEIN TEAM 3 4 Dr. Arzt Muster Frau Muster Assistentin Frau Muster Assistentin MEIN TEAM Medizinstudium
1 DR. ARZT MUSTER Facharzt für Urologie und Andrologie 2 Herzlich willkommen in meiner Ordination! MEIN TEAM 3 4 Dr. Arzt Muster Frau Muster Assistentin Frau Muster Assistentin MEIN TEAM Medizinstudium
Hilfe bei plötzlichem, unwillkürlichem Harnverlust.
 Eine A Simple einfache Solution Lösung FÜR EIN TO WEIT A COMMON VERBREITETES PROBLEM PROBLEM Hilfe bei plötzlichem, unwillkürlichem Harnverlust. Ein weit verbreitetes Problem Millionen Frauen leiden an
Eine A Simple einfache Solution Lösung FÜR EIN TO WEIT A COMMON VERBREITETES PROBLEM PROBLEM Hilfe bei plötzlichem, unwillkürlichem Harnverlust. Ein weit verbreitetes Problem Millionen Frauen leiden an
Physiotherapeutische Möglichkeiten bei Inkontinenz
 Physiotherapeutische Möglichkeiten bei Inkontinenz Petra Roth, Physiotherapeutin HF Rosengarten Praxis Wetzikon Spital Männedorf Information Beckenbodendysfunktionen l Belastungsinkontinenz (SUI) l Dranginkontinenz
Physiotherapeutische Möglichkeiten bei Inkontinenz Petra Roth, Physiotherapeutin HF Rosengarten Praxis Wetzikon Spital Männedorf Information Beckenbodendysfunktionen l Belastungsinkontinenz (SUI) l Dranginkontinenz
Es betrifft mehr Menschen als Sie denken. Man kann mehr dagegen tun als Sie denken. Finden Sie sich nicht damit ab! Sprechen Sie mit Ihrem Arzt!
 Blasenschwäche Es betrifft mehr Menschen als Sie denken. Man kann mehr dagegen tun als Sie denken. Finden Sie sich nicht damit ab! Sprechen Sie mit Ihrem Arzt! Patienteninformation zum Thema Blasenschwäche
Blasenschwäche Es betrifft mehr Menschen als Sie denken. Man kann mehr dagegen tun als Sie denken. Finden Sie sich nicht damit ab! Sprechen Sie mit Ihrem Arzt! Patienteninformation zum Thema Blasenschwäche
MS und Blasenentleerung. Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie
 MS und Blasenentleerung Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie Harnblase Speicherung Entleerung Wahrnehmung Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss Wahrnehmung
MS und Blasenentleerung Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie Harnblase Speicherung Entleerung Wahrnehmung Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss Wahrnehmung
Gut beraten, sicher unterwegs
 > Tabuthema Harn- und Stuhlinkontinenz Gut beraten, sicher unterwegs Uwe Papenkordt Inkontinenz ist ein sehr belastendes Problem, über das Betroffene nicht gern sprechen, insbesondere nicht über Stuhlinkontinenz.
> Tabuthema Harn- und Stuhlinkontinenz Gut beraten, sicher unterwegs Uwe Papenkordt Inkontinenz ist ein sehr belastendes Problem, über das Betroffene nicht gern sprechen, insbesondere nicht über Stuhlinkontinenz.
Therapeutisches Drug Monitoring der Antidepressiva Amitriptylin, Clomipramin, Doxepin und Maprotilin unter naturalistischen Bedingungen
 Aus der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. J. Deckert Therapeutisches Drug Monitoring der Antidepressiva Amitriptylin,
Aus der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. J. Deckert Therapeutisches Drug Monitoring der Antidepressiva Amitriptylin,
Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung
 Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang CHRISANA Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung Inhaltsverzeichnis des Moduls Nervensystem Anatomie des
Matthias Birnstiel Modul Nervensystem Medizinisch wissenschaftlicher Lehrgang CHRISANA Wissenschaftliche Lehrmittel, Medien, Aus- und Weiterbildung Inhaltsverzeichnis des Moduls Nervensystem Anatomie des
Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Gutenbrunner
 Manuelle Medizin Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Gutenbrunner Klinik für Rehabilitationsmedizin Koordinierungsstelle Angewandte Rehabilitationsforschung Medizinische Hochschule Hannover D-30625 Hannover
Manuelle Medizin Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Gutenbrunner Klinik für Rehabilitationsmedizin Koordinierungsstelle Angewandte Rehabilitationsforschung Medizinische Hochschule Hannover D-30625 Hannover
kontrolliert wurden. Es erfolgte zudem kein Ausschluss einer sekundären Genese der Eisenüberladung. Erhöhte Ferritinkonzentrationen wurden in dieser S
 5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
Neurogene Blasenfunktionsstörung
 Neurogene Blasenfunktionsstörung Dr. Mark Koen, FEAPU, Abteilung für Kinderurologie, KH der Barmherzigen Schwestern, Seilerstätte, 4010 Linz Die neurogene Blasenfunktionsstörung stellt eine der seltenen
Neurogene Blasenfunktionsstörung Dr. Mark Koen, FEAPU, Abteilung für Kinderurologie, KH der Barmherzigen Schwestern, Seilerstätte, 4010 Linz Die neurogene Blasenfunktionsstörung stellt eine der seltenen
Checkliste zur Kausalitätsattribuierung bei vermuteter toxischer Polyneuropathie
 Aus dem Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Zentrum für Gesundheitswissenschaften Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin Direktor: Prof. Dr.
Aus dem Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Zentrum für Gesundheitswissenschaften Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin Direktor: Prof. Dr.
Transmitterstoff erforderlich. und Tremor. Potenziale bewirken die Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen. Begriffen
 4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
Die Thrombin-Therapie beim Aneurysma spurium nach arterieller Punktion
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) und dem Herzzentrum Coswig Klinik für Kardiologie und
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) und dem Herzzentrum Coswig Klinik für Kardiologie und
Die vaginale Suspensionsplastik
 Aus der Klinik für Urologie des Klinikum Leverkusen Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu Köln Leitender Arzt: Privatdozent Dr. med. Jürgen Zumbé Die vaginale Suspensionsplastik Eine Behandlungsmöglichkeit
Aus der Klinik für Urologie des Klinikum Leverkusen Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu Köln Leitender Arzt: Privatdozent Dr. med. Jürgen Zumbé Die vaginale Suspensionsplastik Eine Behandlungsmöglichkeit
Inhaltsverzeichnis Wen betrifft Inkontinenz? Wie häufig ist Inkontinenz? Welche Formen der Inkontinenz gibt es?
 IX 1 Wen betrifft Inkontinenz?............................................... 1 Frank Perabo Risikofaktoren 1 Klassifikationssystem für Risikofaktoren 3 Was kann getan werden, um einer Harninkontinenz
IX 1 Wen betrifft Inkontinenz?............................................... 1 Frank Perabo Risikofaktoren 1 Klassifikationssystem für Risikofaktoren 3 Was kann getan werden, um einer Harninkontinenz
IPVT - Institut für Psychosomatik und Verhaltenstherapie Alberstraße 15, 8010 Graz, Tel. +43 316 84 43 45, office@psychosomatik.
 INKONTINENZ Harninkontinenz ist eines der häufigsten Krankheitssymptome. Betroffene sprechen aus Scham kaum darüber. Deshalb nehmen viele keine Behandlung in Anspruch. Inkontinenz kann aber häufig sehr
INKONTINENZ Harninkontinenz ist eines der häufigsten Krankheitssymptome. Betroffene sprechen aus Scham kaum darüber. Deshalb nehmen viele keine Behandlung in Anspruch. Inkontinenz kann aber häufig sehr
Autonomes Nervensystem
 Autonomes Nervensystem Karl Zeiler, Christian Wöber Univ.Klinik für Neurologie Blockveranstaltung NEUROLOGIE Systematische Krankheitslehre Anatomische und funktionelle Grundlagen Sympathicus (i) Zentrale
Autonomes Nervensystem Karl Zeiler, Christian Wöber Univ.Klinik für Neurologie Blockveranstaltung NEUROLOGIE Systematische Krankheitslehre Anatomische und funktionelle Grundlagen Sympathicus (i) Zentrale
Einführung in die Neuroanatomie Bauplan, vegetatives Nervensystem
 Einführung in die Neuroanatomie Bauplan, vegetatives Nervensystem David P. Wolfer Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität
Einführung in die Neuroanatomie Bauplan, vegetatives Nervensystem David P. Wolfer Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität
Die periphere arterielle Verschlusskrankheit im höheren Lebensalter
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III an der Martin Luther - Universität Halle - Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) Die periphere arterielle Verschlusskrankheit
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III an der Martin Luther - Universität Halle - Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) Die periphere arterielle Verschlusskrankheit
Uroflowmetrie und Elektromyographie (EMG) des Beckenbodens bei urologisch gesunden Kindern
 Uroflowmetrie und Elektromyographie (EMG) des Beckenbodens bei urologisch gesunden Kindern Von der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen
Uroflowmetrie und Elektromyographie (EMG) des Beckenbodens bei urologisch gesunden Kindern Von der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen
Urologie und Kinderurologie
 Urologie und Kinderurologie Informationen für Patienten und Kooperationspartner Die Klinik für Urologie und Kinderurologie steht unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. Ludger Franzaring, Facharzt für
Urologie und Kinderurologie Informationen für Patienten und Kooperationspartner Die Klinik für Urologie und Kinderurologie steht unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. Ludger Franzaring, Facharzt für
Weitere Vorstellungen erfolgen je nach Befund dann jährlich bis vierteljährlich.
 Hamburger Therapiestandard Blasenstörung bei MS Version: 12-6-12 Zielsetzung des Standards: Dieses Dokument will Konsensus von Urologen und Neurologen sein, wie idealerweise im Raum Hamburg Blasenstörung
Hamburger Therapiestandard Blasenstörung bei MS Version: 12-6-12 Zielsetzung des Standards: Dieses Dokument will Konsensus von Urologen und Neurologen sein, wie idealerweise im Raum Hamburg Blasenstörung
Anatomie und Physiologie I Vorlesung , HS 2012
 Anatomie und Physiologie I Vorlesung 376-0151-00, HS 2012 Teil Anatomie: Neuroanatomie D.P. Wolfer, A. Rhyner, M. Sebele, M. Müntener Bei den Zeichenvorlagen handelt es sich zum Teil um modifizierte Abbildungen
Anatomie und Physiologie I Vorlesung 376-0151-00, HS 2012 Teil Anatomie: Neuroanatomie D.P. Wolfer, A. Rhyner, M. Sebele, M. Müntener Bei den Zeichenvorlagen handelt es sich zum Teil um modifizierte Abbildungen
Inkontinenz und Alter. H. Hertel
 Inkontinenz und Alter H. Hertel geriatrischen Probleme. Inkontinenz Intellektueller Abbau Immobilität Instabilität Urogynäkologie Press Release WHO/49, July 1998 WORLD HEALTH ORGANIZATION CALLS FIRST INTERNATIONAL
Inkontinenz und Alter H. Hertel geriatrischen Probleme. Inkontinenz Intellektueller Abbau Immobilität Instabilität Urogynäkologie Press Release WHO/49, July 1998 WORLD HEALTH ORGANIZATION CALLS FIRST INTERNATIONAL
