STATISTIKBROSCHÜRE 2016 DURCHBLICKEN. WO IMMER ZAHLEN FÜR SICH SPRECHEN. PROFITIEREN. WO IMMER SIE ENERGIE BRAUCHEN.
|
|
|
- Michael Falk
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 STATISTIKBROSCHÜRE 216 DURCHBLICKEN. WO IMMER ZAHLEN FÜR SICH SPRECHEN. PROFITIEREN. WO IMMER SIE ENERGIE BRAUCHEN.
2 Inhalt Vorwort 3 Allgemeines 8 Volkswirtschaft 8 Energiewirtschaft 1 Reserven 17 Betriebs- und Bestandsstatistik 18 Erdgas in Österreich 18 Erdgasinfrastruktur in Österreich 22 Elektrizität in Österreich (Gesamte Elektrizitätsversorgung) 24 Kraftwerkspark in Österreich 29 Öffentliches Netz in Österreich 34 Marktstatistik 36 Erdgasmarkt in Österreich 36 Elektrizitätsmarkt in Österreich (Öffentliches Netz) 42 Großhandel 49 Einzelhandel 57 Glossar 62
3 2 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar
4 Vorwort Die Energie-Control Austria (E-Control) ist gesetzlich zur Durchführung von statistischen Erhebungen für die elektrische Energie sowie für die gasförmigen Energieträger verpflichtet und veröffentlicht diese Daten laufend auf ihrer Homepage unter Darüber hinaus sind die jährlichen Auswertungen der E-Control mittlerweile auch unentbehrliche Werkzeuge für all jene geworden, die sich in ihrem täglichen Arbeitsleben mit elektrischer Energie oder mit Erdgas beschäftigen. Seit 29 gibt die E-Control deshalb eine eigene Statistikbroschüre mit den aktuell vorhandenen und wichtigsten Daten zum österreichischen Strom- und Gasmarkt heraus. In dieser Broschüre werden in übersichtlicher und komprimierter Form einerseits allgemeine Informationen wie volkswirtschaftliche und energiewirtschaftliche Daten sowie Daten zur Mengenstatistik und andererseits umfassende Informationen zur Marktstatistik wie Liberalisierungseffekte im österreichischen Elektrizitäts- und Erdgasmarkt, Zahlen zum Groß- und Einzelhandel und vieles mehr geliefert. Die Broschüre soll weiterhin allen an energie- und marktwirtschaftlichen Zusammenhängen Interessierten einen schnellen und aktuellen Überblick über die wichtigsten Statistikdaten bieten. DI Andreas Eigenbauer Vorstand Energie-Control Austria Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M. Vorstand Energie-Control Austria 3
5 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Die österreichischen Energiestatistiken Aufgrund der Wichtigkeit der Energieversorgung für die Gemeinschaft und dabei insbesondere für die Wirtschaft kommt den Statistiken für diesen Bereich eine besondere Rolle zu. Dies wird unter anderem dadurch dokumentiert, dass die statistischen Erhebungen für diesen Bereich nicht ausschließlich bei der Bundesanstalt Statistik Österreich liegen, sondern zu einem wesentlichen Teil dem zuständigen Bundes minister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft vorbehalten sind. Für die beiden Bereiche der Elektrizitäts- und Erdgasversorgung bzw. der entsprechenden Statistiken bedient sich der Minister der Regulierungsbehörde E-Control, der die damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben in 92 ElWOG 21 bzw. 147 GWG 211 zugeteilt werden. Trotz dieser teilweisen Sonderstellung sind die von der Regulierungsbehörde E-Control durchgeführten Statistiken, zumindest was die sogenannten Betriebsstatistiken anlangt, Teil des österreichischen statistischen Systems und bilden als solche die wesentliche primärstatistische Quelle für den Elektrizitäts- und Erdgasteil der österreichischen Energiebilanz. Allerdings unterscheiden sich die von der Bundesanstalt Statistik Österreich und die von der E-Control erstellten Statistiken insofern wesentlich, als Erstere den Regeln einer Energiebilanz und insbesondere auch denen der internationalen Vergleichbarkeit unterliegen, während Zweitere die jeweiligen Produktströme und dadurch den entsprechenden Markt abbilden. Die zwei wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind einerseits die Behandlung des Energie- bzw. Umwandlungsbereichs und andererseits die Beschränkung der Energiebilanz auf die energetische Nutzung der eingesetzten Rohstoffe. So wird für die Betriebsstatistiken der E-Control jede Art der Verwendung von elektrischer Energie oder von Erdgas als (potentieller) Absatz und damit als Bestandteil des Marktes angesehen, während beispielsweise der Gasverbrauch der Kraftwerke für die Energiebilanz primärenergieseitig als Umwandlungseinsatz berücksichtigt wird, während er in der Endenergie nur in seiner umgewandelten Form als Elektrizität bzw. Wärme Eingang in diese beiden Teilbilanzen findet. Der Verbrauch von Erdgas etwa als Rohstoff für die chemische Industrie wird, da keine energetische Nutzung vorliegt, in der Energiebilanz nicht gemeinsam mit dem energetischen Endverbrauch der Chemie, sondern als nicht-energetischer Verbrauch in der Bilanz ausgewiesen. 4
6 Eine detaillierte Überleitung von einer Bilanzmethode zur anderen wird erstmals für das Berichtsjahr 215 in der Standard-Dokumentation zu den Energiebilanzen dargestellt. Wirtschaftliche Entwicklung 215 Die Wertschöpfung in der österreichischen Volkswirtschaft ist im Jahr 215 real um,9% gestiegen. Der Verbraucherpreis ist insgesamt ebenfalls um,9% gestiegen, dabei wirkten die Gas- und die Strompreisentwicklung inflationsdämpfend. Verbrauchsentwicklung 215 In den beiden Energiemärkten für Erdgas und elektrische Energie war 215 ein Zuwachs des inländischen Verbrauchs zu verzeichnen: Die Abgabe an Erdgaskunden stieg um 7,% auf 84,4 TWh oder 7,5 Mrd Nm 3, der inländische Verbrauch an elektrischer Energie um 1,5% auf 7, TWh. Damit wurde die im Erdgasbereich seit 211 andauernde rückgängige Verbrauchsentwicklung unterbrochen und das Verbrauchsniveau von 22 wieder nahezu erreicht, während im Elektrizitätsbereich der nur in den Jahren 29 und 214 unterbrochene Trend der letzten 2 Jahre fortgesetzt wurde. Während die Entwicklung des Stromverbrauchs der Kleinkunden mit einem mittleren Zuwachs von 1,1% deutlich hinter derjenigen der mittleren und großen Industriebetriebe von 2,5% zurückblieb, nahm der Gasverbrauch im Kleinkundenbereich um 9,2% und im Großkundenbereich um 6,9% zu. Diese Entwicklung ist zu einem wesentlichen Teil auf den erhöhten Heizbedarf, sowohl direkt bei den Verbrauchern wie auch indirekt über die Fernwärme, zurückzuführen. Aufbringung 215 Die Erdgasbilanz war aufbringungsseitig durch drei Faktoren gekennzeichnet: Einerseits war ein weiterer, wenn auch mit 4,4% geringer Rückgang der inländischen Produktion gegeben, andererseits wurde aus den Speichern netto Erdgas entnommen, was eine Umkehrung der Speicherbewirtschaftung gegenüber dem Vorjahr bedeutete, und schließlich gingen die physikalischen Netto-Importe deutlich, nämlich um 21,9%, zurück. 5
7 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Stromseitig war die inländische Produktion mit einem Rückgang um,3% nahezu gleich hoch wie im Vorjahr, wobei allerdings die Erzeugung aus Wasserkraft um 4,2 TWh oder 9,5% zurückging, die Stromerzeugung in Wärmekraftwerken dagegen um 2,9 TWh oder 19,2% und jene der Windkraftanlagen um 1,1 TWh bzw. 25,3% zunahm. Um den Verbrauchszuwachs von rd. 1, TWh abzudecken, war somit eine zusätzliche Erhöhung der Netto-Importe um,8 TWh oder 8,4% notwendig. Speicherinhalte zum Jahresende 215 Zum Jahresende 215 waren in den österreichischen Erdgasspeichern 55,6 TWh oder 5, Mrd Nm 3 vorrätig, was einem Füllungsgrad von 6,4% entspricht. Dies ist im Jahresvergleich ein Rückgang um rd. 1%-Punkte, doch entspricht dieser Speicherinhalt immer noch knapp zwei Drittel (65,8%) des inländischen Gasverbrauchs im gesamten Kalenderjahr 215. In den österreichischen Großspeichern waren zum Jahresende 215 insgesamt 1,6 TWh vorrätig, was einem Speicherinhalt von 51,4% entspricht. Dies war zwar der niedrigste Speicherstand der letzten 15 Jahre zu diesem Stichtag, was im Wesentlichen auf den geringeren natürlichen Zufluss infolge eines niedrigeren Wasserdargebots vor allem in den letzten Monaten zurückzuführen war. Insgesamt befinden sich auf dem österreichischen Bundesgebiet Gasspeicher mit einer Kapazität von 92,7 TWh oder 8,3 Mrd Nm 3 mit einer stündlichen Entnahmerate von 44,9 GWh oder 4 Mio Nm 3. Der Nenninhalt der Großspeicher beträgt 3,2 TWh bei einer installierten Leistung von rd. 8 GW. Marktstrukturen und Verbraucherverhalten 215 Der österreichische Erdgasmarkt zählt etwa 1,3 Mio. Kunden bzw. Zählpunkte, von denen rd. 94% Haushaltskunden sind. Demgegenüber entfällt auf diese nur etwas mehr als ein Fünftel (rd. 21%) des Gasverbrauchs, während auf die lastganggemessenen Endkunden (zu denen auch die gasbefeuerten Kraftwerke zählen) knapp 75% des Verbrauchs entfallen. 6
8 215 wechselten etwas mehr als 46. Erdgaskunden bzw. Zählpunkte oder 3,4% ihren vorherigen Versorger, wobei die Haushaltskunden den Großteil der Wechsler stellten, die lastganggemessenen Verbraucher aber mit einer Wechselrate von 5,% deutlich mehr Flexibilität bewiesen. Österreichweit gab es 215 insgesamt etwas mehr als 6 Millionen Stromkunden bzw. Zählpunkte, wobei viele Kundenstandorte mehr als einen Zählpunkt haben. Über 7% davon entfielen auf den Haushaltsbereich und ein Viertel auf kleinere gewerbliche bzw. landwirtschaftliche Betriebe. Der Anteil der Industrie an den Zählpunkten lag bei unter 1%, an der inländischen Abgabe war ihr Anteil allerdings bei rd. 6%, während jener der Haushalte knapp über 2% und jener der sonstigen Betriebe knapp unter 2% lag. Insgesamt wechselten rd Stromkunden bzw. Zählpunkte ihren bisherigen Versorger, was einer Wechselrate von 2,5% entspricht. Auch hier war die Wechselbereitschaft der großen (lastganggemessenen) Kunden mit einer Wechselrate von 7,1% deutlich höher als die aller anderen Kundengruppen. Endkunden- und Großhandelspreise 215 Die Großhandelspreise sind für Erdgas und Strom im Jahr 215 gesunken. Während die Base Day-ahead-Preise um etwas mehr als 1 /MWh gesunken sind, sind die Peakpreise sogar um 1,7 /MWh gesunken. Die Großhandelspreise für Erdgas waren am CEGH um 1,6 /MWh niedriger als noch 214. Die Haushaltspreise der lokalen Lieferanten sind bei Strom um etwa 4 /MWh und bei Erdgas um etwa 3 /MWh gesunken, ohne Einbeziehung von Netz und Steuern. 7
9 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Allgemeines Volkswirtschaft Verbraucherpreisindex Jänner 25 = 1 Gesamt Elektrizität Erdgas Jahresdurchschnitt Veränderung in % (*) Jahresdurchschnitt Veränderung in % (*) Jahresdurchschnitt Veränderung in % (*) ,4 71,4 7,8 2 9,4 1,4 8,5 2,6 79,9 2,6 25 1, 2,1 1, 4,8 1, 5, 21 19,5 1,8 12,9 1, 12,6 4, ,2 2, 127,4 4,4 137,3, ,1 1,6 127,4, 137,, ,2,9 128,3,7 136,3,5 (*) mittlere bzw. jährliche Veränderungsraten Quelle: Statistik Austria Bruttoinlandsprodukt in Mio. R (Preise 21) Veränderung in % (*) , , , , , , (*) mittlere bzw. jährliche Veränderungsraten Quelle: Statistik Austria, WIFO, OeNB Die Tabellen zeigen die Zusammenhänge zwischen der österreichischen Gesamtwirtschaft und dem Elektrizitäts- und Erdgasbereich. 8
10 Bevölkerung im Jahresdurchschnitt Personen Veränderung in % (*) , , , , , , , , (*) mittlere bzw. jährliche Veränderungsraten Quelle: Statistik Austria Quelle: Statistik Austria Privathaushalte in 1. Einpersonen- Mehrpersonen- insgesamt mittlere haushalte haushalte Haushaltsgröße in Personen , , , , , , , ,22 Die Tabellen zeigen relevante Kennzahlen der Bevölkerungsentwicklung in Österreich. 9
11 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Energiewirtschaft Bruttoinlandsverbrauch (BIV) und energetischer Endverbrauch (EEV) in TJ BIV EEV Quelle: Statistik Austria Bruttoinlandsverbrauch und energetischer Endverbrauch in TJ Bruttoinlandsverbrauch Energetischer Endverbrauch Quelle: Statistik Austria Auf Seite 1 ist die Entwicklung der wesentlichen Eckzahlen der Wirtschaft und des Energieverbrauchs abzulesen. 1
12 ENERGIEBILANZ Energieträgermix des energetischen Endverbrauchs in TJ Erneuerbare Fernwärme Elektr. Energie Erdgas Öl Kohle Quelle: Statistik Austria Quelle: Statistik Austria Energieträgermix des energetischen Endverbrauchs in TJ Kohle Öl Erdgas Elektr. Fern- Erneuer- Gesamt Energie wärme bare Auf Seite 11 ist die aufbringungsseitige Struktur der österreichischen Energiebilanz dargestellt. 11
13 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Sektorale Gliederung des energetischen Endverbrauchs in TJ Haushalte Landwirtschaft Prod. Bereich Dienstleistungen Verkehr Quelle: Statistik Austria Haushalte Land- Prod. Dienst- Verkehr Gesamt wirtschaft Bereich leistungen Quelle: Statistik Austria Sektorale Gliederung des energetischen Endverbrauchs in TJ Auf dieser Seite ist die verwendungsseitige Struktur der österreichischen Energiebilanz dargestellt. 12
14 NUTZENERGIE Nutzenergieverbrauch 214 Traktion 35,4% Raumheizung und Klimaanlagen 27,1% Elektrochemische Zwecke,% Beleuchtung und EDV 2,9% Dampferzeugung 8,2% Standmotoren 11,3% Industrieöfen 15,% Quelle: Statistik Austria Nutzenergieverbrauch 214 TJ Anteil in % Raumheizung und Klimaanlagen ,1 Standmotoren (a) ,3 Industrieöfen (b) , Dampferzeugung ,2 Beleuchtung und EDV ,9 Elektrochemische Zwecke 373, Traktion ,4 Summe , (a) Kühlen und Gefrieren, elektr. Geräte (b) Warmwasser und Kochen Quelle: Statistik Austria Auf dieser Seite ist die anwendungsseitige Struktur der österreichischen Energiebilanz dargestellt. 13
15 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar TJ Anteil in % von Gesamt in % Raumheizung und Klimaanlagen , 24,4 Dampferzeugung ,9 46, Industrieöfen (a) ,8 31,7 Standmotoren (b) ,7 4, Traktion ,6 2,6 Beleuchtung und EDV,, Elektrochemische Zwecke,, Summe , 16,5 (a) Warmwasser und Kochen (b) Kühlen und Gefrieren, elektr. Geräte Quelle: Statistik Austria Erdgas Nutzenergieverbrauch 214 TJ Anteil in % von Gesamt in % Raumheizung und Klimaanlagen ,6 8,7 Dampferzeugung 886,4 1, Industrieöfen (a) ,3 3, Standmotoren (b) ,9 82,3 Traktion ,1 2,9 Beleuchtung und EDV ,6 1, Elektrochemische Zwecke 373,2 1, Summe , 2,2 (a) Warmwasser und Kochen (b) Kühlen und Gefrieren, elektr. Geräte Quelle: Statistik Austria Elektrische Energie Nutzenergieverbrauch 214 Die Tabellen auf Seite 15 zeigen österreichische Kennzahlen im internationalen Vergleich. 14
16 ENERGIEKENNZAHLEN INTERNATIONAL,4,35,3,25,2,15,1,5, LU FI Energieverbrauch pro Kopf in der EU im Jahr 214 in TJ/Einwohner EE SE BE NL CZ DE AT FR SI DK SK IE UK CY ES IT PL BG HU LT GR LV PT MT HR RO Quelle: Eurostat Energieintensität im Jahr 214 spez. Energieverbrauch geteilt durch BIP in TJ/Mio. E BG EE CZ PL HU RO SK HR LV LT SI FI GR BE CY PT FR NL ES SE MT DE AT IT LU UK IE DK Quelle: Eurostat Anteil der Erneuerbaren in der EU im Jahr 214 und Ziel 22 in % Anteil Ziel 22 SE FI LV AT DK HR PT EE RO LT SI BG IT ES EU 28 GR FR DE CZ SK PL HU CY IE BE UK NL MT LU Quelle: Eurostat 15
17 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN Emissionen in Österreich (inkl. 22-Ziel) von 199 bis 214 in Mio. t CO 2 -Äquivalent Ziel ursprüngliches Kyoto-Ziel: 68,8 Mio. t Spezifische Emissionen in der EU im Jahr 214 in t CO 2 -Äquivalent/Einwohner LU EE IE CZ NL DE FI CY BE PL DK GR AT UK SI BG MT SK ES FR IT LT PT SE HU HR LV RO Quelle: UNFCCC Quelle: Eurostat Die Abbildungen auf Seite 16 zeigen Emissionen in Österreich und im internationalen Vergleich. Die Abbildungen auf Seite 17 zeigen Energierohstoffe im internationalen Vergleich. 16
18 Reserven Weltweite Reserven Weltweite Ölreserven 1 in EJ GUS OPEC EU-28 Welt Weltweite Gasreserven 2 in Mrd. m 3 GUS OPEC EU-27 Welt Weltweite Kohlereserven 3 in EJ Hartkohle Weichbraunkohle Hartkohle Weichbraunkohle GUS EU-27 Nordamerika Welt 1 Quelle: BGR Energierohstoffe, Kurzberichte; DERA Rohstoffinformationen, Energiestudie Quelle: BGR Energierohstoffe, Kurzberichte; DERA Rohstoffinformationen, Energiestudie 215 Anmerkung: Ab 21 wurden auch nicht-konventionelle Reserven inkludiert. 3 Quelle: BGR Energierohstoffe, Kurzberichte; DERA Rohstoffinformationen, Energiestudie
19 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Betriebs- und Bestandsstatistik Erdgas in Österreich Schematisierter Erdgasfluss 215 in GWh Speicher Produktion physikalische Importe (einschl. Transite) Aufbringung Verwendung Speicher Eigenverbrauch, Verluste und stat. Differenzen Lastganggemessene Endkunden Haushalte und sonstige Kleinkunden physikalische Exporte (einschl. Transite) Die Abbildung stellt den Erdgasfluss in Österreich dar. 18
20 Erdgasbilanz in GWh Import-/ Exportsaldo Speicher Einpressung Speicher Entnahme Speicher Einpressung Produktion 5. Inlandgasverbrauch 1. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez Erdgasbilanz 215 Angaben Angaben Veränderung in Mio. Nm 3 in GWh zum Vorjahr in % Abgabe an Endkunden (a) , Eigenverbrauch und Verluste (b) und Statistische Differenzen (c) Inlandgasverbrauch ,1 Speicher Einpressung (d) ,2 Exporte (d) ,6 Verwendung = Aufbringung ,5 Importe (d) ,6 Produktion (d) ,4 Einspeisung biogener Gase (d) , Speicher Entnahme (d) ,7 (a) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher (hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke...) (b) für Produktion, Speicherbewirtschaftung und Transport (einschließlich Transite) (c) Statistische Differenz zwischen bilanzieller und gemessener Abgabe an Endkunden (d) physikalisch (bei Importen und Exporten einschließlich Transite) 19
21 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Inlandgasverbrauch und seine Deckung in GWh Inlandgasverbrauch Inlandaufkommen Import-/ Exportsaldo Erdgasbilanz Jahresreihen in GWh Kalender- Abgabe an Statistische Eigenver- Inland- Import-/ Inlandjahr Endkunden Differenz brauch + gasver- Exportsaldo aufkommen (a) (b) Verluste (c) brauch (d) (a) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher (hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke...) (b) Statistische Differenz zwischen bilanzieller und gemessener Abgabe an Endkunden (c) für Produktion, Speicherbewirtschaftung und Transport (einschließlich Transite) (d) Produktion und Speichersaldo Quelle: Bis 22 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, ab 22 E-Control 2
22 Veränderung des Inlandgasverbrauchs in GWh und % Veränderung zum Vorjahr in GWh (links) Veränderung zum Vorjahr in % (rechts) mittlere Veränderung in 1 Jahren in % (rechts) Physikalische Importe und Exporte an Erdgas 215 Importe (*) Exporte (*) in Mio. Nm 3 in GWh in Mio. Nm 3 in GWh Deutschland Schweiz Italien Slowenien Ungarn Slowakei Tschechische Republik Summe (*) physikalische Messwerte an den Grenzübergabestellen (einschließlich Transite) Auf den Seiten 19 bis 21 sind wesentliche Kennzahlen der österreichischen Entwicklung im Gasbereich dargestellt. 21
23 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Erdgasinfrastruktur in Österreich Speicherinhalte und Füllungsgrade 215 zum Monatsletzten (*) in GWh und % Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez Speicherinhalt 214 in GWh (links) Speicherinhalt 215 in GWh (links) Füllungsgrad 214 bezogen auf das Speichervolumen in % (rechts) Füllungsgrad 215 bezogen auf das Speichervolumen in % (rechts) Füllungsgrad 214 bezogen auf die Jahresabgabe in % (rechts) Füllungsgrad 215 bezogen auf die Jahresabgabe in % (rechts) (*) Sämtliche Speicher auf österreichischem Bundesgebiet. Speichervolumen in GWh max. Einspeiserate in MWh je Stunde max. Ausspeiserate in MWh je Stunde (*) Sämtliche Speicher auf österreichischem Bundesgebiet. Speicheranlagen (*) 22
24 Produktionsanlagen 215 max. Produktionsrate max. Produktionsrate in MWh je Stunde in Nm 3 je Stunde 25 k.a. k.a Leitungslängen zum 31. Dezember in km Ebene 1 inklusive Verteilerleitungen Ortsnetze und Fernleitungen der Ebene 2 Verteilerleitungen der Ebene 3 2 (*) k.a (*) teilweise auf Basis des jeweiligen Inbetriebnahmedatums rückgerechnet Auf den Seiten 22 und 23 werden Kennzahlen der für die österreichische Erdgasversorgung wesentlichen Infrastruktur dargestellt. 23
25 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Elektrizität in Österreich (Gesamte Elektrizitätsversorgung) Schematisierter Energiefluss 215 in GWh Wasserkraft und Sonstige Erzeugung Wärmekraft Wind, Photovoltaik, Geothermie physikalische Importe Öffentliches Netz Öff. Netz Eigenerz Eigenerz Aufbringung Verwendung Eigenbedarf, Verluste, Pumpstrom und stat. Differenz 1. Haushalte Gewerbe, Landwirtschaft und Kleinkunden Kleinindustrie 1.26 Mittlere Industrie Großindustrie physik. Exporte Industrie aus Eigenerzeugung Die Abbildung stellt den Fluss der elektrischen Energie in Österreich dar. 24
26 Elektrizitätsbilanz 215 in GWh Phys. Export Pumpspeicherung Eigenbedarf Netzverluste Endverbrauch Wasserkraft 4. Wärmekraft Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Wind, Sonne, Geothermie Sonstige Erzeugung Phys. Import Elektrizitätsbilanz 215 Bilanzposition Veränderungen zum Vorjahr in GWh in GWh in GWh in % Endverbrauch (1) ,5 Netzverluste ,7 Eigenbedarf ,5 Inlandstromverbrauch ,5 Pumpspeicherung ,6 Physikalische Stromexporte ,7 Verwendung = Aufbringung ,7 Brutto-Stromerzeugung Wasserkraftwerke ,5 Wärmekraftwerke ,2 Regenerative (2) ,3 Sonstige Erzeugung Physikalische Stromimporte ,9 (1) Entspricht energiebilanztechnisch dem energetischen Endverbrauch, allerdings einschließlich des Stromverbrauchs des nicht-elektrischen Energiesektors (2) Photovoltaik, Wind und Geothermie 25
27 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Veränderung des Inlandstromverbrauchs in GWh und % Veränderung zum Vorjahr in GWh (links) Veränderung zum Vorjahr in % (rechts) Mittlere Veränderung in 1 Jahren in % (rechts) Elektrizitätsbilanz Jahresreihen in GWh Endver- Eigen- Netz- Inland- Verbrauch braucher bedarf verluste strom- für Pumpverbrauch speicherung physikal. Exporte Verwendung = Aufbringung Auf den Seiten 25 bis 28 sind wesentliche Kennzahlen der österreichischen Entwicklung im Strombereich dargestellt. 26
28 Inlandstromverbrauch und seine Deckung in GWh physikal. Importe Wind, Photovoltaik, Geothermie Wärmekraftwerke Wasserkraftwerke Inlandstromverbrauch Elektrizitätsbilanz Jahresreihen in GWh Brutto-Stromerzeugung physikal. Aufbringung Importe = Wasser- Wärme- Wind, Sonstige Summe Verwendung kraftwerke kraftwerke Photovolt., Geothermie
29 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Brutto-Stromerzeugung 215 Erzeugungskomponente GWh Anteile Wasserkraftwerke Wärmekraftwerke Erneuerbare Laufkraftwerke Speicherkraftwerke über 1 MW ,7% 54,1% bis 1 MW ,5% 12,% über 1 MW ,4% 32,7% bis 1 MW 516,8% 1,3% Summe Wasserkraftwerke ,3% 1,% Fossile Brennstoffe und Derivate Biogene Brennstoffe Steinkohle ,6% 15,8% Braunkohle Kohlederivate (1) ,2% 11,2% Erdölderivate (1) 858 1,3% 4,6% Erdgas ,9% 41,1% Summe ,% 72,6% fest (2) ,% 13,7% flüssig (2),%,% gasförmig (2) 589,9% 3,1% Klär- und Deponiegas (2) 35,1%,2% Summe (2) ,9% 17,% Sonstige Biogene (3) ,8% 6,1% Sonstige Brennstoffe 817 1,3% 4,3% Summe Wärmekraftwerke ,% 1,% (davon in KWK-Anlagen) (15.929) (24,5%) (84,6%) Wind (4) ,4% 89,2% Photovoltaik (4) 585,9% 1,8% Geothermie (4),%,% Summe Erneuerbare (4) ,3% 1,% Sonstige Erzeugung (5) 25,3% Gesamterzeugung ,% 28 (1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohle- bzw. Erdölprodukte bezeichnet. (2) nur Biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien (3) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme (2) (4) Einspeisung anerkannter Öko-Anlagen im Sinne der österreichischen Richtlinien (5) Erzeugung, die nicht nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt bzw. keinem Kraftwerkstyp zugeordnet werden kann
30 Kraftwerkspark in Österreich Kraftwerkspark jeweils zum 31. Dezember in MW Wärmekraftwerke Wind, Photovoltaik, Geothermie Wasserkraftwerke Kraftwerkspark jeweils zum 31. Dezember in MW Brutto-Engpassleistung Wasserkraftwerke Wind, Wärme- insgesamt Netto- Lauf- Speicher- Summe Photovolt., kraftwerke Engpasskraftwerke kraftwerke Geothermie leistung Auf den Seiten 29 bis 34 werden Kennzahlen der für die österreichische Stromversorgung wesentlichen Infrastruktur dargestellt. 29
31 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Großspeicher der öffentlichen Erzeuger Speicherinhalte und Füllungsgrade zum Monatsletzten in GWh und % Speicherinhalte 214 in GWh (links) Speicherinhalte 215 in GWh (links) Speicherfüllungsgrad 214 in % (rechts) Speicherfüllungsgrad 215 in % (rechts) Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Max. und Min. Speicherfüllungsgrad 1999 bis 213 in % (rechts) Wärmekraftwerke der öffentlichen Erzeuger Fossile Brennstofflagerstände zum Monatsletzten in GWh und % Lagerstände 214 in GWh (links) Lagerstände 215 in GWh (links) 214 in % (rechts) in % (rechts) 2. 2 Max. und Min. Lagerstand 1999 bis 213 in % (rechts) Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 3
32 Laufkraftwerke der öffentlichen Erzeuger Monatliche Erzeugungskoeffizienten 1,8 1, ,4 1,2 1,,8 215 Max. und Min bis 213,6,4,2 Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Laufkraftwerke der öffentlichen Erzeuger Jährlicher Erzeugungskoeffizient Max bis 213 Min bis 213 1,3,92 1,16,87 31
33 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Kraftwerke der öffentlichen Erzeuger (*) Arbeits-Verfügbarkeitskennzahlen in % Wärmekraftwerke Speicherkraftwerke Verfüg- Ausnut- Ausfalls- Verfüg- Ausnut- Ausfallsbarkeit zung rate barkeit zung rate 2 76,7 32,6 5,9 93,6 18,6 2, ,3 42,7 5,3 93,3 19,7 1, ,3 35,9 15, 84,2 18,7 7, ,8 16,5 14,9 85,5 19,7 3, , 15,5 13,5 86,2 19,6 5, 215 8,4 12,1 13,7 92,7 17,9 2,3 (*) Kraftwerke mit einer Engpassleistung von zumindest 25 MW, die in österreichische Regelzonen einspeisen Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Wirkungsgrade in % Wärmekraftwerke (WäKW) mit KWK WäKW ohne KWK Leistung in MW Wärmekraftwerke (WäKW) mit KWK WäKW ohne KWK Thermische Grenz- Wirkungs- Thermische Engpass- Engpass- Effizienz (1) effizienz (2) grad (3) Leistung leistung leistung % % % MW MW MW 2 68,9 49,5 42, ,9 52,9 41, ,7 57,2 4, ,8 52,6 38, ,6 51,2 37, ,9 52,3 37, (1) Quotient aus der Stromerzeugung zuzüglich Wärmeabgabe und dem Gesamtbrennstoffeinsatz (2) Quotient aus der Stromerzeugung und dem Gesamtbrennstoffeinsatz abzüglich der Wärmeabgabe (3) Quotient aus der Bruttostromerzeugung und dem Brennstoffeinsatz 32
34 Laufkraftwerke der öffentlichen Erzeuger (*) Anteile des monatlichen Regelarbeitsvermögens am Jahreswert bis 5 MW > 5 MW bis 1 MW > 1 MW bis 25 MW über 25 MW 2 Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. (*) Kraftwerke mit einer Engpassleistung von zumindest 1 MW Laufkraftwerke der öffentlichen Erzeuger (*) Gesicherte Leistung 215 Kraftwerkstyp bis 5 MW 1 MW über insgesamt 5 MW bis 1 MW bis 25 MW 25 MW Laufkraftwerke mit Schwellbetrieb Laufkraftwerke ohne Schwellbetrieb Summe Laufkraftwerke Laufkraftwerke mit Schwellbetrieb Laufkraftwerke ohne Schwellbetrieb Angaben in MW Anteile an der Engpassleistung in % 51,9 46,3 48,6 34,1 53,6 38,5 34,1 37,3 Summe Laufkraftwerke 43,3 47,8 38,5 34,1 4,3 (*) Kraftwerke mit einer Engpassleistung von zumindest 25 MW, die in österreichische Regelzonen einspeisen 33
35 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Öffentliches Netz in Österreich Öffentliches Netz (*) Trassenlängen zum 31. Dezember 215 Freileitungen Kabelleitungen Summe Spannungsebenen km Anteil km Anteil km 38 kv 1.366,6% 55,% kv 1.856,8% 7,% kv ,5% 615,3% von 1 kv bis 11 kv ,% ,7% kv und darunter ,1% ,% insgesamt ,% ,% (*) einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern Öffentliches Netz Umspann- und Schaltwerke zum 31. Dezember 215 Anzahl der Summenleistung Spannungsebenen Transformatoren in MVA Oberspannung bis 2 kv Oberspannung über 2 kv Hochspannung zu Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannung Öffentliches Netz Transformatorstationen zum 31. Dezember 215 Anzahl der Summenleistung Spannungsebenen Trafo-Stationen in MVA Mittelspannung zu Mittel- bzw. Niederspannung
36 Nichtverfügbarkeit der Stromversorgung in Minuten ,47 55,35 56,37 Ungeplante Nichtverfügbarkeit kundengewichtet Ungeplante Nichtverfügbarkeit leistungsgewichtet ,61 42,71 43,27 41,59 39,18 35,93 31,45 28,32 27,62 32,9 36,44 33,1 33,21 33,26 27,8 27,18 24,11 Die Abbildung zeigt die Qualität der österreichischen Stromversorgung. 35
37 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Marktstatistik Erdgasmarkt in Österreich Verbraucherstruktur Abgabe an Endkunden Endkundenkategorie Einheit Mittelwert (*) Anteil (*) Haushalte GWh ,2% Sonstige Kleinkunden GWh ,8% Lastganggemessene Endkunden GWh ,9% Statistische Differenz GWh Abgabe an Endkunden GWh ,% Anzahl der Zählpunkte Endkundenkategorie Einheit Mittelwert (*) Anteil (*) Haushalte ,2% Sonstige Kleinkunden ,2% Lastganggemessene Endkunden ,6% Zählpunkte insgesamt ,% Mittlere Abgabe je Zählpunkt Endkundenkategorie Einheit Mittelwert (*) Haushalte kwh/zp Sonstige Kleinkunden kwh/zp Lastganggemessene Endkunden kwh/zp Mittlere Abgabe kwh/zp (*) Mittelwert der letzten 3 Jahre (213 bis 215) Haushalte: Endverbraucher mit einem der Standardlastprofile HE, HM, PK oder PW Sonstige Kleinabnehmer: Endverbraucher mit einem der Standardlastprofile HG oder PG Statistische Differenz: Differenz zwischen der gemessenen Gesamtabgabe und den Einzelmeldungen je Endkundenkategorie Die Seiten 36 bis 38 zeigen die Struktur des österreichischen Erdgasmarktes nach Kundengruppen und regionalen Gesichtspunkten. 36
38 Verbraucherstruktur Abgabe an Endkunden (Mittelwert der letzten 5 Jahre) Sonstige Kleinkunden 4,8% Haushalte 21,2% Lastganggemessene Endkunden 73,9% Verbraucherstruktur Anzahl der Zählpunkte (Mittelwert der letzten 5 Jahre) Sonstige Kleinkunden 5,2% Lastganggemessene Endkunden,6% Haushalte 94,2% 37
39 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Verbraucherstruktur Abgabe an Endkunden nach Netzgebieten in GWh Bundesland bzw. Netzgebiet Mittelwert (*) Anteil (*) Burgenland ,7% Kärnten ,6% Niederösterreich ,5% Oberösterreich ,2% Salzburg ,5% Steiermark ,4% Tirol ,5% Vorarlberg ,7% Wien ,% Österreich Statistische Differenz Abgabe an Endkunden ,% (*) Mittelwert der letzten 3 Jahre (213 bis 215) Statistische Differenz: Differenz zwischen der gemessenen Abgabe an Endverbraucher und den Einzelmeldungen je Endkundenkategorie Verbraucherstruktur Anzahl Zählpunkte nach Netzgebieten in 1. Bundesland bzw. Netzgebiet Mittelwert (*) Anteil (*) Burgenland ,8% Kärnten ,% Niederösterreich ,7% Oberösterreich ,9% Salzburg ,7% Steiermark ,% Tirol ,4% Vorarlberg ,6% Wien ,9% Österreich ,% (*) Mittelwert der letzten 3 Jahre (213 bis 215) 38
40 Charakteristische Größen der Netzabgabe 215 in MWh/h und GWh Leistungsmaxima in MWh/h (links) Leistungsminima in MWh/h (links) Max. Tagesverbrauch in GWh (rechts) Min. Tagesverbrauch in GWh (rechts) 5 Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Charakteristische Größen der Netzabgabe Bereichs- Leistungs- Leistungs- Max. Max. Min. Benutzeitraum maxima minima Leistungs- Tagesver- Tagesver- zungsminima brauch brauch dauer der Höchstlast Kalenderjahr MWh/h MWh/h MWh/h GWh GWh h Auf Seite 39 werden Leistungskennzahlen der österreichischen Erdgasversorgung dargestellt. 39
41 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar LIBERALISIERUNGSEFFEKTE IM ÖSTERREICHISCHEN ERDGASMARKT Versorgerwechsel und Wechselraten (*) in Anzahl und % Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q Gewechselte Zählpunkte (links) Kumulierte Wechselrate (rechts) (*) bezogen auf Zählpunkte Versorgerwechsel und Wechselraten (*) (*) bezogen auf Zählpunkte Haushalte Sonstige Kleinkunden Lastganggemessene Endkunden insgesamt Haushalte,6,6 2,4 4,2 3,4 Sonstige Kleinkunden 1,1 2,2 3,4 3,5 4,3 Lastganggemessene Endkunden Anzahl der Versorgerwechsel Wechselrate in % 3,1 3,6 5,6 5,3 5, insgesamt,7,7 2,5 4,2 3,4 4
42 Versorgerwechsel nach Netzgebieten (*) Bundesland bzw. Netzgebiet Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien insgesamt (*) bezogen auf Zählpunkte Wechselraten nach Netzgebieten (*) in % Bundesland bzw. Netzgebiet Burgenland,1,3 2,1 2,6 2,3 Kärnten,3,2 1,5 3,8 4,2 Niederösterreich,8 1,1 3,8 5,5 4,3 Oberösterreich,9 1,1 4,2 6,6 5,5 Salzburg,3,2 1,5 1,4 1,6 Steiermark,3 1, 2,8 6, 4,7 Tirol,,,1,5,8 Vorarlberg,,,3,4,9 Wien,7,6 1,9 3,7 2,9 insgesamt,7,7 2,5 4,2 3,4 (*) bezogen auf Zählpunkte Auf den Seiten 4 und 41 sind Informationen zu den Wechselzahlen im Gasbereich zu finden. 41
43 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Elektrizitätsmarkt in Österreich (Öffentliches Netz) Verbraucherstruktur Endkundenkategorie Einheit Mittelwert (*) Anteil (*) Haushalte GWh ,3% Gewerbe und sonstige Kleinkunden Abgabe an Endkunden Landwirtschaft GWh ,5% Klein- Industrie GWh ,8% Mittlere Industrie GWh ,5% Groß- Industrie GWh ,6% Statistische Differenz GWh Abgabe an Endkunden GWh ,% Endkundenkategorie Einheit Mittelwert (*) Anteil (*) Haushalte ,1% Gewerbe und sonstige Kleinkunden GWh ,3% Anzahl der Zählpunkte ,1% Landwirtschaft ,2% Klein- Industrie ,6% Mittlere Industrie ,% Groß- Industrie 1.,% Zählpunkte insgesamt ,% Endkundenkategorie Einheit Mittelwert (*) Haushalte kwh/zp Gewerbe und sonstige Kleinkunden Mittlere Abgabe je Zählpunkt kwh/zp Landwirtschaft kwh/zp Klein- Industrie kwh/zp Mittlere Industrie kwh/zp Groß- Industrie kwh/zp Mittlere Abgabe kwh/zp (*) Mittelwert 211 bis
44 Verbraucherstruktur Abgabe an Endkunden (Mittelwert der letzten 5 Jahre) Groß- Industrie 23,6% Haushalte 23,3% Mittlere Industrie 17,5% Gewerbe und sonstige Kleinkunden 15,3% Klein- Industrie 17,8% Landwirtschaft 2,5% Verbraucherstruktur Anzahl der Zählpunkte (Mittelwert der letzten 5 Jahre) Landwirtschaft 3,2% Industrie,6% Gewerbe und sonstige Kleinkunden 24,1% Haushalte 72,1% Haushalte: Endverbraucher mit einem der Standardlastprofile H... Gewerbe und sonstige Kleinkunden: Endverbraucher mit einem der Standardlastprofile G... oder U... Landwirtschaft: Endverbraucher mit einem der Standardlastprofile L... Klein- Industrie : lastganggemessene Endkunden mit einem Jahresbezug bis 2 GWh Mittlere Industrie : lastganggemessene Endkunden mit einem Jahresbezug von 2 GWh bis 2 GWh Groß- Industrie : lastganggemessene Endkunden mit einem Jahresbezug über 2 GWh Statistische Differenz: Differenz zwischen der gemessenen Abgabe an Endverbraucher und den Einzelmeldungen je Endkundenkategorie. Negative Werte können sich aufgrund der Abgrenzung von Abrechnungszeitraum und Kalenderjahr ergeben. 43
45 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Verbraucherstruktur Abgabe an Endkunden nach Netzgebieten in GWh Bundesland bzw. Netzgebiet Mittelwert (*) Anteil (*) Burgenland ,8% Kärnten ,3% Niederösterreich ,2% Oberösterreich ,5% Salzburg ,3% Steiermark ,% Tirol ,8% Vorarlberg ,5% Wien ,5% Österreich Statistische Differenz Abgabe an Endkunden ,% (*) Mittelwert 211 bis 215 Statistische Differenz: Differenz zwischen der gemessenen Abgabe an Endverbraucher und den Einzelmeldungen je Endkundenkategorie. Negative Werte können sich aufgrund der Abgrenzung von Abrechnungszeitraum und Kalenderjahr ergeben. Verbraucherstruktur Anzahl der Zählpunkte nach Netzgebieten in 1. Bundesland bzw. Netzgebiet Mittelwert (*) Anteil (*) Burgenland ,4% Kärnten ,5% Niederösterreich ,1% Oberösterreich ,7% Salzburg ,2% Steiermark ,5% Tirol ,8% Vorarlberg ,7% Wien ,2% Österreich ,% (*) Mittelwert 211 bis
46 Charakteristische Größen der Netzabgabe 215 in MW und GWh Höchstlast in MW (links) 8. 2 Niedrigstlast in MW (links) Max. Tagesverbrauch in GWh (rechts) 2. 5 Min. Tagesverbrauch in GWh (rechts) Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Charakteristische Größen der Netzabgabe Kalender- Jahres- Jahres- maximale Tages- Benutzungs- Lastfaktor jahr höchstlast niedrigstlast Tages- konstante dauer der (M) niedrigstlast Arbeit Höchstlast MW MW MW GWh h , , , , ,69 Benutzungsdauer der Höchstlast (Ausnutzungsdauer) = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum] Lastfaktor (Ausnutzungsfaktor der Höchstlast) = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum] Die Seiten 42 bis 44 zeigen die Struktur des österreichischen Strommarktes nach Kundengruppen und regionalen Gesichtspunkten. Auf Seite 45 werden Leistungskennzahlen der österreichischen Stromversorgung dargestellt. 45
47 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar LIBERALISIERUNGSEFFEKTE IM ÖSTERREICHISCHEN ELEKTRIZITÄTSMARKT Versorgerwechsel und Wechselraten (*) in Anzahl und % ,5 2 17, ,5 1 7,5 5 2,5 Gewechselte Zählpunkte (links) Kumulierte Wechselrate in % (rechts) Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q (*) bezogen auf Zählpunkte (*) bezogen auf Zählpunkte Versorgerwechsel und Wechselraten (*) Endkundenkategorie Haushalte Sonstige Kleinkunden Lastganggemessene Endkunden insgesamt Wechselrate in % Haushalte,6 1,7 1,7 3,7 2,3 Sonstige Kleinkunden 1,1 1,9 2, 2,8 2,9 Lastganggemessene Endkunden Anzahl der Versorgerwechsel , 9,3 9,7 5,1 7,1 insgesamt,8 1,8 1,8 3,4 2,5 46
48 Versorgerwechsel nach Netzgebieten (*) Bundesland bzw. Netzgebiet Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien insgesamt (*) bezogen auf Zählpunkte Wechselraten nach Netzgebieten (*) in % Bundesland bzw. Netzgebiet Burgenland,2,7 1,5 2,4 1,9 Kärnten 1,4 1, 1,3 3,1 3,5 Niederösterreich,8 2,6 2,3 3,6 2,1 Oberösterreich 1,3 2,1 2,5 5,2 3,6 Salzburg,3,4,4,7,9 Steiermark,4 2,9 2,4 4,3 3,5 Tirol,5,4,5,7,9 Vorarlberg,1,3,6,7 1, Wien,8 1,9 1,9 3,9 2,5 insgesamt,8 1,8 1,8 3,4 2,5 (*) bezogen auf Zählpunkte Auf den Seiten 46 und 47 sind Informationen zu den Wechselzahlen im Strombereich zu finden. 47
49 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Energieträger Ökostrom Einspeisemengen und Vergütungen in Österreich 215 sowie Vergleich zum Jahr 214 Einspeise- Vergütung Geförderter Durchschnittsmenge netto Ökostrom- vergütung in GWh in Mio. E Einspeiseanteil in Cent/kWh in % an der Gesamtabgabemenge 215 (1) Kleinwasserkraft (unterstützt) 1.519, 74,5 2,6% 4,9 Sonstige Ökostromanlagen 7.649,3 883,3 13,3% 11,55 Windkraft 4.591,8 44,5 8,% 8,81 Biomasse fest inkl. Abfall mhba 2.43,3 27,4 3,6% 13,23 Biomasse gasförmig (*) 558,9 98,4 1,% 17,6 Biomasse flüssig,1,,1% 13,72 Photovoltaik 436,6 19,3,76% 25,3 Deponie- und Klärgas 18,6,8,3% 4,3 Geothermie,1,,1% 3,13 Gesamt Kleinwasserkraft und Sonstige Ökostromanlagen 214 (2) Kleinwasserkraft (unterstützt) 1.73,1 81,4 3,% 4,78 Sonstige Ökostromanlagen 6.496, 764,6 11,5% 11,77 Windkraft 3.639,9 315,5 6,4% 8,67 Biomasse fest inkl. Abfall mhba 1.941,2 259,7 3,4% 13,38 Biomasse gasförmig (*) 542,7 95,1 1,% 17,53 Biomasse flüssig,1,,2% 13,21 Photovoltaik 351,4 93,3,62% 26,56 Deponie- und Klärgas 2,4,9,4% 4,58 Geothermie,4,,7% 3,48 Gesamt Kleinwasserkraft und Sonstige Ökostromanlagen 9.168,3 957,8 15,9% 1, , 846, 14,5% 1,32 48 (*) inklusive Betriebskostenzuschläge (1) bezogen auf die Gesamtabgabemenge aus öffentlichen Netzen an Endverbraucher von GWh für das Gesamtjahr 215 (Stand 2/216) (2) bezogen auf die Gesamtabgabemenge aus öffentlichen Netzen an Endverbraucher von GWh für das Gesamtjahr 214 (Stand 2/216) Quelle: OeMAG, E-Control, Februar 216 vorläufige Werte
50 Großhandel Terminmarkt Strom in E/MWh EEX Base Y 217 EEX Peak Y Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug Quelle: EEX Kassamarkt Strom in E/MWh EXAA Base (7-Tage-Schnitt) EXAA Peak (7-Tage-Schnitt) Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug Quelle: EXAA Die Seiten 49 bis 55 zeigen Preisentwicklungen auf verschiedenen relevanten Großhandelsmärkten. 49
51 // Vorwort // Allgemeines // Betriebs- und Bestandsstatistik // Marktstatistik // Glossar Termin- und Kassamarkt Strom in /MWh Spitzenlast (Peak) Grundlast (Base) Day-ahead- Y 217 Day-ahead- Y 217 Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt ,8 42,55 32,76 33, ,6 38,47 31,63 3,25 Jänner ,6 39,89 28,72 31,22 Februar ,8 4,96 36,72 32,1 März ,37 4,43 31,32 31,47 April ,4 4,27 29,72 31,7 Mai ,16 4,17 25,36 31,73 Juni ,92 39,75 3,7 31,45 Juli ,88 39,69 35, 31,44 August ,48 38,35 31,61 3,11 September ,55 37,31 31,88 29,14 Oktober ,69 35,83 39,37 28,25 November ,86 35,6 32,39 27,75 Dezember ,81 33,98 27,78 26,83 Jänner ,32 3,73 29,4 24,28 Februar ,1 28,16 21,99 21,7 März ,72 27,97 24,29 21,99 April ,58 29,36 24,21 23,5 Mai ,34 3,99 22,54 24,87 Juni ,37 33,73 27,69 26,88 Quelle: EXAA, EEX 5
52 Kassamarkt Erdgas in E/MWh 4 3 TTF CEGH 2 1 Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug Quelle: ICIS Heren, CEGH Exchange Quelle: ICIS Heren, CEGH Exchange Kassamarkt Erdgas in /MWh TTF (NL) CEGH (AT) TTF (NL) CEGH (AT) Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt 214 2,95 22,26 September ,18 2, ,8 2,65 Oktober ,22 18,87 Jänner ,74 21,1 November ,9 18,22 Februar ,51 23,6 Dezember ,77 16,99 März ,79 22,45 Jänner ,76 15,5 April ,97 22,17 Februar ,39 13,22 Mai 215 2,55 21,17 März ,28 12,72 Juni 215 2,5 21,17 April ,5 12,66 Juli 215 2,88 21,52 Mai ,1 13,91 August ,58 2,65 Juni ,44 15,38 51
Energiedaten: Ausgewählte Grafiken
 Energiedaten: Ausgewählte Grafiken Inhalt A. Energie- und Strompreise 1. Strompreise in Deutschland für Haushalte und Industrie 2. Strompreise im europäischen Vergleich Haushalte 3. Zusammensetzung der
Energiedaten: Ausgewählte Grafiken Inhalt A. Energie- und Strompreise 1. Strompreise in Deutschland für Haushalte und Industrie 2. Strompreise im europäischen Vergleich Haushalte 3. Zusammensetzung der
KONSEQUENZEN FÜR EVU S
 KONSEQUENZEN FÜR EVU S Agenda KONSEQUENZEN FÜR EVU S MIT GASBEFEUERTEN KRAFTWERKEN Entwicklungen am Gasmarkt Preise und Mengen Sicht der EVU Entwicklungen am Strommarkt Erneuerbare Energien drängen verstärkt
KONSEQUENZEN FÜR EVU S Agenda KONSEQUENZEN FÜR EVU S MIT GASBEFEUERTEN KRAFTWERKEN Entwicklungen am Gasmarkt Preise und Mengen Sicht der EVU Entwicklungen am Strommarkt Erneuerbare Energien drängen verstärkt
Kostenverteilung in der Energiewende und Strompreisprivilegien der Industrie
 Kostenverteilung in der Energiewende und Strompreisprivilegien der Industrie Sozial gerechte Energiewende Hessische Landesvertretung Berlin, 26.11.2012 Referentin: Swantje Küchler Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Kostenverteilung in der Energiewende und Strompreisprivilegien der Industrie Sozial gerechte Energiewende Hessische Landesvertretung Berlin, 26.11.2012 Referentin: Swantje Küchler Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Strompreise 2011 Fakten und Zusammenhänge Kurt Rohrbach, Präsident VSE. VSE-Medienkonferenz, Hotel Bern, 26. August 2010
 Strompreise 2011 Fakten und Zusammenhänge Kurt Rohrbach, Präsident VSE VSE-Medienkonferenz, Hotel Bern, 26. August 2010 Inhalt Strompreise im Quervergleich Zusammensetzung Strompreis Einflussfaktoren Fazit
Strompreise 2011 Fakten und Zusammenhänge Kurt Rohrbach, Präsident VSE VSE-Medienkonferenz, Hotel Bern, 26. August 2010 Inhalt Strompreise im Quervergleich Zusammensetzung Strompreis Einflussfaktoren Fazit
Wissenswerte Auszüge aus. BMWFW : Energiestatus Österreich 2006 bis 2014 und E-CONTROL : Stromkennzeichnungsbericht 2006 bis 2014
 Erstellt 15.01.2011 Information für den Kälte -, Klima - und Wärmepumpenbauer, Nr. 20c, 27.12.2014 Seite 1 von 8 Berufsgruppe Kälte und Klimatechnik In Zusammenarbeit dürfen wir Sie informieren über :
Erstellt 15.01.2011 Information für den Kälte -, Klima - und Wärmepumpenbauer, Nr. 20c, 27.12.2014 Seite 1 von 8 Berufsgruppe Kälte und Klimatechnik In Zusammenarbeit dürfen wir Sie informieren über :
Energiewende als Chance Flexibilisierung im Heizkraftwerk Flensburg. Claus Hartmann
 Energiewende als Chance Flexibilisierung im Heizkraftwerk Flensburg Claus Hartmann Gliederung I. Kurzvorstellung Stadtwerke Flensburg GmbH II. III. IV. Anlagenbestand im Heizkraftwerk Flensburg Energiewirtschaftlicher
Energiewende als Chance Flexibilisierung im Heizkraftwerk Flensburg Claus Hartmann Gliederung I. Kurzvorstellung Stadtwerke Flensburg GmbH II. III. IV. Anlagenbestand im Heizkraftwerk Flensburg Energiewirtschaftlicher
2010 Wendepunkt der Energiepolitik?
 2010 Wendepunkt der Energiepolitik? Helmuth Böck 1 Otmar PROMPER 2 Michael SCHNEEBERGER 2 1 TU Wien/Atominstitut, 1020 Wien, Stadionallee 2 2 Österreichische Kerntechnische Gesellschaft c/o Atominstitut,
2010 Wendepunkt der Energiepolitik? Helmuth Böck 1 Otmar PROMPER 2 Michael SCHNEEBERGER 2 1 TU Wien/Atominstitut, 1020 Wien, Stadionallee 2 2 Österreichische Kerntechnische Gesellschaft c/o Atominstitut,
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE
 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE Stromerzeugung aus lar- und Windenergie im Jahr 2013 Prof. Dr. Bruno Burger aunhofer-institut für lare Energiesysteme ISE eiburg, den 03.04.2014 www.ise.fraunhofer.de
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE Stromerzeugung aus lar- und Windenergie im Jahr 2013 Prof. Dr. Bruno Burger aunhofer-institut für lare Energiesysteme ISE eiburg, den 03.04.2014 www.ise.fraunhofer.de
Energie Schlüssel der Zukunft?
 Energie Schlüssel der Zukunft? Ing. Franz Jäger Brunnbachweg 42 5303 Thalgau franz.jaeger@aon.at Datenquellen: Statistik Austria 2006 Bayrischer Gesamtenergiebericht Brockhaus Internet Wikipedia E-Control
Energie Schlüssel der Zukunft? Ing. Franz Jäger Brunnbachweg 42 5303 Thalgau franz.jaeger@aon.at Datenquellen: Statistik Austria 2006 Bayrischer Gesamtenergiebericht Brockhaus Internet Wikipedia E-Control
Erneuerbare Energien und Energiestruktur in Sachsen-Anhalt
 Stand: 1. Juli 2015 Erneuerbare Energien und Energiestruktur in Sachsen-Anhalt Die erneuerbaren Energien spielten in Sachsen-Anhalt bis 1997 keine Rolle in der Energieversorgung. Wie Bild 1a und 1b zeigen,
Stand: 1. Juli 2015 Erneuerbare Energien und Energiestruktur in Sachsen-Anhalt Die erneuerbaren Energien spielten in Sachsen-Anhalt bis 1997 keine Rolle in der Energieversorgung. Wie Bild 1a und 1b zeigen,
Energiewende Status und zukünftige
 XII. Fachkonferenz Synergien mit Stahl Metall mit Energie Prenzlau 05.11.2010 Energiewende Status und zukünftige Entwicklung Dr. Lutz B. Giese Dr. Lutz B. Giese Physikalische Technik Themenübersicht Energie
XII. Fachkonferenz Synergien mit Stahl Metall mit Energie Prenzlau 05.11.2010 Energiewende Status und zukünftige Entwicklung Dr. Lutz B. Giese Dr. Lutz B. Giese Physikalische Technik Themenübersicht Energie
Nur ein kleiner Teil des Stromgeschäfts ist wettbewerblich organisiert
 Nur ein kleiner Teil des Stromgeschäfts ist wettbewerblich organisiert Wettbewerb Regulierung des Netzzugangs und der Netzentgelte (Bundesnetzagentur) Wettbewerb Festgelegt durch den Staat Erzeugung Börse
Nur ein kleiner Teil des Stromgeschäfts ist wettbewerblich organisiert Wettbewerb Regulierung des Netzzugangs und der Netzentgelte (Bundesnetzagentur) Wettbewerb Festgelegt durch den Staat Erzeugung Börse
Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01
 Anhang 2012-01 Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01 Alterserwerbsbeteiligung in Europa Deutschland im internationalen Vergleich Tabellen und Abbildungen Tabelle Anhang 1: Gesetzliche Rentenaltersgrenzen
Anhang 2012-01 Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01 Alterserwerbsbeteiligung in Europa Deutschland im internationalen Vergleich Tabellen und Abbildungen Tabelle Anhang 1: Gesetzliche Rentenaltersgrenzen
ErNEUERBARE ENERGIEN IN EUROPA
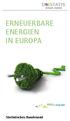 ErNEUERBARE ENERGIEN IN EUROPA Statistisches Bundesamt Einleitung Energie ist der Motor jeder Volkswirtschaft, denn eine stabile, verlässliche Energieversorgung trägt entscheidend zu Wohlstand und Erfolg
ErNEUERBARE ENERGIEN IN EUROPA Statistisches Bundesamt Einleitung Energie ist der Motor jeder Volkswirtschaft, denn eine stabile, verlässliche Energieversorgung trägt entscheidend zu Wohlstand und Erfolg
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE
 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE Stromerzeugung aus lar- und Windenergie im Jahr 2014 Prof. Dr. Bruno Burger aunhofer-institut für lare Energiesysteme ISE eiburg, den 07.01.2015 www.ise.fraunhofer.de
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE Stromerzeugung aus lar- und Windenergie im Jahr 2014 Prof. Dr. Bruno Burger aunhofer-institut für lare Energiesysteme ISE eiburg, den 07.01.2015 www.ise.fraunhofer.de
Entwicklung der erneuerbaren Energien und die daraus folgende Bedeutung für die Spitzenenergieproduktion in der Schweiz
 Entwicklung der erneuerbaren Energien und die daraus folgende Bedeutung für die Spitzenenergieproduktion in der Schweiz Geomatik-News 24. November 2011 Technopark Zürich Niklaus Zepf Leiter Corporate Development
Entwicklung der erneuerbaren Energien und die daraus folgende Bedeutung für die Spitzenenergieproduktion in der Schweiz Geomatik-News 24. November 2011 Technopark Zürich Niklaus Zepf Leiter Corporate Development
Aufbau der IBAN (International Bank Account Number)
 a = alphanumerisch; n = numerisch 4 4 4670 IBAN AD (Andorra) AD 000 200 200 0 000 4 4 4 67 0 ; n 2n 4 4670 IBAN AT (Österreich) AT6 04 002 47 20 4 467 0 ; n ; n 0 467 IBAN BE (Belgien) BE 6 0 074 704 24
a = alphanumerisch; n = numerisch 4 4 4670 IBAN AD (Andorra) AD 000 200 200 0 000 4 4 4 67 0 ; n 2n 4 4670 IBAN AT (Österreich) AT6 04 002 47 20 4 467 0 ; n ; n 0 467 IBAN BE (Belgien) BE 6 0 074 704 24
UMGANG MIT HOHEN PHOTOVOLTAIK- PRODUKTIONSANTEILEN IM DEUTSCHEN STROMNETZ
 UMGANG MIT HOHEN PHOTOVOLTAIK- PRODUKTIONSANTEILEN IM DEUTSCHEN STROMNETZ Prof. Dr. Bruno Burger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Swissolar 214 Lausanne, 1. bis 11. April 214 www.ise.fraunhofer.de
UMGANG MIT HOHEN PHOTOVOLTAIK- PRODUKTIONSANTEILEN IM DEUTSCHEN STROMNETZ Prof. Dr. Bruno Burger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Swissolar 214 Lausanne, 1. bis 11. April 214 www.ise.fraunhofer.de
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2014
 Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2014 Grafiken und Diagramme unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Stand Februar 2015
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2014 Grafiken und Diagramme unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Stand Februar 2015
Bioenergie im Kontext der erneuerbaren Energien in Deutschland
 Technische Universität Hamburg-Harburg Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft Bioenergie im Kontext der erneuerbaren Energien in Deutschland Martin Kaltschmitt Institut für Umwelttechnik und
Technische Universität Hamburg-Harburg Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft Bioenergie im Kontext der erneuerbaren Energien in Deutschland Martin Kaltschmitt Institut für Umwelttechnik und
ENERGIEWENDE IN BAYERN. Energiewende in Bayern
 ENERGIEWENDE IN BAYERN Energiewende in Bayern Bioenergie in Bayern Gesamtverbrauch 2009 2006 PJ Bioenergie in Bayern Beitrag 2009 10,7% Bioenergie in Bayern Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt,C.A.R.M.E.N.
ENERGIEWENDE IN BAYERN Energiewende in Bayern Bioenergie in Bayern Gesamtverbrauch 2009 2006 PJ Bioenergie in Bayern Beitrag 2009 10,7% Bioenergie in Bayern Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt,C.A.R.M.E.N.
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE
 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE Stromerzeugung aus lar- und Windenergie im Jahr 2012 Prof. Dr. Bruno Burger aunhofer-institut für lare Energiesysteme ISE eiburg, den 08.02.2013 www.ise.fraunhofer.de
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE Stromerzeugung aus lar- und Windenergie im Jahr 2012 Prof. Dr. Bruno Burger aunhofer-institut für lare Energiesysteme ISE eiburg, den 08.02.2013 www.ise.fraunhofer.de
2 Kann die Industrie eine finanzielle Mehrbelastung für Ökostrom verkraften?
 Inhalt 1 Vergleich der Industriestrompreise 2 Kann die Industrie eine finanzielle Mehrbelastung für Ökostrom verkraften? 3 Ökostrom verdrängt zunehmend die konventionelle Erzeugung ein Problem für die
Inhalt 1 Vergleich der Industriestrompreise 2 Kann die Industrie eine finanzielle Mehrbelastung für Ökostrom verkraften? 3 Ökostrom verdrängt zunehmend die konventionelle Erzeugung ein Problem für die
Primärenergiefaktoren und Emissionsfaktoren von Energieträgern
 Primärenergiefaktoren und sfaktoren von Energieträgern Fernwärmetage 2010 Villach, am 18.3.2010 Ausgangssituation Inhalt Primärenergiefaktoren (allgemein) Primärenergiefaktoren verschiedener Energieträger
Primärenergiefaktoren und sfaktoren von Energieträgern Fernwärmetage 2010 Villach, am 18.3.2010 Ausgangssituation Inhalt Primärenergiefaktoren (allgemein) Primärenergiefaktoren verschiedener Energieträger
Stromhandel im ¼ Stunden Takt
 IHS Workshop 07.05.2015 Alexander Thuma Stromhandel im ¼ Stunden Takt to be balanced EXAA who? Gründung 2001 Sitz in Wien Aufsicht Abwicklungsstelle für die Eigentümer der EXAA Verbund Trading AG 3.04%
IHS Workshop 07.05.2015 Alexander Thuma Stromhandel im ¼ Stunden Takt to be balanced EXAA who? Gründung 2001 Sitz in Wien Aufsicht Abwicklungsstelle für die Eigentümer der EXAA Verbund Trading AG 3.04%
Aspekte zur Wirtschaftlichkeit des Kraftwerksprojekts Innervillgraten. Dr. Jürgen Neubarth :: Lienz, 26. Jänner 2015
 Aspekte zur Wirtschaftlichkeit des Kraftwerksprojekts Innervillgraten Dr. Jürgen Neubarth :: Lienz, 26. Jänner 2015 Goldgräberstimmung in Österreich: Die Energiewende als Motor für den Wasserkraftausbau
Aspekte zur Wirtschaftlichkeit des Kraftwerksprojekts Innervillgraten Dr. Jürgen Neubarth :: Lienz, 26. Jänner 2015 Goldgräberstimmung in Österreich: Die Energiewende als Motor für den Wasserkraftausbau
Güterverkehr in Österreich
 Güterverkehr in Österreich Transportaufkommen (Millionen Tonnen) 1999 (1) Schiff Pipeline (2) Summe Binnen 243 18 0,8 1 263 Import / Export 51 34 6 12 103 Transit 38 18 3 44 103 Gesamt 331 70 10 57 469
Güterverkehr in Österreich Transportaufkommen (Millionen Tonnen) 1999 (1) Schiff Pipeline (2) Summe Binnen 243 18 0,8 1 263 Import / Export 51 34 6 12 103 Transit 38 18 3 44 103 Gesamt 331 70 10 57 469
Wasserkraft in Österreich Opfer der Energiewende? Dr. Jürgen Neubarth :: Pertisau, 17. Oktober 2014
 Wasserkraft in Österreich Opfer der Energiewende? Dr. Jürgen Neubarth :: Pertisau, 17. Oktober 2014 Die Rolle der Wasserkraft in europäischen Ländern Anteil Wasserkraft an Stromerzeugung 2010 0-10 % 10-20
Wasserkraft in Österreich Opfer der Energiewende? Dr. Jürgen Neubarth :: Pertisau, 17. Oktober 2014 Die Rolle der Wasserkraft in europäischen Ländern Anteil Wasserkraft an Stromerzeugung 2010 0-10 % 10-20
. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE
 . Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Massen-Niederlausitz, 12. Februar 2014 Agenda 2 Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung im Amt Kleine Elster ENERGIE BRAUCHT
. Workshop ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Massen-Niederlausitz, 12. Februar 2014 Agenda 2 Analyse der Energieverbräuche und der Energieerzeugung im Amt Kleine Elster ENERGIE BRAUCHT
Flash Eurobarometer 345 ZUGÄNGLICHKEIT ZUSAMMENFASSUNG
 Flash Eurobarometer 345 ZUGÄNGLICHKEIT ZUSAMMENFASSUNG Befragung: März 2012 Veröffentlichung: Dezember 2012 Diese Umfrage wurde von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Justiz in Auftrag gegeben
Flash Eurobarometer 345 ZUGÄNGLICHKEIT ZUSAMMENFASSUNG Befragung: März 2012 Veröffentlichung: Dezember 2012 Diese Umfrage wurde von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Justiz in Auftrag gegeben
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2014
 Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2014 Grafiken und Diagramme unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Stand Dezember 2015
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2014 Grafiken und Diagramme unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Stand Dezember 2015
Neue Gemeinsame Agrarpolitik ab 20134. Statement
 Bündnis 90 / Die Grünen Neue Gemeinsame Agrarpolitik ab 20134 / Agrarpolitik Landwirtschaft nach 2013 11. Februar 2011 Statement [HAL-080508.PPT] Dr. Hans H. Harpain Hessischer Bauernverband e.v. Leistungen
Bündnis 90 / Die Grünen Neue Gemeinsame Agrarpolitik ab 20134 / Agrarpolitik Landwirtschaft nach 2013 11. Februar 2011 Statement [HAL-080508.PPT] Dr. Hans H. Harpain Hessischer Bauernverband e.v. Leistungen
Stromversorgung in der Türkei. Emrah Vural PEESE, 308680
 Stromversorgung in der Türkei Emrah Vural PEESE, 308680 Inhalt Stromverbrauch in der Türkei Stromerzeugung aus fossilen Kraftwerken Stromerzeugung aus Wasserkraftwerken Stromerzeugung aus erneuerbaren
Stromversorgung in der Türkei Emrah Vural PEESE, 308680 Inhalt Stromverbrauch in der Türkei Stromerzeugung aus fossilen Kraftwerken Stromerzeugung aus Wasserkraftwerken Stromerzeugung aus erneuerbaren
Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland
 Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland Unter Verwendung von Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Inhaltsverzeichnis EINFÜHRUNG ENTWICKLUNG DER
Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland Unter Verwendung von Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Inhaltsverzeichnis EINFÜHRUNG ENTWICKLUNG DER
Unsere Energieversorgung. Fakten von heute, Perspektiven für morgen
 Bayreuther Forum Kirche und Universität Unsere Energieversorgung Fakten von heute, Perspektiven für morgen Prof. Dr.-Ing. D. Brüggemann Dr.-Ing. A. Obermeier 15. November 2003 Energiebedarf Beispiele aus
Bayreuther Forum Kirche und Universität Unsere Energieversorgung Fakten von heute, Perspektiven für morgen Prof. Dr.-Ing. D. Brüggemann Dr.-Ing. A. Obermeier 15. November 2003 Energiebedarf Beispiele aus
Aeneas Wanner Geschäftsleiter Energie Zukunft Schweiz
 WKK Tagung Einführung WKK Aeneas Wanner Geschäftsleiter Energie Zukunft Schweiz 20.03.2012 1 1 Energie Zukunft Schweiz - gemeinsam die Energiewende schaffen Energieeffizienz Entwicklung und Umsetzung Förderprogramm
WKK Tagung Einführung WKK Aeneas Wanner Geschäftsleiter Energie Zukunft Schweiz 20.03.2012 1 1 Energie Zukunft Schweiz - gemeinsam die Energiewende schaffen Energieeffizienz Entwicklung und Umsetzung Förderprogramm
Intelligente Energie Europa 2007-2013
 PTJ Intelligente Energie Europa 2007-2013 Ergebnisse der Projektförderung Ute Roewer Mai 2015 Beteiligung deutscher Partner an IEE An den Aufrufen des Programms Intelligente Energie Europa (IEE) einem
PTJ Intelligente Energie Europa 2007-2013 Ergebnisse der Projektförderung Ute Roewer Mai 2015 Beteiligung deutscher Partner an IEE An den Aufrufen des Programms Intelligente Energie Europa (IEE) einem
Main-Kinzig-Kreis. ENDENERGIEVERBRAUCH Strom
 Rahmendaten Status Quelle Kommentar Datenqualität* Einwohner 241.112 Statistik Hessen Datenstand: 31.12.2013 IST_Gebietsfläche 327.300.000 m² Statistik Hessen Datenstand: 05/2014 Basisjahr 2013 Einzelne
Rahmendaten Status Quelle Kommentar Datenqualität* Einwohner 241.112 Statistik Hessen Datenstand: 31.12.2013 IST_Gebietsfläche 327.300.000 m² Statistik Hessen Datenstand: 05/2014 Basisjahr 2013 Einzelne
Die Solarwirtschaft in Deutschland aktueller Stand und Ausblick
 Die Solarwirtschaft in Deutschland aktueller Stand und Ausblick Dr.-Ing. Brigitte Schmidt, Vorstand Eurosolar, Bonn Eurosolar-Regionalgruppe MV, Triwalk Inhalt Energieverbrauch und Energiekosten Aktuelle
Die Solarwirtschaft in Deutschland aktueller Stand und Ausblick Dr.-Ing. Brigitte Schmidt, Vorstand Eurosolar, Bonn Eurosolar-Regionalgruppe MV, Triwalk Inhalt Energieverbrauch und Energiekosten Aktuelle
Die volkswirtschaftlichen Impulse des Internets für Österreich
 Die volkswirtschaftlichen Impulse des Internets für Österreich Prof. Dr. Bernhard Felderer Institut für Höhere Studien 21. Juli 2011 Internet IHS-Studie 1 Verschiedene Ansätze bei Internetstudien a) Sektorale
Die volkswirtschaftlichen Impulse des Internets für Österreich Prof. Dr. Bernhard Felderer Institut für Höhere Studien 21. Juli 2011 Internet IHS-Studie 1 Verschiedene Ansätze bei Internetstudien a) Sektorale
Soll Ist Vergleich erneuerbarer Energien zu den Zielen der Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes Brandenburg. Carsten Linke
 Soll Ist Vergleich erneuerbarer Energien zu den Zielen der Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes Brandenburg Carsten Linke Referent für Energie, Klimaschutz, Klimawandel 1 energie- und klimapolitische
Soll Ist Vergleich erneuerbarer Energien zu den Zielen der Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes Brandenburg Carsten Linke Referent für Energie, Klimaschutz, Klimawandel 1 energie- und klimapolitische
Gutachten laut Ökostromgesetz 2012 42 (4)
 Gutachten laut Ökostromgesetz 2012 42 (4) zur Bestimmung der Aliquoten Ausgleichsenergie-, Verwaltungs- und Technologieförderungsaufwendungen der Ökostromförderung für das Jahr 2015 auf Basis der Aufwendungen
Gutachten laut Ökostromgesetz 2012 42 (4) zur Bestimmung der Aliquoten Ausgleichsenergie-, Verwaltungs- und Technologieförderungsaufwendungen der Ökostromförderung für das Jahr 2015 auf Basis der Aufwendungen
Europäische Strukturpolitik im Spannungsfeld von Ist und Soll
 Europäische Strukturpolitik im Spannungsfeld von Ist und Soll WSI Herbstforum Dr. Ines Hartwig, Europäische Kommission 27. November 2008, Berlin Fakten & Zahlen Fonds Anteil am EU-Haushalt (2007-13) ESF
Europäische Strukturpolitik im Spannungsfeld von Ist und Soll WSI Herbstforum Dr. Ines Hartwig, Europäische Kommission 27. November 2008, Berlin Fakten & Zahlen Fonds Anteil am EU-Haushalt (2007-13) ESF
Primärenergiebedarf (PEV) Deutschland
 Primärenergiebedarf (PEV) Deutschland Deutschland 2013 heimische Quellen: ~ 25 % Gas 22,3% Steinkohle 12,8% Braunkohle 11,7% Öl 33,4% 474,5 Mio. t SKE/a Regenerativ 11,5% Kernenergie 7,6% Sonstige 0,7
Primärenergiebedarf (PEV) Deutschland Deutschland 2013 heimische Quellen: ~ 25 % Gas 22,3% Steinkohle 12,8% Braunkohle 11,7% Öl 33,4% 474,5 Mio. t SKE/a Regenerativ 11,5% Kernenergie 7,6% Sonstige 0,7
KWK kann s besser. Was ist Kraft-Wärme-Kopplung? Folie 1
 Was ist Kraft-Wärme-Kopplung? Folie 1 Grundprinzip Effizienz Wirkungsgrad Getrennte Energieerzeugung Strom und Wärme werden unabhängig voneinander in getrennten Prozessen erzeugt (Kraftwerk oder Heizkessel)
Was ist Kraft-Wärme-Kopplung? Folie 1 Grundprinzip Effizienz Wirkungsgrad Getrennte Energieerzeugung Strom und Wärme werden unabhängig voneinander in getrennten Prozessen erzeugt (Kraftwerk oder Heizkessel)
Import und Export von Gebrauchtfahrzeugen in Europa
 Cornelia Merz, Dr.-Ing. Georg Mehlhart 27.03.2012, Berlin Gliederung Rahmen und Motivation Bilanzierung der Entwicklung der Fahrzeugflotte Abschätzung des Altfahrzeugaufkommens Zusammenfassung 2 Rahmen
Cornelia Merz, Dr.-Ing. Georg Mehlhart 27.03.2012, Berlin Gliederung Rahmen und Motivation Bilanzierung der Entwicklung der Fahrzeugflotte Abschätzung des Altfahrzeugaufkommens Zusammenfassung 2 Rahmen
Energiewende? Kohlewende!
 DUH-Hintergrund Energiewende? Kohlewende! Kohlekraftwerke im Dauerbetrieb treiben den Stromexport auf historische Höhen und gefährden die nationalen Klimaschutzziele Trotz der endgültigen Stilllegung von
DUH-Hintergrund Energiewende? Kohlewende! Kohlekraftwerke im Dauerbetrieb treiben den Stromexport auf historische Höhen und gefährden die nationalen Klimaschutzziele Trotz der endgültigen Stilllegung von
Erneuerbare Energien 2014
 Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit. Erneuerbare Energien 2014 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Impressum Herausgeber Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit. Erneuerbare Energien 2014 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Impressum Herausgeber Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
100 % grüner Strom aus Österreich.
 100 % grüner Strom aus Österreich. Für unser Warmwasser ist nur der reinste Strom gut genug. Für meinen Eiskaffee ist nur der reinste Strom gut genug. Für meine Biosemmeln ist nur der reinste Strom gut
100 % grüner Strom aus Österreich. Für unser Warmwasser ist nur der reinste Strom gut genug. Für meinen Eiskaffee ist nur der reinste Strom gut genug. Für meine Biosemmeln ist nur der reinste Strom gut
Woher kommt Österreichs Strom
 Woher kommt Österreichs Strom wirklich? Gero Vogl Fakultät für Physik der Universität Wien Dynamik kondensierter Systeme LehrerInnenfortbildungswoche, Vortrag am 24.2.2015 1 1. Wie decken wir unseren Strombedarf
Woher kommt Österreichs Strom wirklich? Gero Vogl Fakultät für Physik der Universität Wien Dynamik kondensierter Systeme LehrerInnenfortbildungswoche, Vortrag am 24.2.2015 1 1. Wie decken wir unseren Strombedarf
www.bmwfj.gv.at Raiffeisen Forum Linz Energiepolitische Perspektiven Oberösterreich 2050
 Raiffeisen Forum Linz Energiepolitische Perspektiven Oberösterreich 2050 Österreichs Diagramme Energiepolitik im Lichte der europäischen Entwicklungen: Chancen, Risken, Perspektiven Sektionschef Dipl.-Ing.
Raiffeisen Forum Linz Energiepolitische Perspektiven Oberösterreich 2050 Österreichs Diagramme Energiepolitik im Lichte der europäischen Entwicklungen: Chancen, Risken, Perspektiven Sektionschef Dipl.-Ing.
pressedienst Bedeutung des Stroms wächst /AG Energiebilanzen aktualisiert Anwendungsbilanz
 Wärme ist wichtigste Nutzenergie Bedeutung des Stroms wächst /AG Energiebilanzen aktualisiert Anwendungsbilanz Berlin/Köln (20.02.2014) - Die privaten Haushalte in Deutschland verwenden rund 90 Prozent
Wärme ist wichtigste Nutzenergie Bedeutung des Stroms wächst /AG Energiebilanzen aktualisiert Anwendungsbilanz Berlin/Köln (20.02.2014) - Die privaten Haushalte in Deutschland verwenden rund 90 Prozent
Möglichkeiten einer weitgehend erneuerbaren Stromversorgung unter Einschluss des Verkehrssektors
 Fraunhofer IWES Energiesystemtechnik Norman Gerhardt Berlin, 12. November 214 Möglichkeiten einer weitgehend erneuerbaren Stromversorgung unter Einschluss des Verkehrssektors Öko-Institut Jahrestagung
Fraunhofer IWES Energiesystemtechnik Norman Gerhardt Berlin, 12. November 214 Möglichkeiten einer weitgehend erneuerbaren Stromversorgung unter Einschluss des Verkehrssektors Öko-Institut Jahrestagung
Ausbau Erneuerbarer Energien: Aktueller Stand und Szenarien in Deutschland
 Ausbau Erneuerbarer Energien: Aktueller Stand und Szenarien in Deutschland Dialogforum: Erneuerbare Energien wohin geht die Reise? ICC Berlin, 26. Januar 211 Dr. Frank Musiol - 1 - Datengrundlagen: unabhängiges
Ausbau Erneuerbarer Energien: Aktueller Stand und Szenarien in Deutschland Dialogforum: Erneuerbare Energien wohin geht die Reise? ICC Berlin, 26. Januar 211 Dr. Frank Musiol - 1 - Datengrundlagen: unabhängiges
Stromakademie Modul Stromerzeugung - Wärmekraft
 Stromakademie Modul Stromerzeugung - Wärmekraft DI Anton Smolak, 1.6.2011 AG, www.verbund.com Thermal Power Stand innerhalb Erzeugung Handel/Vertrieb Übertragung Beteiligungen Ausland Services Hydro Power
Stromakademie Modul Stromerzeugung - Wärmekraft DI Anton Smolak, 1.6.2011 AG, www.verbund.com Thermal Power Stand innerhalb Erzeugung Handel/Vertrieb Übertragung Beteiligungen Ausland Services Hydro Power
Intelligente Energie Europa Beteiligungsergebnisse 2007-2012
 Intelligente Energie Europa Beteiligungsergebnisse 2007-2012 31. Januar 2013 Nationaler Informationstag Intelligente Energie Europa - Aufruf 2013 Ute Roewer, NKS Energie www.nks-energie.de eu-energie@fz-juelich.de
Intelligente Energie Europa Beteiligungsergebnisse 2007-2012 31. Januar 2013 Nationaler Informationstag Intelligente Energie Europa - Aufruf 2013 Ute Roewer, NKS Energie www.nks-energie.de eu-energie@fz-juelich.de
Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung für Haushalte in Schleswig Holstein am Beispiel Energieregion WindWärme Dithmarschen und Nordfriesland
 Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung für Haushalte in Schleswig Holstein am Beispiel Energieregion WindWärme Dithmarschen und Nordfriesland 26.05.2014 Prof. Dr. rer. nat. Rainer Duttmann Prof. Dr. Ing.
Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung für Haushalte in Schleswig Holstein am Beispiel Energieregion WindWärme Dithmarschen und Nordfriesland 26.05.2014 Prof. Dr. rer. nat. Rainer Duttmann Prof. Dr. Ing.
Einfluss des Ausbaus der Photovoltaik auf den Betrieb von herkömmlichen Grundlastkraftwerken in Deutschland
 Einfluss des Ausbaus der Photovoltaik auf den Betrieb von herkömmlichen Grundlastkraftwerken in Deutschland B.Sc. Martin Hofmann Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin 25. Symposium Photovoltaische
Einfluss des Ausbaus der Photovoltaik auf den Betrieb von herkömmlichen Grundlastkraftwerken in Deutschland B.Sc. Martin Hofmann Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin 25. Symposium Photovoltaische
10. DSV Forum WIE VIEL GRENZKAPAZITÄT BENÖTIGT EINE SICHERE STROMVERSORGUNG?
 10. DSV Forum WIE VIEL GRENZKAPAZITÄT BENÖTIGT EINE SICHERE STROMVERSORGUNG? DR. WERNER GÖTZ, GESCHÄFTSFÜHRER TRANSNETBW Olten, 06.11.2015 Paradigmenwechsel Energiewende DER WANDEL IN ZAHLEN: ~1,3 MIO.
10. DSV Forum WIE VIEL GRENZKAPAZITÄT BENÖTIGT EINE SICHERE STROMVERSORGUNG? DR. WERNER GÖTZ, GESCHÄFTSFÜHRER TRANSNETBW Olten, 06.11.2015 Paradigmenwechsel Energiewende DER WANDEL IN ZAHLEN: ~1,3 MIO.
Power-to-Gas Erfahrungen bei der Erzeugung von regenerativem Wasserstoff mittels Alkali / PEM-Elektrolyse
 Power-to-Gas Erfahrungen bei der Erzeugung von regenerativem Wasserstoff mittels Alkali / PEM-Elektrolyse 15. Jahrestreffen Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff der EnergieAgentur.NRW Düsseldorf,19.
Power-to-Gas Erfahrungen bei der Erzeugung von regenerativem Wasserstoff mittels Alkali / PEM-Elektrolyse 15. Jahrestreffen Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff der EnergieAgentur.NRW Düsseldorf,19.
Pressefrühstück, 13. November 2014
 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche The Vienna Institute for International Economic Studies www.wiiw.ac.at Pressefrühstück, 13. November 214 wiiw-prognose für Mittel-, Ost- und Südosteuropa,
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche The Vienna Institute for International Economic Studies www.wiiw.ac.at Pressefrühstück, 13. November 214 wiiw-prognose für Mittel-, Ost- und Südosteuropa,
Die Bedeutung und Entwicklung der regenerativen Energien in Deutschland
 Die Bedeutung und Entwicklung der regenerativen Energien in Deutschland Tarek Al-Wazir, MdL Fraktions- und Landesvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen 1 Warum sind Erneuerbare Energien und Effizienztechnologien
Die Bedeutung und Entwicklung der regenerativen Energien in Deutschland Tarek Al-Wazir, MdL Fraktions- und Landesvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen 1 Warum sind Erneuerbare Energien und Effizienztechnologien
Chancen und Grenzen eines Bewertungssystems auf Basis der Primärenergie. Sean Gladwell Fotolia
 Chancen und Grenzen eines Bewertungssystems auf Basis der Primärenergie Sean Gladwell Fotolia Inhalt Definitionen und Begrifflichkeiten Funktionsweise einer Lebenszyklusanalyse LCA-Emissions- und Primärenergiefaktoren
Chancen und Grenzen eines Bewertungssystems auf Basis der Primärenergie Sean Gladwell Fotolia Inhalt Definitionen und Begrifflichkeiten Funktionsweise einer Lebenszyklusanalyse LCA-Emissions- und Primärenergiefaktoren
Strommarkt heute und morgen
 Strommarkt heute und morgen Dr. Leonhard Birnbaum Jahrestagung Zement, 27.09.2011 in Düsseldorf RWE AG Dr. Leonhard Birnbaum 27.9.2011 SEITE 1 Der Strommarkt im Wandel Strommarkt gestern Strommarkt heute
Strommarkt heute und morgen Dr. Leonhard Birnbaum Jahrestagung Zement, 27.09.2011 in Düsseldorf RWE AG Dr. Leonhard Birnbaum 27.9.2011 SEITE 1 Der Strommarkt im Wandel Strommarkt gestern Strommarkt heute
Entwurf. 1. Hauptstück Allgemeine Bestimmungen
 1 von 12 Entwurf Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über statistische Erhebungen für den Bereich der Elektrizitätswirtschaft (Elektrizitätsstatistikverordnung 2015)
1 von 12 Entwurf Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über statistische Erhebungen für den Bereich der Elektrizitätswirtschaft (Elektrizitätsstatistikverordnung 2015)
Stromperspektiven Schweiz: Welche Optionen haben wir?
 Stromperspektiven Schweiz: Welche Optionen haben wir? 8. Ökologietagung VZK / H+ Olten, 8. September 2009 Niklaus Zepf Leiter Corporate Development 02.09.2009 / Seite 1 Problem 1: Die Stromlücke kommt
Stromperspektiven Schweiz: Welche Optionen haben wir? 8. Ökologietagung VZK / H+ Olten, 8. September 2009 Niklaus Zepf Leiter Corporate Development 02.09.2009 / Seite 1 Problem 1: Die Stromlücke kommt
Versorgerwechsel in den österreichischen Elektrizitäts- und Gasmärkten. Untersuchungszeitraum Oktober 2003 bis September 2004
 Versorgerwechsel in den österreichischen Elektrizitäts- und Gasmärkten Untersuchungszeitraum Oktober 2003 bis September 2004 Hans Nischkauer (hans.nischkauer@e-control.at) Franz Schörg (franz.schoerg@e-control.at)
Versorgerwechsel in den österreichischen Elektrizitäts- und Gasmärkten Untersuchungszeitraum Oktober 2003 bis September 2004 Hans Nischkauer (hans.nischkauer@e-control.at) Franz Schörg (franz.schoerg@e-control.at)
Beteiligung der Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung. und Unternehmensgröße
 Beteiligung der Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung und Unternehmensgröße Befunde auf der Grundlage von CVTS3 Friederike Behringer, Gudrun Schönfeld Bonn, Februar 2011 1 Vorbemerkung Im Folgenden
Beteiligung der Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung und Unternehmensgröße Befunde auf der Grundlage von CVTS3 Friederike Behringer, Gudrun Schönfeld Bonn, Februar 2011 1 Vorbemerkung Im Folgenden
Gutachten laut Ökostromgesetz 2012 42 (4)
 Gutachten laut Ökostromgesetz 2012 42 (4) zur Bestimmung der Aliquoten Ausgleichsenergie-, Verwaltungs- und Technologieförderungsaufwendungen der Ökostromförderung für das Jahr 2016 auf Basis der Aufwendungen
Gutachten laut Ökostromgesetz 2012 42 (4) zur Bestimmung der Aliquoten Ausgleichsenergie-, Verwaltungs- und Technologieförderungsaufwendungen der Ökostromförderung für das Jahr 2016 auf Basis der Aufwendungen
Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer)
 Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) Die Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) ist eine spezielle Steuernummer, die der Identifikation gegenüber anderen Unternehmen dient. Die UID-Nummer
Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) Die Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) ist eine spezielle Steuernummer, die der Identifikation gegenüber anderen Unternehmen dient. Die UID-Nummer
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE
 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE Stromproduktion aus lar- und Windenergie im Jahr 2011 Prof. Dr. Bruno Burger aunhofer-institut für lare Energiesysteme ISE eiburg, den 30.08.2012 www.ise.fraunhofer.de
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE Stromproduktion aus lar- und Windenergie im Jahr 2011 Prof. Dr. Bruno Burger aunhofer-institut für lare Energiesysteme ISE eiburg, den 30.08.2012 www.ise.fraunhofer.de
BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
 1 von 5 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2006 Ausgegeben am 24. Oktober 2006 Teil II 401. Verordnung: Ökostromverordnung 2006 401. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und
1 von 5 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2006 Ausgegeben am 24. Oktober 2006 Teil II 401. Verordnung: Ökostromverordnung 2006 401. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und
Energie- und CO 2 -Bilanz für den Kreis Herzogtum Lauenburg
 Energie- und CO 2 -Bilanz für den Kreis Herzogtum Lauenburg Mit Hilfe der Software ECORegion smart der Firma Ecospeed wurde auf der Grundlage kreisspezifischer Daten sowie in der Software integrierter
Energie- und CO 2 -Bilanz für den Kreis Herzogtum Lauenburg Mit Hilfe der Software ECORegion smart der Firma Ecospeed wurde auf der Grundlage kreisspezifischer Daten sowie in der Software integrierter
Fossile Rohstoffe der Chemischen Industrie Eine Herausforderung für den Standort NRW
 Fossile Rohstoffe der Chemischen Industrie Eine Herausforderung für den Standort NRW Enquetekommission zur Zukunft der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen Stellungnahme zur Anhörung am 20.September
Fossile Rohstoffe der Chemischen Industrie Eine Herausforderung für den Standort NRW Enquetekommission zur Zukunft der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen Stellungnahme zur Anhörung am 20.September
Ökostrom Gesetzesnovelle 2006 Finanzierungsvolumen und Aufbringungsmechanismus
 Ökostrom Gesetzesnovelle 2006 Finanzierungsvolumen und Aufbringungsmechanismus Forst-Platte-Papier, 22. Juni 2006 Ökostrom Novelle FPP 2006-06-22 1 Eckpunkte der Ökostromgesetzes-Novelle Anhebung des Sonstigen
Ökostrom Gesetzesnovelle 2006 Finanzierungsvolumen und Aufbringungsmechanismus Forst-Platte-Papier, 22. Juni 2006 Ökostrom Novelle FPP 2006-06-22 1 Eckpunkte der Ökostromgesetzes-Novelle Anhebung des Sonstigen
Energierohstoffe. Themen. Globale Bedeutung Situation Schweiz Gesamtressourcen Uran Wasserkraft Geothermie. Rohstoffe der Erde.
 Energierohstoffe Rohstoffe der Erde Werner Leu 4. Nov. 2009 Rohstoffe der Erde ( 651-3505-00L) - Energierohstoffe 1 Themen Rohstofftypen Globale Bedeutung Situation Schweiz Gesamtressourcen Uran Wasserkraft
Energierohstoffe Rohstoffe der Erde Werner Leu 4. Nov. 2009 Rohstoffe der Erde ( 651-3505-00L) - Energierohstoffe 1 Themen Rohstofftypen Globale Bedeutung Situation Schweiz Gesamtressourcen Uran Wasserkraft
Alu-Kongress 2011. Geht uns der Strom aus? Anton Bucher, Public Affairs
 Alu-Kongress 2011 Geht uns der Strom aus? Anton Bucher, Public Affairs Geht uns der Strom aus? Schweizer Stromverbrauch mit oder ohne Kernenergie Optimaler Schweizer Produktionsmix Vor Fukushima ist nach
Alu-Kongress 2011 Geht uns der Strom aus? Anton Bucher, Public Affairs Geht uns der Strom aus? Schweizer Stromverbrauch mit oder ohne Kernenergie Optimaler Schweizer Produktionsmix Vor Fukushima ist nach
DIE RICHTUNG VORGEBEN. WO IMMER NACHHALTIGE ENERGIE GEFRAGT IST.
 ÖKOSTROMBERICHT 2014 DIE RICHTUNG VORGEBEN. WO IMMER NACHHALTIGE ENERGIE GEFRAGT IST. PROFITIEREN. WO IMMER SIE ENERGIE BRAUCHEN. INHALT Vorwort 6 Zusammenfassung 7 Gesetzliche Grundlagen in Österreich
ÖKOSTROMBERICHT 2014 DIE RICHTUNG VORGEBEN. WO IMMER NACHHALTIGE ENERGIE GEFRAGT IST. PROFITIEREN. WO IMMER SIE ENERGIE BRAUCHEN. INHALT Vorwort 6 Zusammenfassung 7 Gesetzliche Grundlagen in Österreich
DIDAKTIK FINANZ THEMENBLÄTTER WIRTSCHAFT & FINANZEN DIDAKTIK. Die Bedeutung des Euro für Wirtschaft und Bevölkerung INITIATIVE WISSEN
 OESTERREICHISCHE NATIONALBANK EUROSYSTEM INITIATIVE THEMENBLÄTTER WIRTSCHAFT & EN DIDAKTIK Nr. 1 B DIDAKTIK Aufgaben: 1. Markieren Sie in der folgenden Abbildung jene Länder, in denen der Euro Bargeld
OESTERREICHISCHE NATIONALBANK EUROSYSTEM INITIATIVE THEMENBLÄTTER WIRTSCHAFT & EN DIDAKTIK Nr. 1 B DIDAKTIK Aufgaben: 1. Markieren Sie in der folgenden Abbildung jene Länder, in denen der Euro Bargeld
Energieverbrauch in Deutschland
 Energieverbrauch in Deutschland Daten für das 1.- 3. Quartal 2015 Inhalt 1.1. Primärenergieverbrauch (PEV) 1.2. Bruttoinlandsprodukt und Produktionsindizes 1.3. Temperaturverlauf 1.4. Gradtage 1.5. Windstärke
Energieverbrauch in Deutschland Daten für das 1.- 3. Quartal 2015 Inhalt 1.1. Primärenergieverbrauch (PEV) 1.2. Bruttoinlandsprodukt und Produktionsindizes 1.3. Temperaturverlauf 1.4. Gradtage 1.5. Windstärke
Berlin und wie die Stadt mit Energie versorgt wird
 Berlin und wie die Stadt mit Energie versorgt wird Begleitender Vortrag zum Energietisch & Kraftwerksbesuch Denis Sabin Inhalt Die Erzeugung Das Netz Der Verbrauch Potentiale Fazit Die Erzeugung Aus welchen
Berlin und wie die Stadt mit Energie versorgt wird Begleitender Vortrag zum Energietisch & Kraftwerksbesuch Denis Sabin Inhalt Die Erzeugung Das Netz Der Verbrauch Potentiale Fazit Die Erzeugung Aus welchen
Indirekte Kosten der EEG-Förderung
 Indirekte Kosten der EEG-Förderung Prof. Dr. Georg Erdmann Energiesysteme, TU-Berlin [www.ensys.tu-berlin.de] IAEE-Präsident [www.iaee.org] Energiepolitischer Dialog der CDU/CSUBundestagsfraktion Berlin
Indirekte Kosten der EEG-Förderung Prof. Dr. Georg Erdmann Energiesysteme, TU-Berlin [www.ensys.tu-berlin.de] IAEE-Präsident [www.iaee.org] Energiepolitischer Dialog der CDU/CSUBundestagsfraktion Berlin
Stromsituation in der Schweiz
 Stromsituation in der Schweiz A. Strom-Tatsachen Begriffsklärung und Grundlagen B. Akteure 1. Stromproduktion 2. Stromtransport 3. Stromverbrauch Stromsituation in der Schweiz A. Strom-Tatsachen A. Strom-Tatsachen:
Stromsituation in der Schweiz A. Strom-Tatsachen Begriffsklärung und Grundlagen B. Akteure 1. Stromproduktion 2. Stromtransport 3. Stromverbrauch Stromsituation in der Schweiz A. Strom-Tatsachen A. Strom-Tatsachen:
Herzlich Willkommen zur Veranstaltung. Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Ihr Plus in Fellbach
 Herzlich Willkommen zur Veranstaltung Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Ihr Plus in Fellbach Vortrag im Rahmen der IVF Veranstaltung Energieeffizienz bei KMU am 09.07.2014 Eigner
Herzlich Willkommen zur Veranstaltung Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Ihr Plus in Fellbach Vortrag im Rahmen der IVF Veranstaltung Energieeffizienz bei KMU am 09.07.2014 Eigner
Gekoppeltes Energiesystemmodell für den Energieumstieg in Bayern
 Gekoppeltes Energiesystemmodell für den Energieumstieg in Bayern 13. Symposium Energieinnovation 14.2.2014 Marco Pruckner, Gaby Seifert, Matthias Luther, Reinhard German Informatik 7 Rechnernetze und Kommunikationssysteme
Gekoppeltes Energiesystemmodell für den Energieumstieg in Bayern 13. Symposium Energieinnovation 14.2.2014 Marco Pruckner, Gaby Seifert, Matthias Luther, Reinhard German Informatik 7 Rechnernetze und Kommunikationssysteme
KFW-RESEARCH. Akzente KFW-PROGRAMME: WICHTIGER BAUSTEIN ZUM AUSBAU ERNEUERBARER ENERGIEN
 KFW-RESEARCH Akzente KFW-PROGRAMME: WICHTIGER BAUSTEIN ZUM AUSBAU ERNEUERBARER ENERGIEN Nr. 35, Dezember 2010 Herausgeber KfW Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Telefon 069 7431-0
KFW-RESEARCH Akzente KFW-PROGRAMME: WICHTIGER BAUSTEIN ZUM AUSBAU ERNEUERBARER ENERGIEN Nr. 35, Dezember 2010 Herausgeber KfW Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Telefon 069 7431-0
Wege in eine nachhaltige Energieversorgung
 Enquete des Vorarlberger Landtages Gaskrise und zur Neige gehendes Öl: Wie kann sich Vorarlberg aus der Abhängigkeit befreien? Bregenz, 24. April 2009 Wege in eine nachhaltige Energieversorgung Dr. Adi
Enquete des Vorarlberger Landtages Gaskrise und zur Neige gehendes Öl: Wie kann sich Vorarlberg aus der Abhängigkeit befreien? Bregenz, 24. April 2009 Wege in eine nachhaltige Energieversorgung Dr. Adi
Kraft-Wärme-Kopplung: Schlu sseltechnologie fu r die Energiewende
 Kraft-Wärme-Kopplung: Schlu sseltechnologie fu r die Energiewende Freiburg, 16.11.2012 Dr. Jörg Lange & Martin Ufheil solaresbauen GmbH Emmy Noetherstr. 2 79110 Freiburg Tel.: 0761 / 45688-30 www.solares-bauen.de
Kraft-Wärme-Kopplung: Schlu sseltechnologie fu r die Energiewende Freiburg, 16.11.2012 Dr. Jörg Lange & Martin Ufheil solaresbauen GmbH Emmy Noetherstr. 2 79110 Freiburg Tel.: 0761 / 45688-30 www.solares-bauen.de
Maßnahmen zur Vermeidung von Umsatzsteuerbetrug und Evaluierung bestehender Strategien zur Minimierung der Umsatzsteuerlücke
 Deutscher Bundestag Drucksache 17/5751 17. Wahlperiode 05. 05. 2011 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Thomas Gambke, Britta Haßelmann, Lisa Paus, weiterer Abgeordneter
Deutscher Bundestag Drucksache 17/5751 17. Wahlperiode 05. 05. 2011 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Thomas Gambke, Britta Haßelmann, Lisa Paus, weiterer Abgeordneter
Gas in der europäischen Netzplanung. 6. EUM-Fachtagung Eva Klotz Prognos AG Flensburg, 01.04.2016
 Gas in der europäischen Netzplanung 6. EUM-Fachtagung Eva Klotz Prognos AG Flensburg, 01.04.2016 Agenda 01 Hintergrund und regulatorischer Rahmen 02 Einflüsse auf die Höhe des Gastransportbedarfs 03 Entwicklung
Gas in der europäischen Netzplanung 6. EUM-Fachtagung Eva Klotz Prognos AG Flensburg, 01.04.2016 Agenda 01 Hintergrund und regulatorischer Rahmen 02 Einflüsse auf die Höhe des Gastransportbedarfs 03 Entwicklung
Energie. Panorama. Vereinfachtes Energieflussdiagramm der Schweiz 2013. Rest Gas. Verluste. Rohwasserkraft. Rest Gas. Kernbrennstoffe.
 Energie Panorama Energiefluss Aus der Natur wird Energie in Form von Rohöl, Erdgas, Wasserkraft, Uran, Sonnenstrahlung, Wind usw. gewonnen. Bevor solche Primärenergie an den Endverbraucher geliefert wird,
Energie Panorama Energiefluss Aus der Natur wird Energie in Form von Rohöl, Erdgas, Wasserkraft, Uran, Sonnenstrahlung, Wind usw. gewonnen. Bevor solche Primärenergie an den Endverbraucher geliefert wird,
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2008
 Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr Grafiken und Tabellen unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien - Statistik (AGEE-Stat) Die Weiternutzung der
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr Grafiken und Tabellen unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien - Statistik (AGEE-Stat) Die Weiternutzung der
Versorgungssicherheit, Marktöffnung und Klimapolitik. Energie Apéro 19. Januar 2010 Dr. Beat Deuber, Leiter Handel BKW FMB Energie AG
 Versorgungssicherheit, Marktöffnung und Klimapolitik Energie Apéro 19. Januar 2010 Dr. Beat Deuber, Leiter Handel BKW FMB Energie AG Versorgungssicherheit? Versorgungssicherheit jederzeit, ununterbrochen
Versorgungssicherheit, Marktöffnung und Klimapolitik Energie Apéro 19. Januar 2010 Dr. Beat Deuber, Leiter Handel BKW FMB Energie AG Versorgungssicherheit? Versorgungssicherheit jederzeit, ununterbrochen
Wasserstoff Eine Option für die langfristige Speicherung von Windenergie. (Ergebnisse einer VDE-Studie)
 Wasserstoff Eine Option für die langfristige Speicherung von Windenergie (Ergebnisse einer VDE-Studie) Dr.-Ing. Martin Kleimaier Energietechnische Gesellschaft im VDE Task Force Energiespeicherung 1 VDE-Studie
Wasserstoff Eine Option für die langfristige Speicherung von Windenergie (Ergebnisse einer VDE-Studie) Dr.-Ing. Martin Kleimaier Energietechnische Gesellschaft im VDE Task Force Energiespeicherung 1 VDE-Studie
1 Einleitung und Motivation
 Perspektiven der österreichischen Stromversorgung im liberalisierten Strommarkt Reinhard Haas, Hans Auer Energy Economics Group Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft, TU Wien, Gusshausstrasse
Perspektiven der österreichischen Stromversorgung im liberalisierten Strommarkt Reinhard Haas, Hans Auer Energy Economics Group Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft, TU Wien, Gusshausstrasse
ÖWAV-Konferenz Speicher-/ Pumpspeicherkraftwerke Einbindung österreichischer Pumpspeicher in den europäischen Strommarkt: Das Netz als Flaschenhals?
 ÖWAV-Konferenz Speicher-/ Pumpspeicherkraftwerke Einbindung österreichischer Pumpspeicher in den europäischen Strommarkt: Das Netz als Flaschenhals? Dr. Jürgen Neubarth :: e3 consult :: Innsbruck, 24.
ÖWAV-Konferenz Speicher-/ Pumpspeicherkraftwerke Einbindung österreichischer Pumpspeicher in den europäischen Strommarkt: Das Netz als Flaschenhals? Dr. Jürgen Neubarth :: e3 consult :: Innsbruck, 24.
Windenergie & Solarthermie in Ägypten. Perspektiven der Erneuerbaren Energien In Ägypten - Fact Sheet
 Windenergie & Solarthermie in Ägypten Perspektiven der Erneuerbaren Energien In Ägypten - Fact Sheet Perspektiven der Erneuerbaren Energien in Ägypten Fact Sheet Jahr I. Ägypten s BIP Entwicklung ( * Prognose
Windenergie & Solarthermie in Ägypten Perspektiven der Erneuerbaren Energien In Ägypten - Fact Sheet Perspektiven der Erneuerbaren Energien in Ägypten Fact Sheet Jahr I. Ägypten s BIP Entwicklung ( * Prognose
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu
 Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Marktgemeinde Waal Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische
Energie- und CO 2 -Bilanz für die Kommunen im Landkreis Ostallgäu Gemeindeblatt für die Marktgemeinde Waal Die vorliegende Energie- und CO 2-Bilanz umfasst sämtliche Energiemengen, die für elektrische
Solarthermische Anlagen
 Solarthermische Anlagen Solarenergie in Deutschland Budapest, 26.11.2013 Dipl.-Ing (FH) Markus Metz Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, Landesverband Berlin Brandenburg e.v. 1. DGS LV Berlin Brandenburg
Solarthermische Anlagen Solarenergie in Deutschland Budapest, 26.11.2013 Dipl.-Ing (FH) Markus Metz Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, Landesverband Berlin Brandenburg e.v. 1. DGS LV Berlin Brandenburg
Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten
 Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Inhalt Oranger Einzahlungsschein (TA 826)... 2 Oranger Einzahlungsschein mit indirekt Begünstigter (TA 826)... 3 IPI/IBAN- Beleg (TA 836)... 4 Zahlungen an die Übrigen
Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Inhalt Oranger Einzahlungsschein (TA 826)... 2 Oranger Einzahlungsschein mit indirekt Begünstigter (TA 826)... 3 IPI/IBAN- Beleg (TA 836)... 4 Zahlungen an die Übrigen
