'LIIHUHQ]LHUWHV5DXPZDKUQHKPHQ LPSODVWLVFKHQ*HVWDOWXQJVSUR]HVV
|
|
|
- Frida Dressler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 %LUJLW(LJOVSHUJHU 'LIIHUHQ]LHUWHV5DXPZDKUQHKPHQ LPSODVWLVFKHQ*HVWDOWXQJVSUR]HVV (LQH8QWHUVXFKXQJ]XU$QZHQGXQJ GHV&RJQLWLYH$SSUHQWLFHVKLS$QVDW]HV EHLP0RGHOOLHUHQHLQHV6HOEVWSRUWUlWV +HUEHUW8W]9HUODJ:LVVHQVFKDIW 0 QFKHQ
2 'LH $UEHLW ZXUGH LP -DKU YRQ GHU 3KLORVRSKLVFKHQ )DNXOWlW,, ² 3lGDJRJLN XQG 3KLORVRSKLH ² GHU 8QLYHUVLWlW 5HJHQVEXUJ DOV 'LVVHUWDWLRQ DQJHQRPPHQ 'LH 'HXWVFKH %LEOLRWKHN ² &,3(LQKHLWVDXIQDKPH (LQ 7LWHOGDWHQVDW] I U GLHVH 3XEOLNDWLRQ LVW EHL 'HU 'HXWVFKHQ %LEOLRWKHN HUKlOWOLFK =XJOHLFK 'LVVHUWDWLRQ 5HJHQVEXUJ 8QLY ' 'LHVHV :HUN LVW XUKHEHUUHFKWOLFK JHVFK W]W 'LH GDGXUFK EHJU QGHWHQ 5HFKWH LQVEHVRQGHUH GLH GHU hehuvhw]xqj GHV 1DFKGUXFNV GHU (QWQDKPH YRQ $EELOGXQJHQ GHU :LHGHUJDEH DXI SKRWRPHFKDQLVFKHP RGHU lkqolfkhp :HJH XQG GHU 6SHLFKHUXQJ LQ 'DWHQYHUDUEHLWXQJV DQODJHQ EOHLEHQ ² DXFK EHL QXU DXV]XJVZHLVHU 9HUZHQ GXQJ ² YRUEHKDOWHQ &RS\ULJKW +HUEHUW 8W] 9HUODJ *PE+,6%1 3ULQWHG LQ *HUPDQ\ +HUEHUW 8W] 9HUODJ *PE+ 0 QFKHQ 7HO ² )D[
3 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung und Fragestellung... S Bedeutung differenzierten Raumwahrnehmens im bildnerischen Naturstudium... S Verwendung der Begriffe Natur, Wahrnehmung und Wirklichkeit... S Theorien über das Spannungsverhältnis zwischen Subjektivität und Objektivität beim bildnerischen Naturstudium... S Verwandlung der Natur am Beispiel von Wasserzeichnungen Leonardo da Vincis... S Konsequenzen für die Förderung differenzierten Raumwahrnehmens im plastischen Gestaltungsprozess... S. 29 Anmerkungen... S. 32 3Vorstudie: Expertenberichte über differenziertes Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess... S Fragestellung... S Theorien über den Ablauf eines Gestaltungsprozesses... S Selbstbeobachtung als Methode der Vorstudie... S Durchführung der Vorstudie und Ergebnisse der Expertenberichte: Selbstbeobachtung während des Gestaltungsprozesses eines Selbstporträts... S Gestaltabsicht... S Grobaufbau der Tonmasse... S Werkzeugeinsatz... S Gliederung der Tonmasse auf Basis anatomischer Grundkenntnisse über den menschlichen Schädel... S Anlage von Maßverhältnissen... S Volumenbildung der Gesichtsteile... S Die Augen... S Die Nase... S Der Mund... S Das Ohr... S. 52 7
4 Verlauf von Stirn, Wange, Kinn und Halsansatz... S Plastische Form der Haare... S Anlage des komplexen Formengefüges... S Zusammenfassung der Expertenberichte über differenziertes Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess... S. 59 Anmerkungen... S Theorien der Wahrnehmungspsychologie in Bezug zu künstlerisch- praktischen Aspekten differenzierten Raumwahrnehmens... S Fragestellung... S Elemente der Raumwahrnehmung in Bezug zu differenziertem Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess... S Überblick... S Binokulare Tiefenkriterien... S Okulomotorische Tiefenkriterien... S Disparität... S Bewertung... S Monokulare Tiefenkriterien... S Bewegungsparallaxen... S Abbildungsfaktoren... S Bewertung... S Modelle kognitiver Verarbeitung von Wahrnehmung in Bezug zu differenziertem Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess... S Gestalttheorie: Wahrnehmen in Ganzheiten... S Die Figur-Grund-Trennung... S Gestaltgesetze... S Objektwahrnehmung in Stufen... S Bewertung und Diskussion... S Ausweitung: Identifikation von Personenmerkmalen... S Eine Definition differenzierten Raumwahrnehmens unter wahrnehmungspsychologischen und künstlerischpraktischen Aspekten... S. 91 Anmerkungen... S. 94 8
5 5 Anlage der Untersuchung I über die Ausprägung der Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen... S Fragestellung... S Der exemplarische Fall: Modellieren eines Selbstporträts in Ton... S Diskussion über die Eignung des Motivs Selbstporträt für den Anfänger... S Bearbeitung von Ton beim Modellieren eines Porträts... S Untersuchungsablauf... S Stichprobenbeschreibung... S Einarbeitung der Probanden durch Vorübungen... S Hypothesen... S Erhebungsinstrumente... S Auswahl und Begründung... S Selbstbeobachtung im Arbeitsprozess... S Ratingskala als Erhebungsinstrument zur Einschätzung des Tonmodells... S. 114 Anmerkungen... S Untersuchung I: Durchführung, Ergebnisse und Diskussion... S Durchführung der Untersuchung und Ergebnisse der Selbstbeobachtung... S Beschreibung der Gestaltungsprozesse mittels Aussagen der Selbstbeobachtung... S Zusammenfassung... S Ergebnisse der Experteneinschätzung über den Differenziertheitsgrad der Tonmodelle bezüglich der Annäherung an das Naturvorbild... S Ergebnisse der Experteneinschätzung... S Experten- und Selbsteinschätzung im Vergleich... S Einschätzung einzelner Gesichtspartien in Bezug zu Aussagen der Selbstbeobachtung... S Zusammenfassung... S Diskussion... S
6 6.4 Exkurs: Einschätzung des Ausdrucks... S. 141 Anmerkungen... S Anlage der Untersuchung II über die Förderung der Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen durch die Anwendung der Lehr- und Lernmethoden des Cognitive-Apprenticeship-Ansatzes... S Fragestellung... S Differenziertes Raumwahrnehmen als Lehr- und Lernziel... S Allgemeine Aspekte des Lehrens und Lernens... S Der Cognitive-Apprenticeship-Ansatz als Rahmenmodells des Lehrens und Lernens im plastischen Gestalten... S Lehr- und Lernmodelle zwischen Instruktion und Konstruktion... S Der Cognitive-Apprenticeship-Ansatz... S Überblick... S Inhalt... S Methoden... S Sequenz... S Soziale Aspekte des Lehrens und Lernens... S Lehr- und Lernmethoden basierend auf dem Cognitive-Apprenticeship-Ansatz zur Förderung der Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen... S Untersuchungsablauf... S Hypothesen... S Erhebungungsinstrumente... S Übersicht zur Anlage der Untersuchungen I und II... S. 169 Anmerkungen... S
7 8 Untersuchung II: Durchführung, Ergebnisse und Diskussion... S Durchführung: Anwendung der Lehr- und Lernmethoden des Cognitive-Apprenticeship-Ansatzes zur Förderung der Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen... S Anwendungssituationen der Lehr- und Lernmethoden... S Lehr- und Lernmethode des Vormachens... S Beschreibung der Anwendungssituation... S Reaktion einer Lernenden... S Lehr- und Lernmethode Betreuung bei der Übungsaufgabe Ergänzung einer Kopfhälfte... S Lehr und Lernmethode Betreuung beim Gestalten der Augenpartie... S Lehr- und Lernmethode Betreuung beim Gestalten der Mund- und Nasenpartie... S Zusammenfassung und Bewertung... S Ergebnisse der Experteneinschätzung über den Differenziertheitsgrad der Tonmodelle bezüglich der Annäherung an das Naturvorbild... S Ergebnisse der Experteneinschätzung... S Gegenüberstellung der ersten und zweiten Einschätzung... S Die Experten- und Selbsteinschätzung im Vergleich... S Zusammenhang zwischen den Werten der Einschätzung und der Entwicklung differenzierten Raumwahrnehmens... S Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse... S Ausblick... S. 212 Anmerkungen... S Schlussbetrachtung... S. 215 Literaturverzeichnis... S. 219 Abbildungen... S. 231 Abbildungsverzeichnis... S. 301 Anlagen... S. 305 Ratingskalen... S. 306 Ergänzungsblatt zur Ratingskala... S. 309 Ergänzende Diagramme... S
8 12
9 1 Einführung und Fragestellung Die Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen im Ineinander von Produktion und Reflexion des plastischen Gestaltungsprozesses zu fördern, wird Ziel von Lehre und Lernen, wobei in der vorliegenden Arbeit die Hochschule und darin das Studienfach Kunsterziehung den Hintergrund kunstpädagogischer Überlegungen bildet. Ziel von Studium allgemein ist es, die Befähigung zu erwerben, auf einem Gebiet unter Einbeziehung wissenschaftlicher Kenntnisse, Befunde und Methoden zu arbeiten (Mandl et al. 1994, Gräsel 1997 b). Im Fach Kunsterziehung müssen sich die Studierenden wissenschaftlichen und künstlerischen Gebieten widmen. Es integriert aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen diejenigen Gebiete, die sich auf künstlerische und visuelle Phänomene, Prozesse und ihre Bedingungen beziehen (Endrejat 1978, Straßner 1978). Unter anderem sind als Bezugswissenschaften Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft, Soziologie, Pädagogik und verschiedene Teilgebiete der Psychologie, wie Kreativitätsforschung, Entwicklungspsychologie, Wahrnehmungspsychologie etc. zu nennen (Rindfleisch 1978, Kowalski 1978, Heinig 1981, 1982). In der vorliegenden Arbeit kommt der Wahrnehmungspsychologie große Bedeutung zu. Den Kern des Studiums der Kunsterziehung bildet die eigene praktischkünstlerische Tätigkeit. Im Ineinander von Produktion und Reflexion des bildnerischen Gestaltungsprozesses (Meyers 1973, Leber 1990) sollen Problembewusstsein und Urteilsvermögen erreicht und daraus fachdidaktische Konsequenzen, wie die überlegte Auswahl von Zielen, Inhalten und Methoden, gezogen werden. Das eigene praktisch-künstlerische Tun ist hier das Gestalten im Raum, genauer das plastische Gestalten. Der Begriff plastisches Gestalten umfasst in der Alltags- und Fachsprache bezüglich Technik und Thematik vielfältige Bedeutungen: die Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus Ton, das Modellieren von kleinen Objekten in Plastilin, den Bau von Masken aus Papiermaché, den Guss von kleinen Wachsfiguren, um nur einige Beispiele zu nennen. In der vorliegenden Arbeit meint plastisches Gestalten in technischer Hinsicht das Modellieren mit dem weichen, leicht verformbaren Material Ton und, bezogen auf den thematischen Aspekt, ein figürliches Gestalten im Raum im Sinne bildnerischen Naturstudiums. Der Begriff Natur, der je nach Spezialisierungen in Natur- und Geisteswissenschaften unterschiedlich definiert wird, umfasst im Zusammenhang mit bildnerischem Naturstudium die Gesamtheit der sichtbaren Gegenstandswelt. 13
10 Das visuelle Raumwahrnehmen der sichtbaren, dreidimensionalen Gegenstandswelt im bildnerischem Naturstudium bildet den Schwerpunkt in vorliegender Arbeit. Auf die enge Kooperation zwischen visueller und haptischer Wahrnehmung beim Erkennen der Welt wird, im Rahmen dieser Arbeit, an einigen Stellen verwiesen. Der Gestaltungsprozess ist ein intensives Wechselspiel aus differenziertem Wahrnehmen und Umsetzen im Material. Umsetzen ist hierbei eine zur Wahrnehmung der Naturgestalt gleichzeitige Suche nach bildnerischen Äquivalenten im plastischen Ton. Gestalten ist Ordnung schaffen, wobei es sich vom bloßen Produzieren unterscheidet, das auch chaotisch sein kann (Brodbeck 1995). Der Gestaltungsprozess geschieht hier im Gegenüber der Naturgestalt und erfährt durch den ständigen Vergleich mit ihr Kontrolle. Wenn Studierende der Kunsterziehung - Anfänger im figürlichen Gestalten aus Ton - die Gestaltungsaufgabe Modellieren eines Selbstporträts aus Ton bearbeiten, mit der Auflage, dass die Oberfläche des Tonmodells in seiner plastischen Ausprägung der Oberfläche des Naturvorbildes möglichst nahe kommen soll, zeigen sich - davon handelt Untersuchungsabschnitt I - darin bald Mängel in Form von auffallenden Abweichungen im Vergleich zum Naturvorbild. Es gelingt den Studierenden offensichtlich nicht, die eigene Wahrnehmungsfähigkeit im Wechselspiel aus Wahrnehmen und Umsetzen so zu differenzieren, dass sie dem Anspruch gerecht werden, sich in der plastischen Gestaltung an anatomische Richtigkeit und physiognomische Ähnlichkeit anzunähern. Einer handwerklichen Ungeübtheit ist so weit wie möglich entgegen gearbeitet worden, indem die Studierenden vorausgehend eine Einführung in die Eigenschaften des Materials, in Werktechniken und Werkzeuggebrauch erfahren und dazu Möglichkeiten zu Übungen erhalten haben. Um die Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen innerhalb einer Lehr- und Lernsituation fördern zu können, ist es notwendig, zwei Aspekte, einen fachlich-inhaltlichen und einen pädagogischen, zu diskutieren. Unter dem fachlich-inhaltlichen Aspekt interessiert die Frage, was differenziertes Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess ist, und unter dem pädagogischen, welche Ausprägung bzw. Schwächen Anfänger zeigen und welche Methoden geeignet sind, die Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen zu fördern. Daraus leiten sich folgende Fragen ab, die im Weiteren die Vorgehensweise strukturieren: 14
11 1) Was ist differenziertes Raumwahrnehmen? Genauer: Wie ist differenziertes Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess in Bezug zu Expertenberichten und wahrnehmungspsychologischen Theorien zu definieren? (Kapitel 2, 3 und 4) 2) Welche Ausprägung differenzierten Raumwahrnehmens ist bei Anfängern im plastischen Gestaltungsprozess festzustellen? (Kapitel 5 und 6) 3) Wie kann die Fähigkeit differenzierten Raumwahrnehmens im plastischen Gestaltungsprozess bei Anfängern gefördert werden? (Kapitel 7 und 8) Zu Frage 1: Was ist differenziertes Raumwahrnehmen? Genauer: Wie ist differenziertes Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess in Bezug zu Expertenberichten und wahrnehmungspsychologischen Theorien zu definieren? Im bildnerischen Naturstudium ist der Vergleich des eigenen bildnerischen Produktes mit der Natur ein Orientierungs- und Kontrollsystem, das eine Beliebigkeit der Formgebung optisch entlarvt. Ein Abbild - gleich dem Ergebnis einer Kopiermaschine - kann und soll keinesfalls Ziel des Gestaltungsprozesses sein. Schon eine dementsprechend objektive Wahrnehmung ist nicht möglich. Es gibt nur subjektiv geprägte Wahrnehmung, wobei das Individuum Freiheiten hat und nutzt, z.b. in der Auswahl des zu Beobachtenden, in der Schwerpunktsetzung und Steigerung bestimmter Merkmale. Der Spannungsbogen zwischen Objektivität und Subjektivität forderte Jahrhunderte lang bis heute die bildende Kunst heraus (Leber 1998). Will der Plastiker sich aber der Natur in einem hohen Grad an Objektivität annähern, ist es notwendig, zunächst die sichtbare Oberfläche des Naturgegenstandes zu erforschen. Dabei muss er differenzierter wahrnehmen als bei seiner alltäglichen Wahrnehmung, mit der er sich in der Welt sehr gut zurechtfindet. Was differenziertes Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess bedeutet, wird durch Expertenberichte eingegrenzt, die entstehen, wenn sich der Experte bzw. Künstler während des Entstehungsprozesses seines eigenen Selbstporträts selbst beobachtet. In Zusammenhang mit Theorien der Wahrnehmungspsychologie wird das Phänomen differenziertes Raumwahrnehmen im plastischen Gestaltungsprozess schließlich definiert. 15
12 Zu Frage 2: Welche Ausprägung differenzierten Raumwahrnehmens ist bei Anfängern im plastischen Gestaltungsprozess festzustellen? Studierende der Kunsterziehung bearbeiten in einer Felduntersuchung die Gestaltungsaufgabe Modellieren eines Selbstporträts, nachdem Sie sich durch diverse Vorübungen mit dem Material Ton, Werktechniken und Werkzeug vertraut gemacht haben. Bei der Ausführung der Aufgabe, wobei sie aufgefordert sind, während des Modellierens vor einer laufenden Kamera laut zu denken, erfahren Sie zunächst keine Unterstützung durch eine Lehrperson. Ziel der Untersuchung ist es, den Differenziertheitsgrad ihrer Tonmodelle (nach ca. sechs Arbeitsstunden) und damit verbunden die Ausprägung ihrer Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen festzustellen. Quantifizierbare Unterschiede zwischen Tonmodell und Naturvorbild werden anhand einer standardisierten Ratingskala eingeschätzt. Zusätzlich werden qualitative Daten in Form von konkreten Aussagen der Studierenden zu Schwierigkeiten im differenzierten Raumwahrnehmen eingeschätzt. Zu Frage 3: Wie kann die Fähigkeit differenzierten Raumwahrnehmens im plastischen Gestaltungsprozess bei Anfängern gefördert werden? Die Fähigkeit zu differenziertem Raumwahrnehmen im Ineinander von Produktion und Reflexion des plastischen Gestaltungsprozesses zu fördern, wird Ziel von Lehre und Lernen. Der Cognitive-Apprenticeship-Ansatz bietet dazu ein geeignetes pädagogisches Modell mit breitem Repertoire an Lehr- und Lernmethoden (Collins et al. 1989). Lernprozesse sollen darin den Erwerb von Faktenwissen, spezifischen Fertigkeiten, Denkmustern, Expertenkniffen, Überzeugungssystemen und ethischen Standards der entsprechenden Expertenkultur bewirken (Mandl et al. 1995). Die Lehr- und Lernmethoden dieses Ansatzes sind: modeling : Modell sein, Vormachen coaching : Trainieren, Betreuen, Einarbeiten scaffolding : Unterstützen, Versehen mit einem Gerüst fading : Schwinden, Verblassen, Sich-Zurückziehen articulation : Artikulation reflection : Betrachtung, Reflexion exploration : Erforschung 16
13 Bei den ersten vier Methoden handelt es sich um Aktivitätsformen zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden. Beim Vormachen ( modeling ) einer Arbeitssituation kommentiert der Lehrende sein Tun und externalisiert gewöhnlich intern ablaufende Prozesse. In den Phasen der Betreuung und Unterstützung ( coaching, scaffolding ) geht es um eine kooperative Problemlösung in interaktiven Dialogen zwischen Lehrendem und Lernendem, der sich nun selbst mit der Aufgabe beschäftigt. Absicht des Lehrenden muss dabei sein, sich nach und nach auszublenden und damit dem Lernenden Raum zu selbständigem Lernen und Tun zu geben ( fading ). Die Methoden Artikulation ( articulation ), Reflexion ( reflection ) und Exploration ( exploration ) sind als Verbalisierungsformen zu deuten, die in die oben genannten Aktivitätsbzw. Sozialformen involviert sind. Das eigene Tun und Denken zu artikulieren und reflektieren ist die Basis für erfolgreiche Beratungsgespräche innerhalb einer Lehr- und Lernsituation. Auch hier zeigt sich wie bei den ersten vier Methoden die größere Aktivität zunächst beim Lehrenden, die jedoch nach und nach verblassen soll ( fading ). Das Ausblenden des Lehrenden gibt schließlich eigenem Explorieren des Lernenden Raum. In einer zweiten Untersuchung, die an die vorausgehende anknüpft, werden die Lehr- und Lernmethoden des Cognitive-Apprenticeship-Ansatzes angewandt, während die Studierenden an ihrem Tonporträt weiterarbeiten. In der zweiten Einschätzung (nach weiteren 8-10 Arbeitsstunden) mittels derselben Ratingskala, die bereits im ersten Untersuchungsabschnitt eingesetzt wurde, soll zunächst der Fortschritt der Lernenden anhand der quantitativen Steigerung des Differenziertheitsgrads im Tonmodell bezüglich der Annäherung an die Natur gezeigt werden. Die Werte werden mit Aussagen der Studierenden über die Einschätzung ihres Lernfortschrittes in Zusammenhang gesehen und gedeutet. Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Betrachtung und weiterführenden Untersuchungsansätzen. 17
0DUWLQ)HOL[&ORVV 1XPHULFDO0RGHOOLQJDQG2SWLPLVDWLRQ RI5DGLR)UHTXHQF\,RQ7KUXVWHUV +HUEHUW8W]9HUODJ:LVVHQVFKDIW 0 QFKHQ
![0DUWLQ)HOL[&ORVV 1XPHULFDO0RGHOOLQJDQG2SWLPLVDWLRQ RI5DGLR)UHTXHQF\,RQ7KUXVWHUV +HUEHUW8W]9HUODJ:LVVHQVFKDIW 0 QFKHQ 0DUWLQ)HOL[&ORVV 1XPHULFDO0RGHOOLQJDQG2SWLPLVDWLRQ RI5DGLR)UHTXHQF\,RQ7KUXVWHUV +HUEHUW8W]9HUODJ:LVVHQVFKDIW 0 QFKHQ](/thumbs/49/25326828.jpg) 0DUWLQ)HOL[&ORVV 1XPHULFDO0RGHOOLQJDQG2SWLPLVDWLRQ RI5DGLR)UHTXHQF\,RQ7KUXVWHUV +HUEHUW8W]9HUODJ:LVVHQVFKDIW 0 QFKHQ 'LH'HXWVFKH%LEOLRWKHN²&,3(LQKHLWVDXIQDKPH (LQ7LWHOGDWHQVDW]I UGLHVH3XEOLNDWLRQLVW EHL'HU'HXWVFKHQ%LEOLRWKHNHUKlOWOLFK
0DUWLQ)HOL[&ORVV 1XPHULFDO0RGHOOLQJDQG2SWLPLVDWLRQ RI5DGLR)UHTXHQF\,RQ7KUXVWHUV +HUEHUW8W]9HUODJ:LVVHQVFKDIW 0 QFKHQ 'LH'HXWVFKH%LEOLRWKHN²&,3(LQKHLWVDXIQDKPH (LQ7LWHOGDWHQVDW]I UGLHVH3XEOLNDWLRQLVW EHL'HU'HXWVFKHQ%LEOLRWKHNHUKlOWOLFK
Vortrag im Rahmen des BUKO 13.2.2015, Mozarteum Salzburg. Wahrnehmen und Gestalten lehren
 Vortrag im Rahmen des BUKO 13.2.2015, Mozarteum Salzburg Wahrnehmen und Gestalten lehren , Hans Gruber Ls. Kunsterziehung, Ls. Pädagogik III Analyse und Förderung differenzierter Wahrnehmung beim plastischen
Vortrag im Rahmen des BUKO 13.2.2015, Mozarteum Salzburg Wahrnehmen und Gestalten lehren , Hans Gruber Ls. Kunsterziehung, Ls. Pädagogik III Analyse und Förderung differenzierter Wahrnehmung beim plastischen
Optische Täuschungen. physiologische, psychologische und physikalische Sicht
 Optische Täuschungen physiologische, psychologische und physikalische Sicht Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung der ersten Staatsprüfung für das Lehramt Gymnasium Universität Leipzig Fakultät für Physik
Optische Täuschungen physiologische, psychologische und physikalische Sicht Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung der ersten Staatsprüfung für das Lehramt Gymnasium Universität Leipzig Fakultät für Physik
Einführung zur Kurseinheit Interview
 Interview 3 Einführung zur Kurseinheit Interview Bitte lesen Sie diese Einführung sorgfältig durch! Der Kurs 03420 umfasst zwei Kurseinheiten: die vorliegende Kurseinheit zur Interview-Methode und eine
Interview 3 Einführung zur Kurseinheit Interview Bitte lesen Sie diese Einführung sorgfältig durch! Der Kurs 03420 umfasst zwei Kurseinheiten: die vorliegende Kurseinheit zur Interview-Methode und eine
Lernumgebungen und substanzielle Aufgaben im Mathematikunterricht (Workshop)
 Idee des Workshops Lernumgebungen und substanzielle Aufgaben im Mathematikunterricht (Workshop) Mathematik-Tagung Hamburg, 7. Mai 2010, Workshop Vorname Name Autor/-in ueli.hirt@phbern.ch Einen ergänzenden
Idee des Workshops Lernumgebungen und substanzielle Aufgaben im Mathematikunterricht (Workshop) Mathematik-Tagung Hamburg, 7. Mai 2010, Workshop Vorname Name Autor/-in ueli.hirt@phbern.ch Einen ergänzenden
Methoden des Offenen Unterrichts - Planung. Marie Felten, Patricia Häbe, Patricia Ruff
 Methoden des Offenen Unterrichts - Planung Marie Felten, Patricia Häbe, Patricia Ruff Gliederung 1 Aufgabe 2 Einführung in die Planung des Offenen Unterrichts 3 Die Planung des Offenen Unterrichts 4 Konkrete
Methoden des Offenen Unterrichts - Planung Marie Felten, Patricia Häbe, Patricia Ruff Gliederung 1 Aufgabe 2 Einführung in die Planung des Offenen Unterrichts 3 Die Planung des Offenen Unterrichts 4 Konkrete
Gültig ab Sommersemester Modulhandbuch. Bildende Kunst Campus Landau. Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien
 Gültig ab Sommersemester 2011 Modulhandbuch Bildende Kunst Campus Landau Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien Modul 13: Fachdidaktisches Arbeiten 120 4 3. - 4. Sem 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit
Gültig ab Sommersemester 2011 Modulhandbuch Bildende Kunst Campus Landau Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien Modul 13: Fachdidaktisches Arbeiten 120 4 3. - 4. Sem 1 Lehrveranstaltungen Kontaktzeit
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern
 Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Das Verfassen empirischer Abschlussarbeiten
 Das Verfassen empirischer Abschlussarbeiten Präsenzveranstaltung Anfertigen empirischer Magisterarbeiten Hagen, 17.-18.04.2009 LG Arbeits- und Organisationspsychologie Anforderungen an Abschlussarbeiten
Das Verfassen empirischer Abschlussarbeiten Präsenzveranstaltung Anfertigen empirischer Magisterarbeiten Hagen, 17.-18.04.2009 LG Arbeits- und Organisationspsychologie Anforderungen an Abschlussarbeiten
Problemlösendes Lernen im Physikunterricht
 Naturwissenschaft Martin Bruch Problemlösendes Lernen im Physikunterricht Aktuelle Lerntheorien, problemorientierter Unterricht und Besonderheiten der Physikdidaktik Examensarbeit Universität Konstanz
Naturwissenschaft Martin Bruch Problemlösendes Lernen im Physikunterricht Aktuelle Lerntheorien, problemorientierter Unterricht und Besonderheiten der Physikdidaktik Examensarbeit Universität Konstanz
Vereinbarungen zur Leistungsbewertung
 Fachgruppe: Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Klasse/Stufe: Kunst / Musik mögliche Formen der Bewertung sonstiger Mitarbeit: 5/6 Beiträge zum Unterrichtsgespräch Arbeitsmappe, Kunsthefter bzw. Notenheft
Fachgruppe: Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Klasse/Stufe: Kunst / Musik mögliche Formen der Bewertung sonstiger Mitarbeit: 5/6 Beiträge zum Unterrichtsgespräch Arbeitsmappe, Kunsthefter bzw. Notenheft
Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II. Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
 Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II Schleswig-Holstein. Der echte Norden. Themen der Präsentation Zur Struktur der Fachanforderungen Bildbegriff Arbeitsfelder Kompetenzbereiche Dimensionen Aufbau
Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II Schleswig-Holstein. Der echte Norden. Themen der Präsentation Zur Struktur der Fachanforderungen Bildbegriff Arbeitsfelder Kompetenzbereiche Dimensionen Aufbau
Anwendung verschiedener grafischer Materialien/Mittel: Ausführungsqualität der Skizzen,
 Fachdossier und Musterprüfung Bildnerisches Gestalten Anforderungen im Fachbereich Bildnerisches Gestalten für die Aufnahmeprüfung Niveau I an die Pädagogische Hochschule Zug Kompetenzen Die Studierenden
Fachdossier und Musterprüfung Bildnerisches Gestalten Anforderungen im Fachbereich Bildnerisches Gestalten für die Aufnahmeprüfung Niveau I an die Pädagogische Hochschule Zug Kompetenzen Die Studierenden
Grundlagen des Kunstunterrichts
 Klaus Eid / Michael Langer / Hakon Ruprecht Grundlagen des Kunstunterrichts Eine Einführung in die kunstdidaktische Theorie und Praxis 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2000 Ferdinand Schöningh
Klaus Eid / Michael Langer / Hakon Ruprecht Grundlagen des Kunstunterrichts Eine Einführung in die kunstdidaktische Theorie und Praxis 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2000 Ferdinand Schöningh
Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen
 Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Inhaltsverzeichnis. I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie
 Inhaltsverzeichnis Vorwort des Herausgebers 13 Einleitung 15 I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie I. KAPITEL. Der Entwkklungsdiarakter der klient-bezogenen Gesprädistherapie
Inhaltsverzeichnis Vorwort des Herausgebers 13 Einleitung 15 I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie I. KAPITEL. Der Entwkklungsdiarakter der klient-bezogenen Gesprädistherapie
EF/1 EF/2 Q1/1 Q1/2 Q2/1 Q2/2 Gk Anzahl Gk Stunden 1 2 2U 2U 3U 3Z Lk Anzahl Lk Stunden - - 3U 3U 4U 4,25Z
 Kriterien zur Leistungsbewertung Schriftliche Arbeiten Verteilung der Klausuren in den einzelnen Jahrgangsstufen U:= Unterrichtsstunden Z:= Zeitstunden EF/1 EF/2 Q1/1 Q1/2 Q2/1 Q2/2 Gk Anzahl 1 1 2 2 2
Kriterien zur Leistungsbewertung Schriftliche Arbeiten Verteilung der Klausuren in den einzelnen Jahrgangsstufen U:= Unterrichtsstunden Z:= Zeitstunden EF/1 EF/2 Q1/1 Q1/2 Q2/1 Q2/2 Gk Anzahl 1 1 2 2 2
Bildnerisches Gestalten
 Anzahl der Lektionen Bildungsziel Bildnerische Gestaltung ist Teil der Kultur. Sie visualisiert und verknüpft individuelle und gesellschaftliche Inhalte. Sie ist eine Form der Kommunikation und setzt sich
Anzahl der Lektionen Bildungsziel Bildnerische Gestaltung ist Teil der Kultur. Sie visualisiert und verknüpft individuelle und gesellschaftliche Inhalte. Sie ist eine Form der Kommunikation und setzt sich
Forum C Praxisnahes Lernen am dritten Lernort
 Forum C Praxisnahes Lernen am dritten Lernort Ines Bär Elke Kobbert Britt Kraske Veronika Malic Ann-Kathrin Reif Maria-Ines Stravino Bildungszentrum Robert-Bosch-Krankenhaus Bildungszentrum Robert-Bosch-Krankenhaus
Forum C Praxisnahes Lernen am dritten Lernort Ines Bär Elke Kobbert Britt Kraske Veronika Malic Ann-Kathrin Reif Maria-Ines Stravino Bildungszentrum Robert-Bosch-Krankenhaus Bildungszentrum Robert-Bosch-Krankenhaus
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
 Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Schulinternes idsb Curriculum im Fach Bildende Kunst auf der Basis der Thüringer Lehrpläne 2009
 Schulinternes idsb Curriculum im Fach Bildende Kunst auf der Basis der Thüringer Lehrpläne 2009 Fach: BildendeKunst Jahrgangsstufen: 7/8 Der Kunstunterricht der Jahrgangsstufen 7 und 8 gibt im wesentlichen
Schulinternes idsb Curriculum im Fach Bildende Kunst auf der Basis der Thüringer Lehrpläne 2009 Fach: BildendeKunst Jahrgangsstufen: 7/8 Der Kunstunterricht der Jahrgangsstufen 7 und 8 gibt im wesentlichen
Vorlesung Pädagogische Psychologie. Lernmotivation. Sommersemester Mo Uhr. Alexander Renkl
 Vorlesung Pädagogische Psychologie Lernmotivation Sommersemester 2011 Mo 16-18 Uhr Alexander Renkl Überblick 1 Begriffsbestimmung und Rahmenmodell 2 Personenmerkmale und Lernsituationsmerkmale 3 Aktuelle
Vorlesung Pädagogische Psychologie Lernmotivation Sommersemester 2011 Mo 16-18 Uhr Alexander Renkl Überblick 1 Begriffsbestimmung und Rahmenmodell 2 Personenmerkmale und Lernsituationsmerkmale 3 Aktuelle
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Inhalt. Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13
 Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13 1. Einleitung 15 1.1 Hauptschüler und ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit I 18 1.2 Leitende Thesen der Untersuchung
Inhalt Abkürzungsverzeichnis 11 Tabellen-und Abbildungsverzeichnis 13 1. Einleitung 15 1.1 Hauptschüler und ihre Vorstellungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit I 18 1.2 Leitende Thesen der Untersuchung
TEIL A GRUNDLAGENTHEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.. 9
 Inhaltsverzeichnis TEIL A GRUNDLAGENTHEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.. 9 I Einleitung... 9 1 Prolog Ausgangsüberlegungen... 9 1.1 Inhaltliche Vorüberlegungen... 9 1.2 Paradigmatische Vorüberlegungen... 14 2
Inhaltsverzeichnis TEIL A GRUNDLAGENTHEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.. 9 I Einleitung... 9 1 Prolog Ausgangsüberlegungen... 9 1.1 Inhaltliche Vorüberlegungen... 9 1.2 Paradigmatische Vorüberlegungen... 14 2
LEHRPLANÜBERSICHT: KUNSTERZIEHUNG, KLASSE 5-9 (STAND: NOVEMBER 2007)
 LEHRPLANÜBERSICHT: KUNSTERZIEHUNG, KLASSE 5-9 (STAND: NOVEMBER 2007) Regelschule Förderschule/Lernen Förderschule/Geistige Entwicklung Anmerkungen Klasse 5 Lernbereich Bildende Kunst Malerei/Farbe Farben
LEHRPLANÜBERSICHT: KUNSTERZIEHUNG, KLASSE 5-9 (STAND: NOVEMBER 2007) Regelschule Förderschule/Lernen Förderschule/Geistige Entwicklung Anmerkungen Klasse 5 Lernbereich Bildende Kunst Malerei/Farbe Farben
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen
 Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
Das Fach Philosophie/Ethik im Studiengang Lehramt an Gymnasien (nach GymPO)
 Das Fach /Ethik im Studiengang Lehramt an Gymnasien (nach GymPO) Mit der Entscheidung für den Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Universität Mannheim treffen Sie eine gute Wahl. Ein umfassendes Lehrangebot
Das Fach /Ethik im Studiengang Lehramt an Gymnasien (nach GymPO) Mit der Entscheidung für den Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Universität Mannheim treffen Sie eine gute Wahl. Ein umfassendes Lehrangebot
Fehlerkultur im Mathematikunterricht
 texte zur mathematischen forschung und lehre 39 Monika Schoy-Lutz Fehlerkultur im Mathematikunterricht Theoretische Grundlegung und evaluierte unterrichtspraktische Erprobung anhand der Unterrichtseinheit
texte zur mathematischen forschung und lehre 39 Monika Schoy-Lutz Fehlerkultur im Mathematikunterricht Theoretische Grundlegung und evaluierte unterrichtspraktische Erprobung anhand der Unterrichtseinheit
Methoden quantitativer Sozialforschung I - Datenerhebungsmethoden
 Methoden quantitativer Sozialforschung I - Datenerhebungsmethoden Einführung in die Thematik Ziele von empirischer Sozialforschung Empirische Sozialforschung bemüht sich darum, soziale Phänomene zu entdecken,
Methoden quantitativer Sozialforschung I - Datenerhebungsmethoden Einführung in die Thematik Ziele von empirischer Sozialforschung Empirische Sozialforschung bemüht sich darum, soziale Phänomene zu entdecken,
- VORLÄUFIG - STAND 01. Juni
 Fächerspezifische Bestimmung für das Unterrichtsfach Kunst zur Prüfungsordnung für den Lehramts-Bachelor-Studiengang für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen Universität Dortmund
Fächerspezifische Bestimmung für das Unterrichtsfach Kunst zur Prüfungsordnung für den Lehramts-Bachelor-Studiengang für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen Universität Dortmund
1 Einleitung Erster Teil: Theoretischer Hintergrund Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14
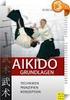 Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
- lernen mit Freude und Neugier.
 Schülerhandeln AKTIVES LERNEN Das Lernen der Schüler/innen steht im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Die Schüler/innen lernen mit Freude und Neugier. zeigen Interesse und Engagement beim Lernen bringen
Schülerhandeln AKTIVES LERNEN Das Lernen der Schüler/innen steht im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Die Schüler/innen lernen mit Freude und Neugier. zeigen Interesse und Engagement beim Lernen bringen
1./2. Semester. 1 Modulstruktur: Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ Leistungspunkte
 MA Modul 1: BK Praxissemester Fachdidaktik Sozialpädagogik Studiengänge: Master Lehramt an Berufskollegs 2 Semester 1./2. Semester 7 LP : 210 Std. 1 Vorbereitungsseminar Seminar 2 2 Begleitseminar Seminar
MA Modul 1: BK Praxissemester Fachdidaktik Sozialpädagogik Studiengänge: Master Lehramt an Berufskollegs 2 Semester 1./2. Semester 7 LP : 210 Std. 1 Vorbereitungsseminar Seminar 2 2 Begleitseminar Seminar
Innovationstransfer- und Forschungsinstitut für berufliche Aus- und Weiterbildung Schwerin. itf-tool 109
 toolbox Grevesmühlener Str.18 D-19057 Schwerin Telefon: ++49-385-4885-130 Fax: ++49-385-4885-129 E-Mail: kontakt@itf-schwerin.de Homepage: www.itf-schwerin.de Innovationstransfer- und Forschungsinstitut
toolbox Grevesmühlener Str.18 D-19057 Schwerin Telefon: ++49-385-4885-130 Fax: ++49-385-4885-129 E-Mail: kontakt@itf-schwerin.de Homepage: www.itf-schwerin.de Innovationstransfer- und Forschungsinstitut
Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung
 Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung Beim selbstorganisierten Lernen (SOL) sind neben Fachinhalten auch die sogenannt überfachlichen Kompetenzen wichtig, z.b. das Planen und Durchführen einer Arbeit,
Überfachliche Kompetenzen Selbsteinschätzung Beim selbstorganisierten Lernen (SOL) sind neben Fachinhalten auch die sogenannt überfachlichen Kompetenzen wichtig, z.b. das Planen und Durchführen einer Arbeit,
Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen
 Fortbildungsoffensive Fachtagung des Arbeitskreises Ausbildungsstätten für Altenpflege Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen Problemstellung Heterogene Lerngruppe Zentrale Standards "typische"
Fortbildungsoffensive Fachtagung des Arbeitskreises Ausbildungsstätten für Altenpflege Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen Problemstellung Heterogene Lerngruppe Zentrale Standards "typische"
Schreiben in Unterrichtswerken
 Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
12. Lehrplanauszug und Lehrplananalyse im Fach Kunsterziehung (Gymnasium) Lernbereich Thema Inhalte Hinweise Anmerkung
 12. Lehrplanauszug und Lehrplananalyse im Fach Kunsterziehung (Gymnasium) farbiges grafisches farbiges grafisches Bedeutung der Farbe in der Kunst Gegenstandsfarbe, Erscheinungsfarbe und Symbolfarbe Anwendung
12. Lehrplanauszug und Lehrplananalyse im Fach Kunsterziehung (Gymnasium) farbiges grafisches farbiges grafisches Bedeutung der Farbe in der Kunst Gegenstandsfarbe, Erscheinungsfarbe und Symbolfarbe Anwendung
Wissen sichtbar machen
 Wissen sichtbar machen Wissensmanagement mit Mapping- Techniken herausgegeben von Heinz Mandl und Frank Fischer Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis I Zur Einführung
Wissen sichtbar machen Wissensmanagement mit Mapping- Techniken herausgegeben von Heinz Mandl und Frank Fischer Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis I Zur Einführung
Lernfeld Kunst. Bildungsverlag EINS. Lernsituationen zur ästhetischen Bildung in sozialpädagogischen Berufen
 Andreas Cieslik-Eichert, Heike Dunker, Claus Jacke Lernfeld Kunst Lernsituationen zur ästhetischen Bildung in sozialpädagogischen Berufen I.Auflage Bestellnummer 04162 ULB Darmstadt r % l 17348957 Bildungsverlag
Andreas Cieslik-Eichert, Heike Dunker, Claus Jacke Lernfeld Kunst Lernsituationen zur ästhetischen Bildung in sozialpädagogischen Berufen I.Auflage Bestellnummer 04162 ULB Darmstadt r % l 17348957 Bildungsverlag
Einführung in die Wahrnehmungspsychologie Optische Täuschungen
 180268 SE Didaktik des Psychologieunterrichts - eine praxisorientierte Anwendung Susanne Sturm, Martina Hörwein Einführung in die Wahrnehmungspsychologie Optische Täuschungen Wahrnehmung beruht auf Empfindungen,
180268 SE Didaktik des Psychologieunterrichts - eine praxisorientierte Anwendung Susanne Sturm, Martina Hörwein Einführung in die Wahrnehmungspsychologie Optische Täuschungen Wahrnehmung beruht auf Empfindungen,
ERMUTIGUNG UND STÄRKUNG
 ERMUTIGUNG UND STÄRKUNG VON MENSCHEN MIT ERFAHRUNGEN VON SCHWÄCHE Ein narrativ-autobiographischer Ansatz in der Erwachsenenbildung Margherita Toma ZWEI SCHWACHE ZIELGRUPPEN Migrantinnen und Migranten oder
ERMUTIGUNG UND STÄRKUNG VON MENSCHEN MIT ERFAHRUNGEN VON SCHWÄCHE Ein narrativ-autobiographischer Ansatz in der Erwachsenenbildung Margherita Toma ZWEI SCHWACHE ZIELGRUPPEN Migrantinnen und Migranten oder
Bachelorarbeit Sport mit Schlaganfallpatienten: Ein neuer Ansatz - Der Gehweg von SpoMobil
 Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement
 Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft eingereicht an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft eingereicht an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Psychologie als Wissenschaft
 Fakultat fur Psychologic Ursula Kastner-Koller, Pia Deimann (Hg. Psychologie als Wissenschaft 2., aktualisierte Auflage facultas.wuv Vorwort 11 1 Einfiihrung in die Psychologie 13 1.1 Einleitung 13 1.2
Fakultat fur Psychologic Ursula Kastner-Koller, Pia Deimann (Hg. Psychologie als Wissenschaft 2., aktualisierte Auflage facultas.wuv Vorwort 11 1 Einfiihrung in die Psychologie 13 1.1 Einleitung 13 1.2
Der Forschungsprozess in der Quantitativen Sozialforschung. Crash-Kurs
 Der Forschungsprozess in der Quantitativen Sozialforschung Eine jede empirische Studie ist ein PROZESS. Definition: Unter PROZESS ist der Ablauf von Strukturen zu verstehen. Definition: Unter STRUKTUR
Der Forschungsprozess in der Quantitativen Sozialforschung Eine jede empirische Studie ist ein PROZESS. Definition: Unter PROZESS ist der Ablauf von Strukturen zu verstehen. Definition: Unter STRUKTUR
Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Picasso KUNST. LehrplanPLus Stand
 Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Picasso KUNST LehrplanPLus Stand 09.12.2013 Orientierung und Partizipation 2 Bilder verstehen, durch Bilder
Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Picasso KUNST LehrplanPLus Stand 09.12.2013 Orientierung und Partizipation 2 Bilder verstehen, durch Bilder
Software-Verifikation
 Hochschule Wismar Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Semesterarbeit (Arbeitsplan und Grobkonzeption) Software-Verifikation Fernstudiengang Master Wirtschaftsinformatik Modul: Formale Methoden Semester:
Hochschule Wismar Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Semesterarbeit (Arbeitsplan und Grobkonzeption) Software-Verifikation Fernstudiengang Master Wirtschaftsinformatik Modul: Formale Methoden Semester:
Arbeitsaufwand (workload) Moduldauer (laut Studienverlaufsplan) (laut Studienverlaufsplan)
 2. BA. Studiengang Erziehungswissenschaft - Beifach Modul 1: Einführung in die Erziehungswissenschaft 300 h 1 Semester 1./2. Semester 10 LP 1. Lehrveranstaltungen/Lehrformen Kontaktzeit Selbststudium VL:
2. BA. Studiengang Erziehungswissenschaft - Beifach Modul 1: Einführung in die Erziehungswissenschaft 300 h 1 Semester 1./2. Semester 10 LP 1. Lehrveranstaltungen/Lehrformen Kontaktzeit Selbststudium VL:
Marco Vannotti (Autor) Die Zusammenhänge zwischen Interessenkongruenz, beruflicher Selbstwirksamkeit und verwandten Konstrukten
 Marco Vannotti (Autor) Die Zusammenhänge zwischen Interessenkongruenz, beruflicher Selbstwirksamkeit und verwandten Konstrukten https://cuvillier.de/de/shop/publications/2438 Copyright: Cuvillier Verlag,
Marco Vannotti (Autor) Die Zusammenhänge zwischen Interessenkongruenz, beruflicher Selbstwirksamkeit und verwandten Konstrukten https://cuvillier.de/de/shop/publications/2438 Copyright: Cuvillier Verlag,
ECVET-konformes Curriculum der Logopädie
 ECVET-konformes Curriculum der Logopädie Entstanden im Projekt 2get1care Lebenslanges Lernen und Interprofessionalität in den Gesundheitsfachberufen (2011-2013) Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
ECVET-konformes Curriculum der Logopädie Entstanden im Projekt 2get1care Lebenslanges Lernen und Interprofessionalität in den Gesundheitsfachberufen (2011-2013) Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
Modul. Empirische Forschungsmethoden. Lehrveranstaltung 1: Empirische Sozialforschung und Alter. Studienbrief. (Lehrstuhl Renn Lehrstuhl Gabriel)
 Modul Empirische Forschungsmethoden Lehrveranstaltung 1: Empirische Sozialforschung und Alter Studienbrief (Lehrstuhl Renn Lehrstuhl Gabriel) Autoren: Jürgen Bauknecht 1 Lehrveranstaltung 1: Empirische
Modul Empirische Forschungsmethoden Lehrveranstaltung 1: Empirische Sozialforschung und Alter Studienbrief (Lehrstuhl Renn Lehrstuhl Gabriel) Autoren: Jürgen Bauknecht 1 Lehrveranstaltung 1: Empirische
Jörg Dieterich. Zur zentralen Frage einer wissenschaftlichen Pädagogik. Geisteswissenschaftliche und empirische Überlegungen
 Jörg Dieterich Zur zentralen Frage einer wissenschaftlichen Pädagogik Geisteswissenschaftliche und empirische Überlegungen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2007 Inhaltverzeichnis Einleitung/Abstract XIII Teil
Jörg Dieterich Zur zentralen Frage einer wissenschaftlichen Pädagogik Geisteswissenschaftliche und empirische Überlegungen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2007 Inhaltverzeichnis Einleitung/Abstract XIII Teil
Heilpädagogik: Entwicklung, Forschung, Leitung
 Heilpädagogik: Entwicklung, Forschung, Leitung Master of Arts berufsbegleitend Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alanus University of Arts and Social Sciences www.alanus.edu Heilpädagogik studieren
Heilpädagogik: Entwicklung, Forschung, Leitung Master of Arts berufsbegleitend Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alanus University of Arts and Social Sciences www.alanus.edu Heilpädagogik studieren
Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule
 Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule Sem BA-Modul A CP BA-Modul B CP BA-Modul C CP BA-Modul D BA-Modul E CP BA-Modul F CP MA-Modul A CP MA-Modul B C Modul D
Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule Sem BA-Modul A CP BA-Modul B CP BA-Modul C CP BA-Modul D BA-Modul E CP BA-Modul F CP MA-Modul A CP MA-Modul B C Modul D
Kulturelle und ästhetische Bildung in der frühen Kindheit Eine Investition für die Zukunft?
 Dr. phil. Vera Bamler, Technische Universität Dresden Kulturelle und ästhetische Bildung in der frühen Kindheit Eine Investition für die Zukunft? Ringvorlesung im Wintersemester 2009/10 1. Was ist eigentlich
Dr. phil. Vera Bamler, Technische Universität Dresden Kulturelle und ästhetische Bildung in der frühen Kindheit Eine Investition für die Zukunft? Ringvorlesung im Wintersemester 2009/10 1. Was ist eigentlich
1 Theoretische Grundlagen
 1 Theoretische Grundlagen In diesem ersten Kapitel wird das Konzept der Basalen Simulation definiert und übersichtlich dargestellt. Die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche werden prägnant beschrieben, und
1 Theoretische Grundlagen In diesem ersten Kapitel wird das Konzept der Basalen Simulation definiert und übersichtlich dargestellt. Die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche werden prägnant beschrieben, und
Beurteilungspraxis. N. Bussmann
 Beurteilungspraxis N. Bussmann Inhaltsverzeichnis: 1. Beurteilungen Seite 3 2. Kompetenzraster Orientieren und Referenzieren Seite 4 - Kompetenzraster Beispiel Seite 5 3. Selbsteinschätzung / Selbstbeurteilung
Beurteilungspraxis N. Bussmann Inhaltsverzeichnis: 1. Beurteilungen Seite 3 2. Kompetenzraster Orientieren und Referenzieren Seite 4 - Kompetenzraster Beispiel Seite 5 3. Selbsteinschätzung / Selbstbeurteilung
Studienordnung für das "vertieft studierte Fach" Kunsterziehung im Studiengang Höheres Lehramt an Gymnasien. Vom
 Technische Universität Dresden Philosophische Fakultät Studienordnung für das "vertieft studierte Fach" Kunsterziehung im Studiengang Höheres Lehramt an Gymnasien Vom 13.01.200 Auf Grund von 21 des Gesetzes
Technische Universität Dresden Philosophische Fakultät Studienordnung für das "vertieft studierte Fach" Kunsterziehung im Studiengang Höheres Lehramt an Gymnasien Vom 13.01.200 Auf Grund von 21 des Gesetzes
Das Praktikum im BA-Studiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Potsdam
 Das Praktikum im BA-Studiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Potsdam Der Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Potsdam ist darauf ausgerichtet, Studierende auf eine
Das Praktikum im BA-Studiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Potsdam Der Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Potsdam ist darauf ausgerichtet, Studierende auf eine
Die Lehrer- und Ausbilderrolle in der Berufsausbildung. Anmerkungen zur aktuellen Situation
 Obchodná Académia Bardejov und Ludwig-Erhard-Schule Fürth Seite 1 Baustein 1A: Der ganzheitliche Zugang zur Lehrerrolle Bewerten die Lehrer und Ausbilder die Berufsausbildung als eine wichtige Phase im
Obchodná Académia Bardejov und Ludwig-Erhard-Schule Fürth Seite 1 Baustein 1A: Der ganzheitliche Zugang zur Lehrerrolle Bewerten die Lehrer und Ausbilder die Berufsausbildung als eine wichtige Phase im
1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden?
 Leitfaden zur Lerndokumentation 1 Die Lerndokumentation 1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden? a. Zum Ersten dokumentieren die Lernenden während der beruflichen Grundbildung ihre Arbeit
Leitfaden zur Lerndokumentation 1 Die Lerndokumentation 1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden? a. Zum Ersten dokumentieren die Lernenden während der beruflichen Grundbildung ihre Arbeit
Legasthenie und Hirnfunktion
 Andreas Wariike Legasthenie und Hirnfunktion Neuropsychologische Befunde zur visuellen Informationsverarbeitung Technische Hochschule DarrnsiacJt Fachbereich 3 Institut für Psychologie} Steubenplatz 12,6100
Andreas Wariike Legasthenie und Hirnfunktion Neuropsychologische Befunde zur visuellen Informationsverarbeitung Technische Hochschule DarrnsiacJt Fachbereich 3 Institut für Psychologie} Steubenplatz 12,6100
Modulbezeichnung M1 - Grundlagen der Kunstgeschichte I: Malerei und Plastik. Semester Dauer Art ECTS-Punkte Studentische Arbeitsbelastung
 Modulkatalog Anbietende Hochschule Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Studiengang Bachelor of Arts (B.A.), Kunstgeschichte, Nebenfach Modulbezeichnung M1 - Grundlagen der Kunstgeschichte I: Malerei und
Modulkatalog Anbietende Hochschule Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Studiengang Bachelor of Arts (B.A.), Kunstgeschichte, Nebenfach Modulbezeichnung M1 - Grundlagen der Kunstgeschichte I: Malerei und
und folgenden Unterricht Kooperation Vorunterrichtliche Erfahrungen,
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Chemie in der Jahrgangsstufe 6 (Klassenunterricht) Holzkamp-Gesamtschule, Witten (aktualisiert 2/2013) Unterrichtseinheit / Thema: Stoffe im Alltag, Stoffe können gefährlich
Schulinterner Lehrplan für das Fach Chemie in der Jahrgangsstufe 6 (Klassenunterricht) Holzkamp-Gesamtschule, Witten (aktualisiert 2/2013) Unterrichtseinheit / Thema: Stoffe im Alltag, Stoffe können gefährlich
Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7
 Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Was ist ein Test? Grundlagen psychologisch- diagnostischer Verfahren. Rorschach-Test
 Was ist ein Test? Ein Test ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage
Was ist ein Test? Ein Test ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage
Lerntheorien im Überblick
 Prof. Dr. Gerd Kegel Institut für Psycholinguistik Programm PROFiL Vortrag im Rahmen des Didaktiklehrgangs der Anatomischen Gesellschaft Frauenchiemsee, 05. März 2001 Seite 1 Aufbau des Vortrags 1. Lerntheorien
Prof. Dr. Gerd Kegel Institut für Psycholinguistik Programm PROFiL Vortrag im Rahmen des Didaktiklehrgangs der Anatomischen Gesellschaft Frauenchiemsee, 05. März 2001 Seite 1 Aufbau des Vortrags 1. Lerntheorien
Reflexion: The missing link? Prof. Dr. Anne Sliwka. 03.07.2008. Prof. Dr. Anne Sliwka
 Reflexion: The missing link? sliwka@uni-trier.de Das Konzept des Service Learning Service Lernen Etwas für andere tun Sich selbst dabei entwickeln Reflexion im Prozess des Service Learning ist das Bindeglied
Reflexion: The missing link? sliwka@uni-trier.de Das Konzept des Service Learning Service Lernen Etwas für andere tun Sich selbst dabei entwickeln Reflexion im Prozess des Service Learning ist das Bindeglied
Individualisierung durch Lernaufgaben
 Individualisierung und neue Medien Individualisierung durch Lernaufgaben Lehren und Lernen mit digitalen Medien Dr. Hildegard Urban-Woldron Überblick Fallstudien zum Einsatz digitaler Medien im Physikunterricht
Individualisierung und neue Medien Individualisierung durch Lernaufgaben Lehren und Lernen mit digitalen Medien Dr. Hildegard Urban-Woldron Überblick Fallstudien zum Einsatz digitaler Medien im Physikunterricht
Inhaltsverzeichnis. Vorwort
 Vorwort V 1 Verhältnis der Sonderpädagogik zur Allgemeinen Pädagogik 1 Martin Sassenroth 1.1 Vorbemerkungen 1 1.2 Entstehungsgeschichte und Definitionen von Heil- und Sonderpädagogik 2 1.2.1 Sonderpädagogik
Vorwort V 1 Verhältnis der Sonderpädagogik zur Allgemeinen Pädagogik 1 Martin Sassenroth 1.1 Vorbemerkungen 1 1.2 Entstehungsgeschichte und Definitionen von Heil- und Sonderpädagogik 2 1.2.1 Sonderpädagogik
Einführung in die Kunstpädagogik
 Urban-Taschenbücher Bd 676 Einführung in die Kunstpädagogik Bearbeitet von Georg Peez, Jochen Kade, Werner Helsper, Christian Lüders, Frank Olaf Radtke, Werner Thole überarbeitet 2012. Taschenbuch. 208
Urban-Taschenbücher Bd 676 Einführung in die Kunstpädagogik Bearbeitet von Georg Peez, Jochen Kade, Werner Helsper, Christian Lüders, Frank Olaf Radtke, Werner Thole überarbeitet 2012. Taschenbuch. 208
KOMPIK Kompetenzen und Interessen von Kindern IFP-Projektgruppe KOMPIK Toni Mayr, Christina Bauer & Martin Krause
 KOMPIK Kompetenzen und Interessen von Kindern IFP-Projektgruppe KOMPIK Toni Mayr, Christina Bauer & Martin Krause Referent: Martin Krause München, 26. Juni 2013 1. Allgemeines zur Beobachtung Seite 2 Beobachtung
KOMPIK Kompetenzen und Interessen von Kindern IFP-Projektgruppe KOMPIK Toni Mayr, Christina Bauer & Martin Krause Referent: Martin Krause München, 26. Juni 2013 1. Allgemeines zur Beobachtung Seite 2 Beobachtung
Kindertagespflege in Bewegung
 LVR-Landesjugendamt Rheinland Kindertagespflege in Bewegung Professionelle Qualität Ein Zusammenspiel aller Beteiligten Vielfalt als Qualitätsmerkmal Inklusive Gedanken in der Kindertagespflege Elke Pfeiffer
LVR-Landesjugendamt Rheinland Kindertagespflege in Bewegung Professionelle Qualität Ein Zusammenspiel aller Beteiligten Vielfalt als Qualitätsmerkmal Inklusive Gedanken in der Kindertagespflege Elke Pfeiffer
Spezifisches Profil des Studiengangs Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung
 Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung im Bachelor-Studiengang der Universität Regensburg Präambel Gegenstand Das Studium der Bildenden Kunst und ästhetischen Erziehung an der Universität Regensburg
Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung im Bachelor-Studiengang der Universität Regensburg Präambel Gegenstand Das Studium der Bildenden Kunst und ästhetischen Erziehung an der Universität Regensburg
IB Medizinische Akademie Reichenau. Ergotherapeut (m/w)
 IB Medizinische Akademie Reichenau Ergotherapeut (m/w) Handlungsfähig bleiben. Aktiv werden! Mit direktem Einsatz am Mensch. Verfügen Sie über Einfühlungsvermögen? Möchten Sie Menschen in ihren Fähigkeiten
IB Medizinische Akademie Reichenau Ergotherapeut (m/w) Handlungsfähig bleiben. Aktiv werden! Mit direktem Einsatz am Mensch. Verfügen Sie über Einfühlungsvermögen? Möchten Sie Menschen in ihren Fähigkeiten
Lernplattformen in der Schule
 iwminst i tut für W issens med ien kmrc K now le dge Med i a Re s e a r c h Cen ter Expertenworkshop Lernplattformen in der Schule Tübingen 22. / 23. Juli 2004 Mediendidaktik Ein Lernmodul für die Aus-
iwminst i tut für W issens med ien kmrc K now le dge Med i a Re s e a r c h Cen ter Expertenworkshop Lernplattformen in der Schule Tübingen 22. / 23. Juli 2004 Mediendidaktik Ein Lernmodul für die Aus-
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Studiensemester. Leistungs -punkte 8 LP
 Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Kindliche Lernprozesse
 Kindliche Lernprozesse European New University Kerkrade (NL) / 1 Definition des Begriffs Bildung Bildung ist die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten
Kindliche Lernprozesse European New University Kerkrade (NL) / 1 Definition des Begriffs Bildung Bildung ist die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten
Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A Qualifikationsziele vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen
 Modulbeschreibungen M.A. Politikwissenschaft Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Politikwissenschaft, der Forschungsmethoden der
Modulbeschreibungen M.A. Politikwissenschaft Modul 1: Methoden der Politikwissenschaft A vertiefte Kenntnisse der wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Politikwissenschaft, der Forschungsmethoden der
Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Gymnasien
 5/35 Universität Leipzig Erziehungswissenschaftliche Fakultät Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Gymnasien Zweiter Teil: Bildungswissenschaften
5/35 Universität Leipzig Erziehungswissenschaftliche Fakultät Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Gymnasien Zweiter Teil: Bildungswissenschaften
Gültig ab Sommersemester Modulhandbuch. Bildende Kunst Campus Landau. Lehramtsbezogener Bachelorstudiengang
 Gültig ab Sommersemester 2011 Modulhandbuch Bildende Kunst Campus Landau Lehramtsbezogener Bachelorstudiengang Modul 1: Fachgrundlagen und Methoden der Kunstdidaktik und Kunstwissenschaft 270 9 1. 4. Sem.
Gültig ab Sommersemester 2011 Modulhandbuch Bildende Kunst Campus Landau Lehramtsbezogener Bachelorstudiengang Modul 1: Fachgrundlagen und Methoden der Kunstdidaktik und Kunstwissenschaft 270 9 1. 4. Sem.
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Politikwissenschaft und Forschungsmethoden 4 2 S P WS 1.
 Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
12Q A TRAUNER VERLAG. Betriebsräte zwischen neuen Funktionen und traditionellen Erwartungen ihrer Belegschaft
 TRAUNER VERLAG UNIVERSITÄT?-. REIHE B: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 12Q URSULA RAMI Betriebsräte zwischen neuen Funktionen und traditionellen Erwartungen ihrer Belegschaft Eine empirische Untersuchung
TRAUNER VERLAG UNIVERSITÄT?-. REIHE B: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 12Q URSULA RAMI Betriebsräte zwischen neuen Funktionen und traditionellen Erwartungen ihrer Belegschaft Eine empirische Untersuchung
Lernerautonomie und selbst gesteuertes fremdsprachliches Lernen
 Lernerautonomie und selbst gesteuertes fremdsprachliches Lernen Referat von Juliane Möller, Nadine Sappik, Manuela Lammel und Eileen Soulos Überblick 1. Definition des Gegenstandsbereichs 2. Entwicklung
Lernerautonomie und selbst gesteuertes fremdsprachliches Lernen Referat von Juliane Möller, Nadine Sappik, Manuela Lammel und Eileen Soulos Überblick 1. Definition des Gegenstandsbereichs 2. Entwicklung
Leistungsanforderung/kriterien Inhaltliche Ausführung Anmerkungen
 Transparente Leistungserwartung Physik Klasse 6-9 Beurteilungskriterien sollten den Lernenden vorgestellt werden. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass sie kontinuierlich beurteilt werden.
Transparente Leistungserwartung Physik Klasse 6-9 Beurteilungskriterien sollten den Lernenden vorgestellt werden. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass sie kontinuierlich beurteilt werden.
Unterrichtsentwurf. vorgelegt von Angela Funk. Thema der Unterrichtseinheit: Kartenverständnis. Thema der Stunde: Vom Modell zur Karte
 Unterrichtsentwurf vorgelegt von Angela Funk Thema der Unterrichtseinheit: Kartenverständnis Thema der Stunde: Vom Modell zur Karte 0. Individuelle Kompetenzentwicklung der Lehrenden Die LAA unterstützt
Unterrichtsentwurf vorgelegt von Angela Funk Thema der Unterrichtseinheit: Kartenverständnis Thema der Stunde: Vom Modell zur Karte 0. Individuelle Kompetenzentwicklung der Lehrenden Die LAA unterstützt
Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden und heilpädagogisch praktiziert
 8 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ingeborg Milz Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden
8 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ingeborg Milz Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden
Modulhandbuch für das Studienfach Kunstwissenschaft im Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang an der Universität Duisburg-Essen
 1 Modulhandbuch für das Studienfach Kunstwissenschaft im Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang an der Universität Duisburg-Essen Modulname Modulcode Modul 1: Grundlagen Modulverantwortliche/r Dr. Alma-Elisa Kittner
1 Modulhandbuch für das Studienfach Kunstwissenschaft im Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang an der Universität Duisburg-Essen Modulname Modulcode Modul 1: Grundlagen Modulverantwortliche/r Dr. Alma-Elisa Kittner
LehrplanPLUS Gymnasium Geschichte Klasse 6. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Kompetenzorientierung
 Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Welche Voraussetzungen sollten SuS für die Arbeit in einer PLG erfüllen? Woran kann man den Erfolg messen?
 Welche Voraussetzungen sollten SuS für die Arbeit in einer PLG erfüllen? Woran kann man den Erfolg messen? Referentin: Franziska Rufflet 1. Voraussetzungen Zielgruppenbeschreibung Voraussetzungen laut
Welche Voraussetzungen sollten SuS für die Arbeit in einer PLG erfüllen? Woran kann man den Erfolg messen? Referentin: Franziska Rufflet 1. Voraussetzungen Zielgruppenbeschreibung Voraussetzungen laut
Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester
 Schullehrplan Behindertenbetreuung 3-jährige Grundbildung Bereich: Betreuen und Begleiten Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester Alltagsgestaltung
Schullehrplan Behindertenbetreuung 3-jährige Grundbildung Bereich: Betreuen und Begleiten Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester Alltagsgestaltung
Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen
 Geisteswissenschaft Katharina Spohn Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen Examensarbeit Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung
Geisteswissenschaft Katharina Spohn Biografieforschung und arbeit mit ErzieherInnen Examensarbeit Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung
Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung
 Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung Name der Einrichtung Träger Name der Praxisanleitung Name des / der Studierenden Der vorliegende Entwurf
Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung Name der Einrichtung Träger Name der Praxisanleitung Name des / der Studierenden Der vorliegende Entwurf
Aufbau der Bachelorarbeit
 Aufbau der Bachelorarbeit Titelblatt Inhaltsverzeichnis incl. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Ehrenwörtliche Erklärung Zusammenfassung/ Abstract Einleitung it Hintergrund Methode Ergebnisse Diskussion
Aufbau der Bachelorarbeit Titelblatt Inhaltsverzeichnis incl. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Ehrenwörtliche Erklärung Zusammenfassung/ Abstract Einleitung it Hintergrund Methode Ergebnisse Diskussion
Konflikte in Organisationen
 Konflikte in Organisationen Formen, Funktionen und Bewältigung von Erika Regnet 2., überarbeitete Auflage Verlag für Angewandte Psychologie Göttingen Inhalt Einleitung 5 1. Was versteht man unter einem
Konflikte in Organisationen Formen, Funktionen und Bewältigung von Erika Regnet 2., überarbeitete Auflage Verlag für Angewandte Psychologie Göttingen Inhalt Einleitung 5 1. Was versteht man unter einem
Informationen zur Praxisaufgabe Interaktion mit Menschen mit Demenz gestalten und reflektieren
 Informationen zur Praxisaufgabe Interaktion mit Menschen mit Demenz gestalten und reflektieren Liebe Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, Ihre Auszubildenden haben sich in ihrem letzten Theorieblock
Informationen zur Praxisaufgabe Interaktion mit Menschen mit Demenz gestalten und reflektieren Liebe Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, Ihre Auszubildenden haben sich in ihrem letzten Theorieblock
