Geld Geldbegriffe Geldpolitik
|
|
|
- Volker Waltz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Geld Geldbegriffe Geldpolitik Ein Klärungsversuch Helmut Creutz Eine krisenfreie Wirtschaft, die uns Wohlstand und Tauschgerechtigkeit sichern kann, ist nur möglich, wenn wir auch die Irrtümer klären, die sich um die Begriffe aufgebaut haben, vor allem bezogen auf Bargeld und Giralgeld. [1] Was ist Geld? Geld ist zuerst einmal eine phantastische Erfindung, deren Genialität und Vielseitigkeit erst bei intensiverer Befassung deutlich wird. So hat das Geld z.b. den Tausch der Güter in einem ähnlichen Ausmaß erleichtert, wie die Erfindung des Rades deren Transport. Außerdem sind die Nutzungsmöglichkeiten des Geldes gleich mehrfacher Art: Es dient nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Recheneinheit, Wertmesser und Wertaufbewahrungsmittel, wobei jedoch diese dem Geld zugesprochene letzte Funktion bereits der ersten widerspricht, weil im Umfang seiner Aufbewahrung das Geld ja im Kreislauf der Wirtschaft fehlen muss. Das aber führt in der Praxis zu erheblichen Problemen! Denn da die Menge des Geldes, multipliziert mit seiner Einsatzhäufigkeit, dessen Wirksamkeit bestimmt und diese wiederum in einem möglichst gleich bleibenden Verhältnis zum Güterangebot in der Wirtschaft stehen muss, wird durch solche Wertaufbewahrungen und damit Umlauf-Unterbrechungen auch die Kaufkraftstabilität des Geldes gefährdet. Diese Unterbrechungen waren besonders in jenen Zeiten problematisch, in denen die Kaufkraft des Geldes aus seinem Materialwert resultierte, wie beim Gold- oder Silbergeld der Fall. Heute, in der Papiergeldzeit, ist dagegen ein Ersatz für die gehorteten Bestände leicht zu beschaffen. Die Kaufkraft des Geldes hängt jedoch nicht von seiner gedruckten Menge ab, sondern alleine von der Relation zwischen dessen 1 Reinhold Schulz, Menschenrecht oder Untergang Moorburg-Verlag, Hannover 1985 nachfrageaktiv eingesetzten Anteilen und dem Angebot zu kaufender Güter oder Leistungen auf dem Markt. Kurz: Unser heutiges Geld ist soviel wert, wie man dafür auf den Märkten erhält! Wenn wir heute also von Geld reden, kann dieser Begriff immer nur dieses staatlich herausgegeben Tauschmedium meinen. Die Bezeichnungen Termingeld, Spargeld oder Giralgeld stehen dagegen lediglich für Geldguthaben, also für Ansprüche auf Rückzahlungen von jenem Geld, das man Dritten normalerweise Banken auf Zeit überlassen hat. Und daran ändert auch der Tatbestand nichts, dass man, mit Hilfe der Girokonten oder Sichtguthaben, diese Forderungen auf Geldzurückzahlung, die man als Guthabenbesitzer an die Bank hat, an Dritte übertragen kann! Denn so oft dies auch geschehen mag: Die Geldmenge wird dadurch nicht beeinflusst, sondern nur deren Einsatzhäufigkeit. Die heute üblichen Additionen von Geld mit Geldguthaben als Geldmenge, wie z. B. bei der Addition von Bargeld und Sichteinlagen als Geldmenge M1, aus der man dann eine Vermehrung des Geldes ableitet, ist also unzutreffend und irreführend. Genau so unzutreffend und irreführend, wie eine Addition von Büchern mit ihren Ausleihungen als Büchermenge. Was ist Zentralbankgeld? Unter dem Begriff Zentralbankgeld (ZBG) werden heute nicht nur die von der EZB bzw. den nationalen Zentralbanken (ZBn) in den Umlauf gegebenen Banknoten verstanden, sondern auch jene gleichwertigen ZBG-Guthaben, die von den Banken bei der Zentralbank gehalten werden. Dabei stehen diese ZBG-Guthaben den Banken nicht nur für weitere Bargeldabhebungen zur Verfügung, sondern vor allem auch für sämtliche bankinternen Verrechnungen! Das heißt, alle Zahlungsabwicklungen zwischen den Banken (und damit auch unsere bargeldlosen Überweisungen!), werden letztlich immer über diese Zentralbankgeld-Reserven die heutigen Mindestreserven abgewickelt. Und wenn bei einer Kunden-Überweisung an eine andere Bank diese Unterlegung und Verrechnung mit ZBG bis zum Abend nicht stattgefunden hat, wird deren Annahme von der empfangenden Bank verweigert. Dabei ist es gleichgültig, ob dieser Ausgleich bei den einzelnen Überweisung jeweils direkt erfolgt oder am Tagesende in einem Sammelverfahren, dem interne Aus /2011
2 gleiche in Giroringen usw. vorausgegangen sind: Das Saldenergebnis am Tagesende ist immer das Gleiche! Diese Haltungen von ZBG-Reserven, die so genannten Mindestreserven (die ursprünglich einmal als Sicherheit für die Einlagen der Kunden gedacht waren), werden den Banken heute bekanntlich in Höhe von zwei Prozent der Kundeneinlagen vorgeschrieben, soweit deren Laufzeit unter zwei Jahren liegt. Von der Zentralbank mit den so genannten Leitzinsen belastet, werden diese Mindestreserven aber auch zur Beeinflussung der Geldmenge und vor allem des Zinsniveaus in der Wirtschaft genutzt. Allerdings werden den Banken die für diese Reserven gezahlten Zinsen seit Euro-Zeiten wieder zurückerstattet, damit sie gegenüber den Banken anderer Ländern nicht benachteiligt werden, in denen solche Pflichtreserven nicht üblich sind. Diese Mindestreserven, die heute von den Banken gehalten werden müssen, sind gleichzeitig die Grundlage jener als Geldmarkt bezeichneten Plattform, auf der die Banken untereinander ZBG ausleihen und sich also gegenseitig ZBG-Kredite gewähren können. In schwierigen Zeiten wie ab Ende 2007 als Folge des Finanzmarkt- und der anschließenden Bankenkrisen funktionierte dieser Ausgleich jedoch oft nur schleppend, weil die Banken aus Sicherheitsgründen alle ZBG-Guthaben-Überschüsse möglichst im eigenen Haus behalten wollten und teilweise sogar ihre Kreditvergaben ans Publikum reduzierten. Selbst die eingeräumten zusätzlichen Liquiditätsspritzen der EZB wurden weitgehend wieder als Sicherheiten geparkt, was durch extrem niedrige Leitzinsen erleichtert wurde. Was versteht man unter Geldpolitik? Zieht man das Glossar des Buches Geld und Geldpolitik der Bundesbank heran, dann umfasst die Geldpolitik...alle Maßnahmen die eine Zentralbank ergreift, um ihre Ziele vor allem Preisstabilität zu erreichen. Dazu setzt sie geldpolitische Instrumente ein, mit denen sie die Zinskonditionen und Knappheitsverhältnisse am Geldmarkt steuert. Geldpolitische Instrumente des Eurosystems sind Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und die Mindestreserve. Wie aus diesen Definitionen zu entnehmen, geht es vor allem auch bei den Veränderungen der Geldmenge und der Leitzinsen um das selbst gestellte Ziel der Preis- bzw. Kaufkraftstabilität, auch wenn man darunter heute eine Inflation von unter aber nahe zwei Prozent versteht. Diese irritierende Definition von Stabilität strebt man an, um das Abrutschen in eine Deflation zu vermeiden, in der die ZBn wie seit rund zwanzig Jahren z. B. in Japan der Fall die Fähigkeit zur Geldmengensteuerung verlieren. Statt also darüber nachzudenken wie man den Geldumlauf auch bei Nullinflation absichern könnte z. B. durch eine Gebühr auf Geld-Zurückhaltungen, lässt man sich lieber auf solche fragwürdigen Steuerungen über geringe Inflationen ein, die eine ständige Entwertung unseres Geldes zur Folge haben! Dieses heutigen etwas fragwürdigen Steuerungen und Ziel in der Geldpolitik werden in normalen Euro-Zeiten überwiegend durch ständig wiederholte Ausleihungen und Einzüge von Zentralbankgeld umgesetzt, orientiert an den jeweils festgelegten Leitzinsen. Dabei wird das Gros des ZB-Geldes den Banken normalerweise überwiegend nur für jeweils eine Woche ausgeliehen und der kleinere Teil etwa ein Drittel mit einer Laufzeit von drei Monaten. Bei jeder dieser sich also ständig wiederholenden Geldausgaben und -einzügen, können also sowohl die Ausleihe- Mengen als auch die Ausleihe-Zeiten und Zinskonditionen, in einer Art Feinsteuerung gegenüber den meist für längere Zeiten festgelegten Leitzinsen, wöchentlich verändert werden. Diese Geld-Einziehungen und -Neuausgaben werden dabei in einer Art von Versteigerung abgewickelt, bei der zum Beispiel die ZB die vorgesehene Ausgabemenge und einen Mindestzins vorgibt und die Banken ihre Bietungen für beides abgeben müssen. Aus den Ergebnissen dieser wöchentlichen Geld-Austausch-Geschäfte können die Zentralbanken wiederum Schlüsse für ihre weiteren Steuerungseingriffe ziehen, vor allem für evtl. Veränderungen der Leitzinsen. Wie oft und vor allem auch in welchem Umfang in den letzten zehn Jahren diese Leitzinsen im Bereich der EZB verändert wurden, zeigt die Darstellung 1. Dabei gibt die mittlere Kurve den Hauptrefinanzierungssatz wieder, der als der Leitzins bezeichnet wird und der im Allgemeinen über längere Zeiten für die Zuteilungen maßgebend ist. Die obere Kurve in der Grafik gibt dagegen jenen Zinssatz wieder, zu dem sich die Banken, über die ihnen zugeteilten Mengen hinaus, jederzeit weiteres Geld von der ZB leihen können. Diese freie 05/
3 Refinanzierungsmöglichkeit wird jedoch von den Banken, aufgrund des durchweg um ein Prozent höheren Zinssatzes, so gut wie nie in Anspruch genommen bzw. allenfalls im Notfall einmal über Nacht, wenn der abendliche Ausgleich zwischen den Banken bei einzelnen Instituten nicht mehr zustande kam. Denn im Grunde ist es immer so, dass einer Bank nur dann ZBG-Guthaben fehlen können, wenn eine andere Bank noch einen Überschuss hat, den diese dann wiederum zur Reduzierung ihrer Zinskosten bei der ZB als Einlage hinterlegt. Für diese Einlagen erhält die Bank entsprechend der dritten unteren Kurve in der Grafik dann einen Guthabenzins, der normalerweise um einen Prozentpunkt unter dem Leitzins liegt, zu dem das ZBG ausgeben worden ist. Seit 2009 liegt dieser Abstand jedoch um nicht die Null-Linie zu tangieren! nur noch bei 0,75% und damit der Guthabenzins bei 0,25%. Die schwedische Zentralbank hatte sogar diesen Guthabenzins 2008 zum ersten Mal ins Negative abgesenkt, womit die Banken bewegt wurden, ihre überschüssigen ZBG-Bestände entweder abzubauen oder weiter zu geben. praktisch nur noch über Geldauszahlungen an den Staat, dessen Verschuldung inzwischen eine Größe erreicht hat, die beim Drei- bis Vierfachen jener 60%-Schwelle liegt, die man bei uns in den Maastrichter Verträgen einmal als Obergrenze festgelegt hatte und die, in US-Dollar gemessen, inzwischen fast der Staatsverschuldung in den USA entspricht. Unterschiedliche Entwicklungen der Leitzinsen Dollar, Euro, Yen bis % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Quelle: Bundesbank-Monatsberichte u. Diverse Darstellung 2 Leitzinsen USA Leitzinsen Euro-Zone Leitzinsen Japan Helmut Creutz / Nr. 030 b Leitzinssätze der Europäischen Zentralbank Veränderungen 2000 bis % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Quelle: Bundesbank-Monatsberichte Darstellung 1 Spitzenrefinanzierungssatz Einlagesatz Helmut Creutz / Nr. 030 a In der Darstellung 2 werden dagegen die Leitzinsen im Euro-Raum einmal mit jenen in den USA und Japan verglichen. Erkennbar ist, dass die Veränderungen der Leitzinsen in den USA meist deutlicher als im Euro-Raum ausfallen und auch früher ein- und ausgeleitet werden. Die japanischen Leitzinsen dagegen, die weitgehend mit der Null-Linie in der Grafik zusammenfallen, sind typisch für ein Land, in dem die Zentralbank, aufgrund deflationärer Verhältnisse (in Japan seit rund zwanzig Jahren der Fall!) so gut wie keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten mehr auf den Geldmarkt und damit die Wirtschaft hat. Ihre einzige Möglichkeit der Markt- Beeinflussung besteht Das Problem der Geldmengensteuerung In den ersten Nachkriegs-Jahrzehnten wurden die Steuerungen der Geldmenge vor allem über Korrekturen der Mindestreservesätze vorgenommen. Mit Hilfe dieser Zwangsreserven, die ständig verändert und in der Spitze zeitweise bis auf 20% der Sichtguthaben angehoben wurden, hat man vor allem versucht, die zuviel herausgegebenen DM-Bestände wieder aus dem Umlauf herauszuziehen, jene DM-Milliarden, die man, zur Stützung des festgeschriebenen hohen Dollarkurses und zum Aufkauf der ins Land fließenden Dollar-Überschüsse, laufend in die Wirtschaft schleusen musste. Nach Aufhebung dieser Wechselkursbindung 1980 hat man dann jedoch diese ständigen Veränderungen der Mindestreservesätze aufgegeben und fast zehn Jahre lang ohne Veränderungen bei 8 bzw. 10% eingefroren, um sie dann, um das Jahr 1995, radikal auf jenen Satz von zwei Prozent abzusenken, der auch von der EZB bis heute übernommen wurde. Nach Aufgabe der ZBG-Mengensteuerung über ständige Korrekturen der Mindestreserven, hat man ab 1975 versucht, die angestrebte Entwicklung bzw. Erweiterung der ZBG-Menge im Herbst jeden Jahres im voraus bekannt zu geben, jeweils als Prozentgröße /2011
4 und bezogen auf die angenommene Entwicklung der Wirtschaftsleistung. Dies geschah in der Hoffnung, dass sich sowohl Wirtschaft und Staat mit ihren Investitionsentscheidungen an diesen Geldmengen- Vorgaben orientieren würden, als auch die Gewerkschaften mit ihren Lohnforderungen. Wie aus der Darstellung 3 zu entnehmen, hatte man dazu anfangs einen festen Satz von 8% vorgegeben, den man jedoch, wegen der abweichenden Ergebnisse, ab 1979 auf einen Korridor von zwei bis drei Prozent ausweitete. Da dies wie ersichtlich auch nicht allzu erfolgreich war, gab man diese direkte Steuerung der ZBG-Menge auf und orientierte sich bei den Zielvorgaben ab 1988 angeregt durch die Praxis in den angelsächsischen Notenbanken vor allem an den Entwicklungen der so genannten Geldmenge M3, also jener Größe, die sich aus der Addition der umlaufenden Bargeldmenge mit den gesamten Kundeneinlagen auf den Sicht- Spar- und Termingeldkonten bis zu zwei Jahren ergibt. Das heißt, man wählte als Haupt-Orientierungsgröße nun einen vielfach größeren Betrag als vorher mit der ZBG-Menge, die ja mit dem Bargeld und den Mindestreserven jene Größe umfasste, die auch von der Bundesbank direkt beeinflusst war. Geldmengensteuerung - Ziele und Ergebnisse bis 1987: Zentralbankgeldmenge (ZBGM) - ab 1988: M3 12% 10% 8% 6% 4% 2% Ergebnisse Zielvorgaben Darstellung 3 Wie aus der Darstellung 3 zu entnehmen, waren die Ergebnisse dieser Orientierungs-Umstellung auf M3 jedoch eher noch fragwürdiger als vorher! Selbst die Bundesbank klagte darüber einmal in ihrem Januar- Monatsbericht 1992: Der Versuch, die Geldmenge zu definieren, treibt akribische Experten an den Rand der Verzweiflung. Denn es gibt keine klare Trennungslinie im Kaleidoskop der Anlagen, die es ermöglichen würde, genau den Punkt festzulegen, an dem sich Geld von anderen Anlagen scheidet. was kein Wunder ist, könnte man anfügen. Denn jener Punkt, an dem sich Geld von anderen Anlagen scheidet, ist nicht irgendwo zwischen den Ersparnissen der Kunden zu finden, sondern ganz klar zwischen dem von der ZB herausgegebenen Geld und jenen Guthaben, die mit diesem Geld von den Bürgern nach Belieben ständig zunehmend gebildet und verändert werden können! Also jenen Größen, die gar kein Geld sind, sondern nur Ansprüche auf Rückgabe von Geld, das man anderen hier den Banken leihweise überlassen hat! Wie ebenfalls aus der Grafik ersichtlich, gab die Bundesbank ab 1989 diese Mengenprognosen und damit die Anlehnungen an M3 auf und beließ es bei einer Steuerung über die Leitzinsen, unter Zuhilfenahme anderer Orientierungshilfen aus dem Wirtschaftsbereich. Ähnliche Schwierigkeiten bei dieser Orientierung an der Geldmenge M3 hatte aber auch die US-Zentralbank, die Fed. Dies geht z. B. aus der Sitzung des Finanzausschusses des US-Parlaments vom 17. Februar 2006 hervor, in dem der langjährige und fast schon legendären US-Notenbankpräsident, Alan Greenspan, durch Senator Ron Paul befragt wurde. Seine offenen Antworten werden sicher für viele Leser ähnlich überraschend sein wie damals auch für die Abgeordneten: Wir haben seit Jahren Probleme damit, Stellvertreter für das Geld aufzuspüren. Und dabei legen wir den Maßstab an, ob es ein guter Vorausindikator für die Richtung der Finanzen und der Wirtschaft ist. Bedauerlicherweise war keiner von denen, die wir entwickeln konnten, dazu in der Lage... und konkreter werdend und bezogen auf seine Erfahrungen: Wir haben früher einmal M1 als Stellvertreter für Geld benutzt, und es erwies sich als ein sehr schwieriger Indikator für irgendwelche finanziellen Zustände. Dann nahmen wir M2 und hatten das ähnliche Problem. M3 haben wir per se niemals so benutzt, weil dies zum großen Teil die Ausweitung der Bankindustrie widerspiegelt. Und wenn Banken effektiv expandieren, sagt das an und für sich nicht schrecklich viel darüber aus, was das wirkliche Geld ist 05/
5 Mit diesem Eingeständnis bestätigte Greenspan also, dass es einen Unterschied zwischen dem wirklichen Geld und jenen Mischgrößen gibt, bei denen man dieses Geld mit den Ausweitungen der Bankindustrie zusammen fasst. Also jenen Ausweitungen, die in Wirklichkeit nur Guthaben-Ausweitungen der Bankkunden sind, die keiner Veränderung der Geldmenge bedürfen, sondern nur ihrer wiederholten Verwendung! Und als Konsequenz daraus führte Greenspan weiter aus: Unser Problem ist also nicht, dass wir nicht an gesundes Geld glauben. Das tun wir. Wir sind fest davon überzeugt, dass, wenn man eine minderwertige Währung hat, auch die Wirtschaft minderwertig wird. Die Schwierigkeit ist, zu definieren, welcher Teil unserer Liquiditätsstruktur wirklich Geld ist... und weiter: Das heißt nicht, dass wir denken, Geld sei unerheblich. Es bedeutet, dass unsere Maßstäbe für Geld unzureichend waren. Als Folge davon haben wir, wie ich vorhin dargelegt habe, die Verwendung monetärer Aggregate für geldpolitische Zwecke herabgestuft, bis wir in der Lage sind, einen stabileren Stellvertreter für das zu finden, was unserer Ansicht nach das der Wirtschaft zu Grunde liegende Geld ist Es ist also schwer, etwas zu managen, was man nicht definieren kann. Liest man diese Aussagen, dann kann man mit den Verantwortlichen in den Zentralbanken fast Mitleid haben. Denn die maßgebende richtige Geldmenge, die auch der entscheidende Maßstab im Wirtschaftsgeschehen ist, kann doch eigentlich nur jene sein, die von den Zentralbanken selbst in den Umlauf gegeben wird und zwar in einer Größe die dann richtig ist, wenn sie weder zu Inflationen noch zu Deflationen führt! Auf die darüber hinausgehenden Hilfs- und Orientierungsgrößen, deren Unzulänglichkeit so laut beklagt wird, greifen die Zentralbanken doch nur deshalb zurück, weil sie diese von ihnen selbst herausgegebene und entscheidende Geldmenge nicht im Griff haben! Zwar wissen sie ganz genau wie viele Scheine sie (durchnummeriert und gegen Fälschungen kompliziert gesichert!) in den Umlauf gegeben haben, aber sie wissen nie, wie viele davon ihrer Aufgabe als Zahlungs- und Nachfragemittel nachkommen und damit über das Preisverhältnis und somit über Inflation und Deflation entscheiden! Genau diese Unkenntnis der schwankenden Differenzen zwischen der ausgegebenen und der tatsächlich nachfrageaktiven Geldmenge aber ist der Grund dafür, dass die Zentralbanken so krampfhaft nach Stellvertretern zur Steuerung der Geldmenge suchen müssen und sich dabei sogar an Größen klammern, die gar kein Geld sind, sondern nur Ansprüche auf die Rückgabe von Geld, das die Bürger den Banken leihweise überlassen haben! Dabei würde sich diese richtige und damit den Preis bestimmende Geldmenge gewissermaßen von alleine ergeben, wenn man die herausgegebene Geldmenge mit der nachfrageaktiven in Übereinstimmung bringen und damit jenen Geldentzug aus der Wirtschaft vermeiden würde, der im Juni-Monatsbericht 2008 von der Deutschen Bundesbank mit zwei Dritteln(!) der ausgegebenen Bargeldmenge angegeben wurde! Und die Überwindung dieser problematischen und völlig überzogenen Geldhaltungen und -hortungen, die heute eine direkte Geldmengensteuerung verhindern, würde sich gewissermaßen von alleine ergeben, wenn man die Geldhaltungen und damit den Geldumlauf! mit Hilfe einer Umlaufsicherungsoder Geldhaltegebühr auf die tatsächlich erforderliche Menge zurückführen würde! Konsequenterweise hat vor wenigen Jahren die US- Zentralbank, die Fed, die Geldmenge M3 endgültig als Orientierungshilfe aus ihrem geldpolitischen Instrumentenkasten herausgenommen. Doch statt diese Maßnahme zu begrüßen, wurde Greenspan verschiedentlich der Unterschlagung wichtiger Zahlen und einer Manipulation der Geldmenge bezichtigt! Die überdimensionalen Unterschlagungen bzw. Hortungen der von den Notenbanken ausgegebenen Bargeldbestände jedoch, werden in der Wissenschaft bis heute kaum thematisiert und eher als ein Kuriosum betrachtet! Dabei hätte, bei einer Verstetigung des Geldumlaufs, auch sein Nachfolger im Amt, Ben Bernanke, keinen Anlass mehr zu solchen Stoßseufzern, wie man sie im Münchner Merkur vom 4./5. Februar 2006 einmal lesen konnte: Unterstellt, Geldpolitik machen wäre wie Autofahren, dann ist es ein Auto mit ungenauem Tacho, trüber Windschutzscheibe und einer Tendenz, der Steuerung nicht zu gehorchen /2011
6 Ähnlich hatte ich diese Gegebenheiten übrigens bereits 1993 in der Erstausgabe meines Buches Das Geld-Syndrom formuliert (Seite 413 der Ausgabe 2001): Die Bemühungen der Notenbanken zur Stabilisierung des Geldumlaufs und damit der Geldkaufkraft, ähneln dem Versuch eines Autofahrers, der seinen Wagen auf der Fahrbahnmitte halten möchte, aber wegen schlechter Sicht die Abweichungen erst bemerkt, wenn er mit den Rädern auf den Randstreifen geraten ist. Die langfristigen Entwicklungen der Zentralbankgeld-Menge Die langfristigen Entwicklungen in Tageswerten, mit denen umzugehen wir im Allgemeinen vertraut sind, lassen sich grafisch nur schwer umsetzen. So z. B. auf Grund der schwankenden inflationären Aufblähungen der Geldmenge, die den Wert der einstigen DM aus den Fünfziger Jahren inzwischen auf weniger als ein Zehntel vermindert haben dürften, aber auch auf Grund sprunghafter Veränderungen des Wirtschaftsraumes, wie z.b. bei der Einbeziehung des Saarlandes oder der ostdeutschen Länder, usw. Vermeiden kann man diese Probleme jedoch, wenn man, wie in der Darstellung 4 geschehen, die ZBG- Entwicklungen im Verhältnis zur jeweiligen nominellen Wirtschaftsleistung wiedergibt, also umgerechnet in Prozenten des Bruttoinlandprodukts, des BIP. Wie daraus zu ersehen, zeigt die Entwicklung der Zentralbankgeldmenge, schwankend etwa zwischen 9 bis 11% des BIP, über die Jahrzehnte hinweg eine weitgehende Übereinstimmung mit jener der Wirtschaft. Das ergibt sich auch aus den Milliardenwerten, die bei den Jahren 1950 und 2010 jeweils eingetragen sind: Demnach nahm die Zentralbankgeldmenge in den 60 Jahren von 5 auf 234 Mrd Euro und damit genau so auf das 47-fache zu, wie das BIP mit seinem Anstieg von rund 53 auf 2499 Milliarden Euro! Zentralbankgeld / Basisgeld - Entwicklung und Bestandteile Mrd in % d. BIP - im Vergleich mit ZBG-Krediten an die Banken Zentralbankgeld (Basisgeld) = Banknotenumlauf + ZBG-Guthaben der Banken (Mindestres.) 13% Ausweitung des Basisgeldes - zusätzliche ZBG-Liquidität 5 Mrd 270 Mrd 12% 11% 10% 9% 8% ZBG-Kredite an Banken 7% 3 Mrd 191 Mrd 6% 2 Mrd 43 Mrd 5% 4% 3% 2% 1% 0% Quelle Bundesbank: 40 Jahre Deutsche Mark, lfd. Monatsberichte Darstellung 4 Helmut Creutz / Nr. 130 e Wie zu erkennen, wurden die meisten Abweichungen der Zentralbankgeldmenge von der Durchschnittsgröße durch die laufenden Veränderungen der Mindestreserven ausgelöst, die im unteren Teil der ZBG- Menge noch einmal markiert sind: Ausgehend von einem Fünftel der ZBG-Menge wurden diese Mindestreserven bis in die 1970er Jahre bis auf deren Hälfte ausgeweitet, um dann, bis Mitte der 1990er Jahre, wieder auf ein Fünftel reduziert zu werden! Ursache dieser starken Schwankungen der Mindestreserve war die bereits erwähnte Flut von Dollar und deren Aufkäufe in den ersten drei Jahrzehnten. Aus dieser Zeit der hohen Export-Überschüsse stammen weitgehend auch die großen Dollar-Devisen-Reserven der Bundesbank und ebenso ihr Goldschatz dem zweitgrößten aller Notenbanken! Im Grunde handelt es sich bei beiden Größen um Werte, die aus den wechselkursbedingten Unterbezahlungen der deutschen Arbeit ähnlich resultierten, wie das heute in China beim Aufbau der dortigen riesigen Dollar-Reserven der Fall ist. Doch zurück zur Darstellung 4: Betrachtet man nun die gegenläufigen Veränderungen im oberen Teil der ZBG-Menge, die den Banknotenumlauf wiedergeben, dann ging dieser in den ersten zweieinhalb Jahrzehnten relativ zurück, um allerdings danach wieder langsam anzusteigen. Ersteres dürfte die Folge zunehmender bargeldlosen Zahlungsabwicklungen gewesen sein, während das Zweite eher Folge der wachsenden Liquiditätsvorlieben ist, die mit den Krisen und niedrigen Zinsen zwangsläufig zunehmen. Die deutlichen und aus dem Rahmen fallenden Reduzierungen der DM-Bargeldmenge nach dem Jahr 2000, hängen dagegen mit 05/
7 dem Abbau von Geldhaltungen bzw. -hortungen vor dem Währungs-Umtausch zusammen, die nach dem Umtausch in den Euro, bis etwa 2007, wieder ausgeglichen wurden. Der in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts ansetzende und punktiert eingetragene Ausreißer nach oben, gibt dagegen die Ausweitungen der ZBG-Menge im Zuge der Bankenkrise wieder, die jedoch weitgehend zur Risiko-Sicherung in den Reserven bei der Zentralbank gehalten wurden. Die zusätzlich eingetragene helle Kurve in der Darstellung 4 gibt dann noch einmal wieder, in welchem Umfang dieses ZBG jeweils über Kredite an die Banken in den Umlauf ausgegeben wurde, während der übrige Bestand normalerweise über Offenmarktgeschäfte in den Umlauf gekommen ist. Aus den wechselseitigen Überschneidungen zwischen dieser Kredit- und der Mindestreservenkurve geht auch noch einmal hervor, in welchem Maße die deutschen Banken zwischen 1960 und 1980 gezwungen waren, ihre Reserven mit dem eingezahlten Bargeld ihrer Kunden aufzufüllen und damit Geld aus dem Kreislauf herauszuziehen. In welchem Umfang die Veränderungen der Bargeldhaltungen mit Hortungen zusammen hängen, wird aus der Darstellung 5 ersichtlich: Während die kleineren Noten, im Zusammenhang mit der Währungsumstellung um 2001, nur geringfügig reduziert wurden, baute man die großen Noten (deren Zunahme schon nach dem Bekanntwerden des Geldumtauschs ab 1996 gestoppt wurde!) in kurzer Zeit auf ein Drittel ihres Bestandes ab. Erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts erreichten sie wieder den gestrichelt eingetragenen langfristigen Zunahmetrend. Zentralbankgeld im Vergleich mit Bankguthaben und Krediten Um einen solchen Vergleich grafisch überhaupt zu ermöglichen, wird in der Darstellung 6, die Entwicklung des ZBG aus der Darstellung 4, noch einmal stark verkleinert wiedergegeben. Darunter auch noch einmal jener Anteil des Zentralbankgeldes, der über Kreditvergaben an die Banken in den Umlauf kam. In der mittleren Grafik, ebenfalls in Prozenten des BIP, ist dann die so genannte Geldmenge M1 mit ihren Entwicklungen in den letzten sechs Jahrzehnten eingezeichnet, also jene Größe, die man aus dem umlaufenden Bargeld und den Sichtguthaben der Bankkunden zusammenzählt. Banknotenentwicklung in Deutschland / Aufgeteilt nach Stückelungsgruppen - Jahresendwerte Mrd DM 280 Umtausch DM in Euro: 2001/02 langfristiger Trend Mrd Zentralbankgeld, M1und Bankgeschäfte in D Größen in Prozent des BIP Entwicklungsvergleiche Eintragungen im Fünfjahresabstand ZBG = Zentralbankgeld / Basisgeld = Banknoten plus ZBG-Guthaben der Banken bei der Zentralbank (Mindestreserven) 243% Bankeinlagen der Nichtbanken 206% Bankkredite an Nichtbanken u.a. Aktiva u DM 200 u % % 48% M1= % Sichtguthabe n und 200 DM 50 und , 10, 20, 50 DM-Noten bzw. 5, 10, 5, und u Euro DM 5, 10 u Quelle: Bundesbank - Monats- bzw. Jahresberichte Helmut Creutz - Nr % 6% 10% ZBG 10% ZBG-Kredite an Banken Quelle: Bundesbank 40 Jahre Deutsche Mark, lfd. Monatsberichte Helmut Creutz / Nr. 130 Darstellung 6 Darstellung /2011
8 Auch diese Darstellung zeigt, dass dieses Gemisch aus Geld und Guthaben in den ersten dreieinhalb Jahrzehnten, gleich bleibend bei etwa 17 Prozent des BIP, ebenfalls mit der Wirtschaftsleistung zugenommen hatte, wobei die Ausweitungen der Sichtguthaben innerhalb dieser Bestandsgröße durch eine Abnahme des Bargeldes ausgeglichen wurde. Erst ab Mitte der 1980er Jahre kam es dann zu einem deutlichen Anstieg dieser Sichtguthaben, die bis 2010 auf rund das Viereinhalbfache der ZBG-Menge ausgeweitet wurden. Dieser übermäßige Anstieg der Sichtguthaben (über deren Umfang jeder einzelne Bankkunde selbst und sonst niemand entscheidet!) dürfte sowohl mit zunehmendem Liquiditätsbedarf im Zuge der wachsenden Börsengeschäfte und anderer Geldanlagen zusammenhängen, als auch mit den niedrigen Zinsen in den letzten zehn Jahren, die solche Liquiditätshaltungen weniger verlustreich machten. Die Grafik macht jedoch vor allem sichtbar, dass selbst diese übermäßige Ausweitung der Sichtguthaben in den letzten Jahrzehnten, gemessen an den Entwicklungen der gesamten Bankeinlagen und Kreditvergaben (auf deren Kosten die Sichtguthaben- Ausweitungen vorgenommen wurden!), noch relativ unbedeutend ist. Vor allem aber kann man den jeweils eingetragenen Prozentzahlen entnehmen, dass die gesamten Bankeinlagen und Kredite in den letzten 60 Jahren rund sieben Mal schneller angestiegen sind als das BIP eine Relation, die die Problematik jener langfristigen und zinsbedingten Überentwicklungen im monetären Raum deutlich macht! Der geringfügige Einbruch in der Anstiegskurve der gesamten Geldvermögen und Kredite um 1990/91, dürfte damit zusammenhängen, dass in der vormaligen DDR die Geldvermögen gemessen an der Wirtschaftsleistung! relativ geringer waren als im Westen. Umgekehrt nahmen die Sichtguthaben nach der Vereinigung sprunghaft zu, die vorher in den neuen Ländern weniger verbreitet waren. Die Konsequenz daraus: Für die häufig zu hörende Vermutung, dass sich die Banken das Geld für ihre Kredite bei der Zentralbank billig leihen können und dann mit hohen Zinsen weiter verleihen und auf diese Weise große Gewinne machen, gibt es also sowohl von den Zahlen als auch den Vorgängen her in der Realität keinen Platz. So lag z.b. im Raum der Deutschen Bundesbank die gesamte den Banken und der Wirtschaft zur Verfügung gestellte ZBG-Menge also die Summe von Banknoten und Mindestreserven Ende 2010 bei 276 Mrd, die Kreditvergaben der Banken an die Nichtbanken jedoch bei Mrd, also beim 13- bis 14-fachen der ZBG-Menge! Außerdem ist zu beachten, dass sich das Gros dieser ZBG-Menge in Form von Banknoten, im Werte von 203 Mrd, in den Händen der Wirtschaftsteilnehmer befand, während die ZBG-Guthaben der Banken in Höhe von 51 Mrd in den Mindestreserven der Banken gebunden waren. Bei den oft zu hörenden Vermutungen oder gar Behauptungen über das Zusammenwirken von Banken und Zentralbanken wird darüber hinaus außer Acht gelassen, dass abgesehen vom Bargeld die bei der ZB gehaltenen Guthaben gar nicht in den Wirtschaftsraum verlagert werden können! Ganz einfach deshalb nicht, weil ein Transfer von ZBG (abgesehen von den Bargeld-Abrufungen durch die Bankkunden!) genauso wenig in die Wirtschaft möglich ist wie umgekehrt ein Transfer von Giralgeld oder Bankengeld in die Zentralbank! Das gleiche gilt entsprechend auch für die Vorstellung, die Banken könnten aus der Differenz zwischen Leitzinsen und den von ihnen geforderten Kreditzinsen riesige Gewinne erwirtschaften. Auch dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte in den Statistiken. Es ist also dringend erforderlich, dass man in alle Theorie-Diskussionen rund ums Geld jeweils das statistische Zahlenmaterial mit einbezieht und damit die Realitäten! Zum Autor Helmut Creutz Jg. 1923, Architekt, Wirtschaftsanalytiker und Publizist. 1979/80 war er Mitbegründer der Alternativen Liste und der Grünen in Aachen und NRW. Seit 1980 befasst er sich mit den Zusammenhängen zwischen Geld und Gesellschaft, Währung und Wirtschaft. Umfangreiche Vortrags- und Seminartätigkeit, Veröffentlichtung von zahlreichen Büchern, Aufsätze und statistische Grafiken zum Thema. 05/
Europäische Zentralbank
 Europäische Zentralbank Ziele Instrumente Offenmarktgeschäfte Fazilitäten Mindestreserven Mandat Geldmengensteuerung expansiv & restriktiv Aktuelle ausgestaltung des Instrumentariums Ankaufprogramme Geldpolitische
Europäische Zentralbank Ziele Instrumente Offenmarktgeschäfte Fazilitäten Mindestreserven Mandat Geldmengensteuerung expansiv & restriktiv Aktuelle ausgestaltung des Instrumentariums Ankaufprogramme Geldpolitische
SOZIALÖKONOMIE. Aufstieg und Niedergang der Technokratie. Leitzinssenkungen und billige Notenbankkredite Sanierungsmöglichkeit für die Banken?
 Z f SÖ ZEITSCHRIFT FÜR ISSN 0721-0752 SOZIALÖKONOMIE Gerhard Senft Helmut Creutz Andreas Rams & Dirk Löhr 3 20 25 30 Aufstieg und Niedergang der Technokratie Leitzinssenkungen und billige Notenbankkredite
Z f SÖ ZEITSCHRIFT FÜR ISSN 0721-0752 SOZIALÖKONOMIE Gerhard Senft Helmut Creutz Andreas Rams & Dirk Löhr 3 20 25 30 Aufstieg und Niedergang der Technokratie Leitzinssenkungen und billige Notenbankkredite
Vorlesung Geld- und Währungstheorie und -politik. Dr. Joscha Beckmann
 Vorlesung Geld- und Währungstheorie und -politik Dr. Joscha Beckmann Gliederung Part I: Money and credit supply 1. Money and credit: definition, function, origin and aggregates 2. From gold to paper money:
Vorlesung Geld- und Währungstheorie und -politik Dr. Joscha Beckmann Gliederung Part I: Money and credit supply 1. Money and credit: definition, function, origin and aggregates 2. From gold to paper money:
Wem aber gehört die deutsche Zentralbank mit dem Namen Bundesbank?
 Diese zwei Fragen sind eng miteinander verknüpft. Geld wird aus dem Nichts erschaffen, und zwar von zwei unterschiedlichen Parteien: den Notenbanken und den Geschäftsbanken. Geld entsteht ausschließlich
Diese zwei Fragen sind eng miteinander verknüpft. Geld wird aus dem Nichts erschaffen, und zwar von zwei unterschiedlichen Parteien: den Notenbanken und den Geschäftsbanken. Geld entsteht ausschließlich
Was ist Geld? Was ist Geld? Geld umfasst alle Arten von Gütern und Vermögenswerten, die allgemein zur Zahlung angenommen werden.
 Was ist Geld? Was ist Geld? Geld umfasst alle Arten von Gütern und Vermögenswerten, die allgemein zur Zahlung angenommen werden. Salz Felle Stockfisch Zigaretten Münzen Vieh (Ochsen) Papier mit besonderem
Was ist Geld? Was ist Geld? Geld umfasst alle Arten von Gütern und Vermögenswerten, die allgemein zur Zahlung angenommen werden. Salz Felle Stockfisch Zigaretten Münzen Vieh (Ochsen) Papier mit besonderem
Geld, Preise und die EZB
 Geld, Preise und die EZB MB Gebrauch von Geld Funktionen von Geld Tauschmittel Ohne Geld müssten Transaktionen durch Tauschhandel (Naturaltausch) durchgeführt werden Problem der Doppelkoinzidenz der Wünsche
Geld, Preise und die EZB MB Gebrauch von Geld Funktionen von Geld Tauschmittel Ohne Geld müssten Transaktionen durch Tauschhandel (Naturaltausch) durchgeführt werden Problem der Doppelkoinzidenz der Wünsche
die Kontostände bei den Banken. Das heißt, den Umfang und die Zunahme unserer wiederholbaren bestimmen alleine wir Bürger, die Vermehrung des dabei
 (CC BY-NC-SA 2.0) nickwheeleroz/flickr Von Geld, Geldmengen und Geldillusionen Helmut Creutz Der Versuch, die Geldmenge zu definieren, treibt akribische Experten an den Rand der Verzweiflung. Denn es gibt
(CC BY-NC-SA 2.0) nickwheeleroz/flickr Von Geld, Geldmengen und Geldillusionen Helmut Creutz Der Versuch, die Geldmenge zu definieren, treibt akribische Experten an den Rand der Verzweiflung. Denn es gibt
Quantitative Easing der EZB Fluch und Segen zugleich?
 Quantitative Easing der EZB Fluch und Segen zugleich? Agenda Mandat der EZB Definitionen Inflation Klassische Instrumente der Geldpolitik der EZB Quantitative Easing Diskussion Mandat der EZB Artikel 127
Quantitative Easing der EZB Fluch und Segen zugleich? Agenda Mandat der EZB Definitionen Inflation Klassische Instrumente der Geldpolitik der EZB Quantitative Easing Diskussion Mandat der EZB Artikel 127
Volkswirtschaftliches Hauptseminar
 Volkswirtschaftliches Hauptseminar Die Wirtschafts- und Finanzkrise und ihre Folgen für die Wirtschaft und ihre Ordnung Thema 8: Die Liquiditätspolitik der Notenbanken und ihre Folgen für die Geldwertstabilität
Volkswirtschaftliches Hauptseminar Die Wirtschafts- und Finanzkrise und ihre Folgen für die Wirtschaft und ihre Ordnung Thema 8: Die Liquiditätspolitik der Notenbanken und ihre Folgen für die Geldwertstabilität
Inhalt. Money makes the world go round 5. Die Banken 17. Was Geldmärkte ausmacht 31
 2 Inhalt Money makes the world go round 5 Warum es ohne Geld nicht geht 6 Geld ist nicht gleich Geld 7 ede Menge Geld: die Geldmengen M1, M2 und M3 8 Gebundene und freie Währungen 10 Warum es deneuro gibt
2 Inhalt Money makes the world go round 5 Warum es ohne Geld nicht geht 6 Geld ist nicht gleich Geld 7 ede Menge Geld: die Geldmengen M1, M2 und M3 8 Gebundene und freie Währungen 10 Warum es deneuro gibt
Wenn Zusammenhänge schwer nachvollziehbar
 Dauerbrenner Geldschöpfung von Helmut Creutz Wenn Zusammenhänge schwer nachvollziehbar sind, dann hilft wie schon Konfuzius wusste oft eine Klärung der Begriffe. Das gilt nicht nur für die Unterscheidungen
Dauerbrenner Geldschöpfung von Helmut Creutz Wenn Zusammenhänge schwer nachvollziehbar sind, dann hilft wie schon Konfuzius wusste oft eine Klärung der Begriffe. Das gilt nicht nur für die Unterscheidungen
Das Geldangebot. 2.1 Wichtige Begriffe. 2.2 Geldschöpfung und -vernichtung. 2.3 Das Multiplikatormodell. 2.4 Die endogen bestimmte Geldmenge
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Tino Conrad, MSc Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2015/2016 Übung
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Tino Conrad, MSc Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2015/2016 Übung
Struktur des Geldangebots-/ Kreditangebotsprozesses
 Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 1 Bankensystem: ein preistheoretisches Geldangebotsmodell Version: 12.1.212 Die Rolle von Banken Struktur des Geldangebots-/ Kreditangebotsprozesses Geldnachfrage
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 1 Bankensystem: ein preistheoretisches Geldangebotsmodell Version: 12.1.212 Die Rolle von Banken Struktur des Geldangebots-/ Kreditangebotsprozesses Geldnachfrage
Dr. Ulrich Mössner Grundbegriffe der Volkswirtschaft und was dahinter steckt
 Dr. Ulrich Mössner Grundbegriffe der Volkswirtschaft und was dahinter steckt Der volkswirtschaftliche Kreislauf Entwicklung (Agrar, Gewerbe, Dienstleist.) Arbeitsteilung (Vor- und Nachteile) Geld und Geldwert
Dr. Ulrich Mössner Grundbegriffe der Volkswirtschaft und was dahinter steckt Der volkswirtschaftliche Kreislauf Entwicklung (Agrar, Gewerbe, Dienstleist.) Arbeitsteilung (Vor- und Nachteile) Geld und Geldwert
Geld, Geldschöpfung, Preise und die Rolle der Nationalbank
 Geld, Geldschöpfung, Preise und die Rolle der Nationalbank iconomix-fachtagung Bern, 7. September 2013 Carlos Lenz, Leiter Inflationsprognosen, SNB Zürich Was ist Geld? Wer schöpft Geld? Was hat Geldschöpfung
Geld, Geldschöpfung, Preise und die Rolle der Nationalbank iconomix-fachtagung Bern, 7. September 2013 Carlos Lenz, Leiter Inflationsprognosen, SNB Zürich Was ist Geld? Wer schöpft Geld? Was hat Geldschöpfung
Deutscher Bundestag. Sachstand. Fragen zum System der Europäischen Zentralbanken. Wissenschaftliche Dienste WD /12
 Deutscher Bundestag Fragen zum System der Europäischen Zentralbanken Seite 2 Verfasser: Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit: 30. August 2012 Fachbereich: WD 4: Haushalt und Finanzen Telefon: Ausarbeitungen
Deutscher Bundestag Fragen zum System der Europäischen Zentralbanken Seite 2 Verfasser: Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit: 30. August 2012 Fachbereich: WD 4: Haushalt und Finanzen Telefon: Ausarbeitungen
LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 3
 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 3 Aufgabe 1: Geldnachfrage I Die gesamtwirtschaftliche
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 3 Aufgabe 1: Geldnachfrage I Die gesamtwirtschaftliche
Christine Brandt Wintersemester 2004/2005. Geldmarkt
 Christine Brandt Wintersemester 2004/2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 01 Tel. 0731 50 24266 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Christine Brandt Wintersemester 2004/2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 01 Tel. 0731 50 24266 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
2 Entwicklung des Geldmengenwachstums
 Entwicklung des Geldmengenwachstums im Euroraum Das Geldmengenwachstum ging im Euroraum ab Oktober 212 (+3,9 %) stetig zurück und wies im April 214 mit,8 % nur noch einen leicht positiven Wert auf. Vor
Entwicklung des Geldmengenwachstums im Euroraum Das Geldmengenwachstum ging im Euroraum ab Oktober 212 (+3,9 %) stetig zurück und wies im April 214 mit,8 % nur noch einen leicht positiven Wert auf. Vor
Schon gewusst? M2: Wie wirkt der Leitzins? M3: Was ist das Besondere der aktuellen Leitzinsentwicklung im Euroraum?
 Die Richtschnur am Geldmarkt: Der Leitzins Nach dem Ausbruch der Finanzmarktkrise senkte die Europäische Zentralbank (EZB) seit 2008 nahe zu stetig den Leitzins im Frühjahr 2016 sogar erstmals auf null
Die Richtschnur am Geldmarkt: Der Leitzins Nach dem Ausbruch der Finanzmarktkrise senkte die Europäische Zentralbank (EZB) seit 2008 nahe zu stetig den Leitzins im Frühjahr 2016 sogar erstmals auf null
Bachelor-Orientierungsphase: Makroökonomie I
 Bachelor-Orientierungsphase: Makroökonomie I Download des Foliensatzes http://www.wiwi.euv-frankfurto.de/de/lehrstuhl/fine/makro/index.html Prof. Dr. Georg Stadtmann stadtman@whu.edu Überblick Kapitel
Bachelor-Orientierungsphase: Makroökonomie I Download des Foliensatzes http://www.wiwi.euv-frankfurto.de/de/lehrstuhl/fine/makro/index.html Prof. Dr. Georg Stadtmann stadtman@whu.edu Überblick Kapitel
OESTERREICHISCHE NATIONALBANK EUROSYSTEM. KURZFILME DER OeNB. Geldpolitik und Preisstabilität DIDAKTIK
 OESTERREICHISCHE NATIONALBANK EUROSYSTEM KURZFILME DER OeNB Geldpolitik und Preisstabilität DIDAKTIK 1 DIDAKTIK-INFO Das Didaktik Material besteht aus drei Teilen: Allgemeine Fragen/Basics Gruppenarbeit/Recherchearbeit
OESTERREICHISCHE NATIONALBANK EUROSYSTEM KURZFILME DER OeNB Geldpolitik und Preisstabilität DIDAKTIK 1 DIDAKTIK-INFO Das Didaktik Material besteht aus drei Teilen: Allgemeine Fragen/Basics Gruppenarbeit/Recherchearbeit
4 Die US-Wirtschaftspolitik versagt
 4 Die US-Wirtschaftspolitik versagt Sie hat sich der US-Geopolitik unterzuordnen. Teil 4 des Zyklus: Motive, Hintergründe und Folgen der Zinswende in den USA Von Hermann Patzak 4.1 Die Geldpolitik der
4 Die US-Wirtschaftspolitik versagt Sie hat sich der US-Geopolitik unterzuordnen. Teil 4 des Zyklus: Motive, Hintergründe und Folgen der Zinswende in den USA Von Hermann Patzak 4.1 Die Geldpolitik der
Die Auswirkungen der Finanzkrise aus Notenbanksicht
 Die Auswirkungen der Finanzkrise aus Notenbanksicht Jens Ulbrich Deutsche Bundesbank Achte Jahreskonferenz Mannheim Research Institute for the Economics of Aging 24. November 2009 Mannheim Auswirkungen
Die Auswirkungen der Finanzkrise aus Notenbanksicht Jens Ulbrich Deutsche Bundesbank Achte Jahreskonferenz Mannheim Research Institute for the Economics of Aging 24. November 2009 Mannheim Auswirkungen
UE5: Fragen zu Geldpolitik
 UE5: Fragen zu Geldpolitik 1) Was ist das vorrangige Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) und welche geldpolitischen Instrumente werden eingesetzt für die Erreichung dieses Ziels? 2) a) Woraus besteht
UE5: Fragen zu Geldpolitik 1) Was ist das vorrangige Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) und welche geldpolitischen Instrumente werden eingesetzt für die Erreichung dieses Ziels? 2) a) Woraus besteht
1923, ein Ei kostete 80 Millionen Mark Inflation
 Geld / Zahlungsmittel 1 1 Wann gab es in Deutschland eine galoppierende Inflation? 2 Wenn eine Regierung immer mehr Geld druckt, um ihre Importe zu finanzieren, führt das auf lange Sicht zur 3 Wenn die
Geld / Zahlungsmittel 1 1 Wann gab es in Deutschland eine galoppierende Inflation? 2 Wenn eine Regierung immer mehr Geld druckt, um ihre Importe zu finanzieren, führt das auf lange Sicht zur 3 Wenn die
Geld, Zins, Geldangebot und Geldnachfrage. 0 Was ist Geld und warum ist es für die Funktionalität einer entwickelten Volkswirtschaft unerläßlich?
 Geld, Zins, Geldangebot und Geldnachfrage 0 Was ist Geld und warum ist es für die Funktionalität einer entwickelten Volkswirtschaft unerläßlich? 0.1 Definition erfolgt über die Funktionen von Geld Transaktionsmittel
Geld, Zins, Geldangebot und Geldnachfrage 0 Was ist Geld und warum ist es für die Funktionalität einer entwickelten Volkswirtschaft unerläßlich? 0.1 Definition erfolgt über die Funktionen von Geld Transaktionsmittel
So funktioniert dergeldmarkt. Manfred Weber
 So funktioniert dergeldmarkt Manfred Weber 2 Inhalt Money makes the world go round 5 Warum es ohne Geld nicht geht 6 Geld ist nicht gleich Geld 7 ede Menge Geld: die Geldmengen M1, M2 und M3 8 Gebundene
So funktioniert dergeldmarkt Manfred Weber 2 Inhalt Money makes the world go round 5 Warum es ohne Geld nicht geht 6 Geld ist nicht gleich Geld 7 ede Menge Geld: die Geldmengen M1, M2 und M3 8 Gebundene
Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie
 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 4: Geld- und Finanzmärkte Günter W. Beck 1 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 2 2
Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 4: Geld- und Finanzmärkte Günter W. Beck 1 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 2 2
Geheimnis Geldschöpfung
 1 Geheimnis Geldschöpfung Seite 1 von 2 Geld regiert die Welt! Wer regiert das Geld? Die Geldproduzenten! Denn wir wissen nicht, was sie tun... Das heutige Geldsystem ist kompliziert und undurchsichtig.
1 Geheimnis Geldschöpfung Seite 1 von 2 Geld regiert die Welt! Wer regiert das Geld? Die Geldproduzenten! Denn wir wissen nicht, was sie tun... Das heutige Geldsystem ist kompliziert und undurchsichtig.
Geld, Zins, Geldangebot und Geldnachfrage. 1 Geldmengenaggregate (EZB)
 Geld, Zins, Geldangebot und Geldnachfrage 0 Was ist Geld und warum ist es für die Funktionalität einer entwickelten Volkswirtschaft unerläßlich? 0.1 Definition erfolgt über die Funktionen von Geld Transaktionsmittel
Geld, Zins, Geldangebot und Geldnachfrage 0 Was ist Geld und warum ist es für die Funktionalität einer entwickelten Volkswirtschaft unerläßlich? 0.1 Definition erfolgt über die Funktionen von Geld Transaktionsmittel
Geld als Instrument der Makropolitik
 Geld als Instrument der Makropolitik Workshop der OeNB in Kooperation mit der WU am 24. Oktober 2016 Dr. Clemens Jobst/Dr. Claudia Kwapil Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen Ein Ausgangspunkt:
Geld als Instrument der Makropolitik Workshop der OeNB in Kooperation mit der WU am 24. Oktober 2016 Dr. Clemens Jobst/Dr. Claudia Kwapil Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen Ein Ausgangspunkt:
Wirtschaftspolitik. Aufgabe der Zentralbank ist die Versorgung der Wirtschaft mit Geld:
 Wirtschaftspolitik Staatliche Wirtschaftspolitik(=Fiskalpolitik) Ziele des StaBG Zentralbankpolitik (Geldpolitik) Primäres Ziel: Geldwertstabilität Wenn diese erreicht ist: Unterstützung der Wipol der
Wirtschaftspolitik Staatliche Wirtschaftspolitik(=Fiskalpolitik) Ziele des StaBG Zentralbankpolitik (Geldpolitik) Primäres Ziel: Geldwertstabilität Wenn diese erreicht ist: Unterstützung der Wipol der
Langfristige Goldbewertung aus monetärem Blickwinkel - Marktkommentar Mark Valek -
 Langfristige Goldbewertung aus monetärem Blickwinkel - Marktkommentar Mark Valek - Money is Gold, everything else is Credit. 1 Dies stellte J.P Morgan, einer der bedeutendsten Bankiers seiner Zeit vor
Langfristige Goldbewertung aus monetärem Blickwinkel - Marktkommentar Mark Valek - Money is Gold, everything else is Credit. 1 Dies stellte J.P Morgan, einer der bedeutendsten Bankiers seiner Zeit vor
Geldmengen und Geldpolitik
 Geldmengen und Geldpolitik 1. Bilanz der Notenbank Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist für die Geldpolitik der Schweiz zuständig (Bundesverfassung Art. 99,2). Dies zeigt sich auch in der Bilanz der
Geldmengen und Geldpolitik 1. Bilanz der Notenbank Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist für die Geldpolitik der Schweiz zuständig (Bundesverfassung Art. 99,2). Dies zeigt sich auch in der Bilanz der
Makroökonomik I Kapitel 4: Geld- und Finanzmärkte
 Makroökonomik I Kapitel 4: Geld- und Finanzmärkte Günter W. Beck 1 Überblick Die Geldnachfrage Die Bestimmung des Zinssatzes ohne Banken Die Bestimmung des Zinssatzes mit Banken Die Geldnachfrage (Kapitel
Makroökonomik I Kapitel 4: Geld- und Finanzmärkte Günter W. Beck 1 Überblick Die Geldnachfrage Die Bestimmung des Zinssatzes ohne Banken Die Bestimmung des Zinssatzes mit Banken Die Geldnachfrage (Kapitel
N E U 2.Auflage : Z SÖ ZEITSCHRIFT FÜRfSOZIALÖKONOMIE Auszug Seite 15-24 Geld: Das letzte Rätsel der Freiwirtschaftslehre? Geldschöpfung der Banken?
 Z f SÖ ZEITSCHRIFT FÜR ISSN 0721-0752 SOZIALÖKONOMIE Auszug Seite 15-24 Thomas Betz Helmut Creutz Ralf Becker Dirk Löhr Christopher Mensching 3 15 25 30 33 39 40 Geld: Das letzte Rätsel der Freiwirtschaftslehre?
Z f SÖ ZEITSCHRIFT FÜR ISSN 0721-0752 SOZIALÖKONOMIE Auszug Seite 15-24 Thomas Betz Helmut Creutz Ralf Becker Dirk Löhr Christopher Mensching 3 15 25 30 33 39 40 Geld: Das letzte Rätsel der Freiwirtschaftslehre?
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Euro 19.06.2014 Lesezeit 4 Min Das Trilemma der EZB Als der Eurokurs vor kurzem über 1,40 Dollar zu steigen drohte, wurde lauthals gefordert,
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Euro 19.06.2014 Lesezeit 4 Min Das Trilemma der EZB Als der Eurokurs vor kurzem über 1,40 Dollar zu steigen drohte, wurde lauthals gefordert,
Was löst die Fed aus?
 Was löst die Fed aus? Wellenreiter-Kolumne vom 02. Dezember 2015 Während die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik verstärkt, zieht die US- Zentralbank die Zügel an. Voraussichtlich am 16. Dezember
Was löst die Fed aus? Wellenreiter-Kolumne vom 02. Dezember 2015 Während die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik verstärkt, zieht die US- Zentralbank die Zügel an. Voraussichtlich am 16. Dezember
Makroökonomie I: Vorlesung # 13. Geldangebot und Geldpolitik II
 Makroökonomie I: Vorlesung # 13 Geldangebot und Geldpolitik II 1 Vorlesung # 13 1. Zusammenfassung 2. Der Geldschöpfungsprozeß (Wiederholung) 3. Logik der Geldpolitik 4. Details: Wie steuert die Zentralbank
Makroökonomie I: Vorlesung # 13 Geldangebot und Geldpolitik II 1 Vorlesung # 13 1. Zusammenfassung 2. Der Geldschöpfungsprozeß (Wiederholung) 3. Logik der Geldpolitik 4. Details: Wie steuert die Zentralbank
Das Gelddrucken der EZB ist nicht geeignet, Deflation zu verhindern
 Das Gelddrucken der EZB ist nicht geeignet, Deflation zu verhindern Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann Universität Hamburg Vortrag vor dem Alumni Universität Hamburg e.v. am 10. April 2014 1 Gliederungsübersicht
Das Gelddrucken der EZB ist nicht geeignet, Deflation zu verhindern Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann Universität Hamburg Vortrag vor dem Alumni Universität Hamburg e.v. am 10. April 2014 1 Gliederungsübersicht
CHAPTER. Financial Markets. Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano
 Financial Markets Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano CHAPTER R4 R 4 2006 Prentice Hall Business Publishing Macroeconomics, 4/e Olivier Blanchard 4-1 Die Geldnachfrage Wir haben Vermögen und
Financial Markets Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano CHAPTER R4 R 4 2006 Prentice Hall Business Publishing Macroeconomics, 4/e Olivier Blanchard 4-1 Die Geldnachfrage Wir haben Vermögen und
Geld und Währung. Übungsfragen. Geld
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Geld und
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Geld und
Zinserträge der Banken im Vergleich Mit 724 Mrd DM lagen die Bankzinserträge im Jahr 2000 bei:
 Zinserträge der Banken im Vergleich Mit 724 Mrd DM lagen die Bankzinserträge im Jahr 2000 bei: 18% des Bruttoinlandsprodukts (3.960 Mrd) 28% des verfügbaren Einkommens (2.564 Mrd) 31% der Haushaltsausgaben
Zinserträge der Banken im Vergleich Mit 724 Mrd DM lagen die Bankzinserträge im Jahr 2000 bei: 18% des Bruttoinlandsprodukts (3.960 Mrd) 28% des verfügbaren Einkommens (2.564 Mrd) 31% der Haushaltsausgaben
Euro. Fürs Erste.
 Seite 1 von 5 1.140.000.000.000 Euro. Fürs Erste. rottmeyer.de /1-140-000-000-000-euro-fuers-erste/2/ Kauft die EZB die Papiere von Nichtbanken, so überweist sie den Kaufbetrag direkt auf die Konten der
Seite 1 von 5 1.140.000.000.000 Euro. Fürs Erste. rottmeyer.de /1-140-000-000-000-euro-fuers-erste/2/ Kauft die EZB die Papiere von Nichtbanken, so überweist sie den Kaufbetrag direkt auf die Konten der
Der Transmissionsmechanismus in Krisenzeiten
 Wirtschaft Jürgen Gmeiner Der Transmissionsmechanismus in Krisenzeiten Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Wirtschaft Jürgen Gmeiner Der Transmissionsmechanismus in Krisenzeiten Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Was ist Geld? Betrachtung des Weltfinanzsystems. Dr. Dirk Solte 25. Mai 2009 FAW/n, Lehrstuhl für Informatik. solte@faw-neu-ulm.de
 Dr. Dirk Solte 25. Mai 2009 FAW/n, Lehrstuhl für Informatik Was ist Geld? Betrachtung des Weltfinanzsystems solte@faw-neu-ulm.de Seite 2 Bretton Woods (1) Benannt nach einem Ort in New Hampshire Währungssystem
Dr. Dirk Solte 25. Mai 2009 FAW/n, Lehrstuhl für Informatik Was ist Geld? Betrachtung des Weltfinanzsystems solte@faw-neu-ulm.de Seite 2 Bretton Woods (1) Benannt nach einem Ort in New Hampshire Währungssystem
@googlemail.com> 5. April 2011 An: pressestelle.hv-mainz@bundesbank.de Sehr,
 @googlemail.com> Bankensystems, Anfrage bezüglich unseres Geld- und @googlemail.com> 5. April 2011 An: pressestelle.hv-mainz@bundesbank.de Sehr, haben Sie herzlichen Dank für Ihr Schreiben und für das
@googlemail.com> Bankensystems, Anfrage bezüglich unseres Geld- und @googlemail.com> 5. April 2011 An: pressestelle.hv-mainz@bundesbank.de Sehr, haben Sie herzlichen Dank für Ihr Schreiben und für das
Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 Das Unternehmen // Produktion Cobb-Douglas-Produktionsfunktion Problem Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist gegeben durch F (K, L) = K β L 1 β Für welche Werte von β zeigt sie steigende, konstante
Das Unternehmen // Produktion Cobb-Douglas-Produktionsfunktion Problem Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist gegeben durch F (K, L) = K β L 1 β Für welche Werte von β zeigt sie steigende, konstante
informieren Steht die Schweiz vor einer Hyperinflation? Tagung der Finanzverwaltern/innen der Thurgauer Gemeinden, 24.
 informieren Steht die Schweiz vor einer Hyperinflation? Tagung der Finanzverwaltern/innen der Thurgauer Gemeinden, 24. Oktober 2013 Inflation Was genau ist Inflation eigentlich? Definition Inflation Inflation
informieren Steht die Schweiz vor einer Hyperinflation? Tagung der Finanzverwaltern/innen der Thurgauer Gemeinden, 24. Oktober 2013 Inflation Was genau ist Inflation eigentlich? Definition Inflation Inflation
Geld- und Währungspolitik
 Prof. Dr. Werner Smolny Wintersemester 2005/2006 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Prof. Dr. Werner Smolny Wintersemester 2005/2006 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Das Auslandvermögen der Schweiz im Jahr 2003
 Das Auslandvermögen der Schweiz im Jahr 2003 Inhalt 37 Übersicht 39 Auslandaktiven 41 Auslandpassiven Das Auslandvermögen der Schweiz im Jahr 2003 43 Gliederung der Auslandaktiven und -passiven nach Währungen
Das Auslandvermögen der Schweiz im Jahr 2003 Inhalt 37 Übersicht 39 Auslandaktiven 41 Auslandpassiven Das Auslandvermögen der Schweiz im Jahr 2003 43 Gliederung der Auslandaktiven und -passiven nach Währungen
Eine Währung sucht ihren Weg
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Wechselkurse 05.02.2015 Lesezeit 4 Min Eine Währung sucht ihren Weg Der Euro fällt und fällt das macht kaum jemanden so nervös wie die jahrzehntelang
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Wechselkurse 05.02.2015 Lesezeit 4 Min Eine Währung sucht ihren Weg Der Euro fällt und fällt das macht kaum jemanden so nervös wie die jahrzehntelang
Das Geldangebot. 2.1 Wichtige Begriffe. 2.2 Geldschöpfung und -vernichtung. 2.3 Das Multiplikatormodell. 2.4 Die endogen bestimmte Geldmenge
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl-WiWi Sabrina Böck Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2007/2008
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl-WiWi Sabrina Böck Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2007/2008
Funktion eines umlaufgesicherten Geldsystems - Praktische Durchführung
 Funktion eines umlaufgesicherten Geldsystems - Praktische Durchführung An erster Stelle steht die Frage, wie ein zinsfreies Geld heute in der Praxis aussehen könnte. Da die Überlegenheit des Geldes über
Funktion eines umlaufgesicherten Geldsystems - Praktische Durchführung An erster Stelle steht die Frage, wie ein zinsfreies Geld heute in der Praxis aussehen könnte. Da die Überlegenheit des Geldes über
IK: Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Wintersemester 2011/12) Geld- und Finanzmärkte
 Finanzmärkte (Wintersemester 2011/12) Geld- und Finanzmärkte Inhalt Ziel: Erstellung eines kleinen Geldmarktmodells zur Bestimmung des Zinssatzes in einer Ökonomie Geld- und Finanzmärkte zentrale Akteure
Finanzmärkte (Wintersemester 2011/12) Geld- und Finanzmärkte Inhalt Ziel: Erstellung eines kleinen Geldmarktmodells zur Bestimmung des Zinssatzes in einer Ökonomie Geld- und Finanzmärkte zentrale Akteure
Geld ist ein Wertaufbewahrungsmittel:
 4. Geld, Zinsen und Wechselkurse 4.1. Geldangebot und -nachfrage Geldfunktionen u. Geldangebot (vgl. Mankiw; 2000, chap. 27) Geld genießt generelle Akzeptanz als Tauschmittel: Bartersystem ohne Geld: Jemand,
4. Geld, Zinsen und Wechselkurse 4.1. Geldangebot und -nachfrage Geldfunktionen u. Geldangebot (vgl. Mankiw; 2000, chap. 27) Geld genießt generelle Akzeptanz als Tauschmittel: Bartersystem ohne Geld: Jemand,
René Müller. Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen. Europa, USA und Japan vor dem Abgrund? Diplomica Verlag
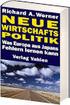 René Müller Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen Europa, USA und Japan vor dem Abgrund? Diplomica Verlag René Müller Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen: Europa, USA und Japan vor
René Müller Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen Europa, USA und Japan vor dem Abgrund? Diplomica Verlag René Müller Mögliche Staatspleiten großer Industrienationen: Europa, USA und Japan vor
Prof. Dr. rer. pol. Norbert Konegen. downloads: www.p8-management.de/universität konegen@uni-muenster.de
 Prof. Dr. rer. pol. Norbert Konegen downloads: www.p8-management.de/universität konegen@uni-muenster.de SS 2014 Die Europäische Zentralbank (EZB) in der Grauzone zwischen Geld- und Fiskalpolitik (monetärer
Prof. Dr. rer. pol. Norbert Konegen downloads: www.p8-management.de/universität konegen@uni-muenster.de SS 2014 Die Europäische Zentralbank (EZB) in der Grauzone zwischen Geld- und Fiskalpolitik (monetärer
Der Weg in die Zinsfalle
 Der Weg in die Zinsfalle tenen Länder deutlich. Hierbei ist anzumerken, dass die EZB im Gegensatz zu anderen Zentralbanken nicht systematisch Staatsanleihen von Mitgliedsstaaten aufgekauft hat und die
Der Weg in die Zinsfalle tenen Länder deutlich. Hierbei ist anzumerken, dass die EZB im Gegensatz zu anderen Zentralbanken nicht systematisch Staatsanleihen von Mitgliedsstaaten aufgekauft hat und die
Löse Dich von dem Ding Geld Bild.
 Löse Dich von dem Ding Geld Bild. Die Zahl selbst ist dein Geld, eine Zahl ist kein Ding, es ist eine Information. Drei Teilnehmer, zwei Geld Kreisläufe. Ein Kredit wird vergeben (Geldschöpfung) Bei der
Löse Dich von dem Ding Geld Bild. Die Zahl selbst ist dein Geld, eine Zahl ist kein Ding, es ist eine Information. Drei Teilnehmer, zwei Geld Kreisläufe. Ein Kredit wird vergeben (Geldschöpfung) Bei der
Betriebswirtschaft Volkswirtschaft und Gesellschaft. Zweite Auflage
 Heinrich Andereggen Martin Bachmann Rahel Balmer-Zahnd Vera Friedli Renato C. Müller Vasquez Callo 3W&G Lehrmittel für die kaufmännische Grundbildung 3. Lehrjahr Lösungen Zweite Auflage Betriebswirtschaft
Heinrich Andereggen Martin Bachmann Rahel Balmer-Zahnd Vera Friedli Renato C. Müller Vasquez Callo 3W&G Lehrmittel für die kaufmännische Grundbildung 3. Lehrjahr Lösungen Zweite Auflage Betriebswirtschaft
Das Geld- und Kreditschöpfungspotential von Bankensystemen
 Das Geld- und Kreditschöpfungspotential von Bankensystemen Der Einfachheit halber betrachten wir zunächst ein Geschäftsbankensystem bei ausschließlich bargeldlosem Zahlungsverkehr. Die Nichtbanken zahlen
Das Geld- und Kreditschöpfungspotential von Bankensystemen Der Einfachheit halber betrachten wir zunächst ein Geschäftsbankensystem bei ausschließlich bargeldlosem Zahlungsverkehr. Die Nichtbanken zahlen
Zusammenfassung Geldangebot Geldtheorie und Geldpolitik Wintersemester, 2011/12
 Zusammenfassung Geldangebot Geldtheorie und Geldpolitik Wintersemester, 2011/12 1 Geldangebot Geldangebot: Wie entsteht Geld? Die ZB druckt Geld und verleiht es an Geschäftsbanken oder kauft damit Assets.
Zusammenfassung Geldangebot Geldtheorie und Geldpolitik Wintersemester, 2011/12 1 Geldangebot Geldangebot: Wie entsteht Geld? Die ZB druckt Geld und verleiht es an Geschäftsbanken oder kauft damit Assets.
Die 29Irrtümer rund ums Geld
 Helmut Creutz Die 29Irrtümer rund ums Geld Signum Wirtschaftsverlag Vorwort: 15 Irrtum Nr. 1:»Alles, was man als Geld bezeichnet, ist auch Geld!«17 Was ist die Geldmenge? Und was sind Geldguthaben? Die
Helmut Creutz Die 29Irrtümer rund ums Geld Signum Wirtschaftsverlag Vorwort: 15 Irrtum Nr. 1:»Alles, was man als Geld bezeichnet, ist auch Geld!«17 Was ist die Geldmenge? Und was sind Geldguthaben? Die
Vorlesung Geldpolitik 2. Das Geldangebot. Enzo Rossi FS 2011. 2. Das Geldangebot
 2 Struktur der Vorlesung. Geldmengen 2. Definitionen 3. Geldmultiplikator 4. Monetäre Basis 5. Bargeld-/Reserven-Einlagen-Relationen 6. Bankkredite 3. Geldmengen M 0 M M2 M3 Notenumlauf Noten + Münzen
2 Struktur der Vorlesung. Geldmengen 2. Definitionen 3. Geldmultiplikator 4. Monetäre Basis 5. Bargeld-/Reserven-Einlagen-Relationen 6. Bankkredite 3. Geldmengen M 0 M M2 M3 Notenumlauf Noten + Münzen
Einkommen, Inflation und Arbeitslosigkeit - Thema 5: Geld- und Finanzmärkte, Geldmengenmultiplikator.
 Einkommen, Inflation und Arbeitslosigkeit - Thema 5: Geld- und Finanzmärkte, Geldmengenmultiplikator. Mario Lackner JKU Linz, Abteilung für Wirtschaftspolitik. 24. November 2008 Inhalt 1. Begriffsabgrenzungen
Einkommen, Inflation und Arbeitslosigkeit - Thema 5: Geld- und Finanzmärkte, Geldmengenmultiplikator. Mario Lackner JKU Linz, Abteilung für Wirtschaftspolitik. 24. November 2008 Inhalt 1. Begriffsabgrenzungen
WIRTSCHAFTSDATEN DEZEMBER 2015
 WIRTSCHAFTSDATEN DEZEMBER 2015 I. Konjunkturaussichten... 2 II. Wirtschaftskraft weltweit... 3 III. Die reichsten Bürger der Welt... 4 IV. Plus und Minus im deutschen Außenhandel... 5 V. Deutschland wichtigste
WIRTSCHAFTSDATEN DEZEMBER 2015 I. Konjunkturaussichten... 2 II. Wirtschaftskraft weltweit... 3 III. Die reichsten Bürger der Welt... 4 IV. Plus und Minus im deutschen Außenhandel... 5 V. Deutschland wichtigste
Geldmenge und Geldpolitik Kritische Anmerkungen zu den gängigen Interpretationen erweiterte Version 2012
 1 Geldmenge und Geldpolitik Kritische Anmerkungen zu den gängigen Interpretationen erweiterte Version 2012 Die geldpolitischen Vorstellungen werden in Deutschland geprägt von der Geldmengentheorie. Diese
1 Geldmenge und Geldpolitik Kritische Anmerkungen zu den gängigen Interpretationen erweiterte Version 2012 Die geldpolitischen Vorstellungen werden in Deutschland geprägt von der Geldmengentheorie. Diese
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Übungsblatt 12
 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Übungsblatt 12 Robert Poppe robert.poppe@uni-mannheim.de Universität Mannheim 3. Dezember 2010 Überblick 1 Das monetäre System (Kapitel 29): Aufgabe 1 und Aufgabe 3
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Übungsblatt 12 Robert Poppe robert.poppe@uni-mannheim.de Universität Mannheim 3. Dezember 2010 Überblick 1 Das monetäre System (Kapitel 29): Aufgabe 1 und Aufgabe 3
Wirtschaftsaussichten 2015
 Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann Wirtschaftsaussichten 2015 Vortrag beim Rotary Club Hamburg Wandsbek 5. Januar 2015 Hoffnungen in 2015 1. Wirtschaftswachstum positiv (global, EU, Deutschland) 2. Reformfrüchte
Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann Wirtschaftsaussichten 2015 Vortrag beim Rotary Club Hamburg Wandsbek 5. Januar 2015 Hoffnungen in 2015 1. Wirtschaftswachstum positiv (global, EU, Deutschland) 2. Reformfrüchte
Öffentlicher Schuldenstand*
 Öffentlicher Schuldenstand* In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ausgewählte europäische Staaten, 1997 bis 2011 Prozent 165 Griechenland 160 * Bruttoschuld des Staates (konsolidiert) 150 140 145
Öffentlicher Schuldenstand* In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ausgewählte europäische Staaten, 1997 bis 2011 Prozent 165 Griechenland 160 * Bruttoschuld des Staates (konsolidiert) 150 140 145
Frankfurt am Main, 9. März Jahresabschluss 2009 Pressekonferenz
 Frankfurt am Main, 9. März 2010 Jahresabschluss 2009 Pressekonferenz Agenda I. Bundesbankgewinn II. III. IV. Jahresabschluss 1. Bilanz der Bundesbank 2. Ausgewählte Bilanzpositionen 3. Gewinn- und Verlustrechnung
Frankfurt am Main, 9. März 2010 Jahresabschluss 2009 Pressekonferenz Agenda I. Bundesbankgewinn II. III. IV. Jahresabschluss 1. Bilanz der Bundesbank 2. Ausgewählte Bilanzpositionen 3. Gewinn- und Verlustrechnung
MONETATIVE » - GELDSCHÖPFUNG IN ÖFFENTLICHE HAND« Von Helmut Creutz
 MONETATIVE» - GELDSCHÖPFUNG IN ÖFFENTLICHE HAND«Von Helmut Creutz Zu einem Reformvorschlag von Bernd Senf, Josef Huber, Thomas Betz und Klaus Karwat D ie Wurzel der jüngsten Finanzkrisen liegt im heutigen
MONETATIVE» - GELDSCHÖPFUNG IN ÖFFENTLICHE HAND«Von Helmut Creutz Zu einem Reformvorschlag von Bernd Senf, Josef Huber, Thomas Betz und Klaus Karwat D ie Wurzel der jüngsten Finanzkrisen liegt im heutigen
Thema: Wirtschaftspolitik der EU Die Wa hrungsunion
 Thema: Wirtschaftspolitik der EU Die Wa hrungsunion Anforderungsbereich I: Reproduktion: 1. Arbeiten Sie die Spielregeln für den Euro heraus und ermitteln Sie was dadurch sichergestellt werden soll. 2.
Thema: Wirtschaftspolitik der EU Die Wa hrungsunion Anforderungsbereich I: Reproduktion: 1. Arbeiten Sie die Spielregeln für den Euro heraus und ermitteln Sie was dadurch sichergestellt werden soll. 2.
1. Aufgabe. 2. Aufgabe. 3. Aufgabe. 4. Aufgabe. 5. Aufgabe. Übungsaufgaben Geldpolitik
 1. Aufgabe Sie erfahren, dass das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) in seiner letzten Sitzung beschlossen hat, die Leitzinssätze zu erhöhen. Prüfen Sie, welches Ziel die EZB damit verfolgt.
1. Aufgabe Sie erfahren, dass das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) in seiner letzten Sitzung beschlossen hat, die Leitzinssätze zu erhöhen. Prüfen Sie, welches Ziel die EZB damit verfolgt.
Das Ende der Sparkultur?
 Ulrich Bindseil Europäische Zentralbank Das Ende der Sparkultur? Symposium anlässlich des Weltspartags 2015 Stuttgart, 30 Oktober 2015 Rubric Logik der Zinsen 1. Für Sparer zählt Realzins = Nominalzins
Ulrich Bindseil Europäische Zentralbank Das Ende der Sparkultur? Symposium anlässlich des Weltspartags 2015 Stuttgart, 30 Oktober 2015 Rubric Logik der Zinsen 1. Für Sparer zählt Realzins = Nominalzins
institut für banken und finanzplanung institute for banking and financial planning /
 institute for banking and financial planning www.ibf-chur.ch / max.luescher@ibf-chur.ch Weiterbildungsseminar vom Freitag, 27. März 2009 in Nuolen im Auftrag von Volkswirtschaftsdepartement, Kanton Schwyz
institute for banking and financial planning www.ibf-chur.ch / max.luescher@ibf-chur.ch Weiterbildungsseminar vom Freitag, 27. März 2009 in Nuolen im Auftrag von Volkswirtschaftsdepartement, Kanton Schwyz
Unser Finanzsystem Die Arbeiter arbeiten hart für ihr Geld
 Unser Finanzsystem Die Arbeiter arbeiten hart für ihr Geld Unser Finanzsystem Die Arbeiter zahlen Steuern Unser Finanzsystem Arbeiter zahlen unter dem Mantel der Steuer Zinsen für die Staatsschulden über
Unser Finanzsystem Die Arbeiter arbeiten hart für ihr Geld Unser Finanzsystem Die Arbeiter zahlen Steuern Unser Finanzsystem Arbeiter zahlen unter dem Mantel der Steuer Zinsen für die Staatsschulden über
So funktioniert dergeldmarkt. Manfred Weber
 So funktioniert dergeldmarkt Manfred Weber 2 Inhalt Money makes the world go round 5 Warum es ohne Geld nicht geht 6 Geld ist nicht gleich Geld 7 ede Menge Geld: die Geldmengen M1, M2 und M3 8 Gebundene
So funktioniert dergeldmarkt Manfred Weber 2 Inhalt Money makes the world go round 5 Warum es ohne Geld nicht geht 6 Geld ist nicht gleich Geld 7 ede Menge Geld: die Geldmengen M1, M2 und M3 8 Gebundene
Eine andere unsichtbare Hand des Marktes
 Eine andere unsichtbare Hand des Marktes Prof. Dr. Jürgen Kremer 2012 Die Polarisierung der Gesellschaft Ursachen und Reformvorschläge Prof. Dr. Jürgen Kremer (2012) Eine andere unsichtbare Hand Polarisierung
Eine andere unsichtbare Hand des Marktes Prof. Dr. Jürgen Kremer 2012 Die Polarisierung der Gesellschaft Ursachen und Reformvorschläge Prof. Dr. Jürgen Kremer (2012) Eine andere unsichtbare Hand Polarisierung
Die Geldpolitik des ESZB. Die Versorgung mit Zentralbankgeld. Kredit. Kredit. Das Europäische System der Zentralbanken
 Die Geldpolitik des ESZB Das Europäische System der en Die geldpolitischen Instrumente des ESZB Wirkungsweise der Refinanzierungspolitik Die Versorgung mit geld 1 Kredit Kredit Nach K.H. Bruckner 2 Das
Die Geldpolitik des ESZB Das Europäische System der en Die geldpolitischen Instrumente des ESZB Wirkungsweise der Refinanzierungspolitik Die Versorgung mit geld 1 Kredit Kredit Nach K.H. Bruckner 2 Das
Geld und Währung. Übungsfragen. Geld
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
WORKSHOP AKTUELLE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
 1 WORKSHOP AKTUELLE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE Geldmengen Geldschöpfung Geldpolitik: Auswertung von SNB Geldmengen-Statistiken Marcel Bühler mu.buehler@bluewin.ch 5.3 Die Entstehung von Geld 5 2 SNB kauft Devisen
1 WORKSHOP AKTUELLE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE Geldmengen Geldschöpfung Geldpolitik: Auswertung von SNB Geldmengen-Statistiken Marcel Bühler mu.buehler@bluewin.ch 5.3 Die Entstehung von Geld 5 2 SNB kauft Devisen
Umlaufgeld / Bargeld (Basisgeld) Eigenkapital der EZB. von Girokonten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Zentralbanken/Banken
 ANHANG: (1) GELDSCHÖPFUNG DURCH GESCHÄFTSBANKEN: Was ist Geld? BASISGELD (M0): normale Geldscheine / Bargeld dürfen nur von der EZB gedruckt & an Geschäftsbanken in einem speziellen Bieterverfahren verteilt
ANHANG: (1) GELDSCHÖPFUNG DURCH GESCHÄFTSBANKEN: Was ist Geld? BASISGELD (M0): normale Geldscheine / Bargeld dürfen nur von der EZB gedruckt & an Geschäftsbanken in einem speziellen Bieterverfahren verteilt
5. GELD- UND FINANZMÄRKTE
 5. GELD- UND FINANZMÄRKTE 1 LERNZIELE KAPITEL 5 1. Was ist Geld und woran erkennt man es? 2. Was versteht man unter einem makroökonomischen Geldmarkt? 3. Was versteht man unter Geldangebot und Geldnachfrage?
5. GELD- UND FINANZMÄRKTE 1 LERNZIELE KAPITEL 5 1. Was ist Geld und woran erkennt man es? 2. Was versteht man unter einem makroökonomischen Geldmarkt? 3. Was versteht man unter Geldangebot und Geldnachfrage?
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 204/5 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.07.205 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (5 Punkte). Wenn
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 204/5 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.07.205 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (5 Punkte). Wenn
Die Rolle von Bargeld in der Geldtheorie und Geldpolitik
 Die Rolle von Bargeld in der Geldtheorie und Geldpolitik Prof. Volker Wieland, Ph.D. IMFS, Goethe Universität Frankfurt und Mitglied im Sachverständigenrat 3. Bargeldsymposium der Deutschen Bundesbank
Die Rolle von Bargeld in der Geldtheorie und Geldpolitik Prof. Volker Wieland, Ph.D. IMFS, Goethe Universität Frankfurt und Mitglied im Sachverständigenrat 3. Bargeldsymposium der Deutschen Bundesbank
Die EZB und ihre Geldpolitik
 Die EZB und ihre Geldpolitik M1 Sitz der EZB in Frankfurt/Main (fotolia, kuegi) Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) umfasst alle Maßnahmen, die sie ergreift, um Preisstabilität im Euroraum
Die EZB und ihre Geldpolitik M1 Sitz der EZB in Frankfurt/Main (fotolia, kuegi) Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) umfasst alle Maßnahmen, die sie ergreift, um Preisstabilität im Euroraum
Zusatzliteratur (für Interessenten):
 Thema 4: Ein einfaches Modell für den Geld- und Finanzmarkt Zusatzliteratur (für Interessenten): - Manfred Borchert: Geld und Kredit. München 2001 - Andrew B. Abel / Ben S. Bernanke: Macroeconomics. 2005
Thema 4: Ein einfaches Modell für den Geld- und Finanzmarkt Zusatzliteratur (für Interessenten): - Manfred Borchert: Geld und Kredit. München 2001 - Andrew B. Abel / Ben S. Bernanke: Macroeconomics. 2005
Schwellenländer kämpfen ums Überleben ihrer Währungen
 Schwellenländer kämpfen ums Überleben ihrer Währungen Schwellenländer wie Malaysia pumpen Milliarden Dollar in den Markt, um den Verfall ihrer Währungen zu stoppen. Doch es hilft nichts. Inzwischen droht
Schwellenländer kämpfen ums Überleben ihrer Währungen Schwellenländer wie Malaysia pumpen Milliarden Dollar in den Markt, um den Verfall ihrer Währungen zu stoppen. Doch es hilft nichts. Inzwischen droht
2. Aufgaben der Geldpolitik
 1. Preisstabilität 2. Aufgaben der Geldpolitik 2. Glättung konjunktureller Schwankungen 3. Die Kosten von Inflation und Deflation, Optimale Inflationsrate 4. Ziele der Zentralbanken im Vergleich 5. Wirkungsmechanismen
1. Preisstabilität 2. Aufgaben der Geldpolitik 2. Glättung konjunktureller Schwankungen 3. Die Kosten von Inflation und Deflation, Optimale Inflationsrate 4. Ziele der Zentralbanken im Vergleich 5. Wirkungsmechanismen
Wie Banken Wachstum ermöglichen und Krisen verursachen
 Mathias Binswanger Geld aus dem Nichts Wie Banken Wachstum ermöglichen und Krisen verursachen WlLEY WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung: Warum wir den Prozess der Geldschöpfung
Mathias Binswanger Geld aus dem Nichts Wie Banken Wachstum ermöglichen und Krisen verursachen WlLEY WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung: Warum wir den Prozess der Geldschöpfung
Vom Buchgeld bis über alle Währungsgrenzen
 Lisa + Mark Auf den Gedanken, ein Haus zu kaufen und es bar zu bezahlen, kommt heute wohl kaum einer. Aber es gab in Deutschland Zeiten, da bezahlte man fast alles in bar. In den 1950er Jahren bekamen
Lisa + Mark Auf den Gedanken, ein Haus zu kaufen und es bar zu bezahlen, kommt heute wohl kaum einer. Aber es gab in Deutschland Zeiten, da bezahlte man fast alles in bar. In den 1950er Jahren bekamen
Michael Rasch I Michael Ferber DIE (UN)HEIMLICHE ENTEIGNUNG. So schützen Sie Ihr Geld vor Politikern und Notenbankern FBV
 Michael Rasch I Michael Ferber DIE (UN)HEIMLICHE ENTEIGNUNG So schützen Sie Ihr Geld vor Politikern und Notenbankern FBV Inhalt Vorwort zur ersten Auflage 13 Vorwort zur Neuauflage 16 Prolog 21 Die Retter
Michael Rasch I Michael Ferber DIE (UN)HEIMLICHE ENTEIGNUNG So schützen Sie Ihr Geld vor Politikern und Notenbankern FBV Inhalt Vorwort zur ersten Auflage 13 Vorwort zur Neuauflage 16 Prolog 21 Die Retter
News Aktuelles aus Politik, Wirtschaft und Recht 10.01.11 Geldschöpfung Verlag Fuchs AG
 News Aktuelles aus Politik, Wirtschaft und Recht 10.01.11 Geldschöpfung Geldschöpfung durch die Geschäftsbanken Durch die Gewährung von Krediten schaffen die Geschäftsbanken neues Geld. Der Anteil von
News Aktuelles aus Politik, Wirtschaft und Recht 10.01.11 Geldschöpfung Geldschöpfung durch die Geschäftsbanken Durch die Gewährung von Krediten schaffen die Geschäftsbanken neues Geld. Der Anteil von
Seiten langen Buchanhang ausdrücklich. Jahren rumort eine spezielle Zinsüberwindungs-Lehre
 Vollgeld... Ein Beitrag zur Lösung unserer Geldprobleme oder zur weiteren Verwirrung? Versuch einer Klärung Helmut Creutz Mit der Einführung des Vollgeldes wäre mit einem Schlag die Eurokrise beendet.
Vollgeld... Ein Beitrag zur Lösung unserer Geldprobleme oder zur weiteren Verwirrung? Versuch einer Klärung Helmut Creutz Mit der Einführung des Vollgeldes wäre mit einem Schlag die Eurokrise beendet.
1.140.000.000.000 Euro. Fürs Erste.
 Seite 1 von 5 1.140.000.000.000 Euro. Fürs Erste. rottmeyer.de /1-140-000-000-000-euro-fuers-erste/ von Thorsten Polleit Zusammenfassung Der EZB-Rat gibt den Startschuss zum QE also zur Monetisierung der
Seite 1 von 5 1.140.000.000.000 Euro. Fürs Erste. rottmeyer.de /1-140-000-000-000-euro-fuers-erste/ von Thorsten Polleit Zusammenfassung Der EZB-Rat gibt den Startschuss zum QE also zur Monetisierung der
Makroskop. Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft. Unser Geldsystem XXXV: Schulden, Schulden ohne Grenzen?
 1 Makroskop Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft. Unser Geldsystem XXXV: Schulden, Schulden ohne Grenzen? Heiner Flassbeck Freitag den 27. Februar 2015 Wenn es ein Land gibt auf dieser Welt, wo
1 Makroskop Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft. Unser Geldsystem XXXV: Schulden, Schulden ohne Grenzen? Heiner Flassbeck Freitag den 27. Februar 2015 Wenn es ein Land gibt auf dieser Welt, wo
Geld- und Kreditschöpfungspotential von Bankensystemen
 Geld- und Kreditschöpfungspotential von Bankensystemen Der Einfachheit halber betrachten wir zunächst ein Geschäftsbankensystem bei ausschließlich bargeldlosem Zahlungsverkehr. Die Nichtbanken zahlen ausschließlich
Geld- und Kreditschöpfungspotential von Bankensystemen Der Einfachheit halber betrachten wir zunächst ein Geschäftsbankensystem bei ausschließlich bargeldlosem Zahlungsverkehr. Die Nichtbanken zahlen ausschließlich
