Matthias Strunz. Instandhaltung. Grundlagen Strategien Werkstätten
|
|
|
- Axel Heinrich
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Instandhaltung
2 Matthias Strunz Instandhaltung Grundlagen Strategien Werkstätten
3 Matthias Strunz Faculty of Engineering Hochschule Lausitz Senftenberg Deutschland ISBN DOI / Springer Heidelberg Dordrecht London New York ISBN (ebook) Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Springer Vieweg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer Vieweg ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
4 Vorwort Das Bruttoanlagevermögen der Bundesrepublik Deutschland stieg innerhalb der letzten 10 Jahre um rund 10 % und erreichte 2010 mit rund 11,8 Bio. einen Spitzenplatz im weltweiten Ranking der reichen Industriestaaten. Dieses Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 1,5 bis 2 % (2010) jährlich sorgt für eine kontinuierliche Zunahme des Sachanlagevermögens unseres Landes. Sachanlagevermögen, in welcher Form auch immer, unterliegt dem physischen und psychischen Verschleiß und muss daher regelmäßig gewartet und gepflegt sowie rechtzeitig ersetzt werden, um eine reibungslose wirtschaftliche und sichere Nutzung zu realisieren. Das erfordert erhebliche Aufwendungen und bedeutet für Staat, Unternehmen und private Haushalte gleichermaßen, finanziell angemessen kontinuierlich für die Werterhaltung des Sachanlagevermögens zu sorgen. Die Umsätze in diesem Bereich liegen gegenwärtig bei fast 400 Mrd. jährlich. Das Optimierungspotenzial wird mit % beim Material und etwa 20 % bei den Lohnkosten bewertet. Das ergibt ein Potenzial von Mrd.. Wenn davon auszugehen ist, dass etwa 15 % dieser Summe als Einsparpotenzial erschlossen werden können, ergibt sich ein realistisches Optimierungspotenzial von Mrd. jährlich. Deutschland exportiert weltweit Erzeugnisse, Investitionsgüter und Leistungen aller Art kletterte die Exportleistung auf über eine Billion Euro. Insgesamt nehmen damit die Verpflichtungen der exportorientierten Unternehmen zu, auch in den Exportländern die Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung der Erzeugnisse, Maschinen und Anlagen zu realisieren. Das bedeutet insbesondere für diese Unternehmen neben dem globalen Warenaustausch u. a. den After Sales Service länderübergreifend zu organisieren. Der damit verbundene Strukturierungsprozess ist eine gewaltige Herausforderung und stellt enormeanforderungen an diese Unternehmen hinsichtlich Organisation, Planung und Durchführung werterhaltender bzw. wertsteigernder Maßnahmen einschließlich einer nachhaltigen globalen Ersatzteileversorgung. Hochschulen und Universitäten stehen vor dem Problem, diese Entwicklung zu antizipieren und die studentische Ausbildung verstärkt an den Herausforderungen der Globalisierung zu orientieren. Das erfordert neben einer Aufstockung der personellen und finanziellen Ressourcen auch eine Verbesserung der Lehre. In Deutschlands V
5 VI Vorwort Hochschulen und Technischen Universitäten genießt die Instandhaltung als Wissenschaftsgebiet in den Studiengängen der ingenieurtechnischen Fakultäten noch nicht den Stellenwert, den sie eigentlich verdient. Da nur wenige Studiengänge das Fach Instandhaltung anbieten, gelingt es den Hochulen nicht, die globale Entwicklung der Wirtschaft auch in den Studiengängen in befriedigender Weise abzubilden. Dies sollte Anlass sein, vermehrt die wissenschaftliche Auseinandersetzung zu suchen und die Instandhaltung stärker in die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung der technischen Fakultäten von Universitäten und Hochschulen einzubinden. Das vorliegende Lehrbuch wendet sich an die Studierenden und Absolventen der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge einschließlich des Wirtschaftsingenieurwesens, und hier speziell an die Produktionstechniker und Produktionswirtschaftler, aber auch an Jungingenieure gleichermaßen, die als Fabrikplaner und Instandhaltungsmanager in den produzierenden Unternehmen des primären und sekundären Bereichs tätig sind. Es soll die Basis für eine Vertiefung und Erweiterung theoretischen Wissens bilden. Zahlreiche Anwendungs- und Rechenbeispiele stellen eine fundierte Verbindung von Theorie und Praxis her und sollen helfen, das theoretische Verständnis von Instandhaltungsprozessen zu verbessern. Ausgehend von der Analyse und Würdigung der volks- und betriebswirtschaftlichen Bedeutung der Instandhaltung (Kap. 1) vermittelt das Buch die Grundlagen der Instandhaltung (Kap. 2) und beleuchtet die grundlegenden Aspekte der Schädigungstheorie. Diese sollen das Verständnis für die Ursachen von Schädigungsprozessen prägen und den interessierten Leser dazu anzuregen, nachhaltige Verbesserungskonzepte zu entwickeln. Nach einem Überblick zur Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit als wesentliche Instandhaltungsziele (Kap. 4) wendet sich das Buch den theoretischen Grundlagen der Zuverlässigkeitstheorie zu (Kap. 5). Das Verständnis der zuverlässigkeitstheoretischen Zusammenhänge bildet die Grundvoraussetzung für eine fundierte theoretische Durchdringung von Instandhaltungsprozessen. Daher wird diese Problematik ausführlich behandelt. Zahlreiche Beispiele mit starker Praxisorientierung unterstützen die Relevanz der theoretischen Zusammenhänge zur Praxis. Breiter Raum wird der konzeptionellen Entwicklung von praxisorientierten Instandhaltungsmodellen (Kap. 6), dem eigentlichen Kerngebiet der Instandhaltung, eingeräumt. Das Ziel produzierender Unternehmen besteht vordergründig darin, den zunehmenden Kostendruck mit kostenoptimalen Instandhaltungsstrategien sowie durch vernünftige Insourcing- bzw. Outsourcing- als uch nachhaltige Make-or-Buy-Entscheidungen zu entlasten. Spezielle Modelle sollen den Betriebsingenieur oder Instandhaltungsplaner bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Die Problematik der Funktionsbestimmung, Dimensionierung und Strukturierung von Instandhaltungswerkstätten findet in der Fachliteratur in Ermangelung wissenschaftlicher Durchdringung bisher sehr wenig Beachtung. Daher widmet sich Kapitel 7 dieser wissenschaftlich anspruchsvollen Problematik in umfassender Weise. Ziel ist die Optimierung des Ressourceneinsatzes nach unterschiedlichen Zielgrößen und -funktionen. Zahlreiche praktische Beispiele und Lösungsansätze unterstützen das Verständnis für die theoretischen Betrachtungen. Kapitel 8 beschäftigt sich mit den
6 Vorwort VII prinzipiellen Möglichkeiten und Ansätzen der strukturellen Einordnung von Instandhaltungswerkstätten in ein Unternehmen. Kapitel 9 behandelt die grundlegenden Aspekte des Ersatzteilemanagements und Kap. 10 rundet das Fachbuch mit Fragestellungen zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Instandhaltungsstrukturen ab. An jedes Kapitel schließt sich ein Katalog von Übungs- und Kontrollfragen an. Die Fragen sind so strukturiert, dass ihre korrekte Beantwortung das Verständnis des Stoffinhalts reflektiert und neben der Aneignung fachlicher Kompetenz auch das vernetzte Denken, also das Denken in Zusammenhängen, anregt und fördert. Die Beantwortung der Fragen in Verbindung mit den zahlreichen Rechenbeispielen und Übungsaufgaben sollen die Entwicklung der erforderlichen Sach- und Methodenkompetenz auf dem Fachgebiet unterstützen. Persönliche Anmerkung: Angetrieben von der Tatsache, dass eine generell gut organisierte und fundierte Lehre wesentlich mit dazu beigetragen hat, dass viele in der Praxis erfolgreicheabsolventen die Hochschule verlassen konnten, habe ich den Versuch unternommen, für Studierende und Absolventen der Ingenieurwissenschaften und hier insbesondere für die Jungingenieure der produktionsorientierten Studiengänge ein Lehrwerk zur Verfügung zu stellen, das Interesse, Verständnis und Akzeptanz für die Instandhaltung wecken und aufrecht erhalten soll. Chemnitz im Dezember 2011 Matthias Strunz
7 Inhalt 1 Gegenstand, Ziele und Entwicklung betrieblicher Instandhaltung Stand und Entwicklungsaspekte der Instandhaltung Grundsätzliches Arbeitsgegenstand der Instandhaltung Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Instandhaltung Die unternehmensbezogene Bedeutung der Instandhaltung Veränderungstreiber in der Instandhaltung Aufgaben und Funktionsbereiche der Instandhaltung Situationsanalyse Aufgaben der Instandhaltung Funktionen, Verantwortungsbereiche und Tätigkeitsschwerpunkte Produktionsfunktion der Instandhaltung Zielgrößen, Zielfunktionen und Zielkonflikte der Instandhaltung Allgemeines Zielgrößen Zielkonzepte Methoden und Hilfsmittel Qualitätsmanagement und Instandhaltung Entwicklung der Instandhaltung Zusammenfassung Übungs- und Kontrollfragen Quellenverzeichnis Die Elemente betrieblicher Instandhaltung Begriffe Grundlegende Strategien zur Produktion von Abnutzungsvorrat Aufgabenbereiche der Instandhaltung Wartung, Pflege, Inspektion und Instandsetzung Allgemeine Grundsätze der Wartung und Pflege Allgemeine Wartungs- und Pflegemaßnahmen IX
8 X Inhalt Filterpflege Abstellen Wartungs- und Inspektionsplanung Grundbegriffe Allgemeine Aspekte Schritte zur Erstellung eines Wartungs- und Inspektionsplans (VDI 2890) Schmierstoffe Instandsetzung Begriffe und Definitionen Instandhaltungsgrundstrategien Verbesserung Anforderungen an eine instandhaltungsgerechte Konstruktion Allgemeine Vorbemerkungen Bewertungsgrundlagen Grundbegriffe instandhaltungsgerechter Konstruktion Instandhaltbarkeit und Produktsicherheit Instandhaltbarkeit und Umweltverträglichkeit Instandhaltbarkeit und Wirtschaftlichkeit Instandhaltungsstrategien und -ebenen Gestaltungsrichtlinien Kennzahlen in der Instandhaltung Instandhaltbarkeitsnachweis Instandhaltbarkeitsdatensysteme Vertragliche Regelungen Zusammenfassung Übungs- und Kontrollfragen Quellenverzeichnis Schadensanalyse und Schwachstellenbeseitigung Begriffe Grundlagen der Tribologie und der Theorie der Schädigung Tribotechnische Systeme Gebrauchswertmindernde Prozesse Abnutzungseffekte Allgemeiner Überblick Tribologische Beanspruchungen Reibung Verschleiß Korrosion Schadensanalyse (Instandhaltungsorientierte Analyse der Schädigung) Bedeutung der Schadensanalyse Ziel und Inhalt der instandhaltungsorientierten Schadensanalyse
9 Inhalt XI Durchführung der Schadensanalyse Schwachstellenermittlung und Schadensbeseitigung Methodik zur optimalen tribotechnischen Werkstoffauswahl, dargestellt an einem Beispiel Übungs- und Kontrollfragen Quellenverzeichnis Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit als Instandhaltungsziele Rechtsbeziehungen zum Instandhaltungsobjekt Gefahren- und Sicherheitsanalyse für Arbeitsplätze in der Anlageninstandhaltung Sicherheits- und Umweltschutzmanagement als Aufgabe der Integrierten add Instandhaltung Sicherheitsmanagement in Dienstleistungsverträgen Übungs- und Kontrollfragen Quellenverzeichnis Grundlagen der Zuverlässigkeitstheorie Einführung Wahrscheinlichkeitsfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichte Definitionen und Grundbegriffe des Ausfallgeschehens Bewertung von Ausfällen Grundmodell der induktiven Statistik Klassifizierung von Merkmalen Klassifizierung von Verteilungen Definition des Vertrauensbereichs Definition des Zufallsstreubereichs Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsfunktion Statistische Kenngrößen Lebensdauerstatistiken, Bestimmung und Kennwerte des Ausfallverhaltens Wichtige Verteilungen Diskrete Verteilungen Wichtige kontinuierliche Verteilungen Verteilungsfreie Korrelationsrechnung Quantitative Zuverlässigkeitskenngrößen Ausfallwahrscheinlichkeit Überlebenswahrscheinlichkeit (Zuverlässigkeit) Ausfallhäufigkeitsdichte der Lebensdauer Ausfallrate Verfügbarkeit Eigenschaften und Berechnung der Zuverlässigkeit Eigenschaften der Zuverlässigkeit Ausfallarten
10 XII Inhalt 5.6 Erneuerungsprozesse Zuverlässigkeitsprozess mit und ohne Erneuerung Arten von Erneuerungsprozessen Herleitung der Erneuerungsgleichung Spezielle Erneuerungsfunktionen Charakteristische Funktionen Systemzuverlässigkeits- und Schwachstellenermittlung von Produktionssystemen Problemstellung Zuverlässigkeitsanalysen für Systeme Zuverlässigkeitstheoretische Grundstrukturen Möglichkeiten der Schwachstellenermittlung Berechnungsvorschriften zur Ermittlung der Systemzuverlässigkeit Ermittlung von Schwachstellen Zuverlässigkeit und Redundanz Übungs- und Kontrollfragen Übungsaufgaben Quellenverzeichnis Planung und Optimierung von Instandhaltungsstrategien für Elemente und Systeme Grundlagen der Strategieentwicklung Festlegung des Untersuchungsbereichs Grundsätzliche Methoden der Instandhaltung Instandhaltungsstrategische Begriffe und Definitionen Grundstrategien Vor- und Nachteile geplanter Instandhaltung Bestimmung der optimalen Instandhaltungsmethode für Elemente Planung der Instandhaltung für eine Betrachtungseinheit (Einzelteil oder Baugruppe) Bestimmung der Weibull-Parameter Verfahren zur Ermittlung der Parameter der Weibull-Verteilung Bestimmung der Anpassungsgüte m. H. parameterfreier stastistischer Tests Instandhaltungsmodelle Definition der Planungsbasis Ermittlung der Instandhaltungskosten Bestimmung optimaler Instandhaltungsstrategien für Elemente von Produktionssystemen Planung und Optimierung von Instandhaltungsstrategien für Maschinen bzw. Anlagensysteme Übungs- und Kontrollfragen
11 Inhalt XIII 6.5 Übungsaufgaben Quellenverzeichnis Strukturierung und Dimensionierung von Instandhaltungswerkstätten Planungsgrundsätze Flexibilität von Instandhaltungswerkstätten als Gestaltungsaufgabe Strukturansatz für Instandhaltungswerkstätten Definition Funktionsbestimmung Morphologie von Instandhaltungswerkstätten Planungsansätze zur Dimensionierung von Instandhaltungswerkstätten Definition Deterministische Ansätze Bedienungstheoretische Ansätze Simulation versus analytische Modellierung Simulationsmodelle Analytische Modelle Dimensionierung von Instandhaltungswerkstätten add m. H. bedienungstheoretischer Modelle Markov-Ketten zur Abbildung von Geburts- und Todesprozessen Grundsätzliche Einteilung Modellierung von Werkstätten als offene Bedienungssysteme Instandhaltungswerkstätten als geschlossene Wartesysteme Strukturierung von Instandhaltungswerkstätten Grundlegendes Ermittlung des Ausrüstungsbedarfs Einkauf von Werkstattbedarf Gestaltung Die Kompetenzzelle als Denkansatz Instandhaltungswerkstatt als Kompetenzzelle Layout-Planung Ressourcenplanung von externen Instandhaltungsstrukturen add in Produktionsnetzwerken Dimensionierungsproblematik Lösungsansatz Grundlagen der Gestaltung von Instandhaltungsarbeitsplätzen Gefährdungs- und Belastungsfaktoren mit instandhaltungstypischen Ursachen Ergonomische Anforderungen Arbeitsplatzanforderungen
12 XIV Inhalt Probleme von Alleinarbeit bei der Instandhaltung, Wartung und Inspektion Umweltschutz für Instandhaltungswerkstätten Übungs- und Kontrollfragen Übungsaufgaben Quellenverzeichnis Organisationsstrukturen von Instandhaltungsbereichen im Unternehmen Ziele und Prinzipien der Organisationsgestaltung in der Instandhaltung Ziel der Aufbauorganisation Prinzipien einer effizienten Instandhaltungsaufbauorganisation Organisationsmodelle Ablauforganisation Fremdvergabe Make-or-Buy-Entscheidungen Anforderungen an eine zweckmäßige Organisationsstruktur in der Instandhaltung Lösungsansätze in den KMU Übertragung von Instandhaltungsaufgaben an Produktionsteams Gestaltung von Dienstleistungsverträgen Planung und Abrechnung von Instandhaltungsprojekten Grundsätze für die Instandhaltungsplanung Vorbereitungsmanagement von Instandhaltungsprojekten Abrechnung von Instandhaltungsprojekten im Unternehmen Personalmanagement in Instandhaltungsprojekten Vergleichende Betrachtung der Organisationsformen Übungs- und Kontrollfragen Quellenverzeichnis Ersatzteilmanagement Grundlagen Definitionen Aufgabe und Zielstellung des Ersatzteilmanagements Leistungsebenen im Rahmen des Ersatzteilmanagements Grundproblem der Ersatzteillogistik Ersatzteilypisierung Ersatzteilorganisation Verantwortlichkeiten und Voraussetzungen Ersatzteilmanagement Klassifizierung von Ersatzteilen
13 Inhalt XV Ersatzteilverzeichnisse Ersatzteillisten Ersatzteilverwendungsnachweis Ersatzteilplanung Informationen der Ersatzteilewirtschaft zum Ausfallverhalten als Entscheidungsgrundlage Informationsbasis Ersatzteilebewirtschaftung Lagerhaltungssysteme Bestellmengenverfahren zur logistischen Ersatzteilebewirtschaftung Ersatzteilewirtschaftliche Analyseinstrumente und Effektivitätsmaße Algorithmus zur Ersatzteilbewirtschaftung Randbedingungen Berechnung von Effektivitätskenngrößen Kennziffern zur Erfolgsmessung Übungs- und Kontrollfragen Übungsaufgaben Quellenverzeichnis Kennzahlen zur Beurteilung der Instandhaltung Ausgangssituation Aufgabencluster der Instandhaltung Die Instandhaltung als Wertschöpfungsintegrator Die Instandhaltung als technischer Dienstleister an der Wertkette mit Modernisierungs- und Anpassungsfunktion Die Instandhaltung als proaktiv agierende Wertschöpfungsstruktur Die Instandhaltung als integrierte Wertschöpfungsstruktur Die Instandhaltung als Reparaturbereich Geeignete Kennzahlen zur Beurteilung der Instandhaltung Gesamtanlageneffektivität Instandhaltungskenngrößen Wirtschaftliche Kennziffern Methoden zur Erschließung von Verschwendungspotenzialen Übungs- und Kontrollfragen Übungsaufgaben Quellenverzeichnis Anhang Sachverzeichnis
14 Kurzzeichenverzeichnis Kurzzeichen (Dimension) Erläuterung Kapitel 1 ET A (ZE) ET R (ZE) K r (GE, ME) L P (ME/ZE) N Aus (ME) N G (, %) N IST (ME) N SOLL (ME) n (ME) T Soll (ZE) T St (ZE) T p (ZE) T Plan (ZE) T Tech (ZE) V (, %) V Ausl (, %) V D (, %) V eff (, %) V Prod (, %) V Qal (, %) Mittlere Zeitdauer des störungsfreien Einsatzes einer BE Mittlere Reparaturdauer einer ausgefallenen BE Ressourceneinsatz Mittlere Produktionsleistung Ausschussmenge Nutzungsgrad Ist-Menge Soll-Menge Anzahl der BE Soll-Laufzeit Stillstandszeit Stillstandszeit für geplante Instandhaltung Geplante Maschinenbelegungszeit Technologisch und technisch bedingte Stillstandszeit Verfügbarkeit, allgemein Auslastungsverfügbarkeit Dauerverfügbarkeit Effektive Verfügbarkeit Produktionsverfügbarkeit Qualitätsverfügbarkeit Kapitel 3 a V (mm) b (mm) Verschleißmarkenbreite Breite XVII
15 XVIII c (μm) d N (mm) D (mm) E 0 (N/mm 2 ) E r (N/mm 2 ) F (N) F G (N) F N (N) F R (N) f (-) G (N/mm 2 ) H (N/mm 2 ) k V (μm 3 /Nm) L(t) (N/m 2 ) n (min 1 ) r (mm) s e (mm, μm) T u ( C) P R (J/s) W V (μm 3 ) p(t) (N/m 2 ) p ms (t) (N/m 2 ) γ (μm) ε 1 ( μm) ε el ( μm) ε r ( μm) ε v ( μm) η (Nsm 2 ) η μ R σ (N/mm 2 ) τ e (N/mm 2 ) ψ (μm) Kurzzeichenverzeichnis Kritische Risslänge Nenndurchmesser Durchmesser E-Modul Relaxationsmodul Lagerkraft Gewichtskraft Normalkraft Reibungskraft Reibungszahl Schubmodul Härte Verschleißkoeffizient Schallpegel Drehzahl Radius Gleitweg Temperatur Reibleistung Verschleißvolumen Schalldruck, allgemein Energetisch gemittelter Schalldruckverlauf Teilchengröße Versagensdehnung Elastische Deformation Viskoelastische Deformation Plastische Deformation Viskosität Linienverteilung der Rauheitshügel Gleitreibungszahl Spannung Versetzungsschubspannung Lagerspiel Kapitel 5 A (ME) A(t) (ME; ZE, GE (pro Per.)) a(t) (ZE 1 ) A V (, %) a (ZE) B b C Durchschnittliche Ausfallanzahl Verlustfunktion Momentane Ausfallintensität Abnutzungsvorrat Maßstabsparameter der Weibull-Verteilung Bestimmtheitsmaß Formparameter der Weibull-Verteilung Eulersche Konstante
16 Kurzzeichenverzeichnis XIX c (ZE) Ortsparameter der dreiparametrischen Weibull- Verteilung (ausfallfreie Zeit) COV Kovarianz ˆD Prüfquotient D 1-α,n Testgröße D max Maximale Differenz der Testgröße D(t) Diagnosefunktion E(x) (ZE) Erwartungswert einer Zufallsvariablen ET B (ZE, h) Mittlere Betriebszeit f (t) Ausfallwahrscheinlichkeitsdichte F B Hypothetische Ausfallwahrscheinlichkeit F E Empirische Ausfallwahrscheinlichkeit F t Summenhäufigkeit F(t) Ausfallwahrscheinlichkeitsfunktion F emp (t) Empirische Ausfallwahrscheinlichkeitsfunktion g 1 Schiefe g 2 Exzess (Wölbung) H(t) (ZE 1 ) Erneuerungsfunktion h(t) (ZE 1 ) Erneuerungsdichtefunktion h abs Absolute Häufigkeit h rel Relative Häufigkeit K 1-α,n Vergleichsgröße K V (t) (GE) Kostenfunktion ka I (GE/ZE) Instandhaltungskosten ka II (GE/ZE) Verluste k b (GE/ZE) Befundabhängige Instandsetzung m(t) (ME) Anzahl der funktionsfähigen Elemente zum Zeitpunkt t m r Momentenkoeffizient N, n (ME) Stichprobenumfang P(t) Ausfallwahrscheinlichkeitsfunktion R (ME, ZE) Range, Spannweite R(t) Überlebenswahrscheinlichkeits-, Zuverlässigkeitsfunktion R S (t) Systemzuverlässigkeitsfunktion r Korrelationskoeffizient r P Spearmans-Rangkorrelationskoeffizient S(t*) Schwachstellenkoeffizient S (, %) Signifikanzniveau, statistische Sicherheit s (ZE, GE) Standardabweichung T (ZE) Lebensdauer T A (ZE) Alter einer BE T B (ZE) Betriebsdauer T B γ (ZE) Gamma-prozentuale Lebensdauer T Plan (ZE) Planungszeitpunkt T VI (ZE) Geplantes Instandhaltungsintervall
17 XX T st (ZE) t A (ZE) t R (ZE) t WR (ZE) t WV (ZE) u z VAR v W X x x Med x Mod ȳ Ɣ(x) γ H (ZE 1 ) (t) λ (ZE 1 ) λ(t) μ (ZE) ρ σ (ZE, ME, %) Kurzzeichenverzeichnis Stillstandszeit Ausfallzeitpunkt Reparaturdauer Wartezeit auf Instandhaltung Unproduktive Zeit Vertrauensbereich Varianz Variationskoeffizient Wahrscheinlichkeit Zufallsvariable Mittelwert, Erwartungswert einer Variablen Median Modalwert Mittelwert, Erwartungswert einer Variablen Gammafunktion Harmonisches Mittel Integrierte Ausfallrate Verlustfunktion Ausfallrate Verlustfunktion Mittlere Betriebsdauer der Grundgesamtheit Korrelationskoeffizient Standardabweichung der Grundgesamtheit Kapitel 6 a (ZE) B B K (ZE) b b median b O b U c (ZE) EL W (ME) ET B (ZE) ET W (ZE) ET Z (GE) Et A (ZE) Et B (ZE) EK (GE) EK V (GE) Maßstabsparameter der Weibull-Verteilung Bestimmtheitsmaß Klassenbreite Formparameter der Weibull-Verteilung Median des Formparameters Weibull-Verteilung Obergrenze des Formparameters der Weibull- Verteilung Untergrenze des Formparameters der Weibull- Verteilung Ortsparameter der dreiparametrischen Weibull- Verteilung Warteschlangenlänge Erwartete Betriebsdauer Mittlere Wartezeit Erwarteter Zyklus Mittlerer Ankunftsabstand Mittlere Bedienzeit, mittlere Servicezeit Erwartete Kosten Erwartete Verluste
18 Kurzzeichenverzeichnis F(t) G(t) H(t) (ZE 1 ) K AFA (GE/Per.) K En (GE/Per.) K E (GE/ME) K e (GE/Maßnahme) K g (GE) K IH (GE/ZE) K IHGes (GE/BE, GE/Per.) K L (GE/ZE) K LST (GE/ZE) K MST (GE/ZE) K R (GE/ZE) K Raum (GE/m 3 u. R.) K V (GE/ZE) k a (GE/ZE) k b (GE/ZE) k LD (GE/ZE) k dk (GE/ZE) k LS (GE/ZE) k LZ (GE/ZE) k Mat (GE/Maßn., GE/Per.) k d (GE/ZE) k e (GE/ZE) k f (GE/ZE) k p (GE/ZE) k pk (GE/ZE) k z (GE/ZE) L(t) m G m opt P (GE/ME) P G p i R(t) (, %) R S (t) (, %) r s (ZE, ME, %) T (ZE/Per.) T B (ZE) XXI Ausfallwahrscheinlichkeitsfunktion Zeitlicher Verlauf eines Gebrauchsparameters Erneuerungsfunktion (durchschnittliche Anzahl der Ausfälle bei vollständiger Instandsetzung nach Ausfall) Abschreibungskosten Energiekosten Ersatzteilekosten Kosten für eine BE bei Einzelinstandsetzung Kosten für eine BE bei Gruppeninstandsetzung Instandhaltungskosten Instandhaltungsgesamtkosten Lagerhaltungskosten Lagerkostensatz Maschinenstundensatz Reparatur- bzw. Servicekosten Raumkosten Stillstandskosten, Verluste Instandhaltungskosten für Ausfallmethode Kosten der Inspektion (nach Befundung) Durchschnittslohn des Bedienpersonals Kosten der kontinuierlichen Diagnose Lohnkostensatz der Instandhalters Überstundenzuschlag Materialkosten Instandhaltungskosten im Falle der Inspektionsmethode (Diagnose) Kosten der Eigeninstandhaltung Kosten der Fremdinstandsetzung Kosten für Präventivinstandsetzung Kosten der periodischen Diagnose Zusätzliche Kosten und Verluste Likelyhood-Funktion Ganzzahliges Vielfaches des Elementarzyklus Optimales Verhältnis der Zeitintervalle für Präventivinstandsetzung und Inspektionsdiagnose Preis des Produkts, Einstandspreis Ranggrößenverteilung Übergangswahrscheinlichkeit Zuverlässigkeit, Überlebenswahrscheinlichkeit Systemzuverlässigkeitsfunktion Korrelationskoeffizient Standardabweichung Betriebszeit Betriebsdauer
19 XXII T IHges (ZE) T Inst (ZE) T L (ZE/Per.) T Min (ZE) t median (ZE) T npf (ZE) T PBj (ZE) T Plan (ZE) T PVI (ZE) T Renuda (ZE) T Rj (ZE) T tech (ZE) t L (ZE) t 0 (ZE) t opt (ZE) t p (ZE) t O (ZE) t ra (ZE) t sa (ZE) t st (ZE) t U (ZE) t r (ZE/Maßn.) U V (, %) V(t) (, %) V dp V t (s) (, %) V P (t), V K (t) V t (, %) V tmax (, %) V t Var(x) (, %) v W q (ZE) Z(x) Z A z AK (ME) Z erfüllt (ME) Z ges (ME) Z P (t), Z K (t) (ME) α Ɣ(x) Kurzzeichenverzeichnis Instandhaltungsgesamtzeitaufwand Instandhaltungszeitaufwand Maschinenlaufzeit Mindestlebensdauer Median der Betriebszeit Instandhaltungszeitaufwand in der nicht produktionsfreien Zeit Personaleinsatzzeit der Berufsgruppe j Plan-Betriebszeit Geplanter Instandsetzungszeitpunkt Restnutzungsdauer Mittlerer Arbeitszeitaufwand der Berufsgruppe j Technologisch bedingte Stillstandszeit Pufferzeit Ausfallfreie Zeit Optimales Instandhaltungsintervall Instandsetzungszeit bei Präventivmethode Obergrenze der mittleren Betriebsdauer Instandsetzungszeit bei Ausfallmethode Stillstandszeit bei Ausfall der BE Stillstandszeit Untergrenze der mittleren Betriebsdauer Reparaturdauer Umfang einer Instandhaltungsmaßnahme Verfügbarkeit, allgemein Verlustfunktion Zahl der verhinderten Ausfälle Technische Verfügbarkeit Mittlere Anzahl der durch periodische/ kontinuierliche Inspektion verhinderten Ausfälle Technische Verfügbarkeit Maximale technische Verfügbarkeit Nichtverfügbarkeit Varianz Variationskoeffizient Wartezeit Zielfunktion Zahl der Ausfälle Anzahl der Instandhaltungsarbeitsplätze Erwartungswert der unverzüglich erfüllten Aufträge Gesamtzahl der Aufträge Mittlere Anzahl der Ausfälle, die trotz periodischer/ kontinuierlicher Inspektion noch auftreten Beschäftigungskoeffizient Gammafunktion
20 Kurzzeichenverzeichnis ϕ η ϑ κ (ME/Per.) (ZE 1 ) μ (ZE 1 ) μ 0, μ U ν (ZE 1 ) ψ τ E (ZE) XXIII Spezifischer Kostenfaktor Koordinierungsfaktor Diagnosewirkungsgrad Kostenverhältnis Integrierte Ausfallrate Anzahl der Ausfälle Bedienrate, Servicerate Obere, untere Bereichsgrenze (Studentverteilung) Ankunftsrate Überlegenheitsfaktor Elementarzyklus Kapitel 7 A F (m 2 ) A MA (m 2 ) A MG (m 2 ) A T (m 2 ) A Z (m 2 ) A ZL (m 2 ) B M (m, mm) B MA (m, mm) C E (ZE/Per.) C E (ZE/Per.) C fk (GE/KE) C IST (ZE/Per.) C N (ZE/Per.) C N (ZE/Per.) C V (ZE, GE) EL B (ME) EL V (ME) EL W (ME) EM (ME) EN (ME) ET A (ZE) Fertigungsfläche Maschinenarbeitsplatzfläche Maschinengrundfläche Transport- und Verkehrsfläche Zusatzfläche Zwischenlagerfertigungsfläche Maschinenbreite Breite des Maschinenarbeitsplatzes Direkt an das Serviceunternehmen herangetragene Einzelaufträge Direkt an die Netzwerkpartner gerichtete Kapazitätsnachfrage Vorläufige Reservierung kurzfristig reservierbarer Instandhaltungskapazität für das Netzwerk tatsächlich zur Verfügung gestellte Kapazität Kapazitätsnachfrage des Netzwerks Vom Produktionsnetzwerk insgesamt nachgefragte Kapazität Vertraglich gebundene Reservierung von Pool- Kapazität Mittle Zahl der in Reparatur befindlichen Forderungen Mittle Zahl der im System verweilenden Forderungen Mittlere Warteschlangenlänge Durchschnittlich im Lager gebundene Güter Mittlere Anzahl der Forderungen im System Erwartungswert der Ankunftsabstände der Forderungen
21 XXIV ET B (ZE) ET R (ZE) ET V (ZE) ET W (ZE) EN (ME) E(e E ) E(e kf ) (GE/Per.) E(e V ) (GE/Per.) E(K IH ) (GE/Per.) EK S (GE/Per.) E(X IST ) (KE) E(X S ) (GE/Per.) f 1, f 2 f(c E ) f(c N ) f(p E ) f(p kf ) g a g(t) K r (GE/ZE) K W (GE) k B (GE/ZE) k E (GE/Per.) k F (GE/ZE) k f (GE/ZE) k IH (GE) k LD (GE/ZE) k LS (GE/ZE) k LST (GE/ZE) k LZ (GE/ZE) k Mat (GE/ME) K MST (GE/ZE) k Min (GE/ZE) Kurzzeichenverzeichnis Erwartungswert der Bediendauer (stetige Zufallsgröße) Mittlere Reparaturdauer Mittlere Verweildauer einer Forderung Mittlere Wartedauer einer Forderung Mittlere Anzahl im System verweilender Forderungen Erwartete Erlöse aus direkt an den Netzwerkpartner herangetragenen Aufträgen Erwartete Erlöse für kurzfristig reservierte Kapazität (ergeben sich aus der Behebung plötzlich aufgetretener technischer Störungen Erwartete Erlöse aus der vertraglich gebundenen Kapazität Erwartete Kosten der Kapazitätsnutzung Erwartete Strafkosten Erwartungswert der tatsächlich erfüllten (unsicheren) Pool-Kapazitätsnachfrage Erwartetes Poolkapazitätsdefizit Zuschlagsfaktoren (Bedienung, Wartung) Verteilung der direkt an die Netzwerkpartner gerichtete Kapazitätsnachfrage Verteilung der vom Produktionsnetzwerk insgesamt nachgefragten Kapazität Verteilung der direkt an das Instandhaltungsunternehmen gerichtete Kapazitätsnachfrage Verteilung kurzfristig reservierbarer Kapazität Energetischer Ausnutzungsgrad Instandhaltbarkeitsdichte Kosten des Ressourceneinsatzes Wartezeitkosten Kosten für einen im Einsatz befindlichen Instandhaltungstechniker Energiekosten Kosten für einen nicht im Einsatz befindlichen Instandhaltungstechniker (Leerkosten) Kosten für FremdInstandhaltung Kosten der Instandhaltungsmaßnahme Durchschnittslohn des Bedienpersonals Lohnkostensatz des Instandhalters Lagerhaltungskostensatz Überstundenzuschlag Materialkosten Maschinenstundensatz Kosten für eine Minimalinstandsetzung
22 Kurzzeichenverzeichnis XXV k pv (GE/ZE) Kosten für geplante (vollständige) Instandsetzung k v (GE/ZE) Kosten für den Verlust einer Forderung k W (GE/ZE) Kosten für eine auf Instandhaltung wartende Maschine k Z (GE/ZE) Zusätzliche Kosten und Verluste durch Ab- und Anfahren der BE L P (ME/ZE) Mittlere Produktionsleistung L Wzul (ME) Zulässige Warteschlangenlänge m Kostenverhältnis n (ME) Anzahl der Elemente eines Systems, Anzahl der BE p a (GE/KWh) Arbeitspreis p i Zustandswahrscheinlichkeit p (GE/KE) Entgelt für die Inanspruchnahme von Instandhaltungskapazitäten p E (GE/ KE) Entgelte für direkt an die Netzwerkpartner gerichtete Kapazitätsnachfrage p E (GE) Ersatzteilepreis p kf (GE/KE) Entgelt für die Inanspruchnahme von kurzfristig reservierbarer Instandhaltungskapazität p Res (GE/KE) Reservierungsentgelt p U, NP (GE/KE) Nutzungsentgelt, das der Instandhalter für die unsichere Inan-spruchnahme aus dem Netzwerk erhält p V Wahrscheinlichkeit, dass eine Forderung im System verweilt p N (GE/KE) Nutzungsentgelt für die vertraglich gebundene Reservierung von Instandhaltungskapazität (sichere Inanspruchnahme) p o Leerwahrscheinlichkeit p W Wartewahrscheinlichkeit s (AK, APL) Anzahl der Instandhalter/ Instandhaltungsarbeitsplätze T M (mm) Maschinentiefe T MA (mm) Tiefe des Maschinenarbeitsplatzes T Plan (h/a u. Masch.) Geplante Maschinenbelegungszeit T R (ZE/Maßn.) Reparaturdauer T W (ZE) Wartezeit T WZul (ZE) Zulässige Wartedauer einer Forderung t am (ZE) Instandsetzungszeit bei Minimalinstandsetzung nach Ausfall t av (ZE) Instandsetzungszeit bei vollständiger Instandsetzung nach Ausfall (vollständige Erneuerung) t Ist (ZE) Tatsächliche Takt-(Zyklus-)zeit mit der die Anlage betrieben wird t L (ZE) Zeitdauer für die Aufrechterhaltung der Produktion t 0 (ZE) Ausfallfreie Zeit t wu (ZE) Wartezeit auf Instandhaltung, unproduktive Zeit
23 XXVI Kurzzeichenverzeichnis V(ET B ) Warteschlangenlänge (allgemeiner Fall) v Variationskoeffizient v A Variationskoeffizient der Ankunftsabstände der Forderungen v B Variationskoeffizient der Bedienzeiten der Forderungen W q (t) Wartewahrscheinlichkeitsfunktion x i Zufallsvariable i z (ME) Anzahl der Betrachtungseinheiten z AK ME Anzahl der vor Ort gleichzeitig eingesetztenarbeitskräfte z AKInst (ME) Anzahl der eingesetzten Instandhaltungsmitarbeiter für die Anlage z APL (ME) Anzahl der Arbeitsplätze α Beschäftigungskoeffizient V Verfügbarkeitszuwachs γ (ZE 1 ) Ausfallintensität (Kehrwert der charakteristischen Lebensdauer a) Ɣ(x) Gammafunktion t (ZE) Zeitintervall P (ME/ZE) Produktivitätsschub η (, %) Bedienungstheoretischer Auslastungsgrad η B (, %) Ausnutzungsgrad η D (, %) Bedienungstheoretischer Auslastungsfaktor, deterministisch η GI (, %) Bedienungstheoretischer Auslastungsfaktor, allgemein η M (, %) Bedienungstheoretischer Auslastungsfaktor (markovsch) λ (ZE 1 ) Generationsrate des Bereiches μ (ZE 1 ) Bedienintensität, Reparaturintensität μ(t) (ZE 1 ) Instandhaltungsrate ν, λ (ZE 1 ) Forderungsintensität ρ (, %) Belastungsfaktor σ Streuung τ (ZE) Entscheidungsvariable ω (, %) Nichtausnutzungskoeffizient ξ (, %) Auslastungsgrad, Belastungsfaktor (offene Bediensysteme) Kapitel 9 B (ME/ZE) B adhoc (ME, GE) Bedarf (Verbrauch) in der Periode Erwartungswert des sofort (ad hoc) befriedigten Bedarfs
24 Kurzzeichenverzeichnis B akt (ME/ZE) B ges (ME/ZE) B D,geg (ME/ZE) B D,verg (ME/ZE) B i, tat (ME) B L (ME) B Plan (ME) b M (ME) b t (ME) E(D) (ME/Per.) E(Y) (ME/Per.) EL b (ME) ET D (ZE) K Z (GE) K IH (GE/KE) K S (GE/KE) K tτ (GE/ZE) k k Best (GE/Bestell-vorgang) k ft (GE/Bestell-vorgang) k LT (GE/ME) L (ME/ZE) l t (ME) M max (ME) M N (ME) M opt (ME) M s (ME) M vorh (ME) M wbt (ME) n W POS p E (GE/ME) Q (GE) q (ME) q opt (ME) q t (ME) R W (ME) ROS r opt (ME) SDT (ZE) XXVII Aktueller Bedarf Gesamtbedarf Gegenwärtiger, gewichteter durchschnittlicher Bedarf Exponentiell gewichteter, gleitender Durchschnitt des Bedarfs der vergangenen Periode Tatsächlich eingetretener Bedarf (Nachfrage) Durchschnittlicher Lagerbestand Auf Basis von Vergangenheitsdaten prognostizierter Bedarf (Verbrauchsrate) Ersatzteilebedarf Bedarf in der Periode t =1,...,T (Nachfrage in Periode t) Mittler Periodennachfragemenge Wahrscheinliche Nachfragemenge Mittlerer Lagerbestand Durchschnittliche Lagerdauer (Umschlagsdauer), Zinskosten Instandhaltungskosten Strafkostensatz Mittlere Lagerhaltungskosten Sicherheitsfaktor Bestellkosten Fixe Bestellkosten in Periode t Lagerhaltungskosten Produktionsmenge Lagerbestand während der Periode t Maximalbestand Nachschub- bzw. Bestellmenge Optimale Bestellmenge Sicherheitsbestand Aktueller Bestand Verbrauch in der Wiederbeschaffungszeit Anzahl der Wartenden Forderungen Probability of Stockout (Ersatzteilenichtverfügbarkeit) Einstandspreis für das Ersatzteil Bestellmenge Bedarf Optimale Bestellmenge Für Periode t zu bestellende Menge (wird zu Beginn von t eingelagert) Lagerreichweite Risk of Shortage (Ersatzteilenichtverfügbarkeit) Disponibler Lagerbestand Supply Delay Time
25 XXVIII Kurzzeichenverzeichnis S (ME) Lagerbestandshöchstwert, Anzahl der Kreislaufreserven s (ME) Lagerbestand, ab dem bestellt wird s B (ME) Sicherheitsbestand T (ZE) Periode T K (ZE) Kreislaufzeit T L (ZE) Instandsetzungskreislauf einschl. Transportzeiten T La (ZE) Lagerzeit t wb (ZE) Wiederbeschaffungszeit +t Bs (ZE) Bestellzeitpunkt t Plan (ZE) Geplante Takt-(Zyklus-)zeit V Lager (m 3 ) Lagervolumen V SP (, %) Ersatzteileverfügbarkeit V(t) Verlustfunktion W BW (GE) Wiederbeschaffungswert WT (ZE) Waiting Time Y (ME) Nachfragemenge Z E (Stück/BE) Anzahl gleicher Ersatzteile Z erf ülltc (ME) Erwartungswert der unverzüglich erfüllten Aufträge Z ges (ME) Gesamtzahl der Aufträge z t Binärvariable Z TB (ME) Erwartungswert der Zahl der Perioden mit Lieferbereitschaft Z T,Ges (ME) Gesamtzahl der Perioden Z TS (ME) Gesamtzahl der Perioden Z U Umschlagshäufigkeit (Schlagzahl) Z W (ME) Anzahl zurückgestellter Forderungen Z WBTF (ME) Anzahl der Wiederbeschaffungszeiträume Z WBges (ME) Gesamtzahl der Wiederbeschaffungszeiträume α g Glättungsfaktor α Sg α-servicegrad β Sg β Servicegrad γ Sg γ Servicegrad δ Sg δ Servicegrad λ(ze 1 ) Bedarfsrate η Serv Externer Servicegrad ω Serv Servicegrad ω L Lieferbereitschaft ω Q Sendungsqualität Termintreue ω T Kapitel 10 A IHges (GE, ZE) Während der Nutzung angefallener Instandhaltungsgesamtaufwand
26 Kurzzeichenverzeichnis G AB (, %) G IHges (GE) G Inst (, %) G P (, %) G(t) (, %) G PM (t) (, %) G R (t) (, %) GEFF (, %) I R (, %) I Q (, %) K IHges (GE/Peri.) L G (, %) MTBA (ZE) MTBF (ZE) MTTF (ZE) MTTM (ZE) MTTPM (ZE) MTTR S (ZE) MWT (ZE) N G (, %) n (ME/Per.) n Aus (ME/Per.) n ges (ME/Per.) n Nach (ME/Per.) P Fremd (ZE, GE) P Gesamt (ZE, GE) Q Anl (, %) Q G (, %) Q L (, %) S Q (, %) T B (ZE) T IHges (ZE) T IH (ZE) T Ist (ZE/Per.) T npf (ZE/Per.) T tech (ZE/Pei.) T Plan (ZE/Per.) W BW (GE/Objekt) λ(ze 1 ) μ(t) (ZE 1 ) XXIX Abhängigkeitsgrad Instandhaltungsaufwand einer Anlage Instandhaltungsgrad Produktionsbehinderungsgrad Verteilungsfunktion der Instandhaltungsdauer Wartbarkeit und Instandsetzbarkeit Reparierbarkeit Gesamtanlageneffektivität Instandhaltungskostenrate Instandhaltungsquote Instandhaltungsgesamtkosten Leistungsgrad Meantime between Arising Mean Time BetweenFailure (mittlere ausfallfreie Zeit) Mean Time To Failure (mittlere ausfallfreie Zeit) Mean Time To Maintenance (mittlere Reparaturdauer) Mean Time To Preventive Maintenance (mittlere Instandsetzungsdauer) Mittelwert der Reparaturzeit des Systems Mean Waiting Time Nutzungsgrad Produktionsmenge Ausschussteile insgesamt gefertigte Teile, Nachzuarbeitende Teile Instandhaltungsfremdleistung Instandhaltungsgesamtleistung Anlagenbewirtschaftungsquote Qualitätsgrad Störungsbedingte Minderleistungsquote Stillstandsquote Betriebszeit, ausfallfreie Zeit Instandhaltungszeitaufwand für die Anlage Instandhaltungszeitaufwand Tatsächliche Nutzungszeit (Ist-Zeit) Instandhaltungsaufwand in der nicht produktionsfreien Zeit Technisch bedingte Ausfallzeit Planbelegungszeit Wiederbeschaffungswert Bedarfsrate Instandhaltungsrate
27 XXX Kurzzeichenverzeichnis Abkürzungen AK APL BE BSC FCFS FEM FIFO GE GK IH IS EMAS LCFS LW LIFO ME Per TPM VWP W ZE Erläuterung Arbeitskraft Arbeitsplatz Betrachtungseinheit Balanced Score Card First Come-First Served Finite-Elemente-Methode First In-First Out Geldeinheit Gemeinkosten Instandhaltung Instandsetzung Eco-Management and Audit Scheme Last Come-First Served Lastwechsel Last In-First Out Mengeneinheit, Menge Periode Total Productive Maintenance Vorrichtungen, Werkzeuge, Prüfmittel Wahrscheinlichkeit Zeiteinheit (Jahre, Monate, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden) Tief gestellte Indizes i, j Laufvariable a Ausfallinstandsetzung b Befundabhängige Instandhaltung d Diagnose des Schädigungszustandes e Eigeninstandhaltung f Fremdinstandhaltung k Kontinuierlich M Minimalinstandsetzung P Prophylaktisch, Präventivinstandsetzung p Periodisch s Starrer (periodischer) Zyklus v Vollständige Instandsetzung Hoch gestellte Indizes I Kosten (im engeren Sinn)
28 Abbildungsverzeichnis 1.1 Begriffe der Instandhaltung. (Nach DIN 31051) Strategische Einordnung der Instandhaltungsziele Regelkreis des Instandhaltungsmanagements Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Instandhaltung Verlauf der ertragsgesetzlichen Produktionsfunktion Einfluss des Instandhaltungsaufwandes auf ausgewählte Leistungskenngrößen Produktionsfunktion der Instandhaltung Arbeitsziele der Instandhaltung Bestandteile der Produktqualität Instandhaltung als Bestandteil des Qualitätsmanagements Qualitätssicherung im Instandhaltungsbereich Entwicklung der Instandhaltung Instandhaltung als Kernelement eines nachhaltigen Verfügbarkeitsmanagements Möglichkeiten der Herstellung von Abnutzungsvorrat nach Ausfall Verlauf der Abnutzungskurve. (Modifiziert nach DIN 31051) Maschinenüberwachung und Fehlerdiagnose Struktur einer Wartungs-/Inspektionsmaßnahme Wartungs- und Inspektionsplanung Regelkreismodell der Wartungs- und Inspektionsplanung Grunddaten einer Instandsetzungsmaßnahme Durchführungsmöglichkeiten der Instandsetzung. (Nach DIN 31051) Bestimmung einer Schwachstelle nach DIN Gestaltungsrichtlinien Regelkreis der Erarbeitung von Kennziffern Genereller Kennzahlenbildungsprozess Kennzahlenbildung zur Instandhaltungssteuerung Mögliche Schädigungsverläufe einer Betrachtungseinheit Unterschiedliche Verläufe der Ausfallrate Aufbau einer technischen Oberfläche XXXI
29 XXXII Abbildungsverzeichnis 3.4 Viskoelastische (volumenbezogene) Deformation (Burger-Modell) Feder-Dämpfer-Modelle zur Beschreibung von Kriechen und Relaxieren BURGER-Modell Deformationskomponente der Reibung Verschleißformen an der Werkzeugschneide eines Drehmeißels Oberflächenzerrüttungsverschleiß. (mit Adhäsionsverschleiß) Adhäsionsverschleiß. (mit Rissbildung) Verschleißmechanismen Einflussfaktoren auf heterogene Phasengrenzreaktionen Interkristalline Korrosion Transkristalline Korrosion Lochkorrosion Korrosionsangriff Flächenkorrosion Muldenkorrosion Prinzip der Säurekorrosion Lochkorrosion an einem passiven Metall mit Elektronen leitender Passivschicht Korrosionsvorgänge in einem Wassertropfen an verzinntem Stahlblech Elementbildung bei der galvanischen Korrosion Bimetall-Korrosion, dargestellt am Beispiel einer Nietverbindung (links), Möglichkeit der Verhinderung durch Isolierscheiben (rechts) Spannungsrisskorrosion Schematische Darstellung des Abscheidevorgangs beim CVD-Verfahren Verlauf der Ausfallrateeines technischen Systems Zusammenhang zwischen Schadensbild, Ursache und Grund von Schäden am Beispiel eines Wälzlagers Abfolge von Störverknüpfungen Kausalkette der technischen Störungen am Beispiel der Werkzeugmaschine Struktur der menschlichen Fehler Abfolge von Störverknüpfungen Schadenfalltripel (WEKA-Katalog) Prozesskette einer Störung Skizze eines Pendelgleitlagers aus Kunststoff (PA 6) und Verschleißgrößen Methodik einer Gefahren- und Sicherheitsanalyse Instandhaltungsvertrag einschließlich der Festlegung der Verantwortlichkeiten bei der Abnahme von Instandhaltungsleistungen
30 Abbildungsverzeichnis XXXIII 4.3 Festlegung der Verantwortlichkeiten bei der Annahme von Instandhaltungsleistungen Verteilungsfunktion F und Dichtefunktion f einer stetigen Zufallsvariablen Sprungartiger Schädigungsverlauf eines elektronischen Bauteils Zusammenhang zwischen Lebensdauer, Alter und effektiver Betriebsdauer Charakteristische Zeitpunkte der effektiven Lebensdauer Grundmodell der technischen Statistik Schematische Darstellung von Merkmalsarten Ausfallwahrscheinlichkeitsdichte und charakteristische Kenngrößen Zufallsstreubereich Erläuterung des Erwartungswerts Ermittlung des Medians am Beispiel der Monatseinkommen von Instandhaltungstechnikern Häufigkeiten der Maschinentypen Der Korrelationskoeffizient ρ als Maß für die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von Zufallsvariablen Ordinale Darstellung der Merk- malsausprägung von Werkzeugmaschinen Lagemaße Abweichungen von der symmetrischen Glockenkurve Verläufe der Wahrscheinlichkeitsdichte bei verschiedenen Parametern λ Kurvenverläufe der Überlebenswahrscheinlichkeit R(t) in Abhängigkeit verschiedener Parameter Verlauf der Ausfallrate λ(t) Kurvenverläufe der Wahrscheinlichkeitsdichte bei verschiedenen Formparametern b Kurvenverläufe der Überlebenswahrscheinlichkeit R(t) in Abhängigkeit von verschiedenen Formparametern b der Weibull-Verteilung Verlauf der Ausfallrate λ in Abhängigkeit vom Formparameter b Wellenprobe (Maße in mm) Empirische Weibull-Verteilung aus dem Rechenbeispiel Ermittlung des Annahmeschlauchs der Weibull-Verteilung KOLMOGOROW-SMIRNOW-Anpassungstest Ausfall- und Überlebenswahrscheinlichkeitsfunktion Absolute Zahl der Ausfälle im Intervall h Betrachtungsintervall Betriebsdauer Experimentell ermittelte Ausfalldaten Anzahl der nach der Zeit t noch nicht ausgefallen Betrachtungseinheiten Erhaltungsstrategien
31 XXXIV Abbildungsverzeichnis 5.32 Ausfallarten von Betrachtungseinheiten Zuverlässigkeitsprozess mit und ohne Erneuerung Einfacher und erweiterter Erneuerungsprozess Verlauf der Zuverlässigkeitsfunktion mit und ohne Erneuerung Einfacher Erneuerungsprozesses ohne Berücksichtigung instandsetzungsbedingter Stillstandszeiten Einfacher Erneuerungsprozesses mit Berücksichtigung instandsetzungsbedingter Stillstandszeiten Einfacher vorbeugender Erneuerungsprozess ohne Berücksichtigung instandsetzungsbedingter Stillstandszeiten Einfacher vorbeugender Erneuerungsprozess mit Berücksichtigungz instandsetzungsbedingter Stillstandszeiten Einfacher vorbeugender Erneuerungsprozess mit Instandsetzung nach Befund Vorbeugender Erneuerungsprozess mit Verbesserung der Lebensdauer und der Gebrauchseigenschaften Darstellung der Faltung der Erneuerungsdichtefunktionen der effektiven Lebensdauer nacheinander installierter (ersetzter, erneuerter) Elemente Verlauf der Erneuerungsdichtefunktion Verlauf der Erneuerungsfunktion Strukturierung eines Maschinensystems Zuverlässigkeitslogische Reihenschaltung Parallelschaltung zweier in Reihe geschalteter Elemente Reihenschaltung zweier Parallelelemente Gemischte Schaltung zu Beispiel Gemischte Schaltung zu Beispiel Serienschaltung Redundante Parallelschaltung Blockschaltbild zu Aufgabe Zuverlässigkeitsschaltbild zu Aufgabe Verlauf eines Schädigungsparameters Verlauf eines Gebrauchsparameters und einer Verlustfunktion Instandhaltungsstrategien. (Nach DIN 31051) Strategiebedingter Verlauf des Abnutzungsvorrates Ausfallarten Verläufe der Wahrscheinlichkeitsdichte bei verschiedenen Formparametern. (GAUßSCHE Glockenkurve für b 3,6) Verläufe der Wahrscheinlichkeitsdichte unter Berücksichtigung einer ausfallfreien Zeit t Kurvenverläufe der Überlebenswahrscheinlichkeit R(t) in Abhängigkeit verschiedener Formparameter b der Weibull-Verteilung (zweiparametrisch) Verläufe der Ausfallrate λ in Abhängigkeit vom Formparameter b
32 Abbildungsverzeichnis XXXV 6.10 Ablaufalgorithmus zur Ermittlung der empirischen Ausfallrate λ(t) Skizze für Berechnungsbeispiel Verlauf der Ausfallrate des Rechenbeispiels in Tab Weibull-Gerade und 95 %-Vertrauensbereich Ausfallwahrscheinlichkeitsfunktion F(t) im Weibull-Netz Ablaufalgorithmus zur Ermittlung der Weibull-Parameter a und b Ablaufalgorithmus zum Vergleich zweier Verteilungen Ermittlung des Vertrauensbereichs der Weibull-Parameter a und b Histogramm der Dichtefunktion Erfassung der mittleren Anzahl der Ausfälle mit anschließender Minimalinstandsetzung Schematische Darstellung der Ermittlung der Weibull-Parameter a und b auf der Grundlage der integrierten Ausfallrate (t) Dreiparametrische Weibull-Verteilung F(t) im Weibull-Netz mit der um c korrigierten Betriebszeit t c Ermittlung der ausfallfreien Zeit t 0 nach DUBEY Darstellung der instandhaltungsbedingten Stillstandzeiten, dargestellt am Beispiel einer Spritzgießmaschine Struktur des zeitlichen Ereignisverlaufs der Instandhaltung Instandhaltungswerkstatt als geschlossenes Bedienungsmodell Strukturtypen von Instandhaltungsstrategien für eine einzelne BE Ablaufalgorithmus zur Ermittlung der optimalen Instandhaltungsmethode Formparameter b der Weibull-Verteilung und abgeleitete Instandhaltungsmethoden Raupenkettenglied des Eimerkettenbaggers ERs 741 mit aufgearbeiteter Schake in der Schweißvorrichtung Abgenutzte Schake eines Kettengliedes des Eimerkettenbaggers 341 ERs Feststellung des Abnutzungsbetrages einer Schake mittels Prüflehre Aufgearbeitung der Schake eines Raupenkettengliedes vom Eimerkettenbagger 341 ERs Schake des Kettenglied des Eimerkettenbaggers 341 ERs Neue Schake eines Kettengliedes des Eimerkettenbaggers 341ERs Algorithmus zur Ermittlung der optimalen Erneuerungsvariante Beispiel für die Festlegung zusammengefasster Instandsetzungsumfänge fürdie Koordinierungsstrategie (τ E =10 d, m 1 = 2, m 2 =2, m 3 =8, m 4 =6, m 5 =12) Beispiel für korrekte und unkorrekte Anordnung der Messstellen am Lager einer Antriebswelle Kosten und Nutzen der Qualität einer Projektlösung Quellen und Komponenten der Wandlungsfähigkeit Geplante, nicht realisierte und unbeabsichtigte Strategien
Bettina Heberer. Grüne Gentechnik. Hintergründe, Chancen und Risiken
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung in der Energiewirtschaft
 Zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung in der Energiewirtschaft Werner Hecker Carsten Lau Arno Müller (Hrsg.) Zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung in der Energiewirtschaft Herausgeber Werner Hecker
Zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung in der Energiewirtschaft Werner Hecker Carsten Lau Arno Müller (Hrsg.) Zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung in der Energiewirtschaft Herausgeber Werner Hecker
Herausgegeben von Professor Dr. Nikolaus Franke Universität Wien, Wien, Österreich
 Museumsmarketing VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte Ergebnisse aus Forschungsprojekten oder Abschlussarbeiten werden in konzentrierter Form der Fachwelt
Museumsmarketing VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte Ergebnisse aus Forschungsprojekten oder Abschlussarbeiten werden in konzentrierter Form der Fachwelt
Berufswahl und Bewährung
 Berufswahl und Bewährung Silke Müller-Hermann Berufswahl und Bewährung Fallrekonstruktionen zu den Motivlagen von Studierenden der Sozialen Arbeit RESEARCH Silke Müller-Hermann Basel, Schweiz Zugleich
Berufswahl und Bewährung Silke Müller-Hermann Berufswahl und Bewährung Fallrekonstruktionen zu den Motivlagen von Studierenden der Sozialen Arbeit RESEARCH Silke Müller-Hermann Basel, Schweiz Zugleich
Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen
 Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Carsten Wesselmann Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Detaillierte T-Konten und Rechenwege Carsten Wesselmann Köln Deutschland ISBN 978-3-658-07066-3
Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Carsten Wesselmann Lösungen zum Lehrbuch Angewandtes Rechnungswesen Detaillierte T-Konten und Rechenwege Carsten Wesselmann Köln Deutschland ISBN 978-3-658-07066-3
Führung und Mikropolitik in Projekten
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur
 essentials Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
essentials Springer essentials sind innovative Bücher, die das Wissen von Springer DE in kompaktester Form anhand kleiner, komprimierter Wissensbausteine zur Darstellung bringen. Damit sind sie besonders
Peter tom Suden. Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht
 Peter tom Suden Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht Peter tom Suden Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht Einführung, Signatur, Dokumentation Bibliografische Information
Peter tom Suden Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht Peter tom Suden Die elektronische Rechnung in Handels- und Steuerrecht Einführung, Signatur, Dokumentation Bibliografische Information
Praxiswissen Online-Marketing
 Praxiswissen Online-Marketing Affiliate- und E-Mail-Marketing, Suchmaschinenmarketing, Online-Werbung, Social Media, Facebook-Werbung 6. Auflage Praxiswissen Online-Marketing Praxiswissen Online-Marketing
Praxiswissen Online-Marketing Affiliate- und E-Mail-Marketing, Suchmaschinenmarketing, Online-Werbung, Social Media, Facebook-Werbung 6. Auflage Praxiswissen Online-Marketing Praxiswissen Online-Marketing
Das Internet als Instrument der Unternehmenskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Investor Relations
 Wirtschaft Jörn Krüger Das Internet als Instrument der Unternehmenskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Investor Relations Eine theoretische und empirische Analyse Diplomarbeit Bibliografische
Wirtschaft Jörn Krüger Das Internet als Instrument der Unternehmenskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Investor Relations Eine theoretische und empirische Analyse Diplomarbeit Bibliografische
Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit
 Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit Benjamin Benz Günter Rieger Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit Eine Einführung Benjamin Benz Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EFH
Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit Benjamin Benz Günter Rieger Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit Eine Einführung Benjamin Benz Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EFH
Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager
 Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Gravitation und Physik kompakter Objekte
 Gravitation und Physik kompakter Objekte Max Camenzind Gravitation und Physik kompakter Objekte Eine Einführung in die Welt der Weißen Zwerge, Neutronensterne und Schwarzen Löcher Max Camenzind Heidelberg,
Gravitation und Physik kompakter Objekte Max Camenzind Gravitation und Physik kompakter Objekte Eine Einführung in die Welt der Weißen Zwerge, Neutronensterne und Schwarzen Löcher Max Camenzind Heidelberg,
Berufseinstieg für Ingenieure
 Berufseinstieg für Ingenieure Elke Pohl Bernd Fiehöfer Berufseinstieg für Ingenieure Elke Pohl Bernd Fiehöfer Berlin, Deutschland ISBN 978-3-658-05073-3 DOI 10.1007/978-3-658-05074-0 ISBN 978-3-658-05074-0
Berufseinstieg für Ingenieure Elke Pohl Bernd Fiehöfer Berufseinstieg für Ingenieure Elke Pohl Bernd Fiehöfer Berlin, Deutschland ISBN 978-3-658-05073-3 DOI 10.1007/978-3-658-05074-0 ISBN 978-3-658-05074-0
Entwicklung eines Marknagels für den Humerus
 Medizin Eric Bartsch Entwicklung eines Marknagels für den Humerus Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Medizin Eric Bartsch Entwicklung eines Marknagels für den Humerus Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Felix Huth. Straßenkinder in Duala
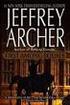 Felix Huth Straßenkinder in Duala VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte Ergebnisse aus Forschungsprojekten
Felix Huth Straßenkinder in Duala VS COLLEGE Reviewed Research. Auf den Punkt gebracht. VS College richtet sich an hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Referierte Ergebnisse aus Forschungsprojekten
Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten
 Nadine Schlabes Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten Eine konzeptionelle Studie Bachelorarbeit Schlabes, Nadine: Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten.
Nadine Schlabes Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten Eine konzeptionelle Studie Bachelorarbeit Schlabes, Nadine: Die Big Five und ihre Auswirkungen auf das Gründungsverhalten.
Klinische Untersuchung der Stütz- und Bewegungsorgane
 Klinische Untersuchung der Stütz- und Bewegungsorgane Georg Freiherr von Salis-Soglio Klinische Untersuchung der Stütz- und Bewegungsorgane Mit über 200 Abbildungen 123 Prof. Dr. med. Georg Freiherr von
Klinische Untersuchung der Stütz- und Bewegungsorgane Georg Freiherr von Salis-Soglio Klinische Untersuchung der Stütz- und Bewegungsorgane Mit über 200 Abbildungen 123 Prof. Dr. med. Georg Freiherr von
I. Deskriptive Statistik 1
 I. Deskriptive Statistik 1 1. Einführung 3 1.1. Grundgesamtheit und Stichprobe.................. 5 1.2. Merkmale und Verteilungen..................... 6 1.3. Tabellen und Grafiken........................
I. Deskriptive Statistik 1 1. Einführung 3 1.1. Grundgesamtheit und Stichprobe.................. 5 1.2. Merkmale und Verteilungen..................... 6 1.3. Tabellen und Grafiken........................
Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion
 Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Mit 106
Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Ralf-Stefan Lossack Wissenschaftstheoretische Grundlagen für die rechnerunterstützte Konstruktion Mit 106
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Die Europäische Union erfolgreich vermitteln
 Die Europäische Union erfolgreich vermitteln Monika Oberle (Hrsg.) Die Europäische Union erfolgreich vermitteln Perspektiven der politischen EU-Bildung heute Herausgeber Monika Oberle Universität Göttingen
Die Europäische Union erfolgreich vermitteln Monika Oberle (Hrsg.) Die Europäische Union erfolgreich vermitteln Perspektiven der politischen EU-Bildung heute Herausgeber Monika Oberle Universität Göttingen
Langfristige Betrachtung der Sparquote der privaten Haushalte Deutschlands
 Wirtschaft Alexander Simon Langfristige Betrachtung der Sparquote der privaten Haushalte Deutschlands Eine kritische Analyse von Zusammenhängen zwischen der Sparquote und ausgewählten ökonomischen Einflussfaktoren
Wirtschaft Alexander Simon Langfristige Betrachtung der Sparquote der privaten Haushalte Deutschlands Eine kritische Analyse von Zusammenhängen zwischen der Sparquote und ausgewählten ökonomischen Einflussfaktoren
Thomas Geisen. Arbeit in der Moderne
 Thomas Geisen Arbeit in der Moderne Thomas Geisen Arbeit in der Moderne Ein dialogue imaginaire zwischen Karl Marx und Hannah Arendt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Thomas Geisen Arbeit in der Moderne Thomas Geisen Arbeit in der Moderne Ein dialogue imaginaire zwischen Karl Marx und Hannah Arendt Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche
Ideengeschichte der Physik
 Ideengeschichte der Physik Eine Analyse der Entwicklung der Physik im historischen Kontext 2. Auflage Ideengeschichte der Physik Ideengeschichte der Physik Eine Analyse der Entwicklung der Physik im historischen
Ideengeschichte der Physik Eine Analyse der Entwicklung der Physik im historischen Kontext 2. Auflage Ideengeschichte der Physik Ideengeschichte der Physik Eine Analyse der Entwicklung der Physik im historischen
Jan Lies. Kompakt-Lexikon PR Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden
 Kompakt-Lexikon PR Jan Lies Kompakt-Lexikon PR 2.000 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden Jan Lies Hamm Deutschland ISBN 978-3-658-08741-8 DOI 10.1007/978-3-658-08742-5 ISBN 978-3-658-08742-5 (ebook)
Kompakt-Lexikon PR Jan Lies Kompakt-Lexikon PR 2.000 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden Jan Lies Hamm Deutschland ISBN 978-3-658-08741-8 DOI 10.1007/978-3-658-08742-5 ISBN 978-3-658-08742-5 (ebook)
Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg
 Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg Heinz Rapp Jörg Matthias Rapp Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg Anwendungsorientierte Aufgaben mit ausführlichen
Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg Heinz Rapp Jörg Matthias Rapp Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg Anwendungsorientierte Aufgaben mit ausführlichen
Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf
 Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf Modelle, Befunde, Interventionen 2., vollständig überarbeitete Auflage Herausgeber Dr. Westfälische Wilhelms-Universität
Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf (Hrsg.) Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf Modelle, Befunde, Interventionen 2., vollständig überarbeitete Auflage Herausgeber Dr. Westfälische Wilhelms-Universität
Elementare Numerik für die Sekundarstufe
 Elementare Numerik für die Sekundarstufe Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II Herausgegeben von Prof. Dr. Friedhelm Padberg, Universität Bielefeld, und Prof. Dr. Andreas Büchter, Universität
Elementare Numerik für die Sekundarstufe Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II Herausgegeben von Prof. Dr. Friedhelm Padberg, Universität Bielefeld, und Prof. Dr. Andreas Büchter, Universität
Inhaltsverzeichnis. Inhalt Teil I: Beschreibende (Deskriptive) Statistik Seite. 1.0 Erste Begriffsbildungen Merkmale und Skalen 5
 Inhaltsverzeichnis Inhalt Teil I: Beschreibende (Deskriptive) Statistik Seite 1.0 Erste Begriffsbildungen 1 1.1 Merkmale und Skalen 5 1.2 Von der Urliste zu Häufigkeitsverteilungen 9 1.2.0 Erste Ordnung
Inhaltsverzeichnis Inhalt Teil I: Beschreibende (Deskriptive) Statistik Seite 1.0 Erste Begriffsbildungen 1 1.1 Merkmale und Skalen 5 1.2 Von der Urliste zu Häufigkeitsverteilungen 9 1.2.0 Erste Ordnung
Birgit Baur-Müller. Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin. Von der Musterdiagnose zur Rezeptur
 Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Von der Musterdiagnose zur Rezeptur Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Von der Musterdiagnose
Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Von der Musterdiagnose zur Rezeptur Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Westliche Heilpflanzen in der chinesischen Medizin Von der Musterdiagnose
Innovative Preismodelle für hybride Produkte
 Wirtschaft Christoph Da-Cruz Innovative Preismodelle für hybride Produkte Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Wirtschaft Christoph Da-Cruz Innovative Preismodelle für hybride Produkte Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Familienforschung. Herausgegeben von A. Steinbach, Duisburg, Deutschland M. Hennig, Mainz, Deutschland O. Arránz Becker, Köln, Deutschland
 Familienforschung Herausgegeben von A. Steinbach, Duisburg, M. Hennig, Mainz, O. Arránz Becker, Köln, In der Familienforschung lassen sich zwei Grundpositionen zu Familie identifizieren, die seit Jahrzehnten
Familienforschung Herausgegeben von A. Steinbach, Duisburg, M. Hennig, Mainz, O. Arránz Becker, Köln, In der Familienforschung lassen sich zwei Grundpositionen zu Familie identifizieren, die seit Jahrzehnten
Erziehungswissenschaft
 Erziehungswissenschaft Lehrbuch für Bachelor-, Master- und Lehramtsstudierende Erziehungswissenschaft Erziehungswissenschaft Lehrbuch für Bachelor-, Master- und Lehramtsstudierende Institut für Erziehungswissenschaft
Erziehungswissenschaft Lehrbuch für Bachelor-, Master- und Lehramtsstudierende Erziehungswissenschaft Erziehungswissenschaft Lehrbuch für Bachelor-, Master- und Lehramtsstudierende Institut für Erziehungswissenschaft
Picking the winners - Dienstleistungsorientierte Bestandspflegeund Ansiedlungspolitik
 Geographie Bernd Steinbrecher Picking the winners - Dienstleistungsorientierte Bestandspflegeund Ansiedlungspolitik Dienstleistungsunternehmen in der Regionalentwicklung am Beispiel der Region Aachen Diplomarbeit
Geographie Bernd Steinbrecher Picking the winners - Dienstleistungsorientierte Bestandspflegeund Ansiedlungspolitik Dienstleistungsunternehmen in der Regionalentwicklung am Beispiel der Region Aachen Diplomarbeit
Weiterbildung Schmerzmedizin
 Weiterbildung Schmerzmedizin H. Göbel R. Sabatowski Weiterbildung Schmerzmedizin CME-Beiträge aus: Der Schmerz 2013 2014 Mit 49 größtenteils farbigen Abbildungen und 33 Tabellen 123 Prof. Dr. H. Göbel
Weiterbildung Schmerzmedizin H. Göbel R. Sabatowski Weiterbildung Schmerzmedizin CME-Beiträge aus: Der Schmerz 2013 2014 Mit 49 größtenteils farbigen Abbildungen und 33 Tabellen 123 Prof. Dr. H. Göbel
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Anjes Tjarks. Familienbilder gleich Weltbilder
 Anjes Tjarks Familienbilder gleich Weltbilder Anjes Tjarks Familienbilder gleich Weltbilder Wie familiäre Metaphern unser politisches Denken und Handeln bestimmen Bibliografische Information der Deutschen
Anjes Tjarks Familienbilder gleich Weltbilder Anjes Tjarks Familienbilder gleich Weltbilder Wie familiäre Metaphern unser politisches Denken und Handeln bestimmen Bibliografische Information der Deutschen
Mentoring als gendergerechte Personalentwicklung
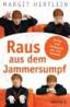 Mentoring als gendergerechte Personalentwicklung Bahar Haghanipour Mentoring als gendergerechte Personalentwicklung Wirksamkeit und Grenzen eines Programms in den Ingenieurwissenschaften Bahar Haghanipour
Mentoring als gendergerechte Personalentwicklung Bahar Haghanipour Mentoring als gendergerechte Personalentwicklung Wirksamkeit und Grenzen eines Programms in den Ingenieurwissenschaften Bahar Haghanipour
Der Weg in die Unternehmensberatung
 Martin Hartenstein Fabian Billing Christian Schawel Michael Grein Der Weg in die Unternehmensberatung Consulting Case Studies erfolgreich bearbeiten 12. Auflage Der Weg in die Unternehmensberatung Martin
Martin Hartenstein Fabian Billing Christian Schawel Michael Grein Der Weg in die Unternehmensberatung Consulting Case Studies erfolgreich bearbeiten 12. Auflage Der Weg in die Unternehmensberatung Martin
Optimal Energie sparen beim Bauen, Sanieren und Wohnen
 Optimal Energie sparen beim Bauen, Sanieren und Wohnen Jürgen Eiselt Optimal Energie sparen beim Bauen, Sanieren und Wohnen Ein vergleichbarer Index aller Maßnahmen Jürgen Eiselt Frankfurt Deutschland
Optimal Energie sparen beim Bauen, Sanieren und Wohnen Jürgen Eiselt Optimal Energie sparen beim Bauen, Sanieren und Wohnen Ein vergleichbarer Index aller Maßnahmen Jürgen Eiselt Frankfurt Deutschland
Mobbing am Arbeitsplatz
 Wirtschaft Nicole Busch Mobbing am Arbeitsplatz Das Leiden der Opfer im Kontext von Führungsstilen und Konfliktmanagement Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Wirtschaft Nicole Busch Mobbing am Arbeitsplatz Das Leiden der Opfer im Kontext von Führungsstilen und Konfliktmanagement Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Wilfried Weißgerber. Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen
 Wilfried Weißgerber Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Aus dem Programm Elektrotechnik Formeln und Tabellen Elektrotechnik herausgegeben von W. Böge und W. Plaßmann Vieweg Handbuch Elektrotechnik
Wilfried Weißgerber Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Aus dem Programm Elektrotechnik Formeln und Tabellen Elektrotechnik herausgegeben von W. Böge und W. Plaßmann Vieweg Handbuch Elektrotechnik
Die Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes nach HGB und IFRS
 Wirtschaft Michael Liening Die Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes nach HGB und IFRS Eine empirische Analyse Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Wirtschaft Michael Liening Die Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes nach HGB und IFRS Eine empirische Analyse Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen
 Sport Carla Vieira Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Sport Carla Vieira Yoga - die Kunst, Körper, Geist und Seele zu formen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Behinderung und Migration
 Behinderung und Migration Gudrun Wansing Manuela Westphal (Hrsg.) Behinderung und Migration Inklusion, Diversität, Intersektionalität Herausgeber Prof. Dr. Gudrun Wansing Prof. Dr. Manuela Westphal Universität
Behinderung und Migration Gudrun Wansing Manuela Westphal (Hrsg.) Behinderung und Migration Inklusion, Diversität, Intersektionalität Herausgeber Prof. Dr. Gudrun Wansing Prof. Dr. Manuela Westphal Universität
Strategisches Biodiversitätsmanagement durch den Einsatz einer Biodiversity Balanced Scorecard
 Niels Christiansen Strategisches Biodiversitätsmanagement durch den Einsatz einer Biodiversity Balanced Scorecard OPTIMUS Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Niels Christiansen Strategisches Biodiversitätsmanagement durch den Einsatz einer Biodiversity Balanced Scorecard OPTIMUS Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Führungsstile im Vergleich. Kritische Betrachtung der Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation
 Wirtschaft Stefanie Pipus Führungsstile im Vergleich. Kritische Betrachtung der Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Wirtschaft Stefanie Pipus Führungsstile im Vergleich. Kritische Betrachtung der Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Prüfungstraining für Bankkaufleute
 Prüfungstraining für Bankkaufleute Wolfgang Grundmann Rudolf Rathner Abschlussprüfungen Bankwirtschaft, Rechnungswesen und Steuerung, Wirtschafts- und Sozialkunde 10. Auflage Wolfgang Grundmann Norderstedt,
Prüfungstraining für Bankkaufleute Wolfgang Grundmann Rudolf Rathner Abschlussprüfungen Bankwirtschaft, Rechnungswesen und Steuerung, Wirtschafts- und Sozialkunde 10. Auflage Wolfgang Grundmann Norderstedt,
Reihe Nachhaltigkeit. Energiepolitik: Rahmenbedingungen für die Entwicklung von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien.
 Simon Reimer Energiepolitik: Rahmenbedingungen für die Entwicklung von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien Ökonomische Realität im Konflikt zu energiepolitischen Ambitionen? Reihe Nachhaltigkeit
Simon Reimer Energiepolitik: Rahmenbedingungen für die Entwicklung von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien Ökonomische Realität im Konflikt zu energiepolitischen Ambitionen? Reihe Nachhaltigkeit
Rüdiger Zarnekow Lutz Kolbe. Green IT. Erkenntnisse und Best Practices aus Fallstudien
 Rüdiger Zarnekow Lutz Kolbe Green IT Erkenntnisse und Best Practices aus Fallstudien Green IT Rüdiger Zarnekow Lutz Kolbe Green IT Erkenntnisse und Best Practices aus Fallstudien Rüdiger Zarnekow Fachgebiet
Rüdiger Zarnekow Lutz Kolbe Green IT Erkenntnisse und Best Practices aus Fallstudien Green IT Rüdiger Zarnekow Lutz Kolbe Green IT Erkenntnisse und Best Practices aus Fallstudien Rüdiger Zarnekow Fachgebiet
Zielvereinbarung und variable Vergütung
 Zielvereinbarung und variable Vergütung Eckhard Eyer Thomas Haussmann Zielvereinbarung und variable Vergütung Ein praktischer Leitfaden nicht nur für Führungskräfte Mit neun ausführlichen Fallbeispielen
Zielvereinbarung und variable Vergütung Eckhard Eyer Thomas Haussmann Zielvereinbarung und variable Vergütung Ein praktischer Leitfaden nicht nur für Führungskräfte Mit neun ausführlichen Fallbeispielen
Empirische Methoden in der Psychologie
 Markus Pospeschill Empirische Methoden in der Psychologie Mit 41 Abbildungen und 95 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel PD Dr. Markus Pospeschill lehrt und forscht als Akademischer Direktor
Markus Pospeschill Empirische Methoden in der Psychologie Mit 41 Abbildungen und 95 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel PD Dr. Markus Pospeschill lehrt und forscht als Akademischer Direktor
Inhaltsverzeichnis. Kurt Matyas. Instandhaltungslogistik. Qualität und Produktivität steigern. ISBN (Buch): 978-3-446-43560-5
 Kurt Matyas Instandhaltungslogistik Qualität und Produktivität steigern ISBN (Buch): 978-3-446-43560-5 ISBN (E-Book): 978-3-446-43589-6 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-43560-5
Kurt Matyas Instandhaltungslogistik Qualität und Produktivität steigern ISBN (Buch): 978-3-446-43560-5 ISBN (E-Book): 978-3-446-43589-6 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-43560-5
Zweckgesellschaften und strukturierte Unternehmen im Konzernabschluss nach HGB und IFRS
 Wirtschaft Roberto Liebscher Zweckgesellschaften und strukturierte Unternehmen im Konzernabschluss nach HGB und IFRS Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Wirtschaft Roberto Liebscher Zweckgesellschaften und strukturierte Unternehmen im Konzernabschluss nach HGB und IFRS Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden
 Naturwissenschaft Franziska Schropp Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden Das Pendler Paradoxon und andere Methoden im Vergleich Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Naturwissenschaft Franziska Schropp Auswirkungen des Pendelns auf das subjektive Wohlbefinden Das Pendler Paradoxon und andere Methoden im Vergleich Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
2. Übung zur Vorlesung Statistik 2
 2. Übung zur Vorlesung Statistik 2 Aufgabe 1 Welche der folgenden grafischen Darstellungen und Tabellen zeigen keine (Einzel-)Wahrscheinlichkeitsverteilung? Kreuzen Sie die richtigen Antworten an und begründen
2. Übung zur Vorlesung Statistik 2 Aufgabe 1 Welche der folgenden grafischen Darstellungen und Tabellen zeigen keine (Einzel-)Wahrscheinlichkeitsverteilung? Kreuzen Sie die richtigen Antworten an und begründen
Erfolg in der Sozialen Arbeit
 Erfolg in der Sozialen Arbeit Michael Boecker Erfolg in der Sozialen Arbeit Im Spannungsfeld mikropolitischer Interessenkonflikte Michael Boecker Hagen, Deutschland Die vorliegende Arbeit wurde an der
Erfolg in der Sozialen Arbeit Michael Boecker Erfolg in der Sozialen Arbeit Im Spannungsfeld mikropolitischer Interessenkonflikte Michael Boecker Hagen, Deutschland Die vorliegende Arbeit wurde an der
Kapitel XIII - p-wert und Beziehung zwischen Tests und Konfidenzintervallen
 Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel XIII - p-wert und Beziehung zwischen Tests und Konfidenzintervallen Induktive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller
Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel XIII - p-wert und Beziehung zwischen Tests und Konfidenzintervallen Induktive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller
Gudrun Höhne. Unternehmensführung in Europa. Ein Vergleich zwischen Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Diplomica Verlag
 Gudrun Höhne Unternehmensführung in Europa Ein Vergleich zwischen Deutschland, Großbritannien und Frankreich Diplomica Verlag Gudrun Höhne Unternehmensführung in Europa: Ein Vergleich zwischen Deutschland,
Gudrun Höhne Unternehmensführung in Europa Ein Vergleich zwischen Deutschland, Großbritannien und Frankreich Diplomica Verlag Gudrun Höhne Unternehmensführung in Europa: Ein Vergleich zwischen Deutschland,
Ingenieur-Bureau Oscar Kihm AG Seestrasse 14b CH-5432 Neuenhof
 Normierung in der Instandhaltung Grundlagen & Begriffe zur DIN 31051 : Oktober 2001 EN 13306 : 2001 Ingenieur-Bureau Oscar Kihm AG Seestrasse 14b CH-5432 Neuenhof www.okag.ch Beat Meier Dr. sc. techn.,
Normierung in der Instandhaltung Grundlagen & Begriffe zur DIN 31051 : Oktober 2001 EN 13306 : 2001 Ingenieur-Bureau Oscar Kihm AG Seestrasse 14b CH-5432 Neuenhof www.okag.ch Beat Meier Dr. sc. techn.,
Zeugnisse richtig formulieren
 Zeugnisse richtig formulieren Heinz-G. Dachrodt Volker Engelbert Zeugnisse richtig formulieren Mit vielen Mustern und Analysen Heinz-G. Dachrodt Witten, Deutschland Volker Engelbert Iserlohn, Deutschland
Zeugnisse richtig formulieren Heinz-G. Dachrodt Volker Engelbert Zeugnisse richtig formulieren Mit vielen Mustern und Analysen Heinz-G. Dachrodt Witten, Deutschland Volker Engelbert Iserlohn, Deutschland
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Hydrologie und Flussgebietsmanagement
 Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Gliederung der Vorlesung Statistische Grundlagen Etremwertstatistik
Hydrologie und Flussgebietsmanagement o.univ.prof. DI Dr. H.P. Nachtnebel Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau Gliederung der Vorlesung Statistische Grundlagen Etremwertstatistik
Langfristige Unternehmenssicherung in KMU durch optimale Liquiditätsplanung und -steuerung
 Sviatlana Zaitsava Langfristige Unternehmenssicherung in KMU durch optimale Liquiditätsplanung und -steuerung Diplomica Verlag Sviatlana Zaitsava Langfristige Unternehmenssicherung in KMU durch optimale
Sviatlana Zaitsava Langfristige Unternehmenssicherung in KMU durch optimale Liquiditätsplanung und -steuerung Diplomica Verlag Sviatlana Zaitsava Langfristige Unternehmenssicherung in KMU durch optimale
ETWR Teil B. Spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen (stetig)
 ETWR Teil B 2 Ziele Bisher (eindimensionale, mehrdimensionale) Zufallsvariablen besprochen Lageparameter von Zufallsvariablen besprochen Übertragung des gelernten auf diskrete Verteilungen Ziel des Kapitels
ETWR Teil B 2 Ziele Bisher (eindimensionale, mehrdimensionale) Zufallsvariablen besprochen Lageparameter von Zufallsvariablen besprochen Übertragung des gelernten auf diskrete Verteilungen Ziel des Kapitels
Handlungsansätze für ein betriebliches Gesundheitsmanagement in Krankenhäusern
 Medizin Annika Dühnen Handlungsansätze für ein betriebliches Gesundheitsmanagement in Krankenhäusern Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Medizin Annika Dühnen Handlungsansätze für ein betriebliches Gesundheitsmanagement in Krankenhäusern Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Distribution in Afrika
 Distribution in Afrika Philipp von Carlowitz Alexander Röndigs Distribution in Afrika Distributionslogistik in Westafrika als Beispiel Philipp von Carlowitz ESB Business School Hochschule Reutlingen Reutlingen
Distribution in Afrika Philipp von Carlowitz Alexander Röndigs Distribution in Afrika Distributionslogistik in Westafrika als Beispiel Philipp von Carlowitz ESB Business School Hochschule Reutlingen Reutlingen
H. Forst T. Fuchs-Buder A. R. Heller M. Weigand Hrsg. Weiterbildung Anästhesiologie
 H. Forst T. Fuchs-Buder A. R. Heller M. Weigand Hrsg. Weiterbildung Anästhesiologie CME-Beiträge aus: Der Anaesthesist 2015 Weiterbildung Anästhesiologie H. Forst T. Fuchs-Buder A. R. Heller M. Weigand
H. Forst T. Fuchs-Buder A. R. Heller M. Weigand Hrsg. Weiterbildung Anästhesiologie CME-Beiträge aus: Der Anaesthesist 2015 Weiterbildung Anästhesiologie H. Forst T. Fuchs-Buder A. R. Heller M. Weigand
I. Zahlen, Rechenregeln & Kombinatorik
 XIV. Wiederholung Seite 1 I. Zahlen, Rechenregeln & Kombinatorik 1 Zahlentypen 2 Rechenregeln Brüche, Wurzeln & Potenzen, Logarithmen 3 Prozentrechnung 4 Kombinatorik Möglichkeiten, k Elemente anzuordnen
XIV. Wiederholung Seite 1 I. Zahlen, Rechenregeln & Kombinatorik 1 Zahlentypen 2 Rechenregeln Brüche, Wurzeln & Potenzen, Logarithmen 3 Prozentrechnung 4 Kombinatorik Möglichkeiten, k Elemente anzuordnen
Islam und Politik. Herausgegeben von K. Schubert, Münster, Deutschland
 Islam und Politik Herausgegeben von K. Schubert, Münster, Deutschland Die Buchreihe Islam und Politik hat das Ziel, die zentralen Fragen und aktuellen Diskussionen zu diesem Thema aufzugreifen und die
Islam und Politik Herausgegeben von K. Schubert, Münster, Deutschland Die Buchreihe Islam und Politik hat das Ziel, die zentralen Fragen und aktuellen Diskussionen zu diesem Thema aufzugreifen und die
Günter Schmidt. Prozessmanagement. Modelle und Methoden. 3. überarbeitete Auflage
 Prozessmanagement Günter Schmidt Prozessmanagement Modelle und Methoden 3. überarbeitete Auflage Günter Schmidt Universität des Saarlandes Operations Research and Business Informatics Saarbrücken, Deutschland
Prozessmanagement Günter Schmidt Prozessmanagement Modelle und Methoden 3. überarbeitete Auflage Günter Schmidt Universität des Saarlandes Operations Research and Business Informatics Saarbrücken, Deutschland
Aufbau, Entwicklung & Optimierung eines integrierten Managementsystems unter Berücksichtigung der DIN EN ISO 9001:2015 Revision
 Eric Hohmuth Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen e-fellows.net (Hrsg.) Band 1567 Aufbau, Entwicklung & Optimierung eines integrierten Managementsystems unter Berücksichtigung der DIN EN ISO
Eric Hohmuth Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen e-fellows.net (Hrsg.) Band 1567 Aufbau, Entwicklung & Optimierung eines integrierten Managementsystems unter Berücksichtigung der DIN EN ISO
Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland
 Geisteswissenschaft Axel Jäckel Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland Ein Fall für die soziale Arbeit?! Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Geisteswissenschaft Axel Jäckel Übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland Ein Fall für die soziale Arbeit?! Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Erfolgsfaktor Inplacement
 Nicole Blum Erfolgsfaktor Inplacement Neue Mitarbeiter systematisch und zielgerichtet integrieren Dargestellt am Beispiel der ITK-Branche Diplomica Verlag Nicole Blum Erfolgsfaktor Inplacement: Neue Mitarbeiter
Nicole Blum Erfolgsfaktor Inplacement Neue Mitarbeiter systematisch und zielgerichtet integrieren Dargestellt am Beispiel der ITK-Branche Diplomica Verlag Nicole Blum Erfolgsfaktor Inplacement: Neue Mitarbeiter
Immobilien als Mittel der privaten Altersvorsorge
 Wirtschaft Andreas Vorbauer Immobilien als Mittel der privaten Altersvorsorge Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Wirtschaft Andreas Vorbauer Immobilien als Mittel der privaten Altersvorsorge Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Einführung in die computergestützte Datenanalyse
 Karlheinz Zwerenz Statistik Einführung in die computergestützte Datenanalyse 6., überarbeitete Auflage DE GRUYTER OLDENBOURG Vorwort Hinweise zu EXCEL und SPSS Hinweise zum Master-Projekt XI XII XII TEIL
Karlheinz Zwerenz Statistik Einführung in die computergestützte Datenanalyse 6., überarbeitete Auflage DE GRUYTER OLDENBOURG Vorwort Hinweise zu EXCEL und SPSS Hinweise zum Master-Projekt XI XII XII TEIL
Springer Spektrum, Springer Vieweg und Springer Psychologie.
 essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. Essentials informieren
Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik
 Günther Bourier Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik Praxisorientierte Einführung Mit Aufgaben und Lösungen 3. F überarbeitete Auflage GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis
Günther Bourier Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik Praxisorientierte Einführung Mit Aufgaben und Lösungen 3. F überarbeitete Auflage GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis
Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund
 Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Peter Keel Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Ganzheitliches Behandlungskonzept für somatoforme Störungen 1 C Peter
Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Peter Keel Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne ersichtlichen Grund Ganzheitliches Behandlungskonzept für somatoforme Störungen 1 C Peter
 Prozesskontrolle Modul 7 Dr.-Ing. Klaus Oberste Lehn Fachhochschule Düsseldorf Sommersemester 2012 Quellen www.business-wissen.de www.wikipedia.de www.sdreher.de 2012 Dr. Klaus Oberste Lehn 2 SPC Statistische
Prozesskontrolle Modul 7 Dr.-Ing. Klaus Oberste Lehn Fachhochschule Düsseldorf Sommersemester 2012 Quellen www.business-wissen.de www.wikipedia.de www.sdreher.de 2012 Dr. Klaus Oberste Lehn 2 SPC Statistische
Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten
 Medien Claudio Cosentino Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten Sport und Lifestylemagazin für Frauen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
Medien Claudio Cosentino Konzeption eines Sportmagazins für Randsportarten Sport und Lifestylemagazin für Frauen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische
7.2 Moment und Varianz
 7.2 Moment und Varianz Def. 21 Es sei X eine zufällige Variable. Falls der Erwartungswert E( X p ) existiert, heißt der Erwartungswert EX p p tes Moment der zufälligen Variablen X. Es gilt dann: + x p
7.2 Moment und Varianz Def. 21 Es sei X eine zufällige Variable. Falls der Erwartungswert E( X p ) existiert, heißt der Erwartungswert EX p p tes Moment der zufälligen Variablen X. Es gilt dann: + x p
Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr
 Wirtschaft Gordon Matthes Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr Diplomarbeit Bibliografische
Wirtschaft Gordon Matthes Die Entwicklung der Rechtsprechung hinsichtlich der Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und ihrer Gesellschafter im Rechtsverkehr Diplomarbeit Bibliografische
Kati Förster (Hrsg.) Strategien erfolgreicher TV-Marken
 Kati Förster (Hrsg.) Strategien erfolgreicher TV-Marken Kati Förster (Hrsg.) Strategien erfolgreicher TV-Marken Eine internationale Analyse Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Kati Förster (Hrsg.) Strategien erfolgreicher TV-Marken Kati Förster (Hrsg.) Strategien erfolgreicher TV-Marken Eine internationale Analyse Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen
 Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Wilfried Weißgerber Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Aufgaben mit ausführlichen Lösungen 5., korrigierte und verbesserte Auflage Mit 331 Abbildungen
Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Wilfried Weißgerber Elektrotechnik für Ingenieure Klausurenrechnen Aufgaben mit ausführlichen Lösungen 5., korrigierte und verbesserte Auflage Mit 331 Abbildungen
Technik. Matthias Treptow
 Technik Matthias Treptow Der Faktor Umwelt in der Praxis britischer und deutscher Banken und mögliche Implikationen für die Ausweitung des EG Umwelt Audits (EMAS) auf Finanzdienstleister Diplomarbeit Bibliografische
Technik Matthias Treptow Der Faktor Umwelt in der Praxis britischer und deutscher Banken und mögliche Implikationen für die Ausweitung des EG Umwelt Audits (EMAS) auf Finanzdienstleister Diplomarbeit Bibliografische
Einführung in die Montessori-Pädagogik
 Ingeborg Hedderich Einführung in die Montessori-Pädagogik Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung 3., aktualisierte Auflage Mit 49 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. päd.
Ingeborg Hedderich Einführung in die Montessori-Pädagogik Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung 3., aktualisierte Auflage Mit 49 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. päd.
Statistik. Datenanalyse mit EXCEL und SPSS. R.01denbourg Verlag München Wien. Von Prof. Dr. Karlheinz Zwerenz. 3., überarbeitete Auflage
 Statistik Datenanalyse mit EXCEL und SPSS Von Prof. Dr. Karlheinz Zwerenz 3., überarbeitete Auflage R.01denbourg Verlag München Wien Inhalt Vorwort Hinweise zu EXCEL und SPSS Hinweise zum Master-Projekt
Statistik Datenanalyse mit EXCEL und SPSS Von Prof. Dr. Karlheinz Zwerenz 3., überarbeitete Auflage R.01denbourg Verlag München Wien Inhalt Vorwort Hinweise zu EXCEL und SPSS Hinweise zum Master-Projekt
Das Spannungsfeld im mittleren Management. Ein möglicher Burnout-Faktor?
 Wirtschaft Matthias Schupp Das Spannungsfeld im mittleren Management. Ein möglicher Burnout-Faktor? Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Wirtschaft Matthias Schupp Das Spannungsfeld im mittleren Management. Ein möglicher Burnout-Faktor? Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst
 Geisteswissenschaft Holger Sieber Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst Bachelorarbeit Bibliografische Information
Geisteswissenschaft Holger Sieber Ein Konzept zur Verbesserung der Gesprächsführung in bayerischen integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst Bachelorarbeit Bibliografische Information
Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
 Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Argang Ghadiri Anabel Ternès Theo Peters (Hrsg.) Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Ansätze aus Forschung und Praxis Herausgeber Argang Ghadiri
Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Argang Ghadiri Anabel Ternès Theo Peters (Hrsg.) Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Ansätze aus Forschung und Praxis Herausgeber Argang Ghadiri
Kulturpolitik in Deutschland
 Kulturpolitik in Deutschland Klaus von Beyme Kulturpolitik in Deutschland Von der Staatsförderung zur Kreativwirtschaft Klaus von Beyme Heidelberg, Deutschland ISBN 978-3-531-19402-8 DOI 10.1007/978-3-531-19403-5
Kulturpolitik in Deutschland Klaus von Beyme Kulturpolitik in Deutschland Von der Staatsförderung zur Kreativwirtschaft Klaus von Beyme Heidelberg, Deutschland ISBN 978-3-531-19402-8 DOI 10.1007/978-3-531-19403-5
5. ASO Infotag. Rheda-Wiedenbrück, ,
 5. ASO Infotag Rheda-Wiedenbrück, 18.09.2013, Prüfung / Wartung/ Instandsetzung Rheda-Wiedenbrück, 18.09.2013, René Heydorn Agenda Einleitung Die Basis der Instandhaltung Normative Verweise und Regelungen
5. ASO Infotag Rheda-Wiedenbrück, 18.09.2013, Prüfung / Wartung/ Instandsetzung Rheda-Wiedenbrück, 18.09.2013, René Heydorn Agenda Einleitung Die Basis der Instandhaltung Normative Verweise und Regelungen
Anja Schüler. Arbeit für alle?! Berufliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland und den USA.
 Anja Schüler Arbeit für alle?! Berufliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland und den USA Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Schüler, Anja: Arbeit für alle?! Berufliche
Anja Schüler Arbeit für alle?! Berufliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland und den USA Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Schüler, Anja: Arbeit für alle?! Berufliche
Statistik für Ökonomen
 Wolfgang Kohn Riza Öztürk Statistik für Ökonomen Datenanalyse mit R und SPSS 2., überarbeitete Auflage 4ü Springer Gabler Inhaltsverzeichnis Teil I Einführung 1 Kleine Einführung in R '! 3 1.1 Installieren
Wolfgang Kohn Riza Öztürk Statistik für Ökonomen Datenanalyse mit R und SPSS 2., überarbeitete Auflage 4ü Springer Gabler Inhaltsverzeichnis Teil I Einführung 1 Kleine Einführung in R '! 3 1.1 Installieren
Kooperation und Vertrauen - Das Konzept der virtuellen Unternehmung als Organisationsform
 Wirtschaft Andreas Eggert Kooperation und Vertrauen - Das Konzept der virtuellen Unternehmung als Organisationsform Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Wirtschaft Andreas Eggert Kooperation und Vertrauen - Das Konzept der virtuellen Unternehmung als Organisationsform Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager
 Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Günter Umbach Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Wie Sie effektiv wissenschaftliche Daten kommunizieren
Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Günter Umbach Erfolgreich als Medical Advisor und Medical Science Liaison Manager Wie Sie effektiv wissenschaftliche Daten kommunizieren
Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie
 Hildegard Kaiser-Mantel Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Mit 46 Abbildungen und 3 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Hildegard
Hildegard Kaiser-Mantel Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Mit 46 Abbildungen und 3 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Hildegard
Einführung Wirtschaftsinformatik
 Einführung Wirtschaftsinformatik Iris Vieweg Christian Werner Klaus-P. Wagner Thomas Hüttl Dieter Backin Einführung Wirtschaftsinformatik IT-Grundwissen für Studium und Praxis Prof. Dr. Iris Vieweg Prof.
Einführung Wirtschaftsinformatik Iris Vieweg Christian Werner Klaus-P. Wagner Thomas Hüttl Dieter Backin Einführung Wirtschaftsinformatik IT-Grundwissen für Studium und Praxis Prof. Dr. Iris Vieweg Prof.
