1+2/ F o r s t t e c h n i s c h e I n f o rm a t i o n e n Fachzeitung für Waldarbeit und F o r s t t e c h n i k D 6050
|
|
|
- Jürgen Meissner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 K W F - I n f o r m a t i o n S t u rmschäden im Wa l d Aus aktuellem Anlass gibt das KWF in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten zu den verschiedenen Problemschwerpunkten bei der Sturmholzaufarbeitung zusammenfassende Empfehlungen und Verweise auf vertiefende Q u e l l e n. F o r s t t e c h n i s c h e I n f o rm a t i o n e n Fachzeitung für Waldarbeit und F o r s t t e c h n i k D 6050 I. KONZEPTION EINER WINDWURF- A U F A R B E I T U N G (Im Anhalt an Referate von D. Kraft und G. S c h n e i d er) Grundvoraussetzung zur Begrenzung der direkten Sturmschäden und der Folgeschäden ist ein geplantes systematisches Vorgehen bei der Schadensfeststellung, I n h a l t K W F - I n f o r m a t i o n Sturmschäden im Wald Aus der Prüfarbeit Kombinationsmaschine HSM9 04F Kombi in FPA-Prüfung; K. Arnold u. J. Graupner, KWF Aus der Forschung Die Relativzeitstudie Eine empirische Analyse anhand von Holzerntetätigkeiten; K. Reichel 13. KWF-Tagung Fachexkursion P e r s o n e l l e s h t t p :// w w w.k w f - o n l i n e. d e L a n d / S t a a t G e s c h ä t z t e r S c h a d h o l z a n f a l l [M i o. m 3 ] B W 23, 5 B Y 4, 3 R P 0, 3 S L < 0, 05 S H 0, 08 D 27 F 115 C H 11 A 0, 4 E 3, 3 D K 3, 4 S 8 P L 2 E u r o p a ca. 170 Tab. 1: Schadensumfang in Deutschland und Europa (Schätzungen Stand , BML) Das Sturmtief Anatol am 4. Dezember 99 und insbesondere der Orkan Lothar am zweiten Weihnachtsfeiertag haben in den Wäldern Mitteleuropas eine breite Spur der Verwüstung hinterlassen. Der geschätzte Schadholzanfall liegt europaweit bei ca. 170 Mio m 3. Am stärksten betroffen sind Frankreich, Deutschland (insbesondere Baden-Württemberg) und die Schweiz. Im Vergleich zu den von Vivian und Wiebke 1990 hervorgerufenen Schäden ist mit einem deutlich höheren Bruchholzanteil und entsprechend höheren Vermögensschäden zu rechnen. Durch die bewältigten Sturmkatastrophen der Vergangenheit verfügen zahlreiche Forstbetriebe, -verwaltungen und Forschungseinrichtungen über breite Erfahrungen im Umgang mit diesen Schadereignissen. Die nachfolgende Zusammenstellung versucht zu den Hauptproblemfeldern einen knappen Überblick zu geben und Hinweise zur Beschaffung vertiefender Informationen zu liefern. Aufarbeitung und Verwertung. Daher ist zunächst eine Strategie zu entwickeln, die organisatorische, verwertungstechnische und waldschutzorientierende Rahmenbedingungen berücksichtigt. Diese gewählte Strategie ist auf die verfügbaren Kapazitäten an Arbeitskräften und Betriebsmitteln abzustimmen und in einem individuell angepassten Schlachtplan umzusetzen. S c h a d e n s f e s t s t e l l u n g Jede Planung beginnt mit einer Inventur: - Grobinventur zur Feststellung der Größenordnung mittels Satellitenaufnahmen, Luftbildern, eigene Befli e g u n- 1+2/
2 V e r w e r t u n g s o r i e n t i e r t e A u f a r b e i t u n g Waldschutzorientierte A u f a r b e i t u n g gen (Sportflu g z e u g ). - Feininventur zur Verdichtung der Daten aus Luftbildern oder durch Begang. Mindestanforderung an Inventurdaten: Bestandeskennung mit Baumart, Alter, Schadfläche, Holzanfall, Bruchanteil, d1.3, MZ-Stammholz und Sortenanfall. Festlegen von Aufarbeitungsstrategien Da die Rahmenbedingungen bei einem Windwurf von Ort zu Ort verschieden sind und sich am gleichen Ort von Windwurf zu Windwurf ändern, sind Schubladenpläne nur selten treffend, geben aber immer einen ersten Anhalt. Aus den genannten Gründen gibt es auch nicht die Aufarbeitungsstrategie, sondern ein ganzes Bündel möglicher Vorgehensweisen, die sich allerdings durch folgende Hauptprioritäten begrenzen lassen: Voraussetzung: kühler und nasser Sommer, keine Käfergefahr Durchführung: G r o ß flächen vor Nester- und Einzelwurf, Bruch vor Wurf, wertvolles Holz vor weniger wertvollem, etc. Voraussetzung: Käfergefahr, v.a. nach heißem und trockenem Sommer D u r c h f ü h r u n g : Einzel- und Nesterwurf in wertvollen Beständen vor Flächenwurf, ggf. Wurf vor Bruch, Flächenwürfe nach der jeweiligen Befallsituation Der Schlachtplan muss ständig überprüft und an geänderte Gegebenheiten angepasst werden. Bernhard Hauck, KWF II. AUFARBEITUNGSTECHNIK UND -V E R F A H R E N Oberste Maxime: Der Mensch steht im Mittelpunkt! Daher Sicherheit vor Kosten! - Heute steht Forsttechnik zur Sturmholzaufarbeitung in bisher einmaligem Umfang zur Verfügung. Sie hat sich in Deutschland seit Wiebke vervielfacht. - Diese Technik bietet mehr denn je die Chance, sicherheitstechnische und ökologische Gesichtspunkte zu berücksicht i g e n. - Ein flächiges Befahren der Verhaue ist nicht mehr erforderlich. - Maschinen sollten mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten (BaH) gefahren werden. - Die moderne Ausbildung der Forstwirte sollte genutzt werden. Sie könnten z.t. im organisatorischen Bereich eingesetzt werden. 2 F T I 1+2/ Zur Entwicklung der konkreten Aufarbeitungsstrategie werden alle betroffenen Flächen einer Priorität zugeordnet und eine Prioritätenliste erstellt. Diese Zuordnung ist nicht starr, sondern kann sich je nach Witterung (Käfer) oder Verwertungssituation ändern. Aus der Prioritätenliste wird die verkaufsorientierte Loseinteilung und die angestrebte Verwertung festgelegt: - Trennung in möglichst homogene Einh e i t e n, - was kann oder muss verkauft werden, - was kann oder muss konserviert werd e n. K a p a z i t ä t s p l a n u n g Aus dem Vergleich von Schaden und Schadensverteilung mit den betrieblichen Möglichkeiten wird der Bedarf ermittelt an: - Personal für Betriebsleitung, -vollzug und Verwaltung, - Aufarbeitungskapazität (motormanuell und maschinell), - T r a n s p o r t k a p a z i t ä t, - L a g e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n. Die eigenen Kapazitäten können durch die Schaffung finanzieller Anreize für Mehrarbeit, Funktionalisierung der Aufgaben, Abwandlung von Arbeitsverfahren, Änderung der Sortiervorschriften, etc. im begrenzten Rahmen ausgeweitet werden. Darüber hinaus müssen Kapazitäten von Dritten beschafft werden. S c h l a c h t p l a n Nach Einweisung und Schulung des Personals (v.a. Arbeitssicherheit) wird die Aufarbeitung nach der Prioritätenliste beg o n n e n. 1. Verfahrensauswahl und Aufbau der Aufarbeitungskapazität. (Im Anhalt an (1), Referat von G.S c h n e i d er). Für Verfahrensauswahl und Aufbau der Aufarbeitungskapazität sind der Umfang an Lager- und Vermarktungsmöglichkeiten für Lang- und Kurzholzsortimente bzw. die Antworten auf folgende Fragen e n t s c h e i d e n d : - Wieviel Lang-/Kurzholz ist innerhalb des nächsten Jahres im Inland absetzb a r? - Wieviel Lang-/Kurzholz ist innerhalb des nächsten Jahres im Ausland absetzb a r? - Wieviel Lang-/Kurzholz kann mittelfristig durch Nasslagerung werterhaltend gelagert werden? - Wieviel Lang-/Kurzholz kann über eine Vegetationsperiode hinweg mit Wurzelkontakt natürlich konserviert werd e n? - Wieviel Lang-/Kurzholz kann für 1( 2 ) J a hr(e) trockengelagert werden? 2. Prämissen zur Gewährleistung von Arbeitssicherheit, Bodenschonung und käuferorientierter Aufarbeitungs- und Ablängqualität - Außer dem Abstocker befinden sich keine Arbeitskräfte im Verhau. - Alle motormanuellen Verfahren beinhalten das Entzerren. - Baggereinsatz bei großem Schadvolumen, intensivem Verhau und hohem S t ü c k v o l u m e n. - Schleppereinsatz bei geringem Stückvolumen und +/ einheitlicher Wurfr i c h t u n g. - Konzentration der Fahrbewegungen auf Fahrlinien (Reisigarmierung).
3 - Rindenebene Entastung vor allem bei maschineller Aufarbeitung. - Möglichst hohe Ablänggenauigkeit. - Zeitnahes Rücken innerhalb von 2 Woc h e n. - Abfuhr zum Nasslager innerhalb von 2 M o n a t e n. - Aushaltung von maximal 3 Sorten. 3. Was hat sich seit Wiebke im forsttechnischen Bereich getan? S e i l s c h l e p p e r - Es steht eine größere Palette an Spezialbringungsschleppern, vor allem in der Schlepperklasse 3 ( > 80 kw ) zur V e r f ü g u n g. - Es gibt ebenfalls eine noch größere Palette an vielfach erprobten landwirtschaftlichen Schleppern mit Forstausrüstung in den Schlepperklassen 2 und 3 ( > bzw. > 80 kw ). - Nahezu alle Schlepper haben komfortable Kabinen, starke funkgesteuerte Winden, z.t. Rückekräne oder zangen. - Neben bereits bewährten stehen weitere ausgefeilte Anbauwinden zur Verf ü g u n g. - Es gibt noch bessere Beseilungen (Bruchfestigkeit 1960 N/mm2, litzenverdichtet, Stahleinlagen). H a r v e s t e r - Es gibt stärkere Radharvester ( Klasse 3 > 140 kw ) mit deutlich stärkeren Kränen und damit auch größeren Köpfen. - Reichweiten von 9,30 10,50 m sind n o r m a l. - Z. T. gibt es hydraulisch verstellbare F a h r g e s t e l l e. - Es stehen Maschinen mit HKS-konformer Vermessung zur Verfügung. - Hoher Kabinenkomfort lässt längere Einsatzzeiten der Fahrer zu. - Baggerharvester gehören nicht mehr zu den Exoten (z.b. Timbco, Königstiger). Sie haben sich inzwischen in der Praxis bewährt. - Baggerfahrgestelle stehen im Baumaschinenbereich in großer Vielfalt und preisgünstig zur Verfügung. Sie sind relativ schnell mit Harvesteraggregaten oder Spezialgreifern zum Entzerren, Ablängen und Einschneiden liegenden Holzes aufzurüsten. - Es stehen für sie Köpfe zur Aufarbeitung von Starkholz zur Verfügung. T r a g s c h l e p p e r - Es gibt inzwischen mehr Tragschlepper der Klasse 3 (> kw). - Neben stärkeren Motoren und Kränen haben sie ein Einsatzgewicht von > kg und sind in der Lage, mit der Klemmbank auch Nadel-Starkholz ohne Gefahr der Überlastung zu r ü c k e n. - Alle neueren Tragschlepper bieten höheren Kabinen- und Fahrkomfort. 4. Wo erscheint der Einsatz welcher Technik am sinnvollsten? Die Fülle der zur Verfügung stehenden Technik lässt nicht in jedem Fall eine eindeutige Aussage zu. Beachtet werden sollte, dass es bei der Aufarbeitung im Verhau nahezu bei jedem Baum durch Verspannung zur Freisetzung zusätzlicher Kräfte kommt, auf die die Maschine noch mit freier Power reagieren muss. Im Zweifelsfalle ist daher die etwas stärkere Maschine immer die bessere, vor allem dann, wenn sie unmittelbar zur Unterstützung von motormanueller Arbeit eingesetzt ist. Die HKS-konforme Harvestervormessung sollte möglichst häufig und mit großer Präzision eingesetzt werden, auch wenn sie vielleicht nur als Kontrollmaß verwendet wird. Es wird in absehbarer Zukunft kaum ein weiteres Mal möglich sein, sie so umfangreich und zielgerichtet einzusetzen und Erfahrungen zu samm e l n. L a u b s t a r k h o l z v e r h a u (Stückvolumen > 3 Fm/Baum ) Hier ist vermutlich der höchste Anteil motormanuellen Einsatzes erforderlich, vor allem um wertvolles Holz durch saubere Aushaltung zu retten. Auch starke Bagger werden wegen des hohen Holzgewichtes beim Entzerren kaum hilfreich sein, wenn sie ein Rückegassen-System einhalten sollen. Technische Hilfsmittel Starke Schlepper (möglichst über 80 KW) mit Doppeltrommel-Seilwinde. (nicht unter 2 x 80 kn ). Ein starker Rückekran kann beim Manipulieren des Holzes (Sortieren am Weg, Lastbildung, etc.) sehr nützlich sein. Er sollte abseits der Rückegasse nicht zum Anfahren des Stammes missbraucht werden. L a u b h o l z v e r h a u (Stückvolumen >1 3 Fm/Baum ) Auch hier ist noch hoher motormanueller Einsatz erforderlich, um wertvolles Holz zu retten und optimal auszuhalten. Entzerren erfolgt mit starken Seilschleppern oder auch Baggern mit einem Einsatzgewicht von > kg. Technische Hilfsmittel Wie vor. Weiterhin Bagger mit einem Einsatzgewicht von > kg und ca. 10 m Reichweite, um Rückegassen nicht ver- 3 F T I 1+2/
4 lassen zu müssen. Laubholzverhau (Stückvolumen bis 1 Fm/Baum ) Hier kann auf jeden Fall mit starken Radharvestern ( > 140 kw ), besser noch mit Baggerharvestern gearbeitet werden. Der Einsatz dieser Technik als Alternative zu motormanuellen Verfahren wird im wesentlichen von der Qualität des Holzes abhängig sein. Dabei sollte beachtet werden, dass das hohe Holzgewicht und die Entastungsarbeit Kräne und Köpfe extrem belasten. Technische Hilfsmittel Gegebenenfalls Seilschlepper, auch der Klasse 2 ( > kw ) und der Klasse 1 ( < 50 kw ). Die Windenzugkraft sollte Entscheidend ist bei zunehmendem Stückvolumen der Umfang der geforderten Langaufarbeitung des Holzes. Diese Aufarbeitung belastet Kran und Drehkranz nahezu aller Radharvester extrem. Auch hier ist der Baggerharvester im oberen Bereich des Stückvolumens angeb r a c h t. Die Langaufarbeitung sollte für Radharvester der Klasse 3 keinesfalls über ein Stückvolumen von 0,6 0,8 Fm gehen. Erwähnt werden muss, dass die Harvester-Vermessung von derartigem Holz sehr genau ist. Technische Hilfsmittel Im oberen Bereich selbstverständlich Seilschlepper aller Kategorien oder Bagger zum Entzerren. Baggerharvester, Befahrbare Lagen >200 Fm Schadholzvolumen <200 Fm Schadholzvolumen vollmechanisiert teilmechanisiert motormanuell Stückvolumen bis 0,15 Fm in undifferenzierten Beständen: Kurzholzaufarbeitung durch kleinere Kranvollernter bis ca. 70 kw Rücken mit Tragschlepper Stückvolumen 0,1 bis 0,2 Fm in differenzierten Beständen Kurzholzaufarbeitung durch mittelgroße Kranvollernter (Rad- oder Raupen) kw Rücken mit Tragschlepper Stückvolumen 0,1 bis 0,6 Fm Kurzholzaufarbeitung durch große Kranvollernter >140 kw, ggf. auch Langholzaufarbeitung Rücken mit Trag- bzw. Klemmbankschlepper Stückvolumen >0,5 Fm Langholzaufarbeitung durch große Kranvollernter >140 kw Rücken mit Klemmbankschlepper T a b.2: Zusammenstellung von Arbeitsverfahren für befahrbare Lagen. ÿ Motormanuelles Abstocken Entzerren mit Bagger oder Seilschlepper Prozessoraufarbeitung Rücken mit Trag- bzw. Klemmbankschlepper Motormanuelles Abstocken Entzerren mit Bagger oder Seilschlepper Entasten mit Motorsäge Rücken mit Klemmbankschlepper 4 F T I 1+2/ nicht unter 2 x 40 kn liegen. Radharvester wie oben beschrieben. Baggerharvester oder auch Bagger mit oben beschriebener Ausrüstung zum Entzerren. Nadelstarkholzverhau (Stückvolumen > 1,5 Fm/Baum ) Hier dürfte von seiten des Holzverkaufes generell die Forderung nach Langaufarbeitung bestehen, um es so zu verkaufen oder in die Beregnung zu bringen. Neben einer motormanuellen Aufarbeitung mit den oben beschriebenen Hilfsmitteln liegt hier der Schwerpunkt in der hochmechanisierten Holzernte mit Baggerharvestern. Radharvester sind hier überfordert. Dies trifft vor allem für das Langaufarbeiten zu. Technische Hilfsmittel Seilschlepper der Klasse 2 und 3 (s.o.) oder Bagger zum Entzerren. Baggerharvester mit mindestens 10 m Reichweite und entsprechenden Köpfen, möglichst mit HKS-konformer Vermess u n g. Nadelholzverhau (Stückvolumen <1,5 Fm/Baum ) Hier wird nicht weiter unterschieden, da es bei der Fülle der zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten immer fließende Übergänge geben wird. möglichst mit HKS-konformer Vermessung. Radharvester aller Klassen. Die Tabelle2 gibt in Abhängigkeit von Befahrbarkeit, Schadholzvolumen und Mechanisierungsgrad eine Auswahl möglicher Arbeitsverfahren wieder. K.D. Arnold, Hannover und A. Forbrig, KWF III. SICHERHEIT BEI DER S T U R M H O L Z A U F A R B E I T U N G Erfahrungsgemäß steigen die Unfallzahlen in Sturmwurfsituationen erheblich an. Im Jahr des Wiebke - Sturmes 1990 stieg die Anzahl der verletzten Personen um 35%. Damals wurden nahezu 5000 Personen mehr verletzt als sonst üblich. Die Anzahl der Todesfälle stieg 1990 auf 68 Personen im Vergleich zu 31 Toten im Vorjahr. Nun, da wieder so große Holzmengen auf dem Boden liegen und der Aufarbeitung harren, ist es wichtig, sich die Notwendigkeit der intensiven und konsequenten Schulung vor Augen zu halten. Die Aufarbeitung von Holz, das durch den Sturm geworfen wurde, gehört zu den gefährlichsten Forstarbeiten überhaupt. Die Arbeit im Verhau ist dabei besonders unfallträchtig. Es herrschen im allgemeinen folgende Zustände:
5 Schlechte Begehbarkeit im Verhau, Holz ist vielfach gespannt, Bäume sind angeschoben, Kronenteile hängen noch an stehengebliebenen Schaftstücken, wipfellose Schaftstücke sind stehen geb l i e b e n, Wurzelteller sind umgeschlagen, Holz ist gesplittert. H ä u fige Unfallursachen sind neben mangelnder Arbeitsorganisation, ungenügender Einweisung und bewußtem oder unbewußtem Zeitdruck vor allem fehlerhafte Arbeitstechnik, Selbstüberschätzung, Gewöhnung an die Gefahr und Gedankenlosigkeit. Private Waldbesitzer sollten sich unbedingt mit Nachbarn oder anderen Betroffenen verständigen und gemeinsam vorgehen sowie mit dem zuständigen Forstamt oder mit einer nahegelegenen Waldarbeitsschule Kontakt aufnehmen. Planen Sie den Arbeitseinsatz sorgsam und legen Sie die zweckmäßige Ausrüstung fest. Halten Sie Erste-Hilfe-Material bereit. Stellen Sie den Notruf sicher (Handy einsetzen etc.) Überprüfen Sie die Schutzausrüstung auf Funktion und Vollständigkeit und tragen Sie diese bei den Arbeiten kons e q u e n t. 1. Vorschriftenlage: Die Unfallverhütungsvorschriften Forsten geben Anweisungen für das allgemeine Vorgehen. UVV Forsten 6 : Vor Beginn der Aufarbeitung von Windwürfen, von gebrochenem oder in Spannung stehendem Holz ist der Ablauf vom Unternehmer zu planen. Hochliegende Bäume dürfen ausser zum Befestigen von Seilen nicht bestiegen werden. Bei Beginn der Arbeit am Baum sind zunächst gefährliche Spannungen fachgerecht zu beseitigen. Überhängende oder aufrechtstehende Wurzelteller sind vor dem Abtrennen so zu sichern, dass sie nicht wegrollen und nicht zum Stamm hin kippen k ö n n e n. UVV Forsten 6, DA Nr. 2 : Gefährliche Spannungen können fachgerecht beseitigt werden, indem Bäume weggeräumt und spannungfrei abgelegt werden. Unter Spannung stehende Baumteile können von der Druckzone her angeschnitten werden und anschließend z.b. durch versetzten Schnitt, durch Schrägschnitt oder durch Stechschnitt durchtrennt werden. UVV Forsten 6, DA Nr. 3 : Die Sicherung überhängender oder aufrecht stehender Wurzelteller gegen Kippen oder Wegrollen kann dadurch erfolgen, dass Wurzelteller mit Drahtseilen gehalten oder gleichwertig so gesichert werden, dass der Motorsägenführer, der den Teller abtrennt, und andere nicht gefährdet werden Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz Das Motto Sicherheit vor Schnelligkeit muss bei der Sturmholzaufarbeitung mehr sein, als nur ein frommer S p r u c h!! Allgemeine Maßnahmen: So arbeiten Sie sicherheitsbewusst: Legen Sie die Aufarbeitsrichtung und die Arbeitskette fest. Beginnen Sie mit der Aufarbeitung an den Flanken der Seite, aus der der Sturm gekommen ist. Lassen Sie nie mehr Personen im Verhau arbeiten, als unbedingt notwend i g. Gehen Sie stets besonnen und überlegt vor. Beurteilen Sie schwierige Fälle unbedingt gemeinsam. (Nie nur den einzelnen Stamm beurteilen). Setzen Sie bei geringstem Zweifel Hilfen und Geräte ein, die den Mann schützen (Holz mit Seil und Winde sic h e r n ). Arbeiten Sie bei aufeinanderliegendem Holz von oben nach unten. 5 F T I 1+2/
6 6 F T I 1+2/ Nicht unter angedrückten, angesägten Bäumen oder hängenden Wipfelstücken arbeiten. Setzen Sie beim Trennschnitt am Wurzelteller geeignete Motorsägen ein (lange Schiene, damit auf Abstand geschnitten werden kann, starke Motorsäge; hier geht Sicherheit ausnahmsweise vor Ergonomie). Führen Sie Trennschnitte nicht über S c h u l t e r h ö h e. Sichern Sie zum Stamm überhängende, aufrecht stehende oder am Hang in labiler Lage befindliche Wurzelteller mit einer Seilwinde oder dem Seilzug oder belassen Sie ein ausreichend langes Schutzstück. Vergewissern Sie sich vor dem Trennschnitt, dass sich hinter dem Wurzelteller niemand aufhält. Wählen Sie am Hang den Standplatz oberhalb des Stammes (Gefahr durch abrollende Stammteile). Arbeiten Sie noch aufrecht stehende Bäume ohne Schäden erst nach dem Wegräumen des geworfenen Holzes a u f. Wipfellose Schaftstücke müssen i.d.r. umgekeilt werden, da die Kronenlast f e h l t. Versuchen Sie noch anhängende Wipfelstücke vor dem Fällen mit der Seilwinde abzuziehen. Falls das nicht möglich ist, müssen die Dreiecke seitwärts im 90 Winkel gefällt werden. Achten Sie stets auf sicheren Stand Holz in Spannung Für alle Fälle gespannter Hölzer gilt: Immer zuerst in die Druckseite sägen, aber Vorsicht: Klemmgefahr!! Dann gefühlvoll in die Zugseite sägen Bei starken Stämmen, mit starker Spannung, Schnitt seitlich versetzen Bei seitlicher Spannung immer auf der Druckseite stehen (sonst Lebensgef a h r! ) J. Hartfiel, KWF IV. SCHULUNG UND INFORMATION Die Aufarbeitung von Sturmholz ist schwierig und gefährlich. Sie ist eine Ausnahmesituation für alle Beteiligten, die verschärft wird durch den Zwang, die Aufarbeitung rasch zu bewerkstelligen. Kenntnisse und Fertigkeiten der Aufarbeitenden müssen deshalb schnell wieder aufgefrischt werden. Für Privatwaldbesitzer sind praktische Schulungen besonders wichtig. Information der betroffenen Privatw a l d b e s i t z e r Hier steht die besondere Gefahrensituation im Vordergrund, die sich bei der Aufarbeitung von Sturmholz ergibt. Besonders Kleinprivatwaldbesitzer, die nur gelegentlich mit der Motorsäge arbeiten, müssen verstehen, dass Sturmholzaufarbeitung das Geschäft von Profis ist. Sie sollten, wenn immer möglich, die Aufarbeitung von Sturmholz in ihrem Wald erfahrenen Dienstleistern überlassen. Wenn Privatwaldbesitzer ihr Sturmholz selbst aufarbeiten, müssen sie darüber informiert werden, dass systematisches Herangehen und Arbeitsorganisation hier noch wichtiger sind als sonst. Gefahren müssen in allen Arbeitsschritten erkannt, analysiert und die Handlungen danach ausgerichtet werden. Daneben ist es ebenso wichtig die Privatwaldbesitzer über Technik und Verfahren zur Sturmholzaufarbeitung zu inf o r m i e r e n. Hinweise über weitere Beratungs- und Informationsmöglichkeiten, Merkblätter usw. runden die Information der Waldbesitzer ab. Schulung der selbstaufarbeitenden P r i v a t w a l d b e s i t z e r Hier geht es um schnelle Wiederauffrischung von Fertigkeiten und Kenntnissen in kurzen eintägigen Schulungsmaßnahmen, die durch Waldarbeitsschulen vor Ort oder an den Schulen durchgeführt werden. Auch hier sollten zunächst in Kurzvorträgen die besonderen Gefahren der Sturmholzaufarbeitung dargestellt werden; ein Überblick über technische und Verfahrensalternativen kann den theoretischen Teil abschließen. Im Vordergrund müssen aber praktische Übungen stehen. Unter Anleitung sollten zunächst Spannungen im Sturmholz angesprochen werden. Die Beseitigung von Spannungen kann am effektivsten an Spannungssimulatoren oder Spannungs-Übungsstationen geübt werden (19 und 22). In Kleingruppen mit max. 5 Personen sollte dann unter Praxisbedingungen die Sturmholzaufarbeitung mit Schlepperunterstützung durchgeführt werden. Auch hier: bei jedem Ablaufabschnitt Sicherheitsaspekte ansprechen. Natürlich müssen auch Fragen der Arbeitsorganisation besprochen und demonstriert werden. Insbesondere die Rettungskette sollte anebenfalls Thema sein. Schulung der Forstwirte Forstwirte sind Profis der Waldarbeit. Sie können bei der Sturmholzaufarbeitung auch auf ihre berufliche Erfahrung zurückgreifen. Die Ausnahmesituation Sturmholzaufarbeitung, die nur periodisch auftritt, erfordert dennoch auch für diesen Personenkreis kurzfristige Auf-
7 Tab. 3: Aus der KWF-Merkblattdatei: Sturmholzaufarbeitung Broschüren, Merkblätter, Videos 7 F T I /19 9 9
8 frischung der Fertigkeiten und Kenntnisse. Auch hier sind die Waldarbeitsschulen gefordert. Es empfehlen sich halbtägige Schulungen vor Ort. Einem kurzen theoretischen Vorspann sollten intensive praktische Übungen folgen. In Kleingruppen bis max. 10 Personen, denen je ein Schlepper und zwei Ausbilder zugeteilt sind, werden die verschiedenen Aspekte der Sturmholzaufarbeitung vorgeführt. Jeder Teilnehmer sollte die Möglichkeit haben, unter Anleitung entsprechende Arbeitsschritte durchführen. Auszubildende und Sturmwurfa u f a r b e i t u n g Auszubildende sollten nicht bei der Sturmholzaufarbeitung eingesetzt werden. Dabei sein ist wirklich schon alles. Sturmholzaufarbeitung und das Aufarbeiten von Holz unter Spannung werden im dritten Lehrjahr der Ausbildung behandelt. Es sollte nichtsdestotrotz versucht werden die Auszubildenden an die Sturmholzaufarbeitung heranzuführen. Dazu gehören das Ansprechen von Spannungen, Trennschnitte und Verfahren der Sturmholzaufarbeitung. Über allen Ausbildungsaktivitäten muss aber das Primat der Arbeitssicherheit stehen. Auszubildende sollten an den Sicherheitsschulungen teilnehmen. Ausbildende Betriebe müssen ihre Ausbildungspläne an die durch den Sturm veränderten Bedingungen anpassen. Trotz Hiebsstopp in vielen öffentlichen Betrieben sollten für Zwecke der Ausbildung Hiebe geführt werden dürf e n. Lehr- und Lernmedien Es stehen Medien, die nach den letzten Sturmkatastrophen entwickelt worden sind, zur Verfügung (siehe dazu Tab. 3 ). Spannungssimulatoren werden von der Firma GAT (Gesellschaft für Automatisierungstechnik), Pankowerstr. 8 b, Geesthacht und der Firma Metallbau Richert, Dorfstr. 1, Schopsdorf (Tel.: /307) hergestellt. Beim Aufbau von Spannungsstationen berät die Waldarbeitsschule Itzelberg. F o l g e r u n g e n Es ist noch nicht absehbar, wie die Folgen von Lothar gemeistert werden können. Die Periodizität der Ereignisse lässt die während einer Katastrophe gemachten Erfahrungen zwischenzeitlich wieder in Vergessenheit geraten. Alle Erfahrungen sollten deshalb gesammelt, strukturiert und in Form eines offenen, ergänzbaren und weiterführbaren Handbuchs festgehalten werden. Gleichsprachige Nachbarländer könnten dabei kooperieren. Es ist zu überlegen, ob nicht an einer Waldarbeitsschule in Deutschland eine Sturm-Task-Force eingerichtet werden könnte. Dort könnte z.b. das Handbuch erstellt und gepflegt werden. Besonders q u a l i fizierte Ausbilder könnten Technik und Verfahren gezielt für die Sturmholzaufarbeitung weiterentwickeln und durch dauerndes Training festigen. Im Katastrophenfall könnten diese Personen als Ausbilder und Berater eingesetzt werden. J. Morat, KWF V. TECHNIKEN DER R U N D H O L Z K O N S E R V I E R U N G Die Konservierung von Kalamitätsholz dient dessen Qualitätserhaltung und vermeidet gleichzeitig einem extremes Überangebot am Holzmarkt. Zudem erlaubt die Lebendkonservierung eine zeitliche Entzerrung der Aufarbeitung für den Betrieb. Die zur Konservierung im Einzelfall geeigneten Verfahren sind stark von der Holzmenge, der Baumart, dem Holzzustand (Bruch/Wurf) und den regionalen/lokalen Gegebenheiten abhängig (z.b. vorhandene Naßlagerkapazitäten). Aufgrund der z.t. recht hohen Kosten ist unabhängig vom Verfahren jedoch nur großzügig gesundgeschittenes Holz, ggf. getrennt nach Längen/Sorten/Stärkeklassen einzulagern. G r u n d s ä t z l i c h e s : Durch geeignete Konservierungsmethoden (Abb.1) kann Rundholz über mehrere Vegetationsperioden ohne nennenswerte Qualitätseinbußen gelagert werden. Das bisherige Vorgehen zielte darauf ab, den Feuchtegehalt in einem Bereich zu halten, der für die Besiedlung v.a. durch rinden- und holzbrütende Insekten sowie Pilze unattraktiv ist. Solche Bedingungen liegen bei Holzfeuchten von über 120% bzw. unter 40% vor. Zwischenzeitlich bestehen Praxiserfahrungen über die Holzlagerung in sauerstoffarmer Atmosphäre über mehrere Jahre (FVA Baden-Württemberg). Die handelsüblichen Insektizide bieten dagegen nur einen relativ kurzfristigen Schutz. Zuver- 8 F T I 1+2/ A b b.1: Übersicht Rundholzkonservierung
9 lässige Präparate u.a. gegen Bläuepilze sind nicht vorhanden. Nachfolgende Ausführungen beziehen sich v.a. auf die Erfahrungen aus den 90er Stürmen. windruhigen Orten wird die Holzfeuchte im Innern des Polters auf hohem Niveau gehalten. Eine Schutzspritzung gegen Borkenkäfer kann jedoch erforderlich 1. F e u c h t k o n s e r v i e r u n g 1.1 Naßlagerung: Die Beregnung stellt die derzeit beste Konservierungsmöglichkeit für Nadelund Laubstammholz dar. Da die Einlagerung in Oberflächen- und Fließgewässer aus rechtlichen und organisatorischen/logistischen Gründen ggf. nur im geringen Umfang erfolgen kann, wird hier nur auf Naßlagerplätze eingegangen. Baumarteneignung: Fichte: Holzqualität bleibt mindestens 3 Jahre erhalten, die auftretenden Verfärbungen durch Gerbstoffe beschränken sich auf den Splint. Kiefer: Die Holzqualität bleibt auf 5 Jahre erhalten. Buche: Holzqualität bleibt ca. 8 Monate erhalten, es treten jedoch irreversieble Verfärbungen auf. Voraussetzung: rechtliche Genehmigung nach den bundes- und landesrechtlichen Gesetzen (v.a. Wassergesetz). Flächengrößen ab 1ha (erweiterungsfähig). Geeignete Lkw-Zufahrten und Wasserableitungen. Der ganze Lagerplatz sollte mit basenreichem Gestein überschottert werden, um die Abwasserqualiät in der Anfangsphase zu verbessern und das Einwachsen von Hallimasch aus dem Boden in die Polter zu vermeiden. Wasserbedarf bei 1ha ca. 400 m 3 /Tag bei Nadel- und m 3 / T a g bei Laubholz. Auf eine ausreichende Befeuchtung der Stirnflächen ist zu achten. Die Beregnung kann i.d.r. zwischen November und Februar ausgesetzt werden (Frostperioden). Lagerkapazität je ha bei 4m Polterhöhe und 75% effektiv nutzbarer Fläche ca Fm Laub- /Nadelholz bei wechselweise dick- /dünnörtiger Polterung. Abwasser: Nach Inbetriebnahme kommt es im Abwasser zunächst zu einem deutlichen Anstieg von organischen Verbindungen und N H4. Die Konzentrationen gehen jedoch nach einigen Monaten schrittweise auf unkritische Werte zurück. Kosten: Beifuhr ca. 8-15DM/Fm, Beregung 1DM/ Fm und Monat. Die Investionskosten für die Anlage des Platzes sind stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. 1.2 Waldlagerung in Rinde Baumarteneignung: Eiche, Esche Robinie, Lärche und Douglasie (gut), Fi/Ta Kiefer (mittel), Buche u. sonstiges Laubholz (gering). V o r a u s s e t z u n g : Durch rasche Aufarbeitung, intakten Rindenmantel und dichte Polterung (dick- /dünnörtig) an wenig besonnten und sein (Wasserschutzbestimmungen beachten!), sofern das Holz nicht ausserhalb des Waldes gelagert wird. Zum optimalen Schutz empfiehlt sich die Behandlung während der Polterung. Regelmäßige Kontrolle auf Käferbefall ist nötig. Kosten: Sofern Zusammenfahren/Auslagerung erfolgt ca. 7 12D M/Fm, einmalige Schutzspritzung ca. 4 5D M / F m. 2. L e b e n d e n k o s e r v i e r u n g Baumarteneignung: Eiche bis zu 2 Jahre, Buche mit Einschränkung, da Verfärbungsgefahr. Fichte und Kiefer maximal bis zum folgenden Winter danach massive Entwertung durch Pilze und Insekten. Nur auf ganzjährig gut wasserversorgten Standorten, regelmäßige Käferkontrolle nötig. Voraussetzung: Ein wesentlicher Wurzelkontakt mit dem Boden muss gegeben sein (> 1/3), nur geringe Schäden an Stamm und Krone (Pilzeintrittspforten), geringe Bruchholzanteile. Keine sonnen- und windexponierten Flächen. K o s t e n : Kontrolle, ggf. Borkenkäfermonitoring mittels Fallen. 3. Trockenkonservierung Die Trockenkonservierung empfiehlt sich für Nadelstarkholz, sofern keine Naßlagerungsmöglichkeiten gegeben sind, bzw. wenn die Lagerung in Rinde aufgrund möglicher Qualitätseinbußen nicht in Frage kommt. Die bloße Entrindung und Lagerung in Haufenpoltern führt i.d.r. zu Qualitätsverlusten Vorraussetzung: sauber und schonend entrindetes Stammholz. Die Lagerung erfolgt in gut belüfteten freistehenden Poltern mit Zwischenlagen auf Unterlagen (keine Haufenpolter, kein Bodenkontakt) an nicht zu sonnigen Orten, da es bei zu rasch verlaufender Trocknung zur Schwundrißbildung kommt. Die Polter müssen entsprechend gesichert und ge- 9 F T I 1+2/
10 1 0 F T I 1+2/ gen Niederschläge geschützt sein. Bewährt haben sich PE-Folien. Bei sehr langsamer Trocknung ist u.u. eine einmalige Behandlung gegen holzbrütende Borkenkäfer erforderlich. K o s t e n : ca DM/Fm, einmalige Schutzspritzung ca. 4-5DM/Fm. 4. Konservierung in PE-Folie (FVA B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) Das Verfahren macht sich den Umstand zu nutze, dass in luftdicht verpackten Holzpaketen durch Atmung der Holzzellen der eingeschlossene Sauerstoff in kurzer Zeit in Kohlendioxid umgesetzt wird. In dieser Atmosphäre können sich holzzerstörende Organismen nicht entw i c k e l n. Baumarteneignung: Erfahrungen liegen zur Fichte und Buche vor. Beiden Baumarten konnten ohne Verluste der Holzqualität über 4 bzw. 1 Jahr konserviert werden. Bei der Fichte bildeten sich im Splint analog zur Naßlagerung Verfärbungen. Bei der Buche traten gelegentlich ebenfalls Vergrauungen im Splint ein, die bei Dämpfung des Holzes jedoch verschwanden. Voraussetzung: Neben Folienschweißgeräten und einem Instrument zur Sauerstoffmessung im Polter ist spezielles Know-how zur Anlage und Messung nötig. Weitere Geräte werden nicht benötigt. Etwaige Risiken durch Beschädigung/Zerstörung der PE- Folie, z.b. durch Mausfraß, Wind und sich ansammelnde Niederschläge auf der Polteroberseite, können durch entsprechende Maßnahmen minimiert werden. Die Anlage spezieller Lagerplätze ist nicht erforderlich. Die 50 bis 450 Fm großen Packete können im Wald gelagert werden. Das ausgepackte Holz muss zügig der Weiterverarbeitung zugeführt werden. Die Poltergröße ist daher auf die Kapazität des potentiellen Käufers abzustimmen. K o s t e n : Je nach Poltergröße zwischen 30 und 15 DM/Fm 5. Schutzspritzung von Holz in Rinde Voraussetzung: Sofern kalamitätsbedingt Holz im Wald in Rinde gelagert werden muss, kann eine Schutzspritzung gegen holz- und rindenbrütende Borkenkäfer erforderlich sein. Dabei ist auf eine vollständige tropfnasse Benetzung der Stammoberflächen und Polterzwischenräume zu achten, bei großen Poltern ist deshalb ggf. während der Polterung die Spritzung durchzuführen, damit eine ausreichende Behandlung auch der im Polter liegenden Stämme gewährleistet ist. Sofern die Lagerung sich bis in das Frühjahr des 2. Jahres erstreckt ist ggf. eine erneute Behandlung gegen holzbrütende Borkenkäfer nötig. Die Wasserschutz- und Abstandsaufla g e n zu offenen Gewässern sind zu beachten. Behandeltes Holz darf anschließend nicht beregnet werden! Kosten: Ca. 4 5 DM/Fm (einmalig) Frank Bohlander, KWF V. Wiederbewaldung Während bei der Aufarbeitung der Sturmschäden aufgrund drohender Entwertung und Forstschutzprobleme schnelles Handeln geboten ist, bedarf die Wiederbewaldung keiner übereilten Schritte! Die Schadereignisse der letzten Jahrzehnte lieferten der Forstpraxis vielfältige waldbauliche und verfahrenstechnische Erkenntnisse. Erfolge, insbesondere auch mit sukzessionsgestützten, extensiven Verfahren zeigten neue Wege. Unterschiedlichste Ausgangssituationen hinsichtlich Standort, Verjüngungsziel, natürlichem Verjüngungspotential und Ausmaß der betroffenen Flächen erfordern angepasste fallweise Entscheidungen. Sie können nur unter Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten vor Ort getroffen werden. Zur Unterstützung aller betroffenen Waldbesitzer werden in den Ministerien der am stärksten betroffenen Bundesländer (Baden-Württemberg u. Bayern) zur Zeit waldbauliche Handlungsempfehlungen ausgearbeitet. Sie werden rechtzeitig über die örtlich zuständigen Forstämter, die mit ihrer Fach- und Ortskenntnis für alle Fragen als direkte Ansprechpartner zur Verfügung stehen, in die Fläche geb r a c h t. Trotz dieser vielfältigen Einflußgrößen, die im konkreten Einzelfall zu berücksichtigen sind, gibt es aus den Erfahrungen der Vergangenheit auch allgemein gültige Empfehlungen. In Abhängigkeit vom Schadensumfang (Flächengröße) und der Standortsituation sind die entstandenen Sturmwurfflächen nach der Dringlichkeit ihrer Bearbeitung zu reihen. Höhere Priorität haben Flächen mit - Schäden an angekommener Naturverjüngung oder bestehenden Vorbauten durch aufliegendes Reisig, - Forstschutzproblemen (Käfer, Frost), - hohen Risiken von Folgeschäden durch die Kahllage (B o d e n v e r s c h l e c h- terung durch Humusabbau und Nährstoffauswaschung, Vergrasung, Verwilderung, Vernässung...). Trotz der wachsenden Bemühungen den Anteil der natürlichen Verjüngung zu erhöhen, wird wieder auf großer Fläche auf künstliche Verjüngungsverfahren, insbesondere die Pflanzung, zurückgegriffen werden müssen. Empfehlenswerte Pflanzverfahren müssen nicht nur kostengünstig sein, sondern auch sicheres Anwachsen gewährleisten. Hierzu liegen umfangreiche Untersuchungsergebnisse der LWF Bayern (4) aus den letzten Jahren vor. Eine
11 d u r c h z u f ü h r e n. Reiner Hofmann, KWF VI. Weiterführende Literatur: 1.) Autorenkollektiv, 1991 Die Sturmkatastrophe im Wald - eine Herausforderung für die Frosttechnik, Forum auf der INTER- FORST 90, Band 1; KWF-Bericht Nr ) Autorenkollektiv, 1994 Dokumentation der Sturmschäden 1990, verschiedene Autoren, Schriftenreihe der LFV Baden-Württemberg, Band 75, 190 S. 3.) Bücking, et.al., 1997 Untersuchungen zur Lebendlagerung von Sturmwurfholz der Baumarten Fi,Ki,Dgl,Ei, Untersuchungsbericht der FVA Rheinland-Pfalz. 4.) Dahmer J. und Raab S., 1997, Pflanzung und Wurzelentwicklung, LWF-Bericht Nr.15 der Bayrischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft 5.) Dietze W., 1985 Arbeitsplanung und Organisation für die Sturmholzaufarbeitung, Forsttechnische Informationen 2/3, S. 9ff 6.) Dubbel et. al., 1991 Sturmschäden des Frühjahrs 1990 in Hessen, Forschungsbericht Nr. 162 der Hessischen Forstlichen Verfahren Sortiment Anforderungen an Räumungs Bewuchs grad freiheit Gründig keit Skelettar mut Buchenbühler Schrägpflanzung Rhodener Verfahren Bohrpflanzung (Pflanzfuchs, Erdbohrer) Baggerpflanzung Pflanzmaschinen (Brenig Green Master, Frischo u.ä.) Lh 40 bis 60 cm Bis 100 cm Lbh u. Ndh cm Lbh u. Ndh cm Lbh cm Lbh u. Ndh Anforderungen: + = eher hoch; 0 = mittel; = eher gering Tab. 4: Bewährte Pflanzverfahren und deren Anforderungen an die Pfla n z flä c h e. entscheidende Forderung an die Pflanzverfahren ist der Erhalt der vollständigen (unbeschnittenen) Wurzelmasse, insbesondere auch bei Pfahl- und Herzwurzl e r n. Zur Aufforstung von Sturmwurfflächen 1990 wurden insbesondere größere Normalsortimente (60 bis 100 cm) und Großpflanzen (120 bis 180 cm) verwendet. Geringe Pflanzzahlen pro Hektar, geringeres Wildverbißrisiko und verminderte Konkurrenzwirkung der Begleitflora waren trotz höherer Pflanzungskosten pro Stück meist die ausschlaggebenden Argumente für diese auf zahlreichen Flächen erfolgreiche Entscheidung. Neuere Untersuchungen der LWF weisen jedoch darauf hin, dass bei Eiche, Buche, Esche und Ahorn die Vitalität steigt, je kleiner das verwendete Sortiment ist. Die oben genannten Vorteile von Großpflanzen werden demnach mit höheren Risiken erkauft. Vor diesem Hintergrund sollte, sofern mehrere Sortimente in Frage kommen, eher dem kleineren der Vorzug gegeben werden. P fla n z v e r f a h r e n Geeignete Pflanzverfahren müssen - das wurzel- und artgerechte, - ergonomisch vertretbare Einbringen von größeren Pflanzen (mit Pfahl- o. H e r z w u r z e l ) - auf extensiv geräumten Flächen g e s t a t t e n. Einen Überblick über bewährte Pflanzverfahren, die diesen Forderungen gerecht werden, gibt die Tabelle 4. Eine weitere verfahrenstechnische Alternative ist das streifenweise Fräsen von extensiv geräumten Flächen. Die eigentliche Pflanzung erfolgt in diesem Falle gelöst von dieser Pfla n z b e t t v o r b e r e i t u n g mit herkömmlichen Pfla n z v e r f a h r e n. Diese Variante ist besonders dann zu empfehlen, wenn Kalk oder ähnliche Dünger in den Boden eingearbeitet werden sollen. Einige am Markt verfügbare Maschinen (z.b. Pein-Plant) gestatten es, beide Maßnahmen in einem Arbeitsgang Versuchsanstalt, s. 12f 7.) Duffner W., 1991 Mechanisierte Sturmholzaufarbeitung, AFZ 46, S ) Dummel K, 1987 Beitrag der Waldarbeit zur Bewältigung von Waldkatasprophen, AFZ, S ) Düssel V., 1987 Organisations- und Arbeitspla-nungen zur Bewältigung akuter Schadensereignisse, AFZ 35/36 10.) Eisele F.-L., 1987 Holzerntetechniken und Maschinen zur Bewältigung akuter Waldschadensfälle in der BRD, AFZ 35/36, S ) Hubrig M., 1999 Dokumentation der Stumrschäden vom in Niedersachsens Wäldern verursacht durch Schwere lokale Stürme, Aus dem Walde, Mitteilungen der Niedersächsischen Landesforstverwaltung Heft 52, Teil I 12.) König A., 1995 Waldbauliche Dokumentation der flächigen Sturmschäden des Frühjahrs 1990 in Bayern, LWF-Bericht Nr. 2 der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, S. 352ff 13.) Körner H., 1993 Kostenkalkulation aus Sicht des Unternehmers, Der Wald Nr. 43(10), S F T I 1+2/
12 14.) Maier T., 1998 Rundholzkonservierung à la Christo. Ein neues Lagerverfahren für Rundholz. AFZ/Der Wald 26/1998, S ) Maier T., 1997 Alternative Holzkonservierung durch Sauerstoffentzug Lagerungsverlauf und Holzqualität bei der Auslagerung, Versuchsberichte der FVA Baden-Württemberg, Abt. AWF 16.) Maier T.u. Mahler G. Rundholzkonservierung unter Sauerstoffabschluß. Eine Alternative zur Naßlagerung? Teil I u. II; Versuchsberichte der FVA Baden-Württemberg, Abt. A W F 17.) Schneider G., 1991 Sturmholzaufarbeitung. Kritische Würdigung der Beiträge von K.v. Teuffel u. M. Hall in AFZ Nr /1990, S u AFZ 46, S ) Schüler G., 1998 Alternative Holzkonservierung durch Sauerstoffent- zug Umsetzung in die Praxis, Versuchsberichte der FVA Baden-Württemberg, Abt. AWF 19.) Seidler S., 1991 Forstunternehmer bei der Aufarbeitung von Windwürfen mit Harvester-Forwarder-Systemen, Diploma r b e i t 20.) Stolzenburg H.U., 1996 Der Spannungssimulator. Gewusst wie Windwurfaufarbeitung, AFZ 1996, S. 129f 21.) Teuffel K.v., 1990 Räumung von Schlagabraum mit Forwarder, AFZ 45, S ) Teuffel K.v., Hall M., 1990 Sturmholzaufarbeitung mit Vollerntern, AFZ 45, S ) Waldarbeitsschule Itzelberg, 1998 Neue Spannungsstation an der Waldarbeitsschule Itzelberg, Forsttechnische Informationen 1998, S Aus der Prüfarbeit K o m b i n a t i o n s m a s c h i n e HSM 904 F Kombi in FPA - P r ü f u n g Hersteller: HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau-GmbH & Co. Im Greut Neu-Kupfer 1 2 F T I 1+2/ Am fand bei Fa. Thiele in Hayn (Ostharz) im Rahmen der Vorprüfung eine Besichtigung der Kombinationsmaschine HSM 904 F-Kombi durch eine Arbeitsgruppe des Prüfungsausschusses Schlepper und Maschinen statt. Kombinationsmaschinen von Tragund Rückeschlepper sind seit der letzten Interforst im Gespräch. Ohne die jeweiligen Spezialmaschinen vom Markt verdrängen zu können, bieten solche Kombinationsmaschinen den Vortreil großer Universalität. Mit einer Maschine und damit auch einer Investition können Kurzund Langholzsortimente entweder nacheinander oder auch in einem Zuge gerückt werden. Dadurch gewinnt der kleine Forstunternehmer Flexibilität und kann effektiver als mit Spezialmaschinen auch kleinere Rückeaufträge mit großer Kombinationsmaschine HSM 904 F Kombi in FPA-Prüfung. Sortimentsbreite bearbeiten. Mit dem HSM 904 F Kombi ist die erste Maschine dieser Art in FPA-Prüfung. K u r z b e s c h r e i b u n g Die vorgestellte Maschine ist eine Kombination von Tragschlepper und Rückeschlepper. Bewährte Baugruppen des Skidders HSM 904 und des 8-Rad-Rückezuges HSM 208F sind hier zusammengefügt. Sie besteht aus: Vorder u. Hinterwagen in Rahmenbau- weise, verbunden durch ein dezentrales Knickgelenk sowie ein stabiles Verschränkungsgelenk mit hydraulischer Verschränkungsgelenkbremse, Antriebsmotor Iveco 6 Zylinder Turbodieselmotor 108 KW, Clark 3-Gang-Lastschaltgetriebe und 2- s t u figem Verteilergetriebe, 6-Radfahrgestell mit Bereifung 23,1-26 (vorn) und 700/45-22,5 (hinten) Nokia Forest auf Forstfelgen, Differentialsperre (100% Sperrwirkung) elektrohydraul. zuschaltbar, Hinterachse NAF Bogieachse mit Zahnr a d b o g i e g e t r i e b e n, Kabine eigener Konstruktion mit nach hinten schwenkbarem, verstellbarem, luftgefederten Fahrersitz, Lenkung (Obitrollenkradlenkung vorn, Hebellenkung hinten), Arbeitshydraulik ( bioöltauglich nach H e r s t e l l e r a n g a b e ), Ladekran Cranab 660 Combi (9,3 m Auslage) auf Hinterwagen zwischen Kabine und Rungenkorb montiert, Seilwinde: mechanisch angetriebene Adler-Doppeltrommelwinde mit 2x8t Zugkraft elektrohydraulisch betätigt, Seile über Führungrollen in Teleskoprohren zum Fahrzeugheck geführt, Seileinlauf (Umlenk- und Führungsrollen) an heckseitigem Querträger des Rungenkorbrahmens montiert, Teleskop-Rungenkorbrahmen quer zur Fahrzeugachse neigbar, Aus- und Einschub sowie Neigung wird durch eine hydraulisch betätigte Schwinge am Heck des Hinterwagens betätigt, hydraulisch absenkbares Rückeschild am Heck des Hinterwagens, ermöglicht auch das Ausheben der Bogiehinterachse, Prallgitter mechanisch mittels Kran längsverstellbar (2 Positionen), Hinterster Rungenschemel um eine leicht nach hinten geneigte Vertikalachse schwenkbar, übernimmt bei Skidderbetrieb Klemmbankfunktion (Zahnleiste als Stammauflage), die Haltekräfte werden durch Druck des
13 geöffneten Greifers von oben aufgeb r a c h t. Es sind die in nachfolgenden Skizzen dargestellten drei Betriebsmodifikationen m ö g l i c h. 1. Langholzrückevariante mit angekipptem und eingeschobenen Rungenkorb, hinterer Rungenschemel wird nach hinten gedreht und als Klemmbank genutzt. 2. Kombinationsvariante mit angekipptem, jedoch ausgeschobenem Rungenkorb, Kurzholztransport im Rungenkorb, Langholzrückung mittels Seil und Rückeschild. 3. Kurzholzrückung mit eingeschobenem und abgesenktem Rungenkorb (normale Tragschleppervariante). 2. Die Maschine besitzt eine komfortable, geräumige Kabine mit guten Sicht- und ergonomischen Bedingungen sowie Drehsitz. Ausreichende und gut zugängliche Stauräume sind eingebaut. 3. Insgesamt wird diese Maschine als interessante neue Konzeption angesehen, die insbesondere für Forstunternehmer erweiterte Einsatzmöglichkeiten bietet. Wichtigste techn. Daten/Meßergebnisse der Vorprüfung M a s s e n : Eigenmasse: ca kg Nutzmasse: 9000 kg A b m e s s u n g e n : Länge : ca mm Transporthöhe: 2930 mm (ohne Krana u f b a u ) Kurzholzversion (Tragschlepper): Rungenkorblänge(Abstand Prallgitter bis hinteren Rungenschemel): 3850 Heckseitiger Abstand hintere Runge von Bogieachse: 1765 K o m b i n a t i o n s v e r s i o n : Rungenkorblänge(Abstand Prallgitter bis hinteren Rungenschemel): 3040 Heckseitiger Abstand hintere Runge von Bogieachse: ca Klemmbankschlepperversion: Heckseitiger Abstand hintere Runge von Bogieachse: ca. 900 Heckseitiger Abstand Seileinlauf von Bogieachse: ca.1200 Seileinlaufhöhe: ca.1620 Seilkraft: max. 2x8o kn Bodenfreiheit: ca. 580 mm Fahrleistung max. Fahrgeschwindigkeit : 33 km/h F e s t s t e l l u n g e n : 1. Die vorgestellte Kombinationsmaschine zeichnet sich durch eine sinnvoll modifizierte Tragschlepperkonzeption aufbauend auf bewährte Baugruppen des HSM 904, ergänzt durch einen teleskopartig (mittels hydraulisch betätigter Kurbelschwinge) ein- bzw. ausschiebbaren Rungenkorb, ein mit Kran verstellbares Prallgitter, Doppeltrommelseilwinde unterhalb des Kranes, Seileinlauf am Heck des Rungenkorbes und heckseitig absenkbare Bergstütze aus. Durch das Teleskopgetriebe des Rungenkorbrahmens wird einerseits eine vertretbare Rungenkorblänge bei der Tragschlepperversion und andererseits eine hinterachsnahe Positionierung der Klemmbank bei der Langholzversion erreicht. P r o b l e m e : 1. In Bezug auf die Motor-Leistung ist die Nutzlast für einen Tragschlepper relativ gering (9t bei Tragschlepperleistungsklasse 3!). 2. In der derzeitigen Form nicht akzeptabel ist die Gestaltung des Seileinlaufes (Rollendurchmesser zu klein). 3. Als problematisch wird die hohe Passgenauigkeit der Verstellkinematik (insbesondere an den Arretierungsbolzen) in Verbindung mit den rauhen forstlichen Einsatzbedingungen angesehen. 4. Bei Nutzung der Maschine als Klemmbankschlepper (Langholzrückung) verursacht die in Fahrtrichtung starre Klemmbanklagerung durch Geländeunebenheiten und unterschiedliche Holzlängen hohe mechanische Beanspruchungen an Drehschemel und Rungenkorbrahmen. Durch eine funktionsgerechte Neigung der Drehschemelachse nach hinten wurde dieser Effekt konstruktiv gemindert. 1 3 F T I 1+2/
14 E r g e b n i s : Die vorgestellte Maschine entspricht weitestgehend den an Tragschlepper dieser Leistungs- und Preisklasse stellbaren Anforderungen und erscheint insbesondere wegen der Neuartigkeit dieser Konzeption aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes nach Realisierung der gegebenen Empfehlungen prüffähig. Vorbehalt: Die getroffenen gutachterlichen Beurteilungen beruhen auf einer Vorprüfung und stehen unter dem Vorbehalt weiterer Erkenntnisse im Zuge einer formellen Gebrauchswertprüfung des KWF. Die Beurteilung der Vorprüfung darf nur mit diesem einschränkendem Zusatz verwendet werden. K. Arnold und J. Graupner, KWF Aus der Forschung Die Relativzeitstudie Eine empirische Analyse anhand von Holzern t e t ä t i g k e i t e n Katrin Reichel Kurzfassung der Dissertation Die Variabilität der menschlichen Leistung und ihr Einfluß auf die Methodik des Zeitstudiums - Eine empirische Analyse der Relativzeitstudie anhand von Tätigkeiten in der Holzernte am Institut für Forstliche Arbeitswissenschaft der Universität G ö t t i n g e n. 1 4 F T I 1+2/ E i n f ü h r u n g Forstbetriebe benötigen für alle Betriebsarbeiten Vorgabezeiten für Betriebsorganisation, Arbeitsplanung und -kontrolle und leistungsbezogene Entlohnungsform e n. Die Vorgabezeit für die Bearbeitung einer Sacheinheit mit einem bestimmten Arbeitsverfahren wird hergeleitet unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der menschlichen Leistungsherg a b e. Die aus einer Vielzahl von Faktoren bestehende menschliche Leistungshergabe entzieht sich genauer Messbarkeit und Analyse. Das bringt das Problem mit sich, wie der personale Einfluß auf Sachleistungen erfasst und bei der Vorgabezeitherleitung berücksichtigt werden kann. Das ist notwendig, weil allen Vorgabezeiten eines Regelwerkes eine einheitliche Bezugsleistung zugrunde liegen muss, auf die alle in einer Zeitstudie erfassten Ist-Leistungen nivelliert werden. Keine der bekannten Bezugsleistungen (Repräsentative Durchschnittsleistung, Personifizierte Durchschnittsleistung, Normalleistung im Sinne von REFA) kann in dieser Frage vollständig befriedigen. Die Forderung nach Konstanz der Bezugsleistungen wird z.b. dann erhoben, wenn Arbeitsverfahren eine Veränderung bzw. eine Verbesserung erfahren, die die Aktualisierung der zugehörigen Vorgabezeiten erfordert; denn die Bezugsleistung der neu in den Tarif aufgenommenen Vorgabezeiten muss identisch sein mit der Bezugsleistung aller anderen im Tarif enthaltenen Vorgabezeiten einschließlich der alten V o r g a b e z e i t. Im folgenden soll eine Zeitstudienmethodik erläutert werden, bei der die Frage, wie die Bezugsleistung von neuen Vorgabezeiten an die dem vorhandenen Tarif innewohnende Bezugsleistung angeglichen werden kann, methodikimmanent gelöst wird. Relativzeitstudie Methodik und Hyp o t h e s e n Häufig weisen die im Tarif enthaltenen Basistätigkeiten und die neuen Tätigkeiten (= Zieltätigkeiten) Ähnlichkeiten hinsichtlich Arbeitsverfahren, -objekt oder -mittel auf. Aus der Verwandtschaft von Ziel- und Basistätigkeit ergibt sich die Möglichkeit, mit einer Relativzeitstudie die Bezugsleistung der neuen Vorgabezeit der Basis-Bezugsleistung anzugleichen, ohne diese in einem gesonderten Schritt herleiten zu müssen. Folgendermaßen ist vorzugehen: Dieselben Versuchsarbeiter arbeiten jeweils in der Basis- und der Zieltätigkeit. Dabei sind bis auf das Merkmal, in dem sich die beiden Tätigkeiten unterscheiden, idealtypisch alle Neben -Arbeitsbedingungen bei den Tätigkeiten identisch, denn unter dieser Bedingung lassen sich Zeitverbrauchsstreuungen, die innerhalb der Tätigkeiten auftreten, allein auf die menschliche Leistungsstreuung zurückführen. Beide Tätigkeiten werden durch Zeitstudien erfaßt. Nimmt man an, dass sich die zwei Zeitverbrauchswerte (zv) der einzelnen Versuchsarbeiter zu- einander verhalten wie der gesuchte Vorgabezeitwert (Vgzt) der Zieltätigkeit zum bekannten Vorgabezeitwert der Basistätigkeit, d.h. z v Z i e l t ä t i g k e i t / z v B a s i s t ä t i g k e i t = V g z t Z i e l t ä t i g k e i t / V g z t B a s i s t ä t i g k e i t so lässt sich die gesuchte Vorgabezeit der Zieltätigkeit errechnen als V g z tzieltätigkeit = ( zv Zieltätigkeit / zv Basistätigkeit ) x V g z t B a s i s t ä t i g k e i t Dieses Vorgehen ist möglich, wenn folgende Annahmen zutreffen: ( 1 ) Die Relativzeiten sind nur gering mit den Streuungseinflüssen der menschlichen Leistung belastet. Die Relationen zwischen den Zeitverbrauchswerten von Basis- und Zieltätigkeit streuen daher wesentlich geringer als die originären Zeitverbrauchswerte innerhalb der einzelnen Tätigkeiten. Diese Annahme impliziert zwei Vora u s s e t z u n g e n : (a) Die Leistungshergabe eines Arbeiters schwankt nur in begrenztem Umf a n g. (b) Ändern sich Arbeitsbedingungen, so reagieren die Arbeiter darauf mit prozentual ähnlichen Änderungen ihrer Zeitverbrauchswerte. ( 2 ) Als Folge aus Annahme (1) lässt sich der Stichprobenumfang, der für eine repräsentative Aussage nötig ist, durch Anwendung der Relativzeitstudie im Vergleich zu konventionellen Zeitstudien verringern. Die Stichprobenumfänge werden über den Repräsentationsfehler verglichen:
15 Rf = t x Variationskoeff. (zv) / _ n ( 3 ) Die Relation zwischen den Zeitverbrauchswerten der Ziel- und der Basistätigkeit wird in der Relativzeitstudie unter einer ganz bestimmten, zwischen beiden Tätigkeiten identischen Kombination von Ausprägungen von Arbeitsbedingungen ermittelt. Es wird angenommen, dass sich diese Relation auf alle anderen Ausprägungen dieser Arbeitsbedingungen übertragen lässt, sofern diese zwischen Zielund Basistätigkeit identisch bleiben. Beispiel: Basis- und Zieltätigkeit sind der Einschlag jeweils eines Holzsortimentes. Die Sortimente unterscheiden sich durch die Baumstärke, die Hangneigung bleibt identisch. Die Zeitverbrauchsrelation zwischen den Sortimenten lässt sich auf andere Hangneigungen übertragen. Die Grundgedanken dieser Methodik sind in ähnlichen Formen unabhängig voneinander in Schweden von MORN (1953) sowie MAKKONEN (1954), in Finnland von ARO (z.b. 1963) und in Deutschland von HÄBERLE (1965) beschrieben worden. Die von HÄBERLE lediglich in Hypothesen formulierte Methodik fand in Deutschland bereits Eingang in die Praxis der Tariferstellung: Sie wurde in den 70er Jahren bei der Aktualisierung des HET- Grunddatenmaterials für die Entwicklung des EST verwendet und Anfang der 80er Jahre für eine Aktualisierung des EST hera n g e z o g e n. Zielsetzung der Untersuchung Die Methodik wurde anhand eines Arbeitsverfahrens experimentell geprüft. Folgenden Fragen wurde dabei nachgeg a n g e n : 1. Wie ist die Streuung der Leistungshergabe der Versuchsarbeiter zu beschreiben? Wie stark werden die Zeitverbrauchsrelationen von dieser Leistungsstreuung beeinflu ß t? 2. Sind alle Arbeiter gleichermaßen als Versuchsarbeiter für eine Relativzeitstudie geeignet? 3. Kann eine Relativzeitstudie mit einem Musterarbeiter durchgeführt werden, d.h. können Ergebnisse einer Relativzeitstudie mit nur einem Arbeiter repräsentativ sein für eine größere Arb e i t e r g r u n d g e s a m t h e i t? 4. Ist die Relation der Zeitverbrauchswerte zwischen Ziel- und Basistätigkeit numerisch gleich zwischen verschiedenen Ausprägungen von Arbeitsbedingungen (bei identischen Ausprägungen in Ziel- und Basistätigkeit)? (sog. K o n v e r g e n z - H y p o t h e s e ) 5. Welcher Stichprobenumfang ergibt sich für die Relativzeitstudie im Vergleich zu einer konventionellen Zeits t u d i e? 6. Da Arbeitsbedingungen im Wald i.d.r. nicht homogen sind, ist zu erwarten, dass neben den Arbeitsbedingungen, durch die sich Ziel- und Basistätigkeit unterscheiden, weitere Neben - Arbeitsbedingungen auftreten. Nehmen diese Einfluß auf das Ergebnis? Wenn ja: Wie lässt sich die Grundmethodik der Relativzeitstudie so erweitern, dass Neben -Arbeitsbedingungen in methodisch operationaler Weise berücksichtigt werden? D a t e n m a t e r i a l Die Methodik der Relativzeitstudie wurde experimentell am Beispiel des Arbeitszyklusses Fällen mit EMS, Entasten mit EMS, Handentrindung in mittelstarker Fichte untersucht. Das Datenmaterial umfasst Zeitstudien an 101 Versuchsarbeitern. Jeder Versuchsarbeiter bearbeitete vier Fichten, die durch die Merkmale Baumstärke und Hangneigung klassifiziert waren: Baum 1 [28 cm Bhd / 00 % Hangneigung] Baum 2 [28 cm Bhd / 40 % Hangneigung] Baum 3 [42 cm Bhd / 00 % Hangneigung] Baum 4 [42 cm Bhd / 40 % Hangneigung] Zusätzlich bearbeitete ein Musterarbeiter 24 Sätze von je 4 Fichten. Die Bearbeitung der Bäume aller Straten kann gleichermaßen Ziel- und Basistätigkeit sein. Es wurden die Ist-Zeiten von Fällung, Entastung und Entrindung sowie die Naturaldaten der Bäume detailliert erfaßt. Ergebnisse und Schlussfolgerungen Die Untersuchung ergab zu den Fragestellungen (1) (6) folgendes: ( 1 ) Die Streuung der Leistungshergabe der Versuchsarbeiter ist wie folgt zu charakterisieren: (a) Die intraindividuelle Leistungsstreuung beträgt im Durchschnitt bei RAZ Fällen 20,3%, bei RAZ Entasten 13,3% und bei RAZ Entrinden 15,5% und ist damit stets geringer als die durchschnittliche interindividuelle Leistungsstreuung mit 26,1%, 17,8% und 27,1%. (b) Die RAZ Entasten weisen die geringste Leistungsstreuung auf, was durch den im Vergleich der Tätigkeiten hohen Mechanisierungsgrad zu erklären ist. Die RAZ Fällen weisen eine hohe Leistungsstreuung auf, weil diese Tätigkeit in besonderem Maße von Arbeiter-Eigenschaften abhängig ist und weil kurze Arbeitsablaufabschnitte anfälliger gegen zufällige Leistungsschwankungen sind. Die hohe interindividuelle Leistungsstreuung bei RAZ Handentrinden resultiert v.a. aus den unterschiedlichen Schälfähigkeiten der Versuchsarbeiter. (c) Im Mittel der Tätigkeiten beträgt das Verhältnis von minimalen zu maximalen Einzelleistungen der Versuchspersonen 1:4, das Verhältnis von minimalen zu maximalen Durchschnittsleistungen 1:2,4. (d) Der Umfang der intraindividuellen 1 5 F T I 1+2/
16 Leistungsstreuung ist unter den Versuchsarbeitern sehr verschieden. Er variiert zwischen den extremen Var i a t i o n s k o e f fizienten von 4% und 47% bei RAZ Fällen, 3% und 28% bei RAZ Entasten sowie 2% und 34% bei RAZ E n t r i n d e n. (e) Aus der Höhe der Durchschnittsleistung eines Versuchsarbeiters bei einer der Tätigkeiten ist die Höhe der Durchschnittsleistung bei einer anderen der Tätigkeiten nicht vorauss a g b a r. (f) Aus der prozentualen Leistungsstreuung eines Versuchsarbeiters bei einer der Tätigkeiten ist dessen prozentuale Leistungsstreuung bei einer anderen der Tätigkeiten nicht vorauss a g b a r. ( g )V o n Bedeutung für die Relativzeitstudien-Methodik ist die Frage, ob zwischen Durchschnittsleistung und prozentualer Leistungsstreuung ein Zusammenhang besteht, der ein Minimum hat: Dann könnten anhand von Durchschnittsleistungen Versuchsarbeiter für Relativzeitstudien ausgewählt werden. Ein solcher Zusammenhang bestand jedoch bei keiner der untersuchten Tätigkeiten. F a z i t ( 1 ) Die Hypothese, dass die Zeitverbrauchsrelationen nur gering mit Einflüssen der menschlichen Leistungsstreuung belastet sind, muss für alle Tätigkeiten abgelehnt werden. ( 2 ) Nicht alle Versuchsarbeiter sind gleichermaßen für eine Relativzeitstudie geeignet. Diese Feststellung ergibt sich aus der folgenden Beobachtung: Folge aus Ergebnis (1) ist, dass bei dem untersuchten Versuchsarbeiterkollektiv bei den meisten Kombinationen von Ziel- und Basistätigkeiten die Stichprobe für die Relativzeitstudie wesentlich größer sein muss als die für eine konventionelle Zeitstudie. Jedoch ist der Stichprobenumfang der Relativzeitstudie zu senken, wenn man Versuchsarbeiter hat, deren prozentuale Leistungsstreuung (weit) unterdurchschnittlich ist: Wählt man z.b. aus dem Versuchsarbeiterkollektiv diejenigen Versuchsarbeiter aus, deren Leistungshergabe höchstens um 10% variiert, so führt das dazu, dass im Durchschnitt aller 1 6 F T I 1+2/ T a b.1: Stichprobenumfangvergleich konventionelle Zeitstudie Relativzeitstudie (Probandenkollektiv mit Variatio n s k o e f fizient LI<10).
17 Tätigkeiten und aller Zielstraten die Stichprobe für die Relativzeitstudie ca. 60% des Stichprobenumfangs einer konventionellen Zeitstudie beträgt. (Tab. 1). Die Reduktion des Versuchsarbeiterkollektivs ist jedoch nur dann möglich, wenn sich dadurch die Zeitverbrauchsrelationen zwischen Basis- und Zieltätigkeit gegenüber dem Gesamtkollektiv nicht verschieben. Im vorliegenden Versuch stimmten diese Relationen weitestgehend überein. ( 3 ) Dagegen stimmten die Zeitverbrauchsrelationen des Musterarbeiters nicht mit denen des Gesamtkollekivs der Versuchsarbeiter überein. Die Zeitverbrauchswerte eines einzelnen Arbeiters sind individuell geprägt durch Interaktionen zwischen Arbeiter, Arbeitsverfahren und Arbeitsbedingungen. Der Musterarbeiter vermag das Versuchsarbeiterkollektiv nicht zu repräsentieren. ( 4 ) Innerhalb eines größeren Versuchsarbeiterkollektivs bleiben Zeitverbrauchsrelationen, die sich unter bestimmten Ausprägungen von Arbeitsbedingungen ergeben, nahezu gleich, wenn man sie unter anderen Ausprägungen dieser Arbeitsbedingungen ermittelt (Tab. 2). Beim Musterarbeiter weichen die Relationen der konvergenten Stratenpaare jedoch um 0% 12% voneinander ab; er vermag auch hierin das Probandenkollektiv nicht zu repräsentieren. ( 5 ) Verwendet man die Relativzeitstudie anstelle einer konventionellen Zeitstudie zur Vorgabezeitherleitung unter einer Kombination von Ausprägungen von Arbeitsbedingungen, so bringt das eine Verringerung des Stichprobenumfangs nur dann mit sich, wenn die Leistungsstreuung der Versuchsarbeiter unterdurchschnittlich ist. Die Stichprobenreduktion wird jedoch bedeutend, wenn sich die Zeitverbrauchsrelationen zwischen Ziel- und Basistätigkeit unter anderen Ausprägungen bestimmter Arbeitsbedingungen als gleich erweisen. Lässt sich der notwendige Stichprobenumfang prognostizieren? Er hängt ab von (a) den Eigenschaften der Zeitverbrauchswerte von Ziel- und Basisstratum, (b) deren Verteilung und (c) deren Korrelation. (b) und (c) sind jedoch kaum prognostizierbar. ( 6 ) Dass die Neben -Arbeitsbedingungen bei Ziel- und Basistätigkeit gleich sind, ist unter den stark variierenden Arbeitsbedingungen im Wald i.d.r. nicht zu gewährleisten. Es ist jedoch möglich, den Einfluss der variablen Naturaldaten zu eliminieren, indem man durch eine Kovarianzanalyse in dem durch Baumstärke und Hangneigung klassifizierten Datenmaterial Regressionsbeziehungen zwischen Zeitverbrauch und variablen Neben-Arbeitsbedingungen herstellt. Ob die Relativzeitstudie ein operationales Verfahren zur Ermittlung bzw. Aktualisierung von Vorgabezeiten ist, kann abschließend erst beurteilt werden nach Beantwortung der Fragen hinsichtlich (1) der Ermittelbarkeit von Arbeitern mit geringer Leistungsstreuung, (2) der Prognostizierbarkeit des notwendigen Stichprobenumfangs der Relativzeitstudie und (3) der Bestätigung der Konvergenz-Hypothese anhand eines umfassenderen Dat e n m a t e r i a l s. Den Landesforstverwaltungen Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wird für die Bereitstellung von Versuchsflächen und Versuchsarbeitern gedankt. Eine ausführliche Literaturliste ist bei der Autorin zu erhalten. Katrin Reichel Am Erdbeerstein Königstein im Taunus T a b.2: Gegenüberstellung der Zeit-Relation zweier Stratenpaare mit unterschiedlichen Ausprägungen von Arbeitsb e d i n g u n g e n. 1 7 F T I 1+2/
18 13. KWF-Tagung Bilder der Fachexkursion Einige ausgewählte Bilder der Fachexkursion der 13. Grossen KWF-Tagung (13. bis in Celle) werden in den nächsten Ausgaben der Forsttechnischen Informationen kurz vorgestellt. Schwerpunkt Verfahrenstechnik Zielstärkennutzung im Laubholz unter den Bedingungen naturnaher Waldwirtschaft am Beispiel der B u c h e Naturnahe Waldwirtschaft ist in den Landesforstverwaltungen, vielen kommunalen und privaten Forstbetrieben inzwischen Oberziel. Mit der Umsetzung dieses Zieles gehen strukturelle Veränderungen in unseren Wäldern einher, die die Waldarbeit und Forsttechnik- insbesondere auch die Holzernte anspruchsvoller und oft auch schwieriger und gefahrvoller werden lassen. Die gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit bei der Starkholzernte können in den durch Unter- und Zwischenstand unübersichtlich gewordenen Althölzern mit erwünschtem höheren Totholzanteil nur durch eine seilschlepperunterstützte Fällung erfüllt werden. Daneben sind häufig nur auf diesem Wege Einschläge holzmarktbedingt teilweise auch im belaubten Zustand bestandesschonend durchführb a r. Am Beispiel der Baumart Buche wird ein seilschlepperunterstütztes Starkholzernteverfahren vorgestellt, bei dem besonders auf die Kommunikation zwischen Fällern und Rücker mittels Sprechfunk [Jedermann-Funk (LPD) im 70-cm Band] und das wirtschaftlich günstige und sichere Anbringen des Schlepperseiles am zu fällenden Zielstärkebaum eingegangen wird. Das Verfahren stellt vor: Versuchs- und Lehrbetrieb für Waldarbeit und Forsttechnik beim hessischen Forstamt Weilburg Frankfurter Str. 31 D Weilburg Tel /39075 Fax 06471/1786 Forstliches Bildungszentrum R h e i n l a n d - P f a l z In der Burgbitz 3 D Hachenburg Tel /95470 Fax 02662/ P e r s o n e l l e s J ü rgen Herget im Ruhestand 1 8 F T I 1+2 / Oberamtsrat Jürgen Herget, langjähriger Leiter des Betriebes Staatliche Samenklenge und Pflanzgarten Laufen der Bayerischen Landesanstalt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, Teisendorf, wurde mit Ablauf des Septembers 1999 in den Ruhestand versetzt. Seine forstliche Laufbahn beginnt er am 02. Januar 1954 als Lehrling für den gehobenen technischen Staatsforstdienst im Forstamt Bad Brückenau. Im Juli 1960 legt er die Revierförsterprüfung als Bester mit der Note sehr gut ab. Seine eigene Forstdienststelle wird am 02. Januar 1961 das Revier Bischbrunn I. Schon im gleichen Jahr wird er an die Forstschule Lohr abgeordnet, um bei den Auswärtskursen der Revierförsteranwärter mitzuwirken. Im Mai 1961 kommt er auf diesem Weg zum ersten Mal in den Betrieb Laufen. Im November 1968 wird er an die Forstschule Lohr versetzt, wo er Dienstkunde und Jagdkunde lehrt. In dieser Zeit eignet er sich besondere pädagogische und didaktische Fähigkeiten an. Sein breitgestreutes, fundiertes Fachwissen und seine ausgesprochene Führungseignung waren der Grund für seine erfolgreiche Bewerbung um die Stelle als Betriebsleiter in Laufen im März Jahre lang hat Jürgen Herget in Lau-
19 fen gewirkt. In diese Zeit fallen große betriebliche Veränderungen. Die betonte Nachzucht von Fichten wird umgestellt auf ein breitgefächertes Spektrum von Baumarten. Für die Schutzwaldsanierung werden Containersysteme für Ballenp flanzung entwickelt. Im Zuge von Generhaltungsprogrammen werden erhebliche Investitionen zur Lagerung von Saatund Pflanzgut getätigt. Politisch geforderte Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit waren zu vollziehen, ohne die Funktionsfähigkeit des Betriebes für Aus- und Fortbildung sowie für Forschung und Entwicklung im Bereich des forstlichen Vermehrungsgutes zu verlier e n. Jürgen Herget hat seine Persönlichkeit in diese Arbeit eingebracht und sich um den Jungwuchs Pflanze, wie Mensch sehr verdient gemacht. Wir wünschen ihm einen frohen und gesunden Ruhestand. A. Behm Herrn Professor Dr. Siegfried Häberle, früherer Direktor des Instituts für Waldarbeit und Forstmaschinenkunde an der Universität in Göttingen, von 1967 bis 1997 KWF-Verwaltungsratsmitglied, von 1974 bis 1976 KWF-Vorstandsmitglied und seit 1967 KWF-Mitglied, zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am 16. November Ausführliche Würdigungen finden sich in FTI 11/89 und 12/94. Wir gratuliere n Herrn Klaus-Jürgen Roediger, früheres langjähriges Mitglied im KWF-Arbeitsausschuß Jungwuchspflege und seit 1967 KWF-Mitglied, zur Vollendung seines 75. Lebensjahres am 13. Dezember Anläßlich der Jahrestagung des KWF- Ausschusses Waldarbeitsschulen am 12. Oktober 1999 in Bernau/Brandenburg wurde dessen langjähriger Leiter Dr. Silvius Wodarz mit der KWF-Medaille geehrt, die ihm der KWF-Vorstand für seine Verdienste um die Waldarbeiter-Aus- und Fortbildung und um den Ausschuß Waldarbeitsschulen verliehen hatte. Der stellvertretende KWF-Vorsitzende Dr. Wolfgang Hartung übergab die Medaille mit folgender Laudatio: Forstdirektor Dr. Silvius Wodarz, am 14. Dezember 1930 in Ratibor / Oberschlesien geboren, auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, studierte Forstwissenschaften in Hannoversch Münden und promovierte mit der Arbeit Ertragskundliche Untersuchungen über den Buchen-Unterstand unter Eiche, Kiefer und Lärche trat er in den schleswig-holsteinischen Landesforstdienst ein folgte er einem Ruf an die Lehranstalt für Forstwirtschaft der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Bad Segeberg, die er bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven Forstdienst Ende 1995 leitete. Als Leiter der Lehranstalt war er Mitglied im KWF-Arbeitsausschuß Waldarbeitsschulen, zu dessem Vorsitzenden er 1974 gewählt wurde, bis er diese wichtige bundesweite Aufgabe 1993 nach 19 Jahren in jüngere Hände weitergab. Bleibende Spuren der Arbeit zusammen mit seinem Ausschuß sind die Integration der vielfältigen Konzepte und Ansätze zu einem gemeinsamen Standpunkt der deutschen Waldarbeitsschulen, der ihm das notwendige fachliche Gewicht KWF-Medaille an D r. Silvius Wo d a r z Dr. Wodarz (rechts) im Gespräch mit Landesforsmeister a. D. Dr. Georg Volquardts. in dem komplexen politischen Interessenspiel verlieh. Diesen Standpunkt hat er stets unbeirrt mit Nachdruck, aber auch mit Witz, Charme und einem Schuß Bauernschläue vertreten. Beispielhafte Ergebnisse dieser Integration, ergänzt durch sein unermüdliches persönliches Zupacken und Beispiel-Geben, sind - die sog. FOMA, Vorläufer des bereits in dritter Auflage in Arbeit stehenden Fachkundebuchs für die Forstwirtausbildung, Der Forstwirt ; dessen beiden ersten Auflagen betreute er als verantwortlicher Herausgeber für den Ausschuß Waldarbeitsschulen; - Mitwirkung bei der Verordnung über die Berufsausbildung zum Forstwirt vom , - langjähriger Vorsitz des Arbeitskreises der zuständigen Stellen für die Berufs- 1 9 F T I 1+2/
Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach
 Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach Folie 2 Meteorologischer Ablauf Entstehung eines Sturmtiefs über dem Nordatlantik am 25. Dezember 1999 Rapider Druckabfall innerhalb weniger Stunden Zugbahn
Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach Folie 2 Meteorologischer Ablauf Entstehung eines Sturmtiefs über dem Nordatlantik am 25. Dezember 1999 Rapider Druckabfall innerhalb weniger Stunden Zugbahn
Prüfbericht. Forstschlepper Welte W 130 K und Variante W 130 mit Rückekran. KWF-Verzeichnis-Nr.:
 Prüfbericht KWF-Verzeichnis-Nr.: 1.09.3785 Forstschlepper Welte W 130 K und Variante W 130 mit Rückekran Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland und Inhaber der Prüfurkunde: Firma Welte Fahrzeugbau
Prüfbericht KWF-Verzeichnis-Nr.: 1.09.3785 Forstschlepper Welte W 130 K und Variante W 130 mit Rückekran Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland und Inhaber der Prüfurkunde: Firma Welte Fahrzeugbau
Gefährdungsbeurteilung
 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Abteilung II, Ref II/5 Sifa-Support Gefährdungsbeurteilung Arbeitsschutzgesetz UVV Richtlinien des Freistaates Vorlagen zu Gefährdungsbeurteilungen
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Abteilung II, Ref II/5 Sifa-Support Gefährdungsbeurteilung Arbeitsschutzgesetz UVV Richtlinien des Freistaates Vorlagen zu Gefährdungsbeurteilungen
LSV-Information. Weiterbildung Arbeiten mit der Motorsäge für Waldbauern und Waldbesitzer
 LSV-Information Weiterbildung Arbeiten mit der Motorsäge für Waldbauern und Waldbesitzer Stand 05.08.2015 Inhaltsverzeichnis Seite 0 Vorbemerkung... 2 1 Einleitung... 3 2 Persönliche und fachliche Eignung...
LSV-Information Weiterbildung Arbeiten mit der Motorsäge für Waldbauern und Waldbesitzer Stand 05.08.2015 Inhaltsverzeichnis Seite 0 Vorbemerkung... 2 1 Einleitung... 3 2 Persönliche und fachliche Eignung...
Ergebnisprotokoll. Amtschefkonferenz am 13. Januar 2000 in Berlin
 Ergebnisprotokoll Vorsitz: Ministerialdirektor Anton Adelhardt Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forst - 2 - TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung Beschluss: Die Tagesordnung
Ergebnisprotokoll Vorsitz: Ministerialdirektor Anton Adelhardt Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forst - 2 - TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung Beschluss: Die Tagesordnung
Entastungstechniken. Grundinformationen
 Entastungstechniken Grundinformationen Drei wichtige Gründe Es gibt mindestens 3 wichtige Gründe, eine perfekte Entastungstechnik mit der Motorsäge zu beherrschen. Entastungsarbeit ist: 1. Gefährlich Jeder
Entastungstechniken Grundinformationen Drei wichtige Gründe Es gibt mindestens 3 wichtige Gründe, eine perfekte Entastungstechnik mit der Motorsäge zu beherrschen. Entastungsarbeit ist: 1. Gefährlich Jeder
Übersicht unserer Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
 Übersicht unserer Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Harvester Holzerntemaschine mit 360PS und 8-fach 700er Niederdruckbereifung, mit bis zu 11m Reichweite, maschinelles Baumfällen bis 70cm Durchmesser. HSM
Übersicht unserer Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Harvester Holzerntemaschine mit 360PS und 8-fach 700er Niederdruckbereifung, mit bis zu 11m Reichweite, maschinelles Baumfällen bis 70cm Durchmesser. HSM
5. Ernten und Verwenden von Forsterzeugnissen Fällen und Nutzen
 Unterricht, FAZ Mattenhof 1. Mensch und Arbeit 2. Begründung und Verjüngung von Waldbeständen 3. Pflege von Waldbeständen 4. Wald und Naturschutz - Lebensgemeinschaft Wald 5. Ernten und Verwenden von Forsterzeugnissen
Unterricht, FAZ Mattenhof 1. Mensch und Arbeit 2. Begründung und Verjüngung von Waldbeständen 3. Pflege von Waldbeständen 4. Wald und Naturschutz - Lebensgemeinschaft Wald 5. Ernten und Verwenden von Forsterzeugnissen
- knickgelenkt. gerecht wird. Der NF160-6R schreibt die Erfolgsstory des NF160 im 6-Rad Bereich weiter.
 - knickgelenkt 14 - knickgelenkt NF160-6R - schnell, kombiniert und leistungsstark Der NF160-6R ist die konsequente Fortsetzung unserer Kombinationsmaschinen-Strategie. Auf Basis des erfolgreichen NF160
- knickgelenkt 14 - knickgelenkt NF160-6R - schnell, kombiniert und leistungsstark Der NF160-6R ist die konsequente Fortsetzung unserer Kombinationsmaschinen-Strategie. Auf Basis des erfolgreichen NF160
Waldbesitzerschule Sachsen startet im Mai!
 Waldbesitzerschule Sachsen startet im Mai! Seit über zwei Jahren bemüht sich der Sächsische Waldbesitzerverband um Schulungsangebote für Waldbesitzer. Nun geht es endlich los. Anmeldungen sind ab sofort
Waldbesitzerschule Sachsen startet im Mai! Seit über zwei Jahren bemüht sich der Sächsische Waldbesitzerverband um Schulungsangebote für Waldbesitzer. Nun geht es endlich los. Anmeldungen sind ab sofort
Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer Niedersachsen e.v. Frank-Ludger Sulzer, (Diplom-Forstwirt)
 Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer Niedersachsen e.v. Frank-Ludger Sulzer, (Diplom-Forstwirt) FoWi Holzeinschlag- und Holzhandelsunternehmen, 21644 Wiegersen AfL Nds. e.v. 1979 Forderungen
Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer Niedersachsen e.v. Frank-Ludger Sulzer, (Diplom-Forstwirt) FoWi Holzeinschlag- und Holzhandelsunternehmen, 21644 Wiegersen AfL Nds. e.v. 1979 Forderungen
Voraussetzung dafür ist: Ziel:
 Erste Hilfe nach Unfällen im Wald "Rettungskette Forst" Nach der Unfallverhütungsvorschrift hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass bei Arbeitsunfällen unverzüglich die notwendige Hilfe herbeigerufen
Erste Hilfe nach Unfällen im Wald "Rettungskette Forst" Nach der Unfallverhütungsvorschrift hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass bei Arbeitsunfällen unverzüglich die notwendige Hilfe herbeigerufen
Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels. Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst
 Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Die Baumartenzusammensetzung entscheidet für die nächsten 70 150 Jahre über Stabilität,
Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Die Baumartenzusammensetzung entscheidet für die nächsten 70 150 Jahre über Stabilität,
Lehrgangsunterlagen Modul 3 - Fälltechnik. www.kirst-forst.de
 Lehrgangsunterlagen Modul 3 - Fälltechnik www.kirst-forst.de 1 Lehrgangsunterlagen Modul 3 (Fälltechnik): Werkzeugauswahl Spaltaxt Keile Kombi Kanister Motorsäge Wendehaken Wendering www.kirst-forst.de
Lehrgangsunterlagen Modul 3 - Fälltechnik www.kirst-forst.de 1 Lehrgangsunterlagen Modul 3 (Fälltechnik): Werkzeugauswahl Spaltaxt Keile Kombi Kanister Motorsäge Wendehaken Wendering www.kirst-forst.de
Forstwirtschaft der Schweiz. Taschenstatistik 2009
 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 29 Neuchâtel, 29 Forststatistik 28 Schweiz Zürich Bern Luzern Holznutzung Total in m 3 5 262 199 428 645 1 58 791 329 465 Veränderung zum Vorjahr (27) in %
Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 29 Neuchâtel, 29 Forststatistik 28 Schweiz Zürich Bern Luzern Holznutzung Total in m 3 5 262 199 428 645 1 58 791 329 465 Veränderung zum Vorjahr (27) in %
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern
 Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Unsere Tanne fest verwurzelt! Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst
 Unsere Tanne fest verwurzelt! Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Tanne: Baumart für weltvergessene Waldbauträumer? oder Baumart für betriebswirtschaftlichen Erfolg? 2 Weißtanne
Unsere Tanne fest verwurzelt! Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Tanne: Baumart für weltvergessene Waldbauträumer? oder Baumart für betriebswirtschaftlichen Erfolg? 2 Weißtanne
Erd-Kühlschrank selbst machen
 Erd-Kühlschrank selbst machen Von Arto F.J. Lutz gefunden auf http://www.philognosie.net/index.php/article/articleview/858/ Vielleicht glauben viele Zeitgenossen in einer niemals versagenden Infrastruktur
Erd-Kühlschrank selbst machen Von Arto F.J. Lutz gefunden auf http://www.philognosie.net/index.php/article/articleview/858/ Vielleicht glauben viele Zeitgenossen in einer niemals versagenden Infrastruktur
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald -
 Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Wie weit gehen wir, um Bodenverdichtungen auf zu brechen?
 Wie weit gehen wir, um Bodenverdichtungen auf zu brechen? Vorhaben: Mit einem Erdbohrer, die Bodenstruktur zu Gunsten der Pflanzen verändern. Verwendetes Material: > gewaschener Kies 0-3 mm > reiner Kompost
Wie weit gehen wir, um Bodenverdichtungen auf zu brechen? Vorhaben: Mit einem Erdbohrer, die Bodenstruktur zu Gunsten der Pflanzen verändern. Verwendetes Material: > gewaschener Kies 0-3 mm > reiner Kompost
Handlungshilfe Selbstcheck Sicherheit und Gesundheit - Schule -
 Handlungshilfe Selbstcheck Sicherheit und Gesundheit - Schule - Stand: Juni 2015 2 Unfälle und Krankheiten haben für die Betroffenen und die Schule oft schwer wiegende Folgen. Dies ist einer der Gründe,
Handlungshilfe Selbstcheck Sicherheit und Gesundheit - Schule - Stand: Juni 2015 2 Unfälle und Krankheiten haben für die Betroffenen und die Schule oft schwer wiegende Folgen. Dies ist einer der Gründe,
Ergebnisse der Forsteinrichtung für im Stadtwald Scheer
 Ergebnisse der Forsteinrichtung für 011-00 im Stadtwald Scheer Örtliche Prüfung am 3. April 01 der Waldbewirtschaftung ( aus Zielsetzung im Stadtwald, UFB Sigmaringen 011 Produktionsfunktion, gleichmäßige
Ergebnisse der Forsteinrichtung für 011-00 im Stadtwald Scheer Örtliche Prüfung am 3. April 01 der Waldbewirtschaftung ( aus Zielsetzung im Stadtwald, UFB Sigmaringen 011 Produktionsfunktion, gleichmäßige
Hand-Arm-Vibrationen beim Holzeinschlag
 Fachbereich Verkehr und Landschaft Sachgebiet Straße, Gewässer, Forsten, Tierhaltung Hand-Arm-Vibrationen beim Holzeinschlag Forschungsprojekt zur Messung der Hand-Arm-Vibrationen bei der Waldarbeit mit
Fachbereich Verkehr und Landschaft Sachgebiet Straße, Gewässer, Forsten, Tierhaltung Hand-Arm-Vibrationen beim Holzeinschlag Forschungsprojekt zur Messung der Hand-Arm-Vibrationen bei der Waldarbeit mit
Wie betroffen ist die ukrainische Landwirtschaft vom Klimawandel?
 Wie betroffen ist die ukrainische Landwirtschaft vom Klimawandel? Der Klimawandel bewirkt, daß extreme Witterungsverhältnisse immer häufiger auftreten. Einerseits muß man damit rechnen, daß in manchen
Wie betroffen ist die ukrainische Landwirtschaft vom Klimawandel? Der Klimawandel bewirkt, daß extreme Witterungsverhältnisse immer häufiger auftreten. Einerseits muß man damit rechnen, daß in manchen
Waldbäume pflanzen das kann doch jeder!?
 Waldbäume pflanzen das kann doch jeder!? Leider ist dem nicht so. Obwohl am gleichen Tag mit der gleichen Qualität ausgeliefert, beklagen manche Waldbesitzer den kompletten Ausfall ihrer Pflanzen, während
Waldbäume pflanzen das kann doch jeder!? Leider ist dem nicht so. Obwohl am gleichen Tag mit der gleichen Qualität ausgeliefert, beklagen manche Waldbesitzer den kompletten Ausfall ihrer Pflanzen, während
Der Sicherheitsmeter. Worum es geht: Der Sicherheitsmeter. Publikation
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Der Sicherheitsmeter Worum es geht: Im Verlauf der Ausbildung entwickelt jede lernende Person bewusst und unbewusst eine spezifische Arbeitshaltung in
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Der Sicherheitsmeter Worum es geht: Im Verlauf der Ausbildung entwickelt jede lernende Person bewusst und unbewusst eine spezifische Arbeitshaltung in
DVD Forst Videofilme aus dem Forstbereich
 DVD Forst Videofilme aus dem Forstbereich BG/GUV 71.9 Juni 2009 Medienpaket Abgelenkt Das Medienpaket Abgelenkt besteht aus einem Videofilm und dem Begleitmaterial, das zum Öffnen auf dem PC gedacht ist.
DVD Forst Videofilme aus dem Forstbereich BG/GUV 71.9 Juni 2009 Medienpaket Abgelenkt Das Medienpaket Abgelenkt besteht aus einem Videofilm und dem Begleitmaterial, das zum Öffnen auf dem PC gedacht ist.
Laubholz - Aufarbeitung
 Merkblatt Laubholz - Aufarbeitung Einleitung Bei Laubholz ist im Gegensatz zu Nadelholz ein schematisches Entasten nicht möglich. Aufgrund der sehr unregelmäßigen Astverteilung, des hohen Astgewichts,
Merkblatt Laubholz - Aufarbeitung Einleitung Bei Laubholz ist im Gegensatz zu Nadelholz ein schematisches Entasten nicht möglich. Aufgrund der sehr unregelmäßigen Astverteilung, des hohen Astgewichts,
Qualifikationsanforderungen bei Gasmessungen abwassertechnischen Anlagen Arbeitsbericht des DWA Fachausschusses BIZ-4 Arbeits- und Gesundheitsschutz
 Qualifikationsanforderungen bei Gasmessungen in abwassertechnischen Anlagen Arbeitsbericht des DWA Fachausschusses BIZ-4 Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Umsetzung des DGUV Grundsatz 313-002 (bisher:
Qualifikationsanforderungen bei Gasmessungen in abwassertechnischen Anlagen Arbeitsbericht des DWA Fachausschusses BIZ-4 Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Umsetzung des DGUV Grundsatz 313-002 (bisher:
Einsatz der Motorsäge bei der Feuerwehr
 Einsatz der Motorsäge bei der Feuerwehr Der Umgang mit der Motorsäge bei der Feuerwehr ist auch für uns ein Thema. Wir haben diese Information zusammengestellt, um die kommunalen Aufgabenträger und die
Einsatz der Motorsäge bei der Feuerwehr Der Umgang mit der Motorsäge bei der Feuerwehr ist auch für uns ein Thema. Wir haben diese Information zusammengestellt, um die kommunalen Aufgabenträger und die
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Kyrill und seine Folgen
 Kyrill und seine Folgen Forstliche Sturmschadenskartierung mit Hilfe von GPS+ Technologie und mobilem GIS am Beispiel des Forstbetriebes Oberharz Dipl. Forsting. (FH) Alexander Leipold Forstbetrieb Oberharz
Kyrill und seine Folgen Forstliche Sturmschadenskartierung mit Hilfe von GPS+ Technologie und mobilem GIS am Beispiel des Forstbetriebes Oberharz Dipl. Forsting. (FH) Alexander Leipold Forstbetrieb Oberharz
Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen
 Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen Multifunktionale Waldbewirtschaftung - Ausgleich von Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Naturnahe Waldwirtschaft, PEFC-Zertifizierung Waldbauliche
Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen Multifunktionale Waldbewirtschaftung - Ausgleich von Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Naturnahe Waldwirtschaft, PEFC-Zertifizierung Waldbauliche
Ausbilden mit Lernaufträgen
 Ausbilden mit Lernaufträgen Was verstehe man unter einem Lernauftrag? Die Ausbildung mit Lernaufträgen eignet sich insbesondere für das Lernen am Arbeitsplatz. Betriebliche Tätigkeiten werden im Lernauftrag
Ausbilden mit Lernaufträgen Was verstehe man unter einem Lernauftrag? Die Ausbildung mit Lernaufträgen eignet sich insbesondere für das Lernen am Arbeitsplatz. Betriebliche Tätigkeiten werden im Lernauftrag
Holzwirtschaft in Deutschland und Potenziale für die stoffliche und energetische Nutzung
 Holzwirtschaft in Deutschland und Potenziale für die stoffliche und energetische Nutzung Deutscher Bioraffinerie-Kongress 2007 Berlin, 12.09.2007 Dr. Jörg Schweinle Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft in Deutschland und Potenziale für die stoffliche und energetische Nutzung Deutscher Bioraffinerie-Kongress 2007 Berlin, 12.09.2007 Dr. Jörg Schweinle Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Die Schankanlage: Neue gesetzliche Grundlagen Fragen und Antworten
 Im Jahr 2005 ist der Rest der Schankanlagenverordnung außer Kraft gesetzt worden. Seit dem sind für den Betrieb von Schankanlagen vorrangig die europäische Lebensmittelhygieneverordnung (852/2004) und
Im Jahr 2005 ist der Rest der Schankanlagenverordnung außer Kraft gesetzt worden. Seit dem sind für den Betrieb von Schankanlagen vorrangig die europäische Lebensmittelhygieneverordnung (852/2004) und
Berufsfeuerwehr Oberhausen Fachbereich
 Berufsfeuerwehr Oberhausen Fachbereich 6-1-60 stadt oberhausen Kennzeichnung von Freiflächen für die Feuerwehr Vorwort Für die Durchführung von gezielten und wirksamen Rettungs- und Löschmaßnahmen ist
Berufsfeuerwehr Oberhausen Fachbereich 6-1-60 stadt oberhausen Kennzeichnung von Freiflächen für die Feuerwehr Vorwort Für die Durchführung von gezielten und wirksamen Rettungs- und Löschmaßnahmen ist
Sicheres Arbeiten. Aufarbeiten von Bäumen
 Sicheres Arbeiten Aufarbeiten von Bäumen Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger und für die Richtigkeit des Inhaltes: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Abteilung für Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung
Sicheres Arbeiten Aufarbeiten von Bäumen Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger und für die Richtigkeit des Inhaltes: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Abteilung für Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung
2007 W. Kohlhammer, Stuttgart 1 Einleitung
 1 Einleitung Mit neuen Erkenntnissen aus dem Bereich der Höhenrettung, die nach dem Fall der Mauer ab 1990 auch in den alten Bundesländern Einzug hielten, erkannte man Defizite bei der Verwendung von Fangleinen
1 Einleitung Mit neuen Erkenntnissen aus dem Bereich der Höhenrettung, die nach dem Fall der Mauer ab 1990 auch in den alten Bundesländern Einzug hielten, erkannte man Defizite bei der Verwendung von Fangleinen
Die neue Gefahrstoffverordnung
 FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com Die neue Gefahrstoffverordnung Herausgeber: Verband Deutscher Sicherheitsingenieure
FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com Die neue Gefahrstoffverordnung Herausgeber: Verband Deutscher Sicherheitsingenieure
Strategisches Risikomanagement bei den Bayerischen Staatsforsten. Freiburg, 27. Januar 2012 Reinhardt Neft, Vorstand
 Strategisches Risikomanagement bei den Bayerischen Staatsforsten Freiburg, 27. Januar 2012 Reinhardt Neft, Vorstand Agenda 1 Die Bayerischen Staatsforsten 2 Ökologie 3 Ökonomie 4 Gesellschaft 5 Mitarbeiterinnen
Strategisches Risikomanagement bei den Bayerischen Staatsforsten Freiburg, 27. Januar 2012 Reinhardt Neft, Vorstand Agenda 1 Die Bayerischen Staatsforsten 2 Ökologie 3 Ökonomie 4 Gesellschaft 5 Mitarbeiterinnen
Wälder und Waldbesitzer in Bayern
 Privatwald, Waldbesitzer und ihre Organisationen www.waldbesitzer-info.de Infoblatt 4.1 Wälder und Waldbesitzer in Bayern und im Bundesdeutschen Vergleich Bayern ist mit ca. 2,5 Millionen Hektar ein sehr
Privatwald, Waldbesitzer und ihre Organisationen www.waldbesitzer-info.de Infoblatt 4.1 Wälder und Waldbesitzer in Bayern und im Bundesdeutschen Vergleich Bayern ist mit ca. 2,5 Millionen Hektar ein sehr
Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie
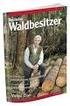 Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie Christian Ammer, Universität Göttingen Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen 1/25 Waldbau Abteilung Waldbau und Waldökologie der
Zur Bedeutung von Starkholz für Waldbau und Waldökologie Christian Ammer, Universität Göttingen Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen 1/25 Waldbau Abteilung Waldbau und Waldökologie der
1.Ziele der Anpassung an Klimaveränderung 2.Der Wald in Hessen 3. Naturgemäße Waldwirtschaft 4. Beispielhafte waldbauliche Steuerung 5.
 Umsetzung waldbaulicher Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel Uwe Zindel 1.Ziele der Anpassung an Klimaveränderung 2.Der Wald in Hessen 3. Naturgemäße Waldwirtschaft 4. Beispielhafte waldbauliche
Umsetzung waldbaulicher Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel Uwe Zindel 1.Ziele der Anpassung an Klimaveränderung 2.Der Wald in Hessen 3. Naturgemäße Waldwirtschaft 4. Beispielhafte waldbauliche
Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel
 Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der forstlichen Verbände und Vereine in Bayern Waldtag Bayern Freising-Weihenstephan
Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der forstlichen Verbände und Vereine in Bayern Waldtag Bayern Freising-Weihenstephan
Forstförderung in Niederösterreich
 Entwicklung des ländlichen Raumes 2007 bis 2013 Forstförderung in Niederösterreich Die niederösterreichische Landesförderungskonferenz hat folgendes Programm für die Forstwirtschaft beschlossen. Allgemeine
Entwicklung des ländlichen Raumes 2007 bis 2013 Forstförderung in Niederösterreich Die niederösterreichische Landesförderungskonferenz hat folgendes Programm für die Forstwirtschaft beschlossen. Allgemeine
Einsatz von Forstunternehmern in Baden-Württemberg
 Einsatz von Forstunternehmern in Baden-Württemberg - Führt die Ausschreibung ins Aus? - Geschäftsführer Martin Strittmatter 17. April 2012 - Hundisburg Themenübersicht I. Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg/
Einsatz von Forstunternehmern in Baden-Württemberg - Führt die Ausschreibung ins Aus? - Geschäftsführer Martin Strittmatter 17. April 2012 - Hundisburg Themenübersicht I. Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg/
FoMaFüPrV. Ausfertigungsdatum: Vollzitat: "Forstmaschinenführer-Prüfungsverordnung vom 23. Juli 2009 (BGBl. I S.
 Verordnung über die Anforderungen in der Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Forstmaschinenführer/ Geprüfte Forstmaschinenführerin (Forstmaschinenführer- Prüfungsverordnung - FoMaFüPrV) FoMaFüPrV
Verordnung über die Anforderungen in der Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Forstmaschinenführer/ Geprüfte Forstmaschinenführerin (Forstmaschinenführer- Prüfungsverordnung - FoMaFüPrV) FoMaFüPrV
HSM 208F Kurzchassis Modelle
 HSM 208F Kurzchassis Modelle Technische Daten 208F Kurzchassis Bremse: 2-Kreis Bremse, im Ölbad laufende Lamellenbremse Federspeicher-Feststellbremse Lenkung: Knickrahmenlenkung mit 2 Zylindern Lenkeinschlag
HSM 208F Kurzchassis Modelle Technische Daten 208F Kurzchassis Bremse: 2-Kreis Bremse, im Ölbad laufende Lamellenbremse Federspeicher-Feststellbremse Lenkung: Knickrahmenlenkung mit 2 Zylindern Lenkeinschlag
Wege und Hürden der nachhaltigen Intensivierung im Forstbetrieb. Forstökonomische Tagung Forstliche Ausbildungsstätte Pichl Norbert Putzgruber
 22 11 2012 Wege und Hürden der nachhaltigen Intensivierung im Forstbetrieb Forstökonomische Tagung Forstliche Ausbildungsstätte Pichl Norbert Putzgruber Inhalt 1. Grundlagen bei der ÖBf AG 2. Wege einer
22 11 2012 Wege und Hürden der nachhaltigen Intensivierung im Forstbetrieb Forstökonomische Tagung Forstliche Ausbildungsstätte Pichl Norbert Putzgruber Inhalt 1. Grundlagen bei der ÖBf AG 2. Wege einer
Neue Anforderungen der Gesellschaft an die Forstwirtschaft
 Neue Anforderungen der Gesellschaft an die Forstwirtschaft Bonus oder Malus für die Leistungen der Branche im Cluster? Josef Stratmann Ressource Holz 6.IV.2016 Gesellschaft - Forstwirtschaft - Cluster
Neue Anforderungen der Gesellschaft an die Forstwirtschaft Bonus oder Malus für die Leistungen der Branche im Cluster? Josef Stratmann Ressource Holz 6.IV.2016 Gesellschaft - Forstwirtschaft - Cluster
Bebauungsplan Erweiterung Gewerbegebiet Aucht in Sachsenheim - Ochsenbach
 Bebauungsplan Erweiterung Gewerbegebiet Aucht in Sachsenheim - Ochsenbach eventuelle Eingriffe in ein nach 32 NatSchG besonders geschütztes Biotop Auftraggeber: A. Amos GmbH + Co KG August 2013 0. INHALTSVERZEICHNIS
Bebauungsplan Erweiterung Gewerbegebiet Aucht in Sachsenheim - Ochsenbach eventuelle Eingriffe in ein nach 32 NatSchG besonders geschütztes Biotop Auftraggeber: A. Amos GmbH + Co KG August 2013 0. INHALTSVERZEICHNIS
Ausführung des Hilfsrahmens. Allgemeines. Der Hilfsrahmen besitzt eine Reihe von möglichen Anwendungen:
 Der Hilfsrahmen besitzt eine Reihe von möglichen Anwendungen: Die Belastung gleichmäßig über den Fahrgestellrahmen verteilen. Für einen ausreichenden Abstand zu Rädern und anderen Bauteilen sorgen, die
Der Hilfsrahmen besitzt eine Reihe von möglichen Anwendungen: Die Belastung gleichmäßig über den Fahrgestellrahmen verteilen. Für einen ausreichenden Abstand zu Rädern und anderen Bauteilen sorgen, die
44-49 Unterabschnitt 2 Dienstunfähigkeit
 TK Lexikon Arbeitsrecht Bundesbeamtengesetz 44-49 Unterabschnitt 2 Dienstunfähigkeit 44 Dienstunfähigkeit HI2118746 HI2118747 (1) 1 Die Beamtin auf Lebenszeit oder der Beamte auf Lebenszeit ist in den
TK Lexikon Arbeitsrecht Bundesbeamtengesetz 44-49 Unterabschnitt 2 Dienstunfähigkeit 44 Dienstunfähigkeit HI2118746 HI2118747 (1) 1 Die Beamtin auf Lebenszeit oder der Beamte auf Lebenszeit ist in den
300 Jahre Forstliche Nachhaltigkeit DER THÜNGENER WALD
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt 300 Jahre Forstliche Nachhaltigkeit DER THÜNGENER WALD WALDFLÄCHE Das Thüngener Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 1361 Hektar. Davon
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt 300 Jahre Forstliche Nachhaltigkeit DER THÜNGENER WALD WALDFLÄCHE Das Thüngener Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 1361 Hektar. Davon
Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen. Wertholzproduktion in agroforstlichen Systemen. Mathias Brix
 Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen Wertholzproduktion in agroforstlichen Systemen Mathias Brix Gliederung des Vortrags 1. Qualitätsanforderungen an Wertholz 2. Erreichen der
Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen Wertholzproduktion in agroforstlichen Systemen Mathias Brix Gliederung des Vortrags 1. Qualitätsanforderungen an Wertholz 2. Erreichen der
Städtische Bäume: Pflege und Kontrolle
 Sie sind hier: Herten Service ZBH - Zentraler Betriebshof Herten Stadtgrün Straßenbäume Städtische Bäume: Pflege und Kontrolle Warum wurde der Baum gefällt, der sah doch gesund aus?! immer wieder werfen
Sie sind hier: Herten Service ZBH - Zentraler Betriebshof Herten Stadtgrün Straßenbäume Städtische Bäume: Pflege und Kontrolle Warum wurde der Baum gefällt, der sah doch gesund aus?! immer wieder werfen
21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02)
 21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02) 21.0 Der Gesetzgeber hat die Träger der Deutschen Rentenversicherung verpflichtet, ihren Verwaltungsaufwand zu senken
21 Rentenversicherungsträger scheuen Leistungsvergleiche (Kapitel 1113 Titelgruppe 02) 21.0 Der Gesetzgeber hat die Träger der Deutschen Rentenversicherung verpflichtet, ihren Verwaltungsaufwand zu senken
Konzept für Schulungen zur Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR)
 Konzept für Schulungen zur Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR) Stand: Juni 2015 Schulungsmaterialien: Durchführung von Schulungen 1 Organisation der Schulung (Teilnehmer, Aufbau,
Konzept für Schulungen zur Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR) Stand: Juni 2015 Schulungsmaterialien: Durchführung von Schulungen 1 Organisation der Schulung (Teilnehmer, Aufbau,
1. Einleitung 2. 2. Grundlagen 3
 Regierungspräsidium Darmstadt Merkblatt Merkblatt Windenergieanlagen Version 1.6 Stand 01.03.2013 Hinweise für Planung und Ausführung INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung 2 2. Grundlagen 3 3. Anforderungen
Regierungspräsidium Darmstadt Merkblatt Merkblatt Windenergieanlagen Version 1.6 Stand 01.03.2013 Hinweise für Planung und Ausführung INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung 2 2. Grundlagen 3 3. Anforderungen
Salzburger Wald & Holzgespräche Wolfgang Holzer. Holztechnikum Kuchl
 21 11 2013 Salzburger Wald & Holzgespräche 2013 Wolfgang Holzer Holztechnikum Kuchl Überblick - Holzmarkt allgemein - ÖBf-Einschlag 2013 und 2014 - Innovationen Wolfgang Holzer 2 Holzmarkt - Industrie
21 11 2013 Salzburger Wald & Holzgespräche 2013 Wolfgang Holzer Holztechnikum Kuchl Überblick - Holzmarkt allgemein - ÖBf-Einschlag 2013 und 2014 - Innovationen Wolfgang Holzer 2 Holzmarkt - Industrie
Entwicklungsprozess von Forsttechnik von der technischen Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt
 Impressum (wird nicht angezeigt) Referat: MIL, Referat Titel: Entwicklungsprozess von Forsttechnik von der technischen Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt Vortrag Interforst
Impressum (wird nicht angezeigt) Referat: MIL, Referat Titel: Entwicklungsprozess von Forsttechnik von der technischen Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt Vortrag Interforst
Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr. Fassung Februar 2007
 Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr Fassung Februar 2007 (zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) Zur Ausführung des 5 MBO wird hinsichtlich der
Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr Fassung Februar 2007 (zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) Zur Ausführung des 5 MBO wird hinsichtlich der
Verordnung. über die Berufsausbildung. zum Fahrradmonteur und zur Fahrradmonteurin. vom 18. Mai 2004
 über die Berufsausbildung zum Fahrradmonteur und zur Fahrradmonteurin vom 18. Mai 2004 (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 25 vom 27. Mai 2004) Auf Grund des 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs.
über die Berufsausbildung zum Fahrradmonteur und zur Fahrradmonteurin vom 18. Mai 2004 (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 25 vom 27. Mai 2004) Auf Grund des 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs.
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in Gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 (Verordnung vom 10. Juni 2014)
 Informationen für die Praxis Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in Gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 (Verordnung vom 10. Juni 2014) Stand: April 2015 (aktualisiert: Mai 2015) Inhalt: 1
Informationen für die Praxis Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in Gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 (Verordnung vom 10. Juni 2014) Stand: April 2015 (aktualisiert: Mai 2015) Inhalt: 1
ARBEITS- UND An der Hasenquelle 6. Seit dem ist die neue Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV in Kraft.
 Die neue Betriebssicherheitsverordnung Seit dem 01.06.2015 ist die neue Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV in Kraft. Diese Verordnung heißt in der Langversion eigentlich Verordnung über Sicherheit
Die neue Betriebssicherheitsverordnung Seit dem 01.06.2015 ist die neue Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV in Kraft. Diese Verordnung heißt in der Langversion eigentlich Verordnung über Sicherheit
Gefährdungsbeurteilung
 Gefährdungsbeurteilung Alfred Wrede Fachkraft für Arbeitssicherheit im Auftrag des Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Wissenschaft und Kunst Grundlagen Durchführung Vorlagen zu Gefährdungsbeurteilungen
Gefährdungsbeurteilung Alfred Wrede Fachkraft für Arbeitssicherheit im Auftrag des Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Wissenschaft und Kunst Grundlagen Durchführung Vorlagen zu Gefährdungsbeurteilungen
Parameter unternehmerischer Entscheidungen
 Parameter unternehmerischer Entscheidungen Dr. Hans-Peter Schiffer - Leiter Genehmigungen und Umweltschutz 3. Nachbarschaftsforum, Niederaußem 18. Mai 2010 SEITE 1 Generelle Parameter SEITE 2 Parameter
Parameter unternehmerischer Entscheidungen Dr. Hans-Peter Schiffer - Leiter Genehmigungen und Umweltschutz 3. Nachbarschaftsforum, Niederaußem 18. Mai 2010 SEITE 1 Generelle Parameter SEITE 2 Parameter
Konzeption. Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Stand 03.03
 Konzeption Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Gesetzlicher Auftrag und Ziele Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages fördern und unterstützen die Delme- Werkstätten (dw) den Übergang von behinderten
Konzeption Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt Gesetzlicher Auftrag und Ziele Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages fördern und unterstützen die Delme- Werkstätten (dw) den Übergang von behinderten
VORWORT. Wald ist Wert der wächst
 VORWORT Wald ist Wert der wächst Das ist das Motto des Kärntner Waldpflegevereins und es beschreibt den Wert des Waldes als Einkommensquelle für den Waldbesitzer, als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt,
VORWORT Wald ist Wert der wächst Das ist das Motto des Kärntner Waldpflegevereins und es beschreibt den Wert des Waldes als Einkommensquelle für den Waldbesitzer, als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt,
Ergebnisse der 3. Bundeswaldinventur in der Region Berlin-Brandenburg
 Ergebnisse der 3. Bundeswaldinventur in der Region Berlin-Brandenburg Ministerium für Infrastruktur 1 Was ist eine Bundeswaldinventur? Ministerium für Infrastruktur alle 10 Jahre werden im gesamten Bundesgebiet
Ergebnisse der 3. Bundeswaldinventur in der Region Berlin-Brandenburg Ministerium für Infrastruktur 1 Was ist eine Bundeswaldinventur? Ministerium für Infrastruktur alle 10 Jahre werden im gesamten Bundesgebiet
Landesforstbetrieb Sachsen - Anhalt
 Wald hat einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Die Erhaltung sowohl des Gesundheitszustandes als auch des Flächenumfanges sowie die Waldmehrung werden von der Mehrheit der Bürger erwartet. (Minister
Wald hat einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Die Erhaltung sowohl des Gesundheitszustandes als auch des Flächenumfanges sowie die Waldmehrung werden von der Mehrheit der Bürger erwartet. (Minister
Sicherheitstechnische Prüfungen bei Getränkeschankanlagen
 ASI Sicherheitstechnische Prüfungen bei Getränkeschankanlagen ASI 6.83 ASI - Arbeits-Sicherheits-Informationen - BGN Themenübersicht Vorwort 3 1. Was versteht man unter Prüfung einer Getränkeschankanlage
ASI Sicherheitstechnische Prüfungen bei Getränkeschankanlagen ASI 6.83 ASI - Arbeits-Sicherheits-Informationen - BGN Themenübersicht Vorwort 3 1. Was versteht man unter Prüfung einer Getränkeschankanlage
NFB Forsttechnik. Die komplette Übersicht
 NFB Forsttechnik Die komplette Übersicht Inhaltsverzeichnis Firmendaten Otmar Noe GmbH Forstspezialmaschinen knickgelenkt NF120 / NF160 Kombinationsmaschine allradgelenkt KL100 Kombinationsmaschine 6-Rad
NFB Forsttechnik Die komplette Übersicht Inhaltsverzeichnis Firmendaten Otmar Noe GmbH Forstspezialmaschinen knickgelenkt NF120 / NF160 Kombinationsmaschine allradgelenkt KL100 Kombinationsmaschine 6-Rad
Informationsblatt für Bewirtschafter von GVO-Anbauflächen zur Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung
 Informationsblatt für Bewirtschafter von GVO-Anbauflächen zur Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung in Bezug auf das Standortregister Der gesetzliche Rahmen 1 für Nutzer von gentechnisch veränderten
Informationsblatt für Bewirtschafter von GVO-Anbauflächen zur Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung in Bezug auf das Standortregister Der gesetzliche Rahmen 1 für Nutzer von gentechnisch veränderten
Inhalt. Projektmanagement
 Inhalt Inhalt...4...6 Schritt 1: Projekte initiieren...8 Projektidee entwickeln... 9 Richtziele des Projekts festlegen... 9 Organisationsform auswählen... 11 Projektgrößen unterscheiden... 17 Ablauf festlegen...
Inhalt Inhalt...4...6 Schritt 1: Projekte initiieren...8 Projektidee entwickeln... 9 Richtziele des Projekts festlegen... 9 Organisationsform auswählen... 11 Projektgrößen unterscheiden... 17 Ablauf festlegen...
1.1 Organisationscheck zum Arbeitsschutz
 Besonders wichtige Forderungen, die sich auf gesetzliche Grundlagen beziehen, sind in diesem Organisations-Check grau hinterlegt. Erläuterung: : : : : Bearbeitet am: Maßnahmen wurden bereits durchgeführt.
Besonders wichtige Forderungen, die sich auf gesetzliche Grundlagen beziehen, sind in diesem Organisations-Check grau hinterlegt. Erläuterung: : : : : Bearbeitet am: Maßnahmen wurden bereits durchgeführt.
Dokument Nr. 4.1/ Stand:
 Dokument Nr. 4.1/ 2015-07-14 Stand: 14.07.2015 Vorschläge zur Anpassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TA
Dokument Nr. 4.1/ 2015-07-14 Stand: 14.07.2015 Vorschläge zur Anpassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TA
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Medizinprodukte Information
 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Medizinprodukte Information Sicherheitsrisiken von Kranken- und Pflegebetten Erstellt: 02.05.2008 Medizinprodukte Information
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Medizinprodukte Information Sicherheitsrisiken von Kranken- und Pflegebetten Erstellt: 02.05.2008 Medizinprodukte Information
Name Vorname Schuljahr 2005/2006 Datum der Durchführung Donnerstag, ORIENTIERUNGSARBEIT
 Sekundarschule 4. Klasse Niveau P Name Vorname Schuljahr 2005006 Datum der Durchführung Donnerstag, 17.11.05 ORIENTIERUNGSARBEIT Sekundarschule Mathematik Niveau P (M6) Lies zuerst Anleitung und Hinweise
Sekundarschule 4. Klasse Niveau P Name Vorname Schuljahr 2005006 Datum der Durchführung Donnerstag, 17.11.05 ORIENTIERUNGSARBEIT Sekundarschule Mathematik Niveau P (M6) Lies zuerst Anleitung und Hinweise
Forstspezialschlepper
 Forstspezialschlepper Erprobte Konstruktion HSM - Rückeschlepper gibt es in verschiedenen Leistungsklassen mit und ohne Kranaufbau und vielen Optionen für jeden Einsatzbereich. Allen gemeinsam ist die
Forstspezialschlepper Erprobte Konstruktion HSM - Rückeschlepper gibt es in verschiedenen Leistungsklassen mit und ohne Kranaufbau und vielen Optionen für jeden Einsatzbereich. Allen gemeinsam ist die
Gruppenspezifische Anthropometrie in der ergonomischen Gestaltung
 Brandenburgische Umwelt Berichte (BUB) 10 S. 54-61 (2001) Gruppenspezifische Anthropometrie in der ergonomischen Gestaltung K.Nagel Einleitung Die ergonomische Anpassung eines Arbeitsplatzes an eine Zielpopulation
Brandenburgische Umwelt Berichte (BUB) 10 S. 54-61 (2001) Gruppenspezifische Anthropometrie in der ergonomischen Gestaltung K.Nagel Einleitung Die ergonomische Anpassung eines Arbeitsplatzes an eine Zielpopulation
Allgemeine Unterstützungspflicht
 Beschäftigte Allgemeine Unterstützungspflicht 15 (1) BGV A1 Nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Arbeitsschutz) zu sorgen. Auch
Beschäftigte Allgemeine Unterstützungspflicht 15 (1) BGV A1 Nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Arbeitsschutz) zu sorgen. Auch
Fachbereich Waldarbeit Maschinenbetrieb St. Peter Herbert Kirsten Forum 3 Neues aus Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
 Seilarbeit im Forst Forum 3 Neues aus Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Reserven am Hang? Rechtliche Grundlagen Umsetzung der rechtlichen Grundlagen Maschinenrichtlinie Richtlinie 2006/42EG, Anhang
Seilarbeit im Forst Forum 3 Neues aus Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Reserven am Hang? Rechtliche Grundlagen Umsetzung der rechtlichen Grundlagen Maschinenrichtlinie Richtlinie 2006/42EG, Anhang
Anforderungen an Produktion und Logistik
 Vermarktung und Belieferung mit Holzhackschnitzeln Anforderungen an Produktion und Logistik Inhalt Qualitätsanforderungen Produktionsverfahren Konditionierung Lagerung Logistik Qualitäten des Marktes Quelle:
Vermarktung und Belieferung mit Holzhackschnitzeln Anforderungen an Produktion und Logistik Inhalt Qualitätsanforderungen Produktionsverfahren Konditionierung Lagerung Logistik Qualitäten des Marktes Quelle:
1. BImSchV. Informationsblatt Nr. 22 März 2011
 Informationsblatt Nr. 22 März 2011 1. BImSchV Teil 1: Regelungen für die Errichtung, die wesentliche Änderung und den Betrieb von Holzzentralheizungskesseln ab dem 22. März 2010 1 Zielsetzung Zum 22. März
Informationsblatt Nr. 22 März 2011 1. BImSchV Teil 1: Regelungen für die Errichtung, die wesentliche Änderung und den Betrieb von Holzzentralheizungskesseln ab dem 22. März 2010 1 Zielsetzung Zum 22. März
 TRGS 500 Umgang mit Gefahrstoffen Schutzmaßnahmen - Für alle Tätigkeiten mit Gefahrstoffen müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um die Gefährdungen für die Beschäftigten zu minimieren. Der Umfang der
TRGS 500 Umgang mit Gefahrstoffen Schutzmaßnahmen - Für alle Tätigkeiten mit Gefahrstoffen müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um die Gefährdungen für die Beschäftigten zu minimieren. Der Umfang der
Montageanleitung für Monteure
 Montageanleitung für Monteure ACHTUNG: Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass diese Anweisungen befolgt werden. Eine falsche Installation oder Missbrauch dieses Produktes kann körperliche und an Materialien
Montageanleitung für Monteure ACHTUNG: Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass diese Anweisungen befolgt werden. Eine falsche Installation oder Missbrauch dieses Produktes kann körperliche und an Materialien
Lehrer als Beobachter schulischer Leistung
 Pädagogik Marco Schindler Lehrer als Beobachter schulischer Leistung Essay - CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT - OLDENBURG FAKULTÄT II INSTITUT FÜR INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN Essay
Pädagogik Marco Schindler Lehrer als Beobachter schulischer Leistung Essay - CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT - OLDENBURG FAKULTÄT II INSTITUT FÜR INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN Essay
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Klimawandel: Ein globales Problem - Stationenlernen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klimawandel: Ein globales Problem - Stationenlernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Klimawandel: Ein
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Klimawandel: Ein globales Problem - Stationenlernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Klimawandel: Ein
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall. Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb
 Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Obwohl Österreich sehr dicht besiedelt ist, kommt auf jeden Bundesbürger fast ein halber Hektar Wald.
 1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
Neue Techniken in der motormanuellen Holzernte
 Neue Techniken in der motormanuellen Holzernte Beiträge und Erläuterungen v. Huskygerry veröffentlich im www.motorsaegen-portal.de Vorbemerkung Ich habe mir länger überlegt, ob ich meine Erläuterungen
Neue Techniken in der motormanuellen Holzernte Beiträge und Erläuterungen v. Huskygerry veröffentlich im www.motorsaegen-portal.de Vorbemerkung Ich habe mir länger überlegt, ob ich meine Erläuterungen
Masterlayout HB 2000. Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.v. Beziehung Reifen - Boden. Kraftübertragung und Bodenbelastung
 Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.v. Beziehung Reifen - Boden Kraftübertragung und Bodenbelastung Bodenfunktion und Radlast Prinzipieller Zusammenhang zwischen gewünschter Bodenfunktion, Bodenspannung,
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.v. Beziehung Reifen - Boden Kraftübertragung und Bodenbelastung Bodenfunktion und Radlast Prinzipieller Zusammenhang zwischen gewünschter Bodenfunktion, Bodenspannung,
Wertastung. Förster Ing. Johannes Ablinger. Forstliche Ausbildungsstätte Ort / Gmunden
 Wertastung Förster Ing. Johannes Ablinger Forstliche Ausbildungsstätte Ort / Gmunden Veranstaltungsreihe Basisinfo Forstwirtschaft Gmunden 30. Juni 2016 Inhalt Grundsätzliches wozu Asten?, richtig schneiden,
Wertastung Förster Ing. Johannes Ablinger Forstliche Ausbildungsstätte Ort / Gmunden Veranstaltungsreihe Basisinfo Forstwirtschaft Gmunden 30. Juni 2016 Inhalt Grundsätzliches wozu Asten?, richtig schneiden,
Schöfferstadt Gernsheim Der Magistrat
 Selber Holz machen - so geht s 1 VORBEREITUNG Informationsmaterial des Forstamtes aufmerksam lesen Unterlagen im Stadthaus Gernsheim erhältlich oder im Internet unter www.gernsheim.de herunterladen 2 TELEFON-SPRECHSTUNDE
Selber Holz machen - so geht s 1 VORBEREITUNG Informationsmaterial des Forstamtes aufmerksam lesen Unterlagen im Stadthaus Gernsheim erhältlich oder im Internet unter www.gernsheim.de herunterladen 2 TELEFON-SPRECHSTUNDE
Angebot über Gebrauchtmaschine Welte W180
 Stand: 11.02.2015 Angebot über Gebrauchtmaschine Welte W180 (FG-Nr.: 20418017) Baujahr 09/2004 Betriebsstunden ca. 8.000 Deutz 6 Zylinder mit 180 PS Getriebeart ZF Lastschaltgetriebe Loglift F 101 RT 72
Stand: 11.02.2015 Angebot über Gebrauchtmaschine Welte W180 (FG-Nr.: 20418017) Baujahr 09/2004 Betriebsstunden ca. 8.000 Deutz 6 Zylinder mit 180 PS Getriebeart ZF Lastschaltgetriebe Loglift F 101 RT 72
Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung. 2. Teil Allgemeiner Ablauf
 Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2. Teil Allgemeiner Ablauf 1 1. Rechtliche Grundlage und Zuständigkeit Art. 32 Abs. 1 BayJG Regelung der Bejagung (1) Der Abschussplan ( 21 Abs. 2
Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2. Teil Allgemeiner Ablauf 1 1. Rechtliche Grundlage und Zuständigkeit Art. 32 Abs. 1 BayJG Regelung der Bejagung (1) Der Abschussplan ( 21 Abs. 2
Strategisches Marketing für kommunale Zentren in Baden-Württemberg
 Strategisches Marketing für kommunale Zentren in Baden-Württemberg Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie der Geowissenschaftlichen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität
Strategisches Marketing für kommunale Zentren in Baden-Württemberg Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie der Geowissenschaftlichen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität
Kapitel 7. Crossvalidation
 Kapitel 7 Crossvalidation Wie im Kapitel 5 erwähnt wurde, ist die Crossvalidation die beste Technik, womit man die Genauigkeit der verschiedenen Interpolationsmethoden überprüft. In diesem Kapitel wurde
Kapitel 7 Crossvalidation Wie im Kapitel 5 erwähnt wurde, ist die Crossvalidation die beste Technik, womit man die Genauigkeit der verschiedenen Interpolationsmethoden überprüft. In diesem Kapitel wurde
