Die Helden von Sumer und Rom
|
|
|
- Insa Dieter
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Helden von Sumer und Rom Heroen als Herrschaftsinstrument I. Einleitung... 2 II. Die beiden Heroen Aeneas Enmerkar... 4 III. Vergleich der Mythen... 5 IV. Heldenepen als Propaganda Die Könige von Uruk und Ur III Aeneis und Augustus V. Zwei perfekte Gründungsmythen VI. Synthese Literatur / Quellen Primärquellen Sekundärliteratur
2 I. Einleitung Aeneas, Prinz von Troia, entkam als einer von wenigen aus der brennenden Stadt, nach langen Irrfahrten ließ er sich schließlich in Italien nieder. So erzählt es die römische Überlieferung, die ihn als Stammvater der Römer preist. Die Julier, allen voran Kaiser Augustus, führten ihre Abstammung auf ihn zurück. Im alten Sumer indes, zweitausend Jahre früher und über dreitausend Kilometer entfernt, waren es andere Helden, auf die man seine Identität gründete: Die Rede ist von Enmerkar, Lugalbanda und Gilgamesch, den legendären Königen von Uruk. So weit beide Kulturen auch auseinanderliegen mögen, so unterschiedlich die Mythen auf den ersten Blick vielleicht scheinen kann es sein, dass jene sagenhaften Helden und Stadtgründer, Aeneas und Enmerkar, mehr gemein haben als allgemein bekannt? Kann es gar sein, dass die in der Zeit der 3. Dynastie von Ur (21. Jhd. V. Chr.) abgefassten Epen um die Könige von Uruk eine ganz ähnliche, nur allzu politische Funktion hatten wie zweitausend Jahre später Vergils Aeneis? Ebendies soll im Folgenden untersucht werden. Nach einer knappen Einführung in beide Mythenkreise werden diese miteinander verglichen. Nicht nur geht es hierbei um die konkreten inhaltlichen Ähnlichkeiten, vielmehr nämlich um die unterschwelligen Motive dahinter, die beide Mythen als Gründungserzählungen legitimierenden Inhalts interessant machen. Aus welchen Gründen waren die Erzählungen für Herrscher interessant und welche Aspekte prädestinierten die Mythen für eine politische Instrumentalisierung, wie wurde literarisch nachgeholfen? Als Grundlage dienen hierfür vor allem Editionen der zugrundeliegenden Epen (Aeneis, Enmerkara und der Herr von Arata, das Lugalbanda-Epos) sowie die anbei zu findenden Kommentare der Herausgeber, des Weiteren allgemeine Literatur zur Geschichte der fraglichen Kulturen und einzelnen Figuren der Mythen. Die hiesige Fragestellung selbst scheint in der einschlägigen Forschungsliteratur noch nicht erörtert worden zu sein, obgleich sich zweifellos vergleichbare Überlegungen bezüglich anderer Vergleichspaare finden dürften. Nicht zuletzt liegt dies daran, dass aus diesem Vergleich weniger neue empirische Kenntnisse, als vielmehr Schlussfolgerungen bezüglich der allgemeinen Natur von Gründungserzählungen gewonnen werden, die man vermutlich auch an anderen Beispielen entdecken könnte. Ein Einbezug jener wäre weiterführend zweifellos sinnvoll, kann an dieser Stelle jedoch aus verständlichen Gründen nicht geleistet werden. Was die Könige von Uruk betrifft, wird das Hauptaugenmerk auf Enmerkar liegen, da er am meisten die in diesem Kontext relevanten Aspekte verkörpert, wobei zu beachten ist, dass sich seine Geschichte (gerade im Lugalbanda-Epos) teilweise mit der des Lugalbanda überschneidet. 2
3 II. Die beiden Heroen Zunächst seien beide zentralen Figuren einmal zusammenfassend vorgestellt, um eine Grundlage für die späteren Abschnitte zu schaffen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf den mythischen Quellentexten und deren Inhalt, weniger auf den gesellschaftlichen und politischen Umständen der Entstehung liegt. 2.1 Aeneas Aeneas gilt als einer der bedeutendsten Heroen der griechisch-römischen Mythologie. Anders als etwa bei Herakles oder Perseus beruht dieser Ruhm jedoch weniger auf konkreten Heldentaten, als vielmehr auf seiner Rolle als mythischer Ahnherr der Stadt Rom. Bei seinem ersten Auftauchen in der Literatur spielt dies freilich noch keine Rolle: In der Ilias nämlich ist Aineias schlicht einer von zahlreichen Helden, die in den Schlachten vor Troia kämpfen. Seine Mutter ist die Göttin Aphrodite (bzw. später in der römischen Interpretation Venus), der Vater Anchises, welcher dem trojanischen Königshaus entstammt. Im Fünften Gesang kämpft er gegen Diomedes und wird von diesem mit einem Stein schwer verwundet, woraufhin ihn seine Mutter Aphrodite vom Schlachtfeld hinweg und nach Pergamon trägt, wo seine Wunden von Leto und Artemis geheilt werden. Anschließend, mit neuer Kraft erfüllt, kehrt er zum Schlachtfeld zurück und kämpft im Zwanzigsten Gesang sogar gegen Achilleus mit selbem Ausgang: Da die Götter ihn unterlegen sehen, entfernt ihn Poseidon aus dem Kampfe. Im Endeffekt ist Aineias in der Ilias also zwar ein individueller und erinnerungswürdiger, aber doch für die Haupthandlung nebensächlicher Charakter. Zwar gilt er als großer Krieger, doch Diomedes und Achilleus trotz seiner göttlichen Abstammung offensichtlich unterlegen. Anders sieht es schließlich in der römischen Tradition aus: Es schälte sich im Laufe der Jahrhunderte die Tradition heraus, Aeneas sei nach dem Untergang Troias nach Italien gefahren und dort zum Gründungsheros Roms geworden. Keinesfalls aber darf man diese Tradition als politisch motivierte Erfindung der Römer selbst annehmen, ist sie doch durch bildliche Darstellungen des Aeneas mit seinem Vater Anchises bereits bei den Etruskern des 6. Jahrhunderts v. Chr. belegt, ebenso in Latium auch wenn sich für eine Verwendung als Gründungsheros oder einen Aeneas-Kult keine Belege finden 1. Waren dann in römischer Zeit zunächst noch diverse verschiedene Versionen der Aeneas-Geschichte im Umlauf (mal mehr, mal weniger kombiniert mit der alternativen Gründungslegende um Romulus) 2, wurde der Stoff zur Zeit des Augustus gewissermaßen kanonisiert: Es erschien das von Vergil verfasste 1 H. Heckel, Aineias, in: DNP 1 (1996), 330f. 2 Zur Pluralität römischer Gründungserzählungen siehe F. Dupont: Rom - Stadt ohne Ursprung. Gründungsmythos und römische Identität (Darmstadt 2013) 32ff. 3
4 Epos Aeneis, das in Anlehnung an die homerischen Epen die Flucht des Aeneas aus Troia, seine Irrfahrten und seine Konflikte in der neuen Heimat Italien schildert. Da Aeneas, von einer Göttin abstammend und vom göttlichen Plan geleitet, zudem als Stammvater der Julier galt, stellte die Aeneis ein hervorragendes Propagandawerk zur Herrschaftslegitimation des Augustus dar. Mit diesem Epos war nunmehr die kanonische Geschichte des Aeneas zementiert, welche von da an die Rezeption der Gestalt beherrschen sollte auch spätere Adaptionen wie der mittelalterliche Eneasroman des Heinrich von Veldeke hielten sich stets weitgehend an die von der Aeneis festgehaltenen Handlungspunkte. Die Aeneis berichtet, wie Aeneas nach seiner Flucht aus dem brennenden Troia, bei der er seine erste Frau verliert, zunächst in Tradition der Odyssee einige Irrfahrten und Abenteuer absolviert, bis er schließlich nach Karthago gelangt. Die dortige Herrscherin Dido verliebt sich in ihn und es entspannt sich eine eheähnliche Beziehung zwischen den beiden doch die Götter haben andere Pläne: Auf Geheiß Jupiters verlässt Aeneas Dido, welche sich daraufhin das Leben nimmt, und segelt weiter nach Sizilien. An seinen Aufenthalt dort schließt noch ein Abstieg in die Unterwelt an, wo sein zu Anfang der Erzählung verstorbener Vater Anchises ihm die zukünftige Größe Roms prophezeit. Es folgen angelehnt an die Ilias Aeneas weniger mythische Konflikte in Italien. Latinus, König von Latium, verspricht ihm seine Tochter Lavinia zur Frau, was deren anderen Verehrer Turnus verärgert. Mit diesem entspannt sich ein Krieg, an dessen Ende Aeneas Turnus tötet. 2.2 Enmerkar Enmerkar, der mythische König und Gründer der Stadt Uruk (sumerisch Unug) galt, zweitausend Jahre vor Aeneas, ebenfalls als großer Held, ja Nationalheros. Angesiedelt wird seine Regierungszeit im ausgehenden 4. Jahrtausend v. Chr. 3, also in der Blütezeit Uruks. Die sumerische Königsliste, aufgezeichnet in der altbabylonischen Zeit, welche alle relevanten Herrscher bis in die mythischen Zeiten vor der Sintflut auflistet, weiß Folgendes über ihn zu berichten: Enme(r)kar, der Sohn des Meskiaggascher, der König von Unug, der Unug erbaut hat, wurde König; er regierte 420 Jahre. 4 Diese erheblich lange Regierungszeit ist in der sumerischen Königsliste nichts Ungewöhnliches sie findet sich, mitunter mit noch wesentlich längeren Zeiten, bei allen Herrschern der früheren Dynastien. Enmerkar ist hier der zweite Herrscher der zweiten Dynastie nach der Sintflut. Sein Vater Meskiaggascher indes wird als Sohn des Sonnengottes Utu bezeichnet 5, was auch für Enmerkar eine göttliche 3 C. Mittermayer, Enmerkara und der Herr von Arata, in: Konrad Volk (Hrsg.), Erzählungen aus dem Land Sumer (Wiesbaden 2015), W. H. Ph. Römer (übers.), Die sumerische Königsliste, in: TUAT CD-ROM Band I Lieferung 4 (Gütersloh 2005), ebd, 331, 3,2. 4
5 Abstammung bestätigt. Andere Werke bezeichnen ihn auch direkt als Sohn Utus, wobei dies in Mesopotamien auch allgemein einen Nachfahren bezeichnen kann. Zentral für die Figur des Enmerkar sind eine Reihe thematisch zusammengehöriger Epen: Die größte Rolle spielt er in der Erzählung Enmerkara und der Herr von Arata, welche von dem Konflikt zwischen Uruk und der im Osten lokalisierten Metropole Arata erzählt. Beide Städte buhlen um die Gunst der Göttin Innana, doch es ist Uruk, das sie bevorzugt, wie schon zu Anfang klargestellt. Enmerkar beabsichtigt, seine Macht über Arata auszudehnen, um an die reichen Rohstoffe jener Region zu gelangen, und stellt Tributforderungen an den König Aratas. Jener ist erwartungsgemäß nicht sofort damit einverstanden und es entspannt sich ein Wettstreit zwischen den Städten, bei dem Enmerkar und der König von Arata Boten mit Rätseln hin und her schicken, die der Kontrahent zu lösen hat. Durch die Unterstützung der Götter gelingt Enmerkar natürlich jede dieser Aufgaben. Als sein eigener Bote sich schließlich die Botschaft nicht mehr selbst merken kann, ritzt Enmerkar diese in Ton und erfindet damit kurzerhand die Schrift. Der König Aratas, der mit der beschriebenen Tontafel nichts anfangen kann, muss sich geschlagen geben und entrichtet den Tribut. Der siegreiche Enmerkar vermählt sich zum Ende der Erzählung mit seiner Gönnerin Innana. Eine weitere Erzählung, Enmerkar und Ensukukeschdana, erzählt eine ganz ähnliche Geschichte von der durch Wettstreite ausgetragenen Rivalität zwischen Uruk und Arata. Zum Krieg kommt es schließlich im zweiteiligen Lugalbanda-Epos, welches sich eigentlich in erster Linie um Enmerkars künftigen Schwiegersohn Lugalbanda dreht. Jener nimmt an Enmerkars Feldzug gegen Arata teil, wird jedoch krank und daraufhin von seinen Gefährten im Gebirge zurückgelassen. Mit der Hilfe der Götter gelingt es ihm natürlich, zu überleben und nach weiteren Abenteuern zum Heer zurückzukehren. Schließlich unterstützt er Enmerkar bei der zuvor erfolglosen Eroberung Aratas. Lugalbanda wird schließlich Enmerkars Nachfolger wofür er sich, das ist die Aussage des Epos, durch seine Taten und seine Beziehung zu den Göttern hinreichend qualifiziert hatte und heiratet Ninsumun, die göttliche Tochter von Enmerkar und Innana. Aus dieser Ehe wiederum geht der bekannteste Held der mesopotamischen Mythologie hervor, Gilgamesch. III. Vergleich der Mythen Zwar erzählen die Mythen um Aeneas und Enmerkar oberflächlich gesehen vollkommen unterschiedliche Geschichten, doch lässt sich bei genauerer Betrachtung eine Reihe von Parallelen feststellen: Zunächst handelt es sich bei beiden um schon von der Abstammung her zum Heldentum prädestinierte Gestalten, stammen sie doch beide von Königsgeschlechtern und Göttern ab Aeneas, Prinz von Troia, von Aphrodite/Venus; Enmerkar, König von Uruk, von Utu. Diese Nähe zu den Göttern führt bei beiden zu einer engen Verbindung mit jenen, so werden sie offen und direkt von den Göttern angeleitet und 5
6 unterstützt. Was sie aber über die Bloße Rolle als Halbgötter hinaus verbindet, ist vor allem die Rolle als Stadtgründer. Aeneas, wenn er auch nicht Rom selbst gründet, gilt doch als Begründer der römischen Kultur. Nach seinen langen Irrfahrten in Italien angekommen, gründet er die spätere Mutterstadt Lavinium (sein Sohn Askanius zudem später Alba Longa) und, noch wichtiger, jene Dynastie seiner Nachfahren, die direkt zu Romulus und somit der Gründung von Rom selbst führen soll. Im Falle Enmerkars ist die Gründung von Uruk nicht mit einem (bekannten) eigenen Mythos verbunden, wird in den überlieferten Werken jedoch vorausgesetzt. Neben eben zitierter Stelle der sumerischen Königsliste ist hier vor allem eine Passage aus dem zweiten Teil des Lugalbanda-Epos zu nennen, wo er berichtet, wie er die Wildnis um das Heiligtum der Innana (Eanna) 6 urbar macht und schließlich die Stadt errichtet: Enki, der Herr von Eridu, ließ mich das alte Rohr da ausreißen, ließ mich den Wasserfluss da unterbrechen - Fünfzig Jahre habe ich es erbaut, in fünfzig Jahren habe ich es erreicht! 7 Beide Helden charakterisieren sich auch maßgeblich durch ihre berühmte Nachkommenschaft: Aeneas ist (in der verbreitetsten Fassung der Geschichte) der Ahnherr von Romulus, dem (ebenfalls halbgöttlichen) Gründer Roms, sowie von Caesar und Augustus, den großen Herrschern der für die Römer unmittelbar erlebten Zeit. Enmerkar indes ist Schwiegervater des Lugalbanda sowie über jenen und seine (durchweg als Göttin charakterisierte!) Tochter Ninsumun Großvater des Gilgamesch, welcher in Mesopotamien eine ähnlich bedeutende Rolle als archetypischer Held innehatte wie Herakles/Herkules in Griechenland und Rom. Ein weiterer zentraler Punkt, in dem sich beide Heldengeschichten ähneln, ist der Aspekt der Feindschaft zwischen Städten. Aeneas, der fast in Karthago eine neue Heimat gefunden hätte, wird von den Göttern stattdessen nach Italien delegiert, um dort eine neue Stadt zu grünen. Dies hat durch den Selbstmord der Dido und ihren hasserfüllten Schwur dabei 8 die bekannte Erbfeindschaft zwischen Rom und Karthago zur Folge, die zum Zeitpunkt der Abfassung der Aeneis tief in das kulturelle Gedächtnis der Römer eingegraben war. Bei Enmerkar ist es die Stadt Arata, zu der er eine Hegemonialrivalität (E. und der Herr von Arata) bis offene Feindschaft (Lugalbanda-Epos) pflegt. Es ist bis heute umstritten, ob Arata wirklich existierte 6 Das Eanna gilt gemäß der sumerischen Überlieferung nicht als von Menschen errichtet, sondern wurde von der Göttin Innana selbst vom Himmel herab geholt, vgl. hierzu Annette Zgoll (übers.), Innana holt das erste Himmelshaus auf die Erde, in: TUAT Neue Folge Band 8 (Gütersloh 2014), 45ff. 7 Claus Wilcke (übers.), Vom klugen Lugalbanda, in: Konrad Volk (Hrsg.), Erzählungen aus dem Land Sumer (Wiesbaden 2015), 267 Lugalbanda II, 300ff. 8 Verg. Aen. 4,
7 und wenn ja, wo es zu lokalisieren sei. Es wurde unter anderem eine Verortung im Südosten des heutigen Iran vorgeschlagen, was sich aber nicht eindeutig belegen lässt 9. Die Frage, ob und wo Arata nun existierte, dürfte für die damaligen Rezipienten freilich zweitrangig gewesen sein: Das Epos wurde rund tausend Jahre nach der angeblichen Regierungszeit des Enmerkar verfasst; bei jener handelte es sich schon um eine ferne Vergangenheit recht genau jene Grenze zwischen dem Beginn der historisch nachvollziehbaren Geschichte und der nur durch Sagen und Mythen charakterisierten Vorzeit, ganz ähnlich wie bei dem kurz nach dem trojanischen Krieg verorten Szenario des Aeneas. Für die Sumerer damals dürfte Arata genauso historisch gewesen sein wie der trojanische Krieg für die Römer; das Konzept der historischen Realität in Opposition zum Mythos, wie wir es heute kennen, existierte noch nicht. Es scheint also naheliegend, dass beide Städte, Arata und Karthago, für die Autoren wie Rezipienten der Epen eine ganz ähnliche Funktion erfüllten. Beide waren zum Zeitpunkt der Niederschrift schon seit langem nicht mehr existent, sehr wohl aber präsent in der historischen Weltsicht der Sumerer/Römer. Die Vermutung liegt nahe, dass es in beiden Fällen weniger um die jeweiligen Städte an sich, als vielmehr um eine Aufwertung der eigenen Stadt (Rom/Uruk) ging. Beide, Rom wie Uruk nämlich, werden in den Mythen nicht nur als siegreich gegenüber Karthago/Arata charakterisiert, sondern überdies auch als im Gegensatz zu jenen von den Göttern bevorzugt und legitimiert. Ein Unterschied zwischen beiden Figuren ist, dass Enmerkar, der selbst die Hegemonie über Arata anstrebt, als wesentlich aktiver erscheint als Aeneas, welcher bloß den ihm von den Göttern erteilten Anweisungen folgt. Im Kontext der Erkenntnisse des letzten Absatzes verliert dieser Punkt jedoch seine Relevanz: Uruk, das wird schon zum Beginn des Epos klargestellt, wird von der Göttin Innana gegenüber Arata bevorzugt das Gelingen des Wettstreites wie auch letztlich die Eroberung Aratas entsprechen dem göttlichen Plan; Enmerkars Handeln geht diese göttliche Prädestination bereits voraus. So sind der Wettstreit und der Krieg letztlich nur Bestätigung einer Überlegenheit, die schon zuvor durch die göttlichen Mächte festgelegt wurde. Diese göttliche Legitimation Uruks sollte schließlich zur Zeit der Abfassung der Epen noch einem ganz anderen politischen Zweck dienen, wie man im nächsten Abschnitt sehen wird. Obligatorisch sei noch einmal die Frage aufgeworfen, ob die Ähnlichkeiten zwischen beiden Mythenkreisen auf einen direkten Zusammenhang zurückzuführen sein könnten. Die nach kurzer Überlegung offensichtliche Antwort: Nein. Zunächst ist der räumliche und zeitliche Abstand zwischen beiden Erzählungen zu nennen: Die Epen um Enmerkar und Lugalbanda wurden fast anderthalb Jahrtausende vor der ersten Bezeugung von Aeneas niedergeschrieben, zumal weit entfernt in Mesopotamien. Während das akkadischsprachige 9 Mittermayer 2015,
8 Gilgamesch-Epos eine weitere Verbreitung gefunden hat und aus zahlreichen Funden aus dem ganzen Nahen Osten bezeugt ist, ist eine solche Rezeptionsgeschichte für die sumerischen Epen nicht bezeugt diese sind nur aus der neusumerischen bis altbabylonischen Zeit bekannt. Mehr noch als diese räumliche und zeitliche Differenz indes dürfte ein anderer Aspekt wiegen: Der der teils durchaus nachvollziehbaren Mythenentwicklung. Die erste Erwähnung von Aeneas findet sich in der Ilias, wo er noch keine Rolle als Begründer von Städten und Stadtfeindschaften innehat, ja bis auf seine göttliche Abstammung in nichts an die sumerischen Helden erinnert. Seine Reise nach Italien und der Aufenthalt in Karthago dürften spätere Ausschmückungen sein, teils aus ideologischen Motiven. Umso mehr, da beide Mythenkreise trotz mancher Ähnlichkeit keine direkte Kausalität verbindet, scheint es ratsam, ihre Funktion und die Motivation der Schreiber nachzuvollziehen. IV. Heldenepen als Propaganda Die bloßen Gemeinsamkeiten der Mythen können womöglich noch als zufällige Parallelen, resultierend aus allgemeiner Heldentopik, angesehen werden. Interessant wird der Vergleich beider Mythenkreise indes erst, wenn man die politische Verwendung in ihrer Entstehungszeit analysiert und gegenüberstellt. 4.1 Die Könige von Uruk und Ur III Die Epen um die Könige von Uruk scheinen eine Art mesopotamisches Gemeingut gewesen zu sein, nicht nur auf die Stadt Uruk beschränkt. Schon ein Fragment aus dem 27. Jahrhundert v. Chr. (Fāra- Zeit) berichtet von Lugalbandas Hochzeit mit der Göttin Ninsumun 10. Und als wohl bekanntester Text der mesopotamischen Kultur gilt das auf Akkadisch verfasste Gilgamesch-Epos aus dem 2. Jahrtausend v. Chr., dessen bekannte aus zwölf Tafeln bestehende Komposition von dem wahrscheinlich um 1200 lebenden Sîn-leqe-unnīnī verfasst wurde. Kaum ein mesopotamischer Text dürfte eine solche Verbreitung erfahren haben wie dieser das Epos fand sich nicht nur in der im 7. Jahrhundert v. Chr. begründeten Bibliothek des Assurbanipal, sondern sogar in hethitischen und hurritischen Übersetzungen 11. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Geschichten um Gilgamesch und seine Vorgänger Lugalbanda und Enmerkar in Sumer allgemein bekannt waren vielleicht vergleichbar mit dem panhellenischen Helden Herakles. Die fraglichen Epen um Enmerkar und Lugalbanda indes entstammen einer ganz bestimmten Zeit, der 3. Dynastie von Ur (2112 bis 2004 v. Chr.). Dies ist gewissermaßen die einzige Zeit, in der man von einem Sumerischen Reich sprechen kann. Bereits zwei Jahrhunderte zuvor war Mesopotamien unter 10 Wilcke 2015, 226f 11 K. Hecker, Das akkadische Gilgamesch-Epos, in: TUAT CD-ROM Band III Lieferung 4 (Gütersloh 2005),
9 Sargon von Akkad im Akkadischen Reich vereint worden, doch hatte dies keinen dauerhaften Bestand zu den zahlreichen Faktoren des Untergangs zählten maßgeblich die Souveränitätsbestrebungen der alten sumerischen Stadtstaaten, die die Zentralgewalt nicht anerkennen wollten 12. Unter einem ähnlichen Vorzeichen stand erwartungsgemäß auch die 3. Dynastie von Ur, der es unter König Ur-Namma gelang, nach einer hundertjährigen Phase der Herrschaft diverser Lokalfürsten erneut ganz Sumer unter eine Oberhoheit zu zwingen. Auf Urnamma folgten Šulgi, Amar-Sin, Šu-Sin und Ibbi-Sin, bis auch dieses Reich am Ende des dritten Jahrtausends zerbrach und damit das Ende der traditionellen sumerischen Kultur einläutete. In genau diesem Kontext sind auch die Epen des Uruk-Zyklus zu sehen. Obgleich nunmehr Ur die Hauptstadt Sumers war, stellten sich die Könige von Ur III ganz bewusst in die Tradition der Könige von Uruk. So findet sich im zweiten Teil des Lugalbanda-Epos, direkt anschließend an den zuvor zitierten Bericht von der Gründung Uruks, folgendes Bekenntnis des Enmerkar: In Sumer und Akkad insgesamt hatten sich die Amurriter, die kein Getreide kennen, erhoben. Ich aber habe die Mauer von Uruk wie ein Vogelnetz durch die ganze Steppe gespannt. 13 Nicht nur war der Bau einer Mauer augenscheinlich zu allen Zeiten eine prestigeträchtige Angelegenheit. Nein, hier zeigt sich eine aus Sicht der Schreiber und Rezipienten nur allzu aktuelle Angelegenheit war es doch Šu-Sin, der vierte König von Ur III, der eine ebensolche Mauer zur Abwehr der Amurriter bauen ließ 14. Hier wird offensichtlich ein plakatives Werk in mythische Vorzeit übertragen und der mythische Held mit dem aktuellen König identifiziert. Dafür, dass sich die Könige von Ur III in der Tradition der Helden von Uruk sehen, zeugen auch zahlreiche (pseudo)genealogische Verbindungen, wie sie in den Königshymnen jener Zeit zutage treten. So heißt es über Ur-Namma etwa in der als Ur-Namma C bezeichneten Hymne: Ich bin das Geschöpf des Nanna! Ich bin der ältere Bruder des Gilgamesch! Ich bin der Sohn, geboren von Ninsumun, eine fürstliche Nachkommenschaft! Für mich kam das Königtum hinab vom Himmel! 15 Auch Šulgi nennt Ninsumun seine Mutter und Gilgamesch seinen Bruder: 12 D. O. Edzward, Geschichte Mesopotamiens. Von den Sumerern bis zu Alexander dem Großen (München 2009), Wilcke 2015, 267 Lugalbanda II, 303ff 14 Wilcke 2015, 223; Edzward 2009, A praise poem of Ur-Namma (Ur-Namma C), in ETCSL - Z
10 Oder im Falle von Šu-Sin: Denn es war für meine wahre Mutter Ninsumun, mit der zusammen meine Mutter mich geboren hat, um Glück und Freude zu gewähren [ ] 16 Wie mein Freund und Bruder Gilgamesch 17 Den Kopf hoch erhoben, passend für die königliche Krone, Son der Ninsumun, stark und mächtig unter den Anuna-Göttern Šu-Sin! 18 Solcherlei Formulierungen finden sich zahlreich in den Königshymnen der Ur III-Zeit 19. Ein Grund, weshalb man ausgerechnet die weibliche Göttin Ninsumun als symbolisches Elternteil aussuchte, mag sein, dass diese Abstammung die über den Vater vererbte Königslegitimation nicht tangierte. Sie galt auch schon vor den Königen von Ur III als Mutter mancher neusumerischer Herrscher und wurde dabei mitunter auch je nach Nutzen in die Nähe anderer Göttinnen wie etwa Gula oder Gatumdu gestellt oder mit diesen gleichgesetzt 20. Zu nennen ist auf jeden Fall auch der Aspekt der Vergöttlichung, wie wir ihn ja auch bei Aeneas und den römischen Kaisern finden: Auch die Könige von Ur III nämlich ließen sich vergöttlichen ein Phänomen, das sich erstmalig bei dem akkadischen König Naram-Sin findet. In Mesopotamien ist die Identifikation einer Person als Gott denkbar simpel zu erkennen, nämlich werden diese Individuen in Texten mit dem Determinativ Diĝir (Keilschriftzeichen vergleichbar einem Stern, meist als d transliteriert) versehen. Beachtet man nur das Vorkommen dieser Determinative in den Texten 21, so ergibt sich folgendes Bild: Enmerkar ist nicht vergöttlicht, Lugalbanda manchmal, Gilgamesch und Ninsumun immer. Bei Ur-Namma findet sich die Vergöttlichung nur indirekt da sein Name nämlich von der Gottheit Namma abgeleitet ist (Ur- d Namma). Šulgi wird manchmal mit Determinativ geschrieben, manchmal ohne. Ein Text nennt ihn auch Sohn der Ninsumun und des Lugalbanda 22. Amar-Sin, Šu-Sin und Ibbi-Sin werden immer vergöttlicht, d.h. mit vorangestelltem Diĝir geschrieben, allerdings wird die Nennung von Ninsumun selten. 16 A praise poem of Šulgi (Šulgi B), in ETCSL: Z. 184ff 17 A praise poem of Šulgi (Šulgi C), in ETCSL: Z A hymn for Šu-Suen, in ETCSL: Z Für weitere siehe unter Royal Praise Petry / Third Dynasty of Ur / [Name des Königs] 20 C. Wilcke, Ninsun, in: RlA 9 (2001), Gemeint sind hierbei sämtliche im ETCSL vorhandenen Königshymnen und Epen um die fraglichen Personen. 22 Wilcke 2001,
11 Es ist nicht mehr zu bestreiten, dass die Könige der 3. Dynastie nicht nur einen gewissen Herrscherkult betrieben, sondern diesen auch maßgeblich von den Protagonisten des Uruk-Zyklus herleiteten. Tatsächlich mag es auch eine gewisse Grundlage geben, weshalb die Könige von Ur sich ausgerechnet in die Tradition von Uruk und nicht etwa einer anderen Stadt stellten: Ur-Namma, der Begründer des Ur III-Reiches, war General und Statthalter, vermutlich auch Bruder des Königs Utuḫengal von Uruk 23, entstammte also selbst jener Stadt und somit (zumindest symbolisch) der Nachfolge jener ersten Dynastie von Uruk um Enmerkar, Lugalbanda und Gilgamesch. Es scheint offensichtlich und somit kaum noch erwähnenswert, dass diese Herkunftsgeschichte eine klassische Gründungserzählung mit legitimierender Wirkung darstellte. Das Bedürfnis nach einer solchen muss nicht nur in bloßem Narzissmus der Herrscher mit Hang zur Selbststilisierung gesucht werden, sondern dürfte auch einen strategischen Grund haben: Ur herrschte zu jener Zeit über ein brüchiges Reich aus zahlreichen Städten, die sich sehr wohl noch an ihre Zeiten der Souveränität erinnern konnten und diese nur allzu gerne bewahrt hätten. Schon dem Reich von Akkad war dies zum Verhängnis geworden. Es scheint auch naheliegend, dass als legitimierende Erzählung nicht bloß ein lokaler Mythos von Ur oder eine angebliche Berufung durch den dortigen Stadt- und nunmehr Reichsgott Nanna ausreichte sinnvoller scheint in der Tat ein überregional bekannter Mythenkreis. 4.2 Aeneis und Augustus Im Falle der Aeneas-Geschichte ganz besonders natürlich im Falle der Aeneis selbst sieht es mit dem politischen Programm kaum anders aus. Schon vor dem Epos galt die Abstammung von Aeneas als wichtiger Aspekt des Eigenbildes der Julier so zitierte beispielsweise schon Caesar diese bis zu den Göttern reichende Genealogie in der Totenrede auf seine Tante Julia 24. Die Aeneis indes verdichtet die Geschichte zu einem Ruhmgedicht auf den ersten römischen Kaiser Augustus an mehreren Stellen wird explizit dieser als Ziel der mit Aeneas begründeten römischen Geschichte dargestellt. So stellt ihn die sogenannte Heldenschau im 6. Buch als den verkündeten Erben des Aeneas in die Reihe zahlreicher mythischer Helden: Hier steht Caesar und die ganze Nachkommenschaft des Iulus, die dazu bestimmt ist, zum mächtigen Himmelsgewölbe aufzusteigen. Der hier, der ist der Held, der dir, so hörst du es oft, verheißen wird, Augustus Caesar, Sohn eines Gottes: Goldene Zeiten wird er von neuem für Latium stiften in dem Land, wo Saturnus einst König war [ ] Edzard 2009, Binder 2012, Verg. Aen. 6,
12 Er habe mehr Land durchwandert genauer: erobert als Herkules und Dionysos, wie es wenige Zeilen später heißt, und übertrifft damit sogar die größten Heroen. Augustus werde in seiner schicksalhaften Bestimmung nicht nur die Weltherrschaft, sondern auch eine globale Friedensordnung errichten und damit folglich ein neues Goldenes Zeitalter 26. Bewusst parallelisiert Vergil auch beide Helden, Aeneas und Augustus, durch ihre Taten: So, wie Aeneas als einziger Volk und Kultur der Trojaner vor dem Untergang bewahrt, indem er ihnen eine neue Heimat in Italien gibt, so sei auch Augustus in den Wirren der Bürgerkriege die einzige Hoffnung Roms auf Fortbestehen gewesen. Bücher ließen sich füllen mit der Thematik der politischen Intention und Instrumentalisierung der Aeneas-Geschichte und der Aeneis im Speziellen durch vor allem Augustus, doch sei es an dieser Stelle bei jener kurzen Zusammenfassung belassen. V. Zwei perfekte Gründungsmythen Ganz wie bei der 3. Dynastie von Ur, die sich als Oberhoheit gegenüber den zuvor unabhängigen Stadtstaaten behaupten musste, stellte auch das Prinzipat des Augustus eine neue Herrschaftsform dar, die einer legitimierenden Erzählung bedurfte. Doch weshalb, mag man fragen, haben es gerade diese beiden Mythenkreise zum Status von Nationalmythen gebracht? Beide Erzählungen haben über ihren hohen Bekanntheitsgrad hinaus mehrere beträchtliche Vorteile, die sich hervorragend ergänzen: Einerseits laufen sie (zumindest in der Interpretation der vorherrschenden Textversion) auf die konkrete Herrschaft einer Person/Dynastie zu: Augustus gilt als Abkömmling des Aeneas und somit auch der Venus; schon in der Aeneis wird die große Zukunft unter ihm beschworen. Ur-Namma und seine Nachfolger auf der anderen Seite stehen in historischer (Herkunft aus Uruk) und symbolischer (Mutterschaft der Ninsumun) Genealogie mit den altvorderen Königen Uruks; der Mauerbau im Lugalbanda-Epos parallelisiert beide Herrschaften. Auf der anderen Seite sind gleichsam Aeneis und die sumerischen Epen nicht nur eine auf ebendiese einzelnen Herrscher zugeschnittene Propaganda stattdessen fungieren sie gleichsam als eine Art Nationalepen. Aeneas gilt nicht nur als Stammvater der Julier, sondern auch der Römer allgemein. Ihm bzw. seinen Nachkommen ist in der römischen Tradition die Gründung der Stadt überhaupt erst zu verdanken. Gleichsam kann Enmerkar als ein maßgeblicher Begründer einer gesamtsumerischen Kultur gelten. Gleichsam wie die Aeneas-Geschichte den Konflikt mit dem Erbfeind Karthago vorwegnimmt und somit die Einheit der Römer gegenüber einem äußeren Feind postuliert, so fungiert auch der Wettstreit zwischen Uruk und Arata als eine solche Auseinandersetzung mit dem Fremden, dem äußeren Feind. (Obwohl im 3. Jahrtausend politisch uneins, bestand doch im Denken der Sumerer 26 Binder 2012, 816f. 12
13 schon immer eine Abgrenzung Sumers von den Fremdvölkern, den Barbaren des Berglandes 27, ob nun Elamer, Amurriter oder Gutäer.) Es ist ein altbekanntes Phänomen, dass wenig ein sonst mithin gespaltenes Volk so sehr eint wie ein gemeinsames Feindbild hier Karthago und Arata. Im Wettstreit mit der anderen Stadt, in dem Enmerkar natürlich die Überlegenheit der eigenen Stadt und folglich Kultur beweist, erfindet er nebenbei mit der Schrift die im alten Sumer wohl wichtigste Kulturtechnik, des Weiteren den Tauschhandel. Enmerkar also ist gewissermaßen der Begründer all dessen, was Sumer ausmacht. So kann man in ihm (neben seinem Enkel Gilgamesch als Archetyp des Kriegers und großen Helden) eine Art pansumerischen Heros sehen sein Mythos ist gleichsam eine angemessene Ursprungserzählung für ganz Sumer, wie auch Aeneas der Vater aller Römer ist. Nicht zuletzt basieren auch beide Mythenkreise darauf, dass sich eine Stadt bzw. Dynastie bewusst in die Tradition einer anderen stellt, deren Glanz unbestritten ist: Zum einen Troia, legendäre Metropole und Schauplatz des wohl bekanntesten Epos der damaligen Zeit, in dessen Nachfolge sich Rom durch Aeneas stellt; zum anderen Uruk, eine der ältesten und traditionsreichsten sumerischen Städte, in der darüber hinaus (gleichsam nach Mythos und aktuellem historischem Wissensstand) die Schrift, die wichtigste Kulturtechnik des Landes, erfunden wurde. Genau wie Ur III sich in einer Art Translatio Namlugal 28 in die Tradition Uruks stellte, geschah es Jahrtausende später in Rom, das sich als wiedergeborenes Troia inszenierte. VI. Synthese Letztendlich ergibt sich also folgendes Bild: Sowohl die 3. Dynastie von Ur als auch das römische Prinzipat unter Augustus standen, da sie eine vollkommen neue, den Untertanen ungewohnte Herrschaftsordnung errichtet hatten, unter akutem Legitimationsdruck. Beide antworteten darauf (unter anderem) dadurch, dass sie ältere, schon längst etablierte mythologische Überlieferungen zu einer geeigneten Ursprungserzählung umformten. Dies war bei den Sumerern der Mythenzyklus um die Könige von Uruk Enmerkar, Lugalbanda und Gilgamesch, bei den Römern die schon lange in gewissen Variationen kursierende Aeneas-Geschichte in beiden Fällen führte es zur Konkretion dieser Mythen in literarischen Epen, die uns heute als Hauptzeugnisse für ebendiese Mythenkreise erscheinen. (Trotz zahlreicher Erwähnungen der Protagonisten und z.t. ihrer Geschichten in anderen Texten und Dokumenten ist uns aus früheren Zeiten keine eigenständige epische Erzählung zu diesen Helden überliefert.) Dass gleichsam die Geschichten um Aeneas und um die Könige von Uruk so geeignet schienen, eine 27 Bezeichnenderweise verwendet das Sumerische dasselbe Wort kur für gleichsam Berg(land), Feindland, ein anderes Land allgemein (Sumer indes ist kalam ) und auch Unterwelt. 28 Abgeleitet von der Translatio Imperii, mit der sich die deutschen Kaiser als Nachfolger Roms darstellten, und namlugal, dem sumerischen Wort für Königtum. 13
14 Herrschaft zu fundieren, lässt sich an mehreren Aspekten festmachen: Beide kombinierten den Aspekt der Propaganda für eine konkrete Herrschaft mit einer weiteren Bedeutungsebene, auf der die Geschichte die ganze spätere Kultur repräsentiert, die ja der kleinste gemeinsame Nenner des unter der neuen Herrschaft vereinigten Reiches ist. Dies geschieht durch zweimaßgebliche Methoden: Die Darstellung bzw. Begründung elementarer Kulturgüter: Enmerkar erfindet Schrift und Tauschhandel, zwei nicht wegzudenkende Kulturtechniken im alten Sumer. Aeneas indes zeigt sich durch Repräsentation der klassischen römischen Tugenden (virtus, pietas etc., insbesondere die Treue gegenüber den Göttern) als Vorbild aller Römer. Die Abgrenzung gegenüber einer als feindlich definierten anderen Stadt, was den eigenen Zusammenhalt betont/verbessert: Enmerkar zeigt sich im Konflikt mit Arata als deutlich überlegen und folglich rechtmäßiger Herrscher, Aeneas begründet (unabsichtlich, im Epos aber bewusst so angelegt) die Erbfeindschaft Roms mit dem einstigen Rivalen Karthago. All dies betont die Großartigkeit des eigenen Reiches und weckt somit eine Sympathie in den eigenen Reihen. Hinzu kommen Methoden, wie in beiden Fällen die konkrete neue Herrschaft legitimiert wird: Die Darstellung des Aufstiegs von Rom/Uruk als gottgewollt: Aeneas handelt im Auftrag der Götter und ist selbst ein Halbgott, Enmerkar ist Günstling und Geliebter der Innana. Die Übernahme der Tradition einer anderen Stadt, die als respektabel vorausgesetzt wird: Rom durch Aeneas als Nachfolger Troias, Ur III über symbolische und teils reale Genealogie als Erbe von Uruk. Die Parallelisierung der Taten der mythischen und aktuellen Herrscher: Enmerkar baut wie Šu- Sin eine Mauer gegen die Amurriter, Aeneas ist wie Augustus der letzte Retter einer vom Zerfall bedrohten Kultur. Bei dieser Auflistung zeigt sich, dass sich manche Aspekte sogar zwischen beiden Intentionen bewegen der göttliche Plan etwa verherrlicht sowohl Rom allgemein als auch Augustus; die Amurriter-Mauer dient gleichsam der Abgrenzung von den Barbaren, also Nicht-Sumerern. Im Endeffekt kann man also für beide Mythen und insbesondere ihre epischen Konkretionen feststellen, dass sie vielschichtige (gesellschafts)politische Legitimationsschemata enthalten, die kaum voneinander und von der mythischen Handlung selbst zu trennen sind. Damit erweisen sich die Epen als teils bewusst, teils unbewusst brillant konzipierte Propagandawerkzeuge für eine konkrete Herrschaft. Die verschiedenen Ähnlichkeiten zwischen beiden Mythenkreisen lassen sich im Wesentlichen auf diese ideologischen Konzepte und Methoden zurückführen, die, weil erfolgsversprechend, augenscheinlich in zwei ganz unterschiedlichen Kulturen und Zeiten so ähnlich angewandt wurden. 14
15 Dieses vorläufige Ergebnis schafft unweigerlich Raum für weitergehende Forschungen, insbesondere unter Einbezug noch anderer Kulturen. Weisen dortige Legitimationserzählungen ebenfalls diese Charakteristika auf? Wenn ja, war es dort erfolgreich? Wenn nein, wieso nicht? Inwiefern unterscheiden sich die Bedürfnisse verschiedener Kulturen bezüglich solcher Erzählungen, wenn man bedenkt, dass zumindest die beiden betrachteten Kulturen ganz ähnliches hervorgebracht haben? Die Liste potenzieller weitergehender Fragestellungen ist schier endlos. Es bleibt jedenfalls die Erkenntnis, dass gleichsam Römer und Sumerer zur Fundierung ihrer Herrschaft einige ganz ähnliche, eindeutig benennbare Prinzipien anwandten. 15
16 Literatur / Quellen Primärquellen C. Mittermayer (übers.), Enmerkara und der Herr von Arata, in: Konrad Volk (Hrsg.), Erzählungen aus dem Land Sumer (Wiesbaden 2015) C. Wilcke (übers.), Vom klugen Lugalbanda, in: Konrad Volk (Hrsg.), Erzählungen aus dem Land Sumer (Wiesbaden 2015) P. Vergilius Maro, Aeneis (übers. + hrsg. von Edith und Gerhard Binder), Stuttgart 2008 (Reclam, Lateinisch/Deutsch) W. H. Ph. Römer (übers.), Die sumerische Königsliste, in: TUAT CD-ROM Band I Lieferung 4 (Gütersloh 2005), 328ff. Diverse Herrscherhymnen der Könige der 3. Dynastie von Ur, gefunden im ETCSL (Electronic Text Corpus of Sumerian Literature): Ur-Namma: Šulgi: Amar-Sin: Šu-Sin: Ibbi-Sin: Sekundärliteratur C. Wilcke, Ninsun, in: Reallexikon der Assyriologie 9 (2001), 501 ff. D. O. Edzward, Geschichte Mesopotamiens. Von den Sumerern bis zu Alexander dem Großen (München 2009), XY. F. Dupont: Rom - Stadt ohne Ursprung. Gründungsmythos und römische Identität (Darmstadt 2013) 32ff. H. Heckel, Aineias, in: DNP 1 (1996), 330f. K. Hecker, Das akkadische Gilgamesch-Epos, in: TUAT CD-ROM Band III Lieferung 4 (Gütersloh 2005), 646. Des Weiteren die teils umfangreichen Erläuterungen bei o.g. Quelleneditionen. 16
Roms Gründungsmythos und Erzählungen zur Frühzeit
 Roms Gründungsmythos und Erzählungen zur Frühzeit Jahrgangsstufe Fach Zeitrahmen Benötigtes Material 5 L1 Latein abhängig von der gewählten Methode; siehe unter Hinweise zum Unterricht Lehrwerkstexte;
Roms Gründungsmythos und Erzählungen zur Frühzeit Jahrgangsstufe Fach Zeitrahmen Benötigtes Material 5 L1 Latein abhängig von der gewählten Methode; siehe unter Hinweise zum Unterricht Lehrwerkstexte;
Die Doppelwegstruktur in Heinrich von Veldeke s Eneasroman
 Germanistik Jan Schultheiß Die Doppelwegstruktur in Heinrich von Veldeke s Eneasroman Essay Die Doppelwegstruktur in Heinrich von Veldeke s Eneasroman 1. Resümee der bisherigen Schwerpunkte und Denkanstöße...
Germanistik Jan Schultheiß Die Doppelwegstruktur in Heinrich von Veldeke s Eneasroman Essay Die Doppelwegstruktur in Heinrich von Veldeke s Eneasroman 1. Resümee der bisherigen Schwerpunkte und Denkanstöße...
Einführung in die klassische Mythologie
 Einführung in die klassische Mythologie Bearbeitet von Barry B. Powell, Bettina Reitz 1. Auflage 2009. Taschenbuch. ix, 236 S. Paperback ISBN 978 3 476 02324 7 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 381
Einführung in die klassische Mythologie Bearbeitet von Barry B. Powell, Bettina Reitz 1. Auflage 2009. Taschenbuch. ix, 236 S. Paperback ISBN 978 3 476 02324 7 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 381
Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing
 Germanistik Stephanie Reuter Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing Zusätzlich ein kurzer Vergleich der Fabel 'Der Rabe und
Germanistik Stephanie Reuter Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing Zusätzlich ein kurzer Vergleich der Fabel 'Der Rabe und
GESCHICHTE DER RÖMISCHEN REPUBLIK VON JOCHEN BLEICKEN
 GESCHICHTE DER RÖMISCHEN REPUBLIK VON JOCHEN BLEICKEN 3., überarbeitete Auflage R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1988 INHALT Vorwort XI I. Darstellung 1 1. Italien im frühen 1. Jahrtausend v. Chr 1 a. Landschaft
GESCHICHTE DER RÖMISCHEN REPUBLIK VON JOCHEN BLEICKEN 3., überarbeitete Auflage R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1988 INHALT Vorwort XI I. Darstellung 1 1. Italien im frühen 1. Jahrtausend v. Chr 1 a. Landschaft
"Die Gestalt des Helden, -Joseph L.Henderson: Der moderne Mensch und die Mythen. Auszüge":
 "Die Gestalt des Helden, -Joseph L.Henderson: Der moderne Mensch und die Mythen. Auszüge": Die Erneuerung der Informationsstruktur geschieht immer nach dem selben zyklischen Muster: Tod und Wiedergeburt
"Die Gestalt des Helden, -Joseph L.Henderson: Der moderne Mensch und die Mythen. Auszüge": Die Erneuerung der Informationsstruktur geschieht immer nach dem selben zyklischen Muster: Tod und Wiedergeburt
Inhalt. Orientierung 11
 Inhalt Orientierung 11 Grundfragen 13 1. Was sind Götter? 13 2. Wie können unsterbliche Götter Geschichte(n) haben? 14 3. Was ist ein Mythos? 15 4. Was unterscheidet den Mythos von Märchen? 16 5. Was unterscheidet
Inhalt Orientierung 11 Grundfragen 13 1. Was sind Götter? 13 2. Wie können unsterbliche Götter Geschichte(n) haben? 14 3. Was ist ein Mythos? 15 4. Was unterscheidet den Mythos von Märchen? 16 5. Was unterscheidet
GESCHICHTE.. DER ROMISCHEN REPUBLIK
 GESCHICHTE.. DER ROMISCHEN REPUBLIK VON JOCHEN BLEICKEN 6. Auflage R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 2004 INHALT Vorwort XIII I. Darstellung 1 1. Italien im frühen 1. Jahrtausend v. Chr 1 a. Landschaft und
GESCHICHTE.. DER ROMISCHEN REPUBLIK VON JOCHEN BLEICKEN 6. Auflage R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 2004 INHALT Vorwort XIII I. Darstellung 1 1. Italien im frühen 1. Jahrtausend v. Chr 1 a. Landschaft und
Predigt im Gottesdienst am Muttertag Sonntag 14. Mai 2017 reformierte Kirche Birmensdorf Dankbarkeit die Mutter aller Tugenden
 Predigt im Gottesdienst am Muttertag Sonntag 14. Mai 2017 reformierte Kirche Birmensdorf Dankbarkeit die Mutter aller Tugenden Lesung - Psalm 103 1 Von David. Lobe den HERRN, meine Seele, und alles, was
Predigt im Gottesdienst am Muttertag Sonntag 14. Mai 2017 reformierte Kirche Birmensdorf Dankbarkeit die Mutter aller Tugenden Lesung - Psalm 103 1 Von David. Lobe den HERRN, meine Seele, und alles, was
Hatten sich die Ragnarök, die letzten Tage, bereits ereignet? Würden sie noch kommen? Ich wusste es nicht. Und ich bin mir auch heute nicht sicher.
 Hatten sich die Ragnarök, die letzten Tage, bereits ereignet? Würden sie noch kommen? Ich wusste es nicht. Und ich bin mir auch heute nicht sicher. Die Tatsache, dass diese Welt und ihre Geschichten enden
Hatten sich die Ragnarök, die letzten Tage, bereits ereignet? Würden sie noch kommen? Ich wusste es nicht. Und ich bin mir auch heute nicht sicher. Die Tatsache, dass diese Welt und ihre Geschichten enden
Die Bedeutung von Sprache in Peter Handkes "Wunschloses Unglück"
 Germanistik Miriam Degenhardt Die Bedeutung von Sprache in Peter Handkes "Wunschloses Unglück" Eine Analyse der Sprache bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Leben der Mutter und Handkes Umgang mit der
Germanistik Miriam Degenhardt Die Bedeutung von Sprache in Peter Handkes "Wunschloses Unglück" Eine Analyse der Sprache bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Leben der Mutter und Handkes Umgang mit der
Predigt zu Johannes 14, 12-31
 Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Siegfried und Hagen. Michael Brandl. Die Ermordung Siegfrieds als Höhepunkt des Konflikts zweier unterschiedlicher Heldentypen im Nibelungenlied
 Germanistik Michael Brandl Siegfried und Hagen Die Ermordung Siegfrieds als Höhepunkt des Konflikts zweier unterschiedlicher Heldentypen im Nibelungenlied Studienarbeit I.) Inhaltsverzeichnis S. 1 II.)
Germanistik Michael Brandl Siegfried und Hagen Die Ermordung Siegfrieds als Höhepunkt des Konflikts zweier unterschiedlicher Heldentypen im Nibelungenlied Studienarbeit I.) Inhaltsverzeichnis S. 1 II.)
VORANSICHT. Alexander der Große strahlender Held oder gnadenloser Eroberer? Das Wichtigste auf einen Blick. Andreas Hammer, Hennef
 Antike Beitrag 8 Alexander der Große (Klasse 6) 1 von 24 Alexander der Große strahlender Held oder gnadenloser Eroberer? Andreas Hammer, Hennef m Alexander III. von Makedonien ranken Usich zahlreiche Mythen.
Antike Beitrag 8 Alexander der Große (Klasse 6) 1 von 24 Alexander der Große strahlender Held oder gnadenloser Eroberer? Andreas Hammer, Hennef m Alexander III. von Makedonien ranken Usich zahlreiche Mythen.
Von der "res publica libera" zum "novus status" - Octavians Weg zur Alleinherrschaft
 Geschichte Daniel Mielke Von der "res publica libera" zum "novus status" - Octavians Weg zur Alleinherrschaft Studienarbeit TU Darmstadt Fachbereich II Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften Institut
Geschichte Daniel Mielke Von der "res publica libera" zum "novus status" - Octavians Weg zur Alleinherrschaft Studienarbeit TU Darmstadt Fachbereich II Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften Institut
Ramses II. Gottkönig und Idealist
 Ramses II Gottkönig und Idealist Gliederung Teil 1 Der Mensch und Gott 1. Überblick 2. Die Biographie eines Gottkönigs 3. Timetable Teil 2 Der Architekt 1. Ramses als Bauherr 2. Ramses als Vorbild 3. Der
Ramses II Gottkönig und Idealist Gliederung Teil 1 Der Mensch und Gott 1. Überblick 2. Die Biographie eines Gottkönigs 3. Timetable Teil 2 Der Architekt 1. Ramses als Bauherr 2. Ramses als Vorbild 3. Der
Bei den Sumerern. (Rollsiegel von Wein Amphore)
 Bei den Sumerern Ursprünglich stammt der Wein von einer Göttin ab, jedenfalls bei den Sumerern. 2700 v. Chr. wird eine Weingöttin in sumerischer Schrift zum ersten Mal erwähnt. Die Beschützerin der sumerischen
Bei den Sumerern Ursprünglich stammt der Wein von einer Göttin ab, jedenfalls bei den Sumerern. 2700 v. Chr. wird eine Weingöttin in sumerischer Schrift zum ersten Mal erwähnt. Die Beschützerin der sumerischen
Von Sokrates bis Pop-Art
 Von Sokrates bis Pop-Art Roland Leonhardt Ein Smalltalk-Guide ISBN 3-446-22820-9 Leseprobe Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/3-446-22820-9 sowie im Buchhandel Geschichte
Von Sokrates bis Pop-Art Roland Leonhardt Ein Smalltalk-Guide ISBN 3-446-22820-9 Leseprobe Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/3-446-22820-9 sowie im Buchhandel Geschichte
M. Porcius Cato und die griechische Kultur
 Geschichte Robert Scheele M. Porcius Cato und die griechische Kultur Studienarbeit Eberhard-Karls-Universität Tübingen Fakultät für Philosophie und Geschichte Historisches Seminar Abteilung für Alte Geschichte
Geschichte Robert Scheele M. Porcius Cato und die griechische Kultur Studienarbeit Eberhard-Karls-Universität Tübingen Fakultät für Philosophie und Geschichte Historisches Seminar Abteilung für Alte Geschichte
2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken
 4 REZEPTIONS- GESCHICHTE 5 MATERIALIEN 6 PRÜFUNGS- AUFGABEN 2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken Kleists Œuvre besteht neben einer überschaubaren Zahl von Gedichten, Anekdoten sowie Essays
4 REZEPTIONS- GESCHICHTE 5 MATERIALIEN 6 PRÜFUNGS- AUFGABEN 2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken Kleists Œuvre besteht neben einer überschaubaren Zahl von Gedichten, Anekdoten sowie Essays
Religionskritik in der Antike
 Annette Pohlke Religionskritik in der Antike Zwischen Pantheismus, Agnostizismus und Atheismus Impressum Annette Pohlke Engadiner Weg 4 12207 Berlin annette@pohlke.de www.pohlke.de 1. Auflage, August 2013
Annette Pohlke Religionskritik in der Antike Zwischen Pantheismus, Agnostizismus und Atheismus Impressum Annette Pohlke Engadiner Weg 4 12207 Berlin annette@pohlke.de www.pohlke.de 1. Auflage, August 2013
Chinesisches Denken im Wandel
 Chinesisches Denken im Wandel HORST TIWALD 11. 04. 2006 I. Es gibt mehrere Wege, um zum Verständnis des chinesischen Denkens vorzudringen. Jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. Man kann sich zum Beispiel
Chinesisches Denken im Wandel HORST TIWALD 11. 04. 2006 I. Es gibt mehrere Wege, um zum Verständnis des chinesischen Denkens vorzudringen. Jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. Man kann sich zum Beispiel
Ur- und Altrom bis zur augusteischen Zeit in der Literatur
 Geschichte Chali Xu Ur- und Altrom bis zur augusteischen Zeit in der Literatur Studienarbeit Ur- und Alt-Rom und Rom in augusteischer Zeit anhand literarischer Quellen 1 Einleitung Mein Vortrag tangiert
Geschichte Chali Xu Ur- und Altrom bis zur augusteischen Zeit in der Literatur Studienarbeit Ur- und Alt-Rom und Rom in augusteischer Zeit anhand literarischer Quellen 1 Einleitung Mein Vortrag tangiert
GOTT ENTDECKEN GOTT LIEBEN
 GOTT ENTDECKEN GOTT LIEBEN v1 Apostelgeschichte 17, 22-31 22 Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen! Ich habe mich mit eigenen
GOTT ENTDECKEN GOTT LIEBEN v1 Apostelgeschichte 17, 22-31 22 Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen! Ich habe mich mit eigenen
Vorwort. Brief I An Claudine. Brief II Die Idylle und die Zäsur. Brief III Ein Hurenhaus in Wien. Brief IV Wiener Kreise
 Vorwort 8 Brief I An Claudine 11 Brief II Die Idylle und die Zäsur 16 Brief III Ein Hurenhaus in Wien 24 Brief IV Wiener Kreise 29 Brief V Monolog der Madame Chantal 36 Brief VI Julius Andrassy und Graf
Vorwort 8 Brief I An Claudine 11 Brief II Die Idylle und die Zäsur 16 Brief III Ein Hurenhaus in Wien 24 Brief IV Wiener Kreise 29 Brief V Monolog der Madame Chantal 36 Brief VI Julius Andrassy und Graf
Die Welt der griechischen Götter und Sagengestalten gliedert sich in verschiedene Zeitalter auf, nämlich in :
 Die Welt der griechischen Götter und Sagengestalten gliedert sich in verschiedene Zeitalter auf, nämlich in : die Zeit der Urgottheiten, die Herrschaftszeit von Kronos, einem der Titanen, die man das Goldene
Die Welt der griechischen Götter und Sagengestalten gliedert sich in verschiedene Zeitalter auf, nämlich in : die Zeit der Urgottheiten, die Herrschaftszeit von Kronos, einem der Titanen, die man das Goldene
Sie durften nicht Oma zu ihr sagen. Auf keinen Fall! Meine Mutter hasste das Wort Oma.
 Der Familien-Blues Bis 15 nannte ich meine Eltern Papa und Mama. Danach nicht mehr. Von da an sagte ich zu meinem Vater Herr Lehrer. So nannten ihn alle Schüler. Er war Englischlehrer an meiner Schule.
Der Familien-Blues Bis 15 nannte ich meine Eltern Papa und Mama. Danach nicht mehr. Von da an sagte ich zu meinem Vater Herr Lehrer. So nannten ihn alle Schüler. Er war Englischlehrer an meiner Schule.
Die attische Demokratie in der Leichenrede des Perikles auf die Gefallenen im ersten Jahr des Peloponnesischen Krieges (Thuk II,35-41)
 Geschichte Anonym Die attische Demokratie in der Leichenrede des Perikles auf die Gefallenen im ersten Jahr des Peloponnesischen Krieges (Thuk II,35-41) Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität Mainz
Geschichte Anonym Die attische Demokratie in der Leichenrede des Perikles auf die Gefallenen im ersten Jahr des Peloponnesischen Krieges (Thuk II,35-41) Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität Mainz
Der Untergang Roms - Chronologischer Überblick und Ursachendiskussion
 Geschichte Domenic Schäfer Der Untergang Roms - Chronologischer Überblick und Ursachendiskussion Wissenschaftlicher Aufsatz INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung S.3 2. Überblick über das Ende des weströmischen
Geschichte Domenic Schäfer Der Untergang Roms - Chronologischer Überblick und Ursachendiskussion Wissenschaftlicher Aufsatz INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung S.3 2. Überblick über das Ende des weströmischen
Grundwissen Geschichte Jahrgangsstufe 6
 1. Grundlagen Grundwissen Geschichte Jahrgangsstufe 6 Quellen Alles, woraus man Kenntnisse über die Vergangenheit gewinnen kann; es gibt schriftliche, mündliche Quellen und Gegenstände oder Überreste.
1. Grundlagen Grundwissen Geschichte Jahrgangsstufe 6 Quellen Alles, woraus man Kenntnisse über die Vergangenheit gewinnen kann; es gibt schriftliche, mündliche Quellen und Gegenstände oder Überreste.
Topografie des Imperium Romanum: Orte und Regionen
 Topografie des Imperium Romanum: Orte und Regionen Jahrgangsstufe Fach Zeitrahmen Benötigtes Material 7 L2 Latein Variante A (Partnerarbeit): ca. 20 Minuten; Variante B (Einzelarbeit): ca. 25 Minuten Karte
Topografie des Imperium Romanum: Orte und Regionen Jahrgangsstufe Fach Zeitrahmen Benötigtes Material 7 L2 Latein Variante A (Partnerarbeit): ca. 20 Minuten; Variante B (Einzelarbeit): ca. 25 Minuten Karte
Die Mythen der Griechen
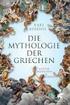 Die Mythen der Griechen Merkmale und Beispiele Eine -Literaturmappe zum GORILLA-Band Ikarus fliegt 2017 Am Anfang war Homer Die europäische Literatur begann mit den Werken des griechischen Dichters Homer.
Die Mythen der Griechen Merkmale und Beispiele Eine -Literaturmappe zum GORILLA-Band Ikarus fliegt 2017 Am Anfang war Homer Die europäische Literatur begann mit den Werken des griechischen Dichters Homer.
Zentrale Botschaft - Religion zur Kontrolle der Bevölkerung?! Gegentheorie zum Zeitgeist Film
 Wahrheit und Lügen Thema Der von uns behandelte Teil des "Zeitgeist"-Projekts handelt von der Entstehung des Christentums und seinen Wurzeln. Doch wenn man genauer hinschaut, merkt man bald, dass auch
Wahrheit und Lügen Thema Der von uns behandelte Teil des "Zeitgeist"-Projekts handelt von der Entstehung des Christentums und seinen Wurzeln. Doch wenn man genauer hinschaut, merkt man bald, dass auch
Gottes Gnade PS 136 GOTTES GNADE HÖRT NIEMALS AUF
 Gottes Gnade PS 136 GOTTES GNADE HÖRT NIEMALS AUF Ps 136: 1-9 1 Dankt dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört 2 Dankt ihm, dem Gott über alle Götter, seine Gnade hört 3 Dankt ihm, dem Herrn über alle
Gottes Gnade PS 136 GOTTES GNADE HÖRT NIEMALS AUF Ps 136: 1-9 1 Dankt dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört 2 Dankt ihm, dem Gott über alle Götter, seine Gnade hört 3 Dankt ihm, dem Herrn über alle
Der ungläubige Thomas, wie er so oft genannt wird, sieht zum ersten Mal den auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus, den die andern Apostel be
 Joh 20,28 - stand der allmächtige Gott vor Thomas? Einleitung Eine weitere bei Anhängern der Trinitätslehre sehr beliebte und oft als Beweis zitierte Stelle sind die Wortes des Apostels Thomas, die uns
Joh 20,28 - stand der allmächtige Gott vor Thomas? Einleitung Eine weitere bei Anhängern der Trinitätslehre sehr beliebte und oft als Beweis zitierte Stelle sind die Wortes des Apostels Thomas, die uns
Der Beginn der Liebe von Tristan und Isolde bei Gottfried von Straßburg
 Germanistik Julia Cremer Der Beginn der Liebe von Tristan und Isolde bei Gottfried von Straßburg Ist der Minnetrank Ursache oder lediglich Symbol dieser Liebe? Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 2 Seite
Germanistik Julia Cremer Der Beginn der Liebe von Tristan und Isolde bei Gottfried von Straßburg Ist der Minnetrank Ursache oder lediglich Symbol dieser Liebe? Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 2 Seite
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde! Es ist wohl gar nicht so einfach, noch einmal nach
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde! Es ist wohl gar nicht so einfach, noch einmal nach
Ein Referat von: Christina Schmidt Klasse:7a Schule: SGO Fach: Geschichte Thema: Hundertjähriger Krieg England gegen Frankreich Koordination: Der
 Ein Referat von: Christina Schmidt Klasse:7a Schule: SGO Fach: Geschichte Thema: Hundertjähriger Krieg England gegen Frankreich Koordination: Der Konflikt zwischen England und Frankreich INHALT 1. Warum
Ein Referat von: Christina Schmidt Klasse:7a Schule: SGO Fach: Geschichte Thema: Hundertjähriger Krieg England gegen Frankreich Koordination: Der Konflikt zwischen England und Frankreich INHALT 1. Warum
V Academic. Bonifatia Gesche, Die Esra-Apokalypse
 V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Die Esra-Apokalypse Übersetzt und eingeleitet von Bonifatia Gesche
V Academic Kleine Bibliothek der antiken jüdischen und christlichen Literatur Herausgegeben von Jürgen Wehnert Vandenhoeck & Ruprecht Die Esra-Apokalypse Übersetzt und eingeleitet von Bonifatia Gesche
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Cicero und die Catilinarische Verschwörung
 Geschichte Friederike Doppertin Cicero und die Catilinarische Verschwörung Studienarbeit 1 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis 1 2. Einleitung 2 3. Brauchbarkeit von Reden in der historischen
Geschichte Friederike Doppertin Cicero und die Catilinarische Verschwörung Studienarbeit 1 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis 1 2. Einleitung 2 3. Brauchbarkeit von Reden in der historischen
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst
 34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
Krippenspiele. für die Kindermette
 Krippenspiele für die Kindermette geschrieben von Christina Schenkermayr und Barbara Bürbaumer, in Anlehnung an bekannte Kinderbücher; erprobt von der KJS Ertl Das Hirtenlied (nach dem Bilderbuch von Max
Krippenspiele für die Kindermette geschrieben von Christina Schenkermayr und Barbara Bürbaumer, in Anlehnung an bekannte Kinderbücher; erprobt von der KJS Ertl Das Hirtenlied (nach dem Bilderbuch von Max
Das Bild der Adelsclique und des C. Marius in Sallusts Bellum Iugurthinum
 Geschichte David Hohm Das Bild der Adelsclique und des C. Marius in Sallusts Bellum Iugurthinum Studienarbeit Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Institut für Geschichte, Lehrstuhl für Alte
Geschichte David Hohm Das Bild der Adelsclique und des C. Marius in Sallusts Bellum Iugurthinum Studienarbeit Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Institut für Geschichte, Lehrstuhl für Alte
Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln
 Medien Sebastian Posse Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln Eine quellenhistorische Analyse Studienarbeit Sebastian Posse Musikwissenschaftliches Seminar
Medien Sebastian Posse Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln Eine quellenhistorische Analyse Studienarbeit Sebastian Posse Musikwissenschaftliches Seminar
Das Spartabild im Nationalsozialismus
 Geschichte Philipp Prinz Das Spartabild im Nationalsozialismus Exemplarisch dargestellt an Hermann Görings Rede vom 30. Januar 1943 Essay Westfälische Wilhelms-Universität Münster WS 2007/08 Seminar für
Geschichte Philipp Prinz Das Spartabild im Nationalsozialismus Exemplarisch dargestellt an Hermann Görings Rede vom 30. Januar 1943 Essay Westfälische Wilhelms-Universität Münster WS 2007/08 Seminar für
Stefan Reben ich. Die 101 wichtigsten Fragen. Antike. Verlag C. H. Beck
 Stefan Reben ich Die 101 wichtigsten Fragen Antike Verlag C. H. Beck Inhalt Gebrauchsanweisung 9 Zur Einleitung 1. Was ist die Antike? 10 2. Welche Wissenschaften erforschen die griechisch-römische Antike?
Stefan Reben ich Die 101 wichtigsten Fragen Antike Verlag C. H. Beck Inhalt Gebrauchsanweisung 9 Zur Einleitung 1. Was ist die Antike? 10 2. Welche Wissenschaften erforschen die griechisch-römische Antike?
Neuer Lehrplan. Neues Buch. Ihr Stoffverteilungsplan. Geschichte und Geschehen. Sekundarstufe I, Ausgabe A für Nordrhein-Westfalen, Band 1
 Neuer Lehrplan. Neues Buch. Ihr Stoffverteilungsplan. Sekundarstufe I, Ausgabe A für NordrheinWestfalen, Band 1 Was geht mich Geschichte an? S. 8 Was ist eigentlich Geschichte? S. 10 Wie finden wir etwas
Neuer Lehrplan. Neues Buch. Ihr Stoffverteilungsplan. Sekundarstufe I, Ausgabe A für NordrheinWestfalen, Band 1 Was geht mich Geschichte an? S. 8 Was ist eigentlich Geschichte? S. 10 Wie finden wir etwas
"BESIEDLUNG IN WORTEN":
 "BESIEDLUNG IN WORTEN": -VOR 100.000 JAHREN -"ENKI & ENLIL". -ZECHARIA SITCHIN: "IN DER VORZEIT WAREN DIE "DIN-GIR"; -DER "RECHTMÄSSIGE ERBE DER RAKETENSCHIFFE" UND "DIE GESCHÖPFE, DIE SPÄTER VON DEN GRIECHEN
"BESIEDLUNG IN WORTEN": -VOR 100.000 JAHREN -"ENKI & ENLIL". -ZECHARIA SITCHIN: "IN DER VORZEIT WAREN DIE "DIN-GIR"; -DER "RECHTMÄSSIGE ERBE DER RAKETENSCHIFFE" UND "DIE GESCHÖPFE, DIE SPÄTER VON DEN GRIECHEN
Der neue König. Peter Schütt Auf dem Marktplatz. (Simon, Halum, Diener) Simon und Halum stehen beieinander
 Der neue König Peter Schütt 2016-10-17 1 Auf dem Marktplatz (,, Diener) und stehen beieinander Diener Diener Hey, hast Du es schon gehört? Was denn? Da ist heute morgen eine große Karawane nach Jerusalem
Der neue König Peter Schütt 2016-10-17 1 Auf dem Marktplatz (,, Diener) und stehen beieinander Diener Diener Hey, hast Du es schon gehört? Was denn? Da ist heute morgen eine große Karawane nach Jerusalem
Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum?
 Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Russische Philosophen in Berlin
 Russische Philosophen in Berlin Julia Sestakova > Vortrag > Bilder 435 Julia Sestakova Warum wählten russische Philosophen vorzugsweise Berlin als Ziel ihres erzwungenen Exils? Was hatte ihnen das Land
Russische Philosophen in Berlin Julia Sestakova > Vortrag > Bilder 435 Julia Sestakova Warum wählten russische Philosophen vorzugsweise Berlin als Ziel ihres erzwungenen Exils? Was hatte ihnen das Land
Die wahre Familie. Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert. Bibel lesen Bibel auslegen
 Die wahre Familie Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert Bibel lesen Bibel auslegen 1 Bibel lesen Persönliche Resonanz! Was macht der Text mit mir?! Was lerne ich durch den Text?! Welche Fragen löst
Die wahre Familie Wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert Bibel lesen Bibel auslegen 1 Bibel lesen Persönliche Resonanz! Was macht der Text mit mir?! Was lerne ich durch den Text?! Welche Fragen löst
Von Arkadien über New York hinein ins Labyrinth des Minotaurus
 Dr. Max Mustermann Didaktik Referat Kommunikation der deutschen & Marketing Sprache und Literatur Verwaltung Von Arkadien über New York hinein ins Labyrinth des Minotaurus Antike Mythologie in der aktuellen
Dr. Max Mustermann Didaktik Referat Kommunikation der deutschen & Marketing Sprache und Literatur Verwaltung Von Arkadien über New York hinein ins Labyrinth des Minotaurus Antike Mythologie in der aktuellen
H.G.Wells "Die Zeitmaschine" als Spiegel der Zeit
 Germanistik C. Köhne H.G.Wells "Die Zeitmaschine" als Spiegel der Zeit Studienarbeit 1. Einleitung... 2 1.2 Einordnen in den gesellschaftlichen Kontext... 3 1.1.1 Eloi und Morlocks als Klassenvertreter
Germanistik C. Köhne H.G.Wells "Die Zeitmaschine" als Spiegel der Zeit Studienarbeit 1. Einleitung... 2 1.2 Einordnen in den gesellschaftlichen Kontext... 3 1.1.1 Eloi und Morlocks als Klassenvertreter
Die Bedeutung des Anderen - Identitätskonstruktion zur Zeit des Kolonialismus und im Zeitalter der Globalisierung im Vergleich
 Germanistik Jasmin Ludolf Die Bedeutung des Anderen - Identitätskonstruktion zur Zeit des Kolonialismus und im Zeitalter der Globalisierung im Vergleich Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...
Germanistik Jasmin Ludolf Die Bedeutung des Anderen - Identitätskonstruktion zur Zeit des Kolonialismus und im Zeitalter der Globalisierung im Vergleich Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 5 Unterrichtsvorhaben: Könige in Israel Berufung und Versagen
 Unterrichtsvorhaben: Könige in Israel Berufung und Versagen Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Bildliches Sprechen von Gott (IHF2) Lebensweltliche Relevanz: Nachdenken über das Gottesbild und die
Unterrichtsvorhaben: Könige in Israel Berufung und Versagen Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Bildliches Sprechen von Gott (IHF2) Lebensweltliche Relevanz: Nachdenken über das Gottesbild und die
Zu Theodor Storms Novelle "Ein Doppelgänger" - Eine Analyse
 Germanistik Jennifer Plath Zu Theodor Storms Novelle "Ein Doppelgänger" - Eine Analyse Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Handlung... 4 2.1 Erste Komplikationshandlung... 4 2.2 Zweite
Germanistik Jennifer Plath Zu Theodor Storms Novelle "Ein Doppelgänger" - Eine Analyse Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Handlung... 4 2.1 Erste Komplikationshandlung... 4 2.2 Zweite
Geschi E2 (Rom) Klausur
 Geschi E2 (Rom) Klausur Name: Die Agrarrevolte (144-78) 1 Wodurch änderten sich Wirtschaft und Gesellschaft in Italien nach den punischen Kriegen? 2 (133) Was wollte Tiberius Gracchus und warum wollte
Geschi E2 (Rom) Klausur Name: Die Agrarrevolte (144-78) 1 Wodurch änderten sich Wirtschaft und Gesellschaft in Italien nach den punischen Kriegen? 2 (133) Was wollte Tiberius Gracchus und warum wollte
Die Bibliothek von Alexandria
 Geschichte Benjamin Knör Die Bibliothek von Alexandria Studienarbeit Ludwig-Maximilians-Universität München Historisches Seminar Abteilung Alte Geschichte Hauptseminar Resistenz und Integration im Hellenismus
Geschichte Benjamin Knör Die Bibliothek von Alexandria Studienarbeit Ludwig-Maximilians-Universität München Historisches Seminar Abteilung Alte Geschichte Hauptseminar Resistenz und Integration im Hellenismus
Topografie des Imperium Romanum: Orte und Regionen
 Topografie des Imperium Romanum: Orte und Regionen Jahrgangsstufe Fach Zeitrahmen Benötigtes Material 7 L1 Latein Variante A (Gruppenarbeit): ca. 20 Minuten; Variante B (Einzelarbeit): ca. 25 Minuten Karte
Topografie des Imperium Romanum: Orte und Regionen Jahrgangsstufe Fach Zeitrahmen Benötigtes Material 7 L1 Latein Variante A (Gruppenarbeit): ca. 20 Minuten; Variante B (Einzelarbeit): ca. 25 Minuten Karte
Jesus Christus Geburt und erstes Wirken
 Die Bibel im Bild Band 12 Jesus Christus Geburt und erstes Wirken Die Welt, in die Jesus kam 3 Lukas 1,5-22 Ein Geheimnis 8 Lukas 1,23-55 Der Wegbereiter 9 Lukas 1,57-80; Matthäus 1,18-25; Lukas 2,1-5
Die Bibel im Bild Band 12 Jesus Christus Geburt und erstes Wirken Die Welt, in die Jesus kam 3 Lukas 1,5-22 Ein Geheimnis 8 Lukas 1,23-55 Der Wegbereiter 9 Lukas 1,57-80; Matthäus 1,18-25; Lukas 2,1-5
Hesekiel 28,12-15; Jesaja 14,12; 1. Mose 1; 2
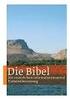 Der Fall Satans Hesekiel 28,12-15; Jesaja 14,12; 1. Mose 1; 2 William J. Hoste SoundWords,online seit: 20.09.2009 soundwords.de/a5266.html SoundWords 2000 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Artikel sind
Der Fall Satans Hesekiel 28,12-15; Jesaja 14,12; 1. Mose 1; 2 William J. Hoste SoundWords,online seit: 20.09.2009 soundwords.de/a5266.html SoundWords 2000 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Artikel sind
Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid, Güte. Predigt am 6. Januar 2017 (Epiphanias) in der Petruskirche zu Gerlingen Das Johannesevangelium beginnt mit
 Predigt am 6. Januar 2017 (Epiphanias) in der Petruskirche zu Gerlingen Das Johannesevangelium beginnt mit einem Hymnus, mit einer großartigen Gedankendichtung. Wir haben Teile dieses Hymnus vorhin gemeinsam
Predigt am 6. Januar 2017 (Epiphanias) in der Petruskirche zu Gerlingen Das Johannesevangelium beginnt mit einem Hymnus, mit einer großartigen Gedankendichtung. Wir haben Teile dieses Hymnus vorhin gemeinsam
Bibelüberblick - Teil 89
 1 von 6 02.01.2009 10:23 [ vorheriger Teil Inhalt nächster Teil ] Bibelüberblick - Teil 89 Daniel 2-7 HAUSAUFGABE 1. 2. 3. BIBEL: Dan 2-7 aufmerksam durchlesen FRAGEN ZUM NACHDENKEN: Schreibe kurze Antworten
1 von 6 02.01.2009 10:23 [ vorheriger Teil Inhalt nächster Teil ] Bibelüberblick - Teil 89 Daniel 2-7 HAUSAUFGABE 1. 2. 3. BIBEL: Dan 2-7 aufmerksam durchlesen FRAGEN ZUM NACHDENKEN: Schreibe kurze Antworten
Jahresplan Geschichte Realschule Klasse 6 mit zeitreise 1
 Jahresplan Geschichte Realschule Klasse 6 mit zeitreise Inhalt Zeitreise Methoden, Projekte, Wiederholung Stundenzahl Bildungsstandards Geschichte Klasse 6 Arbeitsbegriffe Das Fach Geschichte Aufgaben
Jahresplan Geschichte Realschule Klasse 6 mit zeitreise Inhalt Zeitreise Methoden, Projekte, Wiederholung Stundenzahl Bildungsstandards Geschichte Klasse 6 Arbeitsbegriffe Das Fach Geschichte Aufgaben
3. Drei Männer im Feuerofen (Daniel 3) 5. Daniel in der Löwengrube (Daniel 6) 6. Daniel und die Bibel (Gesamtschau)
 1. Daniel in Babylon (Daniel 1) 2. Nebukadnezars Traum (Daniel 2) 3. Drei Männer im Feuerofen (Daniel 3) 4. Belsazars Fest (Daniel 5) 5. Daniel in der Löwengrube (Daniel 6) 6. Daniel und die Bibel (Gesamtschau)
1. Daniel in Babylon (Daniel 1) 2. Nebukadnezars Traum (Daniel 2) 3. Drei Männer im Feuerofen (Daniel 3) 4. Belsazars Fest (Daniel 5) 5. Daniel in der Löwengrube (Daniel 6) 6. Daniel und die Bibel (Gesamtschau)
Du bist der Mann! Bio Graphie. Leben Schreiben. Geschichten, die das Leben schreibt. Narratologie, Biographiearbeit und biblisches Erzählen
 Geschichten, die das Leben schreibt Narratologie, Biographiearbeit und biblisches Erzählen Prof. Dr. Ilse Müllner www.ilsemuellner.at 1 Geschichten erzählen Du bist der Mann! 2 Biographie Bio Graphie Leben
Geschichten, die das Leben schreibt Narratologie, Biographiearbeit und biblisches Erzählen Prof. Dr. Ilse Müllner www.ilsemuellner.at 1 Geschichten erzählen Du bist der Mann! 2 Biographie Bio Graphie Leben
Johann Wolfgang von Goethe: Iphigenie auf Tauris Analyse und Interpretation der Dramenszene IV, 4
 Germanistik Tim Blume Johann Wolfgang von Goethe: Iphigenie auf Tauris Analyse und Interpretation der Dramenszene IV, 4 Referat / Aufsatz (Schule) Johann Wolfgang von Goethe Iphigenie auf Tauris Analyse
Germanistik Tim Blume Johann Wolfgang von Goethe: Iphigenie auf Tauris Analyse und Interpretation der Dramenszene IV, 4 Referat / Aufsatz (Schule) Johann Wolfgang von Goethe Iphigenie auf Tauris Analyse
"Moralische Wochenschriften" als typische Periodika des 18. Jahrhundert
 Medien Deborah Heinen "Moralische Wochenschriften" als typische Periodika des 18. Jahrhundert Studienarbeit Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Institut für Geschichtswissenschaft Veranstaltung:
Medien Deborah Heinen "Moralische Wochenschriften" als typische Periodika des 18. Jahrhundert Studienarbeit Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Institut für Geschichtswissenschaft Veranstaltung:
Der Neue Bund ist Frieden mit Gott
 Der Neue Bund ist Frieden mit Gott Ich werde den Tag nie vergessen, als ich Jesus mein Leben übergab. Als seine Liebe und Frieden mein Herz erfüllten. Epheser 2, 12 14 12 zu jener Zeit ohne Christus wart,
Der Neue Bund ist Frieden mit Gott Ich werde den Tag nie vergessen, als ich Jesus mein Leben übergab. Als seine Liebe und Frieden mein Herz erfüllten. Epheser 2, 12 14 12 zu jener Zeit ohne Christus wart,
Das Reich. Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher
 Das Reich Gottes Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher Das Reich Gottes ist prinzipiell dasselbe wie das Reich der Himmel Reich Gottes antwortet auf die Frage: Wem gehört das Reich? Reich der Himmel antwortet
Das Reich Gottes Marienheide, Mai 2011 Werner Mücher Das Reich Gottes ist prinzipiell dasselbe wie das Reich der Himmel Reich Gottes antwortet auf die Frage: Wem gehört das Reich? Reich der Himmel antwortet
Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten
 Ägypten Im 4.Jt.v.Chr. enstanden am Nil Kleinstaaten,die sich zu zwei größeren Einheiten zusammenschlossen: Oberägypten im Niltal und Unterägypten im Delta. Ein sagenhafter König Menes soll sie um 3000
Ägypten Im 4.Jt.v.Chr. enstanden am Nil Kleinstaaten,die sich zu zwei größeren Einheiten zusammenschlossen: Oberägypten im Niltal und Unterägypten im Delta. Ein sagenhafter König Menes soll sie um 3000
Geschichte. Klassenstufe 6. Kerncurriculum 6. Kerncurriculum Geschichte 6 Hölderlin-Gymnasium Nürtingen. Zeit. (Daten und Begriffe)
 Geschichte Klassenstufe 6 Standard 1. Annäherungen an die historische Zeit Kerncurriculum 6 - sich - ausgehend von einer Spurensuche in der eigenen Lebenswelt - als Teil der Geschichte begreifen. Inhalte
Geschichte Klassenstufe 6 Standard 1. Annäherungen an die historische Zeit Kerncurriculum 6 - sich - ausgehend von einer Spurensuche in der eigenen Lebenswelt - als Teil der Geschichte begreifen. Inhalte
Exzerpt Frank Kopanski "... sam säw zum nuosch" Anmerkungen zum Hochzeitsmahl in Heinrich Wittenwilers 'Ring'
 Germanistik Hans Erdmann Hans Erdmann Exzerpt Frank Kopanski "... sam säw zum nuosch" Anmerkungen zum Hochzeitsmahl in Heinrich Wittenwilers 'Ring' Exzerpt TU Dresden Fakultät Sprach-, Literatur- und
Germanistik Hans Erdmann Hans Erdmann Exzerpt Frank Kopanski "... sam säw zum nuosch" Anmerkungen zum Hochzeitsmahl in Heinrich Wittenwilers 'Ring' Exzerpt TU Dresden Fakultät Sprach-, Literatur- und
Inhalt. Vorwort Themen und Aufgaben Rezeptionsgeschichte Materialien Literatur... 87
 Inhalt Vorwort... 5 1. Thomas Mann: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 11 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 16 2. Textanalyse und -interpretation...
Inhalt Vorwort... 5 1. Thomas Mann: Leben und Werk... 7 1.1 Biografie... 7 1.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund... 11 1.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken... 16 2. Textanalyse und -interpretation...
Aristoteles über die Arten der Freundschaft.
 1 Andre Schuchardt präsentiert Aristoteles über die Arten der Freundschaft. Inhaltsverzeichnis Aristoteles über die Freundschaft...1 1. Einleitung...1 2. Allgemeines...2 3. Nutzenfreundschaft...3 4. Lustfreundschaft...4
1 Andre Schuchardt präsentiert Aristoteles über die Arten der Freundschaft. Inhaltsverzeichnis Aristoteles über die Freundschaft...1 1. Einleitung...1 2. Allgemeines...2 3. Nutzenfreundschaft...3 4. Lustfreundschaft...4
Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. interpretiert von der Kl. 7aM Mittelschule Prien
 Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus interpretiert von der Kl. 7aM Mittelschule Prien So erzählt Matthäus Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen weise Männer.
Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus interpretiert von der Kl. 7aM Mittelschule Prien So erzählt Matthäus Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen weise Männer.
Das Buch Ruth steht in enger Verbindung zum Buch der Richter.
 1 Stand: 09.01.2014 im Buch Zahlen der Bibel Inhalt Vorbemerkungen... 1 Zahlen im Buch... 2 Zusammenfassung... 5 Vorbemerkungen Das Buch steht in enger Verbindung zum Buch der Richter. { 1.1} Und es geschah
1 Stand: 09.01.2014 im Buch Zahlen der Bibel Inhalt Vorbemerkungen... 1 Zahlen im Buch... 2 Zusammenfassung... 5 Vorbemerkungen Das Buch steht in enger Verbindung zum Buch der Richter. { 1.1} Und es geschah
Schuleigenes Kerncurriculum (Geschichte) für den Jahrgang 6
 Schuleigenes Kerncurriculum (Geschichte) für den Jahrgang 6 Anzahl der schriftlichen Arbeiten: 1 (da epochal); Gewichtung der schriftlichen Leistungen: 1/3 ; Schulbuch: Forum Geschichte 5/6 Einheit: Roms
Schuleigenes Kerncurriculum (Geschichte) für den Jahrgang 6 Anzahl der schriftlichen Arbeiten: 1 (da epochal); Gewichtung der schriftlichen Leistungen: 1/3 ; Schulbuch: Forum Geschichte 5/6 Einheit: Roms
Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments
 Wolfgang Fenske Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments Ein Proseminar Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus Inhalt I. Einleitung 1. Warum befassen wir uns mit dem Neuen Testament? 13 2. Historisch-kritische
Wolfgang Fenske Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments Ein Proseminar Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus Inhalt I. Einleitung 1. Warum befassen wir uns mit dem Neuen Testament? 13 2. Historisch-kritische
"Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik
 Germanistik Jasmin Ludolf "Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Das Kunstmärchen...3 2.1 Charakteristika
Germanistik Jasmin Ludolf "Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Das Kunstmärchen...3 2.1 Charakteristika
1 Lukas 2, Weihnachtstag 2000 Der Anfang der Weihnachtsgeschichte ist uns sehr geläufig und fast jeder von könnte ihn zitieren.
 1 Lukas 2, 15-20 2. Weihnachtstag 2000 Der Anfang der Weihnachtsgeschichte ist uns sehr geläufig und fast jeder von könnte ihn zitieren. Es begab sich aber zu der Zeit als ein Gebot von dem Kaiser Augustus
1 Lukas 2, 15-20 2. Weihnachtstag 2000 Der Anfang der Weihnachtsgeschichte ist uns sehr geläufig und fast jeder von könnte ihn zitieren. Es begab sich aber zu der Zeit als ein Gebot von dem Kaiser Augustus
Inhaltsverzeichnis. Geschichte und Gegenwart 10. Unseren Vorfahren auf der Spur 28. Die ersten Spuren der Menschheit 32
 Inhaltsverzeichnis Geschichte und Gegenwart 10 Ein neues Fach auf dem Stundenplan Geschichte 12 Geschichte und ihre Epochen Eine Reise auf der Zeitleiste 14 Meine Geschichte, deine Geschichte, unsere Geschichte
Inhaltsverzeichnis Geschichte und Gegenwart 10 Ein neues Fach auf dem Stundenplan Geschichte 12 Geschichte und ihre Epochen Eine Reise auf der Zeitleiste 14 Meine Geschichte, deine Geschichte, unsere Geschichte
Die Götter des Olymp 3 Museen 1 Mythos
 Wer mit wem? 3 Museen 1 Mythos Herausgegeben von Katja Lembke Mit Beiträgen von Thomas Andratschke, Ralf Bormann, Bastian Eclercy und Christine Springborn Wer mit wem? 3 Museen 1 Mythos Niedersächsisches
Wer mit wem? 3 Museen 1 Mythos Herausgegeben von Katja Lembke Mit Beiträgen von Thomas Andratschke, Ralf Bormann, Bastian Eclercy und Christine Springborn Wer mit wem? 3 Museen 1 Mythos Niedersächsisches
Eine Übersicht von 1. Samuel Die Bibel im Überblick
 Eine Übersicht von 1. Samuel Die Bibel im Überblick Titel des Buches Der Titel des Buches stammt von dem Propheten und Richter Samuel (hebr. Name Gottes oder von Gott erbeten ), der die Hauptfigur in diesem
Eine Übersicht von 1. Samuel Die Bibel im Überblick Titel des Buches Der Titel des Buches stammt von dem Propheten und Richter Samuel (hebr. Name Gottes oder von Gott erbeten ), der die Hauptfigur in diesem
a) Unterstreiche in grün durch welche Mittel die Vergrößerung des Herrschaftsgebietes erreicht wurde.
 M1: Der Aufstieg Brandenburg-Preußens zum Königtum Seit 1415 herrschten die Hohenzollern als Kurfürsten in Brandenburg. Friedrich III. wurde unter dem Namen Friedrich I. von Preußen zum König. Durch geschickte
M1: Der Aufstieg Brandenburg-Preußens zum Königtum Seit 1415 herrschten die Hohenzollern als Kurfürsten in Brandenburg. Friedrich III. wurde unter dem Namen Friedrich I. von Preußen zum König. Durch geschickte
Gottesdienst 7. Januar 2017 Richterswil Königlich unterwegs Mt 2,1-12
 Gottesdienst 7. Januar 2017 Richterswil Königlich unterwegs Mt 2,1-12 Liebe Königskinder alle, eine eigenartige Anrede, liebe Freundinnen und Freunde in Christus, liebe Gemeinde am Sonntag nach Dreikönig,
Gottesdienst 7. Januar 2017 Richterswil Königlich unterwegs Mt 2,1-12 Liebe Königskinder alle, eine eigenartige Anrede, liebe Freundinnen und Freunde in Christus, liebe Gemeinde am Sonntag nach Dreikönig,
Die Varusschlacht als Gründungsereignis eines Deutschen Nationalbewusstseins
 Geschichte Marcel Weitschat / Nicolai Meyer Die Varusschlacht als Gründungsereignis eines Deutschen Nationalbewusstseins Für und Wider der populären Theorie des 19. Jahrhunderts Studienarbeit DieVarusschlachtalsGründungsereigniseines
Geschichte Marcel Weitschat / Nicolai Meyer Die Varusschlacht als Gründungsereignis eines Deutschen Nationalbewusstseins Für und Wider der populären Theorie des 19. Jahrhunderts Studienarbeit DieVarusschlachtalsGründungsereigniseines
KARL DER GROßE UND DAS FRANKENREICH
 1 Karl der Große und das Frankenreich KARL DER GROßE UND DAS FRANKENREICH Lernziele: 1. Erkläre, wer die Germanen waren und beschreibe die Geschichte der Sachsen zur Zeit Karls des Großen. 2. Nenne wichtige
1 Karl der Große und das Frankenreich KARL DER GROßE UND DAS FRANKENREICH Lernziele: 1. Erkläre, wer die Germanen waren und beschreibe die Geschichte der Sachsen zur Zeit Karls des Großen. 2. Nenne wichtige
"SELENE": Als ihre Eltern werden auch Helios oder Passas und die Euryphaessa, "die weithin Leuchtende", ein anderer Name für Theia, genannt.
 "SELENE": Selene (griechische Mythologie, bei den Römern Luna), die Göttin des Mondes, nach Hesiod Tochter des Hyperion und der Theia, Schwester des Helios und der Eos, auch Phoibe genannt, später mit
"SELENE": Selene (griechische Mythologie, bei den Römern Luna), die Göttin des Mondes, nach Hesiod Tochter des Hyperion und der Theia, Schwester des Helios und der Eos, auch Phoibe genannt, später mit
Die verschiedenen Schlüsse des "Iwein" - Präzedenzfall für den unfesten Text des Mittelalters
 Germanistik H. Filla Die verschiedenen Schlüsse des "Iwein" - Präzedenzfall für den unfesten Text des Mittelalters Eine exemplarische Untersuchung poetischer Konzepte anhand der Handschriften A, B und
Germanistik H. Filla Die verschiedenen Schlüsse des "Iwein" - Präzedenzfall für den unfesten Text des Mittelalters Eine exemplarische Untersuchung poetischer Konzepte anhand der Handschriften A, B und
Gedanken zur Jahreslosung 2013 zur Erarbeitung von Andachten für Mitarbeiter und Teilnehmer
 Gedanken zur Jahreslosung 2013 zur Erarbeitung von Andachten für Mitarbeiter und Teilnehmer Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen
Gedanken zur Jahreslosung 2013 zur Erarbeitung von Andachten für Mitarbeiter und Teilnehmer Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen
Der Vorabend des ersten punischen Krieges
 Geschichte Maxi Pötzsch Der Vorabend des ersten punischen Krieges Musste Rom expandieren, um sich zu schützen? Studienarbeit Inhaltsverzeichniss I. Einleitung Seite 1 II. Die Vorgeschichte des Ersten
Geschichte Maxi Pötzsch Der Vorabend des ersten punischen Krieges Musste Rom expandieren, um sich zu schützen? Studienarbeit Inhaltsverzeichniss I. Einleitung Seite 1 II. Die Vorgeschichte des Ersten
Roms Frühzeit und die frühe Republik
 Die Römische Antike Roms Frühzeit und die frühe Republik Um 800 v. Chr. Ansiedlung der Etrusker in Mittelitalien Gründung Roms bereits vor 753 v.chr. etruskische Könige bis Ende des 6. Jh. v. Chr. seit
Die Römische Antike Roms Frühzeit und die frühe Republik Um 800 v. Chr. Ansiedlung der Etrusker in Mittelitalien Gründung Roms bereits vor 753 v.chr. etruskische Könige bis Ende des 6. Jh. v. Chr. seit
Inhalt. 17 Erster Teil: Die Zeit der Götter oder Woher wir alle kommen. 117 Zweiter Teil: Die lebendige Welt oder Was um uns herum geschieht
 Inhalt 7 Einleitung 17 Erster Teil: Die Zeit der Götter oder Woher wir alle kommen 1 Unordnung und Schöpfung 18 2 Die Herrschaftszeit der Könige Re, Schu und Geb 45 3 Die Königsherrschaft des Osiris 71
Inhalt 7 Einleitung 17 Erster Teil: Die Zeit der Götter oder Woher wir alle kommen 1 Unordnung und Schöpfung 18 2 Die Herrschaftszeit der Könige Re, Schu und Geb 45 3 Die Königsherrschaft des Osiris 71
Bibelkurs Erkenne den Willen Gottes verstehe die Offenbarung Jesu Christi.
 Herzlich Willkommen! Bibelkurs Erkenne den Willen Gottes verstehe die Offenbarung Jesu Christi. ZUM VERSTÄNDNIS DER OFFENBARUNG JESU CHRISTI GEMEINDE JESU CHRISTI EINLEITUNG JANUAR 2018 1 Erkenne den Willen
Herzlich Willkommen! Bibelkurs Erkenne den Willen Gottes verstehe die Offenbarung Jesu Christi. ZUM VERSTÄNDNIS DER OFFENBARUNG JESU CHRISTI GEMEINDE JESU CHRISTI EINLEITUNG JANUAR 2018 1 Erkenne den Willen
Unterrichtseinheit Wie veränderte sich das Leben in der Steinzeit und wie erfahren wir davon?
 Fach/Jahrgang: Geschichte / Jg.6 (1) Unterrichtseinheit Wie veränderte sich das Leben in der Steinzeit und wie erfahren wir davon? 1. Analysekompetenz: Die L. können anhand formaler Merkmale verschiedene
Fach/Jahrgang: Geschichte / Jg.6 (1) Unterrichtseinheit Wie veränderte sich das Leben in der Steinzeit und wie erfahren wir davon? 1. Analysekompetenz: Die L. können anhand formaler Merkmale verschiedene
"JUNGFRAU - MUTTER - GÖTTIN":
 "JUNGFRAU - MUTTER - GÖTTIN": Uhlig weiter: 60: Wir wissen nicht, wie sich der Mensch des späten Paläolithikums, -ein Mensch, dem wir "die älteste Formensprache und auch die erste Selbstdarstellung" 1
"JUNGFRAU - MUTTER - GÖTTIN": Uhlig weiter: 60: Wir wissen nicht, wie sich der Mensch des späten Paläolithikums, -ein Mensch, dem wir "die älteste Formensprache und auch die erste Selbstdarstellung" 1
Buchwissenschaftliche Beiträge
 Buchwissenschaftliche Beiträge Herausgegeben von Christine Haug, Vincent Kaufmann und Wolfgang Schmitz Begründet von Ludwig Delp Band 83 Harrassowitz Verlag. Wiesbaden. 2012 Harald Weiß Der Flug der Biene
Buchwissenschaftliche Beiträge Herausgegeben von Christine Haug, Vincent Kaufmann und Wolfgang Schmitz Begründet von Ludwig Delp Band 83 Harrassowitz Verlag. Wiesbaden. 2012 Harald Weiß Der Flug der Biene
