Programm Psychologie FSU Jena
|
|
|
- Kajetan Mann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Programm 2007 Psychologie FSU Jena Foyer, EAP
2
3 Inhaltsverzeichnis Gruppe 1 Warum Physikstudenten sich gegenseitig für Mädchen halten Cross-modale Adaptationseffekte bei der Wahrnehmung des Geschlechts von Gesichtern...6 Lars Buder, Michaela Litzmann, Kristin Eisengräber-Pabst, Nida ul Habib Bajwa Gruppe 2 Wir sind alle so wie ich und deshalb sind wir alle gleich...8 Michael Becker, Simone Becker, Anne Hoffmann, Cornelia Just, Mareike Scholze-Starke Gruppe 3 Langzeiteffekte bei Blickrichtungsadaptation...10 Jessika Golle, Julia Gorschewski, Helen Helms, Moritz Nickel, Maren Patzwahl, Stephanie Trost Gruppe 4 "Gemeinsam sind wir stark!" - Effekte von Kontiguität und Reihenfolge bei cross-modaler evaluativer Konditionierung...12 Franziska Hecht, Sebastian Langer, Marie-Ann Milde, Simon Pabst, Christiane Tuch Gruppe 5 Angst macht Blind: Mortalitätssalienz reduziert die soziale Distanz zu Vertretern rechtsextremer Weltanschauungen...14 K. Albrecht, C. Lechner, A. Mock, M. Niehaus, M. Schwarz, P. Zak Gruppe 6 Anleitung zum (Un)glücklich sein...16 M. Brenker, D. Cremerius, M. Jung, S. Kuchinke, R. Müller, A.-K. Schubert Gruppe 7 Neuronale Grundlagen der Fehlerentdeckung...18 Sina Braune, Uta Kappauf, Sabrina Maichrowitz, Stefanie Müller,Caroline Roeser, Andreas Sauer, Lisa Schulz, Christin Schulze, Mario ten Venne, Lisa Wallner Gruppe 8 Zielunabhängigkeit von Erregungs-Valenzinteraktionen bei der Verhaltenssteuerung...20 Sarah Ohnesorge, Nicole Baus, Anica Spatz, Pelle Bernhold, Dave Cromm Gruppe 9 Umgang mit Terrorismus. Einsam oder gemeinsam? Effekte von Bedrohung auf Maße sozialer Distanz...22 Julia Barth, Ilka Fritsche, Elena Landeck, Manuela Richter, Sebastian Schulz 3
4 Gruppe 10 America vs. Germany Bush vs. Merkel: EKP Hinweise für kategoriales Priming von Personen anhand von Nationalität...24 Stefanie Beyermann, Verena Blasczyk, Laura Menger, Sabrina Rath, Teresa Voigt Gruppe 11 Warum sollte man wissen, dass Angela Merkel Politikerin ist? Semantisches Priming von Personennamen...26 Katharina Bachmeier, Lisa Bayerle, Dorit Grundmann, Susanne Markert, Antonia-Sophia Scholz Gruppe 12 Wir sind alle gleich und deshalb sind wir so wie ich...28 Diana Kurze, Franziska Stöhr, Claudia Thoß, Katharina Voigt Gruppe 13 Gute Stimmung, schlechte Stimmung: Hat sie einen Einfluss auf kognitive Kontrollprozesse...30 Sven Kachel, Elena Partschefeld, Stefanie Schneider, Robert Wegner, Christian Zeeh Gruppe 14 Jugendliche auf dem Weg zur ersten Partnerschaft Prädiktoren für romantische Beziehungen...32 Monique Krieg, Janine Müller, Nicole Osburg, Annemarie Rhode, Julia Schubert Gruppe 15 Die Uhr hat mich so angelacht Valenzimpulse auf Käuferentscheidungen...34 Annika Huhn, Claudia Recksiedler, Stefanie Schmidt, Christiane Schütz, Kerstin Seifert Gruppe 16 Ein Hirn voller Zerrbilder? Karikaturen & Gesichtererkennung...36 C. Casper, J. Görnandt, I. Hentrich, A. Kurt, L. Merkel, C. Müller, M. Pfisterer, S. Schwager, D. Schwartze, L. Walther Gruppe 17 Web Testing - On Line With Lab-Research? Factors Influencing Credibility Of Online Ability Tests...38 Franziska Lemke, Kerstin Lieder, Franka Martin, Jonas Müller, Sabine Schmidt Gruppe 18 Validierung eines Stufenmodells zur Entwicklung von Partnerschaften im Jugendalter...40 Antonia Böhm, Antje Bursian, Adriane Grolla, Josephine Otto und Nils Schönfeld 4
5 Kurzberichte der Empiriepraktikumsgruppen 5
6 Gruppe 1 Warum Physikstudenten sich gegenseitig für Mädchen halten Cross-modale Adaptationseffekte bei der Wahrnehmung des Geschlechts von Gesichtern Lars Buder, Michaela Litzmann, Kristin Eisengräber-Pabst und Nida ul Habib Bajwa 1. Einleitung Leitung: Prof. Dr. Stefan Schweinberger und Dipl.-Psych Nadine Kloth Visuelle Adaptation beschreibt die Anpassung des visuellen Systems an die wiederholte Präsentation einer Reizkonfiguration. Als neuronalen Mechanismus vermutet man eine selektive Verminderung der Sensitivität für wiederholt dargebotene Reizqualitäten. Unsere Wahrnehmung beruht folglich nicht auf einem absoluten Maß, sondern wird von vorangehenden Reizen systematisch beeinflusst, was sich in Nacheffekten äußert. So verändert z.b. die wiederholte Präsentation von männlichen Gesichtern das wahrgenommene Geschlecht eines androgynen Gesichts hin zum Weiblichen. Kovács et al. (2006) verglichen die Ereigniskorrelierten Potentiale (EKPs) der Wahrnehmung von Gesichtern uneindeutigen Geschlechts, die entweder nach einem weiblichen Gesicht als Adaptationsstimulus oder nach einem unidentifizierbaren Kontrollstimulus (fourierphasenrandomisierte Version des Gesichts) präsentiert wurden. Sie zeigten, dass sich die N170 auf Testgesichter in der weiblichen Adaptationsbedingung durch eine größere Latenz und kleinere Amplitude auszeichnete als in der Kontrollbedingung. Die Autoren deuteten dies als neuronales Korrelat der Adaptation auf das Merkmal Geschlecht. In der o.g. Studie wurde nur in der Adaptationsbedingung, nicht jedoch in der Kontrollbedingung eine Gesichtskonfiguration vor dem Teststimulus präsentiert. Somit kann als Ursache für die Auswirkungen auf die N170 die Adaptation eines allgemeinen Gesichtsdetektionsmechanismus unabhängig vom Merkmal Geschlecht nicht ausgeschlossen werden. Durch die Wahl eines androgynen (geschlechtsneutralen) Gesichtes als Adaptionsstimulus in der Kontrollbedingung wurde in der vorliegenden Studie versucht dieses Ungleichgewicht zu beseitigen und zu prüfen, ob die gefundenen Unterschiede in der N170 tatsächlich ein Korrelat der Geschlechtsadaptation darstellen. Ein weiterer Punkt ist die Frage der Existenz einer zentralen oder einer modalitätsspezifischen Verarbeitung des Merkmals Geschlecht. Durch Präsentation akustischer Adaptoren (weibliche vs. androgyne Stimme) und visueller Targets soll die Existenz crossmodaler Adaptationseffekte geprüft werden. 2. Methode Wir untersuchten die Daten von 16 Studenten der Universität Jena (M = 23,3 Jahre, 13 weiblich). Eine Teilnehmerin war beidhändig, alle anderen Probanden waren rechtshändig. Als visuelle Reize wurden aus 4 Paaren eines männlichen und weiblichen Bildes mittels eines Morph-Algorithmus männliche (98% männlicher Anteil) und androgyne (50% männlicher Anteil) Adaptoren und Teststimuli (jeweils 20%, 40%, 60% und 80% weiblicher Anteil) generiert. Die akustischen Reize wurden in ähnlicher Weise erstellt: Ausgehend von 4 Stimmenpaaren (männlich und weiblich), wurden männliche bzw. androgyne Adaptoren generiert. Das EEG der Probanden wurde an 32 Kanälen erhoben. In jedem Durchgang wurde zunächst der Adaptationsstimulus für 3544 ms dargeboten, gefolgt von einem Fragezeichen (800 ms), das den Teststimulus (200 ms) ankündigte. Dieser sollte mittels Tastendruck gemäß seinem Geschlecht klassifiziert werden. Jede Versuchsperson durchlief vier Adaptationsbedingungen: Zur Untersuchung unimodaler Adaptationseffekte verwendeten wir einerseits männliche und in einer weiteren 6
7 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Adaptationsbedingung androgyne Gesichter als Adaptationsstimuli. Die Existenz crossmodaler Effekte untersuchten wir mit männlichen bzw. androgynen Stimmen als Adaptationsstimuli. Um Reihenfolge-Effekte auszuschließen wurden diese vier Adaptationsbedingungen in ihrer Abfolge über die Versuchspersonen ausbalanciert. 3. Ergebnisse Zum Prüfen der Hypothesen führten wir eine 2x2x4-ANOVA mit Messwiederholungen mit den Faktoren Modalität des Adaptationsstimulus (Gesicht, Stimme), Geschlecht des Adaptationsstimulus (androgyn, männlich) und Morphlevel des Teststimulus (20,40,60,80% weiblicher Anteil) durch. Der signifikante Haupteffekt von Morphlevel (F(3, 45) = , p <.001) resultiert aus der Abnahme männlicher Klassifikationen mit zunehmendem weiblichen Anteil in den Teststimuli. Nach einem männlichen (relativ zu einem androgynen) Adaptationsstimulus wurden Teststimuli des Morphlevels 60 seltener als männlich klassifiziert (M = 42,62 % vs. 49,05 %; Interaktion zwischen Geschlecht des Adaptors und Morphlevel, F(3, 45) = 3.96, p <.05). Interessanterweise zeigten sich keine Interaktionen zwischen Modalität und Geschlecht des Adaptors, (Fs < 1.4, ps >.20). Demzufolge waren die gefundenen Adaptationseffekte für die unimodale wie für die crossmodale Bedingung ähnlich stark ausgeprägt. Bei der visuellen Inspektion der EKPs zeigten sich innerhalb der unimodalen wie in der crossmodalen Bedingung keine Unterschiede in der Amplitude der N170 zwischen den androgynen und den männlichen Adaptationsbedingungen. Ein Vergleich der EKPs nach Modalität des Adaptationsstimulus hingegen zeigte, dass die N170 nach Adaptation auf ein Gesicht eine deutlich geringere Amplitude aufwies als nach Adaptation auf eine Stimme. Diese Ergebnisse wurden durch die statistische Analyse der Amplituden der N170 ( ms) in den verschiedenen Bedingungen bestätigt. Eine ANOVA mit den Faktoren Hemisphäre (links, rechts), Modalität des Adaptationsstimulus (Gesicht, Stimme) und Geschlecht des Adaptationsstimulus (androgyn, männlich) an den Elektroden P7 und P8 ergab einen signifikanten Haupteffekt für Hemisphäre (F[1,11] = 6,955, p <.05]. Des weiteren fanden wir einen Haupteffekt für Modalität (F[1,11] = 28,106, p <.001] und eine signifikante Interaktion Hemisphäre x Modalität (F[1,11] = 13,241, p <.01]. Post-hoc t-tests ergaben, dass diese Interaktion sich dadurch ergibt, dass nur über der rechten Hemisphäre (Elektrode P8), nicht aber über der linken Hemisphäre (Elektrode P7) Teststimuli in den Gesichts-Adaptationsbedingungen eine signifikant niedrigere Amplitude evozieren als in den Stimmen-Adaptationsbedingungen. 4. Diskussion Unsere behavioralen Ergebnisse replizieren die Befunde von Kovács et al. (2006), zeigen darüber hinaus aber erstmals die Existenz cross-modaler Adaptationseffekte in der Wahrnehmung des Geschlechts von Gesichtern. Die Interpretation von Kovács et al. (2006), nach der die Reduktion der N170 eine spezifische Adaptation der Geschlechtswahrnehmung reflektiert, konnte nicht bestätigt werden. Die vorliegenden Ergebnisse sprechen vielmehr dafür, dass die Reduktion der N170 eine Adaptation eines generellen Gesichter-Detektionsmechanismus reflektiert. 5. Literatur Kovacs, G., Zimmer, M.,Banko, E., Harza, I., Antal, A. & Vidnyanszky, Z. (2006), Electrophysiological Correlates of Visual Adaptation to Faces and Body Parts in Humans, Cerebral Cortex, 16,
8 Gruppe 2 Wir sind alle so wie ich und deshalb sind wir alle gleich Michael Becker, Simone Becker, Anne Hoffmann, Cornelia Just, Mareike Scholze Starke 1. Einleitung Leitung: Dr. Maya Machunsky Unter sozialer Projektion versteht man, dass Eigenschaften, Einstellungen und Verhaltenspräferenzen der eigenen Person auf Mitglieder der Eigengruppe übertragen werden (Krueger, Acevedo, Robbins, 2005). Dieser Prozess findet jedoch nicht bei der Fremdgruppe statt. Da positive Eigenschaften der eigenen Person auf die Eigengruppe, jedoch nicht auf die Fremdgruppe projiziert werden, ergibt sich eine bessere Bewertung der Eigengruppe im Vergleich zur Fremdgruppe. Durch das Übertragen der individuellen Eigenschaften auf die Gruppe, verringert sich die wahrgenommene Distanz zwischen dem Selbst und der Eigengruppe. Diese Differenz dient als Prädiktor für die wahrgenommene Variabilität der Eigengruppe. Es ergibt sich der Effekt, dass die Eigengruppe homogener erscheint, je mehr projiziert wird (Park & Judd, 1990). Gärtner und Schopler (1998) konnten einen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Variabilität und Eigengruppenbevorzugung nachweisen. Dies führt zu der Annahme, die Verbindung zwischen der wahrgenommenen Variabilität und der Eigengruppenbevorzugung auf soziale Projektion zurückzuführen. Zudem sollen die bisherigen korrelativen Zusammenhänge mit einer kausalen Richtung belegt werden, in der das Ausmaß an sozialer Projektion als Ursache der homogeneren Eigengruppenwahrnehmung und der Eigengruppenbevorzugung gilt. Somit ergeben sich die folgenden Hypothesen: a) Soziale Projektion beeinflusst die Vorhersage wahrgenommener Variabilität. Das bedeutet: Mit zunehmender Projektion wird die Eigengruppe homogener wahrgenommen. b) Soziale Projektion beeinflusst das Ausmaß an Eigengruppenbevorzugung. Das bedeutet: Je mehr man projiziert, desto stärker wird die Eigengruppe bevorzugt. 2. Methode An dem Computerexperiment nahmen 60 Versuchspersonen teil. Wir verfolgten ein einfaktorielles Design mit drei Bedingungen, wobei soziale Projektion jeweils in einer Zeitdruck-, Akkuratheitsund Kontrollbedingung als unabhängige Variable galt. In der Akkuratheitsbedingung bzw. in der Zeitdruckbedingung bestand die Aussicht auf den Gewinn von Essensgutscheinen, wenn die Probanden besonders akkurat bzw. schnell antworten würden. Zunächst wurden alle Teilnehmer gebeten, sich auf zehn positiven und zehn negativen Items selbst einzuschätzen. Anschließend erfolgte ein minimales Gruppenparadigma, in dem den Probanden suggeriert wurde, dass sie auf Basis ihres Punktwertes in einem Aufmerksamkeitstest einer von zwei distinkten Gruppen zugeteilt wurden. Dann sollten die Versuchspersonen die durch das minimale Gruppenparadigma erhaltene Eigen- und Fremdgruppe auf den gleichen Items bewerten. Dabei wurde nach dem typischen Gruppenmitglied (Mittelwert) und nach den extremsten Gruppenmitgliedern (Spannweite) gefragt. Anschließend erfolgte eine Erhebung der Eigengruppenbevorzugung auf semantischer und behavioraler Ebene. Abschließend wurden einige Fragen zum Manipulationscheck beantwortet. Das Ausmaß der Eigengruppenfavorisierung und die wahrgenommenen Gruppenvariabilitäten stellten unsere abhängigen Variablen dar. Soziale Projektion wurde als intraindividuelle Korrelation zwischen Selbst und Eigengruppe gemessen. 8
9 3. Ergebnisse 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Zunächst erfolgten Berechnungen zu den Mittelwertsunterschieden zwischen Eigen- und Fremdgruppe. Es zeigte sich, dass auf die Eigengruppe signifikant mehr soziale Projektion stattfindet als auf die Fremdgruppe, F(1,51) = 7,529, p =.008, η² =.129. Außerdem wird je nach experimenteller Bedingung unterschiedlich stark projiziert. Paarweise Vergleiche zeigten, dass sich das Ausmaß an sozialer Projektion auf die Eigengruppe/ Fremdgruppe vor allem in der Akkuratheitsbedingung unterscheidet, F(1,51) = 14,288, p =.000, η² =.219. Bei der Berechnung zur subjektiven Einschätzung der Gruppenhomogenität ergab sich, dass die Eigengruppe signifikant homogener wahrgenommen wird, F(1,57) = 9,922, p =.003, η² =.148. Jedoch gab es keinen Einfluss der experimentellen Bedingung. Abschließend betrachteten wir die Eigengruppenbevorzugung. Die Eigengruppe wurde signifikant besser bewertet als die Fremdgruppe, F(1,57) = 7.995, p =.000, η² =.219. Anschließend standen korrelative Betrachtungen im Mittelpunkt. Zunächst wurde eine Korrelation zwischen der wahrgenommenen Gruppenvariabilität und der sozialen Projektion berechnet. Es zeigte sich, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen beiden gibt, r(1) = -.586, p =.000. Weiterhin fanden wir eine signifikante Korrelation von sozialer Projektion und Eigengruppenbevorzugung, r(1) =.440, p =.001. Außerdem fanden wir den erwarteten Zusammenhang von wahrgenommener Gruppenvariabilität und Eigengruppenbevorzugung, r(1) = -.295, p =.027. Dieser Effekt verschwindet, wenn man die Korrelation für soziale Projektion kontrolliert, r(1) = -.163, p =.259 (n.s.). 4. Diskussion Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit replizieren Effekte bisheriger Untersuchungen zur sozialen Projektion. So konnten die korrelativen Zusammenhänge zwischen sozialer Projektion und Eigengruppenbevorzugung sowie zwischen wahrgenommener Gruppenvariabilitätseinschätzung und der Eigengruppenbevorzugung belegt werden. Darüber hinaus konnte die zuletzt genannte Verbindung auf soziale Projektion zurückgeführt werden. Da dies aber nicht für alle erhobenen Maße bestätigt werden konnte, wäre eine Überlegung nach weiteren Mediatorvariablen angemessen. Die gefundenen Zusammenhänge lassen sich jedoch nicht kausal auf soziale Projektion zurückführen, da die experimentelle Manipulation soziale Projektion nicht in der erwarteten Weise beeinflusste. Entgegen unserer Erwartung zeigte sich, dass die Probanden in der Akkuratheitsbedingung mehr projizierten als in der Zeitdruckbedingung. Dies steht im Gegensatz zu den gefundenen Effekten von Epley et al. (2004). Anscheinend achteten die Probanden der Akkuratheitsbedingung aufgrund ihrer experimentellen Aufforderung besonders darauf, was als mögliche Basis der Gruppeneinschätzung dienen könnte. Zusätzlich konnte ein korrelativer Zusammenhang zwischen sozialer Projektion und wahrgenommener Gruppenvariabilität gefunden werden. Damit konnten die Ergebnisse unserer Untersuchung zur sozialen Projektion aus dem Wintersemester bestätigt werden. 5. Literatur Epley, N., Keysar, B., van Boven, L., & Gilovich, T. (2004). Perspective Taking as Egocentric Anchoring and Adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 87, Gaertner, L., Schopler, J. (1998). Perceived ingroup entitativity and ingroup bias: an interconnection of self and others. European Journal of Social Psychology, 28, Krueger, J. I., Acevedo, M., & Robbins, J. M. (2005). Self as sample. In K. Fiedler & P. Juslin (Eds.), Information sampling and adaptive cognition (pp ). Cambridge, UK: University Press. Park, B., & Judd, C. M. (1990). Measures and models of perceived group variability. Journal of Personality and Social Psychology, 59,
10 Gruppe 3 Langzeiteffekte bei Blickrichtungsadaptation Jessika Golle, Julia Gorschewski, Helen Helms, Moritz Nickel, Maren Patzwahl, Stephanie Trost 1. Einleitung Leitung: Prof. Dr. Stefan Schweinberger, Dipl.-Psych. Nadine Kloth Visuelle Adaptation wird als Anpassungsleistung des visuellen Systems hinsichtlich verschiedener Reizqualitäten (Farbe, Helligkeit, Orientierung etc.) definiert. Als Folge dessen zeigt sich eine Tendenz zur gegenteiligen Wahrnehmung. In der aktuellen Forschung werden Adaptationseffekte beschrieben, die visuelle Adaptation auf komplexe Stimuli beinhalten und auf höherer kognitiver Ebene kodiert werden (Leopold, O Toole, Vetter & Blanz, 2001; Jorden, Fallah & Stoner, 2006). Besonders im Bereich der Gesichterwahrnehmung werden diese visuellen Effekte beobachtet (Löffler, Yourganova, Wilkinson & Wilson, 2005). Für die vorliegende Untersuchung sind die Ergebnisse der Adaptation auf die Blickrichtung besonders relevant. Jenkins, Beaver & Calder (2006) konnten zeigen, dass die Adaptation auf eine Blickrichtung zur Folge hat, dass ein Teststimulus derselben Blickrichtung eher als geradeaus blickend eingeschätzt wird. Bei einer ähnlichen Studie von Schweinberger, Kloth & Jenkins (2007) zur Blickrichtungsadaptation wurden die Effekte von Adaptation auf einen linksgerichteten und einen rechtsgerichteten Blick in aufeinander folgenden Blöcken untersucht. Beim Wechsel der Adaptationsbedingungen ergaben sich Hinweise auf Langzeitadaptationseffekte. Die aktuelle Studie widmet sich daher der Frage des Zeitverlaufs der Blickrichtungsadaptation: Sind auch noch Minuten nach der Adaptation Effekte auf die Wahrnehmung der Blickrichtung zu beobachten? 2. Methode a) Experiment I: Wir untersuchten 25 Studenten der Friedrich-Schiller-Universität (3 männlich) in einem Verhaltensexperiment bestehend aus 7 Blöcken. Die einzelnen Experimentalblöcke waren durch klar definierte Pausen von jeweils 30s voneinander getrennt. Die Aufgabe der Versuchspersonen war, die Blickrichtung der auf einem Bildschirm präsentierten Gesichter mittels Tastendruck (rechts, links, geradeaus) zu bewerten. Wir verwendeten 12 unterschiedliche Gesichter als Stimuli, wobei die Adaptationsstimuli eine Blickrichtung von 25 nach rechts und die Teststimuli eine Orientierung von 5 nach rechts, 5 nach links und geradeaus aufwiesen. In der Prä-Adaptations-Phase (127s) wurde die Basisrate erhoben. Hierfür sollten die Versuchspersonen 36 Teststimuli bezüglich ihrer Blickrichtung einschätzen. Danach schloss sich die Adaptationsphase (89s) an, in der die Probanden die Adaptationsstimuli intensiv betrachten sollten, die insgesamt zweimal präsentiert wurden. Ohne Unterbrechung folgte die erste postadaptive Phase (368s), in der jedes dritte Gesicht einen zu bewertenden Teststimulus darstellte. Die anderen beiden Gesichter waren Top-Ups (Adaptationsstimuli). Diese Phase wurde bei der Berechnung der Gesamtdauer des Langzeiteffekts nicht berücksichtigt. Die restlichen postadaptiven Phasen (jeweils 107s) unterschieden sich in ihrem Aufbau nicht voneinander. In jedem der Blöcke sollte auf 36 präsentierte Teststimuli reagiert werden. b) Experiment II: Aufbau, zeitlicher Verlauf und Probandenzahl entsprechen denen von Experiment I. Es wurde sichergestellt, dass keiner der Probanden auch an Experiment 1 teilgenommen hatte. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Blickrichtung der Teststimuli jeweils 10 betrug. 10
11 3. Ergebnisse 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress a) Experiment I: Die relative Häufigkeit für die Geradeaus -Antworten stieg nach der Adaptationsphase und näherte sich später der Basisrate wieder an (M PostA01 = 59.17%, M PostA02 = 53.21%, M PostA03 = 52.55%, M PostA04 = 49.04%, M PostA05 = 47.90%, M Basisrate = 43.32%). Es wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholungen (ANOVA) mit den Faktoren Adaptationsphase und Teststimulus (rechts, links, geradeaus) durchgeführt. Sie ergab einen signifikanten Haupteffekt der Adaptationsphase (F(5, 120) = 11.4, p <.001) und des Teststimulus (F(2, 48) = 93.9, p <.001). Der Interaktionsterm wurde ebenfalls signifikant (F(10, 240) = 32.45, p <.001). Post-hoc durchgeführte t-tests für abhängige Stichproben zeigten signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den Geradeaus -Antworten der Basisrate und denen der ersten drei postadaptiven Phasen auf den nach rechts blickenden Teststimulus (t(24) = -11.9, p <.001; t(24) = -6.96, p <.001; t(24) = -4.10, p <.001). b) Experiment II: Eine Varianzanalyse mit Messwiederholungen mit denselben Faktoren wie für Experiment 1(s. oben) zeigte einen signifikanten Haupteffekt der Adaptationsphase (F(5, 120) = 74.95, p<.001) und des Teststimulus (F(2, 48) = , p<.001), sowie eine signifikante Interaktion beider Faktoren (F(10, 240) = 69.62, p<.001). In den postadaptiven Phasen 01 und 02 waren die Antwortraten der Geradeaus-Antworten auf Teststimuli mit Blickrichtung nach rechts (10 ) erhöht. (t(24) = -19,18, p <.001; t(24) = -3,21, p <.001). 4. Diskussion Die Hypothese von bestehenden Langzeiteffekten bei Adaptation auf eine bestimmte Blickrichtung konnte bestätigt werden. Dieser Effekt hielt mehrere Minuten an (in Experiment I (5 ) bis in die sechste Minute und in Experiment II (10 ) bis in die dritte Minute). Die geringere Dauer des Effekts in der zweiten Untersuchung könnte darauf zurückzuführen sein, dass hier die Blickrichtung der Teststimuli eindeutiger war. Somit konnten wir die Ergebnisse der Studie von Jenkins et al (2006) bestätigen und um den Nachweis von Langzeitadaptationseffekten erweitern. Außerdem ist es ein weiterer Beleg dafür, dass es Parallelen zwischen den Charakteristika von Adaptationsprozessen auf frühen und späteren Stufen der visuellen Wahrnehmung gibt. 5. Literatur Jenkins, R., Beaver, J.D. & Calder, A.J. (2006). I Thought You Were Looking at Me: Direction-Specific Aftereffects in Gaze Perception. Psychological Science, 6,, Jorden, H., Fallah, M. & Stoner, G.R. (2006). Adaptation of gender derived from biological motion. Nature Neuroscience, 9, Kovács, G., Zimmer, M., Bankó, È., Harza, I., Antal, A.& Vidnyánszky, Z. (2006). Electrophysiological Correlates of Visual Adaptation to Faces and Body Parts in Humans. Cerebral Cortex, Leopold, D.A., O Toole, A.J., Vetter & Blanz, V. (2001). Prototype-referenced shape encoding revealed by high-level aftereffects. Nature Neuroscience, 4, Löffler, G., Yourganov, G., Wilkinson, F., & Wilson H.R. (2005). fmri evidence for the neural representations of faces. Nature Neuroscience, 8, Schweinberger, S.R., Kloth, N. & Jenkins, R.(2007). Are you looking at me? Neural correlates of gaze adaptation. NeuroReport, 18,
12 Gruppe 4 "Gemeinsam sind wir stark!" - Effekte von Kontiguität und Reihenfolge bei cross-modaler evaluativer Konditionierung Franziska Hecht, Sebastian Langer, Marie-Ann Milde, Simon Pabst, Christiane Tuch 1. Einleitung Leitung: Dipl. Psych. Anne Gast Evaluative Konditionierung (EC) ist die Übertragung der positiven oder negativen Valenz eines unkonditionierten Stimulus (US) auf einen neutralen Stimulus (CS), durch deren gemeinsame wiederholte Paarung. US und CS können gleichzeitig oder nacheinander präsentiert werden. Wird der CS vor dem US gezeigt spricht man von einer vorwärts gerichteten EC, bei umgekehrter Reihenfolge von einer rückwärts gerichteten Konditionierung. In dieser Studie untersuchen wir die Effekte der Reihenfolge von CS und US. Geht man von dem Modell aus, welches ausdrückt, dass die EC eine Unterform der Klassischen Konditionierung (PC) darstellt, so sollten sich nur Effekte in der vorwärts gerichteten Bedingung finden lassen. Untersuchungen von Stuart (1987) sowie Hammerl und Grabitz (1993) ergaben, dass eine vorwärts gerichtete Präsentation die größten Effekte erzielt. Dieses Ergebnis ist inkonsistent mit der Annahme, dass die Kontiguität (zeitliche Nähe) der ausschlaggebende Faktor für die EC ist (De Houwer et al., 2001). Darauf basierend ist davon auszugehen, dass die Reihenfolge der Stimuli für einen Konditionierungserfolg keine bedeutende Rolle einnimmt und die stärkste Valenzänderung auftritt, wenn die Stimuli gleichzeitig präsentiert werden. Vorwärts und rückwärts gerichtete EC sollten sich danach nicht unterscheiden. In unserer Untersuchung im Wintersemester deutete sich der Effekt der Kontiguität an, wurde jedoch aufgrund eines schwachen Effektes in der Simultanpräsentation nicht völlig eindeutig. Die gleichzeitige Präsentation zweier visueller Stimuli könnte zur Folge gehabt haben, dass beiden Stimuli nicht gleich viel Aufmerksamkeit zukam, somit eine schwächere Assoziation stattfand und dadurch ein schwächerer EC-Effekt in der Simultanbedingung auftrat. Durch die Verwendung verschiedener Modalitäten von CS und US könnte diese Problematik kontrolliert werden. Diese Interpretation beruht auf dem Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley, nach welchem ikonische und echoische Reize getrennt voneinander verarbeitet werden. Dass cross-modale EC erfolgreich funktioniert, konnte bereits in Experimenten von Van Reekum et al. (1999) gezeigt werden. Davon ausgehend wurden in der vorliegenden Studie Reihenfolgeeffekte bei modalitätsübergreifender Stimuluspräsentation untersucht, unter der Annahme die größten Auswirkungen von EC in der simultanen Bedingung zu finden. 2. Methode An der Studie nahmen 127 Männer und Frauen teil. Davon gingen 14 Versuchspersonen (VPn) aufgrund der Anforderungen des experimentellen Designs nicht in die Auswertung mit ein. Die verwendete Stichprobe beinhaltete 113 VPn zwischen 19 und 66 Jahren, im Mittel 23,96 Jahren. Für das E-Prime gestützte Computerexperiment wurden als US positive und negative gesprochene Wörter aus einer vorbewerteten Liste (Aussprache der Wörter war neutral) sowie angenehme und unangenehme Töne verwendet. Aus 56 durch die VPn bewerteten Kleidungsstücken gingen acht neutral bewertete Stimuli als CS hervor. Dafür wurden zunächst in einem Überblicksdurchgang alle Stimuli vorgestellt und danach vorbewertet. Zur Bewertung der subjektiven Valenz stand eine Skala von +9 bis -9 (neutral +2 bis -2) zur Verfügung. Die auditiven US wurden zusammen mit den visuellen CS fünfmalig in Konditionierungsdurchgängen gepaart. Aus der Variation von Tönen und Wörtern sowie der Reihenfolge ergaben sich sechs Gruppen. Um die Valenzänderung zu berechnen, wurden jeweils für die positiven und negativen CS die Differenzen aus Post- und Präbewertung gebildet. Der Unterschied zwischen positiven und negativen Valenzänderungen repräsentiert den EC-Effekt und dient als abhängige Variable. 12
13 3. Ergebnisse 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Eine Messwiederholungs-ANOVA mit den Zwischensubjektfaktoren Reihenfolge und Wort-Ton- Variation sowie dem Innersubjektfaktor Valenz ergab, dass sich die gesamte Stichprobe signifikant von Null unterscheidet (F(1) = 58.26, p <.000, η² = 0.353). Weiterhin wurde ein Effekt für die Art der Stimuli (Wort oder Ton) gefunden (F(1) = , p <.001, η² = 0.105). Eine Testung der EC- Effekte gegen Null in den sechs einzelnen Gruppen ergab, dass vorwärts und rückwärts gerichtete EC in der Wörtergruppe keinen Effekt hatten, in allen anderen Bedingungen ergeben sich bedeutende Valenzänderungen. Für die Reihenfolge wurde kein signifikantes Ergebnis ermittelt (F(2) = 2.297, p <.106, η² = 0.041). Mittels einer Kontrastanalyse wurden vorwärts und rückwärts gerichtete EC verglichen, welche nicht signifikant unterschiedlich waren (t(110) = 0.51, p <.959). Bei der simultanen Präsentation kam es verglichen mit vorwärts und rückwärts gerichteter EC zu einem signifikant unterschiedlichen, größeren EC-Effekt (t(110) = 1.936, p <.028, einseitiger Test gemäß gerichteter Hypothese). 4. Diskussion Der generelle Befund, dass auch bei cross-modalen Stimuli eine Valenzübertragung möglich ist, unterstützt die bisherige Evidenz in diesem Gebiet. Auf der Grundlage des gefundenen Haupteffektes bezüglich der Materialart der US kann weiterhin geschlussfolgert werden, dass es hierbei Unterschiede bezüglich der Konditionierbarkeit nach der Qualität der akustischen Stimuli gibt. Die Töne haben generell bessere Effekte geliefert als die Wörter. Dies könnte auf unterschiedlich starke Valenzen zurückgeführt werden, das heißt die Töne wurden subjektiv valenter wahrgenommen. Schwächere Einschätzungen der Wörter könnten dadurch zustande kommen, dass diese sich über ihre Bedeutung erschließen. Damit geht eine aufwändigere kognitive Verarbeitung einher, was eine schwächere Assoziationsbildung zwischen CS und US und somit einen geringeren EC-Effekt verursachen könnte. Die Hypothese bezüglich der gleich starken Wirkung von vorwärts und rückwärts gerichteter EC konnte bestätigt werden. Der vorhergesagte stärkere EC-Effekt bei größtmöglicher zeitlicher Kontiguität in der simultanen Bedingung wurde ebenfalls bestätigt. Wenn man von EC als Unterform der PC ausgeht, dürfte dies nicht der Fall sein, da aufgrund einer Signalwirkung des CS die vorwärtsgerichtete Konditionierung den stärksten Effekt haben und in der simultanen oder rückwärts gerichteten Bedingung kein EC-Effekt auftreten sollte. Die Ergebnisse sprechen also dafür, dass bei EC ein Signallernen wie bei PC keine Rolle spielt und besonders die Kontiguität ausschlaggebend für die Stärke des EC-Effektes ist. Damit wäre ein weiterer Beleg erbracht, dass der EC und der PC unterschiedliche Prozesse zugrunde liegen. Aus dieser und unserer vorherigen Untersuchung können wir ableiten, dass EC bei simultaner Präsentation der Stimuli am besten cross-modal funktioniert und es bei unimodaler Präsentation (visueller CS und US) einen besseren EC-Effekt bei nicht-simultaner Präsentation gibt, das heißt bei vorwärts oder rückwärts gerichteter Konditionierung mit dem geringsten möglichem Zeitabstand zwischen beiden Stimuli. 5. Literatur Baddeley, A.D. (1999). Essentials of Human Memory. Hove: Psychology Press, 1999 De Houwer, J., Thomas, S. & Baeyens, F. (2001). Associative learning of likes and dislikes: A review of 25 years of research on human evaluative conditioning. Psychological Bulletin, 127, Hammerl, M. & Grabitz, H.-J. (1993). Human evaluative conditioning: Order of stimulus presentation. Integrative Physiological and Behavioral Science, 28, Van Reekum, C.M., Van den Bergh, H. & Frijda, N.H. (1999). Cross-modal preference acquisition: Evaluative Conditioning of pictures by affective olfactory and auditory cues. Cognition and Emotion, 13,
14 Gruppe 5 Angst macht Blind: Mortalitätssalienz reduziert die soziale Distanz zu Vertretern rechtsextremer Weltanschauungen 1. Einleitung K. Albrecht, C. Lechner, A. Mock, M. Niehaus, M. Schwarz, P. Zak Leitung: Dr. Immo Fritsche In unserer Studie untersuchten wir die Auswirkung der empfundenen Bedrohung durch den internationalen Terrorismus auf die soziale Distanz, die Individuen gegenüber Vertretern rechtsextremer Meinungen einnehmen und wahren. Unsere Überlegungen basieren hierbei auf der Terror Management Theory (TMT; Greenberg, Solomon & Pyszczynski, 1997). Diese beschreibt die psychologischen Auswirkungen einer Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit: Demnach löst die Einsicht in die Unabwendbarkeit des eigenen Todes intensive Furcht aus, die regelrecht paralysierend wirken kann. Nach der klassischen TMT verfügt der Mensch über zwei kognitive Mechanismen zur Bewältigung dieser Furcht: (1) Zum einen ermöglicht ihm das Vertreten der eigenen kulturellen Weltsicht eine bedeutungsvolle Konzeption der Realität und bietet ihm eine Aussicht auf Transzendenz. (2) Zum anderen fungiert der Selbstwert als Puffer gegen die Todesangst. Diesen erhöhen Menschen aktiv, indem sie die Werte und Normen ihrer Kulturgemeinschaft befolgen und verteidigen. Neuere Forschung zur TMT (Wisman & Koole, 2003) legt nahe, dass ein dritter Bewältigungsmechanismus mit physiologischer Basis existiert: (3) Die bloße Affiliation an eine Gruppe, d.h. die physische oder mentale Annäherung, vermag die Mortalitätssalienz (MS) zu reduzieren. Im Rahmen eines Szenarios, das eine terroristische Bedrohung in Deutschland beschrieb, untersuchten wir den Effekt von Mortalitätssalienz auf die Tendenz zum Anschluss an eine Gruppe, die eine konträre Weltsicht vertrat. Dazu erfassten wir den bevorzugten Sitzplatz der Versuchspersonen in einer fiktiven Gruppendiskussion. Gemäß den Annahmen der klassischen TMT müsste eine solche Gruppe als Bedrohung empfunden werden, da sie mit der eigenen Weltsicht (1) einen zentralen Angstpuffer in Frage stellt. Bereits Wisman und Koole (2003) zeigten, dass sich niederländische Versuchspersonen nach experimentell induzierter MS signifikant häufiger einer Gruppe mit konträrer Weltanschauung anschlossen. Die Gruppe in jenem Experiment vertrat eine generell intolerante Einstellung, was im Widerspruch zu dem in den Niederlanden weithin akzeptierten Wert der Toleranz steht. Dies belegt, dass das Affiliationsstreben (3) stärker sein kann als die Verteidigung der eigenen Weltsicht (1). Gestützt auf diese Ergebnisse geht unsere Untersuchung einen Schritt weiter und untersucht die Affiliation an eine Gruppe mit rechtsextremen, gesellschaftlich nicht akzeptierten Meinungen. Wir stellten folgende zentrale Hypothese auf: Nach der Induktion von Mortalitätssalienz ist der Bewältigungsmechanismus der Affiliation stärker als die Verteidigung der eigenen Weltsicht. Daher wählen Versuchspersonen, denen der eigene Tod bewusst gemacht wurde, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe häufiger einen Gruppensitzplatz als einen Einzelsitzplatz. 2. Methode An unserer Untersuchung nahmen 42 Studentinnen und 25 Studenten der Friedrich-Schiller- Universität Jena im Alter von 18 bis 64 Jahren (M=22,64 Jahre) teil. Den Probanden wurde mitgeteilt, es handele sich um eine Untersuchung zum Verhalten in Gruppendiskussionen. In Einzelkabinen bekamen sie zwei fingierte Zeitungsartikel, zu denen sie ihre Gedanken und Meinungen niederschreiben sollten. Ihnen wurde mitgeteilt, dass einer der beiden Zeitungsartikel als Gegenstand der im Anschluss stattfindenden Diskussion dienen würde. 14
15 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Tatsächlich bildetete der erste Artikel zum Fest der Völker, einer neonazistischen Großveranstaltung in Jena, die Grundlage für das spätere Framing der Teilnehmer der Diskussionsgruppe als Sympathisanten einer rechtsextremen Weltanschauung. Ein zweiter Artikel über einen angeblich sehr wahrscheinlichen Terroranschlag mit Biowaffen in Deutschland (Experimentalbedingung) diente der Induktion von Mortalitätssalienz. Probanden der Kontrollgruppe erhielten einen Artikel zum Thema falsche Zahnarztabrechungen. Nach einer Ablenkaufgabe teilte der Versuchsleiter den Teilnehmern mit, die Diskussion werde sich mit dem Fest der Völker befassen. Es wurden ihnen angeblich von den anderen Diskussionsteilnehmern verfasste Essays zum Durchlesen ausgehändigt, die deutliche Hinweise auf eine rechtsextreme Einstellung enthielten. Anschließend sollte auf einer Abbildung des späteren Diskussionsraumes der gewünschte Sitzplatz angekreuzt werden. Zur Wahl standen ein Sitzplatz in der Gruppe und ein gegenüberliegender Einzelplatz. Auch sollte auf einer Skala von 1 bis 5 der Grad der Bevorzugung des gewählten Sitzplatzes angegeben werden. 3. Ergebnisse Unsere Hypothese postulierte einen signifikanten Effekt der Mortalitätssalienz-Manipulation auf die Sitzplatzwahl. Durch Gewichtung des gewählten Sitzplatzes mit dem Grad der Präferenz für diesen Sitzplatz bildeten wir eine ordinalskalierte abhängige Variable mit Werten von 5 bis +5, wobei positive Werte eine Wahl des Einzelsitzplatzes anzeigten, negative Werte hingegen eine Wahl des Gruppensitzplatzes. Ein Mann-Whitney-Rangtest mit dieser abhängigen Variable ergab, dass Probanden aus der Experimentalgruppe mit einem mittleren Rang von R = gegenüber R = in der Kontrollgruppe signifikant stärker zur Wahl des Gruppensitzplatzes neigten (z= 2,000, p=.046). Dies bestätigt unsere Hypothese, dass Versuchspersonen, denen der eigene Tod bewusst gemacht wurde, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe häufiger einen Sitzplatz in der Gruppe als einen Einzelplatz wählen selbst, wenn die Gruppenmitglieder eine völlig konträre Weltsicht vertreten. 4. Diskussion Mit dieser Untersuchung ist uns eine konzeptuelle Replikation früherer Befunde zu Effekten von Bedrohung auf Maße sozialer Distanz gelungen. Wie auch die Ergebnisse von Wisman und Koole (2003), liefern unsere Daten Unterstützung für die Hypothese, dass es sich bei jenem Affiliationsstreben um eine eigenständige Methode zur Bewältigung von Todesangst handelt, welche stärker als die Verteidigung der eigenen Weltsicht sein kann. Diese Befunde liefern Hinweise darauf, dass die in Deutschland zunehmende Furcht vor terroristischen Angriffen (Bulmahn, 2004) zu einer schwächeren Abgrenzung gegenüber Vertretern rechtsextremer Meinungen führen, und somit indirekt sogar ein Erstarken rechtsextremer Tendenzen begünstigen könnte, wie es sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat (Bundesministerium des Innern, 2007). 5. Literatur Greenberg, J., Solomon, S., & Pyszczynski, T. (1997). Terror management theory of self-esteem and cultural worldviews: Empirical assessments and cultural refinements. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 29, pp ). San Diego, CA: Academic Press. Bulmahn, T. (2004). Unsichere Zeiten. Analysen zum Sicherheits- und Bedrohungsempfinden in Deutschland. SOWI.NEWS, 4/2004, Bundesministerium des Innern (2007). Verfassungsschutzbericht Wisman, A., & Koole, S. L. (2003). Hiding in the crowd: Can mortality salience promote affiliation with others who oppose one s worldviews? Journal of Personality and Social Psychology, 84,
16 Gruppe 6 Anleitung zum (Un)glücklich sein M. Brenker, D. Cremerius, M. Jung, S. Kuchinke, R. Müller & A.-K. Schubert 1. Einleitung Leitung: Dr. Kristin Mitte Emotionsregulation bezeichnet die bewusste oder unbewusste Beeinflussung der aktuellen Stimmung. Gross (2006) unterscheidet zwischen den Strategien Suppression (Emotionsunterdrückung) und Reappraisal (kognitive Umbewertung). Aufbauend auf den Arbeiten von Gross (vgl. Gross, 06) konnten wir im WS 06/07 an 436 Studenten zeigen, dass hohe Suppression mit einer geringeren Lebenszufriedenheit (LZF), häufiges Reappraisal mit höherer LZF zusammenhängt. Ausgehend davon war Ziel der vorliegenden Arbeit die Untersuchung der Effektivität einer Intervention, die bei den Probanden Suppression senken und Reappraisal erhöhen sollte. Hierfür wurde die Methode des Expressiven Schreibens (ES) nach Pennebaker und Beall (1986) gewählt. Durch das Aufschreiben tiefster Gedanken und Gefühle zu einem belastenden Erlebnis scheint ES effektive Regulation zu fördern. Obwohl eine Vielzahl von Studien die Effektivität von ES belegen, liegen bislang nur wenige Arbeiten vor, die differentielle Wirksamkeit sowie mögliche Mediatoren untersuchen (s. Horn & Mehl, 2004). Eine Ausnahme bildet die Studie von Gortner und Kollegen (2006). Sie konnten zeigen, dass besonders Personen, die zu Emotionsunterdrückung neigen, von dieser Methode profitieren. Allerdings ist die Interpretation der Ergebnisse aufgrund methodischer Eigenschaften der Studie schwierig. Die folgenden Hypothesen wurden überprüft: 1. ES erhöht positiven Affekt und verringert negativen Affekt und Depression. 2. ES senkt das Ausmaß von Suppression. 3. ES hat den größten Effekt bei Probanden, die Suppression in besonders hohem Maß betreiben. 2. Methode Probanden der Studie waren 39 Studenten (davon 30 Frauen) zwischen 19 und 30 Jahren (M = 21,51). Es erfolgte eine quasirandomisierte Aufteilung in eine Interventions- (BG; N=20) und eine Kontrollgruppe (KG; N=20). Alle Probanden nahmen an einer dreiwöchigen Studie mit drei Messzeitpunkten teil (T1: Prä, T2: Post, T3: Follow-Up 1 Woche später). Zu allen Messzeitpunkten erhielten sie den Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), der Suppression und Reappraisal misst. Außerdem wurde positiver sowie negativer Affekt durch die Positive and Negative Affect Scale (PANAS) erhoben. Als klinisches Maß diente die Kurzversion der Allgemeinen Depressionsskala (ADS). Alle Probanden füllten zu T1 die Fragebogenbatterie inklusive demographischer Daten aus. Zusätzlich erhielten sie die PANAS, die sie in der darauf folgenden Woche täglich ausfüllen sollten. Die BG bekam außerdem die Instruktion, jeden Abend nach dem Ausfüllen der PANAS drei emotionale Erlebnisse des Tages aufzuschreiben, wovon sie eines in Form des ES 15 Minuten lang genauer ausführen sollten. Wir orientierten uns im Instruktionswortlaut an Pennebaker (1988). Zu T2 erhielten die Probanden denselben Fragebogen per , den sie am gleichen Tag ausgefüllt zurücksandten. Schließlich wurde der Fragebogen zu T3 für die BG mit einer Einschätzung der Effektivität des ES ergänzt. 3. Ergebnisse H1 und H3 wurden gleichzeitig mit einer ANOVA (Messwiederholung) getestet, wobei als Innersubjektfaktor die Zeit (operationalisiert über die MesszeitpunkteT1, T2 und T3) und als Zwischensubjektfaktoren die Gruppenzugehörigkeit (Interventions- und Kontrollgruppe) sowie Suppression (hoch vs. niedrig) verwendet wurden. 16
17 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Für die AVs positiver Affekt (PA) und negativer Affekt (NA) wurden keine signifikanten Interaktionseffekte für Gruppenzugehörigkeit mal Zeit (F<1.5) bzw. für Gruppenzugehörigkeit, Zeit und Suppression gefunden. Für PA konnten keine Haupteffekte (HE) nachgewiesen werden. Für NA wurden zwei signifikante HE gefunden: Der HE der Gruppenzugehörigkeit wurde signifikant (F(1,31)=14.57, p<.001). Post-hoc Tests ergaben, dass die BG einen signifikant höheren NA hatte als die KG. Der HE für die Zeit wurde ebenso signifikant (F(2,62)=19.22, p<.001). Post-hoc Tests ergaben eine signifikante Abnahme des NA von T1 zu T2 und von T1 zu T3, nicht aber von T2 zu T3. Die dritte Analyse erfolgte für Depressivität. Erneut erfolgte eine ANOVA (Messwiederholung). Die Analyse zu H1 ergab dabei keine signifikante Interaktion der beiden Faktoren Zeit und Gruppe (F<2). Allerdings zeigte sich ein signifikanter HE für die Zeit (F(2,62)=6,50 p<.05). Dieser Unterschied trat von T1 zu T2 sowie von T1 zu T3 auf, nicht aber von T2 zu T3. Für den Faktor Gruppe wurde ein HE signifikant (F(1,31)=6,53 p<.05). Die BG war zu T1 depressiver. Von Interesse, war die signifikante Dreifach-Interaktion zwischen Zeit, Gruppe und Suppression (F(2,62)=4,56; p<.05). Um diese aufzuklären, wurde die ANOVA (Messwiederholung) mit einer gesplitteten Stichprobe (Suppression hoch vs. niedrig) durchgeführt. Nur für die Probanden mit hohen Suppressionswerten wurde die Interaktion der Faktoren Zeit und Gruppe signifikant (F(1.45, 30)=4.03 p<.05). Es zeigte sich nur für die BG eine Abnahme der Depressivität über die Zeit. Für die zweite Hypothese, die wiederum mittels einer Varianzanalyse (within: Zeit; between: Gruppe; AV: Suppression) untersucht wurde, wurde die hier interessierende Interaktion zwischen Zeit und Gruppe nicht signifikant (F < 1). 4. Diskussion Ziel der Untersuchung war, herauszufinden, wie sich ES in Abhängigkeit vom Suppressionsausmaß auf emotionale Variablen auswirkt. Da ES keinen Einfluss auf positiven Affekt hatte, aber Depressivität signifikant gesenkt wurde, kann der Schluss gezogen werden, dass es den Probanden durch die Intervention insgesamt zwar nicht besser aber weniger schlecht ging. Im Gegensatz zu Pennebakers Resultaten konnte keine Reduktion von Suppression durch ES festgestellt werden, sondern ein Rückgang der klinisch relevanten Depressivitätswerte. Die Suppressionswerte zeigten keine Veränderung, folglich können sie nicht als Mediator für die Veränderung auf der Depressionsskala angenommen werden. Hierbei kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der verwendete Fragebogen zu wenig sensitiv war. Hoch suppressive Probanden profitierten verglichen mit einer aktiven Kontrollgruppe besonders durch das ES. Da auch in der Kontrollgruppe der negative Affekt sinkt, ist dies ein Hinweis darauf, dass die reine Beschäftigung mit den eigenen Emotionen schon negativen Affekt verringert. Dies ist ein sehr interessanter, untersuchungswürdiger Aspekt. Um sicherzustellen, dass das Ausfüllen der PANAS die Ursache für den niedrigeren negativen Affekt darstellt, müsste eine Wartelisten- als Kontrollgruppe hinzugezogen werden. In unserer Studie ergab es sich durch die Quasirandomisierung zufällig, dass es der Interventionsgruppe von Anfang an schlechter ging als der Kontrollgruppe, weswegen eigentlich vorhandene Effekte möglicherweise nicht signifikant wurden. Bei Studien mit kleinen Stichproben empfiehlt es sich daher, statt einer Randomisierung Matching vorzunehmen. Herauszustellen ist, dass der Depressionswert hoch suppressiver Menschen durch minimales ES allein weit gesenkt und eine hohe Effektstärke (Hedges g = 1,09) mit einem geringen ökonomischen Aufwand erreicht wurde. 5. Literatur Horn, A. B. & Mehl, M. R. (2004). Expressives Schreiben als Copingtechnik: Ein Überblick über den Stand der Forschung. /Verhaltenstherapie, 14/, Gross, J. J., Richards, J. M. & John, O. P. (2006). Emotion regulation in everyday life. In D. K. Snyder, J. A. Simpson & J. N. Hughes (Eds.). /Emotion regulation in families: Pathways to dysfunction and health/. Washington DC: American Psychological Association. 17
18 Gruppe 7 Neuronale Grundlagen der Fehlerentdeckung Sina Braune, Uta Kappauf, Sabrina Maichrowitz, Stefanie Müller, Caroline Roeser, Andreas Sauer, Lisa Schulz, Christin Schulze, Mario ten Venne, Lisa Wallner 1. Einleitung Leitung: Dr. Ralf Trippe Der Mensch lebt in einer komplexen Umwelt. Um sich in dieser zurecht zu finden benötigt er ein Kontrollsystem, welches sein Handeln stetig überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Dieses System wurde bereits 1890 von W. James als Willen bezeichnet. Dieser sei notwendig, um effizientes Handeln möglich zu machen. Seit den 1960er beschäftigen sich zahlreiche Forscher mit der Fehlererkennung beim Menschen. So entdeckte u.a. Rabbitt, dass falsche Antworten i.d.r. schneller erfolgen als richtige und Antworten nach Fehlern länger dauern. Nimmt man alle Befunde der letzten Jahrzehnte zusammen, so scheint der Mensch über einen automatischen Fehlerdetektionsmechanismus zu verfügen, welcher Verhalten überwacht und es gleichzeitig auch beeinflusst. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckten zwei Forschergruppen unabhängig voneinander das hirnelektrische Korrelat dieses Mechanismus (Falkenstein, 1990, Gehring, 1993). Sie zeigten, dass ca. 50 bis 100 ms nach fehlerhaften Antworten eine stärkere Negativierung im Ereignis Korrelierten Potential (EKP) des EEG zu beobachten ist. Dieses Phänomen bezeichnet man als Error-Related-Negativity (ERN). In einer Studie von Bernstein et al. (1995) mussten die Versuchsteilnehmer einen von vier möglichen Buchstaben identifizieren und einen, dem jeweiligen Buchstaben zugewiesenen Knopf drücken. Auch hier zeigte sich nach fehlerhaften Antworten eine ERN, welche, so nachgewiesen, als Response-ERN bezeichnet wird. Eine weitere Form der ERN ist die Feedback-ERN, welche sich ca. 250 bis 400 ms nach negativem Feedback zeigt (Miltner, 1997). Es wird angenommen, dass beide Formen die Aktivität eines einheitlichen Fehlerdetektionssystems darstellen. Bildgebende Studien zu beiden Paradigmen, bei denen jeweils Aktivierungen im medialen Frontalkortex (MFC), genauer im dorsalen Teil des anterioren cingulären Cortex (ACC) gefunden wurden, stützen diese Annahme. In der vorliegenden Studie soll an einer einzigen Versuchpersonengruppe überprüft werden, ob beide Arten der ERN ein vergleichbares Aktivierungsmuster im fmrt zeigen, oder ob sich diese Muster unterscheiden. Dazu wurden die Paradigmen von Bernstein und Miltner übernommen und für eine kombinierte fmrt/eeg Messung angepasst. 2. Methode Als Versuchspersonen (VP) dienten 10 Studenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das Durchschnittsalter betrug 22 Jahre und die Teilnahme an der Studie war freiwillig. Aufgrund technischer Probleme (Bewegungsartefakte im MRT, Verstärkerausfälle im EEG, zu geringe Fehlerzahl, etc.) konnten nur 5 VP ausgewertet werden. Den VP wurde vor Beginn der Untersuchung ein 64-Kanal EEG angelegt und die Untersuchung fand in einem 3-Tesla-MRT statt. Die VP mussten während der Zeit im MRT zwei verschiedene Aufgaben hintereinander bearbeiten. Bei der ersten Aufgabe handelte es sich um das angepasste Experiment von Bernstein. Der VP wurden zu Beginn vier Buchstaben gezeigt (S, H, K, C). Jedem Buchstabe wurde eine Taste auf einer der beiden Tastaturen zugewiesen. Diese Zuweisung sollte genau eingeprägt werden. Während des Experiments erschien nur ein Buchstabe auf dem Bildschirm und die Aufgabe der VP bestand nun darin in einem festgelegten Zeitintervall die richtige Taste zu drücken. Bei falscher Antwort kam keine Fehlermeldung, jedoch erhielt die VP bei zu langsamer Antwort eine Aufforderung schneller zu reagieren. Dies sollte den Druck auf die VP erhöhen damit ihr deshalb mehr Fehler unterlaufen. 18
19 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Im zweiten Experiment sollte die VP ein Zeitintervall von 1 sek. schätzen. Hierzu wurde der VP ein Startton präsentiert und die VP sollte nach Ablauf einer Sekunde eine Taste drücken. Die Rückmeldung, ob das eingeschätzte Intervall einer Sekunde entsprach oder nicht, erfolgte in Form von zwei Tönen unterschiedlicher Frequenz. Die Auswertung der EKP erfolgte nach Bereinigung der Scannerartefakte und Korrektur der kardioballistischen Artefakte. Zur Auswertung der fmri-daten wurden die anatomischen Aufzeichnungen zunächst in den Talairachraum überführt und dann vorverarbeitet (Slicescantimecorrection, Bewegungskorrektur, Lineare Trendkorrektur). Desweiteren wurde eine Region-of-Interest-Analyse und anschließend eine explorative Analyse durchgeführt. 3. Ergebnisse Response Paradigma: Im Response Paradigma zeigte sich eine EKP Differrenzkurve mit einem frontozentralen Maximum nach ca. 80 ms. Die fmri Daten zeigten eine signifikante Aktivierung im MFC, genauer im rostralen Teil des dorsalen ACC, desweiteren eine Aktivierung im lateralen Frontalcortex (FC). Eine explorative Analyse ergab keine signifikanten Aktivierungen. Feedback Paradigma: Die EEG-Daten lieferten eine EKP-Differenzkurve mit einer maximalen Negativierung nach ca. 380 ms, mit einer eher zentralen Topographie. Die fmri Daten belegen eine signifikante Aktivierung im MFC, und zwar im caudalen Teil des dorsalen ACC. Zusätzlich eine Aktivierung im lateralen SMA und im Präfrontalen Cortex. Die explorative Analyse erbrachte zusätzlich eine Aktivierung in der Insula und dem visuellen Assoziationscortex. 4. Diskussion Mit vorliegender Studie wurde der Fragestellung nachgegangen, ob der Response - und der Feedback - ERN vergleichbare neuronale Aktivierungen zugrunde liegen. In beiden Untersuchungen wurde im EKP eine ERN gefunden, jedoch mit unterschiedlichem zeitlichen Auftreten und etwas anderer Topographie. Diese Befunde replizieren weitgehend die Ergebnisse der Studien von Bernstein et al. und Miltner et al. Die fmrt Analysen ergaben für beide Paradigmen signifikante Aktivierungen im FC, insbesondere im Bereich des dorsalen ACC. Dies zeigt, dass sowohl Response - als auch Feedback - ERN mit einer Aktivierung des dorsalen ACC einhergehen. Response jedoch eher im rostralen Bereich und Feedback eher caudal. Diese Ergebnisse spiegeln sich wie bereits erwähnt auch im EEG wider mit einem mehr posterior gelegenen Maximum der ERN im Feedback - Paradigma. Diese (vorläufigen) Ergebnisse sprechen also dafür, dass der Response - und der Feedback - ERN unterschiedliche neuronale Prozesse zugrunde liegen, es also wahrscheinlich kein einheitliches generelles Fehlerdetektionssystem gibt. Da jedoch nur 5 VP ausgewertet werden konnten, muss das Ergebnis sehr vorsichtig interpretiert werden. Zudem scheint (für die Zukunft) eine trial by trial EEG/fMRI coupling Analyse notwendig, um diese Ergebnisse zu sichern und zu stützen. 5. Literatur Bernstein, Peter S., Scheffers, Marten K., Coles, Michael G. H. (1995)."Where Did I Go Wrong?" A Psychophysiological Analysis of Error Detection; Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, Vol. 21, No. 6; Miltner, Wolfgang H.R., Braun, Christoph H., Coles, Michael G. H.(1997). Event-Related Brain Potentials Following Incorrect Feedback in a Time-Estimation Task: Evidence for a Generic Neural System for Error Detection; Journal of Cognitive Neuroscience, Vol. 9 No. 6;
20 Gruppe 8 Zielunabhängigkeit von Erregungs-Valenzinteraktionen bei der Verhaltenssteuerung Sarah Ohnesorge, Nicole Baus, Anica Spatz, Pelle Bernhold, Dave Cromm 1. Einleitung Leitung: Dr. Andreas B. Eder Die Valenz eines Stimulus sowie sein Erregungsgehalt geben dem Menschen wichtige Informationen über seine Umwelt. Vorangegangene Studien zeigten, dass die Kombination einer negativen Valenz mit einer hohen Erregung, sowie die Paarung einer positiven Valenz mit einer niedrigen Erregung zu schnelleren Stimulusbewertungen führen (Robinson, Storbeck, Meier, & Kirkeby, 2001). Da jedoch in diesen Studien stets explizite Reizbewertungen verlangt wurden, bleibt unklar, ob Valenz-Erregungs-Interaktionen auch ohne ein explizites evaluatives Verarbeitungsziel auftreten. In unserer Untersuchung wurden deshalb zwei unterschiedlichen Aufgaben eingeführt: Evaluationsdurchgänge mit einer direkten Bewertung von Bildern unterschiedlichen Erregungsgehalts und Farbdurchgänge mit einer indirekten Bewertung dieser Reize, in denen auf die Farbe des Bildrahmens mit dem Aussprechen von Valenzen reagiert wurde (Voß, Rothermund, & Wentura, 2003). In den Bewertungsdurchgängen erwarteten wir schnellere und korrektere Bewertungen, wenn die Bildvalenz mit dem Erregungsgehalt kongruent ist (positiv-niedrig, negativ-hoch; cf. Robinson et al., 2001). In den Farbdurchgängen erwarteten wir schnellere und korrektere Aussprechreaktionen bei einer Übereinstimmung der Reaktionsvalenz mit der Bildvalenz (positiv-positiv, negativ-negativ); dieser affektive Simon Effekt sollte bei einer Valenz-Erregungs-Kongruenz der Reize besonders stark ausgeprägt sein, was für eine Zielunabhängigkeit dieser Interaktionen sprechen würde. 2. Methode Stichprobe. An dem Experiment nahmen 19 Studenten mit normaler Sehkraft (13 Frauen, 6 Männer) der Universität Jena teil (Alter: M = 21.7; SD =3.1). Design. Es liegt ein 2 (Bildvalenz: positiv vs. negativ) x 2 (Bilderregungsgehalt: niedrig vs. hoch) x 2 (Reaktionsvalenz: positiv vs. negativ) x 2 (Durchgangstyp: evaluativ vs. farb)-design vor, wobei alle Faktoren innerhalb der Personen variiert wurden. Ausbalanciert wurden zwischen den Personen die Valenz-Farbzuweisung (gelb = positiv / blau = negativ vs. gelb = negativ / blau = positiv) sowie die Zuweisung der beiden Bildsets zu den Farb- und Bewertungsdurchgängen. Material. Als Stimulusmaterial dienten die 56 von Robinson und Kollegen (2004) ausgewählten IAPS-Bilder, mit je 14 Bildern in jeder Valenz-Erregungskombination. Davon wurden zwei Sets mit je 28 Bildern gebildet, die auf Extremheit und Erregungsgehalt parallelisiert wurden. Für die Übung wurden 40 separate IAPS-Bilder verwendet. Das Experiment wurde mit Hilfe eines Mikrofons und eines Voicekeys, der die Aussprechreaktion registrierte, durchgeführt. Prozedur. Das Experiment beinhaltete zwei Durchgangsarten, die durch die Farbe des Bildrahmens angezeigt wurden: Ein weißer Rahmen verlangte die Bewertung des präsentierten Bilds und ein farbiger Rahmen (blau vs. gelb) das Aussprechen von positiv und negativ in Abhängigkeit von der Farb-Valenzzuweisung. Die Abfolge eines Durchgangs umfasste ein 100 ms währendes Fixationszeichen, auf das 50 ms später der umrahmte Stimulus folgte. Nach 1 Sekunde folgte bei Nichtreaktion eine Fehlermeldung. Die Reaktion wurde von einem anwesenden Versuchsleiter kodiert. Das Experiment startete mit 3 Übungsblöcken: 20 Bewertungsdurchgänge, 20 Farbdurchgänge und 24 gemischte Durchgänge. Hierauf folgten 4 Experimentalblöcke mit je 112 Durchgängen (66 pro Aufgabe). Korrekte, schnelle Reaktion (< 700ms ) wurden mit je einem Cent belohnt. Am Ende jedes Blocks erhielt die Versuchsperson eine Übersicht über ihren Kontostand und die Fehleranzahl. Direkte Aufgabenwiederholungen wurden auf maximal drei limitiert, und es wurde kein Bild direkt wiederholt. Aufgabenwechsel- und Aufgabenwiederholungen waren annähernd gleichverteilt. 20
21 3. Ergebnisse 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Ein Ausschluss erfolgte bei einem Voicekey-Fehler (3.06%). Bei den Reaktionszeitanalysen erfolgte zusätzlich ein Ausschluss aufgrund einer Reaktionszeitüberschreitung (RT > 1000ms, Evaluation: 3.97 %, Farb: 2.39 %) und bei inkorrekten Antworten (Evaluation: 8.67 %, Farb: 14.4 %). Direkte Bewertung (Evaluationsdurchgänge) Eine 2 (Valenz) x 2 (Erregung) ANOVA der Reaktionszeiten mit Messwiederholungen ergab keine signifikante Valenz x Erregung Interaktion, F(1,18) = 0.22, p =.65 (siehe Tab. 1). Die Haupteffekte der Valenz und Errregung wurden nicht signifikant, beide Fs < 1. In einer analogen ANOVA der Fehlerrate wurde die Interaktion ebenfalls nicht signifikant, F(1,18) = 2.35, p =.14 (siehe Tab. 1). Es zeigten sich keine signifikanten Haupteffekte, beide Fs < 1. Tabelle 1: Mittlere Reaktionszeiten und Fehler in den Evaluationsdurchgängen Valenz Erregung M (RZ) SD (RZ) M (Fehler) SD (Fehler) positiv niedrig 632,6 69,3 4,4 7,2 hoch 636,3 70,0 5,7 5,2 negativ niedrig 642,8 77,1 5,0 6,3 hoch 642,4 67,4 4,4 3,6 Indirekte Bewertung (Farbdurchgänge) Eine 2 (Antwortvalenz: positiv vs. negativ) x 2 (Bildvalenz: positiv vs. negativ) x 2 (Valenz- Erregungs-Kongruenz) ANOVA der Reaktionszeiten mit Messwiederholungen ergab eine signifikante Zweifach-Interaktion von Antwortvalenz x Valenz, F(1,18) = 36.95, p <.001, die einen affektiven Simon Effekt bestätigt (siehe Tab. 2). Die dreifache Interaktion Antwortvalenz x Valenz- Erregungs-Kongruenz x Valenz wurde jedoch nicht signifikant, F(1,18) = 1.64, p =.22. Auf Valenz-Erregungs-kompatible Bilder wurde generell schneller reagiert, F(1,18) = 7.81, p <.05. Alle anderen Haupteffekte und Interaktionen wurden nicht signifkant (mit allen ps >.20). In einer analogen ANOVA der mittleren Fehlerzahl zeigte sich ein affektiver Simon-Effekt, F(1,18) = 49.6, p <.001. Die Dreifachinteraktion wurde marginal signifikant F(1,18) = 3.75, p =.07 (siehe Tab. 2). Die Haupteffekte der Bildvalenz, F(1,18) = 13.1, p <.01, und der Reaktionsvalenz wurden signifikant, F(1,18) = 8.9, p <.01; alle anderen Effekte wurden nicht signifikant (alle ps >.08). Tabelle 2: Mittlere Reaktionszeiten und Fehler in den Farbdurchgängen Antwortvalenz Valenz Erregung M (RZ) SD (RZ) M (Fehler) SD (Fehler) positiv positiv niedrig 568,4 59,8 0,7 1,1 hoch 582,8 65,1 0,8 1,3 negativ niedrig 603,1 85,4 2,6 2,1 hoch 605,3 68,7 3,7 2,3 negativ positiv niedrig 595,2 70,4 1,7 1,5 hoch 603,5 80,0 1,9 1,9 negativ niedrig 579,1 69,1 0,8 1,5 hoch 558,3 69,6 0,6 0,8 4. Diskussion Das Ergebnismuster deutet einen zielunabhängigen Einfluss der Valenz-Erregungsinteraktion auf die Verhaltenssteuerung in den Farbdurchgängen an. Mit einer größeren Stichprobe würden die Ergebnisse vermutlich signifikant werden. 5. Literatur Robinson, M. D., Storbeck, J., Meier, B. P., & Kirkeby, B. S. (2004). Watch out! That could be dangerous: Valence arousal interactions in evaluative processing. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, Voß, A., Rothermund, K., & Wentura, D. (2003). Estimating the valence of single stimuli: A new variant of the affective Simon task. Experimental Psychology, 50,
22 Gruppe 9 Umgang mit Terrorismus. Einsam oder gemeinsam? Effekte von Bedrohung auf Maße sozialer Distanz Julia Barth, Ilka Fritsche, Elena Landeck, Manuela Richter, Sebastian Schulz 1. Einleitung Leitung: Dr. Immo Fritsche Angesichts der zunehmenden terroristischen Bedrohungswahrnehmung stellt sich die nachfolgende Untersuchung die Frage, wie Menschen mit einer derartigen Gefahr umgehen. Nach der Terror Management Theory (Greenberg, Solomon und Pyszczynski, 1997) verfügen Menschen über ein Bewusstsein der Unvermeidbarkeit des eigenen Todes. Dieser existenziellen Bedrohung kann mit dem Selbstwert und den kulturellen Weltsichten begegnet werden. Die kulturellen Weltsichten formen eine bedeutungsvolle Konzeption der Realität und garantieren durch ihr Fortbestehen das Überdauern der eigenen Ansichten auch über den individuellen Tod hinaus. Zudem ist davon auszugehen, dass das soziale Selbst der Identität als Teil einer unsterblichen Entität das individuelle Selbst überdauert und daher zu einer Art symbolischen Unsterblichkeit führt (Castano, E., Yzerbyt, V, Paladino, M.-P. & Sacchi, S., 2002). Aufgrund dieser Angst puffernden Wirkung sollte der Mensch unter Bedrohung ein erhöhtes Bedürfnis nach Eigengruppenmitgliedern haben, welche die eigene Weltsicht validieren. Anderen Untersuchungen zufolge sollte unter Bedrohung jedoch ein automatischer Anschluss an Gruppen erfolgen, unabhängig von deren Überzeugungen (Wisman & Koole, 2003). Grundlage der aktuellen Untersuchung ist die Annahme, dass terroristische Bedrohungswahrnehmung mit Mortalitätssalienz (MS) einhergeht (Moskalenko, McCauley & Rozin, 2006). Entsprechend den bisherigen Erkenntnissen nehmen wir eine erhöhte Identifikation mit (Eigen-) Gruppen unter MS an, was sich bereits in unserer ersten Studie zeigen ließ. Zudem gehen wir davon aus, dass es unter MS zu einem Anschluss an Gruppen kommt, den wir anhand eines Sitzabstandsmaßes erfassen (Wisman & Koole, 2003). Ergänzend zur bisherigen Forschung messen wir den Sitzplatz nicht nur, sondern manipulieren ihn zusätzlich. Der Sitzplatz während der Untersuchung moderiert somit den Effekt von MS auf die Identifikation und den gewählten Sitzabstand. Aufgrund der Angst puffernden Wirkung von Gruppen erwarten wir, dass sich nur bei Abwesenheit einer Gruppe ein solcher MS-Effekt zeigt, wobei wir zusätzlich annehmen, dass sich gesellige Menschen unter MS besonders stark annähern, sehr schüchterne sich jedoch eher distanzieren sollten. 2. Methode Die Gesamtstichprobe setzte sich aus 50 weiblichen und 30 männlichen studentischen Versuchspersonen mit einem Altersmittelwert von M = 22 (SD = 2.64) zusammen, wobei in der statistischen Analyse alle ausländischen Studierenden sowie eine unvollständige (Zweier-) Gruppe ausgeschlossen wurden. Bei der Untersuchung handelte es sich um ein 2 (non-ms vs. MS) x 2 (Einzel- vs. Gruppensitzung) - Design. Die abhängigen Variablen waren die Identifikation, die explizit gemessen wurde, sowie der Anschluss an eine Gruppe, gemessen durch ein Sitzabstandsmaß. Den Fragebogen bearbeiteten die Probanden entweder allein oder in Gruppen von 3-4 Personen, was die Manipulation nach Einzel- bzw. Gruppensitzung ausmachte. Nach der Einverständniserklärung und der Erfassung der soziodemografischen Angaben fand die subtile MS- Manipulation statt, die mithilfe eines Zeitungsartikels realisiert wurde. Dabei wurde der Fokus auf einen neutralen zentralen Artikel gelenkt, der jedoch von terrorismusbezogenen Artikeln umgeben war. In der Kontrollgruppe wurden diese durch neutrale Artikel ersetzt. Im Anschluss erfolgten die 22
23 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Messungen der expliziten Identifikation und des Sitzabstandes. Explizit wurde die Identifikation mit den drei Gruppen Experimentalteilnehmer, Studierende desselben Fachs und Europäer anhand von zwölf Items mit einer zehnstufigen Skala erfasst (α =.78). Das Sitzabstandsmaß zur Bestimmung der Gruppenannäherung wurde anhand von sechs Abbildungen verschiedener Räume ermittelt, für welche die Probanden ihre Sitzplatzpräferenzen angeben sollten (α =.87). Dabei war jeweils eine Gruppe von drei Stühlen bereits belegt. Daraufhin erfolgte noch die Messung der dispositionalen Schüchternheit anhand von fünf Items mittels einer fünfstufigen Skala (α =.81). 3. Ergebnisse Eine multiple Regressionsanalyse mit den Prädiktoren MS, Sitzplatzbedingung, Schüchternheit und deren Interaktionen, der Kontrollvariable Geschlecht sowie dem Kriterium Sitzabstand ergab zwei wesentliche Effekte. Erstens wurde der Regressionskoeffizient für den Haupteffekt von Schüchternheit mit β =.19, p =.07 marginal signifikant, was die Validität des Sitzabstandsmaßes bestätigt. Zweitens zeigte sich für die Dreifachinteraktion von MS x Sitzplatzbedingung x Schüchternheit mit β = -.22, p =.03 ein signifikanter Regressionskoeffizient. Die getrennte Betrachtung der Sitzplatzbedingungen ergab nur bei den Einzelsitzungen eine signifikante MS x Schüchternheit - Interaktion mit β =.32, p =.03, in der Gruppenbedingung jedoch weder einen Effekt von MS noch einen MS x Schüchternheit - Interaktionseffekt. 4. Diskussion Die erwartete Dreifachinteraktion zwischen MS, Sitzplatzbedingung und Schüchternheit konnte gefunden werden. In Übereinstimmung mit unserer Hypothese gab es unter Anwesenheit einer Gruppe keinerlei Effekte, die mit der MS in Beziehung stehen, was die Vermutung stützt, dass die Gruppe einen Angstpuffer darstellt. Weiterhin gab es wie erwartet bei Abwesenheit einer Gruppe einen Effekt der MS in nicht nur quantitativer, sondern auch qualitativer Abhängigkeit von der Schüchternheit. Gesellige Personen näherten sich unter MS tendenziell eher der Gruppe an, wogegen schüchterne Personen genau die entgegengesetzte Tendenz zeigten, indem sie sich unter MS distanzierten. Dies lässt vermuten, dass MS nicht wie bisher angenommen einen über alle Menschen zu findenden Effekt hat, sondern dass sich Menschen in ihrer Reaktion auf eine existenzielle Bedrohung grundsätzlich unterscheiden. Einsam oder gemeinsam? Wie mit wahrgenommener terroristischer Bedrohung umgegangen wird, ist scheinbar von individuellen und situationalen Faktoren abhängig. 5. Literatur Castano, E., Yzerbyt, V., Paladino, M.-P., Sacchi, S. (2002). I belong, therefore, I exist: Ingroup identification, ingroup entitativity, and ingroup bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, Greenberg, J., Solomon, S., & Pyszczynski, T. (1997). Terror management theory of self-esteem and cultural worldviews: Empirical assessments and conceptual refinements. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 29 (pp ). San Diego: Academic Press. Moskalenko, S., McCauley, C., & Rozin, P. (2006). Group identification under conditions of threat: College students attachment to county, family, ethnicity, religion and university before and after September 11, Political Psychology, 27, Wisman, A., & Koole, S. L. (2003). Hiding in the crowd: Can mortality salience promote affiliation with others who oppose one s worldviews? Journal of Personality and Social Psychology, 84,
24 Gruppe 10 America vs. Germany Bush vs. Merkel: EKP Hinweise für kategoriales Priming von Personen anhand von Nationalität Stefanie Beyermann, Verena Blasczyk, Laura Menger, Sabrina Rath, Teresa Voigt 1. Einleitung Leitung: Holger Wiese Wie sind Personen eigentlich in unserem Gedächtnis repräsentiert? Gibt es eine kategoriale Organisation, wie dies für Objekte angenommen wird, oder sind Personen ausschließlich durch gemeinsames Auftreten miteinander assoziiert? Das IAC-Modell von Burton et al. (1990) sagt sowohl einen assoziativen, als auch einen kategorialen Primingeffekt vorher. Entscheidend ist lediglich, dass Prime und Target gemeinsame semantische Informationseinheiten haben. Das bedeutet, eine Targetperson sollte nicht nur schneller erkannt werden, wenn sie auf eine Primeperson folgt, mit der sie hochgradig assoziiert ist, sondern auch dann, wenn Prime und Target lediglich der gleichen Kategorie angehören, also z.b. denselben Beruf haben, und nicht direkt miteinander assoziiert sind. Die Existenz eines kategorialen Primingeffekts ist jedoch umstritten (z.b. Barry et al., 1998), auch wenn er in jüngeren Studien wiederholt gefunden wurde (z.b. Wiese und Schweinberger, 2007). Vorhergehende Arbeiten haben Kategoriezugehörigkeit ausschließlich über den Beruf der Personen operationalisiert. In der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, ob ein kategorialer Primingeffekt auch für andere Arten semantischer Information, zum Beispiel durch Nationalitätszugehörigkeit, nachzuweisen ist. Über die Analyse von Verhaltensdaten hinaus sollten mögliche elektrophysiologische Korrelate des Effekts untersucht werden. Dabei wurden folgende Hypothesen untersucht: 1. Die Reaktionszeiten bei Kategorieübereinstimmung ( gleiche Nationalität ) sind schneller als bei verschiedenen Kategorien ( andere Nationalität ), dies jedoch nur bei bekannten Primes. 2. Der kategoriale Primingeffekt ist in den EEG-Daten an okzipitalen Elektroden zu finden (siehe Wiese & Schweinberger, 2007). 2. Methode Stichprobe. Es nahmen insgesamt 17 rechtshändige Probanden, davon 14 weiblich, an der Studie teil. Das Durchschnittsalter betrug 22,1 Jahre. Stimulusmaterial. Die Probanden bekamen Namen bzw. Gesichter berühmter (Deutsche oder Amerikaner) und unbekannter Personen auf einem Bildschirm gezeigt. Dabei wurden die Stimuli in einem Prime-Target-Experiment präsentiert, d.h. jedem Primestimulus folgte direkt ein Targetreiz. Primes waren entweder bekannte oder unbekannte Namen, Targetreize waren immer bekannt. Die Personenpaare waren nicht miteinander assoziiert, hatten weder das gleiche Geschlecht, noch den gleichen Beruf. Design. In der Studie wurde ein 2x2x2-Design verwendet. Der erste Innersubjektfaktor, welcher variiert wurde, war Prime-Bekanntheit mit den zwei Stufen bekannt und unbekannt. Der zweite Innersubjektfaktor war Prime-Target-Kombination mit den Stufen gleiche Nationalität und andere Nationalität von Prime und Target. Als letzter Faktor wurde kategoriales Priming sowohl innerhalb einer Modalität (Prime: Name - Target: Name) als auch zwischen zwei Modalitäten (Prime: Name - Target: Gesicht) untersucht. Pro experimentelle Bedingung wurden 40 Durchgänge dargeboten. Die Aufgabe des Probanden bestand darin, für jeden Trial so schnell und korrekt wie möglich zu entscheiden, ob die Targetperson amerikanischer oder deutscher Herkunft war. Datenaufzeichnung und Analyse. Während des Experiments wurden Reaktionszeiten und die elektrischen Hirnströme (32-Kanal-EEG, DC-75 Hz, 256 Hz sample rate) erfasst. Aus dem EEG 24
25 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress wurden für alle Bedingungen getrennt ereigniskorrelierte Potentiale gemittelt und durch Berechnung mittlerer Amplitudenmaße in einem frühen ( ms) und einem späteren Zeitbereich ( ms) quantifiziert. 3. Ergebnisse Das Name-Name Experiment wird im Folgenden nicht weiter dargestellt, da vermutlich die rein sprachliche und nicht personen-spezifische Information der Targetnamen einen unkontrollierten Störeinfluss auf die Aufgabe hatte. Reaktionszeiten. Für die Targetmodalität Gesicht ergab eine Varianzanalyse mit Messwiederholung und den Faktoren Prime-Bekanntheit und Prime-Target-Kombination keine signifikanten Effekte (alle F<1). Ereigniskorrelierte Potentiale. In der cross-modalen Bedingung Name-Gesicht zeigte sich im frühen Zeitbereich an der okzipitalen Elektrode I1 eine signifikante Interaktion der Faktoren Prime-Bekanntheit und Prime-Target-Kombination (F[1,16]=5,3; p<.05). Post-hoc durchgeführte T-Tests ergaben signifikant positivere Amplitudenmaße im Vergleich der Bedingungen gleiche Nationalität und andere Nationalität, jedoch nur im Falle eines bekannten Prime-Stimulus ( Prime bekannt : T[16]=2,7; p<.05; Prime unbekannt : T[16]=-0,4; p>.05). An der Elektrode I2 fand sich im gleichen Zeitbereich ein Trend, der ebenfalls auf eine Interaktion der Faktoren hindeutete (F[1,16]=3,4; p=.08). Schließlich wurde im Zeitbereich von ms nach Reizdarbietung an der Elektrode Cz ein signifikanter Haupteffekt des Faktors Prime-Bekanntheit gefunden (F[1,16]=7,9; p<.05), der sich auf positivere Amplitudenmaße in der Bedingung Prime bekannt zurückführen ließ. 4. Diskussion Im Gegensatz zu den in der Einleitung formulierten Erwartungen konnten keine schnelleren Reaktionszeiten für Kategorieübereinstimmung bei bekannten Primes nachgewiesen werden. Allerdings wurde die zweite Hypothese bestätigt, da entsprechende Effekte im EEG gefunden wurden. Im frühen Zeitbereich findet möglicherweise ein Abgleich der strukturellen Analyse des Targetreizes mit den durch die Primes beeinflussten Repräsentationen bekannter Personen statt. Die Abweichung von der gebahnten Nationalität wirkt sich hier hemmend aus. Hingegen kann der späte Effekt an CZ als Erleichterung interpretiert werden. Der Zeitraum ist typisch für semantische Prozesse, so dass der Abruf personenspezifischer semantischer Informationen durch bekannte Primes vermutlich erleichtert wird. Das Ausbleiben von Unterschieden in den Reaktionszeiten kann auf die möglicherweise zu unspezifische Kategorie Nationalität zurückgeführt werden. So könnten sich die potentiell bahnenden Einflüsse des Primes auf eine zu große Anzahl von Personen verteilen um in Reaktionszeiten messbare Effekte zu erzielen. Daraus resultiert die Frage, welche Art semantischer Kategorien in zukünftigen Untersuchungen verwendet werden könnten, die gleichzeitig die Forderung erfüllen, nicht visuell erschließbar zu sein. 5. Literatur Barry C., Johnston R.A., Scanlan L.C. (1998). Are faces special objects? Associative and semantic priming of face and object recognition and naming. The quarterly journal of experimental psychology. 51A(4), Burton A.M., Bruce V., Johnston R.A. (1990). Understanding face recognition with an interactive activation model. British Journal of Psychology, 81, Carson D. R., Burton A.M. (2001). Semantic priming of person recognition: categorial priming may be a weaker form of the associative priming effect. The quarterly journal of experimental psychology, 54A(4), Wiese H., Schweinberger S.R. (2007). Accessing semantic information of famous people: ERP evidence for both associative and categorial priming of names. Poster presented at the Experimental Psychology Society (EPS) Meeting, July 2007, Edinburgh, UK 25
26 Gruppe Einleitung Warum sollte man wissen, dass Angela Merkel Politikerin ist? Semantisches Priming von Personennamen Katharina Bachmeier, Lisa Bayerle, Dorit Grundmann, Susanne Markert, Antonia-Sophia Scholz Leitung: Dr. Holger Wiese Nach Barry et al. (1998) ist das semantische Gedächtnis für Objekte in Kategorien organisiert, während (berühmte) Personen durch assoziative Verbindungen verknüpft sind, die auf gemeinsamem öffentlichem Auftreten basieren. Andererseits sagt das Interactive-Activation-and- Competition-(IAC) -Modell der Personenerkennung (Burton et al., 1990) sowohl einen kategorialen als auch einen assoziativen Primingeffekt für Personen vorher, bedingt durch die von Prime und Target geteilte semantische Information. Entsprechend fanden Wiese und Schweinberger (2007) zusätzlich zum assoziativen einen kategorialen Primingeffekt und konnten darüber hinaus unterschiedliche neuronale Korrelate in den ereigniskorrelierten Potentialen (EKP) dieser Effekte identifizieren. Die vorliegende Studie wurde entwickelt, um den kategorialen Primingeffekt sowie seine neuronalen Korrelate weiter zu untersuchen. Dem IAC-Modell zufolge sollte eine Bahnung durch rein semantische und nicht aus der Repräsentation von Individuen erschlossene Information den kategorialen Primingeffekt verstärken. Daher sollte neben der Bahnung über kategorial verwandte Namen ein möglicherweise verstärkter Effekt durch Priming mit Kategorieoberbegriffen erzeugt werden. 2. Methode Die Stichprobe bestand aus 20 rechtshändigen Studenten (12 davon weiblich, Altersdurchschnitt: 22,2 Jahre). Die Stimuli wurden in einem Prime-Target-Experiment dargeboten. Als Primes wurden Namen berühmter Personen unterschiedlicher Berufskategorien, unbekannte Namen, sowie Kategorieoberbegriffe (= Berufsbezeichnungen) verwendet. Dabei wurden bekannte (z.b. Sportler/in oder Politiker/in ), sowie unbekannte Kategorieoberbegriffe (z.b. Bäcker/in oder Ingenieur/in ) präsentiert. Als Targets wurden Namen berühmter oder unbekannter Personen verwendet. Bei der Zusammenstellung der Namenspaare wurde darauf geachtet, nur Stimuli zu kombinieren, die nicht direkt assoziiert waren. Dem Experiment lag ein 2 (Primetyp: Name vs. Kategorieoberbegriff ) x 3 (Prime-Target- Kombination: gleiche Kategorie vs. andere Kategorie vs. neutral, d.h. unbekannter Prime) faktorielles Design zugrunde. Es bestand aus sechs Blöcken mit jeweils 40 Durchgängen, wobei die Targets zu jeweils 50% Namen bekannter und unbekannter Personen waren. Die Aufgabe der Probanden bestand darin, so schnell und korrekt wie möglich zu entscheiden, ob es sich bei dem Target um eine bekannte oder unbekannte Person handelte. Es wurden Reaktionszeiten sowie ereigniskorrelierte Potentiale (32-Kanal-EEG, DC-75 Hz, 256 Hz sample rate) erfasst. Zur statistischen Auswertung der für die verschiedenen Bedingungen resultierenden EKPs wurden mittlere Amplitudenmaße in einem frühen ( ms) und einem späteren ( ms) Zeitfenster berechnet. In die Auswertung wurden nur korrekt beantwortete Durchgänge für bekannte Targets miteinbezogen. 26
27 3. Ergebnisse 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Zur Analyse wurden sowohl Reaktionszeiten als auch ereigniskorrelierte Potentiale jeweils einer Varianzanalyse mit Messwiederholung mit den Faktoren Primetyp und Prime-Target-Kombination unterzogen. Signifikante Interaktionen wurden mittels t-tests in Paarvergleichen analysiert. Dabei wurde das Signifikanzniveau entsprechend der Bonferoni-Korrektur angepasst. In den Reaktionszeiten wurde die Interaktion der Faktoren signifikant (F[2,38] = 14,35; p <.001). Bei dem Vergleich der Prime-Target-Kombinationen innerhalb des Primetyps Kategorieoberbegriff fanden sich signifikante Unterschiede bezüglich der Reaktionszeiten sowohl zwischen den Bedingungen gleiche Kategorie und andere Kategorie (T[19] = -4.44; p <.001), als auch zwischen gleiche Kategorie und neutral (t[19] = -4.2; p <.001). Die Reaktionszeiten in der Bedingung gleiche Kategorie waren dabei durchgehend schneller als in den beiden anderen Bedingungen. Beim Vergleich der Prime-Target-Kombinationen innerhalb des Primetyps Name fanden sich nach Bonferoni-Korrektur keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Prime-Target-Kombinationen. Die Analyse der elektrophysiologischen Daten zeigte im frühen Zeitfenster ( ms nach Stimuluspräsentation) an der Elektrode PO9 einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Primetyp (F[1,19]=17,4; p<.001). Weiterhin wurde im späten Zeitfenster ( ms) eine signifikante Interaktion der Faktoren Primetyp und Prime-Target-Kombination an der Elektrode Pz gefunden (F[2,38]=5,3; p<.01). Post-hoc durchgeführte t-tests zeigten einen Trend für einen Primingeffekt in der Bedingung Primetyp Kategorieobergriff ( gleiche Kategorie / andere Kategorie : t[19]=2,7; p<.05; gleiche Kategorie / neutral : t[19]=2,2; p<.05, jeweils unkorrigiert für multiple Vergleiche), nicht aber in der Bedingung Primetyp Name. 4. Diskussion Sowohl die behavioralen als auch die elektrophysiologischen Ergebnisse zeigen, dass ein kategorialer Primingeffekt abhängig von der Ausprägung des Primetyps auftritt. So waren schnellere Reaktionszeiten und erleichterter Zugriff auf semantische Information (später EKP Effekt) lediglich in der Bedingung zu erkennen, in der mit einem Kategorieoberbegriff gebahnt wurde. Dabei tritt eine Unterscheidung zwischen den beiden Primetypen bereits zu einem frühen Zeitpunkt auf (früher EKP-Effekt an PO9), der möglicherweise die Aktivierung einer frühen strukturellen Repräsentation darstellt. Im Gegensatz zu aktuellen Befunden, die lediglich assoziativ oder kategorial verknüpfte Personennamen verwendeten (Wiese & Schweinberger, 2007), deutet dieses Ergebnismuster darauf hin, dass gemeinsame semantische Information von Prime und Target nur dann genutzt wird, wenn sie ausdrücklich durch den Kategorieoberbegriff vorgegeben wird, nicht aber, wenn sie aus dem Namen des Primes erschlossen werden muss. Das Auftreten eines kategorialen Primingeffekts unter Verwendung von Namen ist also von den weiteren experimentellen Bedingungen abhängig. Dieses Resultat lässt sich nicht vollständig mit klassischen Modellen der Personenwahrnehmung (IAC-Modell, Burton et al., 1990) erklären, die in jedem Fall eine automatische Aktivierungsausbreitung zwischen den verschiedenen Hierarchieebenen annehmen. 5. Literatur Barry, C., Johnston, R.A., Scalan, L.C. (1998). Are faces special objects? Associative and semantic priming of face and object recognition and naming. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 51A, Burton, A.M., Bruce, V., Johnston, R.A. (1990). Understanding face recognition with an interactive activation model. British Journal of Psychology, 81, Wiese, H., Schweinberger, S. R. Accessing Semantic Information of Famous People: ERP evidence for both associative and categorial priming of names. Poster presented at the Experimental Psychology Society (EPS) Meeting, July 2007, Edinburgh, UK. 27
28 Gruppe 12 Wir sind alle gleich und deshalb sind wir so wie ich Diana Kurze, Franziska Stöhr, Claudia Thoß, Katharina Voigt Leitung: Dr. Maya Machunsky 1. Einleitung Gemäß der Sozialen Identitätstheorie (Tajfel, 1981) strebt der Mensch nach einer positiven sozialen Identität. Dies führt zu einer generellen Eigengruppenfavorisierung, das heißt die Bewertung dieser wird ins Positive verzerrt. Das Phänomen der Eigengruppenhomogenität (Simon & Brown, 1987), bei dem die Mitglieder der Eigengruppe im Vergleich zur Fremdgruppe als einander ähnlicher wahrgenommen werden, ist ebenfalls auf das Streben nach positiver sozialer Identität zurückzuführen. In der Untersuchung von Gaertner und Schopler (1998) konnte der Zusammenhang von Eigengruppenhomogenität und positivere Bewertung dieser belegt werden. Homogenität wird dabei als ein spezifisches Charakteristikum von Entitativität definiert. Kurz zusammengefasst heißt dies, dass je ähnlicher die Mitglieder der eigenen Gruppe wahrgenommen werden, desto positiver wird diese auch bewertet. Das Ziel dieser Untersuchung ist es nun, den Zusammenhang zwischen Homogenität und positiverer Bewertung der Eigengruppe kognitiv zu erklären und damit eine alternative Begründung zum bisherigen motivationalen Ansatz zu schaffen. Der entscheidende Faktor dafür scheint die soziale Projektion zu sein. Darunter versteht man das Zuschreiben eigener Eigenschaften auf Mitglieder der Gruppe, der man selbst angehört. Krueger (2007) konnte bereits belegen, dass soziale Projektion zu mehr Eigengruppenfavorisierung führt. Es erscheint logisch, dass Gruppenhomogenität zu mehr sozialer Projektion führt, denn wenn alle Mitglieder der Gruppe gleich wahrgenommen werden, erscheint der Schluss von sich selbst auf die Eigengruppe als berechtigter. Aus diesen bisherigen Forschungsergebnissen und Vorüberlegungen ergibt sich folgende Mediationshypothese: Der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Homogenität und Eigengruppenfavorisierung wird über das Konzept der sozialen Projektion vermittelt. 2. Methode An der Untersuchung nahmen 68 Studierende (21 Männer, 47 Frauen, Durchschnittsalter: 22 Jahre) der FSU Jena teil. Im Experiment wurde ein einfaktorielles Design mit drei Bedingungen (Ähnlichkeit vs. Vielfältigkeit vs. Kontrollgruppe) verwendet. Nach einführenden Instruktionen erhielten die Probanden einen Fragebogen, in dem sie sich zunächst selbst einschätzen sollten. Genutzt wurden positive und negative Items wie Ich bin freundlich, Ich bin passiv usw., die auf einer 7-Punkt- Skala von Stimme überhaupt nicht zu bis Stimme voll zu bewertet werden sollten. Anschließend wurden die Teilnehmer gebeten, sich stichpunktartig über Ähnlichkeit (Experimentalgruppe 1) bzw. Vielfältigkeit (Experimentalgruppe 2) der Gruppe der Deutschen Gedanken zu machen. Um die Zeit zwischen Experimental- und Kontrollgruppe konstant zu halten, hatte diese inzwischen Anagramme zu lösen. Zur Überprüfung des Erfolges der Manipulation sollten die Probanden anschließend auf zwei Items angeben, wie ähnlich und wie vielfältig ihrer Meinung nach die Deutschen sind. Hierbei fand eine 7-Punkt- Skala von Überhaupt nicht bis Vollkommen Verwendung. Nach diesem Manipulationscheck wurden die gleichen Trait-Ratings zur Eigen- (Deutsche) und Fremdgruppe (Polen) abgefragt. Danach wurde die Eigengruppenfavorisierung mit mehreren Items erhoben. So sollten die Probanden zunächst ihre Einstellung über Deutsche und Polen äußern ( Die deutsche/polnische Mentalität ist mir irgendwie sympathisch ), wobei wieder eine 7-Punkt- Skala mit den Extremwerten Trifft gar nicht zu bis Trifft völlig zu genutzt wurde. Im Anschluss schätzten die Probanden auf einer Thermometerskala von 0 bis 100 C ein, wie angenehm ihnen die Eigen- und die Fremdgruppe ist. Beim letzten Biasmaß sollten die Teilnehmer Geldeinheiten zwischen Deutschland und Polen aufteilen, zu dem angeblichen Zweck, die von Algen befallene Ostseeküste zu retten. Nach Aufklärung und Entlohnung wurden die Versuchspersonen entlassen. 28
29 3. Ergebnisse 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress Zwei nichtdeutsche Probanden mussten aufgrund von ungewisser Identifikation von den Analysen ausgeschlossen werden. Um den Erfolg der Manipulation zu überprüfen, wurde für wahrgenommene Ähnlichkeit der Eigengruppe ein Index berechnet. Eine einfaktorielle Varianzanalyse mit wahrgenommener Ähnlichkeit als abhängiger Variable ergab keinen signifikanten Effekt der experimentalen Bedingung. Allerdings zeigte sich beim Vergleich der Ähnlichkeits- und Vielfältigkeitsbedingung deskriptiv ein Trend in die vorhergesagte Richtung (M Ä = 3.67, SD Ä = 1.13, M V = 3.36, SD V = 1.10). Zur Erfassung von Projektion berechneten wir intraindividuelle Korrelationen zwischen Selbst- und Gruppeneinschätzungen, sowie die euklidische Distanz. Hierfür werden die Selbst- von den Gruppeneinschätzungen abgezogen und die Differenzen anschließend aufsummiert. Auch hier ergaben sich keine signifikanten Effekte auf den abhängigen Variablen, alle Fs < 1. Doch wie auch in früheren Untersuchungen zeigte sich ein Haupteffekt der sozialen Kategorie, und zwar derart, dass auf die Eigengruppe mehr projiziert wird als auf die Fremdgruppe. So waren die Werte der Korrelationen für die Eigengruppe größer als für die Fremdgruppe (M EG =.21, SD =.29, M FG =.11, SD =.25). Da sich keine signifikanten Unterschiede in Abhängigkeit von der experimentalen Bedingung ergaben, wurde nun die wahrgenommene Ähnlichkeit (kontinuierlich) als Prädiktor genutzt. Daraufhin ergaben sich bei allen Biasmaßen zwar keine signifikanten Effekte aber konsistente Ergebnisse. Sowohl bei der Einstellung, als auch beim Thermometermaß zeigte sich in der einfaktoriellen Varianzanalyse, dass Deutsche vor allem in der Ähnlichkeitsbedingung positiver eingeschätzt wurden als Polen, Fs < 1.6. Wie angenommen, ergaben sich signifikante Zusammenhänge zwischen den berechneten Maßen. Es zeigte sich, dass mit zunehmender Projektion, gemessen durch die euklidische Distanz, eine bessere Bewertung der Eigengruppe relativ zur Fremdgruppe einhergeht, r(62) = -.24, p =.059. Ein weiterer Zusammenhang zeigte sich zwischen dem Manipulationscheck und der Korrelation von der Selbst- und Eigengruppeneinschätzung, r(62) = 0.25, p =.042. Das könnte bedeuten, je ähnlicher die Eigengruppe wahrgenommen wurde, desto stärker projizierten die Probanden auf sie. 4. Diskussion Ziel der Untersuchung war es zu zeigen, dass der Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit und Eigengruppenfavorisierung über soziale Projektion vermittelt wird. Hypothesenkonform wurde ein bisher noch nie gezeigter Zusammenhang zwischen wahrgenommener Ähnlichkeit und Projektion bei den positiven Selbstratings gefunden. Weiterhin fand sich eine Verbindung von sozialer Projektion und Eigengruppenfavorisierung. Damit wurden zwei der drei angenommenen Pfade nachgewiesen. Doch die Hypothese, laut derer sich ein Zusammenhang zwischen Variabilität und Eigengruppenfavorisierung vermittelt durch soziale Projektion zeigen sollte, konnte nicht bestätigt werden. Möglicherweise war die Manipulation das entscheidende Problem. So wurden in der Vielfältigkeitsbedingung weniger relevante Stichpunkte aufgezählt und somit blieb die Manipulation eventuell wirkungslos. Fraglich ist auch, ob Polen als Fremdgruppe geeignet ist. Um soziale Erwünschtheit auszuschließen, sollten daher auch implizite Maße eingesetzt werden. 5. Literatur Gaertner, L., & Schopler, J. (1998). Perceived ingroup entitativity and intergroup bias: an interconnection of self and others. European Journal of Social Psychology, 28, Krueger, J. I. (2007). From social projection to social behavior. European Review of Social Psychology, 18, Otten, S., & Wentura, D. (2001). Self-Anchoring and in-group favoritism: An individual profiles analysis. Journal of Experimental Social Psychology, 37, Simon, B. & Brown, R. (1987). Perceived intragroup homogeneity in minority-majority contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 53, Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in social psychology. Cambridge: Cambrigde University Press. 29
30 Gruppe 13 Gute Stimmung, schlechte Stimmung: Hat sie einen Einfluss auf kognitive Kontrollprozesse Sven Kachel, Elena Partschefeld, Stefanie Schneider, Robert Wegner, Christian Zeeh 1. Einleitung Leitung: Jutta Eber Die kognitiven Prozesse des Menschen weisen eine enorme Effizienz auf. In der Durchführung begriffene Aufgaben werden vor einer Unterbrechung durch zielinkongruente Handlungstendenzen geschützt und gleichzeitig wird ein hohes Ausmaß an Flexibilität gegenüber sich verändernden externalen und internalen Umständen gewährleistet (Mayr & Keele, 2000). Eine Abfolge verschiedener Handlungen erfordert immer einen Aufgabenwechsel. Nach Mayr & Keele (2000) ist eine Komponente die Inhibition der vorhergehenden Aufgabe, die daher auch als rückwärtsgerichtete Inhibition (im Folgenden als BI abgekürzt) bezeichnet wird. Um BI angemessen zu operationalisieren, werden drei verschiedene Aufgaben verwendet, A, B, C, wobei zwei Aufgabenreihenfolgen, nämlich ABA und CBA miteinander verglichen werden. In beiden Abfolgen erfolgt ein Wechsel von B nach A. Bei ABA erfolgt jedoch ein Wechsel auf ein kürzlich verwendetes Aufgabenset. Die Bearbeitung der dritten Aufgabe der ABA-Reihenfolge dauert länger, relativ zur Reihenfolge CBA, aufgrund der zu überwindenden Inhibition. Diese, als BI-Effekt bezeichnete Reaktionszeitdifferenz sollte zunächst von uns reproduziert werden. Es gibt Hinweise darauf, dass Inhibition von der gegenwärtigen Stimmung beeinflusst wird. Phillips et al. (2002) induzierten positive oder neutrale Stimmung bei Probanden, bevor diese die Stroop- Aufgabe, welche ein Indikator für Inhibition ist, lösen mussten. Probanden mit positiver Stimmung produzierten signifikant höhere Wechsel- und Stroopkosten, als Probanden mit neutraler Stimmung. Daraus lässt sich folgende Hypothese ableiten: Probanden mit positiver Stimmung sollten, relativ zu Probanden mit neutraler Stimmung, einen schwächeren BI aufweisen. Durch den Vergleich von Blöcken mit und ohne Aufgabenwiederholungen erhofften wir uns Indizien bzgl. des zeitlichen Auftretens und der Beeinflussbarkeit von BI. Findet Inhibition direkt nach gelösten Aufgaben statt, müsste der BI-Effekt in Blöcken geringer sein, in denen auch direkte Aufgabenwiederholungen vorkommen. Wissen die Probanden um eine mögliche Wiederholung, sollte eine Aufgabe weniger Inhibition werden, da es sich bei der nächsten Aufgabe um die gleiche handeln könnte. Laut Hypothese fällt der BI in Blöcken mit Aufgabenwiederholung geringer aus, als in Blöcken ohne Aufgabenwiederholung. 2. Methode An unserem Experiment nahmen insgesamt 56 Versuchspersonen teil, von denen jedoch nur 50 (11, 39 ; Durchschnittsalter 20,90 Jahre) in unseren Analysen berücksichtigt werden konnten. Jede Versuchsperson wurde zu Beginn zufällig einer der beiden Bedingungen positiv vs. neutral zugeordnet. Mittels der Kurzform des mehrdimensionalen Befindlichkeitsfragebogens (Steyer et al, 1997) erhoben wir die Stimmung vor der Stimmungsinduktion. Diese erfolgte anschließend durch die Präsentation dreiminütiger, bereits validierter, Filme (Haase & Silbereisen, 2007). Probanden in der positiven Bedingung erhielten zur weiteren Kontrastierung zusätzlich eine kleine Süßigkeit (neutral am Ende). Nach der Induktion wurde abermals mittels MDBF die Stimmung erhoben, bevor das eigentliche Experiment gestartet wurde. Das Computerexperiment bestand aus zwei Übungsblöcken zur Gewöhnung an die Aufgabe und je fünf Blöcken mit bzw. ohne Aufgabenwiederholung (Reihenfolge ausbalanciert) à 38 Trials. Die zu unterscheidenden Stimuli bestanden aus geometrischen Formen (Kreis/Viereck) in zwei Farben (gelb/blau) und zwei Größen (groß/klein), aus denen sich die drei Aufgaben Kontur, Farbe, Größe 30
31 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress ergaben. Dem 300ms lang präsentierten Aufgaben-Cue (K, F, G) folgte ein 100ms-Cue-Stimulus- Intervall. Anschließend wurde der Stimulus so lange präsentiert, bis eine Reaktion erfolgte. Das Response-Cue-Intervall betrug 600ms. Es wurden Reaktionszeit und Fehleranzahl gemessen. 3. Ergebnisse Die Daten wurden nach Tukey (1977) bereinigt. Von der Analyse ausgeschlossen wurden außerdem jeweils die ersten beiden Durchgänge jedes Block sowie fehlerhafte Aufgaben und die beiden darauf folgenden Aufgaben, da in diesen Fällen keine fehlerfreie Dreiersequenz gegeben war. Eine varianzanalytische Überprüfung der Stimmungs-induktion ergab eine signifikante Interaktion zwischen dem Zeitpunkt der Stimmungsmessung und der Art der Stimmungsinduktion, F(1,48) = 19.65, p <.01. Weitere Analysen zeigten, dass sich die Gruppen vor der Induktion nicht unterschieden, F(1,48) = 1.62, p =.21. Nach dieser zeigten sich bei der positiven Gruppe allerdings höhere Stimmungswerte, F(1,48) = 6.62, p <.05 (Abb. 1). Die Auswertung der Reaktionszeiten erfolgte ebenfalls durch eine Varianzanalyse mit Messwiederholung. Dabei nutzten wir ein 2x2x2x2 Design mit BI (ABA vs. CBA) als ersten und Wiederholung (mit vs. ohne) als zweiten Innersubjektfaktor. Zwischensubjektfaktoren waren die induzierte Stimmung Reaktionszeiten in ms Abb. 2. Backward Inhibition (positiv vs. neutral) und die Reihenfolge (ohne/mit Wiederholung vs. mit/ohne Wiederholung). Wir fanden einen deutlichen BI-Effekt F(1,46) = 18.36, p <.01 (Abb. 2). Die Interaktion zwischen BI und Stimmung wurde nicht signifikant, F(1,46) = 0.11, p =.75. Ebenso wurde keine signifikante Interaktion zwischen BI und dem Aufgabenwiederholungsfaktor gefunden, F(1,46) = 1.46, p = ,32 15,44 17,84 16,24 vorher neutral positiv nachher Abb. 1. Stimmungsinduktion 905 CBA 942 ABA 4. Diskussion In unserer Untersuchung konnten wir den BI-Effekt replizieren. Ein Einfluss der Stimmung auf die diesen trat allerdings nicht auf. Eine Ursache dafür könnte sein, dass die Stimmungsinduktion, trotz signifikanter Unterschiede zwischen der neutralen und der positiven Gruppe, zu schwach war, um den BI-Effekt zu beeinflussen. Möglich wäre aber auch, dass sich die Einflüsse von neutraler und positiver Stimmung auf kognitive Prozesse gar nicht unterscheiden. Eventuell könnten größere Stimmungsunterschiede mit einer negativen Gruppe erzielt werden und so auch eher ein Einfluss auf BI festgestellt werden. Auch die dritte Hypothese bestätigte sich nicht. Aufgabenwiederholung hatte entgegen unseren Erwartungen keinen Einfluss auf den BI-Effekt. Diese Untersuchung legt daher eher nah, dass Inhibition nicht direkt nach einer Aufgabe stattfindet, sondern erst die nächste Aufgabe die vorhergehende unterdrückt. 5. Literatur Haase, C. & Silbereisen, R. K. (2007). Affective influences on risk decision-making in adolescents and young adults. Manuskript in Vorbereitung. Mayr, U. & Keele, S.W. (2000). Changing constraints on action: The role of backward inhibition. Journal of Experimental Psychology: General, 129, Phillips, L.H., Bull, R., Adams, E. & Fraser, L. (2002). Positive Mood and executive functions: Evidence from Stroop and fluency tasks. Emotion, 2, Steyer, R., Schwenkmezger, P., Notz, P. & Eid, M. (1997). Der Mehrdimensionale Befindlichkeitsfragebogen (MDBF). Göttingen: Hogrefe. Tukey, J.W. (1977). Exploratory data analysis. Reading, MA: Addison-Wesley. 31
32 Gruppe 14 Jugendliche auf dem Weg zur ersten Partnerschaft Prädiktoren für romantische Beziehungen Monique Krieg, Janine Müller, Nicole Osburg, Annemarie Rhode & Julia Schubert 1. Einleitung Leitung: Dr. Peter F. Titzmann & Dipl. Psych. Mohini Lokhande In jedem Abschnitt des menschlichen Lebens sind bestimmte Entwicklungsaufgaben an das Individuum gerichtet. Unter Anderem gehört in der Adoleszenz die Ausbildung romantischer Beziehungen dazu. Doch welcher Jugendliche findet wann und warum einen potentiellen Partner? Eventuell dahinter liegende Konstrukte können durch das bio psycho soziale Modell umfassend beschrieben werden: der Prädiktor / die unabhängige Variable pubertäre Reife deckt den biologischen Teil ab. Datingerfahrungen, Agency (dynamisches Zusammenspiel von individuellen Bemühungen, Shanahan & Hood, 2000), das aktive Aufsuchen von Freizeitkontexten, die nach Silbereisen, Noack und von Eye (1992) in private und öffentliche Kontexte geteilt werden; sowie die generelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung decken den psychologischen Teil der Prädiktoren ab. Als letzte Einheit stellen die gefühlte elterliche Kontrolle und soziale Netzwerke, gemessen durch das durchschnittliche Alter des Freundeskreises (Meschke & Silbereisen, 1997; Weichold & Silbereisen, 2007), den sozialen Teil dar. 2. Methode Untersucht wurde, ob diese Variablen interindividuelle Unterschiede im Wunsch nach einer romantischen Beziehung (in folgendem kurz: Wunsch) und im Status (hatten bereits einen romantischen Partner oder nicht, in folgendem kurz: Partner) vorhersagen konnten. Die daraus folgenden Hypothesen lauten: Je früher die pubertäre Reife eines Jugendlichen im Vergleich zu Gleichaltrigen ist, je höher die Selbstwirksamkeitsüberzeugung eines Jugendlichen ist, je häufiger ein Jugendlicher öffentliche Freizeitkontexte aufsucht & je mehr Kontakt ein Jugendlicher zu älteren Peers hat; umso größer ist der Wunsch nach einer romantischen Beziehung. Je früher die pubertäre Reife eines Jugendlichen im Vergleich zu Gleichaltrigen ist, je mehr Datingerfahrungen ein Jugendlicher aufweist, je höher die Selbstwirksamkeitsüberzeugung eines Jugendlichen ist & je mehr Kontakt ein Jugendlicher zu älteren Peers hat; umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine romantische Beziehung eingeht. Je stärker sich ein Jugendlicher von seinen Eltern kontrolliert fühlt, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit eine Liebesbeziehung zu haben. Es wurden 251 Gymnasiasten zwischen 12 und 20 Jahren als Stichprobe ausgewählt und per Fragebogen untersucht. Zuerst wurden Skalen der Items der entsprechenden Messinstrumente gebildet. Der Prädiktor Agency wurde durch die generelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung und das aktive Aufsuchen von Freizeitkontexten operationalisiert. Die Freizeitkontexte wurden durch Faktorenanalyse in zwei öffentliche Freizeitkontexte unterteilt: den sportlichen und den draufgängerischen Kontext. Als erstes wurden deskriptive Analysen und bivariate Korrelationen aller Variablen durchgeführt. Anschließend wurde anhand des Datensatz eine Multiple Lineare Hierarchische Regression mit der AV Wunsch und eine Multiple Logistische Hierarchische Regression mit der AV Partner gerechnet. 3. Ergebnisse Die Prädiktoren Aufsuchen von öffentlich draufgängerischen Freizeitkontexten, Datingerfahrungen, durchschnittliches Alter des Freundeskreises und empfundene elterliche Kontrolle korrelierten 32
33 2. Jenaer Empiriepraktikumskongress (bivariat) signifikant mit der AV Partner. Die AV Wunsch korrelierte signifikant mit pubertärer Reife, Aufsuchen von öffentlich draufgängerischen Freizeitkontexten und Datingerfahrungen. Die deskriptiven Analysen zeigten, dass die abhängige Variable Wunsch kaum Varianz hatte, nahezu alle Jugendlichen wünschten sich einen Partner. Nur in den 6. Klassen befanden sich 20,2 %, die keinen festen Partner wollten (im Vergleich zu 3% und 5% in den 9./11. Klassen). Die zweite abhängige Variable Partner verteilt sich auf 66,5% der Stichprobe, die schon einmal einen Partner hatten bzw. momentan einen haben. In beiden Regressionsanalysen wurden vier Blöcke nacheinander der Regressionsgleichung hinzugefügt: (1) Kontrollvariablen Alter & Geschlecht; (2) biologische Reife; (3) Aufsuchen von öffentlich sportlichen Freizeitkontexten, Aufsuchen von öffentlich draufgängerischen Freizeitkontexten, generelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Datingerfahrungen; (4) gefühlte elterliche Kontrolle und durchschnittliches Alter des Freundeskreises. Die gesamte Varianzaufklärung in der Variable Wunsch betrug 8,1 %; die Hypothesen konnten nicht bestätigt werden. Auch eine Aufteilung der Analyse nach den Klassenstufen brachte kein signifikantes Ergebnis hinsichtlich der aufgestellten Hypothesen. Für die Regressionsanalyse zur Vorhersage des Übergangs in die Partnerschaft wurden ebenfalls die oben erwähnten vier Blöcke nacheinander in die Regressionsgleichung aufgenommen. Es zeigte sich, dass mit jedem Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit den Übergang in eine romantische Beziehung bereits gemacht zu haben, um 50% steigt und dass das Aufsuchen von draufgängerischen öffentlichen Kontexten ebenfalls mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Übergangs zusammenhängt. Auch ein älterer Freundeskreis und größere Datingerfahrungen des Jugendlichen erhöhen die Wahrscheinlichkeit bereits einen romantischen Partner gehabt zu haben. Nicht bestätigt wurden die Hypothesen zu pubertärer Reife, generelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung, das Aufsuchen öffentlich sportlicher Kontexte und die gefühlte elterliche Kontrolle. 4. Diskussion Ein Ceiling Effekt (fehlende Varianz) bezüglich der AV Wunsch verhinderte die Vorhersage. Nur 24 der 163 Versuchspersonen (meist sehr junge) gaben an, sich keinen romantischen Partner zu wünschen. Wahrscheinlich wird dieser Wunsch bereits in einem Alter entwickelt, das unter dem unserer Stichprobe liegt. Offenbar hätten auch jüngere Untersuchungsteilnehmer erfasst werden müssen, um eine höhere Varianz des Partnerwunschs zu erhalten. Deshalb sollten sich zukünftige Studien zum Wunsch nach einer romantischen Partnerschaft auf Jugendliche vor dem 12. Lebensjahr beziehen. Da der beste gefundene Prädiktor Datingerfahrung (AV: Partner) auch Varianz weiterer damit verbundener Phänomene, wie pubertärer Reife und gefühlter elterlichen Kontrolle erklären könnte, ist es für nachkommende Forschung nötig, kausale Schlussfolgerungen durch längsschnittliche Untersuchungen durchzuführen. 5. Literatur Meschke, L.L. & Silbereisen, R.K. (1997): The influence of puberty, family processes, and leisure activities on the timing of first sexual experience. Shanahan, J.M. & Hood, E.K. (2000): Adolescents in Changing Social Structures: Bounded Agency in Life Course Perspective. Silbereisen, R.K., Peter Noack & Alexander von Eye (Januar 1992): Adolescents`Development of Romantic Friendship and Change in Favorite Leisure Contexts, Journal of Adolescent Research. 33
34 Gruppe 15 Die Uhr hat mich so angelacht Valenzimpulse auf Käuferentscheidungen Annika Huhn, Claudia Recksiedler, Stefanie Schmidt, Christiane Schütz, Kerstin Seifert 1. Fragestellung Leitung: Andreas Eder Im Online-Uhrenversand sowie in großen Einrichtungshäusern werden analoge Uhren überzufällig häufig auf dieselbe Zeit eingestellt (10 vor 2 bzw. 10 nach 10). Dieser speziellen Stellung der Zeiger liegt die Annahme zugrunde, dass dadurch eine Ähnlichkeit zu einem fröhlichen schematischen Gesichtsausdruck hergestellt wird ( Smiley ), dessen positive Valenz in die Kaufentscheidung einfließt. Uhren mit einer traurigen Zeigerstellung ( Grumpy ; 20 nach 8 bzw. 20 vor 4) sollten hingegen den gegenteiligen Effekt bewirken. In beiden Fällen sollte die Valenzverarbeitung nicht intendiert vorgenommen werden, da die Zeigerstellung kein rationales Kaufkriterium darstellt (wie z.b. der Preis oder das Aussehen). Irrelevante Valenzimpulse üben demnach einen Einfluss auf das Kaufverhalten aus. Darauf aufbauend leiteten wir folgende Hypothesen ab: Uhren mit Smiley -Zeigerstellung (10 vor 2; 10 nach 10) sollten in Entscheidungssituationen häufiger gewählt werden als Uhren mit einer neutralen Zeigerstellung, die wiederum gegenüber Uhren mit Grumpy -Zeigerstellung (20 nach 8; 20 vor 4) bevorzugt werden. Diese Hypothesen wurden in zwei Experimenten empirisch überprüft. Experiment 1b unterscheidet sich von Experiment 1a im verwendeten Bildmaterial und in zusätzlichen Präferenzentscheidungen zwischen zwei evaluativ kontrastierten Uhren (Smiley vs. Grumpy). 2. Methode Stichprobe. An Experiment 1a nahmen 151 Personen (99 Frauen, 52 Männer) von 18 bis 62 Jahren (M = 22,56) und in Experiment 1b 116 Personen (77 Frauen, 38 Männer) von 18 bis 33 Jahren (M = 21,93) teil. In beiden Experimenten wurde jeweils eine Person aufgrund eines repetitiven Antwortverhaltens (dieselbe Taste 95 % der Durchgänge) ausgeschlossen. Material. Als Stimulusmaterial dienten acht Fotos von möglichst ähnlichen Wanduhren. Sie wurden in 3 verschiedenen Zeigerstellungen fotografiert (siehe Abb. 1): Smiley (10 vor 2; 10 nach 10), Grumpy (20 vor 4; 20 nach 8) und neutrale Zeigerstellung (beide Zeiger auf einer Geraden). Von den 8 Bildern wurden zwei Sets mit je 4 Uhren gebildet; die Zuweisung der Zeigerstellung (evaluativ vs. neutral) zu den Uhrensets wurde über die Versuchspersonen hinweg ausbalanciert. Somit war jede Uhr in jeder Zeigerstellung zu sehen, sodass eine Konfundierung der Zeigermanipulation mit dem Bildmaterial ausgeschlossen ist. In Experiment 1b wurden drei Uhren mit Bildern von unauffälligeren Uhren ersetzt. Um Präferenzen für bestimmte Uhrengruppierungen vorzubeugen, wurden die beiden Bildsets über die Versuchsteilnehmer hinweg noch ein weiteres Mal durchmischt (zu insgesamt 4 Sets). Abbildung 1: Beispiel einer Uhr in Smiley -, Grumpy - und neutraler Zeigerstellung Prozedur. Beide Experimente wurden am Computer durchgeführt. Zu Beginn gaben die Probanden ihr Alter, ihr Geschlecht und ihren Studiengang/Beruf an. Danach sollten sie sich in eine Situation versetzen, in der sie für einen Freund eine Uhr kaufen wollen. In jedem Durchgang sollte eine von 34
Stereotypes as Energy-Saving Devices
 Stereotypes as Energy-Saving Devices Stereotype 2012 Henrik Singmann Was sind die vermuteten Vorteile davon Stereotype zu benutzen und was wäre die Alternative zum Stereotyp Gebrauch? Welche bisherige
Stereotypes as Energy-Saving Devices Stereotype 2012 Henrik Singmann Was sind die vermuteten Vorteile davon Stereotype zu benutzen und was wäre die Alternative zum Stereotyp Gebrauch? Welche bisherige
Beobachtung und Experiment II
 Beobachtung und Experiment II Methodologie der Psychologie Thomas Schmidt & Lena Frank Wintersemester 2003/2004 Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie Uni Göttingen Was ist ein Experiment? kontrollierte
Beobachtung und Experiment II Methodologie der Psychologie Thomas Schmidt & Lena Frank Wintersemester 2003/2004 Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie Uni Göttingen Was ist ein Experiment? kontrollierte
Glossar. Cause of Effects Behandelt die Ursache von Auswirkungen. Debriefing Vorgang der Nachbesprechung der experimentellen Untersuchung.
 Abhängige Variable Die zu untersuchende Variable, die von den unabhängigen Variablen in ihrer Ausprägung verändert und beeinflusst wird (siehe auch unabhängige Variable). Between-Subjects-Design Wenn die
Abhängige Variable Die zu untersuchende Variable, die von den unabhängigen Variablen in ihrer Ausprägung verändert und beeinflusst wird (siehe auch unabhängige Variable). Between-Subjects-Design Wenn die
Studie: Awareness of faces is modulated by their emotional meaning Autoren: M.Milders, A.Sahraie, S.Logan & N.Donnellon
 Studie: Awareness of faces is modulated by their emotional meaning Autoren: M.Milders, A.Sahraie, S.Logan & N.Donnellon Referenten: Janet Gaipel, Holger Heißmeyer, Elisabeth Blanke Empirisches Praktikum:
Studie: Awareness of faces is modulated by their emotional meaning Autoren: M.Milders, A.Sahraie, S.Logan & N.Donnellon Referenten: Janet Gaipel, Holger Heißmeyer, Elisabeth Blanke Empirisches Praktikum:
Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung
 Sprachen Valentina Slaveva Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität - Mainz Department of English and Linguistics
Sprachen Valentina Slaveva Sprachverarbeitung und Integration von stereotypen Erwartungen bei auditiver Wahrnehmung Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität - Mainz Department of English and Linguistics
Psycholinguistik. Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt.
 Psycholinguistik Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt. Teilgebiete der Psycholinguistik Können danach klassifiziert
Psycholinguistik Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt. Teilgebiete der Psycholinguistik Können danach klassifiziert
RER WÖRTER DURCH. Erfassung unbewusster Verarbeitung. Empirisches Praktikum: Methoden der / )
 ZUM EINFLUSS EMOTIONALER VALENZ AUF DIE DIE INDUKTION ILLUSIONÄRER W WIEDERHOLUNGSBLINDHEIT Empirisches Praktikum: Methoden der Erfassung unbewusster Verarbeitung Dozent: Prof. Michael Niedeggen Referent:
ZUM EINFLUSS EMOTIONALER VALENZ AUF DIE DIE INDUKTION ILLUSIONÄRER W WIEDERHOLUNGSBLINDHEIT Empirisches Praktikum: Methoden der Erfassung unbewusster Verarbeitung Dozent: Prof. Michael Niedeggen Referent:
Empirische Forschung. Übung zur Vorlesung Kognitive Modellierung. Kognitive Modellierung Dorothea Knopp Angewandte Informatik/ Kognitve Systeme
 Empirische Forschung Übung zur Vorlesung Kognitive Modellierung S. 1 Überblick: Forschungsprozess Theoriebil dung Auswertung Interpretation Operationalisierung Erhebung S. 2 Versuchsplanung Festlegung
Empirische Forschung Übung zur Vorlesung Kognitive Modellierung S. 1 Überblick: Forschungsprozess Theoriebil dung Auswertung Interpretation Operationalisierung Erhebung S. 2 Versuchsplanung Festlegung
Thema 2: Forschungsstrategien & Forschungsdesigns. PD Dr. Maximilian Sailer
 Thema 2: Forschungsstrategien & Forschungsdesigns PD Dr. Maximilian Sailer Lernziele Funktion Forschungsstrategien und Forschungsdesigns in den Sozialwissenschaften Experimentelle Forschung Versuchspläne
Thema 2: Forschungsstrategien & Forschungsdesigns PD Dr. Maximilian Sailer Lernziele Funktion Forschungsstrategien und Forschungsdesigns in den Sozialwissenschaften Experimentelle Forschung Versuchspläne
Messwiederholungen und abhängige Messungen
 Messwiederholungen und abhängige Messungen t Tests und Varianzanalysen für Messwiederholungen Kovarianzanalyse Thomas Schäfer SS 009 1 Messwiederholungen und abhängige Messungen Bei einer Messwiederholung
Messwiederholungen und abhängige Messungen t Tests und Varianzanalysen für Messwiederholungen Kovarianzanalyse Thomas Schäfer SS 009 1 Messwiederholungen und abhängige Messungen Bei einer Messwiederholung
Self-complexity and affective extremity. Präsentation von Katharina Koch Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie WS 11/12
 Self-complexity and affective extremity Präsentation von Katharina Koch Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie WS 11/12 Inhalt 1. Einführung 2. Struktur des Selbst Modell von P. Linville 3. Aufbau
Self-complexity and affective extremity Präsentation von Katharina Koch Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie WS 11/12 Inhalt 1. Einführung 2. Struktur des Selbst Modell von P. Linville 3. Aufbau
statistisch signifikanter Einfluss des Geschlechts (p <.05).
 Dickhäuser / Kapitel 5 38 KAPITEL 5: GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE IN COMPUTERSPEZIFISCHE ATTRIBUTIONEN UND DEREN EFFEKTE 1. QUALITATIVE ANALYSE VON COMPUTERSPEZIFISCHEN ATTRIBUTIONEN: Attributionstheorien (vgl.
Dickhäuser / Kapitel 5 38 KAPITEL 5: GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE IN COMPUTERSPEZIFISCHE ATTRIBUTIONEN UND DEREN EFFEKTE 1. QUALITATIVE ANALYSE VON COMPUTERSPEZIFISCHEN ATTRIBUTIONEN: Attributionstheorien (vgl.
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen
 Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Forschungsprojekt Stereotype Geschlechterrollen in den Medien Online Studie: Geschlechterrollenwahrnehmung in Videospielen Hintergrund Videospiele stellen die in ihnen handelnden Figuren häufig stereotyp
Evaluative Konditionierung
 Evaluative Konditionierung Seminar Einstellungen Dipl.-Psych. Johannes Ullrich SS 2007 10.05.2007 Referat: Felix Müller, Sabine Stock Evaluative Konditionierung Woher kommt das Mögen oder Nichtmögen von
Evaluative Konditionierung Seminar Einstellungen Dipl.-Psych. Johannes Ullrich SS 2007 10.05.2007 Referat: Felix Müller, Sabine Stock Evaluative Konditionierung Woher kommt das Mögen oder Nichtmögen von
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie
 Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Aufmerksamkeit II Bewusstsein
 Aufmerksamkeit II Bewusstsein VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Dipl.-Psych. S. Raisig, Humboldt Universität Berlin, WS 2008/2009 Wozu dient selektive Aufmerksamkeit? 1. Binding Problem Objekt wird von
Aufmerksamkeit II Bewusstsein VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Dipl.-Psych. S. Raisig, Humboldt Universität Berlin, WS 2008/2009 Wozu dient selektive Aufmerksamkeit? 1. Binding Problem Objekt wird von
Kipp/Opitz UdS 2007/08. Experimentalmethodik
 Experimentalmethodik Alltagspsychologie & Wissenschaftliche Psychologie nicht systematisch trennend zw. Richtigem und Falschem nicht methodisch kontrolliert geeignete Werkzeuge nicht kritische Überprüfung
Experimentalmethodik Alltagspsychologie & Wissenschaftliche Psychologie nicht systematisch trennend zw. Richtigem und Falschem nicht methodisch kontrolliert geeignete Werkzeuge nicht kritische Überprüfung
Wer ist wirklich hochsensibel?
 Biological and Experimental Psychology School of Biological and Chemical Sciences Wer ist wirklich hochsensibel? Ein Workshop zur Messung von Sensitivität Michael Pluess, PhD HSP Kongress, Münsingen, Schweiz,
Biological and Experimental Psychology School of Biological and Chemical Sciences Wer ist wirklich hochsensibel? Ein Workshop zur Messung von Sensitivität Michael Pluess, PhD HSP Kongress, Münsingen, Schweiz,
Functional consequences of perceiving facial expressions of emotion without awareness
 Functional consequences of perceiving facial expressions of emotion without awareness Artikel von John D. Eastwood und Daniel Smilek Referent(Inn)en: Sarah Dittel, Carina Heeke, Julian Berwald, Moritz
Functional consequences of perceiving facial expressions of emotion without awareness Artikel von John D. Eastwood und Daniel Smilek Referent(Inn)en: Sarah Dittel, Carina Heeke, Julian Berwald, Moritz
THEORY OF MIND. Sozial-kognitive Entwicklung
 06.12.2010 THEORY OF MIND Sozial-kognitive Entwicklung Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozent: Dipl.-Psych. Susanne Kristen Referentin: Sabine Beil Gliederung 1. Definition und Testparadigma
06.12.2010 THEORY OF MIND Sozial-kognitive Entwicklung Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozent: Dipl.-Psych. Susanne Kristen Referentin: Sabine Beil Gliederung 1. Definition und Testparadigma
Emotional Design. Lehren und Lernen mit Medien II. Professur E-Learning und Neue Medien. Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät
 Professur E-Learning und Neue Medien Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät Lehren und Lernen mit Medien II Emotional Design Überblick Einführung CATLM Vermenschlichung und Farbe Klassifikation
Professur E-Learning und Neue Medien Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät Lehren und Lernen mit Medien II Emotional Design Überblick Einführung CATLM Vermenschlichung und Farbe Klassifikation
Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren
 Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren Parametrische Verfahren haben die Besonderheit, dass sie auf Annahmen zur Verteilung der Messwerte in der Population beruhen: die Messwerte sollten einer
Parametrische vs. Non-Parametrische Testverfahren Parametrische Verfahren haben die Besonderheit, dass sie auf Annahmen zur Verteilung der Messwerte in der Population beruhen: die Messwerte sollten einer
Methodenlehre. Vorlesung 6. Prof. Dr. Björn Rasch, Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg
 Methodenlehre Vorlesung 6 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre II Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 18.2.15 Psychologie als Wissenschaft
Methodenlehre Vorlesung 6 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre II Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 18.2.15 Psychologie als Wissenschaft
- Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen -
 - Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen - Eine Evaluierungsstudie zum Einfluss der Trainingsmaßnahme Job-Coaching auf personale Variablen von arbeitssuchenden AkademikerInnen
- Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit bei arbeitslosen AkademikerInnen - Eine Evaluierungsstudie zum Einfluss der Trainingsmaßnahme Job-Coaching auf personale Variablen von arbeitssuchenden AkademikerInnen
Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie
 Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie Heutiges Thema: Persönlichkeitstheorien Davidson: Frontale Asymmetrie Larissa Fuchs Gliederung 1. Wiederholung: Gray (BIS/BAS) & Eysenck 2. Davidson: Frontale
Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie Heutiges Thema: Persönlichkeitstheorien Davidson: Frontale Asymmetrie Larissa Fuchs Gliederung 1. Wiederholung: Gray (BIS/BAS) & Eysenck 2. Davidson: Frontale
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
 Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Fachtagung 17.09.2008, Luzern Alles too much! Stress, Psychische Gesundheit, Früherkennung und Frühintervention in Schulen Barbara Fäh, Hochschule für
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Fachtagung 17.09.2008, Luzern Alles too much! Stress, Psychische Gesundheit, Früherkennung und Frühintervention in Schulen Barbara Fäh, Hochschule für
Uli Monzel Universität des Saarlandes FR 5.3 Psychologie Seminar: Elektrophysiologie kognitiver Prozesse Dozentin: Nicola Ferdinand
 Uli Monzel Universität des Saarlandes FR 5.3 Psychologie Seminar: Elektrophysiologie kognitiver Prozesse Dozentin: Nicola Ferdinand Definition EKP Extraktion von Komponenten aus dem EEG Identifikation
Uli Monzel Universität des Saarlandes FR 5.3 Psychologie Seminar: Elektrophysiologie kognitiver Prozesse Dozentin: Nicola Ferdinand Definition EKP Extraktion von Komponenten aus dem EEG Identifikation
Volitionale Faktoren und Theory of Planned Behaviour: Moderatoranalysen
 Seminar 12644: Methoden theoriegeleiteter gesundheitspsychologischer Forschung Volitionale Faktoren und Theory of Planned Behaviour: Moderatoranalysen Urte Scholz & Benjamin Schüz www.fu-berlin.de berlin.de/gesund/
Seminar 12644: Methoden theoriegeleiteter gesundheitspsychologischer Forschung Volitionale Faktoren und Theory of Planned Behaviour: Moderatoranalysen Urte Scholz & Benjamin Schüz www.fu-berlin.de berlin.de/gesund/
Manche mögen s bildlich Individuelle Unterschiede im crossmodalen Satz-Bild Priming
 Manche mögen s bildlich Individuelle Unterschiede im crossmodalen Satz-Bild Priming Gerrit Hirschfeld & Pienie Zwitserlood Otto Creutzfeldt Center for Cognitive and Behavioral Neuroscience Ist Kognition
Manche mögen s bildlich Individuelle Unterschiede im crossmodalen Satz-Bild Priming Gerrit Hirschfeld & Pienie Zwitserlood Otto Creutzfeldt Center for Cognitive and Behavioral Neuroscience Ist Kognition
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung 1 Teststärkebestimmung a posteriori Berechnen der Effektgröße f aus empirischen Daten und Bestimmung
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung 1 Teststärkebestimmung a posteriori Berechnen der Effektgröße f aus empirischen Daten und Bestimmung
Optimal Experience in Work and Leisure Csikszentmihalyi, M. & LeFevre, J. (1989) Flow-Erleben in Arbeit und Freizeit. Überblick.
 Optimal Experience in Work and Leisure Csikszentmihalyi, M. & LeFevre, J. (1989) Flow-Erleben in Arbeit und Freizeit Schallberger, U. & Pfister, R. (2001) Patricia Wäger & Moira Torrico 18.12.2006 Proseminar
Optimal Experience in Work and Leisure Csikszentmihalyi, M. & LeFevre, J. (1989) Flow-Erleben in Arbeit und Freizeit Schallberger, U. & Pfister, R. (2001) Patricia Wäger & Moira Torrico 18.12.2006 Proseminar
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Anwendungsaufgaben. Effektgröße bei df Zähler = df A = 1 und N = 40 (zu berechnen aus df Nenner ): Der aufgedeckte Effekt beträgt also etwa 23 %.
 Anhang A: Lösungen der Aufgaben 39 beiden Kombinationen sehr hoch ist. (Dieses Ergebnis wäre aber in diesem Beispiel nicht plausibel.) 5. Der Faktor A und die Wechselwirkung werden signifikant: Lärm hat
Anhang A: Lösungen der Aufgaben 39 beiden Kombinationen sehr hoch ist. (Dieses Ergebnis wäre aber in diesem Beispiel nicht plausibel.) 5. Der Faktor A und die Wechselwirkung werden signifikant: Lärm hat
5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung
 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz U.R. Roeder - 66-5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung 5.1 Die Hypothesen Im Rahmen dieser Arbeit können nur wenige der im theoretischen
Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz U.R. Roeder - 66-5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung 5.1 Die Hypothesen Im Rahmen dieser Arbeit können nur wenige der im theoretischen
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION. Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme
 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION 1 Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme ÜBERSICHT Entwicklungspsychologie Einführung Faktoren der Entwicklung Geschlechterunterschiede Diskussionen
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE & SOZIALISATION 1 Mädchenschachpatent 2015 in Nußloch Referentin: Melanie Ohme ÜBERSICHT Entwicklungspsychologie Einführung Faktoren der Entwicklung Geschlechterunterschiede Diskussionen
Dipl.-Psych. Sascha Purmann Titel der Dissertation: Different Mechanisms Underlying Adaptation to Frequent and Adaptation to Recent Conflict
 Dipl.-Psych. Sascha Purmann Titel der Dissertation: Different Mechanisms Underlying Adaptation to Frequent and Adaptation to Recent Conflict Wenn man sich verdeutlicht, welche Menge an Informationen unseren
Dipl.-Psych. Sascha Purmann Titel der Dissertation: Different Mechanisms Underlying Adaptation to Frequent and Adaptation to Recent Conflict Wenn man sich verdeutlicht, welche Menge an Informationen unseren
Zum Einfluss von Angriffsurheber und Angriffsobjekt beim Negative Campaigning
 Zum Einfluss von Angriffsurheber und Angriffsobjekt beim Negative Campaigning Universität Hohenheim, März 2012 Inhalt 1. Projektvorstellung 2. Allgemeines 3. Ergebnisse zu den Hypothesen 4. Beantwortung
Zum Einfluss von Angriffsurheber und Angriffsobjekt beim Negative Campaigning Universität Hohenheim, März 2012 Inhalt 1. Projektvorstellung 2. Allgemeines 3. Ergebnisse zu den Hypothesen 4. Beantwortung
Der Einfluss sozialer Faktoren auf die individuelle Musikwahrnehmung
 Der Einfluss sozialer Faktoren auf die individuelle Musikwahrnehmung Die emotionale Rezeption von Musik in einem Gruppengefüge Präsentation von Freya van Husen, Julian Hensel und Marian Lepke vom 20.07.2018
Der Einfluss sozialer Faktoren auf die individuelle Musikwahrnehmung Die emotionale Rezeption von Musik in einem Gruppengefüge Präsentation von Freya van Husen, Julian Hensel und Marian Lepke vom 20.07.2018
Attribution. Unterschied zwischen Akteur und Beobachter
 Attribution Unterschied zwischen Akteur und Beobachter Christine Faist & Carina Gottwald Seminar: Soziale Kognition 2.Fachsemester Datum: 25.04.2012, 10.00 12.00 Überblick Hypothese Nisbett und Jones Watson
Attribution Unterschied zwischen Akteur und Beobachter Christine Faist & Carina Gottwald Seminar: Soziale Kognition 2.Fachsemester Datum: 25.04.2012, 10.00 12.00 Überblick Hypothese Nisbett und Jones Watson
Aufgaben zu Kapitel 7:
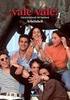 Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Fragestellung Fragestellungen
 Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROZESSE BEI PATIENTEN MIT POSTTRAUMATISCHER VERBITTERUNGSSTÖRUNG
 INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROZESSE BEI PATIENTEN MIT POSTTRAUMATISCHER VERBITTERUNGSSTÖRUNG Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) im Fach Psychologie
INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROZESSE BEI PATIENTEN MIT POSTTRAUMATISCHER VERBITTERUNGSSTÖRUNG Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) im Fach Psychologie
Die automatische Aktivierung von Verhalten: die Befunde von John Bargh
 Die automatische Aktivierung von Verhalten: die Befunde von John Bargh Claudia Lange SoSe 2012 21.6.2012 Seminar Soziale Kognition Inhaltsverzeichnis O Grundlage: Priming O Erinnerung: automatische vs.
Die automatische Aktivierung von Verhalten: die Befunde von John Bargh Claudia Lange SoSe 2012 21.6.2012 Seminar Soziale Kognition Inhaltsverzeichnis O Grundlage: Priming O Erinnerung: automatische vs.
Die Rolle von Ähnlichkeit bei Beratungsangeboten für Frauen mit HIV
 Die Rolle von Ähnlichkeit bei Beratungsangeboten für Frauen mit HIV Eine experimentelle Untersuchung FernUniversität in Hagen / Horst Pierdolla Überblick Theorie und Forschungsstand Methode Ergebnisse
Die Rolle von Ähnlichkeit bei Beratungsangeboten für Frauen mit HIV Eine experimentelle Untersuchung FernUniversität in Hagen / Horst Pierdolla Überblick Theorie und Forschungsstand Methode Ergebnisse
Methodenlehre. Vorlesung 13. Prof. Dr. Björn Rasch, Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg
 Methodenlehre Vorlesung 13 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 19.05.15 Methodenlehre II Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 18.2.15 Psychologie
Methodenlehre Vorlesung 13 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 19.05.15 Methodenlehre II Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 18.2.15 Psychologie
Aufgaben zu Kapitel 5:
 Aufgaben zu Kapitel 5: Aufgabe 1: Ein Wissenschaftler untersucht, in wie weit die Reaktionszeit auf bestimmte Stimuli durch finanzielle Belohnung zu steigern ist. Er möchte vier Bedingungen vergleichen:
Aufgaben zu Kapitel 5: Aufgabe 1: Ein Wissenschaftler untersucht, in wie weit die Reaktionszeit auf bestimmte Stimuli durch finanzielle Belohnung zu steigern ist. Er möchte vier Bedingungen vergleichen:
Forschungsbericht. Effekt bildlicher Warnhinweise auf die Einstellung Jugendlicher zum Zigarettenrauchen
 Forschungsbericht Effekt bildlicher Warnhinweise auf die Einstellung Jugendlicher zum Zigarettenrauchen PD Dr. Matthis Morgenstern Ramona Valenta, M.Sc. Prof. Dr. Reiner Hanewinkel Institut für Therapie-
Forschungsbericht Effekt bildlicher Warnhinweise auf die Einstellung Jugendlicher zum Zigarettenrauchen PD Dr. Matthis Morgenstern Ramona Valenta, M.Sc. Prof. Dr. Reiner Hanewinkel Institut für Therapie-
Kognitive Neurowissenschaften am Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie
 Kognitive Neurowissenschaften am Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie Beteiligte Abteilungen Experimentelle Psychologie (Prof. Mattler) Kognitive Neurowissenschaften und Biopsychologie (Prof. Treue
Kognitive Neurowissenschaften am Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie Beteiligte Abteilungen Experimentelle Psychologie (Prof. Mattler) Kognitive Neurowissenschaften und Biopsychologie (Prof. Treue
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (010). Quantitative Methoden. Band (3. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (010). Quantitative Methoden. Band (3. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Formulierung und Transformation von Hypothesen Prüfung am Beispiel des Artikels von Bailer, Takats, & Westermeier, 2001)
 Formulierung und Transformation von Hypothesen Prüfung am Beispiel des Artikels von Bailer, Takats, & Westermeier, 2001) Die Forschungshypothesen sind auf S. 270 formuliert. Bailer et al. sprechen nicht
Formulierung und Transformation von Hypothesen Prüfung am Beispiel des Artikels von Bailer, Takats, & Westermeier, 2001) Die Forschungshypothesen sind auf S. 270 formuliert. Bailer et al. sprechen nicht
Methodenlehre. Vorlesung 12. Prof. Dr. Björn Rasch, Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg
 Methodenlehre Vorlesung 12 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre II Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 18.2.15 Psychologie als Wissenschaft
Methodenlehre Vorlesung 12 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre II Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 18.2.15 Psychologie als Wissenschaft
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Überwindung von Dropout durch emotionale Bindung und Spaß am Sport
 Überwindung von Dropout durch emotionale Bindung und Spaß am Sport Prof. Dr. Darko Jekauc ARBEITSBEREICH: GESUNDHEITSBILDUNG UND SPORTPSYCHOLOGIE INSTITUT FÜR SPORT UND SPORTWISSENSCHAFT FAKULTÄT FÜR GEISTES-
Überwindung von Dropout durch emotionale Bindung und Spaß am Sport Prof. Dr. Darko Jekauc ARBEITSBEREICH: GESUNDHEITSBILDUNG UND SPORTPSYCHOLOGIE INSTITUT FÜR SPORT UND SPORTWISSENSCHAFT FAKULTÄT FÜR GEISTES-
Intergruppenkontakt. Präsentation von: Jennifer Di Gangi Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie Autor: Wilder (1984)
 Intergruppenkontakt Präsentation von: Jennifer Di Gangi Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie Autor: Wilder (1984) 1 Kontakt zwischen Gruppen Einführung in die Studien Experiment 1 Experiment 2 Experiment
Intergruppenkontakt Präsentation von: Jennifer Di Gangi Seminar: Themenfelder der Sozialpsychologie Autor: Wilder (1984) 1 Kontakt zwischen Gruppen Einführung in die Studien Experiment 1 Experiment 2 Experiment
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Minderheiteneinfluss
 Minderheiteneinfluss Prof. B. Schäfer WS 2005/06 Referat von: Maike Steinhoff, Kathrin Staufenbiel, Kati Keuper... Einfluss einer konsistenten Minorität auf das Verhalten einer Majorität bei einer Farbwahrnehmungsaufgabe
Minderheiteneinfluss Prof. B. Schäfer WS 2005/06 Referat von: Maike Steinhoff, Kathrin Staufenbiel, Kati Keuper... Einfluss einer konsistenten Minorität auf das Verhalten einer Majorität bei einer Farbwahrnehmungsaufgabe
Trendanalyse zu Burnout bei Studierenden
 Franziska Wörfel, Katrin Lohmann, Burkhard Gusy Trendanalyse zu Burnout bei Studierenden Hintergrund Seit Einführung der neuen Studiengänge mehren sich die Beschwerden über psychische Belastungen bei Studierenden.
Franziska Wörfel, Katrin Lohmann, Burkhard Gusy Trendanalyse zu Burnout bei Studierenden Hintergrund Seit Einführung der neuen Studiengänge mehren sich die Beschwerden über psychische Belastungen bei Studierenden.
Epistemische Motivation als Grundlage für Social Tuning. Olga Streich Seminar: Soziale Kognition und Attribution
 Epistemische Motivation als Grundlage für Social Tuning Olga Streich Seminar: Soziale Kognition und Attribution 18.01.2012 Gliederung Was ist Social Tuning? Studie von Lun, Sinclair, Whitchurch und Glenn:
Epistemische Motivation als Grundlage für Social Tuning Olga Streich Seminar: Soziale Kognition und Attribution 18.01.2012 Gliederung Was ist Social Tuning? Studie von Lun, Sinclair, Whitchurch und Glenn:
Aufgaben zu Kapitel 3
 Aufgaben zu Kapitel 3 Aufgabe 1 a) Berechnen Sie einen t-test für unabhängige Stichproben für den Vergleich der beiden Verarbeitungsgruppen strukturell und emotional für die abhängige Variable neutrale
Aufgaben zu Kapitel 3 Aufgabe 1 a) Berechnen Sie einen t-test für unabhängige Stichproben für den Vergleich der beiden Verarbeitungsgruppen strukturell und emotional für die abhängige Variable neutrale
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse
 Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Eike Fittig, Johannes Schweizer & Udo Rudolph Technische Universität Chemnitz/ Klinikum Chemnitz. Dezember 2005
 Lebenszufriedenheit bei chronischen Erkrankungen: Zum wechselseitigen Einfluss von Strategien der Krankheitsbewältigung, Depression und sozialer Unterstützung Technische Universität Chemnitz/ Klinikum
Lebenszufriedenheit bei chronischen Erkrankungen: Zum wechselseitigen Einfluss von Strategien der Krankheitsbewältigung, Depression und sozialer Unterstützung Technische Universität Chemnitz/ Klinikum
Mutabor Therapeutische Tagesstätte am Stemmerhof. Evaluation von Behandlungseffekten
 Dr. Barbara Baur (Dipl.-Psych.) Wissenschaftliche Beratung und Evaluation XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX Tel.: XXX-XXXXXXXX Email: XXXXXX@lXXXXX.XXX Mutabor Therapeutische Tagesstätte am Stemmerhof Evaluation
Dr. Barbara Baur (Dipl.-Psych.) Wissenschaftliche Beratung und Evaluation XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX Tel.: XXX-XXXXXXXX Email: XXXXXX@lXXXXX.XXX Mutabor Therapeutische Tagesstätte am Stemmerhof Evaluation
Auswertung des IAT anla sslich der Ausstellung Check Your Stereotypes
 Hanna Schiff, Honorata Kaczykowski-Patermann, Renate Schubert Auswertung des IAT anla sslich der Ausstellung Check Your Stereotypes Was ist der IAT? Stereotype sind Wegbereiter für Vorurteile und Diskriminierungen.
Hanna Schiff, Honorata Kaczykowski-Patermann, Renate Schubert Auswertung des IAT anla sslich der Ausstellung Check Your Stereotypes Was ist der IAT? Stereotype sind Wegbereiter für Vorurteile und Diskriminierungen.
Experimentelle und quasiexperimentelle
 Experimentelle und quasiexperimentelle Designs Experimentelle Designs Quasi- experimenttel Designs Ex- post- facto- Desingns Experimentelle Designs 1. Es werden mindestens zwei experimentelle Gruppen gebildet.
Experimentelle und quasiexperimentelle Designs Experimentelle Designs Quasi- experimenttel Designs Ex- post- facto- Desingns Experimentelle Designs 1. Es werden mindestens zwei experimentelle Gruppen gebildet.
Einstellung als kurzlebige Bewertungen. von Susanne, Corinna und Jan
 Einstellung als kurzlebige Bewertungen von Susanne, Corinna und Jan Als erstes benötigen wir beispielhaft ein paar Einstellungen... Einstellungsobjekte: Fernsehprogramm (Bipolar) Umweltschutz (Unipolar)
Einstellung als kurzlebige Bewertungen von Susanne, Corinna und Jan Als erstes benötigen wir beispielhaft ein paar Einstellungen... Einstellungsobjekte: Fernsehprogramm (Bipolar) Umweltschutz (Unipolar)
Leon Festinger Theorie der kognitiven Dissonanz. Referenten: Bastian Kaiser, Jenja Kromm, Stefanie König, Vivian Blumenthal
 Leon Festinger Theorie der kognitiven Dissonanz Referenten: Bastian Kaiser, Jenja Kromm, Stefanie König, Vivian Blumenthal Gliederung klassisches Experiment Allgemeines zu Leon Festinger Vorüberlegungen
Leon Festinger Theorie der kognitiven Dissonanz Referenten: Bastian Kaiser, Jenja Kromm, Stefanie König, Vivian Blumenthal Gliederung klassisches Experiment Allgemeines zu Leon Festinger Vorüberlegungen
Ereignisse: Erinnerung und Vergessen
 Vergessen Der Selbstversuch von Ebbinghaus (~1880) Lernte 169 Listen mit je 13 sinnlosen Silben Versuchte diese Listen nach variablen Intervallen wieder zu lernen, und fand, dass offenbar ein Teil vergessen
Vergessen Der Selbstversuch von Ebbinghaus (~1880) Lernte 169 Listen mit je 13 sinnlosen Silben Versuchte diese Listen nach variablen Intervallen wieder zu lernen, und fand, dass offenbar ein Teil vergessen
Methodenlehre. Vorlesung 11. Prof. Dr. Björn Rasch, Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg
 Methodenlehre Vorlesung 11 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 03.12.13 Methodenlehre I Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 25.9.13 Psychologie
Methodenlehre Vorlesung 11 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 03.12.13 Methodenlehre I Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 25.9.13 Psychologie
Motivationale und volitionale Prozesse in der Handlungsinitiierung (Orbell & Sheeran, 2000)
 Seminar 12644: Methoden theoriegeleiteter gesundheitspsychologischer Forschung Motivationale und volitionale Prozesse in der Handlungsinitiierung (Orbell & Sheeran, 2000) Urte Scholz & Benjamin Schüz www.fu-berlin.de
Seminar 12644: Methoden theoriegeleiteter gesundheitspsychologischer Forschung Motivationale und volitionale Prozesse in der Handlungsinitiierung (Orbell & Sheeran, 2000) Urte Scholz & Benjamin Schüz www.fu-berlin.de
Gibt es einen intermanuellen Transfer bei der Prismen- Adaptation?
 Emperie- Referat Prismen- Adaptation von: Daniel Lang Hamadou Zarmakoye Katharina Walckhoff Kerstin Runde Moritz Walser Versuchsidee und Fragestellung Beim Blick durch eine Prismenbrille sieht man Gegenstände
Emperie- Referat Prismen- Adaptation von: Daniel Lang Hamadou Zarmakoye Katharina Walckhoff Kerstin Runde Moritz Walser Versuchsidee und Fragestellung Beim Blick durch eine Prismenbrille sieht man Gegenstände
Wie Vertrauen im Gehirn entsteht
 Wie Vertrauen im Gehirn entsteht Assoziierter Univ.-Prof. Mag. Dr. habil René Riedl University of Applied Sciences Upper Austria & Johannes Kepler University Linz Neuromarketing Kongress 2013 München,
Wie Vertrauen im Gehirn entsteht Assoziierter Univ.-Prof. Mag. Dr. habil René Riedl University of Applied Sciences Upper Austria & Johannes Kepler University Linz Neuromarketing Kongress 2013 München,
Wie entwickelt sich die Ablehnung gegenüber der Outgroup?
 Wie entwickelt sich die Ablehnung gegenüber der Outgroup? Stereotype 2012 Henrik Singmann Wann neigen wir eher dazu Menschen als Teil unserer Ingroup wahrzunehmen und was für Konsequenzen hat das? 2 Wann
Wie entwickelt sich die Ablehnung gegenüber der Outgroup? Stereotype 2012 Henrik Singmann Wann neigen wir eher dazu Menschen als Teil unserer Ingroup wahrzunehmen und was für Konsequenzen hat das? 2 Wann
Statistik III Regressionsanalyse, Varianzanalyse und Verfahren bei Messwiederholung mit SPSS
 Statistik III Regressionsanalyse, Varianzanalyse und Verfahren bei Messwiederholung mit SPSS Verena Hofmann Dr. phil. des. Departement für Sonderpädagogik Universität Freiburg Petrus-Kanisius-Gasse 21
Statistik III Regressionsanalyse, Varianzanalyse und Verfahren bei Messwiederholung mit SPSS Verena Hofmann Dr. phil. des. Departement für Sonderpädagogik Universität Freiburg Petrus-Kanisius-Gasse 21
Visuelles Bewusstsein und unbewusste Wahrnehmung. Thomas Schmidt Justus-Liebig-Universität Gießen Abteilung Allgemeine Psychologie 1
 Visuelles Bewusstsein und unbewusste Wahrnehmung Thomas Schmidt Justus-Liebig-Universität Gießen Abteilung Allgemeine Psychologie 1 Judas Priest, Stained Class (1978) Hemineglekt Nach Läsionen des rechten
Visuelles Bewusstsein und unbewusste Wahrnehmung Thomas Schmidt Justus-Liebig-Universität Gießen Abteilung Allgemeine Psychologie 1 Judas Priest, Stained Class (1978) Hemineglekt Nach Läsionen des rechten
TEIL 4: FORSCHUNGSDESIGNS UND UNTERSUCHUNGSFORMEN
 TEIL 4: FORSCHUNGSDESIGNS UND UNTERSUCHUNGSFORMEN GLIEDERUNG Forschungsdesign Charakterisierung Grundbegriffe Verfahrensmöglichkeit Störfaktoren Graphische Darstellung Arten von Störfaktoren Techniken
TEIL 4: FORSCHUNGSDESIGNS UND UNTERSUCHUNGSFORMEN GLIEDERUNG Forschungsdesign Charakterisierung Grundbegriffe Verfahrensmöglichkeit Störfaktoren Graphische Darstellung Arten von Störfaktoren Techniken
Methodenlehre. Vorlesung 12. Prof. Dr. Björn Rasch, Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg
 Methodenlehre Vorlesung 12 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre I Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 25.9.13 Psychologie als Wissenschaft
Methodenlehre Vorlesung 12 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre I Woche Datum Thema 1 FQ Einführung, Verteilung der Termine 1 25.9.13 Psychologie als Wissenschaft
Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development. Abell, Happé, & Frith (2000)
 Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development. Abell, Happé, & Frith (2000) 12. Dezember 2012 Theory of Mind bei Autismus 2 Theoretischer
Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development. Abell, Happé, & Frith (2000) 12. Dezember 2012 Theory of Mind bei Autismus 2 Theoretischer
Doing is for Thinking
 Doing is for Thinking Stereotype 2012 Henrik Singmann Fragen zu: Mussweiler, T. (2006). Doing Is for Thinking! Stereotype Activation by Stereotypic Movements. Psychological Science, 17(1), 17 21. doi:10.1111/j.1467-9280.2005.01659.x
Doing is for Thinking Stereotype 2012 Henrik Singmann Fragen zu: Mussweiler, T. (2006). Doing Is for Thinking! Stereotype Activation by Stereotypic Movements. Psychological Science, 17(1), 17 21. doi:10.1111/j.1467-9280.2005.01659.x
Hypothesentests mit SPSS
 Beispiel für eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung auf einem Faktor (univariate Lösung) Daten: POKIII_AG4_V06.SAV Hypothese: Die physische Attraktivität der Bildperson und das Geschlecht
Beispiel für eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung auf einem Faktor (univariate Lösung) Daten: POKIII_AG4_V06.SAV Hypothese: Die physische Attraktivität der Bildperson und das Geschlecht
VIII Experimentelle und quasi-experimentelle Designs
 VIII Experimentelle und quasi-experimentelle Designs Varianzkontrolle für die abhängige Variable Bestimmung von Vergleichsgruppen Modus für die Aufteilung der Versuchspersonen Vergleichsgruppen bestimmen
VIII Experimentelle und quasi-experimentelle Designs Varianzkontrolle für die abhängige Variable Bestimmung von Vergleichsgruppen Modus für die Aufteilung der Versuchspersonen Vergleichsgruppen bestimmen
methodenlehre ll ALM und Mehrfaktorielle ANOVA Mehrfaktorielle ANOVA methodenlehre ll ALM und Mehrfaktorielle ANOVA
 15.04.009 Das Allgemeine lineare Modell Post hoc Tests bei der ANOVA Mehrfatorielle ANOVA Thomas Schäfer SS 009 1 Das Allgemeine lineare Modell (ALM) Varianz als Schlüsselonzept "The main technical function
15.04.009 Das Allgemeine lineare Modell Post hoc Tests bei der ANOVA Mehrfatorielle ANOVA Thomas Schäfer SS 009 1 Das Allgemeine lineare Modell (ALM) Varianz als Schlüsselonzept "The main technical function
Anwendung von Multi-Level Moderation in Worst Performance Analysen
 Anwendung von Multi-Level Moderation in Worst Performance Analysen Präsentation auf der FGME 2015 - Jena Gidon T. Frischkorn, Anna-Lena Schubert, Andreas B. Neubauer & Dirk Hagemann 16. September 2015
Anwendung von Multi-Level Moderation in Worst Performance Analysen Präsentation auf der FGME 2015 - Jena Gidon T. Frischkorn, Anna-Lena Schubert, Andreas B. Neubauer & Dirk Hagemann 16. September 2015
Ergebnisse der Evaluation von MeisterPOWER
 Ergebnisse der Evaluation von MeisterPOWER Durchgeführt durch den Fachbereich Serious Games Kompetenzförderung durch adaptive Systeme der Universität Ulm Jun. Prof. Dr. Claudia Schrader Mag. Valentin Riemer
Ergebnisse der Evaluation von MeisterPOWER Durchgeführt durch den Fachbereich Serious Games Kompetenzförderung durch adaptive Systeme der Universität Ulm Jun. Prof. Dr. Claudia Schrader Mag. Valentin Riemer
Der Zusammenhang zwischen funktionellem Status und Krankheitseinsicht nach Schädel- Hirn-Trauma: Eine Längsschnittstudie
 Der Zusammenhang zwischen funktionellem Status und Krankheitseinsicht nach Schädel- Hirn-Trauma: Eine Längsschnittstudie Michael Schönberger, Ph.D, Dipl.-Psych. Jennie Ponsford, Adam McKay, Dana Wong,
Der Zusammenhang zwischen funktionellem Status und Krankheitseinsicht nach Schädel- Hirn-Trauma: Eine Längsschnittstudie Michael Schönberger, Ph.D, Dipl.-Psych. Jennie Ponsford, Adam McKay, Dana Wong,
Aufgaben zu Kapitel 7:
 Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Kapitel 6: Zweifaktorielle Varianzanalyse
 Kapitel 6: Zweifaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung 1 Teststärkebestimmung a posteriori 4 Berechnen der Effektgröße f² aus empirischen Daten und Bestimmung
Kapitel 6: Zweifaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung 1 Teststärkebestimmung a posteriori 4 Berechnen der Effektgröße f² aus empirischen Daten und Bestimmung
Zeitgefühl und mentale Vorstellung bei der Lauftechnik im Badminton
 283 Zeitgefühl und e Vorstellung bei der Lauftechnik im Badminton 1 Zielstellung R. Pretzlaff, J. Munzert (Projektleiter) Universität Gießen Institut für Sportwissenschaft Die vorliegenden Untersuchungen
283 Zeitgefühl und e Vorstellung bei der Lauftechnik im Badminton 1 Zielstellung R. Pretzlaff, J. Munzert (Projektleiter) Universität Gießen Institut für Sportwissenschaft Die vorliegenden Untersuchungen
Eine hohe Emotionserkennungsfähigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg
 Eine hohe Emotionserkennungsfähigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg Unter Emotionserkennungsfähigkeit (EEF) versteht man die Fähigkeit einer Person, die Gefühle anderer Menschen richtig einzuschätzen. Hierbei
Eine hohe Emotionserkennungsfähigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg Unter Emotionserkennungsfähigkeit (EEF) versteht man die Fähigkeit einer Person, die Gefühle anderer Menschen richtig einzuschätzen. Hierbei
Automaticity of Social Behavior: Direct Effects of Trait Construct and Stereotype Activation on Action
 : Direct Effects of Trait Construct and Stereotype Activation on Action John A. Bargh, Mark Chen and Lara Burrows New York University (1996) Journal of Personality and Social Psychology 1996, Vol.71, No.2
: Direct Effects of Trait Construct and Stereotype Activation on Action John A. Bargh, Mark Chen and Lara Burrows New York University (1996) Journal of Personality and Social Psychology 1996, Vol.71, No.2
Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz
 Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freie Universität Berlin Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Philosophie
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freie Universität Berlin Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Philosophie
Methodenlehre. Vorlesung 5. Prof. Dr. Björn Rasch, Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg
 Methodenlehre Vorlesung 5 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre I Woche Datum Thema 1 FQ 20.2.13 Einführung, Verteilung der Termine 1 25.9.13 Psychologie
Methodenlehre Vorlesung 5 Prof. Dr., Cognitive Biopsychology and Methods University of Fribourg 1 Methodenlehre I Woche Datum Thema 1 FQ 20.2.13 Einführung, Verteilung der Termine 1 25.9.13 Psychologie
Autismus besser verstehen
 Informationstag des Pädagogischen Zentrums Schleiz am 09.05.2015 zum Thema Hören / Autismus / Kommunikation Autismus besser verstehen Stefan R. Schweinberger Dana Schneider Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie
Informationstag des Pädagogischen Zentrums Schleiz am 09.05.2015 zum Thema Hören / Autismus / Kommunikation Autismus besser verstehen Stefan R. Schweinberger Dana Schneider Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie
Correspondence Bias & Actor-Observer Bias
 & Felix-Nicolai Müller & Amir Ghoniem Übung zur Vorlesung Sozialpsychologie (A) - SS2008 - Universität Trier Dipl.-Psych. Tina Langer & Dipl.-Psych. Rebecca Weil 28.05.2008 Felix-Nicolai Müller & Amir
& Felix-Nicolai Müller & Amir Ghoniem Übung zur Vorlesung Sozialpsychologie (A) - SS2008 - Universität Trier Dipl.-Psych. Tina Langer & Dipl.-Psych. Rebecca Weil 28.05.2008 Felix-Nicolai Müller & Amir
Kapitel 8: Verfahren für Rangdaten
 Kapitel 8: Verfahren für Rangdaten Der Mann-Whitney U-Test 1 Der Wilcoxon-Test 3 Der Kruskal-Wallis H-Test 4 Vergleich von Mann-Whitney U-Test und Kruskal-Wallis H-Test 6 Der Mann-Whitney U-Test In Kapitel
Kapitel 8: Verfahren für Rangdaten Der Mann-Whitney U-Test 1 Der Wilcoxon-Test 3 Der Kruskal-Wallis H-Test 4 Vergleich von Mann-Whitney U-Test und Kruskal-Wallis H-Test 6 Der Mann-Whitney U-Test In Kapitel
Zusammenfassung Wissenschaftliche Ausgangslage: Methoden, Theorien und Befunde... 14
 Inhaltsverzeichnis - 3 - Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung... 2 1 Einleitung... 9 2 Wissenschaftliche Ausgangslage: Methoden, Theorien und Befunde... 14 2.1 Die kognitive Neurowissenschaft von Entscheidungsprozessen...
Inhaltsverzeichnis - 3 - Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung... 2 1 Einleitung... 9 2 Wissenschaftliche Ausgangslage: Methoden, Theorien und Befunde... 14 2.1 Die kognitive Neurowissenschaft von Entscheidungsprozessen...
Eigene MC-Fragen 3409 (1 aus 5)
 Eigene MC-Fragen 3409 (1 aus 5) 1. Welche Aussage trifft nicht zu auf T1 Personality and sociocultural factors in intergroup attitudes: a cross-national comparison (Pettigrew, 1958) [a] Thomas Pettigrew
Eigene MC-Fragen 3409 (1 aus 5) 1. Welche Aussage trifft nicht zu auf T1 Personality and sociocultural factors in intergroup attitudes: a cross-national comparison (Pettigrew, 1958) [a] Thomas Pettigrew
Protokoll Der Einfluss von Plausibilität auf Ankereffekte
 Protokoll Der Einfluss von Plausibilität auf Ankereffekte Einzelbericht von Max Mustermann Vorgelegt im Rahmen der Lehrveranstaltung: Empiriepraktikum 3. FS Bachelor Psychologie WS XXX; Station XXX Universität
Protokoll Der Einfluss von Plausibilität auf Ankereffekte Einzelbericht von Max Mustermann Vorgelegt im Rahmen der Lehrveranstaltung: Empiriepraktikum 3. FS Bachelor Psychologie WS XXX; Station XXX Universität
