Forum Citizen Science Deutschland
|
|
|
- Susanne Frei
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) Bericht Nr. 13 Juni 2016 Herausgegeben von Lisa Pettibone, David Ziegler, Claudia Göbel, Anett Richter, Marie Grimm, Aletta Bonn und Katrin Vohland
2 Impressum Pettibone, L., Ziegler, D., Göbel, C., Richter, A., Grimm, M., Bonn, A. und Vohland, K. (2016): Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation, GEWISS Bericht Nr. 13. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ, Leipzig, Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (idiv) Halle-Jena-Leipzig, Leipzig; Berlin-Brandenburgisches Institut für Biodiversitätsforschung (BBIB), Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung MfN, Berlin. Online verfügbar unter Danksagung Die Herausgeberinnen und Herausgeber möchten sich bei Miriam Brandt, Martina Franzen, Julia Hahn, Leonhard Hennen, Inge Paulini und Michael Weber für die konzeptionelle Arbeit bei den Workshops und bei Susanne Hecker für die Moderation bedanken. Einen großen Dank richten wir auch an Marie Grimm und Alina Rupp vom MfN sowie alle helfende Hände der Berliner Stadt- Mission und an Veronika Neumeier und Arne Pinnschmidt vom UFZ/iDiv für die Unterstützung vor Ort. Herzlichen Dank an die Storyteller und die Impulsgebenden im Plenum und in den Workshops. Vielen Dank auch an alle Teilnehmenden für die rege Diskussion und den Enthusiasmus für Citizen Science, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Design & Layout Martina Gerber, GerberDesign; Vorlage von Tobias Tank, Burghardt & Tank GbR Disclaimer Dieser Bericht ist als Resultat einer Veranstaltung entstanden, deren Ziel es war, einen Raum für Diskussion in einem intensiv diskutierten Feld zu schaffen. Die in diesem Bericht geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen der beteiligten Organisationen übereinstimmen. Fotos Alle Fotos von Ralf Rebmann. Förderung und Fachbetreuung Das Projekt BürGEr schaffen Wissen WISSen schafft Bürger (GEWISS) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert (Fachbetreuung: Referat 113 Strategische Vorausschau, Wissenschaftskommunikation und DLR PT, Büro Wissenschaftskommunikation). GEWISS-Koordination BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) ist ein Bausteinprogramm zur Entwicklung von Citizen Science Kapazitäten. Als Konsortiumsprojekt wird es von Einrichtungen der Helmholtz- und der Leibniz-Gemeinschaft mit ihren universitären Partnern getragen. Beteiligte Partnereinrichtungen sind das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (idiv) Halle-Jena-Leipzig mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena; sowie das Berlin-Brandenburgische Institut für Biodiversitätsforschung (BBIB) mit den Institutionen Museum für Naturkunde Berlin (MfN), Leibniz Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Leibniz- Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) und der Freien Universität Berlin. Projektpartner sind außerdem der Leibniz-Forschungsverbund Biodiversität (LVB) und Wissenschaft im Dialog (WiD). Juni 2016 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (idiv) Halle-Jena-Leipzig, Helmholtz- Zentrum für Umweltforschung UFZ, Leipzig; Berlin-Brandenburgisches Institut für Biodiversitätsforschung (BBIB), Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung MfN, Berlin. Dieser Bericht ist online als Download verfügbar unter Inhalt Einleitung 4 Übersicht 5 Grußworte und Eröffnungs-Impuls 6 Science-Slam: Ocean Sampling Day 9 Ergebnisse aus GEWISS und buergerschaffenwissen.de 10 Storytelling-Session: Erfolgsgeschichten der Bürgerwissenschaft 14 Sensebox, Thomas Bartoschek 14 Beach Explorer, Rainer Borcherding 14 ispex: wie sauber ist der Himmel über Berlin, Ingrid Elbertse 15 Mundraub, Kai Gildhorn 15 Offene Naturführer, Alice Chodura und Gregor Hagedorn 16 Die Ofentechnologie der Mayener Töpferei-Industrie im Experiment, Michael Herdick 16 Füchse in der Stadt: Sophia Kimmig, Sarah Kiefer und die Kollegen am IZW 16 Tagfalter-Monitoring Deutschland, Elisabeth Kühn und Reinart Feldmann 17 Expedition Münsterland, Wilhelm Bauhus und Katarina Kühn 17 Verlust der Nacht-App, Christopher Kyba 17 Wissenschaftsläden als Partner im Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft, Daniel Ludwig 18 Grundschulkinder unterstützen Forschung zu Ökosystemfunktionen, Victoria L. Miczajka, Alexandra-Maria Klein und Gesine Pufal 19 umweltwikisachsen, Lutz Reiter 19 ArtenFinder, Oliver Röller 19 Landscape and You-th. Dem Flachs auf der Spur, Andrea Sieber 20 Landscape Change, Wolfgang Wende 20 Workshops 21 Citizen Science & Nachhaltigkeitsforschung 21 Citizen Science & Innovation, neue Formen der Partizipation 23 Citizen Science & gesellschaftliche Kohäsion 25 Citizen Science & strukturelle Änderungen im Wissenschaftssystem 27 Anschließende Podiumsdiskussion 29 Schlussworte 30 Fazit 32 Anhang: Liste der Teilnehmenden Personen und Institutionen 34 Anhang: Offizielles Programm 38 2 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Inhalt 3
3 Einleitung Das Kapazitätenaufbauprogramm für Citizen Science in Deutschland BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS), wird getragen von einem Konsortium aus Einrichtungen der Leibniz- und Helmholtz-Gemeinschaft und ihren universitären und nicht-universitären Partnern und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) von Mai 2014 bis Sep 2016 gefördert. Ziel von GEWISS ist es, die Citizen Science-Community in Deutschland besser zu vernetzen und den Bestand, Bedarf und Mehrwert von Citizen Science für die Wissenschaft und andere gesellschaftliche Bereiche zu diskutieren und abzuschätzen. Gleichzeitig soll analysiert werden, welche Barrieren es für einen Citizen Science- Ansatz gibt, und welche Möglichkeiten bestehen, diese zu überwinden und Kapazitäten für die Durchführung von Citizen Science- Projekten aufzubauen. Das GEWISS Programm startete mit zwei großen Veranstaltungen, dem Think Tank und der Auftaktveranstaltung, wo wichtige Impulse für eine thematische Schwerpunktsetzung gegeben wurden, die dann in den Dialogforen und weiteren Veranstaltungen bearbeitet wurden. Daraus entstanden themenspezifische Berichten, Trainingsmaterial, ein Tipps und Tricks Wiki, wissenschaftliche Publikationen, sowie das Grünbuch für eine Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland, das durch eine online Konsultation und 53 Positionspapiere öffentlich konsultiert wurde. Insgesamt waren an diesem Prozess 700 Personen aus 350 Organisationen beteiligt. Ziel des Forums Citizen Science war es, das Grünbuch vorzustellen, zu diskutieren und gemeinsam zu überlegen, welche (weiteren) gesellschaftlichen Anschlussbereiche es für Citizen Science gibt. Im Mittelpunkt standen erfolgreiche Citizen Science-Projekte, mit deren Initiatoren und Beteiligten interaktiv an kleinen Tischen diskutiert wurde, nachdem diese ihre Erfahrungen und Erkenntnisse im Storytelling-Format vorgetragen hatten. Die Veranstaltung wurde durch Diskussionsworkshops und eine Podiumsdiskussion abgerundet. Der Festsaal der Berliner Stadtmission diente als Tagungsort für das Forum Citizen Science. Übersicht Das Forum Citizen Science Deutschland wurde am 16. März 2016 von BürGEr schaffen WISSen (GEWISS) in den Tagungsräumen der Berliner Stadtmission in Berlin veranstaltet. Die 130 Teilnehmenden repräsentierten verschiedene Anspruchsgruppen, u. a. aus Bürgerforschung, Wissenschaftspolitik und Zivilgesellschaft. In positiver, teilweise fast schon familiärer Atmosphäre wurden die Potentiale von Citizen Science in Deutschland intensiv diskutiert. Nach einem Kurzfilm zum Thema eröffnete Susanne Hecker vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ und Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung als Moderatorin die Veranstaltung. 4 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Übersicht 5
4 Grußworte und Eröffnungs-Impuls Im Namen des gesamten Teams Bürger schaffen Wissen begrüßte Dr. Katrin Vohland die Teilnehmenden der Veranstaltung. Sie zitierte aus dem Grünbuch Citizen Science, dass diese eine der stärksten Ausdrucksformen bürgerschaftlichen Engagements ist und eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts spielen wird als den Hauptgrund, warum Citizen Science in der Wissenschaftspolitik, in den Medien und im wissenschaftlichen Diskurs eine immer größere Rolle spielt. Aber ein zweites Zitat aus der Kommentierung des Grünbuchs, nämlich Citizen Science ist ein Privilegierten- Phänomen, dessen Teilnehmende sich vor allem aus Schulklassen und der weißen Mittelschicht rekrutieren, weist auf den Bias der Teilnehmenden im Hinblick auf das Ausbildungsniveau hin. Die Veranstaltung solle auch einen Beitrag zur Debatte leisten, in wieweit Citizen Science das Versprechen gesellschaftlicher Teilhabe einlösen kann. Ziel des Forum sei es daher, 1) zu diskutieren, inwieweit Citizen Science an weitere gesellschaftliche Felder und für weitere gesellschaftliche Gruppen anschlussfähig gemacht werden kann, 2) voneinander zu lernen und von den Erfahrungen der Projekte zu profitieren und 3) gemeinsam die Erfolge zu feiern. Der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft Prof. Dr. Matthias Kleiner begrüßte die Teilnehmenden mit dem aktuellen Leitsatz der Leibniz- Gemeinschaft: Mehr Gemeinschaft wagen!. In Bezug auf Citizen Science bedeute dies, neue Aktivitäten nicht nur zu wagen, sondern auch zu tragen das Grünbuch stelle hier gelungen die wichtigsten Potenziale und klar umrissene Handlungsoptionen heraus. Gleichsam leiste die Online-Plattform buergerschaffenwissen.de einen wichtigen Beitrag, Citizen Science in Deutschland bekannter zu machen. Herr Kleiner wies auf eine hohe Akzeptanz des Grünbuches zur Citizen Science-Strategie 2020 innerhalb der Wissenschafts- Community hin. Das Papier argumentiere gründlich und formuliere geeignete Empfehlungen zur Öffnung der Wissenschaft in Richtung Gesellschaft. Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung seien angehalten, sich mit der Umsetzung der aufgezeigten Strategien auseinanderzusetzen, denn Citizen Science biete der Wissenschaft eine große Chance, aus dem Elfenbeinturm heraus zu treten und eine Wissenschaftskultur des Dialogs mit der Gesellschaft zu etablieren. Im Rückblick sei es dem GEWISS Konsortium in den vergangenen zwei Projektjahren gelungen, das Thema Citizen Science in einem transparenten Prozess für Wissenschaft und Öffentlichkeit aufzuarbeiten und strategisch zu positionieren. Herauszuheben sei außerdem das Engagement diverser Einrichtungen der Leibniz Gemeinschaft, besonders der Forschungsmuseen, über alle Disziplinen hinweg sei es durch strategische Impulse im GEWISS-Konsortium, die Beteiligung an den Dialogforen sowie durch Stellungnahmen zur erarbeiteten Strategie. Damit besitze das Grünbuch auch vor dem Hintergrund des aktuellen Strategieprozesses innerhalb der Leibniz Prof. Dr. Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz- Gemeinschaft, hält das erste Grußwort Dr. Volker Meyer-Guckel, stellv. Generalsekretär des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, bei seinem Grußwort Gemeinschaft Relevanz. Zum Abschluss seines Grußwortes stellte Herr Kleiner die Verbindung zu übergreifenden Entwicklungen in der Wissenschaftslandschaft her, etwa den Leitfaden für Nachhaltigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungseinrichtungen (LeNa) oder die drei Dimensionen offener Wissenschaft (Open Innovation, Open Science, Open to the World) der Open Science Initiatives der EU-Kommission, und bekräftigte die wichtige Rolle von Citizen Science in diesen Kontexten. Herr Kleiner rief dazu auf, den Austausch zum Thema auch über das Projekt hinaus weiterzuführen. Im Anschluss hob Dr. Volker Meyer-Guckel, stellv. Generalsekretär des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, hervor, welche großen Fortschritte die Entwicklung von Citizen Science in Deutschland in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Die in einem hervorragenden Grünbuch gemündete Arbeit des GEWISS-Konsortiums habe einen bedeutenden Anteil daran, dass sich Bürgerwissenschaft als verbindendes Element der aktuellen Debatten um das Innovationssystem in Deutschland etablieren konnte. Jedoch stelle sich in der Wissenschaft die Frage, ob Citizen Science tatsächlich ein neues Thema sei, oder sich vielmehr mit weiteren wissenschaftspolitischen Entwicklungen verknüpfe. Insbesondere sei zu diskutieren, inwiefern Citizen Science ein transformatives Potential berge und einen Beitrag zur übergreifenden Diskussion bzgl. Partizipation in der Wissenschaft leiste. Herr Meyer-Guckel nahm diesbezüglich die Sozialwissenschaften in die Pflicht: es gelte, Methoden, Technologien und Paradigmen zu etablieren, die eine neue Art der Interaktion von Wissenschaft und Gesellschaft ermöglichen. Weiterhin forderte er, das Feld der datengetriebenen Vernetzung in der Wissenschaft nicht allein kommerziellen Akteuren zu überlassen und sich in der Wissenschaftspolitik konsequent für Open Science, Open Data und Open Innovation einzusetzen. Darüber hinaus biete Citizen Science eine besondere Chance für die Schulbildung, denn echte Forschung durch Schülerinnen und Schüler könne einen wichtigen Beitrag zu Fachkräftesicherung für den MINT-Standort Deutschland leisten. Herr Meyer-Guckel schloss sein Grußwort mit der Bitte an die Citizen Science Community, die Forschungsförderer zu beraten, in welchen Formaten man Citizen Science-Projekte am besten unterstützen könne. Der Impuls-Vortrag zur Eröffnung des Forums Citizen Science wurde von Staatssekretär Dr. Georg Schütte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gehalten. Nach der Erarbeitung des Grünbuchs zur Citizen Science Strategie 2020 in Zusammenarbeit mit den Schlüsselakteuren auf diesem Gebiet gelte es nun, in eine breitere Debatte einzutreten und die Potentiale sowie die Grenzen von Bürgerwissenschaft zu erkunden. Die vom GEWISS-Konsortium vorgelegte Definition von Citizen Science biete hier eine sehr dichte, sehr gute und sehr hilfreiche Grundlage. Zum Ausgangspunkt nahm Herr Schütte die Frage Wer beteiligt sich eigentlich in Citizen Science-Projekten? Dass sich unter den Citizen Scientists in großer Zahl Menschen mit akademischem Abschluss fänden, sei nicht verwunderlich. 6 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Grußworte und Eröffnungsimpuls 7
5 So verweise bereits das Konzept der Risikogesellschaft des Sozio- tizen Science und Politik konkretisiert werden. Bürgerwissenschaft logen Ulrich Beck auf die zunehmende Reflexivität moderner Gesell- verspreche eine Erweiterung der Wissensbasis für politische Ent- schaften. Steige das Bildungsniveau insgesamt und besäßen auch scheidungen. Es sei allerdings zu klären, wie man solche Prozesse immer mehr Menschen eine akademische Ausbildung, würde infolge gestalte und wie man mit den Ergebnissen umgehe. auch der akademische Prozess der Generierung wissenschaftlichen Herr Schütte merkte außerdem an, dass das Grünbuch zur Citizen Wissens häufiger hinterfragt. Eine solche Reflexivität durch kriti- Science Strategie 2020 selbst Teil der Interessenpolitik bestimmter sches Hinterfragen und konstruktives Einbringen zeige sich auch Gruppen sein könne und ausreichend begründet werden müsse. bei Citizen Science. Seit den 1980er Jahren gebe es in Deutschland In Bezug auf die geforderte Anerkennungskultur sei das Grünbuch ein konstruktives Spannungsverhältnis zwischen direkter und re- dagegen zu vorsichtig. Herr Schütte bekräftigte, dass Citizen Science präsentativer Demokratie, welches durch neue Technologien unter- eine eigene Qualität habe. Er empfahl der Community, selbstbewuss- stützt werde. ter aufzutreten und die Mehrwerte von Citizen Science deutlicher zu Diese Technologien bringen auch für die Wissenschaft neue Mög- zeigen. lichkeiten mit sich, die nun mit Citizen Science in einer Bewegung Das Grünbuch stellt nach den Worten von Staatssekretär Schüt- mündeten, die stetig an Bedeutung gewinne. So habe sich die Com- te viele Forderungen an zahlreiche Akteure er empfahl deshalb, munity der Bürgerwissenschaften über die Graswurzelebene hinaus entwickelt, institutionalisiert und es sei ein Momentum gewonnen, das sich selbst trägt. Damit sei inzwischen ein kritischer Wert über- Staatssekretär Dr. Georg Schütte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung hält den Eröffnungs-Impuls hier spezifischer zu sein. Zudem gelte es, die Anschlussfähigkeit von Citizen Science an andere gesellschaftliche Bereiche zu definieren, hier könne die Community offensiver vorgehen. Ebenfalls sollten die schritten weder die Existenz noch die Relevanz von Citizen Science Aspekte der Qualitätssicherung, Transparenz, Vernetzung und die würden noch in Frage gestellt. Jetzt gelte es die Frage zu beantwor- Demonstration der Mehrwerte durch Good-Practice-Beispiele voran- ten: Wo stehen wir in Bezug auf Citizen Science und welchen Heraus- getrieben werden. forderungen müssen wir uns stellen? Unstrittig ist laut Herrn Schütte, dass Citizen Science den wissenschaftlichen Handlungsspielraum durch neue Daten, neue Themen, neue Technologien und interdisziplinäre Ansätze erweitere. Ebenfalls Science-Slam: Ocean Sampling Day biete die Bürgerforschung Möglichkeiten für innovative Formen des Gleich nach dem Impuls von Herrn Schütte erzählte Julia Schnetzer formellen und informellen Lernens. Citizen Science könne zudem ein vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie über den Ocean besseres und kritischeres Verständnis von wissenschaftlichen Me- Sampling Day (myosd) im Form eines Science Slams. MyOSD findet thoden sowie mehr Akzeptanz und eine bessere Nachvollziehbarkeit seit 2014 immer am 21. Juni statt, um eine weltweite Momentauf- wissenschaftlicher Ergebnisse schaffen und nicht zuletzt das Gemein- nahme der Mikroorganismen in unserem Weltmeer zu schaffen. Seit schaftsgefühl zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stärken. Es 2015 gebe es mit MyOSD auch die Möglichkeit für Bürgerinnen und gelte aber, die Herausforderungen von Citizen Science und vor allem Bürger sich bei diesem Projekt zu beteiligen, was zu einer wesent- mögliche Spannungsverhältnisse realistisch einzuschätzen. lichen Vergrößerung der Probenaufnahmen gegenüber 2014 führe. An der Schnittstelle von Citizen Science und professioneller Wissenschaft gehe es um das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung von Wissenschaft. Die akademische Profession Susanne Hecker moderiert die Veranstaltung Julia Schnetzer bei ihrem Citizen Science Slam 2016 ist das Wissenschaftsjahr Meere und Ozean. Darum liegt der OSD-Fokus dieses Jahr auf Deutschlands Küsten und den darin mündenden Flüssen. Bürgerinnen und Bürger werden bei der Untersu- stünde vor der Herausforderung, die wissenschaftliche Freiheit und chung der bakteriellen Artenvielfalt mithelfen. Selbstverwaltung immer wieder neu zu belegen. Denn Wissenschaft bedeute auch große Verantwortung, was beispielsweise in der Debatte um Nachhaltigkeit und Forschung sehr deutlich werde. Die Gefahr bestehe, das Citizen Science von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als ein weiteres Kriterium wahrgenommen werde, das ihre wissenschaftliche Freiheit einschränke. In diesem Zusammenhang gelte es zu klären, wie weit der partizipative Anspruch von Citizen Science reicht. Zivilgesellschaftliche Beteiligung sei nicht per se gut, es gelte zu klären, wer als Zivilgesellschaft in jedem Falle konkret angesprochen werde. Außerdem müssten die Forderungen an der Schnittstelle von Ci- 8 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Science-Slam: Ocean Sampling Day 9
6 Ergebnisse aus GEWISS und buergerschaffenwissen.de Dr. Katrin Vohland vom Museum für Naturkunde Berlin lieferte eine Überblick über GEWISS und den Kontext für Citizen Science in Deutschland. Die immer virulenter diskutierte Frage, wer wird wie legitimiert, wissenschaftliche Erkenntnis beizutragen, habe auch dazu geführt, dass sich ein Konsortium aus Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, Universitäten und Wissenschaft im Dialog gebildet habe, um ausgehend von der damit verbundenen Debatte um Citizen Science die Veränderungen im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft genauer zu betrachten. Hauptziele des GEWISS Projektes waren die Vernetzung der Akteure über eine Webplattform und eine Reihe von Veranstaltungen, die wissenschaftliche Analyse der Kapazitäten und Prozesse, und darauf basierend eine Gap-Analyse, die als Grundlage der Entwicklung technischer und organisatorischer Ressourcen diene. Beim Ziel der Entwicklung von Vorschlägen zur Stärkung von Citizen Science sei GEWISS über die angepeilte Liste von Empfehlungen hinausgekommen und hat das offline und online konsultierte Grünbuch für eine Citizen Science Strategie 2020 entwickelt (Bonn et al. 2016). 1 Dr. Katrin Vohland stellt die Ergebnisse von BürGEr schaffen WISSen (GEWISS) vor Inhaltlich stark in die Tiefe gegangen wurde auf den Dialogforen. Nach einem eher politisch ausgerichtetem Think Tank und einer Auftaktveranstaltung, bei denen die Themen der Dialogforen festgelegt wurden, habe sich GEWISS jeweils mit verschiedenen Gast gebern mit Virtuellen Ansätzen in Citizen Science Citizen Science und kulturelle Bildung Umweltbildung Naturschutz Daten Fördermöglichkeiten Evaluierung Citizen Science in den Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften Citizen Science und Partizipation auseinandergesetzt (Pettibone et al. 2016). 2 Das letzte Dialogforum wurde als Barcamp durchgeführt (Ziegler et al. 2016). 3 Dort haben die Teilnehmenden auf der Veranstaltung selbst die Themen gesetzt. Berichte zu allen Veranstaltungen sind auf der Online-Plattform buergerschaffenwissen.de veröffentlicht, es gibt Filme, ein Tipps & Tricks Wiki (wiki.buergerschaffenwissen.de), Handreichungen, Trainingsworkshops und Publikationen für den wissenschaftlichen Diskurs. Eine der Haupterkenntnisse, die im Rahmen des Projekts gewonnen wurden, war das große Bedürfnis nach Beteiligung. Dies drücke sich zum Beispiel in den Ergebnissen dieser Bürgerumfrage aus: Zwar spiele der Beitrag zur Datenerhebung noch eine herausragende Rolle und ist ja auch weiterhin eine sehr typische Tätigkeit aber die gemeinsame Erarbeitung der Fragestellung wird als genauso wichtig erachtet. Daher können die quasi auf jeder Veranstaltung aufkommenden Diskussionen um die Definition von Citizen Science auf einen Kern zurückgeführt werden: Partizipation. Es müsse weiter ausgehandelt werden, wie man zusammenarbeiten möchte. Eine weitere zentrale Erkenntnis sei, dass Datenqualität kein Problem sein müsse, da es ausreichend Methoden und Ansätze zur Qualitätssicherung gäbe. Die meisten noch nicht verwirklichten Synergien lägen im Bereich des gemeinsamen Lernens. Einmal in den klassischen Bildungsbereichen, schulische Bildung, Umweltbildung, aber auch dahingehend, wissenschaftliche Erkenntnisse 1 Bonn, A., Richter, A., Vohland, K., Pettibone, L., Brandt, M., Feldmann, R., Goebel, C., Grefe, C., Hecker, S., Hennen, L., Hofer, H., Kiefer, S., Klotz, S., Kluttig, T., Krause, J., Küsel, K., Liedtke, C., Mahla, A., Neumeier, V., Premke-Kraus, M., Rillig, M. C., Röller, O., Schäffler, L., Schmalzbauer, B., Schneidewind, U., Schumann, A., Settele, J., Tochtermann, K., Tockner, K., Vogel, J., Volkmann, W., von Unger, H., Walter, D., Weisskopf, M., Wirth, C., Witt, T., Wolst, D. & D. Ziegler (2016): Grünbuch Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland. Online verfügbar unter 2 Pettibone, L., Richter, A., Ziegler, D., Bonn, A., & Vohland, K., Hrsg. (2016): Kompendium der GEWISS Dialogforen zu Citizen Science: Acht Orte Acht Schwerpunktthemen Acht-same Diskussionen. GEWISS Bericht Nr. 12. Online verfügbar unter 3 Ziegler, D., Göbel, C., Pettibone, L., Kloppenburg, J., Schwarzkopf, C. & Vohland, K., Hrsg. (2016): GEWISS Dialogforum: Barcamp Citizen Science: Gemeinsam Freies Wissen schaffen! GE- WISS Bericht Nr. 11. Online verfügbar unter 10 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Ergebnisse aus GEWISS und buergerschaffenwissen.de 11
7 in gelebte Praxis zu übernehmen und damit die gesellschaftliche Transformation zu mehr Nachhaltigkeit voranzubringen. Da ließe sich von den von vornherein stärker praktisch orientierten Fablabs, Do-it-yourself-Wissenschaftlern oder Reallaboren noch einiges für die Praxis gesellschaftlicher Innovation lernen. Als Fazit könne festgehalten werden, dass Citizen Science eine wesentliche Bereicherung der Wissenschaftslandschaft darstelle und stark zum Wissensaustausch zwischen verschiedenen wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Akteuren beitrage. Markus Weißkopf, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog, stellte anschließend die Online-Plattform wissen.de vor und zeigte ihre Entwicklung in den zwei Jahren ihres Bestehens auf. Das Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaft im Dialog und dem Museum für Naturkunde Berlin ermöglicht Citizen Science-Projekten in Deutschland, sich zentral zu präsentieren und dient Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit als Informationsplattform zum Thema. Im April 2014 ging die Plattform mit zehn Citizen Science-Projekten online und zeigt inzwischen über 65 Projekte aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Bereichen und mit einer großen Bandbreite partizipativer Ansätze in der Forschung. Die Plattform dient als umfangreiches Kommunikationsportal: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben hier die Möglichkeit, ihr Vorhaben attraktiv und allgemein verständlich zu präsentieren und Bürgerforscher für ihr Projekt zu gewinnen. Dadurch stärkt sie ein wichtiges Feld für die deutsche Forschung und ihrer Kommunikation und fördert den Austausch zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft. Durch die Darstellung verschiedener Funktionen der Citizen Science-Projekte wie Datennutzbarkeit, Wissenschaftskommunikation und Bildung trägt die Plattform zum Qualitätsmanagement bei. In Zukunft werden die Partner weiter daran arbeiten, die zentrale Anlaufstelle für Citizen Science in Deutschland zu sein und so die Sichtbarkeit von Citizen Science-Strukturen und -Akteuren zu fördern. Weiterhin soll auch die Unterstützung bei der Projektentwicklung und -konzeption ausgebaut werden. Zum Schluss skizzierte Prof. Dr. Aletta Bonn in ihrer Präsentation die Entwicklung des Grünbuchs Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland. Hierzu wurde ein animierter Film gezeigt, der die Phasen der Entwicklung sowie die Beteiligten entlang einer zeitlichen Dimension aufzeigt (online verfügbar unter Besonders werden in diesem Clip die Vielfalt der Akteure, die in diesem Prozess eingebunden waren, vorgestellt und der partizipative Charakter der Entwicklung des Grünbuchs herausgestellt. Anschließend stellte Frau Bonn ausgewählte Ergebnisse aus den über 50 eingereichten Positionspapieren vor. Nach Aussage der zivilgesellschaftlichen Organisation werde die Integration von Ehrenamtlichen in wissenschaftliche Prozesse vor allem in der Phase Markus Weißkopf berichtet über die Resonanz der Online-Plattform buergerschaffenwissen.de Prof. Dr. Aletta Bonn beschreibt den Entwicklungsprozess des Grünbuchs für eine Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland der Datenerhebung, gleichwohl aber auch in der Phase der Kommunikation und im Agenda Setting zu Beginn eines wissenschaftlichen Prozesses als wichtig erachtet. Im Gegensatz dazu sei die Einbindung von Ehrenamtlichen in den wissenschaftlichen Prozess aus der Perspektive von wissenschaftlichen Organisationen vornehmlich bei der Datenerhebung erwünscht. Nur zu einem sehr geringen Anteil werde die Beteiligung in weiteren Phasen wie dem Agenda Setting, Auswertung und Analyse oder Kommunikation als wichtig erachtet. Der quantitative Nachweis dieses Meinungsbildes kann nun als Grundlage des weiteren Diskurses zwischen Wissenschaft und Gesellschaft herangezogen werden. Einen qualitativen Eindruck zum Mehrwert von Citizen Science in Deutschland vermitteln die vorgestellten Zitate aus der Online Konsultation. Die Aussagen hierzu variieren von einer wunderbaren Möglichkeit, gemeinsam nach Antworten auf gesellschaftsrelevante Fragestellungen zu suchen bis zur Ermöglichung von Forschung erst durch die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ( Gerade erst der Austausch zu speziellen Themen ergibt belastbare Aussagen und erweitert den Nutzen der Forschung ). Zum Abschluss verwies Frau Bonn auf die weiteren notwendigen Schritte, um die im Grünbuch identifizierten Handlungsfelder zu spezifizieren. Nächste Schritte sind die (Weiter-) Entwicklung eines Weißbuchs mit der Erarbeitung von Aktionsplänen für die einzelnen Handlungsfelder und eine gemeinsame Erarbeitung von konkreten Maßnahmen mit den potenziellen Stakeholdern. 12 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Ergebnisse aus GEWISS und buergerschaffenwissen.de 13
8 Storytelling-Session: Erfolgsgeschichten der Bürgerwissenschaft Nach den Grußworten und der Vorstellung allgemeiner Ergebnisse aus burgerschaffenwissen.de und dem GEWISS moderierten Dr. Lisa Pettibone und David Ziegler eine interaktive Session, deren Ziel es war, einen intensiven Austausch zu konkreten Citizen Science- Projekten zu ermöglichen. Auf 14 Tischen erzählten 16 Storyteller (deren Namen darunter mit ihren Co-Autorinnen und -Autoren fett markiert sind) ihre Erfahrungsgeschichten und diskutierten zusammen in 10er Gruppen mit den Teilnehmenden über zwei Runden. Sensebox, Thomas Bartoschek Die SenseBox ist ein Do-it-yourself-Bausatz für stationäre und mobile Sensoren. Mit der SenseBox können Bürgerinnen und Bürger, z. B. Schülerinnen und Schüler, Umweltdaten über Klima, Luftqualität, Verkehrsaufkommen, Lärmbelästigung und vieles mehr positionsbezogen messen und so zu genaueren Aussagen über lokale Umweltphänomene beitragen. Die Daten werden im Internet als Open Data bereitgestellt und auf einer Karte sichtbar gemacht. Die Bürger können ihre eigenen lokalen Forschungsfragen stellen und die nötigen Daten selbst sammeln und sammeln lassen. Beach Explorer, Rainer Borcherding Die Idee für ein Wattenmeer-weites Portal zur Meldung von Strandfunden entstand schon im Jahr 2006 bei einem Treffen der Naturführer aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Da Citizen Science damals aber noch nicht bekannt und akzeptiert war, begann erst 2012 mit einer Projektförderung des Bundesumweltministeriums und Bundesamts für Naturschutz die Umsetzung ging der BeachExplorer mitsamt kostenlosen Apps online, bald darauf auch der BalticExplorer für die Ostsee. Eine Besonderheit des BeachExplorers ist die bildgestützte Bestimmungshilfe für über 2000 Arten von Strandfunden natürliche Funde ebenso wie Strandmüll. Ingrid Elbertse erzählt die Geschichte von ispex, einem Citizen Science-Projekt zu Feinstaub ispex: wie sauber ist der Himmel über Berlin, Ingrid Elbertse Im Rahmen des internationalen Jahres des Lichts wurde zwischen 1. September und 15. Oktober 2015 in 10 Großstädten europaweit darunter Berlin Feinstaub mithilfe von iphone-kameras gemessen. Dazu wurde das Smartphone mit einem Spektropolarimeter add on genannt ausgerüstet, wonach über 500 Bürgerinnen und Bürger, begleitet von der dazugehörenden App, zweimal am Tag die Feinstaubkonzentration maßen. Die Resultate wurden direkt auf die ispex-webseite hochgeladen, um später von Wissenschaftlern des Observatorium Leiden (NL) ausgewertet und publiziert zu werden. Mundraub, Kai Gildhorn Mundraub ist eine 2009 gegründete Community-Plattform mit Landkarte, die Obstbäume im öffentlichen Raum und auf freigegebenen privaten Flächen abbildet. Zehntausende Menschen nutzen die Plattform, um Fundorte einzutragen und abzurufen, miteinander zu teilen und zu kommentieren, in Gruppen ihre Erfahrungen und Rezepte auszutauschen oder sich zu Aktionen zu verabreden. In Zusammenarbeit mit und im Auftrag von Unternehmen wie dem Netzbetreiber 50Hertz sowie Akteuren wie der Bundesgartenschau 2015 und der Tourismusregion Hasetal betreibt die Terra Concordia wertschöpfende Entwicklung von Kulturlandschaften und Regionen unter aktiver Beteiligung von Communities. mundraub.org 14 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Storytelling-Session: Erfolgsgeschichten der Bürgerwissenschaft 15
9 Offene Naturführer, Alice Chodura und Gregor Hagedorn Bei der Vielfalt des Lebens lassen sich vermeintlich einfache Fragen wie Welcher Vogel singt mitten in der Nacht die schönsten Lieder? oder Wie heißt das Unkraut in meinem Garten? nur selten spontan beantworten, ist eine Bestimmung des Lebewesens anhand der beobachteten Merkmale notwendig. An diesem Punkt helfen die offenen Naturführer mit freien und kostenlosen Bestimmungsmaterialien, welche aufgrund der eingesetzten Wikitechnik kontinuierlich ergänzt und verbessert werden können. Tagfalter-Monitoring Deutschland, Elisabeth Kühn und Reinart Feldmann Das Projekt Tagfalter-Monitoring Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Situation der Tagfalter in der Normallandschaft über einen langen Zeitraum hinweg zu erfassen und zu analysieren. Koordiniert wird das Projekt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ, die Datenerhebung übernehmen ehrenamtliche Schmetterlingszählerinnen und -zähler auf ca. 500 Zählstrecken im ganzen Land. Seit mittlerweile 10 Jahren wird so die Bestands-Entwicklung des Großteils der heimischen Arten dokumentiert. Die Ofentechnologie der Mayener Töpferei-Industrie im Experiment, Michael Herdick Im Rahmen der technikarchäologischen Evaluierung der Ofentechnologie der Mayener Töpfereiindustrie wurden neben Berufswissenschaftlern auch selbstständige Töpferinnen und Töpfer sowie Lehrerinnen und Lehrer von Fachschulen für Keramik mit ganz unterschiedlichen sozialen und fachlichen Hintergründen eingebunden. Einige hatten ein besonderes Interesse an der Geschichte ihres Handwerks, andere hatten schon selber Experimente durchgeführt und wieder andere hatten ethnoarchäologisch relevante Erfahrungen im Rahmen der Entwicklungshilfe gesammelt. Ihre Integration trug entscheidend zum Forschungserfolg bei. Expedition Münsterland, Wilhelm Bauhus und Katarina Kühn 2014 jährte sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal. Diesen Jahrestag nahm die WWU Münster zum Anlass, um mit der Expedition zum Frieden die historischen Großereignisse in einen regionalen Kontext zu stellen. Neben zahlreichen Expertinnen und Experten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen beteiligten sich Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie zahlreiche Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler an der Gestaltung der Veranstaltungen und setzten den konzeptionellen und organisatorischen Projektrahmen. Füchse in der Stadt, Sophia Kimmig, Sarah Kiefer und die Kollegen am IZW Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) erforscht, wo und wie Rotfüchse (Vulpes vulpes) in Berlin leben. Wie passen sie sich an das Leben in dieser scheinbar lebensfeindlichen Umgebung an? Mit intensiver Begleitung vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) schon sind ca Einsendungen von Fotos, Videos und Beobachtungen eingegangen. Voraussichtlich ab Juni können Interessierte aktiv mitforschen. Über eine online-berlin-karte können Ortsteile ausgewählt werden und verschiedene Aufgaben in den jeweiligen Ortsteilen übernommen werden. Dazu gehört zum Beispiel das Kartieren von Strukturen, die für Füchse von Bedeutung sind, wie z.b. Versteckmöglichkeiten oder Nahrungsquellen. Verlust der Nacht-App, Christopher Kyba Der Forschungsverbund Verlust der Nacht entwickelte die gleich benannte App, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, die Helligkeit des durch künstliches Licht beeinflussten Nachthimmels messen zu lassen. Das Projekt hat zum Ziel, langfristige Entwicklungen in der Lichtverschmutzung vor Ort zu zeigen Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Storytelling-Session: Erfolgsgeschichten der Bürgerwissenschaft 17
10 Grundschulkinder unterstützen Forschung zu Ökosystemfunktionen, Victoria L. Miczajka, Alexandra-Maria Klein, Gesine Pufal 4 Bei der Suche nach Versuchsflächen, um Samenfraß und -ausbreitung an einem Stadt-Land-Gradienten zu untersuchen, stellten sich Schulhöfe als ideale Flächen heraus. Dabei war es naheliegend, die Schulen in das Projekt miteinzubinden, so dass durch Citizen Science ein gemeinsamer Gewinnaustausch zwischen wissenschaftlicher Datengewinnung und naturwissenschaftlicher Umweltbildung entstand. Wissenschaftsläden als Partner im Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft, Daniel Ludwig Wissenschaftsläden arbeiten seit Anfang der 1980er Jahre unter unterschiedlichen organisatorischen Bedingungen als Einrichtungen partizipativer Wissenschaft in Westeuropa und Nordamerika an der Vernetzung von Wissenschaft und Gesellschaft. Das Konzept kommt ursprünglich aus den Niederlanden, wo zahlreiche Hochschulen Wetenschapswinkel betreiben. Ihre typische Vorgehensweise unterscheidet sich durch ihren dialogorientierten Ansatz und ihre zivilgesellschaftliche Ausrichtung von der herkömmlicher Transferstellen. Durch diese Herangehensweise und ihre oft langjährige Erfahrung mit Projekten partizipativer Wissenschaft bieten sich Wissenschaftsläden in besonderem Maße als Partnereinrichtungen für Citizen Science Initiativen und Projekte sowie als Bindeglied zur institutionalisierten Wissenschaft an. Auf dem Forum Citizen Science wurden die im Netzwerk wissnet organisierten deutschsprachigen Wissenschaftsläden durch den Science Shop Vechta/Cloppenburg vertreten. Daniel Ludwig von der Universität Vechta beschreibt die Arbeit des Wissenschaftsladens umweltwikisachsen, Lutz Reiter Erinnern Sie sich noch an die braune, übelriechende Brühe der sächsischen Elbe zu Beginn der 90er-Jahre? Oder an die bizarren Bilder abgestorbener Nadelbäume im Erzgebirge? Viele dieser Umweltsünden sind dank des besonderen Einsatzes engagierter Menschen geheilt, aber leider auch in Vergessenheit geraten. Das Portal umweltwiki Sachsen bietet künftig die Möglichkeit, diese Erlebnisse, Erinnerungen und Dokumente auf seiner Homepage zu recherchieren und zu dokumentieren. Die Umweltgeschichte Sachsens seit der friedlichen Revolution wird somit wieder erlebbar, persönliche Erinnerungen für die Nachwelt festgehalten. ArtenFinder, Oliver Röller ArtenFinder ist eine Meldeplattform zum Melden von Tieren, Pflanzen und Pilzen. Ein wichtiges Ziel des Projekts ist es, Menschen dazu zu bringen, sich mit Arten zu beschäftigen, ihnen Artenkenntnisse zu vermitteln sowie Daten zu geschützten Arten zu erfassen. Seit 2011 haben mehrere 100 Mitwirkende über Meldungen zusammengetragen, großteils mit Fotos, Tonaufnahmen und Beschreibungen. artenfinder.rlp.de 4 Der Tisch wurde zusammen mit Andrea Sieber geführt. 18 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Storytelling-Session: Erfolgsgeschichten der Bürgerwissenschaft 19
11 Workshops Nach einer Kaffee- und Networking-Pause setzten sich die Teilnehmenden mit Citizen Science unter unterschiedlichen Aspekten aus im Rahmen von vier Workshops auseinander. Landscape and You-th. Dem Flachs auf der Spur, Andrea Sieber Das Projekt Landscape and You-th fokussiert den Zusammenhang zwischen regionalem Erfahrungswissen und Kulturlandschaft anhand der Kulturpflanze Flachs im Kärntner Lesachtal. Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen entstehen aus der Konvergenz verschiedener Perspektiven der Akteure (lokale Schulen, Vereine, Einzelpersonen, Gemeinde Lesachtal, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt). Dabei wird im intergenerationellen Dialog Erfahrungswissen gesichert (Re-Enactment-Aktivitäten und ZeugInneninterviews) und in Medienprodukte (App, Trickfilm, Lied, Flachserlebnisweg ) transferiert. Siehe Forschungstagebuch der Schülerinnen und Schüler. Landscape Change, Wolfgang Wende Landschaft im Wandel ist ein Citizen Science-Pilotprojekt, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger für Landschaftsforschung begeistern und den Wandel von Landschaft mit eigenen Fotopaaren dokumentieren und bewerten. Es geht darum, ein kollektives Landschaftsgedächtnis zu schaffen. Der Landschaftswandel soll zudem mit ökologischen Daten hinterlegt werden, um Zusammenhänge zwischen der Veränderung der Landschaft und ökologischen Parametern wie bspw. die Ab- oder Zunahme biologischer Vielfalt besser erklären zu können. Andrea Sieber und Victoria Miczajka betreuen gemeinsam einen Storytelling-Tisch Der Workshop zu Citizen Science und Nachhaltigkeitsforschung findet große Resonanz Citizen Science & Nachhaltigkeitsforschung von Michael Weber (Projektträger Jülich) und Dr. Miriam Brandt (Institut für Zoo- und Wildtierforschung) Ziel des Workshops war es, den Mehrwert herauszuarbeiten, den Citizen Science für die Nachhaltigkeitsforschung haben kann. Dieser Mehrwert definiert sich aus der Perspektive verschiedener Beteiligter sehr unterschiedlich: hauptamtliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eine andere Motivation als Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Freizeit mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigen, sich zivilgesellschaftlich engagieren oder sich aus spontanem Interesse an einer Aktion beteiligen. Aus der Sicht der Forschungsförderung ergeben sich nochmals andere Interessen. Im Workshop wurden diese Perspektiven beleuchtet und diskutiert, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die verschiedenen Ansprüche erfüllt werden können. Als Impuls für die Diskussion erläuterte Michael Weber (Projektträger Jülich) zunächst das BMBF-Forschungsrahmenprogramm Forschung für Nachhaltige Entwicklungen (FoNa). Er ging auf die Potenziale von Citizen Science in diesem Zusammenhang ein, erläuterte jedoch auch, dass es z.t. überzogene Erwartungen an Citizen Science gebe. Im Weiteren wurden zwei laufende Citizen Science- Projekte als Fallbeispiele betrachtet. Rainer Borcherding (Schutzstation Wattenmeer Husum) präsentierte das Projekt BeachExplorer, bei dem Freiwillige Objekte, die sie am Strand finden, mit Hilfe eines Bestimmungsschlüssels identifizieren und dann melden können (siehe auch Storytelling-Session, oben). Er hob vor allem den Mehrwert des Projekts zur Steigerung der Umweltwahrnehmung und für die digitale Umweltbildung hervor. Wolfgang Wende (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) stellte das Projekt Landschaft 20 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Workshops 21
12 im Wandel vor, in dem Bürgerinnen und Bürger alte Landschaftsfotos sowie aktuelle Vergleichsfotos desselben Motivs beitragen (siehe ebenfalls oben). Er betonte, das Projekt sei ohne Bürgerbeteiligung nicht durchführbar. Dabei bestehe seitens der Beteiligten großes Interesse, nicht nur Daten bereitzustellen, sondern auch an deren Interpretation mitzuwirken. Die folgende Diskussion erbrachte, dass Citizen Science Beiträge zu allen drei Prinzipien des FoNa-Programms leisten kann (Wirksamkeit, Relevanz und Offenheit/Partizipation). Citizen Science wurde als Chance gesehen, Fragestellungen aus der Gesellschaft aufzugreifen, Kenntnisse über wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln und Bürgerinnen und Bürger an wissenschaftlichen Prozessen teilhaben zu lassen. Im Bereich der sozialökologischen Forschung könne Citizen Science wichtige Beiträge zu räumlich und zeitlich umfangreichen Datensätzen leisten, die es überhaupt erst ermöglichen, große Zusammenhänge zu erkennen und sinnvolle Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Die Teilnehmenden des Workshops identifizierten eine Reihe von Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um diese potentiellen Mehrwerte auszuschöpfen. Notwendig sind eine größere Offenheit der Wissenschaft und die Bereitschaft, sich mit Aspekten auseinanderzusetzen, die von Bürgerinnen und Bürgern in die Forschung eingebracht werden eine veränderte Anerkennungskultur in der Wissenschaft, die Engagement für Citizen Science würdigt eine stärkere Einbeziehung des gesellschaftlichen Mehrwerts als Kriterium für die Bewertung von Forschung personelle und finanzielle Kapazitäten zur gezielten Unterstützung des Aufbaus und der Umsetzung von Citizen Science-Projekten Infrastrukturen zur offenen Bereitstellung und langfristigen Nutzung von Daten eine Stärkung ehrenamtlich Forschender durch Strukturen, Anerkennung und Fördermöglichkeiten flexible und langfristig angelegte Fördermodelle. Citizen Science & Innovation, neue Formen der Partizipation von Julia Hahn und Leonhard Hennen (Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, ITAS) Begonnen hat der Workshop mit einem kurzen Impuls seitens der Referenten, um verschiedene Formen von Partizipation in neuere forschungs- und innovationspolitische Entwicklungen und Kontexte zu stellen. Hierbei sind Begriffe wie Responsible Research and Innovation (RRI) oder auch Scientific Citizenship von zunehmender Bedeutung. Besonders RRI, ein zentrales Konzept auf EU-politscher Ebene, zeigt Merkmale auf, die auch für Citizen Science interessant sind: Problemorientierung, Antizipation, Responsivität, Öffentlichkeit und Inklusion im Sinne einer verantwortlichen Gestaltung von Forschung und Innovation. Die Idee von Scientific Citizenship bezieht sich auf wissenschaftliche und technologische Bürgerrechte und nimmt die Fragen, was Partizipation konkret bedeutet und woran partizipiert wird bzw. werden soll, in den Blick. Hierbei finden sich vier Ebenen von Partizipation an Innovation: Partizipation in der Politikformulierung zu Bedarf und Ziel von Innovation, z. B. in Bürgerdialogen Partizipation in Programmen und in der Regulierung, z. B. Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen in Beiräten Partizipation am Projektdesign, z. B. Wissenschaftsläden, Patientenorganisationen Partizipation in der Projektdurchführung, z. B. FabLabs, User Involvement Alle diese Kontexte sind wichtig für Citizen Science und stellen unterschiedliche Ansprüche und Fragen daran. Das Beispiel von Fab- Labs, die als offene, demokratische Werkstätten verstanden werden können, ist für die Diskussion um innovative Beteiligungsformen sowie deren forschungspolitische Bedeutung interessant. Für die Diskussion wurden darauf aufbauend Thesen vorgestellt: Mit Citizen Science und FabLabs entwickelt sich derzeit neue Partizipationsformen abseits vom Wissenschaftssystem. Eine längere Beschäftigungmit dem Thema ist essenziell für tatsächliche Partizipation. Die praktische Beschäftigung mit einem Forschungsgegenstand oder technischen Problem berge eine neue Qualität gegenüber einer rein theoretischen. Innovationspolitik, die sich um Demokratisierung von Forschung und Entwicklung bemüht, muss nicht nur Citizen Science, sondern auch Scientific Citizenship auf allen o. g. Ebenen fördern. 22 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Workshops 23
13 Die anschließende Diskussion setzte sich mit dem vom GEWISS Projekt vorgelegten Grünbuch zu Citizen Science in Deutschland auseinander, insbesondere mit Bezug auf das Spannungsfeld zwischen Freiheit der Forschung und gesellschaftlicher Relevanz von Wissenschaft sowie im Hinblick auf die Umsetzung von Bürgerwissenschaftsprojekten und -programmen. Weitere Diskussionen sind gerade im Spannungsfeld zwischen einer unabhängigen Forschung und einem demokratischen Verständnis von Beteiligung und der Pflicht zur Integration von Bürgerinnen und Bürgern notwendig. Dies sei ein Aushandlungsprozess zwischen allen beteiligten Akteuren, der sich ständig verändert. Beispielsweise wurde auf der einen Seite davor gewarnt, dass das Ziel der Problemorientierung bei Ansätzen wie RRI die wissenschaftliche Freiheit mehr und mehr aushebeln könnte. Die Forderung nach (gesellschaftlicher) Relevanz von Forschung könne ein Einfallstor sein für politische Einflussnahme. Dem wurde auf der anderen Seite entgegengehalten, dass Wissenschaft immer auch Finanzierungszwängen unterliegt und auch Drittmittelforschung an Nutzen orientiert ist, und damit niemals vollkommen autonom stattfinden kann. Außerdem wurde angeführt, dass gerade in von Bürgerinnen und Bürgern initiierten Citizen Science-Projekten und FabLabs freie Forschung, im Sinne einer intrinsisch motivierten Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand, tatsächlich stattfindet. Es wurde auch hinterfragt, ob die Übersetzung von Scientific Citizenship als wissenschaftliche und technologische Bürgerrechte nicht zu harmlos ist, denn der Diskurs um Citizen Science umfasse nicht nur neue Bürgerrechte, sondern auch Bürgerpflichten, im Sinne eines aktiven Einbringens von bürgerschaftlichem Engagement in Forschungstätigkeiten. Entscheidend für Citizen Science seien Anerkennung und Wertschätzung, die sich in finanzieller Unterstützung für konkrete Projekte sowie in der Integration von Citizen Science in die wissenschaftliche Ausbildung ausdrückt. Es wurde außerdem angemerkt, dass WissenschaftlerInnen bei der Umsetzung solcher Konzepte wie Responsible Research and Innovation (RRI) wird im Workshop zu Citizen Science und Innovation diskutiert RRI oft überfordert seien. Hier brauche es unterstützende Mechanismen, wie Kompetenzzentren und Beratungsangebote, vorgeschaltete Prozesse der Einbeziehung von der Zivilgesellschaft in die Definition von Fragestellungen sowie strukturelle Veränderungen im Wissenschaftssystem (z. B. neue Evaluationskriterien), welche Beteiligung zu einem zentralen Bestandteil von Förderkriterien machen. Kritisch angemerkt wurde, dass die Beziehung von Citizen Science zu Exzellenz noch nicht ausreichend thematisiert werde. Dies berge die Gefahr, dass Bürgerwissenschaft ein Nischenthema bleibe, während sich wissenschaftspolitische Realitäten weiter in Richtung einer Förderung von Exzellenz entwickelten. Zum einen sollte in dieser Hinsicht verstärkt die Diskussion mit der Forschungspolitik gesucht werden, zum anderen wurde vorgeschlagen, parallel zur Exzellenzinitiative eine Initiative Bürgerwissenschaft einzurichten. Auf der konzeptuellen Ebene macht die Idee einer Scientific Citizenship neue Perspektiven für die Betrachtung von Bürgerwissenschaft auf, da sie Verbindungen zu Akteuren aufzeigt, die eine andere Art von Forschung schon praktizieren und diese erfolgreich institutionalisiert haben. Citizen Science & gesellschaftliche Kohäsion Dr. Inge Paulini (WBGU), Andrea Sieber (AAU Klagenfurt) und Dr. Lisa Pettibone (Museum für Naturkunde Berlin) Gesellschaftliche Vielfalt und sozialer Zusammenhalt durch Citizen Science stehen im Mittelpunkt dieses Workshopaustausches. Inge Paulini leitet mit der These ein, dass Citizen Science geeignet ist, neben der thematischen Bearbeitung einer Forschungsfrage als Zusatzergebnis und als Begleitnutzen ein Gruppenbewusstsein entstehen zu lassen und zu befördern, das als Kern für gesellschaftliche Kohäsion fungieren kann. Diese kann sich aus der gemeinsamen, durch das Forschungsprojekt vorgegebenen Zielsetzung der am Projekt Beteiligten ( Kern des Gruppenbewusstseins ) und der während der Durchführung des Projektes zwischen diesen Personen persönlich oder virtuell erfolgenden Begegnungen, inklusive der sozialen (auch interkulturellen) Interaktionen ergeben. Frau Ulrike Peters (DBU) führte anschließend zum Spannungsfeld gesellschaftlicher Vielfalt ein.. Kohäsion wurde als ein Gemeinschaftsgefühl definiert, bei dem man sich als Gemeinschaft fühlt und auch als solche handelt. Als gutes Beispiel für Kohärenzbildung, stellte Andrea Sieber daran anknüpfend ihr Projekt Dem Flachs auf der Spur vor (siehe auch Storytelling-Session, oben). In diesem Projekt mit Teilnehmenden im Alter von 8 bis 88 Jahren entstand eine Win-Win-Situation für regionale Akteure und die Schule. Durch das intergenerationelle Arbeiten wurden nicht nur soziale, ökologische und kulturelle Werte vermittelt, sondern man versteht sich auch mehr als Region. Andrea Sieber erläuterte anhand von Zitaten der Projektpartner auds 24 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Workshops 25
14 Die regen und vielseitigen Beiträge und Diskussionen verdeutlichten die Breite der Sichtweisen. Citizen Science kann zu Gruppenbildung aufgrund von gemeinsamen Interessen führen und dass diese Gruppe auch nach Projektende stabil bleibt, und zum anderen das Verständnis, dass sich durch Citizen Science-Projekte neue Forschergruppen von Menschen bilden, die sich sonst nicht gefunden hätten. der prozessbegleitenden Projektevaluation, welche Bedeutung eine Lern- und Beziehungskultur in einem Projekt für eine Region haben kann, wenn es von Grund auf partizipativ angelegt ist (gemeinsame Gestaltung der Forschungsfragen, Datengeneration, Datenanalyse und Transfer in die Öffentlichkeit). Selbst die Forschungsfragen wurden gemeinsam ermittelt. Wie erreiche ich Menschen bei ihren eigenen Interessen, sodass sie mitmachen wollen? war eine der Hauptfragen, die diskutiert wurden. Gemeinsames Interesse ist oft die Grundvoraussetzung. Dabei kommt es auf das Projekt an, ob es sich um eine themenbasierte Gemeinschaft ( Verlust der Nacht ) oder um eine lokale Gemeinschaft ( Dem Flachs auf der Spur ) handelt. So wurde auch betont, dass Citizen Science neben der Akzeptanz der Wissenschaft auch Leidenschaft für bestimmte Themen steigern oder wecken kann. Bürgerinnen und Bürger nehmen teil, weil sie betroffen sind oder aufgrund von Faszination für ein bestimmtes Thema. Idealerweise führt Citizen Science dann weit über die gemeinsame Datensammlung hinaus, es bildet sich eine Beziehungskultur mit Gemeinsinn und Kreativität. Auch die Rolle der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers in Citizen Science-Projekten wurde diskutiert. Hier ist es bei Citizen Science-Projekten notwendig, dass die Forschenden eine neue Rolle einnehmen. Ihre Aufgabe liegt mehr in der Schaffung von Möglichkeitsfeldern für die Projektpartner, sondern auch um die adäquate Projektgestaltung zur Partizipation. Die Entwicklung einer gemeinsamen Fragestellung, also Co-Design, zahlt sich vor allem durch anhaltendes Interesse der Beteiligten aus. Es gibt schon lange Hobby- Wissenschaftler, die aus reinem Interesse Forschung betreiben. Hierzu gehören beispielsweise Gruppen von Vogelzählenden. Solche Gruppen können als selbstständige Forschergruppen gesehen werden, an die Citizen Science-Projekte angeknüpft werden können. Hier ist den Teilnehmenden oft wichtig, dass ihre Daten gespeichert und archiviert werden. Der soziale Kontext der Bürgerforschung ist Thema des Workshops zu Citizen Science und gesellschaftlicher Kohäsion Citizen Science & strukturelle Änderungen im Wissenschaftssystem (Dr. Martina Franzen, WZB) Der Workshop wurde mit einem Impulsreferat von Frau Dr. Franzen (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) eröffnet. Gegenstand des Vortrags war es, Citizen Science im Kontext rezenter Entwicklungen in der Wissenschaft zu betrachten (Open Participation, Open Data, Open Review, Open Metrics), um davon ausgehend die Möglichkeiten und Grenzen von Citizen Science genauer auszuloten. Wissenschaft wird als distinkte Form sozialer Praxis definiert, die qua Rolle des Wissenschaftlers auf die Produktion neuen, gesicherten Wissens ausgelegt ist. Quantitativ betrachtet ist Citizen Science bislang noch nicht in der professionellen Wissenschaft angekommen. Citizen Science-Projekte konzentrieren sich bislang auf bestimmte Forschungsfelder, vorrangig im Bereich Biodiversitätsforschung. Anstelle eines Einbezugs der Bürgerinnen in alle Etappen des Forschungsprozesses findet Citizen Science praktisch überwiegend im Bereich der Datengewinnung und -auswertung statt. Diskutiert wurde zunächst die Frage, ob Citizen Science nicht mehr als nur eine Methode oder ein neues Instrument im Werkzeugkasten der Wissenschaft sei. Auf Crowd Sourcing reduziert (Crowd Science) wird Citizen Science den normativen Erwartungen an sich selbst nicht gerecht werden. Genauso wenig aber taugen diskursive Formeln wie Demokratisierung der Wissenschaft oder Emanzipation des Bürgers zum Maßstab des Erfolges von Citizen Science. Citizen Science sollte demnach ihre Zielvorstellungen klarer formulieren: Bildung, Wissenstransfer oder epistemisches Korrektiv professioneller Wissenschaft? Umgekehrt sollte in Bezug auf wissenschaftspolitische Erwartungen Citizen Science nicht als Selbstzweck gehandelt werden, sondern nur dort Anwendung finden, wo es gute Gründe gibt. Für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bedeutet Citizen Science nicht nur einen möglichen Mehrwert in Richtung Innovationssteigerung, sondern auch eine kaum zu unterschätzende Mehrbelastung, die Ressourcen bindet. Wissenschaftler stehen heute unter multiplem Erwartungsdruck und gesteigerter Rechenschaftspflicht. Im gegenwärtigen Publikationsdruck kondensieren interne und externe Erwartungen an wissenschaftliche Problemlösungen. Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob Citizen Science tatsächlich auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 26 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Workshops 27
15 gewollt ist oder primär ein politisches Projekt darstellt. Hinsichtlich des zukünftigen Aufbaus von Förderstrukturen für Citizen Science sollte daher ebenso auf Freiwilligkeit seitens der Wissenschaft gebaut werden. Ein weiterer Punkt betraf die Frage der Anerkennung von Citizen Science in der Wissenschaft. Spielt der Erkenntnisgewinn aus Citizen Science in der etablierten Wissenschaft eine Rolle? Belastbare Ergebnisse sind hierzu nicht bekannt, doch hängt die Rezeption vermutlich nicht allein an der Datenqualität, sondern an der Art der Ergebnisse und ihrer Aufbereitung z. B. in Form von Publikationen. Jenseits der kognitiven Erwartungen an Citizen Science werden zu selten die handlungsleitenden Normen innerhalb von Citizen Science diskutiert. Dabei wäre es ein lohnenswertes Unterfangen, die Anlage von Citizen Science-Projekten in Bezug auf die berühmten institutionellen Imperative der Wissenschaft nach Merton: Kommunismus, Universalismus. Uneigennützigkeit und Organisierter Skeptizismus einmal auf ihre praktische Kompatibilität hin zu reflektieren. Der 1,5-stündige Workshop offenbarte insgesamt einen enormen Diskussionsbedarf zu diesem Themenkomplex. Um das Potenzial von Citizen Science aber richtig einschätzen zu können und die Strukturen der Wissensproduktion zu optimieren, sind weitere sozialwissenschaftliche Studien gefragt, die jenseits von Erfahrungsberichten die notwendigen empirische Daten liefern. Dr. Martina Franzen leitet in die Thematik von Citizen Science und strukturellen Änderungen im Wissenschaftssystem ein Moderatorin Susanne Hecker befragt die Workshopleiterinnen und -leiter zu den wichtigsten Ergebnissen der Workshops Anschließende Podiumsdiskussion Angesichts der fortgeschrittenen Zeit wurde die Podiumsdiskussion kurz gehalten. Eine Person aus jedem Workshop fasste kurz die wichtigsten Ergebnisse zusammen: Herr Hennen legte dar, dass es innovative Formate für Partizipation (z. B. FabLabs) gäbe. Dennoch bliebe unklar, wie die weitere Entwicklung skizziert werden könne. Dafür seien mehr konkrete Ideen zur Umsetzung des Citizen Science-Ansatzes nötig, d. h. mehr Auseinandersetzung in der Wissenschaft zu Citizen Science Frau Paulini stellte die Unterschiede zwischen Kohäsion und Kohärenz heraus. Kohäsion hieße, dass die Wissenschaft die Community mitnimmt und empowert; Kohärenz dagegen bezieht sich darauf, dass die (Citizen Science-)Community gemeinsame Interessen mit anderen Akteuren ausbildet. Dabei müsse man auch die räumliche Skala der Beteiligung beachten, damit es für die Beteiligten sinnstiftend sei Frau Franzen trieb die Frage um, wie man das Wissenschaftssystem in Bewegung kriegt. Neben Citizen Science spielen die Konzepte von RRI und Open Science eine wichtige Rolle, damit Wissenschaft sich öffnet. Hier müsse man durch mehr empirische sozialwissenschaftliche Forschung feststellen, wann Citizen Science inhaltliche Erweiterung biete, und welche intrinsische Motivationen bei den verschiedenen Akteuren vorhanden sind. Herr Weber führte aus, dass Synergien zwischen Citizen Science und Nachhaltigkeitsforschung nicht von allein kommen, weil unterschiedliche Interessen verfolgt werden. Man muss konkrete Interessenslücken noch schließen und wechselseitige Wertschätzung schaffen. 28 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Anschliessende Podiumsdiskussion 29
16 Schlussworte Zum Abschluss der Veranstaltung präsentierte Sascha Dickel eine soziologische Reflexion auf die aktuellen Debatten um Citizen Science. Ausgangspunkt sei eine Perspektive, in der Bürgerforschung nicht als Praxis, sondern als Teil des wissenschaftspolitischen Diskurses um Partizipation betrachtet werde. In dieser Auseinandersetzung werde Teilhabe über die politische Rolle von Bürgerinnen und Bürgern verhandelt, wie der Begriff des Citizens deutlich mache. Für die Wissenschaft verspreche Partizipation, eine doppelte Funktion aus Problemlösung und Legitimation zu erfüllen. Einerseits könnten wissenschaftliche Probleme durch die Inklusion nichtzertifizierten Wissens, d. h. den Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern und ihrem Wissen sowie ihrer Kompetenz besser gelöst werden. Bürgerinnen und Bürger würden hier also zur Wissensproduktion beitragen. Andererseits könnte durch Partizipation die öffentliche Legitimation von Wissenschaft und Technik in demokratischen Gesellschaften gesteigert werden. Hier liege der Fokus also auf Wissenschaftskommunikation, welche wiederum verbunden sei mit der Absorption, Modulation und Disziplinierung uneingeladener Partizipation. Für Bürgerinnen und Bürger zeichne sich die aktuelle Diskussion um Citizen Science gegenüber vergangenen Debatten um Partizipation durch die Aussicht auf direkte Beteiligung an der Wissensgenerierung aus, d. h. auf ein Mitforschen. Mitforschen sei allerdings nicht automatisch gleichbedeutend mit Mitreden, d. h. einer Beteiligung an der Festlegung der zu bearbeitenden Forschungsfragen oder gar der wissenschaftlichen Spielregeln. Partizipation, so Herr Dickel, erwecke im Kontext von Citizen Science allerdings das Versprechen von Mitreden. Vor diesem Hintergrund ergeben sich laut Herr Dickel zwei kritische Punkte: Erstens setze Citizen Science die Wissenschaft unter den Erwartungsdruck, Chancen für «echte» Partizipation anzubieten, d. h. für Beteiligung an Forschungsprozessen. Wenn Citizen Science «nur» als Wissenschaftskommunikation und damit Beschaffung von Legitimation wahrgenommen wird, könnte dies Erwartungsenttäuschungen provozieren. Zweitens entstünde ein Spannungsfeld um das Verhältnis zwischen eingeladener und uneingeladener Partizipation. Zu vermuten sei, dass Citizen Science als Gegenstand von Wissenschaftspolitik eine Dynamik entfaltet, die auch bei anderen Formen der Partizipation an Wissenschaft beobachtbar ist: nämlich den Versuch, uneingeladene Bürgerwissenschaft einzuladen und dadurch für professionelle Wissenschaft fruchtbar zu machen und in das akademische Spiel der Wissenschaft zu integrieren. Nach welchen Regeln wird das Spiel der Citizen Science dann aber gespielt? Und wie muss das Spiel aufgebaut sein, dass es nicht als eine bloße Instrumentalisierung der Teilnehmer erscheint? Citizen Science stünde demnach vor Herausforderung, nicht nur als Parti- Dr. Sascha Dickel von der TU München formuliert in seiner Abschlußrede provokative Thesen zipationsdiskurs wahrgenommen zu werden, sondern auch Erwartungen an Emanzipation und Problemlösen einzulösen dazu müsse Mitforschen auch mit Mitreden verknüpft werden. Abschließend ermutigte Herr Dickel dazu, die Autonomie von Wissenschaft einmal anders zu denken: nicht als eine völlige Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Einflüssen sondern als eine sich vielfältigen Einflüssen aussetzende und auf Vielfältigkeit beruhenden Unabhängigkeit. In einer solchen Perspektive wäre Citizen Science dann denkbar als wertvolles Korrektiv für die diversen gesellschaftlichen Einflüsse, derer sich die zeitgenössische Wissenschaft ausgesetzt sieht. 30 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Schlussworte 31
17 Fazit Mit dem Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation wurden die Ergebnisse des Projektes BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) gefeiert sowie die rasante Entwicklung des Themas Citizen Science reflektiert und die Anschlussfähigkeit von Citizen Science als Ansatz für verschiedene gesellschaftliche Bereiche diskutiert. Auch wenn es in Deutschland wie auch in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern eine lange Tradition der Zusammenarbeit von Laien und institutionell gebundenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt, so ist mit dem Begriff Citizen Science eine neue und auch sehr intensive Dynamik entstanden. Im Laufe der GEWISS Veranstaltungen der letzten zwei Jahre und auf Veranstaltungen anderer Akteure wurde deutlich, wie viele Ebenen der durchaus umstrittene Begriff Citizen Science anspricht. Es sind ganz praktische Ebenen, wobei es z. B. um die Qualität von Daten oder den Umgang mit Urheberrechten geht. Es gibt zunehmend Begleitforschung zu Citizen Science, die sich damit befasst, was die Teilnehmenden lernen und ob sie ihre Einstellung zu bestimmen Themen oder der Wissenschaft im Allgemeinen ändern. Auf wissenschaftspolitischer Ebene wird diskutiert, ob die Forschungsfreiheit in Gefahr ist, wenn sich Forschung zu stark dem Anspruch an gesellschaftliche Relevanz und Wirksamkeit unterwirft. Etwas abstrahiert lässt sich sagen, dass damit ein Verhältnis von Wissenschaft zu Gesellschaft neu ausgehandelt wird, dass die Modalitäten der Zusammenarbeit in einigen Feldern neu bestimmt werden. Beteiligt sich die Öffentlichkeit an Forschung in einem von Am Ende des Forums bedankt sich Dr. Katrin Vohland im Namen des Teams bei Mitgliedern des GEWISS- Konsortiums und -Beirats sowie den Dialogforengastgebern für deren Unterstützung der Wissenschaft klar umrissenen Rahmen? Oder inspirieren gesellschaftliche Akteure die Forschung, neue Wege zu gehen? Gibt es Co-Design wirklich, oder ist dieses Konzept nur ein exemplarisches, aber schwer zu realisierendes Konstrukt? Auch wenn sich Unterschiede in Handlungsoptionen, Interessen und Ressourcen zwischen verschiedenen Akteuren schon alleine aufgrund der unterschiedlichen finanziellen und ausbildungsbedingten Kapazitäten sowie Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -verarbeitung ergeben, so lässt sich konstatieren, dass die Vielfalt an Kooperationen, die sich auf einem hohen Niveau um eine ausgewogene Zusammenarbeit auf Augenhöhe bemühen, beeindruckend ist. Mit Methoden, die zum Teil der transdisziplinären oder sozialwissenschaftlichen Forschung entlehnt sind, werden epistemische und praxisorientierte Interessen zusammengebracht und auf den Mehrwert für alle Beteiligten geachtet der ganz oft einfach die Freude am Lernen und den Kontakten zu Gleichgesinnten besteht. Für die zukünftige Entwicklung des Feldes Citizen Science wird es wichtig sein, den Mehrwert für verschiedene gesellschaftliche Bereiche sichtbarer und stärker operationalisierbar zu machen. Dazu bedarf es weiterhin des Diskurses zwischen allen Beteiligten aus Gesellschaft, Politik und Wissenschaft, und einer Reflexion und Forschung zu Auswirkungen dieser neuen Formen der Zusammenarbeit, beispielsweise im Hinblick auf Innovationskraft, Kreativität oder der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung im Sinne einer aufgeklärten Bürgerschaft. Wir hoffen, dass dieser Diskurs fortgesetzt werden kann und in den nächsten Jahren spannende Erfahrungen gesammelt und ausgetauscht werden können, die zum weiteren Blühen des Feldes Citizen Science beitragen. 32 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Fazit 33
18 Anhang: Liste der Teilnehmenden Personen und Institutionen Vorname Nachname Institution Elke Baranek EUROPARC Deutschland e. V. Thomas Bartoschek Westfälische Wilhelms-Universität Münster Uwe Beckert Rechenkraft.net e. V. Christian Beer Rechenkraft.net e. V. Susann Beetz Helmholtz-Gemeinschaft, Geschäftsstelle Silke Bicker Erdhaftig Umwelt-PR Wolfram Birmili Umweltbundesamt (UBA) Anne Böhnke-Henrichs Wageningen University, Universität Potsdam Aletta Bonn UFZ/iDiv Rainer Borcherding BeachExplorer / Schutzstation Wattenmeer Falk Böttcher Deutscher Wetterdienst Miriam Brandt Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Christoph Bruch Helmholtz Gemeinschaft Benjamin Bühring Universität Göttingen - Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Eva Bunge Universitätsbibliothek der TU Berlin David Burger Institut für Humangeographie, Goethe-Universität Luca Casetti Bern University of Applied Science Alice Chodura Museum für Naturkunde Berlin Stephanie Christmann-Budian Wikimedia Deutschland Kyba Christopher Verlust der Nacht-App Ulrike Cress Leibniz-Institut für Wissensmedien Sascha Dickel Technische Universität München Janice Dietrich Bundestagesfraktion Bündnis 90/Die Grünen Markus Dotterweich UDATA GmbH - Umwelt & Bildung Florian Druckenthaner DLR-PT Evelyn Echeverria Projektträger Jülich Ute Eggers Universität Potsdam Carolin Ehmig Ingrid Elbertse MINT Impuls e. V. Franziska Engels Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB Klaudia Erhardt SOEP am DIW Berlin Marianne Feller-Gehre Katja Felsmann IGB Berlin Katharina Fial Projektträger Jülich Christa Fischer Jennifer Flück Science et Cité Martina Franzen WZB Jens Freitag Genius GmbH - Science & Dialogue Sascha Friesike Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft Christine Gieraths Max-Planck-Gesellschaft e. V., Stabsstelle Wissenschaftssystem Kai Gildhorn Mundraub Claudia Göbel Museum für Naturkunde Berlin, ECSA Stefan Gotthold Clear Sky-Blog Marie Grimm Museum für Naturkunde Berlin Christine Gröneweg Science Shop Vechta/Cloppenburg, Universität Vechta Vorname Nachname Institution Gregor Hagedorn Museum für Naturkunde Berlin Julia Hahn Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse Anna Hampf ZALF Andreas Hantschk Naturhistorisches Museum Wien Doris Härms u. a. Netzwerk Zukunft e. V. Susanne Hecker Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ/iDiv Leonhard Hennen Karlsruher Institut für Technologie Heike Hensel Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) Christian Herbst Bundesministerium für Bildung und Forschung Marc Hermann TRICKLABOR Miira Hill TU Berlin Tim Florian Horn Zeiss-Großplanetarium Berlin Christina Hörth Redaktionsstab Rechtssprache beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Carolin Hübner Bundeskanzleramt Clemens Jacobs Universität Heidelberg, Geographisches Institut, GIScience Sabine Jank szenum.berlin René John Institut für Sozialinnovation Consulting Pierre Karrasch TU Dresden Sarah Kiefer Interdisziplinärer Forschungsverbund (IFV) Biodiversität Chika Kietzmann Sophia Kimmig Füchse in der Stadt Agnes Kirchhoff Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin Iris Klaßen Wissenschaftsmanagement Lübeck Matthias Kleiner Leibniz-Gemeinschaft Julia Kloppenburg Wikimedia Deutschland e. V. Thekla Kluttig Sächsisches Staatsarchiv Katrin Knickmeier Kieler Forschungswerkstatt Bettina Knothe medeambiente Teresa Kollakowski HU Berlin Christine Kreutzer science3 Wissenschaftskommunikation Julia Krohmer Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung Dany Krohne basis.wissen.schafft e. V. Katrin Kruse Kieler Forschungswerkstatt Elisabeth Kühn Tagfalter-Monitoring Deutschland Katarina Kühn Uni Münster, Arbeitsstelle Forschungstransfer Miltos Ladikas Karlsruher Institut für Technologie André Lampe Andrea Langer Germanisches Nationalmuseum Eric Lettkemann TU Berlin Sophie Leukel DLR PT/ Büro Wissenschaftskommunikation Melanie Liebscher Bundesministerium für Bildung und Forschung Christin Liedtke Helmholtz-Gemeinschaft Maria Lisenko 34 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Liste der Teilnehmenden Personen und Institutionen 35
19 Vorname Nachname Institution Thomas Loew Institute for Sustainability - Forschung und Beratung zu Nachhaltigkeitsmanagement Daniel Ludwig Universität Vechta Nadine Lux science³ - Wissenschaftskommunikation Kreutzer Lux Schönherr Kun MA Heidrun Mader Bärbel Maessen Ilona Marenbach Rundfunk Berlin-Brandenburg Sebastian Mehling Europa Universität Viadrina Wolfgang Meyer-Guckel Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Herdick Michael Experimentelle Archäologie am Römisch-Germanischen Zentralmuseum Klaus Mickus Victoria Miczajka Leuphana Universität Lüneburg/ Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Uwe Mischke Gesellschaft Naturforschender Freunde (gegr.1773) Nicola Moczek PSY:PLAN, Institut für Architektur- und Umweltpsychologie Brigitte Morgenroth Paul-Ehrlich-Institut Dana Müller Jüdisches Museum Berlin Stephan Naundorf Bundeskanzleramt Veronika Neumeier Helmholtz-Center for Environmental Research UFZ German Centre for Integrative Biodiversity Research (idiv) Anika Nowak-Wetterau Jüdisches Museum Berlin Matthias Nuß Senckenberg Museum für Tierkunde Dresden Franka Ostertag DLR-PT e. V., Büro Wissenschaftskommunikation Iris Ott NHM Wien Lucy Patterson Science Hack Day Berlin Inge Paulini WBGU Elizabeth Pavez Loriè IUF Ulrike Peters Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Lisa Pettibone Museum für Naturkunde Berlin Christine Prußky duz - Deutsche Universitätszeitung Josefine Puppe Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege Patricia Rahemipour Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin Thomas Reichert Lutz-Wolfram Reiter Ö GRAFIK agentur für marketing und design Bettina Renner Leibniz-Institut für Wissensmedien Katrin Reuter Museum für Naturkunde Berlin Anett Richter Helmholtz-Center for Environmental Research UFZ German Centre for Integrative Biodiversity (idiv) Oliver Röller Institut für Naturkunde in Südwestdeutschland Frank Roßner Beckmann-Kommission Alina Rupp Museum für Naturkunde Berlin Sabine Säck-da Silva deenet Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologie Rolf Satzger Initiative Madrenatura e. V. Livia Schäffler Leibniz-Verbund Biodiversität (LVB)/ Museum für Naturkunde Berlin (MfN) Bettina Schmalzbauer Deutsches Komitee für Nachhaltigkeitsforschung in Future Earth Julia Schnetzer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie Bremen Vorname Nachname Institution Willi Scholz ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Gabriele Schönherr sciencehoch3 Wissenschaftskommunikation Philipp Schrögel Büro für Wissenschafts- und Technikkommunikation Christina Schumacher Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth Anke Schumann Interdisziplinärer Forschungsverbund (IFV) Biodiversität Georg Schütte Bundesministerium für Bildung und Forschung Katrin Schwahlen basis.wissen.schafft e. V. Paul Sehgal TU Berlin Josef Settele UFZ Michaela Shields Wissenschaftsladen Bonn e. V. Andrea Sieber Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Schottenfeldgasse 29, A 1070 Wien Christin Skiera Geschäftsstelle des Hightech-Forums Christian Smoliner BMWFW Natalia Sousa Freie Universität Berlin Claire Speiser Französische Botschaft Nadja Steinkühler Umweltbundesamt, FG II 1.1 Christiane Stork Körber-Stiftung Malte Timpte Museum für Naturkunde Berlin / Netzwerk-Forum zur Biodiversitätsforschung Deutschland Matthias Trénel Zebralog Maureen Tsakiris Geographisches Institut Kiel Maximilian Ueberham Stella Veciana Kathrin Vohland Museum für Naturkunde Berlin Wiebke Volkmann Wissenschaft im Dialog ggmbh Sebastian von Peter Charité Corinna Vosse Netzwerk Wachstumswende Wolfgang Wägele Museum Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere Michael Weber Projektträger Jülich Kirsten Wegner DGKV, Deutsch. Ges. f. kontextuelle Verhaltenswissenschaften e. V. Ralf Weiß Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit Karoline Weißhuhn Freie Universität Berlin / BBIB Markus Weißkopf Wissenschaft im Dialog Marc-Denis Weitze acatech Wolfgang Wende Leibniz-Insitut für ökologische Raumentwicklung Dresden Iris Wessolowski Journalistin : technik, science - Researcher Kommunikation Magdalena Wiatr ISIconsult Maiken Winter WissenLeben e. V. Thorsten Witt Wissenschaft im Dialog David Ziegler Museum für Naturkunde Berlin 36 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Liste der Teilnehmenden Personen und Institutionen 37
20 Anhang: Offizielles Programm 13:00 Registrierung und Mittagsimbiss Informelles Kennenlernen 14:00 Begrüßung Dr. Katrin Vohland (MfN) & Prof. Dr. Aletta Bonn (UFZ/iDiv) Moderation: Susanne Hecker (UFZ/iDiv) 14:05 Grußworte Prof. Dr. Matthias Kleiner (Präsident der Leibniz-Gemeinschaft) Dr. Volker Meyer-Guckel (stellv. Generalsekretär des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft) 14:15 Eröffnungs-Impuls Dr. Georg Schütte (Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung) 14:30 Citizen Science Slam Julia Schnetzer (Ocean Sampling Day MyOSD) 14:35 Citizen Science 2020 Wie hat BürGEr schaffen WISSen (GEWISS) die Citizen Science-Landschaft in Deutschland verändert? Dr. Katrin Vohland (MfN): Produkte und Erkenntnisse des GEWISS-Prozesses Markus Weißkopf (WiD): Eine Plattform für Citizen Science buergerschaffenwissen.de Prof. Dr. Aletta Bonn (UFZ/iDiv): Gemeinsam zu einem Citizen Science- Grünbuch für Deutschland 15:00 Storytelling-Session: Erfolgsgeschichten der Bürgerwissenschaft Thomas Bartoschek, sensebox Die Kiste mit Sinn Rainer Borcherding, Beach Explorer Ingrid Elbertse, ispex: wie sauber ist der Himmel über Berlin Kai Gildhorn, Mundraub.org Gregor Hagedorn, Offene Naturführer Michael Herdick, Experimentelle Archäologie am Römisch-Germanischen Zentralmuseum Sarah Kiefer & Sophia Kimmig, Füchse in der Stadt Elisabeth Kühn, Tagfalter-Monitoring Deutschland (TMD) Katarina Kühn, Expedition Münsterland Christopher Kyba, Verlust der Nacht-App Victoria L. Miczajka, Grundschulkinder unterstützen Forschung zu Ökosystemfunktionen Lutz Reiter, umweltwikisachsen Oliver Röller, ArtenFinder Andrea Sieber, Landscape and You-th. Dem Flachs auf der Spur Wolfgang Wende, Landscape Change 15:45 Kaffeepause 16:15 Parallele Workshops Citizen Science & Nachhaltigkeitsforschung Michael Weber (PtJ), Dr. Miriam Brandt (IZW) Citizen Science & Innovation, neue Formen der Partizipation Julia Hahn (KIT), Dr. Leonhard Hennen (KIT) Citizen Science & gesellschaftliche Kohäsion Dr. Inge Paulini (WBGU) Citizen Science & Strukturelle Änderungen im Wissenschaftssystem Dr. Martina Franzen (WZB) 17:30 Bericht aus den Workshops und Diskussion: Der Blick nach vorne 18:00 Schlussworte und Abendempfang Citizen Science im Kontext partizipativer Wissenschaft (Dr. Sascha Dickel; Technische Universität München) 38 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation Programm 39
21 GEWISS-Konsortium
Unangeforderte Stellungnahme
 Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Ausschussdrucksache 18(18)132 13.10.2015 Prof. Dr. Aletta Bonn Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH UFZ / Dr. Katrin Vohland Leibniz-Institut
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Ausschussdrucksache 18(18)132 13.10.2015 Prof. Dr. Aletta Bonn Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH UFZ / Dr. Katrin Vohland Leibniz-Institut
Forum Citizen Science Deutschland
 Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) Bericht Nr. 13 Juni 2016 Herausgegeben von Lisa Pettibone, David
Forum Citizen Science Deutschland Eine Strategie für Nachhaltigkeit und Innovation BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) Bericht Nr. 13 Juni 2016 Herausgegeben von Lisa Pettibone, David
Virtuelle Bürgerwissenschaft. Digitale Ansätze in Citizen Science Projekten. Dr. Katrin Vohland & Dr. Sascha Dickel
 Virtuelle Bürgerwissenschaft Digitale Ansätze in Citizen Science Projekten Dr. Katrin Vohland & Dr. Sascha Dickel Virtuelle Bürgerwissenschaft Digitale Ansätze in Citizen Science Projekten Dr. Katrin Vohland
Virtuelle Bürgerwissenschaft Digitale Ansätze in Citizen Science Projekten Dr. Katrin Vohland & Dr. Sascha Dickel Virtuelle Bürgerwissenschaft Digitale Ansätze in Citizen Science Projekten Dr. Katrin Vohland
Autonome Fahrzeuge UNSERE ZUKUNFT MIT AUTONOMEN FAHRZEUGEN. Es ist Zeit, das Wort zu ergreifen MISSIONS PUBLIQUES
 UNSERE ZUKUNFT MIT AUTONOMEN FAHRZEUGEN Autonome Fahrzeuge bedeuten eine Revolution sowohl auf technologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Doch während öffentliche und private Akteure
UNSERE ZUKUNFT MIT AUTONOMEN FAHRZEUGEN Autonome Fahrzeuge bedeuten eine Revolution sowohl auf technologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Doch während öffentliche und private Akteure
#ODD16 #OGMNRW 1/5
 Wir plädieren für ein offenes NRW Wir sind Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und setzen uns dafür ein, den Prozess der Offenheit, Zusammenarbeit und
Wir plädieren für ein offenes NRW Wir sind Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und setzen uns dafür ein, den Prozess der Offenheit, Zusammenarbeit und
Citizen Science und die Leibniz-Gemeinschaft ein Thesenpapier
 Citizen Science und die Leibniz-Gemeinschaft ein Thesenpapier Präambel Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss herausragender Forschungseinrichtungen. Nach dem Motto theoria cum praxi zeichnet
Citizen Science und die Leibniz-Gemeinschaft ein Thesenpapier Präambel Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss herausragender Forschungseinrichtungen. Nach dem Motto theoria cum praxi zeichnet
Innovative Ansätze für gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Dr. Steffi Ober Forschungswende / VDW e. V.
 Innovative Ansätze für gesellschaftliche Veränderungsprozesse Dr. Steffi Ober Forschungswende / VDW e. V. Wer gestaltet unsere Zukunft? 09.11.2015 Forschungswende 2 Neue Herausforderungen Von Antworten
Innovative Ansätze für gesellschaftliche Veränderungsprozesse Dr. Steffi Ober Forschungswende / VDW e. V. Wer gestaltet unsere Zukunft? 09.11.2015 Forschungswende 2 Neue Herausforderungen Von Antworten
Citizen Science und die Forschung für Nachhaltigkeit im BMBF
 Citizen Science und die Forschung für Nachhaltigkeit im BMBF Ein Förderinstrument im Rahmenprogramm FONA 3? Eckart Lilienthal (BMBF, Referat 721: Grundsatzfragen Nachhaltigkeit, Klima, Energie) Dr. Martin
Citizen Science und die Forschung für Nachhaltigkeit im BMBF Ein Förderinstrument im Rahmenprogramm FONA 3? Eckart Lilienthal (BMBF, Referat 721: Grundsatzfragen Nachhaltigkeit, Klima, Energie) Dr. Martin
Workshop B2 - Nachhaltigkeit in der Wissenschaft (SISI) Hintergrund und aktueller Stand des Agendaprozesses; Programm und Ziele des Workshops
 Workshop B2 - Nachhaltigkeit in der Wissenschaft (SISI) Hintergrund und aktueller Stand des Agendaprozesses; Programm und Ziele des Workshops Christiane Ploetz / Thomas Potthast Nachhaltigkeit in der Wissenschaft
Workshop B2 - Nachhaltigkeit in der Wissenschaft (SISI) Hintergrund und aktueller Stand des Agendaprozesses; Programm und Ziele des Workshops Christiane Ploetz / Thomas Potthast Nachhaltigkeit in der Wissenschaft
University Meets Industry. Forum für Lebensbegleitendes Lernen und Wissenstransfer
 University Meets Industry Forum für Lebensbegleitendes Lernen und Wissenstransfer University Meets Industry Forum für Lebensbegleitendes Lernen und Wissenstransfer University Meets Industry (unimind) will
University Meets Industry Forum für Lebensbegleitendes Lernen und Wissenstransfer University Meets Industry Forum für Lebensbegleitendes Lernen und Wissenstransfer University Meets Industry (unimind) will
Forschungsdaten - Perspektiven der Allianz(-Initiative) und einer Allianz-Organisation (Helmholtz)
 Forschungsdaten - Perspektiven der Allianz(-Initiative) und einer Allianz-Organisation (Helmholtz) Workshop des AK Forschungsdaten, Leibniz-Gemeinschaft Berlin, 29.06.2017 Hans Pfeiffenberger AWI, Helmholtz-Gemeinschaft
Forschungsdaten - Perspektiven der Allianz(-Initiative) und einer Allianz-Organisation (Helmholtz) Workshop des AK Forschungsdaten, Leibniz-Gemeinschaft Berlin, 29.06.2017 Hans Pfeiffenberger AWI, Helmholtz-Gemeinschaft
Entwicklung von Citizen Science- Kapazitäten in Deutschland
 Entwicklung von Citizen Science- Kapazitäten in Deutschland BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) Endbericht April 2017 Anett Richter,
Entwicklung von Citizen Science- Kapazitäten in Deutschland BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) BürGEr schaffen WISSen Wissen schafft Bürger (GEWISS) Endbericht April 2017 Anett Richter,
DIE FORSCHUNGSBÖRSE BRINGT WISSENSCHAFT INS KLASSENZIMMER.
 DIE FORSCHUNGSBÖRSE BRINGT WISSENSCHAFT INS KLASSENZIMMER. Wie das funktioniert? Die Online-Plattform Forschungsbörse bringt Wissenschaft und Schule im Klassenzimmer zusammen: Lehrerinnen und Lehrer können
DIE FORSCHUNGSBÖRSE BRINGT WISSENSCHAFT INS KLASSENZIMMER. Wie das funktioniert? Die Online-Plattform Forschungsbörse bringt Wissenschaft und Schule im Klassenzimmer zusammen: Lehrerinnen und Lehrer können
Nationale Kontaktstelle FORSCHUNG
 Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft Nationale Kontaktstelle FORSCHUNG Forschung und Innovation sollen nicht für sich stehen, sondern mit der Gesellschaft verwoben sein. Durch einen fruchtbaren
Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft Nationale Kontaktstelle FORSCHUNG Forschung und Innovation sollen nicht für sich stehen, sondern mit der Gesellschaft verwoben sein. Durch einen fruchtbaren
frei.raum.mit.gestalten. Kreative Stadtentwicklung durch Kunst, Kultur und Wissenschaftsvermittlung
 frei.raum.mit.gestalten. Kreative Stadtentwicklung durch Kunst, Kultur und Wissenschaftsvermittlung 22.11. Ringvorlesung Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Ilka Bickmann, Vorstandsvorsitzende science2public
frei.raum.mit.gestalten. Kreative Stadtentwicklung durch Kunst, Kultur und Wissenschaftsvermittlung 22.11. Ringvorlesung Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Ilka Bickmann, Vorstandsvorsitzende science2public
Foto Copyright: Dr. Thomas Mauersberg W I S S E N S C H A F T S KO M M U N I K AT I O N
 7. 9. November 2018 Bonn Foto Copyright: Dr. Thomas Mauersberg 11. FORUM W I S S E N S C H A F T S KO M M U N I K AT I O N Inhalt Wissenschaft im Dialog 1 Das 11. Forum Wissenschaftskommunikation 3 Überblick
7. 9. November 2018 Bonn Foto Copyright: Dr. Thomas Mauersberg 11. FORUM W I S S E N S C H A F T S KO M M U N I K AT I O N Inhalt Wissenschaft im Dialog 1 Das 11. Forum Wissenschaftskommunikation 3 Überblick
Neuer Kulturdialog & Digitaler Masterplan Kultur: Einen gemeinsamen Weg gestalten
 Prof. Dr. Martin Zierold Beratung & Coaching Neuer Kulturdialog & Digitaler Masterplan Kultur: Einen gemeinsamen Weg gestalten Vorstellung Konzept & Prozessdesign 30. Mai 2018 1 Der Reiseplan für heute
Prof. Dr. Martin Zierold Beratung & Coaching Neuer Kulturdialog & Digitaler Masterplan Kultur: Einen gemeinsamen Weg gestalten Vorstellung Konzept & Prozessdesign 30. Mai 2018 1 Der Reiseplan für heute
Gemeinsam für eine Nachhaltige Gemeindeentwicklung in Lüneburg
 ANSPRECHPARTNER_INNEN/ KONTAKT. Wenn Sie sich dabei beteiligen möchten zu einer Nachhaltigen Entwicklung der Stadt Lüneburg beizutragen und das LaborN aktiv mitgestalten wollen, wenden Sie sich gerne an:
ANSPRECHPARTNER_INNEN/ KONTAKT. Wenn Sie sich dabei beteiligen möchten zu einer Nachhaltigen Entwicklung der Stadt Lüneburg beizutragen und das LaborN aktiv mitgestalten wollen, wenden Sie sich gerne an:
Memorandum. Gesellschaftliche Verantwortung an Hochschulen
 Memorandum Gesellschaftliche Verantwortung an Hochschulen Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Hochschulnetzwerks Bildung durch Verantwortung am 22.11.2013 Übersicht 1. Weshalb gesellschaftliche
Memorandum Gesellschaftliche Verantwortung an Hochschulen Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Hochschulnetzwerks Bildung durch Verantwortung am 22.11.2013 Übersicht 1. Weshalb gesellschaftliche
Symposium Gemeinsam Natur- und Kulturgüter erfassen, bewerten und erleben
 Symposium Gemeinsam Natur- und Kulturgüter erfassen, bewerten und erleben Wiesenfelden 11. April 2018 Dr. Anett Richter Helmholtz Zentrum für Umweltforschung- UFZ Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung
Symposium Gemeinsam Natur- und Kulturgüter erfassen, bewerten und erleben Wiesenfelden 11. April 2018 Dr. Anett Richter Helmholtz Zentrum für Umweltforschung- UFZ Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung
Erster Themengipfel. 28.Juli 2017 Alte Feuerwache AGORA KÖLN
 Erster Themengipfel ESSBARE STADT KÖLN 28.Juli 2017 Alte Feuerwache Ein Projekt von: Wer organisiert heute? Das Netzwerk hat sich einen Wandel der Stadtgesellschaft Richtung Nachhaltigkeit auf die Fahne
Erster Themengipfel ESSBARE STADT KÖLN 28.Juli 2017 Alte Feuerwache Ein Projekt von: Wer organisiert heute? Das Netzwerk hat sich einen Wandel der Stadtgesellschaft Richtung Nachhaltigkeit auf die Fahne
zur Erarbeitung einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines partizipativen Prozesses
 Kurzkonzept zur Erarbeitung einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines partizipativen Prozesses 1 Einleitung In Nordrhein-Westfalen gibt es eine vielfältige Engagementlandschaft
Kurzkonzept zur Erarbeitung einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines partizipativen Prozesses 1 Einleitung In Nordrhein-Westfalen gibt es eine vielfältige Engagementlandschaft
Transferpotentiale der Sozial- und Geisteswissenschaften in Forschung und Lehre
 Transferpotentiale der Sozial- und Geisteswissenschaften in Forschung und Lehre Dr. Volker Meyer-Guckel, 22. November 2013, Bonn 1. Was ist Transfer? 2. Gelebte Transferkultur in den Geistes- und Sozialwissenschaften
Transferpotentiale der Sozial- und Geisteswissenschaften in Forschung und Lehre Dr. Volker Meyer-Guckel, 22. November 2013, Bonn 1. Was ist Transfer? 2. Gelebte Transferkultur in den Geistes- und Sozialwissenschaften
Citizen Science und Daten
 Citizen Science und Daten Datenqualität, Datenmanagement und rechtliche Aspekte Dr. Katrin Vohland Museum für Naturkunde Berlin Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung Citizen Science
Citizen Science und Daten Datenqualität, Datenmanagement und rechtliche Aspekte Dr. Katrin Vohland Museum für Naturkunde Berlin Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung Citizen Science
Grußwort. Es gilt das gesprochene Wort!
 Grußwort Dr. Georg Schütte Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung anlässlich der Eröffnung der Wissenschaftsnacht Bonn 2012 am 15. Juni 2012 in Bonn Es gilt das gesprochene Wort!
Grußwort Dr. Georg Schütte Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung anlässlich der Eröffnung der Wissenschaftsnacht Bonn 2012 am 15. Juni 2012 in Bonn Es gilt das gesprochene Wort!
Nachhaltige Stadtentwicklung Zwischenergebnisse einer soziologischen Begleitforschung
 Nachhaltige Stadtentwicklung Zwischenergebnisse einer soziologischen Begleitforschung 2 Erwartungshorizont Transformative Forschung Ein Input zur theoretischen Rahmung Nachhaltige Stadtentwicklung in Münster
Nachhaltige Stadtentwicklung Zwischenergebnisse einer soziologischen Begleitforschung 2 Erwartungshorizont Transformative Forschung Ein Input zur theoretischen Rahmung Nachhaltige Stadtentwicklung in Münster
Internationale Zusammenarbeit. (6. Herausforderung) Nationale Kontaktstelle
 Internationale Zusammenarbeit (6. Herausforderung) Nationale Kontaktstelle Horizont 2020 (2014 2020), das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union, bietet vielfältige Kooperationschancen
Internationale Zusammenarbeit (6. Herausforderung) Nationale Kontaktstelle Horizont 2020 (2014 2020), das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union, bietet vielfältige Kooperationschancen
Fördermöglichkeiten für den Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft
 Fördermöglichkeiten für den Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft Vechta - 30. Juni 2016 University s 3rd Mission Public Engagement Partizipative Wissenschaft Community Based Research Citizen Science
Fördermöglichkeiten für den Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft Vechta - 30. Juni 2016 University s 3rd Mission Public Engagement Partizipative Wissenschaft Community Based Research Citizen Science
Impuls Das IÖW als ein Knoten im Netzwerk nachhaltigkeitsorientierter Wirtschaftswissenschaften: Potenziale und Herausforderungen
 Impuls Das IÖW als ein Knoten im Netzwerk nachhaltigkeitsorientierter Wirtschaftswissenschaften: Potenziale und Herausforderungen Workshop C2 Transformative Ökonomik stärker im Wissenschaftssystem verankern?
Impuls Das IÖW als ein Knoten im Netzwerk nachhaltigkeitsorientierter Wirtschaftswissenschaften: Potenziale und Herausforderungen Workshop C2 Transformative Ökonomik stärker im Wissenschaftssystem verankern?
Öffentliche Konsultation
 VERNETZUNGSPLATTFORM FORSCHUNG FÜR GLOBALE GESUNDHEIT Öffentliche Konsultation Seit 2015 hat die Globale Gesundheit auch in der internationalen Politik verstärkte Aufmerksamkeit erhalten. Im Rahmen der
VERNETZUNGSPLATTFORM FORSCHUNG FÜR GLOBALE GESUNDHEIT Öffentliche Konsultation Seit 2015 hat die Globale Gesundheit auch in der internationalen Politik verstärkte Aufmerksamkeit erhalten. Im Rahmen der
Wissen vernetzen - in Theorie und Praxis
 Wissen vernetzen - in Theorie und Praxis Die Gesellschaft Überregionales Netzwerk mit regionaler Verankerung im deutschen Sprachraum mit Beteiligten aus der Praxis sowie aus Lehre und Forschung mehr als
Wissen vernetzen - in Theorie und Praxis Die Gesellschaft Überregionales Netzwerk mit regionaler Verankerung im deutschen Sprachraum mit Beteiligten aus der Praxis sowie aus Lehre und Forschung mehr als
Makroplastik Mikroplastik Was heute in Rhein, Main und Elbe schwimmt, kann schon morgen in der Nord- oder Ostsee landen. Citizen-Science-Aktion
 CITIZEN-SCIENCE FÜR JUGENDLICHE AKTIONSZEITRAUM 01.05. 30.06.2017 In Meeren und Ozeanen findet sich jede Menge Plastikmüll. Makroplastik wie zerrissene Tüten, weggeworfene Plastikflaschen oder verknotete
CITIZEN-SCIENCE FÜR JUGENDLICHE AKTIONSZEITRAUM 01.05. 30.06.2017 In Meeren und Ozeanen findet sich jede Menge Plastikmüll. Makroplastik wie zerrissene Tüten, weggeworfene Plastikflaschen oder verknotete
Der Strukturierte Dialog mit den Jugendlichen in der EU Sachstand und Handlungsbedarf
 Der Strukturierte Dialog mit den Jugendlichen in der EU Sachstand und Handlungsbedarf - Konferenzpapier zum Runden Tisch vom 25.-26.02.08 in München - Jugendpolitischer Hintergrund und Ziele Im Rahmen
Der Strukturierte Dialog mit den Jugendlichen in der EU Sachstand und Handlungsbedarf - Konferenzpapier zum Runden Tisch vom 25.-26.02.08 in München - Jugendpolitischer Hintergrund und Ziele Im Rahmen
Aktive Europäische Bürgerschaft
 Checkpoint 2015 28.09.2015 Bonn Heike Zimmermann Leitaktion 1 Yvonne Buchalla Leitaktionen 2 und 3 t Kernelemente Aktiver Europäischer Bürgerschaft kognitive Dimension Wissen über das politische System
Checkpoint 2015 28.09.2015 Bonn Heike Zimmermann Leitaktion 1 Yvonne Buchalla Leitaktionen 2 und 3 t Kernelemente Aktiver Europäischer Bürgerschaft kognitive Dimension Wissen über das politische System
Alltagsweltliche Aneignung und gesellschaftliche Verbreitung von Praktiken des Reparierens und Selbermachens
 Alltagsweltliche Aneignung und gesellschaftliche Verbreitung von Praktiken des Reparierens und Selbermachens Repara/kul/turist eine Verbundforschungsprojekt, das im Rahmen der Förderrichtlinie CitizenScience/
Alltagsweltliche Aneignung und gesellschaftliche Verbreitung von Praktiken des Reparierens und Selbermachens Repara/kul/turist eine Verbundforschungsprojekt, das im Rahmen der Förderrichtlinie CitizenScience/
Memorandum. Gesellschaftliche Verantwortung an Hochschulen
 Memorandum Gesellschaftliche Verantwortung an Hochschulen Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Hochschulnetzwerks Bildung durch Verantwortung am 22.11.2013 Übersicht 1. Weshalb gesellschaftliche
Memorandum Gesellschaftliche Verantwortung an Hochschulen Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Hochschulnetzwerks Bildung durch Verantwortung am 22.11.2013 Übersicht 1. Weshalb gesellschaftliche
Von der Stakeholderbeteiligung zur Kultur der Teilhabe?
 Von der Stakeholderbeteiligung zur Kultur der Teilhabe? Partizipative Praktiken zwischen Anspruch und Wirklichkeit dr. stefanie baasch konzepte kommunikation evaluation für umwelt, klima und energievorhaben
Von der Stakeholderbeteiligung zur Kultur der Teilhabe? Partizipative Praktiken zwischen Anspruch und Wirklichkeit dr. stefanie baasch konzepte kommunikation evaluation für umwelt, klima und energievorhaben
Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten:
 Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten: Geplanter Kursaufbau mit Stichworten zum Inhalt Organisatorischer Rahmen 3 Blöcke á 1,5 SSt, 4 ECTS-AP + 2 Blöcke á 2,25 SSt, 6 ECTS-AP + 1 Block mit 0,5 SSt,
Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten: Geplanter Kursaufbau mit Stichworten zum Inhalt Organisatorischer Rahmen 3 Blöcke á 1,5 SSt, 4 ECTS-AP + 2 Blöcke á 2,25 SSt, 6 ECTS-AP + 1 Block mit 0,5 SSt,
STEAM Hub. Ein Innovationsforum Mittelstand
 STEAM Hub Ein Innovationsforum Mittelstand Vorwort Wenn Forschergeist und Unternehmertum aufeinandertreffen, dann ist der Nährboden dafür gelegt, dass Neues entsteht. Diesen Nährboden wollen wir mit den
STEAM Hub Ein Innovationsforum Mittelstand Vorwort Wenn Forschergeist und Unternehmertum aufeinandertreffen, dann ist der Nährboden dafür gelegt, dass Neues entsteht. Diesen Nährboden wollen wir mit den
Selbstdarstellung: Zivilgesellschaftliche Plattform. ForschungsWende
 Selbstdarstellung: Zivilgesellschaftliche Plattform Projekt 2012-2014 Vereinigung Deutscher Wissenschaftler e.v. Die Idee Gentechnik ist die Antwort wie aber war die Frage? Die jahrzehntelange Auseinandersetzung
Selbstdarstellung: Zivilgesellschaftliche Plattform Projekt 2012-2014 Vereinigung Deutscher Wissenschaftler e.v. Die Idee Gentechnik ist die Antwort wie aber war die Frage? Die jahrzehntelange Auseinandersetzung
Jetzt das Morgen gestalten
 Jetzt das Morgen gestalten Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 3. März 2007 Warum braucht Baden-Württemberg eine Nachhaltigkeitsstrategie? Baden-Württemberg steht vor großen Herausforderungen, die
Jetzt das Morgen gestalten Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 3. März 2007 Warum braucht Baden-Württemberg eine Nachhaltigkeitsstrategie? Baden-Württemberg steht vor großen Herausforderungen, die
Eine freie Gesellschft braucht offene Daten von Daniel Dietrich, Januar 2011
 Eine freie Gesellschft braucht offene Daten von Daniel Dietrich, Januar 2011 Ich werde in meinem Vortrag die Perspektive auf offene Daten als Chance für Demokratie und Wirtschaft richten und die Faktoren
Eine freie Gesellschft braucht offene Daten von Daniel Dietrich, Januar 2011 Ich werde in meinem Vortrag die Perspektive auf offene Daten als Chance für Demokratie und Wirtschaft richten und die Faktoren
Leitbild Forschungsdialog Rheinland
 Leitbild Forschungsdialog Rheinland Niederrhein Mittlerer Niederrhein Düsseldorf Wuppertal- Solingen- Remscheid Köln Bonn/Rhein-Sieg Aachen powered by Leitbild Gemeinsames Verständnis zur Zusammenarbeit
Leitbild Forschungsdialog Rheinland Niederrhein Mittlerer Niederrhein Düsseldorf Wuppertal- Solingen- Remscheid Köln Bonn/Rhein-Sieg Aachen powered by Leitbild Gemeinsames Verständnis zur Zusammenarbeit
HOCHSCHULEN DES 21. JAHRHUNDERTS. Ein nationales Forum zur digitalen Zukunft der deutschen Hochschullehre
 HOCHSCHULEN DES 21. JAHRHUNDERTS Ein nationales Forum zur digitalen Zukunft der deutschen Hochschullehre Auf sechs Themenfeldern beschäftigen sich Experten aus Politik, Hochschule und Unternehmen mit den
HOCHSCHULEN DES 21. JAHRHUNDERTS Ein nationales Forum zur digitalen Zukunft der deutschen Hochschullehre Auf sechs Themenfeldern beschäftigen sich Experten aus Politik, Hochschule und Unternehmen mit den
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: Beginn der Rede!
 Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Zukunft gestalten in Demokratien
 Zukunft gestalten in Demokratien Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb DBU-Tagung Umweltbildung, Osnabrück, 19. Januar 2016 Der Mensch als transformative Macht "Die Kapazitäten
Zukunft gestalten in Demokratien Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb DBU-Tagung Umweltbildung, Osnabrück, 19. Januar 2016 Der Mensch als transformative Macht "Die Kapazitäten
FORSCHUNGSKREIS DER ERNÄHRUNGSINDUSTRIE E.V. Wir fördern Gemeinschaftsforschung. für die Lebensmittelwirtschaft
 FORSCHUNGSKREIS DER ERNÄHRUNGSINDUSTRIE E.V. Wir fördern Gemeinschaftsforschung für die Lebensmittelwirtschaft Ziel eines jeden IGF-Projektes des FEI ist es, ganze Branchen voranzubringen: mit Ergebnissen,
FORSCHUNGSKREIS DER ERNÄHRUNGSINDUSTRIE E.V. Wir fördern Gemeinschaftsforschung für die Lebensmittelwirtschaft Ziel eines jeden IGF-Projektes des FEI ist es, ganze Branchen voranzubringen: mit Ergebnissen,
WIE INTERNATIONAL SOLL MINT SEIN?
 Globale Talente interkulturelle Kompetenzen WIE INTERNATIONAL SOLL MINT SEIN? Berlin 13. Oktober 2016 Eine Initiative von WIE INTERNATIONAL SOLL MINT SEIN? Globale Talente interkulturelle Kompetenzen 13.
Globale Talente interkulturelle Kompetenzen WIE INTERNATIONAL SOLL MINT SEIN? Berlin 13. Oktober 2016 Eine Initiative von WIE INTERNATIONAL SOLL MINT SEIN? Globale Talente interkulturelle Kompetenzen 13.
Die Lernenden in den Mittelpunkt stellen Tagung bringt Bildungscommunities und transformative Methoden zusammen
 Pressemitteilung 23.01.2019 Nr. 01/2019 Die Lernenden in den Mittelpunkt stellen Tagung bringt Bildungscommunities und transformative Methoden zusammen Wie sieht transformative Bildung für eine nachhaltige
Pressemitteilung 23.01.2019 Nr. 01/2019 Die Lernenden in den Mittelpunkt stellen Tagung bringt Bildungscommunities und transformative Methoden zusammen Wie sieht transformative Bildung für eine nachhaltige
WHERE GEOINFORMATION MEETS TECHNOLOGY BÜRGERCOCKPIT. Digitale Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene. BÜRGERBETEILIGUNG für Ihre Gemeinde
 WHERE GEOINFORMATION MEETS TECHNOLOGY BÜRGERCOCKPIT Digitale Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene BÜRGERBETEILIGUNG für Ihre Gemeinde Das Bürgercockpit als Chance für Ihre Gemeinde Das Bürgercockpit
WHERE GEOINFORMATION MEETS TECHNOLOGY BÜRGERCOCKPIT Digitale Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene BÜRGERBETEILIGUNG für Ihre Gemeinde Das Bürgercockpit als Chance für Ihre Gemeinde Das Bürgercockpit
Grußwort. Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
 Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 2. Jahrestreffen des am Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) angesiedelten Regionalen Innovationsnetzwerks
Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 2. Jahrestreffen des am Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) angesiedelten Regionalen Innovationsnetzwerks
Participation reloaded
 Participation reloaded Werkstatt: Participation Reloaded - Neuer Schub durch Online-Beteiligung? Forum für Bürger/innenbeteiligung und kommunale Demokratie, Evangelische Akademie Loccum 26.9.2009, Christoph
Participation reloaded Werkstatt: Participation Reloaded - Neuer Schub durch Online-Beteiligung? Forum für Bürger/innenbeteiligung und kommunale Demokratie, Evangelische Akademie Loccum 26.9.2009, Christoph
Voneinander lernen. Miteinander fördern Jahresveranstaltung des Deutschlandstipendiums am 19. Mai 2015 in Berlin
 Voneinander lernen. Miteinander fördern Jahresveranstaltung des Deutschlandstipendiums am 19. Mai 2015 in Berlin ENGAGEMENT ZEIGT WIRKUNG BEISPIELE STIPENDIATISCHER PROJEKTE Ergebnisse aus dem Themenforum
Voneinander lernen. Miteinander fördern Jahresveranstaltung des Deutschlandstipendiums am 19. Mai 2015 in Berlin ENGAGEMENT ZEIGT WIRKUNG BEISPIELE STIPENDIATISCHER PROJEKTE Ergebnisse aus dem Themenforum
Beteiligungskultur stärken! Was heisst das?
 Beteiligungskultur stärken! Was heisst das? Forum für Bürgerbeteiligung und kommunale Demokratie: Bürgerbeteiligung in der Kommune auf dem Weg zur Selbstverständlichkeit Samstag, 14. September 2013 Dr.
Beteiligungskultur stärken! Was heisst das? Forum für Bürgerbeteiligung und kommunale Demokratie: Bürgerbeteiligung in der Kommune auf dem Weg zur Selbstverständlichkeit Samstag, 14. September 2013 Dr.
transitions. Gelingende Übergänge in Ausbildung und Arbeit: Zwischenergebnisse
 transitions. Gelingende Übergänge in Ausbildung und Arbeit: 9. Fachforum Eigenständige Jugendpolitik 18. Februar 2014 Durchgeführt von Gefördert vom Ziele Impulse für die Weiterentwicklung der individuellen
transitions. Gelingende Übergänge in Ausbildung und Arbeit: 9. Fachforum Eigenständige Jugendpolitik 18. Februar 2014 Durchgeführt von Gefördert vom Ziele Impulse für die Weiterentwicklung der individuellen
Förderinitiative Forschungscampus
 Förderinitiative Forschungscampus Vorwort Die Innovationskraft Deutschlands stärken, indem Wissen und Ressourcen gebündelt werden das ist ein Ziel der Hightech-Strategie. Mit der Förderinitiative Forschungscampus
Förderinitiative Forschungscampus Vorwort Die Innovationskraft Deutschlands stärken, indem Wissen und Ressourcen gebündelt werden das ist ein Ziel der Hightech-Strategie. Mit der Förderinitiative Forschungscampus
Technik Plus Wissenschaft für die vernetzte Gesellschaft. Universität Passau April 2012
 Technik Plus Wissenschaft für die vernetzte Gesellschaft Universität Passau April 2012 Technik Plus Technik Plus steht für die Verbindung von mathematischtechnischen Wissenschaften mit den Rechts-, Wirtschafts-,
Technik Plus Wissenschaft für die vernetzte Gesellschaft Universität Passau April 2012 Technik Plus Technik Plus steht für die Verbindung von mathematischtechnischen Wissenschaften mit den Rechts-, Wirtschafts-,
3. Herbstakademie Wirtschafts- und Unternehmensethik
 3. Herbstakademie Wirtschafts- und Unternehmensethik 21. 25. Oktober 2018 Wittenberg Die Akademie Im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung wird Ethik unverzichtbar: Bei raschen Umbrüchen und
3. Herbstakademie Wirtschafts- und Unternehmensethik 21. 25. Oktober 2018 Wittenberg Die Akademie Im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung wird Ethik unverzichtbar: Bei raschen Umbrüchen und
Neues Wissen? Welchen Beitrag leistet die Wissenschaft?
 Neues Wissen? Welchen Beitrag leistet die Wissenschaft? Dr. Carsten Neßhöver Department Naturschutzforschung Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung -UFZ Haupt-Projektpartner: Ein Projekt im Rahmen von:
Neues Wissen? Welchen Beitrag leistet die Wissenschaft? Dr. Carsten Neßhöver Department Naturschutzforschung Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung -UFZ Haupt-Projektpartner: Ein Projekt im Rahmen von:
Ergebnisprotokoll: Netzwerktreffen Bildung für nachhaltige Entwicklung
 Ergebnisprotokoll: Netzwerktreffen Bildung für nachhaltige Entwicklung 12.06.2018 im Grünen Zentrum des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen Programm: 1 Begrüßung und Einführung
Ergebnisprotokoll: Netzwerktreffen Bildung für nachhaltige Entwicklung 12.06.2018 im Grünen Zentrum des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen Programm: 1 Begrüßung und Einführung
"Senioren mobil im Alter 2011"
 "Senioren mobil im Alter 2011" Bericht zur Tagung am 19.10.2011 im KREATIVHAUS MITTE Antragsteller: VCD Nordost Projektzeitraum: 01.04.2011 bis 31.12.2011 Ansprechpartner für Rückfragen: Thorsten Haas
"Senioren mobil im Alter 2011" Bericht zur Tagung am 19.10.2011 im KREATIVHAUS MITTE Antragsteller: VCD Nordost Projektzeitraum: 01.04.2011 bis 31.12.2011 Ansprechpartner für Rückfragen: Thorsten Haas
Das EnRRICH-Projekt: Lernen in verantwortungsvoller Forschung an der Universität Vechta
 Das EnRRICH-Projekt: Lernen in verantwortungsvoller Forschung an der Universität Vechta "Hochschule in Verantwortung 30. Juni 2016, Universität Vechta Prof. Dr. Marco Rieckmann Juniorprofessor für Hochschuldidaktik,
Das EnRRICH-Projekt: Lernen in verantwortungsvoller Forschung an der Universität Vechta "Hochschule in Verantwortung 30. Juni 2016, Universität Vechta Prof. Dr. Marco Rieckmann Juniorprofessor für Hochschuldidaktik,
Innovation Interaktiv! Ein Innovationsforum Mittelstand
 Innovation Interaktiv! Ein Innovationsforum Mittelstand Vorwort Wenn Forschergeist und Unternehmertum aufeinandertreffen, dann ist der Nährboden dafür gelegt, dass Neues entsteht. Diesen Nährboden wollen
Innovation Interaktiv! Ein Innovationsforum Mittelstand Vorwort Wenn Forschergeist und Unternehmertum aufeinandertreffen, dann ist der Nährboden dafür gelegt, dass Neues entsteht. Diesen Nährboden wollen
im Rahmen des Projektes Lernen über den Tag hinaus Bildung für eine zukunftsfähige Welt
 im Rahmen des Projektes Lernen über den Tag hinaus Bildung für eine zukunftsfähige Welt 11.09.2012 Übersicht Unser Verständnis von BNE Definition und Zielgruppe Das BNE Hochschulnetzwerk: Netzwerktyp,
im Rahmen des Projektes Lernen über den Tag hinaus Bildung für eine zukunftsfähige Welt 11.09.2012 Übersicht Unser Verständnis von BNE Definition und Zielgruppe Das BNE Hochschulnetzwerk: Netzwerktyp,
Erfolgreich im globalen Dorf!
 ID I N T E G R A L D E V E L O P M E N T World Café Dialog: Erfolgreich im globalen Dorf! 10.10.2008, 10.15 15.45 Uhr, Leonardo-Büro Part Sachsen, Technische Universität Dresden Moderation: Ulrich Soeder,
ID I N T E G R A L D E V E L O P M E N T World Café Dialog: Erfolgreich im globalen Dorf! 10.10.2008, 10.15 15.45 Uhr, Leonardo-Büro Part Sachsen, Technische Universität Dresden Moderation: Ulrich Soeder,
Die Fraunhofer-Gesellschaft auf dem Weg zu einem Nachhaltigkeitsmanagement. Fraunhofer
 Die Fraunhofer-Gesellschaft auf dem Weg zu einem Nachhaltigkeitsmanagement Wie weit sind unsere Stakeholder? Wirtschaft Während der Durchführung des Liefervertrags hat der Auftragnehmer die notwendigen
Die Fraunhofer-Gesellschaft auf dem Weg zu einem Nachhaltigkeitsmanagement Wie weit sind unsere Stakeholder? Wirtschaft Während der Durchführung des Liefervertrags hat der Auftragnehmer die notwendigen
Strategie science cité
 Strategie science cité 2017-20 Wer sind wir? Das nationale Netzwerk für den Dialog Wissenschaft Gesellschaft Handlungsbedarf aufgrund Situationsanalyse Ansatzpunkt für Dialog bei Zivilgesellschaft Verbindung
Strategie science cité 2017-20 Wer sind wir? Das nationale Netzwerk für den Dialog Wissenschaft Gesellschaft Handlungsbedarf aufgrund Situationsanalyse Ansatzpunkt für Dialog bei Zivilgesellschaft Verbindung
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt Juli 2011
 Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt 1 Juli 2011 Leitlinien für die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements des Bezirksamtes Treptow-Köpenick von Berlin
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt 1 Juli 2011 Leitlinien für die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements des Bezirksamtes Treptow-Köpenick von Berlin
Foto Copyright: Peter Prengel, Stadt Essen 12. FORUM W I S S E N S C H A F T S KO M M U N I K AT I O N
 10. 12. Dezember 2019 Essen Foto Copyright: Peter Prengel, Stadt Essen 12. FORUM W I S S E N S C H A F T S KO M M U N I K AT I O N Inhalt Wissenschaft im Dialog 1 Das 12. Forum Wissenschaftskommunikation
10. 12. Dezember 2019 Essen Foto Copyright: Peter Prengel, Stadt Essen 12. FORUM W I S S E N S C H A F T S KO M M U N I K AT I O N Inhalt Wissenschaft im Dialog 1 Das 12. Forum Wissenschaftskommunikation
Innovation in der Lehre. Eine Einführung.
 Bern, 29. Juni 2016 Innovation in der Lehre. Eine Einführung. Tobias Hensel, Delegation Lehre 01 Innovation warum? Digitalisierung, Vielfalt, Flexibilität 02 Innovation wo? Curriculum, Didaktik, Organisation
Bern, 29. Juni 2016 Innovation in der Lehre. Eine Einführung. Tobias Hensel, Delegation Lehre 01 Innovation warum? Digitalisierung, Vielfalt, Flexibilität 02 Innovation wo? Curriculum, Didaktik, Organisation
WAS IST OPEN SCIENCE?
 WAS IST OPEN SCIENCE? Begleitheft zur Ausstellung Open Up! Wie die Digitalisierung die Wissenschaft verändert DR. GUIDO SCHERP Intro: Was ist Open Science? Bei Open Science geht es im Kern darum, die Glaubwürdigkeit
WAS IST OPEN SCIENCE? Begleitheft zur Ausstellung Open Up! Wie die Digitalisierung die Wissenschaft verändert DR. GUIDO SCHERP Intro: Was ist Open Science? Bei Open Science geht es im Kern darum, die Glaubwürdigkeit
Willkommen zum DKK-Klima-Frühstück. DKK zu den Perspektiven für die Klimaforschung 2015 bis 2025
 Willkommen zum DKK-Klima-Frühstück DKK zu den Perspektiven für die Klimaforschung 2015 bis 2025 Prof. Dr. Mojib Latif, GEOMAR Prof. Dr. Gernot Klepper, IfW Dr. Silke Beck, UFZ Marie-Luise Beck, DKK Auf
Willkommen zum DKK-Klima-Frühstück DKK zu den Perspektiven für die Klimaforschung 2015 bis 2025 Prof. Dr. Mojib Latif, GEOMAR Prof. Dr. Gernot Klepper, IfW Dr. Silke Beck, UFZ Marie-Luise Beck, DKK Auf
Internationale Städte-Plattform für Nachhaltige Entwicklung
 Internationale Städte-Plattform für Nachhaltige Entwicklung Im Auftrag des Durchgeführt von Deutscher Städtetag Sabine Drees Gereonstraße 18 32, 50670 Köln +49 (0) 221 3771 214 sabine.drees@staedtetag.de
Internationale Städte-Plattform für Nachhaltige Entwicklung Im Auftrag des Durchgeführt von Deutscher Städtetag Sabine Drees Gereonstraße 18 32, 50670 Köln +49 (0) 221 3771 214 sabine.drees@staedtetag.de
Kurt B. Neubert BBE Europa-Newsletter 5/2014. Forschung und Verantwortung
 Kurt B. Neubert BBE Europa-Newsletter 5/2014 Forschung und Verantwortung Was können Transparenz und Partizipation für ein innovatives Wissenschaftssystem leisten? Nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche
Kurt B. Neubert BBE Europa-Newsletter 5/2014 Forschung und Verantwortung Was können Transparenz und Partizipation für ein innovatives Wissenschaftssystem leisten? Nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche
Samira Bouslama FORUM Umweltbildung
 Samira Bouslama FORUM Umweltbildung Bildung für nachhaltige Entwicklung Ziel und Zweck ist eine gesellschaftliche Transformation. Lerninhalt: Aufnahme von zentralen Themen wie Klimawandel, Biodiversität,
Samira Bouslama FORUM Umweltbildung Bildung für nachhaltige Entwicklung Ziel und Zweck ist eine gesellschaftliche Transformation. Lerninhalt: Aufnahme von zentralen Themen wie Klimawandel, Biodiversität,
Die Allianz-Initiative der Wissenschaftsorganisationen und Ihre Aktivitäten im Bereich Open Access
 Die Allianz-Initiative der Wissenschaftsorganisationen und Ihre Aktivitäten im Bereich Open Access Olaf Siegert Leiter Publikationsdienste ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Open-Access-Tag,
Die Allianz-Initiative der Wissenschaftsorganisationen und Ihre Aktivitäten im Bereich Open Access Olaf Siegert Leiter Publikationsdienste ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Open-Access-Tag,
Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften
 Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften Jahrestagung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung Geschäftsmodell Nachhaltigkeit Ulrich Petschow 21. November 2013, Berlin
Kollaborative Ökonomie Potenziale für nachhaltiges Wirtschaften Jahrestagung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung Geschäftsmodell Nachhaltigkeit Ulrich Petschow 21. November 2013, Berlin
Forschung wird zum Stadtgespräch. Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen.
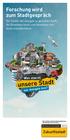 Forschung wird zum Stadtgespräch Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen. WISSENSCHAFTSJAHR 2015 ZUKUNFTSSTADT Liebe Leserinnen und Leser, die nachhaltige
Forschung wird zum Stadtgespräch Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen. WISSENSCHAFTSJAHR 2015 ZUKUNFTSSTADT Liebe Leserinnen und Leser, die nachhaltige
Grußwort der Sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Sabine von Schorlemer anlässlich der
 Grußwort der Sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Sabine von Schorlemer anlässlich der Eröffnung der DFG-Ausstellung Von der Idee zur Erkenntnis am 22.05.2012 - Es gilt das
Grußwort der Sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Sabine von Schorlemer anlässlich der Eröffnung der DFG-Ausstellung Von der Idee zur Erkenntnis am 22.05.2012 - Es gilt das
Nachhaltigkeitscommunity zu leisten, was ich ohnehin als einen Teil meines Jobs betrachte. Umgekehrt mache ich das übrigens auch ständig.
 Svetlana Thaller-Honold, 16.09.2018 Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Mitglieder des HOCH-N-Netzwerks Liebe Aktive und Interessierte im Bereich Nachhaltigkeit an Hochschulen, im Namen des Bundesministeriums
Svetlana Thaller-Honold, 16.09.2018 Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Mitglieder des HOCH-N-Netzwerks Liebe Aktive und Interessierte im Bereich Nachhaltigkeit an Hochschulen, im Namen des Bundesministeriums
Informelle Ministerkonferenz zum Thema "Europa vermitteln"
 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss Informelle Ministerkonferenz zum Thema "Europa vermitteln" Rede von Roger BRIESCH Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 7./8. April
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss Informelle Ministerkonferenz zum Thema "Europa vermitteln" Rede von Roger BRIESCH Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 7./8. April
Jahresveranstaltung Fördern Gewinnen Begeistern: das Deutschlandstipendium am 8. Juli 2014 in Berlin
 Jahresveranstaltung Fördern Gewinnen Begeistern: das Deutschlandstipendium am 8. Juli 2014 in Berlin Ergebnisse aus dem Workshop Die richtige Wahl: Auswahl und Förderung in der Praxis Im Zentrum des Workshops
Jahresveranstaltung Fördern Gewinnen Begeistern: das Deutschlandstipendium am 8. Juli 2014 in Berlin Ergebnisse aus dem Workshop Die richtige Wahl: Auswahl und Förderung in der Praxis Im Zentrum des Workshops
Das Konzept der Kopernikus-Projekte
 Das Konzept der Kopernikus-Projekte Prof. Dr. Eberhard Umbach Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina acatech Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Das Konzept der Kopernikus-Projekte Prof. Dr. Eberhard Umbach Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina acatech Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Workshop-Phase ( )
 (10.45 12.30) 4 thematische Workshops sollen die Teilnehmer/innen einladen und aktivieren, zu einem Teilaspekt des Konferenzthemas mehr zu erfahren, ihre eigenen Erfahrungen aktiv einzubringen und durch
(10.45 12.30) 4 thematische Workshops sollen die Teilnehmer/innen einladen und aktivieren, zu einem Teilaspekt des Konferenzthemas mehr zu erfahren, ihre eigenen Erfahrungen aktiv einzubringen und durch
Christian Geiger St. Gallen Ulm digitale Agenda für Ulm
 Christian Geiger St. Gallen 23.08.2017 Ulm 2030 - digitale Agenda für Ulm TRENDS Technologie - Smight Smight: http://www.stereopoly.de/wp-content/uploads/2015/08/enbw-smight-produkte.jpg Christian Geiger
Christian Geiger St. Gallen 23.08.2017 Ulm 2030 - digitale Agenda für Ulm TRENDS Technologie - Smight Smight: http://www.stereopoly.de/wp-content/uploads/2015/08/enbw-smight-produkte.jpg Christian Geiger
Deutscher Bürgerpreis
 Hintergrund Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements Jeder dritte Deutsche über 14 Jahre engagiert sich in seiner Freizeit für andere in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien, Selbsthilfegruppen
Hintergrund Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements Jeder dritte Deutsche über 14 Jahre engagiert sich in seiner Freizeit für andere in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien, Selbsthilfegruppen
LEADER TRANSNATIONAL KULTUR
 LEADER TRANSNATIONAL KULTUR Transformation des ländlichen Raums durch internationale Kulturzusammenarbeit Transformation durch Kultur? Transformation findet statt, sie ist aber auch gestaltbar. Digitale
LEADER TRANSNATIONAL KULTUR Transformation des ländlichen Raums durch internationale Kulturzusammenarbeit Transformation durch Kultur? Transformation findet statt, sie ist aber auch gestaltbar. Digitale
Synfonie. Ein Innovationsforum Mittelstand
 Synfonie Ein Innovationsforum Mittelstand Vorwort Wenn Forschergeist und Unternehmertum aufeinandertreffen, dann ist der Nährboden dafür gelegt, dass Neues entsteht. Diesen Nährboden wollen wir mit den
Synfonie Ein Innovationsforum Mittelstand Vorwort Wenn Forschergeist und Unternehmertum aufeinandertreffen, dann ist der Nährboden dafür gelegt, dass Neues entsteht. Diesen Nährboden wollen wir mit den
ESPRESSO - Dipl.-Ing. Martin Fabisch
 ESPRESSO - A systemic Standardisation approach to Empower Smart cities and communties Dipl.-Ing. Martin Fabisch TU Kaiserslautern Morgenstadt Werkstatt 2016, Stuttgart This project has received funding
ESPRESSO - A systemic Standardisation approach to Empower Smart cities and communties Dipl.-Ing. Martin Fabisch TU Kaiserslautern Morgenstadt Werkstatt 2016, Stuttgart This project has received funding
Gemeinsam. gestalten, individuell. entfalten. Arbeiten an der Fachhochschule St. Pölten. St. Pölten University of Applied Sciences
 St. Pölten University of Applied Sciences Gemeinsam gestalten, individuell entfalten fhstp.ac.at/karriere Katarina Balgavy Arbeiten an der Fachhochschule St. Pölten Unsere Benefits Die FH St. Pölten bietet
St. Pölten University of Applied Sciences Gemeinsam gestalten, individuell entfalten fhstp.ac.at/karriere Katarina Balgavy Arbeiten an der Fachhochschule St. Pölten Unsere Benefits Die FH St. Pölten bietet
.wird konkret
 01/12/15 Digitale Agenda Wien.wird konkret 25.11.2015 1 Digitale Agenda Wien Startschuss im September 2014 Online-Partizipationsprojekt Ergebnis: To-Do-Liste für die Stadt Wien im IKT-Bereich 2 1 01/12/15
01/12/15 Digitale Agenda Wien.wird konkret 25.11.2015 1 Digitale Agenda Wien Startschuss im September 2014 Online-Partizipationsprojekt Ergebnis: To-Do-Liste für die Stadt Wien im IKT-Bereich 2 1 01/12/15
Referenzrahmen Schulqualität. Leitfaden für den Einsatz der Reflexionsbögen
 für den Einsatz der als Instrument für die Selbstvergewisserung und für die interne Bestandsaufnahme Die Frage nach der Wirksamkeit des täglichen professionellen Handelns ist grundlegend für eine Schule,
für den Einsatz der als Instrument für die Selbstvergewisserung und für die interne Bestandsaufnahme Die Frage nach der Wirksamkeit des täglichen professionellen Handelns ist grundlegend für eine Schule,
Fachtagung Migrantenvereine als Akteure der Zivilgesellschaft 27. April 2013, München. Grußwort
 Fachtagung Migrantenvereine als Akteure der Zivilgesellschaft 27. April 2013, München Grußwort Dr. Andreas Kufer, Leiter des Referats Integrationspolitik im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
Fachtagung Migrantenvereine als Akteure der Zivilgesellschaft 27. April 2013, München Grußwort Dr. Andreas Kufer, Leiter des Referats Integrationspolitik im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
Großgruppen-Moderation
 Großgruppen-Moderation Manche Frage erfordert eine besondere Antwort. Und manche Fragestellungen benötigen besondere Antwortszenarien. Ein solches spezielles Antwortszenario kann eine Großgruppen-Moderation
Großgruppen-Moderation Manche Frage erfordert eine besondere Antwort. Und manche Fragestellungen benötigen besondere Antwortszenarien. Ein solches spezielles Antwortszenario kann eine Großgruppen-Moderation
Dörte von Kittlitz, Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, Hannover
 Gruppengemeinschaft und Geselligkeit: Welche Rahmenbedingungen bieten Selbsthilfekontaktstellen, welche Unterstützungsbedarfe und -möglichkeiten gibt es? Dörte von Kittlitz, Selbsthilfe-Büro Niedersachsen,
Gruppengemeinschaft und Geselligkeit: Welche Rahmenbedingungen bieten Selbsthilfekontaktstellen, welche Unterstützungsbedarfe und -möglichkeiten gibt es? Dörte von Kittlitz, Selbsthilfe-Büro Niedersachsen,
Open Forum 10. November 2014, Uhr Museumsquartier, Ovalhalle
 Open Forum 10. November 2014, 12-17 Uhr Museumsquartier, Ovalhalle Moderation Ingrid Preissegger Trigon Entwicklungsberatung 2 Agenda 12:00 warm-up 13:00 Begrüßungsworte Vorstellung des Prozesses IW2020
Open Forum 10. November 2014, 12-17 Uhr Museumsquartier, Ovalhalle Moderation Ingrid Preissegger Trigon Entwicklungsberatung 2 Agenda 12:00 warm-up 13:00 Begrüßungsworte Vorstellung des Prozesses IW2020
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wissenstransfer beim DLR.
 Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Wissenstransfer beim DLR www.dlr.de DLR.de Folie 2 Das DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Bild: Nonwarit/Fotolia Forschungseinrichtung Raumfahrt-Agentur
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Wissenstransfer beim DLR www.dlr.de DLR.de Folie 2 Das DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Bild: Nonwarit/Fotolia Forschungseinrichtung Raumfahrt-Agentur
LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF
 LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF 2013 2017 Präambel: Zur Zielgruppe der Jugendarbeit Regensdorf gehören Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren. Die Jugendarbeit ist ein freiwilliges
LEITBILD DER JUGENDARBEIT REGENSDORF 2013 2017 Präambel: Zur Zielgruppe der Jugendarbeit Regensdorf gehören Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren. Die Jugendarbeit ist ein freiwilliges
